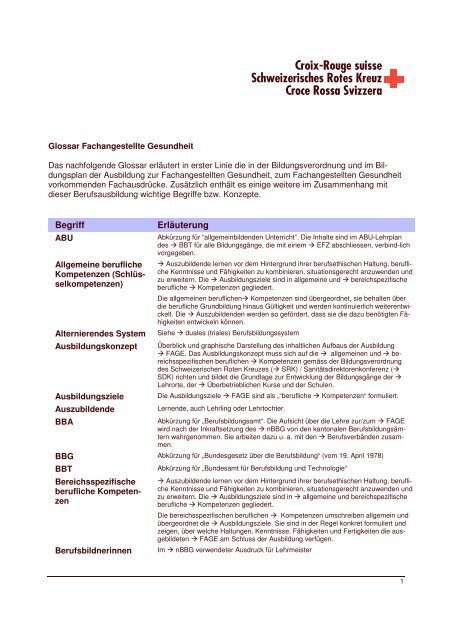Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung
Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung
Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Glossar</strong> Fachangestellte Gesundheit<br />
Das nachfolgende <strong>Glossar</strong> erläutert in erster Linie die in der <strong>Bildung</strong>sverordnung und im <strong>Bildung</strong>splan<br />
der Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit, zum Fachangestellten Gesundheit<br />
vorkommenden Fachausdrücke. Zusätzlich enthält es einige weitere im Zusammenhang mit<br />
dieser <strong>Beruf</strong>sausbildung wichtige Begriffe bzw. Konzepte.<br />
Begriff Erläuterung<br />
ABU<br />
Allgemeine berufliche<br />
Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen)<br />
Abkürzung für “allgemeinbildenden Unterricht”. Die Inhalte sind im ABU-Lehrplan<br />
des BBT für alle <strong>Bildung</strong>sgänge, die mit einem EFZ abschliessen, verbind-lich<br />
vorgegeben.<br />
Auszubildende lernen vor dem Hintergrund ihrer berufsethischen Haltung, berufliche<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten zu kombinieren, situationsgerecht anzuwenden und<br />
zu erweitern. Die Ausbildungsziele sind in allgemeine und bereichspezifische<br />
berufliche Kompetenzen gegliedert.<br />
Die allgemeinen beruflichen Kompetenzen sind übergeordnet, sie behalten über<br />
die berufliche Grundbildung hinaus Gültigkeit und werden kontinuierlich weiterentwickelt.<br />
Die Auszubildenden werden so gefördert, dass sie die dazu benötigten Fähigkeiten<br />
entwickeln können.<br />
Alternierendes System Siehe duales (triales) <strong>Beruf</strong>sbildungssystem<br />
Ausbildungskonzept<br />
Überblick und graphische Darstellung des inhaltlichen Aufbaus der Ausbildung<br />
FAGE. Das Ausbildungskonzept muss sich auf die allgemeinen und bereichsspezifischen<br />
beruflichen Kompetenzen gemäss der <strong>Bildung</strong>sverordnung<br />
des Schweizerischen Roten Kreuzes ( SRK) / Sanitätsdirektorenkonferenz (<br />
SDK) richten und bildet die Grundlage zur Entwicklung der <strong>Bildung</strong>sgänge der<br />
Lehrorte, der Überbetrieblichen Kurse und der Schulen.<br />
Ausbildungsziele Die Ausbildungsziele FAGE sind als „“berufliche Kompetenzen“ formuliert.<br />
Auszubildende<br />
Lernende, auch Lehrling oder Lehrtochter.<br />
BBA Abkürzung für „<strong>Beruf</strong>sbildungsamt“. Die Aufsicht über die Lehre zur/zum FAGE<br />
wird nach der Inkraftsetzung des nBBG von den kantonalen <strong>Beruf</strong>sbildungsämtern<br />
wahrgenommen. Sie arbeiten dazu u. a. mit den <strong>Beruf</strong>sverbänden zusammen.<br />
BBG<br />
BBT<br />
Bereichsspezifische<br />
berufliche Kompetenzen<br />
Abkürzung für „Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung“ (vom 19. April 1978)<br />
Abkürzung für „Bundesamt für <strong>Beruf</strong>sbildung und Technologie“<br />
Auszubildende lernen vor dem Hintergrund ihrer berufsethischen Haltung, berufliche<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten zu kombinieren, situationsgerecht anzuwenden und<br />
zu erweitern. Die Ausbildungsziele sind in allgemeine und bereichspezifische<br />
berufliche Kompetenzen gegliedert.<br />
Die bereichsspezifischen beruflichen Kompetenzen umschreiben allgemein und<br />
übergeordnet die Ausbildungsziele. Sie sind in der Regel konkret formuliert und<br />
zeigen, über welche Haltungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die ausgebildeten<br />
FAGE am Schluss der Ausbildung verfügen.<br />
<strong>Beruf</strong>sbildnerinnen Im nBBG verwendeter Ausdruck für Lehrmeister<br />
1
Begriff Erläuterung<br />
<strong>Beruf</strong>sfachschule Schultyp, der auf der Sekundarstufe II angesiedelt ist. Sie vermittelt die notwendigen<br />
theoretischen <strong>Beruf</strong>skenntnisse, die Allgemeinbildung sowie Turnen und Sport.<br />
Sie fördert den Erwerb berufsübergreifender Kompetenzen und unterstützt die<br />
Persönlichkeitsentwicklung ( Allgemeine berufliche Kompetenzen).<br />
<strong>Beruf</strong>smaturität<br />
<strong>Beruf</strong>sverbände<br />
Sie schliesst für die Ausbildung nach dem Schulortsprinzip mit der Auszubildenden<br />
einen Ausbildungsvertrag ab und organisiert die praktische Ausbildung an<br />
Praktikumsorten.<br />
Abschluss, der zum prüfungsfreien Eintritt in eine FHS (z. B. Richtung Gesundheit<br />
und Soziales) berechtigt ( BMS)<br />
Die <strong>Beruf</strong>sverbände vertreten die Interessen der Arbeitswelt. Sie sind als „Organisationen<br />
der Arbeitswelt“ wichtige Partner in der <strong>Beruf</strong>sbildung, die im nBBG als<br />
Verbundsaufgabe zwischen Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt<br />
bezeichnet wird.<br />
<strong>Bildung</strong>spartner Die an der Ausbildung beteiligten Partner: <strong>Beruf</strong>sfachschule, Lehrorte,<br />
Überbetriebliche Kurse. Für die drei Lernorte gilt eine Zusammenarbeitspflicht.<br />
<strong>Bildung</strong>sverantwortliche<br />
Fachperson in der Praxis mit der Hauptverantwortung für die organisatorische und<br />
pädagogische Durchführung der Ausbildung<br />
BMS Abkürzung für <strong>Beruf</strong>smittelschule. Die erweiterte Allgemeinbildung führt zur<br />
<strong>Beruf</strong>smaturität, die zum Studium an einer Fachhochschule ( FHS) berechtigt. Die<br />
Ausbildung kann ausbildungsbegleitend oder nach der Grundbildung berufsbegleitend<br />
oder im Rahmen eines Vollzeitschuljahres absolviert werden. Sie umfasst in der<br />
Regel 1‘440 Lektionen.<br />
Bundesamt Das für <strong>Bildung</strong>sgänge gemäss Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung ( BBG) zuständige<br />
Bundesamt für <strong>Beruf</strong>sbildung und Technologie ( BBT).<br />
CRFP<br />
DBK<br />
DMS<br />
duales (triales) <strong>Beruf</strong>sbildungssystem<br />
EDK<br />
EFZ<br />
Erweiterte Allgemeinbildung<br />
Abkürzung für „Conférence romande de la formation professionnelle“. Das westschweizer<br />
Pendant zur DBK.<br />
Abkürzung für „Deutschschweizerische <strong>Beruf</strong>sbildungsämter-Konferenz“. Das<br />
deutschschweizer Pendant zur CRFP.<br />
Diplommittelschule. Die 3-jährige Diplommittelschule (DMS-3) ist eine allgemeinbildende<br />
Vollzeitschule, die auf weiterführende <strong>Bildung</strong>sgänge vorbereitet, die besondere<br />
Anforderungen an die Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz stellen. Die Ausbildung<br />
führt zu einem gesamtschweizerisch durch die Erziehungsdirektorenkonferenz<br />
(EDK) anerkannten Diplom. Dieses ermöglicht den Eintritt in eine Diplomausbildung<br />
an einer HFS oder an einer FHS.<br />
<strong>Beruf</strong>sbildungssystem, das von der Schule, der Praxis (und den dritten Lern-orten<br />
Überbetriebliche Kurse) gemeinsam getragen wird. Die Lernenden wechseln in<br />
sinnvollen Abständen den Lernort, es findet ein Wechselspiel zwischen dem Lernen<br />
von theoretischem Wissen und seiner anwendungsorientierten Umsetzung und<br />
Vertiefung statt. Das alternierende System erfordert eine enge Zusammenarbeit der<br />
<strong>Bildung</strong>spartner zur Sicherstellung der inneren Kohärenz der Ausbildung.<br />
Abkürzung für „Erziehungsdirektoren-Konferenz“.<br />
Abkürzung für das „Eidgenössische Fähigkeitszeugnis“.<br />
Der Unterricht an der <strong>Beruf</strong>smittelschule ( BMS) wird im übergeordneten Sinn als<br />
erweiterte Allgemeinbildung bezeichnet. Sie führt zur zusammen mit dem EFZ zur<br />
<strong>Beruf</strong>smaturität.<br />
Fachnote Die für ein bestimmtes Prüfungsfach im Rahmen des Qualifikationsverfahrens erteilte<br />
Note. In der Regel werden Prüfungsfächer in einzelne Positionen gegliedert.<br />
Fachnoten aus Positionsnoten werden auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.<br />
FAGE<br />
Abkürzung für „Fachangestellte(r) Gesundheit“<br />
FHS Abkürzung für „Fachhochschule“. Die Fachhochschule ist ein auf der Tertiärstufe<br />
angesiedelter Schultyp, an dem die in die FH -Ausbildung integrierten Diplomausbildungen<br />
erlernt werden können. FH - Abschlüsse gelten als akademische Abschlüsse,<br />
als anwendungsorientiertes Pendant zur Universität.<br />
2
Begriff Erläuterung<br />
GSH<br />
Abkürzung für „Gesundheit - Soziales – Hauswirtschaft“. Ein Trend in der <strong>Beruf</strong>sbildung<br />
ist die Schaffung so genannter „<strong>Beruf</strong>sfelder“. Die FAGE gehört ins <strong>Beruf</strong>sfeld<br />
GSH.<br />
HFS Abkürzung für „höhere Fachschule“. Die höhere Fachschule ist ein auf der Tertiärstufe<br />
angesiedelter Schultyp, an dem die Diplomausbildungen (z. B. Pflege, Physiotherapie,<br />
Ernährungsberatung, Ergotherapie, MTRA, TOA usw.) absolviert werden<br />
können.<br />
Kohärenz<br />
Kohärenz bedeutet „innere Stimmigkeit“, d. h. dass die einzelnen Ausbildungselemente<br />
sich gegenseitig unterstützen. Dies ist dann der Fall, wenn die Auszubildenden<br />
die Ausbildung im Betrieb und in der <strong>Beruf</strong>sfachschule als stimmig bzw.<br />
als sich nicht widersprechend erleben.<br />
Kompetenzbereich Bereich, der definiert ist durch die zu erlernenden Kompetenzen. Beim <strong>Beruf</strong> der<br />
FAGE sind dies die allgemeinen beruflichen Kompetenzen und die bereichsspezifischen<br />
beruflichen Kompetenzen.<br />
Kompetenzen<br />
Lehrkräfte / Lehrpersonen<br />
Lehrort<br />
Lernbegleiterin<br />
Lernende Siehe Auszubildende<br />
Darunter wird die „situationsgerechte und sachlich wie fachlich korrekt kombinierte<br />
Anwendung von Haltungen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ verstanden.<br />
<strong>Beruf</strong>spersonen mit einer anerkannten pädagogisch bzw. methodisch-didaktischen<br />
Ausbildung, die an einer <strong>Beruf</strong>sfachschule einem Lehrauftrag nachkommen<br />
Lehrbetrieb, der über eine kantonale Ausbildungsbewilligung verfügt. Im Lehrort erwerben<br />
die Auszubildenden die Kompetenzen der beruflichen Praxis.<br />
Er schliesst in der Ausbildung nach dem Lehrortsprinzip mit der Auszubildenden<br />
einen Ausbildungsvertrag ab.<br />
Sie stellt die direkte Lernbegleitung im Betrieb sicher, begleitet das Lernen am Ort.<br />
Lernort Dieser beinhaltet die <strong>Beruf</strong>sfachschule, den Lehrort und die überbetrieblichen<br />
Kurse. Für die drei Lernorte gilt eine Zusammenarbeitspflicht.<br />
nBBG<br />
OdA<br />
Positionsnote<br />
Abkürzung für neues Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung (Entwurf, der voraussichtlich<br />
im Jahre 2004, allenfalls 2005 in Kraft treten wird)<br />
Abkürzung für „Organisation der Arbeitswelt“. Die OdA sind in der <strong>Beruf</strong>sbildung ein<br />
Partner der „gemeinsamen Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA“ (gem. Entwurf<br />
nBBG). Sie repräsentieren die Arbeitswelt und umfassen die Sozialpartner, die <strong>Beruf</strong>sverbände,<br />
andere zuständige Organisationen und andere Anbieter der <strong>Beruf</strong>sbildung.<br />
Die für eine bestimmte Prüfungsposition erteilte Note. Aus dem Durchschnitt der Positionsnoten<br />
wird die Note für das ganze entsprechende Prüfungsfach ermittelt. Positionsnoten<br />
sind als ganze oder halbe Notenwerte von 6 bis 1 zu setzen.<br />
Praktikumsort In der Ausbildung nach dem Schulortsprinzip erwerben die Auszubildenden die<br />
Kompetenzen der beruflichen Praxis am Praktikumsort. Die Praktika werden durch<br />
die <strong>Beruf</strong>sfachschulen organisiert. .<br />
Qualifikationsverfahren Wird in der <strong>Bildung</strong>sverordnung FAGE entsprechend der Terminologie des<br />
nBBG verwendet und ist identisch mit „Lehrabschlussprüfung“.<br />
SBBK<br />
Schlussnote<br />
SDK<br />
Abkürzung für „Schweizerische <strong>Beruf</strong>sbildungsämter-Konferenz“. Umfasst die<br />
DBK und die CRFP.<br />
Die für die Lehrabschlussprüfung (betrieblicher oder schulischer Teil) erteilte Gesamtnote.<br />
Sie berechnet sich aus den erworbenen Fachnoten und ist für das Bestehen<br />
oder Nichtbestehen massgebend, unter Berücksichtigung der Bestehensnorm.<br />
Schlussnoten werden wie Fachnoten auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.<br />
Abkürzung für „Sanitätsdirektorenkonferenz“<br />
3
Begriff Erläuterung<br />
Sekundarstufe II<br />
SRK<br />
Tertiärstufe<br />
Überbetriebliche Kurse<br />
Wabern, im November 2002<br />
Die Sekundarstufe II ist definiert als die Unterrichts- und Ausbildungsstufe, die im<br />
Anschluss an die obligatorische Schulzeit allen Jugendlichen zwischen dem 15. und<br />
20. Altersjahr zugänglichen berufs- und allgemeinbildenden <strong>Bildung</strong>szweige umfasst.<br />
Zurzeit befinden sich, je nach Region, etwa 10 bis 30% eines Schülerjahrgangs<br />
in allgemeinbildenden Schulen (Gymnasien, DMS) während rund 55 bis<br />
75% eine berufliche Ausbildung absolvieren.<br />
Die Ausbildungsgänge, die auf die obligatorische Schule folgen, bilden das eigentliche<br />
Stellwerk unseres <strong><strong>Bildung</strong>ssystem</strong>s. Sie qualifizieren und selektionieren die jungen<br />
Menschen für einen <strong>Beruf</strong> oder für ein Weiterstudium; sie dienen entscheidend<br />
der individuellen Entfaltung und stellen gleichzeitig der Gesellschaft, der Wirtschaft<br />
und dem Staat die nötigen Nachwuchskräfte zur Verfügung.<br />
Abkürzung für „Schweizerisches Rotes Kreuz“<br />
Die Tertiärstufe umfasst die Ausbildungsgänge, die an den jeweiligen Abschluss einer<br />
Ausbildung auf der Sekundarstufe II anschliessen. Innerhalb der Tertiärstufe<br />
ist zwischen den Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen), der höheren <strong>Beruf</strong>sbildung<br />
an einer HFS und der beruflichen Weiterbildung zu unterscheiden.<br />
Die Überbetrieblichen Kurse (Ü.K.) gelten als „dritter Lernort“. Die Auszubildenden<br />
können dort spezifische Kompetenzen erwerben. Im Vordergrund steht<br />
das Einüben bestimmter Fertigkeiten. Sie entsprechen den im heutigen BBG<br />
festgelegten Einführungskursen.<br />
In der Ausbildung FAGE umfassen die Ü.K. mind. 9 Wochen. Die Ü. K. werden<br />
von den Lehrorten getragen.<br />
4