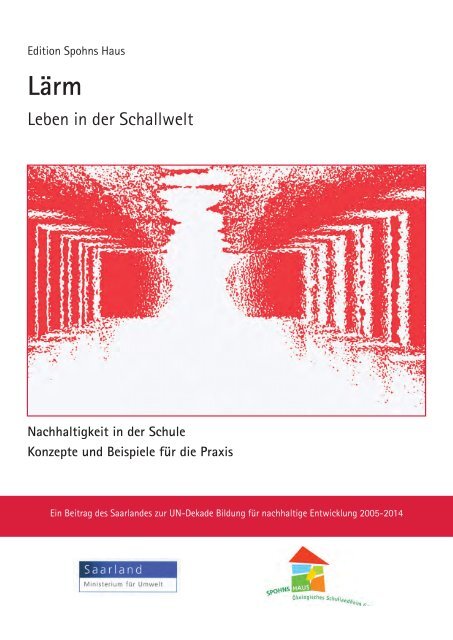Nachhaltigkeit in der Schule - TuWas!
Nachhaltigkeit in der Schule - TuWas!
Nachhaltigkeit in der Schule - TuWas!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Edition Spohns Haus<br />
Lärm<br />
Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schallwelt<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
Konzepte und Beispiele für die Praxis<br />
E<strong>in</strong> Beitrag des Saarlandes zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014
Diese Materialien wurden im Auftrag des M<strong>in</strong>isteriums für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes erstellt.<br />
Die Konzeption, Texterstellung und Redaktion lag bei <strong>der</strong> stratum® GmbH, Berl<strong>in</strong>.<br />
Die vorgestellten praktischen Unterrichtsideen und Unterrichtsmethoden s<strong>in</strong>d im Schulalltag e<strong>in</strong>setzbar und beziehen sich<br />
auf die Lehrpläne des Saarlandes für die Sekundarstufe I. Sie för<strong>der</strong>n das fachübergreifende und projektorientierte Lernen.<br />
Die Module s<strong>in</strong>d auch für außerschulische Lernorte (wie Schullandheime und Umweltbildungszentren) geeignet.<br />
Autoren dieses Heftes:<br />
Richard Häusler, stratum® GmbH<br />
Horst Cürette, M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes<br />
Layout und Gestaltung:<br />
Claudia Kerns, stratum® GmbH<br />
Druck:<br />
Pöge Druck, Leipzig
Inhalt<br />
Lesetipps vorweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
Didaktische Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s Thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />
Planungsübersicht <strong>der</strong> Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />
Modul 1: Brennpunkte des Lärms im Saarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Lernziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Zeitliche Struktur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Beispiel für die Präsentation <strong>der</strong> Lärmsituation – Verknüpfung <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Situation mit . . . . . . . . .17<br />
<strong>in</strong>dividueller Betroffenheit<br />
Modul 2: Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en Leiseraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Lernziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Lehrplanbezüge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Zeitliche Struktur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Ist unsere <strong>Schule</strong> zu laut? - Fragebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Modul 3: Wir erstellen e<strong>in</strong>en Lärmschutzplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Lernziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Lehrplanbezüge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Zeitliche Struktur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />
Lärmwettbewerb - Scoreliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />
„Schallwelt <strong>Schule</strong>“ - Fragebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26<br />
Modul 4: Geräusch- und Lärmsammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Lernziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Lehrplanbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />
Laute Musik – Ke<strong>in</strong> Grund für Hörschäden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />
Modul 5: Lärmlandkarte unserer <strong>Schule</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />
Lernziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />
Lehrplanbezüge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />
Zeitliche Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />
Benötigte Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
Ablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />
Fragebogen zur Akustik im Klassenzimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />
1
Modul 6: „Gegenlärm“ – goodforears-Disco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Lernziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Lehrplanbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />
Messreihe <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />
Modul 7: Wir komponieren e<strong>in</strong>e Lärmoper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />
Lernziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />
Lehrplanbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />
Storyboard „Lärmoper“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />
Modul 8: Stummer Dialog - Erfahrungsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Lernziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Lehrplanbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
M<strong>in</strong>dmap - Beispielstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49<br />
Modul 9: Exkursionen zum unhörbaren Lärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />
Lernziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Zeitliche Struktur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Benötigte Materialien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Ablauf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Partner und Auskunftgeber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />
Bildquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />
Lesetipps vorweg<br />
Die folgenden Titel empfehlen sich für die allgeme<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung und als H<strong>in</strong>tergrundwissen – sowohl <strong>in</strong>haltlich als auch<br />
methodisch .<br />
Richard Häusler, Erfundene Umwelt: Das Konstruktivismus-Buch für Öko- und an<strong>der</strong>e Pädagogen, 2005, 127 S ., EUR<br />
24,90<br />
Jürgen H . Maue, 0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 Dezibel – E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Grundbegriffe und die quantitative Erfassung<br />
des Lärms, 2009, 196 S ., EUR 24,80<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Lärm und Gesundheit . Materialien für die Klassen 5 bis 10, 2008,<br />
230 S ., kostenlos zu beziehen bei <strong>der</strong> BZgA (or<strong>der</strong>@bzga .de); e<strong>in</strong>e PDF-Version steht zum Download von <strong>der</strong> Infomaterialien-Seite<br />
unter www .bzga .de bereit; die Pr<strong>in</strong>tversion enthält zusätzlich e<strong>in</strong>e Audio-CD und e<strong>in</strong>e DVD<br />
2
Didaktische Voraussetzungen<br />
Für die schulische Bildung stellt die Aufgabe <strong>der</strong> nachhaltigen<br />
Entwicklung, vor <strong>der</strong> unsere Gesellschaft steht,<br />
e<strong>in</strong>e große Herausfor<strong>der</strong>ung dar . Man ist sich heute e<strong>in</strong>ig,<br />
dass <strong>Nachhaltigkeit</strong>sthemen ke<strong>in</strong>e bloße Erweiterung des<br />
Lernstoffs bedeuten, son<strong>der</strong>n dass damit <strong>der</strong> Anspruch<br />
zur Ausbildung spezifischer Kompetenzen verbunden ist .<br />
Das heißt, dass man „<strong>Nachhaltigkeit</strong>“ nicht nur als Wissensstoff<br />
behandeln darf . Die Kompetenzen, wie sie die<br />
„Bildung für e<strong>in</strong>e nachhaltige Entwicklung“ (BNE) för<strong>der</strong>n<br />
und tra<strong>in</strong>ieren möchte, umfassen sehr viel mehr:<br />
• Kognitive Problemlösefähigkeiten: Wissen e<strong>in</strong>setzen<br />
können, um Probleme zu analysieren und Lösungswege<br />
zu f<strong>in</strong>den<br />
• Handlungsbereitschaft: Probleme erkennen und<br />
selbst zur Lösung beitragen wollen<br />
• Motivationskraft: An<strong>der</strong>e Menschen zur Mitarbeit<br />
bewegen und sie für e<strong>in</strong> Engagement begeistern<br />
können<br />
• Werteorientierung: Ethische Maßstäbe entwickeln,<br />
anwenden und durchsetzen<br />
• Soziale Intelligenz: Die Interessen und Gefühle an<strong>der</strong>er<br />
<strong>in</strong> das eigene Denken und Handeln e<strong>in</strong>beziehen .<br />
Auch wenn dies Bildungsziele s<strong>in</strong>d, die allgeme<strong>in</strong> anerkannt<br />
und befürwortet werden, steht zum<strong>in</strong>dest im<br />
System <strong>der</strong> formellen Bildung die Wissensvermittlung<br />
und Wissensreproduktion im Vor<strong>der</strong>grund . BNE hat<br />
deshalb durchaus e<strong>in</strong>e systemkritische o<strong>der</strong> systemerweiternde<br />
Funktion im Kontext des schulischen Lehrens und<br />
Lernens . Um dieser Funktion gerecht zu werden und die<br />
<strong>Schule</strong> dabei zu unterstützen, <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbildung zu<br />
<strong>in</strong>tegrieren, s<strong>in</strong>d die vorliegenden Bildungsprogramme<br />
konzipiert worden .<br />
Die dabei verwendete Methodik basiert auf dem „BNE-<br />
Generator“ – e<strong>in</strong>er dreidimensionalen Konstruktionshilfe<br />
für die <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbildung, die <strong>in</strong>zwischen sowohl<br />
im schulischen wie im außerschulischen Bildungsbereich<br />
zum E<strong>in</strong>satz kommt . E<strong>in</strong>e ausführliche Beschreibung ist<br />
im Servicebereich von www .stratum-consult .de (unter<br />
„Praxispaper“) verfügbar .<br />
Der BNE-Generator <strong>in</strong>tegriert drei Dimensionen von<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
• Die (lern-)psychologische Dimension berücksichtigt<br />
die Tatsache, dass Menschen sich <strong>in</strong> ihren<br />
Denk- und Verhaltenspräferenzen unterscheiden und<br />
unterschiedlich an Aufgaben heran gehen . Diese<br />
menschliche Diversität hat Auswirkungen auf unser<br />
Lernverhalten ebenso wie auf unser grundlegendes<br />
Verständnis von <strong>Nachhaltigkeit</strong> .<br />
• Die <strong>in</strong>haltliche Dimension des <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs<br />
trägt <strong>der</strong> Tatsache Rechnung, dass es ke<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>heitliche Def<strong>in</strong>ition von <strong>Nachhaltigkeit</strong> gibt . Statt<br />
<strong>der</strong> Festlegung auf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Def<strong>in</strong>ition arbeiten<br />
wir mit fünf abstrakten Begriffen, die imstande<br />
s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong> breites Bedeutungsspektrum von <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
abzudecken und zu differenzieren .<br />
• Die pädagogische Dimension orientiert sich an den<br />
von Gerhard de Haan e<strong>in</strong>geführten „Gestaltungskompetenzen“<br />
. Das Konzept <strong>der</strong> Gestaltungskompetenzen<br />
trägt <strong>der</strong> Idee Rechnung, dass <strong>Nachhaltigkeit</strong> nicht<br />
nur e<strong>in</strong> Wissens<strong>in</strong>halt ist, son<strong>der</strong>n die Handlungs-<br />
fähigkeit und -bereitschaft <strong>der</strong> Menschen erhöhen<br />
soll, um e<strong>in</strong>e nachhaltige Entwicklung zu unterstützen<br />
.<br />
Im Folgenden werden die drei genannten Dimensionen<br />
kurz erläutert, damit dem Leser die Funktionsweise des<br />
BNE-Generators klar wird .<br />
Wir arbeiten mit dem Diversitätsmodell des Herrmann<br />
Bra<strong>in</strong> Dom<strong>in</strong>ance Instrument (HBDI), um die (lern-)<br />
psychologische Dimension zu erschließen . Ausführliche<br />
Erläuterungen zum HBDI f<strong>in</strong>det man unter www .hid .de .<br />
Das HBDI unterscheidet vier Denk- und Verhaltensbereiche,<br />
die je<strong>der</strong> Mensch – jedoch <strong>in</strong> unterschiedlicher<br />
Ausprägung – nutzt . Wie die folgende Grafik zeigt,<br />
entspricht das Modell e<strong>in</strong>er vere<strong>in</strong>fachten Charakteristik<br />
des menschlichen Gehirns, die auf den Erkenntnissen <strong>der</strong><br />
neueren Hirnforschung beruht .<br />
Die Darstellung ist jedoch nicht als physiologische<br />
Beschreibung von Hirnarealen und Hirnfunktionen zu<br />
verstehen, son<strong>der</strong>n als Metapher . H<strong>in</strong>ter dem HBDI steht<br />
e<strong>in</strong> validiertes Test<strong>in</strong>strument, das seit langem <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Personalberatung und Teamentwicklung sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Bildungsplanung e<strong>in</strong>gesetzt wird .<br />
A<br />
B C<br />
3<br />
D
Je<strong>der</strong> <strong>der</strong> vier Quadranten des HBDI entspricht e<strong>in</strong>er<br />
an<strong>der</strong>en Art, sich mit <strong>der</strong> Welt ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen .<br />
Dementsprechend lassen sich z .B . auch vier grundsätzlich<br />
verschiedene Zugänge zur <strong>Nachhaltigkeit</strong>sthematik<br />
unterscheiden:<br />
A: Unter dem sachorientierten, logisch und technisch<br />
dom<strong>in</strong>ierten Aspekt bedeutet <strong>Nachhaltigkeit</strong> die Suche<br />
nach besseren Lösungen für e<strong>in</strong>e komplexer werdende<br />
Welt. Wissenschaft und technologische Innovation stehen<br />
im Fokus dieses <strong>Nachhaltigkeit</strong>sverständnisses .<br />
B: Für das planende, absichernde und praxisorientierte<br />
Verhalten des B-Quadranten stellt <strong>Nachhaltigkeit</strong> <strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>e Frage <strong>der</strong> verlässlichen Zukunftsgestaltung<br />
dar . Hier geht es um Regelungen, Verfahren,<br />
Kontrolle und die praktische Umsetzung e<strong>in</strong>es angemessenen<br />
Risikobewusstse<strong>in</strong>s . Der praktische Bezug zum<br />
alltäglichen Verhalten und e<strong>in</strong>e gewisse Bodenständigkeit<br />
stehen im Vor<strong>der</strong>grund .<br />
C: In <strong>der</strong> Gefühlswelt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> es um Kommunikation,<br />
sozialen Kontakt und Selbstwahrnehmung geht, bekommt<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> e<strong>in</strong>e entsprechende Ausprägung .<br />
Die <strong>in</strong>dividuelle Verantwortung, die Lebensqualität des<br />
e<strong>in</strong>zelnen und das Gefühl für Gerechtigkeit und Solidarität<br />
prägen den <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriff im C-Quadranten .<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> ist hier e<strong>in</strong>e emotionale und soziale Qualität,<br />
es geht um die Motivation <strong>der</strong> Menschen, die sich<br />
am <strong>Nachhaltigkeit</strong>sprojekt beteiligen sollen . Nicht so sehr<br />
die Sache (wie im rationalen A-Quadranten), son<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Mensch steht im Mittelpunkt .<br />
D: In <strong>der</strong> Perspektive, die <strong>der</strong> D-Quadrant eröffnet, wird<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> zur Herausfor<strong>der</strong>ung für visionäres<br />
Denken und die Neuerf<strong>in</strong>dung unserer Zivilisation. Die<br />
kreative und experimentelle Orientierung verlangen nach<br />
großen neuen Konzepten, die bisherige Begrenzungen<br />
überw<strong>in</strong>den und kulturelle Bedeutung erhalten . An<strong>der</strong>s<br />
als im absichernden Denken, das den B-Quadranten<br />
bestimmt, werden Risiko und Verän<strong>der</strong>ung hier positiv<br />
gesehen und stellen die Voraussetzung des Handelns dar .<br />
Es ist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im pädagogischen Bereich sehr hilfreich,<br />
diese Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem „Faktor“ Mensch<br />
und <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> zu reflektieren und die menschliche<br />
Diversität als Ursache für unterschiedliche E<strong>in</strong>stellungen<br />
zur <strong>Nachhaltigkeit</strong> zu erkennen . Die E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong><br />
diesen Zusammenhang bewahrt uns vor <strong>der</strong> Illusion, die<br />
Teilnehmer von pädagogischen Veranstaltungen müssten<br />
alle denselben Begriff von <strong>Nachhaltigkeit</strong> im Kopf haben<br />
wie wir selbst .<br />
Das HBDI-Modell hilft uns, auch unterschiedlichen<br />
Lerntypen gerecht zu werden . Denn die Differenzierung<br />
<strong>der</strong> Denk- und Verhaltensstile im HBDI korrespondiert<br />
natürlich auch mit unterschiedlichen Lernformen und<br />
4<br />
Lernmotivationen . Demnach können wir unterscheiden:<br />
• Das kognitive, sachbezogene, auf Fakten und Logik<br />
beruhende Lernen entspricht dem A-Quadranten .<br />
Dieses Lernen dom<strong>in</strong>iert unsere formellen Bildungssysteme<br />
. Es bildet dennoch, wie wir sehen, nur e<strong>in</strong>en<br />
Teil des menschlichen Lernverhaltens .<br />
• Das Lernen über praktisches Ausprobieren, Anwenden<br />
von Regeln und Verfahren ist m<strong>in</strong>destens<br />
genauso bedeutsam wie das kognitive Lernen . In<br />
unserer „Wissensgesellschaft“ wird es zwar unterbewertet,<br />
es stellt aber für viele K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche<br />
den präferierten Lernweg dar .<br />
• In <strong>der</strong> Pädagogik kennt man auch das soziale Lernen,<br />
das im Austausch <strong>der</strong> Lernenden untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, <strong>in</strong><br />
kommunikativen Aufgabenstellungen und <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Verknüpfung von Verstand und Gefühl stattf<strong>in</strong>det .<br />
Der sozial-kommunikative Zugang zum Lernen wird<br />
von e<strong>in</strong>em Schulunterricht, bei dem vor allem <strong>der</strong><br />
Lehrer spricht, erschwert . Er ist aber für nicht wenige<br />
Schüler eigentlich <strong>der</strong> primäre Lernweg .<br />
• Das experimentelle Lernen spricht vor allem diejenigen<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler an, die sehr viel<br />
Freiheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beschäftigung mit Lern<strong>in</strong>halten<br />
benötigen . Der selbstbestimmte, kreative Zugang<br />
zum Thema ist für diese K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen<br />
die Voraussetzung für den Lernerfolg . Diesen Lernern<br />
kommt fachübergreifendes Arbeiten sehr entgegen .<br />
Die im vorliegenden Bildungsprogramm vorgeschlagenen<br />
Lerne<strong>in</strong>heiten s<strong>in</strong>d so ausgewählt, dass je<strong>der</strong> <strong>der</strong> vier<br />
lernpsychologischen Zugänge <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> Module im<br />
Vor<strong>der</strong>grund steht .<br />
Modul 1 „Brennpunkte des Lärms im Saarland“<br />
Dieses Modul stellt das fakten- und wissensorientierte<br />
Lernen <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund . Bei <strong>der</strong> Suche nach<br />
Erkenntnissen über die Lärmsituation im Saarland<br />
werden auch Methoden <strong>der</strong> Recherche und Informationsbeschaffung<br />
geübt . Das Ergebnis soll e<strong>in</strong>e gute<br />
Übersicht über die Lärmquellen, die Lärmverteilung<br />
und die Lärmschutzpolitik im Saarland geben .<br />
Modul 2 „Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en Leiseraum“<br />
Die Planung und eventuell auch E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es<br />
Leiseraums <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> ist weniger e<strong>in</strong>e technischorganisatorische<br />
Aufgabe, son<strong>der</strong>n zunächst e<strong>in</strong>e<br />
Frage des Bedarfs und <strong>der</strong> Akzeptanz e<strong>in</strong>es solchen<br />
Projekts . Außerdem sollen Schüler und Lehrer auch <strong>in</strong><br />
die Konzeption des Leiseraums e<strong>in</strong>bezogen werden .<br />
Das Modul erfor<strong>der</strong>t also <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie sozialkommunikative<br />
Kompetenzen .
Modul 3 „Wir erstellen e<strong>in</strong>en Lärmschutzplan“<br />
Dieses Modul macht mit Lärmmessung und Lärmvermeidung<br />
bekannt . Die konkrete Aufgabe, im<br />
eigenen schulischen o<strong>der</strong> familiären Umfeld Lärmschutzmaßnahmen<br />
zu konzipieren, konfrontiert die<br />
Schüler(<strong>in</strong>nen) mit den praktischen und organisatorischen<br />
Fragen, die mit <strong>der</strong> Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen<br />
im Alltag verbunden s<strong>in</strong>d . Der<br />
Lärmschutzplan soll schließlich praktisch anwendbar<br />
und wirksam werden, d .h . auch von an<strong>der</strong>en (Lehrern,<br />
Eltern, Mitschülern) verstanden und praktiziert<br />
werden .<br />
Modul 4 „E<strong>in</strong>e Geräusch- und Lärmsammlung“<br />
Auch hier geht es um e<strong>in</strong>en praxisorientierten Zugang<br />
zum Thema, bei dem die organisatorische und strukturierende<br />
Komponente im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Aufgabenstellung<br />
steht . Die Erstellung e<strong>in</strong>er Geräusch- und<br />
Lärmsammlung erfor<strong>der</strong>t die Lösung praktisch-technischer<br />
Fragen ebenso wie Entscheidungen über die<br />
Systematisierung des Materials und die Organisation<br />
des Zugriffs auf die Geräusch- und Lärmproben .<br />
Modul 5 „Die Lärmlandkarte unserer <strong>Schule</strong>’“<br />
Bei diesem Modul handelt es sich um e<strong>in</strong>e Art von Forschungsauftrag,<br />
<strong>der</strong> somit den kognitiv-wissenschaftlichen<br />
Lerntyp beson<strong>der</strong>s for<strong>der</strong>t . Auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
e<strong>in</strong>er Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung über Lärmmessung, Lärmquellen<br />
und Lärmdokumentation soll die Situation <strong>der</strong><br />
gesamten <strong>Schule</strong> <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Lärmlandkarte dargestellt<br />
werden . Dabei wird es auch darum gehen, zahlreiche<br />
unterschiedliche Sach<strong>in</strong>formationen <strong>in</strong> geeigneter<br />
Weise zusammenzufassen und zu präsentieren .<br />
Modul 6 „‘Gegenlärm‘ – Die goodforears-Disco“<br />
Ausgehend von den gesundheitlichen Gefahren<br />
starken Disco-Lärms for<strong>der</strong>t dieses Modul dazu auf,<br />
kreative Formen e<strong>in</strong>er gesundheitsverträglichen Disco-<br />
Veranstaltung zu entwickeln und zu realisieren . Die<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung liegt also im experimentellen Bereich<br />
und es wird e<strong>in</strong> großer Spielraum für <strong>in</strong>novative Lösungsideen<br />
und Realisierungsformen eröffnet .<br />
Modul 7 „Wir komponieren e<strong>in</strong>e Lärmoper“<br />
Dieses Modul stellt das kreative Lernen <strong>in</strong>s Zentrum .<br />
E<strong>in</strong>e Oper ist e<strong>in</strong>e Form des Musiktheaters, bei <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
szenisch-dramatische Handlung durch Musik dargestellt<br />
wird . Im Fall <strong>der</strong> „Lärmoper“ besteht die Musik<br />
aus Geräuschkompositionen, die die Schüler(<strong>in</strong>nen)<br />
selbst aufnehmen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e ebenfalls selbst erfundene<br />
Geschichte e<strong>in</strong>bauen .<br />
Modul 8 „Stummer Dialog - Erfahrungsfeld“<br />
Der „Stumme Dialog“ arbeitet mit e<strong>in</strong>em kommunikativen<br />
Paradox – die Verständigung über das Thema<br />
„Lärm“ ohne die Verwendung von Schallwellen . Damit<br />
wird vor allem die subjektive Lärmerfahrung thematisiert<br />
. Es wird deutlich, dass Geräusche und Lärm<br />
<strong>in</strong>dividuell unterschiedlich wahrgenommen werden<br />
und auch <strong>in</strong>dividuell verschiedene Bedeutungen haben .<br />
Nicht zuletzt geht es um die Funktion, die Lautstärke<br />
auch für Kommunikation, Kultur und soziale Zugehörigkeit<br />
hat . Der „Stumme Dialog“ kann als Interaktionsspiel,<br />
aber auch als dauerhafte Erlebnis<strong>in</strong>stallation<br />
(„Erfahrungsfeld“) konzipiert werden .<br />
Modul 9 „Exkursionen zum unhörbaren Lärm <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>drä<strong>der</strong>“<br />
Dieses Modul erfor<strong>der</strong>t Vorstellungsvermögen, Abenteuerlust<br />
und Experimentierfreude . Der „unhörbare“<br />
Lärm im Infraschallbereich, den W<strong>in</strong>drä<strong>der</strong> an Land<br />
machen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Vibrationslärm, <strong>der</strong> beim Bau von<br />
Offshore-W<strong>in</strong>danlagen entsteht und <strong>der</strong> z .B . Auswirkungen<br />
auf Schwe<strong>in</strong>swale hat, ist unser Thema . Durch<br />
Besuche <strong>in</strong> Forschungse<strong>in</strong>richtungen und <strong>in</strong> W<strong>in</strong>dparks<br />
sollen die Schüler(<strong>in</strong>nen) <strong>der</strong> Sache auf die Spur kommen<br />
und die Frage klären, ob <strong>der</strong> Lärm <strong>der</strong> W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
e<strong>in</strong> Problem für die umgebende (menschliche<br />
und nicht-menschliche) Natur darstellen könnte .<br />
Die Tabelle auf S . 13 verortet die neun Bildungsmodule<br />
im Raster des BNE-Generators . Dadurch wird auch<br />
deutlich, welche Inhaltsaspekte des <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs<br />
und welche spezifischen Gestaltungskompetenzen<br />
mit dem jeweiligen Modul verknüpft s<strong>in</strong>d . Damit s<strong>in</strong>d<br />
wir auch bereits bei <strong>der</strong> zweiten Dimension des BNE-<br />
Generators angelangt – <strong>der</strong> <strong>in</strong>haltlichen Bedeutung des<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs . Um das Bedeutungsspektrum<br />
abzudecken, folgen wir e<strong>in</strong>em Vorschlag, den Alexan<strong>der</strong><br />
Walter 2002 an <strong>der</strong> ETH Zürich gemacht hat . In<br />
se<strong>in</strong>er Arbeit unter dem Titel „<strong>Nachhaltigkeit</strong>: Mehr als<br />
e<strong>in</strong> Zauberwort?“ destilliert er fünf Inhaltsaspekte des<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs heraus:<br />
1 . Integration. Dieser Begriff bezeichnet die Intention,<br />
die bisher oft unverbunden nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehenden<br />
o<strong>der</strong> sogar konträr verwendeten Aspekte <strong>der</strong><br />
Ökonomie, <strong>der</strong> Ökologie und des Sozialen zu vere<strong>in</strong>en<br />
. Als nachhaltig gelten also diejenigen Entwicklungen,<br />
die die Bedürfnisse je<strong>der</strong> dieser drei Sphären<br />
gleichermaßen berücksichtigen . Dah<strong>in</strong>ter steht die<br />
Überzeugung, dass auf Dauer we<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Wirtschaften<br />
ohne Berücksichtigung <strong>der</strong> natürlichen Umwelt<br />
und <strong>der</strong> sozialen Bedürfnisse <strong>der</strong> Menschen möglich<br />
ist, noch dass Umweltschutz und Sozialpolitik ohne<br />
5
e<strong>in</strong>e ausreichende wirtschaftliche Fundierung erfolgreich<br />
se<strong>in</strong> werden . Diese Integrationsvorstellung<br />
wird auch als das „Agenda 21-Dreieck“ bezeichnet,<br />
weil sie mit <strong>der</strong> „Agenda 21“ des Erdgipfels von Rio<br />
im Jahre 1992 von nahezu allen Staaten <strong>der</strong> Erde<br />
als Leitl<strong>in</strong>ie <strong>der</strong> eigenen Entwicklung anerkannt<br />
worden ist .<br />
2 . Permanenz. Unter diesem Aspekt <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
wird die Überzeugung verstanden, dass präventives<br />
Denken und Handeln nötig ist, um e<strong>in</strong>e<br />
dauerhafte Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen<br />
zu erreichen . Ohne e<strong>in</strong>e Permanenz-<br />
Vorstellung geraten wir <strong>in</strong> Gefahr, zu kurzfristig zu<br />
planen, schnelle Erfolge und Gew<strong>in</strong>ne anzustreben<br />
und die längerfristige Perspektive unseres Tuns<br />
aus dem Auge zu verlieren . Die Bedeutung, die die<br />
Biodiversität (Artenvielfalt) heute hat, ist e<strong>in</strong> Beleg<br />
für den Permanenz-Aspekt des <strong>Nachhaltigkeit</strong>sgedankens<br />
.<br />
3 . Gerechtigkeit. Unter dem Aspekt <strong>der</strong> Gerechtigkeit<br />
versteht man <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdiskussion<br />
e<strong>in</strong>e weiter reichende Vorstellung von Fairness, die<br />
über die geltenden Normen unserer Rechtsstaatlichkeit<br />
h<strong>in</strong>ausgeht . Die Gerechtigkeitsvorstellung<br />
des <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs schließt zum e<strong>in</strong>en die<br />
<strong>in</strong>tergenerationelle Gerechtigkeit mit e<strong>in</strong>, d .h . die<br />
Verpflichtung, die Lebensqualität und die Lebenschancen<br />
kommen<strong>der</strong> Generationen nicht durch<br />
unser heutiges Handeln zu schmälern . Außerdem<br />
gilt das Gerechtigkeitsgebot auch für das Verhältnis<br />
zwischen den Nationen und den verschiedenen Völkern<br />
<strong>der</strong> Erde, d .h . man gesteht jedem Weltbürger<br />
im Pr<strong>in</strong>zip dieselbe Lebensqualität und denselben<br />
Ressourcenverbrauch zu .<br />
4 . Subjektivität. Als wesentlicher Aspekt <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
wird auch die Verantwortung jedes e<strong>in</strong>zelnen<br />
Menschen für e<strong>in</strong>e dauerhafte und umweltverträgliche<br />
Entwicklung angesehen . D .h . dass <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
nicht alle<strong>in</strong>e Angelegenheit <strong>der</strong> Regierungen<br />
und <strong>der</strong> Politik ist, son<strong>der</strong>n die Beteiligung aller<br />
Menschen erfor<strong>der</strong>t, die sich als Konsumenten, als<br />
Bürger und als Mitglied von Organisationen angesprochen<br />
fühlen sollen . Die Vorstellung, dass <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> eigenen Lebensqualität ist, soll<br />
im Bewusstse<strong>in</strong> aller Menschen verankert werden .<br />
5 . Dependenz. Unter diesem Begriff versteht man die<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Tragfähigkeit <strong>der</strong> Erde als dem<br />
Ökosystem, auf das wir angewiesen s<strong>in</strong>d . Damit ist<br />
die Erhaltung <strong>der</strong> Regenerationsfähigkeit natürlicher<br />
Systeme geme<strong>in</strong>t, von denen wir abhängig s<strong>in</strong>d . Die<br />
For<strong>der</strong>ung nach Schonung und effizientem E<strong>in</strong>satz<br />
natürlicher Ressourcen gehört zum Dependenz-<br />
6<br />
Aspekt des <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs, <strong>der</strong> uns mit<br />
den natürlichen Grenzen unserer Wirtschaftsweise<br />
konfrontiert .<br />
Die Module des vorliegenden Bildungsprogramms verteilen<br />
sich auf alle fünf genannten Inhaltsaspekte <strong>der</strong><br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> – Integration, Permanenz, Subjektivität,<br />
Gerechtigkeit und Dependenz . Die folgende Übersicht<br />
ordnet die <strong>in</strong>haltlichen Schwerpunkte den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Modulen zu .<br />
Natürlich s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelfall auch an<strong>der</strong>e Aspekte relevant,<br />
doch empfehlen wir aus pädagogischer Sicht die<br />
Konzentration auf jeweils e<strong>in</strong> zentrales Thema . Diese<br />
„Profilschärfung“ <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Unterrichtsmodule för<strong>der</strong>t<br />
den Zusammenhang zwischen dem theoretisch-abstrakten<br />
Verständnis und <strong>der</strong> konkreten und praktischen<br />
Handlungsrelevanz von <strong>Nachhaltigkeit</strong> .<br />
Modul 1 „Brennpunkte des Lärms im Saarland“<br />
Durch dieses Modul wird <strong>der</strong> „Integrations“-Aspekt<br />
von <strong>Nachhaltigkeit</strong> beleuchtet . Die Lärmsituation<br />
im Saarland hat ökonomische, soziale und ökologische<br />
Aspekte . E<strong>in</strong>e entsprechende Differenzierung<br />
hilft uns, die Bedeutung des <strong>Nachhaltigkeit</strong>skonzepts<br />
für die Lärmdiskussion heraus zu arbeiten und<br />
verständlich darzustellen .<br />
Modul 2 „Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en Leiseraum“<br />
Der „Permanenz“-Aspekt dom<strong>in</strong>iert dieses Modul,<br />
denn es geht um die Frage, was <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
dafür getan werden kann, dass junge Menschen<br />
ihre Hörfähigkeit entwickeln und tra<strong>in</strong>ieren, um<br />
späteren Hörschäden vorzubeugen . Dabei kann z .B .<br />
auch die Beziehung zwischen Lärm und k<strong>in</strong>dlicher<br />
Gehirnentwicklung thematisiert werden . Auf jeden<br />
Fall geht es darum, dass die Schüler(<strong>in</strong>nen) e<strong>in</strong><br />
Bewusstse<strong>in</strong> für (vorbeugenden) Gesundheitsschutz<br />
bekommen .<br />
Modul 3 „Wir erstellen e<strong>in</strong>en Lärmschutzplan“<br />
Der Lärmschutzplan thematisiert die <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdimension<br />
<strong>der</strong> „Gerechtigkeit“ . Durch Lärmschutz<br />
soll verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden, dass Menschen an<br />
bestimmten Orten o<strong>der</strong> bei bestimmten Tätigkeiten<br />
dadurch benachteiligt werden, dass sie beson<strong>der</strong>s<br />
hohem o<strong>der</strong> dauerhaftem Lärm ausgesetzt s<strong>in</strong>d .<br />
Auch die <strong>in</strong>dividuell unterschiedliche Empf<strong>in</strong>dlichkeit<br />
gegen Lärm soll durch den Lärmschutzplan berücksichtigt<br />
werden .
Modul 4 „E<strong>in</strong>e Geräusch- und Lärmsammlung“<br />
Der Aspekt <strong>der</strong> „Subjektivität“ lässt sich am leichtesten<br />
mit <strong>der</strong> Lärmthematik verb<strong>in</strong>den, denn Lärm<br />
ist <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong> Problem für die <strong>in</strong>dividuelle Lebensqualität<br />
von Menschen, die unter ihm leiden . Die<br />
Geräusch- und Lärmsammlung soll die Vielfältigkeit<br />
von Lärmursachen beleuchten und die Abhängigkeit<br />
<strong>der</strong> Lärmwahrnehmung vom subjektiven Empf<strong>in</strong>den<br />
erlebbar machen .<br />
Modul 5 „Die Lärmlandkarte unserer <strong>Schule</strong>’“<br />
Auch bei diesem Modul steht die <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdimension<br />
<strong>der</strong> „Subjektivität“ im Vor<strong>der</strong>grund . Die<br />
Erstellung <strong>der</strong> Lärmlandkarte <strong>der</strong> eigenen <strong>Schule</strong><br />
benötigt die Mithilfe <strong>der</strong> Schüler, da objektive<br />
Lärmmessungen alle<strong>in</strong>e nicht ausreichen . Außerdem<br />
soll das Modul dazu beitragen, dass die Schüler e<strong>in</strong>e<br />
aktive E<strong>in</strong>stellung entwickeln und e<strong>in</strong>e möglicherweise<br />
vorhandene hohe Lärmbelastung nicht e<strong>in</strong>fach<br />
h<strong>in</strong>nehmen, son<strong>der</strong>n Mitverantwortung für e<strong>in</strong>e<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Situation übernehmen .<br />
Modul 6 „‘Gegenlärm‘ – Die goodforears-Disco“<br />
Der „Subjektivitäts“-Aspekt <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> spielt<br />
auch <strong>in</strong> diesem Modul die zentrale Rolle, denn es<br />
geht um die Verb<strong>in</strong>dung zwischen Disco-Erlebnis und<br />
bewusstem Umgang mit den gesundheitsschädlichen<br />
Auswirkungen hoher Lärmbelastung .<br />
Modul 7 „Wir komponieren e<strong>in</strong>e Lärmoper“<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund dieses Moduls steht <strong>der</strong> Aspekt<br />
<strong>der</strong> „Subjektivität“, d .h . die Relevanz, die Lärm für<br />
die eigene Lebensqualität hat . Je nachdem, welche<br />
Handlung die Schüler erf<strong>in</strong>den, können unterschiedliche<br />
Aspekte <strong>der</strong> persönlichen Betroffenheit von Lärm<br />
e<strong>in</strong>e Rolle spielen . Das dramatische Format e<strong>in</strong>er<br />
Oper legt sowohl Opfer- und Täterperspektiven nahe<br />
als auch tragische o<strong>der</strong> komische Verwicklungen .<br />
Modul 8 „Stummer Dialog - Erfahrungsfeld“<br />
Der Begriff „Erfahrungsfeld“ sagt es schon: „Subjektivität“<br />
ist <strong>der</strong> Schlüsselbegriff dieses Moduls <strong>der</strong><br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sbildung, bei dem es um e<strong>in</strong>e neue<br />
Dimension <strong>der</strong> Reflexion über das Lärmthema geht .<br />
Sich ohne Schallwellen über Lärm zu verständigen,<br />
erfor<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e sehr persönliche Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung<br />
mit <strong>der</strong> Thematik .<br />
Modul 9 „Exkursionen zum unhörbaren Lärm <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>drä<strong>der</strong>“<br />
Die <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdimension <strong>der</strong> „Dependenz“ soll<br />
durch dieses Unterrichtsmodul mit <strong>der</strong> Lärmthematik<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht werden . Die Frage lautet:<br />
Welche Grenzen <strong>der</strong> natürlichen Belastbarkeit werden<br />
durch Lärm überschritten? Dabei soll explizit nicht <strong>der</strong><br />
Bereich <strong>der</strong> bewussten, hörbaren Lärme<strong>in</strong>wirkungen<br />
auf den Menschen behandelt werden . Vielmehr geht<br />
es sowohl um Lärme<strong>in</strong>wirkungen auf die Tierwelt als<br />
auch um den Lärm, den Menschen zwar nicht hören<br />
können, <strong>der</strong> sie aber möglicherweise dennoch bee<strong>in</strong>flusst<br />
.<br />
Als dritte Dimension im BNE-Generator dient uns das<br />
Konzept <strong>der</strong> Gestaltungskompetenzen, wie es <strong>der</strong> Berl<strong>in</strong>er<br />
Pädagogikprofessor Gerard de Haan entworfen hat . In dessen<br />
Kompetenzset waren zunächst acht Gestaltungskompetenzen<br />
aufgenommen worden . Inzwischen hat de Haan<br />
das Set zwar auf 12 Kompetenzen erweitert, wir bleiben<br />
aus pragmatischen Gründen jedoch bei dem ursprünglichen<br />
achtteiligen Kompetenzen-Set . Die <strong>in</strong>haltlichen Unterschiede<br />
zwischen <strong>der</strong> acht- und <strong>der</strong> 12-teiligen Version<br />
s<strong>in</strong>d für unsere Zwecke kaum relevant . Folgende Gestaltungskompetenzen<br />
sollen durch BNE vermittelt werden:<br />
1 . Vorausschauendes Denken. Dazu gehören die Fähigkeit,<br />
die Gegenwart aus e<strong>in</strong>er Zukunftsperspektive zu<br />
betrachten, das Erkennen von Beziehungen zwischen<br />
jetzigem Handeln und <strong>der</strong> Zukunft, das Entwerfen von<br />
Zukunftsvisionen und das Arbeiten mit verschiedenen<br />
Zukunftsszenarien .<br />
2 . Offenheit für neue Perspektiven. Diese Kompetenz<br />
erfor<strong>der</strong>t das Verstehen historischer und kultureller<br />
Zusammenhänge, das Erkennen von Unterschieden<br />
und das aktive Interesse an ihnen sowie e<strong>in</strong>e positive<br />
E<strong>in</strong>stellung zur Offenheit künftiger Entwicklungen .<br />
3 . Interdiszipl<strong>in</strong>äres Denken und Handeln. Dabei geht<br />
es darum, unterschiedliche fachliche und methodische<br />
Zugangsweisen zu e<strong>in</strong>em Thema zu kennen und anzuwenden,<br />
zu erkennen, dass und wie e<strong>in</strong> Problem auch<br />
von <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Fragestellung abhängt, um Problemstellungen<br />
fachübergreifend formulieren zu können .<br />
4 . Partizipieren können. Dies bedeutet, sich darüber<br />
bewusst zu se<strong>in</strong>, dass die eigene Beteiligung an Diskussions-<br />
und Entscheidungsprozessen sowie an <strong>der</strong>en<br />
Umsetzung möglich und s<strong>in</strong>nvoll ist, zu wissen, wie<br />
und wo Entscheidung bee<strong>in</strong>flusst werden können, sich<br />
selbst aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen,<br />
konstruktive Formen <strong>der</strong> Beteiligung zu praktizieren<br />
und Gruppen- o<strong>der</strong> Autoritätsdruck standhalten zu<br />
können .<br />
7
5 . <strong>Nachhaltigkeit</strong>sorientiert planen und handeln. Dazu<br />
ist es erfor<strong>der</strong>lich, spezifisches Planungswissen zu<br />
erwerben, verschiedene Elemente <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong> <strong>in</strong><br />
Verb<strong>in</strong>dung br<strong>in</strong>gen und Kenntnisse über nachhaltige<br />
Entwicklung <strong>in</strong> eigene Planungskontexte e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen zu<br />
können .<br />
6 . Empathie, Engagement und Solidarität. Dazu gehören<br />
die Fähigkeit, sich <strong>in</strong> die Lebenssituation an<strong>der</strong>er<br />
Menschen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> versetzen und sich <strong>in</strong> sie e<strong>in</strong>fühlen<br />
zu können, Interesse an den Gefühlen, Erfahrungen<br />
und Me<strong>in</strong>ungen an<strong>der</strong>er zu haben, eigene Gefühle artikulieren<br />
und sie mit den Gefühlen an<strong>der</strong>er vergleichen<br />
zu können sowie Gerechtigkeits- und Geme<strong>in</strong>schaftsgefühl<br />
zu entwickeln .<br />
7 . Sich und an<strong>der</strong>e motivieren. Damit ist geme<strong>in</strong>t, die<br />
Bedeutung von „<strong>Nachhaltigkeit</strong>“ für sich selbst zu<br />
entdecken, zu wissen, was Menschen motiviert, über<br />
eigene Interessen und Motive sprechen zu können,<br />
Führungsrollen übernehmen zu können sowie Teamfähigkeit<br />
zu zeigen .<br />
8 . Individuelle und kulturelle Leitbil<strong>der</strong> reflektieren.<br />
Dies bedeutet, sich selbst kritisch wahrnehmen und eigene<br />
Reaktionen reflektieren zu können, die kulturelle<br />
E<strong>in</strong>bettung des eigenen und des fremden Verhaltens zu<br />
erkennen und kulturelle Unterschiede soweit als möglich<br />
wertfrei (nicht explizit wertend) zu beschreiben .<br />
Die Zuordnung <strong>der</strong> Module zum Thema „Lärm“ zu den<br />
e<strong>in</strong>zelnen Komponenten <strong>der</strong> Gestaltungskompetenz wird <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> folgenden Übersicht deutlich .<br />
Auch hier gilt, dass das Isolieren e<strong>in</strong>er zentralen Kompetenz<br />
pro Modul ke<strong>in</strong>e Ausschließlichkeit nahelegen soll .<br />
Natürlich ist immer e<strong>in</strong> ganzes Kompetenzbündel erfor<strong>der</strong>lich,<br />
um erfolgreich zu handeln .<br />
Um jedoch die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> jedem <strong>der</strong> acht Kompetenzbereiche<br />
herauszuheben und zu beleuchten, ist<br />
es s<strong>in</strong>nvoll, <strong>in</strong> jedem <strong>der</strong> Module speziell auf diejenigen<br />
Verhaltensweisen und E<strong>in</strong>stellungen zu achten, die dem<br />
herausgegriffenen e<strong>in</strong>zelnen Kompetenzmuster entsprechen<br />
. Dadurch wird auch die Überprüfung von Lernerfolgen<br />
erleichtert und <strong>der</strong> Transfer <strong>in</strong> den Alltag unterstützt .<br />
Pädagogisch wirksam ist nämlich die enge Verb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen e<strong>in</strong>em Sachthema - z .B . <strong>der</strong> Erfassung von<br />
Lärmproblemzonen im Saarland - und den menschlichen<br />
Aspekten, die durch den Kompetenzaspekt geför<strong>der</strong>t wird .<br />
Diese Verb<strong>in</strong>dung verstärkt die Handlungsmotivation - was<br />
wie<strong>der</strong>um zurückwirkt auf die kognitive Seite des Lernprozesses<br />
. Man könnte sagen, dass durch BNE e<strong>in</strong> sehr viel<br />
ganzheitlicheres Lernen ermöglicht wird als durch klassisches<br />
Behandeln von re<strong>in</strong>en „Sachthemen“ .<br />
8<br />
Modul 1 „Brennpunkte des Lärms im Saarland“<br />
Unter dem Kompetenzaspekt legt dieses Modul den<br />
Schwerpunkt auf „Empathie, Engagement, Solidarität“ .<br />
Die Erfassung <strong>der</strong> Lärmsituation im Saarland ergibt e<strong>in</strong><br />
Bild <strong>der</strong> Lärmbelastung <strong>der</strong> Bevölkerung und legt die<br />
Frage nahe, ob es bestimmten Teilen <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
denn zumutbar ist, unter Lärme<strong>in</strong>wirkungen zu leiden .<br />
Modul 2 „Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en Leiseraum“<br />
Die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es „Leiseraums“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> erfor<strong>der</strong>t<br />
die „Offenheit für neue Perspektiven“ . Denn zum<br />
e<strong>in</strong>en wird von den Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern gefor<strong>der</strong>t,<br />
dass sie sich mit <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuell unterschiedlichen<br />
Lärmempf<strong>in</strong>dlichkeit ihrer Mitschüler und <strong>der</strong> Lehrkräfte<br />
beschäftigen . Zum an<strong>der</strong>en ist das Erlebnis im<br />
„Leiseraum“ selbst für die allermeisten Schüler(<strong>in</strong>nen)<br />
sicherlich e<strong>in</strong>e neue Erfahrung und för<strong>der</strong>t die Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung<br />
mit unterschiedlicher S<strong>in</strong>neswahrnehmung<br />
– u .a . auch <strong>der</strong> von hörbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Menschen .<br />
Modul 3 „Wir erstellen e<strong>in</strong>en Lärmschutzplan“<br />
E<strong>in</strong> Lärmschutzplan stellt immer e<strong>in</strong>en Kompromiss<br />
zwischen dem ökonomisch Möglichen und dem sozial<br />
Notwendigen dar . Idealerweise bezieht er die Betroffenen<br />
mit e<strong>in</strong> und geht über passiven Lärmschutz<br />
h<strong>in</strong>aus . Das Modul vermittelt am Beispiel des Lärmschutzes<br />
die Anfor<strong>der</strong>ungen an „<strong>Nachhaltigkeit</strong>sorientiertes<br />
Planen“ .<br />
Modul 4 „E<strong>in</strong>e Geräusch- und Lärmsammlung“<br />
Ähnlich wie das Modul „Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en<br />
Leiseraum“ thematisiert die „Geräusch- und Lärmsammlung“<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Multiperspektivität<br />
gegenüber dem Erleben von Lärm . Zum e<strong>in</strong>en werden<br />
<strong>in</strong> dem Modul <strong>in</strong>dividuelle Unterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> Reaktion<br />
auf Lärm thematisiert, zum an<strong>der</strong>en werden<br />
die unterschiedlichen Lärmquellen erlebbar und wird<br />
<strong>der</strong> Unterschied zwischen <strong>der</strong> objektiv-naturwissenschaftlich<br />
messbaren Lärmhöhe und dem subjektiven<br />
Lärmempf<strong>in</strong>den deutlich .<br />
Modul 5 „Die Lärmlandkarte unserer <strong>Schule</strong>’“<br />
Bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Lärmlandkarte <strong>der</strong> eigenen <strong>Schule</strong><br />
erweist sich „<strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äres Denken“ als hilfreich .<br />
Die Erfassung <strong>der</strong> mit Geräten messbaren Lärmsituation<br />
steht neben <strong>der</strong> Erhebung des subjektiven Lärmempf<strong>in</strong>dens<br />
<strong>der</strong> Schüler . Außerdem ist es erfor<strong>der</strong>lich,<br />
die Lärmquellen zu orten, zu beschreiben und zu<br />
kategorisieren . Dabei werden naturwissenschaftliche,<br />
soziologische, psychologische und architektonische<br />
Erklärungsmodelle heran gezogen und mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
verknüpft .
Modul 6 „‘Gegenlärm‘ – Die goodforears-Disco“<br />
Die Konzeption und Realisierung <strong>der</strong> „Gegenlärm“-<br />
Disco macht die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler zu Akteuren<br />
<strong>in</strong> eigener Sache . Sie sollen die Möglichkeit<br />
bekommen, das Projekt eigenverantwortlich zu<br />
planen und auch die Realisierung <strong>der</strong> Disco <strong>in</strong>nerhalb<br />
<strong>der</strong> <strong>Schule</strong> (o<strong>der</strong> im schulischen Umfeld), ggf . zusammen<br />
mit Projektpartnern, selbstständig zu übernehmen<br />
. Am Thema „Lärm“ lernen sie so, die <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdimension<br />
<strong>der</strong> sozialen „Partizipati-on“ <strong>in</strong> die<br />
Praxis umzusetzen .<br />
Modul 7 „Wir komponieren e<strong>in</strong>e Lärmoper“<br />
Gefor<strong>der</strong>t wird vor allem die Fähigkeit, „sich und<br />
an<strong>der</strong>e zu motivieren“ . Die Komposition (und Aufführung)<br />
<strong>der</strong> „Lärmoper“ erfor<strong>der</strong>t die Koord<strong>in</strong>ation<br />
unterschiedlichster Aufgaben und die geschickte<br />
Organisation e<strong>in</strong>er Arbeitsteilung, die neben den<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen des Konzepts auch die Vorlieben und<br />
Ideen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Schüler(<strong>in</strong>nen) berücksichtigt .<br />
Frustrationsphasen und <strong>der</strong> Zwang zur Improvisation<br />
müssen bewältigt werden, Führungs- und Spezialistenrollen<br />
s<strong>in</strong>d auszuhandeln und <strong>der</strong> Term<strong>in</strong>druck<br />
e<strong>in</strong>er Eventproduktion muss ausgehalten werden .<br />
Modul 8 „Stummer Dialog - Erfahrungsfeld“<br />
In diesem Modul konzentrieren wir uns auf den Kompetenzaspekt<br />
„Leitbil<strong>der</strong> reflektieren“ . Der Wegfall des<br />
auditiven Kommunikationskanals entspricht zunächst<br />
e<strong>in</strong>er Reduktion unseres alltäglichen Leitsystems und<br />
ersche<strong>in</strong>t als Erschwernis für die zwischenmenschliche<br />
Kommunikation und erst recht für die Verständigung<br />
über das Thema „Lärm“ . Im weiteren Verlauf<br />
des stummen Dialogs eröffnen sich jedoch neue<br />
Wahrnehmungshorizonte . Aus <strong>der</strong> ursprünglichen<br />
E<strong>in</strong>schränkung wird e<strong>in</strong>e Erweiterung unserer S<strong>in</strong>ne<br />
und Reflexionsmöglichkeiten .<br />
Modul 9 „Exkursionen zum unhörbaren Lärm <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>drä<strong>der</strong>“<br />
Die Beschäftigung mit den Auswirkungen des „unhörbaren“<br />
Lärms übt das „vorausschauende Denken“ .<br />
Was kann man tun, um diesen Lärm zu vermeiden?<br />
Da W<strong>in</strong>dkraftanlagen an sich e<strong>in</strong> Beitrag zur <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
s<strong>in</strong>d, zeigt dieses Modul auch, dass es<br />
ke<strong>in</strong>e absolut nachhaltigen Lösungen gibt, son<strong>der</strong>n<br />
bei je<strong>der</strong> Form von Technologie und wirtschaftlicher<br />
Betätigung des Menschen neue Probleme und<br />
nachteilige Wirkungen an an<strong>der</strong>er Stelle des Gesamtsystems<br />
entstehen . Diese E<strong>in</strong>sicht ist die Basis des<br />
vorausschauenden Denkens .<br />
Nun haben Sie e<strong>in</strong>en Überblick über die Dreidimensionalität<br />
des BNE-Generators erhalten (vgl . auch nachstehende<br />
Grafik) und kennen die Herleitung und Positionierung<br />
<strong>der</strong> vorgeschlagenen Bildungsmodule .<br />
Dieses Raster kann Ihnen nicht nur bei <strong>der</strong> Kreation und<br />
Konstruktion von Bildungsmodulen und bei <strong>der</strong> methodischen<br />
Profilierung <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbildung helfen,<br />
son<strong>der</strong>n es lässt sich auch zur Evaluation bestehen<strong>der</strong><br />
Unterrichts- und Bildungskonzepte im Bereich <strong>der</strong> nachhaltigen<br />
Entwicklung e<strong>in</strong>setzen .<br />
Auf S . 13 f<strong>in</strong>den Sie die Gesamtübersicht <strong>der</strong> hier vorgestellten<br />
neun BNE-Unterrichtsmodule <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Matrixdarstellung,<br />
die das Konstruktionspr<strong>in</strong>zip noch e<strong>in</strong>mal<br />
verdeutlicht . Sie werden dabei auch feststellen, dass <strong>in</strong><br />
je<strong>der</strong> Spalte und je<strong>der</strong> Zeile <strong>der</strong> Matrix m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong><br />
Modul vorhanden ist und dass auch alle vier lernpsychologischen<br />
Zugänge gleichmäßig berücksichtigt wurden .<br />
9
H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s Thema<br />
Unabhängig davon, welche Module Sie verwenden wollen,<br />
gibt es verschiedene Möglichkeiten zur H<strong>in</strong>führung<br />
auf das Thema „Lärm“ . E<strong>in</strong> paar Vorschläge:<br />
Diskussionsrunde „Vuvuzela – Hat Paul Breitner<br />
recht?“ Während <strong>der</strong> letzten Fußballweltmeisterschaft<br />
gab es e<strong>in</strong>e größere Diskussion um den Vuvuzela-Lärm <strong>in</strong><br />
den Stadien . Fußball-Legende Paul Breitner beschwerte<br />
sich über die spielzerstörende Wirkung <strong>der</strong> Vuvuzelas<br />
<strong>in</strong> den südafrikanischen WM-Arenen . Das Video se<strong>in</strong>er<br />
Stellungnahme ist unter <strong>der</strong> Adresse www .youtube .com/<br />
watch?v=Ua2iyqKMvk4 im Internet zu f<strong>in</strong>den, es kann<br />
als E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e von <strong>der</strong> Lehrkraft mo<strong>der</strong>ierte Diskussionsrunde<br />
dienen . Dabei wird deutlich werden, wie<br />
verschieden die Wahrnehmung von „Lärm“ ist .<br />
Das Lärmampel-Experiment. Ihre Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler f<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>es Morgens e<strong>in</strong>en H<strong>in</strong>weis auf die<br />
Installation e<strong>in</strong>er Lärmampel auf ihren Tischen . (E<strong>in</strong>e<br />
Vorlage dazu siehe Seite 12 .) Dabei wird über das<br />
gesundheitliche Risiko aufgeklärt, dem Lehrer aufgrund<br />
<strong>der</strong> ständigen Lärmbelastung <strong>in</strong> den Klassenzimmern<br />
ausgesetzt s<strong>in</strong>d . Mit <strong>der</strong> Lärmampel soll getestet werden,<br />
ob die Rückmeldung über den Lärmpegel dazu führt,<br />
dass das „Lärmbewusstse<strong>in</strong>“ <strong>der</strong> Schüler steigt – und<br />
<strong>der</strong> Lärmpegel s<strong>in</strong>kt . Nach e<strong>in</strong>er Woche veranstaltet die<br />
Lehrkraft e<strong>in</strong>e Klassendiskussion über diese Frage .<br />
Lärmampeln s<strong>in</strong>d im Handel erhältlich . Empfehlenswerte<br />
Modelle s<strong>in</strong>d u .a .:<br />
• Lärmampel 77968, Arnulf Betzold GmbH (Ell-wangen), www .<br />
betzold .de, EUR 82,11; mit LED-Leuchten und Akku-Betrieb,<br />
Anzeige mit Smileys, zum Aufhängen, 44 cm hoch; <strong>in</strong> ähnlicher<br />
Ausführung auch bei www .sportco .de, www .lms .de<br />
• Kompakte Lärmampel, PädBoutique (Süstedt), www .paedboutique<br />
.de, EUR 177,31; mit LED-Leuchten und Netzteil, sehr<br />
kompakte Bauweise; Warnton e<strong>in</strong>schaltbar, zum Aufstellen,16<br />
cm hoch<br />
• SoundEar® 2000, Audis Informatik (Bremen), www .soundear .<br />
de, EUR 415,30; sehr viele verschiedene E<strong>in</strong>stellmöglichkeiten,<br />
ke<strong>in</strong>e Ampelsymbolik, son<strong>der</strong>n Ohrdarstellung, sehr ästhetisches<br />
Formdesign, zum Aufstellen, 28 cm hoch<br />
• Pädagogische Lärmampel, ORG-DELTA (Reichen-bach), www .<br />
org-delta .de, EUR 329,00; stabile Ausführung mit Metallgehäuse<br />
und Tischstän<strong>der</strong>, Warnton e<strong>in</strong>schaltbar, 40 cm hoch<br />
• Lärmampel 1001, Easyplay GmbH (Herford), www .laermampel .<br />
de, EUR 236,81, Standfuß EUR 53,55; robuste Ausführung,<br />
Warnton e<strong>in</strong>schaltbar, 33 cm hoch (mit Standfuß 1,51 m)<br />
• Krachampel W-42125, Wiemann Lehrmittel (Schlaitz), www .<br />
wiemann-lehrmittel .de, EUR 136,85; Metallgehäuse, Lautsprecherbuchse,<br />
zum Aufstellen o<strong>der</strong> Hängen, ke<strong>in</strong> Ampeldesign,<br />
son<strong>der</strong>n Display mit Ampel-Smileys, variierbarer Warnton, 34<br />
cm hoch .<br />
10<br />
Im Saarland können <strong>Schule</strong>n sich Lärmampeln auch<br />
ausleihen beim<br />
• Landes<strong>in</strong>stitut für Pädagogik und Medien (LPM),<br />
Anfragen an Harald Zimmer, Fon 06897-7908120,<br />
E-Mail h .zimmer@lpm .uni-sb .de<br />
Die Lärmampeln ermöglichen e<strong>in</strong>e freie E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong><br />
Warngrenzen <strong>in</strong> Dezibel . Nach <strong>der</strong> Arbeitsstättenverordnung<br />
gilt für Büroarbeitsplätze (vorwiegend geistige<br />
Tätigkeiten) e<strong>in</strong> Höchstwert von 55 db (A) . Von Fachleuten<br />
werden daneben folgende Lärmgrenzen empfohlen:<br />
• 5 bis 45 dB (A) bei konzentrierter, überwiegend<br />
geistiger Arbeit<br />
• 40 bis 45 dB (A) bei notwendiger Kommunikation<br />
mit an<strong>der</strong>en und Anfor<strong>der</strong>ung an e<strong>in</strong>e sehr gute<br />
Sprachverständigung .<br />
Ab 80 db (A) s<strong>in</strong>d nach <strong>der</strong> Verordnung Gehörschutzmaßnahmen<br />
erfor<strong>der</strong>lich . Für die E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Lärmampel<br />
im Klassenzimmer s<strong>in</strong>d also z .B . folgende Grenzen<br />
s<strong>in</strong>nvoll:<br />
GRÜN = 0 bis 50 db (A)<br />
GELB = 51 bis 65 db (A)<br />
ROT = über 66 db (A)<br />
E<strong>in</strong>e Lärmampel kann im Klassenzimmer „selbstregulatorische“<br />
Wirkung entfalten<br />
Musikquiz „… nur wenn sie laut ist“ . In e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en<br />
improvisierten Musikquiz werden die Schüler(<strong>in</strong>nen)<br />
aufgefor<strong>der</strong>t, Musikstücke und Interpreten zu nennen,<br />
die mit „laut se<strong>in</strong>“ und „Lärm“ <strong>in</strong> Zusammenhang gebracht<br />
werden können . Dabei soll jeweils die Bedeutung,<br />
die die „Lautstärke“ <strong>in</strong> dem Musikstück hat, reflektiert<br />
werden .<br />
Beispiele s<strong>in</strong>d:<br />
• „Musik nur, wenn sie laut ist“, Herbert Grönemeyer<br />
(1983), Album: „Gemischte Gefühle“; besungen wird<br />
das Lebensgefühl e<strong>in</strong>es tauben Mädchens
• „Lets get loud“, Jennifer Lopez (2000), Album “on<br />
the 6”; die Botschaft: “Life‘s a party, make it hot”<br />
• “Schrei so laut ich kann”, Luxuslärm (2010), Album<br />
„So laut ich kann“; Sehnsucht nach e<strong>in</strong>er heilen<br />
Welt, „die nicht mehr me<strong>in</strong>e ist“, und die Hoffnung,<br />
verstanden zu werden („Geh nicht vorbei, schau<br />
nicht weg, stell dir vor Du bist ich und kommst<br />
alle<strong>in</strong> hier nicht mehr hier raus“)<br />
• „Sign of the Hammer“, Manowar (1985), Album<br />
„Sign of the Hammer“ . Seit <strong>der</strong> Spectacle-of-Might-<br />
Tour 1985 durch Europa beanspruchen Manowar<br />
den Titel „lauteste Band <strong>der</strong> Welt“ für sich . So wurde<br />
am 8 . März 1994 e<strong>in</strong> Schalldruckpegel von 129,5<br />
Dezibel <strong>in</strong> <strong>der</strong> hannoverschen „Music Hall“ (ohne<br />
Publikum) gemessen .<br />
• „S<strong>in</strong>fonie mit dem Paukenschlag“, Joseph Haydn<br />
(1791); Haydns erster Biograph, Georg August Gries<strong>in</strong>ger,<br />
berichtet über das Werk: „Ich fragte Haydn<br />
e<strong>in</strong>st im Scherz, ob es wahr wäre, dass er das Andante<br />
mit dem Paukenschlage komponiert habe, um<br />
die <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Konzert e<strong>in</strong>geschlafenen Englän<strong>der</strong> zu<br />
wecken? ‚Ne<strong>in</strong>‘, erhielt ich zur Antwort, ‚son<strong>der</strong>n es<br />
war mir daran gelegen, das Publikum durch etwas<br />
Neues zu überraschen“ .<br />
• „Well<strong>in</strong>gtons Sieg“, Ludwig van Beethoven (1813);<br />
e<strong>in</strong> s<strong>in</strong>fonisches Schlachtengemälde, für dessen<br />
Aufnahme durch das C<strong>in</strong>c<strong>in</strong>nati Symphony Orchestra<br />
unter Erich Kunzel digital aufgenommene<br />
Kanonenschläge verwendet wurden . Die Discografie<br />
enthält den Warnh<strong>in</strong>weis: „Zu lautes Hören kann<br />
Ihre Lautsprecher zerstören .“<br />
S<strong>in</strong>nvoll ist es, wenn die Lehrkraft die genannten Musikstücke<br />
(und e<strong>in</strong>ige weitere aus eigener Sammlung) parat<br />
hat, um die (auf den e<strong>in</strong>zelnen sicher unterschiedliche)<br />
Wirkung gleich im Klassenraum testen zu können .<br />
11
Unser Klassenzimmer ist zu laut! Wir führen die Lärmampel e<strong>in</strong>!<br />
Deutsche Klassenzimmer s<strong>in</strong>d zu laut . Das ist das nicht nur das Ergebnis von Studien, son<strong>der</strong>n entspricht auch <strong>der</strong> Wahrnehmung<br />
<strong>der</strong> allermeisten Lehrkräfte .<br />
U .a . hat e<strong>in</strong>e größere Untersuchung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen die Raumakustik von Klassenzimmern unter die Lupe genommen<br />
. Bauliche Mängel und das Verhalten <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler <strong>in</strong> den Unterrichtsstunden ließen den Schallpegel<br />
dabei auf bis zu 75 Dezibel ansteigen . Dieser Lärm belastet die Gesundheit <strong>der</strong> Lehrer und senkt die Qualität des Unterrichts<br />
.<br />
Lärm ist e<strong>in</strong> generelles Problem <strong>in</strong> Bildungsstätten . Vier von fünf Lehrern fühlen sich durch von Schülern verursachten<br />
Lärm belastet . Die Unterrichtsstunden beg<strong>in</strong>nen und enden meist laut . Schallpegel unter 50 Dezibel (A) werden zumeist<br />
nur während <strong>der</strong> Stillarbeit erreicht . In an<strong>der</strong>en Arbeitsphasen kommt es zu Schallpegeln um die 75 Dezibel (A) .<br />
Den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Lärm zeigt folgende Tabelle:<br />
dB (A) Subjektives Empf<strong>in</strong>den Geräuschart (Beispiele) Gesundheitliche Wirkung<br />
10 unhörbar Atemgeräusch <strong>in</strong> 30 cm Entfernung<br />
30 sehr leise Flüstern o<strong>der</strong> Ticken e<strong>in</strong>es Weckers<br />
12<br />
sicherer Bereich<br />
40 leise leise Radiomusik mögliche psychische und vegetative<br />
Reaktionen<br />
50 leise Laserdrucker<br />
60 laut normale Unterhaltung (2 m) Beg<strong>in</strong>n vegetativer Schäden<br />
70 sehr laut<br />
80 sehr laut<br />
Schreibmasch<strong>in</strong>e, Matrix- o<strong>der</strong><br />
Typenraddrucker, laute Sprache<br />
Kraftwagen <strong>in</strong> 7 m Entfernung,<br />
starker Straßenverkehr<br />
nervöse Störungen<br />
deutliche vegetative Schäden<br />
90 sehr laut Lastwagen <strong>in</strong> 5 m Distanz gesundheitsgefährden<strong>der</strong> Bereich, Beg<strong>in</strong>n<br />
von Gehörschäden<br />
100 sehr laut Diskothek<br />
110 unerträglich<br />
120 unerträglich<br />
Flugzeugtriebwerk <strong>in</strong> 240 m Entfernung<br />
Flugzeugtriebwerk <strong>in</strong> 30 m Entfernung<br />
gesundheitsschädigen<strong>der</strong> Bereich<br />
Verletzung des Zentralnervensystems<br />
150-180 unerträglich Raketentriebwerk Lähmung und Tod von Organismen<br />
Damit alle <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse – Schüler und Lehrer – besser kontrollieren können, wie laut es tatsächlich ist und wie leise wir<br />
wirklich se<strong>in</strong> können, gibt es ab heute e<strong>in</strong>e Lärmampel <strong>in</strong> unserem Klassenzimmer . Schaut e<strong>in</strong>fach immer wie<strong>der</strong> mal auf<br />
die Ampel, damit ihr seht, ob wir im grünen, schon im gelben o<strong>der</strong> gar im roten Bereich s<strong>in</strong>d! Danke für eure Mithilfe!
Planungsübersicht <strong>der</strong> BNE-Module zum Thema „Lärm“<br />
In <strong>der</strong> untenstehenden Tabelle s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Zeilen die Gestaltungskompetenzen und <strong>in</strong> den Spalten die <strong>in</strong>haltlichen Aspekte<br />
des Begriffs „<strong>Nachhaltigkeit</strong>“ aufgeführt . Die lernpsychologischen Zugänge s<strong>in</strong>d farbig markiert:<br />
• blau = kognitives Lernen, hoher Sachbezug, daten- und faktenbasiertes Vorgehen, technische Zusammenhänge<br />
• grün = praktisches Lernen, Ausprobieren und zum Funktionieren br<strong>in</strong>gen, Organisieren, Bauen<br />
• rot = soziales Lernen, über Themen kommunizieren, Gruppenprozesse organisieren, sich austauschen<br />
• gelb = experimentelles Lernen, kreatives Herangehen, nach neuen Lösungen suchen, sich selbst erleben .<br />
Die leeren Stellen <strong>der</strong> Matrix dürfen Sie gerne herausfor<strong>der</strong>n, neue Komb<strong>in</strong>ationen zu f<strong>in</strong>den und mit Aspekten des Themas<br />
„Lärm“ zu verknüpfen!<br />
Vorausschauendes<br />
Denken<br />
Offenheit für<br />
neue Perspektiven<br />
Interdiszipl<strong>in</strong>äres<br />
Denken<br />
Integration Permanenz Gerechtigkeit Subjektivität Dependenz<br />
Unsere <strong>Schule</strong> braucht<br />
e<strong>in</strong>en Leiseraum<br />
E<strong>in</strong>e Geräusch- und<br />
Lärmsammlung<br />
Die Lärmlandkarte<br />
unserer <strong>Schule</strong><br />
Partizipieren „Gegenlärm“ – Die<br />
goodforears-Disco<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sorientiert<br />
planan<br />
Empathie, Engagement,<br />
Solidarität<br />
Sich und an<strong>der</strong>e<br />
motivieren<br />
Leitbil<strong>der</strong><br />
reflektieren<br />
Brennpunkte des Lärms<br />
im Saarland -<br />
Ausstellung<br />
Wir erstellen e<strong>in</strong>en<br />
Lärmschutzplan<br />
Wir komponieren e<strong>in</strong>e<br />
Lärmoper<br />
Stummer Dialog - Erfahrungsfeld<br />
Exkursionen zum<br />
unhörbaren Lärm <strong>der</strong><br />
W<strong>in</strong>drä<strong>der</strong><br />
13
<strong>Nachhaltigkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> - Konzepte und Beispiele für die Praxis<br />
Bisher s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Reihe erschienen:<br />
Da e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Broschüren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>tversion bereits vergriffen ist, nutzen Sie bitte auch<br />
den kostenlosen PDF-Download unter www .tuwas .net/shop!<br />
14
Modul 1: Brennpunkte des Lärms im Saarland<br />
Lernziel:<br />
Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler erwerben Grundlagen-<br />
wissen über Lärm (Lärmarten, Lärmquellen, Lärmmessung,<br />
Grenzwerte und Lärmschutz), <strong>in</strong>dem sie sich eigenständig<br />
e<strong>in</strong> Bild <strong>der</strong> Lärmsituation im Saarland machen. Im<br />
Saarland wurde 2007 die erste strategische Lärmkartierung<br />
vorgenommen. Derzeit beg<strong>in</strong>nen die zweite Stufe<br />
<strong>der</strong> Kartierung und die Lärmaktionsplanung entsprechend<br />
<strong>der</strong> EU-Umgebungslärm-Richtl<strong>in</strong>ie. Die Informationsbeschaffung<br />
schließt auch die Befragung zuständiger Stellen<br />
e<strong>in</strong>. Der erarbeitete Wissensbestand sollte so aufbereitet<br />
werden (z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Ausstellung), dass das Thema<br />
auch an<strong>der</strong>en Schülern o<strong>der</strong> <strong>in</strong>teressierten Erwachsenen<br />
(z.B. den Eltern) vermittelt werden kann. Außerdem sollten<br />
an<strong>der</strong>e Projektgruppen, die e<strong>in</strong>zelne <strong>der</strong> <strong>in</strong> diesem Heft<br />
beschriebenen Module bearbeiten, ggf. auf die Ergebnisse<br />
von Modul 1 zurückgreifen können.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Ganzheitliche Erfassung <strong>der</strong> Lärmsituation unter<br />
verschiedenen Perspektiven und Darstellung des<br />
Ine<strong>in</strong>an<strong>der</strong>greifens ökonomischer, ökologischer und<br />
sozialer Bed<strong>in</strong>gungen von Lärmproblemen (Integrations-Aspekt)<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Empathie und Engagement gegenüber den von<br />
beson<strong>der</strong>er Lärmemission betroffenen Gruppen;<br />
Diskussion <strong>der</strong> Frage, wie viel Lärm zumutbar ist.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Kognitive, faktenbasierte Erarbeitung e<strong>in</strong>er Wissensgrundlage<br />
zur Lärmsituation im Saarland.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schalwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 7H/M, Biologie: Ökosystem Wald/Wahlthema (Lärmschutz)<br />
ERS 7H/M, Biologie: Ökosystem Stadt und Dorf/Wahlthema<br />
(Lärm)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Das Saarland (Geographischer<br />
Überblick)<br />
GS 9/10, Bildende Kunst: Gebaute Welt<br />
GS 9/10, Allgeme<strong>in</strong>e Ethik: Politischer Aspekt<br />
GYM 7, Erdkunde: Raumwandel <strong>in</strong> städtischen Siedlungen<br />
GYM 7, Erdkunde: Raumwandel durch nachhaltige Nutzung<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 9, Erdkunde: Deutschland (Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur, „Autoland<br />
Saarland“)<br />
GYM 9, Mathematik: Allgeme<strong>in</strong>e S<strong>in</strong>usfunktion (Schallschw<strong>in</strong>gung)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Das Bildungsmodul benötigt für die Informationsbeschaffung<br />
und –verarbeitung m<strong>in</strong>destens 8-10 Unterrichtsstunden,<br />
für die Aufbereitung und Darstellung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
sollte man 6-12 Unterrichtsstunden veranschlagen,<br />
abhängig von <strong>der</strong> gewählten Präsentationsform und dem<br />
Perfektionsanspruch <strong>der</strong> Schülergruppe. Es hängt auch<br />
vom Grad <strong>der</strong> Arbeitsteilung <strong>in</strong> dem Projekt ab (siehe unter<br />
„Ablauf“), wie schnell man zu Ergebnissen kommt. Das<br />
Projekt eignet sich für e<strong>in</strong>e Ausdehnung über mehrere Wochen<br />
o<strong>der</strong> auch Monate, wenn die Verantwortung für das<br />
Projektmanagement geklärt ist und jemand die Fäden <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Hand behält.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Google Earth<br />
• Farbdrucker, ggf. Plotter<br />
• Digitalkamera<br />
• PC-Programme: Bildbearbeitung (z.B. Photoshop),<br />
Word, Excel, Powerpo<strong>in</strong>t<br />
• Für die Ausstellung entsprechende Präsentationsflächen,<br />
Displays etc.<br />
Ablauf:<br />
Da das Modul im Rahmen des projektorientierten Unterrichts<br />
stattf<strong>in</strong>den soll, sollen die Schüler auch <strong>in</strong> die<br />
Planung des methodischen Vorgehens e<strong>in</strong>gebunden werden.<br />
D.h. die Lehrkraft sollte die Organisation des Projekts nicht<br />
vorweg nehmen. Die Schülergruppe wird vielmehr zunächst<br />
nur mit <strong>der</strong> Aufgabenstellung konfrontiert, sich e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die Lärmsituation im Saarland zu verschaffen<br />
und ihre Erkenntnisse so aufzubereiten, dass damit auch<br />
an<strong>der</strong>e (Mitschüler, Lehrer, Eltern etc.) erreicht werden. Die<br />
Schüler(<strong>in</strong>nen) sollen <strong>in</strong> dem Projekt durchaus die Freiheit<br />
haben, eigene Schwerpunkte, Fragestellungen und Interessen<br />
<strong>in</strong> das Projekt e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen, und sie sollen auch vor <strong>der</strong><br />
Herausfor<strong>der</strong>ung stehen, solch e<strong>in</strong> Projekt zu organisieren.<br />
Als Lehrkraft stehen Sie den Schülern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rolle e<strong>in</strong>es<br />
Mo<strong>der</strong>ators und Supervisors zur Verfügung. Sie können<br />
15
<strong>in</strong> dieser Rolle bei Bedarf natürlich auch Anregungen zur<br />
Arbeitsteilung und Projektorganisation geben und e<strong>in</strong>zelne<br />
H<strong>in</strong>weise auf Strukturierungsmöglichkeiten und Informationsquellen<br />
geben. Ihre Hauptaufgabe besteht jedoch<br />
eigentlich nur <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ermutigung <strong>der</strong> Schülergruppe, die<br />
Aufgabe selbstständig zu bearbeiten.<br />
Entsprechend den unterschiedlichen fachlichen und<br />
<strong>in</strong>haltlichen Aspekten des Themas könnte e<strong>in</strong>e Arbeitsteilung<br />
im Projekt z.B. folgen<strong>der</strong>maßen aussehen:<br />
• Die „Ingenieure“-Gruppe beschäftigt sich mit <strong>der</strong><br />
Frage, wie Lärm def<strong>in</strong>iert und gemessen wird<br />
• Das „Geographen“-Team verschafft sich e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die räumliche Verteilung <strong>der</strong> Lärmemissionen<br />
im Saarland und identifiziert die Problemzonen, wie sie<br />
<strong>in</strong> den bisherigen Kartierungen festgestellt wurden<br />
• Die „Mediz<strong>in</strong>er“-Gruppe erarbeitet die gesundheitliche<br />
Problematik <strong>der</strong> Lärme<strong>in</strong>wirkung auf Menschen<br />
und stellt den Stand <strong>der</strong> Grenzwerte-Diskussion dar<br />
• Die „Umweltpolitiker“-Gruppe erkundigt sich über<br />
die geltenden Rechtsvorschriften auf nationaler und<br />
EU-Ebene und f<strong>in</strong>det heraus, wer im Saarland für<br />
Lärmmessung und Lärmschutz zuständig ist bzw. sich<br />
für das Thema engagiert<br />
• Die „Medien“-Crew recherchiert die Berichterstattung<br />
<strong>der</strong> letzten Zeit über das Lärmthema und berät<br />
die an<strong>der</strong>en Gruppen bei <strong>der</strong> Aufbereitung ihrer Ergebnisse<br />
für e<strong>in</strong>e Veröffentlichung o<strong>der</strong> Präsentation.<br />
Sollten nicht genügend Schüler zur Verfügung stehen,<br />
kann auf die Medien-Crew auch verzichtet werden.<br />
Dann wird die Präsentation nach Abschluss <strong>der</strong> Recherchetätigkeiten<br />
von allen Schülern geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong><br />
Angriff genommen.<br />
Aus je<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gruppen wird e<strong>in</strong> Vertreter <strong>in</strong>s Projektmanagement-Team<br />
entsandt, das die Arbeit koord<strong>in</strong>iert und<br />
zu den Meet<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>lädt, bei denen die Gruppen den Stand<br />
ihrer Arbeit berichten.<br />
Sobald die Informationsbeschaffung abgeschlossen ist,<br />
sollte e<strong>in</strong>e Planungsbesprechung darüber stattf<strong>in</strong>den, wie<br />
die Ergebnisse präsentiert werden. Dabei geht es auch um<br />
die Frage, was die e<strong>in</strong>zelnen Gruppenmitglie<strong>der</strong> an ihrer<br />
Recherchetätigkeit beson<strong>der</strong>s motivierend fanden. Die<br />
Präsentation (z.B. <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Ausstellung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong>)<br />
bildet dann den Projektabschluss.<br />
Bei <strong>der</strong> Präsentation <strong>der</strong> Lärmsituation im Saarland<br />
sollten die Schüler(<strong>in</strong>nen) ermutigt werden, auch den<br />
Bezug zu ihrer eigenen (Wohn-)Situation herzustellen.<br />
So könnte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Lärmkarte z.B. e<strong>in</strong> Marker e<strong>in</strong>montiert<br />
werden, <strong>der</strong> den eigenen Wohnort (o<strong>der</strong> den Arbeitsort<br />
e<strong>in</strong>es Elternteils etc.) zeigt und e<strong>in</strong>e persönliche Stellungnahme.<br />
E<strong>in</strong> Beispiel dafür f<strong>in</strong>den Sie unter „Anleitungen<br />
und Arbeitsunterlagen“.<br />
16<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Landesbetrieb für Straßenbau, L<strong>in</strong>denallee 2a, 66538<br />
Neunkirchen, Fon 06821-1000, www.saarland.de/landesbetrieb_strassenbau.htm;<br />
für die Öffentlichkeitsarbeit<br />
verantwortlich ist Klaus Kosok, Fon 06821-<br />
100220, E-Mail s1@lfs.saarland.de; die Zuständigkeit<br />
für den Lärmschutz hat e<strong>in</strong>e eigene<br />
E-Mail-Adresse: laermschutz@lfs.saarland.de.<br />
• Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische<br />
Kommunen (eGo Saar), Talstr. 9, 66119<br />
Saarbrücken, Fon 0681-9264340, www.ego-saar.de;<br />
<strong>der</strong> Zweckverband koord<strong>in</strong>iert die Lärmkartierung im<br />
Saarland; Geschäftsführer ist Wilhelm Schmitt, Fon<br />
0681-9264318, E-Mail wilhelm.schmitt@ego-saar.de.<br />
• M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Energie und Verkehr, Keplerstr.<br />
18, 66117 Saarbrücken, Fon 0681-5014500,<br />
www.saarland.de/m<strong>in</strong>isterium_umwelt_energie_<br />
verkehr.htm; für das Thema „Lärm“ ist das Immissionsschutzreferat<br />
zuständig, Referatsleiter ist Jörg Luxenburger,<br />
Fon 0661-50100, E-Mail j.luxenburger@<br />
umwelt.saarland.de.<br />
• Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, Don-<br />
Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken, Fon 0681-85000,<br />
www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm;<br />
für den Lärmschutz zuständig ist hier Dr. Michael<br />
Penth, Fon 0681-85001316, E-Mail m.penth@lua.<br />
saarland.de.<br />
• DB Projektbau GmbH – Regionalbereich Süd-west,<br />
Schwarzwaldstr. 82, 76137 Karlsruhe, Fon 0761-<br />
2124504; Projektleiter<strong>in</strong> für das Lärmsanierungsprogramm<br />
ist Sab<strong>in</strong>e Weiler, E-Mail sab<strong>in</strong>e.weiler@bahn.<br />
de.<br />
• Bürger<strong>in</strong>itiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und<br />
Umweltverschmutzung, Postfach 1221, 67602<br />
Kaiserslautern, Fon 0631-45610, www.fluglaermkl.de;<br />
Sprecher <strong>der</strong> Initiative ist Patrick Fey, bifluglaerm@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
• Fakultät <strong>der</strong> Universität des Saarlandes, Kirrberger<br />
Str. 100, 66421 Homburg, Fon 06841-160,<br />
www.unikl<strong>in</strong>ikum-saarland.de; für Umweltmediz<strong>in</strong> ist<br />
<strong>der</strong> zuständige Leiter Prof. Dr. med. Axel Buchter, Fon<br />
086141-1626801,<br />
E-Mail amabuc@unikl<strong>in</strong>ikum-saarland.de.<br />
• Amt für Klima- und Umweltschutz, Disconto-Hochhaus,<br />
Bahnhofstr. 31, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-<br />
9054040, www.saarbruecken.de/de/leben_<strong>in</strong>_<br />
saarbruecken/umwelt/laerm; zuständig für Lärmschutz<br />
ist Thomas Bouillon, Fon 0681-9054186,<br />
E-Mail thomas.bouillon@saarbruecken.de.<br />
• GSB GbR Gier<strong>in</strong>g & Lehnertz, Kastanienweg 24,<br />
66625 Nohfelden-Bosen, Fon 06782-171107; Prof.<br />
Dr. Kerst<strong>in</strong> Gier<strong>in</strong>g ist fachlich an <strong>der</strong> Lärmaktionsplanung<br />
<strong>der</strong> Landeshauptstadt Saarbrücken beteiligt,<br />
E-Mail k.gier<strong>in</strong>g@gsb-gbr.de.
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
An die meisten Informationen zum Thema kommt man im<br />
Internet bzw. durch Experten<strong>in</strong>terviews. Folgende Literatur<br />
ist für die Aneignung von Grundlagen- und Übersichtswissen<br />
geeignet:<br />
• Jürgen H. Maue, 0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 Dezibel –<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Grundbegriffe und die quantitative<br />
Erfassung des Lärms, 2009, 196 S., EUR 24,80<br />
• Lilo Cross, Die heimlichen Krankmacher, 2009, 288 S.,<br />
EUR 8,95<br />
E<strong>in</strong>e umfassende Publikationsliste zum Thema „Lärm“ enthält<br />
folgende Website des Umweltbundesamts:<br />
www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/publikationen.html.<br />
Beispiel für die Präsentation <strong>der</strong> Lärmsituation – Verknüpfung <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Situation mit <strong>in</strong>dividueller<br />
Betroffenheit<br />
17
Modul 2: Unsere <strong>Schule</strong> braucht e<strong>in</strong>en Leiseraum<br />
Lernziel:<br />
Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler eruieren die Möglichkeiten,<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> e<strong>in</strong>en speziellen Raum e<strong>in</strong>zurichten, <strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen „Lärmhygiene“ dient. E<strong>in</strong> solcher „Leiseraum“<br />
kann verschiedene Funktionen haben. Die Aufgabe<br />
für die Schüler ist sowohl e<strong>in</strong>e konzeptionelle als auch<br />
e<strong>in</strong>e kommunikative. Die Diskussion darüber, wie <strong>der</strong> Leiseraum<br />
aussehen und wie er genutzt werden könnte, wird<br />
begleitet durch die Befragung von Schülern und Lehrern,<br />
um den Bedarf und das Interesse an e<strong>in</strong>em Leiseraum zu<br />
erheben. Implizit beschäftigen sich die Schüler(<strong>in</strong>nen) <strong>in</strong><br />
dem Projekt natürlich auch mit <strong>der</strong> Frage, was stören<strong>der</strong><br />
Lärm ist und wie groß ihr Bedürfnis nach lärmfreien<br />
Zonen <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> ist.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Der Permanenz-Gedanke, also die präventive E<strong>in</strong>stellung<br />
zu Umweltfaktoren, steht im Mittelpunkt<br />
des Moduls. Lärm ist nicht nur e<strong>in</strong>e punktuelle und<br />
zeitweise Belastung. Durch die Beschäftigung mit<br />
dem Leiseraum wird auch die Erkenntnis vermittelt,<br />
dass alternative Erfahrungsräume das Bewusstse<strong>in</strong><br />
für die weitreichenden Auswirkungen von Umweltbelastungen<br />
erzeugen können.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Das Modul schult die Offenheit für neue Perspektiven,<br />
denn e<strong>in</strong> Leiseraum stellt völlig neue Erfahrungsmöglichkeiten<br />
dar, die antizipiert und reflektiert<br />
werden.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Kommunikative und soziale Kompetenzen s<strong>in</strong>d<br />
nötig, um die Idee e<strong>in</strong>es Leiseraums <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
bekannt zu machen und e<strong>in</strong>e möglichst große Beteiligung<br />
an <strong>der</strong> Konzeption zu erreichen.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 6/7/8, Deutsch: Sprechen (Interview)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Unsere <strong>Schule</strong><br />
GYM 6, Deutsch: Sprechen und Schreiben (Interview)<br />
GYM 8, Deutsch: Texte und Medien (Interview)<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
18<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Für das Bildungsmodul benötigen Sie zwischen 12 und 20<br />
Unterrichtsstunden. Bedenken Sie, dass die Realisierung<br />
des Leiseraums selbst nicht mehr Bestandteil des Moduls<br />
ist. Je nach dem Aufwand für die Konzeptpräsentation<br />
variiert auch die e<strong>in</strong>zusetzende Unterrichtszeit. Auch durch<br />
den Grad <strong>der</strong> Arbeitsteilung (siehe unter „Ablauf“) wird <strong>der</strong><br />
Zeitaufwand bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Digitalkamera<br />
• MD-Recor<strong>der</strong> mit Mikrofon o<strong>der</strong> Handy mit Aufnahmefunktion<br />
• PC-Programme: Word, Excel, Powerpo<strong>in</strong>t<br />
• Für e<strong>in</strong>e eventuelle Ausstellung entsprechende Präsentationsflächen,<br />
Displays etc.<br />
Ablauf:<br />
Als spezifische E<strong>in</strong>führung kann <strong>der</strong> im Anleitungsteil (am<br />
Ende <strong>der</strong> Modulbeschreibung) abgedruckte kurze Lärmfragebogen<br />
dienen. Mit ihm läßt sich die subjektive Verschiedenheit<br />
von Lärmempf<strong>in</strong>dungen sowie die Lärmsituation im<br />
Schulunterricht thematisieren. Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler<br />
werden außerdem gefragt, was sie von e<strong>in</strong>em eigenen<br />
Leiseraum <strong>in</strong> ihrer <strong>Schule</strong> halten. Auch wenn nach diesem<br />
Fragebogen und e<strong>in</strong>er kurzen Auswertungsdiskussion das<br />
Interesse an e<strong>in</strong>em Leiseraum nicht groß ist, kann die Lehrkraft<br />
<strong>der</strong> Klasse die Aufgabe stellen: „F<strong>in</strong>det heraus, wie<br />
die an<strong>der</strong>en Schüler an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> (und die Lehrer) über<br />
die Idee e<strong>in</strong>es Leiseraums denken! Entwerft dann e<strong>in</strong>en<br />
solchen Leiseraum, <strong>der</strong> euren Vorstellungen sowie denen<br />
eurer Mitschüler entspricht!“ Die Auswertung des kle<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>führungsfragebogens <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse sollten Sie übrigens<br />
ruhig e<strong>in</strong>er Gruppe von drei o<strong>der</strong> vier Schülern überlassen.<br />
Für die nun folgende Aktionsphase ist es empfehlenswert,<br />
drei Gruppen zu bilden:<br />
1. die Befragungsgruppe entwirft den Fragebogen zum<br />
Leiseraum<br />
2. die Organisationsgruppe macht sich Gedanken über<br />
die Durchführung <strong>der</strong> Befragung und die Auswertung.<br />
3. die Konzeptgruppe macht sich erste Gedanken, wie <strong>der</strong><br />
Leiseraum ausgestattet se<strong>in</strong> sollte und wie er benutzt<br />
werden kann; <strong>in</strong> dieser Gruppe sollten vor allem diejenigen<br />
Schüler(<strong>in</strong>nen) mitarbeiten, die bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stiegsbefragung<br />
bereits Interesse an e<strong>in</strong>em Leiseraum<br />
gezeigt haben.
Die Befragung kann sowohl durch Ausgabe von Fragebogen<br />
als auch mit Hilfe e<strong>in</strong>es Onl<strong>in</strong>e-Tools realisiert werden.<br />
(E<strong>in</strong> kostenloses Onl<strong>in</strong>e-Fragebogen-Programm ist z.B.<br />
http://de.surveymonkey.com.) Für die Verbesserung <strong>der</strong><br />
Rücklaufquote ist es empfehlenswert, <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schulklassen die Erlaubnis zu bekommen, den Fragebogen<br />
während e<strong>in</strong>er Schulstunde gesammelt zu bearbeiten. Das<br />
geht auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Onl<strong>in</strong>e-Variante z.B. im Informatikunterricht,<br />
wenn je<strong>der</strong> Schüler vor e<strong>in</strong>em PC sitzt.<br />
Die Konzeptgruppe wird u.a. vor folgenden Fragen stehen:<br />
• Welche Bedürfnisse <strong>der</strong> Schüler sprechen für die E<strong>in</strong>richtung<br />
e<strong>in</strong>es Leiseraums?<br />
• Wie sollte <strong>der</strong> Raum ausgestattet werden?<br />
• Welcher Raum <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> käme grundsätzlich <strong>in</strong><br />
Betracht?<br />
• In welcher Weise sollte <strong>der</strong> Raum eventuell schallgedämmt<br />
werden?<br />
• Wie kann man den Raum benutzen?<br />
Für die Konzeption dürften zwei Aspekte beson<strong>der</strong>s bedeutsam<br />
se<strong>in</strong>:<br />
1. Die Funktion des Raums als chill out room für Schüler<br />
und die Frage, welche Regeln für die Benutzung gelten<br />
sollen<br />
2. Die Nutzung des Raumes für spezielle (angeleitete)<br />
Übungen – z.B. zur Entspannung o<strong>der</strong> zur Sensibilisierung<br />
des Hörens sowie zum aktiven Zuhören. Als<br />
Lehrkraft sollten Sie die Gruppe ggf. darauf aufmerksam<br />
machen, dass die Fähigkeit, Stille auszuhalten und<br />
sich nonverbal zu verständigen, die Kompetenz des<br />
Zuhörens und Verstehens för<strong>der</strong>t.<br />
Bauste<strong>in</strong> 17 <strong>der</strong> folgenden Unterrichtshilfe <strong>der</strong> BZgA gibt<br />
Anregungen und Anleitungen für solche Übungen:<br />
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung<br />
(BZgA), Lärm und Gesundheit. Materialien für die<br />
Klassen 5 bis 10, 2008, 230 S., kostenlos zu beziehen<br />
bei <strong>der</strong> BZgA (or<strong>der</strong>@bzga.de); e<strong>in</strong>e PDF-Version steht<br />
zum Download von <strong>der</strong> Infomaterialien-Seite unter<br />
www.bzga.de bereit; die Pr<strong>in</strong>tversion enthält zusätzlich<br />
e<strong>in</strong>e Audio-CD und e<strong>in</strong>e DVD<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Grundschulen hat die Stiftung Zuhören das<br />
Konzept <strong>der</strong> „Hörclubs“ entwickelt. Das Konzept ließe sich<br />
auch auf die höheren Schulstufen übertragen – e<strong>in</strong>e Aufgabe,<br />
<strong>der</strong> sich e<strong>in</strong>e ehrgeizige Konzeptionsgruppe stellen<br />
könnte. Informationen über die Hörclubs f<strong>in</strong>det man hier:<br />
• www.zuhoeren.de/projekte/k<strong>in</strong><strong>der</strong>-und-jugend/<br />
hoerclubs/keyfacts.html<br />
• Erich Hotter/Josef Zollneritsch, Lärm <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong>.<br />
E<strong>in</strong> Arbeitsbuch, 2008, 174 S., EUR 14,50<br />
• Volker Bernius/Margarete Imhof, Zuhörkompetenz <strong>in</strong><br />
Unterricht und <strong>Schule</strong>. Beiträge aus Wissenschaft<br />
und Praxis, 2010, 214 S., EUR 24,90.<br />
Nachdem die Befragungs- und Organisationsgruppe die<br />
Befragungsergebnisse ausgewertet haben, präsentieren sie<br />
sie <strong>der</strong> Konzeptgruppe. Geme<strong>in</strong>sam versuchen die Schüler<br />
danach die Konzeption e<strong>in</strong>es Leiseraums zu konkretisieren.<br />
Das Ergebnis kann als Powerpo<strong>in</strong>t-Präsentation, als Wandzeitung<br />
o<strong>der</strong> als kle<strong>in</strong>e Ausstellung <strong>der</strong> Schulöffentlichkeit<br />
zur Verfügung gestellt werden. Falls das Projekt zu konkreten<br />
Überlegungen führt, tatsächlich e<strong>in</strong>en Leiseraum <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Schule</strong> zu planen, sollte dies natürlich weiterh<strong>in</strong> unter<br />
E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> Schüler(<strong>in</strong>nen) geschehen.<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Landesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft für Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
Saarland e.V. (LAGS), Feldmannstr. 110, 66119 Saarbrücken,<br />
Fon 0681-9761970, www.lags.de; Geschäftsführer<br />
ist Franz Gigout, Fon 0681-97619710 , E-Mail<br />
gigout@lags.de<br />
• Stiftung Zuhören, c/o Bayerischer Rundfunk Rundfunkplatz<br />
1, 80335 München, Fon 089-59001226,<br />
www.zuhoeren.de; Vorsitzende ist Marion Glück-Levi,<br />
sie leitet die Bildungsprojekte Hörfunk beim Bayerischen<br />
Rundfunk, E-Mail marion.glueck-levi@brnet.de<br />
• Pan Akustik GmbH, Brenschelbacherstr. 8, 66440<br />
Blieskastel, Fon 06844-991620, www.panakustik.de;<br />
das Ingenieurbüro beschäftigt sich mit Schallschutz;<br />
Geschäftsführer ist Thomas Kle<strong>in</strong>, E-Mail<br />
t.kle<strong>in</strong>@panakustik.de.<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
E<strong>in</strong>stiegsfragebogen zum Lärm – dient als H<strong>in</strong>führung zum<br />
Thema, erstes Me<strong>in</strong>ungsbild und Vorbereitung <strong>der</strong> Arbeitsteilung<br />
<strong>in</strong> den Teams.<br />
19
Ist unsere <strong>Schule</strong> zu laut? - Fragebogen<br />
Bitte beantworte folgende Fragen, ohne allzu lang nachzudenken. Der Fragebogen soll nur e<strong>in</strong>e erste E<strong>in</strong>schätzung des<br />
subjektiven Lärmempf<strong>in</strong>dens ermöglichen. Mach die Ohren zu: Sei ehrlich und lass dich nicht von de<strong>in</strong>en Mitschülern<br />
bee<strong>in</strong>flussen!<br />
Wann b<strong>in</strong> ich am lärmempf<strong>in</strong>dlichsten?<br />
(Du kannst mehrere Kreuze machen.)<br />
Ist es dir manchmal <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> zu laut?<br />
(Du kannst mehrere Kreuze machen.)<br />
Wenn du dich mit de<strong>in</strong>en Freunden vergleichst, bist<br />
du dann eher…<br />
Falls es <strong>in</strong> de<strong>in</strong>er <strong>Schule</strong> e<strong>in</strong>en Raum gäbe, <strong>in</strong> dem es<br />
garantiert leise zugeht, was würdest du tun?<br />
(Du kannst mehrere Kreuze machen.)<br />
20<br />
morgens, vor dem Aufstehen<br />
beim Frühstück<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
wenn ich etwas lese<br />
wenn ich mich konzentrieren muss<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er großen Gruppe<br />
wenn ich schlafen will<br />
eigentlich b<strong>in</strong> ich nie lärmempf<strong>in</strong>dlich<br />
ne<strong>in</strong>, nie<br />
manchmal <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse<br />
auf dem Pausenhof<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Turnhalle<br />
beim Mittagessen<br />
lärmempf<strong>in</strong>dlicher als die meisten<br />
an<strong>der</strong>en<br />
weniger lärmempf<strong>in</strong>dlich als die an<strong>der</strong>en<br />
würde nicht h<strong>in</strong>gehen<br />
würde h<strong>in</strong>gehen, um mal <strong>in</strong> Ruhe<br />
abzuhängen<br />
würde h<strong>in</strong>gehen, um Hausaufgaben zu machen<br />
o<strong>der</strong> zu lesen<br />
würde alle<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>gehen, um mal abzuschalten<br />
würde mit me<strong>in</strong>en Freunden h<strong>in</strong>gehen
Modul 3: Wir erstellen e<strong>in</strong>en Lärmschutzplan<br />
Lernziel:<br />
Dieses Modul kann mit den Modulen 1 und 5 komb<strong>in</strong>iert<br />
werden. Im Gegensatz zu Modul 1 beschäftigt sich Modul<br />
3 mehr mit <strong>der</strong> Situation <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> und <strong>der</strong>en Umfeld.<br />
Während <strong>in</strong> Modul 5 stärker die Lärm-Messtechnik im<br />
Vor<strong>der</strong>grund steht, geht es <strong>in</strong> Modul 3 vor allem um die<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Lärmm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung und des Lärmschutzes.<br />
Die Schüler(<strong>in</strong>nen) lernen diese Möglichkeiten sowohl von<br />
<strong>der</strong> technischen wie auch von <strong>der</strong> rechtlichen und gesellschaftspolitischen<br />
Seite kennen. Sie verb<strong>in</strong>den das Thema<br />
Lärmschutz mit ihrer eigenen Lebenswelt und engagieren<br />
sich praktisch für Maßnahmen, die im Schulbereich realisierbar<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Der Schutz vor krankmachendem Lärm ist e<strong>in</strong> Aspekt<br />
<strong>der</strong> Gerechtigkeit, die sich im <strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriff<br />
auch auf die Exposition gegenüber negativen<br />
Umwelte<strong>in</strong>wirkungen bezieht.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Da die schädlichen Auswirkungen von Lärm auf den<br />
Menschen oft nicht sofort sichtbar werden, son<strong>der</strong>n<br />
sich erst langfristig bemerkbar machen, ist Lärmschutz<br />
e<strong>in</strong>e Aufgabe für nachhaltigkeitsorientiertes,<br />
vorausschauendes Planen.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Praktisch-organisatorische Aspekte stehen <strong>in</strong> diesem<br />
Modul im Vor<strong>der</strong>grund. Es geht um Vorschriften,<br />
Verfahren, praktische Maßnahmen und <strong>der</strong>en<br />
Kontrolle<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 7H/M, Biologie: Ökosystem Stadt und Dorf/Wahlthema<br />
(Lärm)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Unsere <strong>Schule</strong><br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Mitwirkung und<br />
Mitbestimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
GS 9/10, Allgeme<strong>in</strong>e Ethik: Politischer Aspekt<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 9, Mathematik: Allgeme<strong>in</strong>e S<strong>in</strong>usfunktion (Schallschw<strong>in</strong>gung)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Dieses Unterrichtsmodul benötigt 8 bis 12 Unterrichtse<strong>in</strong>heiten.<br />
Es kann durch Komb<strong>in</strong>ation mit den Modulen 1<br />
und/o<strong>der</strong> 5 auch zeitlich erweitert werden. Falls <strong>in</strong> diesem<br />
Modul selbst Lärmmessungen vorgenommen werden, ist<br />
dafür natürlich e<strong>in</strong> zusätzlicher Zeitbedarf <strong>in</strong> Rechnung zu<br />
stellen.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Digitalkamera<br />
• PC-Programme: Word, Excel, Powerpo<strong>in</strong>t<br />
• ggf. Lärmmessgerät (siehe unten)<br />
• ggf. MD-Rekor<strong>der</strong> mit Mikrofon o<strong>der</strong> digitale Videokamera<br />
für Interviews<br />
Ablauf:<br />
Zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> dieses Modul kann z.B. e<strong>in</strong> „Lärmwettbewerb“<br />
veranstaltet werden (falls e<strong>in</strong> Lärmmessgerät zur<br />
Verfügung steht). E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Variante wäre e<strong>in</strong>e Gruppendiskussion<br />
zum Thema „Wo ist es <strong>in</strong> unserer <strong>Schule</strong> am<br />
lautesten?“<br />
Der Lärmwettbewerb stellt kle<strong>in</strong>e Schülerteams aus 3-4<br />
Schülern vor die Aufgabe, spontan Ideen zu entwickeln,<br />
wie sie möglichst viel Lärm machen können. Erlaubt ist<br />
nur <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satz des eigenen Körpers, es dürfen also ke<strong>in</strong>e<br />
Gegenstände verwendet werden. Jede Gruppe hat für ihren<br />
Auftritt 10 Sekunden Zeit. Zur Vorbereitung sollten 10<br />
M<strong>in</strong>uten ausreichen. Das Schallmessgerät sollte auf e<strong>in</strong>em<br />
Stativ montiert se<strong>in</strong>. Der Abstand zwischen dem Messgerät<br />
und den Probanden muss festgelegt werden, um gleiche<br />
Ausgangsbed<strong>in</strong>gungen herzustellen; er sollte e<strong>in</strong> bis zwei<br />
Meter betragen, wobei sich im Schallfeld zwischen Messgerät<br />
und Probanden ke<strong>in</strong>e Gegenstände bef<strong>in</strong>den dürfen.<br />
Die übrigen Schüler <strong>der</strong> Klasse sollten sich im maximalen<br />
Abstand zu den Probanden bef<strong>in</strong>den; je<strong>der</strong> Schüler muss<br />
während des gesamten Versuches Ohrenstöpsel tragen, da<br />
durchaus kurzzeitige Lautstärken von über 100 Dezibel erreicht<br />
werden können. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Gruppen werden<br />
auf e<strong>in</strong>er Skala e<strong>in</strong>getragen, die Vergleichswerte enthält<br />
(siehe unter „Anleitungen und Arbeitsunterlagen“).<br />
Falls Ihnen <strong>der</strong> Lärmwettbewerb zu aufwendig ersche<strong>in</strong>t,<br />
veranstalten Sie e<strong>in</strong>e kurze Gruppendiskussion zum Thema<br />
„Wo ist es <strong>in</strong> unserer <strong>Schule</strong> am lautesten?“ Sie können die<br />
Diskussion mit e<strong>in</strong>er Quizfrage e<strong>in</strong>leiten: Je<strong>der</strong> Schüler<br />
und jede Schüler<strong>in</strong> kann e<strong>in</strong>en Tipp abgeben, wo und wann<br />
21
es se<strong>in</strong>er/ihrer Me<strong>in</strong>ung nach <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> am lautesten<br />
ist. Diese Tipps werden auf e<strong>in</strong>em Plakat gesammelt und<br />
können später mit e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Messaktion überprüft werden.<br />
Nachdem die Tipps abgegeben wurden, dreht sich die<br />
von <strong>der</strong> Lehrkraft mo<strong>der</strong>ierte Diskussion um die Frage, ob<br />
<strong>der</strong> Schullärm als problematisch empfunden wird. Hierbei<br />
kann auch die Situation im Umfeld <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> betrachtet<br />
werden, falls sich dort ebenfalls relevante Lärmquellen<br />
bef<strong>in</strong>den. Auch e<strong>in</strong>e Ausdehnung <strong>der</strong> Diskussion auf den<br />
häuslichen Bereich <strong>der</strong> Schüler sollte nicht ausgeschlossen<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Das eigentliche Unterrichtsmodul beg<strong>in</strong>nt mit <strong>der</strong> Aufgabenstellung:<br />
„F<strong>in</strong>det heraus, wo im Schulbereich Lärmm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
o<strong>der</strong> Lärmschutz angebracht o<strong>der</strong> möglich wäre und<br />
macht konkrete Vorschläge für e<strong>in</strong>en solchen ‚Lärmschutzplan‘!“<br />
Dazu sollten zwei Gruppen gebildet werden:<br />
1. Die „Feldforscher“ durchleuchten die <strong>Schule</strong> unter<br />
Lärmaspekten, sie f<strong>in</strong>den Punkte, die beson<strong>der</strong>s laut<br />
s<strong>in</strong>d, sie fragen Mitschüler, wo es ihnen zu laut ist und<br />
verifizieren dabei ggf. auch die Tipps aus <strong>der</strong> Gruppendiskussion<br />
(E<strong>in</strong>führungsphase, siehe oben)<br />
2. Die „Planer“ <strong>in</strong>formieren sich über die geltenden<br />
Vorschriften des Lärmschutzes, über die rechtliche<br />
Situation, die gesundheitlichen Erkenntnisse und die<br />
Grenzwerte-Diskussion sowie technische Möglichkeiten<br />
des Lärmschutzes. Sie f<strong>in</strong>den heraus, auf welcher<br />
Basis Lärmm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspläne erstellt werden. Sobald<br />
die „Feldforscher“ Ergebnisse haben, lassen sich die<br />
„Planer“ berichten und entwickeln Vorschläge für e<strong>in</strong>en<br />
Lärmschutzplan <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong>.<br />
Wenn die Motivation ausreicht, wendet sich die Klasse mit<br />
ihren Vorschlägen zum Lärmschutz an die Schulleitung, die<br />
Eltern und die Mitschüler.<br />
Empfehlenswert ist es, wenn die Feldforscher-Gruppe e<strong>in</strong>en<br />
Grundriss des Schulhauses und des Schulgeländes für die<br />
Dokumentation ihrer Erkenntnisse verwendet. Falls e<strong>in</strong><br />
Messgerät vorhanden ist, kann an neuralgischen Lärmpunkten<br />
auch e<strong>in</strong> Messverlauf protokolliert werden. Die Befragung<br />
von Mitschülern (und Lehrern!), um herauszuf<strong>in</strong>den,<br />
wo diese es zu laut f<strong>in</strong>den, kann relativ formlos stattf<strong>in</strong>den,<br />
<strong>in</strong>dem die Antworten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Liste e<strong>in</strong>getragen werden, die<br />
man h<strong>in</strong>terher auswertet. Wenn die technische Ausstattung<br />
vorhanden ist, um Interviews zu machen, ist es reizvoll,<br />
auch Orig<strong>in</strong>altöne <strong>der</strong> Befragung aufzunehmen.<br />
Quellenh<strong>in</strong>weise für die Planer-Gruppe:<br />
Lärmschutzvorschriften, Grenzwerte<br />
• Unter www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html<br />
wird die Umgebungslärmrichtl<strong>in</strong>ie ausführlich erläutert;<br />
u.a. f<strong>in</strong>det man hier die Übersicht <strong>der</strong> Grenzwerte,<br />
die für das Auslösen von Lärmaktionsplänen gelten:<br />
22<br />
Handlungsziel Zeitrahmen<br />
Vermeidung<br />
e<strong>in</strong>er Gesundheitsgefährdung<br />
M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
erheblicher<br />
Belästigung<br />
Vermeidung<br />
erheblicher<br />
Belästigung<br />
kurzfristig<br />
notwendig<br />
mittelfristig<br />
notwendig<br />
Langfristig<br />
notwendig<br />
Grenzwert<br />
Tag<br />
• Die Umgebungslärmrichtl<strong>in</strong>ie gilt jedoch nicht für<br />
Arbeitsstätten – unter die <strong>der</strong> Vergleichbarkeit halber<br />
auch <strong>Schule</strong>n zu rechnen s<strong>in</strong>d. Arbeitsstätten unterliegen<br />
<strong>der</strong> Arbeitsstättenverordnung (http://bundesrecht.<br />
juris.de/arbst_ttv_2004/<strong>in</strong>dex.html). Früher enthielt<br />
diese Verordnung e<strong>in</strong>en Grenzwert für „überwiegend<br />
geistige Tätigkeiten“ (55 dB(A)), heute haben Arbeitgeber<br />
mehr Spielraum durch die Formulierung: „In<br />
Arbeitsstätten ist <strong>der</strong> Schalldruckpegel so niedrig zu<br />
halten, wie es nach <strong>der</strong> Art des Betriebes möglich ist.“<br />
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz empfiehlt für<br />
Bildschirmarbeitsplätze e<strong>in</strong>en Richtwert von 45dB(A).<br />
Auch die DIN EN ISO 11690 gibt Anhaltsunkte mit<br />
folgenden Richtwerten:<br />
Schalldruck dB(A) Tätigkeit<br />
Grenzwert<br />
Nacht<br />
65 dB(A) 55 dB(A)<br />
60 dB(A) 50 dB(A)<br />
55 dB(A)<br />
45 dB(A)<br />
35-40 Sehr hohe Konzentration<br />
(wissenschaftliches Arbeiten,<br />
Programmieren, anspruchsvolle<br />
Sachbearbeitung)<br />
35-45 Konzentrierte, überwiegend<br />
geistige Arbeit<br />
40-45 Kundenkommunikation, Notwendigkeit<br />
genauer sprachlicher<br />
Verständigung<br />
40-50 Gewerbliche Bildschirmarbeit,<br />
Callcenter etc.<br />
45-55 Rout<strong>in</strong>emäßige Büroarbeit<br />
max. 55 Vorwiegend geistige Tätigkeiten<br />
ohne hohe Anfor-<strong>der</strong>ungen an<br />
Konzentration und sprachliche<br />
Kommunikation<br />
max. 70 E<strong>in</strong>fache o<strong>der</strong> mechanisierte<br />
Bürotätigkeiten (heute kaum<br />
mehr üblich)<br />
Lärmschutz, Gesundheit<br />
• Unter www.saarland.de/dokumente/<br />
thema_immissionsschutz/ULR-Geme<strong>in</strong>den-<br />
15042010-1.pdf <strong>in</strong>formiert e<strong>in</strong> Powerpo<strong>in</strong>t-Vortrag
über den aktuellen Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Umgebungslärmrichtl<strong>in</strong>ie<br />
im Saarland<br />
• Unter www.laermkartierung-saarland.de/laermsl/<br />
themen/INFO_SL.html bekommt man e<strong>in</strong>en vollständigen<br />
und detaillierten Überblick <strong>der</strong> Lärmkartierung<br />
und Lärmschutzprogramme im Saarland, soweit es<br />
den Umgebungslärm betrifft<br />
• Unter www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf/<br />
projekte_laerm.htm ist e<strong>in</strong> schulisches Aktionskonzept<br />
„Lernen unter Lärme<strong>in</strong>fluss“ dokumentiert, das für<br />
unser Modul etliche praktische Anregungen enthält<br />
• Technische Aspekte des Lärmschutzes <strong>in</strong> <strong>Schule</strong>n<br />
behandelt die ansprechend gestaltete Broschüre aus<br />
Hessen, www.best-news.de/file.php4?laermm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung.<br />
pdf&dir=menu2%2F zum Download bereit steht.<br />
Im Unterrichtsmodul „Lärmschutzplan“ ist bewusst offen<br />
gelassen, ob die Empfehlungen <strong>der</strong> Projektgruppe eher <strong>in</strong><br />
Richtung technischer Maßnahmen o<strong>der</strong> organisatorischer<br />
Verän<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong> verhaltensbezogener Alternativen<br />
gehen. Meist wird es e<strong>in</strong> Mix aus allen drei Aspekten se<strong>in</strong>.<br />
Als Lehrkraft sollten Sie darauf achten, dass die Schüler<br />
sich nicht zu früh e<strong>in</strong>seitig auf e<strong>in</strong>e Betrachtungsebene<br />
festlegen.<br />
In diesem Modul ist es nicht unbed<strong>in</strong>gt erfor<strong>der</strong>lich,<br />
dass Ihren Schülern Schallmessgeräte zur Verfügung<br />
stehen. (An<strong>der</strong>s <strong>in</strong> Modul 5, siehe dort.) Wenn Sie über<br />
ke<strong>in</strong>e Messtechnik verfügen, stützt sich das Projekt auf<br />
die subjektiven E<strong>in</strong>schätzungen und Beobachtungen <strong>der</strong><br />
Projektgruppe, die durch e<strong>in</strong>e systematisierte Befragung<br />
mehrerer Klassen auf e<strong>in</strong>e breitere Basis gestellt werden<br />
können. Das Muster e<strong>in</strong>es entsprechenden kle<strong>in</strong>en<br />
Fragebogens f<strong>in</strong>den Sie im Anleitungsteil dieser Modulbeschreibung<br />
(siehe unten).<br />
Das Sortiment <strong>der</strong> Schallpegelmesser reicht vom e<strong>in</strong>fachen<br />
Übersichtsmessgerät bis zu sogenannten <strong>in</strong>tegrierenden<br />
Präzisions-Schallpegelmessern mit verschiedenen<br />
Erweiterungsmöglichkeiten und Echtzeit-Frequenzanalysatoren.<br />
„Integrierend“ bedeutet, dass die Geräte zeitliche<br />
Mittelwerte bilden können. Manche Geräte verfügen<br />
über Datenlogger, also Datenspeicher, mit denen auch<br />
Langzeitaufnahmen von Schallquellen gemacht werden<br />
können. Unterschieden werden Messgeräte <strong>der</strong> Klassen 1<br />
und 2. Klasse 1-Geräte haben e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Messwertabweichung,<br />
messen also genauer und umfassen auch e<strong>in</strong>en<br />
größeren Messbereich. Als Zusatzausstattung benötigt<br />
man für aussagekräftige Schallmessungen e<strong>in</strong> Stativ,<br />
Schnittstellen zur Datenerfassung und unter Umständen<br />
auch e<strong>in</strong> Kalibriergerät.<br />
E<strong>in</strong>e gute Alternative zur Anschaffung e<strong>in</strong>es Schallpegelmessgeräts<br />
ist die Ausleihe. Umweltämter und –m<strong>in</strong>isterien<br />
sowie Verbände und Initiativen sowie <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen<br />
auch Hersteller, Händler und Ingenieurbüros bieten<br />
<strong>Schule</strong>n ausleihbare Geräte an (Adressen siehe unter<br />
„Potenzielle Partner“).<br />
Falls Sie nicht selbst Physik unterrichten, sollten Sie<br />
für die Messgeräteauswahl und die E<strong>in</strong>weisung <strong>in</strong> den<br />
Umgang mit den Messgeräten e<strong>in</strong>en Kollegen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
externe Fachkraft um Unterstützung bitten.<br />
Kle<strong>in</strong>es Universalgerät PCE-222 für<br />
Schall-, Beleuchtungsstärke, Temperatur<br />
und Luftfeuchtemessung, Messbereich<br />
35-130 db, Kostenpunkt ca. 60 Euro<br />
Schallpegelmessgerät PCE-322 A<br />
Schallmessgerät zur re<strong>in</strong>en Messung o<strong>der</strong><br />
zur Langzeitaufnahme, Messbereich 30-<br />
130 db, Kostenpunkt ca. 130 Euro<br />
Schallpegelmessgerät PCE-318 <strong>der</strong><br />
Klasse 2, Messbereich 26-130 db, Anschluss<br />
für externen Datenlogger, Kostenpunkt<br />
ca. 250 Euro<br />
Schallpegelmessgerät PCE-353 <strong>der</strong> Klasse<br />
2, <strong>in</strong>tegrierendes Profigerät, Messbereich<br />
30-130 db, USB-Schnittstelle für Computeranschluss,<br />
Kostenpunkt ca. 900 Euro<br />
Schallpegelmeter CR-821 <strong>der</strong> Klasse 1,<br />
eichfähig, Messbereich 21-140 db, <strong>in</strong>tegrierter<br />
Datenspeicher, Kostenpunkt ca.<br />
3.000 Euro<br />
Schalldosimeter für die personennahe<br />
Messung am Arbeitsplatz, Messbereich<br />
70-140 db, Kostenpunkt ca. 450 Euro<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Energie und Verkehr, Keplerstr.<br />
18, 66117 Saarbrücken, Fon 0681-5014500,<br />
www.umwelt.saarland.de; für das Thema „Lärm“ ist<br />
fachlich zuständig Dr. André Johann, Referat E/3, Fon<br />
0681-5014488, E-Mail a.johann@umwelt.saarland.de<br />
• Unfallkasse Saarland, Beethovenstr. 41, 66125 Saarbrücken,<br />
Fon 06897-97330, www.uks.de; Experte für<br />
den Lärm (auch <strong>in</strong> <strong>Schule</strong>n) ist Dr. Christoph Salm, Fon<br />
06897-973350, E-Mail salm@uks.de<br />
23
• Servicegesellschaft Forum Gutes Hören GmbH, Leopoldstraße<br />
19, 80802 München, Fon 089-1893789711,<br />
www.forum-gutes-hoeren.de; das Forum ist e<strong>in</strong>e Initiative<br />
<strong>der</strong> Hörakustiker und <strong>der</strong> Hörgeräte-Industrie, die<br />
u.a. mit e<strong>in</strong>er „Hörmobil“-Tour für mehr Hörbewusstse<strong>in</strong><br />
wirbt; Geschäftsführer<strong>in</strong> ist Dr. Christ<strong>in</strong>a Beste; <strong>in</strong><br />
Saarbrücken ist die Hörgeräteakustik Nalbach GmbH<br />
Partner des Forums: Kaiserstr. 25a, 66111 Saarbrücken,<br />
Fon 0681-374697; Geschäftsführer ist Harald Nalbach<br />
• Der Verkehrsclub Deutschland verleiht e<strong>in</strong>en „Lärm-<br />
Aktions-Koffer“, die Bestell<strong>in</strong>formation liegt zum<br />
Download unter www.vcd-bw.de/service/laermkoffer/<br />
Info_LAK_Laermbetroffene.pdf; Kontakt: Verkehrsclub<br />
Deutschland e.V., Kochstr. 27, 10969 Berl<strong>in</strong>, Fon 030-<br />
28035132, E-Mail versand@vcd.org; Ansprechpartner<br />
ist Peter Jacob<br />
• An<strong>der</strong>s als <strong>in</strong> Baden-Württemberg, wo die Landesanstalt<br />
für Umwelt, Messungen und Naturschutz<br />
professionelle Schallpegelmessgeräte <strong>der</strong> Klasse 1 an<br />
<strong>Schule</strong>n kostenlos verleiht, gibt es im Saarland ke<strong>in</strong>e<br />
solche zentrale Verleihmöglichkeit; um herauszuf<strong>in</strong>den,<br />
ob es möglicherweise doch auf Landesebene o<strong>der</strong><br />
bei Kommunen Ausleihmöglichkeiten gibt, sollten Sie<br />
sich mit Dr. André Johann im M<strong>in</strong>isterium für Umwelt,<br />
Energie und Verkehr <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung setzen (siehe oben)<br />
• Ingenieurbüros, die sich mit Immissionsschutz beschäftigen,<br />
haben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel auch Lärmmessgeräte<br />
o<strong>der</strong> Zugang zu Messmöglichkeiten; im Saarland kann<br />
u.a. angefragt werden: proTerra Umweltschutz- und<br />
Managementberatung GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach,<br />
Fon 06897-568323,<br />
www.proterra-umwelt.de; Geschäftsführer ist Dipl.-<br />
Ing. Anton Backes, Fon 06897-506185, E-Mail<br />
anton.backes@proterra-umwelt.de.<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
Folgende Anleitungen f<strong>in</strong>den Sie auf <strong>der</strong> nächsten Seite:<br />
1. Scoreliste für den Lärmwettbewerb<br />
2. Fragebogen „Schallwelt <strong>Schule</strong>“<br />
24
Lärmwettbewerb - Scoreliste<br />
Name und dB-Wert hier e<strong>in</strong>tragen dB(A) Tolerierbare Dauer <strong>der</strong> Schallbelastung*<br />
130 -<br />
125 Schmerzgrenze, sofortige Schäden möglich<br />
120 < 9 sec<br />
115 < 30 sec<br />
110 < 90 sec<br />
105 < 5 m<strong>in</strong><br />
100 < 10 m<strong>in</strong><br />
95 < 48 m<strong>in</strong><br />
90 < 2,6 h<br />
85 < 8 h<br />
80 unbegrenzt<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
*nach Bundesverband <strong>der</strong> Unfallkassen, 2006<br />
25
„Schallwelt <strong>Schule</strong>“ - Fragebogen<br />
Ist es dir manchmal <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> zu laut? ne<strong>in</strong>, nie<br />
manchmal <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse<br />
auf dem Pausenhof<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Turnhalle<br />
beim Mittagessen<br />
……………………………………………<br />
Woher kommt <strong>der</strong> Lärm, <strong>der</strong> dich stört?<br />
Wie reagierst du auf Lärm (<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong>, aber auch<br />
woan<strong>der</strong>s)?<br />
Hörst du selbst gern laute Musik? ne<strong>in</strong>, nie<br />
ja, oft<br />
gelegentlich<br />
Glaubst du, dass die Lehrkräfte unter dem Lärm <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong> leiden?<br />
26<br />
Schreien und lautes Reden<br />
Rennen, Trampeln, Türenschlagen<br />
Musik<strong>in</strong>strumente, Audiogeräte<br />
Verkehrslärm von draußen<br />
…………………………………………<br />
schrecke zusammen<br />
mich ärgern<br />
nervös werden<br />
unkonzentriert werden<br />
Kopfschmerzen, Müdigkeit<br />
……………………………………………<br />
ne<strong>in</strong>, <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Klasse ist es nicht wirklich laut<br />
manchmal schon<br />
ja, fast jeden Tag<br />
manche s<strong>in</strong>d eben empf<strong>in</strong>dlicher als an<strong>der</strong>e<br />
ke<strong>in</strong>e Ahnung
Modul 4: Geräusch- und Lärmsammlung<br />
Lernziel:<br />
Dieses Modul vermittelt über die Aufgabenstellung,<br />
möglichst viele verschiedene Geräusch- und Lärmproben<br />
zu sammeln und zu systematisieren, E<strong>in</strong>sichten über den<br />
Unterschied zwischen subjektiver Lärmwahrnehmung<br />
und naturwissenschaftlich-objektiver Lärmmessung.<br />
Dabei eignen sich die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler Grundkenntnisse<br />
<strong>der</strong> Akustik an, lernen akustische Signale und<br />
Töne zu analysieren und zu beschreiben und entwickeln<br />
Kompetenzen im Bereich <strong>der</strong> methodischen Recherche<br />
und Aufbereitung von Daten.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Das Modul thematisiert den Aspekt <strong>der</strong> Subjektivität,<br />
<strong>in</strong>dem die <strong>in</strong>dividuell unterschiedlichen<br />
Reaktionen auf Geräusche und Lärm analysiert<br />
werden und das Bewusstse<strong>in</strong> <strong>der</strong> Eigenverantwortung<br />
als „Lärm-Erzeuger“ und „Lärm-Erlei<strong>der</strong>“<br />
geför<strong>der</strong>t wird.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Geschult wird die Fähigkeit zur Multiperspektivität<br />
und Offenheit für unterschiedliche Deutungssysteme<br />
(subjektive vs. wissenschaftliche<br />
Sichtweise, Unterschiede zwischen <strong>in</strong>dividuellen<br />
Wahrnehmungs- und Bewertungssystemen).<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Praktisch-organisatorische Fähigkeiten stehen im<br />
Vor<strong>der</strong>grund des Projekts, es geht um technische<br />
Realisierung, Sammelfleiß und Systematik.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5, Mathematik: Zuordnungen –Stochastik (Daten<br />
sammeln, darstellen, auswerten)<br />
ERS 5, Musik: Zum Musikhören motivieren und befähigen<br />
(Hörerfahren sammeln und systematisieren)<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 5/6, Musik: Wir und die Musik (Wir erkunden unsere<br />
Stimme)<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 9, Mathematik: Allgeme<strong>in</strong>e S<strong>in</strong>usfunktion (Schallschw<strong>in</strong>gung)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Dieses Unterrichtsmodul ist extrem vielfältig, es kann<br />
thematisch stark variiert werden und auch auf unterschiedlichem<br />
kognitivem Anspruchsniveau angesiedelt<br />
werden. Obwohl die Ausgangsfragestellung die gleiche<br />
ist (Aufbau e<strong>in</strong>er Geräusch- und Lärmsammlung), differenziert<br />
sich e<strong>in</strong> unterschiedliches Vorgehen auf zwei<br />
Ebenen heraus:<br />
• Auf dem „vorwissenschaftlichen“ Niveau (Modul-Variante<br />
A) geht es um das Sammeln und Systematisieren<br />
verschiedenster Geräusch- und Lärmproben aus<br />
dem Erfahrungsfeld <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler.<br />
Dabei bleibt es den Schülern zunächst selbst überlassen,<br />
mit welchen Fragen sie an die Systematisierung<br />
und den Vergleich <strong>der</strong> Geräusch- und Lärmproben<br />
heran gehen. Es ist nicht notwendig, dass <strong>der</strong> Prozess<br />
auf die E<strong>in</strong>führung grundlegen<strong>der</strong> Begriffe <strong>der</strong> Akustik<br />
h<strong>in</strong>ausläuft. Vielmehr soll die Eigenaktivität und<br />
Motivation <strong>der</strong> Schüler beherrschend bleiben. Die<br />
Rolle <strong>der</strong> Lehrkraft besteht dar<strong>in</strong>, die Interessen und<br />
Fragen <strong>der</strong> Schüler zu unterstützen und die Schüler<br />
dazu zu ermutigen, Fragen weiter zu verfolgen und<br />
praktische Anwendungen zu realisieren. Dies könnte<br />
z.B. e<strong>in</strong> Lärm- und Geräuschquiz se<strong>in</strong> o<strong>der</strong> auch die<br />
<strong>in</strong>tensivere Beschäftigung mit <strong>der</strong> Frage, wovon das<br />
Hören abhängt (Aufbau des Ohres, Ursachen von<br />
Hörschäden etc.). Dazu s<strong>in</strong>d Hörtests am Computer<br />
geeignet, die onl<strong>in</strong>e und offl<strong>in</strong>e verfügbar s<strong>in</strong>d.<br />
• Auf e<strong>in</strong>em eher „wissenschaftlichen“ Niveau (Modul-<br />
Variante B) kann die Lärm- und Geräuschesammlung<br />
mit dem computerbasierten Analysetool „Sounds“<br />
komb<strong>in</strong>iert werden, das das Institut für Didaktik<br />
<strong>der</strong> Physik an <strong>der</strong> Freien Universität Berl<strong>in</strong> entwickelt<br />
hat. Als Erweiterung ist <strong>in</strong> diesem Fall e<strong>in</strong>e mit<br />
„Sounds“ mögliche Stimmenanalyse denkbar. Damit<br />
könnten die physikalischen Stimmprofile <strong>der</strong> Schüler<br />
e<strong>in</strong>er Klasse o<strong>der</strong> auch von Lehrern erstellt und mit<br />
subjektiven E<strong>in</strong>drücken, die an<strong>der</strong>e mit diesen Stimmen<br />
verb<strong>in</strong>den, verglichen werden.<br />
Für Modul-Variante A s<strong>in</strong>d 4-8 Unterrichtsstunden<br />
anzusetzen, für Modul-Variante B 8-12 Unterrichtsstunden,<br />
da die E<strong>in</strong>arbeitung <strong>in</strong> das Programm „Sounds“<br />
h<strong>in</strong>zukommt.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Aktivboxen für PC o<strong>der</strong> Laptop-Lautsprecher<br />
27
• ggf. Kopfhörer (auch für Hörtests)<br />
• MD-Rekor<strong>der</strong> mit Mikrofon o<strong>der</strong> Handy-Rekor<strong>der</strong> wie<br />
den Zoom H2; zu letzterem gibt es Informationen<br />
aus Sicht <strong>der</strong> Verwendung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> unter<br />
www.lehrer-onl<strong>in</strong>e.de/h2-handyrecor<strong>der</strong>.php<br />
• ggf. das kostenlose Programm “Sounds” (Download<br />
unter http://didaktik.physik.fu-berl<strong>in</strong>.de/sounds)<br />
• ggf. Lärmmessgerät<br />
Ablauf:<br />
Zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> eignen sich die Diskussionsrunde „Vuvuzela<br />
– Hat Paul Breitner recht?“ o<strong>der</strong> das Musikquiz „…<br />
nur wenn sie laut ist“ (siehe oben, „H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung<br />
<strong>in</strong>s Thema).<br />
Ablauf <strong>der</strong> Modulvariante A:<br />
Die Diskussion über subjektive Unterschiede <strong>der</strong> Geräusch-<br />
und Lärmwahrnehmung wird zum Anlass<br />
genommen, um folgende Aufgabe zu stellen: „Sammelt<br />
so viele unterschiedliche Geräusche und Lärmbeispiele<br />
als möglich und versucht, sie zu systematisieren. Die<br />
dabei entstehende digitale Geräusch- und Lärmsammlung<br />
kann auch für e<strong>in</strong> Quiz e<strong>in</strong>gesetzt werden.“ In <strong>der</strong><br />
Planungsphase des Projekts ist es s<strong>in</strong>nvoll, Arbeitsgruppen<br />
zu jeweils 3 bis 5 Teammitglie<strong>der</strong>n zu bilden, die<br />
jeweils e<strong>in</strong>e eigene spezielle Leitidee für ihre Sammlung<br />
wählen. Solche Leitideen können z.B. se<strong>in</strong>:<br />
• Geräusche aus unserer <strong>Schule</strong><br />
• Geräusche im Verlauf e<strong>in</strong>es Tages<br />
• Verkehrsgeräusche unserer Stadt<br />
• Die Musik<strong>in</strong>strumente unserer Klasse (Instrumente,<br />
die die e<strong>in</strong>zelnen Schüler spielen)<br />
• Schreckliche Geräusche<br />
• Alles, was Lärm macht<br />
• Naturgeräusche<br />
• Geräusche unserer Haustiere etc.<br />
Jede Gruppe braucht e<strong>in</strong>en MD- o<strong>der</strong> Handy-Rekor<strong>der</strong>.<br />
(E<strong>in</strong> Handy-Rekor<strong>der</strong> ist ke<strong>in</strong> Mobiltelefon mit Aufnahmefunktion,<br />
son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> spezielles Gerät; Hersteller<br />
s<strong>in</strong>d vor allem die Firmen Zoom und Olympus.) Es gibt<br />
jedoch auch die Alternative, Sounddateien im Internet<br />
zu suchen. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong> größten Sammlungen kostenloser<br />
Audiodateien f<strong>in</strong>det man unter www.soundsnap.com.<br />
Beim Vergleich <strong>der</strong> Geräusche bzw. <strong>der</strong> Geräusche<strong>in</strong>drücke<br />
wird die Frage entstehen, woher die Unterschiede<br />
<strong>der</strong> verschiedenen Geräuscharten kommen. Je nach<br />
Alter <strong>der</strong> Schüler kann jetzt e<strong>in</strong>e mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
weitreichende E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Akustik erfolgen, die<br />
z.B. die Zusammenhänge zwischen Schallpegel (gemessen<br />
<strong>in</strong> db) und Tonhöhe (gemessen <strong>in</strong> Hz) verdeutlicht.<br />
28<br />
Der Hörbereich des Menschen<br />
Die Physik des Hörens führt uns auch zum Aufbau unseres<br />
Hörorgans und zur Frage, wie aus den Schallwellen, die<br />
an unsere Ohren gelangen, Geräusche<strong>in</strong>drücke werden. An<br />
dieser Stelle ist es s<strong>in</strong>nvoll, den Mechanismus zu erläutern,<br />
<strong>der</strong> zu Hörschäden führt. Dabei sollten vere<strong>in</strong>fachende<br />
Erklärungen vermieden werden. Man weiß heute, dass das<br />
menschliche Ohr nicht nur e<strong>in</strong> passiver Schallempfänger<br />
ist. Schon im Innenohr erfolgt auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Haarzellen<br />
(Hörs<strong>in</strong>neszellen) e<strong>in</strong>e aktive Schallverarbeitung.<br />
Wie Professor Eckhard Hoffmann (Hochschule Aalen)<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er groß angelegten empirischen Studie bereits<br />
vor zehn Jahren herausfand, muss Discolärm nicht an<br />
sich schädlich se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>e dosierte Lärmexposition hat im<br />
Gegenteil sogar e<strong>in</strong>en „Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gseffekt“, „so dass diese<br />
nach regelmäßiger Stimulation durch Disco-Besuche den<br />
Belastungen im Alltag besser gewachsen s<strong>in</strong>d. Die Disco<br />
wäre somit das Fitness-Studio für die äußeren Hörzellen.“<br />
Den ganzen Artikel über die Studie f<strong>in</strong>den Sie unter<br />
„Anleitungen und Arbeitsunterlagen“ (Downloadl<strong>in</strong>k:<br />
http://web.tiscali.it/musicculturclub/guest/lautemusik.htm).<br />
Die Bedeutung <strong>der</strong> Hörfähigkeit und des Gleichgewichtss<strong>in</strong>ns,<br />
<strong>der</strong> ja ebenfalls organisch im Ohr angesiedelt<br />
ist, behandelt e<strong>in</strong>e sehr anschauliche Broschüre des<br />
hessischen Kultusm<strong>in</strong>isteriums, die auch pädagogische<br />
Anregungen zur Schulung <strong>der</strong> sensorischen Kompetenz <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Schule</strong> enthält. Sie ist unter dem Titel<br />
• „Projekt Schnecke – Bildung braucht Gesundheit“<br />
im Internet zu f<strong>in</strong>den: www.schuleundgesundheit.hessen.de/<br />
fileadm<strong>in</strong>/content/Medien/Ordner_S_G/Broschuere_<br />
Schnecke_2010_korr.pdf<br />
Im Internet s<strong>in</strong>d auch Hörtests verfügbar, die teils onl<strong>in</strong>e<br />
durchgeführt werden, teils auch für den Offl<strong>in</strong>e-E<strong>in</strong>satz<br />
heruntergeladen werden können (z.B. <strong>der</strong> Test von „earaction“).<br />
Hier e<strong>in</strong>ige L<strong>in</strong>ks zu Hörtests:<br />
• www.earaction.de/hoertest/<strong>in</strong>dex.html<br />
• www.hear-the-world.com/de/hoerverlust-erkennen/onl<strong>in</strong>ehoertest.html<br />
http://www.learnl<strong>in</strong>e.nrw.de/angebote/s<strong>in</strong>us/<br />
projektnw/unterrichtsbeispiele/ohr/Hoertest_<strong>in</strong>teraktiv.htm
Falls aus den Geräusch- und Lärmsammlungen auch e<strong>in</strong><br />
Quiz zusammengestellt werden soll, können entwe<strong>der</strong><br />
die verschiedenen Sammlergruppen sich gegenseitig auf<br />
die Probe stellen („Was für e<strong>in</strong> Geräusch ist das?“) o<strong>der</strong><br />
die Gruppen arbeiten e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Quiz aus, das z.B.<br />
bei Schulveranstaltungen aufgeführt werden kann. Wenn<br />
Interesse und Know-How vorhanden ist, um das Quiz auch<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er PC-Version zu erstellen, kann es an<strong>der</strong>en Schulklassen<br />
und <strong>Schule</strong>n zur Verfügung gestellt werden.<br />
Ablauf <strong>der</strong> Modulvariante B:<br />
Ältere Schüler, die bereits weitergehende Kenntnisse <strong>der</strong><br />
Akustik mitbr<strong>in</strong>gen o<strong>der</strong> sie sich im Rahmen des Unterrichtsmoduls<br />
aneignen wollen, können die gesammelten<br />
Geräusche mit e<strong>in</strong>em speziellen Programm zur Klangvisualisierung<br />
analysieren, das von Wissenschaftlern <strong>der</strong> Freien<br />
Universität Berl<strong>in</strong> entwickelt wurde. Das Programm kann<br />
unter http://didaktik.physik.fu-berl<strong>in</strong>.de/sounds heruntergeladen<br />
werden.<br />
„Sounds“ - Software zur Klanganalyse und Klangvisualisierung<br />
Die Möglichkeit, Geräusche und Klänge o<strong>der</strong> die<br />
Sprache mit Hilfe e<strong>in</strong>er Soundkarte aufzuzeichnen,<br />
zu digitalisieren und anschließend per Computer<br />
zu visualisieren und zu analysieren, eröffnet neue<br />
Perspektiven.<br />
Für die Visualisierung und Analyse von akustischen<br />
Signalen und an<strong>der</strong>en Zeitreihen wurde das Programm<br />
Sounds entwickelt, mit dessen Hilfe digitalisierte<br />
Tonsequenzen und auch Echtzeitsignale<br />
untersucht werden können. Dabei werden sowohl<br />
herkömmliche Verfahren wie z.B. die Fourieranalyse<br />
als auch aus <strong>der</strong> nichtl<strong>in</strong>earen Zeitreihenanalyse<br />
stammende Methoden wie z.B. die Rekonstruktion<br />
genutzt. Insbeson<strong>der</strong>e die Visualisierungsmethoden<br />
von Sounds bieten e<strong>in</strong>en neuen Zugang zur Akustik:<br />
Möglich s<strong>in</strong>d „Flüge“ über dreidimensionale Töne;<br />
Instrumente und Sprachelemente wie z.B. Vokale<br />
lassen sich anhand ihrer chaotischen Attraktoren<br />
identifizieren.<br />
Mit dem Programm „Sounds“ können auch menschliche<br />
Stimmen analysiert und visualisiert werden. Texterkennungsprogramme<br />
o<strong>der</strong> Krim<strong>in</strong>alisten arbeiten mit ähnlichen<br />
Methoden. Für Experimente mit <strong>der</strong> Stimme ist<br />
„Sounds“ beson<strong>der</strong>s hilfreich, denn mit dem Programm<br />
lassen sich kurze Tonsequenzen auf e<strong>in</strong>fache Weise<br />
aufzeichnen und umgehend analysieren und als Sonogramm<br />
darstellen. Bei S<strong>in</strong>gstimmen lassen sich mit dem<br />
Programm sogar Notenwerte zuordnen. Auf diese Weise<br />
können auch visuelle Vergleiche angestellt werden, wel-<br />
che Stimme wie kl<strong>in</strong>gt und welche Variationsbreite e<strong>in</strong>e<br />
Stimme hat, wie hoch o<strong>der</strong> wie tief sie se<strong>in</strong> kann etc. Auf<br />
spielerische Art können die Schüler(<strong>in</strong>nen) auch überprüfen,<br />
ob sie bestimmte Töne treffen.<br />
Auch hier arbeiten die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler am<br />
besten <strong>in</strong> Untergruppen, um sich mit „Sounds“ vertraut zu<br />
machen und <strong>in</strong> je<strong>der</strong> Gruppe ihren eigenen Fragestellungen<br />
nachzugehen. Als Verpflichtung für alle sollte lediglich<br />
festgelegt werden, dass die Gruppen e<strong>in</strong> präsentierbares<br />
Ergebnis ihrer Sound-Forschungen betreiben. Ob jedoch<br />
die Gruppen z.B. eher Alltagsgeräusche o<strong>der</strong> Stimmen o<strong>der</strong><br />
Musikgenres analysieren und vergleichen, sollte ihnen<br />
selbst überlassen bleiben.<br />
Dreidimensionale Darstellung e<strong>in</strong>er Sequenz aus dem Stück „Musik nur, wenn sie<br />
laut ist“ von Herbert Grönemeyer, erzeugt mit dem Analyseprogramm „Sounds“<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Prof. Dr. Eckhard Hoffmann, Hochschule Aalen –<br />
Technik und Wirtschaft, Beethovenstr. 1, 73430 Aalen,<br />
Fon 07361-973312, E-Mail eckhard.hoffmann@htwaalen.de<br />
• Freie Universität Berl<strong>in</strong>, Institut für Didaktik <strong>der</strong> Physik,<br />
Arnimallee 14, 14195 Berl<strong>in</strong>, Fon 03083853031,<br />
didaktik.physik.fu-berl<strong>in</strong>.de; die Autoren des Programms<br />
„Sounds“ s<strong>in</strong>d Adrian Voßkühler, E-Mail Volkhard<br />
Nordmeier, E-Mail nordmeier@physik.fu-berl<strong>in</strong>.<br />
de<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
Als Diskussionsanregung für die Klasse o<strong>der</strong> Projektgruppe<br />
f<strong>in</strong>den Sie auf <strong>der</strong> nächsten Seite den Artikel<br />
• „Laute Musik – Ke<strong>in</strong> Grund für Hörschäden?“ von und<br />
über die Forschungen von Professor Eckhard Hoffmann.<br />
29
Laute Musik – Ke<strong>in</strong> Grund für Hörschäden?<br />
Von Mart<strong>in</strong> Hömberg<br />
Bei jedem vierten Jugendlichen sei das Gehör durch<br />
überlaute Musik bee<strong>in</strong>trächtigt, schrieb das Umweltbundesamt<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Pressemitteilung bereits 1997.<br />
Goldene Zeiten für die Hersteller von Hörgeräten:<br />
Denn nach und nach müssten diese Hörgeschädigten<br />
wohl e<strong>in</strong>sehen, dass sie unwi<strong>der</strong>ruflich auf e<strong>in</strong><br />
Hörgerät angewiesen s<strong>in</strong>d - e<strong>in</strong>e These, die vielleicht<br />
sogar die Entwicklung von Hörhilfen vorangetrieben<br />
hat. An<strong>der</strong>e Erkenntnisse gewann <strong>der</strong> Hörforscher Dr.<br />
Eckhard Hoffmann im Rahmen se<strong>in</strong>er Untersuchungen.<br />
Die vom Umweltbundesamt se<strong>in</strong>erzeit <strong>in</strong> die Welt<br />
gesetzte Behauptung ist oft wie<strong>der</strong>holt, selten aber<br />
h<strong>in</strong>terfragt o<strong>der</strong> gar wissenschaftlich überprüft<br />
worden. Dr. Eckhard Hoffmann von <strong>der</strong> Universität<br />
Ulm [heute Hochschule Aalen] ist <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren <strong>der</strong> Frage nachgegangen, wo denn nun wirklich<br />
die Ursachen für Hörschäden liegen. Se<strong>in</strong>e Ergebnisse<br />
revidieren etablierte, vielleicht sogar schon lieb<br />
gewonnene Ansichten, und sie werden gestützt durch<br />
Beobachtungen, die Kollegen aus <strong>der</strong> Hörforschung<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren und Jahrzehnten <strong>in</strong> aller Welt<br />
gesammelt haben.<br />
Aktuelle Ergebnisse<br />
Untersucht hat Hoffmann <strong>in</strong> den Jahren 1995 bis<br />
2000 <strong>in</strong>sgesamt 1.510 deutsche Männer im Alter von<br />
18 bis 25 Jahren. Die Hörschwelle junger Ewachsener<br />
sollte im Hörtest bei allen getesteten Frequenzen bei<br />
0 dB HL (Hear<strong>in</strong>g Loss) liegen. Diese <strong>in</strong>ternational genormte<br />
Null-L<strong>in</strong>ie (ISO 389) wurde <strong>in</strong> den 60er-Jahren<br />
per Konvention so festgelegt, dass sie <strong>der</strong> Hörschwelle<br />
von HNO-ärztlich unauffälligen und nicht durch Schall<br />
belasteten jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25<br />
Jahren entspricht.<br />
Bei allen Probanden wurde die Hörschwelle unter<br />
guten Messbed<strong>in</strong>gungen bestimmt, ihre Schallbelastung<br />
<strong>in</strong> Beruf und Freizeit war Gegenstand e<strong>in</strong>es<br />
detaillierten Fragebogens. Bei 25 % <strong>der</strong> Probanden<br />
zeigte sich im Frequenzbereich bis 8 kHz auf e<strong>in</strong>em<br />
Ohr e<strong>in</strong> Hörverlust von 20 dB o<strong>der</strong> mehr bei m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong>er Testfrequenz. Hat e<strong>in</strong> Mensch im Alter von<br />
18 bis 25 Jahren e<strong>in</strong>en Hörverlust <strong>in</strong> diesem Ausmaß,<br />
spricht man im Allgeme<strong>in</strong>en von e<strong>in</strong>em Hörschaden.<br />
E<strong>in</strong>e beg<strong>in</strong>nende o<strong>der</strong> höhergradige Schwerhörigkeit<br />
ermittelte Hoffmann bei 1,5 % <strong>der</strong> Probanden.<br />
Disco-Gänger<br />
Die jungen Männer wurden detailliert nach ihren<br />
Gewohnheiten beim Musik-Konsum befragt. Konkrete<br />
Angaben waren auch zu den Disco-Besuchen er-<br />
30<br />
wünscht, hier wurden die Probanden zur Häufigkeit,<br />
<strong>der</strong> durchschnittlichen Länge des Aufenthalts und<br />
seit wie vielen Jahren die Probanden Discotheken<br />
regelmäßig besuchen gefragt. Insgesamt ergab sich:<br />
Jugendliche und junge Erwachsene gehen <strong>in</strong> ihrer<br />
Freizeit gern und häufig <strong>in</strong> Discos. Die diesbezüglichen<br />
Informationen aus dem Fragebogen wurden<br />
aufgerechnet und als „Disco-Stunden“ <strong>in</strong> Relation<br />
zur Hörfähigkeit gesetzt.<br />
Um nun die durch Disco-Aufenthalte verursachte<br />
Wirkung von Musik auf die Hörfähigkeit zu ermitteln,<br />
wurden zwei Extrem-Gruppen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
verglichen. Gegenübergestellt wird <strong>in</strong> gemittelten<br />
Audiogrammen die Kurve von „extremen“ Disco-<br />
Gängern (194 Personen) im Vergleich zu den „Musikmuffeln“<br />
(122 Personen), die we<strong>der</strong> Konzerte noch<br />
Discos besuchten und auch ke<strong>in</strong>en Walkman besitzen.<br />
Die extremen Disco-Gänger dagegen hatten<br />
zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Untersuchung bereits m<strong>in</strong>destens<br />
1.500 Stunden <strong>in</strong> Discos verbracht. Sie s<strong>in</strong>d die<br />
Probanden-Gruppe, die sich <strong>der</strong> höchsten Schallbelastung<br />
durch Diskotheken ausgesetzt hat.<br />
Viel Disco = großer Hörschaden?<br />
Landläufig wird diese These wohl durchaus vertreten.<br />
Die Untersuchungsergebnisse von Hoffmann<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e echte Überraschung, denn sie zeigen, dass<br />
es sich hier tatsächlich um e<strong>in</strong> Vorurteil handelt.<br />
Se<strong>in</strong>e Studie kommt zu ganz an<strong>der</strong>en Ergebnissen:<br />
Wäre Disco-Musik die Hauptursache für die häufig<br />
auftretenden Hörschäden, so wäre bei <strong>der</strong> Auswertung<br />
e<strong>in</strong> Hörschaden-Risiko zu erwarten, das proportional<br />
zur Musikbelastung ansteigt.<br />
Zu beobachten ist jedoch das genaue Gegenteil. Das<br />
relative Risiko e<strong>in</strong>es Hörschadens, so die Studie,<br />
ist bei mo<strong>der</strong>aten Disco-Gängern deutlich ger<strong>in</strong>ger<br />
als bei <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> „Musikmuffel“. So war <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Gruppe mit e<strong>in</strong>er Disco-Dosis von 1.000 bis 1.500<br />
Stunden e<strong>in</strong> statistisch um 90 % ger<strong>in</strong>geres Risiko<br />
für Hörschäden zu beobachten als bei den „Musikmuffeln“.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund dieser Ergebnisse<br />
verliert die Diskussion über die Schädlichkeit von<br />
Discos ihre Bedeutung, im Gegenteil: Mo<strong>der</strong>aten<br />
Disco-Besuchen muss sogar e<strong>in</strong> positiver Effekt für<br />
das Hörvermögen und dessen Erhalt besche<strong>in</strong>igt<br />
werden.<br />
Die Disco als Fitness-Studio für die Hörzellen<br />
Das menschliche Ohr ist nicht nur e<strong>in</strong> passiver<br />
Schallempfänger, schon im Innenohr erfolgt auf <strong>der</strong><br />
Ebene <strong>der</strong> Haarzellen (Hörs<strong>in</strong>neszellen) e<strong>in</strong>e aktive<br />
Schallverarbeitung. Bei e<strong>in</strong>er länger dauernden,<br />
hohen Schallbelastung wird die Empf<strong>in</strong>dlichkeit des
Ohres automatisch heruntergeregelt. Dies führt zu<br />
dem bekannten Effekt des tauben Gefühls im Ohr<br />
nach e<strong>in</strong>em lauten Konzert. Die Funktionsweise <strong>der</strong><br />
äußeren Haarzellen liefert e<strong>in</strong>en Erklärungsansatz<br />
für den zunächst überraschenden Schutzeffekt von<br />
mo<strong>der</strong>aten Disco-Besuchen. Nach den vorliegenden<br />
Ergebnissen ist e<strong>in</strong> „Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gseffekt“ <strong>der</strong> äußeren<br />
Haarzellen denkbar, so dass diese nach regelmäßiger<br />
Stimulation durch Disco-Besuche den<br />
Belastungen im Alltag besser gewachsen s<strong>in</strong>d. Die<br />
Disco wäre somit das Fitness-Studio für die äußeren<br />
Hörzellen.<br />
Die Studie zeigt: Erst bei den Disco-Besuchern mit<br />
e<strong>in</strong>er extrem hohen Disco-Dosis (194 Personen) von<br />
m<strong>in</strong>destens 1.500 Stunden steigt das Hörschaden-<br />
Risiko wie<strong>der</strong> deutlich an. Dass vergleichsweise<br />
auch e<strong>in</strong> zu <strong>in</strong>tensives Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Fitness-<br />
Studio nicht nur positive Effekte mit sich br<strong>in</strong>gt,<br />
ist <strong>in</strong>zwischen allgeme<strong>in</strong> bekannt. Offensichtlich<br />
lässt sich dies auch auf das Gehör übertragen. Wer<br />
sich <strong>in</strong> extremer Weise <strong>der</strong> Schallbelastung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Disco aussetzt, riskiert e<strong>in</strong>e Bee<strong>in</strong>trächtigung se<strong>in</strong>er<br />
Hörfähigkeit. Laut Hoffmann kann die Musik dabei<br />
aber nicht zur Hauptursache e<strong>in</strong>es Hörschadens<br />
werden.<br />
Der Knall, die wirkliche Gefahr<br />
Die große Mehrheit <strong>der</strong> jungen Erwachsenen, die <strong>in</strong><br />
mo<strong>der</strong>ater Form Discos und Konzerte besuchen, hat<br />
ke<strong>in</strong>en Hörschaden, <strong>der</strong> nachweislich durch Musik<br />
bed<strong>in</strong>gt ist. Das pauschal geme<strong>in</strong>te Schlagwort von<br />
<strong>der</strong> „Deaf Generation“ ist daher nicht gerechtfertigt.<br />
Ebenso wenig ist <strong>der</strong> Musikkonsum e<strong>in</strong>e erstrangige<br />
Ursache für Hörschäden bei dieser und bei<br />
allen an<strong>der</strong>en Altersgruppen.<br />
Die Schädigungen, die Hoffmann <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Studie<br />
beobachtete, waren überwiegend e<strong>in</strong>seitig auftretende<br />
Hochton-Senken und Hochtonverluste. Ihre<br />
typische Charakteristik liefert e<strong>in</strong>en H<strong>in</strong>weis darauf,<br />
dass es sich tatsächlich um lärmbed<strong>in</strong>gte Hörschäden<br />
handelt - nicht aber durch Musik verursacht:<br />
Denn e<strong>in</strong> typischer Konzert- o<strong>der</strong> Disco-Besucher<br />
würde sich beidseitige Schädigungen e<strong>in</strong>handeln.<br />
E<strong>in</strong>seitige Hörschäden weisen auf Knalle als Ursache<br />
h<strong>in</strong>: E<strong>in</strong> Ohr ist dem Knall meist stärker zugewandt<br />
als das an<strong>der</strong>e, das <strong>in</strong> diesem Fall schon durch den<br />
Kopf teilweise vor <strong>der</strong> Schallwelle geschützt wird.<br />
Tatsächlich berichtete die Hälfte aller Untersuchten<br />
von e<strong>in</strong>em Knalltrauma mit Ohrgeräuschen beziehungsweise<br />
e<strong>in</strong>em tauben Gefühl im Ohr nach<br />
e<strong>in</strong>em lauten Knall. Verursacht wurden die Knalle<br />
meist durch Silvester-Feuerwerkskörper, zum Teil<br />
auch durch Schreckschusspistolen. Der Knall e<strong>in</strong>es<br />
Silvester-Böllers kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er tausendstel Sekunde<br />
e<strong>in</strong>en lebenslangen Hörschaden verursachen, den<br />
man sich sonst auch durch jahrelange Disco-Besuche<br />
nicht e<strong>in</strong>handelt.<br />
Mart<strong>in</strong> Hömberg lebt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nähe von Köln und<br />
arbeitet als Komponist und Produzent, unterrichtet<br />
Musikproduktion an <strong>der</strong> Hochschule für Musik<br />
und war Autor und Mo<strong>der</strong>ator <strong>der</strong> WDR-Fernsehserie<br />
„Musik aus dem Computer”. Zudem schreibt<br />
Hömberg für verschiedene Fachzeitschriften über<br />
Themen aus den Bereichen Record<strong>in</strong>g und Studio-<br />
Equipment.<br />
31
Modul 5: Lärmlandkarte unserer <strong>Schule</strong><br />
Lernziel:<br />
Die Aufgabe, vor <strong>der</strong> die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler<br />
stehen, ähnelt e<strong>in</strong>em „Forschungsauftrag“. Die Lärmlandkarte<br />
<strong>der</strong> <strong>Schule</strong> soll e<strong>in</strong>en möglichst vollständigen<br />
Überblick über die Lärmzonen <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> geben. Dazu<br />
gehören sowohl die <strong>in</strong>nerschulischen Lärmquellen als<br />
auch E<strong>in</strong>flüsse von außen (z.B. durch den Straßenverkehr).<br />
Die Schüler sollen das methodische Vorgehen<br />
selbst festlegen, um entsprechende Fähigkeiten zu<br />
tra<strong>in</strong>ieren. Als Lehrkraft geben Sie also nicht vor, wie die<br />
Schüler die Aufgabe angehen sollen. Die Fragestellung<br />
lässt offen, mit welchen Erhebungs<strong>in</strong>strumenten die<br />
Schüler arbeiten. Neben <strong>der</strong> naturwissenschaftlichen<br />
Methode (Lärmmessung mit Schallpegelmessgeräten)<br />
könnte auch e<strong>in</strong>e Befragung stattf<strong>in</strong>den. Die Schüler<br />
sollen auch eigenständig festlegen, wann und wo sie<br />
beispielsweise messen wollen bzw. wen und wie sie<br />
befragen. Soll man sich vorher e<strong>in</strong> Bild davon verschaffen,<br />
welche potenziellen Lärmzentren für die Messung<br />
beson<strong>der</strong>s relevant s<strong>in</strong>d? Ist es s<strong>in</strong>nvoll, auch beson<strong>der</strong>s<br />
ruhige Zonen <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> durch Messung zu objektivieren?<br />
Sollen auch die Lehrkräfte <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> <strong>in</strong> die<br />
Befragung e<strong>in</strong>bezogen werden? Ist es vielleicht s<strong>in</strong>nvoll,<br />
auch unterschiedliche Fächer zu vergleichen, gibt es<br />
„lautere“ und „leisere“ Fächer? O<strong>der</strong> hängt es eher von<br />
Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen ab? O<strong>der</strong> ist <strong>der</strong> Unterrichtsstil<br />
<strong>der</strong> Lehrkraft auch e<strong>in</strong> lärmrelevanter Faktor? Indem die<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler sich möglichst eigenständig<br />
mit solchen Fragen beschäftigen, lernen sie Grundlagen<br />
<strong>der</strong> wissenschaftlichen Hypothesenbildung kennen. Als<br />
Lehrkraft sollten Sie ggf. Anregungen geben, die das<br />
wissenschaftliche Fragen unterstützen, jedoch ke<strong>in</strong>e<br />
Lösungen vorschreiben.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Der Aspekt <strong>der</strong> „Subjektivität“ charakterisiert die<br />
Fragestellung dieses Moduls. Es geht zum e<strong>in</strong>en<br />
um die Mitwirkung von Schülern und Lehrern,<br />
eventuell auch Hausmeister, Eltern und Schulträger<br />
an <strong>der</strong> Datenerhebung, zum an<strong>der</strong>en wird die<br />
Verantwortung thematisiert, die alle Beteiligten<br />
für e<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>der</strong> Situation an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
haben.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Gefor<strong>der</strong>t und geför<strong>der</strong>t wird das <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Denken. Naturwissenschaftliche, soziologische,<br />
psychologische und architektonische Erklärungsmodelle<br />
s<strong>in</strong>d erfor<strong>der</strong>lich, um die Lärmlandkarte<br />
<strong>der</strong> <strong>Schule</strong> zu erstellen.<br />
32<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Kognitiv-wissenschaftliche Methoden stehen im<br />
Vor<strong>der</strong>grund des Moduls.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5, Mathematik: Zuordnungen –Stochastik (Daten<br />
sammeln, darstellen, auswerten)<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 6/7/8, Deutsch: Sprechen (Interview)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Unsere <strong>Schule</strong><br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Mitwirkung und<br />
Mitbestimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
GS 9/10, Allgeme<strong>in</strong>e Ethik: Politischer Aspekt<br />
GYM 6, Deutsch: Sprechen und Schreiben (Interview)<br />
GYM 8, Deutsch: Texte und Medien (Interview)<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 9, Mathematik: Allgeme<strong>in</strong>e S<strong>in</strong>usfunktion (Schallschw<strong>in</strong>gung)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Der Zeitbedarf für dieses Modul hängt natürlich auch von<br />
den gewählten Methoden ab. Für die Planung des Untersuchungsdesigns<br />
s<strong>in</strong>d auf jeden Fall 2-4 Unterrichtsstunden<br />
anzusetzen. Die Erhebungs- und Auswertungsphase<br />
erfor<strong>der</strong>t ca. 8-16 Unterrichtsstunden. Werden naturwissenschaftliche<br />
und soziologische Methoden komb<strong>in</strong>iert<br />
(wird also gemessen und befragt), verdoppelt sich <strong>der</strong><br />
Aufwand. Die Auswertungsphase benötigt 3-6 Unterrichtsstunden;<br />
sie ist ggf. noch zu verlängern, falls die<br />
Ergebnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er auch für Außenstehende beson<strong>der</strong>s<br />
gut rezipierbaren Form (z.B. Ausstellung o<strong>der</strong> virtueller<br />
Lärmrundgang durch die <strong>Schule</strong>) aufbereitet werden<br />
sollen. Somit beträgt <strong>der</strong> Zeitbedarf m<strong>in</strong>destens 13-26<br />
Unterrichtsstunden. Das Projekt muss nicht kompakt <strong>in</strong><br />
kurzer Zeit abgeschlossen werden, son<strong>der</strong>n es kann auch<br />
als Halbjahres- o<strong>der</strong> Jahresprojekt organisiert werden.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Digitalkamera o<strong>der</strong> digitale Videokamera<br />
• PC-Programme: Word, Excel, Powerpo<strong>in</strong>t<br />
• ggf. Lärmmessgerät
Ablauf:<br />
E<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>führung zum Thema könnte z.B. durch das<br />
Lärmampel-Experiment erfolgen (siehe „H<strong>in</strong>weise zur<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s Thema“). Dadurch s<strong>in</strong>d die Schüler<br />
bereits für das Thema sensibilisiert. Der Auftrag an die<br />
Klasse, e<strong>in</strong>e Lärmkarte für die <strong>Schule</strong> zu erstellen, soll<br />
als „Forschungsauftrag“ formuliert werden. „Wie sieht<br />
denn die Lärmsituation an unserer <strong>Schule</strong> aus? Um<br />
eventuell etwas für e<strong>in</strong>e Verbesserung tun zu können,<br />
brauchen wir e<strong>in</strong>en Überblick! Wie würdet ihr an diese<br />
Aufgabe herangehen?“<br />
Nach e<strong>in</strong>em kurzen Austausch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse sollte die<br />
Lehrkraft vorschlagen, mehrere Forschergruppen mit ca.<br />
6 Teammitglie<strong>der</strong>n pro Gruppe zu bilden. Diese Teams<br />
haben zunächst die Aufgabe, e<strong>in</strong>en ersten Untersuchungsplan<br />
zu erstellen. Die verschiedenen Konzepte<br />
werden anschließend allen vorgestellt und mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
verglichen. Je nachdem, welche Untersuchungsmethoden<br />
vorgeschlagen werden, arbeiten die Gruppen<br />
anschließend parallel o<strong>der</strong> organisieren ihre Kooperation<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er spezifischen Arbeitsteilung. Die Gruppen, die<br />
mit Befragungen und Beobachtungen arbeiten, können<br />
z.B. e<strong>in</strong> arbeitsteiliges Vorgehen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Zielgruppen<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Beobachtungsorte/-zeiträume festlegen.<br />
Wenn mehrere Gruppen Schallpegelmessungen<br />
machen, empfiehlt sich auch hier e<strong>in</strong>e Arbeitsteilung<br />
nach Messorten und –zeiten. E<strong>in</strong>e weitere Option bietet<br />
die Unterscheidung <strong>in</strong> die re<strong>in</strong>e Schallpegelmessung und<br />
die Messung <strong>der</strong> Nachhallzeit von Räumen. Auf diese<br />
Möglichkeit sollte ggf. die Lehrkraft die Gruppe aufmerksam<br />
machen.<br />
Die Untersuchergruppen s<strong>in</strong>d für die gesamte Planung<br />
ihres Forschungsauftrags, für die Durchführung und<br />
für die Dokumentation zuständig. Die Lehrkraft ist als<br />
Coach jedoch ständig ansprechbar. Falls Sie sich als<br />
Lehrkraft für die soziologische (Befragungen) o<strong>der</strong> die<br />
naturwissenschaftliche (Messungen) Seite nicht kompetent<br />
betrachten, sollten Sie e<strong>in</strong>e/n qualifizierte/n<br />
Kollegen/Kolleg<strong>in</strong> e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den.<br />
Modul 3 (siehe oben) enthält e<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>en Fragebogen<br />
an die Adresse <strong>der</strong> Schüler. E<strong>in</strong>en an Lehrer gerichteten<br />
Fragebogen hat das Institut für Gesundheit <strong>in</strong><br />
pädagogischen Berufen zusammen mit dem Bayerischen<br />
Lehrer<strong>in</strong>nen- und Lehrerverband entwickelt (Download<br />
unter www.bllv.de/fileadm<strong>in</strong>/Dateien/Land-PDF/<br />
Gesundheit/BLLV_Laerm_2009_1_10-1_01.pdf). Diesen<br />
Fragebogen f<strong>in</strong>den Sie auch unter „Anleitungen und<br />
Arbeitsunterlagen“ am Ende dieser Modulbeschreibung.<br />
Erfahrungswerte über den Schallpegel <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
enthält auch folgende Tabelle, die auf e<strong>in</strong>e Lärmmessung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Humboldt-<strong>Schule</strong> (Kiel) zurückgeht (Quelle:<br />
www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/39309/).<br />
Tätigkeit 7. Klasse Schallpegel<br />
db(A)<br />
Klassenarbeit 45<br />
Vorsagen bei <strong>der</strong> Klassenarbeit 40-50<br />
Ruhige Klasse 60<br />
Schülerantworten 55-65<br />
Normal sprechende Lehrkraft 65-80<br />
Hof während <strong>der</strong> Pause 80<br />
Klasse vor dem E<strong>in</strong>treffen <strong>der</strong> Lehrkraft 90<br />
Lautester Lehrer 100<br />
Informationen zur physikalischen Lärmmessung und den<br />
Messgeräten enthält Modul 3 (siehe oben). Für die Nachhallmessung<br />
<strong>in</strong> Schulräumen benötigen Sie:<br />
• Gehörschutz (Ohrenstöpsel etc.)<br />
• Knallquelle (z.B. Schreckschusspistole)<br />
• Stativ<br />
• Schallpegelmessgerät mit Triggerfunktion, z.B.<br />
Schallpegelmeter CR-821.<br />
E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Anleitung enthält die Broschüre „Lärmm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
<strong>in</strong> <strong>Schule</strong>n“ des Hessischen Landesamts für<br />
Umwelt und Geologie (Downloadadresse:<br />
http://schuleundgesundheit.hessen.de/fileadm<strong>in</strong>/content/<br />
Medien/Laerm.pdf). Diese Broschüre gibt auch e<strong>in</strong>e gute<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die baulich-technischen Möglichkeiten zur<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Akustik von Schulräumen.<br />
Als optimale Nachhallzeiten werden von Fachleuten angegeben<br />
(nach Alfred Schmitz, „Nachhaltige akustische<br />
Schulraumsanierung“, Quelle: www.hlug.de/<br />
wirueberuns/veranstaltungen/schulraumsanierung/<br />
dokumente/schmitz.pdf):<br />
Ort Nachhallzeit <strong>in</strong> sec<br />
Klassenraum, Hörsaal,<br />
Sitzungsraum<br />
< 1,0<br />
Theater (Schauspiel) 1,0-1,4<br />
Theater (Oper) 1,2-1,8<br />
Konzertsaal 1,7-2,1<br />
Kirche > 2,0<br />
33
In <strong>der</strong> Auswertungsphase sollten die Untersuchungsteams<br />
sich freilich nicht nur auf die baulich-technischen<br />
Aspekte konzentrieren, wenn es um die Frage <strong>der</strong> Verbesserungsmöglichkeiten<br />
geht. Auch verhaltensorientierte<br />
und organisatorische Maßnahmen sollten diskutiert<br />
werden. Bevor überhaupt Abhilfemaßnahmen erörtert<br />
werden, sollten sich jedoch die verschiedenen Teams<br />
gegenseitig ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen<br />
vorstellen, um nach Möglichkeit zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten<br />
Gesamtbewertung zu kommen. Sich wi<strong>der</strong>sprechende<br />
o<strong>der</strong> schlecht mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu vere<strong>in</strong>barende Ergebnisse<br />
sollten soweit möglich – ggf. durch erneute Überprüfung<br />
– aufgeklärt werden, ohne dass jedoch e<strong>in</strong> Zwang<br />
zur Wi<strong>der</strong>spruchsfreiheit herrschen sollte. Manche <strong>der</strong><br />
Wi<strong>der</strong>sprüche sollte man vielleicht e<strong>in</strong>fach stehen lassen,<br />
um sie ggf. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Präsentationsphase mit dem Publikum<br />
o<strong>der</strong> auch mit Fachleuten zu diskutieren. Für die Präsentation<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse s<strong>in</strong>d verschiedene Ebenen denkbar,<br />
u.a.:<br />
• Veröffentlichung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schülerzeitung<br />
• Publikation auf <strong>der</strong> Website <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
• Vorstellung bei Projekttagen<br />
• Präsentation auf Schulveranstaltungen, Lehrer- und<br />
Elternkonferenzen<br />
• Präsentation und Diskussion beim Schulträger, <strong>in</strong><br />
Fachbehörden o<strong>der</strong> bei Beratungs- und Planungsbüros.<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Energie und Verkehr, Keplerstr.<br />
18, 66117 Saarbrücken, Fon 0681-5014500,<br />
www.umwelt.saarland.de; für das Thema „Lärm“ ist<br />
fachlich zuständig Dr. André Johann, Referat E/3, Fon<br />
0681-5014488, E-Mail a.johann@umwelt.saarland.de<br />
• Unfallkasse Saarland, Beethovenstr. 41, 66125 Saarbrücken,<br />
Fon 06897-97330, www.uks.de; Experte für<br />
den Lärm (auch <strong>in</strong> <strong>Schule</strong>n) ist Dr. Christoph Salm,<br />
Fon 06897-973350, E-Mail salm@uks.de<br />
• Institut für Gesundheit <strong>in</strong> pädagogischen Berufen,<br />
Bavariar<strong>in</strong>g 37, 80336 München, Fon 089-72100195,<br />
www.bllv.de/Das-Institut-IGP.514.0.html; wissenschaftlicher<br />
Leiter ist Prof. Dr. Joachim Bauer, E-Mail<br />
joachim.bauer@unikl<strong>in</strong>ik-freiburg.de; im Münchner<br />
Institut ist die Ansprechpartner<strong>in</strong> Heike Kamstedt,<br />
E-Mail <strong>in</strong>fo@gesundheit.bllv.de<br />
• Prof. Dr.-Ing. Alfred Schmitz, TAC - Technische<br />
Akustik, Am Zollhaus 50, 41352 Korschenbroich,<br />
Fon 02161-4029632, www.tac-akustik.de, E-Mail<br />
schmitz@tac-akustik.de.<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
Als Anregung zur Fragebogengestaltung f<strong>in</strong>den Sie auf<br />
<strong>der</strong> nächsten Seite e<strong>in</strong>e Vorlage des Instituts für Gesund-<br />
34<br />
heit <strong>in</strong> pädagogischen Berufen:<br />
• Fragebogen zur Akustik im Klassenzimmer<br />
(für Lehrer).
Fragebogen zur Akustik im Klassenzimmer<br />
Frage Ja Ne<strong>in</strong><br />
Gibt es auch <strong>in</strong> ruhigen o<strong>der</strong> diszipl<strong>in</strong>ierten Phasen e<strong>in</strong>en ständigen H<strong>in</strong>tergrundgeräuschpegel?<br />
Haben Sie das Gefühl, Ihre Klasse eigentlich nie wirklich ruhig zu bekommen?<br />
Ermahnen Sie die Schüler häufig, ruhiger zu se<strong>in</strong>?<br />
Steigt <strong>der</strong> Lärmpegel zum Ende des Unterrichtstages h<strong>in</strong> an?<br />
Empf<strong>in</strong>den Sie Ihre Klasse oft als zu laut?<br />
Vermeiden Sie offene o<strong>der</strong> handlungsorientierte Unterrichtsformen, da es schnell zu laut/unübersichtlich<br />
wird?<br />
Haben Sie das Gefühl, dass die Schüler permanent unruhigen Störlärm verursachen (Scharren<br />
o<strong>der</strong> Schaben mit den Füßen, Klappern mit Gegenständen, knarzendes Mobiliar)?<br />
Hören Sie beim Zerplatzen e<strong>in</strong>es Luftballons (ca. 2 m Abstand) e<strong>in</strong>en Nachhall?<br />
„Zischelt“ <strong>der</strong> Raum (Nachhall bei hohen Sprachlauten, wie s, z, sch)?<br />
„Dröhnt“ <strong>der</strong> Raum (Nachhall von dunklen/dumpfen Lauten)?<br />
Ermahnen Sie oft Schüler, lauter o<strong>der</strong> deutlicher zu sprechen?<br />
Kommt es im Unterrichtsgespräch immer wie<strong>der</strong> zu Missverständnissen?<br />
Verstehen Sie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e weiter h<strong>in</strong>ten sitzende Schüler schlecht?<br />
Beschweren sich Schüler häufig darüber, dass sie Sie nicht verstanden hätten?<br />
S<strong>in</strong>d die h<strong>in</strong>ten sitzenden Schüler schneller unruhig und abgelenkt als die vorne sitzenden?<br />
S<strong>in</strong>ken bei Schülern, die nach h<strong>in</strong>ten versetzt werden, u. U. die Schulleistungen?<br />
Beklagen sich Schüler über zu viel Lärm?<br />
Beklagen sich Schüler häufig über Kopf- o<strong>der</strong> Bauchschmerzen?<br />
Überanstrengen Sie oft Ihre Stimme (Räuspern, Hüsteln, Heiserkeit)?<br />
„Platzt“ Ihnen am Ende e<strong>in</strong>es Schultages <strong>der</strong> Kopf?<br />
Auswertungsh<strong>in</strong>weis: Wenn öfter „ja“ als „ne<strong>in</strong>“ angekreuzt wurde, sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong> gravierendes akustisches Prolem zu<br />
bestehen. Neben <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelfalldiskussion ist es s<strong>in</strong>nvoll, festzustellen, bei wie vielen Lehrkräften an er <strong>Schule</strong> die „ja“-<br />
Antworten überwiegen. Außerdem sollte man überprüfen, ob es auffallende Häufungen bei bestimmten Fragen gibt. Zu<br />
überprüfen wäre auch, ob es Korrelationen zwischen den Antworten und dem Unterrichtsfach o<strong>der</strong> bestimmten Klassenräumen<br />
gibt. Dazu sowie zur Erhebung von Verbesserungsvorschlägen kann es s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, den Fragebogen um weitere<br />
Fragen zu ergänzen, z.B.:<br />
35
Frage Ja Ne<strong>in</strong><br />
Gibt es Räume, die Ihnen beson<strong>der</strong>s „laut“ vorkommen?<br />
Halten Sie akustische Dämmmaßnahmen <strong>in</strong> den Unterrichtsräumen für zweckmäßig?<br />
Sollte es an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> spezielle „Ruhezonen“ geben?<br />
36
Modul 6: „Gegenlärm“ – goodforears-Disco<br />
Lernziel:<br />
In dem Unterrichtsmodul lernen die Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler, sich ergebnisorientiert mit <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Gesundheitsschädlichkeit<br />
des Disco-Lärms ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen.<br />
Sie h<strong>in</strong>terfragen die gängige These, dass Discolärm<br />
an sich die Hauptursache für spätere Hörschäden<br />
darstellt und gew<strong>in</strong>nen differenzierte E<strong>in</strong>sichten <strong>in</strong> die<br />
Zusammenhänge. Ziel des Moduls s<strong>in</strong>d jedoch nicht nur<br />
die Problematisierung des Themas, son<strong>der</strong>n konkrete Problemlösungen,<br />
die die E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Schüler zu lauter<br />
Discomusik und das Verhalten bee<strong>in</strong>flussen. Zu diesem<br />
Zweck entwickeln und realisieren die Schüler(<strong>in</strong>nen) e<strong>in</strong>e<br />
eigene schulische Discoveranstaltung.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Die Verb<strong>in</strong>dung zwischen Disco-Erlebnis und bewusstem<br />
Umgang mit den gesundheitsschädlichen<br />
Auswirkungen hoher Lärmbelastung fokussiert auf den<br />
„Subjektivitäts“-Aspekt <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>: Inwieweit<br />
ist me<strong>in</strong> eigenes Verhalten entscheidend für e<strong>in</strong>en<br />
nachhaltigen Umgang mit Lärm und Lärmfolgen?<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Die Konzeption und Realisierung <strong>der</strong> goodforears-Disco<br />
tra<strong>in</strong>iert Fähigkeiten <strong>der</strong> sozialen Partizipation als<br />
e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> Teilkompetenzen <strong>der</strong> Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Experimentierfreude und <strong>in</strong>novative Fähigkeiten werden<br />
von diesem Modul gefor<strong>der</strong>t, das <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
kreative Ideen für ohrenfreundliche Disco-Erlebnisse<br />
hervorbr<strong>in</strong>gen soll.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5, Musik: Zum Musikhören motivieren und befähigen<br />
(Hörerfahren sammeln und systematisieren)<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen, Ohr,<br />
Hören, Lärm)<br />
ERS 6/7, Katholische Religion: Ich se<strong>in</strong> – <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>schaft leben<br />
(Geme<strong>in</strong>sam Freizeit verbr<strong>in</strong>gen)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 9H, Erdkunde: Verdichtungsraum und ländlicher Raum (eigene<br />
Freizeite<strong>in</strong>richtungen lokalisieren)<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
ERS 10, Geschichte: Die Welt im Wandel (verän<strong>der</strong>tes Freizeitverhalten)<br />
GS 5/6, Musik: Wir und die Musik (Wir erkunden unsere Stimme)<br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Mitwirkung und<br />
Mitbestimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: K<strong>in</strong>dheit und Jugend<br />
(Jugendliche und ihre Lebenswelt)<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 8/9, Deutsch: Reflexion über Sprache (Jugendsprache,<br />
Jugendkultur)<br />
GYM 9, Sozialkunde: Leben <strong>in</strong> Gruppen (Jugendgruppen)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Für die selbstständige Erarbeitung <strong>der</strong> Problematik des<br />
Discolärms s<strong>in</strong>d 3-5 Unterrichtsstunden anzusetzen, die<br />
Konzeption <strong>der</strong> goodforears-Disco benötigt m<strong>in</strong>destens<br />
ebenfalls 5 Unterrichtsstunden. Für die Realisierung<br />
kann ke<strong>in</strong>e genauere Zeitangabe gemacht werden, da<br />
<strong>der</strong> Aufwand hier von den schulischen Gegebenheiten<br />
abhängt. Falls es an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> e<strong>in</strong>en geeigneten Raum,<br />
das technische Equipment und Erfahrungen mit <strong>der</strong> Abwicklung<br />
von Schulveranstaltungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Freizeit gibt,<br />
kann die Vorbereitung <strong>der</strong> Disco-Veranstaltung ebenfalls<br />
mit ca. 5 Unterrichtsstunden angesetzt werden, so dass<br />
dann <strong>in</strong>sgesamt 13-15 Unterrichtsstunden benötigt<br />
werden.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Aktivboxen für PC o<strong>der</strong> Laptop-Lautsprecher für<br />
Audiobeispiele<br />
Ablauf:<br />
Zum E<strong>in</strong>stieg eignet sich das Musikquiz „… nur wenn<br />
sie laut ist“ (siehe unter „H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s<br />
Thema“). Alternativ könnte auch e<strong>in</strong>e Gruppendiskussion<br />
über das Thema „Ist es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Disco umso besser, je lauter<br />
es ist?“ zur E<strong>in</strong>führung dienen.<br />
Da es sicher unterschiedliche Me<strong>in</strong>ungen geben wird, ob<br />
laute Musik und Discobesuche für das Gehör schädlich<br />
s<strong>in</strong>d, ergibt sich die Aufgabenstellung für die Recherchephase<br />
ohne weiteres: „Wie gefährlich ist laute Discomusik?“<br />
Mit dieser Frage sollten sich die Schüler(<strong>in</strong>nen)<br />
<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Gruppen mit 4-5 Teilnehmern befassen. Die<br />
Vorgehensweise sollte den Gruppen selbst überlassen<br />
werden. E<strong>in</strong>ige H<strong>in</strong>weise zur Bearbeitung geben folgende<br />
Schlüsselfragen:<br />
37
• Was denken Jugendliche über diese Frage?<br />
• Was sagen Ärzte und Wissenschaftler dazu? Gibt es<br />
statistische Aussagen?<br />
• Wie ist <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ische Zusammenhang zwischen<br />
hoher Lärmbelastung und Hörschäden?<br />
• Gibt es auch abweichende Me<strong>in</strong>ungen über die Gefährlichkeit<br />
<strong>der</strong> Lärmexposition?<br />
Um die Recherche und Diskussion zu differenzieren, sollte<br />
die Lehrkraft ggf. gezielt auf die bestehenden „abweichenden“<br />
Me<strong>in</strong>ungen von Wissenschaftlern wie Eckhard<br />
Hoffmann (siehe Modul 4) o<strong>der</strong> Gerald Fleischer (Kl<strong>in</strong>ikum<br />
<strong>der</strong> Justus-Liebig-Universität <strong>in</strong> Gießen) h<strong>in</strong>weisen.<br />
L<strong>in</strong>ks hierzu:<br />
• http://web.tiscali.it/musicculturclub/guest/<br />
lautemusik.htm<br />
• www.stern.de/wissen/gesund_leben/gehoer-laermdoch-nicht-schaedlich-fuers-ohr-501856.html<br />
• http://sciencev1.orf.at/science/news/64165<br />
• www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/<br />
hoeren-ohr-besitzt-eigenen-laermschutz_<br />
aid_363740.html.<br />
Bei <strong>der</strong> Formulierung <strong>der</strong> Frage nach <strong>der</strong> Gefährlichkeit<br />
<strong>der</strong> Discomusik sollten Sie als Lehrkraft bereits klarmachen,<br />
dass diese Frage nur den ersten Schritt zur eigentlichen<br />
Aufgabe darstellt, bei <strong>der</strong> es darum geht, e<strong>in</strong> <strong>in</strong>novatives<br />
Konzept für e<strong>in</strong>e neue Art <strong>der</strong> gehörfreundlichen<br />
Disco zu entwerfen und nach Möglichkeit umzusetzen.<br />
Dieses Projekt läuft unter dem Arbeitstitel „goodforears-<br />
Disco“ und soll möglichst an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> selbst erprobt<br />
und verwirklicht werden.<br />
Die nächste Zwischenfrage auf diesem Weg lautet: „Welche<br />
Lösungsvorschläge für die Entschärfung des Problems<br />
des Discolärms gibt es bereits? Wie bewertet ihr <strong>der</strong>en<br />
Effekt?“ Auch dieser Frage sollte wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den bereits<br />
gebildeten Arbeitsgruppen nachgegangen werden. Zu den<br />
bisher vorhandenen Lösungsideen zählen u.a.<br />
• die Begrenzung <strong>der</strong> Laustärke <strong>in</strong> Discos auf 99 Dezibel<br />
(www.jugendhilfeportal.de/wai/showcontent.<br />
asp?ThemaID=5870)<br />
• das Angebot e<strong>in</strong>es DJ-Führersche<strong>in</strong>s<br />
(www.dj-fuehrersche<strong>in</strong>.com)<br />
• die Entwicklung spezieller Ohrstöpsel, die die Musik<br />
auf allen Frequenzen gleichermaßen dämpfen, also<br />
nicht zu Verzerrungen führen (www.sonicshop.de/De/<br />
Plugs/MusicSafe-3.asp)<br />
• die Erf<strong>in</strong>dung von „Stillen Discos“ (www.<strong>der</strong>westen.<br />
de/staedte/attendorn/Erste-stille-Disco-startet-<strong>in</strong>-<br />
Suedwestfalen-im-Oktober-id184165.html)<br />
• die Empfehlung, dem Ohr nach Lärme<strong>in</strong>wirkungen<br />
bewusste und ausreichende Ruhephasen zu gönnen<br />
(Interview mit dem Direktor <strong>der</strong> HNO-Kl<strong>in</strong>ik <strong>in</strong> Leipzig,<br />
Roland Laszig, zum Download unter<br />
38<br />
www.echo-fm.uni-frei-burg.de/archiv/mp3/hoerschaeden.mp3/archive_view.<br />
Die Schüler(<strong>in</strong>nen) sollten diese und eventuelle weitere<br />
Ansätze selbst recherchieren und versuchen, die verschiedenen<br />
Lösungen aus ihrer eigenen Sicht zu bewerten.<br />
Welche <strong>der</strong> Vorschläge f<strong>in</strong>den sie gut und praktikabel,<br />
welche nicht? Die Rechercheergebnisse und <strong>der</strong>en<br />
Bewertungen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er „goodforears-Disco“-Planungskonferenz,<br />
an <strong>der</strong> alle Arbeitsgruppen teilnehmen,<br />
präsentiert und mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verglichen. Als Lehrkraft s<strong>in</strong>d<br />
Sie <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ator dieser Konferenz, an <strong>der</strong>en Ende <strong>der</strong><br />
abschließende Arbeitsauftrag steht: „Nutzt die bisherigen<br />
Informationen, Erkenntnisse und E<strong>in</strong>schätzungen, um e<strong>in</strong><br />
Schul-Disco-Konzept zu entwickeln, das e<strong>in</strong>en Beitrag<br />
zum bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit dem<br />
Lärmproblem leistet! Versucht dieses Konzept dann auch<br />
geme<strong>in</strong>sam zu realisieren!“<br />
Mit diesem Qualitätssiegel soll <strong>der</strong> Schallpegel <strong>in</strong> Diskotheken unter<br />
Kontrolle gebracht werden<br />
Welche <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Recherchephase gefundenen Lösungsvorschläge<br />
de Schüler(<strong>in</strong>nen) <strong>in</strong> ihrem Disco-Konzept<br />
umsetzen und welche <strong>in</strong>novativen Elemente sie vielleicht<br />
selbst entwickeln, bleibt ihnen überlassen. Die Konzeption<br />
und Realisierung <strong>der</strong> Disco erfor<strong>der</strong>t ja auch e<strong>in</strong> Kommunikationskonzept,<br />
mit dem die Schüler ihren Mitschülern<br />
erklären, worum es geht. Auch hierfür werden Ideen<br />
gesucht. Viele <strong>der</strong> Detailfragen (z.B. ob die E<strong>in</strong>haltung von<br />
Lärmgrenzen durch e<strong>in</strong>e ständige, eventuell sogar visualisierte<br />
Lärmmessung geschehen soll, ob es ausgewiesene<br />
Bereiche mit ger<strong>in</strong>gerer Lärmexposition geben soll, für<br />
<strong>der</strong>en Nutzung beson<strong>der</strong>e Incentives verwendet werden<br />
etc.) müssen auch entsprechend <strong>der</strong> vorhandenen Möglichkeiten<br />
und Rahmenbed<strong>in</strong>gungen entschieden werden.
Disco mit beruhigten Bereichen. Beispiel aus: Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmediz<strong>in</strong>, „Gehörschäden durch Musik“, 2004, Download unter<br />
www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Gesundheitsschutz/Gs05.pdf?__<br />
blob=publicationFile. Die Publikation gibt e<strong>in</strong>e sehr anschauliche E<strong>in</strong>führung<br />
<strong>in</strong> die Zusammenhänge zwichen Lärmbelastung und Gehör.<br />
Partner und Auskungeber:<br />
• Prof. Dr. Gerald Fleischer, Arbeitsgruppe Hörfor schung,<br />
Justus-Liebig-Universität Giessen, Aul-weg 123, 35392<br />
Giessen, Fon 0641-99 47180, http://141.50.39.26/<br />
ag-hoerforschung/de; E-Mail Gerald.Fleischer@audio.<br />
med.uni-giessen.de<br />
• Berufsverband Diskjockey e.V. (BDV), Hungerkamp 4c,<br />
38104 Braunschweig, Fon 0531-23799260,<br />
www.dj-fuehrersche<strong>in</strong>.com; zuständig für den DJ-<br />
Messreihe <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken (November/Dezember 2007)<br />
Lokal Nr. Größe <strong>der</strong><br />
Tanzfläche<br />
(circa)<br />
Anzahl<br />
Lautsprecher<br />
Musik Alter <strong>der</strong><br />
Gäste<br />
(circa)<br />
1 # 20 m 3 4 Pop/Rock über 25<br />
Führersche<strong>in</strong> ist Myrco Keppler, Fon 0531-23799264,<br />
E-Mail sem<strong>in</strong>are@discjockey.de<br />
• Dr. Wolfgang Babisch, Umweltbundesamt (UBA),<br />
Fachgebiet II 1.1, Bismarckplatz 1, 14193 Berl<strong>in</strong>, www.<br />
umweltbundesamt.de/; Babisch ist Lärmspezialist am<br />
UBA, Fon 030-89031370, E-Mail wolfgang.babisch@<br />
uba.de<br />
• Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
<strong>der</strong> Hansestadt Hamburg, Fachab-<br />
teilung Gesundheit und Umwelt, Billstr. 80, 20539<br />
Hamburg, Fon 040-428280, www.hamburg.de/bsu/; für<br />
die Lärmmessung <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken mit verantwortlich<br />
war Dipl.-Biol. Annette Wagner, Fon 040-<br />
428282402, E-Mail annete.wagner@bsu.hamburg.de<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
Als Diskussionsanregung für die Klasse o<strong>der</strong> Projektgruppe<br />
f<strong>in</strong>den Sie auf <strong>der</strong> nächsten Seite zwei Auswertungen aus<br />
e<strong>in</strong>er Lärmmessung <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken, die e<strong>in</strong>e Arbeitsgruppe<br />
vielleicht dazu anregt, selbst Messungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
eigenen Stadt zu machen:<br />
• Messprogramm „Lautstärke <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken<br />
und Tanzbetrieben“, zum Download unter http://<br />
www.hamburg.de/contentblob/768036/data/messprogramm-diskotheken.pdf.<br />
Datum <strong>der</strong><br />
Messung<br />
Startzeit/<br />
Messdauer<br />
Mitteilungspegel<br />
A-bewertet<br />
Dezibel<br />
L Aeq<br />
Zielwert 99<br />
18.07.07<br />
(Sa/So) 0,43/12 M<strong>in</strong>. 103 126<br />
2 # 25 m 3 4 HipHop 20 18.07.07 1,03/12 M<strong>in</strong>. 105 132<br />
3 ## 4<br />
Elektro/<br />
Pop/Rock 20 18.07.07 1,10/17 M<strong>in</strong>. 104 134<br />
4 ## 80 m 3 8 Elektro 18-25 18.07.07 1,17/16 M<strong>in</strong>. 106 134<br />
5a # > 60 m 3 6 Pop/Rock 18-25 18.07.07 2,15/11 M<strong>in</strong>. 105 138<br />
5b # m 3<br />
Bühnenrand<br />
Pop/Rock 18-30 18.07.07 2,28/02 M<strong>in</strong>. 105 133<br />
6 40 m 3 8 Metal k. A. 18.07.07 2,44/16 M<strong>in</strong>. 103 135<br />
Spitzenwert<br />
C-bewertet<br />
Dezibel<br />
L Cpeak<br />
max. 135<br />
Fortsetzung <strong>der</strong> Tabelle und Legende: nächste Seite<br />
39
Lokal Nr. Größe <strong>der</strong><br />
Tanzfläche<br />
(circa)<br />
40<br />
Anzahl<br />
Lautsprecher<br />
Musik Alter <strong>der</strong><br />
Gäste<br />
(circa)<br />
Datum <strong>der</strong><br />
Messung<br />
Startzeit/<br />
Messdauer<br />
Mitteilungspegel<br />
A-bewertet<br />
Dezibel<br />
L Aeq<br />
Zielwert 99<br />
7 ## 40 m 3 k. A. Pop/Rock 20-30 18.07.07 2,51/20 M<strong>in</strong>. 100 130<br />
8 # 50 m 3 6<br />
9 50 m 3 10<br />
10<br />
Pop/Rock/<br />
Metal 20-25 08.12.07 0,07/11 M<strong>in</strong>. 101 129<br />
Rock/<br />
House 18-25 08.12.07 0,24/06 M<strong>in</strong>. 102 132<br />
30 m 3 wenig<br />
Betrieb 6 Rock über 25 08.12.07 0,33/05 M<strong>in</strong>. 104 135<br />
12 20 m 3 wenig<br />
Betrieb<br />
4 Pop 18-25 08.12.07 0,45/08 M<strong>in</strong>. 94 135<br />
13 30 m 3 6 Pop/Rock 18-30 08.12.07 1,04/07 M<strong>in</strong>. 107 131<br />
14 40 m 3 8 HipHop 20-25 08.12.07 1,13/06 M<strong>in</strong>. 107 135<br />
15 # 25 m 3 6 Techno 18-20 08.12.07 1,27/07 M<strong>in</strong>. 107 126<br />
16 ## 80 m 3 k. A. Pop/Rock 20-40 08.12.07 1,51/06 M<strong>in</strong>. 102 127<br />
17 ## 60 m 3 8 Pop/Rock 20-30 08.12.07 2,00/08 M<strong>in</strong>. 97 139<br />
18 # 110 m 3 8+ Elektro 20-30 08.12.07 2,28/07 M<strong>in</strong>. 103 137<br />
19 60 m 3 8 große<br />
sichtbar<br />
House<br />
/Elektro<br />
20 ## 60 m 3 4 Rock,<br />
70er/Live-<br />
Musik<br />
20-30 09.12.07 0,05/12 M<strong>in</strong>. 107 128<br />
20 09.12.07 0,33/08 M<strong>in</strong>. 99 126<br />
21 # k. A. m 3 6 Pop/Rock 20-40 09.12.07 1,06/10 M<strong>in</strong>. 103 124<br />
22 ## 60 m 3 6 House 20-25 09.12.07 1,28/04 M<strong>in</strong>. 103 128<br />
23 ## 40 m 3 4+ Elektro/<br />
New<br />
18-25 09.12.07 1,34/08 M<strong>in</strong>. 100 124<br />
24 ## 100 m 3 6 Pop/Rock 18-30 09.12.07 1,47/06 M<strong>in</strong>. 101 126<br />
25 100 m 3 10+ Hard-Rock 20-30 09.12.07 2,00/06 M<strong>in</strong>. 103 131<br />
26 ## 30 m 3 6 Pop/Rock 20-25 09.12.07 2,26/08 M<strong>in</strong>. 106 134<br />
27 # 80 m 3 6-8 Pop/Rock 20-40 09.12.07 2,43/09 M<strong>in</strong>. 102 132<br />
# Es wird auch außerhalb <strong>der</strong> Tanzfläche getanzt k. A. ke<strong>in</strong>e Angabe<br />
## Es wird weitgehend im gesamten Lokal getanzt<br />
Spitzenwert<br />
C-bewertet<br />
Dezibel<br />
L Cpeak<br />
max. 135
Aus dem Messbericht von 2008:<br />
„Insgesamt ist festzustellen, dass die Branche <strong>in</strong> Hamburg nicht o<strong>der</strong> nur zu e<strong>in</strong>em verschw<strong>in</strong>dend ger<strong>in</strong>gen Teil 99<br />
Dezibel e<strong>in</strong>hält, wie von <strong>der</strong> Gesundheitsm<strong>in</strong>isterkonferenz und <strong>der</strong> DIN 15905-5 gefor<strong>der</strong>t. Es werden auch we<strong>der</strong> e<strong>in</strong><br />
Schallpegelmessgerät noch e<strong>in</strong>e Pegelanzeige entdeckt. E<strong>in</strong> Pegelmessgerät ist jedoch elementare technische Voraussetzung<br />
dafür, dass <strong>der</strong> DJ wahrnehmen kann, wie laut es ist. Will man den Betreibern die Kosten für e<strong>in</strong> Pegelmessgerät als<br />
H<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsgrund zu Gute halten, könnten diese als vorsorgende Maßnahme zum<strong>in</strong>dest Gehörschutz für die Gäste bereithalten.<br />
Dies war nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Lokal <strong>der</strong> Fall, wo dieser käuflich erworben werden.“<br />
Die Grafik zeigt, wie groß <strong>der</strong> Abstand zwischen <strong>der</strong> Gehörschutzgrenze am Arbeitsplatz (85 dB) sowie Empfehlung <strong>der</strong> Gesundheitsm<strong>in</strong>ister für<br />
die Lärmbelastung <strong>in</strong> Diskotheken (99 dB) und <strong>der</strong> tatsächlichen Situation <strong>in</strong> Hamburger Diskotheken ist. Vergleichbare Messungen <strong>in</strong> Bayern und<br />
Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz zeichneten e<strong>in</strong> ähnliches Bild.<br />
41
Modul 7: Wir komponieren e<strong>in</strong>e Lärmoper<br />
Lernziel:<br />
Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler lernen den musikgeschichtlich<br />
überschaubaren Bereich <strong>der</strong> Geräuschkunst<br />
kennen und versuchen sich an e<strong>in</strong>er eigenen Komposition<br />
e<strong>in</strong>er Lärmoper, die ihre Thematik aus <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
Lärmproblematik nimmt – Verkehrslärm, Lärm <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong>, Discolärm etc. In dem Modul verb<strong>in</strong>det sich das<br />
Wissen um die kulturhistorische Phase, die Geräusche<br />
und Lärm zum Vehikel künstlerischer Produktion machte,<br />
mit <strong>der</strong> Erprobung <strong>der</strong> eigenen Kreativität und Erfahrungen<br />
mit kreativen Produktionsprozessen.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Die „Subjektivität“ als <strong>Nachhaltigkeit</strong>sdimension<br />
steht im Zentrum des Moduls. Die Dramatik e<strong>in</strong>er<br />
Oper kann die Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit Täter- und<br />
Opferrollen thematisieren und erlaubt die Konstruktion<br />
des Helden-/Held<strong>in</strong>nen-Typus.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Das Projekt eignet sich für die Entwicklung von<br />
Kompetenzen, die mit Motivation zu tun haben;<br />
es geht darum, sich selbst und vielleicht auch die<br />
an<strong>der</strong>en Teammitglie<strong>der</strong> zu motivieren und e<strong>in</strong>e<br />
arbeitsteilige Vorgehensweise für e<strong>in</strong> ehrgeiziges<br />
Projekt zu organisieren.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Das Modul för<strong>der</strong>t die kreativen und experimentellen<br />
Lernwege.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5, Musik: Zum Musikhören motivieren und befähigen<br />
(Hörerfahren sammeln und systematisieren)<br />
ERS 10, Musik: Musiktheater<br />
GS 5/6, Musik: Wir und die Musik (Wir erkunden unsere<br />
Stimme)<br />
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Mitwirkung und<br />
Mitbestimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
GYM 7, Musik: Musiktheater<br />
GYM 9, Sozialkunde: Leben <strong>in</strong> Gruppen (Jugendgruppen)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Für die selbstständige Erarbeitung des kulturhistorischen<br />
Kontextes <strong>der</strong> Lärmoper s<strong>in</strong>d 4-5 Unterrichtsstunden<br />
anzusetzen; ohne diesen anspruchsvollen E<strong>in</strong>stieg reicht<br />
42<br />
auch 1 Unterrichtsstunde für die H<strong>in</strong>führung auf das<br />
Projekt (Musikquiz und allgeme<strong>in</strong>e Diskussion). Die<br />
Konzeption und Komposition e<strong>in</strong>er eigenen Lärmoper<br />
benötigt m<strong>in</strong>destens 10-12 Unterrichtsstunden. Soll<br />
e<strong>in</strong>e Aufführung vorbereitet werden, vergrößert sich <strong>der</strong><br />
Zeitaufwand um weitere 3-5 Unterrichtsstunden.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Aktivboxen für PC o<strong>der</strong> Laptop-Lautsprecher für<br />
Audiobeispiele<br />
• MD-Rekor<strong>der</strong> mit Mikrofon o<strong>der</strong> Handy-Rekor<strong>der</strong> wie<br />
den Zoom H2; zu letzterem gibt es Informationen<br />
aus Sicht <strong>der</strong> Verwendung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> unter<br />
www.lehrer-onl<strong>in</strong>e.de/h2-handyrecor<strong>der</strong>.php<br />
• PC mit Soundkarte und Audiomixer (z.B. Magix Music<br />
Maker)<br />
Ablauf:<br />
Zum E<strong>in</strong>stieg eignet sich das Musikquiz „… nur wenn<br />
sie laut ist“ (siehe unter „H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s<br />
Thema“). Die Aufgabenstellung, die sich daran anschließt,<br />
lautet: „Gibt es e<strong>in</strong>e Grenze zwischen Musik und Lärm?“<br />
Für e<strong>in</strong>e anspruchsvollere Diskussion dieser Frage gehen<br />
die Schüler(<strong>in</strong>nen) <strong>in</strong> Gruppen zu 4-6 Mitglie<strong>der</strong>n eigenen<br />
Recherchen nach. Stichworte für diese Recherchen<br />
können ggf. von <strong>der</strong> Lehrkraft gegeben werden:<br />
• Was charakterisiert sogenannte Noise-Bands?<br />
• Was bekommt ihr über die „Geräuschkunst“ <strong>der</strong> „proletarischen“<br />
Musikbewegung <strong>der</strong> 30er Jahre („Proletkult“)<br />
heraus?<br />
Unter www.myspace.com/l<strong>in</strong>ijamass f<strong>in</strong>det man Hörbeispiele<br />
von Geräuschmusik <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> russischen<br />
„<strong>in</strong>dustriellen“ Musik. E<strong>in</strong>e deutsche Industrial-Band<br />
ist „Haus Arafna“ (www.myspace.com/hausarafna). Auf<br />
youtube (www.youtube.com) stehen unter dem Stichwort<br />
„L<strong>in</strong>ija Mass“ etliche Geräuschmusiken zur Verfügung.<br />
Um sie downzuloaden, können Sie beispielsweise das<br />
Programm DownloadHelper (www.downloadhelper.net/<br />
<strong>in</strong>stall.php) nutzen, das sich automatisch <strong>in</strong> den Internetbrowser<br />
Firefox (www.mozilla-europe.org/de/firefox)<br />
<strong>in</strong>tegriert.<br />
Anschließend wird die Hauptaufgabe präsentiert:<br />
„Komponiert selbst so etwas wie e<strong>in</strong>e ‚Lärmoper‘! Dazu<br />
benötigt ihr e<strong>in</strong> musikalisches Konzept, das vor allem
mit Geräuschen funktioniert, und e<strong>in</strong>e Theaterhandlung,<br />
die <strong>in</strong> <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Geräusch- und Lärmwelt spielen soll.“<br />
Es kann den Schülern selbst überlassen bleiben, ob sie<br />
eher von <strong>der</strong> Geräusch-Inszenierung ausgehen und darum<br />
herum e<strong>in</strong>e Handlung bauen o<strong>der</strong> umgekehrt e<strong>in</strong> „Lärmdrama“<br />
konstruieren, das entsprechend geräuschvoll <strong>in</strong> Szene<br />
gesetzt wird. E<strong>in</strong>e Idee bestünde z.B. dar<strong>in</strong>, das Schulleben<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Geräuschen abzubilden und daraus e<strong>in</strong>e dramatische<br />
Geräusch- und Lärmkomposition zu machen.<br />
E<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en geeigneten E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Kompositionsarbeit<br />
bietet die Suche nach Geschichten, die mit Lärm<br />
zu tun haben. Im Internet f<strong>in</strong>det man z.B.:<br />
• „Drama im französischen Elsass. Wut über Lärm:<br />
Rentner erschießt Jugendlichen“ (12.06.2009);<br />
http://abendblatt.de/vermischtes/article1050565/Wutueber-Laerm-Rentner-erschiesst-Jugendlichen.html<br />
• „So fiebern die Bergleute ihrer Rettung entgegen:<br />
Der Bohr-Lärm ist Musik für uns!“ (06.10.2010);<br />
www.bild.de/BILD/news/2010/10/06/chile-vorfreude/<br />
countdown-zur-rettung.html<br />
• „E<strong>in</strong>e Hölle aus Wasser und Lärm: Fünf Jahre nach<br />
‚Katr<strong>in</strong>a‘…Fünf Jahre nach dem Monster-Hurrikan<br />
‚Katr<strong>in</strong>a‘ steht New Orleans wie<strong>der</strong> recht gut da,<br />
wenn auch mit verän<strong>der</strong>tem Gesicht. Dann kam mit<br />
<strong>der</strong> Ölpest <strong>der</strong> nächste Schlag. Viele fragen sich, ob<br />
die Jazzmetropole im Süden <strong>in</strong>zwischen wirklich<br />
sicher ist“ (27.08.2010)¸ www.n-tv.de/panorama/<br />
Fuenf-Jahre-nach-Katr<strong>in</strong>a-article1364696.html<br />
• „Lärm und Wut … regieren <strong>in</strong> den Pariser Vorstadtghettos.<br />
Jugendtragödie um zwei ungleiche Freunde…<br />
E<strong>in</strong>e Betonwüste nahe Paris: Schlägereien und<br />
Vergewaltigungen s<strong>in</strong>d an <strong>der</strong> Tagesordnung. Just<br />
hierhergezogen, freundet sich <strong>der</strong> 13-jährige Bruno<br />
mit Nachbarssohn Jean-Roger an. Um se<strong>in</strong>em brutalen<br />
Vater Marcel zu imponieren, legt Jean-Roger<br />
schon mal Feuer im Treppenhaus. Als er bemerkt,<br />
dass e<strong>in</strong>e Lehrer<strong>in</strong> Bruno privat Nachhilfe gibt,<br />
<strong>in</strong>formiert <strong>der</strong> vere<strong>in</strong>samte Junge den Rektor über<br />
die ‚anrüchige‘ Beziehung - e<strong>in</strong> Verrat mit tödlichen<br />
Folgen. Regisseur und Autor Brisseau verarbeitete<br />
Erfahrungen als Vorstadtlehrer“ (Film von 1988, FSK<br />
16); www.c<strong>in</strong>ema.de/k<strong>in</strong>o/filmarchiv/film/laerm-undwut,1325216,ApplicationMovie.html<br />
• „Lärm <strong>in</strong> fremden Län<strong>der</strong>n: In den Mega-Städten<br />
Asiens und Südamerikas wird <strong>der</strong> ‚normale‘ Straßenlärm<br />
zu e<strong>in</strong>em Stressfaktor… Angststörungen und<br />
an<strong>der</strong>e psychische Probleme f<strong>in</strong>den sich u.a. auch bei<br />
Reisenden <strong>in</strong> Großstädten nicht selten“ (07.07.2010);<br />
www.geo.de/GEO/reisen/reise<strong>in</strong>formationen/Laerm.html<br />
Für die Lärmoper müssen nicht alle Sounds selbst aufgenommen<br />
werden. Im Internet gibt es mehrere Soundbibliotheken,<br />
aus denen man kostenlos Sounddateien herunterladen<br />
kann, u.a.:<br />
• www.freesound.org<br />
• www.pdsounds.org/<br />
• soundbible.com/<br />
• www.podcast.soundshifter.de<br />
• http://free-loops.com/free-loops.php<br />
Zum Downloaden, Speichern, Mixen und Abmischen <strong>der</strong><br />
Sounds für die Lärmoper ist technisches Equipment nötig<br />
(siehe unter „Benötigte Materialien“). Falls Sie selbst<br />
ke<strong>in</strong>e Erfahrung mit <strong>der</strong> dazu nötigen Hard- und Software<br />
haben und sich auch nicht völlig von den technisch<br />
gewieften Schülern Ihrer Klasse abhängig machen wollen,<br />
b<strong>in</strong>den Sie e<strong>in</strong>e geeignete Fachlehrkraft Ihrer <strong>Schule</strong><br />
e<strong>in</strong>. Oft haben auch Jugendprojekte eigene Tonstudios<br />
<strong>in</strong>klusive kundiger Betreiber und User, die Sie mit Ihrer<br />
Klasse für das Projekt nutzen können.<br />
Für die Konzeptions- und Realisierungsphase <strong>der</strong> Lärmoper<br />
empfiehlt es sich, e<strong>in</strong> arbeitsteiliges Vorgehen<br />
zusammen mit Ihrer Schulklasse zu organisieren. Die<br />
erste kreative Konzeption könnte <strong>in</strong> mehreren kle<strong>in</strong>en<br />
Teams (4-6 Mitglie<strong>der</strong>) stattf<strong>in</strong>den, die jedes für sich e<strong>in</strong>e<br />
Idee für die Lärmoper entwickeln. Aus den verschiedenen<br />
Ideen und Konzeptvorstellungen wird dann entwe<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>e ausgesucht, die die höchste Zustimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Klasse f<strong>in</strong>det und am besten zu realisieren ist, o<strong>der</strong> es<br />
werden mehrere Ideenvorschläge mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verknüpft.<br />
In <strong>der</strong> anschließenden Planungsphase werden die Arbeiten<br />
festgelegt und e<strong>in</strong> Zeit- und Ressourcenplan erstellt.<br />
Dabei wird deutlich werden, dass es verschiedene Aufgabentypen<br />
gibt, die von spezialisierten Teams angegangen<br />
werden:<br />
• Ausarbeitung <strong>der</strong> Story und Kompositionsarbeit<br />
• Beschaffung <strong>der</strong> benötigten Sounds (eigene Aufnahmen,<br />
Internet-Recherche und Download, ggf. sogar<br />
eigene Geräuschproduktion und –aufnahme)<br />
• Beschaffung des technischen Equipments und Know-<br />
How für die technische Realisierung<br />
• Zentrales Projektmanagement, das die Zusammenarbeit<br />
<strong>der</strong> Teams organisiert, den Zeitplan überwacht<br />
und ggf. weitere externe Ressourcen beschafft<br />
• Falls e<strong>in</strong>e Aufführung geplant ist, benötigt man auch<br />
e<strong>in</strong> Market<strong>in</strong>g- und Eventmanagement-Team.<br />
Als Hilfsmittel für die Komposition eignet sich die Anfertigung<br />
e<strong>in</strong>es Storyboards, also e<strong>in</strong>er visuellen Darstellung<br />
des Konzepts, die den Ablauf und die Dramaturgie<br />
<strong>der</strong> Lärmoper verdeutlicht und die wesentlichen „E<strong>in</strong>stellungen“<br />
(Sound, Licht, Akteure etc.) festhält. Unter<br />
„Anleitungen und Arbeitsunterlagen“ f<strong>in</strong>den Sie e<strong>in</strong>e<br />
Vorlage für das Storyboard.<br />
Die Lärmoper kann <strong>in</strong> verschiedenen Formen realisiert<br />
werden. Welche gewählt wird, hängt sowohl von <strong>der</strong><br />
Story ab als auch von den vorhandenen technischen<br />
Möglichkeiten sowie vom Interesse <strong>der</strong> Schüler(<strong>in</strong>nen).<br />
43
Die Lärmoper kann<br />
• als re<strong>in</strong>e Hörversion o<strong>der</strong> Hörcollage (nur Geräusche,<br />
Töne, Musik)<br />
• als Hörversion mit Text<br />
• als Audioversion mit Lichteffekten o<strong>der</strong> Diashow<br />
• als Theaterversion mit Pantomime<br />
• als Theaterversion mit Schauspielern<br />
produziert werden.<br />
Je mehr theatrale Elemente verwendet werden, desto <strong>in</strong>teressanter<br />
wäre auch e<strong>in</strong>e Kooperation mit <strong>der</strong> Theater-<br />
AG an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> (falls es e<strong>in</strong>e solche gibt).<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Hochschule für Musik Saar (HFM), Bismarckstr. 1,<br />
66111 Saarbrücken, Fon 0681-9673112,<br />
www.hfm.saarland.de; Ansprechpartner für elektronische<br />
Musik ist hier z.B. Prof. Dr. Claas Willeke,<br />
Katholisch-Kirch-Str. 15, 66111 Saarbrücken, Fon<br />
0681-9687161, E-Mail mail@claaswilleke.de<br />
• Unser Malstatt – E<strong>in</strong> Stadtteil <strong>in</strong> Bewegung, Luisenthaler<br />
Straße 11, 66115 Saarbrücken, Fon 0681-<br />
94063346, www.unser-malstatt-onl<strong>in</strong>e.de; das<br />
Jugendzentrum för<strong>der</strong>t Theater- und Musikprojekte<br />
und hat e<strong>in</strong> von den Jugendlichen selbst e<strong>in</strong>gerichtetes<br />
Tonstudio; Ansprechpartner ist Bernd Becken,<br />
E-Mail bernd.becken@unser-malstatt-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
E<strong>in</strong>e Storyboard-Vorlage erleichtert die Konzeption <strong>der</strong><br />
Lärmoper.<br />
44
Storyboard „Lärmoper“<br />
1. Szene Nr. Textliche o<strong>der</strong> bildliche Darstellung <strong>der</strong> Szene<br />
2. Geräusch, Ton, Musik Lichteffekte, Diashow Text (Off o<strong>der</strong> Bühne) Schauspieler (Pantomime<br />
o<strong>der</strong> Sprecher)<br />
3. Technische Anweisung Technische Anweisung Technische Anweisung Technische Anweisung<br />
4. Übergänge<br />
5. Dauer<br />
1. Für jede Szene ist e<strong>in</strong> eigenes Blatt anzulegen und auszufüllen; die Darstellung <strong>der</strong> Szene sollte <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie bildlich<br />
se<strong>in</strong> (freie Skizze)<br />
2. In den Rubriken „Geräusch…“, „Licht…“, „Text…“ und „Schauspieler…“ bitte e<strong>in</strong>e kurze Def<strong>in</strong>ition bzw. Regieanweisung<br />
e<strong>in</strong>tragen<br />
3. Technische Anweisungen, E<strong>in</strong>stellungen etc. für jede <strong>der</strong> Rubriken darunter e<strong>in</strong>tragen<br />
4. Anschlüsse an die nächste Szene def<strong>in</strong>ieren (Ausblenden, Abgang, Dimmen etc.)<br />
5. Die Dauer <strong>der</strong> Szene <strong>in</strong> m<strong>in</strong>:sec angeben (ggf, schätzen)<br />
45
Modul 8: Stummer Dialog - Erfahrungsfeld<br />
Lernziel:<br />
Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler setzen sich <strong>in</strong> diesem<br />
Modul mit ihrer eigenen Erfahrungswelt ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Die<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung, sich gegenseitig über das Thema „Lärm“<br />
zu verständigen, ohne dass die Kommunikationsebene<br />
<strong>der</strong> Sprache und das Medium „Schall“ verwendet werden,<br />
erschließt nicht nur neue Zugänge zu an<strong>der</strong>en, nonverbalen<br />
Kommunikationswegen, son<strong>der</strong>n ist auch e<strong>in</strong>e Übung<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>fühlungsvermögen und Reflexion schlechth<strong>in</strong>.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Der Begriff „Erfahrungsfeld“ weist bereits darauf h<strong>in</strong>,<br />
dass auch <strong>in</strong> diesem Modul <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> „Subjektivität“<br />
im Mittelpunkt steht. In e<strong>in</strong>em verfremdeten<br />
Sett<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> dem es darum geht, ohne die Erzeugung<br />
von Schallwellen e<strong>in</strong>en Dialog über Lärm <strong>in</strong> Gang zu<br />
setzen, s<strong>in</strong>d alle Beteiligten auf sich selbst verwiesen.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
In diesem Modul geht es um die Reflexion von Leitbil<strong>der</strong>n<br />
auf e<strong>in</strong>er sehr basalen Ebene. Was passiert,<br />
wenn das Leitmedium „Schall“ wegfällt. Verän<strong>der</strong>t<br />
sich unsere Orientierung? Erleben wir nur e<strong>in</strong>en<br />
Mangel – o<strong>der</strong> erweitert sich unser Erfahrungsfeld<br />
vielleicht sogar?<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Der Stumme Dialog stellt den kommunikativen<br />
Aspekt des Lernens <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund. Ausdrucksfähigkeit<br />
und E<strong>in</strong>fühlungsvermögen s<strong>in</strong>d gefor<strong>der</strong>t, es<br />
geht um soziales Lernen.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5/6/8H/9H, Deutsch: Lesen<br />
ERS 6, Arbeitslehre: Holz – Textiltechnik (Wahlthema):<br />
Wir spielen –Schattenspiel<br />
GS 5/6, Bildende Kunst: Ich und me<strong>in</strong>e neue Klasse (Das<br />
alles gehört zu mir)<br />
GS 7/8, Bildende Kunst: Sehen – Skizzieren - Zeichnen<br />
GS 9/10, Bildende Kunst: Me<strong>in</strong> Gesicht erzählt nicht<br />
alles über mich<br />
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Unsere <strong>Schule</strong> (Der<br />
Schulweg)<br />
GYM GOS, Allgeme<strong>in</strong>e Ethik: Der Mensch als Person<br />
(Akzeptanz <strong>der</strong> Personalität des An<strong>der</strong>en, Schreiben von<br />
Dialogen)<br />
GYM 5/6, Deutsch: Umgang mit Texten und Medien<br />
(Monolog und Dialog)<br />
46<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Der Stumme Dialog kann <strong>in</strong> zeitlichen Varianten zwischen<br />
2 bis 4 Unterrichtsstunden realisiert werden,<br />
abhängig von den e<strong>in</strong>gesetzten Medien und <strong>der</strong> Intensität<br />
<strong>der</strong> anschließenden Reflexion. Wenn er zu e<strong>in</strong>em<br />
Erfahrungsfeld ausgebaut werden soll (das als ständige<br />
Option <strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse o<strong>der</strong> z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „Leiseraum“ <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong> – vgl. Modul 2 – <strong>in</strong>stalliert ist), s<strong>in</strong>d weitere 5 bis<br />
10 Unterrichtsstunden anzusetzen.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• P<strong>in</strong>nwände und o<strong>der</strong> Flipcharts bzw. Wandflächen,<br />
auf denen große Papierbahnen angebracht werden<br />
können<br />
• P<strong>in</strong>nwandpapier, Flipchartpapier, DIN A3-Bögen<br />
• Schwarze und farbige Mo<strong>der</strong>ationsmarker<br />
• Kreativmaterialien wie Buntpapier, Scheren, Kleber,<br />
alte Zeitschriften (für Kollagen), Kartons etc.<br />
Ablauf:<br />
Zum E<strong>in</strong>stieg eignet sich die Diskussionsrunde „Vuvuzela –<br />
Hat Paul Breitner recht?“ (siehe „H<strong>in</strong>weise zur E<strong>in</strong>führung<br />
<strong>in</strong>s Thema“). Daran schließt sich <strong>der</strong> Vorschlag <strong>der</strong> Lehrkraft<br />
an, sich e<strong>in</strong>mal ganz ohne Schallwellen zu verständigen.<br />
Wie wäre z.B. e<strong>in</strong> Fußballspiel ganz ohne Ton? O<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong> Videospiel? O<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Pause im Schulhof?<br />
Der Stumme Dialog kann <strong>in</strong> unterschiedlichen Sett<strong>in</strong>gs<br />
ausprobiert werden:<br />
• Partnerdialog: Dabei sitzen sich immer zwei<br />
Schüler(<strong>in</strong>nen) gegenüber, haben e<strong>in</strong> großes Blatt<br />
Papier zwischen sich, auf dem <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Art<br />
e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>dmap, siehe unten) das Thema steht (z.B.<br />
„Magst du Lärm – und warum, wo, wie?“), dazu Stifte<br />
und weiteres Kreativmaterial <strong>in</strong> Reichweite. Die Aufgabe<br />
lautet: „F<strong>in</strong>det geme<strong>in</strong>sam e<strong>in</strong>e Antwort auf die<br />
Frage, so dass je<strong>der</strong> vom an<strong>der</strong>en weiß, was er denkt<br />
– aber ohne zu sprechen. Ihr könnt schreiben, malen,<br />
gestikulieren und eure Körpersprache e<strong>in</strong>setzen. Ihr<br />
könnt zusammen etwas basteln o<strong>der</strong> bauen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
pantomimische Geschichte aufführen. Egal, was. Nur<br />
nicht sprechen o<strong>der</strong> Laute von euch geben!“<br />
• Kle<strong>in</strong>gruppendialog: Die gleiche Anweisung wie oben,<br />
nur dass statt zwei Partner drei o<strong>der</strong> vier zusammen<br />
sitzen. Beim Gruppendialog kann es günstiger se<strong>in</strong>,<br />
statt des e<strong>in</strong>en großen Blattes <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte je<strong>der</strong><br />
Gruppe e<strong>in</strong>e P<strong>in</strong>nwand zur Verfügung zu stellen.
• Großgruppendialog: E<strong>in</strong>e größere Gruppe o<strong>der</strong> auch<br />
die gesamte Klasse können zusammen e<strong>in</strong>en Stummen<br />
Dialog führen, wenn e<strong>in</strong>e große mit Papier bespannte<br />
Wandfläche zur Verfügung steht, auf <strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Mitte nach Art e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>dmap das Thema steht<br />
und darum herum genügend Platz zum Schreiben<br />
o<strong>der</strong> Malen ist. Der Großgruppendialog eignet sich<br />
vor allem für eher allgeme<strong>in</strong> gehaltene Themen (wie<br />
z.B. „Was kann man gegen zu viel Lärm <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
tun?“). Es ist s<strong>in</strong>nvoll, dass die Lehrkraft die Methode<br />
ganz kurz erläutert und als Beispiel selbst e<strong>in</strong>en<br />
M<strong>in</strong>dmap-Arm zeichnet und beschriftet. Statt e<strong>in</strong>er<br />
M<strong>in</strong>dmap kann für dafür geeignete Fragestellungen,<br />
die e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache persönliche Antwort verlangen<br />
(z.B. „Ist es dir <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> zu laut?“), auch e<strong>in</strong>e<br />
Skala visualisiert werden (z.B. zwischen „Viel zu laut“<br />
und „Gar nicht laut“), auf <strong>der</strong> je<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelne Schüler<br />
(ohne zunächst darüber zu sprechen) se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung<br />
durch e<strong>in</strong> Kreuz o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Klebepunkt abgibt.<br />
Zur M<strong>in</strong>dmap-Methode: E<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>dmap beschreibt<br />
e<strong>in</strong>e von Tony Buzan geprägte kognitive Technik, die<br />
z. B. zur Erschließung und visuellen Darstellung e<strong>in</strong>es<br />
Themengebietes, zur Planung o<strong>der</strong> für die kreative<br />
Teamarbeit genutzt werden kann. Hierbei soll das<br />
Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Assoziation helfen, Gedanken frei zu<br />
entfalten. Wenn mehrere Personen an e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>dmap<br />
arbeiten, eignet sich die Methode auch dazu, auf<br />
schnellem Weg gegenseitige Anregungen zu erzeugen<br />
und visuell zu dokumentieren, um damit weiter<br />
arbeiten zu können.<br />
E<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>dmap wird auf unl<strong>in</strong>iertem Papier erstellt. In<br />
<strong>der</strong> Mitte wird das zentrale Thema formuliert o<strong>der</strong> als<br />
Bild dargestellt. Davon ausgehend werden auf L<strong>in</strong>ien,<br />
die vom Themenkreis wegführen, die Ideen, Begriffe<br />
etc. aufgetragen. Pro L<strong>in</strong>ie wird e<strong>in</strong> Schlüsselbegriff<br />
verwendet. An diese L<strong>in</strong>ien (die „Äste“ <strong>der</strong> M<strong>in</strong>dmap)<br />
schließen sich <strong>in</strong> dünner werdenden“ Zweigen“ zweite,<br />
dritte o<strong>der</strong> noch mehr weitere Gedankenebenen an.<br />
Verschiedene Farben für Äste o<strong>der</strong> Themen, Bildelemente<br />
zu den Begriffen, Symbole zur Hervorhebung<br />
etc. stellen Zusammenhänge und Querverb<strong>in</strong>dungen<br />
dar. Die M<strong>in</strong>dmap soll mit viel Kreativität und humorvoll<br />
umgesetzt werden. Je<strong>der</strong> Ast und jede Verästelung<br />
wird vom Mittelpunkt aus gelesen.<br />
Anleitungen und Beispiele f<strong>in</strong>det man u.a. <strong>in</strong>:<br />
• Horst Müller, M<strong>in</strong>d Mapp<strong>in</strong>g, 2008,128 S., EUR<br />
6,90<br />
• Tony Buzan, Das M<strong>in</strong>d-Map-Buch. Die beste Methode<br />
zur Steigerung Ihres geistigen Potenzials,<br />
2005, 319 S., EUR 24,90<br />
• Margit Hertle<strong>in</strong>, M<strong>in</strong>d Mapp<strong>in</strong>g – Die kreative<br />
Arbeitstechnik, 2001, 128 S., EUR 7,90<br />
Die Abbildung auf <strong>der</strong> nächsten Seite zeigt das Pr<strong>in</strong>zip<br />
<strong>der</strong> M<strong>in</strong>dmap.<br />
Die Fragestellungen für den Stummen Dialog können das<br />
Thema „Lärm“ unter verschiedensten Gesichtspunkten<br />
aufgreifen, wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Dialogformen bereits angedeutet worden ist. Es hängt<br />
vom Alter und Interesse <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler ab<br />
sowie von <strong>der</strong> fachlichen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> den Unterricht<br />
o<strong>der</strong> die Projektarbeit.<br />
Die Übung schließt mit e<strong>in</strong>er Reflexionsphase ab, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
sich die Schüler(<strong>in</strong>nen), mo<strong>der</strong>iert von <strong>der</strong> Lehrkraft, gegenseitig<br />
Feedback darüber geben, wie sie die Situation<br />
erlebt haben. Schlüsselfragen dazu s<strong>in</strong>d:<br />
• Wie habt ihr die Situation erlebt?<br />
• Ist es euch leicht o<strong>der</strong> schwer gefallen, euch zu verständigen<br />
(zu beteiligen)?<br />
• Was war schwerer, was war leichter als sonst?<br />
• Was war das Neue an dieser Erfahrung?<br />
• Hat die Ausschaltung von Sprache und Lauten auch<br />
e<strong>in</strong>en Vorteil?<br />
Wenn die technischen Möglichkeiten vorhanden s<strong>in</strong>d, ist<br />
es auch s<strong>in</strong>nvoll, e<strong>in</strong>e Videoaufnahme des Geschehens<br />
(mit statischer Kamera) zu machen und zur Unterstützung<br />
des Feedbacks geme<strong>in</strong>sam anzuschauen.<br />
Das Modul zum Erfahrungsfeld auszubauen, bedeutet,<br />
sich dafür zu entscheiden, den Stummen Dialog zur ständigen<br />
Option im Schulalltag zu machen. Damit würde<br />
auch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>übung <strong>in</strong> „lärmfreien“ Umgang erreicht, die<br />
durchaus psychologische und präventive Aspekte aufweist<br />
und mithelfen kann, Gewaltfreiheit zu unterstützen.<br />
Wenn die Hilfsmitel für den Stummen Dialog ständig <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Klasse verfügbar s<strong>in</strong>d, können nicht nur E<strong>in</strong>stiege <strong>in</strong><br />
Fachthemen, son<strong>der</strong>n auch Fragen des sozialen Klimas<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Klasse, Reaktionen auf aktuelle Geschehnisse und<br />
allgeme<strong>in</strong>e Bef<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>der</strong> Schüler auf diese Weise<br />
behandelt werden.<br />
Falls es bereits e<strong>in</strong>en „Leiseraum“ an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> gibt<br />
(vgl. Modul 2), könnten <strong>der</strong> Stumme Dialog auch dort als<br />
ständige Option verfügbar gemacht werden. Denkbar ist<br />
beispielsweise, dass Klassen zusammen mit ihren Lehrkräften<br />
gezielt immer wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den Leiseraum kommen,<br />
um sich mit dem Stummen Dialog auf e<strong>in</strong>e Thema<br />
vorzubereiten. Der Stumme Dialog kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zeitlich<br />
knapp gehaltenen Form auch zum Betretungsritual des<br />
Leiseraums werden o<strong>der</strong> dort (ggf. zeitweise) als die<br />
verpflichtende Standard-Kommunikationsform unter den<br />
Benutzern des Leiseraums e<strong>in</strong>geführt werden.<br />
47
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Landes<strong>in</strong>stitut für Pädagogik und Medien, Beethovenstr.<br />
26, 66125 Saarbrücken, Fon 06897-7908149,<br />
www.lpm.uni-sb.de; das Landes<strong>in</strong>stitut gibt die<br />
Publikation „Dialogisch lernen im Sem<strong>in</strong>arfach.<br />
Handbuch für Kommunikation und wissenschaftliches<br />
Arbeiten“ heraus, <strong>in</strong> <strong>der</strong> u.a. auch das dialogorientierte<br />
M<strong>in</strong>dmapp<strong>in</strong>g behandelt wird:<br />
www.kommunikationspaedagogik.de/<br />
Unterrichtskommunikation/Sem<strong>in</strong>arfach/Download_<br />
Info/Inhalt__Dialogisch_lernen_im_Sem<strong>in</strong>arfach.pdf;<br />
das Buch umfasst 288 Seiten und kostet EUR 18,90<br />
48<br />
Anleitungen und Arbeitsunterlagen:<br />
Auf <strong>der</strong> nächsten Seite f<strong>in</strong>den Sie e<strong>in</strong>e leere M<strong>in</strong>dmap-<br />
Beispielstruktur, die Sie als anregende Kopiervorlage<br />
verwenden können. Die untenstehende Grafik verdeutlicht<br />
das Glie<strong>der</strong>ungspr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>dmap am Beispiel<br />
des Themas „Klimawandel“. Mit dem Computerprogramm<br />
„M<strong>in</strong>dmanager“ (www.m<strong>in</strong>djet.com) lassen sich M<strong>in</strong>dmaps<br />
auch am PC anfertigen bzw. dokumentieren. Die<br />
Schulversion des „M<strong>in</strong>dmanager“ kostet EUR 149,00.
M<strong>in</strong>dmap - Beispielstruktur (Kopiervorlage)<br />
49
Modul 9: Exkursionen zum unhörbaren Lärm<br />
Lernziel:<br />
Das Lernziel dieses Moduls ist auf systemisch-ganzheitliches<br />
Denken und aktives Erkunden e<strong>in</strong>es neuen Terra<strong>in</strong>s<br />
ausgerichtet. Indem die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler sich mit<br />
den Lärmemissionen von W<strong>in</strong>denergieanlagen und dem Vibrationslärm<br />
von Offshore-W<strong>in</strong>dpark-Baustellen beschäftigen,<br />
erschließen sie sich nicht nur e<strong>in</strong>e weitere Dimension<br />
des Themas „Lärm“, son<strong>der</strong>n lernen die Relativität des<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sbegriffs kennen. Was unter dem Aspekt <strong>der</strong><br />
nachhaltigen Energiegew<strong>in</strong>nung s<strong>in</strong>nvoll ersche<strong>in</strong>t, hat auf<br />
an<strong>der</strong>e Systeme durchaus nicht-nachhaltige o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest<br />
negative Auswirkungen.<br />
Kognitives Lernziel im Bereich <strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>:<br />
Das Modul bezieht sich auf den „Dependenz“-Aspekt<br />
<strong>der</strong> <strong>Nachhaltigkeit</strong>, d.h. die (Grenzen <strong>der</strong>) Belastbarkeit<br />
natürlicher Systeme durch Schallimmissionen.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung:<br />
Geschult wird das „vorausschauende Denken“. Dabei<br />
geht es nicht nur um die Frage, wie schädliche Auswirkungen<br />
von Lärmemissionen künftig vermieden<br />
werden können. Das Modul macht auch klar, dass<br />
nachhaltige Energiegew<strong>in</strong>nung an an<strong>der</strong>er Stelle des<br />
Systems auch nichtnachhaltige Nebenwirkungen haben<br />
kann. Vorausschauendes Denken sollte deshalb<br />
auch ganzheitliches Denken se<strong>in</strong>, das Zielkonflikte<br />
erkennt und berücksichtigt.<br />
Primärer lernpsychologischer Zugang:<br />
Experimentierfreude und das selbstständige Entdecken<br />
und Erkunden e<strong>in</strong>es neuen Themengebiets<br />
stehen im Mittelpunkt des Moduls. Dem für uns<br />
„unhörbaren“ Lärm nachzuforschen, schult das Vorstellungsvermögen.<br />
Die Exkursion zu W<strong>in</strong>danlagen<br />
för<strong>der</strong>t das aktive Erkunden <strong>der</strong> Umwelt.<br />
Lehrplanbezüge:<br />
ERS 5, Mathematik: Zuordnungen –Stochastik (Daten sammeln,<br />
darstellen, auswerten)<br />
ERS 6, Biologie: Vom Körper des Menschen (Schallwellen,<br />
Ohr, Hören, Lärm)<br />
ERS 6/7/8, Deutsch: Sprechen (Interview)<br />
ERS 8M, Physik: Schall<br />
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm<br />
GS 9/10, Allgeme<strong>in</strong>e Ethik: Politischer Aspekt<br />
GS 9, Physik: Kräfte <strong>in</strong> Natur und Technik<br />
GS 10, Physik: Energie und Umwelt<br />
50<br />
GYM 6, Deutsch: Sprechen und Schreiben (Interview)<br />
GYM 8, Deutsch: Texte und Medien (Interview)<br />
GYM 8 (math.-naturw.), Physik: Schall<br />
GYM 9, Mathematik: Allgeme<strong>in</strong>e S<strong>in</strong>usfunktion (Schallschw<strong>in</strong>gung)<br />
Zeitliche Struktur:<br />
Das Modul lässt sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Theorie- und e<strong>in</strong>en Praxisteil<br />
unterglie<strong>der</strong>n. Der Theorieteil beschäftigt sich mit <strong>der</strong><br />
Frage, was die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler durch Internetrecherche<br />
über Lärmemissionen von W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
herausf<strong>in</strong>den. Dazu werden zwischen 4 und 6 Unterrichtsstunden<br />
benötigt. Im Praxisteil geht es darum, e<strong>in</strong>e<br />
Exkursion zu e<strong>in</strong>em Brennpunkt des „unhörbaren Lärms“ zu<br />
planen. Dabei kommen grundsätzlich zwei Exkursionsziele<br />
<strong>in</strong> Frage, je nachdem, ob es um die Erforschung des Infraschalls<br />
geht (<strong>der</strong> bei W<strong>in</strong>dkraftanlagen an Land e<strong>in</strong>e Rolle<br />
spielt) o<strong>der</strong> um die Belastung <strong>der</strong> Meeresumwelt durch die<br />
Schallimmission von Offshore-W<strong>in</strong>denergieanlagen, die<br />
vor allem beim Bau <strong>der</strong> Anlagen auftritt. Für beide Exkursionen<br />
sollten 2-3 Tage (ohne Planungsphase) vorgesehen<br />
werden. Näheres unter „Ablauf“.<br />
Benötigte Materialien:<br />
• PC mit Internetzugang und Drucker<br />
• Aktivboxen für PC o<strong>der</strong> Laptop-Lautsprecher<br />
• Digitalkamera<br />
• MD-Rekor<strong>der</strong> mit Mikrofon o<strong>der</strong> digitale Videokamera<br />
(für Interviews)<br />
Ablauf:<br />
Zum E<strong>in</strong>stieg bekommen die Schüler den Auftrag, herauszubekommen,<br />
was das Beson<strong>der</strong>e an dem Musikstück „She<br />
goes back un<strong>der</strong>water“ von Sarah Angliss aus dem Jahr<br />
2003 ist. Die Schüler brauchen dazu e<strong>in</strong>en PC mit Internet-<br />
Anschluss. Am besten bilden Sie mehrere Teams mit jeweils<br />
5-7 Teilnehmern. Nach 30 M<strong>in</strong>uten stellen die verschiedenen<br />
Teams ihre Ergebnisse vor. Weitere H<strong>in</strong>weise s<strong>in</strong>d von<br />
<strong>der</strong> Lehrkraft zunächst nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Das „Infrasonic -17 Hz-Infraschallexperiment“<br />
Am 31. Mai 2003 führte e<strong>in</strong>e Gruppe von britischen<br />
Wissenschaftlern e<strong>in</strong> Massenexperiment durch, bei dem<br />
sie 700 Menschen mit Musik beschallten. Diese war mit<br />
e<strong>in</strong>er 17 Hz-S<strong>in</strong>usschw<strong>in</strong>gung von 90 dB angereichert,
eschrieben als „am Rande des Hörbaren“, und von e<strong>in</strong>em<br />
Hochleistungs-Subwoofer erzeugt. Töne unter 20 Hz<br />
werden als Infraschall bezeichnet, weil Menschen sie<br />
nicht mehr bewusst wahrnehmen können. Auch wenn<br />
Menschen Infraschall kaum ohne Hilfsmittel hören können,<br />
ist er jedoch bei hohen Schalldrücken wahrnehmbar.<br />
Das experimentelle Konzert (mit dem Titel „Infrasonic“),<br />
aufgeführt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Londoner Konzerthalle Purcell Room,<br />
bestand aus zwei Aufführungen mit je vier Musikstücken.<br />
Je zwei <strong>der</strong> Musikstücke waren mit dem 17 Hz-Ton<br />
unterlegt. Um die Testresultate von den Musikstücken<br />
unabhängig zu machen, wurde <strong>der</strong> 17-Hz-Ton <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
zweiten Aufführung gerade unter diejenigen zwei Stücke<br />
gelegt, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Aufführung frei davon waren.<br />
Den Teilnehmern wurde nicht mitgeteilt, welche <strong>der</strong> Stücke<br />
den Ton enthielten. Wurde <strong>der</strong> Ton gespielt, berichtete<br />
e<strong>in</strong>e signifikante Zahl von Befragten (22 %) Beklemmung,<br />
Unbehagen, extreme Traurigkeit und Reizbarkeit,<br />
verbunden mit Übelkeit o<strong>der</strong> Furcht, e<strong>in</strong> „Kalt den Rücken<br />
runterlaufen“ und Druck auf <strong>der</strong> Brust. Als diese Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> British Association for the Advancement of<br />
Science präsentiert wurden, sagte e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> verantwortlichen<br />
Wissenschaftler: „Diese Ergebnisse legen nahe, dass<br />
Klänge niedriger Frequenz bei Menschen ungewöhnliche<br />
Erfahrungen auslösen können, selbst wenn sie Infraschall<br />
nicht bewusst wahrzunehmen vermögen. Manche<br />
Wissenschaftler behaupten, eben diese Geräusche kämen<br />
an verme<strong>in</strong>tlich spukenden Orten vor und vermittelten<br />
auf diese Weise seltsame E<strong>in</strong>drücke, die die Leute dann<br />
Gespenstern zuschrieben – unsere Erkenntnisse stützen<br />
diese Erklärungen.“ Unter www.spacedog.biz/Infrasonic/<br />
sounds/<strong>in</strong>frasonic#<strong>in</strong>tro ist e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> Musikstücke, eben<br />
„She goes back un<strong>der</strong>water“, zu hören, allerd<strong>in</strong>gs ohne<br />
den darunterliegenden 17 Hz-Ton. (Quelle: Wikipedia)<br />
Nachdem sich die Schüler über das Phänomen des Infraschalls<br />
verständigt haben, gibt die Lehrkraft die zweite<br />
Aufgabenstellung bekannt. In zwei etwa gleich großen<br />
Gruppen soll dem „unhörbaren“ Lärm und se<strong>in</strong>er Auswirkung<br />
auf Lebewesen weiter nachgegangen werden:<br />
• Das „Luft“-Team beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage, welchen<br />
Umwelte<strong>in</strong>fluss W<strong>in</strong>dkraftanlagen durch die Produktion<br />
von Infraschall haben können und welche Abhilfemaßnahmen<br />
möglich s<strong>in</strong>d<br />
• Das „Wasser“-Team geht dem Problem des Vibrationslärms<br />
nach, <strong>der</strong> bei beim Bau von Offshore-W<strong>in</strong>dparks entsteht.<br />
Beide Teams arbeiten unabhängig vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> an ihrer Aufgabenstellung.<br />
Wenn die Möglichkeit besteht, e<strong>in</strong>e Exkursion<br />
zu e<strong>in</strong>em o<strong>der</strong> zwei „Tatorten“ zu planen, sollte beiden<br />
Teams dies bereits jetzt mitgeteilt werden: „Wenn ihr auf<br />
<strong>in</strong>teressante Orte stoßt, an denen das Problem offenkundig<br />
wird bzw. wo man sich <strong>in</strong>tensiv mit dem Thema beschäftigt,<br />
dann klärt doch die Möglichkeiten ab, dorth<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Klassenfahrt<br />
zu organisieren!“<br />
Über den „Unhörbaren Lärm von W<strong>in</strong>dkraftanlagen“ hat die<br />
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)<br />
Untersuchungen angestellt, die unter www.giraf2009.org/<br />
nn_1386324/DE/Themen/Seismologie/Infraschall/<br />
Quellen__Phaenomene/Feldmessungen/<br />
w<strong>in</strong>dkraftanlagen.html dokumentiert s<strong>in</strong>d.<br />
Die Infraschalluntersuchung <strong>der</strong> Atmosphäre und <strong>der</strong> Meere<br />
ist e<strong>in</strong> junges Forschungsgebiet, welches sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
durch die Möglichkeit, Atomwaffentests und Schiffsbewegungen<br />
aufzuspüren, entwickelt hat. Im Rahmen <strong>der</strong><br />
Überwachung des Kernwaffenteststopp-Vertrags (CTBT)<br />
sorgt <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong> weltweites, <strong>in</strong>ternational betriebenes<br />
Netz von Infraschall-Messstationen (IMS) dafür, dass ke<strong>in</strong>e<br />
nukleare Sprengung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erdatmosphäre, unter Wasser<br />
o<strong>der</strong> im Weltraum unentdeckt bleibt. Die mit diesen Stationen<br />
gewonnenen Daten eröffnen e<strong>in</strong> neues Aufgaben- und<br />
Forschungsgebiet, dessen Schwerpunkt auf <strong>der</strong> Detektion,<br />
Lokalisierung und Identifizierung von Infraschallquellen<br />
liegt. Für die Bundesrepublik ist die BGR für den Betrieb von<br />
zwei dieser Infraschall-Messanlagen verantwortlich, die zu<br />
dem <strong>in</strong>ternationalen Überwachungsnetz gehören: Die IS26<br />
im Bayerischen Wald und IS27 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Antarktis.<br />
Falls e<strong>in</strong>e Exkursion im Rahmen <strong>der</strong> Behandlung des Themas<br />
„Unhörbarer Lärm“ möglich ist, liegt es nahe, mit Experten<br />
<strong>der</strong> BGR e<strong>in</strong>e Begegnung zu vere<strong>in</strong>baren, die direkt am Ort<br />
<strong>der</strong> IS26 stattf<strong>in</strong>den könnte. Die IS26 liegt im Bayerischen<br />
Wald nord-östlich von Passau. Die genauen Standortdaten:<br />
• 48.85° nördlicher Breite<br />
• 13.72° östlicher Länge<br />
• 1058-1172 m über NN.<br />
Die Messstation wurde bei <strong>der</strong> Ortschaft Haidmühle nahe<br />
dem Dreilän<strong>der</strong>eck Deutschland-Österreich-Tschechien<br />
errichtet. Sie bef<strong>in</strong>det sich geme<strong>in</strong>sam mit <strong>der</strong> seismischen<br />
IMS-Station GERES im dicht bewaldeten Gebiet rund um<br />
den Sulzberg. Informative Webl<strong>in</strong>ks: www.welt<strong>der</strong>physik.<br />
de/de/7020.php und www.bgr.bund.de/nn_1386288/DE/<br />
Themen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Deutsches-NDC/<br />
Deutsche-IMS-Stationen/I26DE/I26DE__<strong>in</strong>halt.html.<br />
Messschacht <strong>der</strong> Infraschallmessstation IS26 im Bayerischen Wald<br />
51
Im Zuge des vorgesehenen umfangreichen Ausbaus <strong>der</strong> Offshore-W<strong>in</strong>danlagen<br />
(siehe Karte auf S. 53) werden Meldungen<br />
und Warnung vor den Auswirkungen auf Meerestiere<br />
häufiger. Im Juni 2010 berichtete SPIEGEL onl<strong>in</strong>e unter dem<br />
Titel „Baulärm hat Schwe<strong>in</strong>swale vertrieben“ (www.spiegel.<br />
de/wissenschaft/natur/0,1518,698372,00.html). Das Strommagaz<strong>in</strong><br />
warnte bereits 2008: „Baulärm bei Offshore-W<strong>in</strong>danlagen<br />
schädigt Schwe<strong>in</strong>swale“ (www.strom-magaz<strong>in</strong>.de/<br />
strommarkt/baulaerm-bei-offshore-w<strong>in</strong>danlagen-schaedigtschwe<strong>in</strong>swale-_22341.htm).<br />
Im August 2010 befasste sich<br />
<strong>der</strong> Deutsche Bundestag mit dem Problem <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nord- und<br />
Ostsee – siehe folgende Meldung:<br />
04.08.2010 - Durch den beim Bau von Offshore-W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
unter Wasser entstehenden Lärm können<br />
selbst tödliche Verletzungen von Schwe<strong>in</strong>swalen nicht<br />
ausgeschlossen werden. In ihrer Antwort (17/2642)<br />
auf e<strong>in</strong>e Kle<strong>in</strong>e Anfrage <strong>der</strong> Fraktion Bündnis 90/<br />
Die Grünen (17/2390) weist die Bundesregierung<br />
darauf h<strong>in</strong>, dass es bei schall<strong>in</strong>tensiven Aktivitäten<br />
e<strong>in</strong>en Grenzwert gebe, <strong>der</strong> die Verletzung o<strong>der</strong> Tötung<br />
von Schwe<strong>in</strong>swalen ausschließen solle. Die aktuelle<br />
Genehmigungspraxis für W<strong>in</strong>dkraftanlagen sehe vor,<br />
dass zum Schutz von mar<strong>in</strong>en Säugern e<strong>in</strong> Grenzwert<br />
von 160 dB außerhalb e<strong>in</strong>es Kreises mit e<strong>in</strong>em Radius<br />
von 750 Meter um die Schallquelle und e<strong>in</strong> Spitzenschalldruckpegel<br />
von 190 dB e<strong>in</strong>zuhalten seien. Durch<br />
den E<strong>in</strong>satz von schallm<strong>in</strong><strong>der</strong>nden Maßnahmen habe<br />
zwar e<strong>in</strong>e deutliche M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schallpegelwerte<br />
erreicht werden können, schreibt die Regierung weiter.<br />
Dennoch sei <strong>der</strong> gesetzte Grenzwert überschritten<br />
worden. Während <strong>der</strong> Rammarbeiten zur Errichtung<br />
<strong>der</strong> Offshore-Anlage ‚Alpha ventus‘ nördlich von<br />
Borkum habe <strong>der</strong> Schalldruckpegel ohne Schallm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> 750 Meter Entfernung zwischen<br />
164 und 170 dB gelegen. ”Der Wert von 160 dB <strong>in</strong> 750<br />
Meter Entfernung wurde ohne Schallm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />
fast kont<strong>in</strong>uierlich überschritten“, schreibt die<br />
Regierung weiter. Es bedürfe weiterer Forschungs- und<br />
Entwicklungsarbeit, um den Grenzwert vollständig<br />
e<strong>in</strong>zuhalten, heißt es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Antwort. Es befänden sich<br />
mehrere Verfahren, die das E<strong>in</strong>rammen von Pfählen <strong>in</strong><br />
den Meeresboden vermeiden würden, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung.<br />
Auf die Frage <strong>der</strong> Abgeordneten nach den Kosten<br />
heute schon e<strong>in</strong>satzfähiger Schallm<strong>in</strong>imierungssysteme<br />
schreibt die Bundesregierung unter Bezugnahme<br />
auf Angaben <strong>der</strong> Hersteller, bei e<strong>in</strong>em W<strong>in</strong>dpark mit<br />
80 Offshore-W<strong>in</strong>denergieanlagen würden die Kosten<br />
6,4 bis 8 Millionen Euro betragen.<br />
Nach Angaben <strong>der</strong> Bundesregierung halten sich<br />
Schwe<strong>in</strong>swale mit höchsten Bestandszahlen im Frühjahr<br />
und Sommer vor <strong>der</strong> Küste Schleswig-Holste<strong>in</strong>s<br />
im Bereich des Sylter Außenriffs auf. Innerhalb dieses<br />
Gebiets lägen acht bereits genehmigte W<strong>in</strong>dparks-<br />
Schwe<strong>in</strong>swale kämen auch mit hohen Frühjahrsbe-<br />
52<br />
ständen im westlichen Teil des Vorranggebiets W<strong>in</strong>denergie<br />
‚Nördlich Borkum‘ vor. ”In <strong>der</strong> zentralen Ostsee<br />
kommt die stark gefährdete Population <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pommerschen<br />
Bucht vor, wo es zu Überschneidungen mit<br />
bereits genehmigten Projekten auf dem Adlergrund<br />
kommt“, schreibt die Regierung, die lärmbed<strong>in</strong>gte<br />
Störungen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Frühjahr und Sommer<br />
während <strong>der</strong> Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten und<br />
während <strong>der</strong> Überw<strong>in</strong>terungs- und Wan<strong>der</strong>ungten für<br />
möglich hält.<br />
(Quelle: www.bundestag.de/presse/hib/2010_08/<br />
2010_264/02.html)<br />
Unter www.spiegel.de/video/video-1062347.html f<strong>in</strong>den Sie<br />
e<strong>in</strong>en kurzen Videobeitrag zum W<strong>in</strong>dpark „Alpha ventus“<br />
Simulation <strong>der</strong> Schallabstrahlung bei Rammarbeiten <strong>in</strong> Meeresgewässern;<br />
Bildquelle: www.isd.uni-hannover.de/223.html<br />
Exkursionsziele im Rahmen dieser Thematik könnten die<br />
Forschungsplattformen FINO 1, 2 und 3 se<strong>in</strong>, die <strong>in</strong> Nord-<br />
und Ostsee aktiv s<strong>in</strong>d:<br />
• FINO 1, www.f<strong>in</strong>o-offshore.de, Plattform <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nordsee,<br />
die sich vor allem mit möglichen Auswirkungen<br />
von zukünftigen Offshore-W<strong>in</strong>denergieanlagen auf die<br />
mar<strong>in</strong>e Umwelt befasst (Alfred-Wegener-Institut für<br />
Polar- und Meeresforschung)<br />
• FINO 2, www.f<strong>in</strong>o2.de, Plattform <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ostsee, die sich<br />
vor allem mit den Bed<strong>in</strong>gungen für die w<strong>in</strong>denergetische<br />
Nutzung <strong>der</strong> Ostsee beschäftigt (Schifffahrts<strong>in</strong>stitut<br />
Warnemünde e. V.)<br />
• FINO 3, www.f<strong>in</strong>o3.de/joomla15, Plattform <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Nordsee, auf <strong>der</strong> u.a. Schallm<strong>in</strong>imierungsmaßnahmen<br />
bei Rammarbeiten untersucht werden (Universität<br />
Hannover, Institut für Statik und Dynamik).<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Forschungsplattformen werden von verschiedenen<br />
Forschungs<strong>in</strong>stituten betreut. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> obenstehenden<br />
Liste <strong>in</strong> Klammern angegeben. Nähere Kontaktdaten<br />
f<strong>in</strong>den Sie unter „Partner und Auskunftsgeber“.
Die Standorte <strong>der</strong> Forschungsplattformen FINO 1, 2 und 3<br />
Partner und Auskunftgeber:<br />
• Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,<br />
Geozentrum Hannover, Stilleweg 2, 30655 Hannover,<br />
Fon 0511-6430, www.bgr.bund.de; für Infraschall<br />
ist Ansprechpartner: Dr. Lars Ceranna, Fon 0511-<br />
6433663, E-Mail Lars.Ceranna@bgr.de<br />
• Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und<br />
Meeresforschung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Helmholtz-Geme<strong>in</strong>schaft,<br />
Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven, Fon<br />
Die Standorte <strong>der</strong> Forschung<br />
0471-48310, www.awi.de; Kontaktperson zur FINO<br />
1 ist Dr. Alexan<strong>der</strong> Schroe<strong>der</strong>, Fon 0471-48311734,<br />
E-Mail aschroe<strong>der</strong>@awi-bremerhaven.de<br />
• Schifffahrts<strong>in</strong>stitut Warnemünde e. V., Richard-<br />
Wagner-Str. 31, 18119 Warnemünde, Fon 0381-<br />
4985830, http://schiffahrts<strong>in</strong>stitut.de; Kontaktperson<br />
zur FINO 2 ist Prof. Dr.-Ing. Re<strong>in</strong>-hard<br />
Müller-Demuth, E-Mail re<strong>in</strong>hard.mueller@hs-wismar.de<br />
• Institut für Statik und Dynamik, Leibniz Universität<br />
Hannover, Appelstr. 9a, 30167 Hannover, Fon 0511-<br />
7620, www.isd.uni-hannover.de; Kontaktperson zu<br />
FINO 3 ist Prof. Dr.-Ing. habil. Raimund Rolfes, Fon<br />
0511-7623867, E-Mail r.rolfes@isd.uni-hannover.de<br />
• NABU Schleswig-Holste<strong>in</strong> e.V., Färberstraße 51,<br />
24534 Neumünster, Fon 04321-53734,<br />
http://schleswig-holste<strong>in</strong>.nabu.de; Ansprechpartner<br />
für den Meeressäugerschutz vor Lärmimmissionen<br />
ist Ingo Ludwichowski, Fon 0160-96230512, E-Mail<br />
Ingo.Ludwichowski@nabu-sh.de.<br />
53
Bildquellenverzeichnis<br />
S. 10 Arnulf Betzold GmbH www.edumero.de<br />
S. 17 Amt für Klima- und Umweltschutz<br />
im Saarland<br />
www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm<br />
S. 23 PCE Deutschland GmbH www.warensortiment.de<br />
S. 29 Fachbereich Didaktik <strong>der</strong> Physik<br />
<strong>der</strong> FU Berl<strong>in</strong><br />
S. 39/40 „Lautstärke <strong>in</strong> Hambruger Tanzbetrieben“,<br />
Behörde für Soziales,<br />
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz;<br />
Hamburg, 2008<br />
S. 39 Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmediz<strong>in</strong>, „Gehörschäden<br />
durch Musik“, 2004<br />
54<br />
http://didaktik.physik.fu-berl<strong>in</strong>.de/projekte/<br />
sounds/<strong>in</strong>dex.html<br />
www.hamburg.de/bsg/veroeffentlichungen<br />
www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Gesundheitsschutz/Gs05.pdf?__blob=publicationFile<br />
S. 48 Global Warm<strong>in</strong>g M<strong>in</strong>d map www.learn<strong>in</strong>gfundamentals.com.au<br />
S. 51 Bundesanstalt für Geowissenschaften<br />
und Rohstoffe (BGR) <strong>in</strong><br />
Hannover<br />
www.welt<strong>der</strong>physik.de/de/7020.php?i=7022<br />
S. 52 FuE-Zentrum FH Kiel GmbH www.fh-kiel-gmbh.de<br />
S. 52 Institut für Statik und Dynamik<br />
<strong>der</strong> Leibniz Universität Hannover www.isd.uni-hannover.de/223.html<br />
S. 53 Bundesamt für Seeschiffahrt und<br />
Hydrographie<br />
www.bsh.de
<strong>Nachhaltigkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> - Konzepte und Beispiele für die Praxis<br />
Mit dieser Handreichung für Lehrkräfte sowie Umweltpädagogen und Fachleute im außerschulischen<br />
Bereich legen wir e<strong>in</strong> systematisches Konzept <strong>der</strong> Generierung von Unterrichtsmodulen<br />
für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vor.<br />
Die Module s<strong>in</strong>d als Anregung gedacht und ersetzen nicht <strong>in</strong> jedem Fall Arbeitsblätter und<br />
Unterrichtsmaterialien im engeren S<strong>in</strong>n. BNE eröffnet Spielraum für kreative Eigenaktivität<br />
von Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern. Damit verbunden ist teilweise zwar auch e<strong>in</strong> höherer Vorbereitungsaufwand.<br />
Doch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Durchführung wird durch die größeren Anteile an Selbsttätigkeit<br />
<strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Ausgleich geschaffen.<br />
Die Reihe umfasst bisher:<br />
• Wasser - Lebensmittel für die Welt<br />
• Wald - Reservoir des Lebens<br />
• Biosphäre - Natur und Mensch im E<strong>in</strong>klang<br />
• Klima - Vorsorge für unseren Planeten<br />
• Ernährung - Auch <strong>der</strong> Mensch is(s)t Natur<br />
• Lärm - Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schallwelt<br />
• Mobilität & Verkehr - Sichere Wege <strong>in</strong> die Zukunft<br />
Da e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Broschüren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>tversion bereits vergriffen ist, nutzen Sie bitte auch den<br />
kostenlosen PDF-Download unter www.tuwas.net/shop!