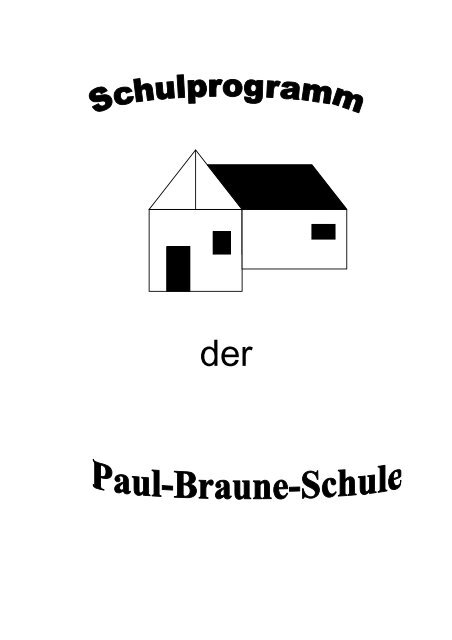Schulprogramm - Webpräsenz der Paul-Braune-Schule Berlin
Schulprogramm - Webpräsenz der Paul-Braune-Schule Berlin
Schulprogramm - Webpräsenz der Paul-Braune-Schule Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>der</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
1 Grafik: För<strong>der</strong>zentrum – ein Haus mit vielen Zimmern 3<br />
2 Grafik: <strong>Schulprogramm</strong> „So starten wir im SJ 2006/07“ 4<br />
3 Leitbild 5<br />
4 Schulspezifische Rahmenbedingungen 6<br />
4.1 Impressum 6<br />
4.2 Lage und Einzugsgebiet 7<br />
4.3 Schülerinnen und Schüler - Lernstandsmessung 8<br />
4.4 Mitarbeiter 12<br />
4.5 Ausstattung 12<br />
4.6 Kooperation mit Eltern u.a. 13<br />
4.7 Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> 13<br />
5 Arbeitsvorhaben 14<br />
5.1 Unterricht 14<br />
5.1.1 Jahrgangsübergreifendes Lernen 14<br />
5.1.1.1 Bildung von Expertenteams 14<br />
5.1.1.2 Stufenkonferenzen 15<br />
5.1.2 Leseför<strong>der</strong>ung 15<br />
5.1.3 Berufsorientierung 16<br />
5.1.4 Entwicklungstherapeutischer Unterricht 19<br />
5.2. Erziehung 20<br />
5.2.3 Soziales Miteinan<strong>der</strong> 20<br />
5.3 VHG 22<br />
5.4 Fortbildungskonzept 23<br />
6 Anhang 24<br />
6.1 Fragebogen<br />
6.2 Auswertung - Kreisdiagramme<br />
6.3 Wünsche (Schüler, Eltern, Lehrer)<br />
2
Gemeinsamer<br />
Unterricht<br />
Sekundarstufe I<br />
Klassenstufe 7 – 10<br />
Unterricht nach den<br />
Rahmenplänen Lernen<br />
und Sek I<br />
Grundschule<br />
Klassenstufe 3 – 6<br />
Unterricht nach den<br />
Rahmenplänen Lernen<br />
und Grundschule<br />
Schulanfangsphase<br />
Temporäre Lerngruppen<br />
JüL Jahrgangsstufen<br />
1 und 2<br />
Pädagogische<br />
Koordinierungsstelle<br />
Ambulanz<br />
Son<strong>der</strong>pädagogisches<br />
För<strong>der</strong>zentrum<br />
<strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong><br />
Grundschule und Sekundarstufe I<br />
För<strong>der</strong>schwerpunkte Lernen und Geistige Entwicklung<br />
Unterricht<br />
in <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>schule<br />
FöZ Standort<br />
Dessauer Str.<br />
Klassenstufe 7 – 10<br />
Rahmenplan: Lernen<br />
FöZ Standort<br />
Dessauer Str.<br />
Oberstufe<br />
Rahmenplan: Geistige<br />
Entwicklung<br />
FöZ Standort<br />
Drakestr.<br />
Klassenstufe 3 – 10<br />
Rahmenplan: Lernen<br />
VHG<br />
3<br />
Projekte<br />
in <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>schule<br />
Projekte mit<br />
außerschulischen<br />
Partnern:<br />
Antigewaltprojekt<br />
„Buddy“<br />
Senior Partner in<br />
School<br />
Psychomotorik<br />
Sens. Integr.<br />
Ergotherapie<br />
Lesepaten<br />
Schulinterne<br />
Projekte<br />
Kooperation mit<br />
außerschulischen<br />
Partnern<br />
öffentlich:<br />
- Schulpsychologie<br />
- Jug<br />
- Ges<br />
- KJPD<br />
- Polizei<br />
Beratung für Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen<br />
Schulstation<br />
(im Aufbau)<br />
VHG<br />
Hort<br />
(im Aufbau)<br />
Personalentwicklung<br />
Schulinternes<br />
Curriculum<br />
Fortbildung<br />
Freie Träger:<br />
- Wadzeck<br />
- contact-Praxis im<br />
Kiez e.V.<br />
- Clara<br />
- Evangelischer Ju-<br />
gendhilfe Verein e.V.<br />
- ASIG<br />
Lernwerkstatt<br />
Prophylaxe von LRS<br />
und Matheschwäche<br />
Regionale<br />
Fortbildungs-<br />
angebote<br />
„Son<strong>der</strong>pädagogische<br />
För<strong>der</strong>ung“
Berufsorientierung<br />
Fortbildungs-<br />
konzept<br />
ETEP/EPU<br />
Leseför<strong>der</strong>ung<br />
Erziehung<br />
Arbeits-<br />
vorhaben<br />
Jahrgangs-<br />
teams<br />
Unterricht JüL<br />
Soziales<br />
Miteinan<strong>der</strong><br />
VHG<br />
Stufenkonferenzn<br />
nnnnnnnn<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
So starten wir im<br />
SJ 2006/07!<br />
Schulleben<br />
Regeln<br />
4<br />
Leitbild<br />
Impressum<br />
Schulabschlüsse<br />
Bestands-<br />
aufnahme<br />
soziale<br />
Situation<br />
Deutsch<br />
Mathematik<br />
Kooperationspartner<br />
Basale Voraussetzungen
3 Leitbild<br />
Unsere Schülerinnen und Schüler sind fähig und bereit zu lernen. Es ist<br />
die Aufgabe unserer <strong>Schule</strong>, diese Bereitschaft wach zu halten und zu<br />
för<strong>der</strong>n.<br />
Ein gutes Schulklima ist die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und<br />
Lehren. Alle am Schulleben Beteiligten nehmen Rücksicht aufeinan<strong>der</strong><br />
und lösen Probleme einvernehmlich.<br />
Für die Entwicklung benötigen junge Menschen Vorbil<strong>der</strong> und oft<br />
beson<strong>der</strong>e Hilfen. Wir betrachten es als Aufgabe, unsere Schüler mit<br />
selbstwerter und verantwortlicher Haltung an<strong>der</strong>en gegenüber aus <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong> entlassen zu können.<br />
Eines unserer Hauptanliegen ist die Vorbereitung unserer Schüler auf<br />
das Berufs- und Alltagsleben.<br />
5
4 Schulspezifische Rahmenbedingungen<br />
4.1 Impressum<br />
<strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> (Filiale)<br />
Dessauerstraße 49-55 Drakestraße 80<br />
12249 <strong>Berlin</strong> 12205 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 90299 2336 Tel.: 8441595 41<br />
Fax: 90299 2334 Fax: 8441595 34<br />
e-mail: braunihome@web.de e-mail: fil-paul-braune@<br />
t-online.de<br />
Homepage: www.paul-braune-schule.de<br />
Schulleitung: Schulleitung: Frau Thiel- Blankenburg<br />
Stellvertretende Schulleitung: Frau Mostertz<br />
Autoren des <strong>Schulprogramm</strong>s / Steuergruppe:<br />
Herr Schulz (bis August 2005)<br />
Frau Thiel- Blankenburg (ab September 2006)<br />
Frau Kahnt<br />
Frau Schick<br />
Frau Drißler (bis November 2005)<br />
Frau Agbaria (bis August 2006)<br />
Frau Haack-Wulff<br />
Frau Krins (bis September 2006)<br />
Frau Odenthal (ab September 2006)<br />
6
4.2 Lage und Einzugsgebiet<br />
Die beiden Schulstandorte <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> liegen im Bezirk Steglitz-<br />
Zehlendorf. Der Hauptsitz befindet sich in <strong>der</strong> Dessauerstaße in Lankwitz und die<br />
Filiale in <strong>der</strong> Drakestraße in Lichterfelde. Der Bezirk Steglitz- Zehlendorf ist ein<br />
gutbürgerlicher Bezirk, <strong>der</strong> im Südwesten <strong>Berlin</strong>s liegt.<br />
Ein Teil <strong>der</strong> SchülerInnen kommt aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien<br />
o<strong>der</strong> lebt in den umliegenden Heimen im Bezirk Steglitz. Arbeitslosigkeit,<br />
Sozialhilfeabhängigkeit, Scheidung und <strong>der</strong>en Folgen prägen das Leben vieler<br />
unserer Kin<strong>der</strong>.<br />
Vernachlässigung, Verwahrlosung, erhöhte Kriminalität und Gewaltbereitschaft treten<br />
im sozialen Umfeld <strong>der</strong> meisten SchülerInnen auf. Nur wenige Kin<strong>der</strong> leben in<br />
wohlbehüteten und för<strong>der</strong>lichen Elternhäusern.<br />
In dem folgenden Diagramm wird die soziale Situation <strong>der</strong> SchülerInnen<br />
veranschaulicht, d.h. wie viele Kin<strong>der</strong> bei einem Elternteil, zwei Elternteilen o<strong>der</strong> im<br />
Heim leben.<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Stand 2004<br />
Drake<br />
Kl 1<br />
Kl 2<br />
Kl 4<br />
Kl 5<br />
Kl 6a<br />
Kl 6b<br />
Kl 7<br />
Kl 8<br />
Kl 9<br />
Soziale Situation<br />
7<br />
Dessauer<br />
GB<br />
Kl 7<br />
Kl 8<br />
Kl 9<br />
Kl 10<br />
Heim<br />
1 Eltern<br />
2 Eltern<br />
In <strong>der</strong> Schulumgebung leben im Vergleich zu an<strong>der</strong>en <strong>Berlin</strong>er Bezirken wenig<br />
nichtdeutsche Familien. Jedoch liegt <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>anteil an <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>-<br />
<strong>Schule</strong> im Schuljahr 2004/2005 bei 24,06%.
4.3 Schülerinnen und Schüler<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> handelt es sich um eine Grundschule mit<br />
Sekundarstufe I mit dem För<strong>der</strong>schwerpunkt „Lernen“. Nach Überprüfung und<br />
Feststellung des För<strong>der</strong>bedarfs durch unsere in <strong>der</strong> Dessauerstraße werden die<br />
SchülerInnen an einem <strong>der</strong> beiden Schulstandorte aufgenommen.<br />
In <strong>der</strong> folgenden Graphik wird dargestellt, in welcher Klassenstufe die SchülerInnen<br />
in die <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> eingetreten sind.<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Eintrittsalter gesamt in die Son<strong>der</strong>schule<br />
Dessauer 1 1 2 3 2 13 2 1 4<br />
Drake 27 7 20 11 20 2 5<br />
Stand 2004<br />
Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 4 Kl 5 Kl 6 Kl 7 Kl 8 Kl 9 Kl 10<br />
8<br />
Dessauer<br />
Anhand <strong>der</strong> Darstellung ist zu beobachten, dass die SchülerInnen vor allem im<br />
ersten, dritten, fünften und siebten Schuljahr in die <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> wechselten.<br />
Der Schulstandort in <strong>der</strong> Drakestraße nimmt vor allem SchülerInnen aus den unteren<br />
Klassen auf. In <strong>der</strong> Dessauerstraße sind hingegen nur die Klassenstufen 7 bis 10<br />
eingerichtet, so dass dieser Schulstandort die SchülerInnen nach <strong>der</strong> 6-jährigen<br />
Grundschulzeit in die Klassen integriert.<br />
Die SchülerInnen <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> besitzen den För<strong>der</strong>status „Lernen“. Sie<br />
haben nicht nur För<strong>der</strong>bedarf im Lernen, son<strong>der</strong>n auch in an<strong>der</strong>en Bereichen, wie<br />
• in <strong>der</strong> Fein- und Grobmotorik,<br />
• in <strong>der</strong> visuellen Wahrnehmung,<br />
• in <strong>der</strong> auditiven Wahrnehmung,<br />
• taktil- kinästhetischen Wahrnehmung und<br />
• im Verhalten.<br />
Im Folgenden werden die Defizite <strong>der</strong> SchülerInnen <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> in<br />
Kreisdiagrammen dargestellt, wobei die vorliegenden Ergebnisse auf Klassenlehrerbeobachtungen<br />
und –einschätzungen beruhen.<br />
Drake
Störung <strong>der</strong> Feinmotorik gesamt<br />
keine<br />
38%<br />
fast keine<br />
11%<br />
vollständig<br />
7%<br />
gering<br />
20%<br />
stark<br />
21%<br />
oft<br />
3%<br />
visuelle Wahrnehmungsstörungen<br />
keine<br />
50%<br />
vollständig<br />
5% stark<br />
7%<br />
fast keine<br />
13%<br />
oft<br />
17%<br />
gering<br />
8%<br />
taktil-kinästhetische<br />
Wahrnehmungsstörungen<br />
keine<br />
58%<br />
vollständig<br />
5% stark<br />
10%<br />
oft<br />
7%<br />
fast keine<br />
2%<br />
gering<br />
18%<br />
9<br />
keine<br />
47%<br />
Störung <strong>der</strong> Grobmotorik<br />
vollständig<br />
stark<br />
2%<br />
9%<br />
oft<br />
4%<br />
fast keine<br />
15%<br />
gering<br />
23%<br />
auditive Wahrnehmungsstörungen<br />
keine<br />
52%<br />
vollständig<br />
7% stark<br />
4%<br />
fast keine<br />
13%<br />
oft<br />
13%<br />
gering<br />
11%<br />
Verhaltensauffälligkeit gesamt<br />
selten<br />
12%<br />
nie<br />
23%<br />
manchmal<br />
20%<br />
immer<br />
19%<br />
oft<br />
13%<br />
fast immer<br />
13%
Wissenstand im Bereich Mathematik<br />
17%<br />
46%<br />
37%<br />
weniger entsprechend mehr<br />
(Die Angaben beziehen sich auf den Rahmenplan <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>schule)<br />
10<br />
Wissenstand im Bereich Deutsch<br />
16%<br />
48%<br />
36%<br />
weniger entsprechend mehr<br />
Ein großer Teil <strong>der</strong> SchülerInnen fühlt sich in <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> wohl.<br />
Sie schätzen das rücksichtsvolle Klima. Die Eltern zeigen sich überwiegend zufrieden<br />
mit <strong>der</strong> Zusammenarbeit.<br />
(vgl. Grafik zur Fragebogenaktion für Schüler, Eltern und Lehrer)<br />
eher nein<br />
7%<br />
Klima an <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
nein<br />
17%<br />
k.A.<br />
12%<br />
eher ja<br />
25%<br />
ja<br />
39%<br />
eher ja<br />
27%<br />
Kooperation k.A. Eltern<br />
6%<br />
nein<br />
3%<br />
eher nein<br />
2%<br />
ja<br />
62%
Bis zum Schuljahr 2004/2005 beendeten die SchülerInnen <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong><br />
nach 9-jährigem Schulbesuch die Sekundarstufe I entwe<strong>der</strong> mit einem Son<strong>der</strong>schulabgangs-<br />
o<strong>der</strong> Son<strong>der</strong>schulabschlusszeugnis.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Schulabschlüsse <strong>Paul</strong> <strong>Braune</strong> <strong>Schule</strong><br />
2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004<br />
Abgang Abschluss<br />
Im Rahmen unseres Schulversuchs, Berufsorientieren<strong>der</strong> Lehrgang im 10.<br />
Schulbesuchsjahr (BO 10), konnten die SchülerInnen <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong> bis<br />
zum Schuljahr 2005/2006 den vergleichbaren Hauptschulabschluss erwerben.<br />
Voraussetzung für die Teilnahme am Berufsorientierenden Lehrgang (BO 10) ist das<br />
Erreichen des Son<strong>der</strong>schulabschlusszeugnisses.<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Abschlüsse Schuljahr 2005/2006<br />
Hauptschulabschluss berufsorientierter<br />
Abschluss<br />
11<br />
Abgangszeugnis
4.4 Mitarbeiter<br />
Schulleiter: vorm. Herr Schulz, seit August 2006 Frau Thiel- Blankenburg<br />
Stellvertretende Schulleiterin: Frau Mostertz (Sitz: Dessauerstraße)<br />
Im Schuljahr 2004/2005 unterrichteten 26 Kolleginnen und Kollegen an <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>-<br />
<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong>. Davon sind insgesamt 12 Lehrer mit dem Amt des Son<strong>der</strong>schullehrers<br />
an beiden Schulstandorten tätig. Eine Lehrerin und ein Lehrer mit dem Amt<br />
des Son<strong>der</strong>schullehrers sind an unserem För<strong>der</strong>zentrum für die son<strong>der</strong>pädagogische<br />
Diagnostik abgeordnet.<br />
<strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> Dessauerstraße <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> (Filiale)<br />
Drakestraße<br />
Lehrerinnen 10 12<br />
Lehrer 2 1<br />
Religionslehrerin 1 1<br />
Erzieherin --- Frau Lechner<br />
2 Therapeuten Frau Haß-Heise<br />
Frau Haß-Heise<br />
(Psychomotorik) Frau Algenstaedt<br />
Frau Algenstaedt<br />
Pädagogische 1 (Frau Haack-Wulff) ---<br />
Unterrichtshilfe<br />
SIS Frau Zühlke, Herr Meinhard Frau Lüdtke<br />
Hausmeister Herr Benz ---<br />
Sekretärin Frau Namli Frau Witte<br />
4.5 Ausstattung <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
<strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> Dessauerstraße <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> (Filiale)<br />
Drakestraße<br />
Klassenräume<br />
Fachräume<br />
6 10<br />
Computerraum 1 1<br />
Küche 1 1<br />
Holzverarbeitung 1 1<br />
Metallverarbeitun<br />
g<br />
--- 1<br />
Naturwissenscha --- 1<br />
ft<br />
Musikraum --- 1<br />
Textilraum --- 1<br />
Epu-Raum --- 1<br />
Religionsraum --- 1<br />
Lehrerzimmer 1 (gemeinsame Nutzung mit <strong>der</strong><br />
Kopernikus-<strong>Schule</strong> )<br />
1<br />
Aula 1 (gemeinsame Nutzung mit <strong>der</strong> 1<br />
Kopernikus-<strong>Schule</strong> )<br />
Hortbetreuung --- 1 (Textilraum gemeinsame<br />
Nutzung)<br />
Cafeteria 1 ---<br />
Turnhalle 1 1<br />
Büro --- 1<br />
Sekretariat 1 (gemeinsame Nutzung mit dem Büro) 1<br />
För<strong>der</strong>zentrum 2 Räume ---<br />
Lernwerkstatt --- 1<br />
Therapeuten 1 1<br />
SIS --- 1<br />
12
4.6 Kooperation mit Eltern, Heimen und sonstigen Institutionen<br />
Wie bereits unter Punkt 2.3 beschrieben, werden an <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong><br />
SchülerInnen mit dem För<strong>der</strong>schwerpunkt „Lernen“ unterrichtet. Bei einem Großteil<br />
<strong>der</strong> SchülerInnen sind Teilleistungsstörungen diagnostiziert, Entwicklungsverzögerungen<br />
sowie Verhaltensauffälligkeiten sind erkennbar. Des Weiteren sind<br />
sprachliche und motorische Auffälligkeiten vorhanden.<br />
Für eine bestmögliche För<strong>der</strong>ung unserer SchülerInnen im schulischen wie auch im<br />
erzieherischen Bereich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und<br />
Eltern Voraussetzung. Aus diesem Grund ist das Kollegium <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong><br />
bemüht, einen guten und regelmäßigen Kontakt zu den Eltern und ErzieherInnen zu<br />
halten. Es werden Elternsprechtage, Elterngespräche angeboten und Schulhilfekonferenzen<br />
einberufen.<br />
Die <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> kooperiert neben den Eltern mit folgenden Institutionen und<br />
Heimen:<br />
• Schulpsychologie<br />
• Therapeuten (Ergotherapie und Psychomotorik)<br />
• JUG (KJPD) Kin<strong>der</strong>- und Jugendpsychologischer Dienst<br />
• Jugendhilfe<br />
• KJGD: Kin<strong>der</strong>- und Jugend Gesundheitsdienst (Schularzt)<br />
• Sis: senior in school (Mediatoren)<br />
• Jugendamt<br />
• Arbeitsamt<br />
• Polizei (präventive Maßnahmen)<br />
• Clara<br />
• kooperierende Heime:<br />
Wadzeck- Stiftung (Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Lernstation)<br />
Haus Neuhland<br />
Pastor-<strong>Braune</strong>-Haus<br />
Verein für Arbeit, Soziales und Segeln<br />
Diverse Wohngruppen<br />
4.7 Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
• Aufglie<strong>der</strong>ung in zwei Schulstandorte (Lankwitz und Lichterfelde)<br />
• Teilnahme an dem Schulversuch „Berufsorientieren<strong>der</strong> Lehrgang (BO 10)<br />
• Einbindung in das Netz <strong>der</strong> <strong>Berlin</strong>er Schülerfirmen<br />
• in den Schulalltag eingeglie<strong>der</strong>te Therapien<br />
• Orientierung am ETEP-Programm (Entwicklungstherapie und<br />
Entwicklungspädagogik) und Einrichtung von ETEP-Lerngruppen<br />
• Integration einer Klasse für geistigbehin<strong>der</strong>te Schüler<br />
• Sitz <strong>der</strong> Koordinationsstelle und <strong>der</strong> Schulpsychologie in <strong>der</strong> Dessauerstraße<br />
(Lankwitz)<br />
• VHG<br />
13
5 Arbeitsvorhaben<br />
5.1 Unterricht<br />
5.1.1 Jahrgangsübergreifendes Lernen<br />
Ausgangslage<br />
Durch das Prinzip des jahrgangsbezogenen Lernens an <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong><br />
konnten Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht sowie Teamteaching nur begrenzt<br />
umgesetzt werden. Aus unserer Sicht besteht in diesen Aspekten ein hohes<br />
Potential zur Verbesserung <strong>der</strong> Unterrichtsqualität und Kompetenzentwicklung <strong>der</strong><br />
Schüler.<br />
Ziel: Verbesserung <strong>der</strong> Unterrichtsqualität<br />
Maßnahmen: Bildung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen<br />
<strong>der</strong> Klassenstufen 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 und 9 / 10 nach Abstimmung<br />
in <strong>der</strong> Schulkonferenz<br />
Timing: SJ 2005/2006 9/10 V: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
SJ 2006/2007 3 /4 V: Frau Krins, Frau Straßburg<br />
SJ 2007/2008 weitere Gruppen<br />
Evaluation: Befragung von Schülern, Lehrern und Eltern, Lernerfolgskontrolle<br />
durch Vergleichsarbeiten, Lernstandsmessung,<br />
Prozessdiagnostik, BELLA<br />
5.1.1.1 Bildung von Expertenteams<br />
Ausgangslage<br />
Analog zum jahrgangsbezogenen Lernen wurde bisher das Klassenlehrerprinzip<br />
durch eine Lehrkraft von <strong>der</strong> Unterstufe bis zum Schulabgang favorisiert. Eine Spezialisierung<br />
<strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer wurde so behin<strong>der</strong>t. Darüber hinaus wurde die<br />
Teamentwicklung innerhalb des Kollegiums eingeschränkt.<br />
Ziel: Verbesserung <strong>der</strong> Unterrichtsqualität durch mehr Professionalisierung<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Steuerungs- und Reflexionsmöglichkeiten durch<br />
Teambildung<br />
Maßnahmen<br />
Es werden Expertenteams gebildet, die den Kolleginnen und Kollegen eine<br />
Spezialisierung auf die Unterrichtsinhalte <strong>der</strong> o.g. jahrgangsübergreifenden<br />
Lerngruppen ermöglichen.<br />
Evaluation: Befragung <strong>der</strong> Teams (Erhebung), Lernerfolgskontrolle<br />
T.: zum SJ 2007/08, Erprobung in Klasse 3 / 4 im SJ 2006/07<br />
14
5.1.1.2 Stufenkonferenzen<br />
Ausgangslage<br />
Die Form herkömmlicher Fachkonferenzen ist nur bedingt geeignet, übergreifende<br />
Entwicklungsprojekte wie die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lesekompetenz o<strong>der</strong> den Bereich <strong>der</strong><br />
Präsentationen vernetzt zu betrachten und zu konzipieren. Durch Stufenkonferenzen<br />
erhalten wir die Möglichkeit, in Expertenteams aufeinan<strong>der</strong> bezogene schulinterne<br />
Curricula zu entwickeln.<br />
Ziel: Konzeptentwicklung eines schulinternen Curriculums<br />
Maßnahmen: Aufbau von Stufenkonferenzen<br />
V.: jeweilige Jahrgangsstufenleiter<br />
5.1.2 Leseför<strong>der</strong>ung<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Bestandsaufnahme zum <strong>Schulprogramm</strong> wurde deutlich, dass ca.<br />
ein Drittel unserer SchülerInnen die Standards des Rahmenplanes für das Fach<br />
Deutsch nicht erreicht. Der Aufbau <strong>der</strong> Lesekompetenz ist nicht nur ein wichtiges<br />
Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele, son<strong>der</strong>n eine Bedingung für die<br />
Weiterentwicklung des eigenen Wissens, <strong>der</strong> eigenen Fähigkeiten – also je<strong>der</strong> Art<br />
selbständigen Lesens – und eine Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen<br />
Leben.<br />
Ziel: Selbständige Bedeutungsentnahme von Texten, die <strong>der</strong> Altersstufe<br />
entsprechen<br />
Maßnahmen:<br />
Konzeption eines schulinternen Curriculums durch die Stufenkonferenzen<br />
T.: Schuljahr 2006/07<br />
V.: LeiterInnen <strong>der</strong> Stufenkonferenzen<br />
Lesenlernen durch den Kieler Leseaufbau<br />
T.: ab Schuljahr 2006/07<br />
V.: Frau Krins, Frau Straßburg (Drakestr.)<br />
V.: Herr Greschista, Frau Hack-Wulff (Dessauer Str.)<br />
Lesepatenschaften<br />
T.: ab Schuljahr 2006/07<br />
V.: Frau Tito Flores, Frau Pautz<br />
Erarbeitung eines arbeitsrelevanten Wortschatzes (Schülerfirmen)<br />
T.: ab Schuljahr 2006/07<br />
V.: Frau Schmidt-Schäfer, Herr Schüttler<br />
15
Evaluation<br />
Gegenstand: Lesenlernen durch den Kieler Leseaufbau<br />
Diagnostik durch den Kieler Leseaufbau<br />
T.: Ende des Schuljahres 2006/07<br />
V.: Frau Krins, Frau Straßburg<br />
Frau Hack-Wulff, Herr Greschista<br />
Computergestützte Diagnostik <strong>der</strong> Lesekompetenz (Lea und Leon)<br />
T.: 1.12.06<br />
V.: Herr Wolski<br />
5.1.3 Berufsorientierung<br />
Ausgangslage:<br />
Die Abgänger unserer <strong>Schule</strong> haben auf dem Arbeitsmarkt nur geringe Chancen.<br />
Ziel:<br />
Durch einen mehrjährigen Berufsorientierungsprozess soll <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong> in die Berufs- und Arbeitswelt unterstützt werden. Die <strong>Paul</strong>- <strong>Braune</strong>- <strong>Schule</strong><br />
macht es sich zur Aufgabe, den Übergang Jugendlicher von <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> in die<br />
Berufsausbildung zu verbessern.<br />
Langfristige Ziele:<br />
Aufbau von Schülerfirmen<br />
Aufbau von festen Beziehungen zu Betrieben zur Durchführung von<br />
Betriebspraktika<br />
Berufswahlpass als unterstützendes Element<br />
Kurzfristige Ziele im Schuljahr 2006/07:<br />
• Einführung des Berufswahlpasses in Klasse 8<br />
• Teilnahme aller Schüler <strong>der</strong> Klassen 9 und 10 an mindestens zwei<br />
Betriebspraktika<br />
• Verbesserung <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Betriebspraktika<br />
• Erstellen von Bewerbungsmappen in Klasse 9/10<br />
• Planung des Übergangs in die Ausbildungs- und Berufswelt für Schüler<br />
ohne Ausbildungsplatz<br />
• Sammeln praktischer Erfahrungen in schülerfirma-<br />
ähnlichen Bereichen<br />
Standort Dessauerstraße: Cafeteria<br />
Standort Drakestraße: Garten, Brötchenservice<br />
Maßnahmen:<br />
1. Durchführung eines Elternabends in den Klassen 8 zum Bekannt machen mit<br />
dem Berufswahlpass<br />
T.: 13. 09. 06 V.: Frau Kahnt, Frau Gau<br />
T.: 6.9.06 V.: Frau Mostertz<br />
2. Beratung durch Berufsberater in Klasse 9/10 in <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
T.: November 2006 V.: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
3.<br />
V.: Frau Drißler<br />
Durchführung eines Elternabends in Klasse 9/10 in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong><br />
Agentur für Arbeit<br />
T.: April 2006 V.: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
V.: Frau Drißler<br />
16
4. Erste Kontakte zur Berufs- und Arbeitswelt innerhalb <strong>der</strong> Durchführung von<br />
Betriebspraktika in den Klassen 8 bis 10 gestaffelt nach Länge und Häufigkeit<br />
– dabei Einsicht in Berufsfel<strong>der</strong>/Berufsbereiche<br />
Standort Dessauerstraße<br />
• Orientierungspraktika 2x 2 Wochen in Klasse 8<br />
T.: 20.11.06- 8.12.06 23.4.07- 11.05.07<br />
V.: Frau Mosterz<br />
• Betriebspraktika 3x 3 Wochen in Klasse 9/10<br />
T.: 6.11.06- 24.11.06 5.3.06- 23.3.06 21.5.06- 8.6.06<br />
V.: Frau Drißler<br />
• Betriebspraktika 2x3 Wochen <strong>der</strong> GB Klasse<br />
T.: 23.10.06- 3.11.06 19.2.06- 2.3.06<br />
V.: Frau Rose<br />
Standort Drakestraße<br />
• Orientierungspraktikum 1x 2 Wochen in Klasse 8<br />
T.: 21.5. 06- 1.6.06<br />
V.: Frau Kahnt, Frau Gau<br />
• Betriebspraktika 1.HJ zwei Wochen, 2. HJ drei Wochen in Klasse 9/10<br />
T.: 23. 10. 06 – 3. 11. 06 4. 6. 06 – 22. 6. 06<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
5. Erste Selbst – und Fremdeinschätzung vor bzw. während <strong>der</strong> Durchführung<br />
des Praktikums in Klasse 8<br />
6. Ergebnisse von Betriebspraktika auswerten – hinsichtlich berufsbezogener<br />
Erfahrungen und <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong>Basiskompetenzen in Klasse 9/10<br />
7. Besuch <strong>der</strong> weiterführenden <strong>Schule</strong>n: Carl Legin-Oberschule,<br />
August-San<strong>der</strong>-<strong>Schule</strong><br />
Biesalski-<strong>Schule</strong> und<br />
Loschmidt-Oberschule zum „Tag <strong>der</strong><br />
Offenen Tür“<br />
mit Erkundungsaufträgen (Klasse 9)<br />
Durchführung von Interviews (Klasse 10)<br />
T.: Januar/Februar 2007<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand, Frau Drißler<br />
8. Durchführung von Schnupperpraktika für Schüler <strong>der</strong> Klasse 10 an den<br />
weiterführenden <strong>Schule</strong>n<br />
T.: nach indiv. Vereinbarung<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand, Frau Drißler<br />
9. Einladung ehemaliger Schüler, die jetzt an weiterführenden <strong>Schule</strong>n sind, um<br />
Erfahrungsberichte zu geben - Erfahrungsaustausch<br />
T.: April 2006<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand, Frau Drißler<br />
10. Betriebsbesichtigung bei Mc Donalds<br />
T.: unbekannt<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
11. Erkundungstraining bezüglich von Praktikumsplätzen in Klasse 9/10<br />
T.: September 2006<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand, Frau Drißler<br />
17
12. Bewerbungstraining ab Klasse 8 – Erste Thematisierung;<br />
Erstellen von Bewerbungsmappen in Klasse 9/10:<br />
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf;<br />
T.: Juni 2007<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand, Frau Drißler<br />
Vorstellungsgespräche im Rahmen des Unterrichts<br />
(Videoaufzeichnung) – Sichtbarmachen von Kompetenzen hier:<br />
Kommunikationstraining<br />
T.: August 2006<br />
V.: Frau Schick, Frau Hildebrand<br />
13. Aktualisierung von Kenntnissen über Berufsfel<strong>der</strong> und Anfor<strong>der</strong>ungsprofilen<br />
mit Hilfe des Computers - Verbesserung <strong>der</strong> Medienkompetenz<br />
T.: in regelmäßigen Abständen<br />
V.: Herr Wolski<br />
Evaluation:<br />
Gegenstand: Qualitätsentwicklung <strong>der</strong> Betriebspraktika<br />
Indikatoren: Liste <strong>der</strong> Betriebe, wo Schüler erfolgreich ein Praktikum absolviert<br />
haben und wo die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Betriebes<br />
fruchtbringend für den Schüler war.<br />
„Praktikumsatlas“, Auswahl von Betrieben, die auch ausbilden bzw.<br />
<strong>der</strong>en Berufsfel<strong>der</strong> den Ausbildungsmöglichkeiten unserer Schüler entsprechen.<br />
Erfolgreiche Beendigung <strong>der</strong> Praktika.<br />
Methoden: Fragebögen (siehe Bella) zur Schülerfirma,<br />
För<strong>der</strong>pläne – Beurteilung des Kompetenzzuwachses, Erfahrungsaustausch<br />
aller beteiligter Kollegen unter Anleitung des Praxisbeauftragten,<br />
Qualitätsanalyse <strong>der</strong> Praxisbetriebe,<br />
Fragebögen über Berufs – Interessenlage,<br />
Videoaufzeichnungen von Vorstellungsgesprächen bei denen <strong>der</strong><br />
Schülerfirma ähnlichen Bereichen.<br />
Zeitplan: November 2006 (1. Praktikum Klasse 9/10)<br />
Ende des Schuljahres 2006/07 (alle Praktika Klasse 8-10)<br />
Teilnehmer: Klassenleiter <strong>der</strong> Klassen 8-10<br />
Praxisbeauftragter <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
Rückmeldung <strong>der</strong> Ergebnisse an den Praxisbeauftragten und den Schulleiter<br />
18
5.1.4 Entwicklungstherapeutischer- Entwicklungspädagogischer<br />
Unterricht (ETEP)<br />
Erfolgreiche Entwicklung <strong>der</strong> Persönlichkeiten von sozial und emotional belasteten<br />
Kin<strong>der</strong>n<br />
Ausgangslage<br />
Ein großer Teil <strong>der</strong> SchülerInnen zeigt Beeinträchtigungen im Verhaltensbereich (vgl.<br />
Grafik in Bestandsaufnahme). Diese Defizite wirken sich sowohl auf den Bereich des<br />
Lernens als auch auf die Sozialkompetenz <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler aus.<br />
Langfristige Ziele:<br />
• Aufbau von zwei ETEP-Gruppen (je eine Gruppe in Klasse 3 und Klasse<br />
4 mit je zwei Lehrern)<br />
• Arbeit mit dem Programm „Ich schaffs“ ab Klasse 5 (ab SJ 07/08)<br />
Kurzfristiges Ziel:<br />
Aufbau einer ETEP-Gruppe zum Schuljahr 2006/2007<br />
In <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 3/4 werden alle Schülerinnen und Schüler nach dem Konzept<br />
des Entwicklungspädagogischen Unterrichts (ETEP) in ihrem Lernen und Verhalten<br />
geför<strong>der</strong>t und unterstützt.<br />
Maßnahmen:<br />
An <strong>der</strong> <strong>Paul</strong>-<strong>Braune</strong>-<strong>Schule</strong> nehmen jahrgangsübergreifend alle Schülerinnen und<br />
Schüler <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 3/4 gemeinsam an dem ETEP-Konzept teil. Vier<br />
Stunden in <strong>der</strong> Woche - je zwei Doppelstunden – findet <strong>der</strong> Entwicklungspädagogische<br />
Unterricht (EPU) statt, <strong>der</strong> von drei Lehrerinnen begleitet wird – eine<br />
unterrichtende Lehrkraft und zwei Assistenzlehrkräfte.<br />
Nach <strong>der</strong> Diagnostik (ELDiB- Entwicklungstherapeutischer Lernziel-Diagnose-Bogen)<br />
durch das Lehrerteam werden folgende Schritte durchgeführt:<br />
Feststellung des aktuellen Entwicklungsstands,<br />
Zuweisung zu einer Entwicklungsstufe und<br />
Aufstellung von individuellen Lernzielen in den Bereichen Verhalten,<br />
Kommunikation und Sozialisation für jedes Kind.<br />
Evaluation:<br />
Indikatoren: Individuelle Lernziele jedes Schülers<br />
Methoden: Anleitung für die Dokumentation und Interpretation des Fortschritts<br />
Option 1: Säulen Grafik<br />
Option 2: Zusammenfassung des ELDiB<br />
Option 3: Prä-Post-ELDiB-Überblick<br />
Option 4: ELDiB-Vergleich mit Einschätzung vor Beginn <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung<br />
Auswahl und Erprobung <strong>der</strong> Dokumentationsoptionen<br />
Termin: Beginn des 2. Schulhalbjahres<br />
Verantwortl.: Frau Krins<br />
19
5.2 Erziehung<br />
5.2.1 Soziales Miteinan<strong>der</strong><br />
Ausgangslage<br />
Die Schüler unserer <strong>Schule</strong> sind in Bezug auf ihre soziale Entwicklung vielfach belastet,<br />
zum Beispiel durch instabile Familiensituationen, durch Mangel an Zuwendung<br />
und auch durch ungünstige Medieneinflüsse. Um dies auszugleichen, muss Unterricht<br />
und Freizeit so gestaltet sein, dass die Schülerinnen und Schüler einen angemessenen<br />
Umgang mit an<strong>der</strong>en erleben, erfahren und erlernen.<br />
Langfristige Ziele:<br />
Die Schüler sollen im Laufe ihrer Schulzeit soziale Kompetenz entwickeln. Sie<br />
lernen, sich aufeinan<strong>der</strong> einzustellen, Regeln einzuhalten, eigene Ideen und<br />
Interessen angemessen einzubringen und mit Enttäuschungen und Einschränkungen<br />
fertig zu werden. Sie lernen unsere <strong>Schule</strong> als ein soziales Miteinan<strong>der</strong> von Lehrern,<br />
Schülern und Eltern/Erziehern kennen.<br />
Kurzfristige Ziele:<br />
Mit <strong>der</strong> Durchführung eines Projekts „Soziales Lernen“, an dem alle Schüler <strong>der</strong><br />
<strong>Schule</strong> beteiligt sind, sollen sie<br />
ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken<br />
unterstützt werden, Gefühle auszudrücken und zur Sprache zu bringen<br />
für die Gefühle an<strong>der</strong>er sensibilisiert werden<br />
gemeinsame Konfliktlösung vertieft kennen lernen<br />
ihre Frustrationstoleranz soll erhöht werden<br />
Maßnahmen<br />
1.) Projekt „Soziales Lernen“<br />
T: 2. Halbjahr des Schuljahres 2006/07<br />
V: alle Lehrer<br />
2. Erstellung eines Maßnahmenkataloges (Regeln)<br />
Mit dem Erstellen eines Maßnahmenkatalogs für „schwierige Alltagsituationen“ bilden<br />
die Lehrer <strong>der</strong> <strong>Schule</strong> einen Konsens, damit alle in diesen Alltagssituationen ähnlich<br />
reagieren („Alle ziehen an einem Strang“). Ziel ist auch hier <strong>der</strong> Aufbau eines<br />
positiven Sozialverhaltens bei den Schülern. Bei Regelverstoß folgt nicht sofort<br />
„Strafe“, son<strong>der</strong>n hierarchisch gestufte Maßnahmen zur Verhaltensän<strong>der</strong>ung (z.B.<br />
20
Gespräche, Besinnungstext, Entschuldigungen bei Beleidigungen, Dienst für die<br />
Schulgemeinschaft, Maßnahmen zur Verhaltensän<strong>der</strong>ung).<br />
T: November 2006<br />
V: Fr. Straßburg, Fr. Lechner<br />
3.) Sportliche Aktivitäten<br />
Termine: über das Schuljahr verteilt<br />
BJS, Krumme-Lanke-Lauf, Staffel, Braunis-Cup<br />
V: Planungskommitee Drake/Dessauer<br />
4.) Schulfeste (Weihnachtsfeier, Schulabschluss)<br />
T.: Weihnachten/vor den Sommerferien<br />
V.: Frau Thiel-Blankenburg, Herr Fest (Elternvertreter)<br />
5.) Auszeichnungen/Belobigungen öffentlich machen<br />
T.: monatlich<br />
V.:<br />
6.) Entspannungsübungen im Bereich VHG und Unterricht<br />
T.: nach den Herbstferien<br />
V.: Fr. Lechner<br />
7.) Psychomotorik<br />
T.: parallel zum Unterricht<br />
V.: Fr. Haß-Heise, Fr. Algenstaedt<br />
8.) Kontakt zu Eltern zu pflegen, auszubauen und zu nutzen (durch Elterngespräche<br />
Hausbesuche, Einladungen zu den Festen, Elternstammtisch)<br />
T.: nach Bedarf, regelmäßig<br />
V.: LehrerInnen und Erzieherin <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
9.) Beratung mit Kollegen und Teamarbeit unter den Lehrern, z.B. Supervision<br />
(s. Punkt 5.4 Fortbilungskonzept)<br />
T : nach Anfrage durch die Lehrer/innen<br />
V : Frau Thiel-Blanknburg<br />
10.) Kontakt mit außerschulischen Einrichtungen z.B. Polizei (Antigewalttraining)<br />
o<strong>der</strong> Hort/Tageseinrichtungen, Jugendfreizeitheimen<br />
11.) AG – Angebote, z.B. Fußball, Breakdance, Theater, Yoga<br />
T: nach den Herbstferien<br />
V: Frau Lechner (Yoga)<br />
21
Evaluation<br />
zu 1) Soziales Klima<br />
Indikatoren: Reduzierung <strong>der</strong> Beleidigungen in <strong>der</strong> <strong>Schule</strong><br />
Verfahren/Instrumente: Fragebögen vor und nach <strong>der</strong> Durchführung des Projekts und<br />
Beobachtungen<br />
Zeitplan:<br />
Beteiligte: alle LehrerInnen<br />
zu 7.) Psychomotorik<br />
Verfahren/Instrumente: Beobachtung, Therapieberichte<br />
Zu 8.) Kontakt zu Eltern<br />
Ziele: Stärkung <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern und Erfahrungsaustausch<br />
<strong>der</strong> Eltern untereinan<strong>der</strong><br />
Indikatoren : Präsenz <strong>der</strong> Eltern bei schulischen Veranstaltungen, Mitwirkung<br />
in schulischen Gremien<br />
Verfahren/Instrumente: Fragebogen zur Zufriedenheit <strong>der</strong> Eltern<br />
zu 9.) Beratung<br />
Ziele: Entlastung des Lehrers in schwierigen Situationen, Stärkung und Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Handlungskompetenz<br />
Indikatoren: Berufszufriedenheit<br />
Methode: Erhebung, Befragung<br />
5.3 VHG – Vernetzung des Unterrichts- und Betreuungsangebotes<br />
Ausgangslage<br />
Bedingt durch eingeschränkte Konzentrations- und Auffassungsmöglichkeiten sowie<br />
soziale Kompetenz benötigen unsere Schüler/innen ein beson<strong>der</strong>s abwechslungsreiches<br />
und strukturiertes Unterrichtskonzept. Dieser For<strong>der</strong>ung wollen wir durch<br />
abgestimmte Angebote aus den Bereichen Betreuung und Unterricht Rechnung<br />
tragen.<br />
Ziele<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lernmotivation<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> personalen und sozialen Kompetenz<br />
Maßnahmen<br />
Einzelbetreuung und Zuwendung im Unterricht durch die Erzieherin, Lesepaten und<br />
Mediatoren<br />
Entspannungsübungen während des Unterrichts und in <strong>der</strong> AG<br />
Unterricht im Team (Lehrerin/Erzieherin/Seniorpartnern)<br />
T: im Schuljahr 2006/07<br />
V: Frau Lechner, Frau Tito Flores<br />
22
Evaluation<br />
För<strong>der</strong>plan (Dokumentation des Arbeits- und Sozialverhaltens)<br />
5.4 Fortbildungskonzept<br />
Langfristiges Ziel<br />
Für die Fortentwicklung unserer <strong>Schule</strong> wollen wir auf <strong>der</strong> Grundlage dieses<br />
<strong>Schulprogramm</strong>s unsere professionellen Kompetenzen weiter schulen.<br />
Kurzfristige Ziele<br />
a) Entwicklung unserer Kompetenz im Bereich „Soziales Miteinan<strong>der</strong>“<br />
Maßnahmen<br />
Schulinterne Fortbildungen mit dem gesamten Kollegium<br />
1. Studientag zum Thema „ETEP“ in Zusammenarbeit mit dem LISUM (Frühjahr<br />
2004)<br />
2. Studientag zum Thema „Gewaltprophylaxe“ in Zusammenarbeit mit dem Anti-<br />
Gewaltbüro <strong>Berlin</strong>/Brandenburg (11. und 12.6. 2006)<br />
3. Studientag zum Thema „Soziales Miteinan<strong>der</strong>“ in Zusammenarbeit mit dem<br />
LISUM (Februar 2007)<br />
V. Frau Straßburg für Punkt 3<br />
b) Entwicklung unserer Kompetenz im Bereich „Berufsorientierung“<br />
1. Gemeinsame Veranstaltung mit dem gesamten Kollegium am 13.12.05 über<br />
das LISUM<br />
2. „Berufswahlpass“ über Partner <strong>Schule</strong> und Wirtschaft für die Kollegen <strong>der</strong><br />
Klassen 7-10<br />
3. weitere Fortbildungen sind geplant<br />
V: Frau Schick<br />
c) Entwicklung unserer Kompetenz im Bereich „Personale Kompetenz“<br />
Supervision durch Schulpsychologin Frau Kreische vom 18.8.05 – 1.6.06<br />
d) Leseför<strong>der</strong>ung<br />
23