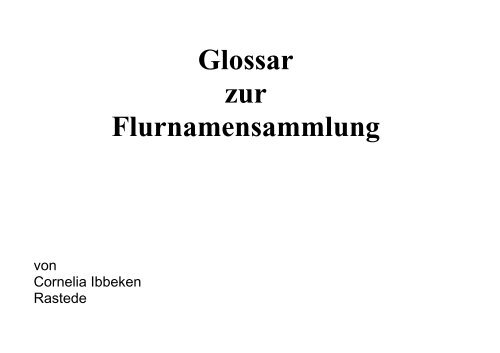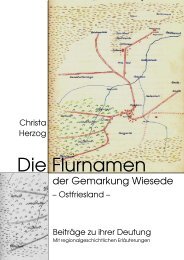Glossar zur Flurnamensammlung - Die Flurnamensammlung der ...
Glossar zur Flurnamensammlung - Die Flurnamensammlung der ...
Glossar zur Flurnamensammlung - Die Flurnamensammlung der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
von<br />
Cornelia Ibbeken<br />
Rastede<br />
<strong>Glossar</strong><br />
<strong>zur</strong><br />
<strong>Flurnamensammlung</strong>
„Alte Flurnamen mit dunklem Sinn<br />
sind wie Münzen aus Edelmetall,<br />
die in <strong>der</strong> Erde gelegen haben.<br />
Wenn sie sorgsam behandelt werden,<br />
leuchten sie.“<br />
(A. Schöneboom)<br />
Das vorliegende <strong>Glossar</strong> versucht, die in <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong> von Heinrich Schumacher häufiger<br />
vorkommenden Wörter bzw. Wortteile zu erklären. In <strong>der</strong> ersten Spalte des <strong>Glossar</strong>s (Begriff I) werden die<br />
jeweiligen Stichwörter angeführt, in <strong>der</strong> zweiten Spalte (Begriff II) einige abweichende Schreibweisen.<br />
Zahlenangaben in runden Klammern „(1), (2)“ kennzeichnen unterschiedliche Erklärungen eines gleich lautenden<br />
Begriffes. <strong>Die</strong> dritte Spalte enthält die entsprechenden Worterklärungen und die vierte Spalte die verwendete<br />
Literatur. Für die Definitionen sind vorwiegend Nachschlagewerke benutzt worden, die sich auf das ostfriesische<br />
Platt beziehen. <strong>Die</strong> Literaturangaben werden in je<strong>der</strong> Zeile vollständig aufgeführt, um eine Übertragung in die<br />
Datenmaske durch Kopieren zu ermöglichen.<br />
Verzeichnis <strong>der</strong> im Flurnamen-<strong>Glossar</strong> verwendeten Abkürzungen sowie eine kurze<br />
Erläuterung <strong>zur</strong> sprachlichen Entwicklungsgeschichte<br />
aengl. altenglisch<br />
afries. altfriesisch<br />
ahd. althochdeutsch<br />
anord. altnordisch<br />
engl. englisch<br />
frz. französisch<br />
germ. germanisch<br />
lat. lateinisch<br />
mhd. mittelhochdeutsch<br />
mnd. mittelnie<strong>der</strong>deutsch<br />
mnl. mittelnie<strong>der</strong>ländisch<br />
nhd. neuhochdeutsch<br />
nie<strong>der</strong>d./nd. nie<strong>der</strong>deutsch<br />
nie<strong>der</strong>l. nie<strong>der</strong>ländisch<br />
nfries. nordfriesisch<br />
nnd. neunie<strong>der</strong>deutsch (seit ca. 1600)
<strong>Die</strong> meisten <strong>der</strong> in Europa gesprochenen Sprachen (Ausnahmen: Baskisch, Samisch, Finnisch, Ungarisch, Türkisch) gehören <strong>zur</strong><br />
indogermanischen Sprachfamilie, die zu Beginn <strong>der</strong> geschichtlichen Überlieferung bereits über Europa und großen Teilen Asiens<br />
verbreitet war. Das Ursprungsgebiet <strong>der</strong> indogermanischen Sprache ist umstritten; in Frage kommen Zentralasien, Osteuropa, aber<br />
auch Mitteleuropa. <strong>Die</strong> indogermanische Sprachfamilie teilt sich in zwei Zweige, einen europäischen und einen asiatischen Zweig, die<br />
sich wie<strong>der</strong>um in einzelne Sprachgruppen aufglie<strong>der</strong>n. <strong>Die</strong>se Sprachgruppen weisen Ähnlichkeiten in <strong>der</strong> Grammatik, <strong>der</strong><br />
Formenbildung und im Wortschatz auf, aus denen sich Rückschlüsse auf die Wan<strong>der</strong>bewegungen <strong>der</strong> Völker ziehen lassen.<br />
Zu den europäischen Sprachgruppen gehören die keltischen Sprachen, die italischen Sprachen (z. B. Latein, Französisch), die<br />
germanischen Sprachen ( z. B. Friesisch, Gotisch), die baltischen und slawischen Sprachen, sowie Albanisch, Griechisch, das<br />
ehemals im Westteil <strong>der</strong> Balkanhalbinsel, jetzt aber ausgestorbene Illyrisch und die ebenfalls ausgestorbenen Sprachen Trakisch und<br />
Dakisch, die im Ostteil <strong>der</strong> Balkanhalbinsel gesprochen wurden.<br />
Zu den asiatischen Sprachgruppen gehören die iranischen Sprachen (z. B. Persisch, Kurdisch), die indoarischen Sprachen,<br />
Armenisch, die im Hindukusch gesprochenen Kafirsprachen und die inzwischen ausgestorbenen Sprachen Hethitisch (Kleinasien) und<br />
Tocharisch (China).<br />
<strong>Die</strong> germanische Sprache wird unterteilt in Ostgermanisch, Nordgermanisch und Westgermanisch.<br />
Zu den ostgermanischen Sprachen gehören die ausgestorbenen Sprachen Gotisch, Burgundisch, Langobardisch und Wandalisch.<br />
<strong>Die</strong> gotische Sprache, die aufgrund <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Goten im 4. und 5. Jahrhun<strong>der</strong>t über weite Teile Europas verbreitet war,<br />
starb mit dem Untergang <strong>der</strong> Krimgoten und <strong>der</strong> Romanisierung <strong>der</strong> Ost- und Westgoten aus. Ein „literarisches Denkmal“ schuf <strong>der</strong><br />
westgotische Bischof Wulfila um 370 mit seiner gotischen Bibelübersetzung.<br />
Zu den nordgermanischen Sprachen gehören Dänisch, Schwedisch, Norwegisch Isländisch und Färöisch. Altnordisch war von ca.<br />
800 bis 1400 n. Chr. die Sprache <strong>der</strong> germanischen Bevölkerung Skandinaviens, Islands und <strong>der</strong> Färöer. Aus dem Altnordischen<br />
entwickelte sich ab dem frühen Mittelalter die dänische Sprache.<br />
Zu den westgermanischen Sprachen gehören Englisch, Friesisch, Deutsch und Nie<strong>der</strong>ländisch, sowie als Neusprachen Jiddisch<br />
und Afrikaans.<br />
Englisch entwickelte sich aus dem Altenglischen („Angelsächsischen“) das entstand, als Angeln, Sachsen und Jüten sich im 5.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t im Gebiet des heutigen England ansiedelten. Altenglisch wurde etwa von 450 bis 1100 gesprochen, die ersten<br />
schriftlichen Zeugnisse stammen aus dem 7. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
<strong>Die</strong> aus dem Altfriesischen kommende friesische Sprache wird unterteilt in Westfriesisch (Nie<strong>der</strong>lande, Provinz Friesland),<br />
Ostfriesisch (Nie<strong>der</strong>sachsen) und Nordfriesisch (Schleswig-Holstein).<br />
Altfriesisch glie<strong>der</strong>t sich in Altwestfriesisch und Altostfriesisch. Altwestfriesisch wurde vom Ende des 14. Jahrhun<strong>der</strong>ts bis <strong>zur</strong> Mitte<br />
des 16. Jahrhun<strong>der</strong>ts gesprochen. Es ist ausschließlich in Rechtstexten und Urkunden überliefert. Zum Altostfriesischen, das ebenfalls<br />
nur in Rechtstexten überliefert ist und von ca. 1300 bis 1450 gesprochen wurde, gehören ein emsfriesischer sowie ein<br />
weserfriesischer Zweig.<br />
<strong>Die</strong> deutsche Sprache wird unterteilt in Hochdeutsch und Nie<strong>der</strong>deutsch. Nie<strong>der</strong>deutsch bzw. Altnie<strong>der</strong>deutsch o<strong>der</strong> Altsächsisch<br />
war ursprünglich die Sprache des Stammes <strong>der</strong> Sachsen, <strong>der</strong> zuerst im Nordwesten des deutschen Sprachgebietes ansässig war,
sich später aber auch im Nordosten ansiedelte. Erste Zeugnisse des Altsächsischen, das bis ca. 1300 gesprochen wurde, stammen<br />
aus dem 8. Jahrhun<strong>der</strong>t. Mittelnie<strong>der</strong>deutsch war die Amtssprache <strong>der</strong> Hanse. Ab dem 16./17. Jahrhun<strong>der</strong>t verlor es mit dem<br />
Nie<strong>der</strong>gang <strong>der</strong> Hanse und dem Vordringen <strong>der</strong> hochdeutschen Sprache durch die Bibelübersetzung Luthers an Geltung und besteht<br />
seitdem nur noch in Form unterschiedlicher Mundarten (Plattdeutsch).<br />
<strong>Die</strong> hochdeutsche Sprache (im ober- und mitteldeutschen Sprachraum entstanden) wird unterteilt in Althochdeutsch, gesprochen<br />
vom 6./7. Jahrhun<strong>der</strong>t bis <strong>zur</strong> Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts, Mittelhochdeutsch, gesprochen von <strong>der</strong> Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts bis <strong>zur</strong><br />
Mitte des 14. Jahrhun<strong>der</strong>ts und Neuhochdeutsch (Frühneuhochdeutsch ab 1350, Neuhochdeutsch ab 1650, Spätneuhochdeutsch ab<br />
1950).<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Stellung nimmt die lateinische Sprache ein. Latein war nicht nur die Sprache des Römischen Reiches, son<strong>der</strong>n vor<br />
allem die Sprache <strong>der</strong> Kirche, die in diesem Sprachgebiet ihren Ursprung hat. So behielt Latein auch nach dem Ende des Römischen<br />
Reiches (476) seinen Rang als Sprache des Klerus, <strong>der</strong> Wissenschaft und <strong>der</strong> Verwaltung bis in die Neuzeit hinein. Das än<strong>der</strong>te sich<br />
erst, als das Papsttum an Geltung verlor und Deutsch als Amtssprache das Lateinische verdrängte.<br />
Quelle: Brockhaus Enzyklopädie, 21. Auflage, 2006
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Aa Wasser, Fluß; auch: Ee, Ei, Ehe; afries. alond, "Wasserland" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 1<br />
Aant Ente Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 1; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
44, 45<br />
Aantje kleine Ente Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 1; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Aas "Aas, Fleisch eines toten Tieres, das Tieren als Futter,<br />
Nahrung dient"<br />
Acht "zu einem Verband zusammengelegte einzelne Flächen";<br />
"Verband, Genossenschaft"<br />
Stand: 24.10.2010 1<br />
44, 45<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 66<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 6; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 2; HWO<br />
achter agter hinter Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 7; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Äcker <strong>Die</strong> Äcker (Aufstrecken, Ackerhufe) entstanden in diesem<br />
Bereich durch das über viele Generationen andauernde<br />
Abgraben (Abtorfen) des Hochmoores. Sie erstreckten sich,<br />
beginnend in <strong>der</strong> Breite <strong>der</strong> Hofstellen, grundsätzlich parallel<br />
zu den Nachbargrundstücken so weit in das Moor hinein, bis<br />
sie auf ein Hin<strong>der</strong>nis (z. B. Aufstrecken einer an<strong>der</strong>en<br />
Ortschaft) trafen. <strong>Die</strong> abgetorften Län<strong>der</strong>eien wurden nach und<br />
nach durch das Aufbringen von Viehdung, Plaggen und Schlick<br />
für die landwirtschaftliche Nutzung hergerichtet. Häufig blieben<br />
die weiter vom Hof entfernten Flächen aber auch zunächst<br />
ungenutzt „wild“ liegen.<br />
1996, S. 2<br />
Bents, Harm; <strong>Die</strong> Entstehung <strong>der</strong> Aufstreckenfluren, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 77 ff.<br />
Adde "strömendes, fließendes Wasser" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 8
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Ad<strong>der</strong> "Kreuzotter, Schlange, Natter" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 8; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Adel "Jauche, schlammige, schmutzige, garstige Flüssigkeit"; auch:<br />
Ahle<br />
Ahle "Jauche, schlammige, schmutzige, garstige Flüssigkeit"; auch:<br />
Adel<br />
Ake nnd. Ake, "ein kleines Stück Land, was als Nebenstück zu<br />
einem Hauptstück od. grösseren Grundstück gehört, indessen<br />
durch einen Weg od. Graben davon getrennt ist"<br />
Akker (1) "beackertes Land, die gesamte Anbaufläche, das anbaufähige<br />
Land eines Besitzers"; ursprünglich: "Streifenparzelle, einzelne<br />
Parzelle in einem Gewann"; Plural: Äcker: "Hinweis auf den<br />
ältesten Teil <strong>der</strong> Ackerflur (<strong>der</strong> Kernflur)"<br />
Akker (2) "ein Stück Land von einer bestimmten Größe, gewöhnlich zwei<br />
rheinl. Ruthen breit"<br />
Aland Das altfriesische "alond" bedeutet "Insel". Gebiet des<br />
ehemaligen Prämonstratenser-Klosters Alund bei Wirdum.<br />
Ame "Verhau, Pallisaden"; "Hinweis auf eine durch Pfähle<br />
gekennzeichnete Gemarkungsgrenze"<br />
1996, S. 2<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 108<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 108<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 108<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 108<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 20<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 23<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Amel Engerling, Maikäferlarve Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 31; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 4<br />
Amtmann "Vorsteher des Gerichts od. Verwaltungs-Amtes" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 33<br />
Stand: 24.10.2010 2
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Angel Ecke, Winkel Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 25<br />
Anger nnd. Anger, "Anger, Grasland, festes Land, das mit Gras, Klee<br />
o<strong>der</strong> Kräutern bewachsen ist und <strong>zur</strong> Weide dient"; "urspr. Teil<br />
<strong>der</strong> Allmende; Weidegrund, <strong>der</strong> oft ausschließlich für eine<br />
bestimmte Tierart genutzt wurde"<br />
Anschott (1) "Anweide, ein in <strong>der</strong> Nähe des Hofes liegendes bzw. an den<br />
Hof angrenzendes Landstück, das <strong>zur</strong> Mast benutzt wird; die<br />
an das Gut angrenzenden Zubehörungen (wie Rain, Uferrand)"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109<br />
Anschott (2) "am Wasser angrenzendes Land, Deichvorland" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109<br />
Anwachs "Außendeichland, Zuwachs" Byl/Brückmann, Ostfriesisches Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch,<br />
Leer 1992, S. 22<br />
Appel Apfel; mnd. appelhof, nnd. Appelhoff = Obstgarten Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109<br />
Asch Esche; "Ansammlung von Eschen" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 144; Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des<br />
Kirchspiels Büsum (Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des<br />
Dithmarscher Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 57<br />
Assel (1) Rasen, Sode, "ein Stück verfilzten Bodens" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 68<br />
Assel (2) abgeleitet von "axsla", einer Stückbezeichnung in alten<br />
Urkunden<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S.47-53<br />
Atte Ette afries. atha, ettha, Richter, Schulze, Vorsteher Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 69<br />
Stand: 24.10.2010 3
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Aufstrecken Vom Rand eines Moorgebietes ausgehendes, meist von<br />
Entwässerungsgräben begrenztes Flurstück, das nach dem<br />
Aufstreckungsrecht von einem Kolonisten <strong>zur</strong> eigenen Nutzung<br />
und Besitznahme so weit in das Moor hinein erschlossen<br />
werden konnte, bis es auf eine Grenze (Wasserlauf, Weg,<br />
Aufstreckung eines an<strong>der</strong>en Siedlers) stieß. Aufstreckungen<br />
wurden lediglich ihrer Breite nach vermessen, während die<br />
Längserstreckung so weit unbegrenzt blieb wie Moor <strong>zur</strong><br />
Kultivierung vorhanden war.<br />
außen draußen, außerhalb; "Außendeich": ein Deich, <strong>der</strong> vor einem<br />
weiter landeinwärts gelegenen Deich liegt<br />
Wassermann, Ekkehard, Aufstreckungsiedlungen in Ostfriesland. Ein<br />
Beitrag <strong>zur</strong> Erforschung <strong>der</strong> mittelalterlichen Moorkolonisation, Aurich<br />
1985, S. 39, 42<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 267; Bd. 3, S. 486<br />
Bääk Bake, Bäke "kleines, fließendes Gewässer", Bach Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 44<br />
Back (1) Bach Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Back (2) altsächsisch bak, afries.bek, Rücken; Hinweis auf einen<br />
Landrücken<br />
Bahn urspr. "Waldschlag, Durchhau im Walde"; Weg, Straße,<br />
Durchgang, Gasse; Eisenbahnlinie<br />
Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 94, 98;<br />
Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 45<br />
Bakker Bäcker Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 85; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 24<br />
Balge Balje nfries. balje, balge; "tiefe Rinne im Watt, die auch bei niedriger<br />
Ebbe Wasser führt (Fahrwasser)"; "Tief für die Einfahrt von<br />
Schiffen"<br />
Balken mnd. balke, "langgestrecktes Flurstück o<strong>der</strong> Heideland<br />
zwischen den Äckern"; nnd. Balken, "ein längeres unbebautes<br />
Stück <strong>der</strong> Flur zwischen gepflügten Teilen, Rasenbank";<br />
"ehemalige Hochäcker wüstgewordener Dörfer"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 87<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 109<br />
Stand: 24.10.2010 4
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Band Teil eines Ganzen; "Teile einer Fläche mit einem<br />
gemeinsamen, sie verbindenden Merkmal, das sie von ihrer<br />
Umgebung abhebt"<br />
Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Bank (1) mnd. bank, "ungepflügter Streifen zwischen zwei Äckern" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Bank (2) mnd. Bank, "langes, schmales Ackerbeet (für Spargel,<br />
Buschbohnen, Kartoffeln)"<br />
Bär nnd. Beer, Bere, Eber; "Oft Hinweis auf Wiese o<strong>der</strong> Weide,<br />
<strong>der</strong>en Nutzung dem Halter des Gemeindeebers zustand."<br />
auch: Basse<br />
baren abgeleitet von nie<strong>der</strong>d. Bâr, Bär od. dem Familiennamen<br />
"Baring"<br />
Barg "Berg, Anhöhe, Hügel, Haufen, Menge"; "In gôsbarg, fosbarg,<br />
negenbargen etc., was sämmtlich nur kleine Anhöhen sind u.<br />
sich von den "wirden" u. "wêren" (Wurten, Wer<strong>der</strong>) in Betreff<br />
<strong>der</strong> Höhe u. des Umfanges nicht unterscheiden."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 28, 29<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 104<br />
Barke Barkel Birke Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 106; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 24<br />
Batterie "militärische Grundeinheit mit mehreren Geschützen" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 52<br />
Bauer nnd. Bûr, afries. bur, "vollberechtigter Hofbesitzer im<br />
Gegensatz zum Häusler o<strong>der</strong> Kätner"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 255; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 53<br />
Baute nnd. Bote, "bebautes altes Kulturland"; "Acker-, Bauland" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Stand: 24.10.2010 5
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
baven oben, über, oberhalb Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 76; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Beck altsächsisch bak, afries. bek, Rücken; Hinweis auf einen<br />
Landrücken<br />
1996, S. 11<br />
Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Bedde Beet Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 118, 121<br />
Beek "kleines, fließendes Gewässer" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 44<br />
Been Knochen; in Namen für Orte, "an denen Knochen gelagert<br />
(Schindanger), verarbeitet (Knochenmühlen <strong>zur</strong> Gewinnung<br />
von Futter- und Düngemitteln) o<strong>der</strong> aufgefunden wurden, etwa<br />
durch Aufpflügen alter Gräberfel<strong>der</strong>"<br />
Beer (1) Bier Erhebung in <strong>der</strong> Marsch bzw. Bezeichnung von Dörfern auf<br />
diesen Erhebungen (Kankebeer). Wahrscheinlich wurde bei<br />
einigen Ortsnamen "beer" zu "weer" (Haus).<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 144; Müller, Gunter, Westfälischer<br />
Flurnamenatlas, Lieferung 3, Bielefeld 2003, S. 393<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 12<br />
Beer (2) "eine Art Vorwerk größerer Höfe" (Einzelhof) Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 253<br />
Beest Rind (junge Kuh, die noch nicht gekalbt hat) Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 155; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 12<br />
Beete "etwa = niedrig gelegene, feuchte Wiese" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Beitel Meißel, Keil; auch: "eine keilförmige Seiteneinfassung einer<br />
Giebelmauer"; möglicherweise auf ein dreieckiges bzw.<br />
keilförmiges Grundstück verweisend<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 135<br />
Stand: 24.10.2010 6
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Bent "Binse, Rasengras, Pfeifengras" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
146<br />
Beppe Großmutter; auch Beppke o<strong>der</strong> Bepps Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 147; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 14<br />
Besen nnd. Bese, Binse Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Beslag mnd. beslach, "Einzäunung, Einhegung" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Betten "Betten ist vermutlich von mnd. bedde, nd. bett, in <strong>der</strong><br />
Bedeutung Beet herzuleiten."<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 42<br />
bi bei, neben, um Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 160; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 16<br />
Biel "Flurstück in Form eines Beiles" Remmers, Arend<br />
Biester afries. biuster, mnd. bоster, wild, verwil<strong>der</strong>t, verfallen, schlecht Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 35; Doornkaat<br />
Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879<br />
bis 1884, Bd. 1, S. 172, 173<br />
Bigge Ferkel Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 162; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Bille Bil "Steinbeil, Steinhaue, speciell die zum Behauen u. Einkerben<br />
<strong>der</strong> Mühlsteine, sowie zum Schärfen <strong>der</strong>selben gebrauchte<br />
doppelschneidige Flachhaue"<br />
1996, S. 17<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 166<br />
Stand: 24.10.2010 7
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Bind "Wörtl. ein Etwas, welches die Ufer bindt (bindet, verbindet)";<br />
z. B. eine (tragbare) Brücke über einen Kanal, die die Ufer<br />
verbindet.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 169; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S.18<br />
binnen innen, innerhalb, drinnen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 170; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 18<br />
Bitt "mit Wasser gefülltes Loch" Byl/Brückmann, Ostfriesisches Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch,<br />
Leer 1992, S. 28<br />
Bitze (1) "die friesische Form von nie<strong>der</strong>d. Bäke o<strong>der</strong> Beeke" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 35<br />
Bitze (2) "Grasland" Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 2, Bielefeld 2001,<br />
S. 205<br />
Blad Blatt: von Baum, Blüte, Kraut; Halm; Zeitungs-Blatt;<br />
Kartenblatt; Spaten-Blatt; Klinge von Schwert, Messer, Säge,<br />
Axt<br />
blank ahd. planch, blanch, blank, glänzend, hell, klar; "von Wasser<br />
überströmt und bedeckt"; "Hinweis auf eine häufig<br />
überschwemmte Wiese"<br />
Blänke mnd. blenke, "glänzende Wasserfläche"; "stehendes Wasser<br />
inmitten von Wiesen"; "von Pflanzenwuchs freier Tümpel im<br />
Moor"; "durch Überschwemmung entstandene größere<br />
Wasserfläche"<br />
blau Bezeichnung für eine dunkle Erdfarbe; "(durch Lichtbrechung<br />
des Wassers bei Flut) beson<strong>der</strong>s blau o<strong>der</strong> dunkel leuchtende<br />
Wattengegend"<br />
Bleek (1) Bleck, Blick mnd. blek, blik, "Grundstück, freie Stelle"; "abgegrenztes<br />
kleines Stück Land, Wiese o<strong>der</strong> Beet"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 175; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 70<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Stand: 24.10.2010 8<br />
178<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 252, 253<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 110
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Bleek (2) Bleiche; Platz zum Bleichen von Leinen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 183; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 71<br />
Blinke (1) "Grüner Platz in o<strong>der</strong> bei einem Ort, <strong>der</strong> freundlich und heiter in<br />
<strong>der</strong> kahlen Umgebung hervorleuchtet." ; "(in <strong>der</strong> Sonne)<br />
glänzendes Stück Land im Flachwasser; kleiner<br />
Gemeindeanger"<br />
Blinke (2) von den Häusern des Dorfes umgebener Dorfplatz,<br />
Gemeindeanger; gleichbedeutend mit "Brink", "Thie"<br />
Block "mit Gräben umgrenztes Ackerstück, kurzer Queracker"; "ein<br />
kurzer Queracker (Blokkakker) vor an<strong>der</strong>en längeren";<br />
Wendeacker; rechteckiges o<strong>der</strong> quadratisches Grundstück;<br />
Mehrzahl: Blöcke<br />
Blöke Blieke "auf beiden Seiten vor den Ackerstreifen liegen<strong>der</strong> Acker, <strong>der</strong><br />
als Wendeacker dient, auch Blockacker o<strong>der</strong> Blöke genannt";<br />
verbindet die einzelnen Ackerstreifen<br />
Boe Nebengebäude, Schuppen <strong>zur</strong> Aufbewahrung von Holz, Stroh,<br />
Torf, manchmal mit einem Stall für Schafe o<strong>der</strong> Schweine.<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Stand: 24.10.2010 9<br />
188<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 20,<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 195<br />
Boer Erbauer, Bebauer Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 195<br />
Bog Biegung, Krümmung, Wendung, Bogen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 195<br />
Bohn Bohne Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 202; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 29<br />
Boll mnd. bol, "hohl, unterhöhlt, aufgebläht (so daß hohle Stellen<br />
zwischen <strong>der</strong> Masse sind)"; nnd. boll, bool, "hohl"; nie<strong>der</strong>l. bol,<br />
"weich, morastig"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Bollen "kurzes, gedrungenes Endstück" eines größeren Flurstückes Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Bolten mnd. bolte, "langes, schmales Flurstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Boom Bohm, Bom Baum; Namensgebung möglicherweise aufgrund eines<br />
auffallenden Baumes; in Komposita mit "- kamp, -ort, -stück ist<br />
an Baumbestand zu denken"; "kann verkürzt für "Slagboom"<br />
stehen"; Plural: Böhm, Böm<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
201<br />
Boomgarden Obstgarten Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Boor "Bohrer, d. h. Stechding, Stechgerät"; Grabstichel;<br />
möglicherweise ein Hinweis auf ein spitzes Landstück<br />
Borg ursprüngl. Bedeutung: "befestigte Höhe"; "Auch als<br />
Bezeichnung für einen (frei gelegenen) Bauernhof<br />
gebräuchlich."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 101, 204<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 59, 90<br />
Born mnd. Born, Brunnen, Quelle; auch: Bach Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Botter mnd. botter, Butter; möglicherweise Hinweis auf beson<strong>der</strong>s<br />
ertragreichen Boden; Butterberg: eventuell Hinweis auf eine<br />
vorchristliche Kultstätte; "Wohnsitz und Arbeitsstätte <strong>der</strong><br />
Unterirdischen"<br />
Braam mnd. brâm, Brombeerstrauch, Dornstrauch; nnd. Braam,<br />
Besenginster, Brombeerbusch<br />
Brake (1) mnd. brâke, Brache, Brachacker; nnd. Brake, zeitweilig<br />
brachliegen<strong>der</strong> Acker; auch: "neu gebrochenes, aus Wald-,<br />
Heide- o<strong>der</strong> Ödland gewonnenes Ackerland"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111, 112<br />
Stand: 24.10.2010 10
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Brake (2) Durchbruchstelle des Deiches; "stehendes Gewässer, das<br />
nach einer Überschwemmung <strong>zur</strong>ückbleibt"<br />
Brand mnd. brant, brand; "Hinweis auf Brandrodung o<strong>der</strong><br />
Brandwirtschaft"<br />
Brede nnd. Brede, "eine Feldfläche, die sich in die Breite erstreckt<br />
und aus mehreren Äckern besteht"; möglicherweise auch ein<br />
Ackermaß<br />
Bree Breede "Bezeichnung von Ackerstücken; sie leitet sich her vom mnd.<br />
brêt, "breit" und weist auf eine größere Fläche mit "einem<br />
ansehnlichen Verhältnis seiner Breite <strong>zur</strong> Länge" o<strong>der</strong> auf ein<br />
"Ackerstück von größerer Breite als Länge" hin.<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 111, 112<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 55<br />
Brett Hinweis auf ein sehr flaches (niedrig gelegenes) Landstück Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 82<br />
Brill von lat. broilus abgeleitet: "grundherrliche Wiese, eingehegter<br />
Wildpark"; "feuchte Wiese"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 41<br />
Brink (1) urspr. "Hügel, Berg" (mölenbrink - Anhöhe mit Mühle) Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Brink (2) Da <strong>der</strong> Rand (engl. brink) eines Ackers oft als Weide benutzt<br />
wurde, auch: grüner Anger.<br />
Brink (3) angeschwemmter Rand eines Baches od. an <strong>der</strong> Küste, Rand<br />
eines Hügels<br />
Brink (4) "grüne, erhöht liegende Fläche im Innern eines Dorfes, <strong>der</strong> als<br />
Sammelplatz <strong>der</strong> Weidetiere diente und nicht bearbeitet wurde"<br />
Stand: 24.10.2010 11<br />
228<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
228<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
228<br />
Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1955, 4
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Broek "buschbestandenes Sumpfland", morastiger Grund;<br />
Nebenform: brak<br />
Brok Brook von afries. brôk abgeleitet: "Bruch, Moor, Sumpf, niedriges,<br />
mooriges sumpfiges Land", "brüchiges, rissiges, von<br />
Wasserrinnsalen durchfurchtes Land"; "sumpfige Nie<strong>der</strong>ung";<br />
auch: Bach<br />
Schöneboom, A., Flurnamen leben in Eigen- und Ortsnamen fort, in:<br />
Unser Ostfriesland 1966, 15, 16<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
233<br />
Bruch Sumpfgelände mit Bäumen und Sträuchern; Steinbruch Brockhaus - die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden, 20. Auflage,<br />
1796 - 1996<br />
Brügge nie<strong>der</strong>d. Brügge, ahd. brucca, Brücke, "Brücke", "bezeichnet<br />
nicht nur freitragende Konstruktionen über einen Wasserlauf,<br />
son<strong>der</strong>n manchmal auch dammartige Überbrückungen von<br />
Mooren und Sümpfen"<br />
Brummel mnd. brômel, Brombeer-, Dorngestrüpp; nnd. Brummel,<br />
Brümmel, Brömmel, Brombeere<br />
Brunnen "eine zu Tage tretende Quelle"; (ein gegrabener Brunnen:<br />
Pütte)<br />
Buchweizen nnd. bôk-weite; "Der Name "Buchweizen" leitet sich von seinen<br />
kastanienbraunen Früchten ab, die eine ähnliche Form wie<br />
Bucheckern haben."<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 253;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 237, 238<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 112<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 240<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 198; Wikipedia<br />
Bühl mnd. bûl, Anhöhe, Hügel Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Bulle (1) Stier, Zuchtstier; "Hinweis auf Weide, <strong>der</strong>en Nutzung dem<br />
Halter des Gemeindebullen zustand"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Stand: 24.10.2010 12
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Bulle (2) gleichbedeutend mit "Bult" (Lautwandel von "lt" zu "ll") Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Bulle (3) mnd. Buller, "Bezeichnung für ein bestimmtes Stadium <strong>der</strong><br />
Landbildung (Verlandungsprozeß), <strong>der</strong> Aufhöhung von<br />
Anschwemmungen, Sänden, bei dem sich bereits Wachstum<br />
von Schilf zeigt"<br />
Bulle (4) Buller mnd. bul<strong>der</strong>, buller, "Gepolter, Getöse, Lärm", möglicherweise<br />
Hinweis auf einen Bach o<strong>der</strong> auf "mythologische<br />
Zusammenhänge"<br />
Bült Bult "Hügel, Klumpen, Land mit vielen Unebenheiten"; "Anhöhe,<br />
Erdhügel, kleine Erhebung"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
251<br />
Bummert "Apfelgarten", "Baumgarten" Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 2, Bielefeld 2001,<br />
S. 241<br />
bunt (1) mnd. bivank, "ein mit irgendeiner Befriedung umgebenes Stück<br />
Land"<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 63<br />
bunt (2) nie<strong>der</strong>l. bent-, buntgras, Binse Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 63<br />
Bünte mhd. biunte, biunde, nhd. Beunde, "eingefriedigtes Rottland in<br />
<strong>der</strong> Allmende, im engeren Sinn nur das <strong>der</strong> Grundherrschaften<br />
(unterlag mithin nicht dem Flurzwang)"<br />
Bürger nnd. Börger; urspr. "Verteidiger einer Burg", später "Bewohner<br />
einer Stadt"<br />
Buschhaus Buschplatz "Der Hofname … hängt vermutlich mit <strong>der</strong> Lage in <strong>der</strong> Nähe<br />
alter Deiche zusammen. Es wird angenommen, dass <strong>der</strong><br />
Hofbesitzer <strong>zur</strong> Deichaufsicht verpflichtet war und gebündelte<br />
Sträucher (Büsche) <strong>zur</strong> Deichsicherung vorrätig halten<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 206; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 90<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Stand: 24.10.2010 13
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
musste.“<br />
Busk Busch mnd. busch, "Busch, Gebüsch, Gehölz; Wildnis, unwegsames<br />
Land"; nnd. Busch, "Busch; Gebüsch; kleineres Gehölz"<br />
Büte nnd. Büte, Büe, "Stück Gemeineland, dessen Benutzung<br />
jährlich auf einen an<strong>der</strong>en Bauernhof übergeht"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
buten draußen, außen; jenseits Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 267; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 28<br />
Buur (1) Bur mnd. bûr, nnd. Buur, Bauer Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 113<br />
Buur (2) mnd. bûre, bûr, "Bauerschaft, Gemeinde; [...] Gebiet <strong>der</strong><br />
Bauerschaft"<br />
Buur (3) "Bezeichnung <strong>der</strong> ersten Bauerngenossenschaft, innerhalb <strong>der</strong><br />
sich eine bäuerliche Selbstverwaltung mit bestimmten Ämtern<br />
entwickelte. <strong>Die</strong> Vergütung für die Ausübung dieser Ämter<br />
bestand in <strong>der</strong> Nutzung von Län<strong>der</strong>eien (Burn), die <strong>der</strong> Bur<br />
gehörten."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Chaussee frz. chaussée, "Landstraße" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 94<br />
Cierge möglicherweise gleichbedeutend mit Ciergel, Segge Schöneboom, A., Geestdorf Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten<br />
Namen, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-35<br />
Cirk Cirk veraltet für: Kirche; Cirkwerum = Kirchdorf Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 338<br />
Stand: 24.10.2010 14
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Dachemt möglicherweise fehlerhafte Schreibweise von "Dachmet": ein<br />
Dachmath zu 450 rheinl. Quadratruten = ein Großes o<strong>der</strong><br />
Moor-<strong>Die</strong>mat.<br />
Dag mnd. dach, Tag Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 271; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 33<br />
Dagwark Tagewerk; "das Werk o<strong>der</strong> die Arbeit eines vollen Tages" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 272<br />
Dal ahd. tal, dal; Tal, Nie<strong>der</strong>ung, Tiefe Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
274<br />
Damm (1) Dam mnd. dam, "bez. gewöhnl. nicht den Deich <strong>zur</strong> Abwehr von<br />
See- od. Flusswasser, son<strong>der</strong>n e. künstlich aufgeworfene<br />
Erhöhung <strong>zur</strong> Überquerung von Sumpf- od. Moorgebieten";<br />
"Querriegel vor od. in einem Wasserlauf gegen das in das<br />
Land eindringende Außenwasser"<br />
Damm (2) "Damm, Deich, Wehr; erhöhter Weg durch das Moor"; "auch<br />
Stätte o<strong>der</strong> Wohnsitz (auf einer schützenden Anhöhe)"<br />
Stand: 24.10.2010 15<br />
HWO<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 254<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
276<br />
dann mnd. dan, Tannenwald; Tanne Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 279<br />
Darg mnd. darg, darrich, "Torf-, Moorerde von vermo<strong>der</strong>ten<br />
Sumpfpflanzen unter dem Kleiboden"<br />
Deel (1) Teil, Abteilung, Stück, Anteil; "Berechtigungsanteil des<br />
Einzelnen an <strong>der</strong> Gemeinheit o<strong>der</strong> an parzelliertem<br />
Privatbesitz, an dem mehrere Anteil haben"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Remmers, Arend, Von Aaltukerei<br />
bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong> Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade,<br />
Leer 2004, S. 55
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Deel (2) afries. del, nie<strong>der</strong>d. dell, Tal, Nie<strong>der</strong>ung, Vertiefung Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 55<br />
Deep (1) "Hauptentwässerungsgraben, Kanal, kleiner Fluss." Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 698<br />
deep (2) nnd. deep, "tief; tief gelegen; feucht, dreckig" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114<br />
Delft Dilft mnd. delf, "Graben, Kanal"; "künstlich angelegter Wasserzug,<br />
Tief"; "Hafenbassin"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114<br />
Delle Nie<strong>der</strong>ung, Tal, Loch, Grube; "flache Geländesenke" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 103<br />
dick "Flurnamen mit dick verweisen möglicherweise auf morastiges,<br />
sumpfiges o<strong>der</strong> nahezu undurchdringliches Gebiet."<br />
<strong>Die</strong>k (1) Deich, Schutzdamm, Seedamm; "<strong>Die</strong>k, Deich auch in Namen<br />
für erhöhte, feste Wege in feuchtem Gelände."<br />
<strong>Die</strong>k (2) Teich, Graben, Grube; "<strong>Die</strong>k, Teich oft letzter Hinweis auf<br />
verlandeten Teich."<br />
<strong>Die</strong>mat Demth,<br />
<strong>Die</strong>math,<br />
<strong>Die</strong>mt, Dimt,<br />
Dimmt<br />
"1 <strong>Die</strong>mat = ca. 56 Ar und 74 Quadratmeter" (=5674 m2);<br />
"uraltes friesisches Landesmass von (jetzt) 400 Quadratruthen<br />
rheinl."; "das Gemähte von einem Tage (bz. das, was ein guter<br />
Arbeiter an einem Tage mähet)"<br />
Ding afries. thing, Thing, Richt- o<strong>der</strong> Versammlungsplatz; Thedinga:<br />
te dinga = zum Thing<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
295, 296<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Stand: 24.10.2010 16<br />
296<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
296<br />
Uphoff, B., Ostfriesische Masze und Gewichte, Aurich 1973, S. 30;<br />
Scheuermann, U., Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- u.<br />
Regionalgesch., Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, J. t.,<br />
Wörterbuch d. ostfr. Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 297<br />
Schöneboom, A., Flurbezeichnung war die Wurzel für den Kloster- und<br />
Familiennamen Thedinga, in: Unser Ostfriesland, 1967, 21
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Dobbe (1) Teich, Grube, Loch, Vertiefung; kleines stehendes Gewässer;<br />
Viehtränke<br />
Dobbe (2) Sumpf; "niedriges, morastiges Land mit überwachsener<br />
Oberfläche"<br />
Dobbe (3) Miete o<strong>der</strong> Erdmulde zum winterfesten Einlagern von<br />
Kartoffeln, Rüben u.s.w.<br />
Dobben nnd. Dobben, Dubben, "sumpfige, elastische, beim Schaukeln<br />
leicht durchbrechende Stelle einer Wiese, auch im Moor u. <strong>der</strong><br />
Heide vorkommend"<br />
Dock "Wasser-Behälter"; "gemauertes Becken, in dem Schiffe<br />
gebaut und repariert werden"<br />
Dodenweg "Richtweg, traditionelle Route des Leichenzuges zum Friedhof<br />
im Kirchdorf"<br />
Dollart Dollert, Dullert nnd. Dollerd, Dollert, Dullert, "thalähnliche Mulde, Vertiefung,<br />
Senkung, grosses weites Loch im Boden, Untiefe, Sumpf"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Stand: 24.10.2010 17<br />
302<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 114; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
302<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 302<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 308; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 113<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Dolle Graben, Tal, Senke Janßen, Georg, Beitrag <strong>zur</strong> Orts- und Flurnamenforschung. Betrachtung<br />
zum Namen Dollart. in: Ostfriesenwart, 1932, Bd. 2, Nr. 3<br />
Domäne "staatliches Gut"; lat. dominium, "Herrschaftsgebiet" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 114<br />
Donk "Bodenerhebung im sumpfigen Gelände" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Dör nnd. Door, "Tor, Tür, Öffnung; Durchlass; Gang, Durchgang";<br />
"vielfach (indirekter) Hinweis auf Dorfbefestigung"<br />
dorn Dorn, Stachel; Dornbusch, Dornstrauch, z. B. Hagedorn,<br />
Weißdorn; "eventuell Hinweis auf die (ehemalige) Einhegung<br />
eines Landstücks mit einer Dornenhecke"<br />
Dörp bäuerliche Siedlung o<strong>der</strong> Einzelhof; auch: Siedlung, <strong>der</strong>en<br />
Gründung nach <strong>der</strong> Ordnung <strong>der</strong> germanischen Flurverfassung<br />
erfolgte<br />
Dose nhd. Doss, "obere, lockere hellgraue Moosschicht auf den<br />
Torfmooren"<br />
Dragoner berittener Soldat; "Hinweis auf jenen Teil <strong>der</strong> Allmende, von<br />
dessen Ertrag <strong>der</strong> Unterhalt <strong>der</strong> Dragonerpferde zu bestreiten<br />
war, die (samt <strong>der</strong> Mannschaft) als Einquartierung in den<br />
Dörfern standen."<br />
Dränke Tränke, Brunnen; "mit Wasser gefüllte Grube, woraus das Vieh<br />
getränkt wird"<br />
Dreck (1) nnd. drêg, ertragreich, fruchtbar; "drêg land: Land, dessen<br />
Fruchtbarkeit lange vorhält, bz. was sich nicht so leicht<br />
erschöpft"<br />
Dreck (2) nnd. Drek, Dreck, Koth, Schlamm, Schmutz; "Hinweis auf ein<br />
feuchtes, morastiges Flurstück"<br />
Dreesch (1) Dreesk,<br />
Dresche<br />
"Höher gelegenes Gras- o<strong>der</strong> Grünland, wurde früher nicht<br />
aufgebrochen, son<strong>der</strong>n diente als Weideland. <strong>Die</strong> „gemene<br />
Dreske“ war nicht nur Gemeindeweide, son<strong>der</strong>n wurde auch<br />
<strong>zur</strong> Nachweide auf den Dorfäckern genutzt, also<br />
gleichbedeutend mit Escher."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Stand: 24.10.2010 18<br />
315<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
318<br />
Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 115; Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong><br />
Geschichte Amdorfs, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund,<br />
1951, S. 36-41<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
322<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
327, 332<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
329<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
331<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Dreesch (2) "urspr. Gras- od. Grün-Land, welches höher liegt als die<br />
umliegenden Aecker u. das sog. Hammrichsland u. früher nie<br />
aufgebrochen, son<strong>der</strong>n ausschließlich als Viehtrift zum Weiden<br />
benutzt wurde, während es jetzt auch ebensowohl wie die<br />
sogenannten wilden zum Getreidebau verwendet u. dann als<br />
Neuland (jungfräuliches Land) bezeichnet wird"<br />
Dreesch (3) nnd. Dreesch, Dreisch, Driesch, Dreesche,1. "ruhen<strong>der</strong> Acker,<br />
unbebautes Land, das als Viehtrift dient"; Hinweis auf<br />
Feldgraswirtschaft 2."wenig fruchtbare, unbebaute, als Trift<br />
benutzte Strecke, die nur spärlich mit Gras bewachsen ist"<br />
Drift (1) Trift, Flur, Weide; "die Trift, als Ort, wohin Vieh <strong>zur</strong> Weide<br />
getrieben wird, und als Weg, auf welchem dasselbe dahin<br />
geht"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 255<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
333<br />
Drift (2) Weg, Durchfahrt, Einfahrt; "Überfahrtsweg über einen Deich" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
drink nnd. drinken, trinken; Drinkeldobbe: "Tränke o<strong>der</strong> Tränk-<br />
Grube, woraus das Vieh trinkt"<br />
dröge nnd. dröge, drüge, trocken; "dröge o<strong>der</strong> trockene Wiesen<br />
können nur einmal im Jahr gemäht werden, sind sog.<br />
einschürige Wiesen"<br />
Stand: 24.10.2010 19<br />
333<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 334, 335; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 39<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116<br />
Drost höherer Beamter, Amtshauptmann, Schlosshauptmann Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 342; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 39<br />
Dummert nnd. Dummert, "sumpfige Nie<strong>der</strong>ung" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116<br />
Düne "vom Wind zusammengewehter Sandhügel"; "trockenes,<br />
dürres, wasserloses, wüstes Land"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 361; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 122
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Dunk "Bodenerhebung im sumpfigen Gelände" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 115<br />
Dust mnd. dust, dûst, feiner Staub; "loses Moor" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116<br />
düster nnd. düster, finster, düster; 1. "Hinweis auf (trübe, moorige und<br />
daher) dunkle Farbe von Wasser, Boden" 2. "schauerlich"<br />
Düwel nnd. Düwel, Döwel, Deuwel, Teufel; "Hinweis auf einen<br />
schauerlichen, unheimlichen, verrufenen Ort"<br />
dwars dwas afries. thweres, nfries. twars, quer, kreuzend, gegenüber;<br />
dwars-strate: Querstraße; dwars-hûs: Querhaus; "die Tiefe, bz.<br />
Länge des Hauses zieht sich an <strong>der</strong> Straße hin, wodurch…<strong>der</strong><br />
spitze Giebel an <strong>der</strong> Seite steht"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
372, 373<br />
Eck Ecke, Winkel Byl/Brückmann, Ostfriesisches Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch,<br />
Leer 1992, S. 40<br />
Eckel Äcker, Ecker 1. Buchecker, Eichel; "Hinweis auf ein mit Eichen be- o<strong>der</strong><br />
umstandenes Landstück, das als Waldweide <strong>zur</strong> Eichelmast<br />
(Schweinemast) benutzt wurde." 2. Eckelkamp: "kann auf<br />
Baumsaat <strong>zur</strong> Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Holzarmut verweisen"<br />
Egge (1) afries. egg, Kante, Spitze, Ecke, Winkel; "Abteilung einer<br />
Gemeinde"; "am Rande <strong>der</strong> Feldmark gelegenes Flurstück";<br />
auch: "wertloses Land"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116, 117; Schöneboom, A., Filsum.<br />
<strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Hausfreund, 1955, S.47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 117<br />
Egge (2) mhd. ecke, egge, Bergspitze, Anhöhe Falkson, K., <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen).<br />
Neumünster 2000, Bd. 2, S. 494<br />
Ehe Ee Wasser, Fluss; fließendes Gewässer o<strong>der</strong> breiter Zugschloot Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 1 (siehe unter: â od. ê); Stürenburg, Cirk<br />
Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich<br />
1857, Leer 1996, S. 46<br />
Stand: 24.10.2010 20
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Ehl ahd. odel, sumpfig; auch: ehl, ohl, uhl; Ohling: Nasswiese Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Ekel (1) abgeleitet von mhd. ecke, egge, Anhöhe = Ragendes, Spitze;<br />
Name einer Ortschaft bei Norden, die auf einer sandigen<br />
Anhöhe liegt.<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 63; Herzog,<br />
Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge<br />
zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 47<br />
Ekel (2) Eckel, Ecker, Äcker; Eichel Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 63; Herzog,<br />
Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge<br />
zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 47<br />
Elend "ohne Land"; im übertragenen Sinn: "ohne Landbesitz" G. Engelkes, <strong>Die</strong> "Landaffen" und das Rechtsdenken <strong>der</strong> Friesen, in: Der<br />
Deichwart 1960, 282<br />
Ell Elle, brabantische Elle = 66,7 cm Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 387; HWO<br />
Eller Erle; Möglicherweise ein Hinweis auf ein Sumpfgehölz, denn<br />
die Erle wächst auch auf feuchten Böden und liefert zudem<br />
Holz für "Wasserbauten".<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 47; Schöneboom, A., Geestdorf<br />
Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-35<br />
eng "Eng, ing(e), ung ist...eine weitverbreitete<br />
Schöneboom, A., Flurbezeichnung war die Wurzel für den Kloster- und<br />
Flurnamenkomposition, die als Nutzland und speziell als Wiese Familiennamen Thedinga, in: Unser Ostfriesland, 1967, 21<br />
- verwandt mit hochdeutsch Anger - Bedeutung hatte."<br />
Enn (1) Ende "Strecke, Streifen von mehr o<strong>der</strong> weniger langer Erstreckung<br />
und Ausdehnung"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 117<br />
Enn (2) "Endstück, abgelegenes Flurstück" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256<br />
Stand: 24.10.2010 21
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Esch (1) Escher, Esk "Der Dorfacker, auch als "Gaste" bezeichnet. Fruchtbares und<br />
zum Getreideanbau geeignetes Land auf <strong>der</strong> Geest sowie auf<br />
leichtem Kleiboden."<br />
Esch (2) "Fruchtbares, zum Getreideanbau vorzügl. Land auf <strong>der</strong> Geest<br />
sowie hochliegendes Kleiland von mit Sand gemischtem<br />
Boden, <strong>der</strong> wärmer ist, wie das gewöhnl. Marschland, u.<br />
deshalb nicht als Weideland, son<strong>der</strong>n zum Gemüse- und<br />
Getreide-Bau benutzt wird."<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 117; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
407<br />
Esch (3) Hinweis auf altes Ackerland; "friesische Pluralform: Escher" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256<br />
Ett Speise, Nahrung; etten: weiden, beweiden; Etland: Gras- und<br />
Weideland nach dem Mähen, das zum Abweiden (<strong>zur</strong><br />
Nachweide) benutzt wird.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 408; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 49<br />
Ey (1) Wasser, Strom, Strömung; wasserreiches Wiesenland (Aue) Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 384 (s. unter: eiland)<br />
Ey (2) Insel, Halbinsel im Fluss Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 384 (s. unter: eiland<br />
Fähre "früher häufigeres Verkehrsmittel <strong>zur</strong> Überquerung von Seen,<br />
Flüssen und Kanälen"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256<br />
Fahren (1) nnd. Farn, Farnkraut Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 117<br />
Fahren (2) mnd. varre, var, "Stier, Bulle, junger Stier"; auch: Farren Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 117<br />
Stand: 24.10.2010 22
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Fahren (3) Furche, Ackerfurche Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Fahren (4) erhöhter Grenzstreifen zwischen zwei Grundstücken, Grenze Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Fahrt mnd. vaart, "Fahrweg, Wasserweg, Fahrwasser"; nnd. Fahrt,<br />
"Fahrweg, Überfahrt"<br />
Fal<strong>der</strong> mnd. val(e)t, volt, vold, "umhegter Raum, u. a. für das Vieh";<br />
"... daß wir in dem ostfriesischen "Fal<strong>der</strong>" einen eingefriedigten<br />
Platz zu sehen haben, in dem Vieh zeitweilig festgehalten wird<br />
bis hin <strong>zur</strong> Bedeutung einer Stelle, wo Mist aufgehäuft wird."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Ramm, H., Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr.<br />
Naturschutz u. Landschaftspflege, Volkskunde u. Brauchtum, Baupflege<br />
u. Gedenkstätten sowie Vorgesch. <strong>der</strong> Ostfr. Ldsch., Bd. 5 (1974), S. 55-<br />
56<br />
Falge Brache Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Falster Valster ursprünglich ein Gewässername Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 68<br />
Fang mnd. vanc, "eingefriedigtes Land, auf dem Tiere gehalten<br />
werden", "eingefriedigtes Grundstück"<br />
fanger möglicherweise gleichbedeutend mit "Fang": mnd. vanc,<br />
"eingefriedigtes Land, auf dem Tiere gehalten werden",<br />
"eingefriedigtes Grundstück"<br />
Fanke Fenne: "Aufteilung <strong>der</strong> Dorfflur für verschiedene Nutzungen:<br />
Weidefennen, nach dem Umbruch auch Ackerfennen; auch als<br />
dorfnah liegende Län<strong>der</strong>eien, denen die Meeden folgen,<br />
beschrieben, ferner als niedriges Wiesenland (zum Beweiden)<br />
mit moorigem Untergrund."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Stand: 24.10.2010 23
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
fatt nahrhaft, kräftig, viele Nährstoffe enthaltend; auch: schmutzig,<br />
schmierig<br />
Fehn (1) Fahn, Fahne,<br />
Veen, Vehn,<br />
Vehne<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 473 (siehe unter: fet); Stürenburg, Cirk<br />
Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich<br />
1857, Leer 1996, S. 51<br />
nnd. Fehn, Fenn, "Fehn, Moor"; Moorkolonie, Moorsiedlung Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
Fehn (2) mnd. venne, ven, veen, "mit Gras o<strong>der</strong> Röhricht bewachsenes<br />
Sumpf-, Moorland, sumpfiges Weideland; in Marsch- und<br />
Moorgegenden […] mit Gräben umzogenes Weideland,<br />
Weidekoppel"<br />
Fehn (3) Fenne: "Aufteilung <strong>der</strong> Dorfflur für verschiedene Nutzungen:<br />
Weidefennen, nach dem Umbruch auch Ackerfennen; auch als<br />
dorfnah liegende Län<strong>der</strong>eien, denen Meeden folgen,<br />
beschrieben, ferner als niedriges Wiesenland (zum Beweiden)<br />
mit moorigem Untergrund."<br />
Feld Felt "Feldmark, Flur"; "in älterer Zeit das herrenlose freie Feld rings<br />
um die Dörfer, und zwar im Unterschied <strong>zur</strong> bebauten<br />
Ackerfläche und zum Waldgebiet"; nnd. Feld, "Ackerland,<br />
abgeteilte (kleinere) Ackerfläche, Beet"<br />
Fenne Venne "Aufteilung <strong>der</strong> Dorfflur für verschiedene Nutzungen:<br />
Weidefennen, nach dem Umbruch auch Ackerfennen; auch als<br />
dorfnah liegende Län<strong>der</strong>eien, denen die Meeden folgen,<br />
beschrieben, ferner als niedriges Wiesenland (zum Beweiden)<br />
mit moorigem Untergrund."<br />
418, 436<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118; Remmers, Arend, Von Aaltukerei<br />
bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong> Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade,<br />
Leer 2004, S. 257<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Filler "Abdecker, Schin<strong>der</strong>" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Fillkuhle nnd. Fill(e)kule, "Schindanger, Grube, in <strong>der</strong> das verendete<br />
Vieh verscharrt wurde"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Stand: 24.10.2010 24
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Fink Fink, Sperling; "eventuell Hinweis auf früheren Vogelfang" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 118<br />
Fit (1) "Wasser haltende Grube", welche als Viehtränke und Brunnen<br />
dient<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 492<br />
Fit (2) feuchte Wiese Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 492<br />
Flachs Flas, Flass,<br />
Flaß<br />
afries. flax, nnd. flas, Flachs Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 502<br />
flack mnd. vlak, flach, platt, eben; nicht tief, seicht Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 499<br />
Flad<strong>der</strong> Fled<strong>der</strong> mnd. flad<strong>der</strong>, "mit dünner Moorschicht überwachsene<br />
Sandfläche"; nnd. Flad<strong>der</strong>, "sumpfige Nie<strong>der</strong>ung"; auch:<br />
"Landstrich, worüber sich leicht Wasser verbreitet,<br />
schwankendes, schwimmendes Grasland"<br />
Flage mnd. vlâge, "breit o<strong>der</strong> lang ausgedehnte Fläche, Strecke,<br />
Streifen"; nnd. Flage, "größere zusammenhängende Fläche<br />
Landes, größere Koppel, größerer Schlag"; nnd. Flach, Flack,<br />
"Stück Land", "größere (Acker-)Fläche"<br />
Fleet (1) Fleeth, Fleth "Größerer Entwässerungsgraben in <strong>der</strong> Marsch, auch Bach,<br />
fließendes Gewässer."<br />
Fleet (2) mnd. vlêt, "fließendes Wasser, Flußlauf; natürlicher<br />
Wasserlauf, Bach, Fluß, Flußarm, Mühlbach; Graben, Kanal<br />
mit fließendem Wasser, Entwässerungsgraben, Moorgraben";<br />
nnd. Fleet, "größerer Abzugsgraben, schiffbarer Kanal"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
496<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119<br />
Stand: 24.10.2010 25
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Flint Feuerstein, Kieselstein, Granitstein, Feldstein Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 511<br />
Flo Floh, Floi sumpfige Nie<strong>der</strong>ung Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Floot mnd. vlôt, "Wasserlauf, Fluß, Strom, Kanal, Graben,<br />
Ablaufgraben"; nnd. Floot, "Bach"; "Kann auch Hinweis auf<br />
(zeitweise) überflutetes, feuchtes Gelände sein."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119<br />
Flumm lat. flumen, fließen; Bezeichnung für ein fließendes Gewässer Ahlrichs, Richard, <strong>Die</strong> Wasserläufe Ostfrieslands im Volksmund. Was<br />
Bezeichnungen wie Jümme, Sichter o<strong>der</strong> Delft bedeuten, in: Heimat am<br />
Meer, 1988, 10<br />
Flut nnd. flôt; "regelmäßiges Steigen des Meeresspiegels vom<br />
Tiedeniedrigwasser zum folgenden Tiedehochwasser";<br />
Vorfluter: "Gewässer, in welches das Wasser <strong>der</strong> Vorflut<br />
abfließen kann"<br />
Fohrde "Furt, Durchgang, seichte Flussstelle, die das Durchwaten<br />
gestattet"; "Weg durch ein Moor, durch sumpfiges Gebiet",<br />
"Damm, Brücke"; "Fahrweg, Einfahrt, Durchfahrt, Tor"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 520, 540 (siehe unter: för-flôd)<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 258; Falkson,<br />
Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen).<br />
Neumünster 2000, Bd. 2, S. 501<br />
Föhre nnd. Fuhre, Föhre, "die Kiefer" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119, 120<br />
Foor Fohr mnd. voore, vöre, "Ackerfurche; Grenzfurche, Ackergrenze";<br />
"Wagenspur"; nnd. Fore, Före, "Furche, kleiner Graben,<br />
Pflugwende, Ackerrain"<br />
Foot Fuß; Maßeinheit ("kleinste Maßeinheit <strong>der</strong> bäuerlichen<br />
Landvermessung vor Einführung des Dezimalsystems")<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 119; Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und<br />
Namenerklärung, Vreden/Südlohn 1997, S. 102<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 500<br />
Stand: 24.10.2010 26
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Fos foss, voss,<br />
voß<br />
Fuchs; Hinweis auf eine "braunrothe od. brandrothe,<br />
glänzende Farbe"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 546<br />
frücht Frucht <strong>der</strong> Bäume und Äcker, Ertrag, Gewinn, Nutzen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 564<br />
Fuhre nnd. Fuhre, Föhre, "die Kiefer" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Fuhrweg "Fuhrwege sind mit Pferdefuhrwerken befahrbare<br />
Wirtschaftswege. Sie konnten in <strong>der</strong> Regel von allen<br />
Angehörigen einer Bauerschaft benutzt werden, die jedoch<br />
auch für die Instandhaltung und Ausbesserung <strong>der</strong> Wege<br />
verantwortlich waren."<br />
fuul mnd. vûl, "sehr schmutzig, stinkend vor Schmutz, mit<br />
stinkendem Schmutz bedeckt"; nnd. fuul, "faul"; "Hinweis auf<br />
Gewässer mit fauligem Wasser o<strong>der</strong> auf feuchtes, morastiges<br />
Flurstück."<br />
Gang "Neben „Durchgang“ hat Gang auch die Bedeutung „Lauf/Bett<br />
eines Gewässers“, wobei Gang ebenso für künstliche wie auch<br />
für natürliche Führungen des fließenden Wasser steht."<br />
Garde mnd. garde, gart, "Landmaß, Ackerstück, Unterteil des Ackers,<br />
1/2, 1/4 Acker"<br />
Garden Garn mnd. gaarde, "eingefriedigte Flur vor dem Tore; Ackerstücke<br />
im Felde, die nicht mit dem Pflug son<strong>der</strong>n mit dem Spaten<br />
bearbeitet werden"; nnd. Garden, "eig. <strong>der</strong> nicht beim Hause<br />
liegende, bald eingefriedigte, bald offene Küchen- o<strong>der</strong><br />
Gemüsegarten"<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 107<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 109<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 593, 590<br />
Gare afries. gara, Rockschoß; später: spitzes Ackerstück Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Stand: 24.10.2010 27
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Gaste (1) "Hohes, dürres Sandland, hochgelegener Sandrücken, aber<br />
auch Dorfacker, Bauacker, von Wällen umgeben."<br />
Gaste (2) mnd. gâst, "Geest, das hohe sandige Land"; nnd. Gast, Gaste<br />
(neben Geest) "hohes, dürres Sandland, hochgelegener<br />
Sandrücken, Sandhügel". - Oft in Namen für den Altacker<br />
eines Dorfes."<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Gaste (3) mnd. gerste, garste, nnd. Garste, Gaste, "Gerste" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Gatt (1) mnd. gat, afries. jet, Loch, Höhle, Grube, Tor, Tür, Öffnung;<br />
"enge Durchfahrt o<strong>der</strong> Einfahrt in Gewässern"; "Meerenge";<br />
"tiefe Stelle, die als Fahrwasser genutzt wird"; "Im Binnenland<br />
oft in Namen für feuchte Bodensenken…"<br />
Gatt (2) "manchmal als pejorative Bezeichnung für schlechte<br />
Wohnplätze gebraucht"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120; Falkson, K., <strong>Die</strong> Flurnamen des<br />
Kirchspiels Büsum (Dithmarschen). Neumünster 2000, Bd. 2, S. 501<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 258<br />
geel gelb; "Hinweis auf Bodenfärbung" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Geest (1) "Aus Sand, Kies und Ton bestehen<strong>der</strong> Boden, zum Teil von<br />
Marsch- o<strong>der</strong> Moorböden überlagert."<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Geest (2) "Geest, das hohe sandige Land" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 120<br />
Geet mnd. geite, gete, "Geiß, Ziege" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 115<br />
Stand: 24.10.2010 28
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Gehölz kleiner Wald Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 271 (siehe unter: Holz)<br />
Gehre Gier "keilförmiges, in eine Spitze auslaufendes Landstück" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 502;<br />
geil nnd. geil, "fett, gut gedüngt, üppig (vom Boden, von<br />
ungewöhnlich gutem Pflanzenwuchs)"<br />
Geise "Geisseland", "( im Amt Leer) gutes, durch Überflutung<br />
verbessertes Land"<br />
gemeen "<strong>der</strong> Gemeinheit zugehörig; gemeinschaftlich, gemeinsam,<br />
ungeteilt, gesamt"<br />
Gemeinheit Gemeindeweide, Allmende HWO<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Bügel, Caspar Heinrich, Vocabularium Ostfrisicum, bearbeitet durch A.<br />
Pannenborg, in: Ostfriesisches Monatsblatt 1875, S. 57-68, 244-249<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Gericht Gerichtsstätte o<strong>der</strong> Hinrichtungsstätte Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 116<br />
Gers nach Bahlow: "sumpfbilden<strong>der</strong> Quellbezirk"; afries. gers, gres,<br />
Gras, Weidegras<br />
Gewann (1) Gewand,<br />
Gewend<br />
"Aufteilung des Dorfackers, <strong>der</strong> Gaste. <strong>Die</strong> Form und die<br />
Größe sind verschieden."<br />
Gewann (2) "Stelle <strong>der</strong> Pflugwende od. wo <strong>der</strong> Pflug wendet, Acker seiner<br />
Länge nach bis <strong>zur</strong> Pflugwende, Ackerlänge od. Längenmass<br />
eines Ackers bis <strong>zur</strong> Pflugwende"; "land in drê gewenden"<br />
Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 624<br />
Stand: 24.10.2010 29
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Giebel nnd. gäfel, Giebel; "Benennung einer dreieckigen Fläche nach<br />
<strong>der</strong> Form des Hausgiebels."<br />
Glas mnd. glas, nnd. Glas, "Glas"; "Im Bergland in <strong>der</strong> Regel<br />
Hinweis auf eine ehemalige Wan<strong>der</strong>glashütte."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 579; Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und<br />
Namenerklärung, Vreden/Südlohn 1997, S. 118<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Gohr mnl. gore, goor; "morastiges, nasses, tiefliegendes Land" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 119<br />
Gohrde mnd. gorde, Gurt, Band, Riemen, Einfassung, Saumrand;<br />
Grenzland; "Wege, die die einzelnen Tjüchen umschlossen<br />
und sie von einan<strong>der</strong> trennten (bevor Wälle angelegt wurden)"<br />
Gold mnd. golt, nnd. Gold, "Gold"; "Hinweis auf guten, fetten Boden,<br />
auf beson<strong>der</strong>s ertragreiche Weidegründe, aber auch, ironisch,<br />
auf beson<strong>der</strong>s min<strong>der</strong>wertigen Boden; auf Bodenfärbung."<br />
Goos mnd. gôs, nnd. Goos, "Gans"; "Zumeist in Namen für<br />
Gänseweiden."<br />
Göte "<strong>der</strong> kleinste Abwässerungsgraben", "kaum größer als ein<br />
Foor"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 664; Roskam, Heinrich, Woher kommt<br />
<strong>der</strong> Ortsname Tjüche?, in: Unser Ostfriesland, 1963, 5<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Ahlrichs, Richard, <strong>Die</strong> Wasserläufe Ostfrieslands im Volksmund. Was<br />
Bezeichnungen wie Jümme, Sichter o<strong>der</strong> Delft bedeuten, in: Heimat am<br />
Meer, 1988, 10<br />
Grab nnd. graf o<strong>der</strong> graft, Grab, Grabstätte Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 670, 672; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 74<br />
Graben nnd. graft, breiter Graben, Teich Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 672; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 74<br />
Graf nnd. grâf, Graf, Vorsteher, Voigt, Richter Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 670, 316<br />
Stand: 24.10.2010 30
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Graft mnd. graft, gracht, "Grube; Graben, Wassergraben,<br />
Grenzgraben, Stadtgraben, Wallgraben"; nnd. Graft, Gracht,<br />
"Graben"<br />
Gras (1) "Flächenmaß = 3/4 <strong>Die</strong>mat o<strong>der</strong> 4255 Quadratmeter, auch 300<br />
rheinl. Quadratruthen o<strong>der</strong> rd. 42,5 Ar."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
670, 672<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Gras (2) mnd. gras, Gras; "Grasland, Weide" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Grasen "das abzumähende Grasland (im Gegensatz zum Weideland)" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 121<br />
Grashaus "ein im Grünland liegen<strong>der</strong> Einzelhof, zu dem viel Weideland<br />
gehört, oft urspr. im Besitz von Herrschaft, Kirche o<strong>der</strong> Kloster"<br />
Grebbe nie<strong>der</strong>l. Greb, "Graben zwischen den einzelnen Äckern und<br />
Fel<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Quergraben, <strong>der</strong> sich durch die Äcker und<br />
Furchen hinzieht"<br />
Grede nnd. grêde, "Weideland, das nur zum Weiden und Mähen<br />
benutzt, d. h. niemals in Ackerland umgepflügt wird."<br />
Gret Grede "Weideland, das nur zum Weiden und Mähen benutzt, d. h.<br />
niemals in Ackerland umgepflügt wird."<br />
Grett "Zu mnd. grêt, „Korn, Sandkorn, sandbedeckter Platz“ und<br />
„Wiese, Weideland“, auch Benennung für sandig-kiesigen<br />
Boden."<br />
Groden Grode,<br />
Grohde,<br />
Groode<br />
"Landwirtschaftlich nutzbares Marschland, aus Sinkstoffen<br />
(des Meeres) entstanden. Neumarsch, eingedeichtes<br />
Neuland/Gras-, Grün-, Weideland."<br />
Stand: 24.10.2010 31<br />
HWO<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 77 (siehe unter: Grüppe)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
676<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
676<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 122<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
grön nnd. gröön, "grün"; "gröner Weg = wenig befahrener, daher mit<br />
Gras bewachsener Weg"; mnd. gröönlant, "Wiesenland"<br />
grot groß; grôt lant, "ein grosses ausgedehntes, sich nach allen<br />
Seiten weit hin erstreckendes Land"; urspr. Bedeutung: grob,<br />
grobkörnig<br />
Grove nie<strong>der</strong>l. groeve, Grube: Wassergrube, Fanggrube; nach<br />
Scheuermann: "Growe", "Grube"; "Graben, breiter, tiefer<br />
Wassergraben, Grenzgraben, Befestigungsgraben,<br />
Entwässerungsgraben"<br />
Grund Grund mnd. grunt, "Tiefe, Vertiefung, Tal; Talgrund, Talsohle;<br />
Abgrund"; nnd. Grund, "eine Nie<strong>der</strong>ung zwischen Bergen, ein<br />
kleines Thal"<br />
Grüppe kleiner Entwässerungsgraben; "kleiner Graben zwischen den<br />
Ackerstücken"<br />
Gunst gehört zum Verb günnen, gönnen, gestatten, gewähren,<br />
erlauben; "Gunst": ein Weg, den zu benutzen gestattet ist;<br />
"Mißgunst": ein Weg, <strong>der</strong> nicht benutzt werden darf<br />
güst mnd. gust, brach, unfruchtbar, unergiebig; gûstfalge: Brache;<br />
gûstweide: "magere Weide, auf die we<strong>der</strong> Milchvieh noch Vieh<br />
getrieben wird, welches kalben o<strong>der</strong> fett werden soll"<br />
Haar nnd. Haar, "hohe, trockene, sandige Stelle"; mnd. haare, haar,<br />
"eine festere, trockne Stelle im Moor"<br />
Hackelwark mnd. hâkelwerk, hackelwerk, "Umzäunung, Palisaden, fester<br />
Schutzzaun"; nnd. Hackelwark, "Weidezaun"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122; Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und<br />
Namenerklärung, Vreden/Südlohn 1997, S. 122<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 697<br />
Scheuermann, U., Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122 (vgl. Gildemacher, Waternamen<br />
in Friesland, Ljouwert 1993, 276f.);<br />
Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 238<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 77<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 707, 708; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 240,<br />
Stand: 24.10.2010 32<br />
228<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 122; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S.<br />
709<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hafe (1) Habe, Besitz Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 2
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Hafe (2) afries. hof, "auch geweihter Hof, bz. Tempel"; Hinweis auf eine<br />
kirchliche Anlage, einen geweihten Raum: wie in Mariahowe,<br />
Engerhove, Victorishowe, Lambertushowe<br />
Hag Hage eingehegter Platz, Weide-Platz; dichtes Gebüsch,<br />
eingezäunter Wald; Park, Gehege, Hag; Hage: Ort in einem<br />
Hag<br />
Schöneboom, A., Geestdorf Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten<br />
Namen, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-35;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 91<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 4; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 243<br />
Hagedorn "Hagedorn, Weißdorn"; "Hagedornbusch, Hagedornhecke" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hagen (1) Hain; mnd. haagen, "Hag, Hagen, Hecke, Knick, leben<strong>der</strong><br />
Zaun zwischen Wiesen, Fel<strong>der</strong>n; Grenzhecke, Dornbusch,<br />
Dornzaun; Buschwerk, Hain, Gehölz"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hagen (2) Hain; mnd. haagen, "eingefriedigtes Grundstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hahn (1) nnd. hân, hane; Schilf; vorgermanisch han, hen, hun, Sumpf,<br />
Morast; Binse, Seebinse, Meerstrandsbinse<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 90; Doornkaat<br />
Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879<br />
bis 1884, Bd. 2, S. 28<br />
Hahn (2) nnd. han, hun, hoch; Hahnebarg = hoher Berg Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Haide Heide; "dürres, sandiges, unfruchtbares, unbebautes ebenes<br />
Land"; "unbestelltes Feld"; Orts- und Flurnamen mit <strong>der</strong><br />
Endung "hee" verweisen auf Heideland.<br />
Hain (1) Hagen; mnd. haagen, "Hag, Hagen, Hecke, Knick, leben<strong>der</strong><br />
Zaun zwischen Wiesen, Fel<strong>der</strong>n; Grenzhecke, Dornbusch,<br />
Dornzaun; Buschwerk, Hain, Gehölz"<br />
Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884; Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen<br />
Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 56<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hain (2) Hagen; mnd. haagen, "eingefriedigtes Grundstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Stand: 24.10.2010 33
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Haken "hakenförmige Biegung", Vorsprung, "vorspringende<br />
Krümmung"; "gekrümmter Flussarm"; "toter Flussarm"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
half halv halb; zerteilt, zerschnitten; Gegensatz zu "ganz" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
13<br />
Hals Hals; Landzunge Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 16<br />
Ham (1) "das gemeine Wiesenland" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Ham (2) "eine Wiese od. ein Stück Grün- od. Weide-Land, welches<br />
nicht wie ein kamp, mit Wällen, son<strong>der</strong>n mit Gräben<br />
abgegrenzt u. eingefriedigt ist."<br />
Ham (3) Bucht; "Ham" in Ortsnamen kann auf e. ehemalige Bucht<br />
hinweisen, die versumpfte und dann eingedeicht wurde.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 21<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 22<br />
Ham (4) Heim, Haus, Dorf Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Hammer "Abgegrenztes Stück Land/Gewann, durch Gräben<br />
abgegrenztes Weideland. Auch Wiese, Weide o<strong>der</strong> Grünland,<br />
das nicht mit Wällen, son<strong>der</strong>n mit Gräben eingefriedigt ist.<br />
Hängt nicht mit Hamrich zusammen."<br />
Hammrich "Bezeichnung für die gesamte Dorfmark/Dorfflur. Wiesen- und<br />
Weideland, das zum Dorf gehört, liegt gewöhnlich niedriger als<br />
die Gaste. Auch Gemeindeweide bzw. oft unter Normalnull<br />
liegendes Grünland (Meede)."<br />
Hamp nnd. Hamp, Hemp, Hanf; "nicht nur Hinweis auf Anbauflächen,<br />
son<strong>der</strong>n auch auf Flurstücke, auf denen <strong>der</strong> geerntete Hanf in<br />
Wasserkuhlen "geröstet" wurde bzw. auf denen er zum<br />
Trocknen "in <strong>der</strong> Spreite" lag"<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Stand: 24.10.2010 34
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Haring Harring,<br />
Hering<br />
ahd. Hare, Anhöhe, Erhebung; Haring: "Wiese in einer<br />
Höhenlage"<br />
Hars afries. hars, hors, Pferd, Ross; "Haas(e), has(e)" sind in<br />
einigen Fällen möglicherweise gleichbedeutend mit "hars".<br />
Hart Hard mhd. hart, herte, hart, fest, nicht nachgebend; mnd. harde,<br />
"harte, trockene, sandige Stelle im Moor"<br />
Hart mnd. haart, hart, "Bergwald, waldige Höhe, hoher Wald"; nnd.<br />
Hard, "Wald, in Orts- u. Flurn. vorkommend"<br />
Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 38; Müller, Gunter, Westfälischer<br />
Flurnamenatlas, Lieferung 4, Bielefeld 2006, S. 457<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Hasel nnd. Hasel, Haßel, Hassel, "Hasel, Haselstrauch" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Hau (1) mnd. houw, hou, "Holzschlag, Durchforstung, Einschlag";<br />
"Flurstück, wo Holz eingeschlagen wird"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Hau (2) mnd. houw, nnd. Hau, "Heu" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Haver Hafer Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 3, 51<br />
Heck Heck, Durchfahrt; Gattertor, Schlagbaum; Zaun aus Latten<br />
o<strong>der</strong> eine Hecke o<strong>der</strong> ein Gebüsch, das ein Landstück<br />
umgrenzt (umhegt) o<strong>der</strong> abgrenzt<br />
heem Nebenform von "Hamm", Heim, Haus, Wohnung, Wohnsitz,<br />
Dorf<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 62; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong><br />
Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
2009, S. 54<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 69; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 84<br />
Stand: 24.10.2010 35
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Heer nnd. Here, "<strong>der</strong> Hirte, vorzugsweise <strong>der</strong> Kuhhirte"; "<strong>Die</strong><br />
Nutzung <strong>der</strong> betreffenden Flurstücke stand dem/den Dorfhirten<br />
zu."<br />
Heerweg mnd. heerwech, heerewech, "öffentliche Straße"; nnd.<br />
Heerweg, "Heerstraße"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Hees nnd. Hees, "(größerer) Buschwald" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Heester Heister 1. Waldname; Kompositum aus hais, Buche und ter, tre, Baum<br />
2. mnd. heyster, hester, "junger, noch nicht ausgewachsener<br />
Baum"; nnd. Heister, "junger Baum", "insbeson<strong>der</strong>e von<br />
Buche, Eiche gesagt"<br />
Hege mnd. heech, "Gehege", "Schonung, Gehege, geschonter,<br />
vorbehaltener Bezirk"; nnd. Hääch, "die Umzäunung, das<br />
Gehege, meistens ein kleineres Gehölz, das oft ursprünglich<br />
die Einfassung eines Feldes gebildet haben wird"; mnd. heege,<br />
"Hecke, Knick, Umzäunung"; "Gehege, Forst, Gehölz"<br />
Heide (1) Heideland; "dürres, sandiges, unfruchtbares, unbebautes<br />
ebenes Land"; "unbestelltes Feld"; "Orts- und Flurnamen mit<br />
<strong>der</strong> Endung "hee" verweisen auf Heideland."<br />
Heide (2) "Heide, Nichtchrist"; "Oft Hinweis auf ur- und/o<strong>der</strong><br />
frühgeschichtliche Plätze."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125; Schöneboom, A., Dorfnamen<br />
entstanden aus Flurbezeichnungen, in: Unser Ostfriesland, 1968, 7<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 36<br />
56<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Heiken "kurzer, kragenartiger Mantel mit daran befestigter Kapuze" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 509<br />
Heim Haus, Wohnung, Heimat; afries. hêm, "Heim, Dorf" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 261;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, S. 257<br />
Hektar 100 Ar, 1 Ar = 100 qm Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, S. 31, 259
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Helle mnd. helde, "Abhang, Halde"; nnd. Helle, Hölle, "“Helle“<br />
Ortsname, <strong>der</strong> an tiefen Abgründen haftet"<br />
Heller Hel<strong>der</strong> nnd. Hel<strong>der</strong>, Heller, "das dem Meere entstiegene, bz. durch<br />
Anschlammung des Schlieks entstandene Aussendeichsland,<br />
od. das Vorland vor den Seedeichen <strong>der</strong> Küste, <strong>der</strong><br />
uneingedeichte Seeanwuchs"<br />
Hellweg mnd. heelwech, helwech, "Hellweg, offene, allgemeine,<br />
öffentliche Straße, Landstraße"; nhd. Hellweg, "Landstraße,<br />
Heerweg"<br />
Helmer Moorweg; Landweg, in die Marsch o<strong>der</strong> in das Moor<br />
hineinführend; abseits <strong>der</strong> "allgemeinen Heerstraße" gelegen<br />
Helmt (1) Hellmt, Helm schilfartiges, langhalmiges Dünengras; hält den Dünensand<br />
fest und fängt Sand <strong>zur</strong> Bildung neuer Dünen auf<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 68; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 85<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 68<br />
Helmt (2) Helmer, Landweg, Moorweg Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 68<br />
Hemelte afries. hamelia, hemilia, verstümmeln; "ein größerer Fluranteil,<br />
<strong>der</strong> durch Wasserzüge abgeschnitten war"<br />
Hemp nnd. Hamp, Hemp, Hanf; "nicht nur Hinweis auf Anbauflächen,<br />
son<strong>der</strong>n auch auf Flurstücke, auf denen <strong>der</strong> geerntete Hanf in<br />
Wasserkuhlen "geröstet" wurde bzw. auf denen er zum<br />
Trocknen "in <strong>der</strong> Spreite" lag"<br />
Herd "Ein voller Herd (Hofplatz) hatte etwa die Größe von 30<br />
preußischen Morgen bzw. 5-8 Hektar im Dorfacker, dazu kam<br />
Wiesenland und ein Anteil an <strong>der</strong> Gemeinheit. <strong>Die</strong><br />
Durchschnittsgröße betrug ca. 10 Hektar."<br />
Herr mnd. hêre, Herr; "Hinweis auf (ehemalige) adlige<br />
Grundherrschaft bzw. den Landesherrn, eventuell auch auf<br />
Kirchenbesitz"<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 124, 125<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Stand: 24.10.2010 37
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Hesel afries. hesel, "Haselwald, Buschwald" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 100<br />
Heu Hoi, Hei, Hai afries. hai, nordfries. hau, Heu Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 81<br />
Hick möglicherweise gleichbedeutend mit "Heck" Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland.<br />
Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 57<br />
hilg heilig; hilgen-gôd: Kirchengut; hilgen-holt: Gehölz, zum<br />
Unterhalt <strong>der</strong> kirchlichen Gebäude genutzt; auch: heiliges<br />
Gehölz (möglicherweise auf ein heidnisches Heiligtum<br />
bezogen)<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 83<br />
Hille Aufbewahrungsort von Heu und Stroh Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
hillig mnd. hillich, nnd. hillig, "heilig", "als flektiertes BW<br />
[Bestimmungswort] Hilligen- oft verkürzt zu Hillen-"<br />
Höcht Hög, Högt,<br />
Högte<br />
Stand: 24.10.2010 38<br />
85<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
"Höhe, Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Hof 1. "als Kurzform für "Bauernhof" zu verstehen", Hinweis auf<br />
einen Einzelhof 2. Hof, Gehöft, Garten; "ein mit Wall, Hecke<br />
etc. umgebenes Land" o<strong>der</strong> "Platz, auf dem auch Gebäude<br />
stehen können"<br />
96<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Remmers, Arend, Von Aaltukerei<br />
bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong> Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade,<br />
Leer 2004, S. 262<br />
Höft mnd. hovet, Haupt, Kopf; Spitze, Ecke, Vorsprung Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 510<br />
hog mnd. hô, hôch, "hochliegend, erhöht liegend; herausgehoben,<br />
hervorgehoben, ausgezeichnet"; oft in Flurnamen für die<br />
ältesten Ackerstücke einer Dorfflur (Kernflur)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Höhle nnd. Höhle, "Höhle, Vertiefung" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126<br />
hol hohl; Höhle, Vertiefung, Loch; "de holen: die Schornsteine,<br />
Rauchhöhlen, Rauchlöcher"<br />
Holke nnd. Holke, "tiefe Stelle im Boden, namentlich im Wege; auch<br />
eine Furche, welche vom Wasser ausgespült und vertieft ist";<br />
"niedrige Stelle bei einer Warft o<strong>der</strong> Wurt, wo die Erde<br />
ausgehoben wurde"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 106;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 98<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126<br />
Holl (1) "Loch, Öffnung; Enge, Wasserabfluss" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
98<br />
Holl (2) "Hohlraum", "Höhle", "Schlupfloch, Wohnung des Tieres" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Holl (3) abgeleitet von "halten"; Flurnamen mit "hollen" wie z. B.<br />
"Uphollen" können auf ein Melksett verweisen, weil die Tiere<br />
hier "halten" mussten.<br />
Stand: 24.10.2010 39<br />
98<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 511; Schöneboom, A.,<br />
Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfr. Hauskalen<strong>der</strong>, 1955, S. 47-53<br />
Holle "Ackermaß"; im Plural: Hollen; auch: "Stücke Landes" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 512<br />
Hölle Helle "Höhle, Vertiefung, Einsenkung des Bodens, caverna" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 125<br />
Hollen mnd. Holle, "niedrige Erhebung, Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126<br />
Holm mnd. holm, "herausragendes Landstück, insbes. Insel"; "in<br />
Flurnamen auch wohl Anhöhe, Hügel"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Falkson, Katharina, <strong>Die</strong><br />
Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen). Neumünster 2000, Bd.<br />
2, S. 289
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Holt Holz; Wald; mnd. holt "Baumbestand, Gehölz, Wald,<br />
Waldstück, Hochwald"; nnd. Holt, "Gehölz, Wald"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 126; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
100<br />
Hood Hoot Hut; "Bezeichnung für eine kleine, spitzwinklige Fläche" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 148<br />
Hööft mnd. hôvet, "Haupt", "vorspringendes Stück, Landnase"; nnd.<br />
Hööft, "kopfartige" aus dem Wasser hervorragende o<strong>der</strong> in das<br />
Wasser hineinragende Uferbefestigung; "Endstück (eines<br />
Ackers)"<br />
Hook Hoek mnie<strong>der</strong>l. hoek, "Spitze (Landspitze, -zunge)"; "Ecke; auf eine<br />
Gegend bezogen: Winkel (Rand, Kante, Ufer)"; auch: Anhöhe<br />
Hooker Höker, Kleinhändler, Krämer; Höker sind keine Hausierer,<br />
son<strong>der</strong>n bieten ihre Ware in einem "hôk" (Winkel, Ecke) o<strong>der</strong><br />
"huk" (kleiner Raum) an.<br />
Hoop mnd. hôp, "Erdaufwurf, kleine Er<strong>der</strong>höhung, feste Stelle in<br />
Sumpf und Moor"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 40<br />
97<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 97<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127<br />
Hoppen mnd. hoppe, hoppen, nnd. Hoppen, "Hopfen" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127<br />
Hor (1) nnd. Haar, "hohe, trockene, sandige Stelle"; mnd. haare, haar,<br />
"eine festere, trockne Stelle im Moor"<br />
Hor (2) mnd. hor, haar "Dreck, Schlamm, Graben- od. Gruben-Erde";<br />
mhd. hor, Sumpfland, Schlamm<br />
Hörgen "Plural von nie<strong>der</strong>d. höge (veraltet), Anhöhe, Hügel;<br />
ansteigendes sandiges Gelände"; "<strong>Die</strong> „offene“ Aussprache<br />
des ö führte später bei dem nicht mehr geläufigen Wort <strong>zur</strong><br />
Schreibung Hörgen(s) mit dem eingefügten r."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 123<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 104<br />
Remmers, Arend
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Horn Hörn mnd. hoorn, nnd. Horn, "spitz zulaufendes, keilförmiges<br />
Landstück", "Winkel, Ecke, Biegung"<br />
Horst Hörst mnd. horst, hurst, host; 1. Gebüsch 2. "eine (früher mit<br />
Gebüsch bewachsene) sandige Anhöhe, ein hochgelegenes<br />
Grünland" 3. "mit Gebüsch bewachsenes Land, das von<br />
Sumpf umgeben ist"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
106, 107<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
107<br />
Hotz gleichbedeutend mit "Horst" Schöneboom, A., Flurnamen leben in Eigen- und Ortsnamen fort, in:<br />
Unser Ostfriesland 1966, 15, 16<br />
Hove "Kirchhof als Marktplatz o<strong>der</strong> als dessen Zentrum" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 263<br />
Huck nie<strong>der</strong>l. hok, abgeschlossener Stall; kleine ärmliche Wohnung Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 112; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Hull Hüll, Hullen,<br />
Hüllen<br />
1996, S. 93<br />
nie<strong>der</strong>d. hull, "kleine Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 127; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
113<br />
Hülse Hülse (ilex aquifolium); Mäusedorn, Stechpalme, Walddistel Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
114<br />
Hümpel mnd. hümpel, "Haufen", "Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Hund (1) Wasserschöpfmühle, Bremster Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
115, Bd. 1, S. 226 (siehe unter: bremster)<br />
Hund (2) eventuell Hinweis auf die Min<strong>der</strong>wertigkeit eines Landstückes Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Stand: 24.10.2010 41
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Hund (3) von <strong>der</strong> germ. Wurzel "hun" abgeleitet: "Sumpf, Mo<strong>der</strong>" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Hund (4) mnd. hunt, Ackermaß; "<strong>der</strong> 6te Teil eines Morgens, o<strong>der</strong> 20<br />
Ruthen in <strong>der</strong> Länge, und 4 in <strong>der</strong> Breite"<br />
Hund (5) han, hun, hoch; Hundekamp = "hoher o<strong>der</strong> hochgelegener<br />
Kamp"<br />
Hüne "Hüne, Riese"; "In <strong>der</strong> Regel Hinweis auf ur- und/o<strong>der</strong><br />
frühgeschichtliche Plätze"<br />
Hunger mnd. hunger, nnd. Hunger, "Hunger"; "Hinweis auf schlechten,<br />
ertragarmen Boden o<strong>der</strong>, bei Bächen, auf geringe<br />
Wasserführung, zeitweiliges Trockenfallen."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Hupen mnd. hûpe, "Haufen", "Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
husen verweist auf die Betreuung einer Gemeinmeede: Dem Wärter<br />
(<strong>zur</strong> Abwehr des Viehs) dieser nicht eingefriedigten Weide, von<br />
dem ständige <strong>Die</strong>nstbereitschaft verlangt wurde, wurde auf <strong>der</strong><br />
Gemeinwiese eine Unterkunft angewiesen.<br />
Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Huud (1) Viehweide; "Ort, wo etwas gehütet wird" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 517, 518<br />
Huud (2) Anlegestelle, Lösch- und Ladeplatz, Fährstelle Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 517, 518<br />
Huus Hus Haus; Gebäude, in dem Menschen wohnen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 118; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 253<br />
Stand: 24.10.2010 42
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Iebe mnd. оve, "1. Eibe. 2. Efeu"; nnd. Iebe, "Eibe" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
ies ieß, is, iß friesische Nebenform von "Esch"; "westlich <strong>der</strong> Lauwers<br />
bedeutet "ies": Esch, Ackerland rings um ein Dorf"<br />
Ihle 1. Igelkolbe (sparganium); Ihlow: "ihl-owe = Igelkolben-Aue"<br />
(Koolmann) 2. "Il", "Ile": Name eines Flusses; "au, auwe,<br />
awen": "Ort, <strong>der</strong> vom Moorwasser überströmt ist"; Ilauw:<br />
"sumpfiger Ort am Fluss Il" (Sun<strong>der</strong>mann)<br />
Imme mnd. im(m)e, "Bienenschwarm, Bienenstand"; "In aller Regel<br />
Hinweis auf Standorte von Bienenständen"<br />
in in, hinein, innen, binnen; in-wîke: "nach innen, bz. ins Land<br />
o<strong>der</strong> Moor hinein gegrabene wîke od. Neben-Canal, <strong>der</strong> sich<br />
von <strong>der</strong> Haupt-wîke abzweigt"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256<br />
Friedrich Sun<strong>der</strong>mann, Zur Ortsnamengeschichte Ostfrieslands,<br />
abgedruckt i. d. Literarischen Beilage zum Ostfr. Schulblatt, 1906;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 124<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 125, 133; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 59<br />
Ing Wiese, Grasplatz Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Insel lat. insula, Insel; "im Wasser liegendes, bz. von Wasser<br />
umgebenes Etwas", "Land im Meer"<br />
Interessenten<br />
(1)<br />
Interessenten<br />
(2)<br />
Mitglie<strong>der</strong> einer genossenschaftlichen<br />
Selbstverwaltungskörperschaft ( Deichinteressent,<br />
Weideinteressent)<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 132<br />
Stand: 24.10.2010 43<br />
HWO<br />
Hofbesitzer; Inhaber <strong>der</strong> vollen o<strong>der</strong> halben Heerde HWO<br />
Isch Ischen, Ischer möglicherweise wie "ies", "ieß", "is" und "iß" Nebenformen von<br />
"Esch"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Isken Nebenform von "Esch" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 407<br />
Jard "Messruthe von 10 Fuss"; Elle, Rute; möglicherweise ein<br />
Landstück von einer bestimmten Größe<br />
Jidde "Ursprünglich ein Längenmaß, dann ein Flächenmaß im<br />
Brookmerland. <strong>Die</strong> Größe wird mit 4665 Quadratmetern, aber<br />
auch mit rd. 1/2 Hektar = 5000 Quadratmeter angegeben."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 589 (siehe unter: garde); Falkson,<br />
Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen).<br />
Neumünster 2000, Bd. 2, S. 520<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Jöd (1) Jude Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S, 14<br />
Jöd (2) afries. jüdd, Unkraut; "Unkraut und Ampfer ist nach dem<br />
Verschwinden <strong>der</strong> friesischen Sprache… (um 1500) nicht mehr<br />
verstanden worden, und so sind …vernachlässigte Landstücke<br />
zu Judenkirchhöfen geworden." Beweis: Erfassung <strong>der</strong><br />
jüdischen Begräbnisplätze 1983<br />
Jödenkarkhof "Es wird damit <strong>der</strong> Schindanger bezeichnet, <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s im<br />
18. Jahrhun<strong>der</strong>t während des großen Viehsterbens seine<br />
Bedeutung hatte. Dabei waren die Judenschlachter als<br />
Fellabzieher beteiligt."<br />
Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Baumann, Andreas; Heimatgeschichtliche Sammlung, im Besitz <strong>der</strong><br />
Ostfriesischen Landschaft<br />
Johls Holz, Wald, "Baumbestand mit ausgewachsener Krone" Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland.<br />
Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. S. 27<br />
Jüch (1) Jüche,<br />
Jüchen, Jücht<br />
Joch: "ein Landmass (Juchart), welches ein Gespann o<strong>der</strong> ein<br />
Joch Ochsen in einem Tage umpflügen kann"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Jüch (2) gleichbedeutend mit "Tjüch, Tjüche" Roskam, Heinrich, Woher kommt <strong>der</strong> Ortsname Tjüche?, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1963, 5<br />
Jück (1) Jücken, Jüg Joch: "ein Landmass (Juchart), welches ein Gespann o<strong>der</strong> ein<br />
Joch Ochsen in einem Tage umpflügen kann"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Stand: 24.10.2010 44
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Jück (2) gleichbedeutend mit "Tjüch, Tjüche" Roskam, Heinrich, Woher kommt <strong>der</strong> Ortsname Tjüche?, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1963, 5<br />
Junker Sohn eines adligen Gutsbesitzers; aber auch: "Edelmann,<br />
adliger Gutsherr"; "Hinweis auf (ehemalige) adlige<br />
Grundherrschaft"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 298<br />
jüst güst unfruchtbar, unergiebig Schöneboom, A., Geestdorf Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten<br />
Namen, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-35<br />
Kaak Pranger, Schandpfahl Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 155; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Kabel (1) nnd. Kafel, "durch das Los bestimmter o<strong>der</strong> überhaupt Anteil<br />
am gemeinsamen Besitz, an <strong>der</strong> Allmende, Parzelle,<br />
Ackerstück, Waldanteil, zugeteilte Deichstrecke"<br />
Kabel (2) "Strecke eines Hauptdeiches, für <strong>der</strong>en ordnungsgemäße<br />
Unterhaltung ein Grundstückseigentümer aus dem<br />
deichgeschützten Gebiet verantwortlich ist"<br />
Kaben Koben mnd. koove, kooven, kaave, "Stallverschlag, Viehstall,<br />
Schweinestall"; nnd. Koben, Kaben, "kleiner Stall"<br />
1996, S. 99<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 128<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Kai "Gehege, Zaun, Umwallung" Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Kaje "Kai, d. h. die Hafen-Einfassung, bz. <strong>der</strong> Damm od. das<br />
Bollwerk, welches zum Schutz des Ufers eines Hafenbeckens,<br />
eines Flusses od. <strong>der</strong> See dient"<br />
Kamer lat. camera, "gewölbte Decke"; Gewölbe, Aufbewahrungsort,<br />
Kammer; fürstliche Wohnung; Gerichtsstube; möglicherweise<br />
Bezeichnung für ein eingefriedetes Landstück<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 153; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 63<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 521<br />
Stand: 24.10.2010 45
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Kammer "eingeschlossen liegendes Flurstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Kamp (1) "Ursprünglich Heideland, das umgebrochen und aus <strong>der</strong><br />
Gemeindeweide ausgeschieden wurde. Eingehegte Kämpe<br />
werden hauptsächlich feldgraswirtschaftlich, aber auch zum<br />
Getreide- o<strong>der</strong> Gemüseanbau genutzt."<br />
Kamp (2) nnd. Kamp, "ein mit einer Hecke o<strong>der</strong> mit einem Graben<br />
eingehegtes Stück Land, gleich viel, ob es Ackerland, o<strong>der</strong><br />
Wiese, o<strong>der</strong> Waldbestand ist"; gewöhnlich in Privatbesitz<br />
Kanal lat. canna, Kanal; "kleines Rohr, Röhre, aber auch Schilfrohr";<br />
"künstlich ausgegrabener Wasserlauf"<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 305<br />
Kant Kante, Rand, Seite, Ecke, Winkel, Gegend Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 169; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 102<br />
Kap (1) mnd. kap, kaap, "Kap, Landspitze" " Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Kap (2) mnd. kaape, "Seezeichen, Bake" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Kark Kirche Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 177; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Karkhoff mnd. kerkhof, "Kirchhof, Platz, befriedeter Raum um die<br />
Kirche, Begräbnisplatz"; nnd. Karkhoff, Kerkhoff, "Friedhof"<br />
1996, S. 103<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Karte "Karten-, Kardendistel", "Weberdistel" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 165<br />
Stand: 24.10.2010 46
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Kasse mundartlich Kasse, "Kirsche" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 166<br />
Kast mnd. kast, kass, kaste, Kasten, Behälter; Schrank;<br />
verschlossener Raum; Gefängnis<br />
Katte mnd. katte, nnd. Katte, "Katze"; "Katte" kann ein Hinweis auf<br />
die Min<strong>der</strong>wertigkeit eines Landstücks sein.<br />
Kattrepel Kompositum aus "kat" (Katze) und "repel" (Raufe):<br />
"Katzenraufe", etwas, womit Katzen gestriegelt werden; <strong>Die</strong><br />
Bezeichnung wurde auf eine Gegend übertragen, wo die<br />
Katzen sich raufen, d. h. sich mit ihren Krallen kämmen und<br />
zerzausen. Das ist vor allem in abgelegenen, das bedeutet,<br />
"vom Pöbel" bewohnten Straßen <strong>der</strong> Fall. "Kattrepel"<br />
bezeichnet somit das Gebiet o<strong>der</strong> den Stadtteil, wo die<br />
"gemeinen Leute" leben bzw. "<strong>der</strong> Pöbel" wohnt<br />
Kau eingefriedigter, abgeschlossenes Raum im Haus o<strong>der</strong> im<br />
Freien; Pferch, Hürde, Koben, Stall<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 182; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 64<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S 185, Bd. 3, S. 31; Stürenburg, Cirk<br />
Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich<br />
1857, Leer 1996, S. 104<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 188; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 104<br />
ke Verkleinerungssilbe (am Ende eines Wortes) Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Keil mnd. kоl, nnd. Kiel, "Keil"; "keilförmig, spitz zulaufendes<br />
Flurstück"<br />
Keller auch Kel<strong>der</strong>, Keller; unterirdische Vorratskammer; "Keller" wird<br />
auch als Metapher für "Tal" benutzt.<br />
Ketel nnd. Ketel, "Kessel"; "Metapher für "kesselförmige Vertiefung"",<br />
"Bezeichnung einer tiefliegenden Örtlichkeit: Wasserloch;<br />
Geländesenke"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
2009, S. 44,<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 129; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 47<br />
195<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
kibbel nnd. kibbeln, streiten, prozessieren; Kibbelland: ein Landstück,<br />
um das gestritten wird<br />
kief mnd. kоf, nnd. Kief, "Streit, Zank; Rechtsstreit, Prozeß";<br />
"Hinweis auf ein Flurstück, das zwischen mehreren<br />
Interessenten umstritten ist/war."<br />
Kiel mnd. kоl, nnd. Kiel, "Keil"; "keilförmig, spitz zulaufendes<br />
Flurstück"<br />
Der "Kibbelkiel" bei Charlottenpol<strong>der</strong>, in: Der Deichwart 1960, 25<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
205, 206<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
208, 210<br />
Kiewitt (1) Kiewiet Kiebitz Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 225<br />
Kiewitt (2) Wasserschöpfmühle ohne Gehäuse od. Umkleidung (auch<br />
"bremster" od. "hund" genannt)<br />
Kill nordfries. kiel, Brunnen, Quelle; natürliche Wasserrinne o<strong>der</strong><br />
natürlicher Wasserlauf, beson<strong>der</strong>s im Watt<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 225<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 210; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 107<br />
Kipp "kleines Flurstück, Endstück", auch: Hügel Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klampe mnd. klampe, nnd. Klampe; kleine Brücke über einen Graben<br />
o<strong>der</strong> ein Tief; Steg<br />
Klappe mnd. klappe, "Klappe, Fallbrücke"; nnd. Klappe, "Klappe, was<br />
sich auf- od. zuklappen läßt"; "Hinweis auf (mit Schlagbaum<br />
gesicherten) Durchlaß durch eine Umzäunung, Befestigung."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 48<br />
232<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klawer mnd. klâver, nnd. Klawer, Klewer, "Klee" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Klees (1) "kleinere, festliegende Brücke, die so hoch liegt, dass die mit<br />
Torf, Heu etc. beladenen Schiffe drunter durchfahren können"<br />
Klees (2) verwandt mit "Klause", nie<strong>der</strong>l. Kluis, Engpass, enger<br />
Durchgang<br />
Klei mnd. kley, "Lehmboden, fetter, schwerer, fruchtbarer Boden";<br />
nnd. Klei, "<strong>der</strong> schlammige, fette Boden <strong>der</strong> Marschgebiete"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 256; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 110<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 110<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klimpe (1) Nebenform von "Klampe": kleine Brücke, Steg Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
260<br />
Klimpe (2) nnd. Klimp, "kleine felsige Anhöhe" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Klinge (1) nnd. Klinge, Furt, "seichte Stelle im Flusse, wo das Wasser<br />
über Kiesel und Sand rasch dahin fließt"<br />
Stand: 24.10.2010 49<br />
260<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klinge (2) nie<strong>der</strong>l. klink, kling, Hügel, Sanddüne Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klinge (3) mhd. Klinge, schmale Schlucht, Wildbach Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130<br />
Klingt mnd. klint, klinte, "Fels, felsige Anhöhe, Uferhöhe, häufig in<br />
Örtlichkeitsbezeichnungen"; nnd. Klint, "kleine felsige Anhöhe"<br />
Klinke Klenke, mnd. klinke, klenke, "Türriegel", "Verschlussklinke<br />
eines Schlagbaumes"; "Hinweis auf Wegesperre, auf (mit<br />
Schlagbaum gesicherten) Durchlaß durch eine Umzäunung,<br />
eine Befestigung."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 130
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Klipp Klippe, steiler Felsen; Granitblock; in Norddeutschland oft in<br />
Flurnamen für ein "steiniges, wenig fruchtbares Gelände"<br />
Kloster lat. claustrum, "Verschluss, Schloss, Riegel"; später<br />
"abgeschlossener Raum für Mönche und Nonnen"; "oft Hinweis<br />
auf Klosterbesitz (Vorwerke); manchmal (scherzhafter) Hinweis<br />
auf eine einsame Lage"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 267; Müller, Gunter, Westfälischer<br />
Flurnamenatlas, Lieferung 4, Bielefeld 2006, S. 462<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 266<br />
Kluft Teil einer Stadt o<strong>der</strong> einer Gemeinde Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 284<br />
Klumpen Klumpen mnd. klumpe, klump, "Haufen", "Anhöhe, Hügel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Kluse Kluse mnd. klûse, "Klause, Einsiedlerhaus, -zelle, -kloster"; "enger<br />
Durchgang, Engpaß"; nnd. Kluse, "Klause", aber auch:<br />
"Kapelle, Wallfahrstkapelle"<br />
Knick mnd. knick, "Hecke auf einem niedrigen Wall, <strong>zur</strong> Einfriedigung<br />
von Fel<strong>der</strong>n und Weiden, aber auch <strong>zur</strong> Befestigung <strong>der</strong><br />
Landwehr"; "Oft Hinweis auf ehemalige Dorfbefestigung."<br />
Knollen mnd. knolle, "Erdvorsprung, kleine Anhöhe, nur als Ortsname<br />
belegt"; nnd. Knollen, "Knollen, "Anhöhe, Hügel"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Knurren hartes Stück Holz; Knorren Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 117<br />
Koben mnd. koove, kooven, kaave, "Stallverschlag, Viehstall,<br />
Schweinestall"; nnd. Koben, Kaben, "kleiner Stall"<br />
Kohltuun auch: Werde o<strong>der</strong> Wi(e)rde; "erweitere Gärten eines Dorfes,<br />
<strong>der</strong>en Böden auf <strong>der</strong> Mitte zwischen Garten- und Ackergrund<br />
stehen"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131<br />
Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1955, 5<br />
Stand: 24.10.2010 50
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Kolde Kolle Kälte, Frost Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 320<br />
Kolk mnd. kolk, kulk, "Vertiefung, Grube"; "teichähnliches Erdloch,<br />
das beim Durchbruch eines Deiches durch das einströmende<br />
und die Erde herauswühlende Seewasser entsteht"<br />
Kolonat lat. colonia, Kolonat, Kolonie, Vorwerk; Ansiedlung,<br />
Nie<strong>der</strong>lassung außerhalb des Mutterlandes; Landstück aus<br />
staatlichen Ödlän<strong>der</strong>eien, in Erbpacht vergeben<br />
Kolonie wie Colonat von lat. colonia abgeleitet: Kolonat, Kolonie,<br />
Vorwerk; Ansiedlung, Nie<strong>der</strong>lassung außerhalb des<br />
Mutterlandes<br />
kolt nnd. kolt, koolt, "kalt"; "kaltgründig (von schwerem, lehmigen<br />
Boden)"; aber auch: "abgelegen, min<strong>der</strong>wertig, wertlos";<br />
"unbewirtschaftet, wüst"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 131; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
321; HWO<br />
Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland.<br />
Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 28; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 346<br />
Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland.<br />
Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 28; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 346<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Koog mnd. kôch, nnd. Koog, "eingedeichtes Marschland" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Kopp mnd. kop, nnd. Kopp, "Kopf"; "Vorsprung einer Anhöhe sowohl<br />
in die Höhe als nach <strong>der</strong> Seite hin"; "vorspringendes<br />
abgeson<strong>der</strong>tes Stück eines Ackers"; "Ausläufer eines Ackers in<br />
Land an<strong>der</strong>er Nutzungsart hinein"<br />
Koppel mnd. koppele, koppel, "ursprünglich gemeinschaftliches<br />
Landstück, vorwiegend Weideland, auch Acker- o<strong>der</strong><br />
Waldstück, dann überh. Feldstück, Stück Weideland,<br />
eingezäuntes Landstück"; nnd. Koppel, "größeres<br />
(eingefriedigtes) Stück Land"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Korn Getreide Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 329<br />
kört kort kurz, eng, schmal Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 331<br />
Stand: 24.10.2010 51
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Köster mnd. köstere, köster, nnd. Köster, "Küster"; "bis in das 20. Jh.<br />
hinein auch = Dorfschullehrer"<br />
Köter mnd. kötter, "Kätner, Häusler, Besitzer einer Kätnerstelle, von<br />
einem Bauernhof abhängiger Kleinbauer, Tagelöhner"; nnd.<br />
Köter, Kötner, "Besitzer einer Kötherei, Kothsasse, Köther"<br />
Krane auch: Krone; mnd. kraane, kraan, krôn, kraaneke, nnd. Kroon,<br />
Kraneke, "Kranich"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Kreie mnd. kreye, nnd. Kreie, "Krähe" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Krempel nnd. Krempel, "kleiner abgezäunter Raum im Stall"; auch:<br />
"Bezeichnung für Flurstücke, "die im Winkel zwischen zwei<br />
Wegen, zwischen Bach und Weg o<strong>der</strong> ähnl. liegen"".<br />
Kreuz Krüüz 1. nnd. krûss, krûs, krûts, Kreuz; Kreuzung, Kreuzweg 2. nnd.<br />
Krüüz, "Kreuz", "Hinweis auf Kreuzstein, Steinkreuz<br />
(Sühnekreuz), evtl. auch Wetterkreuz (das vor Unwetter<br />
schützen soll), Bildstock o<strong>der</strong> aber auch auf Kreuzweg,<br />
Wegekreuz."<br />
Krimpe mnd. krimpe, "Einschrumpfung, Schwund", nnd. Krimpe,<br />
"Biegungs-, Krümmungsstelle"; auch: "abnehmendes = spitz<br />
zulaufendes Flurstück"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 132, 133; Doornkaat Koolman, Jan<br />
ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2,<br />
S. 387<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Krug (1) Kroog nie<strong>der</strong>d. kroog, kleines Wirtshaus od. Schenke auf dem Lande Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 369<br />
Krug (2) dithmar. Kroog, mit einem Wall, Graben od. Zaun umgebenes<br />
Stück Land<br />
Krumme das krumme o<strong>der</strong> gebogene Ende o<strong>der</strong> Stück; krumhörn:<br />
"krumme Ecke", da <strong>der</strong> Deich dort viele Krümmungen aufweist,<br />
ebenso wie die Wege, die das Land durchschneiden<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 369<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 384<br />
Stand: 24.10.2010 52
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
kruus mnd. krûs, nnd. kruus, "kraus, gekräuselt"; "Zumeist in<br />
Verbindung mit einem Baumnamen, dann etwa = verästelt,<br />
wirr, üppig gewachsen"<br />
Kuhle mnd. kûle, nnd. Kûle, Vertiefung, Senkung, Höhlung, Loch,<br />
Grube, Teich<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
396<br />
Kup Bottich, Brenn- o<strong>der</strong> Braubottich; Lohgrube Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 411; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Kuser Kuster nnd. kûse, kûs, Kloben, Klotz; dickes unförmliches Stück,<br />
Brocken o<strong>der</strong> Klumpen<br />
1996, S. 129<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 415<br />
laag nnd. laag, "niedrig gelegen“ Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Laat Lathe Weg o<strong>der</strong> Graben, auch das an diesem Weg o<strong>der</strong> Graben<br />
gelegene Land<br />
Lage mnd. lâge, "Lage, Stelle, Ort, Standort"; nnd. Lage, "Lage"; "frei<br />
daliegende (abgeholzte od. unbebaute, ruhende) Fläche";<br />
"freie offene Fläche zwischen Wäl<strong>der</strong>n"<br />
Lager mnd. leeger, laager, nnd. Lager, "Lager, Liegestatt"; "Lager-,<br />
Ruheplatz des Weideviehs während des täglichen<br />
Weideumtriebs"; "Sammelplatz für die Kühe, auf daß sie hier<br />
von den Mägden gemolken werden konnten"<br />
Lake "kleineres seichtes stehendes Gewässer, mit Wasser gefüllte<br />
Vertiefung im Wiesengelände"; "sumpfige Wiese,<br />
trockengelegte Sumpfwiese"; "langsam fließendes Gewässer,<br />
Seitenarm, Ausbuchtung eines Wasserlaufes; Abfluß eines<br />
Sumpfgeländes"<br />
Land mnd. lant, nnd. Land, "Land"; "Meint im allgemeinen Ackerland,<br />
nicht Grünland."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 475<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 133<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Stand: 24.10.2010 53
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Landwehr auch: Lanfer; "Außenbefestigung zum Schutz eines Gebietes,<br />
meist aus einem Erdwall mit Graben bestehend und mit<br />
Buschwerk o<strong>der</strong> kleinem Holz bewachsen, zum Schutz einer<br />
Territoriumsgrenze, auch eines Dorfes, beson<strong>der</strong>s des<br />
Landgebietes einer Stadt"<br />
lang "Wo in Flurnamen die Bezeichnung lang auftritt, wie in<br />
Langeackers, ..., handelt es sich fast immer um Teile des<br />
Gemeinackers."<br />
Länge mnd. lenge, nnd. Länge, "Länge"; "schmale, langgestreckte<br />
Flurstücke"<br />
Lappen mnd. lappe, "Stück Land"; nnd. Lappen, "etwa identisch mit<br />
Flage"<br />
Lede (1) nnd. Leide, "Leitung, Wasserleitung"; "In den Marschen =<br />
größerer Abzugsgraben"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Lede (2) gleichbebeutend mit "Leegte" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
leeg mnd. lêch, nnd. leeg, "niedrig, niedrig gelegen"; "niedrig,<br />
gering, schlecht"; "mager, trocken, hinfällig, schlecht, nichts<br />
taugend"<br />
Leegte Leegde mnd. lêgede, "Nie<strong>der</strong>ung, niedrig gelegenes Landstück, Wiese,<br />
Umland, Lehde"; nnd. Lägte, "das, was niedrig od. tief ist u.<br />
liegt, Nie<strong>der</strong>ung"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 54<br />
459<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Leeke Gewässername, auf das anliegende Gelände übertragen Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Leetz Flußname, auf das anliegende (niedrige) Gelände übertragen Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Lege (1) nnd. Lege, Lääch, "brach liegendes Land, das sich erholen soll<br />
und als Viehweide genutzt wird"<br />
Lege (1) nnd. Leeg, "niedrig gelegenes Land, das bei höherem<br />
Wasserstand überflutet wird"<br />
Lehm nnd. lêm; "etwas sandiger Thon, <strong>der</strong> früher im Hausbau zum<br />
Verkleben und Bestreichen <strong>der</strong> Wände und als Mörtel anstatt<br />
des Kalkes benutzt wurde"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 134<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 492<br />
Leide Leyde Gewässername; "Zufluss eines Sieltiefs" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 267<br />
Leihe (1) Leie "eine schmale Strecke Grünland od. eine schmale<br />
Wiesenstrecke zwischen den zum Kornbau benutzten<br />
Längsäckern"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 585<br />
Leihe (2) mnd. lêide, "Wasserlauf, Wassergraben" Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 4, Bielefeld 2006,<br />
S. 445<br />
Leis Leise, Leiße mnd. lêsch, "Ried, Schnittgras, Schilf; am Wasser gelegenes<br />
(Weide-) Land"; "Flußname, auf das anliegende (niedrige)<br />
Gelände übertragen"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 85;<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Leitz Flußname, auf das anliegende (niedrige) Gelände übertragen Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Lidde "Höhenteil eines Abhangs", Bergabhang Lüken, D., Lidde, ein alter Lengener Flurname, in: Unser Ostfriesland,<br />
1969, 4; Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1955, 4<br />
Lieftocht mittelalterlicher Rechtsbegriff; mnd. lîftucht, "Leibzucht,<br />
Nahrung, womit man den Leib aufzieht, Einkünfte, die eine<br />
Person Zeit ihres Lebens genießt, das Grundstück, das die<br />
Rente liefert"<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 194-196<br />
Stand: 24.10.2010 55
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Lien mnd. lîn, "Lein, Flachs", nnd. Lien, "Flachs" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Linie nnd. lînje, Linie, gezogener Strich; Linienweg: ein gera<strong>der</strong>,<br />
"nach <strong>der</strong> Schnur gezogener" Weg<br />
Lintel Band, Linie; ein sich "schlängelndes" Landstück o<strong>der</strong> Weg;<br />
Grenze, Begrenzung<br />
litz Gewässername von scheinbar unklarer Herkunft; bezeichnet<br />
einen Bach<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 513<br />
Der Lintelo-Pol<strong>der</strong> - ein Stück Rhei<strong>der</strong>land, in: Der Deichwart 1960, 19<br />
Schöneboom, A., Dorfnamen entstanden aus Flurbezeichnungen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1968, 7<br />
Lock mnd. lok, nnd. Lock, "Loch"; "Etwa = Erdloch, kleiner Tümpel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Loge nnd. Loge, "niedriger Ort, Grasanger" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Loh auch: Lah; mnd. lô, lâ, "kleines Waldstück, Gehölz, Buschwald,<br />
<strong>zur</strong> öffentlichen Weidenutzung frei"; nnd. Loh, "das niedrige<br />
Holz, ein Gebüsch von geringem Umfange"<br />
Lohne 1. mnd. laane, loone, "schmaler Weg, Viehtrift, bes. schmaler<br />
Weg am Seedeich"; nnd. Lane, Lone, Laan, Loon, "Lohne,<br />
Durchgang, Durchfahrt, Gasse od. Gang, Weg" 2. aber auch:<br />
"Abzugsgraben"<br />
Loog 1. "Dorf, Ort, Ortschaft, Wohnstätte" 2. mnd. lôch, "Ort, Stelle,<br />
Wohnstätte, Hausstätte, Wohnort, Dorf (ostfries.)"; nnd. Loog,<br />
"Dorf, Ort, Stätte, Ortschaft, Wohnstätte, Wohnsitz"<br />
Löse mnd. lööse, "Abflussgraben, Sielgraben"; nnd. Löse,<br />
"Abzugsgraben"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697;<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Stand: 24.10.2010 56
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Lübbe mhd. luppen, lüppen, vergiften, heilen; Bedeutung je nach<br />
Bewuchs des Landstücks: "das Heilende, Nährende", gutes<br />
Grasland bzw. Ackerland o<strong>der</strong> "das Giftige"; kleine Lübbe:<br />
Lübke (Lübeck), Lübsche<br />
Lucht (1) Lücht mnd. lucht, nnd. Luft, Lucht, "Licht"; von mnd. lüchte, "Laterne";<br />
nnd. Lüchte, "Leuchte"; "Oft mit dem BW [Bestimmungswort]<br />
„hoch““<br />
Lucht (2) mnd. lucht, nnd. Luft, Lucht, "Luft"; "Auch dies oft mit dem BW<br />
„hoch““<br />
Luk nnd. luken, lockern; "Im Lukmoor lukten (lockerten) arme<br />
Tagelöhner ihre zeitgepachteten Landstücke mit <strong>der</strong> Hauhacke<br />
auf für den Buchweizenbau."<br />
Maan Mahn, Mahne,<br />
Mahnd,<br />
Mande<br />
afries. manda, monda, "Gemeinschaft; gemeinschaftlicher<br />
Besitz"; Hinweis auf Land in Gemeinschaftsbesitz; Mande: die<br />
am Gemeinschaftsbesitz beteiligten Bauern<br />
Maar mnd. maar, maare, "Wassergraben, Abflußgraben<br />
(Ostfriesland)"; nnd. Mâr, Mare, "kleiner Fluss od. natürliche<br />
Wasserleitung, Abzugs-Graben, Grenz-Graben"<br />
Schöneboom, G., Auf <strong>der</strong> Lübsche, in: Unser Ostfriesland, 1970, 17<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Flurnamen in <strong>der</strong> Gemarkung Brockzetel. In <strong>der</strong> einsamen Heide ließen<br />
sich die Johanniter nie<strong>der</strong>,<br />
in: Friesische Heimat, 1968, 2<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 268;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 571<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 135<br />
Maat Made mnd. mâde, nnd. Made, "zu mähende Wiese, Heuwiese" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136<br />
mager mager, wenig Gehalt habend; klein o<strong>der</strong> gering; unbedeutend Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 559<br />
mäh Mählande, Mede: Land, das <strong>zur</strong> Heuernte bestimmt ist; mai-,<br />
mei-feld: Mäh-Feld; "auch Bezeichnung für anmoorige<br />
Übergangsgebiete zwischen Marsch und Geest und für<br />
Feuchtwiesen"<br />
Mahnte mnd. mande, "Wiesenstreifen, Grenzstreifen"; nnd. Mânte,<br />
"schmaler Grasstreif zwischen zwei Fel<strong>der</strong>n und die dadurch<br />
gebildete Grenzscheide"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 560; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 145<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136<br />
Stand: 24.10.2010 57
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
maker Macher, Verfertiger, Erzeuger, Anstifter, Urheber; makerê:<br />
Macherei, Fabrikation, z. B. schô-makerê<br />
Mark Mark, abgegrenztes Landteil; "Bezirk als gemeinschaftliches<br />
Eigenthum einer Gemeinde"; Feld- o<strong>der</strong> Dorf-Mark<br />
Markt nnd. market, markt; "Markt als Platz, Ort od. Stelle und auch<br />
als Tag od. Zeit wo Handel stattfindet"<br />
Marsch "<strong>der</strong> die hohe Geest umgebene, früher vor dem Bestehen <strong>der</strong><br />
Deiche von den Meeresfluten oft überströmte, durch<br />
Meeresanwuchs entstandene u. aus fruchtbarem u. fettem<br />
Kleiboden bestehende Küstenstrich"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 564<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 576<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 578; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 81<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 580; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 146<br />
Matt "Landmaß, jetzt weniger als ein <strong>Die</strong>math" Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 147<br />
Meede (1) Plural: Meeden; "Grasebenen zwischen Geest und Marsch mit<br />
dünner Kleidecke auf Nie<strong>der</strong>moor. Zum Mähen bestimmtes<br />
Wiesenland. Auch Wiesen bzw. das darauf wachsende Gras<br />
werden Meeden genannt."<br />
Meede (2) afries. mede, Heuland; eine Wiese, die nur zum Mähen<br />
bestimmt ist; "auch Bezeichnung für anmoorige<br />
Übergangsgebiete zwischen Marsch und Geest und für<br />
Feuchtwiesen"<br />
Meedje Meetje, Metje 1. "bei aus mehreren Teilen bestehenden Wiesen o<strong>der</strong> Fel<strong>der</strong>n<br />
die Bezeichnung für einen solchen Teil (von einer Breite von<br />
etwa 30 - 35 Schritt)"; 2. kleine Mede<br />
Meeland Mehland,<br />
Mehe<br />
Meene Meente,<br />
Meine, Meinte<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 58<br />
585<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
586<br />
Mählande: Land, das <strong>zur</strong> Heuernte bestimmt ist Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 560; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
nnd. Meene, "Gemeinheit, gemeiner Grund und Boden"; nnd.<br />
Meinte, "das Gemeinegut, nam. <strong>der</strong> gesammte Grundbesitz an<br />
Äckern, Weiden, Ängern und Forsten, welche einer ganzen<br />
Gemeine gehören"<br />
1996, S. 145<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Meer nie<strong>der</strong>d. meer, Land- o<strong>der</strong> Binnen-See, stehendes Wasser im<br />
Gegensatz zu sê (Weltmeer, flutendes Wasser); aber auch:<br />
Sumpf, Moor; Hinweis auf einen verlandeten o<strong>der</strong> trocken<br />
gelegten See; Plural: Meerten<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
592<br />
Mehde Heuland; eine Wiese, die nur zum Mähen bestimmt ist Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 585; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Meier mnd. meyer, "Pächter eines Landbesitzes o<strong>der</strong> mehrerer<br />
Güter/Hufen"; "Verwalter eines kirchlichen Landbesitzes";<br />
"Verwalter o<strong>der</strong> Pächter eines städtischen Landgutes";<br />
nnd./nhd. Meier, "Pächter", "Inhaber eines Meierhofes"<br />
Melk nnd. Melk, Milch; "Hinweis auf eine Milchstelle, einen Melkplatz<br />
in <strong>der</strong> Allmende (die Kühe wurden früher während des<br />
täglichen Weideumtriebs draußen gemolken) o<strong>der</strong> auf einen<br />
dorthin führenden Weg"<br />
Mergel "Mergel, ein Gemenge aus Kalk und Ton, wurde wie Kalk <strong>zur</strong><br />
Bodenverbesserung verwandt. Gruben, in denen Mergel<br />
gewonnen wurde, sind in Norddeutschland bereits aus dem<br />
Frühmittelalter bekannt. <strong>Die</strong> hiervon abgeleiteten FlN geben<br />
die Stellen an, an denen dieses Material abgebaut wurde."<br />
Meß nnd. Meß, Mest, "Dünger, Mist"; "Hinweis auf morastiges<br />
Flurstück o<strong>der</strong>, mit GW [Grundwort] "-weg", auf den Weg, auf<br />
dem <strong>der</strong> Mist auf die Fel<strong>der</strong> gefahren wurde."<br />
middel "Middel- kennzeichnet als FlN-Bestandteil die Lage von<br />
Flurteilen zwischen zweien o<strong>der</strong> mehreren gleichartigen<br />
an<strong>der</strong>en, die eine Identifizierung über die Mittelposition von<br />
Parzellen ermöglichen. Da die Verhältnisse sich im Laufe <strong>der</strong><br />
Zeit wandeln können, ist die Mittellage heute oft nicht mehr zu<br />
erkennen."<br />
Mißgunst nnd. misgünst, misgünnen; "günnen": gönnen, gestatten,<br />
gewähren, erlauben; Gunst: ein Weg, den zu benutzen<br />
gestattet ist; "Mißgunst": ein Weg, <strong>der</strong> nicht benutzt werden<br />
darf<br />
Modde mnd. moode, modde, mudde, "faulen<strong>der</strong> Schlamm, Mod<strong>der</strong>, in<br />
stehendem Wasser abgesetzter Dreck"; nnd. Mode, Mude,<br />
"<strong>der</strong> aus Flüssigkeiten erfolgende Nie<strong>der</strong>schlag, <strong>der</strong> Schlamm"<br />
1996, S. 147<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 136<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 201<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 209-210<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 707, 708, Bd. 2, S. 607; Duden<br />
„Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim<br />
1989, S. 240<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Stand: 24.10.2010 59
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Möh abgeleitet von "möme", Tante; Bezeichnung für eine ältere<br />
Frau o<strong>der</strong> eine weibliche Respektsperson; auch als Anhängsel<br />
an den Namen gebraucht: "Antjemöh"<br />
Möhl "Außer im Namen "Mühlenteich" bezeichnet das Wort … immer<br />
durch Windkraft angetriebene Mühlen. <strong>Die</strong>se waren bzw. sind<br />
nicht nur Korn-, son<strong>der</strong>n auch "Wassermühlen", d. h. Mühlen,<br />
die zum Antrieb von Wasserschöpfwerken dienen bzw.<br />
dienten."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 614; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 151<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 270<br />
Mohr Moor Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 615; Brockhaus - die Enzyklopädie in<br />
vierundzwanzig Bänden, 20. Auflage, 1796 - 1996<br />
Mönk Münk Mönch; Hinweis "auf ein ehemaliges Kloster o<strong>der</strong> eine damit<br />
zusammenhängende Ansiedlung"<br />
Moor (1) Altes Grundwort in Namen von Dörfern, die während <strong>der</strong><br />
Kulturperiode <strong>der</strong> Flachmoore entstanden sind. <strong>Die</strong><br />
Flachmoore bildeten sich, nachdem es durch die Senkung des<br />
Meeresspiegels auch zu einer Senkung des<br />
Grundwasserspiegels kam.<br />
Moor (2) In "Oll Moor, Olle Moor" hat "Moor" die Bedeutung von<br />
"Wiesenmoor" (in Gemeinbesitz); ebenso in Ortsnamen wie<br />
"Bakemoor, Breinermoor".<br />
Mööre Moer, Moert,<br />
Möört, Möörte,<br />
Mörte, Mörke<br />
nie<strong>der</strong>l. moer, Moor, Morast, Sumpf, Torfmoor; Plural:<br />
Moerken, Moerten<br />
Morgen nnd. Morgen; ahd. morgen, Morgen, altes Landmaß (120<br />
Ruthen); "urspr. die Arbeit eines Morgens o<strong>der</strong> Vormittags bz.<br />
das, was an einem Morgen o<strong>der</strong> Vormittag bepflügt o<strong>der</strong><br />
beackert werden kann"<br />
Moß mnd. mos, nnd. Mos, Mus, Müs, "Moos"; "Hinweis auf<br />
sumpfiges, morastiges Gelände"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 269<br />
Schöneboom, A., Woher hat Stapelmoor seinen Namen? <strong>Die</strong> Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Ortsnamen Stapel, Stapelstein, Stapelmoor, in: Der Deichwart, 1969,<br />
3<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 615<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 60<br />
615<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Mucke mnd. mucken, "getrocknete (grössere) Rasen, Plaggen zum<br />
Brennen"; nnd. Mucken, "brennbare Heideschollen";<br />
"Heideplaggen, die als Streu im Viehstall verwendet wurden"<br />
Mudde mnd. moode, modde, mudde, "faulen<strong>der</strong> Schlamm, Mod<strong>der</strong>, in<br />
stehendem Wasser abgesetzter Dreck"; nnd. Mode, Mude,<br />
"<strong>der</strong> aus Flüssigkeiten erfolgende Nie<strong>der</strong>schlag, <strong>der</strong> Schlamm"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Müggen Plaggen Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Muhde Mündung, Wasserdurchlass od. Wasserausfluss, Hafen<br />
(Weener); "(= Mündung) in Ostfriesland gebräuchliche<br />
Bezeichnung für das Außentief"<br />
Mull (1) nnd. Mull, Müll; Mull, lockere, lose, trockene Erde; fein<br />
zerriebener Rückstand von Torf ; feine Torferde<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 270;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 621<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
625<br />
Mull (2) nnd. Mull, Müll; Kehricht, Müll Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
625<br />
Münte (1) Münze; nnd. münten, münzen, Geld prägen Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 630<br />
Münte (2) gleichbedeutend mit "Mönke" Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 178<br />
Murkel Mur =Moor; ke ist die Verkleinerungssilbe; loh = Gesträuch;<br />
"ein kleines Moorstück mit Strauch und Baum"<br />
Nacht nnd. Nacht, "Nacht"; "Hinweis auf die früher gesetzlich<br />
vorgeschriebene Nachtweide für Pferde"<br />
Schöneboom, A., Geestdorf Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten<br />
Namen, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-35<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Stand: 24.10.2010 61
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Neck Vorsprung; Krümmung, Biegung Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 637, 657<br />
ne<strong>der</strong> nedden mnd. nee<strong>der</strong>, nnd. ne<strong>der</strong>, neer, "niedrig, niedrig gelegen" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
nee mnd. nоe, nige, nigge, neye, nоwe, nnd. nie, nee, "neu";<br />
"kennzeichnet einen flurgeschichtlich o<strong>der</strong> besitzgeschichtlich<br />
jüngeren Zustand gegenüber einem älteren"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
neer mnd. nee<strong>der</strong>, nnd. ne<strong>der</strong>, neer, "niedrig, niedrig gelegen" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 137<br />
Nelle "Bezeichnung für kleinere, runde Erhebungen" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 219<br />
Nesse Halbinsel, Vorsprung, Landzunge, vorragende Landecke Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
649<br />
Noord Norden, nördliche Himmelsrichtung Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 660, 661<br />
Nücke Bergspitze, Bergknollen, Hügel; Spitze, Nacken, Krümmung,<br />
Vorsprung; äußerstes Ende<br />
Nüst (1) Nesse, "die in Form einer Nase in eine Wasserfläche ...<br />
vorstoßende Landspitze"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 664, 657 (siehe unter: nokke, nok);<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 161<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Nüst (2) Nest, Lager, Lagerplatz Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 667<br />
Stand: 24.10.2010 62
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Oefer Ufer; Reede; Uferstelle, an <strong>der</strong> Schiffe anlegen können Schöneboom, A., Plettenbarch und Hleri / Der Berg und die Stadt,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1963) 4, 5, 6<br />
Ohl ahd. odel, sumpfig; auch: ahl, ehl, uhl; Ohling: Nasswiese Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Ohm Oheim, Onkel; "Anrede od. Namens- od. Standes-Anhängsel<br />
bz. ehrende Bezeichnung bejahrter od. angesehener<br />
männlicher Personen"; z. B. Gerdôm<br />
Oken (1) mnd. ôke, "Raum unter <strong>der</strong> Dachschräge, Abseite im<br />
Dachboden"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, 682; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 91<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
Oken (2) mnd. ôke, "spitzwinkliges Landstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
olt (1) mnd. oolt, olt, nnd. oolt, olt, alt; "einen alten Zustand<br />
repräsentierend, schon lange genutzt"<br />
olt (2) mnd. oolt, olt, nnd. oolt, olt, alt; "ehemalig, nicht mehr<br />
vorhanden, nicht mehr in Funktion"<br />
oog nie<strong>der</strong>d. ôg, oge, Insel; aber auch: "Bezeichnung für einen Ort<br />
am Wasser (z. B. Nord-oog)"; "Fluss- od. Sumpfinsel;<br />
wasserreiches Wiesenland"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 271;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 677, 678<br />
Oort (1) Ort, Orth Ort, Gegend, Richtung, Seite, Stelle; Spitze, Ecke Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138; Schöneboom, A., Der Ortsname<br />
Ihren - ein westgermanisches Erzwort, in: Unser Ostfriesland, 1970, 14<br />
Oort (2) Hinweis auf Erz (Ortstein, "die eisenschüssige, rotbraun<br />
verfärbte Sandbodenschicht erschwert die Kultivierung des<br />
Bodens")<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138; Schöneboom, A., Der Ortsname<br />
Ihren - ein westgermanisches Erzwort, in: Unser Ostfriesland, 1970, 14<br />
Stand: 24.10.2010 63
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Oort (3) "<strong>der</strong> vierte Teil eines Ganzen und zwar speziell des als<br />
Flüssigkeitsmaß dienenden Kruges o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kanne…o<strong>der</strong><br />
einer größeren Münze";<br />
Oort (4) "Ein Orth o<strong>der</strong> Oort als Flurname ist also die Bezeichnung für<br />
eine Ackerfläche von einem Eimer Einsaat (ein halber<br />
Morgen), für die seinerzeit ein Orth (= ¼ Reichstaler) als<br />
Steuer zu entrichten war."<br />
Oortje "Oortje ist die Bezeichnung für eine Münze, die den Wert eines<br />
Viertels vom Stüber hat.<br />
Oortje als Flurname müßte analog die Bezeichnung für eine<br />
Fläche sein, für die ein Oortje zu entrichten wäre."<br />
Opper mnd. opper, "Opfergabe, Kirchenspende"; nnd. Opper, "Opfer,<br />
jede für eine kirchliche Handlung gegebene Gabe"; "Hinweis<br />
auf Besitz des Küsters (mnd. opperman, nnd. Oppermann)<br />
bzw. <strong>der</strong> Küsterei (mnd. opperоe)"<br />
Osse mnd. osse, nnd. Osse, "Ochse"; "Hinweis auf die Weide für<br />
den Gemeindebullen"; "Ossensett" o<strong>der</strong> "Osshage": Hinweis<br />
auf Ochsenzucht<br />
Ost (1) Oster mnd. ôstern, nnd. Ostern, "Ostern"; "Zusammenhänge mit<br />
Osterbrauchtum"<br />
Ost (2) mnd. Ôster, "östlich, im Osten gelegen"; nnd. Oster, "nach<br />
Osten gelegen"; "Gibt die relative Lage eines Flurstücks an,<br />
Bezugspunkt häufig das Dorf."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 686<br />
Schumacher, Heinrich<br />
Schumacher, Heinrich<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138; Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong><br />
Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund,<br />
1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 138<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139<br />
Otter 1. Otter, Fischotter 2. Schlange, Kreuzotter, Natter Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 692; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 485<br />
Ovelgönne Der Name Övelgönne, <strong>der</strong> häufig etwas abweichend<br />
geschrieben wird und auch in an<strong>der</strong>en Gegenden vorkommt,<br />
wird unterschiedlich gedeutet: Vielfach wird er als „üble Gunst“<br />
ausgelegt, da die Län<strong>der</strong>eien Missgunst, Neid o<strong>der</strong> Hass<br />
hervorriefen. Er wird aber auch mit "ungünstig, drüben,<br />
jenseitig, kalt, außerhalb <strong>der</strong> Gemeinschaft gelegener Besitz,"<br />
gedeutet.<br />
Schiller, Carl/Lübben, August; Mittelnie<strong>der</strong>deutsches Wörterbuch, Bremen<br />
1875-1880, Bd. 3, S. 248; Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis<br />
Zwischenmooren. <strong>Die</strong> Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer<br />
2004, S. 176<br />
Stand: 24.10.2010 64
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Padd Padt, Patt Pfad, Fussweg Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 692; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 94<br />
Page mnd. paage, "Pferd"; nnd. Page, "Pferd, im beson<strong>der</strong>en altes,<br />
abgetriebenes Pferd, Hengst"<br />
Pahl Pfahl; im übertragenen Sinn auch: Ziel o<strong>der</strong> Grenze;<br />
Rutenpfahl, Schandpfahl = Pranger<br />
Paller Palland,<br />
Pallert<br />
lat. palus, nnd. Paller, Pallert, Pollert, "Sumpf; sumpfige, schon<br />
mit Gras bewachsene Nie<strong>der</strong>ung"<br />
Pand (1) Pfand "Stück, Teil, Anteil, Strecke eines Weges, Deiches, Grabens<br />
etc., zu dessen Instandhaltung eine bestimmte Person<br />
verpflichtet ist"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 696; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 525<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 65<br />
697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
699<br />
Pand (2) "Maß beim Torfgraben: 1400 Torfsoden = ein Pand" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 699<br />
Pann Pfanne, flaches Gefäß; Pannog: wasserreiches Wiesenland<br />
(Senke, Nie<strong>der</strong>ung), das "hohlgebogen" wie eine Pfanne ist<br />
Panne "Dachziegel, -pfanne"; in Benennungen von Landstücken, auf<br />
denen Ziegel im Feldbrandverfahren hergestellt wurden<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 700; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 172<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 231-232<br />
Pannkook "metaphorische Bezeichnung für morastigen Boden" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 232<br />
Pape afries. papa, Pfaffe, Pfarrer; "Hinweis auf <strong>zur</strong> Pfarre gehörigen<br />
Besitz"; papen-tjüche: "Name einzelner hiesiger Plätze u.<br />
Landgüter (z. B. bei Uttum) u. ehemaliger Klosterlande, wo das<br />
Vieh <strong>der</strong> Geistlichen aufgezogen u. geweidet wurde."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
701
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Parcell frz. parcelle, Parzelle, "vermessenes Grundstück" Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache,<br />
Mannheim 1989, S. 494<br />
Paul in einigen Flurnamen möglicherweise von "pôl" abgeleitet:<br />
wfries. Poalle, Sumpf; "Vertiefung, in <strong>der</strong> sich Wasser<br />
gesammelt hat"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 708, 744<br />
Pedd Pette mnd. pedde, Kröte; Hinweis auf ein nasses Landstück Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 237<br />
Piepe Röhre zum Durchlassen von Wasser; <strong>zur</strong> Entwässerung Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 719, 720<br />
pil nach Bahlow: vorgermanisch pil, pel, Sumpf; afries. pilkrütt,<br />
Knöterich<br />
Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Plaats Platz, Stelle, Raum, Ort, Wohnort, Bauernhof Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 720<br />
Plack Plack mnd. placke, "Stück e. Ganzen, Lappen, Fetzen"; nnd.<br />
Plack(en), "ein kleinerer Theil einer größeren Bodenfläche, ein<br />
kleines Stück"<br />
Plagge mnd. plagge, "platter, dünner Rasen, Moor- o<strong>der</strong> Heidescholle,<br />
hauptsächlich zum Brennen o<strong>der</strong> Düngen gebraucht"; nnd.<br />
Plagge, "Rasen-Sode od. ein flaches u. verhältnismässig<br />
dünnes, in <strong>der</strong> Regel vierkantiges Stück ausgestochenen<br />
Rasens"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139<br />
Plate nhd. Platte, "kahle Bodenfläche"; abgeholzter Hügel Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
platt mnd. plat, "ganz flach, eben, nicht erhaben: von geringerer<br />
Höhe als üblich; hingestreckt, ausgebreitet"<br />
Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 4, Bielefeld 2006,<br />
S. 513<br />
Stand: 24.10.2010 66
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Pogge mnd. pogge, nnd. Pogge, "Frosch" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Pol<strong>der</strong> (1) Poller nnd. Poller, Pol<strong>der</strong>; "angeschlammtes Marschland, welches<br />
ringsum mit einem Deich umgeben ist od. ein vor dem<br />
Hauptdeich liegen<strong>der</strong> Strich neu eingedeichten Landes,<br />
welcher durch Anschlickung entstand und vor <strong>der</strong> Eindeichung<br />
„heller“ heisst"<br />
Stand: 24.10.2010 67<br />
742<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Pol<strong>der</strong> (2) "Im Binnenland etwa = „niedriges, sumpfiges Gelände““ Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Poll Pull erhöhtes Stück Land; kleiner Hügel; "buckelartige Erhebung" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 549<br />
Pollert Pallert, "Sumpf; sumpfige, schon mit Gras bewachsene<br />
Nie<strong>der</strong>ung"<br />
Pool Poel, Pohl Sumpf, stehendes Wasser; pôl-acht: "ein Entwässerungs-<br />
Verband od. Entwässerungs-Bezirk, … welchem die Sorge <strong>der</strong><br />
Abwässerung … obliegt, u. die Kosten <strong>der</strong>selben gemeinsam<br />
zu tragen hat"<br />
Post (1) Pfosten; dicke, starke Planke, die als Steg benutzt wird; dreipost:<br />
drehbare Bohle über einen Graben<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 139, 140<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 744, 745<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 747<br />
Post (2) Stelle, Standort, Platz; auch: zugewiesenes Amt Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 747<br />
Post (3) "in Namen für alte Poststraßen, -wege bzw. für Flurstücke, die<br />
an solchen liegen"<br />
Pott Topf; "Pott" hat in vielen Flurnamen die Bedeutung von<br />
"dobbe" o<strong>der</strong> "dob "(Grube, Loch, Vertiefung, Sumpf)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 749, Bd. 1, S. 302
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Priel nie<strong>der</strong>l. priel 1. "Wasserrinne auf dem Watt, die auch während<br />
<strong>der</strong> Ebbe Wasser führt" 2. "nasse sumpfige Stelle auf dem<br />
Watt"; Sumpf; "wasserreiches, sumpfiges mit Gras<br />
bewachsenes Land"; "mit Gebüsch bewachsene Sumpfwiese"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
758<br />
Pudde nnd. Pudde, Purde, Purre, "Kröte" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Pump nnd. Pump, "Pfütze, Tümpel, Wasserloch; Sumpf" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Pütt (1) künstl. Brunnen; gegrabenes Loch, Grube, Schacht Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 779<br />
Pütt (2) "längl. Grube am Deich, aus <strong>der</strong> Erde für den Deichbau<br />
entnommen wird"; "Grube im Moor, aus welcher Torf gegraben<br />
wird"<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 185<br />
Pütt (3) Maß bei Erdarbeiten: "1 Ruthe lang u. breit u. 4 Fuss tief" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 779<br />
Quabben nnd. Kwabbe, Kwab, "weiche sumpfige od. morastige Stelle im<br />
Lande, wo man entwe<strong>der</strong> leicht einsinkt, od. diese in eine<br />
zitternde Bewegung geräth, wenn in <strong>der</strong> Nähe ein Druck od.<br />
Stoss etc. stattfindet"<br />
quard quard = (afries.) wurth = wirde: "erhöhtes, gegen<br />
Ueberschwemmungen geschütztes Land, sei es als sandige<br />
Anhöhe in Sümpfen u. Nie<strong>der</strong>ungen, od. als erhöhtes Ufer an<br />
Flüssen u. am Meere, od. als Bezeichnung von Flussinseln"<br />
Queller 1. nnd. Kweller, Kwel<strong>der</strong>, "<strong>der</strong> Meeres-Anwuchs od. das<br />
Aussendeichsland, was sich durch den Nie<strong>der</strong>schlag des<br />
Schlickes allmälig erhöht u. aus dem Meere emporhebt" 2.<br />
"das auf dem "Queller" wachsende Gras"<br />
Queracker auf beiden Seiten vor den Ackerstreifen liegen<strong>der</strong> Acker, <strong>der</strong><br />
als Wendeacker dient, auch Blockacker o<strong>der</strong> Blöke genannt;<br />
verbindet die einzelnen Ackerstreifen<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 141<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 528 (siehe unter: Lôkward, Lôquard), Bd.<br />
3, S. 559 (siehe unter: Wirde)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 141; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S.<br />
Stand: 24.10.2010 68<br />
442<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Rack Rick nie<strong>der</strong>l. rak, "längere gerade Strecke eines Weges, Kanals,<br />
Fahrwassers etc."; "Strecke von einer Flussbiegung bis <strong>zur</strong><br />
nächsten"; "Abschnitt eines Straßen- o<strong>der</strong> Wasserzuges, <strong>der</strong> in<br />
einer Richtung verläuft"<br />
Rad In Bezeichnungen wie "Radstock" Hinweis auf eine Stätte, auf<br />
<strong>der</strong> zum Tode Verurteilte durch das Rä<strong>der</strong>n hingerichtet<br />
wurden.<br />
Radbod fries. König, gest. 719; von Pippin dem Mittleren 689 bei<br />
Dorestad besiegt; Folgen: Vereinigung Westfrieslands mit dem<br />
Frankenreich; Christianisierung <strong>der</strong> Friesen, ausgehend von<br />
dem neu gegründeten Bistum Utrecht und dem Kloster<br />
Echternach<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 6; Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen<br />
<strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 251<br />
Brockhaus - die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden, 20. Auflage,<br />
1796 - 1996<br />
Radde Bezeichnung für ein fließendes Gewässer Ahlrichs, Richard, <strong>Die</strong> Wasserläufe Ostfrieslands im Volksmund. Was<br />
Bezeichnungen wie Jümme, Sichter o<strong>der</strong> Delft bedeuten, in: Heimat am<br />
Meer, 1988, 10<br />
Rah Rott; mnd. rot, raat, "Rodeland, <strong>zur</strong> Ausrodung bestimmtes<br />
o<strong>der</strong> bereits gerodetes Waldland, Neubruch"; nnd. Rott,<br />
"Rodeland"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 140<br />
Rahe "Rodung, gerodetes Land" Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Rajen Raj, Raje Strich, Furche; kleiner, durch das Moor gezogener Kanal o<strong>der</strong><br />
Graben<br />
Rege mnd. rêge, "Reihe, Reihenfolge, Ordnung; Reihe Häuser o<strong>der</strong><br />
Buden, Strasse"; nnd. Rege, Riege, "Reihe"<br />
Regen z. B. in "Regenfenne"; "<strong>Die</strong> Gewanne waren früher durch<br />
Baumreihen abgegrenzt, die die Bezeichnung "Regten, Regen,<br />
Regenten" führten."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 6; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 104<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 141<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Reide Rohr, Schilf, Rieth; Sumpfland Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 24 (siehe unter: Rei<strong>der</strong>land), S. 38<br />
Stand: 24.10.2010 69
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Reihe mnd. rоge, "Reihe, Ordnung; Häuserreihe, Seite einer Straße";<br />
Hinweis auf eine (Deich-) Reihensiedlung<br />
Reit nnd. Reit, "eigentlich Rinnsal, meint heute gewöhnlich das<br />
ganze betreffende Gelände"<br />
Reke mnd. reke, "die im freien Felde sich hinziehende lebendige<br />
(Dorn)hecke; niedriges Gebüsch"; nnd. Reke, Recke, "die im<br />
freien Felde sich hinziehende lebendige Hecke. Der an einer<br />
solchen Hecke sich hinziehende schmale Rasenstreif."<br />
Renne mnd. renne, ronne, "Rinne, Wasserröhre, Dachtraufe, Gosse,<br />
Rinnstein"; nnd. Renne, "Rinne, kleiner Wassergraben,<br />
Rinnsal"<br />
Rennel nnd. Rennel, "kleines fließendes Gewässer, kleiner Bach,<br />
Rinnsal"<br />
rhaude wahrscheinlich auf die ältere Flurbezeichnung "Rawede" o<strong>der</strong><br />
"Rawide" <strong>zur</strong>ückgehend; "Ra" bedeutet als Verkürzung von<br />
"Ro" Rodung, "Wide" bedeutet "Wald". "Rhaude": "Stätte im<br />
gerodeten Wald"<br />
Richt mnd. richten, rechten, richten, gerade machen; Richtweg: <strong>der</strong><br />
gerade o<strong>der</strong> richtige Weg, <strong>der</strong> kürzeste Weg<br />
Riede Riete mnd. ride, rоe, rige, "Bach, kleiner Wasserlauf, Graben"; nnd.<br />
Riede, Riehe, "kleiner Wasserlauf, Rinnsal, sowie die von ihm<br />
durchflossene Nie<strong>der</strong>ung."<br />
Rieg (1) Riege mnd. rоge, "Reihe, Ordnung; Häuserreihe, Seite einer Straße";<br />
Hinweis auf eine (Deich-) Reihensiedlung<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 272;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 38<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 141<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 141<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
Stand: 24.10.2010 70<br />
30<br />
Engelkes, Gustav, Rowide, rigolen und rayen. Vom Ursprung einiger<br />
Namen und Bezeichnungen im heimatlichen Rhau<strong>der</strong>fehn, in: Friesische<br />
Blätter, 1987, 2<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 34<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 272<br />
Rieg (2) Riege = Riede, Rinnsal, kleiner Wasserzug Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Neumünster 2000, Bd. 2, S. 551
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Riek afries. rоk, rоke, Reich, beherrschtes Land, Herrschaftsgebiet;<br />
Himmelriek = Himmelreich, wird auch als Bezeichnung für<br />
"Hammrich" verwendet<br />
Riem 1. "Rand, Grenze, Küste" 2. aengl. rime, Rand, Ring; "(auf den<br />
hiesigen Inseln) Wall o<strong>der</strong> Walleinfassung"; "Ein- u.<br />
Umfassung eines Grundstücks"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 39; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 559<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 272;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 40<br />
rien Rand, Kante, Rain; Grenze Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 41<br />
Riepe Rand, Ufer, Uferrand; Riepe: Ort auf dem Rand <strong>der</strong> Geest;<br />
Reepsholt: früher "Ripes-holt", auf <strong>der</strong> hohen Geest, am<br />
östlichen Rand des dortigen Hochmoores gelegen<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 43; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 200<br />
Ring Ring, Kreis; Bezirk Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 42<br />
Risch mnd. risch, "Schilf, Sumpf-Binse"; nnd. Risch, Rusch, "Binse,<br />
Schilf"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
riß afries. riis, ris, rise, "Busch, Gestrüpp, Reiser" Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Rode Rott, mnd. rot, raat, "Rodeland, <strong>zur</strong> Ausrodung bestimmtes<br />
o<strong>der</strong> bereits gerodetes Waldland, Neubruch"; nnd. Rott,<br />
"Rodeland"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
Rohr mnd. rôr, "Rohr, Schilf; Röhricht"; nnd. Rohr, "Rohr" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
roll nnd. rullen, rollen; Rollbaum: Rullboom, drehbares Gattertor<br />
als Verschluss eines Weges o<strong>der</strong> einer Trift<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 66, 67; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 109<br />
Stand: 24.10.2010 71
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
rook nie<strong>der</strong>l. rook, Rauch, Qualm; rookstall: "ein Stall o<strong>der</strong> ein Platz,<br />
von dem Rauch aufsteigt, Rauchstall"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 188;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 50<br />
Ros afries. hors, hars, hers, Ross Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
rot 1. rot, glänzend, glühend, feurig 2. roter Lehm o<strong>der</strong> Ton;<br />
Erdfarbe (Eisenortstein)<br />
Röte mnd. rote, rate, "das Verrotten, die Fäulnis"; nnd. Rote, Rate,<br />
Raute, "Grube zum Flachsrösten, Rößegrube"<br />
Rott (1) mnd. rot, raat, "Rodeland, <strong>zur</strong> Ausrodung bestimmtes o<strong>der</strong><br />
bereits gerodetes Waldland, Neubruch"; nnd. Rott, "Rodeland"<br />
Rott (2) (selten auch: rot); nie<strong>der</strong>d. rott, Abteilung, Bezirk, Quartier<br />
einer Stadt o<strong>der</strong> Bezirk auf dem Lande<br />
Rott (3) Namen mit "Rott-" können auch auf Flachs- u.<br />
Leinenherstellung hindeuten.<br />
Rötten "Das Rötten ist <strong>der</strong> Gärungsprozeß, dem <strong>der</strong> Flachs <strong>zur</strong><br />
Säuberung seiner Fasern von dem einhüllenden Krautgewebe<br />
in <strong>der</strong> sog. Röttkuhle unterworfen wurde."<br />
Ruge 1. Rauhe, Rauhigkeit, rauhe Seite 2. Rauhgras, Hartgras,<br />
Altgras<br />
Rügg mhd. rügge, Rücken, Rückgrat; Bergkuppe, Bergrücken;<br />
"schmale, langgestreckte Erhebung, Höhenrücken"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 47; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 226 (siehe unter: Schmink)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 142<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 56<br />
Lüpkes, W., Über ostfriesische Meerten, in: Blätter des Vereins für<br />
Heimatschutz und Heimatsgeschichte, 1931, 17<br />
Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 64; Friedrichsen, Hans, Friesische Orts-<br />
und Flurnamen, in: Heimat am Meer, 1884, 9<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
64<br />
Stand: 24.10.2010 72
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
rull rollen; rul-bôm: "Rollbaum, drehbares Gattertor als Verschluss<br />
eines Weges o<strong>der</strong> einer Trift"; rul-fôrde: "drehbarer Verschluss,<br />
drehbares Heck, drehbare Pforte"<br />
Rüme zu nnd. Ruum, "das freie Feld"; "von Gebüsch gereinigte<br />
(ausgeräumte) <strong>zur</strong> Wiese umgewandelte Fläche"<br />
Runge Wasserlauf; auf "Running", einer Ableitung <strong>der</strong> Sprachwurzel<br />
run, rinnen <strong>zur</strong>ückgehend<br />
Rüsch mnd. risch, "Schilf, Sumpf-Binse"; nnd. Risch, Rusch, "Binse,<br />
Schilf"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 66, 67; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 109<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Rüsk nie<strong>der</strong>d. rusch, Binse Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 75<br />
Rüter nhd. Reuter, "berittener Soldat"; "Hinweis auf jenen Teil <strong>der</strong><br />
Allmende, von dessen Ertrag <strong>der</strong> Unterhalt <strong>der</strong> Kavallerie-<br />
Pferde zu bestreiten war, die (samt <strong>der</strong> Mannschaft) als<br />
Einquartierung in den Dörfern standen."<br />
Saal mnd. sol, sool, saal, "stehendes Gewässer, Teich, Tümpel";<br />
soole, "morastige Stelle, Nie<strong>der</strong>ung"<br />
saar Schmerz, Verletzung, Wunde; sâr-dîk: "Land, was zum Zweck<br />
d. Verstärkung u. Ausbesserung eines Deiches ausgegraben<br />
ist u. zu einem kolk gemacht wurde…für den Besitzer<br />
werthlos…ist - dîk…im Sinn von Teich od. ausgegrabenes<br />
Land"<br />
Saat Kornsaat o<strong>der</strong> Baumsaat, um die durch Raubwirtschaft<br />
entstandene Holzarmut zu verringern.<br />
Sand mnd. sant, "sandige Fläche, Gegend"; nnd. Sand, "Sand"; "Als<br />
Simplex = "sandiges Flurstück", als BW [Bedeutungswort]<br />
entwe<strong>der</strong> Hinweis auf Bodenbeschaffenheit o<strong>der</strong> auf<br />
Sandabbau."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 85; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 208<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Stand: 24.10.2010 73
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
sath mnd. sât, nnd. sate, Stelle, Wohnstelle, Nie<strong>der</strong>lassung,<br />
Wohnort<br />
Sautel möglicherweise entstanden aus afries. sûth-dêl, "Südteil,<br />
Süden"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 86<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 193<br />
Schaaf (1) Schaap Schaf Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 99; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 210<br />
Schaaf (2) alte Münze: 10 Schaap = 1 ostfr. Gulden Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 99; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Schaar mnd. schore, schare, Küste, Vorland, "das an <strong>der</strong> Außenseite<br />
des Deiches angeschwemmte Land"; "abschüssige Gegend",<br />
Schanze mnd. schanse, "Reisigbündel, Faschine; durch korbartiges<br />
Geflecht haltbar gemachte Befestigung aus aufgeworfener<br />
Erde"; nnd. Schanze, "Schanze"; "Hinweis auf (ehemaligen)<br />
Verteidigungswall."<br />
Schap Schrank; "Verflechtung", Gitter, Einfriedigung;<br />
Bedeutungswandel zu "Schrank" erst in spätmhd. Zeit<br />
1996, S. 210<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 555<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 99; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 621<br />
schar (1) mnd. schar, "steil abfallend, abschüssig" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Schar (2) mnd. Schaar, "Uferrand, Böschung" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
scharp (1) scharf; mnd. Scharp, "in eine Spitze auslaufend" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143; Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong><br />
Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund,<br />
1955, S. 47-53<br />
Stand: 24.10.2010 74
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
scharp (2) "mit magerem Sandgrund" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143; Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong><br />
Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund,<br />
Schatt afries, sket, schet, schat, Schatz, Geld, Vermögen; Abgabe,<br />
Steuer, Tribut; Vieh; Schatthaus: "Viehhaus, in dem die ostfr.<br />
Häuptlinge ihr Vieh unter <strong>der</strong> Aufsicht eines Voigts hielten u.<br />
die Milchwirtschaft durch eine meierske besorgen ließen."<br />
scheef mnd. schêf, "schief, gekrümmt; schräg; verwachsen,<br />
mißgestaltet"; Hinweis auf eine "Hanglage des Geländes" o<strong>der</strong><br />
auf einen "unregelmäßigen Zuschnitt <strong>der</strong> Parzelle"<br />
1955, S. 47-53<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 101, 102; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 214<br />
Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 3, Bielefeld 2003,<br />
S. 387<br />
Scheer (1) "Scher" ist ein altes Ackermaß. Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 557<br />
Scheer (2) mnd. schêr, "Weide, Weidegerechtigkeit" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 557<br />
Scheide nnd. Schede, Schäi, "Scheide, Grenze" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Schild mnd. schilt, nnd. Schild, "Schild", "dreieckiges Flurstück" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 143<br />
Schill Hartteile von Muscheln o<strong>der</strong> Schnecken, die sich an <strong>der</strong> Küste<br />
abgelagert haben; <strong>zur</strong> Kalkgewinnung abgebaut<br />
Brockhaus - die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden, 20. Auflage,<br />
1796 - 1996<br />
Schlag (1) Slag mnd. slach, "Anteil an <strong>der</strong> Feldmark, Ackerschlag" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 145<br />
Schlag (2) "(Deichwesen:) einem Hofbesitzer <strong>zur</strong> Unterhaltung<br />
zugewiesenes Stück Deich, Deichfach"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 145<br />
Stand: 24.10.2010 75
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Schlag (3) nnd. Slag, "1) Größerer Komplex Landes; doch fast nur von<br />
Kulturland, und zwar, wenn die ganze Fläche nur eine Art<br />
Frucht trägt. 2) Unterteilung eines „Köppels“, die mit gleicher<br />
Frucht bebaut wird"; "In d. Dreifel<strong>der</strong>wirtschaft auch eines <strong>der</strong><br />
drei Fel<strong>der</strong>."<br />
Schlap Slap Schlaf, Ruhe; Slaperdiek: Schlafdeich; 1. Deich innerhalb <strong>der</strong><br />
See- o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Hauptdeiche <strong>zur</strong> Abhaltung des<br />
Binnenwassers; 2. Reservedeich, Sicherungsdeich hinter dem<br />
Hauptdeich gegen Sturmfluten; 3. ehemaliger Hauptdeich,<br />
Binnendeich<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 145<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 193; HWO<br />
Schlede Abhang; verwandt mit afries. slite, abtragen Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Schlei Abhang; verwandt mit afries. slite, abtragen Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Schleng "lang gestreckter Damm aus Pfählen, Busch- u. Flechtwerk an<br />
<strong>der</strong> Küste zum Auffangen von Dünensand, Schlamm od. <strong>zur</strong><br />
Brechung <strong>der</strong> Brandung"; Buhne<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 195; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 220<br />
Schleuse Schleuse; "Stauvorrichtung in fließenden Gewässern" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 218; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 610<br />
Schlipp Zipfel Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 203<br />
Schmink "blauer Klei (sehr fetter, weicher Ton; potklei), <strong>der</strong> in alten<br />
zugeschlämmten Gräben lagert und durch ‚Wühlen‘ auf die<br />
Oberfläche gebracht wird, um dem Land neue Fruchtbarkeit zu<br />
geben"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 230; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 226<br />
Schnepel mnd. sneppel, Zipfel, kleines Grundstück Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 198<br />
Stand: 24.10.2010 76
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Schoot afries. skât, schât, mnd. schôt, Schoß; urspr. Bedeutung: Zipfel<br />
eines Kleides, Rockschoß; Ecke, Zipfel<br />
Schott mnd. schutten, "'schützen, schirmen'; beson<strong>der</strong>s „fremdes<br />
Vieh, das Schaden tut, einsperren““; Das Vieh wurde so lange<br />
im "Schott" eingesperrt bis <strong>der</strong> Eigentümer die dafür erhobene<br />
Gebühr und den angerichteten Schaden bezahlt hatte.<br />
Schöttel Geröll, Feldstein(e); Schöttelkamp: Kamp mit vielen Steinen<br />
(vielleicht auf ein altes Gräberfeld hinweisend)<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 139<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 286<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
schrat mnd., nnd. schrât, "schräg" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
Schütt (1) Schutz; Vorrichtung aus Holz "zum Schutz u. <strong>zur</strong> Sicherheit<br />
gegen das Ein- u. Durchbrechen des Wassers bei<br />
Sturmfluthen"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 165; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 237<br />
Schütt (2) "Vorrichtung aus Holz zum Einsperren des Viehs" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 165; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Schwager abgeleitet von afries. swâch, Weideland; "Grasplatz, Viehplatz"<br />
(Ausdruck aus dem Bereich <strong>der</strong> mittelalterlichen<br />
Viehwirtschaft)<br />
Schwei Grasplatz, Viehplatz (Ausdruck aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
mittelalterlichen Viehwirtschaft)<br />
Schwoog "Grasplatz, Viehplatz" (Ausdruck aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
mittelalterlichen Viehwirtschaft)<br />
1996, S. 237<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 225; Ramm,<br />
Heinz, Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr. Naturschutz<br />
u. Landschaftspflege, Bd. 5 (1974), S. 55-56<br />
Ramm, Heinz, Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr.<br />
Naturschutz u. Landschaftspflege, Bd. 5 (1974), S. 55-56<br />
Ramm, Heinz, Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr.<br />
Naturschutz u. Landschaftspflege, Bd. 5 (1974), S. 55-56<br />
See Meer, Ozean Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 167; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 242<br />
Stand: 24.10.2010 77
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Segge mnd. segge, "Segge", nnd. Segge, "Riedgras, Sumpfgras,<br />
Schilf"<br />
Sett (1) "Setz- od. Lager-Platz, Nie<strong>der</strong>lage im Freien für Holz, Steine<br />
etc."<br />
Sett (2) "die gefriedigte Stelle in einem Stück Weideland, wo das Vieh<br />
gemolken wird od. <strong>der</strong> Platz, wo die milchenden [melkenden]<br />
Mädchen sich setzen"<br />
Sichter mnd. sichter, "Abflußrinne", "Grabendurchlass in Dämmen";<br />
"Bäche, die aus den Mooren kommen (Reiniger)"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 177; Scheuermann, Ulrich,<br />
Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und Regionalgeschichte,<br />
Melle 1995, S. 144<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
sied mnd. sît, side, niedrig; Hinweis auf niedrig gelegenes Land Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 560<br />
siede mnd. sît, sîde, "tief gelegen, unten, niedrig" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 291-292<br />
siegen mnd. sigen, "nie<strong>der</strong>sinken"; Hinweis auf tief gelegenes Land Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 292<br />
Siek mnd. sîk, "wasserhaltiger Grund, sumpfige Nie<strong>der</strong>ung,<br />
Tümpel"; nnd. Siek, "Siek, sumpfige Nie<strong>der</strong>ung, Pfuhl"; auch:<br />
"Bach"<br />
Siel Syhl, Syl "grössere od. kleinere mit Thüren od. einem sonstigen<br />
Verschluss versehene Schleuse zum Durchlassen od.<br />
Abfliessen des Binnenwassers"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
Stand: 24.10.2010 78<br />
182<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 182; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 246<br />
Siep mnd. sîp, "träge rinnen<strong>der</strong> Wasserlauf, Bach, kleiner Fluss" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
siet mnd. sît, "tief, unterwärts gelegen, unten"; nnd. siet, "niedrig" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
Sietwendung 1. Bezeichnug für "alle alten Deiche" 2. mnd. sîtwendinge,<br />
sîtwendige, "senkrecht auf den Hauptdeich zu errichteter<br />
Seitendeich", nnd. Sietwende, "künstliche Wasserscheide,<br />
niedriger Scheidedeich in <strong>der</strong> Marsch"<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 273;<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 144<br />
Sinn ahd. sin, immer, allgemein, groß Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Sling mnd. slinc, 1. "Umfassung, Einfriedigung" 2. "Gatter, Heck;<br />
Schlagbaum"; nnd. Slink, "Einfassung"<br />
Sloot Schloot,<br />
Schlot<br />
Slop Slopp, Schlop,<br />
Schlopp<br />
mnd. slôt, "zwischen zwei Grundstücken gezogener<br />
Wassergraben; Entwässerungskanal, Abzugsgraben,<br />
Deichgraben an <strong>der</strong> Sohle des Deiches"; nnd. Sloot, "Graben<br />
<strong>zur</strong> Befriedigung u. Abgrenzung von Län<strong>der</strong>eien u. auch <strong>zur</strong><br />
Abwässerung <strong>der</strong>selben"<br />
nnd. slôp, slop, 1. "Durchgang in einer Hecke o<strong>der</strong> einem Wall"<br />
2. "eine von <strong>der</strong> Flut in die Dünen einer Insel gerissene<br />
Öffnung"<br />
Snede "Flurgrenze, bes. durch die Waldmark geschlagene<br />
Forstgrenze, Grenzschneise"; "Schnede, Grenze"<br />
Söge mnd. sööge, "ausgewachsenes Schwein; weibliches Schwein,<br />
Sau"; nnd. Söge, "Sau"<br />
Solt mnd. solt, nnd. Solt, "Salz"; "Hinweis auf auffallend hohen<br />
Salzgehalt von Boden, Pflanzenwuchs o<strong>der</strong> Wasser."<br />
Sommer nnd. Sommer, "Sommer"; "Signalisiert „<strong>der</strong> Sonne zugekehrte<br />
Lage““; "Gegensatz: Winter"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 145<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 145<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146;<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 208<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Stand: 24.10.2010 79
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Sool Soll mnd. sol, sool, saal, "stehendes Gewässer, Teich, Tümpel";<br />
soole, "morastige Stelle, Nie<strong>der</strong>ung"<br />
soor (1) mnd. sôr, "bes. von Bäumen: trocken, dürr, abgestorben";<br />
"(Erdboden:) ausgetrocknet, trocken mager"; nnd. saar, soor,<br />
söör, "ausgetrocknet, ausgedörrt, trocken, dürr"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
soor (2) Süden, südlich Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland.<br />
Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich 2009, S. 59<br />
Soot mnd. sôt, nnd. Soot, "Quelle, Brunnen" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Spall Spalt "Son<strong>der</strong>(Sünner)-Grundstück"; "<strong>Die</strong>kspallen", wenn es am<br />
Deich liegt; abgeleitet von spellen, spalten; "<strong>Die</strong> Stücke waren<br />
durch die Besitzer für sich eingefriedigt, d. h. abgegraben."<br />
Spann mnd. span, "Maß einer Fläche Landes, die mit einem ‚span‘ in<br />
einer bestimmten Zeit bestellt werden kann"; nnd. Spann, "das<br />
zu leistende Maß von Arbeit, das Tagewerk"<br />
Spät Spath, Spatt mnd. spedt, späte, ein ausgestochenes od. ausgetorftes Loch;<br />
moor-späte<br />
Speck Specken mnd. specke, "Holzbündel, Faschine", "aus Buschwerk,<br />
Gesträuch, Erde und Grassoden aufgeworfener Weg durch<br />
sumpfiges Gelände, Knüppeldamm, Knüppelbrücke"; nnd.<br />
Specken, "niedrige Stelle mit Knüppeldamm",<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 146<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 268, 279 (siehe unter: 3. spit)<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147<br />
Speke Speiche: schmale Landzunge Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte,1936,1<br />
Spetze Speke gleichbedeutend mit Speke, Knüppeldamm Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Stand: 24.10.2010 80
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Spiek Spieker Nagel, Bolzen, Pflock, spitzer Pfahl; Wie bei "Spiekeroog"<br />
könnte sich <strong>der</strong> Begriff auf die längliche, spitz auslaufende<br />
Gestalt eines Flurstücks beziehen.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 274; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 251<br />
Spitt Bezeichnung für ein "ausgestochenes od. ausgetorftes Loch" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 278, 279, 280<br />
Spoor Spur, Fährte, Geleise, Weg, Pfad, Wagengleis Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 285; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
Spring mnd. sprine, "Quelle, Quellfluß; fließen<strong>der</strong> Brunnen"; nnd.<br />
Spring, "Springquell"<br />
stä Stätte, Stelle, Platz, Ort; Bauernhof; Landstelle mit einem<br />
Haus; Hausstelle, Besitzung<br />
1996, S. 255<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 304; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 259<br />
Stapel (1) Stapel, Stapelplatz, Stapelort, Nie<strong>der</strong>lassung, Markt Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 300, 301<br />
stapel (2) afries. stap, hoch; Hinweis auf eine höher gelegene Siedlung<br />
(auf festem, aufgeschichteten, aufgestapelten Boden) im Moor<br />
Stätte Stette nie<strong>der</strong>d. stede, stê, stee, nhd. Stätte, Stelle, Platz, Ort,<br />
Bauernhof; Landstelle mit einem Haus; Hausstelle, Besitzung<br />
Steck Heck, Verschluss; Einfriedigung, Umzäunung; abgestecktes, d.<br />
h. abgegrenztes u. markiertes Gebiet<br />
Steen Hinweis auf einen "isoliert liegenden Einzelstein (Findling)",<br />
"auf (ehemaliges) Hünengrab", "auf steiniges Gelände" "o<strong>der</strong><br />
auf Steinbruch"<br />
Schöneboom, A., Woher hat Stapelmoor seinen Namen? <strong>Die</strong> Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Ortsnamen Stapel, Stapelstein, Stapelmoor, in: Der Deichwart, 1969,<br />
3<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 304<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 308, 306<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147<br />
Stand: 24.10.2010 81
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Steert afries. stert, 1. Schwanz, Schweif 2. "letztes Ende,<br />
Schlußstück von etwas"; "Landzunge"; "langgestreckte, in eine<br />
Spitze auslaufende Strecke"; "Flurstück in <strong>der</strong> Gestalt eines<br />
Schwanzes"<br />
Stell mnd. stelle, stel, "Stelle, Platz"; "Hessmann 1972,448 sieht in<br />
dem Maskulinum „Stell“ - zu unterscheiden von dem<br />
Femininum „Stelle“ - eine „ausbaufähige, siedlungsfähige (nicht<br />
notwendigerweise besiedelte) Stelle“."<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147; Falkson, Katharina, <strong>Die</strong><br />
Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen). Neumünster 2000,<br />
Bd. 2, S. 565<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147<br />
Stern "Hinweis auf sternförmigen Wegeknoten, Wegespinne." Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147<br />
Stich nnd. stekken, stäken, stechen; mit einem Spaten stechen, z. B.<br />
Torf ausstechen; Hinweis auf einen Torfstich etc.<br />
Stieg ahd. stîg, "Steig, Pfad, Weg"; mnd. stîch, "Fußweg, Steig,<br />
schmaler Weg zwischen Flurstücken o<strong>der</strong> im Gelände,<br />
Bergpfad, Wildpfad"; nnd. Stieg, "Steig, schmaler Fußweg"<br />
Stock mnd. stok, "Baumstumpf, Wurzelstock, in Kaufbriefen: noch<br />
nicht gerodete Waldlandschaft"; "junger Baum"; nnd. Stock,<br />
"Stock, Baumschößling", "Hinweis auf Nie<strong>der</strong>wald(wirtschaft)"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 306<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 147; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
Stand: 24.10.2010 82<br />
313<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Straat Straße, gepflasteter Weg Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 333<br />
Straf nnd. strafen, straffen, strafen, korrigieren, auch in <strong>der</strong><br />
Bedeutung von: gerade o<strong>der</strong> eben machen<br />
Strang mnd. stranc, 1. "schmales langgestrecktes Stück Land,<br />
Ackerstreifen" 2. "Arm eines Gewässers, Meeresarm;<br />
Flußarm, Nebenfluß; Abfluß eines Brunnens"; nnd. Strang, 1.<br />
"ein (schmaler) Streifen Waldes. Oft als Eigenname." 2.<br />
"Flußarm, Flußbett"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 331<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Streek Landstrich, Gegend; Strecke, Streifen; Strich, Linie, Reihe Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 334; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 130
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Streep Streif, Strich, Streifen; ein dünnes langes Etwas Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 335<br />
Stremel mnd. streemel, "schmales Landstück"; nnd. Stremel,<br />
"schmaler, langer Streifen Landes"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Strenge Strang, Strähne, Linie; etwas, das sich lang hinzieht Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 335<br />
Strich Landstrich, Gegend; Strecke, Streifen; Strich, Linie, Reihe Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 334; Byl/Brückmann, Ostfriesisches<br />
Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer 1992, S. 130<br />
Striet mnd. strоt, nnd. Striet, "Streit", "Hinweis auf ein Flurstück, das<br />
zwischen mehreren Interessenten umstritten ist/war."<br />
Stroot Stroth mnd. strôt, "Wald, Buschwerk auf sumpfigen Boden, sumpfiges<br />
Gelände"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Strück Strauch, Buschwerk Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Stubben mnd. stubbe, "Baumstumpf"; "kollekt. Gestrüpp, Gesträuch";<br />
nnd. Stubben, "Baumstumpf"; "Oft Hinweis auf ehemalige<br />
Nie<strong>der</strong>waldwirtschaft."<br />
Stuben "Stumpf, Restzeug"; davon abgeleitet: Bezeichnung für eine<br />
kleine "übriggebliebene" Rinne<br />
Sudde mnd. südde, "Morast, sumpfige Wiese"; nnd. Sudde, "dicker<br />
Gras- o<strong>der</strong> Torfsoden, Plagge"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 148<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 567<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Stand: 24.10.2010 83
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
su<strong>der</strong> nnd. sü<strong>der</strong>, su<strong>der</strong>, suur, "südlich, im Süden" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
Sump Sumpel mnd. sump, sumpt, nnd. Sump, "Sumpf, Morast, feuchtes<br />
Gelände"<br />
Sun<strong>der</strong> nnd. Sun<strong>der</strong>, Son<strong>der</strong>, "aus <strong>der</strong> Markgenossenschaft<br />
ausgeson<strong>der</strong>tes Stück Wald o<strong>der</strong> Land"<br />
Sünner "Son<strong>der</strong>grundstück"; gleichbedeutend mit "Spallen"; abgeleitet<br />
von spellen, spalten; "<strong>Die</strong> Stücke waren durch die Besitzer für<br />
sich eingefriedigt, d. h. abgegraben."<br />
sur suur mnd. sûr, nnd. suur, "sauer"; "Hinweis auf "sauren" Boden o<strong>der</strong><br />
auf "sauren" Pflanzenwuchs (auf Feuchtwiesen)."<br />
swart mnd. swart, nnd. swart, swatt, "schwarz"; "Hinweis auf<br />
Bodenfärbung o<strong>der</strong> auf "feuchte Nie<strong>der</strong>ung"."<br />
2009, S. 94<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
364, 365<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in:<br />
Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 367; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong><br />
Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
2009, S. 94<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Swette mnd. swette, nnd. Swette, "Grenze" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Swienskopp Schweinekopf; Bezeichnung für ein "dreieckiges Stück Land" Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 569<br />
Swoog Grasplatz, Viehplatz (Ausdruck aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
mittelalterlichen Viehwirtschaft)<br />
Ramm, Heinz, Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr.<br />
Naturschutz u. Landschaftspflege, Bd. 5 (1974), S. 55-56<br />
Tal Nie<strong>der</strong>ung, Tiefe, Senke Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 2, S. 274<br />
Stand: 24.10.2010 84
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Tange Ta afries. tange, Landzunge; "langer schmaler Sandrücken im<br />
Wasser, Sumpf o<strong>der</strong> Moor"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 392<br />
Tapp mnd. tappe, Zapfen, Spitze Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 570<br />
Tater nnd. Tater, Zigeuner; "Entwe<strong>der</strong> Hinweis auf obrigkeitlich<br />
genehmigten Rastplatz für Zigeuner und an<strong>der</strong>es "fahrendes<br />
Volk" o<strong>der</strong> auf Grenzpunkt, über den hinaus sie sich einer<br />
Siedlung nicht nähern durften (vor allem "Taternpahl")"<br />
Teel nnd. Teel, "Bezeichnung eines gewissen festen Canons od.<br />
einer gewissen festen Abgabe, welche auf diverse, östlich von<br />
Norden belegenen Län<strong>der</strong>eien haftet u. welche gewisse …<br />
Personen als ihnen zustehende Einkunft od. Erbzins<br />
beziehen".<br />
Teen (1) Theen afries. tên, Stab, Zweig; T(h)een-Land: "Durch Eindeichung<br />
o<strong>der</strong> Urbarmachung von Bruchland o<strong>der</strong> Moor gewonnenes<br />
Land, das mit Hilfe von Losstäbchen verteilt wurde."<br />
Teen (2) Theen afries. Têna, "zäumen, als Einfriedigung errichten" abgeleitet;<br />
Übergang des Namens "von <strong>der</strong> Umzäunung auf das<br />
Umhegte", urspr. Bedeutung demgemäß: "abgegrenztes<br />
Gebiet"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 149<br />
Riemer, <strong>Die</strong>ter, De T(h)e(e)n(e), in: Jahrbuch, Bd. 69, 1990, S.331-345<br />
Tefels "die kleinen Äckerchen" Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer,<br />
1884, 9<br />
Teich "Teich" bezeichnet urspr. ein künstlich angelegtes Gewässer<br />
für die Fischzucht. Afries. dîk, bedeutet sowohl "Teich" o<strong>der</strong><br />
"Grube" als auch "Deich" o<strong>der</strong> "Damm", <strong>der</strong> mit <strong>der</strong><br />
ausgegrabenen Erde aufgeschüttet wird.<br />
Stand: 24.10.2010 85<br />
HWO<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 296; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 704<br />
Teil Stück, Anteil; Abteilung; Strecke Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 289<br />
Thee mnd. tie, ty, tigge, öffentlicher Versammlungsplatz Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 398 (siehe unter: têe-, tê-bôm)
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Tichel nnd. Tichel, "Ziegel"; "Hinweis auf Ziegelbrand, <strong>der</strong> wegen <strong>der</strong><br />
Feuersgefahr oft weit außerhalb <strong>der</strong> Siedlungen erfolgte."<br />
tichelê: Ziegelei<br />
Tie Thie mnd. tî, tîg, "öffentlicher Sammelplatz eines Dorfes, … in <strong>der</strong><br />
Regel erhöht u. mit einigen Bäumen (Linden) besetzt…"; nnd.<br />
Tie, "<strong>der</strong> Gemeineplatz im Dorfe. … Hier versammelt sich die<br />
Dorfgemeine <strong>zur</strong> Berathung <strong>der</strong> Gemeineangelegenheiten…"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 150; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
Stand: 24.10.2010 86<br />
407<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 150<br />
Tief "Hauptentwässerungsgraben, Kanal, kleiner Fluss." Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Tille afries. tille, Brücke, Brett, <strong>Die</strong>le; "Brücke über einen Graben,<br />
die aus einem Brett besteht, welches auf einem Balken<br />
aufliegt."<br />
Timpe Timpen mnd. timpe, "das in eine Spitze auslaufende Ende eines<br />
Dinges, Zipfel"; nnd. Timpe, Timpen, "jedes Äußerste einer<br />
Sache, <strong>der</strong> Zipfel", "zwickelförmige Parzelle"<br />
Tjade nnd. Tjade, Tjae, Tja, Tade, "kleiner Fluss, Wasserleitung,<br />
Grenzgraben od. Wasserlauf, Wasserzug,<br />
Abwässerungsgraben"<br />
Tjüche (1) Tjücht Name von Plätzen, Höfen od. kleiner Ortschaften in <strong>der</strong> Nähe<br />
alter geistlicher Stiftungen, die diesen als Viehhof (wörtlich:<br />
Zucht-Stätte) dienten; daher leitet sich z. B. <strong>der</strong> Name<br />
"Papentücht" (ein ehemaliges Klostergut) ab.<br />
Tjüche (2) afries. tiuche, "einzelne Gebiete <strong>der</strong> Dorfmark, die von<br />
Arbeitsgruppen gemeinsam bearbeitet wurden"<br />
Tjüche (3) "zunächst Landmaß, nämlich die Fläche ..., die an einem Tag<br />
mit einem Joch Ochsen gepflügt werden konnte. Später ...<br />
einfache Stückbezeichnung..."<br />
Tog Toch, Tocht afries. tach, Zug, Bewegung, Strömung; Abfluss bzw. Raum<br />
o<strong>der</strong> Öffnung zum Abfließen des Wassers; toch-slôt: Zug-<br />
Graben, Abwässerungsgraben<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 411; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 282<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 150;<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 282<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 150; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
407<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 417; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 283<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 220, 275<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 418
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Toll "Zoll, Abgabe, Tribut" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 422<br />
Tonne Tünne "Flächenmaß für ein Stück Land, das mit einer Tonne Korn<br />
besät werden kann"<br />
Topp mnd. top, "Zopf, die Spitze, das höchste Ende einer Sache,<br />
Wipfel eines Baumes", nnd. Topp, "<strong>der</strong> Wipfel des Baumes,<br />
das Wipfelende"; "Berggipfel"; auch: "Spitze, äußerster Winkel<br />
(von Flurstücken)"<br />
Toslag nnd. Toslach, "Teil <strong>der</strong> Flur, <strong>der</strong> zugeschlagen worden ist, d. h.<br />
einen Zaun, das Zeichen des Privateigentums erhalten hat";<br />
"jede Art privat genutzten Geländes, sofern es nur aus<br />
Gemeinheitsland abgetrennt war"; auch: Zuschlag<br />
Trane Trade, Trahe mnd. trade, "Spur, Geleise; bes. von dem Wege, den das Vieh<br />
sich macht, wenn es <strong>zur</strong> Tränke geht"; nnd. Trâne,<br />
"Wagenspur, Geleise"<br />
Tränke nnd. Drenke, Tränke, Brunnen; "Grube mit Wasser, woraus<br />
das Vieh getränkt wird"<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum<br />
(Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher<br />
Wattenmeeres, Neumünster 2000, Bd. 2, S. 571<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 150; Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und<br />
Namenerklärung, Vreden/Südlohn 1997, S. 324<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 151<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 151<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 332<br />
Triemel "ein Acker mit drei Maßeinheiten Breite" Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Trift Trifft mhd. trift, Trift; nfries. draft 1. Trift, Flur, Weide; "die Trift, als<br />
Ort, wohin Vieh <strong>zur</strong> Weide getrieben wird, und als Weg, auf<br />
welchem dasselbe dahin geht" 2. Weg, Durchfahrt, Einfahrt;<br />
"Überfahrtsweg über einen Deich"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 116, 151; Doornkaat Koolman, Jan<br />
ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 1,<br />
S. 333<br />
Trube Kalb Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 438<br />
Tucht Fließgewässer, das die Nie<strong>der</strong>schläge ableitet bzw. abzieht. Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 441; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong><br />
Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
2009, S. 87<br />
Stand: 24.10.2010 87
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Tummeldeich "ein auf einem Wall o<strong>der</strong> niedrigen Grunde angelegter Damm,<br />
<strong>der</strong> an den Seiten durch Packwerke geschützt ist u. dazu dient,<br />
dahinter Erde u. Schlick aufzufangen"; "wenn das Land höher<br />
geworden ist, dient er als Grundlage eines neuen Deiches"<br />
Tung Zunge; land-tunge: Landzunge o<strong>der</strong> auch: langes, schmales<br />
Feld<br />
Krünitz, J. G., Oekonomische Enzyklopädie online<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 447<br />
Tuun Garten, eingefriedigter Platz; Hecke, Zaun Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 446<br />
twars twas quer, kreuzend, gegenüber Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 373<br />
Twenter nfries. twiete, Gang zwischen zwei Häusern; Gasse, Gang,<br />
Weg<br />
Twiete mnd. twite, "ein schmaler Gang; eine enge Straße o<strong>der</strong><br />
Gasse"; nnd. Twiete, "Gasse, Nebenstraße"<br />
Twille mnd. twil, "Stamm o<strong>der</strong> Ast, <strong>der</strong> sich gabelförmig gespalten<br />
hat"; nnd. Twille, "Astgabel"; Hinweis auf die Form eines<br />
Flurstücks<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 454; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 294<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 151<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 151<br />
Uhl nnd. Ol, Ul, Sumpf, Moor Siebels, Gerhard, <strong>Die</strong> Siedlungsnamen <strong>der</strong> Gastendörfer des<br />
Auricherlandes, in: Collectanea Frisica, 1995, S. 75-100<br />
uiter außerhalb; üter-dîk: Außendeich; üter-dîks-land:<br />
Außendeichsland<br />
um Endung vieler ostfriesischer Ortsnamen, die aus "hem" bzw.<br />
"ham" = nhd. Heim (Wohnung, Wohnsitz, Ansiedlung)<br />
entstanden ist. afries. Paweshem, Fresbrahteshem, Ol<strong>der</strong>shem<br />
= Pewsum, Freepsum, Ol<strong>der</strong>sum<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 486<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 461; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 296<br />
Stand: 24.10.2010 88
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
ung "Eng, ing(e), ung ist...eine weitverbreitete<br />
Schöneboom, A., Flurbezeichnung war die Wurzel für den Kloster- und<br />
Flurnamenkomposition, die als Nutzland und speziell als Wiese Familiennamen Thedinga, in: Unser Ostfriesland, 1967, 21<br />
- verwandt mit hochdeutsch Anger - Bedeutung hatte."<br />
Unland "wildes, unwirthliches, schlechtes, uncultivirtes, unfruchtbares,<br />
zu nichts zu gebrauchendes Land"; "nicht nutzbares,<br />
unbebautes Land"<br />
Upstrecken Aufstrecken; "Grundstücksstreifen, die durch das seit<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ten im Brookmerland angewandte<br />
"Aufstreckenrecht", in <strong>der</strong> Breite des eigenen (Hof-)-<br />
Grundstücks zum Abgraben von Torf ins Moor vorzudringen,<br />
entstanden."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 472; Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong><br />
Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Aurich<br />
2009, S. 97<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 697<br />
Vaske auch Varsse: Trink- o<strong>der</strong> Süßwasser Lüpkes, W., Über ostfriesische Meerten, in: Blätter des Vereins für<br />
Heimatschutz und Heimatsgeschichte, 1931, 17<br />
Vergrößerung Colonatsvergrößerung: Ausdehnung, Expandierung des<br />
landwirtschaftlich nutzbaren Gebietes<br />
Verlaat nnd. Verlaat, "Doppel- o<strong>der</strong> Kasten-Schleuse, Hebe- o<strong>der</strong><br />
Senkschleuse - wodurch man Wasser und Schiffe „läßt““; "ein<br />
Bauwerk mit Verschlußtoren im Vorfluter einer beson<strong>der</strong>s tief<br />
liegenden Nie<strong>der</strong>ung" (Lü<strong>der</strong>s)<br />
Vie mnd. vî, "Sumpf, Bruch, Sumpfland; sumpfige Wiese,<br />
Sumpfweide; im Sumpfgelände liegen<strong>der</strong> Teich, Fischteich";<br />
früh-nnd. Vie, "sumpfiges Land, ein nasser, aber fruchtbarer<br />
Ort"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 697<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 152; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 312<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 152<br />
Vogt Verwalter, Verwaltungs- o<strong>der</strong> Gerichts-Unterbeamteter Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 411<br />
Vogtei nnd. fâgde; Bezirk, über den ein Vogt gesetzt ist Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 411<br />
Vorwerk "Meist als Name beson<strong>der</strong>er Landgüter u. Oekonomien, die<br />
entwe<strong>der</strong> nahe vor geschlossenen Dörfern liegen od. ehemals<br />
landwirthschaftl. Pertinenzien von Klöstern u. Rittergüter waren<br />
u. ausserhalb <strong>der</strong> geschlossenen Kloster- u. Gutsbezirke<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 546; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 319<br />
Stand: 24.10.2010 89
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
lagen."<br />
Wahl nie<strong>der</strong>l. waal = wêl od. nie<strong>der</strong>d. weel, eine vom Wasser<br />
ausgespülte Tiefe (Loch, Grube) am Deich; Kolk; wâl-dîk:<br />
Fluss- o<strong>der</strong> Strom-Deich<br />
Walke Der Begriff könnte einen Platz bezeichnen (Walkmühle), an<br />
dem "gewalkt" wurde, d. h. wo Stoff durch eine bestimmte<br />
Behandlung (z. B. durch Verfilzen) die gewünschte Dichte<br />
erhielt und außerdem von Unreinigkeiten befreit wurde.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 499; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 319<br />
Krünitz, J. G., Oekonomische Enzyklopädie online<br />
Wall Wall, Mauer, Erddamm zum Schutz; Hügel Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 498<br />
Walle (1) afries. walla, walle, "Stelle, wo das Wasser aus <strong>der</strong> Erde<br />
hervorbricht und sich sammelt"; Quelle<br />
Walle (2) "Walle bezeichnet eine Überquerungsmöglichkeit über einen<br />
Wasserlauf o<strong>der</strong> ein sumpfiges Gebiet"; Wegstrecke durch<br />
eine Furt<br />
Wand mnd. wande, "Wende, Kehre; Grenze, Ende"; nnd. Wanne,<br />
"beim Pflügen <strong>der</strong> Punkt, wo <strong>der</strong> Pflug gewandt wird,<br />
Wendepunkt. Grenze zwischen zwei Äckern, o<strong>der</strong> zwei<br />
Häusern, o<strong>der</strong> den Feldmarken zweier Ortschaften<br />
(Markscheide)", "Wende", "Pflugwendestelle"<br />
Ward Werth "Siedlungsnamen-Element mit verschiedenen Formen: -werth,<br />
-wierth, -ward, -warden. Es geht <strong>zur</strong>ück auf afries. werth,<br />
Insel"; "-wird, -wirth, -wird, "Geländeerhebung in Feuchtgebiet<br />
(in Flurnamen)"“<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 502, 533; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 322<br />
Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 152<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 278<br />
Warde mnd. warde, nnd. Wâre, "Warte, Wartturm" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 152<br />
War<strong>der</strong> von mhd. wert, Insel, nie<strong>der</strong>l. waard, eingedeichtes Land<br />
abstammend; Flussinsel, "Landstrich zwischen Fluß und<br />
stehendem Gewässer"; "gegen Wasser geschütztes o<strong>der</strong><br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 761<br />
Stand: 24.10.2010 90
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
schützendes Land"; mnd. wer<strong>der</strong>, "Insel", "Halbinsel"<br />
Warf (1) "Ein Hügel für ein Haus o<strong>der</strong> eine Siedlung, ein darauf<br />
gebautes Haus, ein kleiner Bauernhof/“Warfstä“ (im Gegens.<br />
zum größeren Herd), eine erhöhte Haus- o<strong>der</strong> Hofstätte, aber<br />
auch ein meist eingefriedigter Hofraum hinter o<strong>der</strong> neben dem<br />
Haus."<br />
Warf (2) afries., mnd. warf, werf; "ein künstlich aufgeworfener Hügel<br />
o<strong>der</strong> eine ring- o<strong>der</strong> kreisförmige Anhöhe in <strong>der</strong> Marsch,<br />
worauf ein Haus o<strong>der</strong> ein Dorf zum Schutz vor Sturmfluten und<br />
Überschwemmungen erbaut ist"<br />
Warf (3) "Warf" in <strong>der</strong> Bedeutung von "Geschäft, Betrieb, Gewerbe":<br />
mölen-warf: meist erhöhter und eingefriedigter Platz, worauf<br />
eine Mühle steht; kalk-warf: Platz, worauf Kalk aus Muscheln<br />
gebrannt wird o<strong>der</strong> wo eine Kalkbrennerei angelegt ist<br />
Wark Arbeit, Beschäftigung, Mühe; Sache, Angelegenheit; Werk,<br />
Fabrik<br />
warm mnd., nnd. warm, "warm"; "Hinweis auf Boden, <strong>der</strong> sich<br />
beson<strong>der</strong>s leicht erwärmt"<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 698<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 513; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 325<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 513<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 516; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 325<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 153<br />
Warp abgeleitet von engl. wharp, Kai, Schiffsanlegestelle Friedrichsen, Hans, "-warden"-Orte: Hütelande o<strong>der</strong> Warfen? Über die<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Ortsnamen im Bereich <strong>der</strong> Nordseeküste, in: Heimat am<br />
Meer, 1984, 22<br />
Warre höhergelegener Acker, auf dem Gemüse angebaut wurde;<br />
gleichbedeutend mit "Wirde, Widde, Were, Wörde"<br />
Wart Warte "Hütelande in <strong>der</strong> Marsch vor dem Deichbau, Allmende,<br />
Maifeld"<br />
Water mnd. water, "Gewässer, Strom, See"; nnd. Water, "das Waßer,<br />
einmal als Element, dann aber auch jedes stehende o<strong>der</strong><br />
fließende Gewäßer, also auch <strong>der</strong> Fluß"<br />
Schöneboom, A., Plettenbarch und Hleri / Der Berg und die Stadt,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1963, 4, 5, 6<br />
Friedrichsen, Hans, "-warden"-Orte: Hütelande o<strong>der</strong> Warfen? Über die<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Ortsnamen im Bereich <strong>der</strong> Nordseeküste, in: Heimat am<br />
Meer, 1984, 22<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 153<br />
Stand: 24.10.2010 91
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Waterlöse mnd. waterlosinge, "Abzugsgraben"; nnd. Waterlöse,<br />
"Wasserlauf, Abflußgraben, Abzugsgraben,<br />
Entwässerungsgraben"<br />
Watt "seichter, bei Ebbe trocken liegen<strong>der</strong> Meeresgrund"; "als Furt<br />
dienende Untiefe zwischen den Inseln und dem Festland"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 153<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 494; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 326<br />
Wede mnd. wede, "Wald, Hölzung"; nnd. Wede, "Wald, Holz" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 153<br />
Wedel nnd. Wedel, (nur in Ortsnamen) "Durchgang, Furt"; "Oft<br />
fälschlich für "Wede" (s.d.) eingetreten…"<br />
Weel mnd. wêl, "eine von Sturmflut hinter dem Deiche ausgespülte<br />
Tiefe, Kolk"; nnd. Weel, "vom Wasser ausgespültes Loch"<br />
Weer (1) Wehr "ein zum Schutz gegen Wassernoth aufgeworfener Damm od.<br />
eine Anhöhe, welche vor dem Wasser Schutz u. Sicherheit<br />
gewährt"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 153<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 538<br />
Weer (2) afries. were, "Hof, Ansiedlung, Wohnstätte" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 538<br />
Weering Wering Schafweide; weer = Wid<strong>der</strong> Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Weert 1. gleichbedeutend mit "wart", "Hütelande in <strong>der</strong> Marsch vor<br />
dem Deichbau, Allmende, Maifeld" 2. Wierde, Insel;<br />
Flussinsel<br />
wege kleiner Wald; "...entstand, indem die Verkleinerungsform<br />
Wedge = Wäldchen ihr d abstieß."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 539; Friedrichsen, Hans, "-warden"-Orte:<br />
Hütelande o<strong>der</strong> Warfen? Über die Bedeutung <strong>der</strong> Ortsnamen im Bereich<br />
<strong>der</strong> Nordseeküste, in: Heimat am Meer, 1984, 22<br />
Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Stand: 24.10.2010 92
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Wehle (1) nnd. wêl, nie<strong>der</strong>d. weel, ein vom Wasser ausgespültes Loch;<br />
Kolk<br />
Wehle (2) abgeleitet von ahd. wadil, waten; "Wehl (=Wedel) bezeichnet<br />
eine Überquerungsmöglichkeit über einen Wasserlauf o<strong>der</strong> ein<br />
sumpfiges Gebiet"; "Wegstrecke durch eine Furt"<br />
Wehre mnd. were, "Haus und Hof, Hofstelle"; nnd. Wêr, "Hof,<br />
Ansiedlung, Wohnstätte"<br />
Weide mnd. weide, "Weide, Futter, Nahrung; Weideplatz"; nnd.<br />
Weide, Wei, "die Weide, Stelle, wo zum Abgrasen bestimmtes<br />
Futter für gewisse Haustiere wächst"<br />
Well (1) afries. walla, walle, "Stelle, wo das Wasser aus <strong>der</strong> Erde<br />
hervorbricht und sich sammelt"; Quelle<br />
Well (2) aus "Wehl" durch Dehnung des Konsonanten entstanden;<br />
Wehl: abgeleitet von ahd. wadil, waten; "Wehl (=Wedel)<br />
bezeichnet eine Überquerungsmöglichkeit über einen<br />
Wasserlauf o<strong>der</strong> ein sumpfiges Gebiet"; "Wegstrecke durch<br />
eine Furt"<br />
Wende (1) wenn Gewende; "Stelle <strong>der</strong> Pflugwende od. wo <strong>der</strong> Pflug wendet,<br />
Acker seiner Länge nach bis <strong>zur</strong> Pflugwende, Ackerlänge od.<br />
Längenmass eines Ackers bis <strong>zur</strong> Pflugwende"<br />
Wende (2) wenn wende-, wend-, wen-akker: Wende-Acker; "Acker, auf dem <strong>der</strong><br />
Pflug gewendet wird u. <strong>der</strong> somit einen gegen die an<strong>der</strong>en<br />
Aecker quer liegenden schmalen Landstrich bildet";<br />
gleichbedeutend mit "Queracker", "Blöke", "Blockacker"<br />
Wendung mnd. wendinge, "Wendung, Umkehr"; nnd. Wennung,<br />
Wenning, "Pflugwendestelle"<br />
Wer<strong>der</strong> von mhd. wert, Insel, nie<strong>der</strong>l. waard, eingedeichtes Land<br />
abstammend; Flussinsel, "Landstrich zwischen Fluß und<br />
stehendem Gewässer"; "gegen Wasser geschütztes o<strong>der</strong><br />
schützendes Land"; mnd. wer<strong>der</strong>, "Insel", "Halbinsel"<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 532<br />
Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 502, 533; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 322<br />
Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und<br />
Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 624<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 535<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154; Duden „Etymologie“.<br />
Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989, S. 761<br />
Stand: 24.10.2010 93
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Wergens "alter Vermessungsname, <strong>der</strong> zum Flurnamen geworden ist";<br />
abgeleitet von Virga, "Rute = zwei Schechte"<br />
Wessel Wechsel nnd. Wessel, "Wechsel, Tausch"; "Hinweis darauf, daß sich<br />
mehrere Beteiligte in einem festgelegten Turnus in <strong>der</strong><br />
Nutzung <strong>der</strong> betreffenden Flurstücke abwechselten."<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Western westlich (von etwas) gelegene Flurstücke Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer<br />
Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Weyer Weher "Kornfegemühle, die durch starken Windzug das<br />
hineingeworfene Korn von Spreu und an<strong>der</strong>en Unreinigkeiten<br />
reinigt"<br />
Widde Nebenform von: Wi(e)rde, Werde; "erweitere Gärten eines<br />
Dorfes"; "Ihre Böden stehen auf <strong>der</strong> Mitte zwischen Garten-<br />
und Ackergrund." Daher auch häufig die Bezeichnung<br />
"Kohltuun". weitere Nebenformen: Wirren, Wehren, Warren,<br />
Wühren, Würden, Wörde<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 529; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 328<br />
Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1955, 5<br />
Wied Wide: alte Waldbezeichnung; gleichbedeutend mit "Wede" Engelkes, Gustav, Rowide, rigolen und rayen. Vom Ursprung einiger<br />
Namen und Bezeichnungen im heimatlichen Rhau<strong>der</strong>fehn, in: Friesische<br />
Blätter, 1987, 2; Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong><br />
Wiede mnd. wide, "Weide, sowohl die Buscharten als <strong>der</strong><br />
Weidenbaum"; nnd. Wiede, "die Weide, als Baum und als<br />
Busch, salix"<br />
ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 547<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 154<br />
Wiek (1) "Stadtquartier od. Abtheilung (Rott, Kluft) einer Stadt" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 548<br />
Wiek (2) (Meeres)bucht; auch "in-wîk" o<strong>der</strong> "in-wike" genannt Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 548<br />
Wiek (3) Kanal im Fehngebiet; in-wîke: von <strong>der</strong> Haupt-wîke<br />
abzweigen<strong>der</strong> Nebenkanal o<strong>der</strong> eine nach innen, ins Land<br />
hinein gegrabene wîke<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 548<br />
Stand: 24.10.2010 94
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Wien mnd. wîn, nnd. wien, "Wein"; "Auch Wein ist (wie Hopfen)<br />
früher bis in den Norden Nie<strong>der</strong>sachsens angebaut worden …"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 155<br />
wier verwandt mit nhd. währen; Wiering: "Dauerwiese" Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Wiese "niedrig gelegenes, feuchtes Grasland, das meistens zum<br />
Heumachen und nur ausnahmsweise zum Beweiden benutzt<br />
wird"<br />
Wiet gleichbedeutend mit "Wede, Wied"; mnd. wede, "Wald,<br />
Hölzung"; nnd. Wede, "Wald, Holz"<br />
Wik urspr. "Gertenzaun"; "Vom Gertenzaun ging die Bedeutung von<br />
"Wik" auf das "Umzäunte", dann speziell "Immunitätsbereich"<br />
über." "Ursprünglich bezog sich … "Wik" auf Siedlungen bzw.<br />
Einzelhöfe, <strong>der</strong>en Fluren in einem geschlossenen Block<br />
zusammenhingen."<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 563<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 155<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 279<br />
wild afries. wilde, wild, unangebaut, wüst; ungezähmt Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 551<br />
Wilde (1) "ein Stück wild, wüst u. uncultivirt (od. unangebaut) liegendes<br />
Land"<br />
Wilde (2) "Nach <strong>der</strong> Abtorfung unbewirtschaftet, unkultiviert<br />
liegengebliebene Län<strong>der</strong>eien."<br />
Wilf <strong>Die</strong> Nutzung <strong>der</strong> Wilf-Äcker ging innerhalb einer Gruppe von<br />
Berechtigten jahrweise reihum.<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 551<br />
Bents, Harm; Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong><br />
Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, Norden 2009, S. 698<br />
Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart,<br />
1966, 26, 27<br />
Wilge mnd. wilge, Weide (salix) Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, 551; Stürenburg, Cirk Heinrich,<br />
Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer<br />
1996, S. 331<br />
Stand: 24.10.2010 95
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Winkel mnd. winkel, "Winkel, Ecke (geheimer) Raum, Versteck"; nnd.<br />
Winkel, "Winkel"; "winkel- o<strong>der</strong> hakenförmiges Flurstück o<strong>der</strong><br />
aber = Ende eines Flurstückes"<br />
Winter nnd. Winter, "Winter"; "Signalisiert „<strong>der</strong> Sonne abgekehrte<br />
Lage“'"; "Gegensatz: Sommer"<br />
Wirde (1) Wierde mhd. Wird, wert, nhd. Wer<strong>der</strong>, "erhöhtes und gegen<br />
Überschwemmung geschütztes Land, als sandige Anhöhe in<br />
Sümpfen o<strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>ungen o<strong>der</strong> als erhöhtes Ufer an Flüssen<br />
o<strong>der</strong> am Meer o<strong>der</strong> als Flussinsel"<br />
Wirde (2) Wierde auch: Werde; "erweitere Gärten eines Dorfes"; "Ihre Böden<br />
stehen auf <strong>der</strong> Mitte zwischen Garten- und Ackergrund." Daher<br />
auch häufig die Bezeichnung "Kohltuun". Nebenformen:<br />
Wirren, Wehren, Warren, Wühren, Würden, Widden, Wörde<br />
Wisch Wiese; "niedrig gelegenes, feuchtes Grasland, das meistens<br />
zum Heumachen und nur ausnahmsweise zum Beweiden<br />
benutzt wird"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 155<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 155<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 559<br />
Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in: Unser<br />
Ostfriesland, 1955, 5<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 563 (siehe unter: wiske, wisk);<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 333<br />
Wisk aus dem Altsächsischen stammend; kleine Wiese Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in:<br />
Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
witt mnd. wit, nnd. witt, "weiß"; "Hinweis auf helle Bodenfärbung<br />
o<strong>der</strong> auf Pflanzenwuchs"<br />
Wittefloh Witte Floh auch: „Weißer Floh“; Witte: "Stellen kleineren Umfangs,<br />
möglicherweise Sandinseln, die im Vergleich zu ihrer<br />
Umgebung aus dem Niveau herausragen"; Floh: "Hinweis auf<br />
die Winzigkeit <strong>der</strong> Fläche"; Wittefloh: "kleine Sandinsel"<br />
Wold "Bezeichnung für Bruch- und Buschwald, aber auch für<br />
Wiesenmoor und Sumpf (Nie<strong>der</strong>ungsmoor)"; "mooriges<br />
Grasland"<br />
Wolf "welfen, wolfen, wulfen": abwechseln, "z. B. mit <strong>der</strong><br />
Bestellung…<strong>der</strong> schlechten Aecker…, wie solches in <strong>der</strong> Moor-<br />
u. Heide-Gegend geschieht, die nicht jedes Jahr gebaut u.<br />
genutzt werden können, woher solche Aecker...jetzt auch<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 155<br />
Schumacher, Heinrich<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 568; Schöneboom, A., Orts- und<br />
Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in: Ostfriesischer Hauskalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 533<br />
Stand: 24.10.2010 96
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
"welf-", "wilf-", "wolf-" od. "wulf-lande" (Wechsel-Lande)<br />
heissen"<br />
Wörde höhergelegener Acker, auf dem Gemüse angebaut wurde;<br />
hochgelegene Grundstücke, erhöhtes Ufer; gleichbedeutend<br />
mit "Wirde, Widde, Were, Warre"<br />
Wort Wurt; mnd. wort, wurt, "urspr. Boden, Grund, bes. <strong>der</strong> erhöhte<br />
o<strong>der</strong> eingehegte, spec. Hofstätte, Hausplatz, Grundstück, area;<br />
auch Garten, Feldstück, Waldmark"; nnd. Wort, Wurt, "ein<br />
freier, unbebauter Platz entwe<strong>der</strong> beim Hause o<strong>der</strong> im Felde";<br />
"Häufig etwa = "Feldgarten""; "Nach G. Müller … auch für<br />
"größere Ackerparzellen in Hofnähe"<br />
Wrock Feindschaft, Groll, Streit; Wrockdeich: strittiger Deichabschnitt,<br />
<strong>der</strong> deshalb ungemacht lag; auch: Zwistdeich<br />
Wulf "welfen, wolfen, wulfen": abwechseln; die Nutzung <strong>der</strong> Wulf-<br />
Äcker ging innerhalb einer Gruppe von Berechtigten jahrweise<br />
reihum.<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong><br />
Ausgabe Aurich 1857, Leer 1996, S. 334; Schöneboom, A., Plettenbarch<br />
und Hleri / Der Berg und die Stadt, in: Unser Ostfriesland, 1963) 4, 5, 6<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 156<br />
Stand: 24.10.2010 97<br />
HWO<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 533; Schöneboom, A., Vom Flurnamen<br />
zum Familiennamen, in: Der Deichwart, 1966, 26, 27<br />
Wüste "Wildnis, Ödland" Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn.<br />
Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn<br />
1997, S. 361<br />
Wüstung "verlassene Siedlungsstätte bzw. aufgegebene<br />
Wirtschaftsfläche"<br />
Wikipedia<br />
ys wie "is" o<strong>der</strong> "ies" eine friesische Nebenform von "Esch"; Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong><br />
"westlich <strong>der</strong> Lauwers bedeutet "ies": Esch, Ackerland rings um Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer 2004, S. 256<br />
ein Dorf"<br />
Ziepel mnd. sipel, nnd. Ziepel, Siepel, Zippel, "Zwiebel" Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 156<br />
Zigge Zigge 1. Nie<strong>der</strong>ung, Senke; niedrige, sumpfige Stelle 2. Riedgras,<br />
Sumpfgras, Schilf, Segge<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, Bd. 181, 182, 168
<strong>Glossar</strong> <strong>der</strong> <strong>Flurnamensammlung</strong><br />
Begriff I Begriff II Bedeutung Quelle / Literatur1<br />
Zingel Singel mnd. singele, singel, zingel, 1. "Befestigungsgürtel einer Stadt"<br />
2. "Verschanzungsanlage vor einem Stadttor, auch das<br />
Verhau, Palisadenwerk, das Gattertor, die Zugbrücke selbst"<br />
3. "Grenzlinie e. Stadtgebietes und dieses selbst gegenüber<br />
<strong>der</strong> Stadtmark" "Grund-, Herrschaftsbezirk, Gerichtsbezirk";<br />
nnd. Zingel, "äusserer Erd-Gürtel od. Wall, Verschanzung etc.<br />
um eine Burg od. ein festes Haus"<br />
Zugschloot Zuggraben; "größerer Entwässerungsgraben, <strong>der</strong> sein Wasser<br />
in das Sieltief weiterleitet"<br />
Zuschlag nnd. Toslach, "Teil <strong>der</strong> Flur, <strong>der</strong> zugeschlagen worden ist, d. h.<br />
einen Zaun, das Zeichen des Privateigentums erhalten hat";<br />
"jede Art privat genutzten Geländes, sofern es nur aus<br />
Gemeinheitsland abgetrennt war"<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 156; Doornkaat Koolman, Jan ten,<br />
Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache, Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S.<br />
184<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 3, S. 418<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und<br />
Regionalgeschichte, Melle 1995, S. 151<br />
Zwinger "befestigter Raum zwischen Mauer und Graben" Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache,<br />
Norden 1879 bis 1884, Bd. 1, S. 375 (siehe unter: dwingen); Duden<br />
„Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim<br />
1989, S. 789 (siehe unter: zwingen)<br />
Stand: 24.10.2010 98
Literatur<br />
Primärliteratur<br />
Schumacher, Heinrich, <strong>Die</strong> Flurnamen Ostfrieslands, Bd. 3, Register <strong>der</strong> Verweise: A – K, Aurich 2002<br />
Schumacher, Heinrich, <strong>Die</strong> Flurnamen Ostfrieslands, Bd. 4, Register <strong>der</strong> Verweise: L – Z, Aurich 2002<br />
Nachschlagewerke<br />
Brockhaus - die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden, 20. Auflage, 1796 - 1996<br />
Byl/Brückmann, Ostfriesisches Wörterbuch. Plattdeutsch/Hochdeutsch, Leer: Schuster 1992<br />
Doornkaat Koolman, Jan ten, Wörterbuch <strong>der</strong> ostfriesischen Sprache. Etymologisch bearbeitet, 3 Bände. Norden: Braams 1879 bis 1884<br />
Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, Mannheim 1989<br />
Krünitz, J. G., Oekonomische Enzyklopädie online<br />
Stürenburg, Cirk Heinrich, Ostfriesisches Wörterbuch, Nachdruck <strong>der</strong> Ausgabe Aurich 1857, Leer: Schuster 1996<br />
Weßels, Paul, Historisches Wörterbuch für Ostfriesland (HWO)<br />
Wikipedia<br />
Sekundärliteratur<br />
Ahlrichs, Richard, <strong>Die</strong> Wasserläufe Ostfrieslands im Volksmund. Was Bezeichnungen wie Jümme, Sichter o<strong>der</strong> Delft bedeuten, in: Heimat am<br />
Meer, 1988, 10<br />
Baumann, Andreas, Heimatgeschichtliche Sammlung, im Besitz <strong>der</strong> Ostfriesischen Landschaft.
Bents, Harm, Flurnamen in Upgant-Schott und Siegelsum, in: Chronik <strong>der</strong> Gemeinde Upgant-Schott mit Siegelsum, 2009, S. 696 - 716<br />
Bügel, Caspar Heinrich, Vocabularium Ostfrisicum, bearbeitet durch A. Pannenborg, in: Ostfriesisches Monatsblatt 1875, S. 57-68, 244-249<br />
Engelkes, Gustav, Rowide, rigolen und rayen. Vom Ursprung einiger Namen und Bezeichnungen im heimatlichen Rhau<strong>der</strong>fehn, in: Friesische<br />
Blätter, 1987, 2<br />
Engelkes, Gustav, <strong>Die</strong> "Landaffen" und das Rechtsdenken <strong>der</strong> Friesen, in: Der Deichwart 1960, 282<br />
Falkson, Katharina, <strong>Die</strong> Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen). Einschließlich <strong>der</strong> Flurnamen des Dithmarscher Wattenmeeres. 2<br />
Bände, Neumünster 2000<br />
Friedrichsen, Hans, Friesische Orts- und Flurnamen, in: Heimat am Meer, 1884, 9<br />
Friedrichsen, Hans, "-warden"-Orte: Hütelande o<strong>der</strong> Warfen? Über die Bedeutung <strong>der</strong> Ortsnamen im Bereich <strong>der</strong> Nordseeküste, in: Heimat am<br />
Meer, 1984, 22<br />
Herzog, Christa, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemarkung Wiesede – Ostfriesland. Beiträge zu ihrer Deutung. Mit regionalgeschichtlichen Erläuterungen,<br />
Aurich 2009<br />
Janßen, Georg, Beitrag <strong>zur</strong> Orts- und Flurnamenforschung. Betrachtung zum Namen Dollart. in: Ostfriesenwart, 1932, Bd. 2, Nr. 3<br />
Jelden, Hajo, Stallbrüggerfeld - schwere Anfangsjahre einer Moorsiedlung, in: Unser Ostfriesland, 2005, 17<br />
Lüken, D., Lidde, ein alter Lengener Flurname, in: Unser Ostfriesland, 1969, 4<br />
Lüpkes, W., Über ostfriesische Meerten, in: Blätter des Vereins für Heimatschutz und Heimatsgeschichte, 1931, 17<br />
Mietzner, Erhard, <strong>Die</strong> Flurnamen <strong>der</strong> Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung, Vreden/Südlohn 1997<br />
Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 2, Bielefeld 2001<br />
Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 3, Bielefeld 2003<br />
Müller, Gunter, Westfälischer Flurnamenatlas, Lieferung 4, Bielefeld 2006
Ohling, G. D., Auf alten Heerwegen. Mit Erklärung einiger Orts- und Flurnamen, in: Heimatkunde und Heimatgeschichte, 1936, 1<br />
Ramm, H., Der Flur- und Ortsname Fal<strong>der</strong>n, in: Mitt. d. Arbeitsgr. Naturschutz u. Landschaftspflege, Volkskunde u. Brauchtum, Baupflege u.<br />
Gedenkstätten sowie Vorgesch. <strong>der</strong> Ostfr. Ldsch., Bd. 5 (1974), S. 55-56<br />
Remmers, Arend, Von Aaltukerei bis Zwischenmooren. <strong>Die</strong> Siedlungsnamen zwischen Dollart und Jade, Leer: Schuster 2004<br />
Riemer, <strong>Die</strong>ter, De T(h)e(e)n(e), in: Jahrbuch, Bd. 69, 1990, S. 331-345<br />
Roskam, Heinrich, Woher kommt <strong>der</strong> Ortsname Tjüche?, in: Unser Ostfriesland, 1963, 5<br />
Scheuermann, Ulrich, Flurnamenforschung. Bausteine <strong>zur</strong> Heimat- und Regionalgeschichte, Melle 1995<br />
Schiller, Carl/Lübben, August; Mittelnie<strong>der</strong>deutsches Wörterbuch, Bremen 1875-1880<br />
Schöneboom, A., Brinkum. Von seiner Flur und <strong>der</strong>en Namen, in: Unser Ostfriesland, 1955, 4<br />
Schöneboom, A., Filsum. <strong>Die</strong> Flur und ihre Namen, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1955, S. 47-53<br />
Schöneboom, A., Flurnamen leben in Eigen- und Ortsnamen fort, in: Unser Ostfriesland 1966, 15, 16<br />
Schöneboom, A., Flurbezeichnung war die Wurzel für den Kloster- und Familiennamen Thedinga, in: Unser Ostfriesland, 1967, 21<br />
Schöneboom, A., Vom Flurnamen zum Familiennamen, in: Der Deichwart, 1966, 26, 27<br />
Schöneboom, A., Wiesennamen wurden Familien- und Ortsnamen, in: Unser Ostfriesland, 1970, 3, 4<br />
Schöneboom, A., Dorfnamen entstanden aus Flurbezeichnungen, in: Unser Ostfriesland, 1968, 7<br />
Schöneboom, A. , Plettenbarch und Hleri / Der Berg und die Stadt,<br />
in: Unser Ostfriesland, 1963) 4, 5, 6<br />
Schöneboom, G., Auf <strong>der</strong> Lübsche, in: Unser Ostfriesland, 1970, 17
Schöneboom, A., Woher hat Stapelmoor seinen Namen? <strong>Die</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Ortsnamen Stapel, Stapelstein, Stapelmoor, in: Der Deichwart, 1969,<br />
3<br />
Schöneboom, A., Backband o<strong>der</strong> Bagband? Bakemoor o<strong>der</strong> Backemoor?, in: Unser Ostfriesland, 1969, 16, 17<br />
Schöneboom, A., Der Ortsname Ihren - ein westgermanisches Erzwort, in: Unser Ostfriesland, 1970, 14<br />
Schöneboom, A., Geestdorf Hesel. Von seiner weiten Flur und ihren alten Namen, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1958, S. 28-<br />
35<br />
Schöneboom, A., Orts- und Flurnamen <strong>zur</strong> Geschichte Amdorfs, in: Ostfriesischer Haus-Kalen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hausfreund, 1951, S. 36-41<br />
Siebels, Gerhard, <strong>Die</strong> Siedlungsnamen <strong>der</strong> Gastendörfer des Auricherlandes, in: Collectanea Frisica, 1995, S. 75-100<br />
Sun<strong>der</strong>mann, Friedrich, Zur Ortsnamengeschichte Ostfrieslands, abgedruckt i. d. Literarischen Beilage zum Ostfr. Schulblatt, 1906<br />
Uphoff, Bernhard, Ostfriesische Masze und Gewichte, Aurich 1973<br />
Wassermann, Ekkehard, Aufstrecksiedlungen in Ostfriesland. Ein Beitrag <strong>zur</strong> Erforschung <strong>der</strong> mittelalterlichen Moorkolonisation, Aurich 1885<br />
Flurnamen in <strong>der</strong> Gemarkung Brockzetel. In <strong>der</strong> einsamen Heide ließen sich die Johanniter nie<strong>der</strong>, in: Friesische Heimat, 1968, 2<br />
Der Lintelo-Pol<strong>der</strong> – ein Stück Rhei<strong>der</strong>land, in: Der Deichwart 1960, 19<br />
Der „Kibbelkiel“ bei Charlottenpol<strong>der</strong>, in: Der Deichwart 1960, 25