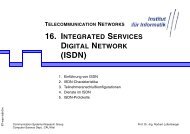die komplette Vorlesung
die komplette Vorlesung
die komplette Vorlesung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10hello.fm<br />
DOKUMENTIEREN<br />
UND PRÄSENTIEREN<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Communications Systems Research Group<br />
Computer Science Dept.<br />
Christian-Albrechts-University in Kiel<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
1-2
INTRODUCTION… schon <strong>die</strong> alten Ägypter wußten es: (1)<br />
Das Schreiben – für den, der es versteht, ist es nützlicher als<br />
jedes Amt. Es ist angenehmer als Brot und Bier, als Kleider<br />
und Salben. Es ist glückbringender als ein Erbteil in Ägypten<br />
und ein Grab im Westen.<br />
aus dem Pypyrus Lansing, ca. 2400 v.Chr.,<br />
zitiert nach [v. Scheidt 1996]<br />
Du sollst dein Herz an <strong>die</strong> Schreibkunst setzen! Siehe, da ist<br />
nichts, das über <strong>die</strong> Schreibkunst geht. Die Schreibkunst –<br />
Du sollst sie mehr lieben als Deine Mutter. Schönheit wird vor<br />
Deinem Angesicht sein. Größer ist sie als jedes andere Amt,<br />
sie hat im Lande nicht ihresgleichen.<br />
der Ägypter Cheti an seinen Sohn Pepi, ca. 2400 v.Chr.,<br />
zitiert nach [v. Scheidt 1996]<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-3
1-4
Abmahnungen … (1)<br />
Was sich sagen läßt, läßt sich klar sagen, und worüber man<br />
nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.<br />
Ludwig Wittgenstein<br />
Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen<br />
und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.<br />
Karl Popper<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-5
1-6
… und Ermahnungen (2)<br />
Wer sich nicht präzise und differenziert ausdrücken kann, wird<br />
aber auch in der Entwicklung seiner Denkfähigkeit zurückbleiben<br />
– das ist <strong>die</strong> Gefahr, und dagegen hilft nur: Lesen,<br />
Schreiben, Üben.<br />
Reumann, K.: „Lesen, Schreiben, Üben“.<br />
FAZ Nr. 161, 15.7.98<br />
Schreiben ist harte Arbeit. Ein klarer Satz ist kein Zufall. …<br />
Wenn Sie finden, daß Schreiben schwer ist, so hat das einen<br />
einfachen Grund: Es ist schwer.<br />
William Zinser<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-7
1-8
… und Wünsche (3)<br />
Jede Chance, Studenten zur klaren und verständlichen<br />
Formulierung, zu einer guten deutschen und englischen<br />
Sprache anzuleiten, sollte genutzt werden. Es sollte als Wert<br />
– etwa bei Seminarvortrag oder Diplomarbeit – vermittelt<br />
werden: „Alles, was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich auch<br />
klar sagen.“<br />
D. Taubner, sd&m AG, München<br />
Software-Entwicklung im industriellen Maßstab.<br />
in: Desel, J.: Das ist Informatik.<br />
Berlin (Springer) 2001<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-9
1-10
… eine bestimmt zutreffende Beobachtung (4)<br />
„Den Stu<strong>die</strong>renden an unseren Hochschulen fehlen nach<br />
meinen Erfahrungen klare Vorstellungen davon, was sie tun<br />
sollen, wenn sie einen wissenschaftlichen Text schreiben<br />
sollen. Sie haben weder von den Textmustern noch von den<br />
auszuführenden Arbeitsschritten ein klares Bild, geschweige<br />
denn davon, was das Attribut ’wissenschaftlich’ ausmacht.<br />
Sie sind beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten auf ihre<br />
Intuition verwiesen und auf Imitation. ’Durchbeißen’ ist der<br />
häufigste Rat, den Stu<strong>die</strong>rende zu hören bekommen, wenn<br />
sie Probleme mit ihrer Haus-, Examens- oder Doktorarbeit<br />
haben.“<br />
Kruse, O.: Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-11
1-12
Vom Nutzen des Schreibens (1)<br />
… im Beruf:<br />
— dauerhafte Dokumentation der Ergebnisse der eigenen Arbeit:<br />
„Wer schreibt, der bleibt!“<br />
— (Rück-) Gewinn von fachlicher/wissenschaftlicher Kompetenz:<br />
„Eine Arbeit zu schreiben, bedeutet zu lernen, in <strong>die</strong> eigenen Gedanken<br />
Ordnung zu bringen.“ (Umberto Eco)<br />
— eine bessere Basis für <strong>die</strong> Bewertung der Arbeit anderer:<br />
„Wenn der Förster durch den Wald geht, sieht er mehr als Städter,<br />
der nur spazierengeht.“ (Ludwig Reiners)<br />
… persönlich:<br />
— Schreiben kann Flow-Erlebnisse erzeugen!<br />
„ … hard work, but also the pleasure of the chase; some frustration,<br />
but more satisfaction; periods of confusion, but confidence that, in the end,<br />
it will all come together.“ (Booth, Colomb, Williams)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-13
1-14
Worum geht’s? (1)<br />
Technische Dokumente …<br />
— Systemdokumentationen und technische Berichte<br />
— Abschlußarbeiten in technischen Disziplinen<br />
— wissenschaftliche Veröffentlichungen<br />
— …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-15
1-16
Lernziele (1)<br />
Sie sollen lernen,<br />
1. wie man den Inhalt technischer Präsentationen und Dokumente<br />
zielgerichtet entwickelt und gliedert,<br />
2. wie man Illustrationen und Tabellen nutzbringend einsetzt,<br />
3. wie man Texte verständlicher und besser lesbar macht,<br />
4. wie man Texte und Präsentationsmaterial typographisch gestaltet, und<br />
5. wie man den eigenen Erstellungsprozeß besser organisiert.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-17
1-18
Literatur (1)<br />
zur Struktur von technischen Dokumenten<br />
[1] Ropohl, G.:<br />
Allgemeine Technologie, eine Systemtheorie der Technik. 2. Aufl.<br />
München, Wien (Hanser) 1999, ISBN 3-446-19606-4.<br />
Eine hervorragende Einführung in <strong>die</strong> Systemtheorie und für mich <strong>die</strong> Grundlage für <strong>die</strong> Auseinandersetzung<br />
mit den Inhalten von ingenieurwissenschaftlichen Arbeiten.<br />
[2] Pirsig, R.M:<br />
Zen und <strong>die</strong> Kunst ein Motorrad zu warten.<br />
Frankfurt/Main (Fischer Taschenbuch Verlag) 1978, ISBN 3-596-22020-3.<br />
Einer der wenigen Romane, <strong>die</strong> ich zweimal gelesen habe.<br />
[3] Booth, W.C., Colomb, G.G., Williams, J.M.:<br />
The Craft of Research.<br />
Chicago, London (The University of Chicago Press) 1995, ISBN 0-226-06584-7.<br />
Eine bermerkenswert akribische Bestandsaufnahme der Tätigkeit von Forschern.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-19
1-20
Literatur (2)<br />
Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten<br />
[4] Krämer, W.:<br />
Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1995 (4. Auflage), ISBN 3-8252-1633-0.<br />
Krämer ist Mathematiker und kommt von daher unserer Mentalität am nächsten.<br />
[5] Eco, U.:<br />
Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt.<br />
München u.a. (UTB) o.J. (6. Auflage), ISBN 3-8252-1512-1.<br />
Ein sehr gutes Buch, das aber leider nur Geisteswissenschaftler anspricht.<br />
[6] Engel, St., Woitzik, A. (Hrsg.):<br />
Die Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1997, ISBN 3-8252-1917-8.<br />
Ein Buch, dem ich einige nützliche Hinweise entnommen habe, so z.B. den Hinweis auf das Führen eines<br />
wissenschaftlichen Journals.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-21
1-22
Literatur (3)<br />
zur Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen<br />
[7] Brauner, I.:<br />
Praxis der Rhetorik.<br />
Berlin u.a. (vde-Verlag) 1994, ISBN 3-8007-2053-1.<br />
Ein im Umfeld des Themas „Präsentation“ weitgehend unbrauchbares Buch. Interessant allerdings <strong>die</strong><br />
Hinweise auf <strong>die</strong> Bedeutung von Selbstgesprächen.<br />
[8] Hartmann, M., Funk, R., Nietmann, H.:<br />
Präsentieren (4. Auflage).<br />
Weinheim u.a. (Beltz Verlag) 1998, ISBN 3-407-36342-7.<br />
Ein sehr brauchbares Buch.<br />
[9] Jay, A.:<br />
Die perfekte Präsentation.<br />
Niedernhausen (Falken) 1997, ISBN 3-8068-4975-7.<br />
Ein sehr business-orientiertes Buch: Im Mittelpunkt des Interesses stehen Produktpräsentationen, <strong>die</strong><br />
Kaufentscheidungen beeinflussen sollen. Interessant zu lesen – der vorgeschlagene klassisch-konservative<br />
dress code, der sogar Papiertaschentücher verbietet.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-23
1-24
Literatur (4)<br />
zur Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen (Forts.)<br />
[10] Kellner, H.:<br />
Reden, zeigen, überzeugen.<br />
München u.a. (Carl Hanser) 1998, ISBN 3-446-19152-6.<br />
Illustrationen<br />
Einige gute Erläuterungen zu Rhetorik, Gestik und Mimik, aber ansonsten ein Flop: unsystematischer Aufbau,<br />
weitgehender Verzicht auf Visualisierungen (bis auf einige überflüssige Strichmännchen), fast ausschließlich<br />
Negativbeispiele und einige Ratschläge, dank derer der Referent den Untergang der Titanic nacherleben<br />
kann.<br />
[11] Tufte, E.R.:<br />
The visual display of quantitative information.<br />
Cheshire (Graphics Press) 1997, ohne ISBN.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-25
1-26
Literatur (5)<br />
zum Erstellungsprozeß<br />
[12] Rico, G.L.:<br />
Garantiert schreiben lernen.<br />
Reinbek (Rowohlt) 1984, ISBN 3-499-60605-4.<br />
Ein nützliches Buch für Leute, für <strong>die</strong> das Schreiben mit einem großen Angang verbunden ist. Es erläutert<br />
außerdem sehr schön einige Hintergrundtheorien zur Kreativität.<br />
[13] Kruse, O.:<br />
Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Frankfurt u.a. (Campus) 1997 (5. Auflage), ISBN 3-593-35693-7.<br />
Ein empfehlenswertes Buch mit nützlichen Hinweisen für eigene Übungen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-27
1-28
Literatur (6)<br />
zu Verständlichkeit und Stil<br />
[14] Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R.:<br />
Sich verständlich ausdrücken.<br />
München (Reinhardt Ernst) 1999, ISBN 3-497-01492-3.<br />
Eine spannende Zusammenfassung der Ergebnisse der Hamburger Forschungen zum Thema<br />
„Verständlichkeit“<br />
[15] Reiners, L.:<br />
Stilfibel.<br />
München (dtv) 1998, ISBN 3-423-30005-1<br />
Ein Buch, das seit seinem ersten Erscheinen im Jahre 1951 nichts an Aktualität verloren hat: der Klassiker!<br />
[16] Schneider, W.:<br />
Deutsch fürs Leben.<br />
Reinbek (rororo) 1997, ISBN 3-499-19695-6.<br />
Eine kurze und knackige Anleitung für Autoren, denen ihre Leser nicht gleichgültig sind. Ein Buch, das meine<br />
Sicht auf Bücher nachhaltig verändert hat.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-29
1-30
Literatur (7)<br />
zu Verständlichkeit und Stil (Forts.)<br />
[17] Rechenberg, P.:<br />
Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker<br />
München, Wien (Carl Hanser) 2002, ISBN 3-446-21944-7.<br />
Eine auf vor allem auf <strong>die</strong> Informatik gezielte Stilkunde, <strong>die</strong> den Leser durch zahlreiche Beispiele und eine<br />
Menge von nützlichen Details erfreut.<br />
zur Typographie<br />
[18] Gulbins, J., Kahrmann, Ch.:<br />
Mut zur Typographie.<br />
Berlin u.a. (Springer) 1993, ISBN 3-540-55708-3.<br />
eine sehr gute Einführung in <strong>die</strong> Textgestaltung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-31
1-32
Literatur (8)<br />
zur Methodik und Geschichte der technischen Dokumentation<br />
[19] Karen A. Shriver:<br />
Dynamics in Document Design.<br />
New York u.a. (Wiley Computer Publishing) 1997, ISBN 0471-30636-3.<br />
Der Impetus ist: „Creating texts for readers!“. Ein spannendes Buch über ein<br />
(nur scheinbar) trockenes Thema.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-33
1-34
Inhaltsübersicht (1)<br />
Hinweise zum Inhalt von technischen Dokumenten<br />
1. Modellbildung – Systemtheoretische Grundbegriffe<br />
2. Schema für den Aufbau einer ingenieurwissenschaftlichen Arbeit<br />
3. Tabellen und Illustrationen –<br />
kompakte Darstellung komplexer Sachverhalte<br />
Vorgehen bei der Erstellung von Dokumenten<br />
4. Von der Idee zur fertigen Arbeit – systematische Vorgehensweise<br />
5. Der weiße Bildschirm – einige Kreativitätstechniken<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-35
1-36
Inhaltsübersicht (2)<br />
Hinweise zu Sprache und Form<br />
6. Verständlichkeit und guter Stil<br />
7. Wissenschaftssprache<br />
8. Formale Gestaltung – Grundelemente der Typographie<br />
9. Hinweise zur Durchführung von Präsentationen<br />
Ausblick<br />
10. Bewertung von wissenschaftlichen Arbeiten – ein Kriterienkatalog<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-37
1-38
Zum Ablauf (1)<br />
Vortrag Luttenberger<br />
— zu den angegebenen Themen<br />
— bevorzugt in den Veranstaltungsstunden zu Semesteranfang<br />
Präsenz!übungen<br />
— gemeinsame Einübung einzelner Schritte aus dem Gesamtprozeß des<br />
Document Design<br />
— Kurzpräsentationen (ggf. nach häuslicher Vorbereitung)<br />
— max. 18 Tln.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-39
1-40
Für das nächste Mal … (1)<br />
Entwickeln Sie einen kurzen Text und 2 – 3 Folien<br />
zu den folgenden Themen:<br />
1. Meine Erfahrungen beim Schreiben<br />
2. Was ich von <strong>die</strong>ser Veranstaltung erwarte<br />
— Vortrag und Diskussion in der nächsten Stunde<br />
— Voraussetzung für weitere Teilnahme<br />
unterschriebener Teilnahmevertrag<br />
Text u. Präsentation (s.o.!)<br />
(Auswahl per Los)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-41
1-42
Zuletzt: ein guter Rat … (1)<br />
„To be a good writer, here are six words of advice:<br />
READ, READ, READ and WRITE, WRITE, WRITE.“<br />
Ernest J. Gaines<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-43
1-44
... ach, übrigens:<br />
Fragen und Kritik<br />
sind erwünscht!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-45<br />
(1)
1-46
20modell.fm<br />
1. SYSTEMTHEORETISCHE<br />
GRUNDBEGRIFFE<br />
1. Lernziele<br />
2. Schulaufsätze<br />
3. Modellbildung<br />
4. Systemtheorie<br />
5. ein längeres Zitat …<br />
6. Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise<br />
7. Exkurs: Architektur und Poesie<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Ropohl, G.:<br />
Eine Systemtheorie der Technik.<br />
Wien (Hanser) 1979, ISBN 3-446-12801-8.<br />
[2] Speck, J. (Hrsg.)<br />
Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. 3 Bd.<br />
München u.a. (UTB) 1980, ISBN 3-525-03313-3, 3-525-03314-1, 3-525-03316-8.<br />
1-2
Lernziele (1)<br />
Sie sollen lernen, wie man Modelle für technische Artefakte<br />
gezielt entwickelt, um <strong>die</strong>se für ihre Beschreibung zu nutzen.<br />
anders:<br />
Sie sollen ein Gerüst für den inhaltlichen Aufbau einer<br />
ingenieurwissenschaftlichen Darstellung bekommen.<br />
— aber nicht:<br />
Vorgabe einer Gliederung, <strong>die</strong> man nur noch abschreiben muß, oder<br />
einer verbindlichen Menge von Überschriftentiteln<br />
— sondern:<br />
Entwicklung einer abstrakten Gliederung, einer „Meta-Gliederung“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-3
Lernziel<br />
Um ein „reales Ding“ beschreiben zu können, muß man es sich handhabbar machen. Auch hier hilft Cäsars divide et impera, d.h. <strong>die</strong> Aufteilung<br />
des „ganzen Dings“ in einzelne Teile. Diese einzelnen Teile sind in Verbindung mit dem Thema der Beschreibung, um das es ja hier<br />
geht, <strong>die</strong> verschiedenen, einzelnen Aspekte (lat. Ansichten, Sichtweisen), unter denen wir unser Ding sehen können. Eine Beschreibung<br />
spaltet also ein Ding auf einelne Aspekte, <strong>die</strong> begrifflich erfaßbar sind, und klärt <strong>die</strong> Zuordnung <strong>die</strong>ser Aspekte zueinander. Dieser Prozeß<br />
soll hier als Modellierung (oder Modellbildung) bezeichnet werden. Im engeren Sinne geht es um das Erlernen einer Systematik für <strong>die</strong>sen<br />
Prozeß der Modellbildung. Die Sichtweisen sollen dabei nicht zufällig gewählt sein, sondern dem Ding angemessen sein. Und sie sollen<br />
so gewählt sein, daß sie zusammengenommen eine möglichst vollständige Sicht ergeben. Die unter <strong>die</strong>sen Anforderungen zu entwikkelnde<br />
Systematik soll vor allem auf auf technische Artefakte bezogen sein. Wobei wir noch sehen werden, daß sich ein ähnliches Vorgehen<br />
auch für andere Artefakte (z.B. Architektur und Poesie) anwenden läßt.<br />
1-4
Schulaufsätze (1)<br />
vier Typen<br />
— der Erlebnisaufsatz: „Mein schönstes Ferienerlebnis“<br />
1. Ort, Zeit und Anlaß<br />
2. Konflikt, Spannungsaufbau<br />
3. Kulmination<br />
4. Auflösung<br />
„Strickmuster“<br />
(„Metagliederung“)<br />
— <strong>die</strong> dialektische Erörterung: „Soll England mit einem Tunnel<br />
an das Festland angeschlossen werden?“<br />
1. Einleitung<br />
2. drei Pro-Argumente<br />
3. drei Contra-Argumente<br />
4. Synthese<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-5
1-6
Schulaufsätze (2)<br />
vier Typen (Forts.)<br />
— <strong>die</strong> Textinterpretation<br />
1. Inhaltswiedergabe<br />
2. formale Analyse<br />
3. (historische, psychologische, biographische, …) Deutung<br />
4. (Bezug zu ähnlichen Texten, Rezeptionsgeschichte)<br />
— <strong>die</strong> Gegenstandsbeschreibung<br />
1. „Zerlegung“ in Komponenten (z.B. Vorder-, Mittel-, Hintergrund)<br />
2. Komponentenbeschreibung: Form, Farbe, Material, …<br />
3. Deutung<br />
4. (Bezug zu ähnlichen Objekten, Rezeptionsgeschichte)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-7
1-8
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-9
1-10
Schulaufsätze (3)<br />
Gibt es „Strickmuster“ zur Beschreibung technischer Artefakte?<br />
meine These:<br />
Die systemtheoretischen Grundbegriffe liefern ein Gerüst<br />
für <strong>die</strong> Beschreibung technischer Artefakte.<br />
Sichtweise:<br />
Die Beschreibung ist ein Modell des zu beschreibenden Gegenstands.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-11
1-12
Modellbildung (1)<br />
Was ist ein Modell?<br />
— Brockhaus:<br />
„Modell: … vereinfachende bildliche oder mathematische Darstellung<br />
von Strukturen, Funktionsweisen …“<br />
— eigener Versuch:<br />
Modelle sind Abbilder realer Gegenstände, bei denen stets gewisse Sichtweisen<br />
verstärkt werden, während andere vernachlässigt werden. Die Sichtweisen, <strong>die</strong><br />
stärker herausgearbeitet werden, sind <strong>die</strong>jenigen, für <strong>die</strong> man sich gerade besonders<br />
interessiert.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-13
Modellbildung<br />
An der aus dem Brockhaus entnommenen Definition finde ich zweierlei sehr bemerkenswert: Zum einen wird der Begriff „Modell“ direkt in<br />
Zusammenhang mit dem Thema „Darstellung“ gebracht, zum anderen tauchen <strong>die</strong> beiden Begriffe Struktur und Funktion auf. Diese werden<br />
uns im folgenden noch beschäftigen.<br />
1-14
Modellbildung (2)<br />
Beispiele für Modelle<br />
— Grundriß eines Hauses: zeigt <strong>die</strong> Raumaufteilung,<br />
aber nicht <strong>die</strong> Fassadengestaltung, <strong>die</strong> Leitungsführung,<br />
<strong>die</strong> Fenstergestaltung, <strong>die</strong> Raumhöhe, <strong>die</strong> diversen Materialien usw.<br />
— Modelleisenbahn: möglichst detailgetreue verkleinerte Nachbildung,<br />
fast ausschließlich mit elektrischen Antriebsaggregaten<br />
— Dampfmaschine: verkleinertes und vereinfachtes Abbild einer Dampfmaschine<br />
zur Darstellung des Prinzips der Energieumwandlung in einer Dampfmaschine<br />
— elektrischer Schaltplan: möglichst übersichtliche Darstellung der Verbindungen<br />
zwischen den einzelnen Bauelementen: Verdeutlichung des Signalflusses.<br />
Nicht identisch mit dem Layout einer Schaltung!<br />
— Simulationsmodell: Funktionale Zusammenhänge werden in Form von<br />
Programmen/Prozeduren nachgebildet. Simulation verzichtet auf Nachbildung<br />
des Echtzeitverhaltens (→ Emulation).<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-15
1-16
Modellbildung (3)<br />
Modell zeichnet sich durch drei Merkmale aus:<br />
1. Abbildungsmerkmal:<br />
„Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen<br />
natürlicher oder künstlicher Originale.“<br />
2. Verkürzungsmerkmal:<br />
„Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten<br />
Originals, sondern nur solche, <strong>die</strong> den jeweiligen Modellerschaffern und/oder<br />
Modellnutzern relevant erscheinen.“<br />
3. pragmatisches Merkmal:<br />
„Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet.<br />
Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion<br />
(1) für bestimmte – erkennende und/oder handelnde, modellbenutzende – Subjekte,<br />
(2) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und<br />
(3) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen.“<br />
Stachowiak, zitiert nach Ropohl, S. 91<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-17
1-18
Modellbildung (4)<br />
Um reale Systeme beschreiben zu können, müssen wir sie modellieren …<br />
— mit „Papier und Bleistift“ (nicht mit Pappe, Schere und Uhu)<br />
— mit Worten und Graphiken (nicht mit Programmen)<br />
aber:<br />
— Es gibt eine ungeheure Vielzahl von Modellierungsmöglichkeiten!<br />
Kann man Aussagen gewinnen, wann ein System<br />
„richtig“ modelliert worden ist?<br />
Welche Modellkategorien gibt es?<br />
Welche muß man (gemeinsam) benutzen,<br />
um ein System vollständig zu beschreiben?<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-19
1-20
Systemtheorie (1)<br />
Systemtheorie: eine „Interdisziplin“,<br />
<strong>die</strong> sich mit den Eigenschaften von Systemen beschäftigt,<br />
<strong>die</strong> allen Systemen gemeinsam sind.<br />
Systemtheorie liefert eine umfassende Sicht auf Systeme.<br />
„Systeme [stellen] <strong>die</strong> theoretischen Werkzeuge [dar], <strong>die</strong> es<br />
uns ermöglichen, <strong>die</strong> Erkenntnis der Wirklichkeit zu organisieren.<br />
Im strengen Sinne ’ist’ ein System also nicht mehr und<br />
nicht weniger als <strong>die</strong> systemtheoretische Darstellung des<br />
Gegenstandes; ein System ist ein Modell, das sich der Mensch<br />
von der Realität macht.“<br />
(Ropohl, S. 90)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-21
1-22
Systemtheorie (2)<br />
System: ein von seiner Umgebung abgrenzbares Gebilde<br />
zwei Beschreibungskonzepte<br />
System Umgebung<br />
1. das strukturale Systemkonzept: Ein System besteht<br />
aus einer Menge von Komponenten und den Relationen zwischen ihnen.<br />
2. das funktionale Systemkonzept: Das System wird durch sein Verhalten in einer<br />
Umgebung beschrieben:<br />
„Der funktionale Systemaspekt behandelt nicht Dinge, sondern Verhaltensweisen<br />
und fragt nicht Was ist <strong>die</strong>ses Ding?, sondern Was tut es?“<br />
Ropohl, S. 55<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-23
1-24
Systemtheorie (3)<br />
Strukturales Systemkonzept: Der innere Aufbau eines Systems wird dargestellt.<br />
Bsp. für Elemente Bsp. für Relationen<br />
Komponente<br />
Relation<br />
System<br />
ICs auf einer Platine „ist verbunden mit“ (ungerichtete Kante!)<br />
Programme in einem Prog.-system „liefert Parameter an“, „empfängt P. von“<br />
Abteilungen in einer Verwaltung „leitet Formular weiter an“, „empfängt F. von“<br />
Instanzen in einem Kommunikationssyst. „benutzt Dienste der unterlagerten Schicht“,<br />
„stellt Dienste zur Verfügung an“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-25
Das strukturale Systemkonzept<br />
„Dem strukturalen Ansatz geht es um <strong>die</strong> Vielfalt möglicher Beziehungsgeflechte, <strong>die</strong> in einer gegebenen Menge von Elementen bestehen<br />
können, und den daraus resultierenden Systemeigenschaften sowie um <strong>die</strong> Beschaffenheit der Elemente, <strong>die</strong> erforderlich ist, <strong>die</strong>se für<br />
eine Integration in ein System zu qualifizieren; … Strukturales Systemdenken beruht auf dem Grundsatz, daß Elemente nicht isoliert, nicht<br />
losgelöst von ihrem Konnex betrachtet werden dürfen, sondern in ihrer Interdependenz mit anderen Elementen innerhalb eines umfassenden<br />
Systems zu sehen sind.“ ([1], S. 54)<br />
1-26
Systemtheorie (4)<br />
Strukturales Systemkonzept:<br />
Der innere Aufbau eines<br />
Systems wird dargestellt.<br />
— ein schönes Beispiel:<br />
<strong>die</strong> Explosionszeichnung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-27
1-28
Systemtheorie (5)<br />
Strukturales Systemkonzept: einige typische Systemstrukturen<br />
Serienschaltung<br />
Rückkopplung<br />
Parallelschaltung<br />
vermaschte Struktur zentralistische Struktur<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-29
1-30
Systemtheorie (6)<br />
Strukturales Systemkonzept – eine wichtige Erweiterung :<br />
das hierarchische Systemkonzept<br />
Komponenten in einem System sind selber wiederum Systeme:<br />
→ Subsysteme<br />
— Die Hierarchiebildung steigert <strong>die</strong> Übersichtlichkeit von Modellen!<br />
— Die Hierarchiebildung hilft bei der Bildung von Abstraktionen!<br />
— Die Hierarchiebildung erlaubt <strong>die</strong> Wiederverwendung von Strukturblöcken.<br />
— „Divide et impera!“ findet sinnvollerweise auf einer hohen<br />
Hierarchieebene statt!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-31
Das strukturale Systemkonzept<br />
Neben das strukturale und das funktionale Systemkonzept stellt Ropohl [1] als drittes gleichberechtigtes Systemkonzept das hierarchische<br />
Systemkonzept. Wir sind hier der Ansicht, daß <strong>die</strong>ses Konzept nur ein „Unterkonzept“ des strukturalen Systemkonzepts ist und führen es<br />
deshalb hier auf. Es ist allerdings ein entscheidend wichtiges „Unterkonzept“.<br />
1-32
Systemtheorie (7)<br />
Strukturales Systemkonzept – zwei häufig verwechselte Begriffe …<br />
Kompliziertheit:<br />
„Von komplizierten Systemen spricht man, wenn sie eine größere Anzahl von verschiedenartiger<br />
Subsysteme enthalten; das Maß der Kompliziertheit, <strong>die</strong> Varietät,<br />
wird durch <strong>die</strong> absolute Zahl unterscheidbarer Subsysteme oder durch den dualen<br />
Logarithmus <strong>die</strong>ser Zahl angegeben.“<br />
Komplexität:<br />
„Komplexe Systeme zeichnen sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Relationen<br />
aus.“<br />
Ropohl, S. 71<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-33
1-34
Systemtheorie (8)<br />
Funktionales Systemkonzept:<br />
Beschreibung des Systemverhaltens unter Abstraktion vom inneren Aufbau<br />
Beispiele:<br />
Kennlinien von Regel-/Übertragungsstrecken, Verstärkern, Lautsprechern, …<br />
Interface-Beschreibung von Objekten in einer OO-Sprache<br />
globale Sicht auf das Börsengeschehen<br />
…<br />
Inputs<br />
innere Zustände<br />
System<br />
Outputs<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-35
1-36
Systemtheorie (9)<br />
Funktionales Systemkonzept: Beispiele für formale Modelle<br />
— Differentialgleichungen, z.B. in der Elektrotechnik<br />
Leistung am Kondensator: p C , an der Spule:<br />
d<br />
---- u<br />
dt<br />
2 = ( ⁄ 2)<br />
p L d<br />
---- i<br />
dt<br />
2 = ( ⁄ 2)<br />
— Automatenmodelle, z.B. TCP-Verbindungsmanagement (Server)<br />
SYN_rcvd<br />
FIN_wait_1<br />
FIN_wait_2<br />
closed<br />
listen<br />
established<br />
closing<br />
time_wait<br />
close_wait<br />
last_ACK<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-37
1-38
Systemtheorie (10)<br />
Funktionales Systemkonzept: Beispiele für formale Modelle (Forts.)<br />
— Automatenmodell für einen HDLC-Receiver (vereinfacht)<br />
DISC sent<br />
RR<br />
REJ sent<br />
CR Connect Request<br />
DR Disconnect Req.<br />
UA<br />
DR/DISC<br />
Invalid N(S)/REJ<br />
I-frame<br />
DISC/UA<br />
disconnected<br />
data transf.<br />
SABM/UA<br />
CR/SABM<br />
Busy/RNR RNR/RR<br />
Clear/RR<br />
RR<br />
Station busy<br />
Remote<br />
stat. busy<br />
SABM sent<br />
waiting for<br />
ACK<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-39<br />
UA<br />
Timer exp./<br />
RR(P=1)<br />
RR(F=1)<br />
I-frame/RR
1-40
Systemtheorie (11)<br />
Funktionales Systemkonzept: weitere Beispiele für formale Modelle<br />
— Petrinetze<br />
s 3<br />
t 2<br />
s 1<br />
t 1<br />
s 4<br />
s 2<br />
t 3<br />
Modell für ein unbeschränktes System<br />
Die Bedingung für Beschränktheit gilt nicht:<br />
∀ M∈[M 0>, s∈S : M(s) ≤ B(s)<br />
M(s) Markierungsfunktion<br />
S Menge der Stellen des Netzes<br />
B(s) Beschränkung für <strong>die</strong> Anzahl der Marken<br />
in einer Stelle<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-41
1-42
Systemtheorie (12)<br />
Funktionales Systemkonzept – eine wichtige Variante des funktionalen Systemkonzepts:<br />
das operationale Systemkonzept<br />
— Ein System wird nur hinsichtlich seiner Benutzung beschrieben.<br />
— Augenmerk liegt auf „Benutzerfreundlichkeit“.<br />
— Beispiel:<br />
Gebrauchsanweisungen<br />
Fahrschule<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-43
1-44
Systemtheorie (13)<br />
formale Definitionen<br />
System:<br />
„Ein echtes System [liegt] dann und nur dann [vor] …, wenn gleichermaßen<br />
Funktionen, eine Struktur und eine Umgebung angebbar sind.“ [1], S.66<br />
Attribut:<br />
„Ganz allgemein ist ein Attribut ein Merkmal oder eine Eigenschaft,<br />
<strong>die</strong> sich einem System ohne Berücksichtigung seines inneren Aufbaus<br />
zusprechen läßt.“ [1], S. 61<br />
Anschaulich: Eingänge, Ausgänge, innere Zustände<br />
Formal: eine nicht-leere Menge von „Eigenschaftsausprägungen“<br />
Funktion:<br />
eine echte Teilmenge des kartesischen Produkts zwischen i Attributen<br />
eines (Sub-)Systems<br />
Relation:<br />
eine echte Teilmenge des kartesischen Produkts zwischen je einem Attribut<br />
verschiedener Subsysteme/Komponenten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-45
1-46
Systemtheorie (14)<br />
eine Klassifikation von Systemen<br />
Merkmal Merkmalsausprägungen<br />
Seinsbereich konkret abstrakt<br />
Entstehungsart natürlich künstlich<br />
Verhältnis zur Umgebung abgeschlossen relativ isoliert offen<br />
Zeitabhängigkeit der Funktion statisch dynamisch<br />
Zeitabhängigkeit der Attributwerte kontinuierlich diskret<br />
Verteilung der Attributwerte kontinuierlich diskret<br />
Verhaltensform instabil metastabil stabil<br />
Funktionstyp linear nicht-linear<br />
Strukturform nicht-rückgekoppelt gegengekoppelt mitgekoppelt<br />
Grad der Bestimmtheit deterministisch stochastisch<br />
Zeitabhängigkeit der Struktur starr flexibel<br />
Anzahl der Subsysteme einfach kompliziert<br />
Anzahl der Relationen einfach komplex<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-47
1-48
Systemtheorie (15)<br />
eine Klassifikation von Systemen (Forts.)<br />
— analoge und digitale Systeme<br />
Verteilung der<br />
Attributwerte<br />
Zeitabhängigkeit der<br />
Attributwerte<br />
analoge Systeme digitale Systeme<br />
kontinuierlich diskret<br />
kontinuierlich diskret<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-49
1-50
Systemtheorie (16)<br />
das Theorem der Systemtheorie:<br />
Die Funktion eines Systems kann aus seiner Struktur abgeleitet<br />
werden, umgekehrt läßt sich jedoch eine bestimmte Funktion<br />
durch mehrere unterschiedliche Systemstrukturen realisieren.<br />
… deshalb:<br />
In einer vollständigen Systemmodellierung müssen<br />
Funktion und Struktur dargestellt werden.<br />
In einer systematischen Darstellung ist von der Funktion eines Systems<br />
auszugehen.<br />
Es muß der Nachweis geführt werden, warum <strong>die</strong> gewählte Struktur<br />
<strong>die</strong> angestrebte Funktion erfüllt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-51
1-52
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (1)<br />
Komplexität des Chipdesigns<br />
— pro Chip ggf. mehrere Millionen Transistoren<br />
— keine Korrektur nach Fertigung möglich<br />
— ASIC-Design soll ermöglicht werden<br />
— teurer Fertigungsprozeß<br />
erneutes Nachdenken über den Designprozeß!<br />
— Entwicklung einer eigenen Designmethodik<br />
— Aufteilung des Designprozesses in<br />
hierachische Schichten verschiedene „Entwurfsdomänen“<br />
System Verhalten: behavioral domain<br />
Architektur Struktur: structural domain<br />
Registertransfer<br />
…<br />
Geometrie: physical domain, layout<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-53
Literaturempfehlungen<br />
[1] Bleck, A., Goedecke, M., Huss, S.A., Waldschmidt, K.: Praktikum des modernen VLSI-Entwurfs.<br />
Stuttgart (B.G. Teubner) 1996, ISBN 3-519-02296-6<br />
[2] Eschermann, B.: Funktionaler Entwurf digitaler Schaltungen.<br />
Berlin u.a. (Springer-Verlag) 1993, ISBN 3-540-56788-7<br />
[3] Grosspietsch, K.-E., Vierhaus, H.Th.: Entwurf hochintegrierter Schaltungen.<br />
Mannheim u.a. (BI-Wissenschaftsverlag) 1994, ISBN 3-411-16661-4<br />
[4] Kropf, Th.: VLSI-Entwurf.<br />
Bonn u.a. (International Thomson Publ.) 1995, ISBN 3-8266-0163-7<br />
[5] Rauscher, R.: Entwurfsmethodik hochintegrierter anwendungsspezifischer digitaler Systeme.<br />
Sinzheim (Pro Universitate Verl.) 1996, ISBN 3-930747-55-3<br />
1-54
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (2)<br />
Hierarchische Schichten:<br />
System-<br />
Ebene<br />
Architektur-<br />
Ebene<br />
zunehmende<br />
Detaillierung<br />
Registertransfer-<br />
Ebene<br />
Leistungsanforderungen: Durchsatz, Latenzzeit usw.;<br />
Operationsprinzip eines Systems (sequentiell/parallel;<br />
MIMD/SIMD; Speicher-/Leitungskopplung); Cluster aus<br />
Prozessoren, Speichern usw.;<br />
Algorithmen; Parallelarbeit im System, Verbindungsstrukturen:<br />
Busse, sternförmige Signale, …; Zusammenwirken von ggf.<br />
unterschiedlichen Prozessoren; Speichersystem (RAM, ROM,<br />
EPROM, …);<br />
Zustandsgraphen; ALU, Register, Multiplexer; Befehlssätze;<br />
Mikrooperationen<br />
Logik-Ebene Boolesche Gleichungen; Gatter;<br />
Transistor-Ebene<br />
Geometrie-Ebene<br />
Differentialgleichungen; Transistoren, Widerstände,<br />
Kondensatoren, Induktivitäten, Leiterbahnen<br />
geometrische Objekte, schichtenweise übereinander liegende,<br />
verschieden dotierte Halbleitermaterialien, Leiterbahnen, …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-55
1-56
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (3)<br />
Hierarchische Schichten (Forts.)<br />
— Schichtenbildung bringt erhebliche Vereinfachung des Entwurfsprozesses:<br />
Hierarchie-Ebene Anzahl der Blöcke/Entwurf<br />
System-Ebene 10<br />
Architektur-Ebene 100<br />
Logik-Ebene 10 000<br />
Geometrie-Ebene 1 000 000<br />
nach [Rauscher]<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-57
1-58
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (4)<br />
Entwurfsdomänen (nach [Bleck u.a.] ):<br />
— Verhalten:<br />
„Ein Systementwickler verwendet <strong>die</strong> Verhaltensbeschreibung, wenn er spezifizieren will, was ein<br />
Entwurfsobjekt bewerkstelligt, und nicht, wie es aufgebaut ist. Dabei handelt es sich um eine<br />
Beschreibung des Objektverhaltens mittels [ … ] Prozeduren, <strong>die</strong> das beobachtbare Ein-<br />
/Ausgangsverhalten über der Zeit definieren.“<br />
— Struktur:<br />
„Die Strukturbeschreibung [ … ] spezifiziert das Objekt mittels einer Verbindungsstruktur<br />
primitiverer Komponenten.“<br />
— Geometrie:<br />
„Die Beschreibung der Geometrie eines Entwurfsobjektes beinhaltet geometrische Objekte, <strong>die</strong><br />
zwei- oder quasi dreidimensional (mittel ’layer’) definiert sind. Eine direkte Zuordnung <strong>die</strong>ser<br />
Objekte zur Funktionalität der Komponente ist nicht gegeben. Sie muß unter Verwendung einer<br />
zwischengeschalteten Strukturbeschreibung gewonnen werden.“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-59
1-60
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (5)<br />
Hierarchieebenen und Entwurfsdomänen im Gajski-Diagramm<br />
Struktur<br />
Netzwerk<br />
Blockschaltbild<br />
RT-Diagramm<br />
Schaltplan<br />
Stickdiagramm<br />
System<br />
Architektur<br />
Registertransfer<br />
Logik<br />
elektr.<br />
Verhalten<br />
Anforderungen<br />
Algorithmen<br />
Daten- u. Steuerfluß<br />
boolsche Gleichungen<br />
Differentialgleichungen<br />
symbol. Layout<br />
Zellen<br />
Floorplan<br />
Cluster<br />
Geometrie<br />
Systempartitionierung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-61
1-62
Beispiel: Entwicklung hochintegrierter Schaltkreise (IC-Design) (6)<br />
systematische Unterstützung des Designprozesses durch<br />
CAD-Werkzeuge:<br />
Entwurfsaufwand in Person Months<br />
Funktions- u. Logikentwurf 100 Layout 70<br />
Funktion 40 Logik 60<br />
10 50<br />
10/2<br />
2/1<br />
2<br />
0,3<br />
0,1<br />
0,1<br />
bis 1979<br />
1980-81<br />
1982-84<br />
1985-87<br />
seit 1988<br />
aus: [Rauscher]<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-63
1-64
Exkurs: Architektur und Poesie (1)<br />
in beiden Bereichen ein zu Funktion & Struktur vergleichbare<br />
Doppelbegrifflichkeit:<br />
— in Architektur und Design: Funktion und Form<br />
(„Form follows function.“)<br />
— in der Poesie: Sinn und Form<br />
(Gedichtinterpretation)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-65
1-66
Exkurs (2)<br />
Architektur<br />
Was halten Sie von dem folgenden Auszug aus einer Beschreibung<br />
der Georgenkirche in Wismar?<br />
„ … Dieser Chor von einem Bau vom Ende des 13., Anfang des 14. Jhdts., dem zweiten<br />
Bau an <strong>die</strong>ser Stelle, in drei Jochen basilikal angelegt, nach Osten platt geschlossen.<br />
Im Inneren Achteckpfeiler und profilierte Arkaden; <strong>die</strong> Kreuzrippengewölbe auf<br />
Diensten, <strong>die</strong> über der Kämpferzone der Pfeiler beginnen. In der Ostwand des Chormittelschiffes<br />
zwei große Spitzbogenfenster. Am Außenbau Strebepfeiler und offene<br />
Strebebögen; Kleeblattbogenfriese, im Giebel großes Blendenkreuz, Spitzbogen- und<br />
Kreisblenden, eine Kreisblende auch über den beiden Chorfenstern. –“<br />
Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR: Mecklenburgische Küstenregion.<br />
München (C.H. Beck) 1990, ISBN 3-406-32763-X<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-67
1-68
Exkurs (3)<br />
Architektur<br />
Und was halten Sie von <strong>die</strong>sen beiden Aussagen zur romanischen<br />
Kirchenarchitektur?<br />
„Meine Bewunderung für <strong>die</strong> romanische Kunst kam natürlich nicht von ungefähr. Ich<br />
hatte mich schon früher [ … ] in den Bann ziehen lassen von … ja, wovon eigentlich?<br />
Der Schlichtheit? Der Geradlinigkeit? Den seltsamen Phantasien? Ich weiß es nicht.<br />
Nicht so recht jedenfalls. Vielleicht kam es daher, weil <strong>die</strong>se Kunst keine richtige Vorgängerin<br />
hatte. Natürlich stimmt auch das wieder nicht ganz, es gibt von römischen<br />
Basiliken beeinflußte Bauformen, <strong>die</strong> ersten Mönche hatten Tier- und Pflanzenmotive<br />
aus dem Mittleren und Fernen Osten mitgebracht, und <strong>die</strong> christliche Symbolik existierte<br />
schon seit Jahrhunderten, aber trotzdem ist <strong>die</strong>s <strong>die</strong> erste große europäische<br />
Kunst nach der Antike, und sie strahlt einen solch unverwechselbaren Charakter und<br />
ein eigenes Weltbild aus, sie ist so völlig verwoben mit dem, was gedacht und geglaubt<br />
wurde – was damals das gleiche war –, daß man sagen kann, hier ist ein Weltbild<br />
Stein geworden. Auf einem anderen Blatt steht, ob wir <strong>die</strong>ses Bild noch lesen können,<br />
… „<br />
Cees Noteboom:<br />
Der Umweg nach Santiago.<br />
Frankfurt (Suhrkamp) 1992<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-69
1-70
Exkurs (4)<br />
Gerberschweier (Elsaß)<br />
Stich von 1828<br />
„Der romanische Kirchenbau hat massive Mauern, <strong>die</strong> den heiligen<br />
geweihten Raum abtrennen von der profanen Welt draußen.<br />
Außen gruppieren sich <strong>die</strong> <strong>die</strong> kubischen, stereometrischen<br />
Körper zum Bild einer Gottesstadt, <strong>die</strong>, von Türmen<br />
gewaltig überragt, Ausdruck der Macht und Stärke des Herrn<br />
bekundet, dem Psalmwort gemäß: ’Wer ist <strong>die</strong>ser König der<br />
Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im<br />
Streit.’ Es ist <strong>die</strong> Ecclesia militans und zugleich <strong>die</strong> Ecclesia triumphans,<br />
<strong>die</strong> uns in <strong>die</strong>sen gebauten Visionen doppelter Dreiturmgruppen<br />
erscheinen. Schon im karolingischen Westwerk<br />
der Corveyer Kirche besagt eine Inschriftentafel aus der Gründungszeit:<br />
Umhege du, o Herr, <strong>die</strong>se Stadt, und laß deine<br />
Engel <strong>die</strong> Wächter ihrer Mauern sein!<br />
Große Doppelturmfassaden sind <strong>die</strong>sen Gottesburgen vogestellt.<br />
Römischer Tempelbau kennt solches nicht, doch antike<br />
Stadttorarchitektur weist auf <strong>die</strong> Herkunft des Motivs. Im Kirchenbau<br />
des Mittelalters erfährt es schließlich seine höchste<br />
Bedeutungssteigerung. …“<br />
Legner, A., Hirmer, A., Hirmer, I.:<br />
Romanische Kunst in Deutschland.<br />
München (Hirmer) 1996, ISBN 3-7774-7340-5<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-71
1-72
Exkurs (5)<br />
Poesie<br />
Versuchen wir gemeinsam eine Interpretation …<br />
ottos mops<br />
ottos mops trotzt<br />
otto: fort mops fort<br />
ottos mops hopst fort<br />
otto: soso<br />
otto holt koks<br />
otto holt obst<br />
otto horcht<br />
otto: mops mops<br />
otto hofft<br />
ottos mops klopft<br />
otto: komm mops komm<br />
ottos mops kommt<br />
ottos mops kotzt<br />
otto: ogottogott<br />
Ernst Jandl<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 1-73
1-74
21gliederung.fm<br />
2. SCHEMA FÜR DEN<br />
AUFBAU EINER<br />
INGENIEURWISSEN-<br />
SCHAFTLICHEN ARBEIT<br />
1. Lernziele<br />
2. Technische Darstellungen<br />
3. Die einzelnen Kapitel<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Ropohl, G.:<br />
Eine Systemtheorie der Technik.<br />
Wien (Hanser) 1979, ISBN 3-446-12801-8.<br />
[2] Speck, J. (Hrsg.)<br />
Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. 3 Bd.<br />
München u.a. (UTB) 1980, ISBN 3-525-03313-3, 3-525-03314-1, 3-525-03316-8.<br />
2-2
Lernziele (1)<br />
Sie sollen lernen, wie man Modelle für technische Artefakte<br />
gezielt entwickelt, um <strong>die</strong>se für ihre Beschreibung zu nutzen.<br />
anders:<br />
Sie sollen ein Gerüst für den inhaltlichen Aufbau einer<br />
ingenieurwissenschaftlichen Darstellung bekommen.<br />
— aber nicht:<br />
Vorgabe einer Gliederung, <strong>die</strong> man nur noch abschreiben muß, oder<br />
einer verbindlichen Menge von Überschriftentiteln<br />
— sondern:<br />
Entwicklung einer abstrakten Gliederung, einer „Meta-Gliederung“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-3
Lernziel<br />
Um ein „reales Ding“ beschreiben zu können, muß man es sich handhabbar machen. Auch hier hilft Cäsars divide et impera, d.h. <strong>die</strong> Aufteilung<br />
des „ganzen Dings“ in einzelne Teile. Diese einzelnen Teile sind in Verbindung mit dem Thema der Beschreibung, um das es ja hier<br />
geht, <strong>die</strong> verschiedenen, einzelnen Aspekte (lat. Ansichten, Sichtweisen), unter denen wir unser Ding sehen können. Eine Beschreibung<br />
spaltet also ein Ding auf einelne Aspekte, <strong>die</strong> begrifflich erfaßbar sind, und klärt <strong>die</strong> Zuordnung <strong>die</strong>ser Aspekte zueinander. Dieser Prozeß<br />
soll hier als Modellierung (oder Modellbildung) bezeichnet werden. Im engeren Sinne geht es um das Erlernen einer Systematik für <strong>die</strong>sen<br />
Prozeß der Modellbildung. Die Sichtweisen sollen dabei nicht zufällig gewählt sein, sondern dem Ding angemessen sein. Und sie sollen<br />
so gewählt sein, daß sie zusammengenommen eine möglichst vollständige Sicht ergeben. Die unter <strong>die</strong>sen Anforderungen zu entwikkelnde<br />
Systematik soll vor allem auf auf technische Artefakte bezogen sein. Wobei wir noch sehen werden, daß sich ein ähnliches Vorgehen<br />
auch für andere Artefakte (z.B. Architektur und Poesie) anwenden läßt.<br />
2-4
Technische Darstellungen (1)<br />
Rückbezug auf <strong>die</strong> systemtheoretische Modellbildung<br />
Funktion<br />
Struktur<br />
System Umgebung<br />
— Beide Sichtweisen: Funktion und Struktur müssen in einer Systembeschreibung<br />
auftauchen.<br />
— Problem: In welcher Reihefolge sollen Funktion und Struktur<br />
in einem linearen Text erläutert werden?<br />
— Ziel: eine Meta-Gliederung, <strong>die</strong> angibt, in welchen Schritten<br />
Funktion und Struktur eines Systems erläutert werden!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-5
2-6
Technische Darstellungen (2)<br />
„Theorem der Systemtheorie“:<br />
„Die Funktion eines Systems kann aus seiner Struktur abgeleitet werden, umgekehrt<br />
läßt sich jedoch eine bestimmte Funktion durch mehrere unterschiedliche<br />
Systemstrukturen realisieren.“<br />
Die Darstellung eines Systems stets muß bei der Funktion anfangen!<br />
Funktionsbeschreibung<br />
Strukturbeschreibung<br />
noch einige Zwischenschritte erforderlich<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-7
2-8
Technische Darstellungen (3)<br />
Funktion → gesellschaftlicher Zweck:<br />
Der „teleologische“ Funktionsbegriff greift über das betrachtete System hinaus. Beispiel:<br />
Das Getriebe eines Autos hat <strong>die</strong> Funktion, Drehzahl und Drehmoment an <strong>die</strong> jeweiligen<br />
Fahrerfordernisse anzupassen.<br />
Funktion → technisches Mittel:<br />
Der „deskriptive“ Funktionsbegriff beschränkt sich auf das betrachtete System. Beispiel:<br />
Das Getriebe eines Autos hat <strong>die</strong> Funktion, Drehzahl und Drehmoment der Motorkurbelwelle<br />
an Drehzahl und Drehmoment der Kardanwelle anzupassen.<br />
das „Ingenium“ einer technischen Entwicklung besteht<br />
in zwei Schritten:<br />
nach Ropohl, S. 61f<br />
1. Auffinden einer funktionellen Umsetzung Zweck → Mittel:<br />
„Lösungsansatz“<br />
2. Überführung der „Mittelfunktion“ in eine technische Struktur<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-9
2-10
Technische Darstellungen (4)<br />
Beispiele für Umsetzungen Funktion → Struktur<br />
1. gesellschaftliches Problem:<br />
Um <strong>die</strong> Umwelt zu entlasten, sollen PKWs nicht mehr als 3 l Kraftstoff auf 100 km verbrauchen.<br />
drei technische Lösungsansätze:<br />
Der Wirkungsgrad von PKW-Motoren muß so gesteigert werden, daß <strong>die</strong> heute übliche<br />
Motorleistung auch bei einem Einsatz von nicht mehr als 3 l Kraftstoff/100 km erbracht<br />
wird.<br />
oder:<br />
Der Abrollwiderstand von PKW-Reifen muß so gesenkt werden, daß <strong>die</strong> Leistung eines<br />
„3-Liter-Motors“ ausreicht, um einen PKW üblicher Größe unter normierten Bedingungen<br />
mit nur 3 l Kraftstoff über eine Distanz von 100 km zu fahren.<br />
oder:<br />
Das Gewicht von PKWs muß so gesenkt werden, daß <strong>die</strong> Leistung eines „3-Liter-<br />
Motors“ ausreicht, …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-11
2-12
Technische Darstellungen (5)<br />
Beispiele für Umsetzungen Funktion → Struktur (Forts.)<br />
2. gesellschaftliches Problem:<br />
Für ein Dokumentenarchiv soll ein Sicherungssystem entwickelt werden, durch das <strong>die</strong><br />
Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der gespeicherten Dokumente sichergestellt<br />
wird.<br />
technischer Lösungsansatz:<br />
Es soll ein System zur Verschlüsselung und digitalen Signatur von Dokumenten entwickelt<br />
werden.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-13
2-14
Technische Darstellungen (6)<br />
Beispiele für Umsetzungen Funktion → Struktur (Forts.)<br />
3. gesellschaftliches Problem:<br />
Für ein verteiltes Rechensystem soll ein Monitor entwickelt werden, mit dessen Hilfe<br />
systeminterne Berechnungs- und <strong>die</strong> Kommunikationsvorgänge beobachtet werden<br />
können. Es soll ein ereignisgesteuertes Beobachtungsverfahren angewendet werden.<br />
technischer Lösungsansatz:<br />
Es soll ein verteiltes Monitor-System entwickelt werden, das <strong>die</strong> von lokalen Monitoren<br />
beobachteten zeitbehafteten Ereignisspuren zu einer globalen Systemspur integriert.<br />
In der Systemspur sind alle lokal beobachteten Ereignisse auf der Basis einer globalen<br />
Zeitinformation nach zeitlicher Reihenfolge geordnet.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-15
2-16
Technische Darstellungen (7)<br />
Beispiele für Umsetzungen Funktion → Struktur (Forts.)<br />
4. gesellschaftliches Problem:<br />
Internet-Nutzer sollen <strong>die</strong> Möglichkeit haben, sich über alle Produkte einer Firma mit<br />
einem großen und sich rasch ändernden Produktspektrum umfassend zu informieren.<br />
Nebenbedingung: Der Aufwand für <strong>die</strong> Erstellung der Internet-Seiten soll so gering wie<br />
möglich sein.<br />
technischer Lösungsansatz:<br />
Es soll ein System entwickelt werden, mit dessen Hilfe HTML-Seiten dynamisch aus<br />
den Inhalten einer Produktdatenbank erstellt werden können. Dazu ist <strong>die</strong> Technik der<br />
Active Server Pages (oder eine ähnliche Technik) zu verwenden, über <strong>die</strong> Datenbankanfragen<br />
aus HTML-Requests erzeugt werden können.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-17
2-18
Technische Darstellungen (8)<br />
Metagliederung<br />
Problemstellung<br />
Systemumgebung<br />
Lösungsansatz<br />
Systemstruktur<br />
Bewertung<br />
Ausblick<br />
Kern der<br />
Ingenieurleistung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-19
2-20
Technische Darstellungen (9)<br />
1 Einführung<br />
— Problemstellung<br />
— Stand der Technik<br />
— Übersicht über <strong>die</strong> Arbeit<br />
2 Systemumgebung<br />
3 Lösungsansatz/Konzept<br />
Vergleich mit anderen Ansätzen, Begründung des eigenen Ansatzes<br />
4 Lösung: Systemstruktur<br />
5 Bewertung<br />
6 Ausblick<br />
A Anhänge<br />
B Verzeichnisse<br />
C Glossar<br />
D Index<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-21
Übersicht<br />
Wenn hier eine Gliederung angegeben wird, bedeutet das nicht, daß <strong>die</strong> einzelnen Gliederungspunkte 1:1 in eine Arbeit übernommen<br />
werden können. Es sind lediglich abstrakte Platzhalter, für <strong>die</strong> je nach der konkreten Aufgabenstellung bestimmte aus dem jeweiligen<br />
Zusammenhang stammende Überschriften eingesetzt werden müssen → Meta-Gliederung!<br />
2-22
Die einzelnen Kapitel (1)<br />
Die Einführung zerfällt in drei Teile:<br />
1. Problemstellung („Zweck“)<br />
präzise Aussage, welches Problem gelöst wird<br />
→ Einordnung in eine wissenschaftliche Systematik<br />
In welchem aktuellen Bezug steht das System?<br />
→ Einordnung in <strong>die</strong> wissenschaftliche Diskussion<br />
manchmal auch: eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
ein schlechtes Beispiel:<br />
„1.1 Problemstellung<br />
Die Aufgabe <strong>die</strong>ser Arbeit ist es, <strong>die</strong> Voraussetzungen für … zu analysieren.<br />
Das Ziel ist es, Möglichkeiten zu finden, das XYZ-Protokoll zu realisieren.“<br />
„Aufgabe“ → keine Identifikation des Bearbeiters mit dem Thema<br />
„Protokollrealisierung“ → vorweggenommene Lösung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-23
2-24
Die einzelnen Kapitel (2)<br />
Einführung (Forts.)<br />
2. Stand der Technik<br />
Nachweis, daß es sich um eine neuartige Lösung handelt<br />
Nachweis, daß es sich um eine Lösung unter spezifischen Bedingungen handelt<br />
3. Vorgehensweise/Übersicht über <strong>die</strong> Arbeit<br />
Warum ist <strong>die</strong> Arbeit so und nicht anders aufgebaut?<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-25
2-26
Die einzelnen Kapitel (3)<br />
Systemumgebung<br />
— Beeinflussung von Funktion und Struktur des Systems<br />
durch seine Umgebung<br />
In welcher Umgebung soll das System betrieben werden?<br />
zusätzliche spezielle Einsatzbedingungen: Klima, Mobilität,<br />
Qualifikation der Benutzer, …<br />
andere „außerhalb“ getroffene Entscheidungen<br />
— Randbedingungen<br />
Leistungsanforderungen?<br />
Zuverlässigkeitsanforderungen?<br />
Kostenrahmen?<br />
Zeitaufwand für <strong>die</strong> Lösung?<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-27
2-28
Die einzelnen Kapitel (4)<br />
Lösungsansatz<br />
— Vorstellung und Bewertung verschiedener Lösungsansätze<br />
(„Mittel zum Zweck“)<br />
<strong>die</strong> meisten Arbeiten:<br />
greifen einen bekannten Ansatz auf und verbessern im Detail<br />
eine Reihe von Arbeiten:<br />
kombinieren bekannte Ansätze<br />
<strong>die</strong> wenigsten Arbeiten:<br />
liefern neuartige Ansätze<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-29
2-30
Die einzelnen Kapitel (5)<br />
Systemstruktur<br />
— Zerlegung in Komponenten<br />
„Divide and conquer!“<br />
„Kunst des Machbaren“<br />
kreativer Schritt<br />
sinnvollerweise: hierarchischer Modellierungsansatz<br />
— je Hierarchieebene<br />
Zuordnung der Komponenten zueinander<br />
Daten- und Kontrollflüsse zwischen Komponenten<br />
Entwurfsqualität: einfache und reguläre Struktur<br />
— Beschreibung der Komponenten<br />
Fleißarbeit<br />
wird nur noch von denjenigen gelesen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Arbeit abkupfern wollen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-31
2-32
Die einzelnen Kapitel (6)<br />
Bewertung – in mindestens drei Schritten<br />
— nachvollziehbare Definition der Bewertungskriterien<br />
Performance (Laufzeit, Durchsatz, Antwortzeit, …)<br />
Komplexität<br />
Zuverlässigkeit (MTBF, MTTR, …)<br />
Robustheit<br />
Skalierbarkeit<br />
Erweiterbarkeit, Flexibilität , …<br />
…<br />
— Durchführung der Bewertung<br />
— knappe und übersichtliche Präsentation der Ergebnisse<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-33
2-34
Die einzelnen Kapitel (7)<br />
Ausblick<br />
— welche Probleme heute schon bekannt, aber noch ungelöst sind<br />
— wo es sich lohnt, weiterzuarbeiten<br />
— welche zusätzlichen Eigenschaften ein System<br />
noch nützlicher machen würden<br />
— …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-35
2-36
Die einzelnen Kapitel (8)<br />
Anhänge<br />
— Detaildokumentationen<br />
— ggf. Überblick über notwendige wissenschaftliche Voraussetzungen<br />
Verzeichnisse<br />
— Inhaltsverzeichnis: vorn<br />
— andere Verzeichnisse: hinten<br />
(Tabellenverzeichnis, Abbildungsverzeichnis usw.)<br />
Glossar<br />
— prägnante Erläuterung wichtiger Fachtermini<br />
Index<br />
— Verweise auf Textstellen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 2-37
2-38
22tab-bild.fm<br />
3. TABELLEN UND<br />
ILLUSTRATIONEN –<br />
KOMPAKTE DARSTELLUNG<br />
KOMPLEXER SACHVERHALTE<br />
1. Lernziel<br />
2. Tabellen im Alltag<br />
3. Tabellen – formal betrachtet<br />
4. Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen<br />
5. Gestaltung von Tabellen<br />
6. Illustrationen<br />
7. Bilder<br />
8. Diagramme<br />
9. Allgemeine Graphen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Krämer, W.:<br />
Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1995 (4. Auflage), ISBN 3-8252-1633-0.<br />
[2] Reichenberger, K., Steinmetz, R.:<br />
Visualisierungen und ihre Rolle in Multimedia-Anwendungen.<br />
Informatik-Spektrum 22, 2, 88-98 (Apr. 1999).<br />
[3] Tufte, E.R.:<br />
The visual display of quantitative information.<br />
Cheshire (Graphics Press) 1997.<br />
[4] Tufte, E.:<br />
Invisioning information.<br />
Cheshire (Graphics Press) 1990.<br />
3-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen, für <strong>die</strong> Veranschaulichung von komplexen<br />
Sachverhalten Tabellen und Illustrationen systematisch zu nutzen.<br />
Warum ist das so wichtig?<br />
neue Systemstrukturen<br />
ausdenken<br />
Systemstrukturen<br />
darstellen<br />
vorhandene<br />
System -<br />
strukturen<br />
kennenle<br />
rn e n<br />
nach: Wendt, S.:<br />
Softwaresystemtechnik –<br />
eine Informatik-Ingenieurdisziplin.<br />
in: Desel, J.: Das ist Informatik.<br />
Berlin (Springer) 2001<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-3
Lernziel<br />
„Ein System entsteht immer als Ergebnis einer Iteration von Entwürfen. Ein Entwurf wird im Grunde immer von einem einzelnen Menschen<br />
geschaffen – <strong>die</strong>s gilt nicht nur für den Bereich der Ingenieurentwürfe, sondern überall, wo das Wort Entwurf einen Sinn hat, also beispielsweise<br />
auch für Gesetzesentwürfe oder für Entwürfe von Tapetenmustern. Die Entscheidung, ob ein Entwurf realisiert werden soll, wird<br />
nicht allein von demjenigen gefällt, der den Entwurf geschaffen hat, sondern <strong>die</strong>se Entscheidung ist <strong>die</strong> Konsequenz einer Diskussion<br />
mehrerer Fachleute. Deshalb müssen <strong>die</strong> Entwürfe so leicht fassbar dargestellt werden, dass <strong>die</strong> zu beteiligenden Fachleute überhaupt in<br />
<strong>die</strong> Lage kommen, in der Diskussion eines vorgelegten Entwurfs konstruktive Beiträge zu leisten.<br />
Die zentrale Rolle der Systemdarstellung ist [im widergegebenen Bild] veranschaulicht. Es sind drei Aktivitäten gezeigt, <strong>die</strong> zyklisch<br />
voneinander abhängen. Damit man sich ein Systemkonzept ausdenken kann, sollte man vorher schon Systemkonzepte, <strong>die</strong> in der Vergangenheit<br />
realisiert wurden, kennen gelernt haben. Damit man Systemkonzepte kennen lernen kann, müssen <strong>die</strong>se leicht fassbar dargestellt<br />
worden sein. Und damit man ein Systemkonzept darstellen kann, muss <strong>die</strong>ses zuvor von jemandem erdacht worden sein.<br />
Unter den drei aufgeführten Aktivitäten begründet nur eine <strong>die</strong> Existenzberechtigung der Ingenieure, <strong>die</strong> Aktivität des Ausdenkens von<br />
Systemkonzepten. Daraus darf man aber nicht den Schluss ziehen, <strong>die</strong> Ausbildung von Ingenieuren müsse sich auf <strong>die</strong>se Aktivität konzentrieren,<br />
weil <strong>die</strong> Ingenieure besonders befähigt werden sollten, neue Ideen und neue Lösungen zu finden. Man kann niemandem beibringen,<br />
gute Einfälle zu haben. Es besteht eine Analogie zur Landwirtschaft, wo man den Bauern auch nicht beibringen kann, gutes Getreide<br />
wachsen zu lassen. Man kann ihnen lediglich beibringen, was sie tun müssen, damit <strong>die</strong> Voraussetzungen für das Wachsen günstig sind.<br />
Da das eine Feld [im Bild] also nicht direkter Gegenstand der Lehre sein kann, muss sich <strong>die</strong> Lehre auf <strong>die</strong> anderen beiden Felder konzentrieren.<br />
Man muss daher den Studenten beibringen, wie Systemkonzepte darzustellen sind, und man muss ihnen sehr viele unterschiedliche<br />
Systeme aus der Vergangenheit vorstellen. Letzteres ist nur möglich, wenn man zuvor <strong>die</strong> Darstellungsmethoden gelehrt hat.“<br />
Wendt, S.: Softwaresystemtechnik – eine Informatik-Ingenieurdisziplin.<br />
in: Desel, J.: Das ist Informatik.<br />
Berlin (Springer) 2001<br />
3-4
Lernziel (2)<br />
Tabellen<br />
„Tabelle: eine systematisch angeordnete Übersicht. Eine Tabelle soll ohne<br />
erläuternden Text verständlich sein.“ (Der Große Brockhaus, 1957)<br />
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“<br />
aber:<br />
— Welche Arten von „Bildern“ gibt es?<br />
— Wie werden sie gezielt eingesetzt?<br />
— Welche Fehler soll man vermeiden?<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-5
3-6
Tabellen im Alltag (1)<br />
Bundesliga-Tabelle<br />
Steuer-Tabelle<br />
tabellarischer Lebenslauf<br />
Tabellen-Kalkulation<br />
Entfernungstabelle<br />
Stundenplan<br />
Wertetabelle<br />
Übersichtstabelle<br />
Umrechnungstabelle<br />
Gewichtstabelle<br />
Matrix, Matrize (Plural: Matrizen)<br />
Inzidenzmatrix<br />
Schema<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-7
Tabellen – Anwendungsbeispiele (nicht nur) im Alltag<br />
Wegen ihrer Fähigkeit, Sachverhalte übersichtlich und schnell erfaßbar darzustellen, werden Tabellen in einer Vielzahl von Umgebungen<br />
genutzt, wie <strong>die</strong> angegebenen Beispiele deutlich zeigen. In <strong>die</strong>sem Kapitel soll – teilweise formal – erläutert werden, wie denn eigentlich<br />
Tabellen „funktionieren“, d.h. was sich in Tabellen darstellen läßt und wie Tabellen entsprechend gelesen werden müssen. Dabei wird sich<br />
zeigen, daß Tabellen u.a. deshalb so beliebt sind, weil sie trotz eines einheitlichen Grundaufbaus aus Zeilen und Spalten mathematisch<br />
gesehen auf sehr unterschiedlichen Mechanismen aufsetzen.<br />
Nach einigen allgemeinen Anwendungen werden wir uns im letzten Teil <strong>die</strong>ses Kapitels einer speziellen Anwendung von Tabellen<br />
zuwenden: Klassifikationen. Diese Anwendung ist ohne Tabellen gar nicht denkbar und von daher besonders gut geeignet, auf <strong>die</strong> Notwendigkeit<br />
zur Nutzung von Tabellen in wissenschaftlichen Arbeit und in allgemeinen technischen Dokumenten hinzuweisen.<br />
3-8
Tabellen – formal betrachtet (1)<br />
… zur Verständigung auf eine gemeinsame Begrifflichkeit:<br />
Kopfzeile<br />
Linke Spalte Tabellenkörper<br />
Tabelle 1: Tabellenbeschriftung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-9<br />
Tabellenkörper
Tabellen – formal betrachtet<br />
Die dargestellte Tabelle <strong>die</strong>nt dazu, <strong>die</strong> Begriffe „Kopfzeile“, „Linke Spalte“ und „Tabellenkörper“ zu definieren.<br />
3-10
Tabellen – formal betrachtet (2)<br />
Tabellen stellen Relationen (Abbildungen, Funktionen) zwischen Mengenelementen dar.<br />
— zur Wiederholung: <strong>die</strong> mathematische Formulierung:<br />
Eine zweistellige Relation R zwischen den Mengen M 1 und M 2 ist<br />
eine Teilmenge aus der Menge aller möglichen Paare (m 1i ,m 2k )<br />
mit m 1i ∈ M 1 und m 2k ∈ M 2 : R ⊆ M 1 × M 2<br />
Ist (m 1i ,m 2k ) ∈ R, so sagen wir, daß m 1i und m 2k in der Relation R stehen.<br />
Statt (m 1i ,m 2k ) ∈ R schreibt man oft: m 1i Rm 2k .<br />
Für mehr als zwei Mengen gilt das Gesagte analog.<br />
Relationen sind dann n-Tupel (x 1i , …, x nl ) mit x ij ∈ M i .<br />
Aber auch auf einer Menge kann eine n-stellige Relation definiert sein.<br />
NB: Das kartesische Produkt M 1 × M 2 gibt <strong>die</strong> Menge aller Paare (m 1i ,m 2k ).<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-11
3-12
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (1)<br />
Darstellung mehrerer zweistelliger oder einer mehrstelligen Relationen<br />
14.9.98 Sp. S U N Tore Punkte Tordiff.<br />
1. Bayern München 4 4 0 0 12:2 12 + 10<br />
2. 1. FC Kaiserslautern 4 3 0 1 8:9 9 – 1<br />
3. Hamburger SV 4 2 2 0 5:3 8 + 2<br />
4. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:3 7 + 4<br />
5. 1860 München 4 2 1 1 8:6 7 + 2<br />
6. 1. FC Nürnberg 4 1 3 0 6:5 6 + 1<br />
7. Hertha BSC Berlin 4 2 0 2 6:7 6 – 1<br />
8. Bayer Leverkusen 4 1 2 1 7:6 5 + 1<br />
9. SC Freiburg 4 1 2 1 4:5 5 – 1<br />
10. Borussia Dortmund 3 1 1 1 4:2 4 + 2<br />
11. Mönchengladbach 4 1 1 2 6:6 4 0<br />
12. Hansa Rostock 4 1 1 2 8:12 4 – 4<br />
13. MSV Duisburg 4 1 1 2 4:8 4 – 4<br />
14. Schalke 04 4 1 1 2 3:7 4 – 4<br />
15. VfL Bochum 3 1 0 2 3:3 3 0<br />
16. VfL Wolfsburg 4 0 3 1 5:6 3 – 1<br />
17. Eintr. Frankfurt 4 0 2 2 5:7 2 – 2<br />
18. Werder Bremen 4 0 1 3 4:8 1 – 4<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-13
3-14
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (2)<br />
Codetabelle:<br />
— zwei-/dreistellige Relation<br />
Code Beschreibung<br />
IP 244 Interrupt Process: Erzeuge das lokale Signal, um den Anwendungsprozeß<br />
abzubrechen.<br />
AO 245 Abort Output: Fordere den Anwendungsprozeß auf, seine laufende<br />
Ausgabe abzubrechen.<br />
AYT 246 Are You There: Server, lebst Du noch?<br />
EC 247 Erase Character: Lösche das letzte eingegebene Zeichen.<br />
EL 248 Erase Line: Lösche <strong>die</strong> letzte eingegebene Zeile.<br />
je Spalte: Elemente einer Menge<br />
je Zeile: ein oder mehrere Wertepaare.<br />
Kopfzeile gibt <strong>die</strong> Mengennamen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-15
3-16
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (3)<br />
eine komplexere Tabelle: der Stundenplan<br />
— Kopfzeile gibt nicht <strong>die</strong> Mengennamen an, sondern definiert eine eigene Menge<br />
1. Std.<br />
2. Std.<br />
3. Std.<br />
4. Std.<br />
5. Std.<br />
6. Std.<br />
7. Std. Rechner-<br />
netze<br />
8. Std.<br />
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
Mathe Physik<br />
Physik Informatik<br />
Englisch<br />
Praktikum<br />
— dreistellige Relation „Am … um … findet statt ….“ zwischen<br />
der Menge der Wochentage<br />
der Menge der „täglichen Zeitschlitze“<br />
der Menge der Fächer<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-17<br />
Dokumentieren und<br />
Präsentieren<br />
Deutsch<br />
Kopfrechnen
3-18
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (4)<br />
eine noch komplexere Tabelle: Relationen in den Zellen<br />
— Grundlage für <strong>die</strong> Tabellenkalkulation<br />
— aber auch in „Papiertabellen“, z.B.:<br />
Achtung: Leserichtung ist wichtig! Obige Tabelle ist zu lesen<br />
von Linker Spalte → Zelle → Kopfzeile<br />
Relationen sind geordnete Paare!<br />
Forschung Produktion<br />
Erzeugung für verboten nicht verboten<br />
Verwertung in nicht verboten nicht verboten<br />
Tabelle 2: Regelung der Erzeugung und Verwertung menschlicher in vitro-Embryonen<br />
entsprechend Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin<br />
des Europarates<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-19
3-20
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (5)<br />
Inzidenzmatrizen geben eine Relation zwischen den Elementen<br />
der oberen Zeile und den Elementen der linken Spalte an.<br />
— z.B. Petri-Netze:<br />
Relation bezieht sich auf <strong>die</strong> Konnektivität zwischen Stellen und Transitionen.<br />
← Transition ist mit Stelle verbunden<br />
→ Stelle ist mit Transition verbunden<br />
↔ Schlinge<br />
¬ inhibitorische Kante<br />
t 1<br />
s 2<br />
s 1<br />
t 2<br />
t 3<br />
s 3<br />
s 4<br />
t 4<br />
t1 t2 t3 t4<br />
s1 ← → ¬<br />
s2 → ←<br />
s3 ←<br />
s3 →<br />
s4 → ←<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-21
Eigenschaften und Anwendungen (6)<br />
…<br />
Inhibitorische Kanten werden hier nur der Vollständigkeit halber eingeführt. Über inhibitorischen Kanten kann das Schalten von Transitition<br />
verhindert werden: Ist eine Stelle s markiert, <strong>die</strong> über eine inhibitorische Kante an eine Transition t angeschlossen ist, so kann <strong>die</strong> Transition<br />
t nicht schalten, auch wenn alle anderen Stellen im Vorbereich von t markiert sind.<br />
3-22
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (6)<br />
Automatentabellen<br />
disconn. SABM data trf. REJ st. busy rm. busy wt. ACK DISC<br />
CR SABM/S<br />
ABM<br />
SABM data trf./<br />
UA<br />
UA data trf. disconn.<br />
DR DISC/DI<br />
SC<br />
DISC disconn./<br />
UA<br />
I-frame /RR data trf.<br />
RR / data trf. data trf.<br />
Invalid REJ/REJ<br />
Busy st. busy/<br />
RNR<br />
Clear data trf.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-23
3-24
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (7)<br />
eine Umrechnungstabelle: eine dreistellige Relation<br />
m km in ft yd mile n mile<br />
m 0,001 39,3701 3,2808 1,0936 – –<br />
km 1 000,0 – – – 0,6214 0,5399<br />
in 0,0254 – 0,0833 0,0278 – –<br />
ft 0,3048 – 12,0 0,3333 – –<br />
yd 0,9144 – 36,0 3,0 – –<br />
mile – 1,6093 63 360,0 5 280,0 1 760,0 0,8690<br />
n mile – 1,852 72 913,0 6 076,1 2 025,4 1,1508<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-25
3-26
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (8)<br />
eine Umrechnungstabelle: eine dreistellige Relation<br />
— zwei „Leserichtungen“:<br />
m km in ft yd mile n mile<br />
m 0,001 39,3701 3,2808 1,0936 – –<br />
km 1 000,0 – – – 0,6214 0,5399<br />
in 0,0254 – 0,0833 0,0278 – –<br />
ft 0,3048 – 12,0 0,3333 – –<br />
yd 0,9144 – 36,0 3,0 – –<br />
mile – 1,6093 63 360,0 5 280,0 1 760,0 0,8690<br />
n mile – 1,852 72 913,0 6 076,1 2 025,4 1,1508<br />
Leserichtung Zeile → Spalte ergibt für Zeile 3: 1 in = 0,0254 m<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-27
3-28
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (9)<br />
eine Umrechnungstabelle: eine dreistellige Relation<br />
— zwei „Leserichtungen“:<br />
m km in ft yd mile n mile<br />
1 m 0,001 39,3701 3,2808 1,0936 – –<br />
1 km 1000,0 – – – 0,6214 0,5399<br />
1 in 0,0254 – 0,0833 0,0278 – –<br />
1 ft 0,3048 – 12,0 0,3333 – –<br />
1 yd 0,9144 – 36,0 3,0 – –<br />
1 mile – 1,6093 63 360,0 5 280,0 1 760,0 0,8690<br />
1 n mile – 1,852 72 913,0 6 076,1 2 025,4 1,1508<br />
Leserichtung Zeile → Spalte ergibt für Zeile 3: 1 in = 0,0254 m<br />
Leserichtung Spalte → Zeile ergibt für Spalte 3: 39,3701 in = 1 m<br />
(Reziprokwert von 0,0254)<br />
aber nicht: 1 inch = 39,3701 m<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-29
Eigenschaften und Anwendungen (8)<br />
Wie aus der Mengenlehre bekannt ist, sind Relationen geordnete n-Tupel. Diese Eigenschaft von Relationen macht sich <strong>die</strong> angegebene<br />
Umrechnungstabelle zunutze. Je nachdem wie man <strong>die</strong> Tabelle liest („Leserichtung“), bekommt man ein Element der dreistelligen Relation<br />
R 1 ⊆ M LS × M T × M K oder der dreistelligen Relation R 2 ⊆ M T × M K × M LS , wobei mit M LS <strong>die</strong> Menge der Elemente der Linken Spalte, mit<br />
M K <strong>die</strong> Menge der Elemente der Kopfzeile und mit M T <strong>die</strong> Menge der Elemente im Tabellekörper gemeint sind.<br />
Leseproben: „Ein m“ (∈ M LS ) „sind 39,3701“ (∈ M T ) „inch“ (∈ M K ).<br />
„39,3701“ (∈ M T ) „inch“ (∈ M K ) sind ein „m“ (∈ M LS ).<br />
Wie der dargestellte Lesefehler zeigt, ist <strong>die</strong>ser Sachverhalt in der obigen Tabelle leider nicht eindeutig dargestellt.<br />
3-30
Tabellen – Eigenschaften und Anwendungen (10)<br />
Flexibilität der Tabellen rührt aus der Vielzahl der Darstellungsmöglichkeiten:<br />
— am besten zusammengefaßt in einer Tabelle!<br />
— Anm. zur Spalte 1:<br />
2-stellige Relation:<br />
zeilenweise<br />
3-stellige<br />
Relation<br />
ggf. mehrere 2-stellige Relationen<br />
Zeilen und Spalten vertauschbar<br />
Relationen<br />
Kopfzeile Mengenname Mengenelemente Mengenelemente<br />
Linke Spalte Mengenelemente Mengenelemente Mengenelemente<br />
Tabellenkörper Mengenelemente Mengenelemente verschiedene<br />
Relationen<br />
Tabelle 3: Darstellung von Relationen durch Tabellen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-31
3-32
Gestaltung von Tabellen (1)<br />
Anordnung von Zeilen und Spalten<br />
— meist sinnvoll: Elemente einer Menge in einer Spalte untereinander<br />
— ein schlechtes Beispiel: „Fläche und Waldbestand“<br />
besser:<br />
Belgien Deutschl. Dänem. Finnland Griechenl. Großbr. Irland<br />
Fläche [km 2 ] 30.519 357.336 43.075 338.107 131.944 244.046 70.283<br />
davon Wald 20% 29% 11% 69% 44% 9% 5%<br />
Fläche [km 2 ] davon Wald<br />
Deutschl. 357.336 29%<br />
Finnland 338.107 69%<br />
Großbr. 244.046 9%<br />
Griechenl. 131.944 44%<br />
Irland 70.283 5%<br />
Dänem. 43.075 11%<br />
Belgien 30.519 20%<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-33
3-34
Gestaltung von Tabellen (2)<br />
Reihenfolge der Zeilen bzw. Spalten<br />
— Oft wird intuitiv angenommen, daß <strong>die</strong> Anordnung der Tabellenelemente<br />
eine Reihen-/Rangfolge ausdrückt:<br />
von oben nach unten bzw. von links nach rechts.<br />
— Anordnung oftmals ohne explizite Erklärung der Rang-/Reihenfolge.<br />
— Beispiel: Bundesligatabelle:<br />
Anordnung nach Clubnamen?<br />
Anordnung nach Punkteanzahl?<br />
Ziel der Aussage der Tabelle bestimmt <strong>die</strong> Anordnung.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-35
3-36
Gestaltung von Tabellen (3)<br />
Gitternetz<br />
— hervorragende Übersicht durch variablen Aufbau des Gitternetzes:<br />
Vortrag 1. Lernziel 5 min<br />
2. Tabellen Einige Anwendungsbeispiele<br />
3. Formaler Aufbau<br />
4. Eigenschaften und Anwendungen<br />
5. Hinweise zur Gestaltung<br />
kl. Übung Errechnen Sie eine Umrechnungstabelle<br />
m/h ↔ km/h für <strong>die</strong> Geschw. 30, 50, 70, 80, 100, 130<br />
Gruppenarbeit:ca. 10 min<br />
3 Vorträge à 5 min:ca. 15 min<br />
Diskussion, Puffer:ca. 10 min<br />
Vortrag 6. Klassifikationen: eine besondere Anwendung<br />
von Tabellen<br />
45 min<br />
25 min<br />
15 min<br />
Zerlegung der Menge der Elemente der Linken Spalte<br />
bzw. der Kopfzeile in mehrere Teilmengen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-37
3-38
Gestaltung von Tabellen (4)<br />
Tabellenbeschriftung<br />
— unterhalb der Tabelle<br />
— Tabellennummerierung ist sinnvoll → Referenz<br />
Fußnoten in Tabellen<br />
— Generell gilt:<br />
Fußnoten sind zu vermeiden!<br />
— Fußnoten nur bei Sonderfällen<br />
(Längerer Erläuterungstext würde <strong>die</strong> Tabelle unübersichtlich machen.)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-39
3-40
Wissenschaftliche Illustrationen (1)<br />
Klassifikation<br />
— Bilder: eingescannte Bilder, Fotographien, Freihandzeichnungen, …,<br />
„ … eines der ersten<br />
Röntgenbilder einer Hand, von<br />
Konrad Röntgen persönlich<br />
aufgenommen, mit Venen, <strong>die</strong><br />
per Färbemittel für <strong>die</strong><br />
Röntgenstrahlen undurchlässig<br />
sind; [<strong>die</strong>se Illustration] hat<br />
seinerzeit sicher mehr<br />
Mediziner von der Wirkung der<br />
neuen Strahlen überzeugt als<br />
mancher Vortrag des Erfinders<br />
selbst.“ aus [1]<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-41
Bilder<br />
„Vor allem in der Medizin und anderen Naturwissenschaften sind solche Bilddokumente nicht nur nützlich, sondern sogar unentbehrlich.<br />
Angefangen bei den anatomischen Zeichnungen Leonardo da Vincis oder den detaillierten Pflanzenzeichnungen der frühen, <strong>die</strong> Welt<br />
bereisenden Botaniker bis hin zu modernen, mit Kernspintomographen erzeugten Querschnitten des menschlichen Gehirns sind solche<br />
Bilder für <strong>die</strong> Botschaft oft wichtiger als jeder Text und dementsprechend wichtig sollten wir sie auch in unserer eigenen Arbeit nehmen.“<br />
aus: [1]<br />
3-42
Wissenschaftliche Illustrationen (2)<br />
Klassifikation (Forts.)<br />
— Diagramme:<br />
„zeichnerisch-anschauliche Darstellung errechneter oder beobachteter Werte“<br />
(Brockhaus, 1953)<br />
Balkendiagramme<br />
Kreisdiagramme<br />
Kartogramme,<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-43
3-44
Wissenschaftliche Illustrationen (3)<br />
Klassifikation (Forts.)<br />
— ein Beispiel für ein besonders ausdrucksstarkes Diagramm:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-45
Diagramme<br />
„Das Diagramm soll unter Verzicht auf Feinheiten und unter Herausstellung des Wesentlichen einen schnelle, leicht faßlichen und einprägsamen<br />
Eindruck auf das Auge erzielen, kann aber wegen fehlender Genauigkeit <strong>die</strong> Tabelle in der Darstellung statistischen Materials nie<br />
ersetzen.“ Brockhaus, 1953<br />
Das oben abgebildete Diagramm „erzählt auf wenigen Quadratzentimetern Napoleons <strong>komplette</strong>n Rußlandfeldzug nach: Datum,<br />
Stärke, Marschrichtung und Aufstellung der Armee, Wetter und Terrain. Das Original ist farbig, und deshalb nochmals eindrucksvoller, aber<br />
selbst in <strong>die</strong>ser Schwarz-Weiß-Reproduktion entfaltet sich Napoleons Desaster vor unseren Augen, fast als wären wir dabei: der breite<br />
Strom der Invasionsarmee (422 000 Mann), das Abzweigen mehrerer Divisionen nach Norden bald danach, <strong>die</strong> ständigen Verluste auf<br />
dem Weg nach Moskau, in zahlreichen kleineren Gefechten mit einem Gegner, der einer Entscheidungsschlacht ausweicht und auf das<br />
Wetter vertraut, der Einmarsch in Moskau mit nur noch 100 000 Mann, der Entschluß zum Rückmarsch im Oktober, und dann das Desaster<br />
des Rückzugs selbst, unter ständigen Verlusten (<strong>die</strong> größten an der Beresina), zunächst im Regen, dann im Schnee, und schließlich<br />
im Dezember <strong>die</strong> letzten 10 000 Soldaten der „Grande Armee“ zurück in Polen, von wo sie 6 Monate vorher ausgezogen waren. … Diese<br />
Graphik ersetzt mehrere Geschichtslektionen und einen Nachholkurs in Pazifismus noch dazu.“ aus: [1]<br />
3-46
Wissenschaftliche Illustrationen (4)<br />
Klassifikation (Forts.)<br />
— Funktionsgraphen: Kurve in einem Koordinatensystem zur Darstellung des<br />
funktionalen Zusammenhangs y = f(x)<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
-0,5<br />
-1<br />
-1,5<br />
-2<br />
-2,5<br />
0,1<br />
natürlicher Logarithmus y = ln(x)<br />
0,3<br />
0,5<br />
0,7<br />
0,9<br />
1,1<br />
1,3<br />
1,5<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-47<br />
1,7<br />
1,9<br />
2,1<br />
2,3<br />
2,5<br />
2,7<br />
2,9
3-48
Wissenschaftliche Illustrationen (5)<br />
Klassifikation (Forts.)<br />
— allgemeine Graphen: Gebilde aus Knoten und Kanten<br />
z.B. GPRS-Netzwerkkonfiguration<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-49
3-50
Wissenschaftliche Illustrationen (6)<br />
daneben viele fachspezifisch-normierte graphische Darstellungen:<br />
— Maschinenbau: Konstruktionszeichnungen, …<br />
— Architektur: Grundriß, Aufriß, Schnitt, …<br />
— Elektrotechnik: Schaltpläne, Verkabelungspläne, …<br />
— Montantechnik: Rißwerke, …<br />
— …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-51
3-52
Bilder (1)<br />
Ein Bild …<br />
— muß einen klaren Zweck verfolgen: Was genau soll gezeigt werden?<br />
z.B. Größe eines Gerätes: Vergleichsobjekt beifügen<br />
z.B. Umgebung eines Gerätes: Perspektive beachten<br />
— muß meist auch in einer s/w-Reproduktion noch aussagefähig sein<br />
— bedarf oft der Nachbearbeitung, vor allem bei Beschriftungen<br />
— kann ggf. sehr großes Datenvolumen erzeugen<br />
— Manchmal kann es sinnvoll sein, nur einen Ausschnitt zu präsentieren.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-53
3-54
Bilder (2)<br />
„Smart dust“<br />
http://www-bsac.eecs.berkeley.edu/archive/users/warneke-brett/SmartDust/<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-55
3-56
Diagramme (1)<br />
eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten; Beispiele:<br />
Koordinaten<br />
system<br />
kartesisches<br />
Koordinaten<br />
system<br />
Polarkoordinaten<br />
Diagrammtyp Datenwerte werden repräsentiert<br />
durch<br />
Beispiele für<br />
Anwendungen<br />
Punktdiagramme Punkte Korrelogramme<br />
Kurvendiagramme Kurven Funktionsgraph<br />
Säulendiagramme (senkrechte) Säulenhöhe Histogramme<br />
Balkendiagramme (waagerechte) Balkenlänge Gantt-Charts<br />
Flächendiagramme Flächen unter einer Kurve<br />
Polardiagramme (meist eine) Kurve in einem<br />
Polarkoordinatensystem (r,ϕ)<br />
Tortendiagramme Winkel eines Kreissegments<br />
(Daten auf 360° normiert)<br />
Landkarte Kartogramme verschiedene Symbole in einer<br />
geographischen Karte<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-57
3-58
Diagramme (2)<br />
Punktdiagramme<br />
— Bsp.: Messungen der Produktfehlerrate über der Tageszeit (3 Meßreihen)<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
— mehrere Meßreihen in einem Diagramm ausgewertet<br />
— funktionaler Zusammenhang ist nicht klar bzw. nur vermutet<br />
— Untersuchung auf Cluster, Basis für eine Approximationsrechnung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-59<br />
Uhrzeit
3-60
Diagramme (3)<br />
Säulendiagramme<br />
— Anwenungsbeispiel für ein Histogramm: Häufigkeitsdichte<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
13<br />
26<br />
20<br />
— x-Achse: Zufallsvariable, in Klassen eingeteilt;<br />
y-Achse: Auftretenshäufigkeit<br />
— Balken erleichtern Vergleich der Einzelwerte<br />
10<br />
8<br />
4<br />
3<br />
HTTP Requests per Visit<br />
≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 ≤ 80 ≤ 90 ≤ 100 ≤ 110 ≤ 120 ≤ 250<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-61<br />
2<br />
7<br />
0<br />
2<br />
1<br />
4
Säulendiagramme<br />
Mit Histogrammen (einer speziellen Anwendungsform von Säulendiagrammen) kann man sich schnell einen Überblick über eine gemessene<br />
Verteilung verschaffen. Wichtig dabei ist, daß man sich stets Gewähr darüber verschafft, daß <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Zufallsvariable vorgenommene<br />
Einteilung in Klassen Erkenntnisse verdecken oder verzerren kann. Deshalb ist es sinnvoll, <strong>die</strong> Klasseneinteilung mehrfach zu variieren.<br />
3-62
Diagramme (4)<br />
Balkendiagramme<br />
— Anwendungsbeispiel:<br />
Zeitanteile für „Spezifikation“, „Co<strong>die</strong>rung u. Test“, „Dokumentation“<br />
Team C<br />
Team B<br />
Team A<br />
3<br />
4<br />
— oft für <strong>die</strong> Darstellung zeitlicher Zusammenhänge<br />
12<br />
10<br />
12<br />
5<br />
5<br />
Entwicklungszeiten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-63<br />
4<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
20<br />
Stunden
3-64
Diagramme (5)<br />
Flächendiagramme<br />
— Anwendungsbeispiel:<br />
Zunahme der Anzahl der weltweit eingesetzten WWW-Server<br />
100000<br />
90000<br />
80000<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
Anzahl WWW-Server<br />
0<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
— durch Einfärben der Fläche: Betonung des Abstands zur x-Achse<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-65
3-66
Diagramme (6)<br />
Spezielle Diagramme<br />
— Gantt-Charts: Verweildauer in verschiedenen Zuständen<br />
P3<br />
P2<br />
P1<br />
OS<br />
Timer-ISR<br />
Round Robin<br />
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240<br />
— dazu der Automatengraph:<br />
P1<br />
Op.-Syst.<br />
P2<br />
Timer-ISR<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-67<br />
P3<br />
[ms]
3-68
Diagramme (7)<br />
Spezielle Diagramme: Kiviat-Diagramme<br />
— besonders geeignet,<br />
wenn mehrere<br />
Eigenschaften eines<br />
Systems beurteilt<br />
werden sollen<br />
— Vergleich von<br />
Systemen<br />
http://icl.cs.utk.edu/hpcc/hpcc_results_kiviat.cgi<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-69
Erläuterung der im Kiviat-Diagramm verwendeten Größen<br />
PP-HPL ( per processor ): Solves a randomly generated dense linear system of equations in double floating-point precision (IEEE 64-bit) arithmetic<br />
using MPI. The linear system matrix is stored in a two-dimensional block-cyclic fashion and multiple variants of code are provided for computational kernels<br />
and communication patterns. The solution method is LU factorization through Gaussian elimination with partial row pivoting followed by a backward<br />
substitution. Unit: Tera Flops per Second<br />
PP-PTRANS (A=A+B^T, MPI) ( per processor ): Implements a parallel matrix transpose for two-dimensional block-cyclic storage. It is an important<br />
benchmark because it exercises the communications of the computer heavily on a realistic problem where pairs of processors communicate with each<br />
other simultaneously. It is a useful test of the total communications capacity of the network. Unit: Giga Bytes per Second<br />
PP-RandomAccess ( per processor ): RandomAccess, also called GUPs, measures the rate at which the computer can update pseudo-random locations<br />
of its memory - this rate is expressed in billions (giga) of updates per second (GUP/s). Unit: Giga Updates per Second<br />
PT-SN-STREAM ( per thread ): The Single Node STREAM benchmark is a simple synthetic benchmark program that measures sustainable memory<br />
bandwidth and the corresponding computation rate for simple numerical vector kernels. It is run on single computational node chosen at random. Unit:<br />
Giga Bytes per Second<br />
PP-FFTE ( per processor ): FFTE, performs the same test as FFTE but across the entire system by distributing the input vector in block fashion across<br />
all the nodes. Unit: Giga Flops per Second<br />
PT-SN-DGEMM ( per thread ): The Single Node DGEMM benchmark measures the floating-point execution rate of double precision real matrix-matrix<br />
multiply performed by the DGEMM subroutine from the BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms). It is run on single computational node chosen at<br />
random. Unit: Giga Flops per Second<br />
Random Ring Bandwidth ( per process ): Randomly Ordered Ring Bandwidth, reports bandwidth achieved in the ring communication pattern. The communicating<br />
nodes are ordered randomly in the ring (with respect to the natural ordering of the MPI default communicator). The result is averaged over<br />
various random assignments of processes in the ring. Unit: Giga Bytes per second<br />
Random Ring Latency ( per process ): Randomly-Ordered Ring Latency, reports latency in the ring communication pattern. The communicating nodes<br />
are ordered randomly in the ring (with respect to the natural ordering of the MPI default communicator) in the ring. The result is averaged over various<br />
random assignments of processes in the ring. Unit: micro-seconds<br />
3-70
Diagramme (8)<br />
„Chart Junk“<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
HTTP Requests per Visit<br />
≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 ≤ 80 ≤ 90 ≤ 100 ≤ 110 ≤ 120 ≤ 250<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-71<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
3D-Darstellung trägt nichts zur<br />
Aussage bei!<br />
13<br />
≤ 10<br />
26<br />
20<br />
≤ 30<br />
10<br />
8<br />
≤ 50<br />
4 3 2<br />
≤ 70<br />
≤ 90<br />
7<br />
HTTP Requests per Visit<br />
0 2 1<br />
≤ 110<br />
≤ 250<br />
4
3-72
Allgemeine Graphen (1)<br />
Klassifikation<br />
gerichteter Graph ungerichteter Graph<br />
zusammenhängender Graph unzusammenhängender Graph<br />
schlichter Graph schlingenbehafteter Graph<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-73
3-74
Allgemeine Graphen (2)<br />
nützlich zur<br />
— Modellierung von Funktionen und Abläufen<br />
— Modellierung von Strukturen und Konfigurationen<br />
— …<br />
aber …<br />
— Regeln beachten!<br />
Die wichtigsten:<br />
möglichst geringe Anzahl der unterschiedlichen Typen von Knoten und Kanten<br />
Semantik der Knoten und Kanten definieren<br />
„Spielregeln“ für den Aufbau beachten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-75
3-76
Allgemeine Graphen (3)<br />
Anzahl der unterschiedlichen Typen von Knoten und Kanten<br />
— vorher festlegen<br />
— klar unterscheidbare Symbole einführen<br />
— Legende aufbereiten<br />
Beispiele:<br />
Automatengraphen: 1 Knotentyp, 1 Kantentyp<br />
Petri-Netze: 2 Knotentypen (Stellen, Transitionen), gerichtete Kanten<br />
UML-Diagramme: diverse Knoten- und Kantentypen<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-77
3-78
Allgemeine Graphen (4)<br />
Semantik von Knoten und Kanten<br />
— Was „bedeuten“ <strong>die</strong> unterschiedlichen Typen von Knoten und Kanten?<br />
Beispiele:<br />
Knoten in Petri-Netzen: Knoten in normierten Programmflußplänen<br />
(DIN 66001):<br />
Stellen<br />
Transitionen<br />
Elementarer Berechnungsschritt<br />
Verzweigung<br />
Start/Ende<br />
… …<br />
Unterprogramm-Aufruf<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-79
3-80
Allgemeine Graphen (5)<br />
Unified Modeling Language<br />
— a family of graphical notations for software:<br />
use case diagrams<br />
class diagrams<br />
object diagrams<br />
sequence diagrams<br />
collaboration diagrams<br />
statechart diagrams<br />
activity diagrams<br />
component diagrams<br />
deployment diagrams<br />
— to express and communicate functional and structural properties<br />
of software systems<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-81
UML<br />
„Was ist <strong>die</strong> UML?<br />
Die Unified Modelling Language ist eine Sprache zur Spezifikation, Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation von Modellen für Softwaresysteme,<br />
Geschäftsmodelle und andere Nicht-Softwaresysteme. Sie bietet den Entwicklern <strong>die</strong> Möglichkeit, den Entwurf und <strong>die</strong> Entwicklung<br />
von Softwaremodellen auf einheitlicher Basis zu diskutieren. Die UML wird seit 1998 als Standard angesehen. Sie lag und liegt<br />
weiterhin bei der Object Management Group (OMG) zur Standardisierung vor.<br />
Wer steht hinter der UML?<br />
Entwickelt wurde <strong>die</strong> UML von Grady Boch, Ivar Jacobsen und Jim Rumbaugh von RATIONAL ROSE SOFTWARE . Sie kombinierten <strong>die</strong><br />
besten Ideen objektorientierter Entwicklungsmethoden und schufen daraus <strong>die</strong> UML. Viele führende Unternehmen der Computerbranche<br />
(Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard,...) wirkten aktiv an der Entwicklung mit und unterstützen <strong>die</strong> UML.<br />
Warum ist <strong>die</strong> UML keine Methode?<br />
Die UML ist keine Methode. Sie ist lediglich ein Satz von Notationen zur Formung einer allgemeinen Sprache zur Softwareentwicklung.<br />
Eine Methode beinhaltet Empfehlungen zur Vorgehensweise bei Entwicklungsprozessen. Um UML erfolgreich zu nutzen, ist es notwendig<br />
eine passende Methode zu entwickeln, <strong>die</strong> <strong>die</strong> UML unterstützt.<br />
Die Modellelemente der UML werden nach Diagrammtypen gegliedert:<br />
Anwendungsfalldiagramm, Klassendiagramm, Aktivitätsdiagramm, Kollaborationsdiagramm, Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm,<br />
Komponentendiagramm, Einsatzdiagramm.“<br />
UML Tutorial der Universität Magdeburg<br />
http://ivs.cs.uni-magdeburg.de/~dumke/UML/index.htm<br />
3-82
Allgemeine Graphen (6)<br />
Unified Modeling Language<br />
— sample sequence diagram<br />
first_class<br />
new()<br />
msg()<br />
reply()<br />
second_class<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-83
UML<br />
„Das Sequenzdiagramm beschreibt <strong>die</strong> zeitliche Abfolge von Interaktionen zwischen einer Menge von Objekten innerhalb eines zeitlich<br />
begrenzten Kontextes.<br />
Beschreibung<br />
Mittels des Sequenzdiagrammes beschreibt man <strong>die</strong> Interaktionen zwischen den Modellelementen ähnlich, wie bei einem Kollaborationsdiagramm,<br />
jedoch steht beim Sequenzdiagramm der zeitliche Verlauf des Nachrichtenaustausches im Vordergrund. Die Zeitlinie verläuft<br />
senkrecht von oben nach unten, <strong>die</strong> Objekte werden durch senkrechte Lebenslinien beschrieben und <strong>die</strong> gesendeten Nachrichten waagerecht<br />
entsprechend ihres zeitlichen Auftretens eingetragen.<br />
Notation<br />
Die Objekte werden durch Rechtecke visualisiert. Von ihnen aus gehen <strong>die</strong> senkrechten Lebenslinien, dargestellt durch gestrichelte<br />
Linien, ab. Die Nachrichten werden durch waagerechte Pfeile zwischen den Objektlebenslinien beschrieben. Auf <strong>die</strong>sen Pfeilen werden<br />
<strong>die</strong> Nachrichtennamen in der Form: nachricht (argumente) notiert. Nachrichten, <strong>die</strong> als Antworten deklariert sind erhalten <strong>die</strong> Form:<br />
antwort:=nachricht() […] Objekte, <strong>die</strong> gerade aktiv an Interaktionen beteiligt sind, sind durch einen Balken auf ihrer Lebenslinie zu<br />
kennzeichnen.<br />
Objekte können während des des zeitlichen Ablaufes des begrenzten Kontextes erzeugt und gelöscht werden. Ein Objekt wird erzeugt,<br />
indem ein Pfeil mit der Aufschrift new() auf ein neues Objektsymbol trifft, und zerstört, indem seine Lebenslinie in einem Kreuz endet.“<br />
UML Tutorial der Universität Magdeburg<br />
http://ivs.cs.uni-magdeburg.de/~dumke/UML/20.htm<br />
3-84
Allgemeine Graphen (7)<br />
Unified Modeling Language<br />
— sample class diagram: inheritance<br />
circle<br />
draw()<br />
erase()<br />
shape<br />
{abstract}<br />
square<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-85
UML<br />
„Inheritance<br />
The inheritance relationship in UML is depicted by a peculiar triangular arrowhead. This arrowhead, that looks rather like a slice of pizza,<br />
points to the base class. One or more lines proceed from the base of the arrowhead connecting it to the derived classes. [The] Figure […]<br />
shows the form of the inheritance relationship. In this diagram we see that Circle and Square both derive from Shape. Note that the name<br />
of class Shape is shown in italics. This indicates that Shape is an abstract class. Note also that the operations, Draw() and Erase() are also<br />
shown in italics. This indicates that they are pure virtual.“<br />
Robert C. Martin: UML Tutorial – Part 1 – Class Diagrams.<br />
http://www.objectmentor.com/resources/articles/umlClassDiagrams.pdf<br />
3-86
Allgemeine Graphen (8)<br />
Semantik von Knoten und Kanten<br />
— Kanten sollten beschriftet werden<br />
Modul 1 Modul 2<br />
aktiviert aktiviert<br />
Modul 4<br />
hält an<br />
Modul 3<br />
Modul 5<br />
übergibt Parameter<br />
— immer dann notwendig, wenn Kanten unterschiedliche Bedeutung haben<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-87
3-88
Allgemeine Graphen (9)<br />
Aufbau von Graphen<br />
— Welche Relationen sind sinnvoll/definiert?<br />
Funktion<br />
Puffer<br />
Funktion<br />
Funktion<br />
Funktion<br />
Puffer<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 3-89
3-90
30arb-krea.fm<br />
4. TECHNIKEN FÜR DAS<br />
EFFEKTIVE ARBEITEN<br />
1. Lernziele<br />
2. Phasenmodell<br />
3. Zeitmanagement<br />
4. Hirnhälften-Paradigma<br />
5. Organisation kreativer Prozesse<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Engel, St., Woitzik, A. (Hrsg.): Die Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1997, ISBN 3-8252-1917-8.<br />
[2] Kruse, O.:<br />
Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Frankfurt u.a. (Campus) 1997 (5. Auflage), ISBN 3-593-35693-7.<br />
[3] Rico, G.L.:<br />
Garantiert schreiben lernen.<br />
Reinbek (Rowohlt) 1998, ISBN 3-499-60605-4.<br />
[4] v. Scheidt, J.:<br />
Kreatives Schreiben.<br />
Frankfurt/Main (Fischer Taschenbuch) 1993, ISBN 3-596-11950-2.<br />
[5] Zweig, Stefan<br />
Die Welt von Gestern.<br />
Frankfurt/Main (Fischer Taschenbuch) 1997, ISBN 3-596-21152-2.<br />
4-2
Lernziele (1)<br />
zwei miteinander verbundene Lernziele:<br />
Sie sollen lernen, sich <strong>die</strong> Zeit, <strong>die</strong> zur Verfügung steht,<br />
möglichst gut einzuteilen.<br />
Sie sollen lernen, <strong>die</strong> Zeit, <strong>die</strong> zur Verfügung steht,<br />
möglichst effektiv zu nutzen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-3
4-4
Lernziel (2)<br />
Beobachtungen:<br />
Fragen:<br />
Die Zeit ist immer zu knapp.<br />
Ein guter Faktor zum Schätzen des wirklichen Zeitaufwands ist π/2 …<br />
Wie kann man mit seiner Zeit effektiver umgehen?<br />
Wie kann man Qualität des Ergebnisses steigern, ohne mehr Zeit zu brauchen???<br />
Zwei (un)kluge Sprüche zum Thema:<br />
Man braucht immer soviel Zeit, wie man hat.<br />
Der erste Satz ist immer der schwerste.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-5
Lernziel<br />
„Aufgrund der Zeitvorgabe für <strong>die</strong> Schreibdauer einer Diplomarbeit ist es wichtig, daß es Ihnen gelingt, <strong>die</strong> zur Verfügung stehende Zeit<br />
(zwischen 3 und 9 Monaten) effektiv zu nutzen. Lernen Sie daher, mit <strong>die</strong>ser kostbaren Zeit umzugehen.“ [1]<br />
Schreiben ist stets ein mühsamer Prozeß. Niemandem gelingt es, gleich druckreif zu schreiben. Stellen Sie sich vor: „Die Menschliche<br />
Komö<strong>die</strong>“ von Honoré de Balzac umfaßt 16 522 Druckseiten! eine Taschenbuchausgabe mit 40 Bänden! Und selbst <strong>die</strong>se gigantische Leistung<br />
ist, wie uns Stefan Zweig berichtet, nicht druckreif entstanden, sondern in Korrekturen über Korrekturen [5]:<br />
„Ich weiß von einem Künstler nicht genug, wenn ich nur sein geschaffenes Werk vor mir habe, und ich bekenne mich zu Goethes<br />
Wort, daß man <strong>die</strong> großen Schöpfungen, um sie ganz zu begreifen, nicht nur in ihrer Vollendung gesehen, sondern auch in ihrem<br />
Werden belauscht haben muß. Aber auch rein optisch wirkt auf mich eine erste Skizze Beethovens mit ihren wilden, ungeduldigen<br />
Strichen, ihrem wüsten Durcheinander begonnener und verworfener Motive, mit der darin auf ein paar Bleistiftstriche komprimierten<br />
Schöpfungswut seiner dämonisch überfüllten Natur geradezu physisch erregend, weil der Anblick mich so sehr geistig erregt;<br />
ich kann solch ein hieroglyphisches Blatt verzaubert und verliebt anstarren wie andere ein vollendetes Bild. Ein Korrekturblatt Balzacs,<br />
wo fast jeder Satz zerrissen, jede Zeile umgeackert, der weiße Rand mit Strichen, Zeichen, Worten schwarz zernagt ist, versinnlicht<br />
mir den Ausbruch eines menschlichen Vesuvs; und irgendein Gedicht, das ich jahrzehntelang liebte, zum erstenmal in<br />
der Urschrift gesehen, in seiner ersten Irdischkeit, erregt in mir ehrfürchtig religiöses Gefühl; ich getraue mich kaum, es zu berühren.“<br />
(S. 191f)<br />
4-6
Phasenmodell (1)<br />
beschreibt <strong>die</strong> Folge einzelner Arbeitsschritte<br />
— Aufzählung aller erforderlichen Tätigkeiten<br />
— unerläßlich für <strong>die</strong> Entwicklung eines Zeitplans<br />
— Rahmen für <strong>die</strong> Überprüfung des Arbeitsfortschritts durch<br />
Definition von Zwischenergebnissen, sog. Milestones<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-7
4-8
Phasenmodell (2)<br />
ein richtiges, aber nicht brauchbares Phasenmodell …<br />
Jeden Text/jede Präsentation schreibt man (4 + x)-mal:<br />
das erste Mal um zu verstehen, worüber man schreiben will,<br />
das zweite Mal um das Geschriebene zu strukturieren,<br />
das dritte Mal um das Geschriebene verständlich zu machen,<br />
das vierte und alle weiteren Male,<br />
um das Geschriebene zu überarbeiten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-9
4-10
Phasenmodell (3)<br />
für <strong>die</strong> Anfertigung einer wiss. Arbeit: ein Phasenmodell mit fünf Phasen<br />
Dabei gilt,<br />
1. Recherche<br />
2. Praktische Arbeit<br />
3. Strukturierung<br />
4. Ausarbeitung<br />
5. Überarbeitung<br />
— daß <strong>die</strong> Ergebnisse früherer Phasen in späteren Phasen<br />
meist revi<strong>die</strong>rt, korrigiert, verfeinert werden müssen;<br />
— daß jede Phase mit einem bewertbaren Resultat<br />
abgeschlossen werden muß (Milestone).<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-11
4-12
Phasenmodell (4)<br />
Phase Anteil Beschreibung<br />
1 Recherche 20%<br />
1. Durchführung von Literatur- und<br />
Internet-Recherchen<br />
2. Festlegung des Themas der Arbeit<br />
und der praktischen Methode<br />
3. Einleitung von Beschaffungen<br />
Ergebnisse,<br />
Milestones<br />
Thema u. Exposé,<br />
Stand der Technik,<br />
Literaturdatenbank,<br />
Zeitplan<br />
Milestone: Projektpräsentation<br />
2 Praktische Arbeit 50%<br />
Programmierung/Entwicklung/Aufbau<br />
von Prototypen,<br />
fortlaufende Dokumentation,<br />
Erarbeitung weiterer Literatur<br />
vervollständigte<br />
Literaturdatenbank,<br />
Textelemente für <strong>die</strong><br />
Dokumentation<br />
Milestone: lauffähiger Prototyp<br />
3 Strukturierung 15%<br />
Milestone:<br />
Strukturieren des Materials<br />
(Literatur, praktische Erfahrungen)<br />
für <strong>die</strong> Ausarbeitung<br />
durchstrukturierte<br />
Stichwortsammlung<br />
konkrete Gliederung<br />
der Ausarbeitung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-13
Phasenmodell<br />
Recherche:<br />
Nur nach einem sorgfältig erhobenen Stand der Technik kann das Thema der Arbeit sinnvoll festgelegt werden. Deshalb ist <strong>die</strong>ser erste<br />
Teilschritt sehr wichtig, denn <strong>die</strong> Festlegung des Themas bestimmt sehr stark <strong>die</strong> Bewertung der Arbeit, wenn auch nur indirekt. Es ist<br />
<strong>die</strong> wichtigste Aufgabe des Betreuer, hier konstruktiv mitzuwirken.<br />
Bei der Aufarbeitung von Literatur sind meiner Meinung nach Karteikarten völliger Unsinn. Was sinnvoll ist: Exzerpte. Exzerpte sind<br />
stichwortartige Niederschriften des Gelesenen. Das stichwortartige Niederschreiben verlängert den Leseprozeß dramatisch, vertieft<br />
aber das Verständnis genauso dramatisch. Ausprobieren! Aus den Exzerpten muß mit Hilfe irgendeiner Kreativitätstechnik (Mind Map,<br />
Metaplan o.ä.) eine Gliederung entstehen. Das ist der entscheidende Schritt.<br />
Praktische Arbeit:<br />
Ist es notwendig, auf den Nutzen fortlaufender Dokumentation hinzuweisen? Ist es notwendig, auf <strong>die</strong> Notwendigkeit zur Kontrolle des<br />
Zeitplans hinzuweisen?<br />
Strukturierung:<br />
Alles Material, das durch <strong>die</strong> Literaturrecherche und durch eigene Erkenntnisse gewonnen worden ist, muß in <strong>die</strong>ser Phase zunächst<br />
aufgeschrieben und dann in <strong>die</strong> Meta-Gliederung hineingebracht werden, <strong>die</strong> wir im vorangegangenen Kapitel diskutiert haben. Wichtig:<br />
Beim Aufschreiben geht es hier noch nicht um das „Ausformulieren“, sondern nur um <strong>die</strong> Erstellung einer möglichst guten und präzisen<br />
Stichwortliste. In <strong>die</strong>ser Stichwortliste soll natürlich der logische Zusammenhang zwischen einzelnen Argumenten erkennbar sein,<br />
<strong>die</strong>ser wird aber nur knapp angedeutet durch Wörter wie „aber“, „weil“, „bevor“ usw. Diese Strukturierungsarbeit ist ein iterativer Prozeß,<br />
der oftmals (leider!) mit dem nahezu vollständigen Verwerfen von Zwischenversionen verbunden ist. Deshalb wäre es schädlich, hier<br />
schon große Mühe in <strong>die</strong> Formulierung von Einleitungs-, Überleitungssätzen usw. zu stecken.<br />
Es ist meist unabdingbar, schon in <strong>die</strong>ser Phase wichtige Graphen und Tabellen zu entwickeln. Die Beschreibung eines Systems kann<br />
oftmals sehr gut an solchen graphischen Darstellungen orientiert werden.<br />
4-14
Phasenmodell (5)<br />
Phase Anteil Beschreibung<br />
4 Ausarbeitung 10%<br />
Schreiben der ersten Fassung<br />
inkl. aller Illustrationen<br />
Ergebnisse,<br />
Milestones<br />
Text und wiss.<br />
Illustrationen<br />
Milestone: erste Fassung<br />
5 Überarbeitung 5%<br />
Milestone:<br />
Einarbeiten von Korrekturen,<br />
Hinzufügen von Titelblatt,<br />
Verzeichnissen usw.,<br />
endgültige Fassung<br />
gebundene Arbeit<br />
Abschlußvortrag<br />
Abschlußkolloquium<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-15
Phasenmodell<br />
Ausarbeitung:<br />
In <strong>die</strong>ser Phase wird das in der zuvor gesammelte und strukturierte Material in einen möglichst leicht und flüssig lesbaren Text umgesetzt.<br />
Bilder müssen ggf. verfeinert werden. Hier kommt es vor allem auf eine sichere Beherrschung der deutschen Sprache, der Rechtschreibung<br />
und des Textsystems an. Inhaltlich müßte hier schon alles „gegessen“ sein. Das Resultat <strong>die</strong>ser Phase, <strong>die</strong> „erste Fassung“,<br />
sollte von Freunden und vom Betreuer gelesen und korrigiert werden.<br />
Überarbeitung:<br />
Da es sehr schwierig ist, von Anfang an, einen konsistenten Text zu entwickeln, ist eine Überarbeitung der ersten Fassung so gut wie<br />
immer notwendig.<br />
4-16
Zeitmanagement (1)<br />
<strong>die</strong> wichtigste Unterscheidung:<br />
— Wichtiges ist nicht immer dringend<br />
und<br />
Was ist wichtig?<br />
— Dringendes ist nicht immer wichtig …<br />
Was ist dringend?<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-17
4-18
Zeitmanagement (2)<br />
ABC-Regel: Bewertung verschiedener Aktivitäten nach Wichtigkeit<br />
— A: sehr wichtig,<br />
z.B. Strukturierung, Konzeptentwicklung, Konzeption von Bildern, …<br />
— B: wichtig,<br />
z.B. gute Aufbereitung von Bildern, Formulierung von Texten, …<br />
— C: unwichtig,<br />
z.B. Schnickschnack bei der Textformatierung, …<br />
ABC-Regel ist auf <strong>die</strong> Aktivitäten aller Phasen anzuwenden!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-19
4-20
Zeitmanagement (3)<br />
Selbstbeobachtung hilft:<br />
— Wann ist meine persönliche prime time,<br />
d.h. meine Tagesphase mit der größten Produktivität?<br />
— Habe ich mein Ziel klar definiert?<br />
— Wie lange kann ich konzentriert ohne Pause arbeiten?<br />
— Wie gut sind meine Schätzungen für Zeitaufwände?<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-21
4-22
Zeitmanagement (4)<br />
A-Aktivitäten in <strong>die</strong> prime time legen.<br />
— Mit 20% der Aktivitäten (→ A-Aktivitäten) werden 80% des Erfolgs erreicht!<br />
— Prime time nicht durch andere Aktivitäten kaputtmachen lassen!<br />
— C-Aktivitäten und Nebenaktivitäten (Telefonieren, Abheften, Aufräumen usw.)<br />
zu Blöcken zusammenfassen.<br />
Selbstbeobachtung<br />
— Vor dem Beginn einer Aktivität: Habe ich mir das Ziel klargemacht?<br />
— Denke ich Zusammenhänge konsequent zu Ende?<br />
— am Abend: Was war? Wie war es? ( → Journal)<br />
kleine Helferlein<br />
— Größere Aktivitäten in Teilaktivitäten (< 2 Std.) aufteilen; Einfügen von Pausen<br />
— Wenn es nicht mehr vorangeht: Abstand suchen; der Kopf arbeitet „von allein“ weiter.<br />
— Den Erfolg bewußt wahrnehmen und genießen!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-23
4-24
Zeitmanagement (5)<br />
Zeitfresser<br />
— Aktivitäten aufschieben und verschieben<br />
— nur halb erledigte Aktivitäten<br />
— Besprechungen ohne klare Zielsetzung und Tagesordnung<br />
— Zulassen von Rückdelegationen<br />
— alles wissen, alles selber machen wollen<br />
— unklare Prioritäten<br />
— Festfahren in offensichtlich erfolglosen Aktivitäten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-25
4-26
Hirnhälften-Paradigma (1)<br />
zur Erläuterung menschlicher Denkvorgänge<br />
linke Hirnhälfte:<br />
sequentielle Verarbeitung<br />
zergliederndes,<br />
analysierendes Denken<br />
regelbasiert, syntaktisch<br />
Ursache/Wirkung<br />
mathematisch<br />
ausgerichtet auf<br />
Einzelheiten<br />
weiß „wie“<br />
→ begriffliches Denken<br />
Beide Aspekte müssen gleichermaßen zur Entstehung<br />
einer schriftlichen/gestalterischen Arbeit beitragen!<br />
rechte Hirnhälfte:<br />
simultane Verarbeitung<br />
synthetisches, zusammenfügendes<br />
Denken<br />
intuitiv, qualitativ<br />
Entsprechungen/Ähnlichkeiten/Analogien<br />
gefühlsbesetzt<br />
ausgerichtet auf<br />
Ganzheiten<br />
entdeckt „was“<br />
→ bildliches Denken<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-27
4-28
Hirnhälften-Paradigma (2)<br />
Ziel: „Ausgleich zwischen den beiden Hirnhälften“<br />
„In der Anfangsphase eines Vorhabens, von dem wir noch keine klare Vorstellung<br />
haben, spielt <strong>die</strong> rechte Hemisphäre eine überaus wichtige Rolle. Die Forschung zeigt,<br />
daß neue Aufgaben zunächst besser von der rechten Hälfte gelöst werden. Sobald <strong>die</strong><br />
für <strong>die</strong> Aufgabe erforderlichen Fertigkeiten erworben und eingeschliffen sind, erweist<br />
sich <strong>die</strong> linke Seite als überlegen. In unserem Zusammenhang heißt das, daß wir uns<br />
in den kreativen, ideenschöpfenden Anfangssta<strong>die</strong>n des natürlichen Schreibens an <strong>die</strong><br />
fragende, forschende, sensitive rechte Hälfte zu halten haben, in den späteren Phasen<br />
der literarischen Produktion dagegen an <strong>die</strong> folgerichtigen, syntaktischen,<br />
systematischen Fähigkeiten der linken Seite.“<br />
[3], S. 73<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-29
4-30
Hirnhälften-Paradigma (3)<br />
noch einmal Stefan Zweig:<br />
„An und für sich produziere ich leicht und fließend, in der ersten Fassung eines Buches<br />
lasse ich <strong>die</strong> Feder locker laufen und fabuliere weg, was mir am Herzen liegt. … kaum<br />
daß <strong>die</strong> erste ungefähre Fassung eines Buches ins Reine geschrieben ist, beginnt für<br />
mich <strong>die</strong> eigentliche Arbeit, <strong>die</strong> des Kondensierens und Komponierens, eine Arbeit, an<br />
der ich mir von Version zu Version nicht genug tun kann. … ich klage nicht, wenn von<br />
tausend geschriebenen Seiten achthundert in den Papierkorb wandern und nur<br />
zweihundert als <strong>die</strong> durchgesiebte Essenz zurückbleiben.“<br />
[5], S. 364f.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-31
4-32
Organisation kreativer Prozesse (1)<br />
vor allem: Unterstützung der kreativen, ersten Phase<br />
— graphische Methoden<br />
Mind Maps<br />
Cluster<br />
— „unkontrolliertes“ Schreiben<br />
wissenschaftliches Journal<br />
Konzept-Datei<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-33
4-34
Organisation kreativer Prozesse (2)<br />
Mind Maps: ein Beispiel<br />
Ad-hoc-Netze<br />
eigener Bericht<br />
studentische Evaluation<br />
Notebooks<br />
Funknetz<br />
Beamer<br />
Funkmaus<br />
Drucker<br />
Browser<br />
MindManager<br />
FrameMaker<br />
PowerPoint<br />
Berichterstattung<br />
Hardware<br />
Software<br />
Kostenschätzung<br />
Academic Writing Studio<br />
Techn. Infrastruktur<br />
23.02.02 - v2<br />
Problemstellung<br />
Eigene Vorarbeiten<br />
Lessons Learned<br />
Strickmuster für Techn. Dok.<br />
Schreiben als Qual<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-35<br />
PISA<br />
Propädeutik<br />
Dokumentieren u. Präsentieren<br />
Akzeptanz der Übung<br />
"Präsenzübung"
4-36
Organisation kreativer Prozesse (3)<br />
Cluster: Ideen-, Assoziationstrauben, ähnlich Mind Maps<br />
„Versuchen Sie <strong>die</strong> Einstellung eines Kindes einzunehmen, für das alles neu ist, das<br />
über alles staunt. Bleiben Sie in <strong>die</strong>ser Haltung, und schreiben Sie Assoziation um<br />
Assoziation aufs Papier. … Vermeiden Sie es, Ihre Ideen zu bewerten oder unter ihnen<br />
auszuwählen. Lassen Sie sich gehen und schreiben Sie. Lassen Sie <strong>die</strong> Wörter und<br />
Wendungen vom Kernwort nach außen ausstrahlen, und ziehen Sie um jeden Einfall<br />
einen Kreis. Verbinden Sie Assoziationen, <strong>die</strong> Ihnen zusammengehörig erscheinen<br />
durch Striche … aber überlegen Sie nicht zu lange und analysieren Sie nicht. Ein<br />
Cluster zu machen, hat etwas „Achtloses“, das <strong>die</strong> Kraft außer Acht zu setzen scheint.<br />
…<br />
Am Anfang wird sich wahrscheinlich Ihr begriffliches Denken vordrängen und Ihnen<br />
weiszumachen versuchen, das, was Sie da treiben, sei einfältig, unlogisch und wirr.<br />
Lassen Sie sich nicht irritieren. Dieses scheinbare Chaos ist <strong>die</strong> wichtige erste Phase<br />
in dem kreativen Prozeß, in den Sie gerade eingetreten sind.“<br />
[3], S. 36f.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-37
4-38
Organisation kreativer Prozesse (4)<br />
Wissenschaftliches Journal<br />
— enthält <strong>die</strong> Gedanken zu Ihrer Arbeit, <strong>die</strong> Sie<br />
nur allerbesten Freunden mitteilen würden;<br />
— spricht deutlich aus, was Ihnen unklar ist;<br />
— formuliert vorläufige, „experimentelle“ Gedanken;<br />
— ist vielleicht schon nach 14 Tagen unlesbar geworden;<br />
— orientiert sich nicht an einer wissenschaftlichen Systematik,<br />
sondern an dem, was Sie gerade beschäftigt<br />
— wie ein intimes Tagebuch …<br />
Regeln:<br />
— Ein Eintrag für jeden Tag, an dem Sie schreiben: „Nulla <strong>die</strong>s sine linea!“<br />
— Jeder Absatz/Eintrag wird zunächst „heruntergeschrieben“,<br />
ohne Rücksicht auf grammatische/orthographische/inhaltliche Korrektheit.<br />
— Den benutzbaren Teil des Eintrags ins Konzept übernehmen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-39
Wissenschaftliches Journal<br />
Ein Auszug aus meinem Journal, das ich zur Vorbereitung der <strong>Vorlesung</strong> „Dokumentieren und Präsentieren“ benutze:<br />
„Gestern habe ich angefangen, das Kap. 4: „Klassifikation“ vorzubereiten. Oh Schreck, oh Graus: Die unklare Vorstellung, <strong>die</strong> ich von <strong>die</strong>sem<br />
Kapitel hatte, hat mich beim erneuten Durchlesen der Konzept-Datei wieder voll getroffen. Das Thema Klassifikation kommt völlig<br />
unvorbereitet in <strong>die</strong> <strong>Vorlesung</strong> hinein und wirkt dort einfach wie ein Fremdkörper. Mir ist dann über Nacht (bei unruhigem Schlaf) eingefallen,<br />
wie ich zu <strong>die</strong>ser unsinnigen Konzeption gekommen bin: Ich wollte etwas zum Thema Tabellen sagen und habe in einem Anflug von<br />
Leichtsinn geglaubt, eine Tabellen sei immer und in jedem Fall <strong>die</strong> Repräsentation einer Klassifikation. Welch ein Unsinn! Ich habe das<br />
Pferd vom Schwanz aufgezäumt: Statt vom allgemeinen Mechanismus der Tabelle auszugehen, habe ich eine spezielle Nutzungsform der<br />
Tabelle – nämlich <strong>die</strong> Klassifikation – benutzt, um in <strong>die</strong> Thematik einzusteigen. Wenn ich dagegen von der Tabelle ausgehe, fügt sich der<br />
Rahmen …“<br />
4-40
Organisation kreativer Prozesse (5)<br />
Konzept-Datei – ein elektronischer Schmierblock<br />
— nach Kapiteln geordnete Stichwortsammlung<br />
— enthält Bilder<br />
— nur einzelne ausformulierte Sätze<br />
— kann auf einfache Art und Weise immer wieder umgestoßen werden<br />
— enthält eine Menge von Textformaten für <strong>die</strong> Aufzählung<br />
dash, bullet, number, square<br />
normal, indented, deep-indent<br />
fett, kursiv, normal<br />
…<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 4-41
4-42
40verstaendlich.fm<br />
SPRACHE UND FORM<br />
5. VERSTÄNDLICHKEIT<br />
1. Lernziel<br />
2. Sprache und Leser/Hörer<br />
3. Verständlichkeit<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Krämer, W.:<br />
Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1995 (4. Auflage), ISBN 3-8252-1633-0.<br />
[2] Kruse, O.:<br />
Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Frankfurt u.a. (Campus) 1997 (5. Auflage), ISBN 3-593-35693-7.<br />
[3] Reiners, L.:<br />
Stilfibel.<br />
München (dtv) 1998, ISBN 3-423-30005-1.<br />
[4] Schneider, W.:<br />
Deutsch fürs Leben.<br />
Reinbek (rororo Sachbuch) 1994, ISBN 3-499-19695-6.<br />
[5] Schneider, W.:<br />
Deutsch für Kenner.<br />
München u.a. (Serie Piper) 1996, ISBN 3-492-22216-1.<br />
[6] Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R.:<br />
Sich verständlich ausdrücken.<br />
München (Reinhardt Ernst) 1999, ISBN: 3-497-01492-3.<br />
5-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen,<br />
– besser verständliche Texte zu schreiben,<br />
– flüssig lesbare Texte zu schreiben,<br />
– eigene und fremde Texte kritisch zu bewerten.<br />
„Schreiben“ heißt nicht: hinschreiben, sondern<br />
das Hingeschriebene planvoll nach Regeln umzugestalten,<br />
bis es <strong>die</strong> angestrebte Qualität hat.<br />
Das Schreiben guter Texte ist nicht wenigen Genies vorbehalten, sondern<br />
harte (handwerkliche?) Arbeit.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-3
5-4
Sprache und Leser/Hörer (1)<br />
Wann liest ein Leser?<br />
— Wenn er den Inhalt kennen muß:<br />
Gebrauchsanweisung, Schriftsatz eines Rechtsanwalts,<br />
Diplomarbeit, <strong>Vorlesung</strong>sskript, …<br />
— Wenn der Text „verständlich und gefällig“ (Schneider) geschrieben ist<br />
eine winzig-kleine Chance!<br />
„Ich suche in den Büchern nichts, als mich bei einem ehrbaren Zeitvertreib zu amüsieren.<br />
Wenn ich beim Lesen auf Schwierigkeiten stoße, so beiße ich mir nicht <strong>die</strong> Fingernägel<br />
ab; bin ich den Schwierigkeiten ein- oder zweimal auf den Leib gerückt, so lasse<br />
ich sie liegen … Wenn mich ein Buch verdrießt, so greife ich nach einem anderen.“<br />
„Wer aber nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile schreiben.“<br />
Montaigne (nach [4])<br />
Goethe (nach [4])<br />
„In der Tat kann der Leser nicht weich genug gehalten werden, und wir müssen ihn,<br />
sobald <strong>die</strong> Sache nicht einbüßt, auf den Händen tragen mit unseren Schreibfingern.“<br />
Jean Paul (nach [4])<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-5
5-6
Sprache und Leser/Hörer (2)<br />
Sprache ist ein unvollkommenes Kommunikationswerkzeug [5]:<br />
— Doppeldeutigkeiten, z.B.<br />
alle Alle Äpfel sind im Keller ↔ Die Äpfel sind alle.<br />
erst Erst ist Fritz dran, ↔ dann erst Du.<br />
Aufgabe Diese schwierige Aufgabe habe ich ↔ aufgegeben.<br />
— „unlogische“ Konstruktionen, z.B.<br />
Kaffeemühle, Windmühle<br />
Lebensgefahr, Todesgefahr<br />
Arbeitspause, Denkpause<br />
— Bedeutungswandel der Begriffe, z.B.<br />
Droge<br />
sorgfältiger Umgang mit der Sprache!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-7
5-8
Verständlichkeit (1)<br />
Methodik zur Steigerung der Verständlichkeit von Texten durch<br />
— Strukturierung<br />
— Formulierung<br />
wissenschaftliche Überprüfung der Ergebnisse der Verständlichkeitsforschung<br />
— Ausstattung von Vergleichsgruppen mit verständlichen/unverständlichen Texten<br />
(Textbewertung durch Jury: „Kampfrichter beim Eiskunstlauf“)<br />
— Wieviel wird von den Probanden verstanden/memoriert?<br />
… in Abhängigkeit von der Vorbildung der Probanden:<br />
→ gebildete/ungebildete Leser profitieren gleichermaßen<br />
… in Abhängigkeit von der Textqualität<br />
→ je verständlicher ein Text, desto höher der Leseerfolg<br />
… in Vergleich zu anderen Methoden, z.B. programmierten Unterweisungen<br />
→ programmierte Unterweisungen: zu wenig prägnant, Gliederung „verschwimmt“,<br />
längere Bearbeitungszeit, hohe Kosten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-9
5-10
Verständlichkeit (2)<br />
Hamburger Verständlichkeitsmodell [6]<br />
— Merkmale der Verständlichkeit:<br />
1. Einfachheit<br />
2. Gliederung – Ordnung<br />
3. Kürze – Prägnanz<br />
4. Anregende Zusätze<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-11
5-12
Verständlichkeit (3)<br />
Hamburger Verständlichkeitsmodell [6]<br />
— Merkmale der Verständlichkeit:<br />
1. Einfachheit<br />
kurze, einfache Sätze, geläufige Wörter bzw. erklärte Fachwörter,<br />
konkrete und anschauliche Darstellung<br />
2. Gliederung – Ordnung<br />
3. Kürze – Prägnanz<br />
4. Anregende Zusätze<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-13
5-14
Verständlichkeit (4)<br />
Hamburger Verständlichkeitsmodell [6]<br />
— Merkmale der Verständlichkeit:<br />
1. Einfachheit<br />
kurze, einfache Sätze, geläufige Wörter bzw. erklärte Fachwörter,<br />
konkrete und anschauliche Darstellung<br />
2. Gliederung – Ordnung<br />
gegliedert, folgerichtig, übersichtlich, gute Unterscheidung von wesentlich und<br />
unwesentlich, sichtbarer roter Faden<br />
3. Kürze – Prägnanz<br />
4. Anregende Zusätze<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-15
5-16
Verständlichkeit (5)<br />
Hamburger Verständlichkeitsmodell [6]<br />
— Merkmale der Verständlichkeit:<br />
1. Einfachheit<br />
kurze, einfache Sätze, geläufige Wörter bzw. erklärte Fachwörter,<br />
konkrete und anschauliche Darstellung<br />
2. Gliederung – Ordnung<br />
gegliedert, folgerichtig, übersichtlich, gute Unterscheidung von wesentlich und<br />
unwesentlich, sichtbarer roter Faden<br />
3. Kürze – Prägnanz<br />
Beschränkung aufs Wesentliche, konzentriert, jedes Wort ist notwendig<br />
4. Anregende Zusätze<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-17
5-18
Verständlichkeit (6)<br />
Hamburger Verständlichkeitsmodell [6]<br />
— Merkmale der Verständlichkeit:<br />
1. Einfachheit<br />
kurze, einfache Sätze, geläufige Wörter bzw. erklärte Fachwörter,<br />
konkrete und anschauliche Darstellung<br />
2. Gliederung – Ordnung<br />
gegliedert, folgerichtig, übersichtlich, gute Unterscheidung von wesentlich und<br />
unwesentlich, sichtbarer roter Faden<br />
3. Kürze – Prägnanz<br />
Beschränkung aufs Wesentliche, konzentriert, jedes Wort ist notwendig<br />
4. Anregende Zusätze<br />
anregend, interessant, abwechslungsreich, persönlich<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-19
5-20
Verständlichkeit (7)<br />
Bewertung anhand einer Matrix<br />
— „Notenskala“:<br />
Einfachheit Gliederung – Ordnung<br />
Kürze – Prägnanz Anregende Zusätze<br />
– – grobe Verstöße gegen <strong>die</strong> Anfoderungen des Verständlichkeitsmerkmals<br />
– einige Verstöße<br />
0 neutrale Mitte<br />
+ überwiegende Einhaltung der Anforderungen<br />
++ Einhaltung aller oder fast aller Anforderungen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-21
5-22
Verständlichkeit (8)<br />
Notenverteilung für verständliche Texte<br />
Einfachheit<br />
Einfachheit ist das wichtigste<br />
Verständlichkeitsmerkmal. Deshalb:<br />
++<br />
Kürze – Prägnanz<br />
Sehr knappe Texte sind ebenso so schwer<br />
zu verstehen wie weitschweifige.<br />
0 oder +<br />
Gliederung – Ordnung<br />
Ist ähnlich wichtig wie <strong>die</strong> Einfachheit.<br />
Deshalb ebenfalls:<br />
(Meine Sicht auf Anregende Zusätze weicht geringfügig von [6] ab;<br />
im Kontext von Präsentationen und wissenschaftl. Veröffentlichungen ist das begründet.)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-23<br />
++<br />
Anregende Zusätze<br />
Nur bei gut gegliedertem Text;<br />
stiften sonst eher Verwirrung.<br />
– oder 0
5-24
Verständlichkeit (9)<br />
ein Beispiel (aus [6]):<br />
§57 StVZO: „Die Anzeige der Geschwindigkeitsmesser darf vom Sollwert abweichen<br />
in den letzten beiden Dritteln des Anzeigebereichs – jedoch mindestens von der<br />
50 km/st-Anzeige ab, wenn <strong>die</strong> letzten beiden Drittel des Anzeigebereichs oberhalb<br />
der 50 km/st liegen – 0 bis +7 von Hundert des Skalenendwertes; bei Geschwindigkeiten<br />
von 20 km/st und darüber darf <strong>die</strong> Anzeige den Sollwert nicht unterschreiten.“<br />
Einfachheit<br />
komplizierter Satzbau: Einschub, nachgestellte<br />
adverbiale Bestimmung<br />
ungeläufige (und falsche) Wörter: Sollwert, km/st,<br />
Geschwindkeitsmesser, Skalenendwert<br />
holprige Sprache<br />
– –<br />
Kürze – Prägnanz<br />
extrem knappe Formulierung<br />
++<br />
Gliederung – Ordnung<br />
unklare Aufgliederung der verschiedenen zu<br />
betrachtenden Fälle<br />
fehlen (korrekterweise).<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-25<br />
– –<br />
Anregende Zusätze<br />
– –
5-26
Verständlichkeit (10)<br />
eine verständliche(re) Formulierung<br />
„Die Tachometeranzeige darf von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit wie folgt<br />
abweichen:<br />
1. Für den Anzeigebereich ab 20 km/h darf ein Tachometer nicht weniger als <strong>die</strong> tatsächlich<br />
gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.<br />
2. In letzten beiden Dritteln des Anzeigebereichs darf ein Tachometer bis zu 7% vom<br />
Skalenendwert mehr anzeigen. Für Tachometer, deren Anzeigebereich über 150 km/h<br />
hinausgeht, gilt <strong>die</strong>se Regelung schon ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h.“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 5-27
5-28
41wissenschaftssprac<br />
SPRACHE UND FORM<br />
6. WISSENSCHAFTSSPRACHE<br />
UND WISSENSCHAFTLICHE<br />
TEXTE<br />
1. Lernziel<br />
2. Wissenschaftssprache<br />
3. Fachbegriffe<br />
4. Umgang mit der Literatur<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Krämer, W.:<br />
Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1995 (4. Auflage), ISBN 3-8252-1633-0.<br />
[2] Kruse, O.:<br />
Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Frankfurt u.a. (Campus) 1997 (5. Auflage), ISBN 3-593-35693-7.<br />
[3] Reiners, L.:<br />
Stilfibel.<br />
München (dtv) 1998, ISBN 3-423-30005-1.<br />
[4] Schneider, W.:<br />
Deutsch fürs Leben.<br />
Reinbek (rororo Sachbuch) 1994, ISBN 3-499-19695-6.<br />
[5] Schneider, W.:<br />
Deutsch für Kenner.<br />
München u.a. (Serie Piper) 1996, ISBN 3-492-22216-1.<br />
[6] Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R.:<br />
Sich verständlich ausdrücken.<br />
München (Reinhardt Ernst) 1999, ISBN: 3-497-01492-3.<br />
6-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen,<br />
– welche Eigenschaften <strong>die</strong> Wissenschaftssprache hat,<br />
– bei Schreiben wissenschaftlicher Texte eine<br />
korrekte Sprachhaltung einzunehmen,<br />
– zugehörige Formalia zu verwenden, und<br />
– Ihre eigenen wissenschaftlichen Texte systematisch<br />
zu beurteilen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-3
6-4
Wissenschaftssprache (2)<br />
Ziele der Wissenschaftssprache:<br />
Verständigung innerhalb der Wissenschaften:<br />
Wissenschaft als<br />
„Kommunikationsgemeinschaft“<br />
manchmal zwei scheinbar unvereinbare Ziele, da<br />
Verständigung in der Öffentlichkeit:<br />
Kommunikation in der demokratischen<br />
„Wissensgesellschaft“<br />
Kommunikation in der Öffentlichkeit auf <strong>die</strong> Fachsprache verzichten muß<br />
öffentliche Kommunikation von bestimmten Wissenschaftlern als<br />
unwissenschaftlich empfunden wird<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-5
6-6
Wissenschaftssprache (3)<br />
Sprachmuster<br />
— begründen<br />
Aussagen werden begründet,<br />
<strong>die</strong> eigene Vorgehensweise wird begründet.<br />
also nicht: „Offensichtlich eignet sich Dijkstras SPF-Algorithmus für <strong>die</strong> schnelle Berechnung von<br />
Wegewahltabellen …“<br />
sondern: „Die Laufzeit von Dijkstras SPF-Algorithmus hängt linear von der Anzahl der Knoten im<br />
Netz ab; er ist deshalb für <strong>die</strong> Berechung von Wegewahltabellen geeignet …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-7
6-8
Wissenschaftssprache (4)<br />
Sprachmuster<br />
— begründen<br />
Aussagen werden begründet,<br />
<strong>die</strong> eigene Vorgehensweise wird begründet.<br />
— differenzieren<br />
Der Gültigkeitsbereich von Lösungen, Aussagen, Argumenten, … wird bestimmt.<br />
also nicht: „Mit dem Service Location Protocol lassen sich Dienste im Netz lokalisieren …“<br />
sondern: „SLP is intended to function within networks under cooperative administrative control.<br />
Such networks permit a policy to be implemented regarding security, multicast routing<br />
and organization of services and clients into groups which are not be feasible on the<br />
scale of the Internet as a whole. …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-9
6-10
Wissenschaftssprache (5)<br />
Sprachmuster<br />
— begründen<br />
Aussagen werden begründet,<br />
<strong>die</strong> eigene Vorgehensweise wird begründet.<br />
— differenzieren<br />
Der Gültigkeitsbereich von Lösungen, Aussagen, Argumenten, … wird bestimmt.<br />
— definieren<br />
Zentrale Begriffe werden definiert. Vorrang haben belegbare Definitionen;<br />
manchmal ist es aber auch notwendig, eigene Definitionen zu entwickeln.<br />
richtig: „Hammer und Champy definieren in [17]: ’A business process is a collection of activities<br />
that take one or more kinds of input and creates an output that is of value to the<br />
customer.’ …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-11
6-12
Wissenschaftssprache (6)<br />
Sprachmuster<br />
— begründen<br />
Aussagen werden begründet,<br />
<strong>die</strong> eigene Vorgehensweise wird begründet.<br />
— differenzieren<br />
Der Gültigkeitsbereich von Lösungen, Aussagen, Argumenten, … wird bestimmt.<br />
— definieren<br />
Zentrale Begriffe werden definiert. Vorrang haben belegbare Definitionen;<br />
manchmal ist es aber auch notwendig, eigene Definitionen zu entwickeln.<br />
— systematisieren/klassifizieren<br />
Die Probleme werden in einen Zusammenhang eingeordnet.<br />
richtig: „HTTP is an application-level protocol …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-13
6-14
Wissenschaftssprache (7)<br />
Sprachmuster<br />
— begründen<br />
Aussagen werden begründet,<br />
<strong>die</strong> eigene Vorgehensweise wird begründet.<br />
— differenzieren<br />
Der Gültigkeitsbereich von Lösungen, Aussagen, Argumenten, … wird bestimmt.<br />
— definieren<br />
Zentrale Begriffe werden definiert. Vorrang haben belegbare Definitionen;<br />
manchmal ist es aber auch notwendig, eigene Definitionen zu entwickeln.<br />
— systematisieren/klassifizieren<br />
Die Probleme werden in einen Zusammenhang eingeordnet.<br />
— logisch schließen und widerspruchsfrei argumentieren<br />
Die Darstellung ist nachvollziehbar.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-15
6-16
Wissenschaftssprache (8)<br />
Sprachliche Grundhaltung<br />
— objektiv<br />
Der Gegenstand der Entwicklung/Untersuchung steht im Mittelpunkt,<br />
nicht der Entwickelnde/Untersuchende!<br />
also nicht: „Das System wurde von mir entwickelt um nachzuweisen, daß …“<br />
sondern: „Das System wurde entwickelt um nachzuweisen, daß …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-17
6-18
Wissenschaftssprache (9)<br />
Sprachliche Grundhaltung<br />
— objektiv<br />
Der Gegenstand der Entwicklung/Untersuchung steht im Mittelpunkt, nicht der<br />
Entwickelnde/Untersuchende!<br />
— sachlich<br />
sachliche Kriterien statt schmückender Zusätze<br />
also nicht: „Die Firma XY gehört zu den im Weltmarkt führenden Anbietern von …“<br />
sondern: „Zur Produktpalette der Firma XY gehören …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-19
6-20
Wissenschaftssprache (10)<br />
Sprachliche Grundhaltung<br />
— objektiv<br />
Der Gegenstand der Entwicklung/Untersuchung steht im Mittelpunkt, nicht der<br />
Entwickelnde/Untersuchende!<br />
— sachlich<br />
sachliche Kriterien statt schmückender Zusätze<br />
— methodisch<br />
Die Darstellung orientiert sich an der Untersuchungs-/Entwicklungsmethodik, nicht an<br />
der Reihenfolge der Durchführung einzelner Tätigkeiten.<br />
also nicht: „In einer ersten Phase wurde <strong>die</strong> Softwarekonfiguration festgelegt.“<br />
sondern: „Die Softwarekonfiguration wurde so festgelegt, daß sie <strong>die</strong> folgenden Anforderungen<br />
erfüllt.“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-21
6-22
Wissenschaftssprache (11)<br />
Sprachliche Grundhaltung<br />
— objektiv<br />
Der Gegenstand der Entwicklung/Untersuchung steht im Mittelpunkt, nicht der<br />
Entwickelnde/Untersuchende!<br />
— sachlich<br />
sachliche Kriterien statt schmückender Zusätze<br />
— methodisch<br />
Die Darstellung orientiert sich an der Untersuchungs-/Entwicklungsmethodik, nicht an<br />
der Reihenfolge der Durchführung einzelner Tätigkeiten.<br />
— präzise<br />
Funktionen und Strukturen werden genau und unmißverständlich beschrieben.<br />
Ein Ding wird stets mit demselben Begriff bezeichnet.<br />
also nicht: „Mit Hilfe eines Sliding Window-Protokolls können Daten schneller übertragen werden.“<br />
sondern: „Mit Hilfe eines Sliding Window-Protokolls kann ein Kanal mit hoher Kapazität und<br />
großer Verzögerungszeit effektiv ausgelastet werden.“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-23
Sprachliche Grundhaltung der Wissenschaftssprache<br />
objektiv<br />
Also nicht: „Das System wurde von mir entwickelt um nachzuweisen, daß …“<br />
Sondern: „Das System wurde entwickelt um nachzuweisen, daß …“<br />
sachlich<br />
Also nicht: „Die Firma XY gehört zu den im Weltmarkt führenden Anbietern von …“<br />
Sondern: „Zur Produktpalette der Firma XY gehören …“<br />
methodisch<br />
Also nicht: „In einer ersten Phase wurde <strong>die</strong> Softwarekonfiguration festgelegt.“<br />
Sondern: „Die Softwarekonfiguration wurde so festgelegt, daß sie <strong>die</strong> folgenden Anforderungen erfüllt.“<br />
präzise<br />
Also nicht: „Mit Hilfe eines Sliding Window-Protokolls können Daten schneller übertragen werden.“<br />
Sondern: „Mit Hilfe eines Sliding Window-Protokolls kann ein Kanal mit hoher Kapazität und großer Verzögerungszeit<br />
effektiv ausgelastet werden.“<br />
6-24
Wissenschaftssprache (12)<br />
Sprachliche Grundhaltung<br />
— formal<br />
Formale Darstellungen da, wo sie <strong>die</strong> Präzision erhöhen. Formal heißt nicht:<br />
formalistisch.<br />
— graphisch<br />
Ein gutes(!) Bild sagt mehr als tausend Worte.<br />
— verständlich<br />
Ein Musterleser mit definierter Vorbildung kann den Text verstehen. Jargon wird<br />
vermieden. Eine anschauliche Deutung komplexer Sachverhalte kann helfen.<br />
— selbstkritisch<br />
Alternative Lösungen werden nicht „verrissen“, sondern angemessen gewürdigt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-25
6-26
Fachbegriffe (1)<br />
Begriffe sollen beim Begreifen helfen!<br />
— sorgfältige Wahl der Fachbegriffe<br />
— gezielte Verwendung<br />
Fachkontext und Alltagskontext<br />
— oftmals abgewandelte, spezialisierte Bedeutung von Begriffen im Fachkontext<br />
— Fachbegriffe im Text explizit definieren,<br />
wenn sie von zentraler Bedeutung für das Verständnis sind.<br />
— Fachbegriffe in einer Klammer oder im Glossar definieren,<br />
wenn sie von untergeordneter Bedeutung sind.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-27
6-28
Fachbegriffe (2)<br />
Fachbegriffe vs. Jargon<br />
„[…] Jargon hat in akademischen Abschlußarbeiten nichts zu suchen, er vermittelt<br />
nicht, sondern grenzt ab, er begründet keine geistige Gemeinschaft, sondern stellt<br />
eine intellektuelle Hackordnung her: Der Experte bin ich, und ihr anderen hört jetzt alle<br />
einmal zu. Der Jargonist will nicht vermitteln, sondern predigen, nicht erläutern, sondern<br />
blenden, nicht anderen etwas mitteilen, sondern sich selbst in Szene setzen …“<br />
(Krämer, S. 121)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-29
6-30
Fachbegriffe (3)<br />
ein Negativbeispiel für Jargon<br />
Microsoft stampft Green ein (Computer Zeitung Nr. 11, 2005, 14.3.2005, S. 3)<br />
Redmond (jf) - „Um unseren Kunden einen sanften Übergang zu ermöglichen, werden wir<br />
Dotnet-Funktionalitäten in <strong>die</strong> bestehenden Geschäftsanwendungen einbauen, anstatt<br />
eine vollkommen neue Lösung zu entwickeln“. So macht Doug Burgum, Senior Vice President<br />
der Microsoft Business Solutions Group, den Anwendern <strong>die</strong> geänderte Strategie bei<br />
Unternehmenssoftware schmackhaft. In der ersten Welle von 2005 bis 2007 will Microsoft<br />
Axapta, Navi-sion, Great Plains und Solomon an <strong>die</strong> serviceorientierte Architektur heranführen.<br />
Alle Suites bekommen dann rollenbasierte Clients. Der Sharepoint Portal Server<br />
verbindet strukturierte und unstrukturierte Daten und stellt Workflow-Funktionen bereit,<br />
während der SQL-Server für Business-Intelligence-Funktionen zuständig ist. Die Verbindung<br />
der Programme untereinander und mit den Produkten von Drittanbietern läuft über<br />
Webservices. In der zweiten Welle ab 2008 ist <strong>die</strong> modulare Konfiguration von Geschäftsabläufen<br />
über <strong>die</strong> Business Software geplant. Zudem soll eine Softwarebibliothek optimierte<br />
Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Diese Strategie kommt einem radikalen<br />
Richtungswechsel gleich. Bisher wollte Microsoft <strong>die</strong> bestehenden Suites komplett durch<br />
ein Dotnet-basiertes Produkt ersetzen. Die jüngste Version des mehrfach verzögerten Zeitplans<br />
von Projekt Green sah vor, dass <strong>die</strong>ses Produkt frühestens 2010 auf den Markt<br />
kommt. Gleichzeitig bekamen <strong>die</strong> bestehenden Releases eine Wartungsgarantie bis 2012.<br />
Der geänderte Produktfahrplan soll sich bereits auf Axapta 4.0 und Navision 5.0 auswirken,<br />
<strong>die</strong> im ersten und zweiten Halbjahr 2006 kommen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-31
6-32
Fachbegriffe (4)<br />
Englische Begriffe sind nicht immer vermeidbar, aber öfter als man denkt<br />
update aktualisieren<br />
backup sichern<br />
managen verwalten; manchmal auch: steuern<br />
control Steuerung<br />
scheduling Ablaufsteuerung<br />
dispatching Betriebsmittelzuteilung<br />
proxy Stellvertreter<br />
head crash Kopflandung<br />
file Datei<br />
folder Ordner; oder: Verzeichnis<br />
sample abtasten, Stichprobe, Beispiel, Probe<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-33
6-34
Fachbegriffe (5)<br />
Vorschläge zu fremdsprachigen Begriffen<br />
— Fremdsprachige Begriffe in einen „typographischen Zaun“ stellen,<br />
z.B. kursiv schreiben.<br />
oder<br />
Innerhalb <strong>die</strong>ses typographischen Zauns können <strong>die</strong> fremdsprachigen<br />
Rechtschreibregeln angewendet werden, z.B. englische Schreibung von<br />
zusammengesetzten Wörtern ohne Bindestrich.<br />
— Benutzung einer sinnvollen Übersetzung<br />
Erwähnung des englischen Begriffs in Klammern:<br />
hilft dem Leser, sich weitere Literatur (z.B. Standards) zu erschließen.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-35
6-36
Fachbegriffe (6)<br />
Vorschläge zur Schreibung fremdsprachiger Begriffe<br />
— Artikel richtet sich nach einer plausiblen Übersetzung, z.B.<br />
Firewall → Brandschutzmauer → <strong>die</strong> Firewall<br />
Host → Wirtsrechner → der Host<br />
— Wenn <strong>die</strong> Deklination/Konjugation unsicher sind: umschreiben; z.B.<br />
des Servers ? → des Server-Systems<br />
gebooted ? → neu gestartet, urgeladen<br />
mailen ? → eine e-Mail senden<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-37
6-38
Umgang mit der Literatur (1)<br />
Belegen<br />
Zitieren<br />
Kruse: „Anführen von Forschungsergebnissen oder Quellen,<br />
<strong>die</strong> eigene Behauptungen stützen können“ ([2], S. 103)<br />
Dazu gehört → ein Belegsystem.<br />
Wörtliche Wiedergabe fremder Aussagen.<br />
Regeln für eigene Veränderungen des Originals beachten!<br />
Paraphrasieren<br />
Umschriebene Wiedergabe fremder Aussagen, wenn ein Zitat oder ein Beleg<br />
nicht ausreichen.<br />
Verweisen<br />
Hinweis auf Schriften, in denen ähnliche Aussagen zu finden sind,<br />
<strong>die</strong> dort ausführlich begründet werden.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-39
6-40
Umgang mit der Literatur (2)<br />
Zitate<br />
— Die Länge und <strong>die</strong> Anzahl von Zitaten ist wohl zu erwägen!<br />
Zu lange und zu viele Zitate in Diplom-Arbeiten wirken ermüdend und lassen den<br />
Verfasser als unselbständig und unbeholfen erscheinen.<br />
Zitate > ¾ Textseite sollen entweder gar nicht verwendet oder aber in einen<br />
Quellen- bzw. Dokumententeil am Schluß der Arbeit eingestellt werden.<br />
— Alle wörtlichen Übernahmen aus fremden Texten sind als Zitate kenntlich zu machen.<br />
Andernfalls – ein Verstoß gegen <strong>die</strong> Regeln guter wissenschaftlicher Praxis.<br />
Auch „wörtliche“ Übersetzungen gelten als Zitate .<br />
— Übliche Kennzeichnung von Zitaten: Anführungsstriche am Beginn und Ende.<br />
Bei Zitaten in Kursivschrift werden keine Anführungszeichen gesetzt.<br />
Bei längeren Zitaten kann der zitierte Text eingerückt werden.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-41
Zitieren<br />
Ich folge in meinen Ausführungen zum Zitieren dem nachfolgenden, ausführlich zitierten Text:<br />
„An Zitate ist <strong>die</strong> Grundforderung zu stellen, "wörtlich" - also genau und richtig - zu sein. Damit sei auf <strong>die</strong> Notwendigkeit sorgfältiger Übernahme<br />
der Fremdtexte hingewiesen, wenn der zu zitierende Text beim Niederschreiben nicht selbst vorliegt.<br />
Veränderungen am zitierten Text dürfen grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Auslassungen sind im Falle eines Wortes durch<br />
zwei Punkte, im Falle mehrerer Wörter oder gar Sätze durch drei Punkte zu kennzeichnen. Diese Punkte auch noch in eckige Klammern<br />
einzuschliessen, bitte ich bei Diplom-Arbeiten zu unterlassen.<br />
Üblich ist es, den Beginn und das Ende von Zitaten durch Anführungsstriche zu kennzeichnen. In letzter Zeit setzt sich durch, Zitate in<br />
Kursivschrift wieder-zugeben. Diesfalls dürften jedoch nicht auch noch Anführungszeichen gesetzt werden. Bei längeren Zitaten kann der<br />
zitierte Text auch eingerückt werden.<br />
Hervorhebungen (Kursivdruck, Sperrungen, fette Schrift, Unterstreichungen) im zitierten Text müssen übernommen werden. Will man<br />
als Zitierender solche in den Text einbringen, dann muss man in eckigen Klammern angeben: [Hervorhebung von N.N.], wobei "N.N:" für<br />
<strong>die</strong> Anfangsbuchstaben des Zitierenden steht. Die oft anzutreffende Form: [Hervorhebung vom Verf.] betrachte ich als Verstoss gegen <strong>die</strong><br />
Zitier-Regeln; denn ich möchte nicht stundenlang werweissen, ob mit "Verf." der Zitierende oder der Zitierte gemeint ist.<br />
Fehlerhafte Schreibweisen oder ähnliche Ungereimtheiten im zitierten Text dürfen nicht korrigiert werden. Sie sind zu übernehmen und<br />
mit [!] oder [sic!] bzw. [so!] zu versehen.<br />
In begrenztem Umfang sind Ergänzungen in Zitaten dann erlaubt, wenn sie zum richtigen oder besseren Verständnis erforderlich sind.<br />
Sie werden dann in eckige Klammern gesetzt. Beispiel: "In <strong>die</strong>sem Jahr [1948] wurde <strong>die</strong> Reichsmark durch <strong>die</strong> Deutsche Mark abgelöst".<br />
Zitate in den Sprachen Englisch und Französisch müssen bei mir vorgelegten Diplom-Arbeiten nicht übersetzt werden. Bei allen anderen<br />
Sprachen verlange ich neben dem Originalzitat <strong>die</strong> deutsche Übersetzung. Liegen deutsche Ausgaben der herangezogenen Werke<br />
vor, so ist im Regelfall aus <strong>die</strong>sen zu zitieren.<br />
Zitate ab Dreiviertel einer Textseite sollen entweder gar nicht verwendet oder aber in einen Quellen- bzw. Dokumententeil am Schluss<br />
der Arbeit eingestellt werden.<br />
Die Länge und <strong>die</strong> Anzahl von Zitaten ist wohl zu erwägen! Zu lange und zu viele Zitate in Diplom-Arbeiten wirken ermüdend und lassen<br />
den Verfasser als un-selbständig und unbeholfen erscheinen.“ (Gerhard Merk, Siegen, http://www.uni-siegen.de/~merk)<br />
6-42
Umgang mit der Literatur (3)<br />
Zitate (Forts.)<br />
— Grundforderung: Zitate müssen „wörtlich“ – also genau und richtig – sein.<br />
Auslassungen sind im Falle eines Wortes durch zwei Punkte zu kennzeichnen.<br />
Auslassung von mehreren Wörter oder gar Sätzen sind durch durch drei Punkte<br />
(„Ellipse“) zu kennzeichnen.<br />
„„An ATM network provides an end-to-end ATM layer connectivity between end stations.<br />
The ATM layer deals only with the functions of the cell header … This simplicity is<br />
necessary to keep up with high-speed transmission links, and it is achieved by leaving<br />
out various services required by applications.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-43
6-44
Umgang mit der Literatur (4)<br />
Zitate (Forts.)<br />
— Grundforderung: Zitate müssen „wörtlich“ – also genau und richtig – sein.<br />
Auslassungen sind im Falle eines Wortes durch zwei Punkte zu kennzeichnen.<br />
Auslassung von mehreren Wörter oder gar Sätzen sind durch durch drei Punkte<br />
(„Ellipse“) zu kennzeichnen.<br />
— Hervorhebungen (Kursivdruck, Sperrungen, fette Schrift, Unterstreichungen) im<br />
zitierten Text müssen übernommen werden.<br />
— Eigene Hervorhebungen muß man kenntlich machen:<br />
„Das verbindungslose [Hervorhebung N.L.] IP-Protokoll …“<br />
— Fehlerhafte Schreibweisen oder Ungereimtheiten im zitierten Text dürfen nicht<br />
korrigiert werden. Sie sind ggf. mit [!] oder [sic!] bzw. [so!] zu versehen.<br />
— Ergänzungen in Zitaten sind durch eckige Klammern kenntlich zu machen:<br />
„Der Transport [von Datagrammen] ist …“<br />
gilt auch für Umstellungen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-45
6-46
Umgang mit der Literatur (5)<br />
Zitate (Forts.)<br />
— Englische Zitate müssen nicht übersetzt werden. Bei anderen Sprachen ist im<br />
Regelfall aus vorliegenden Übersetzungen zu zitieren.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-47
6-48
Umgang mit der Literatur (6)<br />
Belegsystem<br />
— Ziel: schnelles und eindeutiges Auffinden der Quelle für eine wissenschaftliche<br />
Aussage<br />
— verschiedene Belegsysteme:<br />
Vollbeleg (d.h. <strong>komplette</strong> bibliographische Angabe) im laufenden Text<br />
Vollbeleg in einer Fußnote<br />
Vollbeleg im Literaturverzeichnis, im Text nur ein Verweis auf den Vollbeleg<br />
(„Kurzbeleg“), dabei verschiedene Formen des Kurzbelegs<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-49
6-50
Umgang mit der Literatur (7)<br />
Belegsystem<br />
— in der technischen Literatur üblicherweise wie folgt:<br />
Im Text: Kurzbelege in der Form [], wobei auf einen Eintrag im<br />
Literaturverzeichnis verweist.<br />
Neben dem Kurzbeleg wird zusätzlich meist der Autor/<strong>die</strong> Autorin genannt:<br />
„Wie Müller in [23] ausführt, …“<br />
Bei wörtlichen Zitaten wird der Kurzbeleg zusammen mit der Seitenzahl in runde<br />
Klammern gesetzt: „Müller spricht von „wunderschönen Seifenblasen in den<br />
Köpfen junger Autoren“ ([23], S. 24).“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-51
6-52
Umgang mit der Literatur (8)<br />
Literaturverzeichnis<br />
— Literaturverzeichnis alphabetisch nach dem Nachnamen des erstgenannten Autors<br />
sortieren.<br />
— Bibliographische Angaben sind nicht dem Einband, sondern dem Titelblatt und<br />
dessen Rückseite (dem Impressum) zu entnehmen.<br />
— Alle Titel sind aufzunehmen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Arbeit benutzt worden sind, allerdings nicht<br />
Fremdwörterbuch, Rechtschreibe-Lexikon, wichtige Fachbücher usw.<br />
— Formatierung vorzugsweise wie folgt:<br />
[7] Cheswick, W.R., Bellovin, St.M.:<br />
Firewalls und Sicherheit im Internet.<br />
Bonn u.a. (Addison-Wesley) 1999.<br />
[8] Link, C., Luttenberger, N.:<br />
Sicheres Nomadic Computing in Intranet-Umgebungen – Problemstellungen und Lösungskonzepte.<br />
In: Killat, U., Lamersdorf, W. (Ed.): Kommunikation in verteilten Systemen; Fachtagung Hamburg, 20.–23.2.2001,<br />
Berlin u.a. (Springer) 2001, 37–45.<br />
[9] Luttenberger, N.:<br />
Sicherer mobiler Dienstezugang – Gastarbeitsplätze in Intranets.<br />
Wirtschaftsinformatik 42, 6 (Dez. 2000), 523–530.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-53
6-54
Umgang mit der Literatur (9)<br />
Literaturverzeichnis (Forts.)<br />
— daneben viele unterschiedliche Formatierungsvorschriften: z.B.<br />
IEEE, Springer-Verlag, Zeitschriften<br />
— wichtig:<br />
erkennbares System<br />
Angeführte Literatur kann gefunden werden.<br />
— z.B. IEEE:<br />
„List and number all bibliographical references in 9-point Times, single-spaced, at the<br />
end of your paper. When referenced in the text, enclose the citation number in square<br />
brackets, for example [1]. Where appropriate, include the name(s) of editors of<br />
referenced books.<br />
[1] A.B. Smith, C.D. Jones, and E.F. Roberts, "Article Title", Journal, Publisher, Location, Date, pp. 1-10.<br />
[2] Jones, C.D., A.B. Smith, and E.F. Roberts, Book Title, Publisher, Location, Date.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 6-55
6-56
42stil.fm<br />
SPRACHE UND FORM<br />
7. GUTER STIL<br />
1. Lernziel<br />
2. Gute, schlechte Vorbilder<br />
3. Stilkunde<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Krämer, W.:<br />
Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit.<br />
München u.a. (UTB) 1995 (4. Auflage), ISBN 3-8252-1633-0.<br />
[2] Kruse, O.:<br />
Keine Angst vor dem leeren Blatt.<br />
Frankfurt u.a. (Campus) 1997 (5. Auflage), ISBN 3-593-35693-7.<br />
[3] Reiners, L.:<br />
Stilfibel.<br />
München (dtv) 1998, ISBN 3-423-30005-1.<br />
[4] Schneider, W.:<br />
Deutsch fürs Leben.<br />
Reinbek (rororo Sachbuch) 1994, ISBN 3-499-19695-6.<br />
[5] Schneider, W.:<br />
Deutsch für Kenner.<br />
München u.a. (Serie Piper) 1996, ISBN 3-492-22216-1.<br />
[6] Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R.:<br />
Sich verständlich ausdrücken.<br />
München (Reinhardt Ernst) 1999, ISBN: 3-497-01492-3.<br />
7-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen,<br />
– flüssig lesbare Texte zu schreiben,<br />
– eigene und fremde Texte kritisch zu bewerten.<br />
„Schreiben“ heißt nicht: hinschreiben, sondern<br />
das Hingeschriebene planvoll nach Regeln umzugestalten,<br />
bis es <strong>die</strong> angestrebte Qualität hat.<br />
Das Schreiben guter Texte ist nicht wenigen Genies vorbehalten, sondern<br />
harte (handwerkliche?) Arbeit.<br />
Stilkunde<br />
— Regelwerk für <strong>die</strong> Steigerung der Qualität von Einzelformulierungen<br />
— kann als Komponente des von der Verständlichkeitsforschung erarbeiteten<br />
Repertoires gesehen werden<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-3
7-4
Gute, schlechte Vorbilder (1)<br />
Mein persönliches Vorbild: Sigmund Freud<br />
„Außer dem Ich erkennen wir ein anderes seelisches Gebiet, umfangreicher, großartiger<br />
und dunkler als das Ich, und <strong>die</strong>s heißen wir das Es. Sie werden es wahrscheinlich beanstanden,<br />
daß wir zur Bezeichnung unserer beiden seelischen Instanzen oder Provinzen<br />
einfache Fürwörter gewählt haben, anstatt vollautende griechische Namen für sie einzuführen.<br />
Allein wir lieben es in der Psychoanalyse, im Kontakt mit der populären Denkweise<br />
zu bleiben, und ziehen es vor, deren Begriffe wissenschaftlich brauchbar zu<br />
machen, anstatt sie zu verwerfen. Es ist kein Ver<strong>die</strong>nst daran, wir müssen so vorgehen,<br />
weil unsere Lehren von unseren Patienten verstanden werden sollen, <strong>die</strong> oft sehr intelligent<br />
sind, aber nicht immer gelehrt. Das unpersönliche Es schließt sich unmittelbar an<br />
gewisse Ausdrucksweisen des normalen Menschen an. „Es hat mich durchzuckt“, sagt<br />
man; „es war etwas in mir, was in <strong>die</strong>sem Augenblick stärker war als ich.“<br />
zitiert nach [5]<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-5
7-6
Gute, schlechte Vorbilder (2)<br />
… und ein schlechtes Beispiel: eine Erläuterung von IP<br />
„Die Daten werden in sogenannten Datagrammen vollkommen unabhängig durch das<br />
Netzwerk übermittelt. Dabei findet kein Verbindungsauf- oder -abbau statt. Das heißt, <strong>die</strong><br />
Datagramme werden ohne festgelegte Route auf völlig verschiedenen Wegen transportiert.<br />
Die Reihenfolgekorrektheit wird dabei der Transportschicht überlassen, also entweder<br />
dem TCP- oder UDP-Protokoll. Auch <strong>die</strong> Verbindung wird durch das IP-Protokoll<br />
nicht gesichert, so daß <strong>die</strong>s ebenfalls durch höhere Protokolle erfolgen muß. Die Übermittlung<br />
erfolgt durch den Datagramm<strong>die</strong>nst, der auch als verbindungsloser Paketübermittlungs<strong>die</strong>nst<br />
bezeichnet wird. Er gilt als unzuverlässig. Somit können auch keine Fehler<br />
durch <strong>die</strong>sen Service festgestellt werden. Von Vorteil sind <strong>die</strong> bereits erwähnten<br />
Reaktionszeiten, <strong>die</strong> aufgrund des fehlenden Verbindungsauf- und -abbaus sowie der<br />
fehlenden Überwachungsmechanismen sehr schnell sind. Auch kann auf <strong>die</strong> sich stetig<br />
ändernde Netzlast durch Änderung der Wegewahl reagiert werden.“<br />
K.-O. Detken: ATM in TCP/IP-Netzen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-7
7-8
Stilkunde (1)<br />
Die entscheidenden Fragen<br />
— Wie lang ist <strong>die</strong> Gegenwart?<br />
Wahrnehmungspsychologische Untersuchungen sagen: max. 3 s<br />
„Volumen“ des Lesegedächtnisses<br />
das Zeitfenster für das spontane Erfassen<br />
einer zusammengehörigen Wortgruppe als Aussage<br />
entspricht 7 – 9 Wörtern<br />
— Bei wievielten Wort in einem Satz setzt bei einem Leser/Hörer das Verständnis aus?<br />
spätestens beim 14. Wort<br />
Hohe Qualität von Formulierungen erforderlich!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-9
7-10
Stilkunde (2)<br />
Kurze Sätze!<br />
Gut gebaute Sätze haben nicht mehr als fünfzehn bis zwanzig Wörter.<br />
„Schreibt keine langen ineinandergeschachtelten Sätze, und wenn sie euch unterlaufen,<br />
schreibt sie zunächst, aber teilt sie dann auf.“ (Eco, S. 186)<br />
schlecht: Jede der internen Verbindungsleitungen kann dabei für den jeweiligen Anwendungsfall<br />
optimierte Eigenschaften in Bezug auf Vermittlungsart, Co<strong>die</strong>rung und<br />
Übertragungsgeschwindigkeit haben. (20 Worte)<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-11
7-12
Stilkunde (3)<br />
Kurze Sätze!<br />
schlecht: Mit <strong>die</strong>ser Nachricht wird <strong>die</strong> Freigabe des belegten VPI/VCI der Nutzverbindung und <strong>die</strong><br />
Beendigung der Signalisierungstransaktion durch Freigabe der Call Reference bestätigt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-13
7-14
Stilkunde (4)<br />
Kurze Sätze!<br />
schlecht: Die Zusammenfassung der verschiedenen Kommunikationsformen zu einer Multimedia-<br />
Kommunikation erfordert immer höhere Bandbreiten zwischen den Standorten mit einer<br />
flexiblen Zuordnung von Kommunikations-Betriebsmitteln wie beispielsweise <strong>die</strong> jeweils<br />
erforderliche Bandbreite.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-15
7-16
Stilkunde (5)<br />
Hauptsätze!<br />
Folgen von Hauptsätzen wirken lebendiger und deutlicher als Konstruktionen mit<br />
Hauptsatz und Nebensatz.<br />
schlecht: Da sich <strong>die</strong> Netze X.25 und ISDN auf <strong>die</strong> sog. Kernfunktionen der Q.922 beschränken,<br />
kann der Dienstübergang zwischen den verschiedenen Netzen einfach gestaltet werden.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-17
7-18
Stilkunde (6)<br />
Hauptsätze!<br />
Nicht umsonst heißen Hauptsätze Hauptsätze:<br />
— Hauptsätze sollen den wesentlichen Inhalt einer Aussage tragen.<br />
— Ein Nebensatz liefert Nebenaussagen.<br />
schlecht: Ein System, das aufgrund seiner klaren Strukturierung einfach implementiert werden kann,<br />
zeigt Bild 15.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-19
7-20
Stilkunde (7)<br />
Aktiv statt Passiv!<br />
Wann immer möglich: Aktiv statt Passiv verwenden.<br />
(Obwohl <strong>die</strong> gebotene „unpersönliche Sprachhaltung“ manchmal den Passiv nahelegt.)<br />
schlecht: Über <strong>die</strong> X-Schnittstelle werden folgende Informationen vom ISDN-Apparat an <strong>die</strong><br />
angeschlossene Einrichtung übertragen: …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-21
7-22
Stilkunde (8)<br />
Positiv formulieren!<br />
Positive Formulierungen sind stets einfacher zu verstehen als negative.<br />
Doppelte Verneinungen sind immer zu vermeiden.<br />
schlecht: Frame Relay hat sich schnell als Technik für Inter-LAN-Verbindungen etabliert. Für <strong>die</strong>se<br />
Technik wird keine neue Infrastruktur benötigt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-23
7-24
Stilkunde (9)<br />
Positiv formulieren!<br />
schlecht: Das Gespräch muß während des Umsteckens in der Vermittlungsstelle „geparkt“ werden,<br />
damit es nicht aufgrund der nicht verfügbaren Schichten eins bis drei am Endgerät<br />
ausgelöst wird.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-25
7-26
Stilkunde (10)<br />
Schachtelsätze vermeiden!<br />
Ineinandergeschachtelte Nebensätze können fast immer vermieden werden!<br />
schlecht: Ein HDLC-Verfahren kann nur zwischen zwei Endpunkten angewendet werden,
7-28
Stilkunde (11)<br />
Wortstellung beachten!<br />
Die Wortstellung kann entscheidend für den Sinn eines Satzes sein. Deshalb Vorsicht<br />
vor allem beim Gebrauch von „auch“, „noch“, „wieder“ usw.<br />
Vergleichen Sie: Ich liebe Dich auch.<br />
Ich liebe auch Dich.<br />
Auch ich liebe Dich.<br />
schlecht: Mitarbeitern aus dem Intranet steht <strong>die</strong>ses Angebot selbstverständlich auch zur<br />
Verfügung.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-29
7-30
Stilkunde (12)<br />
Umgang mit Nebensätzen<br />
Einschachtelung von Nebensätzen vermeiden.<br />
schlecht: Gefordert ist unter anderem eine klare Trennung des internen und externen<br />
Datenbereichs, so daß sensitive Daten entweder nur im Intranet verfügbar sind, oder wenn<br />
sie aus dem Internet erreichbar sind, dann nur von autorisierten Benutzern.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-31
7-32
Stilkunde (13)<br />
Umgang mit Nebensätzen<br />
Nebensätze kurz halten, da das Verb erst am Ende des Nebensatzes erscheint.<br />
schlecht: Ein Angreifer scheitert an der Firewall, selbst wenn er außerhalb des firmeneigenen<br />
Netzes seine IP-Adresse auf eine zum inneren Firmennetz gehörige einstellt, da <strong>die</strong><br />
Firewall keine Zugriffe von außerhalb auf den inneren Webserver zuläßt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-33
7-34
Stilkunde (14)<br />
Umgang mit Nebensätzen<br />
Nebensätze nur manchmal voranstellen.<br />
schlecht: Wenn das Hilfefenster geschlossen wird, hat das zur Folge, daß sich automatisch auch<br />
das Glossar-Fenster schließt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-35
7-36
Stilkunde (15)<br />
Füllwörter vermeiden!<br />
Füllwörter blasen den Text auf, ohne ihm Inhalt hinzuzufügen.<br />
schlecht: Ebenso ist es grundlegend in der elektronischen Datenverarbeitung, daß alle Daten, <strong>die</strong><br />
zur Bearbeitung benötigt werden, auch vorhanden und verfügbar sind. Neben den Daten<br />
müssen auch <strong>die</strong> Betriebsmittel in einem Intranet vor unbefugtem Zugriff geschützt<br />
werden.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-37
7-38
Stilkunde (16)<br />
Füllwörter vermeiden!<br />
schlecht: Als letztes ist das Informationselementfeld vorhanden, welches eine sehr variable Länge<br />
aufweisen kann.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-39
7-40
Stilkunde (17)<br />
Füllwörter vermeiden!<br />
schlecht: Haben zwei Stationen gleichzeitig einen Sendebedarf, …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-41
7-42
Stilkunde (18)<br />
Füllwörter vermeiden!<br />
schlecht: Die Pointer-Modifikation sieht nun folgendermaßen aus: …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-43
7-44
Stilkunde (19)<br />
Füllwörter vermeiden!<br />
schlecht: Das geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Übertragbarkeit der bestehenden<br />
PDH-Hierarchien.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-45
7-46
Stilkunde (20)<br />
Verben statt Substantive<br />
Verben drücken Aktivität, Tat, Lebendigkeit aus.<br />
schlecht: Die grundsätzlichen Definitionen des Adreß- und Steuerfeldes [des Frame Relay-<br />
Protokollkopfs] entsprechen den allgemeinen Definitionen von HDLC-Protokollen. Beide<br />
Felder sind aber gegenüber dem HDLC-LAPB erweitert, sie sind zwei Oktett lang. Die<br />
Festlegungen der Blockbegrenzung, der Definition des C/R-Bits und <strong>die</strong> Festlegungen der<br />
Blockprüfsequenz entsprechen den HDLC-Festlegungen.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-47
7-48
Stilkunde (21)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
Manchmal sind sie nur unschön, manchmal führen sie zu falschen Aussagen.<br />
schlecht: Die Daten werden in sogenannten Datagrammen vollkommen unabhängig durch das<br />
Netzwerk übermittelt. Dabei findet kein Verbindungsauf- oder -abbau statt. Das heißt, <strong>die</strong><br />
Datagramme werden ohne festgelegte Route auf völlig verschiedenen Wegen<br />
transportiert.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-49
7-50
Stilkunde (22)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
schlecht: Die Daten des DNS werden in einer hierarchischen Baumstruktur abgelegt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-51
7-52
Stilkunde (23)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
schlecht: Konzeption und Aufbau eines integrierten Firewall-/Server-Systems – so lautet das Thema<br />
<strong>die</strong>ser Diplomarbeit. Schon der Titel gibt Aufschluß über den immensen Umfang der<br />
Aufgabenstellung.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-53
7-54
Stilkunde (24)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
schlecht: Im starken Gegensatz dazu stehen <strong>die</strong> Möglichkeiten, <strong>die</strong> ein potentieller Angreifer hat,<br />
wenn er über das Internet Zugriff auf ein ungeschütztes Intranet erlangt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-55
7-56
Stilkunde (25)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
schlecht: Der Header eines Paketes macht spezielle Angaben über <strong>die</strong> IP-Quell- und Zieladresse,<br />
<strong>die</strong> Protokollart, den Quell- und Zielport und den ICMP-Nachrichtentyp eines Paketes.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-57
7-58
Stilkunde (26)<br />
schmückende Zusätze vermeiden<br />
schlecht: Die 10BaseT-Verkabelung ist strukturell eine sternförmige Verkabelung.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-59
7-60
Stilkunde (27)<br />
Fremdsprachige Ausdrücke nur dort, wo sie als Fachbegriffe unumgänglich sind.<br />
— Es gibt hier keine unumstrittenen Regeln.<br />
— Feingefühl!<br />
schlecht: Wie und ob das Merging von Ressourcen vorgenommen wird, entscheiden zwei<br />
Reservierungsarten: Distinct Reservation und Shared Reservation.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-61
7-62
Stilkunde (28)<br />
fremdsprachige Ausdrücke<br />
schlecht: Zusätzlich wird der nächste Router im Upstream erkannt.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-63
7-64
Stilkunde (29)<br />
Synonyme vermeiden<br />
Zentrale Begriffe müssen im gesamten Text beibehalten werden,<br />
um keine Verwirrung zu stiften.<br />
schlecht: Aus <strong>die</strong>ser Sicht kommen allerdings noch <strong>die</strong> Möglichkeiten für interne Benutzer hinzu,<br />
e-Mails zu verschicken bzw. <strong>die</strong> eingetroffenen elektronischen Nachrichten vom System<br />
abzuholen.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-65
7-66
Stilkunde (30)<br />
Synonyme vermeiden<br />
schlecht: TCP ist im Gegensatz zu UDP ein verbindungsorientiertes Protokoll, … TCP ist, wie<br />
bereits erwähnt, ein bidirektionales Protokoll, welches verbindungsabhängig ist.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-67
7-68
Stilkunde (31)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
„Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie<br />
der zwischen Blitz und Glühwürmchen.“<br />
Mark Twain<br />
schlecht: Haben zwei Stationen gleichzeitig einen Sendebedarf, kommt es zu einer Kollision, <strong>die</strong><br />
durch ein geeignetes Verfahren geregelt werden muß.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-69
7-70
Stilkunde (32)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
schlecht: Die Reihenfolgekorrektheit wird dabei der Transportschicht überlassen, …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-71
7-72
Stilkunde (33)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
schlecht: Die PSVC-Zellenrate variiert zwischen den Werten 42, 84, 168, 336, 672, 1 344 und<br />
2 688 Zellen⁄s.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-73
7-74
Stilkunde (34)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
schlecht: Datennetze sind so geschaffen, daß sie als Basis für <strong>die</strong> Realisierung einer Vielzahl von<br />
Komponenten und Technologien zur Verfügung stehen.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-75
7-76
Stilkunde (35)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
schlecht: Das SQE-Signal wird durch eine negative Frequenz mit der halben Bit-Rate (BR/2)<br />
dargestellt. Beim Standard-Ethernet beträgt <strong>die</strong>se Frequenz 2,5 MHz.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-77
7-78
Stilkunde (36)<br />
Nach dem treffenden Begriff suchen!<br />
schlecht: Soll nun <strong>die</strong> Privatsphäre der Informationen bewahrt werden, …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-79
7-80
Stilkunde (37)<br />
Korrekter Wortgebrauch!<br />
schlecht: Durch den Manchester-Mechanismus wird sichergestellt, daß auch bei der Übertragung<br />
mehrerer gleicher aufeinanderfolgender Bits kein gleichförmiges Signal auf dem Kabel<br />
entsteht.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-81
7-82
Stilkunde (38)<br />
Korrekter Wortgebrauch!<br />
schlecht: Die maximale Datengeschwindigkeit beträgt beim 10BaseT-Standard 10 Mbit/s.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-83
7-84
Stilkunde (39)<br />
Korrekter Wortgebrauch!<br />
schlecht: Zur Übertragung des IP-Protokolls zwischen den Routern …<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-85
7-86
Stilkunde (40)<br />
Korrekter Wortgebrauch!<br />
schlecht: Die Laufzeit eines solchen Linksegments beträgt maximal 1000 ns.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-87
7-88
Stilkunde (41)<br />
Korrekter Wortgebrauch!<br />
schlecht: Die untere Bildhälfte zeigt den schematischen Ablauf.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-89
7-90
Stilkunde (42)<br />
zum Abschluß ein multi-kaputter Satz …<br />
schlecht: Folgen alle Pakete eines Dienstes einem speziellen Weg, kommt <strong>die</strong>s einer Reservierung<br />
von Übertragungseigenschaften gleich, <strong>die</strong> Dienstgüten für den errichteten Pfad im<br />
Internet einrichten.<br />
gut:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-91
7-92
Stilkunde (43)<br />
Amerikaner tun sich sehr leicht bei der Benutzung von Metaphern. Im Deutschen<br />
schrecken wir meist davor zurück.<br />
Metapher: Leaky Bucket: tropfender Eimer<br />
Bedeutung: gleichmäßiger Abfluß von Daten aus einem Puffer, der schwallweise gefüllt wird<br />
Metapher: Daisy Chain: Gänseblümchen-Kette<br />
Bedeutung: ringförmig abgeschlossene Verdrahtung zwischen Eingang und Ausgang benachbarter<br />
Baugruppen/-elemente<br />
Metapher: Round Robin: Ringelreihen<br />
Bedeutung: Betriebssystem-Strategie, bei der allen rechenbereiten Prozessen nacheinander der<br />
Prozessor immer wieder für eine kurze Zeitspanne zugeteilt wird.<br />
Metapher: Firewall: Brandschutzmauer<br />
Bedeutung: Rechensystem, das den Verkehr zwischen Intranet und Internet auf unzulässige Zugriffe<br />
überwacht.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-93
7-94
Stilkunde (44)<br />
Metaphern<br />
Metapher: debug: entwanzen<br />
Bedeutung: Ein Programm von Fehlern befreien<br />
Metapher: patch: Flicken<br />
Bedeutung: vorläufige Fehlerkorrektur<br />
Metapher: Bootstrap: Stiefelfalle<br />
Bedeutung: Neustart eines Rechensystems, Urladen.<br />
Metapher: male/female connectors: männliche/weibliche Stecker<br />
Bedeutung: Stecker, Buchse<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-95
7-96
Stilkunde (45)<br />
Alle sieben Satzzeichen gebrauchen!<br />
„Jedes richtig gesetzte Komma ist eine Lesehilfe: immer eine Erleichterung, oft unerläßlich<br />
zur Vermeidung von Mißverständnissen. Alle Satzzeichen bieten solche Hilfen. Wir haben<br />
genau sieben – ein erschreckend dürftiger Vorrat für jeden, der in der Schrift eine Vorstellung<br />
davon vermitteln möchte, was alles unsere Stimme zum Ausdruck bringen kann: Wir sprechen<br />
lauter oder leiser, langsamer oder schneller, mit Hebungen und Senkungen, mit Seufzern<br />
und Kunstpausen, mit Wut in der Kehle oder einem Lachen auf den Lippen – und wie<br />
sieht das Instrumentarium aus, mit dem wir <strong>die</strong>se ganze Sprechmusik ins Schriftbild übertragen<br />
können? Punkt und Komma, Fragezeichen und Ausrufungszeichen, Doppelpunkt, Semikolon,<br />
Gedankenstrich. Wie ärmlich!“<br />
W. Schneider: Deutsch für Kenner<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-97
7-98
Stilkunde (46)<br />
Alle sieben Satzzeichen gebrauchen!<br />
Punkt: trennt unabhängige Aussagen<br />
Komma: trennt Nebensatz und Hauptsatz; trennt zwei sehr eng zusammengehörige<br />
Hauptsätze.<br />
Semikolon: trennt zwei zusammengehörige Hauptsätze.<br />
Doppelpunkt: trennt Voraussetzung und Schlußfolgerung, Behauptung und Beleg.<br />
Gedankenstrich: erzeugt beim Lesen eine Pause, gestattet den Anschluß überraschender Gedankenwendungen<br />
Ausrufungszeichen: zeigt Emotion; in wissenschaftlichen Texten eher zu vermeiden.<br />
Fragezeichen: beschließt direkte Fragen. Solche Fragen können einen Text sehr viel lebendiger<br />
machen. (Fragen ist auch in der Wissenschaft nichts ungewöhnliches!)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 7-99
7-100
50typo.fm<br />
FORMALE GESTALTUNG<br />
8. HINWEISE ZUR<br />
TYPOGRAPHIE<br />
1. Lernziel<br />
2. Elemente einer wissenschaftlichen (Abschluß-) Arbeit<br />
3. Arbeitsschritte<br />
4. Layout<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Gulbins, J., Kahrmann, Ch.:<br />
Mut zur Typographie.<br />
Berlin u.a. (Springer) 1993, ISBN 3-540-55708-3.<br />
[2] Ballstaedt, St.:<br />
Wissensvermittlung.<br />
Weinheim (Beltz) 1997.<br />
8-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen, Dokumente so zu gestalten, daß<br />
— sie den Leser ansprechen und<br />
— den typographischen Standards für<br />
wissenschaftliche Arbeiten genügen.<br />
„Die Abwesenheit des Bleistifts und <strong>die</strong> Allgegenwart der Tastaturen haben zu<br />
einer eigenen Ästhetik selbstgedruckter Schrifterzeugnisse geführt. Einladungen<br />
von Freunden erreichen uns seit längerem in Gestalt seltsam zusammengewürfelter<br />
Schriftarten, <strong>die</strong> den Verfasser mitunter nicht nur als etwas seelen-, sondern<br />
meist als ziemlich geschmacklos enthüllen.“<br />
W. Wischmeyer: Das Ende der Klaue.<br />
FAZ Magazin Nr. 1, 8.1.1999, S. 22<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-3
8-4
Lernziel (2)<br />
Der Begriff „Typographie“:<br />
„Unter Typografie versteht man <strong>die</strong> Gestaltung von gedruckten Texten.<br />
Die Mikrotypografie befasst sich dabei mit den Schriften, <strong>die</strong> Makrotypografie<br />
mit der Anordnung von Schriftblöcken auf einer Seite.“<br />
„Typography matters!“<br />
Ballstaedt, S.83f<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-5
8-6
Elemente einer wissenschaftlichen (Abschluß-)Arbeit (1)<br />
1. Titelblatt<br />
Titel, Bearbeiter, Betreuer usw. (s. Beispiel)<br />
2. (Widmung)<br />
„Für den FC Schalke 04“<br />
3. Erklärung zur Urheberschaft<br />
in Diplomarbeiten (s. Beispiel)<br />
4. (Vorwort)<br />
enthält <strong>die</strong> Danksagungen usw. (Nicht mit der Einleitung zu verwechseln!)<br />
5. Inhaltsverzeichnis<br />
muß spätestens hier erscheinen!<br />
6. Hauptteil<br />
gegliedert in Kapitel und Unterkapitel<br />
7. Anhänge<br />
je Thematik ein eigener Anhang<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-7
8-8
Elemente einer wissenschaftlichen (Abschluß-)Arbeit (2)<br />
8. Verzeichnisse<br />
Literaturverzeichnis muß sein! Abbildungsverzeichnis kann meist entfallen.<br />
9. (Glossar)<br />
knappe Erläuterung wichtiger Fachbegriffe<br />
10. Index<br />
Hinweise auf Textstellen, an denen bestimmte<br />
Begriffe, Namen, Orte, … auftauchen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-9
8-10
Arbeitsschritte (1)<br />
1. Festlegen des Papierformats<br />
(wenn nicht DIN A4 vorgegeben ist)<br />
2. Festlegen des Satzspiegels<br />
3. Festlegen der Anzahl der Textspalten je Seite und<br />
des zugehörigen Zwischenraums<br />
4. Festlegen der Absatzformate<br />
für <strong>die</strong> verschiedenen Elemente des Dokuments<br />
5. Eingabe des Inhalts<br />
6. Feinkorrekturen beim Umbruch<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-11
8-12
Layout (1)<br />
Satzspiegel: der für den Fließtext nutzbare Bereich auf einer Seite<br />
Kopfsteg<br />
Satzspiegel<br />
Fußsteg<br />
Raum für<br />
Marginalien<br />
— inkl. Fußnoten<br />
— ohne Stege, d.h.<br />
ohne Kopf- und Fußzeile<br />
ohne Marginalien<br />
bei doppelseitigem Layout:<br />
zwei spiegelbildliche Satzspiegel<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-13
8-14
Layout (2)<br />
Satzspiegel<br />
— Diagonalenkonstruktion:<br />
Außensteg<br />
Kopfsteg<br />
Fußsteg<br />
Innen-/Bundstege<br />
Satzspiegel<br />
— Regel: Innensteg < Kopfsteg < Außensteg < Fußsteg<br />
— Diagonalenkonstruktion führt zu einer verschwenderischen Aufteilung;<br />
in technischen Dokumenten eher unerwünscht.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-15
8-16
Layout (3)<br />
meine Vorschläge für ein einseitiges Layout:<br />
3,5 cm<br />
3,5 cm<br />
4,7 cm<br />
14 × 21,5 cm 2<br />
3,5 cm<br />
3,5 cm<br />
— Bei Alternative 2 wirkt der Außensteg durch Marginalien breiter.<br />
3,5 cm<br />
11 × 21,5 cm 2<br />
4,7 cm<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-17<br />
4 cm<br />
Alternative 1 Alternative 2<br />
für<br />
Marginalien<br />
0,5 cm Lücke<br />
2 cm
8-18
Layout (4)<br />
wissenschaftliche Texte: meist einspaltig, mit/ohne Marginalien<br />
Ein Beispiel: E-Mail wird typischerweise<br />
zwischen Mail Servern (auch: Mail Exchanges)<br />
transportiert. Ein Benutzer, der sich in seinem<br />
Home Network aufhält, kann <strong>die</strong> an ihn adressierte<br />
e-Mail von dem Mail Server abholen, der<br />
„hinter“ dem Firewall-System seines Home Network<br />
plaziert ist. Für <strong>die</strong>sen Zweck stehen <strong>die</strong><br />
Protokolle POP-3 und IMAP zur Verfügung.<br />
Diese Zugriffe sind jedoch nur innerhalb des Intranets<br />
zulässig, da Firewall-Systeme in der Regel<br />
so konfiguriert sind, daß sie aus dem Internet<br />
kommende POP-3- oder IMAP-Zugriffe nicht<br />
passieren lassen. Wenn sich <strong>die</strong>ser Benutzer temporär<br />
in einem anderen Intranet aufhält, kann er<br />
damit nicht direkt auf seine e-Mail zugreifen.<br />
(Natürlich kann <strong>die</strong>ses Problem durch einen<br />
„manuellen“ Eingriff gelöst werden: Üblicherweise<br />
richtet ein solcher Benutzer im Mail Server<br />
eine forward-Direktive für <strong>die</strong> Weiterleitung<br />
Ein Beispiel: E-Mail wird typischerweise<br />
zwischen Mail Servern (auch:<br />
Mail Exchanges) transportiert. Ein<br />
Benutzer, der sich in seinem Home<br />
Network aufhält, kann <strong>die</strong> an ihn<br />
adressierte e-Mail von dem Mail Server<br />
abholen, der „hinter“ dem Firewall-<br />
System seines Home Network plaziert<br />
ist. Für <strong>die</strong>sen Zweck stehen <strong>die</strong> Protokolle<br />
POP-3 und IMAP zur Verfügung.<br />
Diese Zugriffe sind jedoch nur<br />
innerhalb des Intranets zulässig, da Firewall-Systeme<br />
in der Regel so konfiguriert<br />
sind, daß sie aus dem Internet<br />
kommende POP-3- oder IMAP-Zugriffe<br />
nicht passieren lassen. Wenn<br />
sich <strong>die</strong>ser Benutzer temporär in einem<br />
anderen Intranet aufhält, kann er<br />
damit nicht direkt auf seine e-Mail zu-<br />
Flattersatz/Rauhsatz Blocksatz<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-19<br />
e-Mail<br />
nicht maßstäblich!
8-20
Layout (5)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Basic:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-21
8-22
Layout (6)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Default Font:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-23
8-24
Layout (7)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Pagination:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-25
8-26
Layout (8)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Numbering:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-27
8-28
Layout (9)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Advanced:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-29
8-30
Layout (10)<br />
Adobe FrameMaker paragraph formatting controls<br />
— Table Cell:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-31
8-32
Layout (11)<br />
Absatzformate<br />
Textelement Typisierungen Formate<br />
Fließtext Absatz Para-1<br />
Para-n<br />
eingerückter Absatz Indent Einzug<br />
Abstand vor, kein Einzug<br />
kein Abstand vor, 1. Zeile eingezogen<br />
Zeilenabstand genau, ca. 1,3<br />
langes Zitat Citation Einzug, geringerer Zeilenabstand<br />
Listen geordnete Liste Number-1<br />
Number-n<br />
ungeordnete Liste Dash-1<br />
Dash-n<br />
Definitionsliste Term<br />
Definition<br />
Abstand vor („Durchschuß“)<br />
Abstand vor<br />
eingerückte Liste BullDeep Abstand vor<br />
für den zu definierenden Begriff,<br />
Abstand vor, „Run-In“<br />
für <strong>die</strong> Definition<br />
Marginalie Randtext Marginal am zugehörigen Text ausgerichtet<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-33
8-34
Layout (12)<br />
Absatzformate (Forts.)<br />
Textelement Typisierungen Formate<br />
Abbildungen Beschriftung Figure<br />
Tabellen Kopfzeile Table-Head<br />
Zellen CellLeft,<br />
CellRight,<br />
CellCenter,<br />
CellNumb-1,<br />
CellNumb-n<br />
Beschriftung Table<br />
Überschriften Überschrift 1. Ordnung<br />
(Kapitel)<br />
Überschrift 2. Ordnung<br />
(Unterkapitel)<br />
Überschrift 3. Ordnung<br />
(Unterkapitel)<br />
H1<br />
H1-A<br />
H2-1<br />
H2-n<br />
H3-1<br />
H3-n<br />
Beginn auf rechter Seite, Nummerierung:<br />
(ohne Punkt!)<br />
für Anhang, Nummerierung: A-<br />
großer Abstand vor, Nummerierung:<br />
.<br />
Abstand vor, Nummerierung:<br />
..<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-35
8-36
Layout (13)<br />
meine Empfehlungen zur Schriftauswahl<br />
Überschrift 1. Stufe<br />
Überschrift 2. Stufe<br />
Überschrift 3. Stufe<br />
„Brotschrift“<br />
Fußnoten<br />
Helvetica, 18 pt fett<br />
Helvetica, 14 pt fett<br />
Times New Roman, 12 pt kursiv<br />
Times New Roman, 11 pt<br />
(Fließtext, Bild- u. Tabellenunterschriften)<br />
Times New Roman, 9 pt<br />
Beschriftungen in Tabellen, Grafiken Helvetica, 10 pt<br />
Programmcode<br />
Kopfzeile, Fußzeile<br />
Courier New, 10 pt<br />
Helvetica, 10 pt<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 8-37
8-38
H1: Helvetica 18 pt fett, nummeriert (ohne Punkt!),<br />
Text: beginnt 2 cm links vom Satzspiegelrand,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 180 pt,<br />
Trennung ausgeschaltet,<br />
nächster: Para-1;<br />
inhaltlich: Die Einleitung hat keinen Advance Organizer.<br />
Para-1: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 6 pt, Abst. nach: 0 pt,<br />
kein Einzug,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Para<br />
Para: Times New Roman 11 pt,<br />
kein Abst. vor, kein Abst. nach,<br />
1. Zeile um 11 pt eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Para<br />
PageNumb: Helvetica 10 pt,<br />
rechtsbündig zum Satzspiegelrand,<br />
ca. 2,5 cm oberhalb des Seitenrandes<br />
1 Einleitung<br />
„Mobil sein, aber dran bleiben!“ – <strong>die</strong>sem Leitmotiv erschließt sich heute<br />
dank der Verfügbarkeit digitaler Mobilfunknetze eine Vielzahl von mobilen<br />
Anwendungsszenarien. Solche Szenarien sind z.B. <strong>die</strong> Disposition von Fahrzeugflotten,<br />
<strong>die</strong> Disposition und Informationsversorgung von technischen und<br />
kaufmännischen Außen<strong>die</strong>nsten, <strong>die</strong> mobile Bestandserfassung in großen Lagern<br />
usw. Daneben gibt es auch sog. telemetrische Applikationen, <strong>die</strong> oftmals<br />
zwar nicht inhärent mobil sind, in denen aber dennoch funkbasierte Mobilfunknetze<br />
angewendet werden, da sich auf <strong>die</strong>se Weise Verkabelungskosten einsparen<br />
lassen.<br />
Obwohl manche Anwendungsszenarien eher daten- als sprachorientiert sind,<br />
hat sich gezeigt, daß der überwältigende Erfolg der mobilen Sprachfunknetze<br />
nicht einfach auf <strong>die</strong> mobile Datenkommunikation übertragbar ist. Einer der<br />
Gründe dafür ist, daß <strong>die</strong> Entwicklung von Applikationen für <strong>die</strong> mobile Datenkommunikation<br />
ein hohes Maß an Komplexität aufweist, wie in <strong>die</strong>sem Artikel<br />
noch ausgeführt werden wird.<br />
Man mag dagegen argumentieren, daß sich doch GSM-Netze auch für Datenkommunikation<br />
in einfacher Weise nutzen lassen.<br />
39
8-40
Kopfzeile: Helvetica 10 pt, rechtsbündig<br />
Text der Überschrift 1. Ordnung<br />
inhaltlich: Es folgt ein Advance Organizer.<br />
H2-1: Helvetica 14 pt fett,<br />
hierarchische Nummerierung,<br />
Text: beginnt 2 cm links vom Satzspiegelrand,<br />
Abst. vor: 48 pt, Abst. nach: 24 pt,<br />
Trennung ausgeschaltet,<br />
nächster: Para-1;<br />
Die Seite ist hier nicht vollständig ausgefüllt, da auf der nächsten<br />
Seite eine Überschrift folgt. Überschriften müssen auf jeden Fall<br />
mit dem nachfolgenden Absatz zusammengehalten werden.<br />
2 Das Modacom-Netz<br />
Das Modacom-Netz<br />
In <strong>die</strong>sem Abschnitt wird das Mocacom-Netz erläutert. Es geht zunächst um<br />
<strong>die</strong> Komponenten des Netzes und ihre Konfiguration, danach um <strong>die</strong> Eigenschaften<br />
der Luftschnittstelle. Die wichtigsten Ausführungen folgen im dritten<br />
Kapitel <strong>die</strong>ses Abschnitts: Es erläutert <strong>die</strong> verschiedenen Verbindungstypen im<br />
Modacom-Netz.<br />
2.1 Netzwerkkonfiguration<br />
Die T-Mobil betreibt das Modacom-Netz seit dem Jahre 1993. Die zugrundeliegende<br />
DataTAC-Technik („Total Area Coverage“) wurde von der Firma<br />
Motorola entwikkelt. Das Modacom-Netz hat heute in Deutschland seinen vorläufigen<br />
Endausbau erreicht und steht beinahe flächendeckend zur Verfügung.<br />
Die wichtigsten Nutzer des Modacom-Netzes sind der Technische Außen<strong>die</strong>nst<br />
der IBM, <strong>die</strong> Fa. UPS und der ADAC.<br />
Das Modacom-Netz (vgl. auch <strong>die</strong> ausführlichen Darstellungen in [1], [2])<br />
arbeitet paketvermittelnd und ist ausschließlich für <strong>die</strong> Datenkommunikation<br />
geeignet. Die Tarifierung erfolgt volumenorientiert. Der Festnetzzugang zum<br />
Modacom-Netz erfolgt über das X.25-Netz der Telekom (Datex-P). Das Modacom-Netz<br />
läßt sich aufgrund <strong>die</strong>ser Charakteristika auch als „mobiler Zugang<br />
zum X.25-Netz“ verstehen.<br />
41
8-42
Bull-1: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 6 pt („Durchschuß“), Abst. nach: 0 pt,<br />
Aufzählungszeichen um 11 pt eingezogen,<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Bull<br />
Bull-n: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 2 pt, Abst. nach: 0 pt,<br />
Aufzählungszeichen um 11 pt eingezogen,<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen<br />
Auf eine Liste folgt ein Absatz mit Durchschuß, aber ohne Einzug,<br />
in unserem Fall Para-1.<br />
2.2 Luftschnittstelle<br />
Das Modacom-Netz<br />
Zur Charakterisierung der Luftschnittstelle des Modacom-Netzes mögen einige<br />
Stichworte genügen [3]:<br />
• Frequenzbereich 416 - 417 MHz Uplink, 426 - 427 MHz Downlink;<br />
30 FDMA-Kanäle mit Kanalraster 12,5 kHz<br />
• 4-FSK-Modulation mit 9600 bit/s; Trellis-Co<strong>die</strong>rung mit Coderate 3/4<br />
• Sendeleistung der mobilen Einheiten < 6 W, Zellradius typ. 3 - 8 km<br />
• Protokoll auf der Luftschnittstelle: Radio Data Link Access Protocol<br />
(RD-LAP) mit DSMA/CA-Kanalzugriffsverfahren (Digital Sense Multiple<br />
Access/Collision Avoidance); max. Rahmengröße 512 byte<br />
• Die Adressierung der mobilen Geräte erfolgt über einen sog. Logical<br />
Link Identifier (LLI): <strong>die</strong>ser ist entweder fest in das Funkmodem „eingebrannt“<br />
oder wird per Chipkarte dem Funkmodem zugewiesen. (Bemerkung:<br />
Es existiert kein korrespon<strong>die</strong>render Adressierungsmechanismus<br />
für Festnetzstationen. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Datenfunknetz<br />
Mobitex der Fa. Ericsson.)<br />
Damit ist für unsere Zwecke <strong>die</strong> Luftschnittstelle hinreichend beschrieben. Für<br />
den Anwendungsprogrammierer ist <strong>die</strong> Luftschnittstelle nicht wegen ihrer speziellen<br />
technischen Eigenschaften interessant, sondern einzig und allein wegen<br />
der Performance-Einschränkungen, <strong>die</strong> notwendigerweise mit der Übertragung<br />
von Daten über <strong>die</strong>se Schnittstelle verbunden ist.<br />
Wir werden uns deshalb im folgenden mit der Luftschnittstelle nicht weiter<br />
beschäftigen. Der Leser, der sich für weiterführende Details interessiert, sei an<br />
<strong>die</strong> angeführte Literatur verwiesen.<br />
43
8-44
Number-1: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 6 pt („Durchschuß“), Abst. nach: 0 pt,<br />
Nummer rechtsbündig bei 0,75 cm (>11 pt),<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Number<br />
Number-n: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 2 pt, Abst. nach: 0 pt,<br />
Nummer rechtsbündig bei 0,75 cm (>11 pt),<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen<br />
2.3 Verbindungstypen<br />
Das Modacom-Netz<br />
Bei der Programmierung von Anwendungen im Modacom-Netz spielt der Begriff<br />
des Verbindungstyps eine wichtige Rolle. Durch den Verbindungstyp<br />
wird festgelegt, wie mobile Einheiten und Festnetzstationen einander zugeordnet<br />
werden: one-to-one oder many-to-one (nicht zu verwechseln mit einer multicast-Kommunikation!),<br />
von welcher Seite aus von welcher Seite aus der Verbindungsaufbau<br />
erfolgt, und wie weit der Verbindungsauf-<br />
Die Verbindungstypen sind eingeführt worden, um vier verschiedene Klassen<br />
von Anwendungsszenarien wirkungsvoll unterstützen zu können:<br />
1. Die mobile Einheit ergreift <strong>die</strong> Initiative, um z.B. eine Datenabfrage im<br />
Festnetz durchzuführen: „Einzelverbindung abgehend“.<br />
2. Die Festnetzstation ergreift <strong>die</strong> Initiative, um z.B. eine gespeicherte<br />
Nachricht an eine mobile Einheit zuzustellen: „Einzelverbindung<br />
ankommend“.<br />
3. Die vorgenannten Einzelverbindungen haben den Nachteil, daß auf der<br />
Festnetzseite für jede kommunizierende mobile Einheit ein separater virtueller<br />
Kanal im X.25-Netz zur Verfügung gestellt werden muß. Deshalb<br />
hat man einen dritten Verbindungstyp eingeführt, bei dem mehrere<br />
mobile Einheiten über einen gemeinsamen virtuellen Kanal kommunizieren:<br />
„Flottenverbindung“. De facto ist <strong>die</strong>s der am meisten benutzte<br />
Verbindungstyp. Die Festnetzstation baut hierbei eine Verbindung zum<br />
RNG auf und sendet und empfängt über den entsprechenden virtuellen<br />
Kanal Nachrichten an <strong>die</strong>/von den Mitgliedern der Flotte. Der bei <strong>die</strong>sem<br />
Verbindungstyp notwendige, zuvor erwähnte SCR-Header <strong>die</strong>nt<br />
(unter anderem) dazu, das jeweilige Flottenmitglied über seine LLI zu<br />
identifizieren.<br />
45
8-46
Term: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 6 pt („Durchschuß“), „run-in“,<br />
Tabulator nach 5 cm,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
zusammenhalten mit folgendem Absatz,<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Definition<br />
Definition: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 0 pt,<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen<br />
Das Modacom-Netz<br />
4. Eine mobile Einheit kommuniziert mit einer anderen mobilen Einheit.<br />
Der entsprechende Verbindungstyp wird mit „Two-way messaging“<br />
bezeichnet.<br />
Bild 4 zeigt zusammenfassend Richtung und Reichweite des Verbindungsaufbaus<br />
bei denverschiedenen Verbindungstypen (ohne den Verbindungstyp<br />
„Two-way messaging“). Jedes mobile Gerät kann bis zu sechs Verbindungen<br />
unterhalten. Diese Verbindungen werden über sog. Session Identifier (Session-<br />
Ids) identifiziert.<br />
„Socket-API mit TCP/IP“: Faßt man den Radio Link als Link in einem Internet/Intranet<br />
auf, so läßt sich auf <strong>die</strong>ser Basis <strong>die</strong> Kommunikation über<br />
ein Mobilfunknetz elegant in eine TCP/IP-Umgebung einbetten. Existierende<br />
TCP/IP-Anwendungen können ohne Veränderung in <strong>die</strong> mobile<br />
Umgebung übertragen werden. Diese Strategie wurde zusammen mit einigen<br />
Maßnahmen zur Performance-Steigerung realisiert im IBM-Produkt<br />
ARTour, daß für mobile Rechner unter DOS, Windows, OS/2 zur<br />
Verfügung steht [5]. Der Nachteil <strong>die</strong>ser Lösung liegt darin, daß sie eine<br />
<strong>komplette</strong> Implementierung von „IP over Modacom“ verlangt. Für telemetrische<br />
Anwendungen z.B., in denen auf der mobilen Seite oftmals<br />
nur Mikrocontroller zum Einsatz kommen, ist <strong>die</strong>s wesentlich zu aufwendig.<br />
„Socket-API ohne TCP/IP“: Dies ist eine häufig anzutreffende Lösung: Die<br />
Komplexität von TCP/IP soll vermieden werden, aber <strong>die</strong> bekannte Programmierschnittstelle<br />
soll erhalten bleiben. Hinter dem Socket-API versteckt<br />
sich damit ein proprietäres Protokoll. Ein wichtiges Beispiel aus<br />
dem Mobilfunkbereich für <strong>die</strong>sen Ansatz sind <strong>die</strong> Narrowband Sockets<br />
(NBS), <strong>die</strong> von einem Firmenkonsortium unter Führung von Intel und<br />
Nokia propagiert werden [7]. Der Nachteil <strong>die</strong>ser Lösung liegt darin, daß<br />
sich damit hinter einem einheitlichen API unterschiedliche Semantiken<br />
verbergen können, da unterschiedliche Protokolle benutzt werden.<br />
47
8-48
graf: (Zeichenformat) Helvetica 10 pt<br />
Figure: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 18 pt, zentriert,<br />
Kategorie und Nummer fett, Text normal,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Para-1<br />
footnote: Times New Roman 9 pt,<br />
Nummer rechtsbündig bei 0,75 cm (>11 pt),<br />
Text um 1 cm eingezogen,<br />
Zeilenabstand 12 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen<br />
Das Modacom-Netz<br />
Neben den aufgeführten Nachteilen gaben zwei weitere Gründe den Ausschlag<br />
für <strong>die</strong> Entwicklung eines dedizierten Modacom-API:<br />
• Der Funktionsumfang des Socket-API umfaßt keine Funktionen, <strong>die</strong> explizit<br />
für den Link Setup vorgesehen sind 1 .<br />
• Zusatzfunktionen (z.B. für eine optionale Datenverschlüsselung) lassen<br />
sich im klassischen Socket-API nur schlecht steuern, da entsprechende<br />
Dienstschnittstellenparameter fehlen.<br />
Bild 4 zeigt zusammenfassend Richtung und Reichweite des Verbindungsaufbaus<br />
bei den verschiedenen Verbindungstypen (ohne den Verbindungstyp<br />
„Two-way messaging“).<br />
mobile<br />
Einheit<br />
mobile<br />
Einheit<br />
Festnetz<br />
Modacom RNG (X.25)<br />
Typ 1: Einzelverbindung abgehend<br />
Typ 2: Einzelverbindung ankommend<br />
Bild 4: Modacom-Verbindungstypen<br />
Typ 3:Flottenverbindung<br />
1. Wir unterscheiden hier zwischen Link Setup und Connection Setup. Unter Link Setup<br />
soll das Herstellen einer Netzwerkverbindung durch einen Vermittlungsvorgang verstanden<br />
werden, unter Connection Setup das Herstellen einer logischen Verbindung<br />
als Voraussetzung für ein zuverlässiges Protokoll. Leider steht im Deutschen für <strong>die</strong><br />
beiden unterschiedlichen englischen Begriffe nur der Begriff „Verbindung“ zur Verfügung,<br />
obwohl doch zwei sehr unterschiedliche Konzepte gemeint sind.<br />
49
8-50
CellLeft: Helvetica 10 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 0 pt, linksbündig,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
CellCenter: Helvetica 10 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 0 pt, zentriert,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
CellRight: Helvetica 10 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 0 pt, rechtsbündig,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Table: Times New Roman 11 pt,<br />
Abst. vor: 0 pt, Abst. nach: 18 pt, zentriert,<br />
Kategorie und Nummer fett, Text normal,<br />
Zeilenabstand 15 pt (genau),<br />
Witwe/Schusterjunge: 3 Zeilen,<br />
nächster: Para-1<br />
Das Modacom-Netz<br />
Jedes mobile Gerät kann bis zu sechs Verbindungen unterhalten. Diese Verbindungen<br />
werden über sog. Session Identifier (Session-Ids) identifiziert. Diese<br />
Session Identifier sind für alle mobilen Einheiten gleich und heißen „te1“, …,<br />
„te5“ und „MG“. Bei der Netzwerksubskription legt der Benutzer je mobiler<br />
Einheit fest, welcher Verbindungstyp einer bestimmten Session-Id zugeordnet<br />
werden soll. Während der Session-Id „MG“ stets der Verbindungstyp „Twoway<br />
messaging“ zugeordnet ist, kann den anderen Session-Ids einer drei anderen<br />
Verbindungstypen frei zugeordnet werden. Das impliziert offensichtlich,<br />
daß eine mobile Einheit Mitglied in mehreren verschiedenen Flotten sein kann.<br />
Unabhängig vom Verbindungstyp können weder mobile Einheit, noch Festnetzstation<br />
ihren Kommunikationspartner im gleichen Netz erreichen.<br />
Der Anwendungsprogrammierer stellt zunächst <strong>die</strong> Daten, <strong>die</strong> er mit dem<br />
Netzwerkbetreiber bei der Netzwerksubskription austauscht, in der genannten<br />
Konfigurationsdatei md_api.cfg zusammen. .<br />
Typ<br />
1<br />
Typ<br />
2<br />
bei Ausführung von<br />
md_AssignPort in<br />
Aktion<br />
der mobilen Einheit Aufbau einer X.25-Verbindung zur Festnetzstation<br />
der Festnetzstation –<br />
der mobilen Einheit –<br />
der Festnetzstation Aufbau einer X.25-Verbindung zum RNG,<br />
Datenpaket mit Host-Id, Paßwort, LLI;<br />
RNG prüft Erreichbarkeit des mobilen<br />
Geräts<br />
Typ der mobilen Einheit –<br />
3<br />
der Festnetzstation Aufbau einer X.25-Verbindung zum RNG<br />
Datenpaket mit Host-Id, Paßwort<br />
MG –<br />
Tabelle 2: Wirkung von md_AssignPort<br />
51
8-52
H3-1: Times New Roman 12 pt kursiv,<br />
hierarchische Nummerierung,<br />
Text: beginnt 2 cm links vom Satzspiegelrand,<br />
Abst. vor: 18 pt, Abst. nach: 0 pt,<br />
Trennung ausgeschaltet,<br />
mit nächstem Absatz zusammenhalten,<br />
nächster: Para-1;<br />
2.3.1 Aufrufe<br />
Das Modacom-Netz<br />
Bei Verwendung des m 2 –API tauchen im Anwendungsprogramm nur noch<br />
korrespon<strong>die</strong>rende Aufrufe der Funktion md_AssignPort für <strong>die</strong> Ports auf,<br />
<strong>die</strong> benutzt werden sollen. Fehlererkennung/-behandlung.<br />
Das m 2 –API unterstützt <strong>die</strong> Fehlererkennung und -behandlung durch zwei<br />
Mechanismen: Zum einen fängt das m 2 –API Events ab, <strong>die</strong> vom Funkmodem<br />
generiert werden, und speichert entsprechende Anzeigen in internen Variablen.<br />
53
8-54
60vortr.fm<br />
PRÄSENTIEREN<br />
9. GESTALTUNG U.<br />
DURCHFÜHRUNG VON<br />
PRÄSENTATIONEN<br />
1. Lernziel<br />
2. Einführung<br />
3. Kommunikationspsychologie<br />
4. Systematische Vorbereitung<br />
5. Aufbau einer Präsentation<br />
6. Präsentationsmaterial<br />
7. Inszenierung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
[1] Hartmann, M., Funk, R., Nietmann, H.:<br />
Präsentieren (4. Auflage).<br />
Weinheim u.a. (Beltz Verlag) 1998, ISBN 3-407-36342-7.<br />
[2] Schulz von Thun, F.:<br />
Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen.<br />
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt Taschenbuchverlag) 1981.<br />
9-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen lernen, Präsentationen systematisch vorzubereiten<br />
und erfolgreich durchzuführen.<br />
— Präsentationen oftmals entscheidend für den beruflichen Erfolg<br />
extern: z.B. bei der Vorstellung von Projekten und Produkten<br />
intern: z.B. für <strong>die</strong> Akzeptanz eines Konzepts<br />
immer auch: Steigerung des persönlichen Renommees<br />
Alles ist schon einmal gesagt worden, da aber niemand<br />
zuhört, muß man es immer wieder von neuem sagen.<br />
André Gide<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-3
9-4
Lernziel (2)<br />
Sie sollen lernen, nicht nach der Flaschenpostmethode<br />
vorzutragen:<br />
„Meine Botschaft wird schon irgendwie ankommen …“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-5
9-6
Einführung (1)<br />
Unterscheidung zwischen Rede, Vortrag, <strong>Vorlesung</strong>, Präsentation<br />
Rede: aus bestimmtem Anlaß: Festrede, Grabrede, politische Rede,<br />
Tischrede, …; meist abgelesen, formeller Rahmen, Pathos<br />
Vortrag: thematisch ausgerichtet (z.B. geistes-/sozialwissenschaftlich);<br />
oftmals abgelesen, geschliffene Formulierung,<br />
gute Sprechtechnik, meist ohne Visualisierung;<br />
mit oder ohne Diskussion<br />
<strong>Vorlesung</strong>: Serie von Veranstaltungen, <strong>die</strong> aufeinander aufbauen,<br />
systematische Wissensvermittlung;<br />
klare Rollenverteilung Dozent ↔ Studenten<br />
Präsentation: einmalige Gelegenheit, überzeugen oder informieren;<br />
freies Sprechen, Unterstützung durch Visualisierungen;<br />
verbunden mit anschließender Diskussion<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-7
9-8
Einführung (2)<br />
Präsentation unterscheidet sich von Rede, Vortrag, <strong>Vorlesung</strong>:<br />
1. Referent hat gegenüber seinem Publikum einen niedrigeren Rang:<br />
Referent muß sein Publikum mit Respekt ansprechen.<br />
2. Referent hat genausoviel Zeit, wie sein Publikum erübrigen kann.<br />
(Dozent kann Hausarbeiten auferlegen.)<br />
Referent muß sich an enge Zeitvorgaben halten.<br />
3. Zuhörer nehmen an einer Präsentation freiwillig teil.<br />
(Dozent kann mit Prüfung drohen.)<br />
Referent muß seine Zuhörer durch eine interessante Präsentation „packen“:<br />
thematisch ausgerichtet, klare Sprache, kurzweiliger Auftritt, …<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-9
9-10
Einführung (3)<br />
Präsentation darf nicht isoliert betrachtet werden:<br />
Vorgeschichte<br />
der Präsentation<br />
Präsentationsveranstaltung<br />
Präsentation<br />
Diskussion<br />
— Vorgeschichte: Auftraggeber will einen Sachverhalt geklärt wissen.<br />
— Diskussion: bewertet <strong>die</strong> getroffenen Aussagen.<br />
— Nachgeschichte: Ergebnisse werden erwartet.<br />
Nachgeschichte<br />
der Präsentation<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-11
9-12
Kommunikationspsychologie (1)<br />
vier Merksätze:<br />
Denken ist nicht gleich Sagen<br />
Sagen ist nicht gleich Hören<br />
Hören ist nicht gleich Verstehen<br />
Verstehen ist nicht gleich Tun<br />
Was ist zu tun, damit eine Präsentation gelingt?<br />
Kommunikationspsychologie gibt nützliche Hinweise durch ein<br />
Modell für <strong>die</strong> menschliche Kommunikation.<br />
(ausführlich Darstellung in: Friedemann Schulz von Thun)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-13
9-14
Kommunikationspsychologie (2)<br />
Begleiten wir zwei Personen bei einer gemeinsamen Autofahrt durch <strong>die</strong> Stadt …<br />
Sender: „Du, da vorne ist grün.“<br />
… eine sachliche Information über den Zustand der Ampel<br />
… eine Aussage über den Sender:<br />
„Ich habe es eilig.“ oder:<br />
„Ich mag nicht, wenn <strong>die</strong> Leute hinter uns hupen.“<br />
… eine Aussage über den Empfänger:<br />
„Liebling, Du schläfst schon wieder.“ oder:<br />
„Die Wirkung Deiner Augentropfen hält wohl noch an.“<br />
… eine Handlungsaufforderung (Appell) an den Empfänger:<br />
„Fahr los.“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-15
9-16
Kommunikationspsychologie (3)<br />
Kommunikationsmodell<br />
Sachaussage<br />
Selbstaussage<br />
<strong>die</strong><br />
vier Seiten<br />
einer<br />
Präsentation<br />
Partneraussage<br />
Handlungsaufforderung<br />
— Sachaussage: zielgerichtete Auswahl und Aufbereitung von Information<br />
Recherche, Qualität der erzielten Ergebnisse, …<br />
Verständlichkeit (Strukturierung und Sprache)<br />
Materialien (Visualisierungen, Animationen)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-17
9-18
Kommunikationspsychologie (4)<br />
Kommunikationsmodell (Forts.)<br />
Sachaussage<br />
Selbstaussage<br />
<strong>die</strong><br />
vier Seiten<br />
einer<br />
Präsentation<br />
Partneraussage<br />
Handlungsaufforderung<br />
— Selbstaussage: wird meist nur implizit, aber dennoch wirkungsvoll kommuniziert<br />
Identifiziert sich der Referent mit dem Thema, der Lösung, …?<br />
Ist sich der Referent sicher?<br />
Lebt der Referent in einer anderen Welt?<br />
Selbstaussage bestimmt <strong>die</strong> Glaubwürdigkeit des Gesagten.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-19
9-20
Kommunikationspsychologie (5)<br />
Kommunikationsmodell (Forts.)<br />
Sachaussage<br />
Selbstaussage<br />
<strong>die</strong><br />
vier Seiten<br />
einer<br />
Präsentation<br />
Partneraussage<br />
Handlungsaufforderung<br />
— Partneraussage: Wertschätzung der Zuhörerschaft, drückt sich aus in<br />
Sprachlichkeit, Rhetorik, Mimik, Gestik, Kleidung<br />
Einhalten von zeitlichen Bedingungen<br />
Einstellung auf Vorkenntnisse der Zuhörerschaft und deren<br />
Bezug zum Thema<br />
Eine gute Präsentation provoziert, ohne zu provozieren!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-21
9-22
Kommunikationspsychologie (6)<br />
Kommunikationsmodell (Forts.)<br />
Sachaussage<br />
Selbstaussage<br />
<strong>die</strong><br />
vier Seiten<br />
einer<br />
Präsentation<br />
Partneraussage<br />
— Handlungsaufforderung: Wozu soll <strong>die</strong> Zuhörerschaft veranlaßt werden?<br />
Mit welcher inneren Einstellungen/mit welchem neuen Wissen<br />
sollen <strong>die</strong> Zuhörer <strong>die</strong> Präsentation verlassen?<br />
Sollen Entscheidungen vorbereitet werden?<br />
Was wollen Sie für sich erreichen?<br />
sorgfältige Ausrichtung der Präsentation<br />
Handlungsaufforderung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-23
9-24
Systematische Vorbereitung (1)<br />
Vorgehensmodell<br />
1 Auftrag Ziel der Präsentation<br />
Zuhörerschaft der Präsentation<br />
Erwartung an den Referenten<br />
Ort und Zeit, Zeitdauer<br />
Me<strong>die</strong>n<br />
2 Recherche Stoffsammlung und<br />
logische Strukturierung<br />
3 Entwurf Erstellung einer Gliederung<br />
Visualisierung von Kernaussagen<br />
4 Ausarbeitung Komplette mediale Aufbereitung:<br />
Material für den Referenten<br />
Material für <strong>die</strong> Zuhörer<br />
Überprüfung des Timings<br />
Überprüfung der Sprache: für <strong>die</strong> Zuhörerschaft angemessen?<br />
Alle Fremdwörter und Abkürzungen erklärt?<br />
5 Probelauf Freunde und Kollegen sind gefordert<br />
6 Korrektur bedeutet oftmals vollständige Umordnung der Gliederung<br />
7 Durchführung<br />
8 Nachbereitung Selbstkritik: Konsequenzen für nachfolgende Präsentationen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-25
9-26
Aufbau einer Präsentation (2)<br />
„Man kann über alles reden, nur nicht über 30 – 45 min.!“<br />
bestimmend für den Aufbau einer Präsentation: <strong>die</strong> Aufmerksamkeitskurve<br />
Aufmerksamkeitsniveau<br />
20 min. 40 min.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-27
9-28
Aufbau einer Präsentation (3)<br />
Zeitdauer:<br />
Präsentation: max. 45 min.!<br />
Diskussion: typ. 15 min.<br />
meine persönliche Zeiteinheit für Präsentationen:<br />
<strong>die</strong> Folie<br />
— auch bei Beamer-Präsentationen<br />
(ggf. besteht eine Folie aus einer Basisfolie + Animation)<br />
— mein Erfahrungswert:<br />
je Folie: typ. 3 – 5 min.<br />
je 45 min.: Cover-Folie + max. 10 Folien!<br />
Speed-up: ist möglich: gezielte Animation oder schrittweises Aufdecken<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-29
9-30
Aufbau einer Präsentation (4)<br />
„Eine gute [Präsentation] hat eine klare, einfache Struktur. …<br />
Sag den Zuhörern am Anfang, worüber Du zu reden beabsichtigst,<br />
und elaboriere das ein wenig. Dann rede darüber. Und dann sage<br />
ihnen, worüber Du geredet hast.“<br />
Aram Bakshian, Redenschreiber für <strong>die</strong><br />
Präsidenten Nixon, Ford u. Reagan.<br />
FAZ, 24.8.1998<br />
— Wichtige Punkte: am Anfang oder am Ende der Präsentation<br />
— Zwischen der 10. und der 30. Minute: gezielte Maßnahmen zur<br />
Stimulierung der Aufmerksamkeit<br />
— In der letzten Phase: Aufmerksamkeit nimmt nur dann wieder zu,<br />
wenn der Schluß angekündigt ist.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-31
9-32
Aufbau einer Präsentation (5)<br />
Gerüst<br />
Einleitung<br />
(ca. 10% der Zeit)<br />
Hauptteil<br />
(ca. 85% der Zeit)<br />
Schlußteil<br />
(ca. 5% der Zeit)<br />
Begrüßung und namentliche Vorstellung<br />
Thema der Präsentation<br />
Darstellung der eigenen Kompetenz<br />
Die konkreten Ziele der Präsentation<br />
Übersicht über <strong>die</strong> Inhalte und den Ablauf<br />
max. 5 Gliederungspunkte<br />
vom Bekannten zum Unbekannten<br />
vom Überblick ins Detail<br />
Zusammenfassung<br />
Schlußappell<br />
Dank an das Publikum<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-33
9-34
Aufbau einer Präsentation (6)<br />
Hauptteil ingenieurwissenschaftlicher Präsentationen<br />
1. Problemstellung 1 – 2 Folien<br />
2. Lösungskonzept/Technischer Ansatz 2 Folien<br />
3. Lösung 2 Folien<br />
4. Highlight der Lösung 1 Folie<br />
5. Ausblick 1 Folie<br />
— Pkte. 1 – 3 sollen von allen Zuhörern verstanden werden können,<br />
Pkt. 4 nur von anwesenden Spezialisten<br />
— Visualisierungen müssen sein in den Abschnitten<br />
Lösungskonzept<br />
Lösung<br />
Highlight<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-35
9-36
Aufbau einer Präsentation (7)<br />
wenn man zuviel Stoff hat:<br />
— eine radikale A-B-C-Analyse:<br />
A alles, was berücksichtigt werden muß<br />
B Dinge, <strong>die</strong> gesagt werden sollten<br />
C<br />
Dinge, <strong>die</strong> erwähnenswert sind,<br />
wenn genügend Zeit bleibt<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-37
9-38
Präsentationsmaterial (1)<br />
für den Referenten<br />
— elektronisches Material: PowerPoint oder pdf<br />
— ggf.: Karteikarten mit Stichworten<br />
für <strong>die</strong> Zuhörer<br />
— Handouts: Präsentation + (Raum für) Notizen<br />
Me<strong>die</strong>n<br />
— elektronische Me<strong>die</strong>n<br />
— (Folien)<br />
— Video<br />
— Tafel (Kreide, Whiteboard)<br />
— Flipchart<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-39
9-40
Präsentationsmaterial (2)<br />
Gestaltung: Folienhintergrund<br />
— meine feste Überzeugung: weißer Hintergrund<br />
— allenfalls<br />
Logo und/oder Name → Urheberschutz<br />
Seitenzahl → Referenz für Nachfragen<br />
— keinesfalls<br />
dunkler Hintergrund<br />
„tote Kolumnentitel“: Balken, Datum, Anlaß, Titel usw. → keine Information<br />
Je sparsamer, desto besser. Oder:<br />
Wenn Druckerschwärze, dann nur für Information.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-41
9-42
Präsentationsmaterial (3)<br />
Gestaltung: Navigation/Orientierung<br />
— Der Leser eines geschriebenen Textes hat fünf wichtige Knöpfe,<br />
<strong>die</strong> der Zuhörer einer Präsentation nicht hat:<br />
beginnen, wann man will,<br />
pausieren, wann man will,<br />
einen Text noch einmal lesen<br />
einen Text überspringen,<br />
aufhören, wann man will.<br />
— deshalb: Dem Zuhörer eine Orientierung geben!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-43
9-44
Präsentationsmaterial (4)<br />
Gestaltung: Farbcodes<br />
— bei (mathematischen) Funktionsgraphen<br />
— bei allgemeinen Graphen und Text<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-45
9-46
Präsentationsmaterial (5)<br />
Gestaltung: Farbcodes<br />
— bei (mathematischen) Funktionsgraphen<br />
schwarz Beschriftung<br />
grau Rasterlinien<br />
farbig Kurve(n)<br />
Aufmerksamkeitsniveau<br />
20 min. 40 min.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-47
9-48
Präsentationsmaterial (6)<br />
Gestaltung: Farbcodes<br />
— bei (mathematischen) Funktionsgraphen<br />
schwarz Beschriftung<br />
grau Rasterlinien<br />
farbig Kurve(n)<br />
hervorheben durch Animieren<br />
Aufmerksamkeitsniveau<br />
20 min. 40 min.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-49
9-50
Präsentationsmaterial (7)<br />
Gestaltung: Farbcodes<br />
— bei (mathematischen) Funktionsgraphen<br />
schwarz Beschriftung<br />
grau Rasterlinien<br />
farbig Kurve(n)<br />
hervorheben durch Animieren<br />
— bei allgemeinen Graphen und Text:<br />
eine Farbe jeweils alternativen Strukturen, Begriffen zuordnen<br />
gut sichtbar: Blau und Rot<br />
Farbcode wird durch Animation verstärkt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-51
9-52
Präsentationsmaterial (8)<br />
Was tun mit Texten?<br />
— max. 1 Idee pro Folie<br />
— knappe Formulierungen: Jedes Wort muß sitzen!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-53
9-54
Präsentationsmaterial (9)<br />
Was tun mit Texten?<br />
— Schriftgröße: ≥ 18 pt (Räume mit ca. 50 Zuhörern)<br />
— Schriftart(en)<br />
„Brotschrift“ serifenlose Schrift (Arial, Helvetica)<br />
Programmcode Courier<br />
Hervorhebung Farbe, Kursivschrift (manchmal schlechte Projektion)<br />
— mehr nicht!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-55
9-56
Präsentationsmaterial (10)<br />
Visualisierung von Texten<br />
Argumente lassen sich<br />
oft nur in Textform<br />
darstellen.<br />
aber:<br />
„Bullet-Listen“ zeigen nicht<br />
den Zusammenhang zwischen<br />
Argumenten.<br />
Vermeide „Bullet-Listen“<br />
bei Argumentketten!<br />
Durch <strong>die</strong> Anordnung von<br />
Textelementen und <strong>die</strong><br />
Verwendung von Symbolen<br />
kann man <strong>die</strong> Aussage von<br />
Texten visualisieren.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-57
9-58
Präsentationsmaterial (11)<br />
Animation<br />
1. einen Text schrittweise aufblättern<br />
2. eine Grafik schrittweise entwickeln<br />
3. einzelne Komponenten der Grafik hervorheben/abschwächen<br />
4. eine Grafik animieren<br />
Immer einen (großen) Anteil der Folie konstant lassen!<br />
ein längeres Beispiel aus meiner <strong>Vorlesung</strong>:<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-59
9-60
Präsentationsmaterial (12)<br />
für den Referenten<br />
— Manuskript<br />
Stichworte → zwingen zum freien Formulieren<br />
Verwendung von nummerierten Karteikarten DIN-A5<br />
Karten in verschiedenen Farben:<br />
Farbcode für Inhalte unterschiedlicher Wichtigkeit usw.<br />
Beschriftung mit verschiedenen Farben: z.B.<br />
rot Überschriften, Kernaussagen<br />
blau rhetorische Hinweise<br />
grün Regieanweisungen für Me<strong>die</strong>neinsatz<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-61
9-62
Präsentationsmaterial (13)<br />
für <strong>die</strong> Zuhörer<br />
— Handouts sollen identische Texte und Visualisierungen zeigen<br />
— ggf. erläuternde Texte zu den Visualisierungen<br />
— vor der Präsentation verteilen<br />
→ damit <strong>die</strong> Zuhörer mitschreiben können<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-63
9-64
Inszenierung (1)<br />
Aufmerksamkeitskurve<br />
Aufmerksamkeitsniveau<br />
20 min. 40 min.<br />
— wichtige Punkte: am Anfang oder am Ende der Präsentation<br />
— zwischen der 10. und der 30. Minute:<br />
gezielte Maßnahmen zur Stimulierung der Aufmerksamkeit<br />
— in der letzten Phase:<br />
Aufmerksamkeit nimmt nur dann wieder zu, wenn der Schluß angekündigt ist.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-65
9-66
Inszenierung (2)<br />
Haltung<br />
— leicht breitbeinig und ruhig stehen<br />
— offene Körperhaltung (Arme nicht vor der Brust verschränken)<br />
— den Blick nicht von den Zuhörern wenden:<br />
alle Zuhörer reihum anschauen, nicht einen einzelnen fixieren<br />
— ggf. <strong>die</strong> Hände mit einem Gegenstand beschäftigen<br />
Kleidung<br />
— immer leicht over-dressed<br />
Atmung<br />
— gefährlich: Hochatmung, d.h. Aufblähen des Brustkorbs:<br />
Stimme klingt erst gepreßt, geht dann ganz verloren<br />
— richtig: Tiefatmung, d.h. Zwerchfellatmung „aus dem Bauch heraus“:<br />
Stimme klingt besser, Voraussetzung für das „Durchhalten“<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-67
9-68
Inszenierung (3)<br />
Rhetorische Mittel<br />
— Vermeiden von bewußter oder unbewußter Arroganz!<br />
— kein Evangelizing:<br />
Niemals höhere Wahrheiten verkünden!<br />
Niemals der Zuhörerschaft falsche Überzeugungen unterstellen!<br />
— Frage-und-Antwort-Spiele<br />
— Namentliches Ansprechen<br />
— Geschichten/Anekdoten erzählen, aber mit Verstand!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-69
9-70
Inszenierung (4)<br />
Gestik<br />
— vier Bereiche:<br />
unterer Bereich: Hände unterhalb der Gürtellinie:<br />
Gesten werden negativ gedeutet<br />
mittlerer Bereich: Hände zwischen Gürtellinie und Brusthöhe:<br />
neutrale Deutung<br />
oberer Bereich: Hände auf Brusthöhe: positive Deutung<br />
erhöhter Bereich: Hände über Schulterhöhe:<br />
Gesten werden als Dominanzstreben und<br />
Bedrohung gedeutet;<br />
aber auch als kindliches Verhalten<br />
— vier Richtungen:<br />
nach oben: positiv, dynamisch oder negativ, drohend, arrogant<br />
nach unten: negativ, pessimistisch oder positiv, beruhigend<br />
zum Körper: sympathisch oder aufdringlich<br />
vom Körper weg: abwehrend oder entgegenkommend<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-71
9-72
Inszenierung (5)<br />
Diskussion<br />
— schnell herausfinden, wie ein Diskussionsbeitrag gemeint ist …<br />
sachlich:<br />
ver<strong>die</strong>nt eine sachliche Antwort<br />
Unwissen sofort zugestehen; Frage an das Auditorium leiten.<br />
unsachlich:<br />
defensiv:<br />
„Sie stellen da eine sehr interessante Frage.“<br />
„Diese Frage beschäftigt sicherlich nicht alle Anwesenden;<br />
wir sollten das in der Pause diskutieren.“<br />
„Ich habe nicht genau verstanden, worauf Sie hinauswollen.“<br />
„Ich verspreche Ihnen eine Lösung in meiner nächsten Präsentation.“<br />
niemals offensiv oder aggressiv<br />
(es sei denn, man hat das ganze Auditorium hinter sich.)<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 9-73
9-74
70bewert.fm<br />
… UND ENDLICH<br />
10. ZUR BEWERTUNG VON<br />
WISSENSCHAFTLICHEN<br />
ARBEITEN<br />
1. Lernziel<br />
2. Qualitätskriterien<br />
3. Bewertung<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel
Recommended reading<br />
10-2
Lernziel (1)<br />
Sie sollen Kriterien bekommen, um <strong>die</strong> Qualität Ihrer Arbeiten<br />
bewußt und gezielt steigern zu können.<br />
— Anwendung bei der Erstellung von Diplomarbeiten<br />
— Anwendung bei der Beurteilung:<br />
Grundlage für das Gutachten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-3
10-4
Qualitätskriterien (1)<br />
Fokussierung<br />
— Festlegung und Einengung des Themas:<br />
„Je begrenzter das Gebiet, um so besser kann man arbeiten und auf um so sichererem<br />
Grund steht man.“ (Eco, S. 22)<br />
Rahmen für <strong>die</strong> Bewertung der Arbeit<br />
persönliches Profil für den Autor<br />
Orientierungshilfe für einen Interessenten<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-5
10-6
Qualitätskriterien (2)<br />
Fokussierung: Modell der konzentrischen Ringe<br />
— Zuordnung der Themenstellung der Arbeit zu einem Ring<br />
— im Abschnitt zur Problemstellung:<br />
Einordnung der Themenstellung in <strong>die</strong> Systematik <strong>die</strong>ses Rings<br />
— Modell kann noch weiter verfeinert werden<br />
Achtung:<br />
Wissenschaft (z.B. Informatik)<br />
Disziplin<br />
Gebiet<br />
(z.B. Kommunikationssysteme)<br />
(z.B. Lokale Netze)<br />
Keine Darstellung des ISO/OSI-Referenzmodells in einer Arbeit,<br />
in der eine Komponente für ein spezielles Kom.-system entwickelt wird!<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-7
10-8
Qualitätskriterien (3)<br />
Berücksichtigung des Standes der Technik<br />
— Bezug fremder Ergebnisse zur eigenen Arbeit<br />
— Klarheit der Abgrenzung<br />
— „Vollständigkeit“<br />
Originalität der Arbeit<br />
— neuartige Ergebnisse?<br />
— neuartige Methodik?<br />
nachvollziehbares, systematisch-methodisches Vorgehen<br />
— Darstellung und Begründung der Vorgehensweise<br />
— Angabe der Ziele der einzelnen Vorgehensschritte<br />
— Nennung der getroffenen Annahmen<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-9
10-10
Qualitätskriterien (4)<br />
Nützlichkeit<br />
— Vollständigkeit der Ergebnisse<br />
— Vertrauenswürdigkeit<br />
— Nützlichkeit für den „end user“<br />
— Ausblick für aufbauende Arbeiten<br />
Klarheit der Darstellung<br />
— Gliederung<br />
— Verständlichkeit<br />
— Stil<br />
Angemessene formale Gestaltung<br />
— Anwendung typographischer Grundregeln<br />
— übersichtliche Verzeichnisse<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-11
10-12
Bewertung (1)<br />
Aufteilung von max. 100 Punkten auf <strong>die</strong> Kriterien:<br />
— Qualität der Lösung max. 32 Punkte<br />
— wissenschaftliche Arbeitstechnik max. 32 Punkte<br />
— Eigeninitiative des Bearbeiters max. 20 Punkte<br />
— Qualität der Ausarbeitung max. 16 Punkte<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-13
10-14
Bewertung (2)<br />
Qualität der Lösung<br />
lediglich Lösungsansätze; geringes Vertrauen in <strong>die</strong> Lösung 0 – 8 Pkt.<br />
Lösung von Teilproblemen 9 – 16 Pkt.<br />
Vollständige Lösung 17 – 24 Pkt.<br />
Vollst. Lösung und Behandlung zusätzlicher Fragestellungen 25 – 32 Pkt.<br />
wissenschaftliche Arbeitstechnik<br />
wenig selbständige und systemlose Durchführung;<br />
nur Literatur aus dem engsten Umfeld 0 – 8 Pkt.<br />
Entwicklung einer Systematik erst nach Drängen des Betreuers;<br />
geringes Literaturvolumen 9 – 16 Pkt.<br />
selbständige Durchführung;<br />
Aufarbeitung der relevanten Literatur 17 – 24 Pkt.<br />
selbständige und zielbewußte Durchführung;<br />
strukturierte Erfassung des Standes der Technik 25 – 32 Pkt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-15
10-16
Bewertung (3)<br />
Eigeninitiative des Bearbeiters<br />
Kandidat geht schwierigen Problemen aus dem Weg;<br />
mangelnder zeitlicher Einsatz 0 – 5 Pkt.<br />
teilweise Eigeninitiative 6 – 10 Pkt.<br />
Ziel wurde mit großer Eigeninitiative erreicht 11 – 15 Pkt.<br />
Eigeninitative bei der Entwicklung der Thematik<br />
und der Durchführung der Arbeit 16 – 20 Pkt.<br />
Qualität der Ausarbeitung<br />
Ausarbeitung mit schweren Mängeln (fehlende Systematik,<br />
schlechtes Deutsch, Schreibfehler, fehlende Verzeichnisse usw.) 0 – 4 Pkt.<br />
nur teilweise systematische Darstellung der Ergebnisse;<br />
Weitschweifigkeiten, akzeptable Gestaltung 5 – 8 Pkt.<br />
systematische, einleuchtende Gliederung, aber<br />
leichte Schwächen in Sprache und Gestaltung 9 – 12 Pkt.<br />
systematische Gliederung, flüssige Sprache,<br />
Bilder mit klarer Aussage, gute Gestaltung 13 – 16 Pkt.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-17
10-18
Bewertung (4)<br />
Umsetzung der Punktezahl in eine Note<br />
Note 1,0 ab Punktzahl: 96<br />
1,3 88<br />
1,7 80<br />
2,0 72<br />
2,3 64<br />
2,7 56<br />
3,0 48<br />
3,3 40<br />
3,7 32<br />
4,0 24<br />
Arbeiten, <strong>die</strong> nicht mindestens 9 Punkte für <strong>die</strong> wissenschaftliche<br />
Arbeitstechnik erreichen, bewerte ich auch dann, wenn sich<br />
insgesamt eine Punktzahl ≥ 24 ergibt, als „nicht ausreichend“.<br />
Communication Systems Research Group Prof. Dr.-Ing. Norbert Luttenberger<br />
Computer Science Dept., CAU Kiel 10-19
10-20