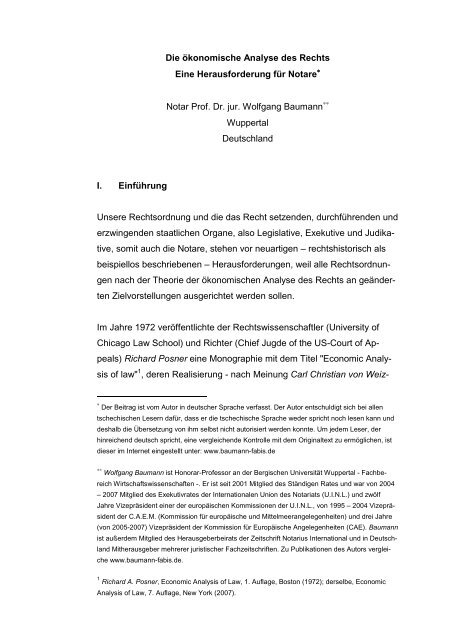Die ökonomische Analyse des Rechts - Notar Prof. Dr. Baumann ...
Die ökonomische Analyse des Rechts - Notar Prof. Dr. Baumann ...
Die ökonomische Analyse des Rechts - Notar Prof. Dr. Baumann ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
I. Einführung<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
Eine Herausforderung für <strong>Notar</strong>e ∗<br />
<strong>Notar</strong> <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. jur. Wolfgang <strong>Baumann</strong> ∗∗<br />
Wuppertal<br />
Deutschland<br />
Unsere <strong>Rechts</strong>ordnung und die das Recht setzenden, durchführenden und<br />
erzwingenden staatlichen Organe, also Legislative, Exekutive und Judika-<br />
tive, somit auch die <strong>Notar</strong>e, stehen vor neuartigen – rechtshistorisch als<br />
beispiellos beschriebenen – Herausforderungen, weil alle <strong>Rechts</strong>ordnun-<br />
gen nach der Theorie der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> an geänder-<br />
ten Zielvorstellungen ausgerichtet werden sollen.<br />
Im Jahre 1972 veröffentlichte der <strong>Rechts</strong>wissenschaftler (University of<br />
Chicago Law School) und Richter (Chief Jugde of the US-Court of Ap-<br />
peals) Richard Posner eine Monographie mit dem Titel "Economic Analy-<br />
sis of law" 1 , deren Realisierung - nach Meinung Carl Christian von Weiz-<br />
∗ Der Beitrag ist vom Autor in deutscher Sprache verfasst. Der Autor entschuldigt sich bei allen<br />
tschechischen Lesern dafür, dass er die tschechische Sprache weder spricht noch lesen kann und<br />
<strong>des</strong>halb die Übersetzung von ihm selbst nicht autorisiert werden konnte. Um jedem Leser, der<br />
hinreichend deutsch spricht, eine vergleichende Kontrolle mit dem Originaltext zu ermöglichen, ist<br />
dieser im Internet eingestellt unter: www.baumann-fabis.de<br />
∗∗ Wolfgang <strong>Baumann</strong> ist Honorar-<strong>Prof</strong>essor an der Bergischen Universität Wuppertal - Fachbe-<br />
reich Wirtschaftswissenschaften -. Er ist seit 2001 Mitglied <strong>des</strong> Ständigen Rates und war von 2004<br />
– 2007 Mitglied <strong>des</strong> Exekutivrates der Internationalen Union <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>iats (U.I.N.L.) und zwölf<br />
Jahre Vizepräsident einer der europäischen Kommissionen der U.I.N.L., von 1995 – 2004 Vizeprä-<br />
sident der C.A.E.M. (Kommission für europäische und Mittelmeerangelegenheiten) und drei Jahre<br />
(von 2005-2007) Vizepräsident der Kommission für Europäische Angelegenheiten (CAE). <strong>Baumann</strong><br />
ist außerdem Mitglied <strong>des</strong> Herausgeberbeirats der Zeitschrift <strong>Notar</strong>ius International und in Deutsch-<br />
land Mitherausgeber mehrerer juristischer Fachzeitschriften. Zu Publikationen <strong>des</strong> Autors verglei-<br />
che www.baumann-fabis.de.<br />
1 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 1. Auflage, Boston (1972); derselbe, Economic<br />
Analysis of Law, 7. Auflage, New York (2007).
- 2 -<br />
säckers 2 , eines ihrer Vertreter - die Zahl notwendiger Juristen auf 30 %<br />
<strong>des</strong> gegenwärtigen Bestan<strong>des</strong> reduzieren würde 3 . Ziel dieser Umgestal-<br />
tung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> ist die Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt.<br />
Posners Werk ist vor wenigen Monaten in der 7. Auflage erschienen und<br />
begründet eine der einflussreichsten <strong>Rechts</strong>theorien der Gegenwart. <strong>Die</strong><br />
Europäische Kommission folgt bei der Durchsetzung eines gemeinsamen<br />
Marktes den Zielen <strong>ökonomische</strong>r Effizienz, etwa bei der Umsetzung einer<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsrichtlinie zur Durchsetzung <strong>ökonomische</strong>r Effizienz einer<br />
liberalisierten Marktwirtschaft. Der Umfang der seit 1972 weltweit veröf-<br />
fentlichten rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zu dieser<br />
Theorie ist unüberschaubar 4 . US-amerikanische Gerichte entscheiden seit<br />
Jahren auch auf der Grundlage der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>. In<br />
den USA wird die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> an den <strong>Rechts</strong>fakultä-<br />
ten aller Universitäten gelehrt. Posner und seine Anhänger bezeichnen die<br />
<strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> als größte Herausforderung aller Zeiten<br />
für die Entwicklung der <strong>Rechts</strong>wissenschaft.<br />
Nach der Theorie der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> soll das Recht<br />
nach den Gesetzen <strong>des</strong> Marktes neu gestaltet werden. Das Recht soll die<br />
freien Kräfte <strong>des</strong> Marktes fördern, nicht behindern. Optimierungsmaßstab<br />
<strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> soll die <strong>ökonomische</strong> Effizienz nach dem Kaldor/Hicks-<br />
Kriterium werden 5 . Ökonomische Effizienz wird mit Nutzen/Kosten Analy-<br />
2 Carl Christian von Weizsäcker ist ein Neffe <strong>des</strong> ehemaligen Bun<strong>des</strong>präsidenten, der u.a. von<br />
1972 – 1974 <strong>Prof</strong>essor für mathematische Ökonomie an der Universität Bielefeld und von 1986 –<br />
2003 Ordinarius für Ökonomie an der Universität zu Köln war.<br />
3 Carl Christian von Weizsäcker in seinem Brief v. 24. 6. 1993 an Horst Eidenmüller, in Eidenmül-<br />
ler, Effizienz als <strong>Rechts</strong>prinzip, 1. Auflage (1995) und 2. (unveränderte) Auflage (2001) Seite 7<br />
Fußnote 20.<br />
4 Umfassend und grundlegend im deutschen juristischen Schrifttum Horst Eidenmüller, Effizienz als<br />
<strong>Rechts</strong>prinzip, 1. Auflage (1995) und 2. (unveränderte) Auflage (2001); Hans-Bernd Schäfer/Claus<br />
Ott, Lehrbuch der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> Zivilrechts (4. Aufl., 2005); vgl. außerdem die<br />
Literaturnachweise bei <strong>Baumann</strong>, Ökonomie und Recht – Ökonomische Effizienzjurisprudenz;<br />
RNotZ (Rheinische <strong>Notar</strong>-Zeitschrift) 2007, S. 297 ff. und Assmann, Heinz-<strong>Die</strong>ter / Kirchner,<br />
Christian / Schanze, Erich (Hrsg.), Ökonomische <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, 2. Auflage, Tübingen (1993).<br />
5 Dazu unten II.
- 3 -<br />
sen ermittelt. Nach der schlagwortartigen Forderung eines deutschen<br />
<strong>Rechts</strong>wissenschaftlers soll richtiges Recht "mehr nützen als kosten" 6 .<br />
Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Wohlfahrt einer Gesellschaft eine<br />
Funktion ihrer Gesetze und handlungsbestimmenden Institutionen ist,<br />
bemüht sich die Transaktionskostenökonomik um eine Verbesserung<br />
marktwirtschaftlicher Effizienz.<br />
Der Transaktionskostenökonomik liegt das Coase-Theorem zugrunde.<br />
Danach könnten private Verhandlungen zu einer invarianten und effizien-<br />
ten Allokation volkswirtschaftlicher Ressourcen führen, wenn keine Trans-<br />
aktionskosten anfielen; der Markt selbst könnte also eine optimale Vertei-<br />
lung aller Güter herbeiführen.<br />
Transaktionskosten sind bei Verträgen die Kosten der Information, der<br />
Verhandlung, der Vertragsgestaltung, der Abwicklung, der Kontrolle von<br />
Erfüllungspflichten und die Kosten einer Anpassung bei veränderten<br />
Bedingungen also auch die <strong>Notar</strong>gebühren. Transaktionen sind jede Art<br />
von Veränderungen der Verfügungs-, Verwertungs- und Nutzungsrechte<br />
(property rights) einschließlich aller Verfügungen über Humankapital.<br />
Somit sind alle notariellen Urkunden auf Transaktionen gerichtet.<br />
Aus den Erkenntnissen der Transaktionskostenökonomik leitet die öko-<br />
nomische <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> die Forderung ab, das Recht marktkonform<br />
zu gestalten. Zum einen soll das Recht einen Markt für <strong>Rechts</strong>positionen<br />
zulassen. Außerdem soll das Recht den Austausch von Waren und Leis-<br />
tungen erleichtern und Transaktionskosten möglichst niedrig halten.<br />
Schließlich soll das Recht interventionistisch dort mit vertragsanalogen<br />
Lösungen eingreifen, wo der Markt versagt, weil zu hohe Transaktionskos-<br />
ten ihn behindern. Das Recht soll also nach den Kriterien und der Metho-<br />
dik einer <strong>ökonomische</strong>n Effizienzjurisprudenz neu gestaltet werden.<br />
6 Hans-Peter Schwintowski in seiner Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität Berlin am 26. 1.<br />
1995, Verteilungsdefizite durch Recht auf globalisierten Märkten, Grundstrukturen einer Nutzenthe-<br />
orie <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, Humboldt-Universität zu Berlin, Heft 47 (1995) S. 1 ff. (18).
- 4 -<br />
<strong>Die</strong>se unter deutschen und europäischen – daher wohl auch tschechi-<br />
schen – Juristen wenig bekannte Theorie hat in den internationalen<br />
<strong>Rechts</strong>entwicklungen bereits zu tiefgreifenden Veränderungen der<br />
<strong>Rechts</strong>systeme geführt, wie exemplarisch die Doing Business Berichte der<br />
Weltbank 7 belegen.<br />
Der folgende Beitrag befürwortet die Anwendung der <strong>ökonomische</strong>n<br />
<strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> auf allen juristischen Ebenen (Legislative, Exekutive<br />
und Judikative) - vornehmlich zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau<br />
- und ihre wissenschaftliche Vertiefung in juristischen Studiengängen.<br />
Zugleich setzt er dieser Methode der <strong>Rechts</strong>findung aber deutliche inhalt-<br />
liche und verfahrensrechtliche Schranken. Ein Primat der <strong>ökonomische</strong>n<br />
Effizienzjurisprudenz darf aus verfahrensrechtlichen und inhaltlichen<br />
Gründen zum Schutz der betroffenen Menschen nicht anerkannt werden 8 .<br />
II. Grundlagen der Theorie<br />
Posners Theorie ist der Versuch, Gerechtigkeit an neuartigen Parametern<br />
auszurichten. <strong>Die</strong> Suche nach dem richtigen Recht ist so alt wie das Recht<br />
7 http://www.doingbusiness.org<br />
8 Anregungen zu dieser Thematik verdanke ich meinem verehrten akademischen Lehrer (von 1977<br />
bis 1979 war ich Mitarbeiter am seinem Lehrstuhl) <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Norbert Horn, der von 1973 bis 1989<br />
Universitäts-<strong>Prof</strong>essor für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Handels- und Wirt-<br />
schaftsrecht an der Universität Bielefeld war. Von 1983 bis 1984 war er Dekan der juristischen<br />
Fakultät, von 1974 bis 1981 war er Direktor <strong>des</strong> Zentrums für interdisziplinäre Forschung an der<br />
Universität Bielefeld. Als erster deutscher <strong>Rechts</strong>wissenschaftler, hat er sich nur 3 Jahre nach dem<br />
Erscheinen der Erstauflage <strong>des</strong> Werkes Posners mit der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> in<br />
einer Publikation auseinandersetzt (AcP = Archiv für die civilistische Praxis, 1976, S. 307 ff.). Ab<br />
1989 war Norbert Horn als Ordinarius und seit 2001 ist er als Emeritus <strong>Rechts</strong>lehrer an der<br />
Universität zu Köln sowie seit 1989 Direktor am dortigen Institut für Bankrecht. Von 1994 bis 1996<br />
war er Dekan der <strong>Rechts</strong>wissenschaftlichen Fakultät, von 1998 bis 2004 stellvertretender Vorsit-<br />
zender <strong>des</strong> Justizprüfungsamtes am OLG Köln. Von 1982 bis 1988 war er zudem Direktor <strong>des</strong><br />
Center for International and Investment Contracts (CITIC) und von 1995 bis 2005 Geschäftsführen-<br />
der Direktor <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>zentrums für europäische und internationale Zusammenarbeit. Seit 1973<br />
hatte er zahlreiche Gastprofessuren im In- und Ausland, unter anderem von 1973 bis 1981 an der<br />
London School of Economics, 1977 am Georgetown University Law Center, Washington D.C., von<br />
1994 bis 2001 am Center for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College,<br />
University of London und von 1999 bis 2006 an der Universität Danzig sowie zwischen 1991 und<br />
1999 mehrere Gastprofessuren in Italien und Japan. Seit 1996 ist er Honorarprofessor der China<br />
Universität für Politische Wissenschaft und Recht, Peking und seit 2006 Gastprofessor an der<br />
Bucerius Law School Hamburg.
- 5 -<br />
selbst. Noch suchen die Juristen eine Definition vom Recht - schreibt<br />
Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft.<br />
Nach „der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>“ soll unsere <strong>Rechts</strong>ordnung<br />
so programmiert werden, das es konform mit dem von Adam Smith grund-<br />
legend beschriebenen Modell <strong>des</strong> offenen Marktes den Wohlstand aller<br />
Menschen fördert. Optimierungsmaßstab <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> soll die <strong>ökonomische</strong><br />
Effizienz sein.<br />
Ökonomische Effizienz, ein Begriff der Wohlfahrtsökonomik 9 , wird mit<br />
Nutzen/Kosten <strong>Analyse</strong>n ermittelt. Kaldor 10 und Hicks 11 hatten 1939 den<br />
<strong>ökonomische</strong>n Effizienzbegriff Vilfredo Paretos 12 dahingehend fortentwi-<br />
ckelt, dass sie als Entscheidungsregel für die Wahl zwischen zwei sozia-<br />
len Zuständen das später nach ihnen benannte Kaldor-Hicks-Kriterium<br />
vorschlugen: Danach ist eine <strong>ökonomische</strong> Veränderung dann effizient,<br />
wenn der Nutzen oder Gewinn aller Begünstigten einen etwaigen Verlust<br />
aller Benachteiligten übersteigt. Effizient sind also Veränderungen, die zur<br />
Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt führen. Nachteile eines<br />
einzelnen müssen demnach in Kauf genommen werden, wenn die Vorteile<br />
für die Allgemeinheit überwiegen.<br />
9 Unter (Wohlfahrtsökonomik) „welfare economics“ wird in der Ökonomie ein wirtschaftstheoreti-<br />
scher Ansatz verstanden, mit dem Maßstäbe zur Messung der Wohlfahrt ermittelt werden, um<br />
daraus die Bedingungen abzuleiten, die zur individuellen und vor allem zur gesamtwirtschaftlichen<br />
Wohlfahrt führen. Wichtigste Vertreter dieses theoretischen Ansatzes sind Pigou, Pareto, Samuel-<br />
son, Kaldor und Hicks.<br />
10 Nicholas Kaldor, Welfare Propositions of Economic and Interpersonal Comparisons of Utility,<br />
Economic Journal 1939, S. 549 ff.<br />
11 John R. Hicks, The Foundations of Welfare Economics, in: Economic Journal (1939) S. 696 ff.<br />
12 Vilfredo Pareto, Manual of Political Economy, London (1897, 1971); das Pareto-Optimum<br />
definiert einen Zustand der Produktion und Vermögens- und Einkommensverhältnisse, der optimal<br />
ist, so dass jede Veränderung <strong>des</strong> gesamten Nutzenniveaus den Nutzen eines einzelnen verringern<br />
würde. Deshalb dürfen nach Pareto nur solche Veränderungen (und das würde dann auch für<br />
Gesetzesänderungen gelten) zugelassen werden, die den Nutzen oder Gewinn aller mehren, ohne<br />
den Nutzen oder Gewinn auch nur eines einzelnen Beteiligten zu verringern. <strong>Die</strong>se sehr theoreti-<br />
sche – in der Praxis nicht erreichbare – Position haben Kaldor und Hicks an gesamtwirtschaftlichen<br />
Wohlfahrtskriterien neu ausgerichtet.
- 6 -<br />
<strong>Die</strong>se – von Kaldor und Hicks definierten – Effizienzkriterien der Wohl-<br />
fahrtsökonomik sind Grundlage der von dem <strong>Rechts</strong>wissenschafter und<br />
langjährigen Vorsitzenden Richter am US-Bun<strong>des</strong>gericht Richard Posner<br />
im Jahre 1972 veröffentlichen Theorie „Economic analysis of law“. <strong>Die</strong><br />
<strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> verfolgt das Ziel, die <strong>Rechts</strong>ordnung<br />
nach den Erkenntnissen der Wohlfahrtsökonomik so umgestalten, dass<br />
die Gesetze und die auf ihnen beruhenden rechtlichen Institutionen nach<br />
dem Kaldor-Hicks-Kriterium effizient sind und zur gesamtwirtschaftlichen<br />
Wohlfahrt beitragen.<br />
Eine künftige Ausrichtung unserer <strong>Rechts</strong>ordnung an <strong>ökonomische</strong>r<br />
Effizienz wäre ein Paradigmenwechsel <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> 13 . Alle aus <strong>Rechts</strong>phi-<br />
losophie und <strong>Rechts</strong>theorie entwickelten traditionellen Gerechtigkeitstheo-<br />
rien wären überholt. Wären die Grundannahmen der <strong>ökonomische</strong>n Ana-<br />
lyse <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> zutreffend, dann würde den Gesetzen und der rechtlichen<br />
Ordnung mit der Effizienz ein Kriterium implementiert, welches erstmals<br />
ermöglichen würde, juristische Wertentscheidungen empirisch – nach am<br />
volkswirtschaftlichen Wohl orientierten Kriterien – zu überprüfen. Ent-<br />
scheidungen <strong>des</strong> Gesetzgebers wie der <strong>Rechts</strong>prechung wären am Nut-<br />
zen/Kosten Verhältnis messbar. Recht könnte also falsifiziert werden 14 .<br />
<strong>Die</strong> Jurisprudenz würde die Kriterien der modernen Wissenschaftstheorie<br />
erfüllen 15 .<br />
<strong>Die</strong> Ableitung juristischer Entscheidungen aus den Ergebnissen empiri-<br />
scher Untersuchungen nach den Vorgaben einer <strong>ökonomische</strong>n Effizienz-<br />
13 Dazu Klaus Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit? Auf der Suche nach den philosophischen<br />
Grundlagen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> (2004); Claus Eidenmüller, Effizienz als<br />
<strong>Rechts</strong>prinzip, Möglichkeiten und Grenzen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> (1995).<br />
14 Da die normativen Wertungen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> nur die Sollensebene betreffen, sind sie nach her-<br />
kömmlichen Verständnis empirisch nicht überprüfbar und somit auf der Ebene <strong>des</strong> Seins nicht<br />
falsifizierbar. Dass die <strong>Rechts</strong>wissenschaft als Normwissenschaft mit hermeneutisch-<br />
geisteswissenschaftlichen Methoden zur wissenschaftlichen Wahrheitsfindung beiträgt, ist in der<br />
modernen Wissenschaftstheorie anerkannt.<br />
15 Sowohl der logische Empirismus, wie er insbesondere vom Wiener Kreis um Rudolf Carnap<br />
vertreten wurde, als auch der maßgeblich von Karl Popper entwickelte kritische Rationalismus, der<br />
auf dem Falsifikationsmodell aufbaut, suchen die Annäherungen an Wahrheiten durch schrittweise<br />
Eliminierung von empirisch und/oder rational als falsch nachgewiesenen Erklärungsmodellen.
- 7 -<br />
jurisprudenz würde nicht nur die juristische Methodenlehre verändern,<br />
sondern nach den Intentionen der Vertreter dieser Theorie eine system-<br />
bedingte Qualitätskontrolle in unsere <strong>Rechts</strong>ordnung einbauen. Das Recht<br />
würde erstmals an einem Optimierungsprogramm ausgerichtet. Bisher<br />
kennen wir im Recht keinen gezielten Selektionsmechanismus, der ver-<br />
hindert, dass bessere <strong>Rechts</strong>regeln durch schlechtere verdrängt werden.<br />
III. Grundlagen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
<strong>Die</strong> juristischen Wurzeln der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> gründen<br />
in der US-amerikanischen <strong>Rechts</strong>prechung zum Schadensersatzrecht.<br />
Learned Hand 16 , ein amerikanischer Bun<strong>des</strong>richter, hatte bereits 1947<br />
eine <strong>ökonomische</strong> Formel 17 entworfen, wonach der Vermeidungsaufwand<br />
mit dem Erwartungswert der Kosten einer Schädigung zur Feststellung<br />
von Fahrlässigkeit zu vergleichen sei. Nutzen/Kosten-Relationen sind<br />
keine Erfindung der von Posner propagierten <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong>, sondern von ihm nur als allgemeines Prinzip auf die gesamte<br />
<strong>Rechts</strong>ordnung ausgedehnt worden.<br />
Der Verdienst Posners liegt darin, dass er, der bereits vor seinen Ideen<br />
existierenden amerikanischen Gerichtspraxis ein mikro<strong>ökonomische</strong>s<br />
Theoriefundament unterlegt hat, das der US-amerikanische <strong>Rechts</strong>wis-<br />
senschaftler Guido Calabresi 18 partiell für das Schadensersatzrecht be-<br />
reits vor Posner entworfen hatte.<br />
Während historisch entwickelte <strong>Rechts</strong>ordnungen - wie alle kontinentaleu-<br />
ropäischen – zur Ermittlung der Fahrlässigkeit auf die „im Verkehr erfor-<br />
16 Learned Hand gilt als einer der bekanntesten und einflussreichsten Richter in der US-<br />
amerikanischen <strong>Rechts</strong>geschichte. Er war u.a. Autor von „The Spirit of Liberty“ (1952) und „The Bill<br />
of Rights“ (1958).<br />
17 Calculus of negligence, in United States v. Caroll Towing, 159 F. 2 d 169 (2 d Cir. 1947).<br />
18 Guido Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, Yale Law Journal<br />
1961, S. 499 ff.; ders., Ideale Überzeugungen, Einstellungen und ihr Verhältnis zum Recht, Berlin<br />
(1985, 1990); ders., The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further, Yale Law Journal 1991,<br />
S. 1211 ff.
- 8 -<br />
derliche Sorgfalt“ abstellen, begründet die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> die Fahrlässigkeit ökonomisch. Ausgangspunkt ist die induktiv<br />
bisher nicht widerlegte Prämisse, dass jeder durch fahrlässiges Handeln<br />
eines Menschen verursachte Schaden mit entsprechend hohem ökonomi-<br />
schen Vorsorgeaufwand vermieden werden könnte. Fahrlässigkeit soll<br />
sich aus dem Verhältnis zwischen dem Vorsorgeaufwand und dem zu<br />
erwartenden Schaden, also der Schadenswahrscheinlichkeit und der<br />
Schadenshöhe ergeben. Übersteigen die Kosten potentieller Vorsorge-<br />
aufwendungen den messbaren Wert <strong>des</strong> Nutzens, dann handelt der<br />
Schädiger nicht fahrlässig. Den mit solchen <strong>ökonomische</strong>n Verfahren nicht<br />
vertrauten Juristen wird überraschen, dass die Ergebnisse nach der<br />
juristischen wie der <strong>ökonomische</strong>n Methode in den meisten Fällen iden-<br />
tisch sind, US-amerikanische Gerichte begründen in ständiger <strong>Rechts</strong>pre-<br />
chung seit der 1947 von Learned Hand aufgestellten „Calculus of negli-<br />
gence-Formel“ die Fahrlässigkeit ökonomisch.<br />
Praktiker schütteln ungläubig den Kopf und fragen: Wie soll der entschei-<br />
dungserhebliche Tatbestand, die <strong>Rechts</strong>widrigkeit oder Schuld ökono-<br />
misch empirisch ermittelt werden? Wie will man gar die konkrete Strafbar-<br />
keit eines Handelns an <strong>ökonomische</strong>n Effizienzkriterien messen? <strong>Die</strong>se<br />
Einwände sind für jeden im Denken juristischer Dogmatik verhafteten<br />
Theoretiker oder Praktiker typisch. Tatbestand, <strong>Rechts</strong>widrigkeit, Schuld<br />
oder Strafbarkeit eines menschlichen Verhaltens ergeben sich aus der<br />
komparativen Zuordnung zu gesetzlichen Regelungen. Ist Wertungsmaß-<br />
stab dieser gesetzlichen Regelungen eine <strong>ökonomische</strong> Nutzen/Kosten<br />
Relation, dann ist die konkrete <strong>Rechts</strong>anwendung nichts anderes als die<br />
Ermittlung und Durchsetzung <strong>ökonomische</strong>r Effizienz mit dem Ziel ge-<br />
samtvolkswirtschaftlicher Wohlfahrt. Wird auch das Verfahren dieser<br />
<strong>Rechts</strong>verwirklichung, also der Zivil- oder Strafprozess, nach ökonomi-<br />
schen Effizienzkriterien gestaltet und sind die staatlichen Institutionen,<br />
etwa die Gerichte nach den Kriterien <strong>ökonomische</strong>r Effizienz ausgerichtet,<br />
dann könnte wohl ein in sich stimmiges Normensystem auf der Grundlage<br />
<strong>ökonomische</strong>r Effizienz entwickelt werden.
- 9 -<br />
Posners Theorie beeinflusst auch das deutsche Schrifttum. Seit 1989<br />
schlägt Heinrichs im Palandt 19 unter Berufung auf die <strong>ökonomische</strong> Analy-<br />
se <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> vor, bei Sachschäden Nutzen/Kosten <strong>Analyse</strong>n heranzu-<br />
ziehen, um den Umfang der erforderlichen Sorgfalt bei Fahrlässigkeitshaf-<br />
tung zu bestimmen. Sorgfaltsmaßnahmen zur Vermeidung von Fahrläs-<br />
sigkeit seien nach der Learned-Hand-Formel nur erforderlich, wenn der für<br />
sie notwendige Aufwand geringer ist, als der durch ihre Nichtanwendung<br />
möglicherweise entstehende Schaden 20 . Obwohl der Palandt auf dem<br />
Tisch je<strong>des</strong> Zivilrechtspraktikers steht, ist bis heute nicht ein einziges Urteil<br />
eines deutschen Gerichts veröffentlicht, das auf die „Calculus of negligen-<br />
ce-Formel“ gestützt wurde 21 .<br />
Heinrichs widersprechen andere deutsche Kommentatoren, etwa Löwisch 22<br />
im Staudinger 23 mit der Begründung, diese Methode laufe auf einen Frei-<br />
brief zur Schädigung <strong>Dr</strong>itter hinaus und sei mit dem Prinzip unserer<br />
<strong>Rechts</strong>ordnung, dass niemand einen anderen schädigen dürfe, nicht zu<br />
vereinbaren. Später wird dargelegt, welche fundamental unterschiedlichen<br />
Sichtweisen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> diesem Meinungsstreit zugrunde liegen. Löwisch<br />
ist entgegenzuhalten, dass unsere <strong>Rechts</strong>wirklichkeit Zweifel an der absolu-<br />
ten Richtigkeit seiner Ansicht weckt, seiner Meinung aber ein berechtigter<br />
Kern zugrunde liegt 24 .<br />
19 Der Palandt ist ein jährlich in neuer Auflage erscheinender Handkommentar zum deutschen<br />
Bürgerlichen Gesetzbuch.<br />
20 So auch die aktuelle Ausgabe Palandt/Heinrichs, 67. Auflage (2008) § 276 BGB Rz. 19; ausführ-<br />
licher MünchKomm/Grundmann (5. Aufl.) § 276 BGB Rz. 62 ff.<br />
21 Das OLG Rostock, NJW 2006, 3650, 3653, hat in einer Entscheidung immerhin die Learned-<br />
Hand-Formel als Hilfsargument verwendet. Der BGH, NJW 762, 763, stützt sich inzwischen – ohne<br />
Bezugnahme auf die Formel – auf das Argument, dass Sicherungsmaßnahmen von der Größe der<br />
Gefahr und <strong>des</strong> Eintritts ihrer Wahrscheinlichkeit abhängen, also letztlich in einer ökonomisch<br />
vernünftigen Relation zum Aufwand stehen müssen.<br />
22 Staudinger/Löwisch [2004] § 276 BGB Rz. 49.<br />
23 Der Staudinger ist der umfassendste und dogmatisch tiefschürfendste Kommentar zum deut-<br />
schen Bürgerlichen Gesetzbuch. <strong>Die</strong> Aktualisierung <strong>des</strong> aus über 100 Bänden bestehenden<br />
Werkes erfolgt jeweils bandweise zu den einzelnen Sachgebieten.<br />
24 Dazu VIII. 2.
- 10 -<br />
Ein einfaches Beispiel der Zivilluftfahrt dürfte jeden Leser an der Richtig-<br />
keit der Meinung Löwischs zweifeln lassen: Zivil-, Straf- und öffentliches<br />
Recht schützen die Flugsicherheit der Passagiere. Trotz dieser Schutzvor-<br />
schriften ereignen sich Flugzeugkatastrophen als Folge technischer Ver-<br />
säumnisse oder durch Eingriffe <strong>Dr</strong>itter. Moderne Technologien verbunden<br />
mit hohem Vorsorgeaufwand könnten nahezu jeden Schaden vermeiden.<br />
Würde jeder von uns - nach einem zur Veranschaulichung gewählten<br />
unrealistischen Extrembeispiel - mit den technischen und persönlichen<br />
Sicherheitsvorkehrungen <strong>des</strong> US-amerikanischen Präsidenten fliegen,<br />
dann wären wohl alle Unglücke der zivilen Luftfahrt mit Passagierflugzeu-<br />
gen in jüngerer Zeit vermieden worden. Handeln die Betreiber von Flug-<br />
gesellschaften fahrlässig, weil sie nicht alle technisch denkbaren Schutz-<br />
vorkehrungen treffen?<br />
<strong>Die</strong> Antwort lautet: Wollte jeder Flugpassagier mit den höchstmöglichen<br />
Sicherheitsstandards fliegen, so würden die Kosten der zur Unfallvermei-<br />
dung erforderlichen Vorsorgeaufwendungen die Flugpreise in eine Höhe<br />
treiben, in der die Flüge für uns unbezahlbar würden oder die Fluggesell-<br />
schaften keine Gewinne erwirtschaften könnten. Obwohl der potentielle<br />
Nutzen dem Erhalt von Menschenleben gälte - und nicht wie im Mei-<br />
nungsstreit zwischen Heinrichs und Löwisch einem bloßen Sachschaden -<br />
schreiben unsere Gesetze aus <strong>ökonomische</strong>n Gründen den Luftfahrtge-<br />
sellschaften solche Flugsicherheitsstandards nicht vor. Ein Zyniker könnte<br />
formulieren: Damit die Fluggesellschaften Gewinne erwirtschaften, werden<br />
restliche Sicherheitsrisiken für Menschenleben bewusst in Kauf genom-<br />
men.<br />
Der Flugsicherheit entsprechende Beispiele lassen sich zu allen gesetzli-<br />
chen verbraucherschützenden Sicherheitsstandards anderer Regelungs-<br />
bereiche bilden. <strong>Die</strong>se Feststellung legt nahe, dass unserem auf philoso-<br />
phischen und rechtstheoretischen Gerechtigkeitskriterien aufgebauten<br />
<strong>Rechts</strong>system latent <strong>ökonomische</strong> Erwägungen zugrunde liegen. Mit der<br />
nach § 276 BGB im Verkehr erforderlichen Sorgfalt können nur solche<br />
Aufwendungen nach dem Gesetz „erforderlich“ sein, die der Nut-<br />
zen/Kosten Relation der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> entsprechen.
- 11 -<br />
Hat Posner mit seiner Theorie lediglich aufgedeckt, was juristischen Ent-<br />
scheidungen seit jeher inhärent war, aber durch kunstvolle Konstruktionen<br />
der juristischen Dogmatik verschleiert wurde? Werden nach der konventi-<br />
onellen juristischen Methode und der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
nur <strong>des</strong>halb fast immer dieselben Ergebnisse erzielt, weil der juristischen<br />
Argumentation uneingestanden eine über Jahrhunderte verborgene öko-<br />
nomische rationabilitas zugrunde liegt?<br />
Am <strong>ökonomische</strong>n Effizienzprinzip soll nach Posner die gesamte <strong>Rechts</strong>-<br />
ordnung ausgerichtet werden, also nicht nur das Wirtschaftsrecht wie<br />
Kartellrecht, Wettbewerbsrecht 25 , Gesellschaftrecht 26 , Insolvenzrecht 27<br />
sondern z.B. das Schuldrecht, das ökonomisch zur Perpetuierung <strong>des</strong><br />
Eigentums wichtige Erbrecht, das Familienrecht und neben dem materiel-<br />
len Recht auch das gesamte Verfahrens- und Prozessrecht. Gleiches gilt<br />
für den Bereich <strong>des</strong> öffentlichen <strong>Rechts</strong> 28 , die staatlichen Institutionen und<br />
das Steuerrecht. Selbst Strafrecht und Strafvollzug werden von den Ver-<br />
tretern der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> auf ihre <strong>ökonomische</strong><br />
Effizienz hin untersucht und sollen umgestaltet werden 29 .<br />
IV. Wirtschaftstheoretische Grundlagen<br />
25 Kirchner, Christian, „Ökonomische <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> und Recht der Wettbewerbsbeschrän-<br />
kungen“ (antitrust law and economics), Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts-<br />
recht, 1980, S. 563 ff.<br />
26 Kirchner, Christian, Ökonomische <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> Unternehmensrechts, Ein Forschungsansatz,<br />
Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, 1983, S. 137 ff.; ders., Ansätze zu einer <strong>ökonomische</strong>n<br />
<strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> Konzernrechts, Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, 1984, S. 223 ff.; ders., Zur<br />
theoretischen Begründung einer „demokratischen Unternehmensverfassung“, Jahrbuch für Neue<br />
Politische Ökonomie, 1985, S. 219 ff.; ders., Ökonomische Überlegungen zum Konzernrecht,<br />
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1985, S. 214 ff.<br />
27 Mönning, Rolf-<strong>Die</strong>ter, Qualitätskriterien von Verwaltern, 9. Düsseldorfer Insolvenztage 2007.<br />
28 Kirchner, Christian, Das öffentliche Recht als ein Gegenstand <strong>ökonomische</strong>r Forschung – die<br />
Begegnung der deutschen Staatsrechtslehre mit der Konstitutionellen Politischen Ökonomie, in:<br />
Öffentliches Recht als ein Gegenstand <strong>ökonomische</strong>r Forschung. <strong>Die</strong> Begegnung der deutschen<br />
Staatsrechtslehre mit der Konstitutionellen Politischen Ökonomie, hrsg. von Christoph Engel und<br />
Martin Morlok, Tübingen, 1998, S. 315 ff.<br />
29 Vgl. z.B. Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political<br />
Economy 1968, S. 169 ff.; ders., The Economic Approach to Human Behavior, in: Gary S. Becker,<br />
The Economic Approach to Human Behavior, Chicago (1976) S. 3 ff.
- 12 -<br />
1. Mikro<strong>ökonomische</strong> Grundlagen<br />
Von welchen wirtschaftstheoretischen Grundlagen und Erkenntnissen<br />
wurde diese <strong>Rechts</strong>theorie ausgelöst und wird sie heute beeinflusst?<br />
Zu den fundamentalen Erkenntnissen der klassischen Nationalökonomie<br />
gehört, dass die Wohlfahrt einer Gesellschaft eine Funktion ihrer Gesetze<br />
und ihrer handlungsbestimmenden Institutionen ist. <strong>Die</strong>se Grundannahme<br />
wurde durch unterschiedliche Theorieansätze in den 60er Jahren <strong>des</strong> 20.<br />
Jahrhunderts neu belegt. Zu diesen Theorieansätzen, die unter der Sam-<br />
melbezeichnung „Neue Institutionenökonomik“ geführt werden, zählen u.a.<br />
die Transaktionskostenökonomik 30 , die Property-Rights-Theorie 31 , die<br />
Agency-Theorie 32 und die <strong>ökonomische</strong> Theorie der Verfassung 33 . <strong>Die</strong>se<br />
Theorien analysieren die Institutionen als wichtige Einflussgrößen <strong>des</strong><br />
Wirtschaftslebens mit mikro<strong>ökonomische</strong>n Methoden, also auf der Basis<br />
eines methodologischen Individualismus, <strong>des</strong>sen Grundlage der homo<br />
30 <strong>Die</strong>ser von Oliver E. Williamson begründete und auf dem Coase-Theorem entwickelte Theorie-<br />
ansatz untersucht die Transaktion eines Gutes über technisch als trennbar gedachte Schnittstellen,<br />
um die kostengünstigste Transaktionsform zu finden. Williamson, <strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong>n Institutionen<br />
<strong>des</strong> Kapitalismus. Unternehmen, Märkte, Kooperation, Tübingen (1990); ders., Transaction-Cost<br />
Economics: The Governance of Contractual Relations, Journal of Law and Economics 1979, S. 233<br />
ff.; ders., The Economic Institutions of Capitalism, New York (1985); ders., Calculativeness, Trust<br />
and Economic Organization, Journal of Law and Economics 1993, S. 453 ff.<br />
31 <strong>Die</strong>se Theorie strebt eine mikro<strong>ökonomische</strong> Erforschung <strong>des</strong> rechtlich oder in anderer Form<br />
gesicherten Umgangs mit Gütern an, durch den der Nutzungsbereich dieser Güter gegenüber<br />
anderen Personen abgegrenzt wird.<br />
32 <strong>Die</strong> Agency-Theorie versucht zu erklären, wie sich eigennutzorientierte Wirtschaftssubjekte in<br />
bestimmten Sozialbeziehungen verhalten. Dabei werden die Informationsasymmetrien, zwischen<br />
„principal“ und „agent“, die Opportunitätskosten zur Aufklärung <strong>des</strong> „principal“ auslösen, empirisch<br />
untersucht. <strong>Die</strong> Agency-Theorie hat eine herausragende Bedeutung für die <strong>Notar</strong>e, weil diese<br />
aufgrund ihrer unparteilichen Belehrungspflichten zur Beseitigung der Informationsasymmetrien<br />
beizutragen haben, indem sie insbesondere rechtlich Unerfahrene oder Behinderte zu schützen<br />
haben. Dazu ausführlich <strong>Baumann</strong>, Das deutsche <strong>Notar</strong>iat. Öffentliches Amt und soziale Funktio-<br />
nen. XXI. Internationaler Kongreß <strong>des</strong> Lateinischen <strong>Notar</strong>iats, Berichte der deutschen Delegation<br />
(in deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch), 1995, S. 1 ff.; ders., Das Amt <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s.<br />
Seine öffentlichen und sozialen Funktionen, MittRhNotK (Mitteilungen der Rheinischen <strong>Notar</strong>kam-<br />
mer = (seit 2001: Rheinische <strong>Notar</strong>zeitschrift) 1996, 1 ff.<br />
33 <strong>Die</strong>ses aus der Public-Choice–Theorie hervorgegangene, von Buchanan beeinflusste Theorie-<br />
programm analysiert kollektive und politische Entscheidungen, indem die Bestimmungsgründe für<br />
die Wahl von Regeln und deren Wirkungen auf das Verhalten von Individuen untersucht werden.
- 13 -<br />
oeconomicius als überwiegend eigennützig handeln<strong>des</strong> Wesen ist. Able-<br />
ger der Transaktionskostenökonomik ist die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong>.<br />
Impulsgeber für Posners Theorie der Ökonomischen <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
wie der gesamten Neuen Institutionenökonomik war der 1972 – wie Pos-<br />
ner – an der Universität Chikago lehrende Nobelpreisträger für Ökonomie<br />
Ronald Coase 34 . Coase hatte bereits 1937 untersucht, warum sich trotz<br />
der Überlegenheit <strong>des</strong> Marktes als Koordinationsinstrument in jeder<br />
Marktwirtschaft auch hierarchische Strukturen herausbilden, nämlich<br />
Unternehmen 35 . Als Ursache ermittelte Coase eine besondere Art von<br />
Kosten, die offenbar maßgebend dafür waren, welcher Koordinationsme-<br />
chanismus - Markt oder Hierarchie - bevorzugt wird. Unternehmen bilden<br />
sich nur dort, wo diese Kosten mit hierarchischen Strukturen niedriger als<br />
am Markt gehalten werden können, während der Markt bevorzugt wird,<br />
wenn diese Kosten nicht anfallen oder zumin<strong>des</strong>t niedrig sind. 1960 veröf-<br />
fentlicht Coase einen Aufsatz, in dem er diese Kosten eher beiläufig als<br />
transaction-costs bezeichnete und seine Untersuchungen auf die Frage<br />
ausdehnte, welche Mechanismen zu einem optimalen Funktionieren <strong>des</strong><br />
Marktes führen 36 . Wiederum waren es die Transaktionskosten, die nach<br />
dem posthum als Coase-Theorem benannten Modell für das Funktionieren<br />
<strong>des</strong> Marktes verantwortlich sein sollten.<br />
2. Bedeutung der Transaktionskosten<br />
Was sind Transaktionskosten? In unserer arbeitsteiligen Welt müssen die<br />
Güter zum Herstellen von Produkten ausgetauscht werden. Je arbeitsteili-<br />
ger und ausdifferenzierter die Wirtschaft gestaltet ist, <strong>des</strong>to mehr Verände-<br />
rungen von Verfügungsrechten, also Transaktionen, sind erforderlich.<br />
<strong>Die</strong>se Veränderungen von Verfügungsrechten sind nicht kostenlos. <strong>Die</strong><br />
dabei anfallenden Kosten, die Transaktionskosten, unterscheiden sich von<br />
34 Ronald Harry Coase war u.a. ab 1964 <strong>Prof</strong>essor für Law and Economics an der University of<br />
Chicago. Er erhielt 1991 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.<br />
35 Ronald H. Coase, The Nature of the Firm, Economica 1937, S. 386 – 405.<br />
36 Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics 1960, S. 1 ff.
- 14 -<br />
den reinen Herstellungskosten eines Gutes. Beide Kosten sind Grundlage<br />
der Preisermittlung aller Güter, also von Produkten oder Leistungen. Zu<br />
den Transaktionskosten zählen bei Verträgen die Kosten der Informati-<br />
onsbeschaffung (z.B. über den Transaktionsgegenstand, den Transakti-<br />
onspartner, die Transaktionsbedingungen usw.), die Anbahnungskosten<br />
(z.B. die vorbereitende Kontaktaufnahme), der Verhandlung, der Ver-<br />
tragsgestaltung, aber auch der Abwicklung (z.B. Transport oder Grund-<br />
bucheintragungen), der Kontrolle von Erfüllungs- und Nebenleistungs-<br />
pflichten und Kosten einer Anpassung bei veränderten Bedingungen,<br />
somit unter verschiedenen Aspekten auch die <strong>Notar</strong>kosten.<br />
Allgemeiner werden als Transaktionskosten die Kosten der Betreibung<br />
eines Wirtschaftssystems, die Kosten der Nutzung <strong>des</strong> Marktes beschrie-<br />
ben, die in modernen Marktwirtschaften auf 70-80 % <strong>des</strong> Nettosozialpro-<br />
duktes geschätzt werden. Würden diese Kosten nicht anfallen, so könnten<br />
nach dem Coase-Theorem private Verhandlungen zu einer invarianten<br />
und effizienten Allokation volkswirtschaftlicher Ressourcen führen. Ver-<br />
ständlicher gesagt: Der Markt selbst könnte eine optimale Verteilung aller<br />
Güter herbeiführen, wenn die Transaktionen kostenfrei – nur gegen Aus-<br />
tausch von Leistung und Gegenleistung – erfolgen könnten.<br />
Darüber hinaus basiert auf dieser Theorie, die Internalisierung sozialer<br />
Zusatzkosten und –nutzen, die durch externe Effekte verursacht werden.<br />
Unter externen Effekten werden die unkompensierten Auswirkungen<br />
<strong>ökonomische</strong>r Entscheidungen auf unbeteiligte <strong>Dr</strong>itte verstanden, wie z.B.<br />
die Umweltverschmutzung (z.B. Verschmutzung von Luft, Kontaminierun-<br />
gen von Grund und Boden und/oder Wasser) durch bestimmte Arten der<br />
Produktion. Das sich darin manifestierende Marktversagen soll durch<br />
staatliche Interventionen (also mit den Mitteln <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>) nach ökonomi-<br />
schen Effizienzkriterien korrigiert werden.<br />
3. Schlussfolgerungen dieser Theorie<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> leitet aus dem Coase-Theorem die<br />
Forderung ab, das Recht nach den Gesetzen <strong>des</strong> Marktes neu zu gestal-
- 15 -<br />
ten. Zum einem soll das Recht einen Markt für <strong>Rechts</strong>positionen zulassen.<br />
Außerdem soll das Recht den Austausch von Waren und Leistungen am<br />
Markt erleichtern und Transaktionskosten möglichst niedrig halten (es wird<br />
von den Vertretern der inzwischen fortentwickelten Transaktionskosten-<br />
theorie eingeräumt, dass Transaktionskosten nicht vollständig vermieden<br />
werden können). Versagt der Markt, weil zu hohe Transaktionskosten ihn<br />
behindern, soll das Recht interventionistisch mit marktkonformen, ver-<br />
tragsanalogen Lösungen eingreifen. Zielrichtung der <strong>ökonomische</strong>n Ana-<br />
lyse <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> ist demnach die Konstruktion eines Sozialsystems, das<br />
private Vorteile und persönliche Egoismen mit Hilfe <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> so steuert,<br />
dass die Summe aller Egoismen dem öffentlichen Interesse dienen.<br />
<strong>Die</strong>se Forderungen verdeutlichen, dass die Transaktionskostenökonomik<br />
nicht von einer beabsichtigten Dominanz der Ökonomie über das Recht<br />
geleitet wird. Das Coase-Theorem legt vielmehr das mikroökonomisch-<br />
theoretische Fundament einer interdependenten Wirtschafts- und <strong>Rechts</strong>-<br />
ordnung 37 .<br />
<strong>Die</strong> Wiederzusammenführung von Wirtschafts- und <strong>Rechts</strong>wissenschaften<br />
entspricht einer Forderung <strong>des</strong> Nobelpreisträgers für Ökonomie Friedrich<br />
August von Hayek 38 , der die scharfe Trennung beider Wissenschaftsbe-<br />
reiche als Fehlentwicklung bezeichnet hat 39 .<br />
Juristen könnten die Frage aufwerfen, warum <strong>Rechts</strong>fragen auf Transakti-<br />
onen reduziert werden. <strong>Die</strong> Frage ist so zu beantworten: Unter Transakti-<br />
37 Kirchner, Christian, Über das Verhältnis der <strong>Rechts</strong>wissenschaft zur Nationalökonomie. <strong>Die</strong> neue<br />
Institutionenökonomie und die <strong>Rechts</strong>wissenschaft, Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, 1988,<br />
S. 192 ff.; ders. Law and Economics. New Approaches in Interdisciplinary Cooperation Universitas,<br />
1988, S. 223 ff.<br />
38 Friedrich August von Hayek, ein Vertreter <strong>des</strong> Neoliberalismus, war als Volkswirtschaftler und<br />
Sozialphilosoph von 1931 – 1950 <strong>Prof</strong>essor an der London School of Economics, von 1950 – 1962<br />
an der Universität Chikago und von 1962 – 1968 an der Universität Freiburg. 1974 erhielt er den<br />
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.<br />
39 Friedrich August von Hayek, Recht, Gesetz und Freiheit, Eine Neufassung der liberalen Grund-<br />
sätze der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie, Tübingen (2003), S. 6: „Nirgends tritt der<br />
verderbliche Einfluß der Teilung in Spezialgebiete deutlicher zutage, als in den zwei ältesten dieser<br />
Disziplinen, der Ökonomie und dem Recht“.
- 16 -<br />
onen verstehen Ökonomen jede Art von Veränderungen der Verfügungs-,<br />
Verwertungs- und Nutzungsrechte zwischen den Teilnehmern am Wirt-<br />
schafts- und <strong>Rechts</strong>verkehr. Nur Veränderungen von Handlungsrechten<br />
werden einer rechtlichen Kontrolle unterzogen, auch Transaktionen von<br />
Humankapital, z.B. durch Eheschließungen oder Scheidungen. Auch<br />
Straftaten führen zu (meistens unfreiwilligen) Transaktionen, also zu<br />
<strong>ökonomische</strong>n Veränderungen, was bei Eigentums- und Vermögensdelik-<br />
ten sofort einleuchtet, aber auch bei Straftaten gegen das Leben oder die<br />
körperliche Unversehrtheit zutrifft, da sie offenkundig zu Veränderungen<br />
<strong>des</strong> Humankapitals führen. Wenn sich in unserer Welt nichts verändern<br />
würde, alles statisch bliebe, bräuchten wir kein Recht.<br />
Mit den dinglichen Rechten (Eigentum, Besitz usw.) kennen die Juristen<br />
scheinbar statische Beziehungen zwischen Mensch und Sache. Der<br />
Ökonom hingegen betrachtet dingliche Rechte als interpersonelle Bezie-<br />
hungen aller Beteiligten und würde das Eigentum als Ausschluss der<br />
Handlungsrechte anderer beschreiben. <strong>Die</strong>se unterschiedliche Betrach-<br />
tungsweise beruht allein auf juristischer Konstruktion und Abstraktion: Der<br />
Jurist muss das rechtliche Band zwischen Person und Sache abstrakt<br />
konstruieren, weil sich die <strong>Rechts</strong>beziehungen einer einzelnen Person zu<br />
allen anderen, mehr als 6,6 Milliarden Individuen zuzüglich ungezählter<br />
Verbände, mit interpersonellen Ansprüchen nicht darstellen lassen. <strong>Die</strong><br />
juristische Fiktion eines Ban<strong>des</strong> zwischen Person und Sache kann einem<br />
<strong>ökonomische</strong>n Transaktionsmodell <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> nicht entgegenstehen.<br />
V. Weltweite Einflüsse der Transaktionskostentheorie<br />
Dass die Transaktionskostentheorie weltweit die <strong>Rechts</strong>ordnungen beein-<br />
flusst, ist leicht zu belegen.
- 17 -<br />
<strong>Die</strong> Internationale Union <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>iats als Weltorganisation der <strong>Notar</strong>e 40<br />
beobachtet und vergleicht in ihren Arbeitsgruppen seit Jahrzehnten welt-<br />
weit die Entwicklungen <strong>des</strong> Privatrechts und aller <strong>Rechts</strong>gebiete, die in<br />
das Privatrecht unmittelbar hineinwirken. In verschiedenen Arbeitsgruppen<br />
der U.I.N.L. ist festgestellt worden, dass in allen Ländern mit offenen<br />
Gesellschaftssystemen eine Entwicklung zur Ökonomisierung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
stattfindet 41 .<br />
Im Normsetzungsprogramm der Europäischen Union lassen sich ökono-<br />
mische Zielvorstellungen mit hoher Priorität nachweisen, weil die histo-<br />
risch vorbildlose Umgestaltung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>raums der Europäischen Union<br />
von dem Ziel der Verwirklichung eines einheitlichen europäischen Bin-<br />
nenmarktes geleitet wird 42 . Daher lässt sich auch an den Programmen der<br />
Organe der europäischen Union nachweisen, dass diese das europäische<br />
Recht nach den Zielvorstellungen <strong>ökonomische</strong>r Effizienz neu zu ordnen<br />
versuchen 43 .<br />
Als konkretes Beispiel für die praktische Anwendung der Transaktionskos-<br />
tentheorie mit globalen Wirkungen können die Doing Business Berichte<br />
der Weltbank dienen 44 . In diesen Berichten bewertet die Weltbank jeweils<br />
nationale <strong>Rechts</strong>ordnungen und erstellt Ranking Listen. Maßstab dieser<br />
Rankings ist das Transaktionskostenmodell. Als wissenschaftliche Me-<br />
40 In der U.I.N.L., <strong>des</strong> weltweiten Verban<strong>des</strong> der <strong>Notar</strong>iate, sind derzeit die Vertreter aus 76<br />
Nationen aller Kontinente (ausgenommen Australien) organisiert, u.a. z.B. China, Japan, Russland,<br />
alle Länder Europas mit in den europäischen Traditionen historisch entwickelten Zivilrechtssyste-<br />
men, alle Länder Lateinamerikas und auch einige muslimische sowie zahlreiche afrikanische<br />
Staaten.<br />
41 Wolfgang <strong>Baumann</strong>, Globalisierung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> als Herausforderung für internationale <strong>Notar</strong>or-<br />
ganisationen, RNotZ 2000, 1 ff.<br />
42 <strong>Die</strong> Generaldirektion Binnenmarkt und <strong>Die</strong>nstleistungen der Europäischen Kommission hat sich<br />
zur Hauptaufgabe gesetzt, den freien Verkehr von Personen, Waren, <strong>Die</strong>nstleistungen und Kapital<br />
innerhalb der Europäischen Union durch Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes sicherzustel-<br />
len.<br />
43 <strong>Die</strong> Europäische Kommission setzt sich ausdrücklich dafür ein, dass Folgenabschätzungen und<br />
Evaluierungen bei Gesetzgebungen sowie Effizienzkontrollen bei der Gesetzesausführung durch<br />
Verwaltungen eine größere Rolle spielen.<br />
44 <strong>Die</strong> verschiedenen Jahresberichte sind im www unter „doingbusiness.org“ abrufbar.
- 18 -<br />
thoden bedient sich die Weltbank sowohl der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> als auch der <strong>Rechts</strong>vergleichung. In ökonomisch zentralen Berei-<br />
chen, etwa im Gesellschaftsrecht oder im wichtigen Segment <strong>des</strong> Grund-<br />
stücksrechts wurden <strong>Analyse</strong>n durchgeführt, indem die Transaktionskos-<br />
ten in verschiedenen Ländern ermittelt wurden. <strong>Die</strong> Ergebnisse dieser<br />
Berichte sind zur wissenschaftlichen Auswertung unbrauchbar, weil die<br />
den Fragebögen der Weltbank zugrunde gelegten <strong>Analyse</strong>methoden<br />
wissenschaftlichen Standards nicht genügen: z.B. werden nicht alle<br />
Transaktionskosten ermittelt, das ermittelte Zahlen- und Datenmaterial<br />
stammt oft aus unzuverlässigen Quellen, beruht auf unvollständigen oder<br />
fehlerhaften Angaben oder ist falsch ausgewertet. Gleichwohl ist der<br />
wissenschaftliche Ansatz der Weltbankberichte von Interesse, weniger<br />
hingegen die auf fehlerhaften Erhebungen beruhenden Ergebnisse. <strong>Die</strong><br />
Untersuchungen müssen trotz ihrer teilweise dilettantischen Fehler wis-<br />
senschaftlich beobachtet und begleitet werden, weil der Wirkungsgrad<br />
dieser Studien hoch ist: Fördermittel an Länder der <strong>Dr</strong>itten Welt werden<br />
nach den Ergebnissen dieser Studien verteilt.<br />
<strong>Die</strong> mit US-amerikanischen Geldmitteln nach US-amerikanischen <strong>Rechts</strong>-<br />
vorverständnis erstellten Berichte der Weltbank mit Sitz in Washington<br />
schlagen den <strong>Dr</strong>itte-Welt Ländern tendenziell vor, ihre <strong>Rechts</strong>ordnungen<br />
nach dem Vorbild <strong>des</strong> US-amerikanischen <strong>Rechts</strong>systems zu gestalten.<br />
Wie amerikanische Investoren mit falschen Ergebnissen der Doing Busi-<br />
ness-Berichte von Investitionen im Ausland abgeschreckt werden, soll mit<br />
einem Beispiel zum deutschen Recht erhellt werden: Nach den Erhebun-<br />
gen der Doing Business Berichte ist die wirtschaftliche Nutzung von<br />
Grundbesitz in Deutschland für einen Käufer erst nach sehr langer Dauer<br />
möglich. Deshalb nimmt das deutsche Grundstücksrecht im Ranking der<br />
Weltbank nur Platz 42 ein. Richtig ist: Der Vollzug von Grundstücksüber-<br />
tragungen bis zur Eigentumsumschreibung hat im Erhebungszeitraum vor<br />
allem in den neuen Bun<strong>des</strong>ländern – der ehemaligen DDR – wegen der<br />
aufgrund der im nachwirkenden sozialistischen System ungeordneten<br />
Eigentumsverhältnisse oft bis zu einem Jahr, in Einzelfällen länger gedau-<br />
ert. Wer das deutsche <strong>Rechts</strong>system nicht kennt oder das Abstraktions-
- 19 -<br />
prinzip nicht verstanden hat - wie die Verfasser <strong>des</strong> Weltbankberichts - der<br />
muss falsche Schlussfolgerungen ziehen. Das außerhalb Deutschlands<br />
nur in einigen anderen Ländern 45 bekannte, auf dem deutsch-rechtlichen<br />
Abstraktionsprinzip 46 beruhende Anwartschaftsrecht verschafft dem Käu-<br />
fer schon wenige Tage nach Vertragsschluss - mit Eintragung einer Auf-<br />
lassungsvormerkung im Grundbuch - eine rechtlich unentziehbar gesicher-<br />
te Position. <strong>Die</strong>ses Anwartschaftsrecht kann auch die wirtschaftlichen<br />
Verfügungs-, Verwertungs- und Nutzungsrechte sichern, also property-<br />
rights. Unter Zugrundelegung <strong>des</strong> Anwartschaftsrechts ist das deutsche<br />
Grundstücksrecht für Investoren eines der schnellsten und sichersten der<br />
Welt 47 .<br />
Aus den methodischen Fehlern (keine umfassende Würdigung <strong>des</strong> jewei-<br />
ligen <strong>Rechts</strong>systems) der Doing Business-Berichte können wir lernen,<br />
dass rechtsvergleichende <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong>n die Beteiligung sach-<br />
kundiger Juristen und Oekonomen aller betroffenen Länder an den Er-<br />
hebungs- und Auswertungsverfahren erfordern, damit wissenschaftlich<br />
verwertbare Ergebnisse erzielt werden. Da die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> weltweit an Einfluss gewinnt, werden sich die europäischen Öko-<br />
nomen und Juristen mit der Methode der <strong>ökonomische</strong>n Effizienzanalyse<br />
auf breiterer Basis als bisher auseinandersetzen müssen.<br />
45 Z. B. Japan, Estland.<br />
46 Hegel, der das Abstraktionsprinzip noch nicht kannte, aber wie v. Savigny (der das Abstraktions-<br />
prinzip entwickelte) in Berlin lehrte, schrieb (Grundlinien der Philosophie <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, Zusatz zu §<br />
78), dass man zwischen dem „gemeinsamen Willen“ als Übereinkunft und dem „besonderen“ als<br />
Leistung unterscheiden müsse. „In der Natur <strong>des</strong> Vertrages liegt es, dass sowohl der gemeinsame<br />
als auch der besondere Wille sich äußere, weil hier Wille sich zu Willen verhält. <strong>Die</strong> Übereinkunft,<br />
die sich in einem Zeichen manifestiert, und die Leistung liegen daher bei gebildeten Völkern<br />
auseinander, während sie bei rohen zusammenfallen können“. Mit seinen – inzwischen – antiquier-<br />
ten Formulierungen will Hegel die Überlegenheit solcher <strong>Rechts</strong>systeme begründen, die zwischen<br />
Verpflichtungs- und Verfügungsgesellschaften trennen, was auf ein Abstraktionsprinzip hinausläuft.<br />
47 Vgl. hierzu auch die unveröffentlichte Studie von Peter L. Murray (Braucher Visiting <strong>Prof</strong>essor of<br />
Law from Practise, Harvard Law School), Real Estate Conveyancing in 5 European Member States:<br />
A Comparative Study. <strong>Die</strong> Studie kann beim Büro der U.I.N.L. in Rom elektronisch angefordert<br />
werden. Murray hat in seiner Studie die Transaktionskosten der Länder Deutschland, Estland,<br />
Frankreich, Großbritannien, Schweden und USA (Maine und New York) ermittelt, mit dem Ergeb-<br />
nis, dass die Länder mit Grundbuch- und <strong>Notar</strong>iatssystem deutlich kostengünstiger abschneiden.
- 20 -<br />
VI. Berechtigter Ansatz der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
In der heutigen <strong>Rechts</strong>wirklichkeit mit zunehmender Technisierung der<br />
Lebenssachverhalte werden die inhaltlichen Gestaltungsoptionen <strong>des</strong><br />
Gesetzgebers durch die <strong>ökonomische</strong> Leistungsfähigkeit der staatlichen<br />
Institutionen begrenzt. Ineffiziente Gesetze belasten jeden Staat und jede<br />
Gesellschaft ökonomisch und damit alle Staatsbürger.<br />
In den politischen Systemen <strong>des</strong> realen Sozialismus – von denen der<br />
östliche Teil Deutschlands ebenso wie Tschechien (als wirtschaftlich<br />
stärkerer Teil der ehemaligen Tschechoslowakei) betroffen waren – nahm<br />
der Staat dem Bürger die Freiheit wirtschaftlicher Betätigung. <strong>Die</strong> Zentrali-<br />
sierung <strong>ökonomische</strong>r Entscheidungsprozesse in staatlichen Unterneh-<br />
men führte zu einer schwerfälligen Bürokratie der Wirtschaftsabläufe.<br />
Auch Staaten mit offenen Gesellschaftssystemen – aber dichter sozial-<br />
staatlicher Regulierung und hohen Transferleistungen in ihren Sozialsys-<br />
temen – tendieren zu einer aufgeblähten Bürokratie. Kleine Wirtschafts-<br />
einheiten sind flexibler und können auf Veränderungen schneller reagie-<br />
ren. In diesem höheren Anpassungsvermögen liegt die Überlegenheit<br />
freier Wirtschaftssysteme gegenüber zentral gesteuerten Wirtschaftssys-<br />
temen begründet. <strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> hat die gesetzli-<br />
chen Rahmenbedingungen hoher <strong>ökonomische</strong>r Flexibilität zu fördern.<br />
<strong>Die</strong> Ausblendung „<strong>ökonomische</strong>r Effizienz“ aus der <strong>Rechts</strong>etzung und<br />
<strong>Rechts</strong>findung, fördert<br />
- eine wachsende Bürokratisierung,<br />
- eine Verrechtlichung unserer Gesellschaft, mit einer selbst für<br />
<strong>Rechts</strong>wissenschaftler nicht mehr überschaubaren Zahl von Normen,<br />
- ein Ansteigen der Staatsquote mit höchster Staatsverschuldung auf<br />
allen staatlichen Ebenen,<br />
- die gesetzliche Gewährung von staatlichen Transferleistungen, wie<br />
offenen oder verdeckten Subventionen, die volkswirtschaftlich nutz-<br />
los sind und den Wohlstand unserer Gesellschaft senken.<br />
Ökonomische Effizienz <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> ist daher in einem modernen Staats-<br />
wesen zur Deregulierung, zum Bürokratieabbau, zum Schutz künftiger
- 21 -<br />
Generationen und zum wirtschaftlichen Handeln geboten. Wir müssen – in<br />
den Grenzen <strong>des</strong> Möglichen – durch empirische Erhebungen ökonomi-<br />
sche Wirkungskontrollen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> durchführen.<br />
VII. Kritik an <strong>ökonomische</strong>r Effizienzjurisprudenz<br />
Trotz <strong>des</strong> möglichen Erkenntnisgewinns 48 bestehen Bedenken gegen eine<br />
schrankenlose Ausrichtung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> an einer Methodik, die allein<br />
<strong>ökonomische</strong> Effizienz zum Maßstab hat. Der radikalen Position Posners,<br />
wonach das Recht an <strong>ökonomische</strong>r Effizienz auszurichten sei, ist – trotz<br />
grundsätzlicher Anerkennung dieser Theorie als tragfähiger Baustein zum<br />
Errichten eines Gebäu<strong>des</strong> der Gerechtigkeit für alle Menschen – deutlich<br />
zu widersprechen.<br />
Ein vermeintlich gewichtiger juristischer Einwand gegen Posners Theorie<br />
richtet sich gegen die praktische Brauchbarkeit <strong>des</strong> Modells auf <strong>Rechts</strong>-<br />
anwendungsebene. Es wird behauptet, die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> sei für Exekutive und Judikative aufgrund der notwendigen Nut-<br />
zen-Kosten-Erhebungen zu aufwändig. Nur als Gesetzgebungsmodell sei<br />
sie brauchbar. Dem kann nicht gefolgt werden. Würde der Gesetzgeber<br />
ein <strong>ökonomische</strong>s Effizienzprogramm durchgängig auflegen, dann hätten<br />
auch Exekutive und Judikative diesem normativen Programm zu folgen<br />
und hätten in der konkreten <strong>Rechts</strong>anwendung jede Abweichung vom<br />
gesetzlichen Nutzen-Kosten Optimum zu berücksichtigen.<br />
Auch die Eingrenzung der <strong>ökonomische</strong>n Effizienz auf einzelne <strong>Rechts</strong>ge-<br />
biete ist im Ansatz verfehlt, weil die Einheit der <strong>Rechts</strong>ordnung verbietet,<br />
Teilsachgebiete <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, etwa das Wirtschaftsrecht, nach ökonomi-<br />
scher Effizienz und andere, etwa das Familienrecht, nach herkömmlichen<br />
Gerechtigkeitskriterien zu werten.<br />
Doch schon die Grundannahme der Theorie, empirische Ermittlungen <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> seien möglich, muss bezweifelt werden. Jede Auswahl der zur<br />
Ermittlung von Effizienz oder Ineffizienz zugrundegelegten Fakten setzt<br />
48 Vgl. oben VI.
- 22 -<br />
bei Kosten- und Nutzenermittlungen und -vergleichen zwingend Wertent-<br />
scheidungen voraus. <strong>Die</strong> Frage, was als nützlich für unsere Gesellschaft<br />
oder für den Einzelnen anzusehen ist, wird immer von einer wertenden<br />
Antwort abhängen. Somit würde die Wertungsebene bei praktischer<br />
Anwendung der Theorie Posners durch Nutzen-Kosten Vergleiche nur<br />
verlagert, empirisch nicht überprüfbare Wertungen, die sich in einem<br />
durch vereinbarte Verfahren 49 offenen Diskurs festgelegten Werten orien-<br />
tieren, können aber nicht entfallen.<br />
Weitere Kritik an einzelnen Voraussetzungen dieser Theorie lässt sich<br />
vortragen, etwa an dem der Realität nur unvollkommen entsprechenden<br />
Modell <strong>des</strong> homo oeconomicus (weil kein menschliches Individuum nur<br />
ökonomisch rational handelt und kein Mensch in jeder Situation nur nach<br />
<strong>ökonomische</strong>n Optimierungskriterien entscheiden will) 50 , an der Unschärfe<br />
der Transaktionskosten (z.B. lässt sich nur mit wertenden Entscheidungen<br />
die Frage beantworten, wie weit zeitlich zurück die vorbereitenden Such-<br />
und Informationskosten – auch ergebnislose und fehlgeschlagene – in die<br />
Transaktionskosten einzubeziehen sind), an den fehlenden eindeutigen<br />
Abgrenzungskriterien zu anderen Kosten, insbesondere zu Produktions-<br />
kosten und an der fehlenden Berücksichtigung staatlicher Interventions-<br />
kosten. Problematisch ist weiterhin die Definition <strong>des</strong> gesellschaftlichen<br />
Nutzens, der Kosten/Nutzen - <strong>Analyse</strong>n als Maßstab zugrunde zu legen<br />
ist. Wer will sich die Urteilsfähigkeit anmaßen, was für die gesellschaftliche<br />
Entwicklung aller Menschen nachhaltig – also für die in ihrer Komplexität<br />
nach Zielvorstellungen nicht definierbare Zukunftsgestaltung – nützlich<br />
ist? Feststellbar – aus historischer Erfahrung – ist allenfalls, was künftig<br />
schädlich ist. Zudem kann ein Nutzen kurzfristig niedrig, nachhaltig hoch<br />
sein bzw. umgekehrt, was für die Folgenbewertung gravierender wäre. Ein<br />
hoher nachhaltiger Nutzen könnte auch hohe (Transaktions-) Kosten<br />
rechtfertigen. <strong>Die</strong> Nachhaltigkeit <strong>des</strong> Nutzens wird in einer sich aufgrund<br />
unterschiedlichster Einflussfaktoren ständig verändernden Welt ebenso<br />
49 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, Beiträge zur Diskurstheorie <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> und <strong>des</strong><br />
demokratischen <strong>Rechts</strong>staats, 1992, S. 151 ff., S. 272 ff.<br />
50 <strong>Die</strong>s belegen auch aktuellste Cerebralforschungen, vgl. Fliessbach/Weber/Trautner/Dohmen<br />
/Sunde/ Eiger/Falk, Social Comparison Affects Reward-Related Brain Activity in the Human Ventral<br />
Stratium, Science, Vol. 318, 23. 11. 2007, S. 1305 – 1308.
- 23 -<br />
wenig wissenschaftlich feststellbar sein – sie bliebe spekulativ – wie die<br />
Prognose künftiger Kosten, die mit den Mitteln <strong>des</strong> Marktes gesenkt<br />
würden.<br />
Weitere Zweifel bestehen an der Reduzierung auf ein mikro<strong>ökonomische</strong>s<br />
Grundmodell, da volkswirtschaftliche Entwicklungen von – bisher noch<br />
nicht hinreichend erklärten – makro<strong>ökonomische</strong>n Strömungen ebenfalls<br />
beeinflusst werden.<br />
Ein rein mikro<strong>ökonomische</strong>s Modell müsste interpersonelle Nutzenverglei-<br />
che berücksichtigen, die allgemein anwendbaren gesetzlichen Regeln<br />
nicht zugrunde gelegt werden können 51 , denn Gesetze müssen abstrakt<br />
gefasst sein und können nicht den individuellen Bedürfnissen je<strong>des</strong> ein-<br />
zelnen Menschen Rechnung tragen (Beispiel: Alle Menschen haben –<br />
aufgrund ihrer genetischen oder durch pädagogische und umweltbedingte<br />
Wirkungen assimilierten Prädispositionen ihre individuell bestimmten<br />
menschlichen Grundbedürfnisse. <strong>Die</strong> Definition eines allgemeinen<br />
menschlichen Nutzens kann in mikro<strong>ökonomische</strong>n Modellen niemals<br />
möglich sein).<br />
Ob allein der Markt eine effiziente Allokation aller Güter herbeiführen kann<br />
- wie das Coase-Theorem im unrealistischen Idealfall <strong>des</strong> Wegfalls aller<br />
Transaktionskosten annimmt -, muss angesichts stabiler Eigentums- und<br />
Besitzverhältnisse bezweifelt werden, weil diese Stabilität selbst bei Weg-<br />
fall aller Transaktionskosten eine Veränderung der optimalen Güteralloka-<br />
tion verhindern würde (Beispiel: Wer ein Grundstück in Top-Lage besitzt,<br />
wird es in den meisten Fällen selbst bei Wegfall sämtlicher Transaktions-<br />
kosten nicht einer besseren <strong>ökonomische</strong>n Nutzung, z.B. als Hotel, zufüh-<br />
ren sondern behalten wollen).<br />
51 Man kann den durch abstrakte <strong>Rechts</strong>normen angestrebten Nutzen der Allgemeinheit nicht nach<br />
den jeweils individuell unterschiedlichen Bedürfnissen der Einzelnen definieren. Hier versagt der<br />
methodische Individualismus bzw. sind seine Aussagemöglichkeiten eingeschränkt.
- 24 -<br />
Berechtigt ist der Einwand, Posners <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> gerate in<br />
Konflikt mit jeder verfassungsrechtlich garantierten Freiheitsordnung, weil<br />
das Primat der <strong>ökonomische</strong>n Effizienz Handlungsfreiheiten einschrän-<br />
ke 52 . Posner selbst begegnet diesem Einwand mit dem Hinweis, dass alle<br />
menschlichen Freiheiten vom Wohlstand abhängig seien, der nach seinem<br />
Modell gefördert werde. Qualitativ mache es für die Betroffenen keinen<br />
Unterschied, ob der Staat Freiheiten einschränke oder ob der fehlende<br />
Wohlstand einer Gesellschaft ihren Mitgliedern den Zugang zu Informatio-<br />
nen, Kultur, Bewegungs- oder Reisefreiheiten hindere 53 . An anderer Stelle<br />
bliebe zu prüfen, ob in den Freiheitsthesen Posners ein berechtigter Kern<br />
liegt, weil der vollständige Verzicht auf <strong>ökonomische</strong> Effizienzjurisprudenz<br />
mit einem Freiheitsverlust durch staatliche Beschränkungen erkauft wird,<br />
wie dies durch die Wirtschaftssysteme sozialistischer Länder möglicher-<br />
weise belegt werden könnte. Den Mitgliedern oder (besser) Bürgern von<br />
Gesellschaften mit großem Wohlstand müsste der Zugang zu Informatio-<br />
nen, Kultur, Bewegungs- und Reisefreiheiten eben nicht nach dem<br />
Gleichheitsmaßstab sozialer Gerechtigkeitskriterien sondern nach ökono-<br />
mischen Effizienzkriterien gewährleistet sein und weitergehend eine<br />
Partizipation an solchen Freiheiten nach sozialen Gerechtigkeitskriterien<br />
auch denjenigen geboten werden, die unverschuldet daran gehindert sind,<br />
einen angemessenen ökonomisch effizienten Beitrag zur Wohlstandsför-<br />
derung der Gesellschaft zu leisten.<br />
Das Primat <strong>ökonomische</strong>r Effizienz wirkt - trotz <strong>des</strong> Wohlstandsarguments<br />
Posners - freiheitsbeschränkend, weil den Gesetzesadressaten die Frei-<br />
heit genommen wird, ökonomisch ineffizient handeln. Unsere gesellschaft-<br />
liche Entwicklung benötigt auch ökonomisch ineffizient Handelnde, die<br />
nach dem Lebensentwurf eines Mozart oder van Gogh handeln und damit<br />
der menschlichen Gesellschaft – von den meisten ihrer Mitglieder als<br />
höherrangig angesehene – Werte schaffen, die mit <strong>ökonomische</strong>r Effizienz<br />
52 Karl-Heinz Fezer, Aspekte einer <strong>Rechts</strong>kritik an der economic analysis of law und am property<br />
rights approach, Juristenzeitung 1986, S. 817 ff.<br />
53 Posner, Utilitarism, Economics and Legal Theorie, Journal of Legal Studies, 1979, S. 103 ff.<br />
(140).
- 25 -<br />
– jedenfalls sofort – nicht messbar sind 54 . Vergleichbares gilt für jegliche<br />
Art von Grundlagenforschung, für die ein <strong>ökonomische</strong>s Effizienzprinzip<br />
mangels zeitnah messbarer wirtschaftlicher Erfolgsauswertung als Maß-<br />
stab untauglich ist. <strong>Die</strong> Freiheit individueller Lebensplanung unter Einbe-<br />
zug sogar ökonomisch unsinnigen Handelns sollte jedem gewährt werden,<br />
solange er nicht - etwa durch gezielte Inanspruchnahme von ökonomi-<br />
schen Transferleistungen (= staatliche Sozialhilfen) - die Handlungsfreihei-<br />
ten anderer beschränkt.<br />
Eine weitere Schwäche <strong>des</strong> Modells Posners zeigt sich bei der Frage, ob<br />
je<strong>des</strong> Mitglied unserer Gesellschaft, also auch Alte, Kranke, Schwache<br />
und unverschuldet in Notlagen Geratende an einer Wohlstandsmehrung<br />
der allgemeinen Volkswirtschaft partizipieren können. <strong>Die</strong> gesamtwirt-<br />
schaftliche Wohlfahrtsmehrung kann – aufgrund zufallsbedingter Faktoren<br />
– sehr ungleich verteilt sein. <strong>Die</strong> aus ungleichmäßiger Einkommens-<br />
und/oder Vermögensverteilung von manchen Gruppen gezogene Forde-<br />
rung nach gleichen Verteilungen (ohne Rücksicht auf die Beiträge <strong>des</strong><br />
Einzelnen zum Wohl der Gesellschaft) ist jedoch verfehlt, weil eine verste-<br />
tigte gleichmäßige Verteilung von Einkommen und Vermögen (ohne<br />
leistungsorientierte Bewertungs- und Verteilungskriterien) den meisten<br />
Mitgliedern unserer Gesellschaft den Anreiz zur Leistung nimmt und zur<br />
Nichtleistung herausfordert.<br />
Jeder hier gedanklich nur angerissene Einwand verdient vertiefende<br />
Untersuchungen und würde – bei Bestätigung der angesprochenen Zwei-<br />
fel – zu Beschränkungen <strong>des</strong> Anwendungsbereichs der <strong>ökonomische</strong>n<br />
<strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> führen.<br />
54 Dass Ergebnisse menschlicher Leistungen frei von <strong>ökonomische</strong>r Bewertung von großen Teilen<br />
unserer Gesellschaft nach offenbar anderen Kriterien geschätzt werden, belegt, dass nicht alle<br />
Wertungen ökonomisch erfolgen können und dürfen. Dem widerspricht nicht, dass trotz der<br />
lebzeitigen wirtschaftlichen Misserfolge der oben genannten Künstler deren Werke heute ökono-<br />
misch mit größtem Erfolg vermarktet werden. <strong>Die</strong> Nachhaltigkeit ihres künstlerischen Schaffens<br />
bestätigt unsere Beobachtung, dass wir den langfristigen Nutzen für unsere Gesellschaft nicht<br />
immer sofort erkennen, sondern nur suchen können. Schon wegen unserer begrenzten Erkenntnis-<br />
fähigkeit sind die Ergebnisse empirischer Nutzen-Kosten <strong>Analyse</strong>n derzeit kein tragfähiger Parame-<br />
ter zur Ermittlung von Gerechtigkeit. <strong>Die</strong> Schranken unserer Erkenntnismöglichkeiten erfordern den<br />
offenen Werte-Diskurs und müssen die Werte in demokratisch legitimierten und zudem in rationali-<br />
sierten Verfahren offen festlegen, schon um unsere gemeinsame Verantwortung für die getroffenen<br />
Entscheidungen gegenüber nachfolgenden Generationen legitimieren zu können.
- 26 -<br />
VIII. Schranken <strong>ökonomische</strong>r Effizienzjurisprudenz<br />
1. Zwei gebotene Beschränkungen<br />
Im folgenden werden der <strong>ökonomische</strong>n Effizienzjurisprudenz zwei zwin-<br />
gend gebotene Schranken gesetzt. <strong>Die</strong> erste ist als methodische Verfah-<br />
rensschranke gestaltet, die zweite als inhaltliche. <strong>Die</strong> erste Schranke wird<br />
– als Antithese zur methodisch anders abgeleiteten <strong>ökonomische</strong>n Analy-<br />
se <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> – auf die rechtsphilosophischen Grundlagen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
gestützt. <strong>Die</strong> zweite Schranke wird aus der Erkenntnis gewonnen, dass<br />
das Transaktionsmodell von Posner und Coase zu eng ist, um unsere<br />
Lebenswirklichkeit widerzuspiegeln.<br />
2. Konsequentialistische versus deontologische Ethik<br />
In den bisherigen kritischen Würdigungen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong> wird nicht weiterführend untersucht, dass diese Theorie ihre Ent-<br />
stehung zwei Impulsen verdankt:<br />
- unmittelbar dem <strong>ökonomische</strong>n Theorieansatz <strong>des</strong> Coase-Theorems,<br />
- mittelbar einem historischen Entwicklungspfad <strong>des</strong> US-<br />
amerikanischen <strong>Rechts</strong>.<br />
Warum entscheiden US-amerikanische Gerichte im Unterschied zu Ge-<br />
richten Europas auf der Grundlage <strong>ökonomische</strong>r Empirik? <strong>Die</strong> Antwort<br />
erschließt aus dem angelsächsischen Utilitarismus 55 .<br />
Angelsächsische <strong>Rechts</strong>ordnungen sind ausgerichtet an einer Erfolgsethik<br />
oder konsequentialistischen Ethik, wie sie von David Hume und später<br />
den Utilitaristen Jeremy Bentham 56 und John Stuart Mill 57 vertreten wor-<br />
55 Norbert Horn, Zur <strong>ökonomische</strong>n Rationalität <strong>des</strong> Privatrechts. - <strong>Die</strong> privatrechtstheoretische<br />
Verwertbarkeit der ‹Economic Analysis of Law›, Archiv für die civilistische Praxis 1976, S. 307 ff.<br />
56 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, hrsg. von J. H.<br />
Burns / H. L. A. Hart, Oxford (1996).<br />
57 John Stuart Mill, Utilitarianism, in: Alan Ryan (Hrsg.): Utilitarianism and other Essays, London<br />
(1987), S. 272 ff.
- 27 -<br />
den ist. Im Gegensatz dazu sind die kontinentaleuropäischen <strong>Rechts</strong>sys-<br />
teme von einer deontologischen Ethik, einer Pflichten- oder Gesinnungs-<br />
ethik geprägt, die in Deutschland namentlich von Leibniz und Kant fort-<br />
entwickelt wurde.<br />
Zu den Wurzeln dieser beiden Theorienstränge führen zweieinhalb tausend<br />
Jahre gewachsener europäischer <strong>Rechts</strong>philosophie zurück. In Platons<br />
Gorgias 58 , wird – eingekleidet in einen Dialog über den Wert der Rhetorik –<br />
die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt. Der Sophist Kallikles propagiert<br />
eine Gerechtigkeitstheorie vom Recht <strong>des</strong> Stärkeren und nennt als höchste<br />
Glückseligkeit die schrankenlose Erfüllung aller lustbringenden Begierden.<br />
Sokrates hingegen überzeugt seinen Dialogpartner, einen Schüler <strong>des</strong><br />
Kallikles, in einem gemeinsamen Dialogergebnis, es sei für Menschen<br />
besser, selbst Unrecht zu erleiden als anderen Unrecht zu tun. <strong>Die</strong>se nicht<br />
als Erfüllung lustbringender Begierden von Masochisten zu missverstehen-<br />
de Aussage, legt Platon ein halbes Jahrtausend vor der schriftlichen Fixie-<br />
rung der christlichen Evangelien als Grundlage einer auf humanistischen<br />
Werten beruhenden Pflichten- oder Gesinnungsethik nieder.<br />
„Besser selbst Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun“ beschreibt ein<br />
ethisches Programm, welches weit über Toleranz hinausgehend den<br />
Respekt vor der Menschenwürde <strong>des</strong> anderen einfordert. Eine sachorien-<br />
tierte Erfolgsethik - selbst ein Regelutilitarismus 59 - kann die Menschen-<br />
würde als Wert nicht hinreichend respektieren, weshalb sich die Konsens-<br />
theorie <strong>des</strong> Amerikaners John Rawls 60 , als einflussreichste Gerechtigkeits-<br />
58 Mein Doktorvater <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Gerhard Otte, Ordinarius an der Universität Bielefeld hat mit uns,<br />
seinen Schülern, in rechtswissenschaftlichen Seminaren u.a. Platons Gorgias (mit rechtsphiloso-<br />
phischer Betrachtung) gelesen. Gorgias wurde in meiner Schulzeit an humanistischen Gymnasien<br />
noch als Pflichtlektüre aus dem Urtext übersetzt. Zu Univ.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Gerhard Otte, Universität<br />
Bielefeld, vgl., Festschrift für Gerhard Otte zum 70. Geburtstag, Gesetz-Recht-<strong>Rechts</strong>geschichte,<br />
München, 2005<br />
59 <strong>Die</strong> Verdienste <strong>des</strong> Utilitarismus als Basistheorem eines Wohlfahrtsstaates dürfen – trotz der hier<br />
ausgesprochenen Kritik nicht verkannt werden. Der Regelutilitarismus versucht die schon von John<br />
Stuart Mill erkannten Schwächen <strong>des</strong> Utilitarismus durch Einbeziehung werteorientierter Entschei-<br />
dungen zu mildern.<br />
60 John Rawls, Philosophie-<strong>Prof</strong>essor an der Harvard University hat in kritischer Auseinanderset-<br />
zung mit dem Utilitarismus ein vertragstheoretisch begründetes Modell der Gerechtigkeit – beru-
- 28 -<br />
theorie <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts, von einer konsequentialistischen Ethik<br />
distanziert 61 .<br />
<strong>Die</strong> Unterschiede beider Ethiksysteme sollen an zwei in der deutschen<br />
Öffentlichkeit in jüngerer Zeit kontrovers diskutierten Beispielen verdeut-<br />
licht werden:<br />
Im Mordfall <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> Jakob von Metzler wurde ein hochrangiger Poli-<br />
zeibeamter wegen Nötigung von einem deutschen Gericht rechtskräftig 62<br />
verurteilt, weil er im polizeilichen Ermittlungsverfahren dem später gestän-<br />
digen Mörder körperlichen Zwang angedroht hatte, um noch das Leben<br />
<strong>des</strong> an einem unbekannten Ort versteckten Kin<strong>des</strong> zu retten. Der Polizei-<br />
beamte hatte sich erfolgsethisch orientiert wie einst jener Richter, der<br />
einer Mutter gedroht hatte, ihr Kind in der Mitte durchzuschneiden 63 . <strong>Die</strong><br />
mit der Tötung ihres Kin<strong>des</strong> genötigte Mutter hat gegen den Richter nie<br />
Strafanzeige erstattet, sondern, nachdem ihr das Kind zur Gänze zuge-<br />
hend auf dem Wert der Fairness – und philosophisch u.a. fußend auf den Theorien von Aristoteles<br />
und Kant entwickelt.<br />
61 John Rawls, A theory of Justice, 1. Auflage, Oxford (1971); 2. Auflage Cambridge (1999).<br />
62 <strong>Die</strong> Verurteilung erfolgte in 1. Instanz. Der Verurteilte verzichtete wegen der ihn belastenden<br />
Aufmerksamkeit der öffentlichen Medien auf <strong>Rechts</strong>mittel.<br />
63 Altes Testament, 1. Buch Könige, Kapitel 3, Verse 16 – 28: Zwei Frauen behaupteten die Mutter<br />
<strong>des</strong>selben Säuglings zu sein. Da sich – damals – die Mutterschaft nicht zweifelsfrei aufklären ließ,<br />
kündigte Salomon als Richter an, jeder Frau die Hälfte <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> zuzusprechen. <strong>Die</strong> eine Frau<br />
brach in Tränen aus und verzichtete auf die ihr überlassene Kin<strong>des</strong>hälfte, während die andere das<br />
Urteil akzeptierte. Der verzichtenden Frau sprach Salomon das Kind zu und gilt seit dieser Andro-<br />
hung einer Kin<strong>des</strong>tötung als Inbegriff eines klugen Richters aufgrund seiner salomonischen<br />
Weisheit. Der deutsche Polizeibeamte wurde von einer Richterin als Straftäter verurteilt. <strong>Die</strong> im<br />
solomonischen Urteil wie im Urteil über den Frankfurter Polizeibeamten sich offenbarende Konflikt-<br />
situation beruht scheinbar zunächst weniger auf konkurrierenden Werten bei Entscheidungen als<br />
auf der Frage welche Tatsachenermittlungen angestellt werden dürfen. Hier konkretisiert sich diese<br />
Frage aber dahingehend, inwieweit zur effizienten Ermittlung die Würde <strong>des</strong> potentiellen Täters<br />
(oder eigentlich noch schlimmer in der Bibel-Stelle: <strong>des</strong> unbeteiligten Babys) eingegriffen werden<br />
darf. Würden wir heute von salomonischer Weisheit sprechen, wenn beide Frauen borniert auf<br />
einer Halbierung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> bestanden hätten und diese vollzogen worden wäre? Eigentlich gab<br />
es keine salomonische Weisheit. Weise war die Frau, die nachgegeben und damit die Tötung <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> vermieden hatte. Welche Prinzipien zur Ermittlung der Wahrheit soll gelten? Nach unserer<br />
<strong>Rechts</strong>ordnung dürfen – aufgrund historischer Erfahrung – die Mittel der Inquisition nicht mehr<br />
eingesetzt werden.
- 29 -<br />
sprochen war, die – seitdem sprichwörtliche – salomonische Weisheit<br />
gepriesen. Der Polizeibeamte, dem kein Erfolg beschieden war 64 , hätte<br />
aus anderen Gründen freigesprochen werden können und auch sollen 65 .<br />
Auf der Grundlage einer Pflichtenethik sind aber – was einem Freispruch<br />
von strafbaren Handlungen <strong>des</strong> Nötigenden im Konflikt der Werte nicht<br />
entgegensteht, sondern ihn aufgrund <strong>des</strong> Wertekonflikts rechtfertigt – die<br />
Androhung von Folter oder die Nötigung eines Menschen (sogar eines<br />
Mörders) zu verurteilen.<br />
Im zweiten Fall hatte der Deutsche Bun<strong>des</strong>tag im Jahr 2005 im Luftsicher-<br />
heitsgesetz den Abschuss von mit Passagieren besetzten Flugzeugen der<br />
Zivilluftfahrt zur Abwehr drohender Gefahren zugelassen 66 . Das Bun<strong>des</strong>-<br />
verfassungsgericht hat im Februar 2006 - durch Kant‘sche Pflichtenethik<br />
geprägt - ein solches modernes Menschenopfer zur Abwendung größerer<br />
Gefahren für verfassungswidrig erklärt 67 .<br />
<strong>Die</strong> Abgeordneten <strong>des</strong> deutschen Bun<strong>des</strong>tages hatten - vermutlich ohne<br />
sich <strong>des</strong>sen bewusst zu sein - im Sinne <strong>ökonomische</strong>r Effizienz erfolgs-<br />
ethisch wie Posner entschieden. Posner würde ein oder mehrere Men-<br />
schenleben sogar zur Rettung von Schafen opfern 68 , falls die Zahl der<br />
Schafe nach Nutzen/Kosten-Relationen – also nach den Maßstäben<br />
<strong>ökonomische</strong>r Effizienz – hoch genug ist. Kein Kritiker darf Posner voreilig<br />
64 <strong>Die</strong> <strong>Dr</strong>ohung war erfolglos, weil Jakob von Metzler zum Zeitpunkt der Gewaltandrohung schon<br />
tot war. <strong>Die</strong> <strong>Dr</strong>ohung führte nur zum schnellen Auffinden seiner Leiche.<br />
65 Ein Freispruch <strong>des</strong> Polizeibeamten wäre darauf zu stützen gewesen, dass die Menschenwürde<br />
<strong>des</strong> Opfers in gleicher Weise wie die <strong>des</strong> Täters schützenswert ist und der Staatsbeamte – wegen<br />
der Nichtauflösbarkeit dieses Wertekonfliktes in der dilemmatischen Situation zumin<strong>des</strong>t schuldlos,<br />
wahrscheinlich sogar mit Rechtfertigungsgrund (einem Notstand oder einer Notwehr vergleichbar)<br />
handelte.<br />
66 Luftsicherheitsgesetz vom 11. Januar 2005 (Bun<strong>des</strong>gesetzblatt Teil I S. 78). § 14 Abs. 3 LuftSiG<br />
ermächtigte die Streitkräfte, Luftfahrtzeuge, die als Tatwaffe gegen das Leben von Menschen<br />
eingesetzt werden sollen, abzuschießen.<br />
67 BVerfG-Urteil v. 15. Februar 2006: Das Gesetz mißachte die betroffenen Flugpassagiere als<br />
Subjekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten und mache sie zum bloßen Objekt staatlicher<br />
Entscheidungen.<br />
68 Posner, Utilitarism, Economics and Legal Theorie, Journal of Legal Studies, 1979, S. 103 ff.<br />
(133).
- 30 -<br />
<strong>des</strong> menschenverachtenden Zynismus zeihen oder seine Auffassung als<br />
abwegig zurückweisen, solange die auf humanistischen Werten beruhen-<br />
den <strong>Rechts</strong>ordnungen nicht verhindern, dass ökonomisch ineffiziente<br />
<strong>Rechts</strong>- und Wirtschaftssysteme täglich Menschen auf dieser Erde wegen<br />
Wasser- oder Nahrungsmangels verdursten oder verhungern lassen.<br />
Aus der dunkelsten Epoche deutscher Geschichte, in der menschliches<br />
Leben anderer von allen Trägern und Sympathisanten <strong>des</strong> deutschen<br />
Nationalsozialismus missachtet wurde, lastet auf dem deutschen Volk eine<br />
historisch begründete Verantwortung im Umgang mit dem Schutz und der<br />
Anerkennung menschlicher Würde. <strong>Die</strong>se historische Verantwortung darf<br />
künftigen deutschen Generationen nicht wie ein Kainsmal eingebrannt<br />
werden; sie muss aber von künftigen deutschen Generationen als morali-<br />
sche Verpflichtung übernommen werden, aus der deutschen Geschichte<br />
dauerhaft zu lernen und dem Gelernten entsprechend zu handeln. <strong>Die</strong><br />
Väter der deutschen Verfassung haben in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG<br />
(Grundgesetz) die historisch bedingte deutsche Verantwortung 69 mit der<br />
Unantastbarkeit der Menschenwürde verankert. Der Wertevorrang der<br />
Menschenwürde durchzieht alle gesetzlichen Bestimmungen der deut-<br />
schen <strong>Rechts</strong>ordnung 70 und ist auch Grundlage einer auf humanistischen<br />
Werten beruhenden Wirtschaftsethik. Methodisch richtungsweisend hat<br />
(u.a.) die Münsteraner Schule um Westermann, Brox und Reinicke 71 den<br />
deutschen Erfahrungen für die praktische <strong>Rechts</strong>anwendung ein rechts-<br />
theoretisches Fundament mit der Wertungsjurisprudenz unterlegt. Das<br />
Primat einer <strong>ökonomische</strong>n Kaldor/Hicks- Effizienzjurisprudenz würde, um<br />
den Wohlstand aller zu mehren, nicht nur z.B. Euthanasie und Eugenik<br />
69 Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz lautet: „<strong>Die</strong> Würde <strong>des</strong> Menschen ist unantastbar“.<br />
70 <strong>Die</strong>ser Wertevorrang dürfte in allen <strong>Rechts</strong>ordnungen, zumin<strong>des</strong>t allen aufgeklärten <strong>Rechts</strong>sys-<br />
temen gelten, die auf einem deontologischen Ethiksystem beruhen.<br />
71 <strong>Die</strong> Universitäts-<strong>Prof</strong>essoren Harry Westermann (der während <strong>des</strong> 2. Weltkrieges als Hochschul-<br />
lehrer an der in Deutschland hoch angesehenen (weil ältesten deutschsprachigen) Universität Prag<br />
mit Distanz zum Nationalsozialismus <strong>Rechts</strong>wissenschaften gelehrt hat, Hans Brox (ein ehemaliger<br />
Richter <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>verfassungsgerichts) und <strong>Die</strong>trich Reinicke (ein ehemaliger Richter <strong>des</strong><br />
Bun<strong>des</strong>gerichtshofs) waren bis in die 70er Jahre als Hochschullehrer an der Universität Münster<br />
(Westfalen) tätig und hatten sowohl mit ihrer Lehre als auch mit ihren wissenschaftlichen Publikati-<br />
onen maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Privatrechtsentwicklung.
- 31 -<br />
rechtfertigen, sondern müsste nach Nutzen/Kosten-Relationen die Ver-<br />
nichtung ökonomisch nicht wertschöpfenden, also nutzlosen Lebens<br />
gesetzlich fordern.<br />
Vor wenigen Monaten behandelte der Deutsche Bun<strong>des</strong>tag das Thema<br />
der Sterbehilfe und <strong>des</strong> menschenwürdigen To<strong>des</strong>. Zu welchen Ergebnis-<br />
sen wir kämen, wenn wir über den Tod eines Menschen allein nach den<br />
Kriterien <strong>ökonomische</strong>r Effizienz zu entscheiden hätten, mag jeder Leser<br />
selbst zu Ende denken.<br />
Ein handlungsbestimmender Wertevorrang <strong>ökonomische</strong>r Effizienz im<br />
Recht (gemessen am Gesamtwohlstand) ist – zumin<strong>des</strong>t aus deutscher<br />
Sicht – spätestens seit den historischen Erfahrungen <strong>des</strong> Nationalsozia-<br />
lismus abzulehnen.<br />
Als Ergebnis <strong>des</strong> philosophischen und methodischen Haupteinwan<strong>des</strong> ist<br />
festzuhalten:<br />
Eine empirisch-<strong>ökonomische</strong> Folgenanalyse hat alle <strong>Rechts</strong>regeln - auch<br />
solche, die auf der Grundlage deontologischer Ethiksysteme erstellt wur-<br />
den - zu untersuchen. <strong>Die</strong> aus einer solchen <strong>Analyse</strong> gezogenen prognos-<br />
tischen Folgerungen, können insbesondere über <strong>Rechts</strong>wirkungskontrol-<br />
len zur <strong>ökonomische</strong>n Effizienzsteigerung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> beitragen. Sie<br />
haben als <strong>Rechts</strong>folgenbewertung aber normativen, nicht empirischen<br />
Charakter, weil die normativen Ergebnisse in Gesetzgebung, Verwaltung<br />
und <strong>Rechts</strong>prechung nicht ohne wertende Entscheidungen festgelegt<br />
werden können. Ein Primat <strong>ökonomische</strong>r Effizienz darf bei der Suche<br />
nach dem richtigen Recht nicht anerkannt werden. Ökonomische Effizienz<br />
ist nur – ein bisher unterschätzter – wichtiger Topos, um das richtige<br />
Recht zu finden. Da alle <strong>Rechts</strong>akte nur die Zukunft gestalten können 72 ,<br />
sind <strong>ökonomische</strong> <strong>Rechts</strong>folgenanalysen und -bewertungen in jede<br />
72 <strong>Die</strong> Vergangenheit ist rechtlicher Regelung nicht zugänglich, weil sie abgeschlossen ist und – mit<br />
unseren gegenwärtigen Mitteln – nicht revidiert werden kann. <strong>Die</strong> Gegenwart – als Hinübergleiten<br />
von der Vergangenheit in die Zukunft, kann nicht gestaltet werden. Im Bewusstsein der Gegenwart<br />
vorgenommene Handlungen oder Unterlassungen können nur Weichen für die Zukunft stellen, aber<br />
weder die Vergangenheit verändern noch in die flüchtige Gegenwart eingreifen. Daher können<br />
rechtliche Normen durch alle das Recht verwirklichenden staatlichen Organe nur die Zukunft<br />
gestalten.
- 32 -<br />
<strong>Rechts</strong>entscheidung unter Beachtung humanistischer Grundwerte einzu-<br />
beziehen.<br />
3. <strong>Die</strong> Beschränktheit <strong>des</strong> Transaktionsmodells Posners<br />
Der zweite Haupteinwand richtet sich gegen die methodische und inhaltli-<br />
che Enge der Transaktionskostentheorie, wie sie von Posner vertreten<br />
wird.<br />
a) <strong>Die</strong> Transaktionsmodelle Williamsons<br />
Als Begründer der Transaktionskostenökonomik - aufbauend auf dem<br />
Coase-Theorem - gilt Oliver Williamson 73 . Williamson hat die von Coase<br />
begründete Dichotomie von Markt und Unternehmung aufgehoben und die<br />
Liste der Beherrschungsformen von Transaktionen nach ihrer Spezifität<br />
und ihrer Häufigkeit auf vier Transaktionsgrundmuster erweitert:<br />
Neben der hierarchischen Abwicklung von Transaktionen in Unternehmen,<br />
wenn spezifische und regelmäßige Faktoreinsätze verlangt werden, und<br />
dem Marktmodell, wenn keine oder nur geringe spezifische Investitionen<br />
erforderlich sind, beschreibt Williamson zwei weitere Transaktionsmuster:<br />
Werden Transaktionen nur mit gewisser Regelmäßigkeit abgewickelt und<br />
verlangen sie einen mittelhohen spezifischen Faktoreinsatz, so erfolgt die<br />
rechtliche Abwicklung über bilaterale Verträge, die den Parteien aufgrund<br />
der im Privatrecht verankerten Privatautonomie die Auslegung, Anpas-<br />
sung und Konfliktklärung überlassen.<br />
<strong>Die</strong> von Williamson benannte vierte Beherrschungsform von Transaktio-<br />
nen ist für <strong>Notar</strong>e von Interesse, bisher in der <strong>Rechts</strong>wissenschaft aber<br />
nicht wahrgenommen worden, weil die US-amerikanische <strong>Rechts</strong>ordnung<br />
aufgrund kultureller Entwicklungen <strong>Notar</strong>funktionen nur in wenigen Bun-<br />
<strong>des</strong>staaten und selbst dort nur rudimentär 74 kennt. Bei einmaligen oder<br />
73 Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York (1975); <strong>Die</strong><br />
Ökonomischen Institutionen <strong>des</strong> Kapitalismus (1990).<br />
74 Z.B. im Staat Louisiana, der Mitglied der U.I.N.L. ist. Fast alle anderen Staaten der USA kennen<br />
nur notarielle Beglaubigungsfunktionen durch einen notary public, der in vielen Staaten keine<br />
juristische Ausbildung absolviert hat und in fast allen Staaten seine Funktionen ohne gesetzlich
- 33 -<br />
fallweisen Transaktionen unter Einbeziehung spezifischer Faktoreinsätze<br />
kann die durch Wettbewerb gewährleistete Kontrolle <strong>des</strong> Marktes gegen<br />
opportunistische Übervorteilungen nicht wirken. Deshalb hält die Transak-<br />
tionskostenökonomik nach dem Theorieansatz von Williamson es für<br />
geboten, eine unparteiische dritte Instanz in die Transaktion einzuschal-<br />
ten, gewissermaßen als Korrektiv für die nicht wirkenden Kräfte <strong>des</strong> Mark-<br />
tes. Als unparteiliche dritte Instanz sollen unabhängige Sachverständige<br />
oder professionelle Berater die Transaktion begleiten. <strong>Die</strong>se sollen Streit-<br />
fragen schlichten und einvernehmlich beilegen. Persönliches Erfordernis<br />
soll ihre entsprechende Kompetenz und Reputation sein. Williamson hält<br />
die dreiseitige Beherrschungsstruktur aufgrund von zu erwartenden Ein-<br />
sparungen anderweitiger Transaktions- und Opportunitätskosten für<br />
legitimiert 75 .<br />
b) Aussagegrenzen der Theorie Williamsons<br />
Obwohl der erweiterte Theorieansatz Williamsons, <strong>des</strong> Begründers der<br />
Transaktionskostenökonomie, eine vertiefende Untersuchung verdient, ist<br />
auch seine Theorie wegen ihrer alleinigen Klassifizierung nach Spezifität<br />
und Häufigkeit nicht vollständig überzeugend. So ist in der modernen<br />
Transaktionstheorie inzwischen unstreitig, dass die Transaktionskosten<br />
auch durch die Transaktionsdimensionen sowie die Unsicherheit und<br />
strategische Bedeutung einer Transaktion beeinflusst werden. Allein diese<br />
sehr unterschiedlichen – empirisch schwer messbaren – Faktoren mit<br />
verschiedener Gewichtung wecken weitere Zweifel, ob die Transaktions-<br />
kostentheorie als hinreichend präzise Grundlage normativer Wertungen<br />
tauglich ist.<br />
aa) Kooperation statt Wettbewerb<br />
Darüber hinaus bestehen grundlegende Zweifel, ob die <strong>Rechts</strong>ordnung<br />
allein auf ein Marktmodell gestützt werden kann. Beispiele <strong>des</strong> australi-<br />
auferlegte juristische Beratungs- und Belehrungspflichten ausübt. Ein solcher „notary public“ nimmt<br />
keine staatlichen <strong>Rechts</strong>pflegeaufgaben wahr und hat mit einem öffentlichen Amtsträger <strong>Notar</strong><br />
keine Gemeinsamkeiten.<br />
75 Dazu auch Schüller, Alfred / Krüsselberg, Hans-Günter, Grundbegriffe zur Ordnungstheorie und<br />
Politischen Ökonomik, 6. Auflage, Marburg (2004).
- 34 -<br />
schen, zuletzt in Oxford lehrenden Philosophen John Leslie Mackie 76 , die<br />
sich mit den logischen Modellen der Spieltheorie 77 bestätigen lassen,<br />
weisen auf Fallkonstellationen hin, in denen möglicherweise außerhalb<br />
marktwirtschaftlicher Systeme durch Kooperation höhere Gewinne als<br />
durch Wettbewerb am Markt erzielt werden könnten, die Handlungspräfe-<br />
renzen <strong>des</strong> homo oeconomicus einer solchen Kooperation aber entgegen-<br />
stehen. Ließen sich Mackies Beispiele als Modelle verifizieren, dann<br />
würde eine <strong>Rechts</strong>ordnung, welche allein auf Wettbewerb und Markt setzt,<br />
die Kooperation außerhalb <strong>des</strong> Marktes auch dort behindern, wo diese<br />
gesellschaftlich nützlich wäre 78 .<br />
Zu suchen wäre also nach einem wissenschaftlichen Beleg für die aus<br />
praktischer Erfahrung entwickelte Beobachtung, dass der Transaktions-<br />
kostenökonomik ein unvollständiges Modell zur Erfassung gesellschaftli-<br />
cher Transaktionen zugrunde liegt und sie <strong>des</strong>halb ungeeignet ist, die<br />
Grundlagen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> umfassend zu bestimmen.<br />
bb) Andere Transaktionsmuster<br />
Im sozialwissenschaftlichen Diskurs sind die Forschungsarbeiten <strong>des</strong><br />
amerikanischen Anthropologen Alan Fiske 79 weltweit anerkannt. Fiske 80<br />
hat vier Transaktionsgrundmuster ermittelt:<br />
- das Market Pricing. <strong>Die</strong>ses liegt dem Modell <strong>des</strong> Marktes zugrunde,<br />
auf den das Transaktionskostenmodell anwendbar ist.<br />
76 John L. Mackie, Ethik, - <strong>Die</strong> Erfindung <strong>des</strong> moralisch Richtigen und Falschen, aus dem Engli-<br />
schen übers. Von Rudolf Finters, Ditzingen (1981); Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwarts-<br />
philosophie Band IV, 1. Aufl., 1989, S. 261 ff.<br />
77 <strong>Die</strong> Spieltheorie (game theorie) als Teilgebiet der Mathematik analysiert mit Hilfe von strategi-<br />
schen Interaktionsmodellen in verschiedenen Interessenkonstellationen die rationalen Entschei-<br />
dungen von Individuen in Konfliktsituationen.<br />
78 Dazu auch Axelrod, Robert, The Evolution of Cooperation, New York (1984); ders., <strong>Die</strong> Evolution<br />
der Kooperation, 5. Auflage, München (2000);<br />
79 Alan Page Fiske ist <strong>Prof</strong>essor für Anthropologie an der University of California, Los Angeles.<br />
80 Fiske, Alan P., The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social<br />
relations. Psychological Review, 99 (1992), S. 689 ff.
- 35 -<br />
Daneben beschreibt Fiske aber drei weitere Transaktionsmuster, für die<br />
das Transaktionskostenmodell <strong>des</strong> Marktes nicht gilt:<br />
- das Authority Ranking, einer Verteilung von Ressourcen nach dem<br />
Autoritätsrang auch außerhalb von Unternehmen;<br />
- das Equality Matching, eine Gleichheitsabstimmung, die Leistungen<br />
und Gegenleistungen in ein adäquates Austauschverhältnis stellt, ein<br />
Transaktionsmuster, das Nichtökonomen oft vorschwebt, wenn sie<br />
sich den Markt erklären;<br />
- das Communal Sharing, bei dem alle Mitglieder der Gemeinschaft<br />
gleichrangigen Zugriff zu Ressourcen haben, ohne dass Gegenleis-<br />
tungen zu erbringen sind.<br />
Je<strong>des</strong> dieser vier in allen Gesellschaften nachweisbaren Transaktions-<br />
muster hat seine eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen. Je nach der Situa-<br />
tion wird die eine oder andere – aus dem jeweiligen Transaktionsmuster<br />
folgende – Gerechtigkeitsvorstellung (teilweise kulturell unterschiedlich)<br />
als geboten gewertet.<br />
Fiskes Ergebnisse belegen, dass unsere <strong>Rechts</strong>ordnung nicht allein auf<br />
eine am Marktmodell orientierte <strong>ökonomische</strong> Effizienz gestützt werden<br />
darf, weil das Recht auch andere von der Gesellschaft in bestimmten<br />
Situationen als gleichwertig angesehene Transaktionsmuster zu bewerten<br />
und regeln hat.<br />
cc) Ergebnisse historischer Ökonomievergleiche<br />
Das hier gefundene Ergebnis fehlender Konvergenz wird bestätigt durch<br />
neuere <strong>ökonomische</strong> Forschungen. Der Wirtschaftshistoriker Douglass<br />
North, der für seine Arbeiten in der Institutionenökonomie und der Trans-<br />
aktionskostenökonomik ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet<br />
wurde, hat seine älteren Modelle modifiziert. North 81 hatte bei Untersu-<br />
81 Douglass C. North, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge (1991); ders.,<br />
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge (1990); ders.,
- 36 -<br />
chungen historischer Wirtschaftsentwicklungen im Widerspruch zu den<br />
Grundannahmen der Transaktionskostenökonomik ermittelt, dass trotz<br />
identischer <strong>Rechts</strong>- und Institutionensysteme in manchen Staaten die<br />
Wirtschaftsentwicklungen höchst unterschiedlich verlaufen waren. <strong>Die</strong>s<br />
galt für Kolonialstaaten nach ihrer Unabhängigkeit ebenso wie für einige<br />
lateinamerikanische Länder, die nach ihrer Selbständigkeit das US-<br />
amerikanische System übernommen hatten. Aus diesen Abweichungen<br />
zog North die Schlussfolgerung, dass nicht allein die Gesetze und die<br />
handlungsbestimmenden Institutionen für die Wirtschaftsentwicklung<br />
maßgebend sind, sondern auch die kulturell gewachsenen informalen<br />
Regeln, also moralische Normen und Sitten, als weitere Einflussgrößen<br />
auf die <strong>ökonomische</strong> Entwicklung einwirken.<br />
Wirtschafts- und <strong>Rechts</strong>entwicklung sind nach seiner Erkenntnis kulturell<br />
pfadabhängig. Ihre wechselseitige Interpendenz ist keine ausschließliche,<br />
weil auch andere Kulturfaktoren in die <strong>Rechts</strong>- und Wirtschaftsordnung<br />
einwirken.<br />
dd) Kulturelle Pfadabhängigkeit der Wirtschaftsentwicklung<br />
Bernhard Losch 82 , hat mit seinem vor einem Jahr erschienenen Werk<br />
„Kulturfaktor Recht“ 83 eine Arbeit vorgelegt, in der die unterschiedlichen<br />
kulturellen Wirkkräfte auf die Evolution <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> im Ansatz aufgezeigt<br />
werden. Noch können wir die kulturellen Wirkkräfte auf <strong>Rechts</strong>ent-<br />
wicklungen nicht exakt beschreiben. Einige wirksame Faktoren lassen sich<br />
aber benennen, wie z.B. die Familienstrukturen einer Gesellschaft, die<br />
Emanzipationsprozesse begünstigen können und zur Finanzierung qualifi-<br />
zierter Ausbildung auch Töchtern die Chancen zur Berufsfähigkeit und<br />
nicht nur reproduktionsbestimmten Ehefähigkeit einräumen. <strong>Die</strong> von Losch<br />
analysierten heterogenen Kulturfaktoren wirken auf die Entwicklung unse-<br />
rer <strong>Rechts</strong>ordnung – teilweise wesentlich tiefer, als das hier gewählte<br />
einzelne Beispiel (Familienstrukturen) – ein.<br />
Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen (1992); ders., Theorie <strong>des</strong><br />
institutionellen Wandels, Tübingen (1988).<br />
82 Univ.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. phil. <strong>Dr</strong>. jur. Bernhard Losch war bis zur Emeritierung im Frühjahr 2007 Lehrstuhl-<br />
inhaber für Öffentliches Recht an der Bergischen Universität Wuppertal.<br />
83 Bernhard Losch, Kulturfaktor Recht Grundwerte-Leitbilder-Normen, Köln (2006).
- 37 -<br />
Eine Definition <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> als historisch gewachsener Kulturfaktor verbie-<br />
tet seine ausschließliche Reduzierung auf <strong>ökonomische</strong> Effizienz. Zum<br />
umfassenden Verständnis unseres <strong>Rechts</strong> können wir auf den von Jürgen<br />
Habermas beschriebenen offenen Wertediskurs 84 nicht verzichten, weil die<br />
permanente Veränderung aller kulturellen Bereiche unserer Gesellschaft<br />
den Wandel unserer Werte bedingt und das Recht vor neue Herausforde-<br />
rungen stellt. In diesen Wertediskurs sind rechtshistorische Erfahrungen<br />
als handlungsbestimmende Wertorientierungen einzubeziehen.<br />
Evolution <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> – wie die Evolution <strong>ökonomische</strong>r Abläufe – bedeu-<br />
tet nicht, dass gesellschaftliche (rechtliche und/oder <strong>ökonomische</strong>) Ent-<br />
wicklungen in festgelegten Pfaden verlaufen müssen. In der Historie aller<br />
staatlichen <strong>Rechts</strong>ordnungen sind Umbrüche erfolgt – in der Sprache der<br />
Biologie „Mutationen“ –, die nicht „pfadabhängig“ verliefen, wie der freiwil-<br />
lig vollzogene Wechsel der zentralistischen Planwirtschaften der ge-<br />
schlossenen Gesellschaftssysteme <strong>des</strong> Sozialismus zu offenen Ge-<br />
sellschaftssystemen mit einer – regelmäßig sozialgedämpften – Marktwirt-<br />
schaft belegen. <strong>Die</strong> Evolution <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> kann auch durch Entwicklungs-<br />
sprünge beeinflusst werden, wobei bislang ein wissenschaftlich hinrei-<br />
chend überzeugen<strong>des</strong> Erklärungsmodell für „Mutationen“ von <strong>Rechts</strong>sys-<br />
temen, die etwa aus revolutionären Umbrüchen von Gesellschaftssyste-<br />
men hervorgehen können, fehlt 85 .<br />
Künftigen <strong>ökonomische</strong>n wissenschaftlichen Untersuchungen ist die<br />
Aufgabe zuzuweisen, den beschränkten Aussagewert der Transaktions-<br />
kostenökonomik empirisch zu belegen. Juristen und Sozialwissenschaftler<br />
haben nachzuweisen, dass alle normativen Wertungen – ob auf morali-<br />
scher, ethischer oder rechtlicher Ebene – weit über <strong>ökonomische</strong> Zielset-<br />
zungen hinausgehen und solchen Zielen sogar – aufgrund nichtökonomi-<br />
scher Werte – Grenzen zu setzen haben.<br />
84 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 2. Aufl., Frankfurt a. Main (1992); ders., Moralbe-<br />
wusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a. Main (1983).<br />
85 Als Ansatz vgl. Klaus Lenk, Theorien der Revolution (2. Aufl., 1981).
- 38 -<br />
IX. <strong>Die</strong> Bedeutung der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> für das<br />
<strong>Notar</strong>iat 86<br />
Für den Berufsstand der <strong>Notar</strong>e drängt sich die Frage auf, wie den neuar-<br />
tigen Herausforderungen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> zu<br />
begegnen ist. Trotz der aufgezeigten Einwände gegen einen Absolutheits-<br />
anspruch <strong>ökonomische</strong>r Effizienz – wie ihn Posner fordert – sollte der<br />
Berufsstand der <strong>Notar</strong>e sich nicht generell gegen die Anwendung dieser<br />
Methode wehren. Denn die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> findet ihre<br />
berechtigte Grundlage – wie dargelegt – in der Notwendigkeit, ökonomi-<br />
sche Folgen in juristische Entscheidungen einzubeziehen.<br />
Den <strong>Notar</strong>en kann die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> zum Vorteil<br />
gereichen. Selbst eingefleischte Kritiker <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>iats müssen aufgrund<br />
der objektiv leicht nachweisbaren Zahlen einräumen, dass ein unparteii-<br />
scher <strong>Rechts</strong>berater (<strong>Notar</strong>) weniger Transaktionskosten verursacht als<br />
zwei oder mehr <strong>Rechts</strong>berater (z.B. bei Erbauseinandersetzungen mit<br />
vielen Nachlassbeteiligten kann die Zahl der <strong>Rechts</strong>berater anschwellen,<br />
während ein <strong>Notar</strong> mit seiner über 2000 Jahre alten <strong>Rechts</strong>tradition –<br />
entsprechend dem in Harvard neu erfundenen (!) unparteilichen Mediator<br />
– viele <strong>Rechts</strong>berater mit ihren jeweiligen Transaktionskosten in der vor-<br />
sorgenden <strong>Rechts</strong>pflege wie ein Richter im Vorfeld ersetzt). Dass mehrere<br />
zur Transaktion eingeschaltete <strong>Rechts</strong>anwälte höhere Transaktionskosten<br />
verursachen als ein einzelner <strong>Notar</strong>, bedarf kaum der Belege, weil sogar<br />
die Einschaltung eines einzelnen <strong>Rechts</strong>anwalts (zumin<strong>des</strong>t in Deutsch-<br />
land) für den <strong>Rechts</strong>uchenden höhere Kosten verursacht als die Einschal-<br />
tung eines <strong>Notar</strong>s 87 .<br />
Trotz solcher Evidenz der Kostenersparnis durch <strong>Notar</strong>e wird die ökono-<br />
mische <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> gegenwärtig noch als Angriffsmittel gegen<br />
86 Dazu auch Ugo Mattei, Regole sicure - Analisi Economico - Guiridica Comparata per il <strong>Notar</strong>iato<br />
(2006); Jesus Silva-Herzog Flores, La dimension economica del notariado, Mexico, 2007.<br />
87 In Deutschland ist – bei Zugrundelegung <strong>des</strong>selben Geschäftswertes – sogar die Gebühr, die<br />
von einem einzelnen <strong>Rechts</strong>anwalt beansprucht wird, höher als die Gebühr <strong>des</strong> eingeschalteten<br />
<strong>Notar</strong>s.
- 39 -<br />
den Berufsstand der <strong>Notar</strong>e verwendet. <strong>Die</strong>s beruht auf min<strong>des</strong>tens drei<br />
Ursachen:<br />
1. <strong>Notar</strong>e erheben für die Beurkundung einer Transaktion Gebühren.<br />
<strong>Notar</strong>e werden daher – methodisch vereinfacht – als bloße Transaktions-<br />
kostenverursacher dargestellt, ohne dass die alternativ anfallenden Kos-<br />
ten verglichen werden.<br />
2. Im angelsächsischen <strong>Rechts</strong>kreis, der das wissenschaftliche Schrifttum<br />
zur Transaktionskostenökonomie beherrscht, sind <strong>Notar</strong>e mit staatlichen<br />
Aufgaben nur partiell bekannt. Deshalb scheint die Einschaltung von<br />
<strong>Notar</strong>en überflüssig, weil die <strong>Notar</strong>kosten scheinbar zusätzlich anfallen. In<br />
vielen europäischen Ländern ist eine Entwicklung zu beobachten, in der<br />
die <strong>Rechts</strong>anwälte beim Wettbewerb um Anteile am <strong>Rechts</strong>besorgungs-<br />
markt im Vorfeld <strong>Rechts</strong>beratungsaufgaben in notariellen Tätigkeitsfeldern<br />
übernehmen. Der <strong>Notar</strong>, der am Ende der Beratungskette nur die von den<br />
Anwälten vorbereiteten Verträge vollzieht, erscheint dann überflüssig.<br />
Tatsächlich sind die <strong>Notar</strong>e als hoch qualifizierte Fachjuristen in den ihnen<br />
zugewiesenen juristischen Fachbereichen den meisten <strong>Rechts</strong>anwälten<br />
überlegen.<br />
3. <strong>Die</strong> weit größere Zahl der Anwälte wiegt als Lobby so schwer, dass die<br />
<strong>Notar</strong>e – trotz niedrigerer Transaktionskosten – sich gegen immer wieder<br />
neue Angriffe auf ihren kleinen Berufsstand wehren müssen. Quantität ist<br />
in einer Demokratie zwar ein Kriterium für Entscheidungsfindungen. <strong>Die</strong><br />
größere Quantität der <strong>Rechts</strong>anwälte darf aber nicht als Kriterium gegen<br />
die bessere Qualität notarieller Leistungen gewertet werden.<br />
Welche Herausforderungen stellen sich den <strong>Notar</strong>en mit den Methoden<br />
der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> gewonnenen Erkenntnissen?<br />
Unmittelbare Herausforderungen folgen aus Untersuchungen der Welt-<br />
bank. Nach dem Verständnis der Verfasser der Doing Business Berichte<br />
werden die <strong>Notar</strong>e – als dem US-amerikanischen <strong>Rechts</strong>system weitge-<br />
hend unbekannte Institutionen – zusätzlich in das Transaktionsverfahren<br />
eingeschaltet. Damit verursachen sie scheinbar überflüssige Transakti-<br />
onskosten.
- 40 -<br />
Nicht berücksichtigt werden in den <strong>ökonomische</strong>n Erhebungen der Welt-<br />
bank die Opportunitätskosten 88 , die anfallen könnten und teilweise immer<br />
anfallen würden, wenn der <strong>Notar</strong> an der Transaktion nicht beteiligt wäre.<br />
Darunter würden immer alle Informationsbeschaffungskosten fallen, die<br />
jeder <strong>Rechts</strong>unkundige zur Einholung angemessener <strong>Rechts</strong>beratung<br />
auslöst. Im weiteren Sinne wären als Opportunitätskosten auch die Kosten<br />
späterer möglicher <strong>Rechts</strong>streitigkeiten zu verstehen, die durch eine<br />
sachgerechte Vertragsgestaltung <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s vermieden werden. Derartige<br />
Kosten zu ermitteln, ist außerordentlich schwierig, weil hypothetische<br />
Kausalverläufe zugrunde gelegt werden müssten. Nur eine mikroökonomi-<br />
sche komparative Kostentheorie, die den Transaktionskosten die Oppor-<br />
tunitätskosten gegenüberstellt, kann zuverlässige Kostenergebnisse für<br />
eine <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> liefern. Bezogen auf die Funktio-<br />
nen der <strong>Notar</strong>e wäre die Ermittlung der Opportunitätskosten komplexer als<br />
eine bloße Ermittlung anderweitiger <strong>Rechts</strong>beratungskosten, weil der<br />
<strong>ökonomische</strong> Funktionswert der öffentlichen notariellen Urkunde ermittelt<br />
werden müsste und die Kompensationskosten beim Wegfall der notariel-<br />
len Beurkundung gegenüber zu stellen wären.<br />
Darüber hinaus fehlen in den bisherigen Untersuchungen – nach der<br />
ebenfalls aus der Transaktionskostenökonomik entwickelten Agency-<br />
Theorie – Erhebungen, in welcher Höhe zwingend notwendige Opportuni-<br />
tätskosten <strong>des</strong> principal anfallen, um Informationsasymmetrien auszuglei-<br />
chen, die von einem <strong>Notar</strong> – zu wesentlich niedrigeren Kosten als von<br />
anderen <strong>Rechts</strong>beratern – ausgeglichen werden. Nicht hinreichend unter-<br />
sucht ist mit den Methoden der Agency-Theorie, inwieweit die bei Informa-<br />
tionsasymmetrien notwendig anfallende Opportunitätskosten zur Aufklä-<br />
rung <strong>des</strong> principal durch die Einschaltung <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s gesenkt werden.<br />
Bezogen auf das <strong>Notar</strong>iat, das in die staatliche <strong>Rechts</strong>pflege einbezogen<br />
ist, fehlen bis heute aussagefähige Ermittlungen der Opportunitätskosten,<br />
die anfallen würden, falls die vorsorgende <strong>Rechts</strong>kontrolle und damit auch<br />
die Gewährleistung von <strong>Rechts</strong>sicherheit durch umfassende <strong>Rechts</strong>bera-<br />
tung und <strong>Rechts</strong>betreuung durch den <strong>Notar</strong> entfallen würde. <strong>Die</strong> Einschal-<br />
88 Unter Opportunitätskosten werden in der Ökonomie entgangene Erlöse verstanden, die dadurch<br />
entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten (Opportunitäten) nicht genutzt werden. Mit ihnen<br />
werden also entgangene Alternativen ökonomisch quantifiziert.
- 41 -<br />
tung <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s beseitigt Informationsungleichgewichte durch die gesetz-<br />
lich verankerte Unparteilichkeit und seine gesetzliche Verpflichtung, recht-<br />
lich unerfahrene und ungewandte Beteiligte durch Beratung und Beleh-<br />
rung zu schützen. <strong>Die</strong> Einschaltung <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s verringert damit das Ent-<br />
stehen negativer externer Effekte. <strong>Die</strong> notarielle Urkunde produziert sogar<br />
positive externe Effekte, indem sie die Richtigkeit der zu beurkundenden<br />
Vorgänge durch vollständige Sachaufklärung und Willensermittlung,<br />
rechtliche Aufklärung und Chancengleichheit der Beteiligten gewährleistet.<br />
Sie hat streitvermeidende Wirkung und trägt damit zur Gerichtsentlastung<br />
bei. Der <strong>Notar</strong> verschafft dem Markt <strong>Rechts</strong>sicherheit und fördert das<br />
Vertrauen auf die – in Einzelfällen zum Wohl der betroffenen Menschen<br />
korrekturbedürftigen 89 – Entwicklungen <strong>des</strong> Marktes.<br />
Ein anders aufgebautes <strong>Rechts</strong>system – ohne <strong>Notar</strong>iat – benötigt andere<br />
Institutionen oder muss versuchen, statt mit den Präventionen der vorsor-<br />
genden <strong>Rechts</strong>pflege durch repressive Abschreckungswirkungen mit<br />
Sanktionen <strong>Rechts</strong>sicherheit zu erzeugen. <strong>Die</strong> hierbei anfallenden Oppor-<br />
tunitätskosten wären gleichfalls zu ermitteln und mit den Kosten eines<br />
juristischen Präventionssystems zu vergleichen. In diesem Zusammen-<br />
hang ist es sicher kein Zufall, dass im US-amerikanischen <strong>Rechts</strong>system<br />
seit Jahren Klage darüber geführt wird, dass die <strong>Rechts</strong>anwälte die Wirt-<br />
schaft ausbeuten 90 .<br />
Der Markt kann nur in einem stabilen gesellschaftlichen Systemen funktio-<br />
nieren, in denen die Regeln <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> anerkannt sind und alle Marktteil-<br />
nehmer sich auf die Geltung und Wirksamkeit der <strong>Rechts</strong>regeln verlassen<br />
können. Wirtschaftssysteme mit hoher <strong>Rechts</strong>sicherheit und stabilen<br />
<strong>Rechts</strong>verhältnissen sind ökonomisch effizienter, als solche in denen (z.B.<br />
durch Korruption) das Recht wirkungslos bleibt. Einrichtungen, welche die<br />
<strong>Rechts</strong>sicherheit erhöhen, schaffen damit einen wirtschaftlichen Mehrwert.<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> Effizienz der <strong>Rechts</strong>sicherheit und der dadurch geschaf-<br />
89 Auch zu diesen Korrekturen trägt der <strong>Notar</strong> bei. Dazu unten zu den sozialen Funktionen <strong>des</strong><br />
<strong>Notar</strong>s.<br />
90 Einzelheiten mit Nachweisen dazu bei <strong>Baumann</strong>, MittRhNotK 2000, 1 ff.
- 42 -<br />
fene wirtschaftliche Mehrwert sind empirisch nur begrenzt messbare<br />
Größen. <strong>Notar</strong>e nehmen staatliche Funktionen wahr. Eine <strong>ökonomische</strong><br />
Effizienzkontrolle hätte die <strong>Notar</strong>iate bzw. die <strong>Notar</strong>e als staatliche Institu-<br />
tionen auch an ihrem Beitrag zur <strong>Rechts</strong>sicherheit zu messen.<br />
Indem der Staat Privatrechtsakte der öffentlichen Beurkundungsform<br />
unterwirft, baut er staatliche Kontrollmöglichkeiten in den Privatrechtsver-<br />
kehr ein u.a. aus fiskalischen, steuerlichen Gründen, aber auch um z.B.<br />
kriminelle Machenschaften – wie Geldwäsche – zu vereiteln oder aus<br />
sozialen Gesichtspunkten 91 . <strong>Die</strong> Überwachung der Einhaltung von Geset-<br />
zen im Privatrechtsverkehr 92 , die Kontrolle der Privatautonomie 93 , die<br />
Fristenüberwachung im staatlichen Interesse 94 , die öffentlichen Register-<br />
aufgaben <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s, die Kundbarmachung und Verlautbarungsfunktion<br />
notarieller Urkunden, ihre Legitimationsfunktion, die Erleichterung staatli-<br />
cher Kontrolle, die Entlastung der Gerichte, die Beweissicherung, die<br />
Amtshilfen für den Fiskus und sonstige Verwaltungsbehörden sowie<br />
zahlreiche weitere öffentliche Funktionen verpflichten den <strong>Notar</strong> als Träger<br />
eines öffentlichen Amtes kraft Gesetzes an den Aufgaben <strong>des</strong> Staates<br />
<strong>des</strong>sen Staatsangehörigkeit er besitzt, mitzuwirken, wozu ihn als Staats-<br />
bürger sein auf die Treue zu seinem Staat abgelegter Amtseid bindet. Der<br />
Staat bedient sich <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s als eines aus der Behördenorganisation<br />
ausgegliederten hoheitlichen Amtsträgers, um die staatlich-hoheitlichen<br />
<strong>Rechts</strong>pflegeaufgaben ökonomisch effizient zu erfüllen.<br />
<strong>Die</strong> Vollstreckbarkeit und die vor Gerichten und Behörden geltende öffent-<br />
liche Beweiskraft notarieller Urkunden sowie die Legalitätskontrolle ihres<br />
gesamten Inhalts unterscheidet sie von allen anderen Dokumenten, ins-<br />
91 <strong>Baumann</strong>, Das Amt <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>s, Seine öffentlichen und sozialen Funktionen, Mitteilungen der<br />
Rheinischen <strong>Notar</strong>kammer = Rheinische <strong>Notar</strong>zeitschrift (RNotZ) 1996, 1 ff.<br />
92 <strong>Baumann</strong>, MittRhNotK 1996, 1 (18). Aus der Überwachung folgt auch die präventive Abschre-<br />
ckung z. B. bei Geldwäsche. Eine solche Abschreckung könnte bei staatlich nicht kontrollierten<br />
Privatrechtsakten nicht gewährleistet werden.<br />
93 <strong>Baumann</strong>, MittRhNotK 1996, 1 (18). Der <strong>Notar</strong> darf rechtswidrige und sittenwidrige <strong>Rechts</strong>ge-<br />
schäfte nicht beurkunden.<br />
94 Zu allen nachfolgenden öffentlichen und staatlichen Funktionen vgl. <strong>Baumann</strong>,<br />
MittRhNotK 1996, 1 (18 ff.).
- 43 -<br />
besondere von privatschriftlichen Urkunden, die von <strong>Rechts</strong>anwälten oder<br />
anderen <strong>Rechts</strong>beratern verfasst und gemeinsam unterzeichnet werden.<br />
Der Grund dieses Unterschie<strong>des</strong> liegt in der staatlichen Beschränkung,<br />
Auswahl, Kontrolle und Überwachung der <strong>Notar</strong>e, so dass diese – trotz<br />
büroorganisatorischer Unabhängigkeit – Teil der staatlichen <strong>Rechts</strong>pflege<br />
sind.<br />
Erkennt man die Notwendigkeit einer staatlichen Kontrolle bestimmter<br />
ausgewählter <strong>Rechts</strong>geschäfte durch Institutionen vorsorgender <strong>Rechts</strong>-<br />
pflege an, so bietet sich als <strong>ökonomische</strong> Lösung an, auf kleine – aus der<br />
unmittelbaren Staatsverwaltung (Behörden) ausgegliederte - Einheiten<br />
zurückzugreifen. Innerhalb staatlicher Organisationsstrukturen können<br />
kleine Einheiten flexibler und schneller auf Veränderungen reagieren. Sie<br />
können sich den permanent ändernden <strong>ökonomische</strong>n Bedürfnissen <strong>des</strong><br />
<strong>Rechts</strong>- und Wirtschaftsverkehrs beweglicher anpassen, als große hierar-<br />
chisch zentralistisch strukturierte Behörden. Um die gestellten Aufgaben<br />
erfüllen zu können, muss diesen kleinen Einheiten organisatorische Un-<br />
abhängigkeit eingeräumt werden. Im Unterschied zu großen staatlichen<br />
Organisationen mit tiefen Administrationen können <strong>Notar</strong>iate als kleinste<br />
staatliche Einheiten sofort auf die individuellen Bedürfnisse <strong>des</strong> Wirt-<br />
schaftsverkehrs bei Gesetzesänderungen reagieren und damit im staatli-<br />
chen Interesse die Einhaltung der geltenden Gesetze überwachen. Nota-<br />
riate dürfen als vorbildliche Muster einer Deregulierung für im Interesse<br />
<strong>ökonomische</strong>r Effizienz aus der Bürokratie ausgegliederte staatliche<br />
Aufgaben bezeichnet werden.<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> Legitimation <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>iats darf nicht zu dem Missver-<br />
ständnis führen, dass <strong>Notar</strong>iate als Wirtschaftsunternehmen geführt wer-<br />
den dürfen. Der <strong>Notar</strong> darf seine Aufgaben nicht primär an <strong>ökonomische</strong>n<br />
Kriterien ausrichten. Der <strong>Notar</strong> ist vorrangig als Träger eines öffentlichen<br />
Amtes seiner <strong>Rechts</strong>ordnung verpflichtet und hat somit der Gerechtigkeit<br />
und der <strong>Rechts</strong>sicherheit zu dienen sowie seine sozialen Funktionen zu<br />
erfüllen. Gerechtigkeitskriterien lassen sich nicht allein an <strong>ökonomische</strong>n<br />
Effizienzkriterien ausrichten 95 . Ein <strong>Notar</strong> darf seine Tätigkeiten nicht am<br />
95 Dazu oben VIII. und unten X.
- 44 -<br />
Primat <strong>ökonomische</strong>r Effizienzkriterien ausrichten, vielmehr hat er die ihm<br />
von der <strong>Rechts</strong>ordnung auferlegten Pflichten zum Schutz von rechtlich<br />
Unerfahrenen und z.B. von Minderjährigen, Alten, Kranken, sozial Schwa-<br />
chen zu erfüllen.<br />
<strong>Notar</strong>e üben im staatlichen Auftrag zahlreiche gesellschaftliche, soziale<br />
Funktionen aus 96 , die ihnen die <strong>Rechts</strong>ordnung zuweisen wie die Klärung<br />
<strong>des</strong> zum Vertragsschluss relevanten Sachverhalts, die Beratung und<br />
Belehrung insbesondere der rechtlich Unerfahrenen, die Formulierungshil-<br />
fe bei Vertragsabschlüssen, die Streitvermeidungs- und Streitbeilegungs-<br />
(= Schlichtungs)funktion, den Schutz insbesondere von solchen Auslän-<br />
dern, die der Sprache <strong>des</strong> jeweiligen Lan<strong>des</strong> nicht hinreichend kundig<br />
sind, den Schutz von Geschäftsunfähigen und von körperlich Behinderten<br />
(Blinden, Stummen, Tauben, Lese- und Schreibunkundigen), den Schutz<br />
von Verbrauchern und letztlich von allen sozial Schwächeren. Beim<br />
Schutz Schwacher zeigt sich, dass eine ausgleichende Gerechtigkeit (ius<br />
distributiva) nicht allein nach <strong>ökonomische</strong>n Kriterien beurteilt werden darf,<br />
weil ein rigoroses <strong>ökonomische</strong>s Effizienzprinzip ökonomisch „nutzlose“<br />
Randgruppen gesellschaftlich „entsorgen“ müsste.<br />
<strong>Notar</strong>e tragen mit ihren öffentlichen Urkunden bei zur Entwicklung <strong>des</strong><br />
sozialen Friedens durch Streitvermeidung und durch Einsatz moderner,<br />
alternativer Systeme der Konfliktbewältigung wie Mediation und Schieds-<br />
gerichtsbarkeit.<br />
Hauptaufgabe <strong>des</strong> <strong>Notar</strong>iats bleibt, die hohe Qualität beizubehalten und zu<br />
verbessern, etwa durch ständige Fortbildung 97 , Einbeziehung neuer Tech-<br />
nologien, Kontrolle durch die Berufsorganisationen, die Einhaltung der<br />
berufsrechtlichen Vorgaben und die ständige Überwachung durch eine<br />
weisungsunabhängige Justizverwaltung als <strong>Die</strong>nstaufsicht.<br />
96 Zu den sozialen Funktionen notarieller Tätigkeit vgl. ausführlich <strong>Baumann</strong>, MittRhNotK 1996, 1<br />
(21 ff.).<br />
97 Wolfgang <strong>Baumann</strong>, <strong>Die</strong> lebenslange Fortbildung der <strong>Notar</strong>e und der <strong>Notar</strong>iatsmitarbeiter,<br />
<strong>Notar</strong>ius International, 2000, S. 116 ff.
X. Ausblick<br />
- 45 -<br />
Juristische Entscheidungen wurden schon immer von den Ergebnissen –<br />
verdeckter oder offener - empirischer Untersuchungen beeinflusst, ohne<br />
dass dieser Wirkungszusammenhang in der Vergangenheit in der<br />
<strong>Rechts</strong>wissenschaft wissenschaftlich systematisch hinreichend beachtet<br />
wurde. Der Gewinn einer Erweiterung der juristischen Methodenlehre mit<br />
der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> beruht auf der Erkenntnis, dass<br />
die Entwicklung unserer <strong>Rechts</strong>- und Wirtschaftsordnung von mikroöko-<br />
nomischen Einflussfaktoren abhängig ist und über solche auch mitgesteu-<br />
ert werden kann.<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> hat die methodischen Wege aufzu-<br />
zeigen, wie <strong>ökonomische</strong> Einflussfaktoren in juristische Entscheidungen<br />
künftig angemessen einzubeziehen sind. Auch wenn man sich auf Be-<br />
rechnungen der <strong>ökonomische</strong>n Effizienz mit empirischen Erhebungen<br />
einlässt, wäre es ein Trugschluss anzunehmen, dass der Wert von<br />
<strong>Rechts</strong>systemen mit mathematischer Exaktheit festgestellt werden kann 98 .<br />
Mathematisch exakte Berechnungen beruhen immer auf der Anerkennung<br />
von Axiomen, so dass die Exaktheit nur innerhalb <strong>des</strong> geschlossenen<br />
axiomatischen Regelsystems gilt. Soziale Verhaltensweisen lassen sich<br />
nicht in ein geschlossenes axiomatisches Regelsystem pressen, weil die<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse – und damit auch die normativen Anforde-<br />
rungen – einem permanenten Wandel bedingt durch die Evolution aller<br />
Lebensbereiche (insbesondere und unmittelbar spürbar im Bereich tech-<br />
nologischer Änderungen) unterliegt. <strong>Die</strong> Offenheit <strong>des</strong> Wertediskurses<br />
spricht zum Schutz elementarer Rechte für ein <strong>Rechts</strong>system mit Präven-<br />
tionswirkungen.<br />
Weitere Forschungen haben herauszuarbeiten, welche nichtökonomi-<br />
schen Zielvorstellungen die Entwicklung <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> bestimmen und ihr<br />
Rangverhältnis zur <strong>ökonomische</strong>n Effizienz abzustimmen. Letztgültige<br />
normative Entscheidungen können ohne wertende Betrachtungen nicht<br />
98 Kritisch auch Rolf Stürner, Markt und Wettbewerb über alles? Gesellschaft und Recht im Fokus<br />
neoliberaler Marktideologie (2007) S. 314.
- 46 -<br />
getroffen werden, schon weil <strong>ökonomische</strong> und nicht <strong>ökonomische</strong> Werte<br />
abzuwägen sind. Das Recht kann und darf nicht allein an <strong>ökonomische</strong>r<br />
Effizienz ausgerichtet werden, weil andernfalls die Grundlagen einer<br />
humanistischen Wertordnung zerstört würden.<br />
Inhaltlich wird künftig – diese Prognose kann gewagt werden – das öko-<br />
nomische Effizienzprinzip ein sehr wichtiger Wertungstopos bei jeder<br />
<strong>Rechts</strong>etzung und <strong>Rechts</strong>anwendung werden, weil die Beachtung <strong>des</strong><br />
allgemein gültigen Prinzips „<strong>ökonomische</strong> Effizienz“ den Wohlstand aller<br />
Menschen fördert. Ein volkswirtschaftlicher Wohlstand muss aber – nach<br />
den philosophischen Kriterien ausgleichender Gerechtigkeit – unter den<br />
Mitgliedern der Gesellschaft min<strong>des</strong>tens so verteilt sein, dass je<strong>des</strong> Mit-<br />
glied nach dem Wert seines Beitrags zum effizienten Gesamtwohl auch an<br />
der Wohlstandsmehrung partizipiert. Darüber hinaus verlangt eine an<br />
humanistischen Werten ausgerichtete Normenordnung, dass das<br />
schwächste Glied der Gesellschaft noch ein menschenwürdiges Dasein<br />
den Lebensverhältnissen der jeweiligen Gesellschaft führt. Beim Auffan-<br />
gen der unverschuldet in Notlagen Geratenen zeigt sich das Versagen<br />
<strong>ökonomische</strong>r Effizienz mit besonderer Deutlichkeit. Wer diejenigen Mit-<br />
glieder der Gesellschaft, die <strong>ökonomische</strong>n Effizienzansprüchen nicht<br />
mehr genügen können, nicht „entsorgen“ will 99 , der muss die schwierigen<br />
Fragen beantworten, wie weit die Leistungsträger einer Gesellschaft<br />
belastet werden dürfen und wo die im Laufe kultureller Entwicklung an-<br />
steigende Grenze menschenunwürdiger Lebensverhältnisse verläuft.<br />
<strong>Die</strong> Abwägung zwischen <strong>ökonomische</strong>r Effizienz und anderen rechtlichen<br />
Grundwerten bleibt eine normative Wertungsaufgabe und wird als solche<br />
dauerhaft den Normwissenschaftlern vorbehalten bleiben müssen, wobei<br />
diese <strong>ökonomische</strong> Folgenbetrachtungen mehr als bis heute in ihre Wer-<br />
tungen einbeziehen müssen. Exakte mathematisch ableitbare Ergebnisse<br />
sind nur in geschlossenen, nicht in offenen Gesellschaftssystemen mög-<br />
lich. Geschlossene Gesellschaftssysteme führen aber immer zu Freiheits-<br />
beschränkungen im Bereich fundamentaler Grund- und Menschenrechte.<br />
99 Dass weltweit politische und <strong>ökonomische</strong> Systeme existieren, die solche Menschen in<br />
Slums unter menschenunwürdigen Umständen dahinvegetieren lassen, entspricht der<br />
Realität, aber nicht den Grundwerten europäischer Kultur.
- 47 -<br />
Für den Berufsstand der <strong>Notar</strong>e ist die <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong><br />
eine neuartige Herausforderung. Positiv wird sich mit der <strong>ökonomische</strong>n<br />
<strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> belegen lassen, dass <strong>Notar</strong>e zum reibungslosen<br />
Ablauf <strong>ökonomische</strong>r Transaktionen mit niedrigen Transaktionskosten<br />
beitragen. Sehr leicht wird sich belegen lassen, dass ein einzelner <strong>Notar</strong><br />
wesentlich niedrigere Transaktionskosten verursacht als mehrere <strong>Rechts</strong>-<br />
anwälte. Zugleich wird bei einer vertieft durchdachten Untersuchung der<br />
Funktionen der <strong>Notar</strong>e deutlich, dass <strong>ökonomische</strong> Effizienz nur einen<br />
(allerdings sehr wichtigen) Teilbereich der Gerechtigkeit definiert. <strong>Die</strong> zur<br />
Gerechtigkeit verpflichteten Staatsorgane – wie insbesondere Richter und<br />
<strong>Notar</strong>e – sind auch anderen Gerechtigkeitskriterien verpflichtet, die sich an<br />
humanistischen Werten zu orientieren haben, wie der Hilfe für unverschul-<br />
det in Notlagen Geratene, selbst wenn dies nicht ökonomisch effizient ist.<br />
Hier gelten Menschenrechte, wie die Anerkennung der Menschenwürde,<br />
die von Juristen und insbesondere von <strong>Notar</strong>en zu beachten sind, um eine<br />
auf humanitären Werten beruhende <strong>Rechts</strong>- und Gesellschaftsordnung<br />
fortzuentwickeln.<br />
Jede funktionale Aufgabenbeschränkung der <strong>Notar</strong>e wäre ein Verlust<br />
kultureller europäischer Identität zugunsten einer US-Amerikanisierung<br />
unserer Gesellschaft. Obwohl alle europäischen Länder dem Freiheits-<br />
drang der international zusammengesetzten Bevölkerung der USA mit –<br />
zumin<strong>des</strong>t ursprünglich – europäischer Prägung, auch wirtschaftlichen<br />
Wohlstand und wichtige Impulse zur Befreiung der von der früheren Sow-<br />
jetunion unterdrückten Staaten Mittel- und Osteuropas zu verdanken<br />
haben, darf hieraus nicht gefolgert werden, dass freiheitliche <strong>Rechts</strong>- und<br />
Wirtschaftssysteme nur nach einer US-amerikanischen Blaupause denk-<br />
bar sind. <strong>Die</strong> Europäische Union muss – auf den Traditionen der europäi-<br />
schen Kultur ruhend – einen eigenen Weg finden 100 , ein europäisches<br />
<strong>Rechts</strong>- und Wirtschaftssystem als weltpolitisches Gewicht zur eigenen<br />
Interessenwahrung gegenüber den politischen und <strong>ökonomische</strong>n Macht-<br />
zentren in Asien und Nordamerika aufzubauen. In einem solchen System<br />
mit europäischer Kulturidentität werden die <strong>Notar</strong>e als Kulturträger mit<br />
100 Dazu Rolf Stürner, Markt und Wettbewerb über alles?, (2007) insbesondere S. 311 ff.
- 48 -<br />
einer mehr als 2000 Jahre alten <strong>Rechts</strong>tradition auch und insbesondere<br />
nach einer <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> ihrer staatlichen und sozialen Funktio-<br />
nen weiterhin einen wichtigen Platz als dienende Organe der vorsorgen-<br />
den <strong>Rechts</strong>pflege einnehmen.
- 49 -<br />
Literaturnachweise<br />
Adams, Michael, Ökonomische Theorie <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>: Konzepte und An-<br />
wendungen, Frankfurt a.M. (2002);<br />
ders., Ökonomische <strong>Analyse</strong> der Gefährdungs- und Verschuldenshaftung,<br />
Heidelberg (1985);<br />
Alexy, Robert, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt a. M.<br />
(1978);<br />
von Armin, Hans Herbert, Wirtschaftlichkeit als <strong>Rechts</strong>prinzip, Berlin<br />
(1988);<br />
Bausch, Thomas: Ungleichheit und Gerechtigkeit: eine Reflexion <strong>des</strong><br />
Rawlsschen Unterschiedsprinzips in diskursethischer Perspektive, Berlin<br />
(1993);<br />
Behrends, Sylke, Neue Politische Ökonomie, München (2001);<br />
Behrens, Peter, <strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong>n Grundlagen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>: politische<br />
Ökonomie als rationale Jurisprudenz, Tübingen (1986);<br />
ders., Über das Verhältnis der <strong>Rechts</strong>wissenschaft zur Nationalökonomie:<br />
<strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong>n Grundlagen <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, Jahrbuch für Neue Politische<br />
Ökonomie 1988, S. 209 - 228;<br />
ders., Legalism, Economism and <strong>Prof</strong>essional Attitu<strong>des</strong> Toward<br />
Institutional Design - Comment, Journal of Institutional and Theoretical<br />
Economics 1993, S. 141 - 147;<br />
Biervert, Bernd / Held, Martin, Das Menschenbild der <strong>ökonomische</strong>n<br />
Theorie - Zur Natur <strong>des</strong> Menschen, Frankfurt a. Main (1991);<br />
Biervert, Bernd / Held, Martin / Wielard, Josef, Sozialphilosophische<br />
Grundlagen <strong>ökonomische</strong>n Handelns, Frankfurt a. Main (1990);
- 50 -<br />
Bohnen, Alfred, <strong>Die</strong> utilitaristische Ethik als Grundlage der modernen<br />
Wohlfahrtsökonomik, Göttingen (1964);<br />
Buchanan, James M., Good Economics - Bad Law, Virginia Law Review<br />
1974, S. 483 - 492;<br />
ders., Rights, Efficiency and Exchange:The Irrelevance of Transactions<br />
Costs, in: Neumann, Manfred (Hrsg.) Ansprüche, Eigentums- und Verfü-<br />
gungsrechte - Schriften <strong>des</strong> Vereins für Socialpolitik n.F. Berlin 1984, S. 9<br />
- 24;<br />
Calabresi, Guido / Melamed, A. Douglas, Property Rules, Liability Rules,<br />
and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review 1972,<br />
S. 1089 ff.;<br />
Chaudhuri, Arun, Ein neuer Ansatz zur <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> De-<br />
liktsrechts am Beispiel BRD und USA, Berlin (1996);<br />
Coase, Ronald H., Law and Economics at Chicago, Journal of Law and<br />
Economics 1993, S. 239 ff.;<br />
Coleman, Jules L., Efficiency, Utility and Wealth Maximization, Hofstra<br />
Law Review 1980, S. 509 - 551;<br />
Coles, Christina, Folgenorientierung im richterlichen Entscheidungspro-<br />
zeß, ein interdisziplinärer Ansatz, Frankfurt a. Main (1991);<br />
Culp, Jerome M., Judex Economicus, Law and Contemporary Problems<br />
1987, S. 95 - 140;<br />
Dworkin, Ronald, Is Wealth a Value? Journal of Legal Studies 1980, S.<br />
191 ff.;<br />
ders., Hard Cases, Harvard Law Review 1975, S. 1057 - 1109;<br />
ders., Why Efficiency?, Hofstra Law Review 1980, S. 563 - 590;<br />
Eidenmüller, Horst, Effizienz als <strong>Rechts</strong>prinzip: Möglichkeiten und Gren-<br />
zen der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, 2. Auflage, Tübingen (1998);
- 51 -<br />
Erlei, Mathias / Leschke, Martin / Sauerland, Dirk, Neue Institutionenöko-<br />
nomik, Tübingen (1999);<br />
Frank, Jürgen, <strong>Die</strong> „Rationalität“ einer <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>,<br />
Zeitschrift für <strong>Rechts</strong>soziologie 1986, S. 191 - 211;<br />
Friedman, Milton, Kapitalismus und Freiheit, Frankfurt a. Main (1984);<br />
Gäfgen, Gérard, Entwicklung und Stand Theorie der Property Rights: Eine<br />
kritische Bestandsaufnahme, in: M. Neumann (Hrsg.), Ansprüche, Eigen-<br />
tums- und Verfügungsrechte - Schriften <strong>des</strong> Vereins für Socialpolitik n.F.<br />
1984, S. 43 - 62;<br />
Gewirth, Alan, Can Utilitarianism Justify any Moral Rights?, in: Pennock /<br />
Chapman (Hrsg.), Ethics, Economics and the Law, New York (1982) S.<br />
158 - 193;<br />
Häberle, Peter, Effizienz und Verfassung, Archiv <strong>des</strong> öffentlichen <strong>Rechts</strong><br />
1973, S. 625 - 635;<br />
ders., Vielfalt der Property Rights und der verfassungsrechtliche Eigen-<br />
tumsbegriff, in: Neumann (Hrsg.), Ansprüche, Eigentums- und Verfü-<br />
gungsrechte - Schriften <strong>des</strong> Vereins für Socialpolitik n.F. 1984, S. 63 -<br />
102;<br />
Hagel, Joachim, Effizienz und Gerechtigkeit: Ein Beitrag zur Diskussion<br />
der ethischen Aspekte der neoklassischen Wohlfahrtstheorie, Ba-<br />
den-Baden (1993);<br />
von Hayek, Friedrich August, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, <strong>Die</strong><br />
Illusion der sozialen Gerechtigkeit, Landsberg a. Lech (1976, 1981);<br />
Höffe, Otfried: Gerechtigkeit: eine philosophische Einführung, München<br />
(2001);<br />
ders., Einführung in die utilitaristische Ethik: klassische und zeitgenössi-<br />
sche Texte, 2. Aufl., Tübingen (1992);
- 52 -<br />
ders., John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Berlin (1998);<br />
Homann, Karl, Philosophie und Ökonomik: Bemerkungen zur Interdiszipli-<br />
narität, Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie 1988, S. 99 - 127;<br />
Homann, Karl / Suchanek, Andreas, Ökonomik: eine Einführung, Tübingen<br />
(2000);<br />
Horn, Norbert, Einführung in die <strong>Rechts</strong>wissenschaft und <strong>Rechts</strong>philoso-<br />
phie, 4. Auflage, Heidelberg (2007);<br />
von Humboldt, Wilhelm, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirk-<br />
samkeit <strong>des</strong> Staats zu bestimmen, Ditzingen (Nachdruck 2002);<br />
Hutter Michael, <strong>Die</strong> Gestaltung von Property Rights als Mittel gesellschaft-<br />
lich-wirtschaftlicher Allokation, Göttingen (1979);<br />
Kaufmann, Arthur, <strong>Rechts</strong>philosophie, München (1997);<br />
Kersting, Wolfgang, Theorien der sozialen Gerechtigkeit, Stuttgart und<br />
Weimar (2000);<br />
Kirchgässner, Gebhard, Homo oeconomicus: das <strong>ökonomische</strong> Modell<br />
individuellen Verhaltens und seine Anwendung in Wirtschafts- und Sozial-<br />
wissenschaften, 2. Aufl., Tübingen (2000);<br />
Kirchhof, Paul, Das Gesetz der Hydra, Gebt den Bürgern ihren Staat<br />
zurück!, München (2006);<br />
Kirchner, Christian, Ökonomische Theorie <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, Berlin/New York<br />
(1997);<br />
Kirchner, Christian / Koch Stefan, Norminterpretation und <strong>ökonomische</strong><br />
<strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, <strong>Analyse</strong> und Kritik 1989, S. 111 - 133;
- 53 -<br />
Kötz, Hein, <strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong>, Zeitschrift für die ge-<br />
samte Versicherungswissenschaft 1993, S. 57 - 70;<br />
Kötz, Hein / Schäfer, Hans-Bernd, Iudex, calcula!, Juristenzeitung 1992, S.<br />
355 - 356;<br />
Kübler, Friedrich, Effizienz als <strong>Rechts</strong>prinzip, Festschrift für Ernst Stein-<br />
dorff zum 70. Geburtstag, Berlin (1990), S. 687 - 704;<br />
Losch, Bernhard / Schwartze, Andreas, <strong>Rechts</strong>wissenschaft für Gesell-<br />
schaftswissenschaften, Juristische Grundlagen für Ökonomen, Politolo-<br />
gen, Sozial- und Kulturwissenschaftler, Stuttgart (2006);<br />
Luhmann, Niklas, <strong>Rechts</strong>soziologie, 3. Auflage, Opladen (1987);<br />
Mathis, Klaus, Effizienz statt Gerechtigkeit, Berlin (2004);<br />
Mishan, Edward J., Cost-Benefit Analysis: an informal introduction, 4.<br />
Auflage, London (1988);<br />
Nolte, Paul, Generation Reform - Jenseits der blockierten Republik, Mün-<br />
chen (2004);<br />
ders., Riskante Moderne - <strong>Die</strong> Deutschen und der neue Kapitalismus,<br />
München (2006);<br />
Nutt, Patrick A., The Economics of Public Choice, 2. Auflage,<br />
Northhampton MA (2002);<br />
Okun, Arthur M.: Equality and Efficiency - The big Tradeoff, Washington<br />
(1975);<br />
Ott, Claus / Schäfer, Hans-Bernd., Ökonomische Probleme <strong>des</strong> Zivilrechts,<br />
Berlin (1991);<br />
dies., Allokationseffizienz in der <strong>Rechts</strong>ordnung Berlin (1989);<br />
dies., <strong>Die</strong> <strong>ökonomische</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>des</strong> <strong>Rechts</strong> - Irrweg oder Chance wis-<br />
senschaftlicher <strong>Rechts</strong>erkenntnis?, Juristenzeitung 1988, S. 213 - 223;
- 54 -<br />
dies., Schmerzensgeld bei Körperverletzungen, Juristenzeitung 1990, S.<br />
563 - 573;<br />
Perelman, Cha|m, Über die Gerechtigkeit, München (1967);<br />
Pigou, Arthur C., The Economics of Welfare, Nachdruck der 4. Auflage,<br />
London (1932);<br />
Polinsky, A. Mitchell, Economic Analysis as a Potentially Defective<br />
Product: A Buyer‘s Guide to Posner‘s Economic Analysis of Law, Harvard<br />
Law Review 1974, S. 1655 - 1681;<br />
Rawls, Political Liberalism, New York (1993);<br />
Richter, Rudolf, Institutionen ökonomisch analysiert, Tübingen (1994);<br />
Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G., Neue Institutionenökonomik: eine<br />
Einführung und kritische Würdigung, 2. Aufllage, Tübingen (1999);<br />
Rosenfeld, Martin, Evolution öffentlicher Aufgaben und Ökonomische<br />
Theorie <strong>des</strong> Institutionellen Wandels, Berlin (1996);<br />
Ross, Stephen A., The Economic Theory of Agency: The Principal's<br />
Problem, American Economic Review 1973, S. 134-139;<br />
Rüthers, Bernd, <strong>Rechts</strong>theorie, 2. Auflage, München (2005);<br />
Schäfer, Hans-Bernd / Ott, Claus, Lehrbuch der <strong>ökonomische</strong>n <strong>Analyse</strong><br />
<strong>des</strong> Zivilrechts, 4. Auflage, Berlin, Heidelberg, New York (2005);<br />
Schünemann, Wolfgang B., Der Homo Oeconomicus im <strong>Rechts</strong>leben,<br />
Archiv für <strong>Rechts</strong>- und Sozialphilosophie 1986, S. 502 - 513;<br />
Smith, Adam, Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner<br />
Natur und seiner Ursachen, München (1978);
- 55 -<br />
ders., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2<br />
Bde., Oxford (1979);<br />
ders., The Theory of Moral Sentiments, hrsg. von Knud Haakonssen,<br />
Cambridge (2002);<br />
Sohmen, Egon, Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik, Tübingen (1976);<br />
Stegmüller, Wolfgang, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, 7.<br />
Auflage, Stuttgart (1989);<br />
Taupitz, Jochen, Ökonomische <strong>Analyse</strong> und Haftungsrecht - Eine Zwi-<br />
schenbilanz, Archiv für die civilistische Praxis 1996, S. 114 ff.;<br />
Trapp, Rainer W., "Nicht-klassicher" Utilitarismus: Eine Theorie der Ge-<br />
rechtigkeit, Frankfurt a. M. (1988);<br />
Ulrich, Peter, Auf der Suche nach der modernen Wirtschaftsethik, Bern<br />
(1990);<br />
Varian, Hal R. / Buchegger, Reiner, Grundzüge der Mikroökonomik, 7.<br />
Auflage, München (2007);<br />
Wegehenkel, Lothar, Coase-Theorem und Marktsystem, Tübingen (1980);<br />
von Weizsäcker, Carl Christian, Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit -<br />
Ein Widerspruch?, in: Rahmsdorf / Schäfer (Hrsg.), Ethische Grundfragen<br />
der Wirtschafts- und <strong>Rechts</strong>ordnung, Berlin (1988), S. 23 – 49.