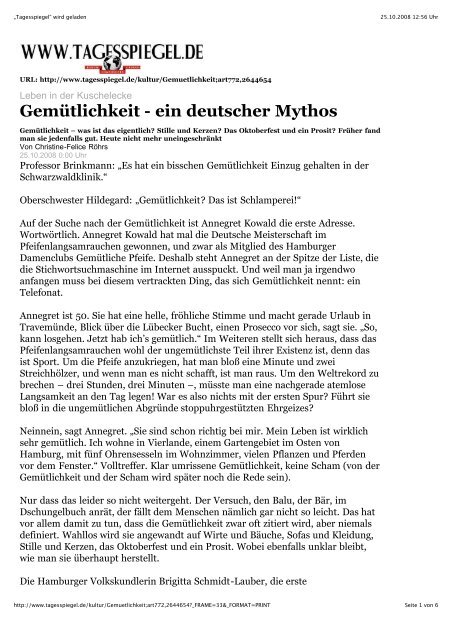als pdf lesen - PSY:PLAN
als pdf lesen - PSY:PLAN
als pdf lesen - PSY:PLAN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
URL: http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654<br />
Leben in der Kuschelecke<br />
Gemütlichkeit - ein deutscher Mythos<br />
Gemütlichkeit – was ist das eigentlich? Stille und Kerzen? Das Oktoberfest und ein Prosit? Früher fand<br />
man sie jedenfalls gut. Heute nicht mehr uneingeschränkt<br />
Von Christine-Felice Röhrs<br />
25.10.2008 0:00 Uhr<br />
Professor Brinkmann: „Es hat ein bisschen Gemütlichkeit Einzug gehalten in der<br />
Schwarzwaldklinik.“<br />
Oberschwester Hildegard: „Gemütlichkeit? Das ist Schlamperei!“<br />
Auf der Suche nach der Gemütlichkeit ist Annegret Kowald die erste Adresse.<br />
Wortwörtlich. Annegret Kowald hat mal die Deutsche Meisterschaft im<br />
Pfeifenlangsamrauchen gewonnen, und zwar <strong>als</strong> Mitglied des Hamburger<br />
Damenclubs Gemütliche Pfeife. Deshalb steht Annegret an der Spitze der Liste, die<br />
die Stichwortsuchmaschine im Internet ausspuckt. Und weil man ja irgendwo<br />
anfangen muss bei diesem vertrackten Ding, das sich Gemütlichkeit nennt: ein<br />
Telefonat.<br />
Annegret ist 50. Sie hat eine helle, fröhliche Stimme und macht gerade Urlaub in<br />
Travemünde, Blick über die Lübecker Bucht, einen Prosecco vor sich, sagt sie. „So,<br />
kann losgehen. Jetzt hab ich’s gemütlich.“ Im Weiteren stellt sich heraus, dass das<br />
Pfeifenlangsamrauchen wohl der ungemütlichste Teil ihrer Existenz ist, denn das<br />
ist Sport. Um die Pfeife anzukriegen, hat man bloß eine Minute und zwei<br />
Streichhölzer, und wenn man es nicht schafft, ist man raus. Um den Weltrekord zu<br />
brechen – drei Stunden, drei Minuten –, müsste man eine nachgerade atemlose<br />
Langsamkeit an den Tag legen! War es <strong>als</strong>o nichts mit der ersten Spur? Führt sie<br />
bloß in die ungemütlichen Abgründe stoppuhrgestützten Ehrgeizes?<br />
Neinnein, sagt Annegret. „Sie sind schon richtig bei mir. Mein Leben ist wirklich<br />
sehr gemütlich. Ich wohne in Vierlande, einem Gartengebiet im Osten von<br />
Hamburg, mit fünf Ohrensesseln im Wohnzimmer, vielen Pflanzen und Pferden<br />
vor dem Fenster.“ Volltreffer. Klar umrissene Gemütlichkeit, keine Scham (von der<br />
Gemütlichkeit und der Scham wird später noch die Rede sein).<br />
Nur dass das leider so nicht weitergeht. Der Versuch, den Balu, der Bär, im<br />
Dschungelbuch anrät, der fällt dem Menschen nämlich gar nicht so leicht. Das hat<br />
vor allem damit zu tun, dass die Gemütlichkeit zwar oft zitiert wird, aber niem<strong>als</strong><br />
definiert. Wahllos wird sie angewandt auf Wirte und Bäuche, Sofas und Kleidung,<br />
Stille und Kerzen, das Oktoberfest und ein Prosit. Wobei ebenfalls unklar bleibt,<br />
wie man sie überhaupt herstellt.<br />
Die Hamburger Volkskundlerin Brigitta Schmidt-Lauber, die erste<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 1 von 6
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
Wissenschaftlerin überhaupt, die sich an ein Buch zum Thema gewagt hat<br />
(Campus 2003), hat es auf den Punkt gebracht: Gemütlichkeit ist ein<br />
unerschlossener Begriff. Und im Übrigen ist auch durchaus nicht jeder dafür.<br />
Verachtung versprüht zum Beispiel Günter Behnisch, großer alter Mann der<br />
deutschen Architektur, Erbauer Freiheit atmender, gläserner Bauten, zum Beispiel<br />
des Münchner Olympiastadions.<br />
Folgende Situation. Ein Interview mit der „Zeit“. Journalist und Architekt sind (im<br />
Geiste) beim Potsdamer Platz angekommen, beim Backsteinturm des Architekten<br />
Kollhoff im Stil der Dreißiger.<br />
– Behnisch: … dass manche Architekten aber auch alles auf ewig stellen wollten<br />
mit ihrem Natursteinwahn.<br />
– Journalist: Aber ob der Herr Behnisch nicht auch denke, dass viele Leute sich<br />
nach diesem historisierenden Stil sehnten, nach Geborgenheit, Gemütlichkeit?<br />
– Behnisch: „Wenn jemand Gemütlichkeit braucht, soll er sich eine Katze<br />
anschaffen. Ich habe zwei Katzen zu Hause, das ist gemütlich.“<br />
Lebte Adolf Behne noch, er würde an dieser Stelle „guter Mann!“ rufen. Behne,<br />
Architekt und Wortführer der Avantgarde in der Weimarer Republik, hatte schon<br />
1918 flammende Anti-Gemütlichkeitsreden gehalten. Das zum Beispiel ist von<br />
Behne: Gemütlichkeit sei ein geistloser, qualliger Beharrungszustand, in dem alle<br />
Werte stumpf würden. Ginge es nach ihm, würde heute nicht halb Berlin in<br />
Altbauwohnungen mit Dielen und Stuck leben, sondern in rebellischen Bauten wie<br />
den Estradenhäusern des Berliner Architekten Wolfram Popp – in Wohnungen<br />
ohne Wände <strong>als</strong>o, und nach vorne raus eine so große Fensterfläche, dass man dem<br />
Mieter bis aufs Klo gucken kann. Behne schrieb: „Waren bisher alle Behausungen<br />
des Menschen weiche Prellböcke seiner Bewegungen, Versuchungen, die Dinge<br />
gehen zu lassen, so wird uns die Glasarchitektur in Räume stellen, die uns immer<br />
wieder hindern, in Stumpfsinn, Gewohnheit und Gemütlichkeit zu verfallen.“<br />
Gemütlichkeit gilt den einen <strong>als</strong>o <strong>als</strong> das Vorrecht von Katzenbesitzern sowie<br />
stumpfsinnsfördernd.<br />
Und den anderen?<br />
In einem Café in Berlin saß vor ein paar Tagen Riklef Rambow, Psychologe am<br />
Architekturlehrstuhl der BTU Cottbus und Mitinhaber von „Psy-Plan“, einem Büro<br />
für Architektur- und Umweltpsychologie in Berlin. Der Professor, 44, ein großer,<br />
blonder Mann mit dunkelgerahmter Brille und Tweedjacket, hat <strong>als</strong> Treffpunkt das<br />
Café Olivia an der Wühlischstraße in Friedrichshain vorgeschlagen. Er setzt sich an<br />
einen Tisch vor der Tür. Autos lärmen vorbei, es nieselt, und der Professor rafft<br />
sein Jacket gegen die Kühle zusammen. Wieso er nicht reingeht? „Nicht so<br />
gemütlich“, sagt er und nickt hinein ins puppenstübchenhafte Laden-Café mit der<br />
Blumentapete und den Wänden voll glänzender Schokoladen.<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 2 von 6
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
– Autorin: „Es sieht aber doch sehr gemütlich aus!“<br />
– Professor: „Zu eng. Die Vorstellung, dass jemand jedes Wort mithört, finde ich<br />
nicht gemütlich. Gemütlichkeit hat ja immer etwas mit Schutz zu tun. Mit einem<br />
subjektiven Gefühl der Kontrolle über seine Umgebung.“<br />
Riklef Rambow ist neben Kulturwissenschaftlerin Schmidt-Lauber einer der<br />
wenigen Wissenschaftler, die sich getraut haben, die Gemütlichkeit mal ernst zu<br />
nehmen. In diesem Fall hat der Architekturpsychologe eine Gruppe Studenten<br />
darauf losgelassen. Ihm war aufgefallen, dass das private Bild von Gemütlichkeit<br />
oft mit dem öffentlichen Raum kollidiert. Geht’s nicht gemütlicher?, fragt der<br />
Bürger und schaut fröstelnd aufs Kanzleramt aus Waschbeton. Aber unter<br />
Stadtplanern und Architekten, sagt Rambow, sei Gemütlichkeit eben „negativ<br />
konnotiert“. Sie seien noch immer stark geprägt von der Klassischen Moderne, von<br />
Visionären wie Corbusier, Gropius, van der Rohe, von Menschen, die fanden, dass<br />
da, wo die klare Linie aufhört, das Chaos beginnt. Ein Chaos, das sie mit<br />
hierarchischen Strukturen in Politik und Familie assoziierten, mit einem Mangel<br />
an Licht, Luft und Kreativität.<br />
Riklef Rambow ist diese Askese der Kollegen, der damaligen wie der heutigen,<br />
allerdings zu ungemütlich. Er findet: „Es gibt Formen der Gemütlichkeit, derer<br />
man sich nicht zu schämen braucht.“<br />
Das Bedürfnis nach Gemütlichkeit ist, historisch gesehen, übrigens noch jung. Man<br />
kann sagen, die Menschen des 17. Jahrhunderts wollten es sich noch nicht<br />
gemütlich machen. „Gemütlichkeit“, sagt Riklef Rambow, „ist ein Begriff, der erst<br />
mit dem Entstehen des Bürgertums aufkam. Das ist auch logisch, denn in den<br />
Schlössern der feudalen Gesellschaft war sie schlecht möglich, und für die armen<br />
Schweine in den überfüllten Hütten war die Privatheit, die <strong>als</strong> Voraussetzung da<br />
sein muss, nicht herstellbar.“<br />
Erst um 1790 wird das Wort in die Schriftsprache eingeführt – angeblich von<br />
Goethe übrigens. Und je schneller sich in der folgenden Zeit die Gesellschaft<br />
veränderte, durch Industrialisierung und Kriege, „desto mehr verstärkte sich das<br />
Bedürfnis nach einem höhlenhaften Innenraum, der dem Gemüt, der Seele guttat“,<br />
sagt die Bürgertumsspezialistin Ute Frevert, Direktorin des Max-Planck-Instituts<br />
für Bildungsforschung in Berlin.<br />
Gemütlichkeit war <strong>als</strong>o ursprünglich ein Wohlfühlbegriff. Das ist er heute nicht<br />
mehr uneingeschränkt. Es gibt Leute, die heftig bestreiten, Gemütlichkeit sei für<br />
sie ein Kriterium. Ihr Gott könnte Adolf Loos heißen, Stiltheoretiker des frühen<br />
20. Jahrhunderts. Sein Credo hieß Schlichtheit. In einem Aufsatz, den er<br />
ausgerechnet „Ornament und Verbrechen“ nannte, schrieb er: „Ich habe folgende<br />
erkenntnis gefunden und der welt geschenkt: Evolution der kultur ist<br />
gleichbedeutend mit dem entfernen des ornamentes aus dem<br />
gebrauchsgegenstande.“<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 3 von 6
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
Und es stimmt ja: Was der Gemütlichkeit einen komischen Geschmack verleiht,<br />
irgendwie kleinbürgerlich, ist, dass sie kulturgeschichtlich aus einer Zeit stammt,<br />
die in der ironischen Rückschau Biedermeier genannt wird: eine Zeit zwischen<br />
Revolution und Reaktion, in der die Menschen ihren Fluchtpunkt im Privaten<br />
fanden. Diese Zeit sei „wohnsüchtig“ gewesen, hat Walter Benjamin mal gesagt.<br />
Die Wohnung <strong>als</strong> „Futteral des Menschen“. Dick abgepolstert gegen die feindliche<br />
Außenwelt lebte Herr Biedermeier inmitten einer Unzahl von Accessoires: Uhren,<br />
Schoner, Läufer, Klapperdeckchen, Spielkarten, Sofakissen.<br />
Aber ist das neue Jahrtausend nicht auch wohnsüchtig? In Berlin berichten<br />
Zeitungen schon vom „Verdrängungswettbewerb“ der Einrichtungshäuser. Die<br />
Deutschen, europaweit führende Hersteller und Käufer von Möbeln und<br />
Accessoires – sind sie die neuen Biedermänner?<br />
Das neue Jahrtausend, geprägt von Terrorwarnungen, Reformdebatten und<br />
Finanzkrisen, böte zumindest Grund genug für den Rückzug auf sich selbst. Der<br />
jüngste „Spiegel“ hat das „Ende der Gemütlichkeit“ sogar auf der Titelseite<br />
verkündet. Ob die Deutschen deshalb aber nun flächendeckend zu Biedermännern<br />
werden, darüber streiten die Experten. Einerseits konstatieren die Trendforscher<br />
schon länger Phänomene, die sie erst Cocooning nannten, jetzt Nesting oder „Neue<br />
Heimeligkeit“. Als Belege führen sie die steigende Zahl der TV-Kochshows an, die<br />
das Werkeln am heimischen Herd zum Gipfel der Freizeitgestaltung erheben,<br />
„neue Wertedebatten“ sowie den reißenden Absatz von Kaminöfen und<br />
Raumsprays.<br />
Andererseits, erklärt Trendata-Chef Roland Schuller, gibt es ja nie nur einen<br />
einzigen Trend. Und sie entstehen immer im Gegensatz zueinander. Die „Neue<br />
Heimeligkeit“ zum Beispiel im Gegensatz zum „Extrem mobilen Menschen“. Es<br />
entsteht da <strong>als</strong>o eher eine Art Gemütlichkeits-Mutation denn neues Spießertum.<br />
Und da ist es plötzlich kein Widerspruch mehr, dass der extrem mobile Mutant<br />
sich mitten in Berlins stylisher Mitte in Kneipen wohlfühlt, die „Wohnzimmer“<br />
heißen und von plüschiger Vollgestopftheit sind. Er heilt sich einfach selbst. Er<br />
verpasst sich jene Dosis Gemütlichkeit, jene Stabilität, die die erodierenden<br />
Großstrukturen ihm nicht mehr geben können.<br />
… das „Wohnzimmer“ nennst du gemütlich?, fragt entsetzt der Kollege, <strong>als</strong> er beim<br />
Text<strong>lesen</strong> an dieser Stelle angekommen ist. Ich nenn’ das muffig! Und da ist er<br />
wieder, der Gemütlichkeitsgraben.<br />
Aber wie entsteht dieses subjektive Empfinden von Gemütlichkeit? Wieso findet<br />
zum Beispiel die Volksbühnen-Schauspielerin Sophie Rois Behaglichkeit dort, wo<br />
andere sich gruseln? In einem Tagesspiegel-Interview zumThema hat sie mal<br />
gesagt, sie sitze „wahnsinnig gerne in diesem scheußlichen Steakhaus am<br />
Alexanderplatz mit Blick auf die Karl-Marx-Allee“. Und im McDonald’s in<br />
Friedrichsfelde hatte sie angeblich sogar „schon lupenreine Glückserlebnisse“.<br />
Aber Sophie Rois ist ja auch in einem 300 Jahre alten Haus aufgewachsen und<br />
zudem auf dem Dorf. Möglicherweise hat diese Kindheit Frau Rois Idyll-vergiftet.<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 4 von 6
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
Da müssen die Träume von Behaglichkeit ja anders aussehen <strong>als</strong> die von<br />
Menschen mit Plattenbausozialisation. Offenbart der individuelle<br />
Gemütlichkeitsbegriff <strong>als</strong>o freudianische Abgründe?<br />
Und was ist außerdem mit dem Verdacht, dass die Deutschen besonders<br />
gemütlichkeitsanfällig sind?<br />
Dieser Verdacht besteht schon länger. Denn Gemütlichkeit hat etwas mit Gemüt zu<br />
tun, „und Gemüt“, sagt die Bürgertumsexpertin Ute Frevert, „war das, was die<br />
Deutschen im späten 18. Jahrhundert zum Nationalcharakter erklärt hatten“.<br />
Genauer: „Urthümliche Anlage des teutschen Gemüths“ ist Liebe zu Natur und<br />
Familienleben. So steht es in der 1853 erschienenen Allgemeinen Encyklopädie der<br />
Wissenschaften und Künste unter „Gemüth“. Nicht umsonst gilt der Begriff <strong>als</strong><br />
unübersetzbar. Das Oxford English Dictionary versucht es unter anderem mit „the<br />
quality of being gemütlich“.<br />
Auf der Wühlischstraße, im Gespräch mit dem Architekturpsychologen, fängt es<br />
jetzt richtig an zu regnen, und widerstrebend stimmt er zu, das Café Olivia zu<br />
betreten. Er setzt sich auf den Fensterplatz und verschränkt die Arme vor der<br />
Brust. Er spricht jetzt sehr leise. Natürlich sei der Begriff von Gemütlichkeit<br />
biographieabhängig, murmelt er, des einen Gemütlichkeit sei des anderen<br />
Ungemütlichkeit. Aber: Es gebe doch einen Aspekt, der jedermanns Gemütlichkeit<br />
innewohne. „Gemütlichkeit erfordert ein Element der Vertrautheit“, sagt Riklef<br />
Rambow. Woraus man folgern kann: Die Gemütlichkeit lässt das Fremde nicht zu.<br />
Denn um das Gefühl des Vertrauten hervorzurufen, muss selektiert werden.<br />
Müssen nicht nur Möbel, sondern auch Menschen und Ansichten ausgesucht<br />
werden, die den geschützten Raum nicht sprengen – und automatisch jene<br />
abgewehrt, die es tun. Hier kommt ins Spiel, was viele der Gemütlichkeit<br />
vorwerfen: der Mangel an Aufgeschlossenheit, der Muff. Was man der freundlichen<br />
Annegret von der Gemütlichen Pfeife, dem Kegelclub Gemütlichkeit Schaafheim<br />
oder dem Schützenverein Gemütlichkeit aus Bayerdilling ja nun nicht pauschal<br />
unterstellen will. Vereinsmeierei ist kein schönes Wort. Andererseits steigert man<br />
Gemütlichkeit nicht umsonst ins Saugemütliche…<br />
Und wie geht Gemütlichkeit jetzt?<br />
Die Fotografen der Wohnmagazine legen Felle aufs Bett, ganz Deutschland kauft<br />
Ikeakerzen im Familienpack, und die Bewohner von Wolfram Popps<br />
Einzimmerbauten stellen Raumteiler auf. Die Ikonographie der Gemütlichkeit,<br />
schreibt Kulturwissenschaftlerin Schmidt-Lauber, ist für die meisten Menschen<br />
doch dieselbe: überschaubare Räume, warme Farben, Holz, alte Möbel. Packt man<br />
<strong>als</strong>o alles zusammen in ein Zimmer, hat man es gemütlich, oder? Nö. Immer noch<br />
nicht. Beispiel: die Schauzimmer in Möbelhäusern voller Kissen und Kerzen, bei<br />
denen man vielleicht „hübsch“ sagen würde oder auch „nicht hübsch“, aber nie<br />
gemütlich. Weil? Ja, warum?<br />
Man kann Gemütlichkeit eben nicht „entwerfen“. Vielleicht, weil Gemütlichkeit vor<br />
allem etwas mit der Kombination von Zutaten zu tun hat, die nicht alle stofflicher<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 5 von 6
„Tagesspiegel“ wird geladen<br />
Natur sind. Wohnzimmer aber, wie sie Ikea erfindet, wirken eher steril, wenn sie<br />
zu Hause nachgebaut werden, eben weil sie nur stofflicher Natur sind.<br />
Gemütlichkeit ist nichts, was dem Objekt per se anhaftet. Menschen wirken ja auch<br />
nicht wirklich gut gekleidet, nur weil sie ein Katalogmodell eins zu eins an sich<br />
selber nachgebildet haben. In der Tat werden sie vor allem dann für Stil<br />
bewundert, wenn er nicht dem Schema F entspricht. Carrie aus „Sex and the City“<br />
war das beste Beispiel. Ursprünglich ist sie einmal globales Stilvorbild dafür<br />
geworden, dass sie verrückt zusammengewürfeltes Secondhandzeug trug oder<br />
sogar Trash.<br />
Mehr Mut zum Müll <strong>als</strong>o? Zur Seele? Oder zur Schlamperei, wie Oberschwester<br />
Hildegard schimpfen würde?<br />
Wem das nicht liegt: Man kann das auch sein lassen, das mit der Gemütlichkeit.<br />
Dann ist man unter Umständen einfach nur gut eingerichtet.<br />
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 25.10.2008)<br />
Sie interessieren sich für dieses Thema und wollen keinen Artikel im Tagesspiegel dazu<br />
verpassen? » Dann klicken Sie hier.<br />
http://www.tagesspiegel.de/kultur/Gemuetlichkeit;art772,2644654?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT<br />
25.10.2008 12:56 Uhr<br />
Seite 6 von 6