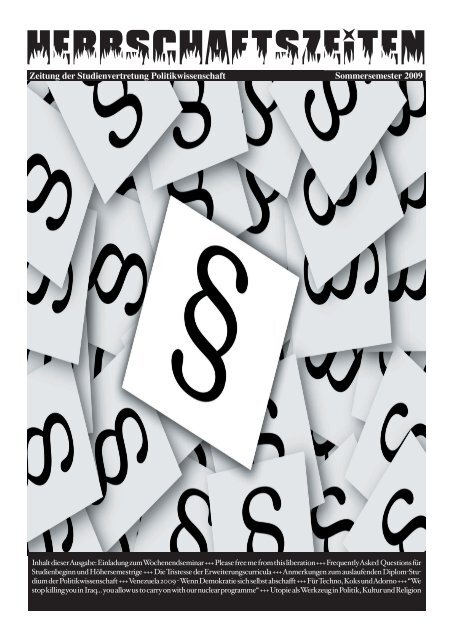pdf download - BAGRU PoWi
pdf download - BAGRU PoWi
pdf download - BAGRU PoWi
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeitung der Studienvertretung Politikwissenschaft<br />
Sommersemester 2009<br />
Inhalt dieser Ausgabe: Einladung zum Wochenendseminar +++ Please free me from this liberation +++ Frequently Asked Questions für<br />
Studienbeginn und Höhersemestrige +++ Die Tristesse der Erweiterungscurricula +++ Anmerkungen zum auslaufenden Diplom-Studium<br />
der Politikwissenschaft +++ Venezuela 2009 - Wenn Demokratie sich selbst abschafft +++ Für Techno, Koks und Adorno +++ “We<br />
stop killing you in Iraq... you allow us to carry on with our nuclear programme“ +++ Utopie als Werkzeug in Politik, Kultur und Religion
Editorial<br />
Die Herrschaftszeiten gehen in die<br />
nächste Runde. Seit dem Wintersemester<br />
2005/06 erscheinen die Herrschaftszeiten<br />
als Zeitung der Studienvertretung<br />
Politikwissenschaft mindestens zweimal<br />
pro Jahr, immer zu Semesterbeginn. Wie<br />
bereits in früheren Ausgaben, berichten<br />
wir in den Studinews ausführlich über den<br />
aktuellen Stand des politikwissenschaftlichen<br />
Bachelor- und Diplomstudiums,<br />
sowie über andere relevante Veränderungen,<br />
die das politikwissenschaftliche Studium<br />
betreff en.<br />
Auch in diesem Semester veranstalten<br />
wir wieder ein Wochenendseminar. Aus<br />
gegebenem Anlass widmen wir uns diesmal<br />
der Marx‘schen Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Als sachkundige Ansprechpersonen<br />
stehen uns Alex Gruber und Florian<br />
Ruttner mit Rat und Tat zur Seite. Unsere<br />
diessemestrige Veranstaltungsreihe dreht<br />
2<br />
Powi-Frühstück!<br />
sich rund um das Thema Sexualität: Von<br />
Sadomasochismus bis Sexualität im Nationalsozialismus<br />
werden unterschiedliche<br />
Themen beleuchtet. Außerdem haben<br />
wir bei der Gestaltung des Lehrangebots<br />
mitgemischt und eine Ringvorlesung auf<br />
die Beine gestellt. Diese befasst sich mit<br />
der Kritischen Theorie und allem was<br />
dazu gehört.<br />
Viele Artikel setzen sich diesmal mit<br />
uni-relevanten Fragen auseinander. Erötert<br />
wird die vermeintliche Befreiung von<br />
den Studiengebühren, die unter großen<br />
bürokratischen Aufwand lediglich einen<br />
Teil der Studierenden von den Gebühren<br />
freistellt. Weiters versuchen wir Klarheit<br />
zu schaff en, für all jene, die sich noch mit<br />
dem auslaufenden Diplom-Studiengang<br />
herumschlagen müssen. Ein weiterer<br />
Beitrag zeigt die Schwächen der starren<br />
Konzeption der Erweiterungscurricula<br />
Beratung:<br />
Montag 16-19 h, Mittwoch 11-14 h<br />
im Kommunikationszentrum der StV (KOZ)<br />
am Institut, Zimmer 221<br />
Off enes Plenum:<br />
Montags ab 19.00 im KOZ<br />
Kontakt:<br />
Mail: stv.powi@oeh.univie.ac.at<br />
Tel: +431 4277/47709 (zu den Beratungszeiten)<br />
Web: www.univie.ac.at/politikwissenschaft/strv<br />
Impressum: HochschülerInnenschaft an der Universität Wien<br />
Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien<br />
Studienvertretung Politikwissenschaft<br />
Universitätsstraße 7/2. Stock, Zi. A221, 1010 Wien<br />
auf, die im Vergleich zu dem freien Wahlfachsystem<br />
einem Rückschritt gleichkommt.<br />
Im Fragen- und Antwort- Teil<br />
sollen häufi g aufkommende Unklarheiten<br />
beseitigt werden.<br />
Der inhaltliche Teil widmet sich den<br />
demokratiepolitischen Ungeheuerlichkeiten,<br />
die sich aktuell in Venezuela abspielten,<br />
sowie der Situation bezüglich<br />
des iranischen Atomprogramms, die sich<br />
sogar noch bedrohlicher, als bisher angenommen<br />
darzustellen scheint.<br />
Wie immer bitten wir, last but not<br />
least, um Infos aus allen Bereichen, in denen<br />
wir etwas für euch tun können und<br />
laden herzlich ein, am Plenum oder beim<br />
Powi-Frühstück vorbeizuschauen.<br />
Eure Studienvertretung<br />
Politikwissenschaft<br />
Jeden zweiten Mittwoch im Monat fi ndet von 11 bis 14 Uhr ein Powi-Frühstück mit Kaff ee, Tee, Kuchen etc. im<br />
KOZ statt. Kommende Termine: 04.03., 08.04., 13.05., 10.06.<br />
Ihr fi ndet die aktuellen Termine immer auch auf unserer Homepage. Schaut vorbei!<br />
Inhalt<br />
Einladung zum Wochenendseminar .................................................................................................................................................. 3<br />
Please free me from this liberation ................................................................................................................................................... 4<br />
Frequently Asked Questions - Semesterbeginn ............................................................................................................................... 5<br />
Frequently Asked Questions - Höhersemestrige ............................................................................................................................. 6<br />
Die Tristesse der Erweiterungscurricula ........................................................................................................................................... 7<br />
Venezuela 2009 - Wenn Demokratie sich selbst abschaff t ............................................................................................................. 8<br />
Anmerkungen zum auslaufenden Diplom-Studium der Politikwissenschaft ............................................................................... 9<br />
Für Techno, Koks und Adorno ......................................................................................................................................................... 10<br />
We stop killing you in Iraq... you allow us to carry on with our nuclear programme ................................................................ 11<br />
Utopie als Werkzeug in Politik, Kultur und Religion ..................................................................................................................... 12
Einladung zum Wochenendseminar<br />
„Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen“ (Karl Marx)<br />
Letztes Semester veranstaltete die<br />
Studienvertretung Politikwissenschaft<br />
ein Seminar, in dem sich die Teilnehmenden<br />
kritisch mit postmodernen<br />
Theorien auseinandersetzten. Eine der<br />
Feststellungen war, dass ein „Abschied<br />
von den großen Erzählungen“ auch<br />
der Abschied von einer emanzipatorischen<br />
und materialistischen Kritik ist.<br />
Die moderne, universale Gesellschaft<br />
ist im Wesentlichen eine kapitalistische.<br />
Das Bewusstsein darüber tritt,<br />
gerade in Zeiten der Weltwirtschaftskrise,<br />
wieder verstärkt hervor.<br />
Die Krise<br />
ExpertInnen sämtlicher Art streiten<br />
wieder einmal darüber, wer denn<br />
„schuld“ sei an der weltumspannenden<br />
Krise. Dabei sind Manager und Spekulanten<br />
sofort ins Visier der plötzlichen<br />
„AntikapitalistInnen“ geraten.<br />
Es wird eine Beschränkung ihrer Gehälter<br />
gefordert; manche ManagerInnen<br />
zeigen sich sogar reuig und demütig<br />
und warnen ihre KollegInnen vor<br />
Egoismus und sonstigen moralischen<br />
Makeln. Dem Kapitalismus stellt man<br />
dann noch ein neues (möglichst negativ<br />
behaftetes: Heuschrecken-, Kasino-,<br />
Börse-...) Wort voran – und fertig<br />
ist die „Kritik“. Das Schlechtfunktionieren<br />
wird dem Willen ein paar We-<br />
niger angelastet und ein starker Staat<br />
als Allheilmittel gefordert. Nicht erkannt<br />
wird dabei, dass die bestehende<br />
blinde Einrichtung der Gesellschaft<br />
eine unvernünftige und an sich schon<br />
krisenhafte ist und wie alle bisherigen<br />
Gesellschaften auf dem Leid eines<br />
Großteils der Menschheit beruht.<br />
Die Warenform<br />
Diese Erkenntnis ist keine neue,<br />
sondern mindestens 142 Jahre alt. Zu<br />
dieser Zeit erschien Karl Marx‘ „Das<br />
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie“.<br />
Marx hat damit eine radikale<br />
Kritik der Gesellschaft geleistet.<br />
Indem er grundlegend die kapitalistische<br />
Produktionsweise analysiert und<br />
erkennt, dass diese Ausbeutung und<br />
Herrschaft in sich trägt und von seiner<br />
Konstitution her in sich tragen muss.<br />
Marx war dabei kein alternativer Ökonom,<br />
der die Anleitung zu einem etwaigen<br />
„fair trade“ lieferte: seine Analyse<br />
ist zugleich Kritik. Die Erkenntnis<br />
ergibt sich ex negativo – wie es nicht<br />
sein soll.<br />
Durch den Kapitalismus wurden historisch<br />
die Möglichkeiten für Freiheit<br />
und Glück jedes/r Einzelnen geschaffen,<br />
noch aber gilt es diese zu verwirklichen.<br />
Die Überwindung der Waren-<br />
So funktioniert die<br />
Bücherbörse:<br />
Bei uns findest du über 10.000<br />
Bücher und Skripten mit<br />
Schwerpunkt auf geistes-, kultur,<br />
human- und sozialwissenschaftlichen<br />
Fächern. Bücher die du<br />
nicht mehr brauchst, kannst du<br />
bei uns auf Kommissionsbasis<br />
verkaufen.<br />
Du kannst bis zu zehn Bücher<br />
pro Woche bei uns vorbeibringen.<br />
Ein Buch, das du in die Bücherbörse<br />
stellst, darf maximal<br />
den halben Neupreis kosten.<br />
Deine Bücher können ein Jahr<br />
in der BüBö stehen, im letzten<br />
Monat wird der Verkaufspreis<br />
auf die Hälfte reduziert. Unverkaufte<br />
Bücher, die nach einem<br />
form ist eine Voraussetzung dafür.<br />
In diesem Sinne, veranstaltet die<br />
Stv. Politikwissenschaft dieses Semester<br />
ein Seminarwochenende, bei dem<br />
es um eine einführende Beschäftigung<br />
mit der Kritik der politischen Ökonomie<br />
gehen soll. Florian Ruttner und<br />
Alex Gruber werden dazu einen einführenden<br />
Vortrag halten. Zusammen<br />
werden Texte gelesen und diskutiert.<br />
Dabei soll es aber nicht bei allzu trockener<br />
Theorie bleiben. Es wird zudem<br />
eine gemütliche Atmosphäre angeboten,<br />
die auch die Gelegenheit zu<br />
Unterhaltung und Spaß bietet.<br />
Wann & Wo<br />
Das Ganze findet vom 27.-29.März<br />
in St. Radegund (Steiermark) statt.<br />
Für Verpflegung und Mitfahrgelegenheiten<br />
wird gesorgt.<br />
Alle Interessierten sind herzlich<br />
dazu eingeladen teilzunehmen!<br />
Anmeldung unter:<br />
stv.powi@oeh.univie.ac.at<br />
Jahr nicht abgeholt werden, gehen<br />
an die BüBö - und wandern in die 50-<br />
Cent-Kiste.<br />
Öffnungszeiten<br />
(während des Semesters)<br />
Mo 12 bis 19 Uhr<br />
Di - Fr 11 bis 17 Uhr<br />
NIG, 1., Universitätsstraße 7, Erdgeschoss<br />
Telefon: 01/4277-19506<br />
buecherboerse@oeh.univie.ac.at<br />
www.univie.ac.at/buecherboerse<br />
3
Please free me from this liberation<br />
Als „historischer Moment“ wurde die<br />
Annahme des Initiativantrags 809 mit den<br />
Stimmen von SPÖ, FPÖ und Grünen bei der<br />
Parlamentssitzung am 24.09.2008 bezeichnet.<br />
Es gab Standing-Ovations, nicht nur in<br />
den ZuseherInnenreihen, begleitet von lang<br />
anhaltendem Geklatsche und Gejubel. Danach<br />
wurde frohgemut verkündet, die Studiengebühren<br />
seien hiermit „abgeschafft“, der<br />
„freie Hochschulzugang“ wieder hergestellt<br />
und insgesamt die Welt um ein gutes Stück<br />
verbessert. Vor allem jene, die die Abschaffung<br />
schon eineinhalb Jahre zuvor zu einem ihrer<br />
wichtigsten Wahlziele erklärt hatten, konnten<br />
sich nun mit Lorbeeren schmücken. Die<br />
zeitliche Nähe des Antrags zum<br />
Wahltermin war natürlich kein Zufall,<br />
wurden bei eben jener Sitzung<br />
des Nationalrates ja auch viele weitere<br />
schmackhafte Wahlzuckerl<br />
beschlossen, die der WählerInnenschaft<br />
in den Rachen geworfen werden<br />
konnten. Und vielleicht war es<br />
ja tatsächlich dieser Antrag, der der<br />
SPÖ bei der Nationalratswahl wenige<br />
Tage später den entscheidenden<br />
Stimmenvorteil gegenüber der<br />
ÖVP brachte.<br />
Da der Antrag so knapp vor Semesterbeginn<br />
abgestimmt wurde,<br />
treten die darin beschlossenen Änderungen<br />
erst mit Sommersemester<br />
2009 in Kraft. Doch was genau wurde<br />
eigentlich beschlossen? Sind die<br />
Studiengebühren wirklich abgeschafft? Oder<br />
wurden die Studierenden der österreichischen<br />
Unis vielleicht wieder einmal „verarscht“, wie<br />
schon so oft bei diversen Gesetzesänderungen<br />
der letzten Jahre (1)?<br />
4<br />
Warum die “Abschaffung” der Studiengebühren mehr Mist anschafft als wegschafft<br />
Neu gemacht statt abgeschafft<br />
Abgeschafft, wie man sich das sinngemäß<br />
denken könnte, wurden die Studiengebühren<br />
nämlich keineswegs. Liest man sich das „Bundesgesetzblatt<br />
der Republik Österreich“ vom<br />
2. Jänner 2009 (2) zur „Veränderung der Studienbeitragsverordnung“<br />
durch, hat man eher<br />
den Eindruck es mit einer Fülle von Ausnahmeregelungen<br />
und undurchsichtigen Paragraphen<br />
zu tun zu haben, als mit der schlichten<br />
Erklärung: Studiengebühren abgeschafft. Davon<br />
ist nämlich in dem Gesetzestext nirgends<br />
die Rede. Es gibt lediglich eine sogenannte<br />
„beitragsfreie Zeit“, eine gewisse Zeitdauer<br />
also, in der Studierende keinen Studienbeitrag<br />
zu entrichten haben. Diese Zeit ist die Mindeststudiendauer<br />
des jeweiligen Studiums,<br />
zuzüglich zwei Toleranzsemester pro Studienabschnitt<br />
für Diplomstudien bzw. pro Studium<br />
bei Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien.<br />
So weit, so gut. Man würde meinen,<br />
diese Regelung ist nicht viel anders als jene der<br />
Familienbeihilfe, die Studierende ja ebenfalls<br />
nur beziehen können, wenn sie sich in einem<br />
gewissen zeitlichen Rahmen befinden. Beides<br />
also hält Studierende dazu an, möglichst rasch,<br />
möglichst zielstrebig, letztlich möglichst effizient<br />
zu studieren um so möglichst rasch für<br />
eine Eingliederung in den allgemeinen Ver-<br />
wertungsprozess zur Verfügung zu stehen.<br />
Es gibt allerdings einen entscheidenden<br />
Unterschied zwischen diesen beiden Regelungen.<br />
Für das Finanzamt genügt ein gewisser<br />
Studienerfolg (Mindeststudiendauer plus<br />
zwei Toleranzsemester sowie mindestens acht<br />
Semesterstunden pro Jahr) in einem, dem so<br />
genannten Hauptstudium. Wird dieser erbracht,<br />
können Studierende theoretisch für<br />
beliebig viele weitere Studien inskribiert sein<br />
und darin Fächer belegen. Die Regelung für<br />
die „beitragsfreie Zeit“ bezieht sich jedoch<br />
auf alle inskribierten Fächer und untergräbt<br />
so jeglichen interdisziplinären Ansatz. Nichts<br />
zahlen müssen nur all jene, die brav ein Studium<br />
absolvieren und sich dabei nach keinen<br />
anderen Studienrichtungen umblicken, die ihr<br />
Studium vielleicht sinnvoll ergänzen oder ihm<br />
auch diametral entgegengesetzt sein könnten,<br />
was beides zu einer „Horizonterweiterung“,<br />
zu einem Blick über den Tellerrand der mehr<br />
oder weniger strikten Studienpläne führen<br />
kann. Und wehe man beschließt, zwei Studien<br />
zu studieren, mit dem Hintergedanken beide<br />
zu Ende zu bringen. Denn dafür müsste man<br />
mit beiden Studien immer in der Mindeststudiendauer<br />
plus Toleranzsemester bleiben.<br />
So wird die „Mindeststudiendauer“, „die ursprünglich<br />
gedacht [war] als Mindestzeit die<br />
ein/e Studierende/r auf der Uni verbringen<br />
muss, um überhaupt Anspruch auf einen akademischen<br />
Grad zu haben“, (3) als Regelstudienzeit<br />
präsentiert, ungeachtet der „Durchschnitsstudiendauer“,<br />
die erstere immer um<br />
einige Semester übertrifft.<br />
Wer genug verdient, muss auch<br />
nicht zahlen?!<br />
Neben den Voraussetzungen,<br />
die man zu erfüllen hat, um in die<br />
„beitragsfreie Zeit“ zu fallen, gibt<br />
es einige weitere Umstände, unter<br />
denen man auf Erlass der Studiengebühren<br />
ansuchen kann. Abgesehen<br />
davon, dass dies mit einem relativ<br />
hohen bürokratischen Aufwand<br />
verbunden ist, gehen auch diese<br />
Regelungen völlig an der Lebensrealität<br />
der Studierenden vorbei. So<br />
kann man um Erlass der Studiengebühren<br />
ansuchen, wenn man im<br />
vorangehenden Semester gearbeitet<br />
hat, allerdings nur wenn das „Jahreseinkommen<br />
(...) zumindest 4.886,14<br />
Euro oder mehr“ beträgt. „Dieser<br />
Betrag wird jährlich angepasst und entspricht<br />
dem höchstmöglichen Jahreseinkommen bei<br />
geringfügiger Beschäftigung.“(4) Warum nur<br />
Studierenden, die das ganze Jahr zumindest<br />
geringfügig beschäftigt waren – denn nichts<br />
anderes bedeutet diese Regelung (5) – vom Studienbeitrag<br />
befreit werden sollen, andere aber,<br />
die nur einige Monate geringfügig beschäftigt<br />
waren, vielleicht aber auch das ganze Jahr um<br />
weniger Verdienst gearbeitet haben, weiterhin<br />
zahlen müssen, entbehrt jeder Logik. Warum<br />
also das Nachgehen einer bezahlten Beschäftigung<br />
erst ab einer bestimmten verdienten<br />
Summe den Studienerfolg beeinflusst und das<br />
Studium verzögert, ist völlig unklar.<br />
Um Befreiung vom Studienbeitrag können<br />
weiters ansuchen: Schwangere, Studierende,<br />
die mit Kinderbetreung beschäftigt sind, Studierende<br />
die Präsenz- oder Zivildienst absolvieren,<br />
Studierende, die durch eine langdauernde<br />
Krankheit eingeschränkt wurden und ▼
▼<br />
Behinderte. Sie alle müssen Nachweise für<br />
den jeweiligen Befreiungsgrund bringen, was<br />
in einigen Fällen unangenehm und belastend<br />
sein kann, und dann auf die langsam mahlenden<br />
Mühlen der Bürokratie hoffen.<br />
Finanzielle Situation der Unis<br />
Die finanzielle Situation der Universitäten<br />
ist seit Jahren prekär, hat sich aber nun vor allem<br />
durch die drastische Kürzung der Mittel<br />
des FWF (Fonds zur Förderung wissenschaftlicher<br />
Forschung) noch mehr verschlechtert.<br />
(6) Hier ist anzumerken, dass bei der Einführung<br />
der Studiengebühren das Budget der<br />
Universitäten insgesamt um genau jenen Betrag<br />
gekürzt wurde, den die Studiengebühren<br />
einbrachten, es wurden also in Wahrheit nur<br />
Budgetlöcher „gestopft“ (7). Dies führte zu einem<br />
extrem konkurrierenden Verhältnis der<br />
Unis, da sich das neue Budget unter anderem<br />
daraus errechnete, wie viel Studierende eine<br />
Uni hatte, also wie viel sie durch die Studiengebühren<br />
einnehmen konnte. Für die Universität<br />
Wien bedeutete das einen Gewinn, für<br />
viele kleinere Unis jedoch massive Einschränkungen.<br />
Durch die neue Regelung des Studienbeitrags<br />
wird die budgetäre Situation der Universitäten<br />
zweifach verschlechtert: Einerseits<br />
durch das Wegfallen der Beträge, die nicht<br />
genügend ausgeglichen werden, andererseits<br />
aber auch durch den bürokratischen Mehraufwand<br />
all der Sonderregelungen, die die Gesetzesänderung<br />
mit sich brachte. Diese „Verwaltungskosten<br />
(...) sind voraussichtlich höher<br />
als die abgecashten Studiengebühren“ (8).<br />
Freie Bildung für alle<br />
Es wurde gezeigt, dass die Neuregelung des<br />
Studienbeitrags keineswegs eine Abschaffung<br />
der Studiengebühren bedeutet, sondern lediglich<br />
einige davon befreit. Auch gelten all diese<br />
Regelungen weder für ausländische noch für<br />
außerordentliche Studierende, auch wenn<br />
diese nur noch den „einfachen“ Studienbeitrag<br />
zu entrichten haben.<br />
Es gibt viele Gründe, die gegen diese Neuregelungen<br />
sprechen, die nicht zuletzt innnerhalb<br />
einer kapitalistischen Verwertungslogik<br />
argumentieren, etwa das Bestehen auf Interdisziplinarität<br />
und das Hinweisen auf die<br />
anfallenden Kosten aufgrund des Bürokratieaufwands.<br />
Bildung selbst und der Zugang zu ihr sollten<br />
frei sein. Frei für alle, egal welchem Geschlecht,<br />
welcher Herkunft, welcher sozialen<br />
Schicht entstammend, und frei von jeglichen<br />
Zwängen und Hierarchien. Dieses Idealbild,<br />
so unrealistisch es scheint, darf in der Argumentation<br />
um Studiengebühren nicht vergessen<br />
werden, will man nicht gänzlich der<br />
marktwirtschaftlichen Logik verfallen. Klar<br />
ist, dass dieser Idealzustand mit der momentanen<br />
Beschaffenheit der Verhältnisse nicht<br />
zu vereinbaren ist, was seine Forderung um<br />
nichts weniger kräftig macht, da er letztlich<br />
auch immer ihre Abschaffung miteinbezieht.<br />
Infos auf einen Blick:<br />
http://www.oeh.univie.ac.at/studieren/studiengebuehren/studiengebuehren-ein-ueberblick.html<br />
(1) so wurden beispielsweise durch das UG 2002 gleich<br />
zwei Ebenen der studentischen Mitbestimmung<br />
gestrichen, nämlich die direkte Wahl der Fakultäts<br />
– und die der Bundesebene<br />
(2) zu finden zum Beispiel hier: www.sbg.ac.at/ver/links/<br />
bgbl/2009b003.<strong>pdf</strong><br />
(3) http://www.gras.at/index.php?option=com_content&t<br />
ask=view&id=85&Itemid=31<br />
(4) http://www.oeh.ac.at/studieren/rund_ums_geld/<br />
studiengebuehren/<br />
(5) http://votacomunista.at/news/article.<br />
php/20090115125334578: „Diese Grenze entspricht<br />
genau deinem Jahreseinkommen, wenn du 2008<br />
durchgehend geringfügig beschäftigt warst und<br />
mindestens die Geringfügigkeitsgrenze von monatlich<br />
€ 349,01 verdient hast - 12 Monate € 349,01 + “13. und<br />
14. Gehalt” ergibt € 4886,14“<br />
(6) http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/briefdes-praesidenten_20090127.html<br />
(7) http://www.univie.ac.at/unique/?tid=331<br />
(8) http://votacomunista.at/news/article.<br />
php/20090115125334578<br />
Frequently Asked Questions - Semesterbeginn<br />
Welche Lehrveranstaltungen sollte ich im ersten<br />
Semester besuchen?<br />
Im STEP I müssen insgesamt drei Vorlesungen besucht<br />
werden. Die STEP I ist eine gemeinsame sozialwissenschaftliche<br />
Studieneingangsphase. Das heißt, dass verschiedene<br />
Institute der Uni Wien daran beteiligt sind. Wundert euch<br />
also nicht, wenn die Vorlesungen von anderen Instituten angeboten<br />
werden. Sie zählen selbstverständlich auch für das<br />
Politikwissenschaft Studium.<br />
• a1: 220060 VO Sozialwissenschaften und gesellschaftlicher Wandel: aktuelle<br />
Debatten.<br />
ab FR. 13.3.09 13:00-14:30 Hs. I NIG<br />
• a2: 220061 VO Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie<br />
ab MI. 11.3.09 14:00-16:00 C1 Campus<br />
• a3: 230011 VO Grundlagen sozialwissenschaftlicher Denkweisen<br />
ab MO. 20.4.09 10:00-13:00 Audi Max<br />
Der STEP II besteht aus der Informationsveranstaltung,<br />
einer Vorlesung und einem Proseminar. Es muss wiederum<br />
nur eines der Proseminare ausgewählt werden.<br />
• b1: 210043 UE Informationsveranstaltung<br />
ab 2.-6.3.09; 9:00-17:00. Hörsaal D, Unicampus Hof 10<br />
Regina Köpl<br />
• b2. 210044 VO BA2.2: VO Methoden und Elemente des politikwissenschaftlichen<br />
Denkens und Arbeitens<br />
ab FR. 6.3.09; 11.00-13:00. Hs. I NIG<br />
Tamara Ehs, Johann Dvorák, Markus Marterbauer, Roland Atzmüller<br />
• BA2.3 PS Methoden und Elemente des politikwissenschaftlichen Denkens<br />
und Arbeitens: Wähle eines aus folgenden PS:<br />
210145 Florian Ruttner, Alexander Gruber ab 10.3.2009<br />
Di 11:30-15:00 Hs. 1 (A212), NIG 2. Stock<br />
210146 Manuela Grabner, Rudolf Werneth ab 10.3.2009<br />
Di 16:45-20:00 Hs. 1 (A212), NIG 2. Stock<br />
210147 Jakob Rosenberg, Jaschar Randjbar ab 13.3.2009<br />
Fr 16:45-20:00 Hs. 1 (A212), NIG 2. Stock<br />
210148 Stephan Grigat, Bernhard Weidinger ab 9.3.2009<br />
Mo 9:45-13:00 Hs. 1 (A212), NIG 2. Stock<br />
210149 Roland Atzmüller, Andreas Grünewald ab 12.3.2009<br />
DO 15:00-18:00 Hs. III NIG Erdgeschoß<br />
Wann und für was muss ich mich anmelden?<br />
Die Anmeldefrist beginnt am 24.2.2009 (8:00) und endet am<br />
3.3.2009 (16:00). Es ist kein First-Come-First-Serve-System, das<br />
heißt, dass der Anmeldezeitpunkt keine Rolle spielt.<br />
Im Rahmen des STEP I und STEP II ist eine Anmeldung nur<br />
für das Proseminar (b3) und die Informationsveranstaltung (b1) not-<br />
5
6<br />
wendig.<br />
Was ist der Unterschied zwschen einer Vorlesung und<br />
einem Proseminar?<br />
Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen ohne Anwesenheitspflicht.<br />
Die Prüfung findet am Ende des Semesters in der Prüfungswoche<br />
statt. Proseminare sind prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen.<br />
Das heißt, dass Anwesenheitspflicht besteht und während<br />
des Semester immer wieder kleinere Aufgaben (z.B.: Referat, Rezension,<br />
etc.) zu erledigen sind. Die Beurteilung erfolgt nicht über<br />
eine Prüfung, sondern ergibt sich aus den abgegebenen Arbeiten,<br />
der Mitarbeit und einer Abschlussarbeit. Der Abgabetermin für<br />
diese Abschlussarbeit ist jeweils der 30.6. (bzw. der 30.11. im Sommersemester)<br />
und darf von der/dem LehrveranstaltungsleiterIn<br />
nicht verkürzt werden.<br />
Woher bekomme ich die Lernunterlagen?<br />
Die meisten LehrveranstaltungsleiterInnen verwenden mittlerweile<br />
das eLearning-System, das online Portal der Universität<br />
Wien. Die Verwendung wird in der Informationsveranstaltung erklärt.<br />
Dort befinden sich dann die zu lesenden Texte als .<strong>pdf</strong>-Dokument.<br />
Falls die LehrveranstaltungsleiterInnen einen Reader bereit<br />
stellen, ist dieser normalerweise in der Buchhandlung Facultas im<br />
NIG zu finden.<br />
Was ist das NIG?<br />
Das NIG ist das „Neue Institutsgebäude“. Es befindet sich in der<br />
Universitätsstraße 7, gleich ums Eck vom Hauptgebäude der Uni<br />
Wien. Im zweiten Stock des NIG befindet sich auch das Institut<br />
für Politikwissenschaft.<br />
Zur Orientierung und finden von Räumlichkeiten hilfreich:<br />
http://www.wegweiser.ac.at<br />
Was ist die StV?<br />
Die Studienvertretung (StV) ist die gewählte studentische Vertretung<br />
am Institut. Sie wird von 5 MandatarInnen der Basisgruppe<br />
Politikwissenschaft gestellt. Die Studienvertretung beschränkt sich<br />
nicht ausschließlich auf Service- und StudentInnenpolitik, sondern<br />
befasst sich darüber hinaus vor allem auch mit gesellschaftspolitisch<br />
relevanten und aktuellen Themen. Dazu gehören Veranstaltungen,<br />
Diskussionsrunden und inhaltliche Seminare. Hierbei bieten wir<br />
Einführungen zu Themengebieten wie Gesellschafts- und Wertkritik<br />
oder Geschlechterverhältnis an. Abgehalten wurden z.B. Seminare<br />
zu Faschismustheorien, Antisemitismus, Psychoanalyse als<br />
„politische Psychologie“, „Grundlagen der Gesellschaftskritik“ und<br />
„Erziehung zur Mündigkeit“.<br />
Wie du uns erreichen kannst, erfährst du auf unserer Homepage:<br />
http://www.univie.ac.at/politikwissenschaft/strv/index.html<br />
Wo bekomme ich Informationen zum Studium?<br />
Die wichtigste Internet-Seite für Studierende ist die Homepage der<br />
Studienprogrammleitung (SPL). Sie ist über die Homepage des Instituts<br />
für Politikwissenschaft (http://politikwissenschaft.univie.ac.at) unter<br />
der Rubrik „Studium“ zu erreichen.<br />
Frequently Asked Questions - Höhersemestrige<br />
Muss ich mich für Vorlesungen anmelden?<br />
Außer für die STEP I Vorlesungen und die Informationsveranstaltung<br />
musst Du Dich für keine Vorlesungen (zumindest auf der<br />
POWI) anmelden.<br />
Ich bin jetzt im 2. Semester (Bakk.). Welche Lehrveranstaltungen<br />
soll ich besuchen?<br />
Im Prinzip kannst Du es Dir völlig frei einteilen welche Lehrveranstaltungen<br />
Du besuchst. Eine Übersicht welche Lehrveranstaltungen<br />
zu besuchen sind, findest Du hier:<br />
http://spl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/spl21/Stundentafeln/<br />
Stundentafel_Bachelor_Politikwissenschaft_neu.<strong>pdf</strong><br />
Woher weiß ich welche Lehrveranstaltungen dieses Semester<br />
angeboten werden?<br />
Die Lehrveranstaltungen die jedes Semester angeboten werden,<br />
stehen im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis, welches Du (für<br />
das SS09) hier findest:<br />
http://online.univie.ac.at/vlvz?kapitel=2101&semester=S2009<br />
Die Methoden-Vorlesungen (Qualitative und Quantitative<br />
„Methoden der Empirischen Sozialforschung“) stehen<br />
gar nicht im Bachelorstudienplan? Muss ich die besuchen?<br />
Soll ich die besuchen?<br />
Du musst sie zwar nicht besuchen, es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert<br />
sie zu besuchen (am besten gleichzeitig mit der dazugehörigen,<br />
gleichnamigen, Übung). Wenn Du die Prüfung absolvierst,<br />
dann kannst Du sie Dir im Rahmen der Erweiterungscurricula (siehe<br />
unsere Infobox in dieser Ausgabe) anrechnen lassen.<br />
Wieso werden im Bachelorstudium dieses Semester<br />
(SS09) so wenige Spezialisierungsmodule angeboten?<br />
Der Grund ist dass das Bachelorstudium ja relativ neu ist und deshalb<br />
der Bedarf für Spezialisierungsmodule noch nicht so groß. Im<br />
kommenden Wintersemester wird sich die Situation entspannen.<br />
Falls Dich keines der angebotenen Themen interessiert, kannst Du<br />
auch schon ein oder zwei Praktika (als Praxis-/Spezialisierungsmodule)<br />
absolvieren. Siehe unten.<br />
Beim Diplomstudium ist ja eine fremdsprachige Lehrveranstaltung<br />
zu besuchen. Muss dies eine prüfungsimmanente<br />
Lehrveranstaltung (SE, PS, UE, etc.) oder kann<br />
es auch eine Vorlesung (VO) sein? Kann die auch in den<br />
Freien Wahlfächern enthalten sein (z.B. Sprachkurs)?<br />
Du hast hier die völlig freie Auswahl und kannst die fremdsprachige<br />
Lehrveranstaltung auch im Rahmen der Freien Wahlfächer<br />
absolvieren.<br />
Muss ich ein Praktikum absolvieren, oder ist das freiwillig?<br />
Im Diplomstudium musst Du ein Forschungspraktikum machen<br />
(welches dann für ein beliebiges G-Modul anrechenbar ist und das<br />
dortige Seminar und noch eine weitere Lehrveranstaltung ersetzt).<br />
Im Bachelorstudium kannst Du bis zu zwei Praktika Dir als Praxis-/Spezialisierungsmodule<br />
anrechnen lassen. Dazu musst Du Dir<br />
das Praktikum aber erst von der Studienprogrammleitung genehmigen<br />
lassen. Ein Praktikum kannst Du beispielsweise bei einer<br />
NGO, NPO und staatlichen oder privaten Institution absolvieren<br />
(Beispiele: Global 2000, Asyl in Not, Stadt Wien, WIFO). Es muss<br />
ein Ausmaß von mindestens 4 Wochen zu je 38,5 Wochenstunden<br />
oder 8 Wochen zu 20 Wochenstunden haben. Außerdem musst Du<br />
einen Praktikumsbericht abliefern.
Die Tristesse der Erweiterungscurricula<br />
Von Freien Wahlfächern, Erweiterungscurricula, Strukturzwängen und Kostengründen...<br />
Vor 10 Jahren gab es an der Universität<br />
Wien noch die kombinationspflichtigen<br />
Studien (AHStG 1992, welche auf<br />
der Politikwissenschaft gerade ausgelaufen<br />
sind). Bei diesen Studien wurde<br />
ein Hauptfach (z.B. POWI) mit einem<br />
dazu passenden Nebenfach (z.B. Geschichte<br />
oder Philosophie) kombiniert<br />
und alle dafür jeweils vorgesehenen<br />
Lehrveranstaltungen mussten absolviert<br />
werden. Das änderte sich dann<br />
Übergangsregelungen für<br />
Erweiterungscurricula<br />
Nachdem nicht alle Studienrichtungen<br />
bis zum Wintersemester 08 Erweiterungscurricula<br />
angeboten haben<br />
(z.B. die Politikwissenschaft) gibt es<br />
eine Übergangsregelung die bis zum<br />
30. September 2009 noch gilt. Ursprünglich<br />
sollte diese Regelung nur<br />
bis zum 30. September 2008 gelten,<br />
aber aufgrund der derzeitigen Situation<br />
an der Uni Wien, ist es vor kurzem<br />
glücklicherweise gelungen, die<br />
Übergangsfrist noch mal um ein Jahr<br />
zu verlängern. Dadurch ist es möglich<br />
interessante, zusammenhängende<br />
Lehrveranstaltungen zu einem Erweiterungscurriculum<br />
zu kombinieren.<br />
Allerdings gibt es dazu auch ein paar<br />
Einschränkungen. So besagt die Übergangsregelung<br />
(die unter http://spl.<br />
univie.ac.at/index.php?id=34448 abrufbar<br />
ist) dass die Lehrveranstaltungen<br />
„sinnvolle Ergänzung oder Vertiefung<br />
des Politikwissenschaftsstudiums<br />
darstellen“ müssen und zusammen<br />
eine „sinnvolle didaktische Einheit<br />
ergeben“. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen<br />
mit Anrechnungen gehen<br />
wir aber davon aus, dass das sehr liberal<br />
gehandhabt werden wird. Wer sich<br />
unsicher ist kann entweder bei Studi-<br />
anstaltungen zu besuchen). Um die<br />
armen unmündigen Studis nicht zu<br />
verwirren, kam die Uni bald auf die<br />
glorreiche Idee, Lehrveranstaltungen<br />
(nämlich in der Regel die langweiligsten<br />
und uninteressantesten, also kurz<br />
die sogenannten ,,Einführungsveranstaltungen”)<br />
einer Studienrichtung als<br />
beim ,,neuen” Diplomstudienplan, in<br />
welchem das Nebenfach einfach durch<br />
48 SStd. freie Wahlfächer ersetzt wurde.<br />
Bis auf manche Einschränkungen<br />
(z.B. Beschränkung der Fächer auf gewisse<br />
andere Studienrichtungen) waren<br />
diese Wahlfächer tatsächlich ,,frei” und<br />
es wurde einem ermöglicht z.B. wirklich<br />
nach Interesse zu studieren (was<br />
einem allerdings auf der anderen Seite<br />
durch die katastrophalen Rahmenbe-<br />
enassistent Michael Mühlböck nachfragen<br />
(Sprechstunden finden sich<br />
auf der Seite der Studienprogrammleitung:<br />
http://spl.univie.ac.at/index.<br />
php?id=5752) oder uns ein Mail schreiben:<br />
stv.powi@oeh.univie.ac.at<br />
Die Lehrveranstaltungen sollten aus<br />
Studienrichtungen kommen die der<br />
POWI „verwandt“ sind. Also geistes-<br />
, kultur- und sozialwissenschaftliche,<br />
aber auch rechts- und wirtschaftswissenschaftliche.<br />
Laut Studienprogrammleitung<br />
gehen folgende Studienrichtungen<br />
auf jeden Fall in Ordnung:<br />
Erziehungswissenschaft, Geschichte,<br />
Internationale Entwicklung, Kommunikationswissenschaft,<br />
Kultur- und<br />
Sozialanthropologie, Philosophie,<br />
Soziologie, Sprachkurse (die an einer<br />
Einrichtung universitären Charakters<br />
absolviert werden), Rechtswissenschaft,<br />
Wirtschaftsstudien. Dabei<br />
müssen aber nicht alle Lehrveranstaltungen<br />
aus derselben Studienrichtung<br />
kommen, sondern es können Lehrveranstaltungen<br />
aus verschiedenen Studienrichtungen<br />
kombiniert werden.<br />
Es ist also auch möglich sich Lehrveranstaltungen,<br />
die z.B. an der WU<br />
absolviert wurden, anzurechnen. Insgesamt<br />
können maximal 30 ECTS<br />
sogenannte ,,Wahlfachmodule” für<br />
andere Studienrichtungen zu organisieren.<br />
Solange diese Module nur eine<br />
Empfehlung blieben, welche Lehrveranstaltungen<br />
denn gut zusammenpassen<br />
würden, war das natürlich nur ein<br />
Vorteil (inkl. Erwähnung der absolvierten<br />
Wahlfachmodule im Diplomzeug-<br />
dingungen, wie etwa völlig überfüllte<br />
Proseminare in einigen Studienrichtungen,<br />
etwa der Politikwissenschaft, dann<br />
auch wieder verunmöglicht wurde).<br />
Die Regelung der Freien Wahlfächer<br />
war äußerst angenehm und studierendenfreundlich.<br />
Es ermöglichte sowohl<br />
ein Studium nach Interesse (möglichst<br />
interessante Lehrveranstaltungen zu<br />
besuchen), als auch ein Studium nach<br />
Faulheit (möglichst einfache Lehrver-<br />
angerechnet werden, entweder zusammen<br />
oder in zwei 15er Modulen (natürlich<br />
kann auch nur ein Modul zu 15<br />
ECTS angerechnet werden). Bei mehr<br />
als 15 oder 30 ECTS wird einfach abgerundet.<br />
Die früher in den Übergangsregelungen<br />
stehende prüfungsimmanente<br />
Lehrveranstaltung (also Seminar,<br />
Proseminar oder Übung) ist nicht<br />
mehr notwendig. Es ist also möglich<br />
sich nur Vorlesungen als ein Erweiterungscurriculum<br />
anzurechnen.<br />
Die qualitativen und quantitativen<br />
Methoden Vorlesungen („Methoden<br />
der empirischen Sozialforschung“)<br />
sind ja im regulären Studienplan nicht<br />
vorgesehen und können deshalb auch<br />
im Rahmen der Erweiterungscurricula<br />
angerechnet werden. Ebenso die<br />
Ringvorlesung aus dem letzten Semester<br />
„Zur Aktualität der Kritischen<br />
Theorie“, sowie die diessemestrige<br />
Ringvorlesung „Quer zur Wirklichkeit<br />
- Kritische Theorie und Gesellschaftskritik“.<br />
Wir empfehlen allen, von dieser<br />
Übergangsregelung Gebrauch zu machen,<br />
da sie zumindest (siehe nebenstehender<br />
Artikel) ein bisschen „Studieren<br />
nach Interesse“ ermöglicht.<br />
nis). Bei den Erweiterungscurricula ist<br />
es nur leider nicht mehr optional...<br />
Was passiert, wenn sich Regulierungswahn<br />
mit Strukturzwängen und<br />
Sparmaßnahmen paaren, sieht man<br />
beim Konzept der Erweiterungscurricula<br />
(EC), welches derzeit noch völlig<br />
7
8<br />
unausgegoren zu sein scheint: Jede Studienrichtung<br />
bietet ein oder mehrere<br />
EC im Ausmaß von 10 bis 30 ECTS an<br />
(idR. ein ,,Basic”-EC mit 15 ECTS und<br />
ein darauf aufbauendes EC mit weiteren<br />
15 ECTS). Ein EC besteht aus mehreren<br />
Lehrveranstaltungen, die (idR.)<br />
fix vorgegeben sind und alle erfolgreich<br />
absolviert werden müssen um ein EC<br />
abzuschliessen. Eine Auswahlmöglichkeit<br />
von Lehrveranstaltungen innerhalb<br />
eines EC besteht in der Regel<br />
nicht (Ausnahme: das Politikwissenschafts-EC).<br />
Da Erweiterungscurricula<br />
nur Kosten und Verwaltungsaufwand<br />
für die sie jeweils anbietenden Institute<br />
bedeutet, ist es natürlich im Interesse<br />
eines jeden Instituts nur möglichst<br />
kostengünstige Lehrveranstaltungen<br />
(sprich Vorlesungen) in ein Erweiterungscurriculum<br />
hineinzunehmen und<br />
das Erweiterungscurriculum insgesamt<br />
möglichst so abstoßend zu gestalten,<br />
dass die Studierenden doch lieber ein<br />
EC von einer anderen Studienrichtung<br />
nehmen. So findet sich in den ganzen<br />
60 derzeit aktiven Erweiterungscurricula<br />
die es derzeit an der Uni Wien<br />
gibt keine einzige prüfungsimmanente<br />
Lehrveranstaltung (also z.B. Proseminare,<br />
Seminare, Übungen), sondern<br />
ausschließlich Vorlesungen. War es bei<br />
Venezuela 2009<br />
Wenn Demokratie sich selbst abschafft<br />
Nachdem Chavez erster Versuch das<br />
Limit für die Wiederwahl in das Präsidentenamt<br />
abzuschaffen im Dezember<br />
2007 fehlgeschlagen war, gelang es ihm<br />
die Bevölkerung Venezuelas im Vorfeld<br />
der Abstimmung am 16. Februar<br />
von seiner Sache zu überzeugen.<br />
54,3 Prozent der Wahlberechtigten<br />
stimmten der Verfassungsänderung<br />
zu, die dem Venezuelanischen Präsidenten<br />
erlaubt beliebig oft hintereinander<br />
zur Wiederwahl anzutreten.<br />
Das bedeutet noch nicht, dass<br />
Chavez tatsächlich, wie er es angeblich<br />
beabsichtigen soll, bis 2049<br />
Präsident bleibt – denn er muss<br />
auch in Zukunft durch Wahlen im<br />
Amt bestätigt werden. Es bedeutet<br />
allerdings, dass die Macht, die er in<br />
seiner Person konzentriert, stetig<br />
anwachsen wird, was eine ernsthafte<br />
Gefährdung der Demokratie<br />
darstellt. Die Beschränkung der Amtsperioden<br />
der Regierungsoberhäupter in<br />
den Freien Wahlfächern sogar noch<br />
verpflichtend einen gewissen Anteil an<br />
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen<br />
zu haben (auf der Politikwissenschaft<br />
z.B. 12 SStd.) so wurde dies<br />
bei den EC aus Kostengründen ,,wegrationalisiert”.<br />
Für Leute die ihr Studium<br />
möglichst schnell hinter sich bringen<br />
wollen um sich am Arbeitsmarkt verwerten<br />
zu lassen und für eine Universität<br />
die mit möglichst hohen AbsolventInnenzahlen<br />
punkten möchte sicher<br />
von Vorteil. Für Leute die (zumindest<br />
auch) aus Interesse studieren aber eine<br />
schiere Katastrophe. Ist doch das Verständnis<br />
einer Materie ausschließlich<br />
über Vorlesungen, meistens nicht zu<br />
vermitteln.<br />
Ein Studieren nach Interesse wird<br />
aber derzeit nicht nur strukturell<br />
(durch überfüllte Lehrveranstaltungen<br />
und ,,Kosten sparen” an allen Ecken<br />
und Enden) sondern auch ganz prinzipiell<br />
verunmöglicht. Kleines Beispiel:<br />
Du findest das Proseminar XY der Studienrichtung<br />
Z, das nächstes Semester<br />
angeboten wird, unglaublich interessant<br />
und willst es unbedingt machen<br />
- obwohl Du weisst dass es Dir nichts<br />
bringen wird, weil es ja im Rahmen der<br />
EC nicht anrechenbar ist. Was also<br />
Demokratien erfüllt nämlich den Zweck<br />
die übermäßige Vormachtstellung einer<br />
Person im Staat zu verhindern und<br />
somit die Gewaltenteilung in einem<br />
„Ich will in Freiheit aufwachsen und in meinem Land Venezuela<br />
andere Präsidenten kennenlernen.“<br />
Gleichgewicht zu halten. Dass dieses<br />
Gleichgewicht in Venezuela schon jetzt<br />
tun? Dich normal mit Deiner POWI-<br />
Studienkennzahl übers Anmeldesystem<br />
dafür anmelden bringt nichts, weil<br />
Du zurückgereiht werden wirst, weil<br />
das Anmeldesystem Leute mit der Studienkennzahl<br />
f ür Z vorziehen wird. Z<br />
inskribieren würde zwar funktionieren,<br />
aber Du wirst Dich nicht mit Z anmelden<br />
können, weil Du ja die Studieneingangsphase<br />
für Z nicht fertig absolviert<br />
hast. Kurzum: Dumm gelaufen.<br />
Tatsächlich bieten die EC aber auch<br />
durchaus Vorteile: War bei den Freien<br />
Wahlfächern noch eine gewisse ,,Fächerverwandtschaft”<br />
(z.B. geistes- und<br />
sozialwissenschaftliche Fächer) notwendig,<br />
so entfällt dies bei den EC<br />
völlig. Es ist also kein Problem das EC<br />
,,Ägyptologie” oder ,,Numismatik” für<br />
POWI zu verwenden. Auch dass bei<br />
den Freien Wahlfächern notwendige<br />
und relativ lästige Anrechnen entfällt.<br />
Das eigentliche Potential von EC würde<br />
aber in interdisziplinären Erweiterungscurricula<br />
liegen. Ein bereits existierendes<br />
Beispiel wäre das EC ,,Psychoanalyse”,<br />
bei der allerdings bis vor<br />
kurzem noch nicht alle notwendigen<br />
Lehrveranstaltungen zur Verfügung<br />
standen. Aus Kostengründen?<br />
nicht mehr vorhanden ist, zeigt, was im<br />
Vorfeld der Abstimmung zur Verfassungsänderung<br />
geschah: Auf den offiziellen<br />
staatlichen Websites wurde das<br />
Referendum beworben und entgegen<br />
der staatlichen Gesetzgebung<br />
wurde im staatlichen Fernsehen und<br />
Radio rund um die Uhr pro-Chavez<br />
Werbung gemacht, wohingegen der<br />
Opposition keine Sendezeit zur<br />
Verfügung gestellt wurde. Wenn<br />
diese Handhabung des politischen<br />
Wettbewerbs durch die staatlichen<br />
Medien bereits ein Vorgeschmack<br />
auf den nächsten Präsidentschaftswahlkampf<br />
ist, dann ist klar, dass<br />
wesentliche Elemente dessen, was<br />
Demokratie bedeutet, in Venezuela<br />
bereits abhanden gekommen sind:<br />
Pluralismus von Parteien und Ideen,<br />
Zugänglichkeit zu unterschiedlicher<br />
Information, Pressefreiheit und<br />
schließlich die Option einen Präsidenten<br />
auch wieder abzuwählen.
Anmerkungen zum auslaufenden Diplom-<br />
Studium der Politikwissenschaft<br />
Das Diplomstudium Politikwissenschaft läuft bekanntlich langsam aber sicher aus. Am 30.4.2012 muss<br />
das Studium, inklusiv benoteter Diplomarbeit und zweiter Diplomprüfung spätestens abgeschlossen<br />
sein.<br />
Grundkurse: Gibt‘s nicht<br />
mehr<br />
Das Auslaufen macht sich mittlerweile<br />
vor allem im ersten Abschnitt<br />
bemerkbar: Es werden kaum mehr<br />
Lehrveranstaltungen angeboten. Dieses<br />
Sommersemester wird es auch das<br />
erste Mal keine Grundkurse (C1-C4)<br />
geben. Als Alternative wird die Studienprogrammleitung<br />
allerdings Vorlesungen<br />
anbieten, bzw. gewisse Vorlesungen<br />
auf C „umwidmen“. In diesen<br />
Vorlesungen gibt es – wie üblich bei<br />
Vorlesungen – keine Anwesenheitspflicht.<br />
Das Anmelden und Absolvieren<br />
der Prüfung ist ausreichend.<br />
Wir empfehlen euch stark zumindest<br />
den ersten Abschnitt des Diplomstudiums<br />
so schnell wie möglich abzuschließen,<br />
da es in Zukunft sicherlich<br />
noch weniger Angebot geben wird.<br />
Tristere Studienbedingungen<br />
Doch auch für StudentInnen, die<br />
bereits im zweiten Abschnitt sind,<br />
Mit Freud. Gesellschaftskritik und Psychoanalyse<br />
Während Kritische Theorie, die sich auf die Psychoanalyse<br />
stützt, stets an Freuds Orthodoxie festhielt, waren es vornehmlich<br />
Linke, die dessen Lehre revidierten und sie mit<br />
verbalradikalem Gestus von einem radikalen Medium der<br />
Aufklärung zu einem der praktischen<br />
Anpassung an die bestehenden Verhältnisse<br />
machten. Wesentliche Erkenntnisse<br />
der Psychoanalyse, wie die<br />
Bedeutung des Unbewussten, der Verdrängung,<br />
sowie die infantile Sexualität,<br />
wurden zurückgenommen, und dadurch<br />
den „revolutionären Vorstößen der unbequemen<br />
Psychoanalyse“ (Freud) der<br />
Stachel gezogen.<br />
stellt sich die Situation immer trister<br />
dar. Für dieses Semester hat das<br />
Rektorat die Mittel für die Lehre im<br />
Diplomstudium stark gekürzt, was ihr<br />
sicherlich schon alle im VVZ gesehen<br />
habt.<br />
Wir haben uns dafür eingesetzt,<br />
dass mehr Seminare für das Grundlagenmodul<br />
(F) angerechnet werden<br />
und die Studienprogrammleitung ist<br />
dem auch nach gekommen.<br />
Kompaktkurse<br />
Wie auch schon in den letzten Semestern<br />
gibt es wieder die Möglichkeit<br />
der Kompaktkurse. Die Anmeldung<br />
erfolgt getrennt von der regulären Anmeldefrist<br />
während des kommenden<br />
Semesters. (Bitte entnehmt die genauen<br />
Fristen der Homepage der Studienprogrammleitung)<br />
Die Kompaktkurse<br />
werden für die qualitativen und quantitativen<br />
Methodenkurse (E1 und E2)<br />
angeboten.<br />
Am Ende des Studiums<br />
Allgemein müssen wir euch leider<br />
daran erinnern, die Zeit bis zum Auslaufen<br />
des Studiums nicht zu unterschätzen.<br />
Gerade am Ende des Studiums<br />
gilt es noch allerhand bürokratische<br />
Hürden zu nehmen, die jeweils<br />
einige Wochen dauern und z.T. nur<br />
nacheinander erledigt werden können.<br />
(Anrechnung der freien Wahlfächer,<br />
Bestätigung über den Abschluss<br />
des zweiten Abschnitts, Benotung<br />
der Diplomarbeit inkl. elektronischer<br />
Plagiatsüberprüfung, etc.) Außerdem<br />
müsst ihr davon ausgehen, dass die<br />
Diplomprüfungstermine gegen Ende<br />
des Studiums sehr begehrt sein werden<br />
und es sicherlich zu Verzögerungen<br />
kommen wird.<br />
Kein Grund zur Panik<br />
Nichtsdestotrotz besteht noch kein<br />
Grund zur Panik, es sind schließlich<br />
noch drei Jahre. Macht euch nur klar,<br />
dass es bei derzeitigem Stand der Dinge<br />
keine Möglichkeit geben wird nach<br />
30.4.2012 abzuschließen.<br />
Gerade an der Zurücknahme der<br />
gesellschaftskritischen Implikationen der Psychoanalyse<br />
zeigt sich auch heute ihre Verwobenheit ins falsche<br />
Ganze. Freud hingegen bot Aufklärung über die Familie als<br />
Elementarform der Gesellschaft, und er stärkte zugleich das<br />
Individuum, das aus der Familie hervorgeht, gegenüber dieser<br />
Gesellschaft. Daran hat jede Kritik sich zu messen, die ihrem,<br />
von Marx bis zur Kritischen Theorie geprägten Begriff<br />
gerecht werden möchte und dem Zwang des repressiven Kollektivs<br />
die freie Assoziation der Individuen entgegensetzt.<br />
Göllner, Renate/Radonic, Ljiljana (Hg.): Mit Freud. Gesellschaftskritik und<br />
Psychoanalyse, Ça ira-Verlag, Freiburg 2007, 200 Seiten, 13,50 €, ISBN:<br />
3924627-99-1<br />
9
Für Techno, Koks und Adorno<br />
Zur Ringvorlesung „Quer zur Wirklichkeit“ - Kritische Theorie und Gesellschaftskritik<br />
Wer die Kritische Theorie schätzt<br />
oder sich zumindest für sie interessiert,<br />
verfolgte wohl die Ringvorlesung,<br />
die letztes Semester auf der<br />
Politikwissenschaft stattgefunden hat.<br />
Die Veranstaltung trug den Titel „zur<br />
Aktualität der Kritischen Theorie“ - in<br />
der Beschreibung war davon die Rede zu<br />
prüfen, wie zeitgemäß die insbesondere<br />
von Adorno und Horkheimer entwickelte<br />
Theorie noch wäre. Dieser Frage wurde<br />
anhand von unterschiedlichen Themen<br />
wie etwa Politik und Ökonomie, Ges<br />
chlechterverhältnissen und Ökologie<br />
nachgegangen, um schließlich auch<br />
nach Verbindungslinien zu anderen<br />
Theorieströmungen zu suchen.<br />
Vor lauter Gramsci und Foucault<br />
und anderer kritischer Theorie mit<br />
kleinem „k“ blieb bei jenen, die die<br />
Kritische Theorie schätzen oder sich<br />
zumindest für sie interessieren ein<br />
Bedürfnis, sich vertiefender mit dem<br />
Kern der Angelegenheit zu befassen.<br />
Diesem Wunsch soll dieses Semester<br />
entsprochen werden.<br />
„Quer zur Wirklichkeit“ - Kritische<br />
Theorie und Gesellschaftskritik<br />
lautet der Titel der dieses Semester<br />
stattfindenden Ringvorlesung, die sich<br />
ausschließlich mit der Kritischen Theorie<br />
beschäftigen wird – mit Adorno und der<br />
Psychoanalyse, mit Marxismus aber<br />
auch mit der Filmtheorie von Kracauer,<br />
der Literatur von Kraus und anderen<br />
Erzeugnissen der Kulturindustrie. Alles<br />
was Spaß macht ist also dabei. Behandelt<br />
werden aber auch Themenbereiche, die<br />
wegen ihrer fortwährenden Aktualität<br />
weniger erfreuen; der von Adorno<br />
10<br />
vorgenommen Analyse des autoritären<br />
Charakters werden sich gleich zwei<br />
Vorträge widmen und eine Kritik und<br />
Analyse des Antisemitismus bildet einen<br />
zentralen Punkt der Lehrveranstaltung.<br />
Des weiteren wird nach den Bezügen<br />
von Wien zur Frankfurter Schule<br />
gefragt werden. Dabei bietet sich an,<br />
das Verhältnis des Winerkreises zur<br />
Kritischen Theorie in den Blick zu<br />
nehmen, wobei sich eine soziale und<br />
inhaltliche Nähe zeigen wird, die<br />
größer ist als häufig angenommen. Die<br />
Auftaktveranstaltung befasst sich, ganz<br />
in diesem Sinne, mit Adornos Zeit in<br />
Wien von 1925-1926 und mit seinen<br />
zahlreichen Beziehungen zu Wien.<br />
Enden wird die Lehrveranstaltung dort,<br />
wo auch die Kritische Theorie endet:<br />
bei der Postmoderne.<br />
Um euch nicht mit dieser Fülle<br />
an Themen zu überfordern, finden,<br />
begleitend zur Lehrveranstaltung,<br />
drei Tutoriums-Abende statt, die sich<br />
entlang der zentralen Themenkomplexe<br />
Psychoanalyse, Kritik des<br />
Antisemtismus und schließlich<br />
Kulturindustrie orientieren werden.<br />
Dort sollen die zugrundelegenden<br />
theoretischen Annahmen noch weiter<br />
vertieft und entwickelt werden. Die<br />
Lehrveranstaltung als Ganzes sollte also<br />
sowohl neu und spannend für jene sein,<br />
die sich bereits mit Kritischer Theorie<br />
und ihren theoretischen Fundierungen<br />
bestens auskennen, gleichzeitig aber<br />
auch jenen, die noch wenig bis gar keine<br />
Ahnung haben, mehr als nur einen<br />
Einblick vermitteln.<br />
Veranstaltungsreihe Sommersemester 2009:<br />
19. März, Carl Smith: BDSM & Political Correctness (Lecture in English)<br />
14. Mai, Lars Quadfasel: Verhältnis des bürgerlichen Subjekts zu seiner Sexualität<br />
im postfaschistischen Deutschland & Österreich<br />
04. Juni, Ljiljana Radonic: Sexualität im Nationalsozialismus<br />
Für mehr Infos, siehe:<br />
http://www.univie.ac.at/politikwissenschaft/strv<br />
Vorlesungsplan<br />
jeweils im HS I, NIG<br />
• 19.03.09 Johann Dvořák:<br />
Adorno und Wien<br />
• 26.3.09 Gerhard Scheit:<br />
Frühe Kritische Theorie<br />
• 02.04.09 Esther Marian:<br />
Siegfried Kracauer<br />
• 23.04.09 Karl Müller:<br />
Frankfurter Schule und Wiener<br />
Kreis<br />
• 30.04.09 Ljiljana Radonic:<br />
Psychoanalyse und „Studien zum autoritären<br />
Charakter“<br />
• 07.05.09 Irina Djassemy:<br />
„Studien zum autoritären Charakter“<br />
• 14.05.09 Stephan Grigat:<br />
Kritik des Antisemitismus<br />
• 21.05.09 Gerhard Scheit:<br />
„Dialektik der Aufklärung“<br />
• 28.05.09 Irina Djassemy:<br />
Karl Kraus<br />
• 04.06.09 Johann Dvořák:<br />
Walter Benjamin und die Kritische<br />
Theorie<br />
• 11.06.09 Ingo Elbe: Kritische<br />
Theorie und Arbeiter_innenbewegung<br />
• 18.06.09 Florian Ruttner/<br />
Alex Gruber: Kritische Theorie und<br />
die Postmoderne<br />
Prüfungsmodalitäten<br />
Als Leistungsnachweis ist ein Essay<br />
im Umfang von 8-12 Seiten zu<br />
verfassen.
„We stop killing you in Iraq... you allow us to<br />
carry on with our nuclear programme“<br />
Die Berichte über das iranische Atomprogramm, die sich in letzter Zeit häufen, sind beunruhigend. Ende<br />
Februar berichtete die IAEA, dass der Iran bereits genug Uran besitzt um eine Atombombe zu bauen.<br />
Zeitgleich scheint das iranische Regime eine neue Verhandlungsstrategie entwickelt zu haben: „Wenn ihr<br />
uns das Nuklearprogramm fortführen lasst, hören wir auf, euch im Irak zu töten.“<br />
Der Iran hat in letzter Zeit genügend<br />
Überraschungen zu bieten und<br />
sichert sich seine Spitzenreiterrolle in<br />
den Schlagzeilen. Den ersten Überraschungseffekt<br />
erzielte die Berichterstattung<br />
über den Abschuss einer<br />
Saphir-2 Rakete, die sich als Trägerin<br />
eines atomaren Sprengkörpers eignet,<br />
Anfang Februar. Ebenfalls im Laufe<br />
des Februar stellte die Internationale<br />
Atomenergiebehörde erstaunt fest,<br />
dass der Iran ein Drittel mehr Uran besitzt,<br />
als bisher angenommen worden<br />
war. Mit der Menge von einer Tonne<br />
hat der Iran, der UNO zufolge, genügend<br />
Uran für den Bau von Atomwaffen<br />
angereichert.<br />
Nahezu zeitgleich erschien ein Bericht<br />
auf BBC, in dem John Sawers,<br />
der Britische UNO-Botschafter, Informationen<br />
aus privaten Verhandlungen<br />
mit Vertretern des iranischen Regimes<br />
preisgibt. In diesen Verhandlungen,<br />
die in London, Paris und Berlin stattgefunden<br />
hatten, hatten die Iraner den<br />
jeweiligen europäischen Regierungen<br />
gegenüber ihr „Engagement“ bei Terroranschlägen<br />
im Irak zugegeben und<br />
zugleich den Deal angeboten, dieses<br />
im Gegenzug für die Beendigung der<br />
Einmischung der EuropäerInnen in das<br />
iranische Atomprogramm einzustellen.<br />
“We stop killing you in Iraq, stop undermining<br />
the political process there,<br />
you allow us to carry on with our nuclear<br />
programme without let or hindrance”,<br />
zitiert Sawers die iranischen<br />
Vermittler auf BBC (siehe http://news.<br />
bbc.co.uk/2/hi/europe/7901101.stm).<br />
Am 12. Juni wird im Iran ein neuer<br />
Präsident gewählt. Um nicht den Anschein<br />
entstehen zu lassen, es handle<br />
sich hier um eine demokratische Wahl,<br />
sei erwähnt, dass man im Iran zwischen<br />
jenen Männern auswählen kann, die<br />
vom sogenannten Wächterrat, einem<br />
mächtigen Gremium, das die Einhaltung<br />
der Prinzipien des Islam gewährleistet<br />
und damit die Richtung der politischen<br />
Entwicklung des Iran vorgibt,<br />
zugelassen werden. Zur kommenden<br />
Wahl werden unter anderen der derzeitige,<br />
als Hardliner geltende Präsident<br />
Mahmud Ahmadinedschad und Mohammad<br />
Khatami antreten.<br />
Mohammad Khatami, der bereits<br />
von 1997 bis 2005 Iranischer Präsident<br />
gewesen war, war bei seinem letzten<br />
Aufenthalt in Wien gegen die Proteste<br />
Zum aktuellen Stand des Immergleichen<br />
Dialektik der Kulturindustrie – vom Tatort zur Matrix<br />
Herausgegeben von Karin Lederer<br />
zahlreicher Studierender auch als Redner<br />
an der Universität Wien geladen.<br />
Im Rahmen der Vorlesungsreihe “Weltethos<br />
und Recht” hielt er im Festsaal<br />
der Universität Wien eine Rede, um<br />
den „kulturellen Dialog“ zu fördern. Zu<br />
den dialogfördernden Maßnahmen, die<br />
der als liberale Reformer bekannte Politiker<br />
während seiner Amtszeit als iranischer<br />
Präsident durchsetzte, zählen<br />
die Unterdrückung von Gewerkschaften,<br />
die blutige Niederschlagung der<br />
iranischen Studierendenbewegung, bei<br />
der Studierende ermordet und inhaftiert<br />
wurden, die Repression von Protestbewegungen<br />
und die Ermordung<br />
von Homosexuellen. Wie Ahmadinedschad<br />
insistiert auch Khatami auf die<br />
ungehinderte Weiterführung des iranischen<br />
Atomprogrammes. „Change“,<br />
scheint daher im Zusammenhang mit<br />
den Iranischen Präsidentschaftswahlen<br />
die falsche Hoffnung zu sein.<br />
h t t p : / / n e w s . b b c . c o . u k / 2 / h i / m i d d l e _<br />
east/7866357.stm<br />
http://www.nytimes.com/2009/02/20/world/<br />
middleeast/20nuke.html?_r=1<br />
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7901101.<br />
stm<br />
Abrufdatum aller Onlinequellen: 23. Februar<br />
2009<br />
Nicht ob Kulturindustrie heute noch funktioniert, sondern wie, dieser Frage gehen die Texte in diesem Sammelband<br />
nach. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Kriminalreihe „Tatort“, den Serien „Star Trek“, „CSI“, „Desperate<br />
Housewives“ sowie den Filmen „Spiderman“ und „Herr der Ringe“. Diese Produkte der Kulturindustrie werden einerseits<br />
als spezielle Ausdrucksformen gesellschaftlicher Verhältnisse kritisiert. Andererseits aber nehmen die Beiträge bei aller<br />
notwendigen Kritik an Schematismus und Standardisierung auch den der Kulturindustriekritik immanenten Bezug auf<br />
die Besonderheiten des Materials und dessen geschichtliche und gesellschaftliche Spezifik ernst.<br />
Mit Beiträgen von Tobias Ebbrecht, Renate Göllner, Karin Lederer, Florian Ruttner und Gerhard Scheit.<br />
Erscheint im Oktober 2008 im Verbrecher Verlag. Broschur, ca. 220 Seiten, 15 €<br />
ISBN 978-3-940426-16-1<br />
11
Utopie als Werkzeug in Politik, Kultur und<br />
Relgion<br />
Vortragsreihe im Institut für Wissenschaft und Kunst<br />
Alles Reden über das Ende der Utopien beweist zumindest<br />
eines: Vorüber ist noch lange nichts. Auch wenn die<br />
großen gesellschaftlichen Entwürfe in der realpolitischen<br />
Umsetzung gescheitert sind, die Funktion der Utopie als<br />
Hoffnungsträgerin und handlungskonstituierendes Moment<br />
bleibt. Aber wie ge-brauchen wir Utopien eigentlich?<br />
Davon ausgehend, dass ihre vorrangige Funktion darin<br />
besteht, Diskurse über ethisches, moralisches und politisches<br />
Handeln, also über das gute Leben in der guten Gesellschaft,<br />
zu strukturieren, möchte diese Vortragsreihe<br />
nachzeichnen, wie Utopien als Werkzeug zur Vermittlung<br />
entsprechender Wertvorstellungen in verschiedenen gegenwärtigen<br />
Diskursen eingesetzt werden, nämlich in Religion,<br />
Politik und Popkultur.<br />
Donnerstag, 7. Mai, 18.30h<br />
Keine Aussicht?<br />
(von Linda Kreuzer, Odin Kroeger & Niki Staritz)<br />
im IWK, Berggasse 17, 1090 Wien<br />
Normen spiegeln einerseits gesellschaftliche Verhältnisse<br />
wider, weisen aber andererseits über diese hinaus, sind in<br />
diesem Sinne utopisch. Sie zeichnen ein Bild einer kommenden,<br />
besseren Gesellschaft, das sie legitimiert, formen<br />
dabei aber auch Realität. Umgekehrt sind in all diesen Bildern<br />
auch Normen eingezeichnet. Je nachdem wie Utopien<br />
(oder Dystopien) ausgemalt werden, evolutionär oder revolutionär,<br />
technisch oder gesellschaftlich, implizieren sie<br />
eine andere Moral. Was sind die Wechselwirkungen zwischen<br />
Wirklichkeit und Utopie, welche Grenzen werden<br />
gezogen und wo können sie überschritten werden?<br />
Montag, 18. Mai, 18.30h<br />
Radikalisierte Utopie in der Religion<br />
(von Peter Zeillinger)<br />
im IWK, Berggasse 17, 1090 Wien<br />
„Ich misstraue der Utopie, ich will das Un-Mögliche“ (J.<br />
Derrida). Radikalität bedeutet nicht immer das Schrecklichste,<br />
den Terror, sondern meint zunächst ein Aus-den-<br />
Wurzeln-Leben und -Handeln. Utopie andererseits ist vielleicht<br />
ebenfalls ungenügend ernst genommen, wenn sie nur<br />
als Ausdruck einer stets fernen Zukunft verstanden wird.<br />
Sowohl zeitgenössische politisch-philosophische wie auch<br />
politisch-theologische Ansätze sind sich dessen bewusst<br />
und suchen den Welt-verändernden Blick daher im konkreten<br />
Hier und Jetzt. Was aber wären „Wurzeln“ einer solchen<br />
Utopie? Wurzeln eines Un-Möglichen, das die Welt nicht<br />
nur anders interpretiert, sondern tatsächlich zu verändern<br />
vermag? Der Vortrag geht dieser Frage in einem großen Bogen<br />
einheitlicher Motive von der biblischen Tradition des<br />
12<br />
AT und NT bis zu den Konsequenzen für ein angemessenes<br />
„postmodernes“ Denken nach.<br />
Dienstag, 09.Juni, 19.00h<br />
Schrift – Umschrift – Wieder-Einschrift:<br />
Das Ereignis der Kunst<br />
(von Andrea Wald)<br />
im Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien<br />
Der Vortrag widmet sich der Frage nach den Bedingungen<br />
der Möglichkeit des Ereignisses der Kunst. Im Speziellen<br />
sollen dabei die Potentiale und Grenzen des Kunst-<br />
Werks erforscht werden, dessen spezifisches Vermögen,<br />
durch seine zwei Seiten – dem Beharren, Verharren, Sein-<br />
Lassen sowie der aktiven Partizipation und Intervention<br />
– die bestehende Ordnung zu hinterfragen wie auch den<br />
Weg für das Neue, das Kommende zu öffnen. Das Ereignis<br />
des Kunst-Werks soll dabei nicht als creatio ex nihilo verstanden<br />
werden, sondern als eine beständige Bearbeitung<br />
des status quo, die ein verändertes Verständnis von Utopie<br />
verlangt – abseits teleologischer oder heilsgeschichtlicher<br />
Konzeptualisierungen. Verdeutlicht werden soll diese Arbeit<br />
an einer immanenten Utopie anhand der Forderungen,<br />
Anliegen und Potentiale der Do-it-Yourself-Bewegung und<br />
ihrer KünstlerInnen.<br />
Montag, 22. Juni, 18.30h<br />
Bis an den Rand der Vorstellungskraft!<br />
Science Fiction als Experimentierraum<br />
feministischer Utopien<br />
(von Ruth Müller, & Lisa Sigl)<br />
im IWK, Berggasse 17, 1090 Wien<br />
Science Fiction erlaubt es, sich eine Zukunft jenseits<br />
dessen, was als Grenzen körperlicher, politischer und wirtschaftlicher<br />
Möglichkeiten gilt, auszumalen. Der „Fortschritt“,<br />
von dem sie erzählt, verknüpft auf verschiedenste<br />
Art wissenschaftlich-technologische und gesellschaftliche<br />
Veränderungen. Zukünfte zeichnen ist insofern auch ein<br />
politischer Akt: Grenzen werden verschoben, neue Denkräume<br />
aufgespannt und alternative Formen des Miteinander<br />
ausprobiert. Neue Ordnungen bzw. Neuordnungen werden<br />
vorstellbar und vielleicht auch lebbar. FeministInnen<br />
bietet Science Fiction daher die Möglichkeit, auszuloten,<br />
wie Welten aussehen könnten, die nicht entlang von Geschlechterdifferenz<br />
im herkömmlichen Sinne strukturiert<br />
sind. Eine Reise ins Genre der Möglichkeiten.<br />
Unterstützt von der Studienvertretung Politikwissenschaft