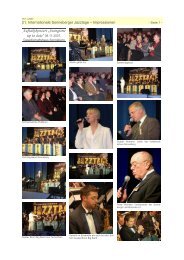Innenstadtkonzept (PDF-Datei, 45,13 MB) - Sonneberg
Innenstadtkonzept (PDF-Datei, 45,13 MB) - Sonneberg
Innenstadtkonzept (PDF-Datei, 45,13 MB) - Sonneberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T
2<br />
Auftrageber:<br />
Stadtverwaltung <strong>Sonneberg</strong><br />
Bahnhofsplatz 1<br />
96515 <strong>Sonneberg</strong><br />
Auftragnehmer:<br />
Dipl. Ing. Gabriele Langlotz<br />
Architektur und Städtebau<br />
An der Falkenburg 9a<br />
99425 Weimar<br />
PAD - Baum Freytag Leesch<br />
Architekten & Stadtplaner BDA<br />
Graben 1<br />
99423 Weimar<br />
April 2009
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Problem<br />
1.1 Einleitung<br />
1.2 methodische Anmerkungen<br />
1.3 Stadtentwicklung<br />
2 Allgemeine Planungsgrundlagen<br />
2.1 Demografische Entwicklung<br />
2.2 Vorhandene Planung<br />
2.2.1 Untere Stadt <strong>Sonneberg</strong> - vorbereitende<br />
Untersuchung/Rahmenplanung<br />
2.2.2 Bundeswettbewerb „Stadtumbau Ost“_2002<br />
2.2.3 Studie zum Stadtleitbild - GMA 2002<br />
2.2.4 Flächennutzungsplan_Fortschreibung 2004<br />
2.2.5 Studie Baulücken und Brachen in der Spielzeugstadt<br />
<strong>Sonneberg</strong> - dargestellt am Sanierungsgebiet Obere<br />
Stadt<br />
2.2.6 Einzelhandelskonzept <strong>Sonneberg</strong>; GMA<br />
Ludwigsburg_2008<br />
2.2.7 Gutachten_Umstellung der Verkehrsführung in der<br />
Innenstadt<br />
2.3 Zusammenfassung<br />
3 Rahmenbedingungen Gesamtstadt<br />
3.1 Lage und regionale Einordnung<br />
3.2 Siedlungsentwicklung/ Stadt-und Baustruktur/ Ortsbild<br />
3.3 Wirtschaft und Verkehr<br />
3.4 Infrastruktur<br />
3.5 Einzelhandel, Dienstleistungen<br />
3.6 Gewerbe<br />
3.7 Kultur<br />
3.8 Tourismus<br />
4 Analyse und Bewertung Stadtumbaugebiet<br />
4.1 Lage, Abgrenzung und Gliederung<br />
4.2 Wichtige stadtbildprägende Gebäude- und Raumsituation,<br />
Denkmale<br />
4.3 Öffentliche Räume, Freiräume<br />
4.4 Probleme von Nutzungs- und Funktionsbereichen<br />
(Problemzonen, Problemthemen)<br />
4.4.1 Wohnen<br />
4.4.2 Einzelhandel und Gastronomie<br />
4.4.3 Dienstleistungen<br />
4.4.4 Gemeinbedarf<br />
4.4.5 Gewerbe<br />
4.4.6 Einzelstandorte<br />
4.5 Intervention / Entwicklungspotenziale<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
5 Entwicklungskonzept<br />
5.1 Gesamtplan<br />
5.2 Funktionsbausteine / Gliederung<br />
5.3 Prognose / Entwicklung Baustruktur<br />
5.4 Vernetzung / Synergien<br />
5.5 Empfehlung für Teilbereiche<br />
5.5.1 Bahnhofsplatz/Woolworth-Gelände (Testentwurf)<br />
5.5.2 Schießhaus-Platz<br />
5.5.3 Güterbahnhof (Testentwurf)<br />
5.5.4 Ehemaliger Busbahnhof<br />
5.5.5 Cuno-Hoffmeister-Straße (Testentwurf)<br />
5.5.6 Sport- und Freizeitpark (Anlage 2)<br />
5.5.7 Röthen<br />
5.5.8 Ehemaliges Salzmann-Gelände (Testentwurf)<br />
6 Leitbild Innenstadt<br />
7 Zusammenfassung<br />
8 Handlungsempfehlungen<br />
9 Anmerkungen<br />
10 Anlagen<br />
Anlage 1: Einzelhandelskonzept für die Stadt<br />
<strong>Sonneberg</strong>, GMA, Ludwigsburg 2009<br />
Anlage 2: Zielplanung Sport- und Freizeitpark<br />
casparius Consulting & Management,<br />
Erfurt 2009<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
3
4<br />
1. Problem<br />
1.1. Einleitung<br />
Die Situation Thüringer Klein- und Mittelstädte wird – wie<br />
in vielen anderen deutschen Städten auch – geprägt durch<br />
demografische Veränderungen wie Bevölkerungsrückgang bzw.<br />
-stagnation, Überalterung und strukturprägende Leerstände<br />
von Wohngebäuden, Industrie- und Gewerbebrachen. Für die<br />
Stadtentwicklung ist deshalb eine von Verwaltung, Politik,<br />
Denkmalpflege, Wirtschaft und Öffentlichkeit gleichermaßen<br />
getragene Handlungsgrundlage erforderlich.<br />
Zielstellung kann es aber nicht nur sein, den Stagnations-<br />
bzw. Schrumpfungsprozess und dessen Folgen zu begleiten,<br />
sodass der Bevölkerung auch in Zukunft ein lebenswertes<br />
und bezahlbares Umfeld zur Verfügung steht, sondern auch<br />
den demographisch bedingten Einwohnerverlust durch die<br />
Gewinnung von Neubürgern zu begrenzen. Nur eine Stadt<br />
mit einem konkurrenzfähigen und nachfragegerechten<br />
Angebot an Arbeitsplätzen, Wohnraum, sozialer, kultureller<br />
und technischer Infrastruktur sowie einer intakten Umwelt hat<br />
eine Chance sich als Zentrum der Region zu behaupten. Es gilt<br />
mit den Lösungsansätzen für die Untere Stadt, <strong>Sonneberg</strong> als<br />
Mittelzentrum im Südthüringer Raum umfassend zu stärken<br />
sowie das Image der Stadt zu verbessern. Die Planungen,<br />
Vorhaben und Maßnahmen sollen Voraussetzung und Impuls<br />
für eine positive Stadt- und Regionalentwicklung sein. Dabei<br />
werden Effekte von gesamtstädtischer Bedeutung aber auch<br />
stadtteil- und quartierbezogene, kleinräumige Ansätze und<br />
Verbesserungen angestrebt. Stadtentwicklungsprobleme sind<br />
komplex, das heißt auch, dass Wirkungszusammenhänge und<br />
Zuständigkeiten deutlich gemacht, dass die Probleme den<br />
entsprechenden Instanzen zugeordnet werden müssen. Diese<br />
Komplexität macht die Raumordnung von Stadt und Umland<br />
teilweise unvorhersagbar – es müssen deshalb weniger rigide,<br />
sondern kreative und flexible Formen der Planung gefunden<br />
werden.<br />
Wichtig scheint ein unvoreingenommener Blick von<br />
außen, der Probleme und Potenziale benennt sowie<br />
Entwicklungsmöglichkeiten und Qualitäten aufzeigt.<br />
Das Konzept sollte als Orientierungshilfe und Handlungsrahmen<br />
für die nächsten 10 bis 15 Jahre aufgebaut werden und als<br />
informelle Planung folgenden Aspekten Rechnung tragen:<br />
_Stadtentwicklungsziele sind zu prüfen und ggf. neu zu<br />
definieren,<br />
_Entwicklung eines Leitbildes,<br />
_Definitionen von räumlichen und sachlichen<br />
Handlungsschwerpunkten,<br />
_Planung, Abstimmung und zeitliche Einordnung<br />
konkreter Maßnahmen.<br />
Dabei wird auf folgende Grundlagen Bezug genommen:<br />
_Vorbereitende Untersuchungen für verschiedene<br />
Stadtquartiere im Sanierungsgebiet Untere Stadt (2000),<br />
_Verkehrskonzept und Konzept zur Straßenraumge-<br />
staltung Untere Stadt (2001),<br />
_Stadtentwicklungskonzept (2002),<br />
_Konzept zur Umstellung der Verkehrsführung in der<br />
Innenstadt (2007).<br />
... der Bevölkerung auch in Zukunft ein<br />
lebenswertes und bezahlbares Umfeld zur<br />
Verfügung steht...<br />
... konkurrenzfähigen und nachfragegerechten<br />
Angebot...<br />
...das Image der Stadt zu verbessern...<br />
... es müssen deshalb weniger rigide, sondern<br />
kreative und flexible Formen der Planung<br />
gefunden werden...
Die Probleme der Stadt <strong>Sonneberg</strong>, ihre Nachteile, Vorzüge,<br />
Besonderheiten und allgemeinen Charakteristika wurden bereits<br />
mehrfach stadtplanerisch behandelt. Zwei Entwicklungsaspekte<br />
sind aus heutiger Sicht bemerkenswert: zum einen müssen<br />
Entwicklungsziele, die vor wenigen Jahren formuliert wurden,<br />
heute modifiziert werden (was nichts ungewöhnliches ist) –<br />
und zum anderen gibt es inzwischen nicht mehr genügend<br />
„Substanz“, das heißt Funktionen und Bauaufgaben, um die<br />
räumlichen Probleme rein baulich zu lösen.<br />
Bestimmte Erwartungen erweisen sich als trügerisch und<br />
Lösungsansätze als unrealistisch. Zum Beispiel fehlt es für<br />
die oft zitierten „low budget – high culture“ Aktivitäten zur<br />
Innenstadtbelebung an kreativen Personal oder die „Startups“<br />
treffen auf ein wenig inspirierendes Umfeld (und ohne<br />
entsprechende Einrichtungen und „Events“ fehlt es an Anreizen<br />
für diesen Personenkreis).<br />
Die Ausgangslage für die Entwicklung der Stadt <strong>Sonneberg</strong><br />
(verglichen mit anderen Städten und Gemeinden, besonders in<br />
den neuen Bundesländern) ist aber durchaus nicht schlecht:<br />
Die Ausstattung ist gut, wenn auch nicht überdurchschnittlich;<br />
die Arbeitslosigkeit liegt mit 6 % deutlich unter dem<br />
Landesdurchschnitt, wozu auch die verkehrsgünstige Lage zu<br />
den oberfränkischen Kommunen beiträgt. <strong>Sonneberg</strong> ist von<br />
attraktiver Landschaft umgeben, touristische Ziele sind leicht<br />
erreichbar und in den Gewerbegebieten des Stadtumlandes<br />
haben sich neue, teilweise innovative Unternehmen angesiedelt.<br />
Auch die Kaufkraft liegt über dem ostdeutschen Mittel. . .<br />
Die positiven Aspekte wiederum haben zur Folge, dass sich<br />
die Bürger weniger stark für die Stadtentwicklungspolitik<br />
engagieren (2). Deshalb muss auch nach Wegen gesucht werden,<br />
die Motivation und Bürger – Integration in diese Prozesse zu<br />
verbessern.<br />
Aus heutiger Sicht sind in früheren Planungen formulierte<br />
Ziele oft Korrektur bedürftig – die Methode, dennoch auf diese<br />
Planungen zurückzugreifen und sie erneut zu kommentieren ist<br />
aber auf jedem Fall mit Erkenntnisgewinn verbunden.<br />
Neben der Zielkorrektur und möglichen Veränderungen von<br />
städtebaulichen Leitbildern ist die Suche nach geeigneten<br />
Umsetzungsstrategien nach wie vor von besonderer<br />
Bedeutung. Gerade bei der Formulierung von Zielen und<br />
Umsetzungsstrategien muss allgemein festgestellt werden, dass<br />
die Erwartungen an die Reichweite der Planung oft zu hoch<br />
bewertet werden und von unrealistischen Endzuständen geprägt<br />
sind.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... nicht mehr genügend „Substanz“...<br />
... ohne entsprechende Einrichtungen und<br />
„Events“ fehlt es an Anreizen...<br />
...die Ausgangslage für die Entwicklung der Stadt<br />
<strong>Sonneberg</strong> durchaus nicht schlecht ist...<br />
...die Erwartungen an die Reichweite der<br />
Planung oft zu hoch bewertet werden und von<br />
unrealistischen Endzuständen geprägt sind...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
5
6<br />
1.2 Methodische Anmerkungen<br />
Ein wichtiger methodischer Aspekt war die Auswertung<br />
und, soweit möglich, Integration bereits vorhandener<br />
Planungsunterlagen.<br />
Neben den inhaltlichen und stadtspezifischen gibt es dabei<br />
das Problem, Aussagen aus unterschiedlichen Bereichen<br />
(Demografie, baulich – räumliche und Infrastruktur,<br />
Branchenstruktur usw.) zu vergleichbaren Aussagen zu<br />
verbinden. Erfahrungen haben gezeigt, dass dies im<br />
umfassenden Sinn und über einen längeren Zeitraum schwer<br />
möglich ist. So hat die Auswertung der vorhandener Unterlagen<br />
gezeigt, dass z. B. Zieldefinitionen schon nach kurzer Zeit<br />
korrektur- und überarbeitungsbedürftig sind. Inkrementelle<br />
Modelle gewinnen deshalb gegenüber längerfristigen,<br />
sequentiellen zunehmend an Bedeutung, weil sie falls<br />
erforderlich einen schnelleren Wechsel von Zieldefinitionen und<br />
Mittelwahl mit frühzeitigen Korrekturen ermöglichen.<br />
Ein weiteres Problem stellt die Informationsgewinnung dar: der<br />
Erfassungsaufwand steht oft in keinem ökonomisch vertretbaren<br />
Verhältnis zu Ergebnis und Nutzen. Die Daten müssen außerdem<br />
noch gewichtet und bewertet werden. Es ist nicht immer<br />
möglich, planungsrelevante Aussagen in vergleichbar guter<br />
Qualität und Aussagentiefe mit vertretbarem Aufwand zu<br />
gewinnen. Das heißt, es gibt die Notwendigkeit zur Abstraktion<br />
und die Verallgemeinerung untergräbt die Plausibilität der<br />
Argumentation. Andererseits bringt erweitertes Faktenwissen,<br />
ohne entsprechenden Ausbau der Problemlösungsmethoden,<br />
keine spürbare Verbesserung der Planungslogik oder der<br />
Planungsergebnisse mit sich.<br />
Als problematisch, aber unerlässlich erweisen sich Aussagen zur<br />
Gestaltung. Die Bewertung formaler Kriterien ist in hohem Maße<br />
subjektiv. Deshalb werden diese Probleme so allgemein wie<br />
möglich formuliert.<br />
Relativ einfach dagegen sind Aussagen zum Denkmalschutz:<br />
Die städtebauliche Denkmalpflege zielt auf Bewahrung der<br />
geschützten Ensemble und des historischen Stadtgrundrisses<br />
mit seinen wesentlichen Elementen (Fluchten, Raumkanten,<br />
Blickbeziehungen, Höhenentwicklung usw.). Einzeldenkmale<br />
sind zu schützen und die Abwägung im Fall von<br />
Nutzungskonflikten muss mit allen Beteiligten zugunsten des<br />
historischen, öffentlichen Erscheinungsbildes erfolgen. (7)<br />
Interessant wäre ein Vergleich zwischen der (objektiven)<br />
Stadtgestalt der <strong>Sonneberg</strong>er Innenstadt und dem (subjektiven)<br />
Stadtbild von Bewohnern und Besuchern. Eine derartige<br />
Befragung ist allerdings aufwendig und, da die Ergebnisse<br />
wenigstens teilweise vorhersehbar sind, auch nicht notwendig.<br />
Die Bearbeitung des Rahmenplans wird aber dieser Thematik<br />
wenigstens teilweise gerecht, weil eine Expertenbefragung zu<br />
den Problemen durchgeführt wurde, deren Ergebnisse in die<br />
Empfehlungen einfließen.<br />
Generell muss darauf verwiesen werden, dass der Widerspruch<br />
zwischen statischer Raumbetrachtung und der Dynamik<br />
räumlicher Veränderungen mit der herkömmlichen Methodik nur<br />
ungenügend entsprochen werden kann.<br />
In der Regel ist das nicht problematisch, weil bauliche<br />
Veränderungen relativ langsam ablaufen. (Wesentlich<br />
schneller vollziehen sich Veränderungen des Stadtbildes durch<br />
Ausstattungselemente wie Stadtmobiliar, Beleuchtung – vor<br />
allem aber öffentliche Werbung und Firmierung.)<br />
Die Datenerfassung ist immer nur eine Momentaufnahme, was<br />
sich beispielsweise beim Gebäudeleerstand und vor allem der<br />
Bewertung des Leerstands als kompliziert erweist.<br />
Es muss deshalb frühzeitig entschieden werden, welche Daten in<br />
welcher Weise relevant sind.<br />
...Probleme so allgemein wie möglich formuliert<br />
und die Argumentation durch besonders positive<br />
Beispiele unterstützt...<br />
... Als problematisch, aber unerlässlich erweisen<br />
sich Aussagen zur Gestaltung...
Bearbeitungsgebiet<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
7
8<br />
1.3 Stadtentwicklung<br />
<strong>Sonneberg</strong> hat sich im Tal der Röthen über Jahrhunderte<br />
langsam entwickelt. Die Produktion von Spielzeug, als wichtiger<br />
Erwerbszweig der Stadtbevölkerung und Ursache der späteren,<br />
unglaublich dynamischen Wirtschaftsentwicklung, ist schon früh<br />
in der Geschichte nachweisbar.<br />
Mit der industriellen Revolution am Ende des 19. Jahrhunderts<br />
und den daraus resultierenden Veränderungen der<br />
Produktions- und Lebensbedingungen hat sich auch die Stadt<br />
über ihre Grenzen hinaus vergrößert. Im Gegensatz zu den<br />
gründerzeitlichen Erweiterungen anderer Städte, etwa zur<br />
gleichen Zeit, war der entstehende neue, „untere“ Stadtteil<br />
nicht nur ein reines Wohngebiet, sondern auch Raum für<br />
neue Produktionsstätten. <strong>Sonneberg</strong>er Firmen konnten ihre<br />
Erfahrungen und die Tradition der Spielwarenherstellung zur<br />
Vermarktung und zur Entwicklung des Labels „Spielzeugstadt“<br />
einbringen.<br />
Der Unterschied zwischen den Stadtteilen, der alten Oberen<br />
und der neuen Unteren Stadt ist groß, weil neben der<br />
Gründerzeitarchitektur mit ihren Neostilen, dem städtebaulichen<br />
Raster der Stadterweiterung im Gegensatz zur linearen<br />
Entwicklung im Tal auch die offene Quartierstruktur der<br />
Neubebauung mit der weitestgehend geschlossenen Bebauung<br />
kontrastiert. Für Ortsfremde entsteht der Eindruck von<br />
zwei unabhängigen, „zusammengewachsenen“ Siedlungen<br />
mit scheinbar unabhängiger Siedlungsgeografie und<br />
Wirtschaftsgeschichte. „Die geschlossenen Straßenräume der<br />
Oberen Stadt werden aus einfach gegliederten (bis auf wenige<br />
repräsentative Häuser) schmucklosen, zwei- bis dreigeschossigen<br />
und meist traufständigen Gebäuden gebildet, während im<br />
gründerzeitlichen Teil bis zu fünfgeschossige, teilweise reich<br />
gegliederte Stadtvillen entstanden.<br />
Neben diesen Charakteristika wird ein Mangel an räumlicher und<br />
funktionaler Zentralität der Unteren Stadt, der im Widerspruch<br />
zur Baumassenentwicklung steht, erkennbar – d. h. man vermisst<br />
ein Stadtzentrum im „klassischen“ Sinn. (3)<br />
Neben den baulich – räumlichen Charakteristika gibt es<br />
entwicklungsbedingte Besonderheiten mit Auswirkungen auf<br />
die Stadtstruktur und Folgen bis in die Gegenwart. Dazu gehört<br />
der plötzliche Bruch in der Kontinuität der Spielwarenproduktion<br />
während der nationalsozialistischen Herrschaft und das damit<br />
verbundene Ende internationaler Beziehungen; die Lage<br />
bedingte Isolation der Stadt nach dem Mauerbau 1961; die De –<br />
Industrialisierungsphase nach der Vereinigung und die Krise der<br />
Spielzeugproduktion.<br />
„Das Gesamtziel lautet: Erhöhung der Attraktivität, Steigerung<br />
der Lebensqualität und damit nicht nur Verhinderung weiterer<br />
Abwanderung sondern auch die Chance von Neuansiedlungen<br />
durch eine erhöhte Anziehungskraft, ein attraktives Stadtimage.<br />
Sinkende Einwohnerzahlen und Verringerung des<br />
Gebäudebestands sind nicht grundsätzlich und per se<br />
negativ, da sie auch als Chancen für Innovationen in einer<br />
Art kulturellem Transformationsprozess verstanden werden<br />
können, der die wirtschaftlichen Veränderungen und Umbrüche<br />
begleitet. Dabei ist die Überschaubarkeit kleiner und mittlerer<br />
Städte hilfreich und die Qualität städtischer Lebensformen ist<br />
keineswegs nur an kompakte mittlere und größere Strukturen<br />
gebunden.“ (4)<br />
Im Landkreis <strong>Sonneberg</strong> leben ca. 63.000 Menschen – das<br />
ergibt mit den Einwohnern der benachbarten Landkreise<br />
Coburg mit 91.000 und Kronach mit 75.000 Einwohnern einen<br />
regionalen Siedlungsraum mit 229.000 Einwohnern. Das heißt,<br />
die Entwicklung der Stadt <strong>Sonneberg</strong>s (und ihrer Stadtteile und<br />
eingemeindeten Siedlungen) ist nicht isoliert zu sehen, sondern<br />
auch in regionaler Abhängigkeit und unter Berücksichtigung der<br />
Teilentwicklungen auf das Ganze.<br />
In den letzten Jahren wurde der demografisch und wirtschaftlich<br />
bedingte Einwohnerrückgang oft thematisiert und zum Anlass<br />
Besorgnis erregender Szenarien („Shrinking Cities“) .<br />
... räumlichen Charakteristika gibt es<br />
entwicklungsbedingte Besonderheiten mit<br />
Auswirkungen auf die Stadtstruktur und Folgen<br />
bis in die Gegenwart...<br />
...Entwicklung des Labels „Spielzeugstadt“...
SPIELZEUGSTADT_<br />
Stadtumbaugebiet Altstadt<br />
Sanierungsgebiet Obere Stadt<br />
Sanierungsgebiet Untere Stadt<br />
Stadtumbaugebiet Innenstadt<br />
Stadtumbaugebiet Wolkenrasen<br />
Stadtteil Wolkenrasen<br />
Wohnumfeldverbesserung<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
9
10<br />
Andererseits hat der Umgang mit dem Phänomen und das<br />
Nachdenken über mögliche Strategien des Stadtumbaus zu einer<br />
Reihe von pragmatischen Ansätzen geführt, die sich z. B. in der<br />
Formulierung neuer Leitlinien niederschlagen.<br />
„Es ist sicher sehr wichtig,“ schreibt beispielsweise Harald<br />
Bodenschatz in: Perspektiven des Stadtumbaus (5), „den<br />
Rückgang der Zahl der Einwohner in einer kommunalen<br />
Strategie zu berücksichtigen. Aber es ist fatal, wenn die<br />
Schrumpfung der Zahl der Stadtbewohner zur Leitlinie der<br />
Stadtentwicklungspolitik genommen wird. Ein rein quantitativer<br />
Trend sollte nicht zum Angelpunkt der Politik werden. Das<br />
wäre ein Verzicht auf die notwendige Suche nach einer neuen<br />
positiven Rolle der Stadt, nach einer neuen sozioökonomischen<br />
Basis. Leitbild Schrumpfstadt - das führt in die Irre. Notwendig<br />
ist es dagegen, eine auf die jeweilige Stadt zugeschnittene,<br />
besondere neue Rolle in einer Gesellschaft zu finden, die nicht<br />
mehr durch die Industrie strukturiert ist.“<br />
Und zur Bedeutung des Zentrums und der Stadtperipherie: „<br />
Wenn man die viel diskutierten Modellstädte des Stadtumbaus in<br />
Europa betrachtet, so fällt zuallererst auf, dass dort vor allem das<br />
Zentrum der Stadt umgebaut wird.<br />
Es ist das Zentrum, das die moderne Stadtregion nach innen wie<br />
außen repräsentiert.<br />
Die Bilder des Zentrums gehören zu den Lockmitteln des<br />
internationalen Stadttourismus und dienen als werbende<br />
Botschafter der Städtekonkurrenz. Nur das Zentrum kann diese<br />
Rolle übernehmen, Es ist einzigartig und symbolisiert das<br />
Besondere der jeweiligen Stadt, ihre Geschichte, ihre baulichen<br />
Höhepunkte, ihre wichtigsten Institutionen...Doch die Stärkung<br />
des Zentrums reicht nicht aus. Teile der übrigen Innenstadt sind<br />
nicht selten von Kaufkraftverlust, unzureichenden Investitionen<br />
und der Konzentration sozialer Probleme gekennzeichnet.<br />
Für diese Gebiete bedarf es einer eigenen Strategie, denn<br />
das Zentrum der Stadt kann sich nur weiterentwickeln, wenn<br />
die umliegenden Stadteile von dieser Entwicklung nicht<br />
abgekoppelt bleiben.“<br />
Die Untere Stadt, die Innenstadt <strong>Sonneberg</strong>s ist das Zentrum<br />
für Stadt und Landkreis – im regionalem Kontext kann<br />
<strong>Sonneberg</strong>, die <strong>Sonneberg</strong>er Innenstadt als Teilzentrum<br />
eines Wirtschaftsraums (z. B. Coburg – Kronach – <strong>Sonneberg</strong>)<br />
interpretiert werden, was eine mögliche funktionelle<br />
Spezialisierung zur Folge haben könnte.<br />
Folgende Probleme tauchen in diesem Zusammenhang immer<br />
wieder auf und müssen besprochen werden:<br />
Der Umgang mit dem Leerstand (Wohn – und<br />
Gewerbeeinheiten); der Verlust an Urbanität, Zentralität<br />
und Attraktivität; die Erlebbarkeit öffentlicher und öffentlich<br />
zugänglicher Räume (z. B. Verkaufsräume, Gasträume in<br />
Restaurants und Cafes).<br />
Wie können Stadträume und Gebäude trotz fragmentarischen<br />
Charakters der baulichen Struktur die Identifikation der<br />
Einwohner mit dem Ort stärken?<br />
Welche Maßnahmen sind dafür u. a. erforderlich?<br />
Zu den Leitlinien nachhaltiger Stadtentwicklung gehört auch<br />
die Suche nach neuen wirtschaftlichen Grundlagen für die<br />
postindustrielle Stadt der Zukunft, die deutliche Erhöhung<br />
der Attraktivität öffentlicher Räume, die Schaffung von<br />
attraktiven Wohnraum in der Innenstadt, die Einschränkung<br />
und Stabilisierung der Suburbanisierungsprozesse. Das<br />
erfordert strategische Planung, die Förderung nationalen und<br />
internationalen Erfahrungsaustauschs und die Zusammenarbeit<br />
der Beteiligten (Verwaltungs- und Planungsinstanzen, Bürger<br />
und Interessenvertretungen, private Akteure usw.).<br />
Vor besondere Probleme steht die Planung in diesem<br />
Zusammenhang, wenn sie versucht, von einer statistischen<br />
Betrachtung des Raums zur einer Analyse der Dynamik<br />
räumlicher Veränderungen überzugehen.<br />
... neue Rolle in einer Gesellschaft zu finden, die<br />
nicht mehr durch die Industrie strukturiert ist...<br />
... Es ist das Zentrum, das die moderne Stadtregion<br />
nach innen wie außen repräsentiert...<br />
... statistischen Betrachtung des Raums zur einer<br />
Analyse der Dynamik räumlicher Veränderungen<br />
überzugehen ...<br />
... neuen wirtschaftlichen Grundlagen für die<br />
postindustrielle Stadt der Zukunft...
2. Allgemeine Planungsgrundlagen<br />
2.1 Demografische Entwicklung<br />
In allen Industrieländern ist seit Jahren ein demografischer<br />
Veränderungsprozess im Gang, der durch Überalterung und<br />
Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet ist. Die Ursachen sind<br />
vielfältig und der familienpolitische Einfluss beispielsweise auf<br />
den Bevölkerungsrückgang signifikant. Klein- und Mittelstädte<br />
der ehemaligen DDR sind in besonderer Weise betroffen, weil<br />
der Überalterungsprozess mit De –Industrialisierung und damit<br />
verbundenen Migrationen und Arbeitsplatzverlusten verbunden<br />
ist.<br />
Die demografische Entwicklung wird aus dem natürlichen Saldo<br />
von Geburten – und Sterbefällen und dem Wanderungssaldo<br />
ablesbar. Bei den Wanderbewegungen werden Familien-,<br />
Bildungs- und Alterswanderung unterschieden.<br />
In einer Studie der Bertelsmann Stiftung (6) zur<br />
demografischen Entwicklung werden die untersuchten<br />
Städte nach „Demographietypen“ klassifiziert. Auffällig an<br />
der Entwicklung ist, dass trotz unterschiedlicher Typisierung<br />
die Bevölkerungsentwicklung generell ähnlich abläuft. – z.<br />
B. <strong>Sonneberg</strong> und Neustadt bei Coburg (Typ 6 – Städte im<br />
ländlichen Raum mit geringer Dynamik), Kronach (Typ 1 –<br />
stabile Mittelstadt und regionales Zentrum), Coburg (Typ ( -<br />
wirtschaftlich starke Stadt mit hoher Arbeitsplatzzentralität). D. h.<br />
demografische, wirtschaftliche, strukturelle Veränderungen sind<br />
nicht nur ein lokales oder regionales Phänomen.<br />
Aber es gibt auch Besonderheiten, die sich aus der Spezifik,<br />
Lage und Attraktivität der Städte ergeben. In <strong>Sonneberg</strong> sind<br />
beispielsweise Verluste durch Bildungswanderung höher als in<br />
der (fränkischen) Region und werden nur noch in Städten und<br />
Gemeinden des Typs 4 übertroffen („schrumpfende und alternde<br />
Städte und Gemeinden mit hoher Abwanderung (z. B. gem. (6):<br />
Rudolstadt).<br />
Apolda<br />
23.774 EW<br />
515 EW/ km 2<br />
Ilmenau<br />
26.307 EW<br />
420 EW/ km 2<br />
Meiningen<br />
21.058 EW<br />
509 EW/ km 2<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Naumburg<br />
29.025 EW<br />
382 EW/ km 2<br />
Rudolstadt<br />
24.650 EW<br />
4<strong>45</strong> EW/ km 2<br />
Saalfeld<br />
27.488 EW<br />
615 EW/ km 2<br />
1km<br />
<strong>Sonneberg</strong><br />
23.252 EW<br />
515 EW/ km 2<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
5 km<br />
11
12<br />
Innenstadt<br />
Gesamtstadt<br />
1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
Einwohnerentwicklung Einwohnerzahl 25.297 25.151Gesamtstadt 24.951 24.892 24.837 24.690 24.582 24.246 24.110 23.864 23.615<br />
1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
Einwohnerzahl 25.297 25.151 24.951 24.892 24.837 24.690 24.582 24.246 24.110 23.864 23.615<br />
26000<br />
24000<br />
26000<br />
22000 24000<br />
20000 22000<br />
20000<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
25297<br />
25297<br />
25151<br />
25151<br />
24951<br />
24892<br />
24837 Einwohnerentwicklung Gesamtstadt<br />
24690<br />
2<strong>45</strong>82<br />
24837<br />
24690<br />
2<strong>45</strong>82<br />
24246<br />
Prosperitäts- und Attraktivitätsunterschiede werden<br />
insbesondere in der Gruppe der 19 bis 24 jährigen besonders<br />
deutlich. In dieser Gruppe wird für <strong>Sonneberg</strong> bis 2025 ein<br />
Rückgang von rd. 47 Prozent prognostiziert, der damit fast<br />
doppelt so hoch wie in der Region liegt. (D. h. die anderen<br />
Städte und Gemeinden der Region verlieren ebenfalls, wenn<br />
auch nicht so deutlich, was darauf schließen lässt, dass deren<br />
Attraktivität letztendlich auch nicht mehr ausreichend ist. Das<br />
bedeutet, dass möglicherweise nur noch Ballungszentren die<br />
Erwartungen erfüllen können, die aber infrastrukturell durch<br />
diese Entwicklung überfordert werden könnten.)<br />
<strong>Sonneberg</strong>s Bevölkerungsrückgang - 2006: 23.516 EW – 2025:<br />
19.634 EW - wird (lt. Studie der Bertelsmann Stiftung) 16, 5<br />
Prozent betragen und damit zwar unter dem prognostizierten<br />
Wert für den Landkreis <strong>Sonneberg</strong> liegen (19,2 %) – aber auch<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
1.996 2.000 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
deutlich über dem Thüringer Landesdurchschnitt (14,2%).<br />
(Diese Prognosewerte liegen damit etwas höher als die<br />
prognostizierte Bevölkerungsentwicklung des Thüringer<br />
Landesamtes für Statistik – mit einem Rückgang von 12, 8 %).<br />
(Ähnliche Tendenzen gibt es auch im benachbarten<br />
Oberfranken.)<br />
EW-Entwicklung Innenstadt - Gesamtstadt<br />
Gesamtstadt<br />
100 98,2 95,9 95,3 94,3 93,4<br />
1996 1.996 1997 2.000 1998 2.003 1999 2.0042000 2.005 2001 2002 2.006 2003 2004 2005 2006<br />
100 102,8 105 105,6 105,4 105,7<br />
Einwohnerentwicklung Innenstadt/ Gesamtstadt<br />
Innenstadt<br />
Gesamtstadt<br />
100 98,2 95,9 95,3 94,3 93,4<br />
EW-Entwicklung Innenstadt - Gesamtstadt<br />
120%<br />
102,8%<br />
105,0% 105,6% 105,4% 105,7%<br />
110% 100,0% 100,0%<br />
98,2%<br />
100%<br />
102,8%<br />
100,0% 100,0%<br />
98,2%<br />
90%<br />
1.996 2.000<br />
95,9%<br />
105,0%<br />
95,9%<br />
2.003<br />
95,3%<br />
105,6%<br />
95,3%<br />
2.004<br />
94,3%<br />
105,4%<br />
94,3%<br />
2.005<br />
105,7% 93,4%<br />
93,4%<br />
2.006<br />
80%<br />
Innenstadt Gesamtstadt<br />
24951<br />
24892<br />
Einwohnerentwicklung Gesamtstadt<br />
1.996 2.000 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
100 102,8 105 105,6 105,4 105,7<br />
100 98,2 95,9 95,3 94,3 93,4<br />
EW-Entwicklung Innenstadt - Gesamtstadt<br />
1.996 2.000 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
Innenstadt Gesamtstadt<br />
24246<br />
Innenstadt<br />
24110<br />
24110<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
23864<br />
23864<br />
23615<br />
23615<br />
100 102,8 105 105,6 105,4 105,7<br />
100,0% 100,0%<br />
102,8%<br />
98,2%<br />
Das Durchschnittsalter, heute <strong>45</strong>,3 Jahre, wird sich auf 50,5<br />
erhöhen und 105,6% damit dem Landesmittel 105,4% entsprechen. 105,7% Besonders<br />
auffällig ist die Prognose bei den über 80 jährigen, deren Anteil<br />
(heute 95,9% ca. 5 Prozent) sich bis 2025 fast verdoppeln wird.<br />
95,3%<br />
94,3%<br />
Diese Entwicklung verändert auch die Erwerbstätigenquote<br />
93,4%<br />
und hat Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Die<br />
Erwerbstätigenquote lag 2006 in <strong>Sonneberg</strong> bei 56,7 Prozent mit<br />
einem 54,9 prozentigen Frauenanteil. Mit 32,2 Prozent war der<br />
Anteil 55 bis 64 jähriger Erwerbstätiger relativ hoch.<br />
Der Anteil Hochqualifizierter am Wohnort lag bei nur 6,7 Prozent<br />
(am Arbeitsort: 8,1 Prozent).<br />
105,0%<br />
1.996 2.000 2.003 2.004 2.005 2.006<br />
Innenstadt Gesamtstadt
Bevölkerungszahl _ 2006 Erwerbstätigenquote<br />
Vergleicht man <strong>Sonneberg</strong> direkt mit der nahe gelegenen<br />
(Partner-) Stadt Neustadt bei Coburg, die 2006 16.386 Einwohner<br />
hatte (und ebenfalls zum Demografietyp 6 gehört), ergibt sich<br />
folgende prognostische Wanderbewegung:<br />
Die Zahl der Zuzüge steigt in <strong>Sonneberg</strong> und Neustadt<br />
tendenziell, die Zahl der Fortzüge sinkt - unter Berücksichtigung<br />
der für 2025 prognostizierten geringeren Einwohnerzahlen.<br />
D. h. es wird mit einer geringen Mobilität gerechnet, was im<br />
Widerspruch zur gewünschten wirtschaftlichen Dynamik<br />
und der daraus resultierenden Dynamik des Arbeitsmarktes<br />
steht. In Neustadt ist das – wie auch in Kronach (Städte, die<br />
nicht nur aufgrund der Nähe, sondern auch im Bezug auf<br />
Einwohnerzahl und Stadtgröße vergleichbar sind) – auf einen<br />
relativ hohen Wohnungsanteil in Ein- und Zweifamilienhäusern<br />
zurückzuführen (54 % in Neustadt, 66 % in Kronach – dagegen in<br />
<strong>Sonneberg</strong>: 38%).<br />
Überalterung, Bevölkerungsrückgang durch Wanderungsverluste,<br />
Verlust an Arbeitsplätzen insbesondere im produzierenden<br />
Gewerbe multiplizieren sich in <strong>Sonneberg</strong> mit einem zu gering<br />
differenzierten Wohnungsangebot mit einer durchschnittlichen<br />
Wohnfläche pro Einwohner (in m 2) von 36,7, die deutlich unter<br />
denen der bayerischen Kommunen liegt (Neustadt 42,6; Kronach<br />
<strong>45</strong>,7 und Coburg <strong>45</strong>,6).<br />
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die in der Studie<br />
verwandte Gemeindetypisierung und Clusterbildung auf<br />
folgenden Variablen basiert: Bevölkerungsentwicklung,<br />
Medianalter, Arbeitsplatzzentralität und Arbeitslosenquote,<br />
Steuereinnahmen, dem Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter<br />
sowie dem Anteil von Mehrpersonenhaushalten mit Kindern.<br />
Das heißt, regionale Besonderheiten, landschaftliche oder<br />
sonstige regionale Vorzüge wie kulturelle Highlights wurden<br />
nicht berücksichtigt.<br />
(Der Wert der ansonsten nicht unumstrittenen Studie besteht<br />
in einem komplexen Bewertungsansatz, der über die übliche<br />
zentralörtliche Betrachtungsweise hinausreicht.)<br />
Die negativen Aspekte, wirtschaftliche Strukturschwäche und<br />
ungünstige demografische Entwicklung sollten jedoch mit<br />
Blick auf die regionalen Potenziale, auf die Verkehrsinfrastruktur<br />
und die landschaftliche Attraktivität der Region, relativiert<br />
werden können. Dafür müssen entsprechende Voraussetzungen<br />
geschaffen werden. Die Autoren der Studie der Bertelsmann<br />
Stiftung sehen deshalb auch die Notwendigkeit, alle denkbaren<br />
Ressourcen, insbesondere durch regionale Kooperation und<br />
bürgerschaftliches Engagement, auszuschöpfen.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... neue Rolle in einer Gesellschaft zu finden, die<br />
nicht mehr durch die Industrie strukturiert ist...<br />
... Es ist das Zentrum, das die moderne Stadtregion<br />
nach innen wie außen repräsentiert...<br />
... statistischen Betrachtung des Raums zur einer<br />
Analyse der Dynamik räumlicher Veränderungen<br />
überzugehen ...<br />
... alle denkbaren Ressourcen, insbesondere durch<br />
regionale Kooperation und bürgerschaftliches<br />
Engagement, auszuschöpfen...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
<strong>13</strong>
14<br />
Bedeutung als Arbeitsort<br />
(Anm.: Besonders interessante Zahlen sind rot hervorgehoben)<br />
Beschäftigungsentwicklung Dienstleistungssektor (%)
SPIELZEUGSTADT_<br />
2.2 Vorhandene Planung<br />
Bereits vorliegende Planungsdokumente, die sich mit der<br />
<strong>Sonneberg</strong>er Innenstadt auseinandersetzen, entstanden<br />
zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen<br />
Problem- und Zieldefinitionen. Sie können und sollen deshalb<br />
nicht miteinander verglichen werden. Die zusammenfassende<br />
Darstellung bezieht sich nur auf Aspekte, die für die künftige<br />
Entwicklung der Unteren Stadt relevant sind, und kommentiert<br />
Entwicklungslinien bzw. erforderliche –korrekturen.<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
15
16<br />
2.2.1 „Untere Stadt <strong>Sonneberg</strong>- vorbereitende<br />
Untersuchung / Rahmenplanung<br />
(Büro Gelbricht, <strong>Sonneberg</strong>)<br />
Sanierungsmaßnahmen nach § <strong>13</strong>6 BauGB dienen der<br />
Beseitigung städtebaulicher und funktioneller Missstände.<br />
Seit 1995 wurden in 2 Teilgebieten der Unteren Stadt, dem<br />
Bereich Obere und Untere Bahnhofstraße vorbereitende<br />
Untersuchungen zur Erfassung von Missständen durchgeführt.<br />
Folgende Kriterien wurden grundstücksbezogen untersucht:<br />
_ Bebauungsdichte<br />
_ Baualter<br />
_ Baustruktur ( Gestaltungsmerkmale, Häufung / Gestaltmängel/<br />
Gebäudebreiten und Höhen)<br />
Die städtebauliche Situation wurde beschrieben und Missstände<br />
aufgezeigt hinsichtlich:<br />
_ Grundstücksgrößen und –zuschnitt<br />
_ Erhaltungszustand / bauliche Mängel<br />
_ Hygienische Mängel<br />
_ Raumstruktur<br />
_ Baulücken, ungeordnete Situationen<br />
_ Mängel, quartierbezogen (Bau-, Raum- und Grünstruktur,<br />
Raumprofile und Raumkanten), Einfriedungen<br />
Als funktionelle Mängel wurden untersucht:<br />
_ Verkehrserschließung und ruhender Verkehr<br />
_ Gebäude- und Flächennutzung<br />
Die Ergebnisse wurden in 3 Kategorien unterteilt:<br />
Ein „erheblicher Sanierungsstau“ als Ursache für<br />
überdurchschnittliche Leerstände, ein hoher Überbauungsgrad<br />
ergänzt durch „eine hochgradige Versiegelung“ privater<br />
Freiflächen und gestalterische Fehlentwicklungen werden<br />
als Ansatzpunkte für eine Verbesserung durch betroffene<br />
Eigentümer benannt.<br />
Komplexe Lösungsansätze werden an Stellen gefordert, die in<br />
städtischen Teilbereichen grundstücksübergreifend eine Vielzahl<br />
von Missständen aufweisen.<br />
Mängel in der Stadtstruktur und im öffentlichen Raum<br />
wurden benannt, die sich vor allem in den unmittelbar an die<br />
Bahnhofstraße anschließenden Quartieren abzeichnen und die<br />
durch ihre Lage das Image der Innenstadt insgesamt negativ<br />
beeinflussen.<br />
Die folgende Rahmenplanung formulierte allgemeine<br />
Sanierungsziele und setzte diese in einem konkreten<br />
Maßnahmekatalog um.<br />
Schwerpunktmäßig wurden Ziele zur Ergänzung, Stabilisierung<br />
und gestalterischen Verbesserung des Plangebietes aufgezeigt,<br />
die aus heutiger Sicht unter dem Aspekt eines demografischen<br />
Wandels und Bevölkerungsrückgangs generell noch gültig<br />
sind, aber im Detail eine differenziertere Betrachtungsweise<br />
erforderlich machen.<br />
Als Oberziele für die Entwicklung der Unteren Stadt wurden<br />
genannt:<br />
1. „Erhaltung der Unteren Stadt mit ihren kulturellen und<br />
stadtbildprägenden Elementen und als Gesamtensemble.“<br />
2. „Sicherung und Entwicklung der Unteren Stadt als<br />
Stadtzentrum von örtlicher und regionaler Bedeutung.“<br />
3. „Erhaltung und Stärkung der Unteren Stadt als Wohnstandort.“<br />
Mit der Umsetzung in Planungsansätze wurden u. a. notwendige<br />
Sicherungsmaßnahmen, Einzelobjekte und Teilbereiche für eine<br />
strukturelle und funktionelle Neuordnung festgelegt, sowie<br />
Standorte für Lückenschließungen und Ergänzungsbauten<br />
ausgewiesen. Funktionelle Verkehrsprobleme sind in einem<br />
separaten Konzept zur Umgestaltung der Straßenräume im<br />
Sanierungsgebiet Untere Stadt im Jahr 2000 bearbeitet worden<br />
und im Rahmenplan nur unter dem Aspekt der Neugestaltung<br />
der Fußgängerzone berücksichtigt.<br />
Das Gebiet wurde auf der Basis dieser Vorbereitenden<br />
Untersuchungen 1996 erstmalig als Sanierungsgebiet förmlich<br />
festgesetzt.
2.2.2 Bundeswettbewerb „Stadtumbau Ost“ _ 2002<br />
Im Rahmen des Wettbewerbs wurde eine Reihe von<br />
Handlungsschwerpunkten formuliert. Für die Untere Stadt sind<br />
u. a. folgende Schwerpunkte benannt:<br />
_ „Einzelhandel und Spielzeug als zentrale Funktionen der<br />
Kernstadt“;<br />
_„Erhalt der soliden Blockstruktur unter Beibehaltung<br />
der Nutzungsmischung, Nutzungsmischung schafft eine<br />
„Risikostreuung“ des Immobilienmarktes;<br />
_„Qualitätssteigerung durch Entdichtung und Rückbau<br />
der Blockinnenbereiche;<br />
_„Eigentumsbildung durch Umnutzung der Stadtvillen“;<br />
_ „erweiterte und neue Nutzungen unter den Gesichtspunkten<br />
Einkaufsstadt, Spielzeugstadt mit temporärer<br />
Vielfalt“;<br />
_„die untere Stadt als imaginäres Spielbrett mit<br />
kreativen und teilweise künstlerischen Spielstationen . . .<br />
ein Familienunterhaltungszentrum . . . mit Spielthemen<br />
aus der Sagenwelt des Thüringer Waldes“;<br />
_„Erhalt der Bahnhofsstraße als verdichtetes städtisches<br />
Rückgrat“.<br />
Stadtstrukturelle Entwicklungsziele basieren auf der Thematik<br />
„Spielzeugstadt“ – daraus wird das Leitbild „SpielStadt“<br />
entwickelt. Dazu heißt es beispielsweise: „Das Leitbild SpielStadt<br />
bietet die Plattform für . . . Generationen übergreifenden<br />
Begegnungen . . . Das Thema ist Programm und trägt zunehmend<br />
zur Verbindung der Wirtschaftsfaktoren Tourismus und<br />
Spielzeug bei.“ Die Autoren schlagen, ergänzend zu bereits<br />
bestehenden Fachmessen, die Konstituierung von „<strong>Sonneberg</strong>er<br />
Spielzeugtagen“ vor.<br />
Aus heutiger Sicht scheint das Thema „Spielzeugstadt“ und<br />
die damit verbundene Erwartungshaltung überbewertet.<br />
Die Produktion von Spielwaren ist gegenwärtig im Vergleich<br />
zu anderen Wirtschaftszweigen, sowohl hinsichtlich der<br />
Beschäftigtenzahl als auch bezogen auf den Umsatz,<br />
marginal und „Spielzeug“ stadtgestalterisch im öffentlichen<br />
Raum zu thematisieren ist zwar eine legitime Möglichkeit,<br />
löst aber die strukturellen Probleme nicht. Legitim ist es<br />
insofern, da die Spezifik der industriellen Vergangenheit (und<br />
der damit verbundenen Bedeutung) der Stadt öffentlich<br />
wahrgenommen wird. Wichtig erscheint die funktionelle<br />
und kulturelle Einbindung des Themas in das Problem<br />
der Zentrumsfunktionen bzw. der Stärkung der zentralen<br />
Funktionen, wohingegen ein Stadtteil als „imaginäres Spielbrett“,<br />
ein „Familienunterhaltungszentrum mit Spielthemen aus der<br />
Sagenwelt des Thüringer Waldes“ mit „Kinderpartys“ weniger<br />
stadtplanerisch (d. h. baulich - räimlich) relevant, weil jederzeit<br />
realisierbare, organisatorische Maßnahmen sind.<br />
Die Elemente einer „Spielmeile“ wurden beispielsweise in der<br />
Folge weitgehend umgesetzt.<br />
Die Frage lautet, wie geht die Stadt <strong>Sonneberg</strong> zukünftig<br />
mit ihrer Tradition als einstmals weltweit wichtigster Ort<br />
der Spielzeugproduktion um, ohne ins Museale einerseits<br />
oder ins vordergründig Spielerische abzugleiten?<br />
Auch das Thema Nutzungsmischung ist ambivalent: bei einem<br />
weiteren Bevölkerungsrückgang und daraus resultierenden<br />
zusätzlichen Leerständen wird die Streuung von Funktionen<br />
eher die Leere verstärken. Die Chancen für Verbesserungen in<br />
<strong>Sonneberg</strong> liegen möglicherweise gerade in einer moderaten<br />
Entflechtung und Funktionsteilung in Zentrums – und<br />
Wohnfunktionen.<br />
Auch die „Stärkung der Gelenke“, der Verbindungen und<br />
Übergänge zwischen Stadtteilen, ist als stadtplanerisches<br />
Ziel aus pragmatische Sicht heute fragwürdig, weil sie mit der<br />
notwendigen funktionellen und gestalterischen Stärkung der<br />
Mitte konkurrieren, also der Aufwertung der Innenstadt, ihrer<br />
Attraktivitätserhöhung.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Interessant in dem Konzept sind einige Vorschläge, das<br />
Immobilienmanagement organisatorisch („Flächenpool“,<br />
kommunale Anreize) zu verbessern und die betroffenen Bürger<br />
stärker einzubeziehen. Der Bundeswettbewerb „Stadtumbau<br />
Ost“ bot außerdem den Vorteil, die abstrakte Darstellung<br />
von Flächennutzungsplänen zu verlassen und allgemeine<br />
Entwicklungsziele stadträumlich zu visualisieren. Die Thesen<br />
der Stadtentwicklung konnten in schematischen Entwürfen<br />
überprüft werden.<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
17
18<br />
2.2.3 Studie zum Stadtleitbild – GMA 2002<br />
Die Studie thematisiert, neben interessanten Aussagen<br />
zum Stadtmarketing, ebenfalls die „Spielzeugstadt“ und<br />
liefert Aussagen für eine „Spielzeugstadt der Zukunft“. Das<br />
(inzwischen abgerissene) „PIKO – Gebäude“ sollte zum<br />
„innovativen Mittelpunkt“ und baulichen „Kristallisationspunkt“<br />
werden und modern umgestaltet werden. Es sollte außer<br />
diversen Spielmöglichkeiten dem Edutainment dienen und<br />
Hightech – Spielzeug präsentieren. Auch wenn das Gebäude<br />
nicht mehr existiert, ist der Grundgedanke, an diesem Ort<br />
die Zentrumsfunktion zu stärken nach wie vor wichtig und<br />
sollte in die weiteren Überlegungen einbezogen bleiben. Die<br />
vorgeschlagenen Themen („Familienunterhaltungszentrum“ u .a.)<br />
bleiben aktuell und spielen auf der Suche nach neuen Nutzungen<br />
für alte Gebäude weiterhin eine Rolle, auch wenn das Thema<br />
„Erlebniswelt“ (mit „Water & Play“, „Ice – Fun“, „Skater – World“,<br />
„Nightlife“) aus heutiger Sicht übertrieben wirkt (vgl. Vorschläge:<br />
2. 2. 2: Stadtumbau Ost).<br />
Analog trifft dies auch für die funktionelle Aufwertung anderer<br />
Bereiche und Einrichtungen zu, wie z. B. der Ausbau der<br />
Sternwarte mit Planetarium und IMAX – Kino.<br />
Prinzipiell richtig und wichtig dagegen sind die Verweise<br />
auf die Möglichkeiten und Chancen zur Nutzung regionaler<br />
Synergie – Effekte; ein dringend erforderliches, umfassendes<br />
Corporate Design und die ebenfalls dringend erforderliche<br />
Verbesserung der Angebotspräsentation im öffentlichen<br />
Raum („Erscheinungsbild des Einzelhandels“), die Installation<br />
kundenfreundlicher Leitsysteme und bessere Ausschilderung.<br />
Die Anregungen und Empfehlungen der Studie wurden in den<br />
Folgejahren im Rahmen städtischer Handlungsmöglichkeiten<br />
weitgehend und konsequent umgesetzt (Wegeleitsystem, CI,<br />
Gestaltung der Stadteingänge. Gestaltung der <strong>Sonneberg</strong>er<br />
Homepage usw.)<br />
PIKO Gebäude (abgerissen)<br />
PIKO Platz (heute)<br />
... Aussagen für eine „Spielzeugstadt der Zukunft“...<br />
...„PIKO – Gebäude“ sollte zum<br />
„innovativen Mittelpunkt“ und baulichen<br />
„Kristallisationspunkt werden und modern<br />
umgestaltet werden“...<br />
...Verbesserung der Angebotspräsentation<br />
im öffentlichen Raum („Erscheinungsbild des<br />
Einzelhandels“)...
2.2.4 Flächennutzungsplan_Fortschreibung 2004<br />
Der im Jahr 2006 erarbeitete Flächennutzungsplan (FNP) umfasst<br />
die Gemarkungen Bettelhecken, Hönbach, Hüttensteinach,<br />
Köppelsdorf, Malmerz, Mürschnitz, Neufang, Oberlind,<br />
<strong>Sonneberg</strong>, Steinbach und Unterlind mit einer Gesamfläche von<br />
4.544 ha. Er basiert auf einer älteren Planfassung von 1991 und<br />
berücksichtigt die aktuellen Planungsstände der Landes- und<br />
Fachplanungen bis Ende 2003. Bestandsdaten zu Bevölkerung<br />
und Wirtschaft basieren auf der Datengrundlage von Ende 2000.<br />
Interessanterweise wird in den Zielen des Flächennutzungsplans<br />
die Stadt- Umland – Bedeutung des Mittelzentrums <strong>Sonneberg</strong><br />
ebenso betont wie die Notwendigkeit Länder übergreifender<br />
Verflechtungsbeziehungen und einer anzustrebenden<br />
gewerblichen Branchenvielfalt.<br />
Ein FNP als vorbereitender Bauleitplan hat grundsätzlich<br />
eine andere Aufgabe zu erfüllen als eine eher unverbindliche<br />
Rahmenplanung. Die Betonung des Regionalzusammenhangs,<br />
der Notwendigkeit zur Entwicklung attraktiver Wohn-<br />
und Gewerbegebiete bis hin zu erforderlichen politisch -<br />
administrativen Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Ziele ist<br />
ebenso augenfällig wie die eher zurückhaltende Behandlung des<br />
Themas „Spielzeugstadt“.<br />
Dagegen wird die Bedeutung des Stadt-, Bildungs- und<br />
Kulturtourismus als besondere raumfunktionale Aufgabe<br />
hervorgehoben, wobei es gilt, „die Bewahrung und<br />
Pflege der kulturhistorisch wertvollen Stadtbereiche in<br />
den Mittelpunkt zu stellen.“ (Zit. FNP) Der orthogonale<br />
gründerzeitliche Stadtgrundriss der Unteren Stadt ist dabei „das<br />
stadtbildprägende Element der Stadt <strong>Sonneberg</strong>“.<br />
Besonderes Augenmerk wird auch hier auf die Entwicklung des<br />
Wohnungsmarktes und die Bedeutung der Eigentumsbildung<br />
gerichtet, wobei der Ansatz, für diese Eigentumsbildung<br />
zusätzliche Flächen im „klassichen Einfamilienhausbereich“ (FNP)<br />
zur Verfügung zu stellen, aus heutiger Sicht eher kritisch zu<br />
sehen ist. Hier sollte vielmehr nach Varianten gesucht werden,<br />
attraktive Wohnverhältnisse in der Innenstadt zu schaffen und an<br />
der Peripherie auf vorhandenen Flächen Wohneigentum in Form<br />
von Ein- und Mehrfamilienhäusern zu realisieren.<br />
Im FNP werden aus dem Regionalen Raumordnungsplan ((RROP)<br />
die grundsätzlichen Aufgaben mit siedlungsrelevantem Bezug<br />
zitiert, u. a.:<br />
_Verbesserung des Arbeitsplatzangebots durch industriell<br />
_gewerbliche Ansiedlung mit Branchenmix;<br />
_Erhaltung und weitere Sanierung des Innenstadt_<br />
bereichs;<br />
_Verbesserung des Wohnungsangebots und des Wohn-<br />
umfeldes.<br />
Die Kernstadt soll gestärkt und langfristig stabilisiert werden. Das<br />
soll nicht allein durch die Verbesserungen im Wohnungssektor<br />
erreicht werden, sondern auch durch die Planung der<br />
Einzelhandelseinrichtungen.<br />
„Die Stadt <strong>Sonneberg</strong> ist demzufolge auch aus rauordnerischer<br />
Sicht angehalten, die weitere Einzelhandelsentwicklung auf<br />
innerstädtische Bereiche zu konzentrieren, hier die Diversifikation<br />
zu fördern um den Anforderungen eines Mittelzentrums zu<br />
entsprechen. Diesem Grundsatz ordnet sich die beabsichtigte<br />
Innenstadtentwicklung unter, welche deutlich auf die Stärkung<br />
de urbanen Mitte ausgerichtet ist.“ (FNP)<br />
Im Zusammenhang mit dem Thema Stadt-, Bildungs- und<br />
Kulturtourismus wird dann doch wieder auf das „Segment<br />
Spielwaren“ verwiesen und die Berücksichtigung der Erlebbarkeit<br />
dieses Tourismussegments im öffentlichen Raum eingefordert.<br />
Hier stellt sich allerdings ebenfalls wieder die Frage,<br />
wie das zu bewerkstelligen ist und wie die diversen<br />
Veranstaltungen der Stadt in diesen Kontext regional,<br />
zeitlich und organisatorisch eingebunden werden können.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... Bedeutung des Mittelzentrums <strong>Sonneberg</strong><br />
ebenso betont wie die Notwendigkeit Länder<br />
übergreifender Verflechtungsbeziehungen<br />
und einer anzustrebenden gewerblichen<br />
Branchenvielfalt...<br />
...Durchsetzung dieser Ziele ist ebenso augenfällig<br />
wie die eher zurückhaltende Behandlung des<br />
Themas „Spielzeugstadt“...<br />
... Die Kernstadt soll gestärkt und langfristig<br />
stabilisiert werden...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
19
20<br />
2.2.5 Studie Baulücken und Brachen in der<br />
Spielzeugstadt <strong>Sonneberg</strong> – dargestellt am<br />
Sanierungsgebiet Obere Stadt<br />
Die Studie behandelt als Schwerpunktthema die Obere Stadt,<br />
enthält jedoch einige Aussagen zur Gesamtstadtentwicklung<br />
und zum Verhältnis des ursprünglichen Siedlungskerns zur<br />
gründerzeitlichen Erweiterung.<br />
Im Rahmen des o. g. Bundeswettbewerbs „Stadtumbau Ost“<br />
2002 wurden, aus den strukturellen Bindungen, Relationen und<br />
einer Bestandsanalyse abgeleitet, folgende Entwicklungsziele<br />
formuliert:<br />
_Stärkung der „Kernbereiche“ von Oberer und Unterer<br />
Stadt sowie des Neubaugebietes „Wolkenrasen“:<br />
_Aufwertung der „Gelenke“ zwischen diesen Stadtteilen<br />
und Entwicklung des „Rückgrats“ (verbindende Achse<br />
der Hauptbereiche), u. a. durch „Verflechtung von<br />
Grünzügen“.<br />
Aufgrund der genannten Bereichscharakteristik stellen sich,<br />
zunächst unabhängig von der Baulücken- und Brachenthematik<br />
in der Baulückenstudie folgende Fragen im Zusammenhang mit<br />
diesen Zielen:<br />
_Welche „Richtung“ soll die Entwicklung nehmen? Wird<br />
ein Ausgleich der Form angestrebt, die Stadt als<br />
einheitlichen, kompakten Stadtkörper wahrzunehmen?<br />
Oder ist es vorteilhafter, bestehende Besonderheiten zu<br />
betonen und „auszubauen“ ?<br />
_Wie muss die funktionelle und gestalterische Ausrichtung<br />
der „Gelenke“ beschaffen sein, die zwar einigermaßen<br />
mit ihrer räumlichen Lage und Situation<br />
beschrieben werden können, aber sowohl auf Anpassung<br />
(woran?) oder Kontrast (wozu?) orientiert werden<br />
können? Ist diese Ausrichtung überhaupt erforderlich?<br />
(vgl. Stadtumbau Ost)<br />
Die Studie zählt außerdem die Besonderheiten der Stadt, der<br />
Stadtentwicklung sowie die Vorzüge und Nachteile auf und<br />
extrahiert daraus folgenden Probleme:<br />
„Wie geht man mit inzwischen entstanden Brachen und<br />
„Perforationen“ um, wo sind weitere zu erwarten und durch<br />
welche Aktivitäten kann ein möglicher Verlust an Urbanität<br />
kompensiert werden?<br />
Wie werden Zentren aktiviert, ihre Attraktivität erhöht und<br />
ihre Bedeutung, nicht nur für die Stadt sondern, auch für den<br />
Regionalverbund, neu definiert?<br />
Wie werden öffentliche Räume erlebbar gemacht, insbesondere<br />
solche, die aus mannigfaltigen Gründen strukturelle, funktionelle<br />
und gestalterische Defizite aufweisen?<br />
Wie können Stadträume und Gebäude trotz fragmentarischen<br />
Charakters der baulichen Struktur die Identifikation der<br />
Einwohner mit dem Ort stärken?<br />
Welche Maßnahmen sind dafür u. a. erforderlich?<br />
Welche Bedeutung, welches Gewicht hat die Obere und welches<br />
die Untere Stadt? Wie funktioniert beides zusammen? Ist es für<br />
dieses Zusammenwirken besser, die jeweils charakteristischen<br />
Merkmale zu verstärken und wie sieht dann die Verbindung aus?<br />
Oder ist es vorteilhafter, die Unterschiede – im Interesse eines<br />
harmonischen Ausgleichs, einer Anpassung an ein, wie auch<br />
immer geartetes gesamtstädtisches Leitbild – zu nivellieren?<br />
Aufgrund höherer Dichte und größerer, relativer Anonymität<br />
ist der südliche, gründerzeitliche Teil <strong>Sonneberg</strong>s - trotz aller<br />
Defizite - in diesem Sinne „urbaner“ als die Obere Stadt, die<br />
allerdings aufgrund ihrer teilweise pittoresken Raumfolgen und<br />
Blickbeziehungen gute Voraussetzungen für eine Aufwertung<br />
bietet.“<br />
Baulücken und Brachen werden klassifiziert und in vier Gruppen<br />
von Problemtypen eingeteilt und entsprechend bearbeitet.<br />
Das trifft in analoger (und noch zu besprechender) Weise auch<br />
auf die Untere Stadt zu, wobei die Maßnahmen entsprechend zu<br />
modifizieren sind.<br />
Die Studie formuliert abschließend Leitbildvorstellungen auf drei<br />
Ebenen: Lokal – räumlich, infrastrukturell und kommunikativ.<br />
Eine wesentliche Schlussfolgerung der Studie lautet, dass die<br />
Auflockerung des geschlossenen Straßenraums der Oberen<br />
Stadt, die Lücken- und Brachenbildung, bis zu einer gewissen<br />
Grenze keine gravierenden negativen Konsequenzen für<br />
die Stadtgestalt hat, wenn es gelingt, die Entwicklung zu<br />
kontrollieren und den Verlust an Bausubstanz mit Hilfe anderer<br />
raumwirksamer Maßnahmen zu kompensieren.
2.2.6 Einzelhandelskonzept für die Stadt <strong>Sonneberg</strong> -<br />
GMA Ludwigsburg, 2008<br />
Das Konzept ist Grundlage für eine strategische und<br />
städtebaulich verträgliche Einzelhandelsentwicklung im<br />
Stadtgebiet, „wobei der Sicherung zentraler Versorgungsbereiche<br />
gem. § 34 Absatz 3 BauGB, § 11 Absatz 3 BauNVO sowie § 9<br />
Absatz 2 a BauGB eine herausragende Bedeutung zukommt.“<br />
(GMA) Die Untersuchung erfolgte auf der Grundlage aktueller<br />
Daten einer Primärerhebung von 2008 sowie statistischer<br />
Angaben des Landesamtes. Der Einzelhandelsstandort<br />
<strong>Sonneberg</strong> wird im Kontext der allgemeinen Stadtentwicklung<br />
und des Strukturwandels untersucht.<br />
Der prognostizierte Bevölkerungsverlust wird sich gem. Konzept<br />
u. a. auch negativ auf die Kaufkraftentwicklung, mit weiteren<br />
Folgen für die Geschäfte, auswirken.<br />
Im Konzept wird aufgezeigt, dass der Einzelhandel in der für die<br />
Zentrumsfunktion relevanten „Einkaufsinnenstadt“ quantitativ<br />
„nur eine nachrangige Position“ einnimmt (GMA).<br />
Das Einzelhandelskonzept beinhaltet neben umfassenden<br />
Informationen zu Umsatzleistungen und Kaufkraftbewegungen,<br />
eine Umsatz- und Verkaufsflächenprognose bis 2015, ein<br />
Markenportfolio sowie ein Stärken- Schwächen- Profil<br />
des Standortes und schließt mit einem Branchen- und<br />
Standortkonzept für den Einzelhandel ab.<br />
Die konstatierten Särken und Schwächen sind dabei weitgehend<br />
kongruent mit den in stadtplanerischen Untersuchungen<br />
festgestellten, wobei die touristische Bedeutung <strong>Sonneberg</strong>s und<br />
die Wertigkeit des PIKO- Platzes „als zentraler Platz für Events“<br />
(GMA) relativiert werden muss.<br />
Auffällig bei den Schwächen ist neben dem, nicht<br />
überraschenden Kaufkraftabfluss in Nachbarstädte und<br />
der lückenhaften Angebotssituation mit relativ geringem<br />
Verkaufsflächenanteil der „Einkaufsinnenstadt“ die<br />
geringe Kundenfrequenz im nördlichen Abschnitt der<br />
Hauptgeschäftslage mit „trading down“- Tendenzen.<br />
(detaillierte Angaben: a. a. O. gem. 11 / Anlage 1)<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... Optimierung der Einzelhandelsstrukturen und<br />
seiner Rahmenbedingungen in <strong>Sonneberg</strong>..<br />
... realistische Prognose der Entwicklungschancen<br />
des Einzelhandels in <strong>Sonneberg</strong> möglich....<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
21
22<br />
2.2.7 Gutachten _ Umstellung der Verkehrsführung in<br />
der Innenstadt<br />
„Die geplante Neuordnung des Hauptstraßennetzes von<br />
<strong>Sonneberg</strong> ist mit dem Bau der Zentrumstangente sowie der<br />
B 89 neu und durch weitere Maßnahmen demnächst in der<br />
Phase angelangt, zu der die von der Stadt bereits seit langem<br />
angestrebten Folgemaßnahmen in der Innenstadt umgesetzt<br />
werden können. Dazu gehört wesentlich, dass die heute<br />
noch als Ein-Richtungsstraßenpaar geregelten innerörtlichen<br />
Hauptstraßen Köppelsdorfer Straße und Bernhardstraße<br />
in der Hierarchie zu Sammelstraßen abgestuft und für den<br />
Zwei-Richtungsverkehr geöffnet werden können. In einer<br />
vorausgegangenen Untersuchung wurde im Jahr 1998 auf die<br />
verkehrlichen Wirkungen eingegangen, die mit der Aufhebung<br />
der Ein-Richtungsregelung verbunden sind. Dabei wurden u.a.<br />
auf Grundlage eines abgestimmten Verkehrsführungsplanes<br />
zukünftige Verkehrsbelastungen hergeleitet. Diese zeigen<br />
auf, dass sehr deutliche Entlastungen im heutigen Ein-<br />
Richtungsstraßenpaar auftreten werden.<br />
In der Untersuchung „Straßenraumgestaltung Unter Stadt (2000)“<br />
sind auf der Grundlage zukünftiger Regelungen und Belastungen<br />
Überlegungen zur Umgestaltung in der Innenstadt angestellt<br />
worden.<br />
Dabei hat es sich einerseits gezeigt, dass Spielraum für eine<br />
umfeldgerechte Umgestaltung der Straßenräume besteht, dass<br />
andererseits jedoch an verschiedenen Stellen im Netz neben<br />
verkehrslenkenden und verkehrsregelnden Maßnahmen auch<br />
bauliche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um den Zwei-<br />
Richtungsverkehr angemessen verkehrlich sicher abwickeln zu<br />
können.<br />
Aufbauend auf bereits vorliegenden Untersuchungen waren<br />
folgende Planungsfragen zu klären:<br />
Welche Maßnahmen sind zwingend erforderlich, damit die<br />
Konzepte umgesetzt werden können?<br />
Welche weiteren Maßnahmen sind nötig, um die beabsichtigten<br />
verkehrlichen und gestalterischen Wirkungen im vorgesehenen<br />
Umfang zu erzielen?<br />
Können die Maßnahmen in einem Stufenplan so unterteilt<br />
werden, dass zunächst die einfacheren Aufwendungen für<br />
eine möglichst rasche Einführung ausreichende Bedingungen<br />
geschaffen werden?<br />
Wie ist danach das „Zielkonzept“ zu erreichen und welche<br />
Maßnahmen sind dafür erforderlich?<br />
Der ÖPNV soll hinsichtlich Linienführung und Haltestellen<br />
unbeeinträchtigt bleiben. Ist dies leistbar?<br />
Welche Aufwendungen und Kosten fallen, gegliedert nach dem<br />
Stufenplan, voraussichtlich an?“<br />
Durch die schon länger vorhandene Zentrumtangente und<br />
durch die in der Fertigstellung begriffene B 89 als vollständige<br />
Ortsumgehung werden die notwendigen Voraussetzungen zur<br />
verkehrlichen Neuregelung in der Innenstadt von <strong>Sonneberg</strong><br />
geschaffen. Darauf hat sich die Stadt gründlich vorbereitet und<br />
hierzu vorab verschiedene Untersuchungen durchführen lassen.<br />
In diesen Untersuchungen ist aufgezeigt, dass sich erhebliche<br />
Entlastungen nicht nur für die ehemaligen Hauptverkehrsstraßen<br />
Köppelsdorfer Straße und Bernhardstraße ergeben werden,<br />
sondern auch, dass sich im gesamten Quartier eine sehr<br />
merkliche verkehrliche Entspannung einstellen wird.<br />
Daraus folgt, dass frühere im Hinblick auf die damaligen<br />
Verkehrsbelastungen getroffenen Regelungen sowie die daraus<br />
resultierenden verkehrlichen Beschränkungen zukünftig nicht<br />
mehr nötig sind. Der sich ergebende Handlungsspielraum soll<br />
nun genutzt werden, um die Innenstadt insgesamt aufzuwerten<br />
und deren Attraktivität durch eine angemessene verkehrliche<br />
Erschließung auf kurzen und übersichtlichen Wegen zu<br />
verbessern. Dies soll mit einer verkehrlichen Beruhigung<br />
verbunden werden, die dem gesamten innerstädtischen Raum<br />
zuträglich ist und auch so, dass dabei Besuchern, Bewohnern<br />
und Beschäftigten der Innenstadt keine Nachteile aufgebürdet<br />
werden.<br />
Die Bestandsaufnahmen und deren Dokumentation gliedert<br />
sich im Wesentlichen in folgende Schwerpunkte: Wegweisung,<br />
Verkehrsregelung und bauliche Maßnahmen, die auch<br />
Grundlagen der Planung waren.<br />
Das Konzept sieht in der Umsetzung zwei Phasen vor, eine<br />
Vorbereitungs- und eine Umstellungsphase.<br />
...Wie ist danach das „Zielkonzept“ zu erreichen und<br />
welche Maßnahmen sind dafür erforderlich?...
3. Rahmenbedingungen Gesamtstadt<br />
3.1 Lage und regionale Einordnung<br />
<strong>Sonneberg</strong> liegt im Süden des Freistaats Thüringen am Südrand<br />
des Thüringer Schiefergebirges am Talausgang der Röthen und<br />
der Steinach in einer Höhenlage von 350 bis 630 m über NN.<br />
Das Stadtgebiet erstreckt sich von den nördlich gelegenen<br />
Ausläufern des Thüringer Waldes über die Linder Ebene bis<br />
unmittelbar an die thüringisch-bayerische Landesgrenze.<br />
<strong>Sonneberg</strong> ist Verwaltungssitz des gleichnamigen<br />
Landkreises und wichtiger Wirtschaftsstandort der Region. Im<br />
Landesentwicklungsplan Thüringen 2004 wurde <strong>Sonneberg</strong> als<br />
Mittelzentrum eingestuft. Der Regionale Raumordnungsplan<br />
sieht <strong>Sonneberg</strong> als mittelzentrales Versorgungszentrum mit<br />
Bedeutung für den östlichen Teil der Region Südthüringen.<br />
Als Stadt-Umlandraum geht die Bedeutung der Stadt<br />
<strong>Sonneberg</strong> über die Landesgrenze hinaus. Es bestehen<br />
enge Verflechtungsbeziehungen zwischen <strong>Sonneberg</strong>, der<br />
Nachbarstadt Neustadt b. Co. und Coburg. Zum Wirtschaftsraum<br />
gehört auch das südöstlich gelegene Kronach.<br />
(vgl. Landesentwicklungsplan Thüringen (LEP) 2004)<br />
Im Stadtgebiet leben derzeit ca. 23.000 Einwohner. Angrenzende<br />
Gemeinden sind Steinach, Oberland am Rennsteig, Judenbach,<br />
Föritz (alle Landkreis <strong>Sonneberg</strong>), Mitwitz (Landkreis Kronach),<br />
Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg), Mengersgereuth-<br />
Hämmern (Landkreis <strong>Sonneberg</strong>).<br />
Beiersdorf<br />
41.283 EW<br />
Rossach<br />
Sachsenbrunn<br />
Sachsendorf<br />
A73<br />
Coburg<br />
Ahorn<br />
Großheirath<br />
Schwarzenbrunn<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Lautertal<br />
Untersiemau<br />
Bachfeld<br />
Mausendorf<br />
4.107 EW<br />
Creidlitz<br />
Cortendorf<br />
Niederfüllbach<br />
Neundorf<br />
Schalkau<br />
Truckenthal<br />
Almerswind<br />
Roth<br />
Weißenbrunn<br />
Dörfles-Esbach<br />
Oberwohlsbach<br />
Unterwohlsbach<br />
A73<br />
Buch am Forst<br />
Theuern<br />
Mittelberg<br />
Grümpen<br />
Fischbach<br />
Waltersdorf<br />
Döhlau<br />
Oeslau Einberg<br />
Waldsachsen<br />
Grub am Forst<br />
Kösten<br />
(Effelder-Rauenstein)Rauenstein<br />
Rödental<br />
Welchendorf<br />
Rückerswind<br />
Mönchröder<br />
A73<br />
3.860 EW<br />
Meschenbach<br />
Seltendorf<br />
Rothenhof<br />
<strong>13</strong>.473 EW<br />
Lichtenfels<br />
Blatterndorf<br />
Großgarnstadt<br />
Steinheid<br />
Rabenäußig<br />
Fichtach<br />
Ebersdorf bei Coburg<br />
Schichtshöhn<br />
Meilschnitz<br />
16.258 EW<br />
6.235 EW<br />
Schney<br />
Ketschenbach<br />
Thann<br />
Mengersgereuth-Hämmern)Hämmern<br />
Schwarzwald<br />
Mürschnitz<br />
Neustadt bei Coburg<br />
Neuensee<br />
Michelau in Oberfranken<br />
2.824 EW<br />
Wildenheid<br />
5.<strong>13</strong>5 EW<br />
Forschengereuth<br />
Sonnefeld<br />
Hönbach<br />
Weidhausen bei Coburg<br />
Schwürbitz<br />
Ebersdorf<br />
Heubisch<br />
Mipperg<br />
Steinach<br />
Lettenreuth<br />
Marktzeuln<br />
<strong>Sonneberg</strong><br />
Köppelsdorf<br />
Steinbach<br />
Unterlind<br />
Örlsdorf<br />
Mogger<br />
3.3<strong>13</strong> EW<br />
4.481 EW<br />
Oberlind<br />
Neufang<br />
Gestungshausen<br />
Hochheim am Main<br />
Blechhammer<br />
Hüttengrund<br />
Rottmar<br />
Gefell<br />
Mitwitz<br />
Judenbach<br />
23.252 EW<br />
GESAMT: 152.000 EW<br />
Redwitz an der Rodach<br />
3.315 EW<br />
Weidnitz<br />
2.592 EW<br />
R 5 km R 10 km<br />
2.981 EW<br />
3.395 EW<br />
6.8<strong>13</strong> EW<br />
Neuhaus-Schierschnitz<br />
Schmölz<br />
Tüschnitz<br />
Oberlangenstadt<br />
Burgkunstadt<br />
Burggrub<br />
Neukenroth<br />
Stockheim<br />
Theisenort<br />
Küps<br />
Hof<br />
8.080 EW<br />
Buchbach<br />
Jagdshof<br />
5.237 EW<br />
Haßlach<br />
R 25 km<br />
WIRTSCHAFTSRAUM<br />
SONNEBERG<br />
COBURG - KRONACH - SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
Kronach<br />
17.739 EW<br />
0 1500 m 3000 m 6000 m<br />
23
24<br />
3.2 Siedlungsentwicklung / Stadt- und Baustruktur/<br />
Ortsbild<br />
Die städtebauliche Entwicklung <strong>Sonneberg</strong>s ist eng mit der<br />
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt verknüpft. Wichtige<br />
Abschnitte der Siedlungsentwicklung lassen sich wie folgt<br />
zusammenfassen:<br />
_der mittelalterlicher Siedlungsschwerpunkt befand sich<br />
im Bereich Marktplatz sowie westlich der Breiten und<br />
Oberen Marktstraße unterhalb des Schlossberges,<br />
_auf dem Standort des heutigen Marktplatzes stand die<br />
Kirche St. Johannis, auf deren Nordseite sich der<br />
mittelalterliche Markt befand,<br />
_eine Stadtmauer gab es nur im Süden (heute: Straße<br />
Am Stadtgraben), die nördliche Siedlungsgrenze<br />
bildeten die Taleinschnitte von Berlagrund und<br />
Salzbrunnen,<br />
_außerhalb der mittelalterlichen Stadt lagen ein<br />
herrschaftlicher Hof (Untere Marktsraße) sowie die<br />
Untere Mühle (Unterer Markt),<br />
_nach dem Dreißigjährigen Krieg – Ausbreitung der<br />
Bebauung in den Bereich Steinersgasse sowie südlich<br />
des Marktplatzes,<br />
_parallel zur Breiten Straße entstand eine zweite Straße<br />
etwa im Verlauf der heutigen Schulstraße,<br />
_seit Anfang des 19. Jh. gab es Pläne für eine südliche<br />
Erweiterung (wachsende Bevölkerung),<br />
_entsprechend einem 1836 aufgestellten Bebauungsplan<br />
wurden bis Mitte des 19. Jh. die Coburger Straße sowie<br />
die Juttastraße zwischen Coburger Straße und<br />
Bahnhofstraße bebaut,<br />
_beschleunigt wurde diese Entwicklung durch den<br />
Stadtbrand von 1840 (weite Teile des alten Stadtkerns<br />
wurden dabei zerstört)<br />
_in diesem Bereich entstand ein neues Zentrum auf<br />
regelmäßigem, weitgehend orthogonalem Grundriss<br />
(Breite Straße, Schulstraße, Marktplatz), eine neue Kirche<br />
jedoch entstand bereits am Westhang des Schönbergs<br />
(1843-18<strong>45</strong>),<br />
_der erste Bahnhof entstand 1859 3 km südwestlich des<br />
damaligen Stadtkerns,<br />
_zwischen Bahnhof und Stadtkirche dehnt sich ab Mitte<br />
des 19. Jh. die Bebauung aus,<br />
_1877 gab es einen neuen Bebauungsplan, der für<br />
das Gebiet der heutigen Unteren Stadt ein rasterförmiges<br />
Straßennetz mit relativ gleich großen<br />
Quartieren vorsah, die Bebauung erfolgte größtenteils<br />
zwischen 1880 und dem 1. Weltkrieg (gemischte<br />
Nutzung: Wohn-, Geschäfts- und Fabrikgebäude tlw. auf<br />
einem Grundstück),<br />
_1880 begann die Bebauung entlang der Cuno-<br />
Hoffmeister-Straße, ein Bebbauungsplan für den südlich<br />
anschließenden Bereich gab es jedoch erst im<br />
Zusammenhang mit dem neuen Bahnhof (1905-1907),<br />
_bereits vor 1914 verfügte die Stadt kaum noch über<br />
Entwicklungsflächen, deshalb zielt die Stadtentwicklungspolitik<br />
auf Verlagerung des Zentrums in den<br />
Bereich des neuen Bahnhofs, auf der Wehd und<br />
westlich der Unteren Stadt entstehen Kleinsiedlungsgebiete<br />
(Reihenhäuser),<br />
_nach 1920 entwickelt sich nördlich des neuen Bahnhofs<br />
ein neues Zentrum, dessen Architektur sich deutlich<br />
von der historischen Bebauung der Unteren Stadt abhob<br />
(AOK Gebäude, Geschäftshaus Woolworth, Neues<br />
Rathaus, Postamt),<br />
_ab 1953 – Entwicklung des Wohngebiets Wolkenrasen<br />
südlich der Bahn.
Mürschnitz (1950)<br />
Bettelhecken (1919)<br />
Höhnbach (1994)<br />
Wehd<br />
Wolkenrasen<br />
Obere Stadt<br />
Untere Stadt<br />
Neufang (1923)<br />
Oberlind (1950)<br />
Unterlind (1994)<br />
3<br />
Köppelsdorf (1950)<br />
Hüttensteinach (1950)<br />
Malmerz (1950)<br />
Steinbach<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
1<br />
2<br />
Jahr der Eingemeindung<br />
Neue Gewerbeflächen seit 1991<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
25
26<br />
Obere (nördliche) und Untere (südliche, gründerzeitliche)<br />
Stadt unterscheiden sich grundlegend: Während die Obere<br />
Stadt dem Talverlauf folgt und insbesondere im Kernbereich<br />
um den Markt durch eine geschlossene, traufständige, zwei bis<br />
dreigeschossige Bebauung geprägt ist, ergibt sich in der Unteren<br />
Stadt auf rechtwinkligen Grundriss eine überwiegend offene, in<br />
Teilbereichen stadtvillenartige, zwei bis max. viergeschossige<br />
Bebauung.<br />
Geschlossene Baufluchten gibt es in der Unteren Stadt nur in<br />
wenigen Teilabschnitten. Auch wenn immer größere Teile der<br />
Industrie sukzessive in reine Industrie- und Gewerbegebiete<br />
verlagert wurden, ist die (städte)bauliche Struktur der Unteren<br />
Stadt und auch das Stadtbild weiter durch die Mischung aus<br />
Wohn- und Fabrikgebäuden gekennzeichnet.<br />
Die Gebäude und Baustrukturen um den Bahnhofsplatz sind ein<br />
prägendes Element innerhalb des Stadtbildes. Der Rathausturm<br />
sowie die Türme der beiden Kirchen bilden vertikale Akzente.<br />
Obere Stadt<br />
3.3 Wirtschaft und Verkehr<br />
Untere Stadt<br />
... die Untere Stadt ist wegen ihrer Größe, Lage<br />
und Struktur der für das Ortsbild <strong>Sonneberg</strong>s<br />
dominierende Teil...<br />
... die (städte)bauliche Struktur der Unteren Stadt<br />
und auch das Stadtbild weiter durch die<br />
Mischung aus Wohn- und Fabrikgebäuden<br />
gekennzeichnet...<br />
... Die Gebäude und Baustrukturen um den<br />
Bahnhofsplatz sind ein prägendes Element<br />
innerhalb des Stadtbildes...
Die Unternehmensstruktur <strong>Sonneberg</strong>s ist von Betrieben der<br />
Spielwarenherstellung, Kunststoff- und Metallverarbeitung,<br />
Technischen Keramik und Kartonagenfertigung sowie<br />
Druckereien bestimmt. (Gemessen an den Beschäftigtenzahlen<br />
von 2 bis 3 Prozent ist die Spielwarenherstellung heute von<br />
relativ geringer Bedeutung) Die Arbeitslosenquote lag trotz<br />
Rückgang der Beschäftigtenzahl von 10.112 im Jahr 2000 auf<br />
9.189 im Jahr 2006 immer deutlich unter den Vergleichswerten<br />
Thüringens. Dabei betraf die rückläufige Entwicklung weniger<br />
das produzierende Gewerbe, jedoch überdurchschnittlich hoch<br />
das Baugewerbe.<br />
Im genannten Zeitraum gab es ein Anstieg im<br />
Dienstleistungssektor und einen positiven Gewerbesaldo (mehr<br />
An- als Abmeldungen).<br />
<strong>Sonneberg</strong> ist über die L 1151 (Anschlussstelle Rödental, 15<br />
km) und die B 89 (Anschussstelle Eisfeld-Nord, 24 km) an die<br />
A73 und damit sehr gut an das überregionale Fernstraßennetz<br />
angebunden. Das Autobahndreieck Suhl (A 71/ A 73) liegt<br />
ca. 50 km entfernt. Außerdem liegt <strong>Sonneberg</strong> an der B 89,<br />
die von Kronach über <strong>Sonneberg</strong> nach Meiningen führt. Eine<br />
Ortsumgehung im Zuge der B 89 ist teilweise fertig gestellt.<br />
Mit der Inbetriebnahme der Innenstadttangente konnten<br />
bedeutsame Entflechtungen innerstädtischer Verkehrsabläufe<br />
erreicht werden und Grundlagen für die Neuordnung des<br />
Durchgangsverkehrs geschaffen werden. Mit der Fertigstellung<br />
der Ortsumfahrt B 89 werden diese Entlastungen in ihrer<br />
Gesamtheit wirksam.<br />
Eine wichtige strukturelle Maßnahme war die Gestaltung<br />
des Umweltbahnhofs mit einer Fußgängerbrücke über das<br />
Bahngelände, wodurch der Stadtteil Wolkenrasen deutlich besser<br />
an die Untere Stadt angeschlossen wurde.<br />
A73<br />
B89<br />
A73<br />
L1150<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
B89<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
27
28<br />
Anliegerstraße<br />
Hauptverkehrsstraße/ Sammelstraße<br />
Zentrumtrangente<br />
50<br />
M. 1: 4.000<br />
100 500 m<br />
r<br />
3.4 Infrastruktur<br />
Der Begriff Infrastruktur ist sehr allgemein und umfassend,<br />
sodass seine Verwendung oft missverständlich ist.<br />
Infrastruktur besteht gemäß heutigen Sprachgebrauch aus den<br />
Komponenten Technische und Soziale Infrastruktur.<br />
Die technische Komponente umfasst die (stadttechnische) Ver-<br />
und Entsorgung, den Verkehr und Kommunikationsnetze für<br />
Funk, Telefonie und Internet.<br />
Die Gestaltung, Wartung, Erneuerung und Erweiterung der<br />
Netze innerhalb des Untersuchungsgebiets ist aufgrund des<br />
städtebaulichen Gründerzeitrasters relativ unproblematisch.<br />
Für detaillierte Planungen gibt es entsprechendes Datenmaterial.<br />
Die städtebaulich - räumliche Untersuchung im Kontext der<br />
Rahmenplanung Innenstadt kann diese technische Komponente<br />
vernachlässigen.<br />
Soziale Infrastruktur beinhaltet das Bildungssystem einschließlich<br />
Kindergärten und –krippen, soziale Dienstleistungen (Betreuung,<br />
Pflege, Vereinswesen), das Gesundheitssystem, Kultur, öffentliche<br />
Sicherheit (Polizei, Feuerwehr u. a.), das Rechtssystem (Gerichte,<br />
Kanzleien), öffentliche Verwaltung und Kirchen.<br />
Dieser funktionale Terminus ist mit dem bau- und<br />
planungsrechtlichen Begriff Gemeinbedarf nahezu<br />
deckungsgleich.<br />
Die aus der Sicht des Rahmenplans wichtigen Aspekte werden<br />
gesondert besprochen (z. B. Pkt. 3. 7 – Kultur).
3.5 Einzelhandel, Dienstleistungen<br />
Im Stadtgebiet befinden sich Einzelhandels- und<br />
Dienstleistungseinrichtungen unterschiedlicher Größe, die zur<br />
Belebung der Innenstadt, zur Attraktivität beitragen und die<br />
teilweise erhebliche Umsatzprobleme haben.<br />
(siehe auch: Anlage 1; Studie GMA)<br />
Der Innenstadtbereich ist geprägt durch eine flächige<br />
Verteilung von Dienstleistungseinrichtungen und von<br />
Einzelhandelseinrichtungen, die sich im Bereich der<br />
Bahnhofstraße und der Straßen mit einem höheren<br />
Verkehrsaufkommen konzentrieren.<br />
Größere Einzelhandelseinrichtungen mit einer<br />
Verkaufsraumfläche über 400m2 tangieren insbesondere den<br />
Bereich der Stadttangente und der Bettelhecker Straße (der<br />
ehemaligen B89) und sind damit sowohl mit dem PKW als auch<br />
für den Fußgänger günstig erreichbar. Charakteristisch für das<br />
Stadtgebiet ist eine starke Durchmischung mit Wohnsubstanz,<br />
die grundsätzlich bestehen bleiben sollte.<br />
Das Stadtgebiet Wolkenrasen besitzt im als Sondergebiet für den<br />
Einzelhandel ausgewiesenen Gebiet an der Friedrich- Ludwig-<br />
Jahn- Straße einen Edeka-Markt und östlich davon einen Plus-<br />
und Rewe-Markt.<br />
Zwischen Köppelsdorf und Steinbach befindet sich ein Norma-<br />
und bei Hüttensteinach ein Diska- Markt.<br />
Einkaufs- und Fachmarktzentren als autokundenorientierte<br />
Versorgungsstandorte befinden sich westlich von Bettelhecken<br />
zwischen der B 89 und der Meilschnitzer Straße und in Hönbach<br />
an der Neustädter Straße (Bayrischen Staatsstraße 2202), die die<br />
Hauptverkehrsachse zwischen <strong>Sonneberg</strong> und Coburg bildet<br />
Aus stadtplanerischer Sicht können die vorhandenen<br />
Standorte für Dienstleistungs- und Einzelhandelseinrichtugen<br />
entsprechend ihrer Lage, Verteilung und den Einzugsradien zum<br />
überwidegenden Teil als günstig eingeschätzt werden.<br />
Die Abgrenzung zwischen Dienstleistung und Sachleistung<br />
(s. Gewerbe) sind heute nicht immer eindeutig bzw. fließend –<br />
Dienstleistungen können auch materielle Bestandteile enthalten.<br />
Im engeren Sinn versteht man darunter Unternehmungen, die<br />
keine materiellen Güter erbringen wie Beratung, Reparaturen,<br />
Reinigungen, IT und Telekommunikation, Werbung usw. – aber<br />
auch Banken, handwerkliche Einrichtungen, Einrichtungen<br />
des Versicherungs- und Sozialwesens, der Verwaltung<br />
usw. sind Dienstleistungsunternehmen - das heißt, es gibt<br />
Überschneidungen mit dem Gewerbe und der Infrastruktur.<br />
Dienstleistungseinrichtungen sind in zweifacher Hinsicht wichtig,<br />
als Einrichtung für die in der Innenstadt lebenden Bürger und als<br />
Arbeitsstätten.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
29
30<br />
3.6 Gewerbe<br />
Im engeren Sinne versteht man unter Gewebe die<br />
produzierenden und verarbeitenden Gewerbe: Industrie und<br />
Handwerk. Die Zahl produzierender Betriebe in der Innenstadt ist<br />
zurückgegangen (dafür sind am südlichen Stadtrand innerhalb<br />
der administrativen Grenzen neue Betriebe in Gewerbegebieten<br />
entstanden).<br />
Im Zusammenhang mit der Rahmenplanung sind für die<br />
gewerbliche Nutzung im wesentlichen zwei Fragen von<br />
Bedeutung:<br />
Wie können leer stehende Gewerberäume oder Gewerbeimmobilien<br />
neuen Nutzungen zugeführt werden?<br />
Hierzu müssen die entsprechenden Räume erfasst, klassifiziert<br />
und auf das Verhältnis Aufwand – Nutzen überprüft werden.<br />
Wie kann eine <strong>Sonneberg</strong>er Besonderheit, die räumliche<br />
Nähe und Verflechtung von Wohnen und Arbeiten<br />
(Spielzeugproduktion), auf ausgewählten Grundstücken<br />
öffentlich (für touristische oder museale Zwecke) dargestellt<br />
werden.<br />
Im Untersuchungsgebiet gibt es heute (Stand: Oktober 2008)<br />
noch folgende Firmen, die mit dem Thema „Spielzeugstadt“,<br />
mit dem traditionellen Zweig der Spielzeugproduktion und<br />
–Vermarktung in Verbindung gebracht werden können:<br />
_Steiner GmbH und KG (Juttastraße 8);<br />
_Martin Spielzeug GmbH (Bahnhofstraße 29);<br />
_Johanna Haida (Cuno - Hoffmeister - Straße 5);<br />
_Puppendesign (Köppelsdorfer Straße 62);<br />
_Modellbahnzubehör (Bernhardstraße 64);<br />
_Spielwarenherstellung (Schöne Aussicht 27 und 47);<br />
_Puppenherstellung/ Puppendoktor (Rathenaustraße 2)<br />
_Spielzeugdesign (Juttastrasse 21).werden?<br />
Der Anteil der Produktion von Spielwaren ist eher gering – das<br />
Johanna Haida Martin Spielzeug<br />
Hauptgeschäftsfeld liegt im Dienstleistungssektor.<br />
Aber allein die Tatsache ihrer Existenz, mit teilweise langen<br />
Traditionslinien und Bezügen zur Wirtschaftsgeschichte der<br />
Stadt, stellt auch eine Entwicklungschance für die Imagebildung<br />
dar. Diese Firmen sollten deshalb in weitere planerische<br />
Überlegungen einbezogen werden und möglichst am Standort<br />
verbleiben<br />
In den letzten Jahren entstanden in <strong>Sonneberg</strong> neue innovativer<br />
Firmen, die teilweise wie auch schon die Spielzeugindustrie<br />
die Ressourcen der Umgebung nutzen und neue<br />
Fertigungstechniken und Technologien aufbauen. Beispielsweise<br />
befinden sich unter Deutschlands innovativsten Firmen des<br />
Mittelstandes, den „Top 100-Unternehmen 2008“ eine Firma aus<br />
der Stadt und eine aus dem Landkreis <strong>Sonneberg</strong>. So ist die Fa.<br />
Power Tank GmbH aus <strong>Sonneberg</strong> einer der Weltmarktführer in<br />
der innovativen Latentspeichertechnologie. Das Unternehmen<br />
Raumag Janich Systemtechnik GmbH aus Rauenstein /Thüringen<br />
ist ein führender Entwickler und Hersteller von Absperr- und<br />
Regelsystemen für Rauchgase.<br />
...Wie können leer stehende Gewerberäume oder<br />
Gewerbe-immobilien neuen Nutzungen zugeführt<br />
werden?...
3.7 Kultur<br />
Die Thematik Kultur ist in mehrfacher Hinsicht für die<br />
Stadtentwicklung bedeutungsvoll: als ein Indikator für<br />
die Lebensqualität in der Stadt; als Standortfaktor für<br />
Firmenansiedlungen mit ihren (möglichst hoch qualifizierten)<br />
Mitarbeitern; als „Attraktor“ für junge Familien, kreative Startups<br />
usw. und natürlich für den als Wirtschaftsfaktor zunehmend an<br />
Bedeutung gewinnenden Städtetourismus.<br />
Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltungen sind auch im<br />
Zusammenhang mit der Pflege und Entwicklung <strong>Sonneberg</strong>s als<br />
„Spielzeugstadt“ von Bedeutung.<br />
Der Begriff „Spielzeugstadt“ ist semantisch nicht eindeutig und<br />
bezieht sich eigentlich, und das ist ein noch zu behandelndes<br />
Problem (Kap.6: Leitbild), auf die Vergangenheit als<br />
Produktionsstandortes mit dem Spielzeugmuseum als Symbol.<br />
(Das Museum hat nicht nur Ausstellungsfunktion, sondern auch<br />
wissenschaftliche und pädagogische Aufgaben zu erfüllen.)<br />
<strong>Sonneberg</strong> verfügt außer dem Deutschen Spielzeugmuseum<br />
noch über eine Reihe von Einrichtungen, die für zukünftige<br />
Entwicklungen wichtig sind bzw. werden könnten.<br />
An erster Stelle wäre hier das Gesellschaftshaus als<br />
multikulturelle und gastronomisch versorgte Lokalität zu<br />
nennen.<br />
Aber auch das Schauaquarium Nautiland (in der Oberen Stadt),<br />
die Sternwarte mit Astronomie – Museum (in Neufang), das<br />
SOMSO – Museum (Untere Stadt) müssen in diesem Kontext<br />
erwähnt werden, auch wenn die heutige Qualität (Gebäude,<br />
Exponate, Ausstellungskonzepte) den Erwartungen und hohen<br />
Ansprüchen teilweise nicht genügen und in einigen Fällen stark<br />
verbesserungsbedürftig sind.<br />
Die städtische Kunstgalerie „Comptoir“ hat ebenfalls eine<br />
wichtige Funktion in der Stadt und sollte als eigenständige<br />
Einrichtung unbedingt erhalten werden.<br />
Neben der erforderlichen kulturellen Infrastruktur gibt es<br />
einige städtische und regionale Veranstaltungen von teilweise<br />
überörtlicher Bedeutung: das Puppenfestival Neustadt –<br />
<strong>Sonneberg</strong>; die Internationalen <strong>Sonneberg</strong>er Jazztage; den<br />
Kinder- und Jugendmusikwettbewerb „Gläserne Harfe“; das<br />
Stadt- und Museumsfest sowie eine ganze Reihe von Festen,<br />
Märkten und diversen Veranstaltungen in der Region (Steinach,<br />
Lauscha, Schalkau, Mengersgereuth – Hämmern und Kronach.<br />
Mit dem Gesellschaftshaus und dem im Stadtteil Wolkenrasen<br />
neu entstandenen multifunktionelllen Stadtteilzentrum „MUFU“<br />
stehen sowohl im kommerziellen als auch im nichtkommerziellen<br />
Bereich Einrichtungen zur Verfügung.<br />
Die Nähe zur Stadt Coburg mit ihrer relativ hohen<br />
Kulturdichte könnte ebenfalls synergetisch als Standort- und<br />
Entwicklungsvorteil genutzt werden.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Jazztage, <strong>Sonneberg</strong><br />
Städtische Galerie, <strong>Sonneberg</strong><br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
31
32<br />
3.8 Tourismus<br />
<strong>Sonneberg</strong> ist keine typische Tourismusstadt, obwohl das<br />
Deutsche Spielzeugmuseum ein attraktives touristisches<br />
Ziel darstellt und das Stadtumland durchaus einige weitere<br />
Attraktionen aufweisen kann.<br />
Das wird auch deutlich in der Beherbergungskapazität, die zwar<br />
mit ca. 300 Betten für eine Stadt mit 23.000 Einwohnern und<br />
einer mittleren Dichte von 515 EW /km 2 ausreichend erscheint<br />
(8), aber für den Tourismus nicht bzw. zu wenig strukturiert ist.<br />
So ist es zum Beispiel gegenwärtig nicht möglich, Reisegruppen<br />
innerhalb eines Hauses unterzubringen.<br />
Die vorhandenen und gut funktionierenden Sport- und<br />
Freizeiteinrichtungen wie das „SonneBad“ (Schwimmhalle,<br />
Sauna und Wellness - Bereich) mit angeschlossener Eislaufhalle<br />
sind zwar in den einschlägigen Touristenführern beworbene<br />
Funktionen, aber primär für die Wohn- und Lebensqualität<br />
der Einwohnerschaft von <strong>Sonneberg</strong> und Umgebung geplant.<br />
Andere, z. B. Tiergarten oder Ausflugsgaststätten wie die<br />
„Blockhütte“, sind informell nicht ausreichend vermerkt und<br />
werden somit touristisch kaum wahrgenommen.<br />
Besonderes Augenmerk verdient eine, sich seit einigen Jahren<br />
kontinuierlich entwickelnde Institution namens „Historische<br />
Meile“, ein „Stadtrundgang durch das alte <strong>Sonneberg</strong>“.<br />
Schautafeln im Stadtgebiet bieten Interessierten ausgewählte<br />
Informationen über Bauwerke, Leben und Arbeit der Bewohner,<br />
Geschichte usw. Hauptbahnhof, Neues Rathaus, Cuno –<br />
Hoffmeister - Straße (als charakteristische „Gemengelage“ aus<br />
Wohnen und Spielwarenfirmen), das Kresge – Geschäftshaus,<br />
einige Wohnhäuser (Familie Lindner, Villa Amalie), Spielzeugmuseum,<br />
ehemaliger Fuhrmannshof, Marktplatz (Obere Stadt),<br />
Gerichtssteig 1, das Gebäude des Alten Bahnhofs sowie einige<br />
Produktionsstätten werden auf diese Weise dargeboten.<br />
Die „Historische Meile“ wird in analoger Weise durch eine<br />
„Spielmeile“ ergänzt.<br />
Gasthaus „Blockhütte“<br />
Outdoor Inn - Hotel mit Freizeitangeboten<br />
Spielzeugmuseum<br />
Schwimmhalle „SonneBad“
4. Analyse und Bewertung Stadtumbaugebiet<br />
Innenstadt<br />
4.1 Lage, Abgrenzung und Gliederung<br />
Das ca. 195 ha große Stadtumbaugebiet Innenstadt<br />
umfasst die überwiegend gründerzeitlich geprägte Untere<br />
Stadt (Betrachtungsschwerpunkt) sowie die heterogen<br />
strukturierten Bereiche westlich der Coburger Allee in<br />
Richtung Bettelhecken. Bestandteil des Stadtumbaugebiets<br />
ist auch das Sanierungsgebiet Untere Stadt. Im Monitoring-<br />
Bericht zum Stadtumbau aus dem Jahr 2007 wurden für das<br />
Stadtumbaugebiet Innenstadt 5.842 Einwohner angegeben. Dies<br />
entspricht ca. einem Viertel der Einwohnerzahl der Gesamtstadt<br />
(Einwohner <strong>Sonneberg</strong> gesamt 2007: 23.309).<br />
Die Anzahl der Wohnungen im Stadtumbaugebiet Innenstadt<br />
wurde mit 3.7<strong>13</strong> angegeben. Die Ost-West Ausdehnung<br />
des Bearbeitungsgebiets beträgt ca. 1,8 km, die Nord-Süd<br />
Ausdehnung ca. 1,2 km. Es wird begrenzt:<br />
_im Osten durch die bergseitige Bebauung entlang der<br />
Straße Schöne Aussicht / Kirchstraße,<br />
_im Süden durch die Gleisanlagen der Bahn,<br />
_im Westen durch eine Begrenzungslinie westlich des<br />
Gleisbogens der Bahnlinie nach Eisfeld,<br />
_im Norden durch die südliche Begrenzung des Ortsteils<br />
Auf der Wehd, die südliche Begrenzung des Grundstücks<br />
Bürgerschule sowie eine Linie südlich des Unteren<br />
Markts.<br />
Das Stadtumbaugebiet Innenstadt umfasst im Wesentlichen<br />
folgende baulich-strukturell sehr unterschiedlichen Teilbereiche:<br />
_die gründerzeitlich geprägte Untere Stadt (1850-1914),<br />
_den Bereich Cuno-Hoffmeister-Straße (ab 1880),<br />
_das Areal nördlich des neuen Bahnhofs (ab 1920),<br />
_den Bereich westlich der Coburger Allee (u.a. Wohnen,<br />
Gewerbe, Sportstätten, ab 1920),<br />
_das innerstädtische Wohngebiet Schöne Aussicht<br />
(ab 1975).<br />
In die Betrachtungen zum Stadtumbaugebiet Innenstadt<br />
wird auch der südlich angrenzende Bereich des ehemaligen<br />
Güterbahnhofs einbezogen.<br />
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Begriff „Untere Stadt“ bisher<br />
für unterschiedlich abgegrenzte Stadtbereiche verwendet wird.<br />
Auch innerhalb des vorliegenden Konzepts wird die Bezeichnung<br />
in einem engeren und einem weiteren Sinn verwendet. Die<br />
Bezeichnung „Untere Stadt“ im engeren Sinn bezeichnet das<br />
Denkmalensemble Untere Stadt (ohne Cuno-Hoffmeister-Straße,<br />
ohne die Bebauung der 1920er / 1930er Jahre nördlich des<br />
Bahnhofs und ohne das Plattenbaugebiet Schöne Aussicht).<br />
Der Begriff „Untere Stadt“ im weiteren Sinn bezeichnet die<br />
Stadterweiterung von 1850 bis heute in dem Dreieck Ernst-<br />
Moritz-Arndt-Straße, Schöne Aussicht / Kirchstraße, Coburger<br />
Straße / Coburger Allee.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
...der Begriff „Untere Stadt“ bisher für<br />
unterschiedlich abgegrenzte Stadtbereiche<br />
verwendet wird....<br />
... Die Bezeichnung „Untere Stadt“ im engeren Sinn<br />
bezeichnet das Denkmalensemble Untere Stadt...<br />
... Der Begriff „Untere Stadt“ im weiteren Sinn<br />
bezeichnet die Stadterweiterung von 1850 bis<br />
heute...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
33
34<br />
4.2 Wichtige stadtbildprägende Gebäude- und<br />
Raumsituationen, Denkmale<br />
Wichtige Gebäude für die Stadt resp. deren Bewohner<br />
enthalten entweder wichtige öffentliche Funktionen oder sind<br />
architektonisch oder städtebaulich signifikant.<br />
Wenn eine öffentliche Funktion ausgelagert wird oder nach<br />
Abbruch des Gebäudes in einen am Standort errichteten<br />
Ersatzneubau zieht, stellt das (in der Regel) kaum ein Problem dar<br />
– wenn hingegen ein signifikantes Haus völlig aus dem Stadtbild<br />
„verschwindet“ ist das mit einem Identitätsverlust verbunden.<br />
Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob das<br />
entsprechende Gebäude im formal – ästhetischen Sinn positiv<br />
oder negativ bewertet wird; relevant ist sein charakteristisches<br />
Erscheinungsbild, das zur Ortstypik beiträgt.<br />
Die Situation Denkmal geschützter Häuser stellt sich insofern<br />
komplizierter dar, weil deren Wert auch ideelle Komponenten<br />
enthält oder enthalten kann. Die historische Spezifik, die<br />
mit dem eigentlichen Haus als Bauwerk nicht unmittelbar<br />
im Zusammenhang stehen muss, ist dabei mitunter<br />
bedeutungsvoller als die Erscheinung und Nutzung im<br />
Stadtraum.<br />
Mit anderen Worten, Entscheidung über den Umgang mit der<br />
Bausubstanz werden im Denkmalfall auf anderer Basis gefällt<br />
als im Fall für das Stadtbild oder die Funktionalität wichtiger<br />
Gebäude.<br />
Das Baudenkmal muss gem. Definition auch nicht zwangsläufig<br />
signifikant, es kann sogar im städtebaulichen Kontext eher<br />
unscheinbar sein. Die Analyse der Situation muss im Einzelfall<br />
ergeben, wie ein Handlungskonzept aussieht – und kann<br />
möglicherweise sogar zu Veränderungen auch der nicht<br />
geschützten Substanz Anlass geben.<br />
Auch Nutzungsentscheidungen sind im Denkmalfall schwieriger,<br />
weil, aus unterschiedlichsten Gründen, nicht jede Nutzung<br />
kompatibel mit dem Denkmal ist und Änderungen oder<br />
Anpassungen sogar zu seiner Zerstörung führen könnten.<br />
Stellvertretend sei hier die Nutzung des zukünftig leer stehenden<br />
Gymnasiums genannt.<br />
Bürgerschule Unterer Markt 4<br />
Gustav-König-Strasse 2<br />
... wenn ein signifikantes Haus völlig aus dem<br />
Stadtbild „verschwindet“ ist das mit einem<br />
Identitätsverlust verbunden....<br />
... die baulichen Denkmale zu klassifizieren und in<br />
einer hierarchischen Liste zu erfassen...
Ein weiteres, häufig zu Kontroversen führendes Problem besteht<br />
in der Abwägung der Interessen:<br />
So wurde beispielsweise der Konflikt zwischen städtischen<br />
Interessen (Stärkung der Zentrumsfunktionen mit öffentlichen<br />
Einrichtungen, Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes,<br />
Unterbringung von Betrieben, Institutionen usw.) einerseits<br />
und Denkmalschutzinteressen am Pikoplatz zuungunsten der<br />
Denkmalpflege entschieden, während beim Einzeldenkmal<br />
die Bewahrung des Denkmals (als städtisches Interesse)<br />
in der Bewertung über den (ebenfalls verständlichen)<br />
Nutzungsinteressen von Haus – und Grundstückseigentümern<br />
steht (z. B. Verbesserung der Wohnqualität durch Anbau von<br />
Balkons oder Loggien).<br />
Das ist in der Öffentlichkeit oft nur schwer zu vermitteln.<br />
Auch aus diesem Grund ist der Diskurs über Prämissen,<br />
Grundsätze und theoretische Grundlagen der Denkmalpflege<br />
notwendig. Das bedeutet auch, dass der Denkmalstatus<br />
differenziert betrachtet und in einigen Fällen überprüft werden<br />
sollte. Altes Gymnasium Karlstrasse 29<br />
Gymnasium Lohau, <strong>Sonneberg</strong><br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... nicht jede Nutzung ist kompatibel mit dem<br />
Denkmal und Änderungen oder Anpassungen<br />
sogar zu seiner Zerstörung führen könnten...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
35
36<br />
Juttaplatz / Juttastraße<br />
Der Bereich Juttastraße mit Juttaplatz ist die wichtigste Ost-West<br />
Verbindung im nördlichen Teil der Unteren Stadt. Die Juttastraße<br />
verbindet die Achsen Coburger und Bahnhofstraße sowie<br />
den Stadtpark mit den Bereichen um das Spielzeugmuseum,<br />
die Katholischen Kirche sowie dem östlich gelegenen<br />
Schießhausplatz. Dabei bildet der sechseckige Juttaplatz mit<br />
einer meist dreigeschossigen offenen Randbebauung einen<br />
stadträumlichen Schwerpunkt der nördlichen Unteren Stadt. Der<br />
nach Gräfin Jutta von Henneberg-Schleusingen benannte Platz<br />
bekam dennoch nie die für ihn vorgesehene zentrale Bedeutung<br />
innerhalb der Unteren Stadt, da sich insbesondere mit dem<br />
Bau des neuen Bahnhofs 1905-1907 der städtebauliche und<br />
funktionale Schwerpunkt auf die Bahnhofstraße verschob.<br />
Bahnhofstraße<br />
Die Bahnhofstraße wurde um 1840 als Verbindung zwischen<br />
der Köppelsdorfer und der Juttastraße angelegt. Der frühere<br />
Name Eisenbahnstraße bezog sich auf einen geplanten,<br />
jedoch nie umgesetzten Bahnhofsbau im Bereich Juttastraße /<br />
Bahnhofstraße. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde<br />
die Straße in nördliche Richtung bis zur Kirchstraße und 1907<br />
bis zum Bahnhofsplatz im Süden verlängert. Seit Beginn des 20.<br />
Jahrhunderts entwickelte sich die Bahnhofstraße vor allem im<br />
südlichen und mittleren Teil zur Hauptgeschäftsstraße der Stadt<br />
<strong>Sonneberg</strong>.<br />
Kresge-Gebäude<br />
Das ehemalige Geschäftshaus der Firma Kresge & Co. aus Detroit<br />
wurde als Verwaltungs- und Lagergebäude 1921 (Nordflügel)<br />
bzw. 1928 (Südflügel) im Westteil der Unteren Stadt errichtet.<br />
Seine Kubatur und Gestaltung unterscheidet sich sehr deutlich<br />
von der gründerzeitlich geprägten Bebauung der Umgebung.<br />
In den Stilformen des Expressionismus sowie des Art deco<br />
errichtet, ist es ein bauliches Zeugnis einer sehr dynamischen<br />
Wirtschaftsentwicklung der Spielzeugstadt <strong>Sonneberg</strong> in<br />
dieser Zeit. Der straßenprägende Gebäudekomplex mit dem<br />
charakteristischen Torturm in Mittellage wurde 1992 umgebaut<br />
und saniert, steht aber seit einiger Zeit leer.<br />
Bahnhofsvorplatz<br />
Die Stadtentwicklungspolitik <strong>Sonneberg</strong>s zielte seit Beginn des<br />
20. Jahrhunderts (im Zusammenhang mit dem Bau des neuen<br />
Bahnhofs) auf die Verlagerung des Zentrums in den Bereich<br />
südlich der Unteren Stadt. Bereits vor dem 1. Weltkrieg verfügte<br />
die Stadt kaum noch über Entwicklungsflächen. So entstand<br />
nach 1920 nördlich des neu entstandenen Bahnhofs ein zentraler<br />
Bereich, dessen räumliche Disposition und Architektur sich<br />
deutlich von der historischen Bebauung der Unteren Stadt<br />
abhebt. Die bemerkenswertesten stadtbildprägenden Bauwerke<br />
aus dieser Zeit sind das neue Rathaus (erbaut 1927/28), das AOK-<br />
Gebäude (1922), das Postamt (1932) und das 19<strong>45</strong> durch die<br />
Wehrmacht gesprengte fünfgeschossige Woolworth-Gebäude<br />
(1925), zu seiner Zeit eines der größten Lagerhäuser Thüringens.<br />
4.2.1 Stadtbildprägende Gebäude<br />
und Raumsituationen
Stadtpark<br />
Der Stadtpark liegt relativ zentral in der Unteren Stadt und ist<br />
eigentlich der einzige etwas größere öffentliche Grünbereich<br />
innerhalb der gründerzeitlichen Stadterweiterung. Der<br />
ehemalige Verlegergarten der Familie Lindner wird heute als<br />
öffentliche Parkanlage genutzt. Im Zuge der Umgestaltungs-<br />
und Aufwertungsmaßnahmen im Jahr 2000/2001 wurde das<br />
Ziel verfolgt, den Stadtpark wieder stärker in den Mittelpunkt<br />
kultureller Ereignisse zu rücken und als Naherholungs- und<br />
Aufenthaltsraum für Bürger und Besucher zu entwickeln.<br />
Gerade in den Sommermonaten ist der Stadtpark mit seinen<br />
zahlreichen Verweilzonen ein gut angenommener Ruhe- und<br />
Erholungsbereich innerhalb der Innenstadt. Durch die Lage<br />
direkt an der Fußgängerzone Bahnhofstraße ist er sehr gut in das<br />
innerstädtische Wegenetz eingebunden.<br />
Piko-Platz<br />
Im Bemühen ein Zentrum, eine neue Mitte zu definieren wurde<br />
nach dem Abbruch des Piko-Produktionsgebäudes (2005) an der<br />
Ecke Bahnhofstraße / Köppelsdorfer Straße ein zurückgesetzter,<br />
viergeschossiger Neubau errichtet und eine neue Platzsituation<br />
geschaffen. Die neuen Funktionen an zentraler Stelle<br />
(Verwaltung, Dienstleistung, Gastronomie, Wohnen) beleben<br />
zweifellos die Innenstadt <strong>Sonneberg</strong>s. Allerdings erreicht weder<br />
die städtebaulich-räumliche Disposition noch die gestalterische<br />
Ausprägung / Architektur des Gebäudeensembles die für diesen<br />
Standort notwendige Qualität. Insbesondere die Stellung des<br />
2008 begonnen 2. Bauabschnitts wirkt innerhalb des ansonsten<br />
weitgehend orthogonalen Stadtgrundrisses unpassend und<br />
fremd.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
37
38<br />
4.2.2 Denkmale<br />
Denkmalensemble „Untere Stadt“<br />
Das Denkmalensemble „Untere Stadt“ umfasst im wesentlichen<br />
die gründerzeitlichen Stadterweiterungen auf orthogonalem<br />
Grundriss zwischen Unterem Markt und neuer Stadtkirche im<br />
Norden und Köppelsdorfer Straße im Süden sowie Coburger<br />
Straße / Coburger Allee im Westen und Schießhausstraße im<br />
Osten. Die Bebauung dieses Bereichs erfolgte größtenteils<br />
zwischen 1880 und 1. Weltkrieg, wobei die ersten Gebäude in<br />
diesem Bereich bereits vor 1850 errichtet wurden (Lindnersche<br />
Häuser, Coburger Straße 31, 32, 35). An diesen Häusern<br />
orientierten sich auch die ersten Planungsüberlegungen für<br />
das Stadterweiterungsgebiet. Die nach 1870 intensivierten<br />
Planungen gingen davon aus, das Entwicklungsgebiet in<br />
rechteckige Quartiere zu gliedern, die durch von Südwesten<br />
nach Nordosten verlaufende Hauptstraßen sowie quer<br />
dazu verlaufende Nebenstraßen erschlossen werden. Im<br />
Rahmen dieser umfangreichen Stadterweiterung wurden<br />
auch eine Reihe wichtiger öffentlicher Gebäude errichtet<br />
(Bürgerschule, Industrieschule, Handels-schule, Lohausschule).<br />
Im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung<br />
<strong>Sonneberg</strong>s zum Ende des 19. Jahrhunderts entstand in der<br />
Unteren Stadt eine Bebauung, die von der stilistischen Vielfalt<br />
des Historismus geprägt ist. Die Bebauungsstruktur zeigt noch<br />
heute die ortsbildprägende Mischung aus Wohn-, Geschäfts-<br />
und Fabrikgebäuden. Die sehr eigenständige und relativ<br />
geschlossene Entwicklung dieses Stadtbereichs, der gegenüber<br />
der bisherigen Stadtfläche ein Mehrfaches an Ausdehnung<br />
aufweist und schließlich selbst zum Kern der Stadt wird,<br />
seine funktional geprägte Gestalt und der gute bauzeitliche<br />
Erhaltungsgrad kennzeichnen die Untere Stadt als wichtiges<br />
Zeugnis der Stadtbaukunst des Industriezeitalters.<br />
Denkmalensemble „Cuno-Hoffmeister-Straße“<br />
An dieser Straße, die bis 1967 nach dem Vornamen des<br />
Kaufmanns Lützelberger Robertstraße hieß, entstand zwischen<br />
1880 und dem 1. Weltkrieg eine gemischte Bebauung aus Wohn-,<br />
Geschäfts- und Fabrikgebäuden vorwiegend nach Entwürfen<br />
einheimischer Architekten. Im Zusammenhang mit dem Bau<br />
des neuen Bahnhofs wurde 1907 ein neuer Bebauungsplan<br />
aufgestellt nach dem 1911/12 die Straße über einen dreieckigen<br />
Platz (Hanns-Arthur-Schönau-Platz) an die Bahnhofstraße<br />
angebunden und bis zur Oberlinder Straße verlängert wurde.<br />
Die Straße wurde 1967 nach dem <strong>Sonneberg</strong>er Astronomen<br />
Cuno Hoffmeister (1892-1968) benannt, dessen Elternhaus<br />
sich im Gebäude Nr. 7 befand. In der Cuno-Hoffmeister-Straße<br />
zeigt sich noch sehr anschaulich die Gemengelage von Fabrik-<br />
und Wohngebäude wie sie für die Spielzeugstadt <strong>Sonneberg</strong><br />
vor dem 1. Weltkrieg typisch war. Charakteristisch ist das<br />
Nebeneinander von meist zwei- bis dreigeschossigen Wohn-<br />
und Geschäftshäusern und den dahinter angeordneten, bis zu<br />
viergeschossigen Fabrikgebäuden. Dominierende Materialien<br />
sind Ziegelstein, verschiedenfarbige Verblendsteine, Fachwerk<br />
und Schiefer. Das architektonische Gesamtbild der Straße wird<br />
überwiegend durch Elemente des Historismus geprägt.
50<br />
M. 1: 4.000<br />
Einzeldenkmal<br />
Denkmalensemble<br />
Gartendenkmal<br />
100 500 m<br />
r<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Einzeldenkmale / Gartendenkmale<br />
Innerhalb des Stadtumbaugebiets gibt es eine Reihe von<br />
Einzeldenkmalen. Eine gewisse Konzentration ergibt sich im<br />
Bereich um Spielzeugmuseum (ehemalige Industrieschule)<br />
und Juttaplatz, im Bereich des Unteren Marktes, um den<br />
Bahnhofsplatz sowie im Bereich Coburger Allee 30 bis 40 (gerade<br />
Hausnummern). Herausragende Einzeldenkmale sind jedoch<br />
auch das derzeit leerstehende ehemalige Geschäftshaus der<br />
US-amerikanischen Firma Kresge & Co. (Gustav-König-Straße 10)<br />
oder die Villen am Weißen Rangen und im Bereich Eller. Neben<br />
den Einzeldenkmalen (Gebäude) gibt es im Bereich der Unteren<br />
Stadt folgende Gartendenkmale (jeweils Gärten mit Einfriedung):<br />
Kirchstraße 32, Schanzstraße 12, Weißer Rangen 34, Schöne<br />
Aussicht <strong>45</strong>.<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
39
40<br />
Städtebaulich wichtige Räume<br />
Städtebaulich wichtige Gebäude<br />
Öffentliche Grünflächen<br />
Historische Alleen<br />
50<br />
100 500 m<br />
r<br />
4.3 Öffentliche Räume, Freiräume<br />
Die Bedeutung öffentlicher Räume für die Wohn- und<br />
Lebensqualität in der Stadt und die Bedeutung öffentlicher,<br />
gemeinschaftlich oder privat genutzter Grünräume<br />
ist unbestritten. <strong>Sonneberg</strong> liegt in einem attraktiven<br />
Landschaftsraum mit interessanten Blickbeziehungen und<br />
verfügt über (teilweise) attraktive Freiräume in der Stadt.<br />
Dabei wurde sehr viel Wert auf die Gestaltung (Bodenbeläge,<br />
Ausstattung, Beleuchtung, Spielmöglichkeiten), Verweise auf die<br />
„Spielzeugstadt“ und die Integration öffentlicher Kunst gelegt.<br />
(Letzteres hatte aber auch in der Vergangenheit zu kontroversen<br />
Diskussionen geführt.)<br />
Problematisch ist dagegen das Erscheinungsbild einiger<br />
Verkehrsräume; die neue funktionale Gestaltung des Pikoplatzes,<br />
die eine Nutzungsvielfalt (Märkte, öffentliche Veranstaltungen)<br />
erschwert und eine Reihe von Quartierinnenbereichen.<br />
Auch die landschaftlichen Einbindungen (Talraum zwischen<br />
Schönberg und Eichberg / Kappel /Auf der Wehd, Südwesthang,<br />
weiterführend in die sich südlich anschließenden Linder Ebene,<br />
Niederungsbereich der Röthen) sind bisher relativ wenig<br />
stadtbildwirksam. Hier gibt es Reserven, die es zukünftig zu<br />
nutzen gilt.<br />
Stadtpark und Stadtfriedhof, Villengärten westlich<br />
der Schanzstraße, der Grünbereich Kirchstraße 32 /<br />
Spielzeugmuseum, die Wegeverbindungen in umgebende<br />
Landschaft (Neufanger Straße, Lutherhaus), das<br />
Freiraumpotential Güterbahnhof, die Entwicklung eines Grün-<br />
und Wegekonzept Sportzentrum und wichtige öffentliche,<br />
größtenteils sanierte Räume wie der Bahnhofsvorplatz, die<br />
Bahnhofstraße, der in diesem Zusammenhang bereits erwähnte<br />
Pikoplatz und der Juttaplatz sowie der Untere Markt stellen ein<br />
bedeutendes Potenzial für die Stadtentwicklung dar.
4.4 Probleme von Nutzungs- und Funktionsbereichen<br />
Die historische Entwicklung im Untersuchungsgebiet hat zu<br />
charakteristischen stadtgestalterischen Prägungen geführt: So<br />
kann die gründerzeitliche, offene Blockrandbebauung mit ihren<br />
Villen und Stadthäusern zwischen Bahnhofstraße, Kirchstraße,<br />
Schöne Aussicht und Köppelsdorfer Straße deutlich von dem<br />
südlich davon gelegenen Gebiet um die Cuno – Hoffmeister –<br />
Straße unterschieden werden.<br />
Davon wiederum unterscheiden sich die Quartiere unmittelbar<br />
an der Bahnhofstraße, die in Ermangelung zentraler Plätze<br />
Zentrumsfunktionen wahrnehmen müssen, und die davon<br />
westlich gelegenen Bereiche bis Coburger Allee bzw. Coburger<br />
Straße. Natürlich spielte auch die Höhenentwicklung der<br />
Parzellen bei der städtebaulichen Ausformung eine bedeutende<br />
Rolle.<br />
Die Unterschiede drücken sich, bis auf wenige Ausnahmen,<br />
weniger architektonisch aus - die Architektur der Gebäude ist<br />
im gesamten Untersuchungsraum eher heterogen, sondern<br />
vielmehr in der städtebaulich – räumlichen und funktionalen<br />
Struktur.<br />
Zwischen dem nordöstlichen Innenstadtbereich und dem<br />
Gebiet um die Cuno – Hoffmeister – Straße ist darüber hinaus<br />
eine deutliche räumliche Zäsur wahrnehmbar, die durch den<br />
ehemaligen Verlauf de Bahnlinie bestimmt wurde und u. U.<br />
auch zur funktional – räumlichen Differenzierung dieser Gebiete<br />
beigetragen hat. Der Bereich Cuno – Hofmeister – Straße ist<br />
durch die Gemengelage Arbeiten (im Quartierinneren) und<br />
Wohnen (zum öffentlichen Raum) stärker geprägt als der<br />
nördliche Teil. (s. a.: Pkt. 4.1 a. a. O.)<br />
Diese charakteristischen Bereiche werden überlagert mit<br />
Problemthemen (Wohnen, Einkaufen usw.).<br />
(Nutzungs- oder Funktionsbereiche sind oft identisch<br />
mit Problemzonen; für die später beschriebenen<br />
Standortentwicklungen sind allerdings nicht funktionelle Defizite<br />
oder städtebaulich - räumliche Konflikte allein maßgebend,<br />
sondern auch die Potenziale der jeweiligen Bereiche bzs.<br />
Standorte als Impuls gebende Standortentwicklungen.)<br />
Ein besonderes, alle Funktionen betreffendes Thema ist der<br />
Gebäudeleerstand:<br />
Bereits in den Planungen vergangener Jahre ( z. B.<br />
Untersuchungen zur Sanierung der Unteren Stadt 1995( a. a. O. )<br />
wurde auf das Problem Leerstände hingewiesen.<br />
Im Rahmen des Monitoring zum Förderprogramm Stadtumbau<br />
Ost wurden durch das Planungsamt der Stadt <strong>Sonneberg</strong><br />
detaillierte Erhebungen zur Leerstandssituation durchgeführt.<br />
(Erfassung: Stadtverwaltung <strong>Sonneberg</strong>)<br />
Im Folgenden soll eine zusammenfassende Darstellung<br />
der Ergebnisse der Zählung von 2008 wiedergegeben<br />
und die Verteilung der Leerstände im Bearbeitungsgebiet<br />
„Stadtumbaugebiet Innenstadt“ untersucht werden.<br />
Unterschieden wurde in Teilleerstand, das heißt von mehreren<br />
WE oder GE (Wohn- und Gewerbeeinheiten) befinden sich nicht<br />
mehr alle in Nutzung (s. Plan 1, Teilleerstand) bzw. in Leerstand,<br />
der das gesamte Gebäude betrifft (s. Plan 2 Leerstand).<br />
Wie die grafischen Darstellungen zeigen, sind ungenutzter Wohn-<br />
oder Gewerbeeinheiten über das gesamte Bearbeitungsgebiet<br />
verteilt. Eine Konzentration auf bestimmte Stadtteile oder<br />
Quartiere als Planungsansatz ist nicht ablesbar.<br />
(siehe auch 18)<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Strukturskizze: mögliche Entwicklung<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
41
42<br />
50<br />
100 500 m<br />
r<br />
vollständiger Gebbäudeleerstand
50<br />
100 500 m<br />
r<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Teilgebäudeleerstand<br />
(Momentaufnahme 2008)<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
43
44<br />
4.4.1 Wohnen<br />
Ein Rundgang durch die Innenstadt offenbart deutliche<br />
Leerstände der Gebäude; das betrifft sowohl Wohnungen als<br />
auch gewerblich genutzte Räume. Zunächst scheint dieser<br />
Leerstand eine Folge demografischer und / oder wirtschaftlicher<br />
Veränderungen (vgl. 2.1) zu sein, die Prozesse sind aber<br />
tatsächlich komplizierter.Nicht nur die Leerstandsdaten haben<br />
sich seit ihrer systematischen Erfassung (9) verändert, auch der<br />
Bestand. So hat es beispielsweise in den Jahren von 2003 bis<br />
2006 eine, wenn auch geringfügige, Positiventwicklung des<br />
Wohnungsbestands gegeben, bei gleichzeitigem Anstieg leer<br />
stehender Wohneinheiten, wobei die Zahl der leer stehenden<br />
WE etwas schneller stieg als der Bestand. Prozentual wuchs der<br />
Leerstand somit von 15,6 % im Jahr 2003 auf 17,2 % im Jahr 2006.<br />
Die deutlichste Veränderung erfolgte nach (9) im Jahr 2007: der<br />
inzwischen offensichtlich durch Rückbaumaßnahmen auf 3.7<strong>13</strong><br />
(-95 im Vergleich zum Vorjahr) reduzierte Wohnungsbestand<br />
in der Innenstadt steht einem Leerstand von nur noch 505<br />
Wohnungen (prozentual: <strong>13</strong>,6 %) gegenüber. Diese offensichtlich<br />
positive Bilanz wurde durch zwei Umstände bewirkt: zum<br />
einen durch Abbruchmaßnahmen im Plattenbaugebiet<br />
Wolkenrasen, was auch den gesamtstädtisch zu hohen Anteil<br />
von Dreiraumwohnungen verringerte, und zum anderen (10)<br />
durch die ungeminderte Nachfrage nach Wohnraum in der<br />
Innenstadt. Die Nachfrage Ende 2008 überstieg sogar die<br />
Angebotsmöglichkeiten, was in Anbetracht des Leerstands<br />
auf unzureichende Qualität (Grundrisse, Ausstattungs-, und<br />
Baumängel, ausstehende Sanierung und Modernisierung) der<br />
Angebote schließen lässt.<br />
Der Erfolg einer, wenn auch nur moderaten Revitalisierung der<br />
Innenstadt wird durch die Tatsache (nach 10; insbesondere<br />
Wohnungsbau GmbH) geschmälert, dass weitaus weniger<br />
Bewohner des Stadtteils Wolkenrasen in die Innenstadt gezogen<br />
sind als erhofft, weil einige das Umland, andere benachbarte<br />
Stadtteile bevorzugten bzw. auch die Stadt <strong>Sonneberg</strong> verlassen<br />
haben.<br />
Bernhardstraße Nr. 38<br />
Coburger Straße Nr. 6<br />
... deutliche Leerstände der Gebäude...<br />
... Die Bezeichnung „Untere Stadt“ im engeren Sinn<br />
bezeichnet das Denkmalensemble Untere Stadt...<br />
... Der Begriff „Untere Stadt“ im weiteren Sinn<br />
bezeichnet die Stadterweiterung von 1850 bis<br />
heute...
(Der Wohnungsleerstand im Jahr 2008 ist dem Anschein<br />
nach weiter gewachsen. Es lässt sich allerdings noch nicht<br />
exakt einschätzen, ob diese potenziellen Veränderungen -<br />
gemessen an der Entwicklung 2003 bis 2007 - prozentual<br />
mit der Einwohnerentwicklung korrelieren oder bereits<br />
überdurchschnittlich sind, weil die aktuellsten, vorliegenden<br />
Zahlen noch nicht hundertprozentig überprüft sind.)<br />
Der Wunsch nach Eigenheimen ist in den letzten Jahren stark<br />
zurückgegangen; Mietwohnungen oder auch komplette Häuser<br />
zur Miete werden privilegiert, was bei den <strong>Sonneberg</strong>er Mieten<br />
einerseits und der von vielen Arbeitgebern gewünschten<br />
Mobilität ihrer Mitarbeiter verständlich ist (vgl. Tabelle:<br />
Mietspiegel). Interessant ist die Tatsache, dass auch Wohnen<br />
in der Innenstadt, besonders innerhalb der gründerzeitlichen<br />
Blockstruktur, als attraktiv angesehen wird (z. B. gibt es am<br />
Juttaplatz und in der Nachbarschaft, die Bereitschaft höhere<br />
Mieten zu bezahlen, wenn die Anforderungen an modernes<br />
Wohnen erfüllt sind.)<br />
Brauhausstraße Nr. 6, 6a<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
<strong>45</strong>
46<br />
Mühlhausen,<br />
Rico Ulricht (2. Preis)<br />
Bad Langensalza,<br />
Osterwold und Schmidt (Realisierung)<br />
Sömmerda,<br />
Schettler+Wittenberg, Stock+Partner, Quaas<br />
Bad Heiligenstadt,<br />
Rene´Eisfeld, Prof. B. Eisele, F.Sonnabend,<br />
A.Müller, H. WIngs<br />
Genial Zentral<br />
Projektinitiative des Freisstaates Thüringen<br />
„Unser Haus in der Stadt“<br />
„Entwicklung innerstädtischer<br />
Brachflächen“
Handel<br />
Nahversorger<br />
50<br />
100 500 m<br />
r<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
4.4.2 Einzelhandel und Gastronomie<br />
Die Situation des Einzelhandels muss an dieser Stelle nicht<br />
detailliert diskutiert werden, weil die neueste Erhebung<br />
der GMA sich ausführlich damit auseinander setzt. Frühere<br />
Untersuchungen und Vorinformationen aus der Studie 2008 der<br />
GMA (11) lassen den Schluss zu, dass die Situation prinzipiell<br />
zufrieden stellend ist, d. h. Zahl der Einrichtungen, Größen von<br />
Verkaufsraumflächen und Sortimentbreite und –verteilung<br />
entsprechen weit gehend dem Bedarf. In unserer Untersuchung<br />
sind diese Parameter nur insofern von Bedeutung als sie<br />
zur Wohnqualität der umliegenden Wohnquartiere und zur<br />
Versorgungsqualität entsprechend der Bedeutung des Stadtteils<br />
beitragen.<br />
Haupteinkaufszone ist die Bahnhofsstraße, die teilweise als<br />
Fußgängerzone ausgebildet wurde. Die wirtschaftliche Situation<br />
des Einzelhandels, insbesondere der kleineren Geschäfte,<br />
ist teilweise kritisch. Die Händler versprechen sich eine<br />
Umsatzsteigerung durch die Aufhebung der Fußgängerzone<br />
und Parkierung der Kundenautos unmittelbar in Ladennähe.<br />
(Die Stadt hat auch deshalb ein Langzeitexperiment zur<br />
Überprüfung dieser Annahme initiiert.) Unabhängig davon wird<br />
der Bevölkerungsrückgang lt. Prognose die Situation weiter<br />
verschlechtern, falls es nicht gelingt durch den Städtetourismus<br />
eine zusätzliche Nachfrage zu erzeugen.<br />
Übersicht über Handelseinrichtungen im<br />
Untersuchungsgebiet<br />
Anmerkung: Definition siehe GMA<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
47
48<br />
Hotel/ Gasthöfe/ Pension<br />
Gastronomie<br />
50<br />
28 Betten<br />
40 Betten<br />
100 500 m<br />
7 Betten<br />
r<br />
8 Betten<br />
23 Betten<br />
Ein Möglichkeit der Verbesserung besteht in der gestalterischen<br />
Aufwertung der öffentlichen Auslagen und Verkaufsräume, der<br />
Verbesserung von Werbung, Firmierung und Kommunikation,<br />
der Verbesserung der Warenpräsentation und nicht zuletzt in der<br />
Qualität (oder Exklusivität, auch Originalität) der angebotenen<br />
Produkte.<br />
Das trifft im Wesentlichen auch auf die Gastronomie zu.<br />
Die vorhandenen gastronomischen Einrichtungen zielen in<br />
erster Linie auf die Stadtbevölkerung und scheinen hinsichtlich<br />
ihrer Kapazität ausreichend. Besucher der Stadt und Kunden<br />
aus anderen Stadteilen werden durch eine ausreichende, d. h.<br />
am Bedarf orientierte, Reihe von Fastfoot – Angeboten versorgt<br />
und den Bewohner der Innenstadt bzw. der innenstadtnahen<br />
Quartiere stehen diverse kleinere Gaststätten besonders im<br />
nördlichen Teil der Innenstadt zur Verfügung. Für höherwertige<br />
Gastronomie gibt es momentan nur das Gemeinschaftshaus.<br />
Die Situation der Gastronomen kann ebenfalls durch die<br />
Tourismusentwicklung verbessert werden. Im Gegensatz<br />
zum Einzelhandel ist es dagegen wenig wahrscheinlich, dass<br />
Bewohner der peripheren Stadtteile in die Innenstadt fahren<br />
um Gaststätten zu frequentieren. Das hängt nicht ausschließlich<br />
von der Qualität und Zahl gastronomischer Einrichtungen<br />
ab, sondern auch von der topografischen Situation und dem<br />
kulturellen Umfeld der Stadt.
Dienstleistung<br />
50<br />
M. 1: 4.000<br />
100 500 m<br />
r<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
4.4.3 Dienstleitungen<br />
Im Bearbeitungsgebiet hat sich insbesondere in den letzten<br />
Jahren ein Wandel von produzierendem Gewerbe zu<br />
Dienstleistungsunternehmen vollzogen. Zumeist handelt es sich<br />
um Dienstleistende in kleinen privaten Unternehmen, die aber in<br />
hoher Anzahl über das Stadtgebiet verbreitet sind.<br />
(s. Plan „Dienstleistungen“, erfasst durch das Gewerbeamt<br />
<strong>Sonneberg</strong> 2008)<br />
(vgl. Pkt. : 3.5)<br />
Übersicht Dienstleistung<br />
Anmerkung: einschließlich Finanz-Dienstleistung<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
49
50<br />
Erscheinungsbild <strong>Sonneberg</strong>er Einzelhandelsgeschäfte_1<br />
Optiker Nr. 85<br />
Fischverkauf Nr. 38<br />
Bank Nr. 62 Fahrschule, Reisen Nr. 62 a<br />
City Center Nr. 44 - 48<br />
Einzelhandel Nr. 43 Straßenansicht Nr. 43 - 49
Erscheinungsbild <strong>Sonneberg</strong>er Einzelhandelsgeschäfte_1<br />
Kunstgewerbe Nr. 18<br />
Apotheke Juttastr. 7<br />
Textilien Nr. 32<br />
Radio Müller Nr. 12<br />
Schuhgeschäft Nr. 34<br />
Fotogeschäft Nr. 36<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Optiker Nr. 21<br />
Textilien Nr. 23<br />
Bank Nr. 43 Martin Bären Nr. 29<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
51
52<br />
Öffentlichen Raum:<br />
Beispiel für attraktive Schaufenstergestaltung
4.4.4 Gemeinbedarf<br />
Grundsätzlich ist die Situation aus der stadtplanerischen<br />
Perspektive positiv zu bewerten: die Stadt ist ausreichend<br />
mit Schulen, Kindertagesstätten und soweit erkennbar mit<br />
medizinischen, kirchlichen und karitativen Einrichtungen<br />
versorgt.<br />
Das Gemeinschaftshaus übernimmt eine Vielzahl kultureller<br />
Aufgaben, im Rathaus befindet sich eine öffentliche Bibliothek<br />
und eine weitergehende Nachfrage konnte nicht festgestellt<br />
werden. Der Leerstand großer Gebäude (beispielsweise Kresge<br />
Gebäude und Parkhaus in der Gustav – König - Straße) bietet<br />
außerdem eine räumliche Reserve, für die augenblicklich kaum<br />
Nutzungen abzusehen sind.<br />
Geringe Entfernungen zu den benachbarten Städte im<br />
Wirtschaftsraum tragen ebenfalls dazu bei, die Nachfrageentwicklung<br />
zu begrenzen.<br />
Problematisch ist eine Auslagerungstendenz von Einrichtungen<br />
aus dem Stadtzentrum an die Peripherie analog zur Entwicklung<br />
des Einzelhandels. Bildungseinrichtungen beleben die Stadt und<br />
sollten erhalten werden.<br />
(vgl. auch Pkt. 3.4 Infrastruktur)<br />
Gymnasium Lohau, <strong>Sonneberg</strong><br />
Gesellschaftshaus Charlottenstraße Nr. 5, <strong>Sonneberg</strong><br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
53
54<br />
Gewerbe<br />
50<br />
M. 1: 4.000<br />
100 500 m<br />
r<br />
4.4.5 Gewerbe<br />
Die wichtigsten Arbeitsstätten der Stadt befinden sich südlich,<br />
außerhalb des Untersuchungsgebietes. Die durchschnittliche<br />
Entfernung Wohnen – Arbeiten ist unproblematisch.<br />
Im Untersuchungsgebiet ist gem. Gewerbeanmeldungen eine<br />
Vielzahl diverser Firmen ansässig. Das auf die Bahnhofsstraße<br />
konzentrierte Angebot ist insgesamt kaum überschaubar und<br />
die Bedeutung für die Stadtbevölkerung in einigen Fällen nur<br />
schwer zu bewerten. Neben großen Einrichtungen wie Banken<br />
finden sich viele kleine, wie handwerkliche und Firmen für<br />
Beratungsdienstleistungen aller Art.<br />
Die Leerstandsproblematik ist analog zum Wohnungsleerstand<br />
zu sehen, wobei die Erfassung und Bewertung komplizierter<br />
ist. Um die Situation zu bewerten, muss die Datenerfassung auf<br />
eine einheitliche Grundlage gestellte werden (vgl. Methodik und<br />
Schlussfolgerungen aus bisherigen Planungen).
Röthen<br />
Bahnhofsstraße<br />
Wollworth Gebäude<br />
Ehemaliger Güterbahnhof<br />
Ehemaliger Busbahnhof<br />
Sport und Freizeitpark<br />
50<br />
M. 1: 4.000<br />
100 500 m<br />
r<br />
Spielzeugmuseum<br />
Cuno - Hoffmeister Straße<br />
ehemaliges<br />
Salzman - Gelände<br />
Schießhausplatz<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
4.4.6 Einzelstandorte<br />
Die Innenstadt als Ganzes mit ihren Bestandteilen,<br />
Rahmenbedingungen, internen und externen funktionellen<br />
Verflechtungsbeziehungen usw. ist ein Bestandteil der<br />
Rahmenplanung – ein anderer sind einige Einzelstandorte als<br />
baulich– räumliche Ensemble im Stadtgebiet.<br />
Diese Einzelstandorte können unabhängig von der<br />
Gesamtentwicklung sukzessiv oder parallel bearbeitet und<br />
entwickelt werden. Sie sind innerhalb der Innenstadt aufgrund<br />
ihrer Lage, ihrer Geschichte oder funktionalen Bedeutung oder<br />
als ungewöhnlich große Brachfläche auffällig und verdienen<br />
besonderes Interesse als Interventionsräume.<br />
Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Bereiche:<br />
_Bahnhofsplatz und Gelände des ehemaligen Woolworth<br />
Gebäudes;<br />
_Schießhausplatz;<br />
_Ehemaliger Güterbahnhof;<br />
_Ehemaliger Busbahnhof;<br />
_Cuno- Hofmeister- Straße:<br />
_Sport- und Freizeitpark;<br />
_Röthen- Renaturierungszone;<br />
_ehemaliges Salzman- Gelände<br />
4.5 Interventionen / Entwicklungspotenziale<br />
Ausgangspunkte für Verbesserungen, Entwicklungen und<br />
Veränderungen werden insbesondere in grundstücks-<br />
bzw. quartiersbezogenen Problemlagen gesehen. Diese<br />
werden dargestellt, bewertet und auf ihre Bedeutung<br />
aus gesamtstädtischer Perspektive untersucht. Für den<br />
gegenwärtigen Arbeitsstand werden die Entwicklungsbereiche<br />
in folgende Kategorien eingeordnet:<br />
_gesamtstädtischer Bedeutung, hohe Priorität,<br />
_gesamtstädtischer Bedeutung, mittlere bis geringe<br />
Priorität,<br />
_quartiersbezogene, lokale Bedeutung, Handlungsbedarf,<br />
_quartiersbezogene, lokale Bedeutung, ohne bzw.<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
55
56<br />
geringer Handlungsbedarf.<br />
Die Analyse ergab innerhalb der o.g. Kategorien<br />
insbesondere folgende Standorte mit Veränderungs- bzw.<br />
Entwicklungspotenzial:<br />
Spielzeugmuseum mit Umfeld<br />
Lage: nordwestliches Stadtumbaugebiet, Nähe Juttaplatz<br />
Probleme / Potenziale: sanierungsbedürftige Gebäudesubstanz,<br />
fehlendes Museumskonzept, Einbindung in den städtebaulichen<br />
Kontext, Schlüsselprojekt der Spielzeugstadt Sonnberg.<br />
Bahnhofsplatz / Woolworth-Gelände<br />
Lage: südliches Stadtumbaugebiet<br />
Probleme / Potenziale: fehlende Raumkanten in einem<br />
städtebaulich wichtigen Auftaktbereich, Möglichkeiten für eine<br />
Nutzung mit größerem Flächenbedarf (z.B. Spielzeug-Kaufhaus<br />
o.ä.), gute verkehrliche Anbindung.<br />
Schießhausplatz<br />
Lage: Ostrand Untere Stadt / Stadtumbaugebiet<br />
Probleme / Potenziale: Fläche für Volksfeste (Festwiese),<br />
Ankunftsbereich für Besucher der Innenstadt und des<br />
Spielzeugmuseums, Caravantourismus, eine funktionelle<br />
und gestalterische Aufwertung ist notwendig (Oberfläche,<br />
Servicegebäude).<br />
Güterbahnhof<br />
Lage: Südlich außerhalb des Stadtumbaugebiets,<br />
Übergangsbereich zu WG Wolkenrasen<br />
Probleme / Potenziale: größtes Flächenpotenzial der Innenstadt<br />
<strong>Sonneberg</strong>s, gemischte bauliche Nutzungen mit größerem<br />
Freiraumanteil denkbar, geringer Handlungsbedarf.<br />
Ehemaliger Busbahnhof<br />
Lage: Südliches Stadtumbaugebiet<br />
Probleme / Potenziale: wichtiger Verkehrsknoten, stadträumlich<br />
sehr indifferent, Flächenpotenzial Nordseite, Stellplätze<br />
Sportzentrum, Einbeziehung in Freiraum- und Wegekonzept.
Cuno-Hoffmeister-Straße<br />
Lage: Südliches Stadtumbaugebiet, zwischen Unterer Stadt und<br />
Bereich Bahnhof<br />
Probleme / Potenziale: charakteristische Gemengelage von<br />
Wohn- und Fabrikgebäuden, ruhige Anliegerstraße in zentraler<br />
Lage, kurze Wege zur Bahnhofsachse, neue Wohnnutzung bzw.<br />
Sonderwohnformen möglich, Aufwertung Straßenraum.<br />
Sport- und Freizeitpark (Anlage 2)<br />
Lage: Südwestliches Stadtumbaugebiet<br />
Probleme / Potenziale: bauliche, funktionelle und gestalterische<br />
Aufwertung notwendig, Handlungsbedarf, Einbeziehung in<br />
Freiraum- und Wegekonzept, Anbindung Innenstadt.<br />
Röthen<br />
Lage / Verlauf: von Nordost nach Südwest<br />
Probleme / Potenziale: keine durchgehende Wegeverbindung,<br />
wenig stadtbildwirksam, Chance für innerörtliche und regionale<br />
Grün- und Wegeverbindung.<br />
Ehemaliges Salzmann-Gelände<br />
Lage: Südöstliches Stadtumbaugebiet<br />
Probleme / Potenziale: Standort ist durch teilweise leerstehende<br />
ehemals gewerblich genutzte Gebäude geprägt, Aufwertung des<br />
östlichen Innenstadteingangs möglich, Mischnutzung.<br />
Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe von Brachen und<br />
Lücken, die überwiegend für eine wohnbauliche Nachnutzung<br />
geeignet sind. Als Baulücken sind vor allem zu nennen:<br />
Mozartstraße 1-3 (Wettbewerbsergebnisse<br />
Architektenwettbewerb liegen vor),<br />
Bernhardstraße 41, Bahnhofstraße <strong>13</strong>-15.<br />
Diese Standorte wurden bisher für das Genial-zentral Programm<br />
des Landes Thüringen angemeldet.<br />
Als Flächenpotenzial in guter Lage wird auch ein Bereich in<br />
der nördlichen Schleicherstraße eingeschätzt, welcher bisher<br />
als Gartenland genutzt wird und sich für eine villenartige<br />
Wohnbebauung eignet.<br />
Neben dem Areal Cuno-Hoffmeister-Straße ist als<br />
Flächenpotenzial Wohnungsbau auch der Bereich Herrnaustraße<br />
zu nennen, der im Westteil des Stadtumbaugebiets liegt und sich<br />
als integrierter Einfamilienhausstandort anbietet.<br />
Außer dem sogenannten Salzmann-Gelände gibt es weitere<br />
ehemals gewerblich oder anderweitig genutzte Bereiche, die für<br />
Folgenutzungen entwickelt werden können (z.B. Bernhardstraße<br />
26 oder Köppelsdorfer Straße 79).<br />
Als Problem wird auch der Zustand der Bausubstanz im<br />
Kreuzungsbereich Coburger Allee / Köppelsdorfer Straße<br />
eingeschätzt. Die Eckhäuser stehen größtenteils leer, ein Verfall<br />
und Abbruch der Substanz droht. Damit würde die westliche<br />
Eingangssituation zur Unteren Stadt Ihre baulich-räumliche<br />
Fassung verlieren.<br />
Eine gewisse Konzentration des Leerstands zeichnet sich im<br />
Bereich Charlottenstraße ab. Ursachen hierfür könnten die<br />
relativ knapp bemessenen Grundstücke sowie die Nähe zum<br />
Gesellschaftshaus sein (Störwirkung bei Veranstaltungen?).<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Realisierungswettbewerb<br />
Statt Brache V Mozartstraße 1-3<br />
hks Architekten + Gesamtplaner GmbH (1. Preis)<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
57
58<br />
Köppelsdorfer Straße 79<br />
Bernhardstraße 26<br />
Coburger Allee 15 a<br />
Charlottenstraße 15<br />
...ehemals gewerblich oder anderweitig genutzte<br />
Bereiche, die für Folgenutzungen entwickelt<br />
werden können...<br />
...die Eckhäuser stehen größtenteils leer, ein Verfall<br />
und Abbruch der Substanz droht...
5 Entwicklungskonzept<br />
„Es ist das Zentrum, das die moderne Stadtregion nach innen wie<br />
außen repräsentiert. Die Bilder des Zentrums gehören zu den<br />
Lockmitteln des . . . Stadttourismus und dienen als werbende<br />
Botschafter der Städtekonkurrenz. Nur das Zentrum kann diese<br />
Rolle übernehmen, Es ist einzigartig und symbolisiert das<br />
Besondere der jeweiligen Stadt, ihre Geschichte, ihre baulichen<br />
Höhepunkte, ihre wichtigsten Institutionen. . .<br />
Doch die Stärkung des Zentrums reicht nicht aus. Teile der<br />
übrigen Innenstadt sind nicht selten von Kaufkraftverlust,<br />
unzureichenden Investitionen und der Konzentration sozialer<br />
Probleme gekennzeichnet. Das Zentrum der Stadt kann sich nur<br />
weiterentwickeln, wenn die umliegenden Stadteile von dieser<br />
Entwicklung nicht abgekoppelt bleiben. . .<br />
Es geht um das Ringen um neue wirtschaftliche Grundlagen<br />
für die postindustrielle Stadt der Zukunft. Ziel ist nicht simple<br />
Unternehmerwerbung, sondern die Schaffung eines kreativen<br />
Klimas in der Stadt, das durch eine hohe Toleranz und Offenheit<br />
ausgezeichnet ist. Diese Offenheit ist für kreative Schichten<br />
attraktiv, fördert Talente und schafft Voraussetzungen für einen<br />
erfolgreichen Strukturwandel. . .<br />
Attraktivierung der Stadt heißt in erster Linie: städtebauliche<br />
Attraktivierung. . . .<br />
Wiedergewinnung und Neuschaffung öffentlicher Räume,<br />
. . . , fußgängerfreundliche Gestaltung von Stadtstraßen<br />
und Stadtplätzen, eine gewisse bauliche Dichte und<br />
Funktionsmischung, . . . , Bau neuer Museen oder anderer<br />
touristischer Attraktionen.<br />
Schaffung von attraktivem Wohnraum in der Innenstadt:<br />
Was die Architektur des neuen Wohnens in der Innenstadt,<br />
betrifft, so haben wir in Deutschland Nachholbedarf. Wir müssen<br />
erst wieder lernen, einen attraktiven mittelschichtsorientierten<br />
Wohnungsbau zu gestalten.<br />
Deutlich werden muss, welche Entwicklungen die maßgeblichen<br />
Akteure in einer Stadt für wünschenswert halten, und welche<br />
Entwicklungen unerwünscht sind, deutlich werden muss,<br />
welche Räume Priorität haben, welche wirtschaftlichen, sozialen,<br />
ökologischen und kulturellen Leitziele vertreten werden, und<br />
mit welchen Leitprojekten oder -kampagnen diesen Zielen nahe<br />
getreten werden soll.“ (5)<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... es ist das Zentrum, das die moderne Stadtregion<br />
nach innen wie außen repräsentiert...<br />
... die Stärkung des Zentrums reicht nicht aus...<br />
... die Schaffung eines kreativen Klimas in der<br />
Stadt, das durch eine hohe Toleranz und<br />
Offenheit ausgezeichnet ist...<br />
... Bau neuer Museen oder anderer touristischer<br />
Attraktionen...<br />
... Schaffung von attraktivem Wohnraum in der<br />
Innenstadt...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
59
60<br />
r<br />
L<br />
Entwicklungsbereich mit gesamtstädtischer Bedeutung<br />
hohe Priorität<br />
Entwicklungsbereich mit gesamtstädtischer Bedeutung<br />
mittlere/geringe Prorität<br />
Quartiersbezogene /Lokale Massnahmen<br />
mit Handlungsbedarf<br />
Quartiersbezogene/Lokale Massnahmen<br />
ohne bzw. geringem Handlungsbedarf<br />
Nachnutzung: Wohnen<br />
Nachnutzung gemischte Nutzung/Gewerbe<br />
Flächenpotenziale<br />
Leerstand<br />
Fußgängerbereich<br />
Vernetzung<br />
Gemeinbedarfs-Einrichtungen<br />
Stadtbildprägende Gebäude<br />
Aufwertung Strassenraum
5.1 Gesamtplan<br />
Die gründerzeitlich geprägte Untere Stadt mit Ergänzungen<br />
aus den 1920er und 1930er Jahren muss städtebaulich nicht<br />
neu erfunden werden. Vielmehr ist es sinnvoll, gegenwärtige<br />
und zukünftige Planungsentscheidungen an den grundsätzlich<br />
vorhandenen auch in Zukunft belastbaren Stadtstrukturen<br />
zu orientieren. In <strong>Sonneberg</strong> sind dies die ausgeprägte,<br />
weitgehend orthogonal aufgebaute Quartiersstruktur der<br />
Unteren Stadt mit der Konzentration von Verwaltungs-,<br />
Dienstleistungs- und Einzelhandelseinrichtungen in der<br />
unteren und mittleren Bahnhofstraße sowie einigen (wenigen)<br />
punktuellen Entwicklungsbereichen außerhalb der Hauptachse<br />
(z.B. Spielzeugmuseum, Kresge-Haus, Cuno-Hoffmeister-Straße).<br />
Das Konzept muss daher keine großräumigen baustrukturellen<br />
Veränderungen verfolgen, sondern sucht Ausgangspunkte<br />
für Verbesserungen insbesondere in grundstücks- bzw.<br />
quartiersbezogenen Problemlagen. Das Vorgehen kann als<br />
inkrementell bezeichnet werden.<br />
Teile des Stadtumbaugebiets Innenstadt bilden das<br />
Stadtzentrum <strong>Sonneberg</strong>s. Die Stärkung der zentralen Bereiche<br />
(der Mitte) ist und bleibt wichtiges Ziel der Stadtentwicklung.<br />
Mit Blick auf die demografischen Veränderungen wird es in den<br />
nächsten Jahren nicht um Expansion sondern um Konzentration,<br />
Bündelung und qualitative Verbesserungen einzelner Bereiche<br />
gehen müssen. Dies gilt auch für die Zentrumsfunktionen. Ein<br />
wichtiges Instrument hinsichtlich Erhalt und Aufwertung der<br />
Nutzungsstrukturen entlang der Achse Bahnhofstraße und<br />
in ihrem Umfeld wird in der Abgrenzung der sogenannten<br />
Einzelhandelsinnenstadt gesehen (siehe hierzu auch Gutachten<br />
der GMA, 2009).<br />
Eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre bleibt die weitere<br />
Sanierung der erhaltenswerten Gebäudesubstanz unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Denkmale. Dort wo<br />
bedeutende Einzeldenkmale von Leerstand bedroht bzw.<br />
betroffen sind (z.B. Kresge-Gebäude, Altes Gymnasium), sollten<br />
in enger Abstimmung zwischen Stadt, Denkmalbehörden<br />
und Eigentümern tragfähige Nutzungskonzepte erarbeitet<br />
werden. Für das Kresge-Gebäude wäre aus städtebaulicher<br />
Sicht eine Nutzung im Bereich Kultur / Bildung ergänzt mit<br />
gastronomischen Angeboten wünschenswert.<br />
Bis auf wenige Ausnahmen (Woolworth-Gelände, Bahnhofstraße<br />
<strong>13</strong>-15, Ostseite Schönau-Platz) werden die Baulücken<br />
innerhalb des Stadtumbaugebiets Innenstadt nicht als<br />
gravierendes Problem eingeschätzt. Da große Teile der Unteren<br />
Stadt durch eine offene Bauweise geprägt sind, in der die<br />
Lücken zwischen zwei Gebäuden und damit Durchblicke in<br />
Innenhöfe charakteristisches Merkmal sind, wirken auch die<br />
richtigen Baulücken nicht derart störend wie innerhalb einer<br />
streng geschlossenen Bauweise. Allerdings sollte trotzdem<br />
jede Möglichkeit genutzt werden, entstandene Baulücken<br />
insbesondere in stadtstrukturell und baulich-räumlich wichtiger<br />
Lage wieder zu schließen.<br />
Nachnutzungsmöglichkeiten für Wohnungsbau ergeben sich<br />
insbesondere für folgende Bereiche (ohne Lücken, Standorte<br />
größer 0,5 ha):<br />
_Schleicherstraße / Karlstraße: Stadtvillen,<br />
_Cuno-Hoffmeister-Straße: Mehrfamilienhäuser,<br />
Mehrgenerationen-Wohnen, Altengerechtes Wohnen,<br />
Sonderwohnformen,<br />
_Herrnaustraße: Einfamilienhäuser innerhalb der Innenstadt.<br />
Als Flächenpotenziale für eine Nachnutzung im Bereich<br />
Mischgebiet / Gewerbe oder für eine Sondernutzung werden<br />
innerhalb des Entwicklungskonzepts für die Innenstadt folgende<br />
Areale vorgeschlagen :<br />
_ehemaliger Güterbahnhof (6,5 ha),<br />
_ehemaliges Salzmann-Gelände (2,1 ha).<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... zukünftige Planungsentscheidungen an den<br />
grundsätzlich vorhandenen auch in Zukunft<br />
belastbaren Stadtstrukturen zu orientieren...<br />
... Ausgangspunkte für Verbesserungen<br />
insbesondere in grundstücks- bzw.<br />
quartiersbezogenen Problemlagen...<br />
...Die Stärkung der zentralen Bereiche (der Mitte) ist<br />
und bleibt wichtiges Ziel der Stadtentwicklung...<br />
... weitere Sanierung der erhaltenswerten<br />
Gebäudesubstanz unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Denkmale...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
61
62<br />
Otto-Keil-Stra e<br />
Alte Poststra e<br />
Röthen<br />
50<br />
M. 1: 4.000<br />
Kantstra e<br />
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stra e<br />
Sport/ Freizeit<br />
100 500 m<br />
Wolkenrasen<br />
Friedrich-Ebert-Stra e<br />
Alte Poststra e<br />
W<br />
Freiheitsstra e<br />
Schwimmhalle<br />
FW<br />
Gorkistra e<br />
G ppinger Stra e<br />
SP<br />
R ntgenstra e<br />
H<br />
Lenaustra e<br />
Forstamt<br />
P<br />
Friesenstra e<br />
D<br />
Röthen<br />
Senioren<br />
Wohnen<br />
VS<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
P<br />
Post<br />
D<br />
D<br />
D<br />
SP<br />
D<br />
Bert-Brecht-Stra e<br />
Friesenstra e<br />
D<br />
Clara-Zetkin-Stra e<br />
Kino<br />
IHK<br />
D<br />
Busbahnhof<br />
Am Wolkenrasen<br />
D<br />
Clara-Zetkin-Stra e<br />
Theodor-K rner-Stra e<br />
P<br />
P<br />
D<br />
D<br />
M<br />
Ziegenr ckweg<br />
VHS<br />
D<br />
D<br />
P<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Grundschule<br />
Lindner<br />
Häuser<br />
Stadtpark<br />
D<br />
Ehemaliger<br />
Güterbahnhof<br />
D<br />
Bürgerschule<br />
D<br />
W<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stra e<br />
Lohau Halle<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Gymnasium<br />
Hinter der Sandgrube<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Gesellschaftshaus<br />
Spielzeugmuseum<br />
D<br />
r<br />
SP<br />
Villa Amalie<br />
Auto<br />
Salzmann<br />
Gelände<br />
St. Stephan<br />
W<br />
FA<br />
Stadtkirche<br />
St. Peter<br />
TS<br />
M<br />
Friedhof<br />
nach Neufang<br />
D<br />
zum Lutherhaus<br />
Schießhausplatz<br />
D<br />
R dnerweg<br />
M<br />
W<br />
Erhaltung und behutsame Ergänzung<br />
der städtebaulichen Grundrissstruktur<br />
Ergänzungs- und Interventionsbereich<br />
Nachnutzung: gemischte Funktion<br />
Neue bauliche Strukturen als Testentwürfe<br />
Nachnutzung: Wohnen<br />
Sanierung und Umbau wichtiger Gebäude<br />
(ggf. neue Nutzungen)<br />
Fußgängerbereich<br />
Vernetzung<br />
Grün- und Wegeverbindung entlang der Röthen<br />
(Aufwertung, Renaturierung)<br />
Öffentliche Grünflächen<br />
Private Grünflächen<br />
Gartendenkmale)<br />
Grünverbindungen, Baumreihen, Alleen<br />
Funktion oder Gestaltung<br />
bedeutender Gebäude<br />
Langer Weg
5.2 Funktionsbausteine / Gliederung<br />
Ausgehend von den vorhandenen Nutzungen ergibt sich<br />
für das Stadtumbaugebiet Innenstadt eine logische und<br />
einfache Funktionsgliederung, die die Grundlage für künftige<br />
Planungsentscheidungen bilden sollte:<br />
1. Konzentration von Verwaltung im Bereich des Bahnhofsplatzes<br />
bzw. der südlichen Bahnhofstraße<br />
2. Schwerpunkt Einzelhandel, Dienstleistungen in der<br />
mittleren Bahnhofstraße<br />
3. Kultur und Bildung um den Juttaplatz bzw. in weiteren<br />
Teilen der nördlichen Unteren Stadt<br />
4. Schwerpunkt Wohnen im östlichen bzw. nordöstlichen<br />
Teil der Unteren Stadt sowie zwischen Gustav-König-<br />
Straße und Coburger Allee sowie westlich davon<br />
5. Sport- und Freizeiteinrichtungen im Südwestteil des<br />
Stadtumbaugebiets.<br />
Anzumerken ist, dass die Funktionen in vielen dieser Bereiche<br />
innenstadttypisch gemischt sind, die Gliederung jedoch die<br />
Schwerpunkte definieren soll. D.h. es gibt Bereiche in denen<br />
die Wohnnutzung dominiert und die, weil sie wegen Lage und<br />
Anbindung gut dafür geeignet sind, auch künftig in erster Linie<br />
für diese Funktion entwickelt werden sollten (Brachen, Lücken,<br />
Sanierung des Bestands).<br />
Andere Bereiche wie die mittlere Bahnhofstraße<br />
wiederum dienen vorrangig dem Einzelhandel und<br />
Dienstleistungseinrichtungen. Hier geht es darum,<br />
Rahmenbedingungen für die Erhaltung der kleinteiligen<br />
Nutzungsstruktur zu schaffen, andererseits muss sich aber auch<br />
die Qualität von Präsentation und Angebot spürbar verbessern.<br />
Die Möglichkeiten der städtebaulichen Planung, für diesen<br />
Bereich Verbesserungen zu initiieren, sind allerdings begrenzt.<br />
Das Problem wird benannt und positive Beispiele werden als<br />
Anregung dargestellt.<br />
Für den Schwerpunktbereich Kultur und Bildung um den<br />
Juttaplatz wird sehr viel von der Sanierung / dem Umbau des<br />
Spielzeugmuseums und der notwendigen Neuausrichtung der<br />
für die Stadt <strong>Sonneberg</strong> so wichtigen Einrichtung abhängen.<br />
Für diese Neuausrichtung ist neben der gegenwärtig in der<br />
Planungsphase befindlichen Sanierung vor allem ein attraktives,<br />
zeitgemäßes und heutigen Anforderungen gerecht werdendes<br />
Museumskonzept notwendig. Aus städtebaulicher Sicht sollte<br />
unbedingt das Umfeld einbezogen werden. Das Gegenüber<br />
des Museums z.B. muss sowohl städtebaulich-räumlich als auch<br />
gestalterisch als unbefriedigend bezeichnet werden und ist<br />
mittelfristig zu verbessern (Freiraum / Bebauung / Nutzung).<br />
Die Stellplatzproblematik sollte im Zusammenhang mit der<br />
Aufwertung / Entwicklung im Bereich Schießhausplatz gelöst<br />
werden. Auch ist zu prüfen inwieweit der nördlich angrenzende<br />
Grünbereich einbezogen werden kann.<br />
Als bevorzugter Wohnstandort <strong>Sonneberg</strong>s gilt der nordöstliche<br />
Teil der Unteren Stadt, insbesondere der Bereich um den<br />
Juttaplatz. Ein Potenzial für hochwertigen Wohnungsbau<br />
ergibt sich u.E. zudem im Ostteil des Quartiers Juttastraße /<br />
Schleicherstraße / Karlstraße / Rathenaustraße. In Ergänzung<br />
des vorhandenen Quartiers bietet sich hier eine Stadtvillen-<br />
Bebauung mit zeitgemäßen Wohnungszuschnitten an.<br />
Auch Areale im Bereich der Cuno-Hoffmeister-Straße sind<br />
für eine wohnbauliche Nutzung geeignet. Mit Blick auf die<br />
demografischen Veränderungen sollte sich die Untere Stadt<br />
neben ihrer wichtigen Zentrumsfunktion mehr als bisher als<br />
der Wohnstandort innerhalb <strong>Sonneberg</strong>s entwickeln. Dazu<br />
müssen an den unterschiedlichen Standorten, die für eine<br />
wohnbauliche (Nach-) Nutzung in Frage kommen, differenzierte<br />
und nachfragegerechte Wohnformen entwickelt werden.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
M. 1: 4.000<br />
Vernetzungsmöglichkeit<br />
erforderliche Aufwertung<br />
Aktivitätsknoten R= 150 m<br />
50 100 500 m<br />
Konzentrationszonen Handel - Gewerbe<br />
Aktivitätsknoten<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
63
64<br />
Ein nachfragegerechtes Wohnungsangebot ist ein wichtiger<br />
Standortfaktor.<br />
Den funktionellen Schwerpunkt im westlichen<br />
Stadtumbaugebiet bilden die verschiedenen Sport- und<br />
Freizeiteinrichtungen. Auf beiden Seiten der Ernst-Moritz-Arndt-<br />
Straße konzentrieren sich mit dem Stadion, den Tennisplätzen,<br />
einer Skateboardbahn sowie dem Sonnebad und der Eislaufhalle<br />
die wichtigsten Sportstätten der Stadt. Das Stadion mit Umfeld<br />
muss saniert werden. Für eine Aufwertung des Gesamtbereichs<br />
ist vor allem ein Freiraum- und Wegekonzept notwendig. In<br />
diesem Zusammenhang ist auch die Stellplatzproblematik zu<br />
lösen.<br />
Zusammenfassend ist zu empfehlen, dass alle künftigen<br />
Standortentscheidungen und Nutzungsüberlegungen auf der<br />
Grundlage und unter Berücksichtigung dieses Funktionskonzepts<br />
getroffen werden sollten. Dies fördert die notwendige<br />
städtebauliche Ordnung und Orientierung und sichert die<br />
Funktionsfähigkeit der Stadt auch bei zurückgehenden<br />
Bevölkerungszahlen.<br />
Funktionsbausteine für Entwicklungen<br />
Areale:<br />
1 Verwaltung<br />
2 Einzelhandel<br />
Dienstleistunen<br />
3 Kultur, Bildung<br />
4 Wohnen<br />
5 Sport, Freizeit<br />
Verbindung zu wichtigen Bereichen,<br />
Verknüfungen<br />
M. 1: 4.000<br />
50<br />
5<br />
Baulich - räumliche Ensemble,<br />
Entwicklungsbereiche<br />
100 500 m<br />
1<br />
4<br />
4<br />
4<br />
2<br />
4<br />
4<br />
3<br />
4<br />
1 Verwaltung<br />
2 Einzelhandel<br />
Dienstleistungen<br />
3 Kultur / Bildung<br />
4 Wohnen<br />
5 Sport / Freizeit
5.3 Prognose / Entwicklung Baustruktur<br />
Bei der Entwicklung der Baustruktur müssen die<br />
Einwohnerentwicklung, die wiederum von der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung und der Attraktivität der Stadt abhängt, und<br />
das Flächenangebot für Wohnen und Gewerbe korreliert<br />
werden. Die heutige Situation gestattet rein rechnerisch<br />
die problemlose Unterbringung neuer Einwohner in der<br />
Innenstadt, aber das Angebot entspricht in den meisten<br />
Fällen nicht den Anforderungen und Wünschen der Bürger.<br />
Bedarfsgerechte Anpassung erfordert Sanierungs- und<br />
Modernisierungsmaßnahmen, die ohne entsprechende<br />
Förderung nicht realisiert werden können. Einige Ansprüche<br />
können nur durch Neubauten abgedeckt werden. Wenn<br />
man berücksichtigt, dass außerdem ein Teil der Bausubstanz<br />
in teilweise bedenklichen Zustand ist, ergibt sich folgende<br />
Situation:<br />
Der Sta<br />
dtgrundriss des Industriezeitalters bildet auch bei weiterem<br />
Verlust von Gebäuden eine solide Basis (die Baustruktur wird<br />
aufgelockert, es gibt mehr Grün, der Zusammenhang geht nicht<br />
verloren).<br />
Auch die extreme, partielle Ausdünnung der baulichen<br />
Strukturen führt nicht zum Verlust der Leitungsfähigkeit (und ist<br />
somit – zumindest theoretisch – möglich).<br />
In einigen Fällen ist der Rückbau von Gebäudesubstanz<br />
unvermeidlich; falls die entstehenden Lücken städtebauliche<br />
oder architektonische Probleme verursachen, sollten „schnelle“,<br />
bauliche Lösungen angestrebt werden, mit funktionellen<br />
Angeboten, die in der heutigen Substanz nicht oder nur mit<br />
großem Aufwand untergebracht werden können.<br />
Entstehende Lücken können auch, falls keine neue Wohn- oder<br />
Gewerbenutzung in Sicht ist, temporär geschlossen werden und<br />
bleiben potenzielles Bauland – es besteht kein Handlungsdruck.<br />
Auch Freiraumelemente oder Öffentliche Kunst können<br />
entstehenden Lücken temporär oder dauerhaft füllen.<br />
- 10 %<br />
- 20 %<br />
Die folgenden Beispiele zeigen die räumlichen Veränderungen durch den hypothetischen Verlust von Bausubstanz in einem<br />
Teil des Denkmal geschützten Innenstadtensembles. Zur besseren Vergleichbarkeit der Entwicklung wurden die Gebäude und<br />
das Gelände stark abstrahiert (nur Volumen mit Firsthöhe und Gelände ohne Höhenentwicklung).<br />
Die Modelle zeigen die Entwicklung vom Verlust weniger Häuser bis zum Verlust von ca. 65 Prozent der Substanz.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Szenario_1<br />
- 30 %<br />
- 40 %<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
65
66<br />
- 50 %<br />
- 65 %<br />
Bäume im oberen Bild symbolisieren zusätzliche<br />
Anpflanzungen, - die Grünflächen im unteren Bild sollen<br />
die Intensivierung und qualitativen Verbesserungen im<br />
Freiraumbereich versinnbildlichen.<br />
„Vordergründig scheint der öffentliche Raum kein lebenswichtiger<br />
Ort mehr für die heutige Stadtgesellschaft zu sein. Man kann ihn<br />
auf vielfältige Weise nutzen, aber man muss es nicht tun. Wenn<br />
man sein Leben entsprechend einrichtet, kann man auch zwischen<br />
Einfamilienhausgebiet und Supermarkt, zwischen Multiplexkino<br />
und Center Park und zwischen Fitnessstudio und Ferienhaussiedlung<br />
selig werden. Die nachlassende Bindung an die traditionellen<br />
Räume hat zur Konsequenz, dass sich die Qualität und Nutzung der<br />
urbanen Räume in verschiedene Richtungen entwickeln: Manche<br />
traditionellen Stadtplätze leeren sich und werden als Angstraum<br />
wahrgenommen.<br />
Doch es gibt auch andere Erfahrungen. Finden sich nicht in den<br />
meisten Städten Orte, die eine große Anziehungskraft entwickeln,<br />
gibt es nicht eine neue „Lust am Stadtraum“ wie es Klaus Humpert<br />
(1994, 30) formuliert hat, die an sonnigen Tagen die Städter in die<br />
Straßencafés treibt?<br />
Was ist heute interessant an der Gestaltung öffentlicher Räume? Es<br />
geht weniger um die Erfüllung notwendiger Programme als um die<br />
Erzeugung von Gelegenheiten. Angesichts der verbreiteten Absicht,<br />
städtische Flaniermeilen und Shopping Center als private Zonen zu<br />
deklarieren und aus dem öffentlichen Raum heraus zu lösen, kommt<br />
der Kultivierung eben jener Räume in der Stadt, die – wie Hans-Paul<br />
Bahrdt es ausdrückte – „allen und niemandem gehören“ besondere<br />
Bedeutung zu.“<br />
(Pesch, 15)
Gegenwärtiger Bestand mit Begrünung<br />
Beide Extremsituationen, sowohl hinsichtlich Schrumpfung<br />
als auch Wachstum, sind unrealistisch; sie sollen lediglich<br />
noch einmal die Anpassungsfähigkeit der städtebaulichen<br />
Struktur verdeutlichen und zeigen, dass diese Struktur in<br />
der Lage ist, auch extreme Veränderungen zu integrieren.<br />
Die zukünftige Entwicklung wird, vorausgesetzt die<br />
Prognosen zur demografischen und wirtschaftlichen<br />
Entwicklung treffen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu,<br />
wird auf die summarische Erhaltung hinauslaufen. D.<br />
h. Gebäudebestand wird in geringen Umfang durch<br />
Neubauten ersetzt und Nebengebäude in den Innenhöfen<br />
weichen zugunsten gemeinschaftlich oder privat genutzter<br />
Grünräume (Gärten, Spielplätze usw.).<br />
Szenario_1<br />
Worst Case aus der Fussgängersicht - mit und ohne<br />
Begrünung (Bereich Juttastraße)<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Szenario_2<br />
Wachstum - Erweiterung<br />
oben + 33 %, unten + 43 %<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
67
68<br />
5.4 Vernetzung, Synergien<br />
Insgesamt wird eine wesentliche Chance innerhalb der künftigen<br />
Stadtentwicklung auch in der besseren Vernetzung der einzelnen<br />
Standorte bzw. einzelnen Maßnahmen unter Ausnutzung von<br />
Synergieeffekten gesehen.<br />
In Anlehnung an die Idee der historischen Meile und der<br />
Spielmeile wird vorgeschlagen noch vorhandene ehemals für die<br />
Spielzeugproduktion genutzte Manufaktur- bzw. Lagergebäude<br />
innerhalb der Unteren Stadt aufzuspüren und zu nutzen<br />
(Fabrikmeile mit Rundgang).<br />
Das Thema Spielzeugstadt <strong>Sonneberg</strong> wäre dann nicht nur auf<br />
Lesetafeln vor den jeweiligen Gebäuden erschließbar, sondern<br />
bekommt eine aktivere Komponente, die nicht als Konkurrenz<br />
zum Spielzeugmuseum gesehen werden sollte, sondern als<br />
Ergänzung und Bereicherung.<br />
Vernetzung und bessere Ausnutzung von Synergien meint<br />
auch Verknüpfung von Funktionen. Orte der Kultur und Bildung<br />
wie das Spielzeugmuseum brauchen eine gastronomische<br />
Infrastruktur und sollten auch mit Handelseinrichtungen<br />
(Museumsshop, Spielzeugläden) verknüpft sein.<br />
Ein gute verkehrliche Erreichbarkeit, ein ausreichendes<br />
Stellplatzangebot sowie die Anbindung an den ÖPNV sind<br />
Grundvoraussetzungen für die Funktionsfähigkeit.<br />
Synergie – Effekte sind auch durch die systematisch organisierte<br />
Nutzung von Ressourcen und Potenzialen der Region, der<br />
Bündelung der Kräfte und Spezialisierung innerhalb des<br />
Wirtschaftsraumes möglich. Das erfordert die Koordination<br />
der Planungsmaßnahmen und Events. Als Beispiel sei hier die<br />
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen<br />
Spielzeugmuseum in <strong>Sonneberg</strong> und dem Museum der<br />
Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt genannt.<br />
Es ist jedoch durchaus denkbar, die notwendige Steuerung privat<br />
mit hoher ehrenamtlicher Beteiligung zu organisieren. Dieses<br />
Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil die zukünftige<br />
Stadtentwicklung unter den geschilderten wirtschaftlichen,<br />
demografischen und soziokulturellen Bedingungen nicht durch<br />
Administrationen bewältigt werden kann.<br />
Die Voraussetzungen für die Mobilisierung einer engagierten<br />
Bürgerschaft müssen durch Information und verbesserte<br />
Motivation geschaffen werden. Die Kommunikation zwischen<br />
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft sollte<br />
durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten hergestellt<br />
werden, in denen regelmäßig Informationsveranstaltungen,<br />
Diskussionsforen, Ausstellungen, Vorträge usw. zu<br />
Stadtentwicklungsthemen stattfinden.<br />
Der Erfahrungsaustausch mit Institutionen, Bürgern, Firmen usw.<br />
aus anderen vergleichbaren Städten (Partnerstädten) könnte<br />
ebenfalls Bestandteil dieser Maßnahme werden.<br />
Die dargestellten Varianten nehmen die Bauflucht und<br />
Höhe des Sparkassengebäudes in der Bahnhofstraße auf,<br />
bilden also gewissermaßen eine moderate Lösung.<br />
Konsequent und durchaus auch im Interesse der<br />
Denkmalpflege wäre die Aufnahme der Flucht des früheren<br />
Woolworth - Gebäudes und der Höhen von Rathaus und<br />
AOK - Gebäude. Um Kubatur und Nutzflächen zu reduzieren<br />
ist in diesem Fall eine Höhenstaffelung (-reduzierung) des<br />
Neubaus in nördliche Richtung denkbar.<br />
Bahnhofsvorplatz<br />
heutiger Zustand<br />
Schließen der Bauflucht - Bahnhofstraße<br />
gegliederte Blockstruktur
5.5 Empfehlungen für Teilbereiche<br />
Die Abbildungen sind Symbole mit einigen wesentlichen,<br />
räumlichen Eigenschaften der zukünftigen Lösungen - sie sind<br />
keinesfalls als Entwürfe zu verstehen.<br />
5.5.1 Bahnhofsplatz / Woolworth-Gelände<br />
Für den Bereich Ostseite Bahnhofsplatz / Woolworth-Gelände ist<br />
eine Wiederherstellung der Raumkanten zur Bahnhofstraße und<br />
zum Bahnhofplatz von großer Bedeutung. Die stadträumliche<br />
Komplettierung des zwischen 1922 und 1932 entstandenen<br />
Ensembles mit Rathaus, AOK-Gebäude und Postamt als<br />
Haupteingang und südlicher Auftakt der Innenstadt ist und<br />
bleibt wichtiges Ziel der Innenstadtentwicklung.<br />
Eine Schwierigkeit wird insbesondere darin bestehen, das<br />
historisch vorhandene Volumen (immerhin hatte das Woolworth-<br />
Lagergebäude fünf Vollgeschosse) mit heutigen Nutzungen zu<br />
füllen.<br />
Ein Neubau sollte aus stadträumlicher Sicht mindestens die Trauf-<br />
bzw. Gebäudehöhe des nördlich angrenzenden viergeschossigen<br />
Sparkassen-Gebäudes aufweisen. Hinsichtlich der Nutzung sind<br />
verschiedene Varianten denkbar.<br />
Realistisch erscheint eine Kombination verschiedener auch<br />
flächenintensiver Handelseinheiten (event. Ausrichtung auf<br />
Spielzeug, „toys are us“ o.ä.) mit Dienstleistungen, Gastronomie,<br />
Freizeit und Unterhaltung.<br />
In den Obergeschossen sind auch Büros oder Wohnungen<br />
möglich.<br />
Veränderungspotenzial gibt es auch hinsichtlich des größtenteils<br />
leerstehenden Gebäudes Gustav-König-Straße 43.<br />
Das bisher für Parken, Gastronomie, Handel und eine Diskothek<br />
genutzte Gebäude sollte saniert, umgebaut und an heutige<br />
Nutzungserfordernisse angepasst werden.<br />
Auch ein Teilrückbau (Geschosse) und gestalterische<br />
Verbesserungen (Fassade) sind in Betracht zu ziehen. Eine<br />
Nutzung als „Freizeitimmobilie“ kann angestrebt werden.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Neubauvarianten auf dem ehemaligen Woolworth - Gelände<br />
heutiger Zustand Blockrand<br />
Zeile (Solitär) gegliederte Blockstruktur - Teilrückbau, Sanierung Parkhaus<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
69
70<br />
5.5.2 Schießhaus-Platz<br />
Der Schießhausplatz am Ostrand des Stadtumbaugebiets ist<br />
für eine multifunktionale Nutzung gestalterisch und funktional<br />
aufzuwerten. Er soll als Festplatz / Festwiese, als Ankunftsort für<br />
die Innenstadt und das Spielzeugmuseum (Parken für Busse und<br />
PKW) sowie als Platz für den Caravantourismus genutzt werden.<br />
Die Einordnung eines Funktions- bzw. Servicegebäudes mit<br />
Informationsbereich, Kiosk, WC erscheint sinnvoll. Für die Lage<br />
des Servicegebäudes ist der südöstliche Platzbereich geeignet<br />
(Standort des ehemaligen Schießhauses).<br />
5.5.3 Güterbahnhof<br />
Der ca. 6,5 ha große Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs ist<br />
das größte innerstädtische Flächenpotenzial <strong>Sonneberg</strong>s.<br />
Durch seine zentrale Lage innerhalb der Gesamtstadt im<br />
Übergangsbereich zwischen der Innenstadt / Unteren Stadt<br />
und dem Wohngebiet Wolkenrasen ergeben sich verschiedene<br />
Nachnutzungsmöglichkeiten. Stadtstrukturell ist sowohl eine<br />
gemischte bauliche Nutzung als auch eine Freiraumzäsur<br />
denkbar.<br />
Auch eine Bebauung mit hohem Grünanteil ist möglich.<br />
Unabhängig von den Nutzungsüberlegungen ist in die Konzepte<br />
die Fuß- und Radwegeverknüpfung zwischen Wolkenrasen und<br />
der Innenstadt zu integrieren. Aus Sicht der Entwicklung der<br />
Innenstadt gibt es für die Nachnutzung dieses Bereichs keinen<br />
großen Handlungsdruck.<br />
Für das Gelände wurden im Auftrag der LEG Thüringen<br />
städtebauliche Varianten unter der Bezeichnung „OPTIRISK“ im<br />
Rahmen des RESINA - Projekts entwickelt.<br />
5.5.4 Ehemaliger Busbahnhof<br />
Der Bereich des ehemaligen Busbahnhofs ist heute eine<br />
große Bitumenfläche, die zum Teil als Stellplatz genutzt wird.<br />
Die Gesamtsituation um den als Kreisverkehr ausgebildeten<br />
Verkehrsknoten (Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Coburger<br />
Straße) im Südwesten der Innenstadt ist räumlich sehr<br />
indifferent. Eine städtebaulich-räumliche Fassung wäre zwar<br />
wünschenswert, wird aber eher als unrealistisch eingeschätzt.<br />
Ansatzpunkte für eine partielle Verbesserung werden in einer<br />
funktionellen und gestalterischen Aufwertung des Bereichs<br />
(Freiraum, Wegeverbindungen) in Verbindung mit einer<br />
besseren Verknüpfung zu angrenzenden Stadtbereichen<br />
(Sportzentrum, Innenstadt) gesehen. Auch die Einordnung<br />
von Systemgastronomie und/oder einer jugendorientierten<br />
Beherbergungseinrichtung ist denkbar. Wichtig ist die<br />
Einbindung des Standortes in ein übergeordnetes Freiraum- und<br />
Wegekonzept.
75 m<br />
ort/ Freizeit<br />
Alte Poststra e<br />
Alte Poststra e<br />
W<br />
Freiheitsst<br />
Freiheitsst<br />
Schwimmhalle<br />
FW<br />
SP<br />
R ntgenstra e<br />
R ntgenstra e<br />
H<br />
P<br />
P<br />
D<br />
Post<br />
Wolkenrasen<br />
Post<br />
D<br />
Röthen<br />
Senioren<br />
Wohnen<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
VS<br />
P<br />
D<br />
Halle<br />
Parken unter Bäumen<br />
P<br />
Wolkenrasen<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Stadtwald<br />
SP<br />
Mietfabrik<br />
D<br />
D<br />
rt-Brecht-Stra e<br />
D<br />
D<br />
rt-Brecht-Stra e<br />
Busbahnhof<br />
Kino<br />
IHK<br />
A<br />
Büros<br />
P<br />
P<br />
Umschlaghalle<br />
Parken<br />
Lohau Halle<br />
Gymnasium<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
A<br />
D<br />
Busbahnhof<br />
D<br />
Stadtwald<br />
P<br />
P<br />
Bahnbetriebswerk<br />
FH für Spielzeugdesign<br />
D<br />
P<br />
D<br />
P<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
W<br />
W<br />
D<br />
D<br />
Lohau Halle<br />
D<br />
Gymnasium<br />
01.Bahnlogistik<br />
D<br />
Auto<br />
SP<br />
Salzmann<br />
Gelände<br />
Auto<br />
Salzmann<br />
Gelände<br />
St. Stephan<br />
W<br />
400 m<br />
02. Bahnnahes Gewerbe, FH für Spielzeugdesign und Mietfabrik<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
FA<br />
FA<br />
400 m<br />
LEG:Thüringen, Bauhaus Universität Weimar, JENA GEOS GmbH<br />
TS<br />
M<br />
TS<br />
M<br />
D<br />
Schieß<br />
71
75 m<br />
rt/ Freizeit<br />
72<br />
Alte Poststra e<br />
Alte Poststra e<br />
W<br />
Freiheitsst<br />
Freiheitsst<br />
Schwimmhalle<br />
FW<br />
SP<br />
R ntgenstra e<br />
R ntgenstra e<br />
H<br />
P<br />
P<br />
Energiezaun D<br />
Energie- D<br />
bausätze<br />
Sportplatz<br />
Post<br />
Spielbereich<br />
Powertank<br />
Energiespielplatz<br />
„Hamsterlaufrad“<br />
Energiepanzbeete<br />
Wolkenrasen<br />
Post<br />
D<br />
Röthen<br />
Senioren<br />
Wohnen<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
VS<br />
P<br />
P<br />
D<br />
D<br />
Rodeln<br />
D<br />
rt-Brecht-Stra e<br />
Langzeitwärmespeicher<br />
Hundeplatz<br />
Wolkenrasen<br />
D<br />
D<br />
D<br />
SP<br />
D<br />
D<br />
Spielplatz<br />
rt-Brecht-Stra e<br />
D<br />
Windräder<br />
Energieberater<br />
Baustoinfolager<br />
Busbahnhof<br />
Kino<br />
IHK<br />
A<br />
Busbahnhof<br />
Physikalische<br />
Experimente<br />
Langzeitwärmespeicher<br />
Temporäres Messegelände,<br />
Ausstellungen, Basketball,<br />
Skaten, Dampokfesttage,<br />
Parken<br />
A<br />
D<br />
P<br />
P<br />
Sonnenzaun<br />
Passivhaus<br />
Dynamo<br />
P<br />
P<br />
Spielbereich<br />
D<br />
P<br />
D<br />
D<br />
Bahnbetriebswerk<br />
D<br />
P<br />
D<br />
D<br />
D<br />
Bahnbetriebswerk<br />
D<br />
D<br />
W<br />
D<br />
Parken<br />
W<br />
Lohau Halle<br />
D<br />
Gymnasium<br />
Lohau Halle<br />
D<br />
Gymnasium<br />
D<br />
Auto<br />
SP<br />
Salzmann<br />
Gelände<br />
Auto<br />
Salzmann<br />
Gelände<br />
St. Stephan<br />
03. Spielzeugland/ Energieinformationsflächen<br />
FA<br />
400 m<br />
04. Stadtgarten mit temporärem Messegelände<br />
W<br />
FA<br />
400 m<br />
LEG:Thüringen, Bauhaus Universität Weimar, JENA GEOS GmbH<br />
TS<br />
M<br />
TS<br />
M<br />
m<br />
D<br />
Schießh<br />
D
5.5.5 Cuno-Hoffmeister-Straße<br />
Aufgrund der ruhigen und dennoch sehr zentralen Lage, den<br />
kurzen Wegen zu Einzelhandels- und Infrastruktureinrichtungen<br />
(150 m bis zur Bahnhofstraße) und der vorhandenen<br />
Erschließung eignet sich der Standort am Südrand der Unteren<br />
Stadt sehr gut für eine Wohnbau-Nutzung. Folgende Aspekte<br />
sind bei einer Neubebauung zu beachten:<br />
Berücksichtigung des städtebaulichen Kontext (Kubaturen,<br />
Materialität ), zeitgemäße Architektur,<br />
offene Bauweise (Gebäudelängen kleiner 50 m),<br />
in der Regel sollten 3 Vollgeschosse angestrebt werden (die<br />
Möglichkeit eines Staffelgeschosses kann diskutiert werden),<br />
vorhandene Bauflucht nicht überschreiten, Zurückspringen bei<br />
städtebaulicher Begründung möglich,<br />
Verbindung Lohaustraße beachten (Anbindung der Lohaustraße<br />
auch im rechten Winkel zur Cuno-Hoffmeister-Straße möglich –<br />
Vorteil: bessere Grundstückszuschnitte)<br />
Nutzung: Mehrfamilienhäuser mit attraktiven<br />
Geschosswohnungen, Sonderwohnformen, Seniorenwohnungen<br />
(ein Programm ist mit den jeweiligen Bauherren / Betreibern zu<br />
erarbeiten).<br />
Der Standort eignet sich aufgrund der Struktur des<br />
städtebaulichen Umfeldes für Mehrfamilienhäuser mit<br />
bedarfsgerechten Wohnungszuschnitten. Charakteristisch<br />
für die Umgebung ist das Nebeneinander von meist zwei-<br />
bis dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern und den<br />
dahinter angeordneten, bis zu viergeschossigen Fabrikgebäuden.<br />
Deshalb können an diesem Standort auch Gebäude eingeordnet<br />
werden, deren Kubaturen die Ausdehnung einer typischen<br />
Stadtvilla überschreiten.<br />
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Standortes ist<br />
auch die Umgestaltung / Aufwertung des Straßenraumes Cuno-<br />
Hoffmeister-Straße zu betrachten.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... Standort am Südrand der Unteren Stadt sehr gut<br />
für eine Wohnbau-Nutzung...<br />
... Standort eignet sich aufgrund der Struktur des<br />
städtebaulichen Umfeldes für<br />
Mehrfamilienhäuser mit bedarfsgerechten<br />
Wohnungszuschnitten...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
73
74<br />
5.5.6 Sport- und Freizeitpark<br />
Der gesamte Sportkomplex bedarf einer umfassenden baulichen,<br />
funktionalen und gestalterischen Aufwertung. Dies betrifft<br />
insbesondere den Eingangsbereich mit Funktionsgebäude<br />
(inkl. Umkleiden, Büro) aber auch das eigentliche Stadion mit<br />
Fußballfeld und Leichtathletikanlagen. Für den Sportkomplex<br />
einschließlich Tennisplatz und Übungsplätzen ist ein Freiraum-<br />
und Wegekonzept zu erarbeiten. Eine parkartige Gestaltung der<br />
Gesamtanlage in Verbindung mit einer gezielten Aufwertung<br />
einzelner Funktionsbereiche ist anzustreben. Dabei ist einerseits<br />
den Interessen der Vereine Rechnung zu tragen, andererseits<br />
müssen jedoch auch Synergien und Mehrfachnutzungen<br />
aufgezeigt und umgesetzt werden. Ein sanierter und gut<br />
nutzbarer Sportkomplex ist ein wichtiger Baustein innerhalb der<br />
Aufwertung der Innenstadt bzw. des Stadtumbaugebietes.<br />
5.5.7 Röthen<br />
Im Zuge der abschnittsweisen Renaturierung des Verlaufs der<br />
Röthen sollten alle Möglichkeiten genutzt werden entlang<br />
des Wasserlaufes eine innerörtliche und in der südlichen<br />
Weiterführung auch regionale Grün- und Wegeverbindung<br />
aufzubauen.<br />
Die Röthen ist bis auf wenige Ausnahmen (Untere Marktstraße,<br />
Coburger Allee) bisher wenig stadtbildwirksam. Dies kann durch<br />
Maßnahmen der Gestaltung und Renaturierung entlang des<br />
Verlaufs verbessert werden.<br />
Außerdem könnte eine zusätzliche, eher grüne Verbindung<br />
innerhalb des Stadtumbaugebietes Innenstadt geschaffen<br />
werden, die insbesondere den heterogen strukturierten<br />
westlichen Teil aufwertet und besser in das städtische Gefüge<br />
einbindet.<br />
...Für den Sportkomplex einschließlich Tennisplatz<br />
und Übungsplätzen ist ein Freiraum- und<br />
Wegekonzept zu erarbeiten...<br />
...er Baustein innerhalb der Aufwertung der<br />
Innenstadt bzw. des Stadtumbaugebietes...<br />
...entlang des Wasserlaufes eine innerörtliche und<br />
in der südlichen Weiterführung auch regionale<br />
Grün- und Wegeverbindung aufzubauen...<br />
...grüne Verbindung innerhalb des<br />
Stadtumbaugebietes Innenstadt geschaffen<br />
werden, die insbesondere den heterogen<br />
strukturierten westlichen Teil aufwertet und<br />
besser in das städtische Gefüge einbindet...
5.5.8 Ehemaliges Salzmann-Gelände<br />
Am südöstlichen Rand des Stadtumbaugebiets Innenstadt<br />
befindet sich ein Bereich, der wegen seiner Lage und dem<br />
städtebaulichen Kontext für eine reine Wohnnutzung wenig<br />
geeignet ist, aber für eine gemischte bzw. gewerbliche Nutzung<br />
revitalisiert werden sollte.<br />
Im Zusammenhang mit einer möglichen Revitalisierung muss<br />
betrachtet werden, dass der Bereich auch den Innenstadteingang<br />
aus östlicher Richtung markiert und auch schon deshalb<br />
einer Verbesserung / Aufwertung bedarf. Im Rahmen einer<br />
Umgestaltung und Neuordnung sind die stabilen vorhandenen<br />
Nutzungen zu integrieren (z.B. Finanzamt).<br />
Eventuell vorhandene Defizite dieser Einrichtungen könnten im<br />
Rahmen der Revitalisierung abgebaut werden. Auch vorhandene<br />
Erweiterungsabsichten sind zu berücksichtigen.<br />
Alle nicht mehr nutzbaren Gewerbegebäude sollten abgerissen<br />
werden. Eine maßvolle bis zu dreigeschossige Bebauung entlang<br />
der Ernst-Moritz-Arndt-Straße kann neu eingeordnet werden.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... der Bereich auch den Innenstadteingang aus<br />
östlicher Richtung markiert und auch schon<br />
deshalb einer Verbesserung / Aufwertung bedarf...<br />
... maßvolle bis zu dreigeschossige Bebauung<br />
entlang der Ernst-Moritz-Arndt-Straße kann neu<br />
eingeordnet werden...<br />
... reine Wohnnutzung wenig geeignet ist, aber<br />
für eine gemischte bzw. gewerbliche Nutzung<br />
revitalisiert werden sollte. ...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
75
76<br />
6. Leitbild Innenstadt<br />
Ein Leitbild ist als strategische Zielvorstellung ein grobes<br />
„Bild“ einer angestrebten Zukunft bzw. eines angestrebten<br />
Zustands. Im Zusammenhang mit dem „Leitbild“ wird häufig<br />
der Begriff „Stadtimage“ als Synonym verwendet, auch wenn<br />
beide Begriffe nicht identisch sind. Zielt das Leitbild auf das<br />
Erscheinungsbild der Stadt, ist das „Image“ mehr auf ein Gesamt<br />
– und Stimmungsbild im Sinne des Prestiges, des Ansehens<br />
orientiert. Die begrifflichen Schwierigkeiten werden erschwert,<br />
weil die Imagebildung großen Einfluss auf die Identität der<br />
Stadt hat und heute unmittelbar mit dem Stadtmarketing in<br />
Verbindung gebracht wird. Auch Kultur, Kulturveranstaltungen<br />
(12) und kulturell relevante Orte und Gebäude, werden in diesem<br />
Zusammenhang genannt. Kultur wird dabei zunehmend als<br />
Marketingaspekt im Städtewettbewerb interpretiert. (<strong>13</strong>)<br />
Es besteht die Gefahr, Stadt nur noch als Bühne, Waren- und<br />
Werbeträger und Verkaufstresen zu betrachten und die<br />
merkantilen Funktionen überzubewerten (mit „City Branding“<br />
und „Place Making“ auf Vermarktungskurs).<br />
Entscheidend für Leitbildentwicklung und Imagebildung ist<br />
der öffentliche Raum, seine funktionalen, gestalterischen und<br />
strukturellen Qualitäten, seine Prägung durch Architektur und<br />
Städtebau. Der öffentliche Raum ist ein „ Wesensmerkmal der<br />
europäischen Stadt“, ein „Ort des Austauschs, der Begegnung“,<br />
des „gesellschaftlichen Lebens“ und hat somit eine „soziale<br />
Funktion“. Er ist ein „Ort für Kunst, Mobilität und Handel“, eine<br />
„Visitenkarte und Bühne“ der Städte (14).<br />
In den letzten Jahren konnte auch Deutschland ein sich<br />
verstärkender Trend zur „McDonaldisierung von Stadtwelten<br />
und Stadtimage“ beobachtet werden, wie der amerikanische<br />
Soziologe George Ritzer die lückenlose Rationalisierung unserer<br />
Tage nannte. In der städtischen Erinnerungskultur treten heute<br />
vermeintliche Ereignisse an die Stelle der realen Historie.<br />
Das so entstehende Bild sollte korrigiert werden: die<br />
Stadt ist (nicht nur) Austragungsstätte der Werbe –und<br />
Marketingkonkurrenz und die Aussage, „hochwertige<br />
Werbeträger fördern das Stadt – Image“<br />
(STRÖER, Pressemitteilung v. 16. 8. 99) ist insofern falsch, als die<br />
Werbeträger in erster Linie das Image ihrer Produkte fördern. (In<br />
diesem Zusammenhang muss auf eine, das Stadtbild zunehmend<br />
negativ beeinflussende Erscheinung aufmerksam gemacht<br />
werden: das Aufstellen so genannter Passantenstopper vor<br />
Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen!)<br />
Es wird häufig betont, dass die Stadt gleichzeitig<br />
Wirtschaftsstandort, Messeschauplatz, Kulturzentrum und/ oder<br />
Touristenziel sein sollte, wobei verkannt wird, dass sie in erster<br />
Linie Wohn – und Arbeitsstandort ist.<br />
Das Image entsteht affektiv und reflektiert Assoziationen,<br />
Informationen und die Wahrnehmung der Stadt. Die Entwicklung<br />
des Leitbildes sollte dies berücksichtigen und sowohl aus<br />
stadtsoziologischer, geografischer als auch stadtmorphologischer<br />
Sicht entwickelt werden. Der Umgang mit den soziologischen<br />
und geografischen Aspekten ist heute selbstverständlich – die<br />
morphologischen Komponenten werden eher unterschätzt.<br />
Dabei ist beispielsweise die Lebensdauer der Bauformen, die<br />
Struktur der Bebauung, die Parzellenbildung, die Anpassung an<br />
neue Bedürfnisse innerhalb des bestehenden Stadtgrundrisses<br />
ebenso wichtig wie die Untersuchung der Struktur formenden<br />
Kräfte, die Minimierung des Wegeaufwands, die Anforderungen<br />
wichtiger Produzenten an den Raum, Orientierung und<br />
Ordnungsbedürfnis usw. Es muss unterschieden werden<br />
zwischen dem Selbstimage (der Bürger) und dem Fremdimage<br />
(der Stadtbesucher), die stark voneinander abweichen können,<br />
und es muss die konservative Meinungsbildung mit der Stabilität<br />
von Werturteilen verglichen werden.<br />
Neben diesen allgemeinen, nicht Standort bezogenen (und<br />
teilweise theoretischen) Aspekten gibt es folgende konkrete<br />
Ansatzpunkte für die Imagebildung:<br />
... der öffentliche Raum ist ein „ Wesensmerkmal<br />
der europäischen Stadt“...<br />
...ein „Ort des Austauschs, der Begegnung“, des<br />
„gesellschaftlichen Lebens“ und hat somit eine<br />
„soziale Funktion“. ...<br />
... er ist ein „Ort für Kunst, Mobilität und Handel“,<br />
eine „Visitenkarte und Bühne“ der Städte....<br />
...die Stadt ist in erster Linie Wohn- und<br />
Arbeitsstandort....
Spiel(zeug)stadt<br />
Diese Thematik hat nach wie vor Priorität, denn als<br />
Spielzeugstadt ist <strong>Sonneberg</strong> auch heute noch international<br />
bekannt, auch wenn die Spielwarenherstellung inzwischen nur<br />
noch eine vergleichsweise marginale Rolle im Erwerbsleben der<br />
<strong>Sonneberg</strong>er spielt.<br />
Um dem Anspruch und der Erwartungshaltung zu entsprechen<br />
sind jedoch einige Maßnahmen erforderlich, die über die<br />
dringend erforderliche Sanierung und Aufwertung des<br />
Deutschen Spielzeugmuseum hinausgehen.<br />
Dazu gehört z. B. ein modernes ausstellungstechnisch–<br />
gestalterisches, aber auch museumspädagogisch– didaktisches<br />
Museumskonzept. Es sollte auch die Integration der aktuellen<br />
wissenschaftlichen Arbeit, der Forschung angestrebt werden,<br />
die mit kontinuierlichen Veranstaltungen den Bezug zur<br />
<strong>Sonneberg</strong>er Spielzeugtradition herstellt. Die Chancen dafür<br />
sind gut, weil die moderne Spieleforschung (Games Studies) als<br />
transdisziplinärer Forschungszweig erst in den 1990 er Jahren als<br />
Schnittstelle von Kultur- und Strukturwissenschaften entstand.<br />
Spielen stellt das älteste bekannte Kulturphänomen dar und<br />
ist auch für Erwachsene als institutionalisiertes Spielen (zum<br />
Beispiel im Sport) eine feste Größe. Spielen im öffentlichen<br />
Raum und die Analyse und Theorie der digitalen Spiele sind<br />
weitere interessante Themen, die auf <strong>Sonneberg</strong>er Kongressen<br />
problematisiert werden könnten.<br />
Die Entwicklung bzw. Erneuerung des Spielzeugstadt – Image<br />
kann darüber hinaus auch über so triviale Maßnahmen wie<br />
der Verbesserung des Angebots und der Verkaufskultur<br />
von Spielzeuggeschäften beeinflusst werden. Ansätze zur<br />
Interaktivität gibt es bereits, z. B. die Manufaktur für Wunsch-<br />
Bären (Bären – Martin). Schauwerkstätten, ein Kinder-Stadtplan,<br />
d. h. ein Stadtplan für Kinder bzw. von Kindern, und ein neues<br />
Spielzeug– Kauf– und- Spielhaus würden die Angebote<br />
komplettieren.<br />
Erhaltung der Stadtstruktur<br />
Die Wahrung des Denkmal geschützten Stadtgrundrisses und<br />
die Berücksichtigung des historischen Kontextes sind ebenso<br />
selbstverständliche Bestandteile der Leitbildentwicklung wie<br />
die Erhaltung und Sanierung der geschützten Bausubstanz. In<br />
diesem Zusammenhang muss auch die Einordnung zeitgemäßer<br />
Architektur und die Umnutzung Stadtbild prägender<br />
Bestandsgebäude diskutiert werden. Architektenwettbewerbe<br />
sind in diesen Fällen hilfreich, weil sie mit geringem Aufwand für<br />
die Auslober eine Vielzahl von möglichen Lösungsansätzen als<br />
Diskursgrundlage liefern.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
... einige Maßnahmen erforderlich, die über die<br />
dringend erforderliche Sanierung und<br />
Aufwertung des Deutschen Spielzeugmuseum<br />
hinausgehen...<br />
... modernes ausstellungstechnisch–<br />
gestalterisches, aber auch<br />
museumspädagogisch– didaktisches<br />
Museumskonzept...<br />
...die Einordnung zeitgemäßer Architektur und die<br />
Umnutzung Stadtbild prägender<br />
Bestandsgebäude diskutiert werden...<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
77
78<br />
Attraktiver Standort - Wohnen<br />
<strong>Sonneberg</strong> sollte als Wohnstandort nicht vernachlässigt<br />
werden. Positiven Aspekten wie Lagegunst (Verkehrsanschlüsse,<br />
Zentralität), attraktiver Landschaftsraum und reiche<br />
Kulturtraditionen stehen die beschriebenen und durch<br />
wirtschaftliche und demografische Entwicklungen verursachten<br />
negativen Erscheinungen gegenüber.<br />
Revitalisierung von Baulücken und Brachen, Umnutzung<br />
und Sanierung im Bestand, die mit staatlicher Hilfe<br />
(Förderung) initiierte Entwicklung differenzierter Wohn- und<br />
Eigentumsformen sind Bestandteile des Entwicklungskonzepts,<br />
das aber auch die Erhaltung der Stadtstruktur, die Wahrung des<br />
denkmalgeschützten Stadtgrundrisses, den historischen Kontext<br />
bei Neubauten (Kubatur, Material usw.) berücksichtigen muss.<br />
Zeitgemäße Architektur sollte keinesfalls ausgeschlossen werden<br />
(dabei sollte die Wirkung moderner Bauten, ihr Einfluss<br />
auf den Städtetourismus nicht vernachlässigt werden.<br />
Qualitätssicherung durch Wettbewerbe, Umnutzung Stadtbild<br />
prägender Bestandsgebäude, die Erhaltung und Sanierung<br />
der Denkmalsubstanz sowie die konsequente Weiterführung<br />
des Baulückenkatasters sind weitere Komponenten des<br />
mittelfristigen Konzepts.<br />
Für eine weitere Belebung der Innenstadt kommen aus der<br />
Perspektive der Wohnungswirtschaft folgenden Maßnahmen in<br />
betracht:<br />
Bereitstellung eines attraktiven und vielfältigen Angebots mit<br />
differenzierten Wohnformen, variablen und familiefreundlichen<br />
Grundrissen und einem gut nutzbaren, gestalteten Wohnumfeld.<br />
Gebäude, die weder unter Denkmalschutz stehen, noch aus<br />
stadtplanerischen Gründen irgendwie relevant sind und deren<br />
Bauzustand bereits bedenklich sind sollten entfernt werden.<br />
Andererseits sollten Baulücken, die ungewohnte oder nicht<br />
erwünschte Blickachsen eröffneten, geschlossen werden.<br />
Die Realisierung dieser Maßnahmen stellt aber auf jedem Fall<br />
eine organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung<br />
dar. (Es muss darauf verwiesen werden, dass gegenwärtig kein<br />
Bauträger bereit ist, dieses Risiko ohne Förderung einzugehen.)<br />
Die Sanierung der Gebäude darf sich auch nicht auf die (Straßen-)<br />
Fassaden und die Ladenzonen beschränken, weil dort die<br />
höchsten Mieten zu erzielen sind, sondern muss das Gebäude<br />
vollständig einschließen.<br />
... Verbesserung des Wohnstandortes sollte von der<br />
qualitativen und quantitativen Aufwertung des<br />
Kultur- und Bildungsangebots begleitet sein...<br />
... Tor zum Thüringer Wald ist die Stadt<br />
auch Ausgangspunkt für diverse Outdoor<br />
Freizeitaktivitäten...<br />
... die Aufwertung des zentralen Bereichs mit der<br />
Konzentration von Einrichtungen, der Zonierung<br />
und Funktionsmischung, die Stärkung der Mitte,<br />
der Schaffung von Aufenthaltsqualität....
Freizeit, Kultur und Bildung<br />
Die Verbesserung des Wohnstandortes sollte von der qualitativen<br />
und quantitativen Aufwertung des Kultur- und Bildungsangebots<br />
begleitet sein, mit Nutzung von Potentialen, Verknüpfung von<br />
Angeboten, den erwähnten Bezüge zu Spielzeugstadt und<br />
Tourismus.<br />
Einwohnerschwund und zunehmende Überalterung haben<br />
Auswirkungen auf das <strong>Sonneberg</strong>er Schulwesen. Hier sollte<br />
versucht werden, einer Verödung des zentralen Bereiches<br />
entgegen zu wirken. (vgl. Pkt. 4.4.3)<br />
Viel zu wenig Aufmerksamkeit wird auf anspruchsvolle<br />
Gegenwartsarchitektur und ein adäquates Design in<br />
öffentlichen Innenräumen (Gastronomie, Schalter- und<br />
Empfangsräume, Verkaufsräume) verwandt, während im<br />
öffentlichen Außenraum Verbesserungen erkennbar sind<br />
(Beläge, Beleuchtung, Stadtmobiliar, Begrünung, öffentliche<br />
Kunst). Architektur ist im modernen Standortwettbewerb ein<br />
anerkanntermaßen bedeutungsvoller Wirtschaftsfaktor und die<br />
sorgfältige, kulturvolle Entwicklung moderner Bauten ist auch<br />
für die <strong>Sonneberg</strong>er Baudenkmale von Vorteil, die durch die<br />
Nachbarschaft schlechter Gebäude<br />
(d. h. hinsichtlich Gestaltung oder Bauzustand) entwertet<br />
werden.<br />
Im öffentlichen Raum wird außerdem die Problematik von<br />
Werbung und Firmierung zunehmend zum Problem, um nicht<br />
zu sagen zum Ärgernis („Passantenstopper“, Warenträger im<br />
öffentlichen Raum als Erweiterung der Verkaufsraumflächen).<br />
Hier müssen verschiedene Wege zur Verbesserung des<br />
Stadtbildes beschritten werden (s. a. Pkt.: 5.5).<br />
Auch die Aufwertung von Einzelhandel, Gastronomie und<br />
Hotellerie, Naherholung und Naturerlebnisse, Gesundheits-<br />
und Fitnessangebote und die Vernetzung mit der Region ist<br />
erforderlich.<br />
Als Tor zum Thüringer Wald ist die Stadt auch Ausgangspunkt<br />
für diverse Outdoor -Freizeitaktivitäten (Wandern, Mountain-<br />
Bike, Wintersport). Alle Maßnahmen in diesem Bereich dienen<br />
der Erhöhung der Attraktivität und damit auch wieder der<br />
Verbesserung des Wohnstandortes.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Dienstleistungs-, Versorgungs- und<br />
Verwaltungszentrum der Region<br />
Die zentralörtliche Bedeutung <strong>Sonneberg</strong>s erfordert ebenfalls<br />
die Aufwertung des zentralen Bereichs mit der Konzentration<br />
von Einrichtungen, der Zonierung und Funktionsmischung, die<br />
Stärkung der Mitte, der Schaffung von Aufenthaltsqualität.<br />
Ohne die Situation im Einzelnen darzustellen, kann gesagt<br />
werden, dass alle Bemühungen darauf abzielen sollten, die<br />
Attraktivität zu steigern und den Verlust an Verkaufsraumflächen<br />
zu stoppen bzw. zu minimieren.<br />
Eine Steuerungsmaßnahme kann in der Standortoptimierung<br />
zugunsten gesamtstädtischer Interessen für neue Geschäfte und<br />
großflächige Einrichtungen liegen.<br />
Die guten Verkehrsanbindungen können dabei vorteilhaft<br />
genutzt werden.<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
79
80<br />
7. Zusammenfassung<br />
Das Image „Spielzeugstadt“ sollte auch zukünftig der essentielle<br />
Bestandteil der Leitbildentwicklung bleiben.<br />
Auch wenn die Spielwarenherstellung heute nicht mehr<br />
gewerblich – industriell dominant ist, wird das doch durch die<br />
einmalige Entwicklungsgeschichte gerechtfertigt.<br />
Dieses Image, das als Fremd – Image<br />
(das Bild, das sich Ortsfremde oder Stadtbesucher machen)<br />
wesentlich stärker geprägt ist als das Eigen – Image<br />
(das Bild der Einwohner <strong>Sonneberg</strong>s von ihrer Stadt), sollte mit<br />
geeigneten Maßnahmen gestärkt werden.<br />
Dabei kommt es weniger darauf an, mit aufwendigen oder<br />
aufdringlichen Werbe – Effekten Aufmerksamkeit um jeden Preis<br />
zu erregen, als vielmehr die beschriebenen Ressourcen und<br />
Kapazitäten sinnvoll zu nutzen. (Die Installation der „Spielmeile“<br />
ist ein Schritt in die richtige Richtung.)<br />
Zur Verbesserung des Eigen – Image, und damit der<br />
Motivation und des Engagements der Bürgerschaft, ist<br />
die Qualitätsverbesserung <strong>Sonneberg</strong>s als Wohn – und<br />
Arbeitsstandort zwar vordringlich, aber auch die Kultur-, Freizeit-<br />
und Tourismus – Aspekte müssen stärker berücksichtigt und<br />
integriert werden.<br />
Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass aufgrund der<br />
relativen Langlebigkeit der Bausubstanz, architektonische<br />
– insbesondere aber städtebaulich– räumliche Fehler die<br />
angestrebte Qualität beeinträchtigen.<br />
... die Installation der „Spielmeile“ ist ein Schritt in<br />
die richtige Richtung...<br />
... die Kultur-, Freizeit- und Tourismus – Aspekte<br />
müssen stärker berücksichtigt und integriert<br />
werden...<br />
... städtebaulich– räumliche Fehler die angestrebte<br />
Qualität beeinträchtigen...
8. Handlungsempfehlungen<br />
Eine deutlich wahrnehmbare und nachhaltige Entwicklung<br />
erfordert entsprechende Maßnahmen, aber auch<br />
Organisationsstrukturen, die heute nicht oder nur rudimentär<br />
vorhanden sind.<br />
(Es muss aber andererseits in diesem Zusammenhang<br />
auch vor dem Versuch gewarnt werden, alle Probleme zu<br />
institutionalisieren, in der Hoffnung, durch Bildung von<br />
Arbeitsgruppen u. ä. anstehende Fragen allein administrativ zu<br />
klären.)<br />
Ein Problem besteht darin, dass möglichst konkrete und<br />
langfristige Vorschläge erforderlich, aber nur relativ allgemeine<br />
und allenfalls mittelfristige Vorschläge möglich sind, weil<br />
einerseits Entwicklung mit Auswirkungen auf alle Teilbereiche<br />
unmöglich eingeschätzt werden kann und andererseits auch<br />
Raum für Anpassungen bleiben muss.<br />
Es gibt Problem bezogene und Standort- (Raum-) bezogene<br />
Empfehlungen.<br />
Im Einzelnen können Problem bezogene Maßnahmen wie folgt<br />
gegliedert werden:<br />
1. Baulich- räumliche:<br />
Sanierung, Modernisierung maroder Gebäude; Teilrückbau oder<br />
Abriss von Gebäuden; Lückenschließungen bzw. Gestaltung<br />
entstehender Lücken (auch als Übergangslösungen) – mit<br />
dem Ziel der verbesserten Wohnqualität und Entwicklung<br />
bedarfsgerechter Angebote.<br />
2. Freiraumlösungen:<br />
Wohnumfeldverbesserungen mit mehr Grün in beräumten<br />
Quartierinnenbereichen, mehr Spielmöglichkeiten für Kinder<br />
und gemeinschaftliche Nutzungsangebote für Familien im<br />
wohnungsnahen Freiraum; <strong>Sonneberg</strong>- angemessene öffentliche<br />
Freiräume; Nutzbarmachung bzw. Erlebbarmachung der<br />
Gartendenkmale, Entwicklung von Grün- und Erholungsachsen<br />
(Röthen- Renaturierung, Sportzentrum u. a.).<br />
3. Funktionelle Maßnahmen:<br />
Verteilung, Vernetzung, Kapazitätsentwicklung und qualitative<br />
Verbesserung gewerblicher, gastronomischer, kultureller und<br />
anderer öffentlicher Einrichtungen.<br />
4. Gestaltung:<br />
Systematische Erfassung von Mängeln (mit Beschreibungen und<br />
Begründungen); Mängelbeseitigung und Aufwertung positiver<br />
Elemente; angepasste oder kontrastierende Ergänzungen zum<br />
Bestand; Erfassen typischer und / oder besonderer Elemente;<br />
Erarbeitung von Fassaden-, Farb- und Lichtgestaltungsleitplänen<br />
(,die nicht nur die beleuchtungstechnische, sondern auch<br />
Design- Komponenten enthalten).<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
81
82<br />
5. Organisatorisch- administrative Maßnahmen und Regelungen:<br />
Dabei sollten in besonderem Maße die beschriebenen Synergie-<br />
Effekte, auch und besonders im Wirtschaftsraum Coburg –<br />
<strong>Sonneberg</strong> – Kronach, genutzt werden.<br />
Die Maßnahmen zielen darauf ab, Anreize und Raumangebote<br />
für diverse Aktivitäten (Kunst, Musik, Handwerk, Unterhaltung,<br />
Jugend, Senioren . . .) zu schaffen – aber auch auf die<br />
Koordinierung von Fördermaßnahmen (Land, Bund, EU),<br />
Sponsoring, Kostenentwicklung städtischer Einrichtungen usw.<br />
Neben diesen allgemeinen politischen Steuerungsansätzen,<br />
die auch Mobilität, und Besteuerung, Immobilienmarkt<br />
und Infrastruktur zum Thema hat, gibt es spezielle Themen<br />
auf institutioneller Ebene wie Fusionen, Kooperation, neue<br />
Verwaltungsebenen, Gemeindeverbände . . .<br />
... Anreize und Raumangebote für diverse<br />
Aktivitäten (Kunst, Musik, Handwerk,<br />
Unterhaltung, Jugend, Senioren . . .) zu schaffen....<br />
6. Infrastrukturell:<br />
Infrastrukturmaßnahmen haben in der Regel relativ wenig<br />
Einfluss auf die Stadtgestaltung, um so mehr auf die Effizienz<br />
städtischer und privater Einrichtungen und damit auch auf die<br />
Attraktivität der Stadt in der Städtekonkurrenz<br />
(hier sie nur beispielsweise auf Wasser- und Energiepreise<br />
verwiesen).<br />
Sie sollten deshalb auch Energieökonomie und<br />
Umweltverträglichkeit in besonderem Maße berücksichtigen.<br />
Im sozialen Bereich verdienen die allgemein bildenden Schulen<br />
(und ihre Träger) besonderes Interesse.<br />
Aber auch weiter führende Schulen sind sehr wichtig, weil hier<br />
möglicherweise die Chance besteht, leer stehende Gebäude<br />
zukünftig zu nutzen.<br />
...im sozialen Bereich verdienen die allgemein<br />
bildenden Schulen (und ihre Träger) besonderes<br />
Interesse....<br />
7. Informell – Medien:<br />
Der Komplex umfasst Stadtinformation (aller Art, also auch über<br />
Behörden, Öffnungszeiten, Veranstaltungen usw.), die Entwicklung<br />
eines öffentlichen Informations- und Orientierungssystems.<br />
Natürlich sind Elemente eines derartigen Systems seit Jahren<br />
im Gebrauch und haben sich bewährt, es sollte jedoch mit Hilfe<br />
professioneller Agenturen technisch und gestalterisch auf den<br />
neuesten Stand gebracht werden.<br />
(Eine verhältnismäßig kleine und nebensächlich erscheinende<br />
Aufgabe besteht zum Beispiel darin, Straßennamen und<br />
Hausnummern deutlich sichtbar und aktuell anzubringen!)<br />
Auch Stadt- TV und Internetauftritte der Stadt und ihrer Partner<br />
müssen medial koordiniert, betreut und gepflegt werden.<br />
Standort bezogene Maßnahmen mit Priorität sind nach<br />
derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand folgende:<br />
... Straßennamen und Hausnummern deutlich<br />
sichtbar und aktuell anzubringen!....
Gesamtstädtische Bedeutung:<br />
_Neuorientierung, Umbau / Sanierung Spielzeugmuseum,<br />
_weitere Belebung und Komplettierung des Piko-Platzes<br />
sowie angrenzender Stadträume als Mittelpunkt und<br />
zentraler Anziehungspunkt der Stadt,<br />
_Aufwertung Sportzentrum,<br />
_Stadtreparatur im Bereich Woolworth-Grundstück,<br />
_multifunktionale Gestaltung des Schießhausplatzes<br />
(Festwiese, Caravan-Platz),<br />
_neue Nutzungen für wichtige historische Gebäude<br />
(z.B. Kresge-Haus, Altes Gymnasium),<br />
_Aufbau einer Grün- und Wegeverbindung entlang der<br />
Röthen (Renaturierung).<br />
Quartier bezogene Bedeutung:<br />
_Aufwertung Cuno-Hoffmeister-Straße,<br />
_Entwicklungsbereiche Schleicherstraße, Herrnaustraße<br />
(Wohnungsbau bei Bedarf),<br />
_Straßenraumgestaltungen<br />
(z.B. Beethovenstraße, Bernhardstraße),<br />
_Lückenbebauungen Mozartstraße, Bahnhofstraße,<br />
_Umnutzung Salzmann-Gelände.<br />
Der Maßnahmekatalog und die Prioritäten sind entsprechend<br />
der sich ändernden Rahmenbedingungen und konkreten<br />
Fördermöglichkeiten fortzuschreiben und ggf. anzupassen.<br />
Die konkreten Planungen für alle Maßnahmen müssen<br />
die jeweiligen städtebaulichen Rahmenbedingungen<br />
umfassend berücksichtigen. Aufgrund der Heterogenität des<br />
Gesamtgebiets und der Vielschichtigkeit der Maßnahmen<br />
(Umbau und Sanierung im Bestand, Lückenbebauung,<br />
Quartiersentwicklungen) kann es keine Regeln geben, die überall<br />
gleichermaßen gelten.<br />
Bei der Diskussion und Bewertung der baulichen Vorhaben<br />
hinsichtlich der städtebaulichen Einfügung sind vor allem<br />
Aspekte wie Einhaltung der Bauflucht, angemessene Kubaturen,<br />
Nutzungen und Geschossigkeit sowie die Bauweise im Kontext<br />
zu beachten. Auf der Ebene der Architektur sind Materialität,<br />
Gestaltung der Fassaden (Öffnungsformate, Verhältnis offene /<br />
geschlossene Flächen), Detailausbildungen aber auch Dachform<br />
oder Einfriedung (Abgrenzung zum öffentlichen Raum) von<br />
großer Bedeutung.<br />
Nur wenn diese Aspekte in Zukunft im Zusammenhang besser<br />
Berücksichtigung finden, ist eine verträgliche und angemessene<br />
Entwicklung innerhalb der Denkmalensemble und darüber<br />
hinaus zu gewährleisten.<br />
Die Struktur des Untersuchungsgebietes ist, insbesondere im<br />
zentralen Bereich, geprägt durch die Nutzungsvielfalt, die es<br />
in angemessener Weise, d. h. auf die moderne Lebens – und<br />
Produktionsweise angepasst, zu erhalten gilt. Problematisch wird<br />
das wie der aktuelle Leerstand zeigt in den Ressorts Einzelhandel,<br />
gewerbliche Dienstleistungen und Gastronomie.<br />
Es muss verhindert werden, dass die Versorgungsqualität unter<br />
das Niveau einer funktionierenden Mittelstadt<br />
(mit ihrer Bedeutung für den Landkreis und die Region) sinkt.<br />
Das erfordert Abstimmungen, Abwägungen und Regelungen mit<br />
den funktionalen und Standortentwicklungen an der Peripherie<br />
von Innen- und Gesamtstadt.<br />
Für die Entwicklung des Wohnungsbaus dürften die<br />
demografischen Veränderungen (Bevölkerungsabnahme,<br />
Überalterung) von Bedeutung sein, aber auch die sich daraus<br />
ergebenden, veränderten Ansprüche an die Wohnungsqualität.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
83
84<br />
Die Bausubstanz der <strong>Sonneberg</strong>er Innenstadt ist – auch im<br />
Bereich des Flächendenkmals – keineswegs gestalterisch<br />
homogen und spiegelt somit nicht nur die Pluralität<br />
der damaligen Baukultur, sondern auch die genannte<br />
Nutzungsmischung wider. Sie variiert in den Kubaturen und<br />
Dachformen, den Proportionen, Materialien, Fassadenfarben<br />
. . . Neben authentischen historischen Elementen finden sich<br />
historisierende aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende.<br />
Seit der Wende gibt es außerdem eine Vielzahl von Neubauten,<br />
die als mehr oder weniger geglückte Adaptionen historischer<br />
Vorbilder, die Gestaltungsvielfalt noch einmal beträchtlich<br />
vermehren. Für den Außenstehenden ist kaum nachvollziehbar,<br />
was tatsächlich noch in der Gründerzeit der Unteren Stadt<br />
entstand und was nicht.<br />
Aus dieser Sicht ist es sehr schwer allgemein gültige Aussagen<br />
zur gestalterischen Entwicklung zu formulieren.<br />
Andererseits ist es dringend erforderlich, wie die jüngsten<br />
baulichen Entwicklungen (z. B. Pikoplatz) zeigen.<br />
Eine rigorose, ausschließlich auf den Denkmalschutz bezogene<br />
Haltung ist in diesem Fall ebenso unangebracht, wie die Toleranz.<br />
Es ist vielmehr erforderlich eine Gestaltsatzung neuen Typus<br />
für <strong>Sonneberg</strong> zu entwickeln, die Investoren und Hausbesitzern<br />
größere Handlungsfreiräume einräumt ohne das Ortsbild - wie<br />
in den letzten beiden Dezennien leider oft geschehen – noch<br />
stärker zu beeinträchtigen.<br />
Dafür müssen Prioritäten und Geltungsbereiche festgelegt<br />
werden; d. h. allgemein gültige, auf das ganze Stadtgebiet<br />
bezogene Empfehlungen, Hinweise, Vorschläge und Regeln<br />
werden durch Standort und Problem bezogene ersetzt.<br />
Besondere Aufmerksamkeit ist in diesem Zusammenhang auf die<br />
Schwerpunktbereiche der Entwicklung fokussiert, die mit den<br />
funktionellen Schwerpunkten („primären“ Elemente“ nach Rossi<br />
(16) oder auch „Aktivitätsknoten“ nach Alexander(17) nahezu<br />
identisch sind.<br />
375 m<br />
<strong>45</strong>0 m<br />
400 m<br />
425 m<br />
400 m<br />
400 m<br />
höchste Priorität<br />
Umgebung von Einzeldenkmalen<br />
wichtig<br />
niedrige Priorität<br />
geringe Regelungsdichte<br />
375 m<br />
425 m<br />
<strong>45</strong>0 m<br />
375 m<br />
50<br />
500 m<br />
<strong>45</strong>0 m<br />
100 500 m<br />
475 m<br />
425 m<br />
400 m<br />
<strong>45</strong>0 m<br />
425 m<br />
475 m<br />
400 m<br />
425 m<br />
525 m<br />
<strong>45</strong>0 m<br />
550 m<br />
500 m<br />
525 m<br />
550 m<br />
550 m<br />
600 m<br />
575 m<br />
600 m<br />
575 m<br />
525 m<br />
475 m
9. Anmerkungen und Quellen<br />
1 Studie Baulücken und Brachen in der Spielzeugstadt<br />
<strong>Sonneberg</strong> – dargestellt am Sanierungsgebiet Obere<br />
Stadt; PAD Weimar im Auftrag der Stadtverwaltung<br />
<strong>Sonneberg</strong>; Juni 2006<br />
2 „Wenig Bürger im Ehrenamt aktiv“ – Martina Hunka;<br />
<strong>Sonneberg</strong>er Tagespresse vom . . .<br />
3 Studie Baulücken . . . a. a. O.<br />
4 Studie Baulücken . . . a a. O.<br />
5 Großstädte von morgen – Internationale Strategien des<br />
Stadtumbaus; Harald Bodenschatz<br />
6 Bertelsmann Stiftung: Kommunale Daten,<br />
Demografiebericht<br />
7 Zwei Anmerkungen zum Denkmalschutz:<br />
Die Bebauung des so genannten Piko - Platzes,<br />
insbesondere die Stellung des nördlichen Neubaus stellt<br />
eine deutliche Zäsur im historischen, städtebaulichen<br />
Kontext dar (siehe auch a. a. O. : „Stadtbild prägende<br />
Gebäude und Raumsituationen“)<br />
- und zweitens, ausgewiesene Gartendenkmale sollten<br />
ihrer Bedeutung gemäß öffentlich erlebbar sein (Einblicke<br />
oder Öffnung, eventuell auch temporäre Zugänglichkeit).<br />
8 Touristenführer für die Spielzeugstadt <strong>Sonneberg</strong><br />
(Internet): nur Hotels und Gasthöfe im Stadtgebebiet,<br />
ohne Gästehäuser, Pensionen und Ferienwohnungen<br />
9 Monitoring<br />
10 Expertengespräche: Wohnungsbau GmbH und Otte<br />
Immobilien (Juli 2008 und Januar 2009)<br />
11 GMA Ludwigsburg:<br />
Einzelhandelskonzept für die Stadt <strong>Sonneberg</strong>. 2008<br />
12 „Mit kühnem Jazz gegen das Provinz – Image“; Schlagzeile<br />
im „Hamburger Abendblatt“ vom 17. 2. 2009<br />
<strong>13</strong> Irene Wiese von Ofen, Die Zukunft unserer Städte, Rede<br />
auf dem Abschlusskongress „Stadtidentität und<br />
Stadtimage“ in Hagen 7.- 9.3. 2007<br />
14 Apostrophiert: Zitate aus: Bedeutung des öffentlichen<br />
Raums für Stadtidentität und Stadtimage, Robert Sander,<br />
Deutsches Institut für Urbanistik<br />
15 Städtebauliche Leitbilder in der Kontroverse, Prof. Dr.<br />
Franz Pesch Universität Stuttgart, Vortrag in Stuttgart Juli<br />
2002<br />
16 Die Architektur der Stadt. Skizze zu einer grundlegenden<br />
Theorie des Urbanen, Aldo Rossi, Bertelsmann 1973<br />
17 A Pattern Language, Christopher Alexander, Oxford<br />
University Press 1977<br />
18 Tabelle „Leerstand“ (nächste Seite):<br />
Auf der Grundlage des Monitoring 2007 und Ergänzungen<br />
von 2008:<br />
Erfasst wurden 695 GE und 37<strong>13</strong> WE. Bei einer Gesamtzahl<br />
von 4408 Nutzungseinheiten bedeutet das bei 698<br />
ungenutzten Gewerbe- und Wohneinheiten einen<br />
Leerstand von insgesamt 16 %.<br />
Von 695 GE sind 175, also 25% ungenutzt. Bei den<br />
Wohnungen beträgt das Verhältnis 37<strong>13</strong> WE auf 523 und<br />
damit einen Anteil von 14 %.<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
Ω<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
85
86<br />
davon davon leere davon leere davon<br />
Straße Anzahl GE davon leer saniert teils. unsan. Anzahl WE davon leer saniert teilsaniert unsaniert MFH saniert teils. uns. 1-2 FH saniert teilsan. uns.<br />
Am alten Bahnhof 5 0 18 0 0 0<br />
Am Schulgarten 0 0 15 7 6 1 5 5 2 1 1<br />
Am Stadtpark 1 1 1 5 4 4 3 3 1 1<br />
Bahnhofsplatz 18 2 2 9 3 3 3 3 0<br />
Bahnhofstraße 1<strong>13</strong> 18 <strong>13</strong> 4 1 256 54 29 18 7 52 28 17 6 2 1 1<br />
Beethovenstraße 19 4 1 3 128 9 9 9 9 0<br />
Bernhardstraße 44 16 9 6 1 356 29 5 8 16 34 5 8 21 0<br />
Bismarckstraße 34 6 5 1 3 0 0 0<br />
Braugasse 4 0 10 5 5 5 5 0<br />
Charlottenstraße 11 2 2 108 22 7 2 <strong>13</strong> 22 7 2 <strong>13</strong> 0<br />
Coburger Allee 22 5 5 157 18 3 5 10 18 3 5 10 0<br />
Coburger Straße 25 18 4 2 12 216 30 3 27 29 2 27 1 1<br />
Cuno- Hoffmeister- Straße 23 2 1 1 166 23 9 4 10 22 8 4 10 1 1<br />
Ernst-Moritz-Arndt- Straße 4 0 1 0 0 0<br />
Ernststraße 5 1 1 21 1 1 1 1<br />
Gustav- König-Straße 88 32 28 4 <strong>13</strong>0 16 8 8 <strong>13</strong> 7 6 3 1 2<br />
Juttastraße 29 1 1 162 26 <strong>13</strong> <strong>13</strong> 25 12 <strong>13</strong> 1 1<br />
Karlstraße 18 11 9 1 1 119 24 1 7 16 24 1 7 16 0<br />
Köppelsdorfer Straße 79 27 <strong>13</strong> 12 2 319 74 66 11 24 31 8 2 2 4<br />
Lohaustraße 1 0 2 0 0 0<br />
Marienstraße 9 5 1 3 1 109 14 1 6 7 14 1 6 7 0<br />
Mozartstraße 4 2 2 11 6 3 3 3 3 3 3<br />
Oberlinder Straße 8 4 4 40 8 8 8 8 0<br />
Quieraustraße 1 0 92 4 2 2 4 2 2 0<br />
Rathenaustraße 32 2 2 197 24 5 19 23 4 19 1 1<br />
Robert-Hartwig- Straße 2 0 0 0 0 0<br />
Rosengasse 1 0 25 1 1 1 1 0<br />
Schanzstraße 9 3 1 1 1 58 8 3 2 3 6 3 2 1 2 2<br />
Schießhausstraße 9 1 1 170 20 8 4 8 20 8 4 8 0<br />
Schleicherstraße 3 1 1 125 19 10 9 19 10 9 0<br />
Schöne Aussicht <strong>13</strong> 0 <strong>13</strong>3 11 5 3 3 11 5 3 3 0<br />
Alte Molkerei 0 0 <strong>13</strong> 0 0 0<br />
Am Forstgraben 1 0 16 1 1 0 1 1<br />
Bettelhecker Straße 23 3 3 233 30 23 7 8 1 7 0<br />
Bismarckstraße 3 0 64 0 0 0<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 7 0 66 25 3 22 25 2 22 0<br />
Gleisdammstraße 19 6 6 100 6 6 6 6 0<br />
Schallerauweg 2 0 15 0 0 0<br />
Weißer Rangen 3 1 1 4 0 0<br />
Wiesenstraße 3 1 1 41 1 1 1 1 0<br />
Summe 695 175 101 <strong>45</strong> 29 37<strong>13</strong> 523 147 <strong>13</strong>7 165 480 <strong>13</strong>0 156 192 19 7 6 <strong>13</strong>
Impressum:<br />
Büro<br />
PAD - Baum Freytag Leesch<br />
Architekten & Stadtplaner BDA<br />
Graben 1<br />
99423 Weimar<br />
Dipl. Ing. Olaf Baum<br />
Dipl. Ing. Thomas Freytag<br />
Dr. Ing. Matthias Leesch<br />
MA:<br />
Dipl. Ing: Manuela Seibt<br />
Dipl. Ing. Dominique Reichhardt<br />
Technische Mitarbeit:<br />
Martin Demski<br />
Büro<br />
Dipl. Ing. Gabriele Langlotz<br />
Architektur und Städtebau<br />
Architektin BDA<br />
An der Falkenburg 9a<br />
99425 Weimar<br />
Layout & Design<br />
PAD<br />
SPIELZEUGSTADT_<br />
SONNEBERG<br />
K O N Z E P T _ I N N E N S T A D T<br />
87