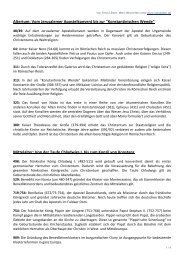Exegese von Mk 16,1-8 (Susanne Schneider - vaticarsten.de
Exegese von Mk 16,1-8 (Susanne Schneider - vaticarsten.de
Exegese von Mk 16,1-8 (Susanne Schneider - vaticarsten.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Johannes Gutenberg – Universität Mainz<br />
Fachbereich 01 – Kath. Theologie<br />
WS 02/03<br />
Proseminar: Einführung in die exegetischen Metho<strong>de</strong>n<br />
Seminarleitung: Christina Metzdorf<br />
1<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Exegetische Übungen<br />
<strong>Mk</strong> <strong>16</strong>, 1-8<br />
Vorgelegt <strong>von</strong>:<br />
<strong>Susanne</strong> <strong>Schnei<strong>de</strong>r</strong><br />
Frie<strong>de</strong>nstr.: 21<br />
65599 Dornburg<br />
Tel.-Nr.: 06436-911550<br />
12. / 7. Semester, Deutsch / kath. Theologie, LA Gym.<br />
Vorgelegt am:<br />
17.6.2003
I. Inhaltsverzeichnis<br />
2<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
I. Inhaltsverzeichnis................................................................................................. 2<br />
II. Einleitung........................................................................................................... 3<br />
III. Aufgabenstellung............................................................................................... 3<br />
1. Textkritik ............................................................................................................ 4<br />
1.1 Textkritik zu Mt 28, 2 nach ?????.......................................................................... 5<br />
1.1.1 Der Text im Nestle-Aland (NA) ........................................................................... 5<br />
1.1.2 Variante a) ....................................................................................................... 5<br />
1.1.3 Variante b)....................................................................................................... 6<br />
1.1.4 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten .................................................................................... 7<br />
1.2 Textkritik zu Mt 28, 6........................................................................................... 7<br />
1.2.1 Der Text im Nestle-Aland (NA) ........................................................................... 8<br />
1.2.2 Variante a) ....................................................................................................... 8<br />
1.2.3 Variante b)....................................................................................................... 9<br />
1.2.4 Variante c) ....................................................................................................... 9<br />
1.2.5 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten .................................................................................... 9<br />
1.3 Textkritik zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,7......................................................................................... 10<br />
1.3.1 Der Text im Nestle-Aland (NA) ......................................................................... 10<br />
1.3.2 Variante a) ..................................................................................................... 11<br />
1.3.3 Variante b)..................................................................................................... 11<br />
1.3.4 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten .................................................................................. 12<br />
2. Übersetzungskritik zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8......................................................................... 12<br />
2.1 Einführung........................................................................................................ 12<br />
2.2 Allgemeine Beobachtungen ................................................................................. 13<br />
2.3 Übersetzungskritik zu <strong>de</strong>n einzelnen Versen ........................................................... 13<br />
2.4 Vor- und Nachteile <strong>de</strong>r einzelnen Übersetzungen .................................................... 21<br />
2.4.1 Die Einheitsübersetzung ................................................................................... 21<br />
2.4.2 Das Münchener Neue Testament........................................................................ 22<br />
3. Synoptischer Vergleich <strong>von</strong> <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 mit Mt 28,1-10........................................... 22<br />
3.1 Gegenüberstellung <strong>de</strong>r Texte................................................................................ 23<br />
3.2 Übereinstimmungen zwischen <strong>Mk</strong> und Mt ............................................................. 24<br />
3.3 Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>Mk</strong> und Mt ....................................................................... 26<br />
3.4 Grün<strong>de</strong> für die Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>Mk</strong> und MT ................................................. 28<br />
4. Zwei Kommentare zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8.......................................................................... 29<br />
4.1 Der Kommentar <strong>von</strong> D. Gustav Wohlenberg........................................................... 29<br />
4.2 Der Kommentar <strong>von</strong> Walter Schmithals ................................................................. 30<br />
4.3 Vergleich <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Kommentare........................................................................ 32<br />
5. Literaturverzeichnis........................................................................................... 33
II. Einleitung<br />
3<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit beschäftigt sich mit einigen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen <strong>Exegese</strong> (genaue<br />
Aufgabenstellung s. Kapitel III). Die behan<strong>de</strong>lten Texte können jedoch nicht ausschöpfend<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n, allerdings wird ein Einblick in die verschie<strong>de</strong>nen Metho<strong>de</strong>n erhalten.<br />
III. Aufgabenstellung<br />
1) Textkritik zu Mt 28, 2 nach ?????; Mt 28, 6; <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,7<br />
Lösen Sie für diese Stellen sämtliche Siglen und Abkürzungen <strong>de</strong>s Apparates <strong>von</strong> Nestle -<br />
Aland 27 auf, nennen Sie knapp Name, Art (Papyrus etc.), Rang und Alter <strong>de</strong>s Textzeugen.<br />
Legen Sie <strong>de</strong>n textkritischen Sachverhalt dar. Was be<strong>de</strong>utet die jeweilige Variante, welchen<br />
Sinn wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Text durch sie erhalten?<br />
2) Übersetzungskritik zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8<br />
Vergleichen Sie die Einheitsübersetzung <strong>von</strong> <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 genau mit <strong>de</strong>m griechischen Text.<br />
Das gleiche tun Sie bitte mit einer weiteren Übersetzung Ihrer Wahl. achten Sie beson<strong>de</strong>rs<br />
darauf, wie genau o<strong>de</strong>r ungenau mit <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>von</strong> Worten und <strong>de</strong>r Syntax umgegangen<br />
wird. Entsprechen die Übersetzungen <strong>de</strong>r Gedankenfolge und <strong>de</strong>r sprachlichen Qualität <strong>de</strong>r<br />
Vorlage? Teilen Sie Ihre Beobachtungen mit, und beurteilen Sie die Stärken und Schwächen<br />
<strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Übersetzungen.<br />
3) Synoptischer Vergleich<br />
Vergleichen Sie die Perikope bei <strong>Mk</strong> mit <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Perikope bei Mt. Analysieren<br />
Sie die Übereinstimmungen und Unterschie<strong>de</strong>; versuchen Sie diese zu <strong>de</strong>uten bzw. zu<br />
erklären.<br />
4) Vergleich zweier Kommentare zu <strong>Mk</strong>,1-8<br />
Lesen Sie zwei Kommentare Ihrer Wahl zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8. Fassen Sie die Kommentare nach<br />
Aufbau, Struktur und Inhalt zusammen:<br />
Welche Metho<strong>de</strong>n, die Sie aus <strong>de</strong>m Proseminar kennen, kommen zur Anwendung und wie<br />
wer<strong>de</strong>n sie vom Autor <strong>de</strong>r Kommentare jeweils eingesetzt? Wie interpretiert <strong>de</strong>r Autor die<br />
Perikope vom leeren Grab? Lässt sich eine theologische Deutung erkennen o<strong>de</strong>r bleibt <strong>de</strong>r<br />
Kommentar auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r historischen Analyse stehen?<br />
Vergleichen Sie die Kommentare unter diesen Gesichtspunkten miteinan<strong>de</strong>r und versuchen<br />
Sie eine vorsichtige Bewertung <strong>de</strong>r Kommentare!
1. Textkritik<br />
4<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Für die nachfolgen<strong>de</strong> Textkritik verwen<strong>de</strong> ich <strong>de</strong>n griechischen Text aus:<br />
Nestle-Aland: Das Neue Testament. Griechisch und Deutsch.<br />
Griechischer Text: 27. Auflage <strong>de</strong>s Novum Testamentum Graece in <strong>de</strong>r Nachfolge <strong>von</strong><br />
Eberhard und Erwin Nestle gemeinsam verantwortet <strong>von</strong> Barbara und Kurt Aland, Johannes<br />
Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger.<br />
Deutsche Texte: Revidierte Fassung <strong>de</strong>r Lutherbibel <strong>von</strong> 1984 und Einheitsübersetzung <strong>de</strong>r<br />
Heiligen Schrift 1979.<br />
Hrsg. im Institut für Neutestamentliche Textforsc hung Münster / Westfalen <strong>von</strong> B. Aland und<br />
K. Aland, 3. Auflage, 2000. 1<br />
Bei <strong>de</strong>n zur Textkritik heranzuziehen<strong>de</strong>n Textzeugen muss man beachten, dass die<br />
verschie<strong>de</strong>nen Textzeugen <strong>von</strong> unterschiedlich hoher Be<strong>de</strong>utung sind. Man unterschei<strong>de</strong>t die<br />
grch. Handschriften in ständige, häufig zitierte und gelegentlich zitierte Zeugen. Die für die<br />
Textkritik wichtigen ständigen Zeugen unterteilt man nach ihrer Qualität und Be<strong>de</strong>utung in<br />
ständige Zeugen erster und zweiter Ordnung. 2 Folgerichtig ist eine Textvariante dann als die<br />
ursprünglichste anzusehen, wenn sie durch möglichst viele und möglichst gewichtige<br />
Textzeugen (d.h. ständige Zeugen erster Ordnung) bezeugt wird. 3<br />
Die positive Textbezeugung <strong>de</strong>s vom NA gewählten Textes wird durch das Kürzel txt<br />
gekennzeichnet. Der NA verwen<strong>de</strong>t zu<strong>de</strong>m das Massensiegel (=Mehrheitstext,<br />
einschließlich <strong>de</strong>s byzantinischen Koine-Textes), welches die Variante bezeichnet, die <strong>von</strong><br />
<strong>de</strong>r Mehrheit aller Handschriften bezeugt wird. 4<br />
1<br />
Wird im Folgen<strong>de</strong>n abgekürzt als: NA.<br />
2<br />
Vgl. NA, S.8f.<br />
3<br />
Häufig zitierte Zeugen gibt es für die Evangelien nicht.<br />
4<br />
bezeichnet die Lesart <strong>de</strong>s Koinetextes, zusätzlich <strong>de</strong>rjenigen ständigen Zeugen zweiter Ordnung, die an <strong>de</strong>r<br />
jeweiligen Stelle mit <strong>de</strong>r Koine lesen. wird an allen Apparatstellen wie ein ständiger Zeuge erster Ordnung<br />
behan<strong>de</strong>lt (vgl. NA, S. 14*).
1.1 Textkritik zu Mt 28, 2 nach ?????<br />
1.1.1 Der Text im Nestle-Aland (NA)<br />
Die im NA vom Herausgeber bevorzugte Textversion lautet:<br />
5<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
☯??e??? ?? ?????? ?ataß? ? ???a? ?a p??se?t??<br />
ape????se? t ?? ????? ?a? e????t? ep??? a?t??.<br />
Deutsche Übersetzung: Denn ein Engel <strong>de</strong>s Herrn stieg vom Himmel herab und trat heran<br />
und wälzte <strong>de</strong>n Stein weg und setzte sich auf ihn.<br />
Diese Textvariante wird positiv bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
Die Majuskeln Sinaiticus [ = ?] (01) (4. Jh.), Vaticanus [ = B] (03) (4. Jh.) sowie <strong>de</strong>r<br />
Co<strong>de</strong>x Bezae Cantabrigiensis [ = D] (04) (5. Jh.).<br />
b) ständige Zeugen zweiter Ordnung:<br />
Die Minuskeln 700 (11. Jh.), 892 (9. Jh.) sowie die Lektionare l 844 (9. Jh.) und l 2211<br />
(10. Jh.).<br />
c) weitere Textzeugen:<br />
Diese Lesart wird <strong>von</strong> wenigen weiteren Handschrif ten [ = pc] bezeugt, außer<strong>de</strong>m <strong>von</strong> <strong>de</strong>r<br />
Vulgata (4./5. Jh.) und einem Teil <strong>de</strong>r altlateinischen Überlieferung [ = lat] (seit <strong>de</strong>m 2.<br />
Jh.), <strong>von</strong> einer sahidischen Übersetzung [ = sa] (ab <strong>de</strong>m 3.Jh.) sowie einer syrischen<br />
Übersetzung im Syrus Sinaiticus 5 [ = sy s ] (ca. 3./4. Jh.).<br />
Zu dieser Version führt <strong>de</strong>r kritische Apparat <strong>de</strong>s NA zwei Textvarianten auf, die <strong>de</strong>n oben<br />
zitierten Text um einige Worte ergänzen.<br />
1.1.2 Variante a)<br />
☯??e??? ?? ?????? ?ataß? ? ???a? ?a p??se?t??<br />
ape????se? t ?? ????? ap? t?? ???a? ?a? e????t? ep??? a?t??.<br />
Deutsche Übersetzung: Denn ein Engel <strong>de</strong>s Herrn stieg vom Himmel herab und trat heran<br />
und wälzte <strong>de</strong>n Stein <strong>von</strong> <strong>de</strong>m Eingang weg und setzte sich auf ihn.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch:<br />
5 Der Syrus Sinaiticus ist eine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Handschriften <strong>de</strong>r Vetus Syra.
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
6<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die Majuskeln Alexandrinus [ = A] (02) (5. Jh.), Co<strong>de</strong>x Ephraemi rescriptus [ = C] (04)<br />
(5. Jh.), W (032) (4./5. Jh.)<br />
b) ständige Zeugen zweiter Ordnung:<br />
Die Majuskeln K (017) (9. Jh.) und ? (037) (9. Jh.); die Minuskeln 579 (13. Jh.) und 1424<br />
(9./10. Jh.).<br />
c) weitere Textzeugen:<br />
Die Lesart wird <strong>von</strong> sehr vielen weiteren Handschriften bezeugt [ = pm] 6 , außer<strong>de</strong>m die<br />
lateinischen Codices f (6. Jh.), h (5. Jh.) und q (6./7. Jh.) sowie eine syrische Übersetzung<br />
in <strong>de</strong>r Peschitta [ = sy p ] (ca. 4./5. Jh.).<br />
1.1.3 Variante b)<br />
☯??e??? ?? ?????? ?ataß? ? ???a? ?a p??se?t??<br />
ape????se? t ?? ????? ap? t?? ???a? t?? µ??µe??? ?a? e????t? ep???<br />
a?t??.<br />
Deutsche Übersetzung: Denn ein Engel <strong>de</strong>s Herrn stieg vom Himmel herab und trat heran<br />
und wälzte <strong>de</strong>n Stein <strong>von</strong> <strong>de</strong>m Eingang <strong>de</strong>s Grabes weg und setzte sich auf ihn.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
Die Majuskeln L (019) (8. Jh.) und T (038) (9. Jh.); die Minuskelfamilien f 1 (= 1, 118,<br />
131, 209, 1582 u.a.) und f 13 (= 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 828, 983, <strong>16</strong>89,<br />
1709 u.a.).<br />
b) ständige Zeugen zweiter Ordnung:<br />
Die Majuskelhandschrift G (036) (10. Jh.); die Minuskeln 565 (9. Jh.) und 1241 (12. Jh.)<br />
sowie das Lektionar l 844 c vid aus <strong>de</strong>m 9. Jh., bei <strong>de</strong>m es sich um eine nicht ganz sichere<br />
und zu<strong>de</strong>m korrigierte Lesart han<strong>de</strong>lt.<br />
c) weitere Textzeugen:<br />
Die Lesart wird <strong>von</strong> sehr vielen weiteren Handschriften bezeugt [ = pm] (vgl. Anm. 6),<br />
außer<strong>de</strong>m <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Minuskelhandschrift 33 (9. Jh.), einer syrischen Übersetzung <strong>von</strong><br />
Thomas <strong>von</strong> Harkel [ = sy h = Harklensis] aus <strong>de</strong>m Jahre 6<strong>16</strong>, einer mittelägyptischen [ =<br />
mae] sowie einer bohairischen [ = bo] Übersetzung (jeweils seit <strong>de</strong>m 3. Jh.). Diese<br />
6 Die Bezeichnung „pm“ taucht bei bei<strong>de</strong>n Varianten auf, da <strong>de</strong>r Mehrheitstext ( ) in zwei Varianten mit<br />
zahlenmäßig etwa gleich starker Bezeugung gespalten ist.
7<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Textvariante fin<strong>de</strong>t sich ebenfalls in <strong>de</strong>n Schriften <strong>de</strong>s Eusebius <strong>von</strong> Caesarea 7 [ = Eus],<br />
gestorben 339/40 n. Chr.<br />
1.1.4 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten<br />
Die bei<strong>de</strong>n Textvarianten a) und b) ergänzen <strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Text <strong>de</strong>s NA. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
dabei jeweils um Ortsangaben im weitesten Sinne, da sie die Tätigkeit <strong>de</strong>s Engels näher<br />
bestimmen. Sie sagen aus, <strong>von</strong> wo er <strong>de</strong>n Stein wegwälzt [b) noch genauer bestimmt als a)].<br />
Alle drei Varianten sind gut bezeugt: <strong>de</strong>r Text <strong>de</strong>s NA durch 3 ständige Zeugen erster sowie 4<br />
ständige Zeugen zweiter Ordnung, die Textvariante a) durch 3 ständige Zeugen erster sowie 4<br />
ständige Zeugen zweiter Ordnung und die Variante b) durch 4 ständige Zeugen erster 8 sowie<br />
4 ständige Zeugen zweiter Ordnung.<br />
Der Herausgeber hat die <strong>von</strong> ihm gewählte Lesart wahrscheinlich bevorzugt, weil sie durch<br />
<strong>de</strong>n Co<strong>de</strong>x Sinaiticus und <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong>x Vaticanus belegt sind. Diese Hands chriften sind <strong>von</strong><br />
beson<strong>de</strong>rs hoher Aussagekraft bei <strong>de</strong>r Rekonstruktion <strong>de</strong>s Ursprungstext. Da die bei<strong>de</strong>n in<br />
diesem Fall zusammentreffen, d.h. die gleiche Lesart bezeugen, kann man in ihr mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit <strong>de</strong>n Ursprungstext vermuten. Außer<strong>de</strong>m sind <strong>de</strong>r Sinaiticus und <strong>de</strong>r<br />
Vaticanus (jeweils 4. Jh.) im Schnitt ein Jahrhun<strong>de</strong>rt älter als die Zeugen <strong>de</strong>r Variante a); die<br />
Zeugen <strong>de</strong>r Variante b) sind sogar erheblich jünger. 9<br />
Die an<strong>de</strong>ren Grundregeln <strong>de</strong>r Philologie stützen ebenfalls die Textversion <strong>de</strong>s NA. Sie ist die<br />
kürzere Lesart und damit gemäß <strong>de</strong>m Grundsatz „lectio brevior potior“ meistens die<br />
ursprünglichere. Außer<strong>de</strong>m ist sie die schwierigere Lesart, die nach „lectio difficilior“<br />
vorzuziehen ist, da die Ergänzungen <strong>de</strong>r Varianten a) und b) <strong>de</strong>m besseren Ve rständnis<br />
dienen. Ohne diese Erläuterungen ist die Tätigkeit <strong>de</strong>s Engels schwerer nachzuvollziehen. Die<br />
Lesarten in a) und b) lassen sich aus <strong>de</strong>r Variante im NA somit als nachträglich beigefügte<br />
Erläuterungen zum besseren Verständnis erklären. So wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r Zeit zunächst „ap?<br />
t?? ???a?“ und dann noch <strong>de</strong>r Zusatz „t?? µ??µe???“ ergänzt. 10<br />
1.2 Textkritik zu Mt 28, 6<br />
7 Eusebius Caesariensis<br />
8 Die Minuskelfamilien f 1 und f 13 wer<strong>de</strong>n jeweils als ein Zeuge gezählt.<br />
9 Es gilt <strong>de</strong>r Grundsatz, dass ältere Lesarten jüngeren vorzuziehen sind, weil sie meist ursprünglicher sind.<br />
10 Dies passt auch genau mit <strong>de</strong> m Alter <strong>de</strong>r Textzeugen zusammen. Die Textzeugen mit <strong>de</strong>r längsten Ergänzung<br />
sind auch die jüngsten.
1.2.1 Der Text im Nestle-Aland (NA)<br />
Die im NA vom Herausgeber bevorzugte Textversion lautet:<br />
8<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
??? st?? <strong>de</strong>, ?????? ?a? ?a?? epe? <strong>de</strong>?te <strong>de</strong>te t ?? t?p?? ??<br />
?e?t?.<br />
Deutsche Übersetzung: Er ist nicht hier, <strong>de</strong>nn er ist auferweckt wor<strong>de</strong>n, wie er gesagt hat.<br />
Kommt her, seht die Stelle, wo er lag.<br />
Diese Textvariante wird positiv bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
Die Majuskeln Sinaiticus [ = ?] (01) (4. Jh.), Vaticanus [ = B] (03) (4. Jh.) und T (038) (9.<br />
Jh.).<br />
b) ständige Zeugen zweiter Ordnung:<br />
Die Minuskelhandschrift 892 (9. Jh.) und das Lektionar l 2211 (10. Jh.).<br />
c) weitere Zeugen:<br />
Es bezeugen noch wenige an<strong>de</strong>re Handschriften diese Leasart [ = pc], zu<strong>de</strong>m<br />
Minuskelhandschrift 33 (9. Jh.), <strong>de</strong>r lateinische Co<strong>de</strong>x e (5. Jh.), eine syrische<br />
Übersetzung im Syrus Sinaiticus [ = sy s ] (ca. 3./4. Jh.) sowie alle koptischen<br />
Übersetzungen [ = co] (seit <strong>de</strong>m 3. Jh. entstan<strong>de</strong>n).<br />
1.2.2 Variante a)<br />
??? st?? <strong>de</strong>, ?????? ?a? ?a?? epe? <strong>de</strong>?te <strong>de</strong>te t ?? t?p?? p??<br />
?e?t? ? ??????.<br />
Deutsche Übersetzung: Er ist nicht hier, <strong>de</strong>nn er ist auferweckt wor<strong>de</strong>n, wie er gesagt hat.<br />
Kommt her, seht die Stelle, wo <strong>de</strong>r Herr lag.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
Die Majuskeln Alexandrinus [ = A] (02) (5. Jh.), Co<strong>de</strong>x Ephraemi rescriptus [ = C] (04)<br />
(5. Jh.), Co<strong>de</strong>x Ephraemi rescriptus [ = D] (05) (5. Jh.), L (019) (8. Jh.), W (032) (4./5.<br />
Jh.) und 0148 (8. Jh.) sowie die Minuskelfamilien f 1 und f 13 . Die Variante a) gilt weiterhin<br />
als Mehrheitstext [= ].<br />
b) weitere Zeugen:
9<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die Vulgata (4./5. Jh.) und ein Teil altlateinischen Überlieferung (seit <strong>de</strong>m 2. Jh.) [ = lat];<br />
außer<strong>de</strong>m die syrische Übersetzung <strong>von</strong> Thomas <strong>von</strong> Harkel [ = Harkle nsis] aus <strong>de</strong>m<br />
Jahre 6<strong>16</strong> n. Chr. und die Peschitta (ca. 4./5. Jh.), die allerdings geringfügig abweicht [ =<br />
sy (p).h ].<br />
1.2.3 Variante b)<br />
??? st?? <strong>de</strong>, ?????? ?a? ?a?? epe? <strong>de</strong>?te <strong>de</strong>te t ?? t?p?? p??<br />
?e?t? t? s?µa t?? ??????.<br />
Deutsche Übersetzung: Er ist nicht hier, <strong>de</strong>nn er ist auferweckt wor<strong>de</strong>n, wie er gesagt hat.<br />
Kommt her, seht die Stelle, wo <strong>de</strong>r Leib <strong>de</strong>s Herrn lag.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen zweiter Ordnung:<br />
Die Minuskelhandschrift 1424 (9./10. Jh.).<br />
b) weitere Zeugen<br />
Des Weiteren wird diese Lesart <strong>von</strong> wenigen an<strong>de</strong>ren Handschriften bezeugt [ = pc].<br />
1.2.4 Variante c)<br />
??? st?? <strong>de</strong>, ?????? ?a? ?a?? epe? <strong>de</strong>?te <strong>de</strong>te t ?? t?p?? op??<br />
?e?t? ? ??s???.<br />
Deutsche Übersetzung: Er ist nicht hier, <strong>de</strong>nn er ist auferweckt wor<strong>de</strong>n, wie er gesagt hat.<br />
Kommt her, seht die Stelle, wo Jesus lag.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch:<br />
a) ständige Zeugen erster Ordnung:<br />
Die Majuskelhandschrift (038) (9. Jh.).<br />
1.2.5 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten<br />
Die drei Textvarianten a), b) und c) ergänzen <strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Text <strong>de</strong>s NA. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
dabei um Erläuterungen <strong>de</strong>ssen, was bzw. wer dort gele gen hat. Variante a) bezeichnet die<br />
Person als <strong>de</strong>n Herrn, während Variante b) vom Leib <strong>de</strong>s Herrn spricht. Dies beinhaltet eine
10<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
leicht inhaltliche Verschiebung, <strong>de</strong>nn in b) wird ausdrücklich auf <strong>de</strong>n „Leib“ hingewiesen.<br />
Dies könnte zum einen betonen wollen, dass Jesus vorher wirklich tot war o<strong>de</strong>r zum an<strong>de</strong>ren<br />
auf die leibliche Auferstehung Jesu verweisen. Variante c) nennt hingegen Jesus beim Namen.<br />
Alle drei Varianten benennen die Person näher, die auch im Text <strong>de</strong>s NA gemeint (nur dort<br />
nicht benennt, da <strong>de</strong>r Kontext die I<strong>de</strong>ntität erschließen lässt) ist. Die Lesarten a), b) und c)<br />
bil<strong>de</strong>n eine Erweiterung <strong>de</strong>s Textes mit jeweils unterschiedlichem Akzent (sie betonen Jesus<br />
als <strong>de</strong>n Herrn, seinen Leib o<strong>de</strong>r die Person selbst).<br />
Die vier Varianten sind unterschiedlich gut bezeugt: <strong>de</strong>r Text <strong>de</strong>s NA durch 3 ständige<br />
Zeugen erster sowie 2 ständige Zeugen zweiter Ordnung, die Textvariante a) durch 8 ständige<br />
Zeugen erster Ordnung (sie gilt außer<strong>de</strong>m als Mehrheitstext), die Variante b) durch einen<br />
ständigen Zeugen zweiter Ordnung und die Variante c) durch einen ständigen Zeugen erster<br />
Ordnung. Die Varianten b) und c) sind <strong>de</strong>utlich schlechter bezeugt als die an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n,<br />
zusätzlich sind die Handschriften wesentlich jünger, so dass keine dieser bei<strong>de</strong>n Lesarten die<br />
ursprüngliche ist.<br />
Der NA hat die <strong>von</strong> ihm gewählte Lesart wahrscheinlich <strong>de</strong>r Variante a) vorgezogen, weil sie<br />
durch <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong>x Sinaiticus und <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong>x Vaticanus belegt sind. Jedoch ist Variante a)<br />
durch eine <strong>de</strong>utlich größere Anzahl an ständigen Zeugen erster Ordnung belegt und gilt als<br />
Mehrheitstext.<br />
Aber für <strong>de</strong>n Text <strong>de</strong>s NA sprechen die an<strong>de</strong>ren Grundregeln <strong>de</strong>r Philologie. Sie ist die<br />
kürzere Lesart und ebenfalls schwierigere Lesart, da die Ergänzungen <strong>de</strong>r Varianten <strong>de</strong>r<br />
Erläuterung dienen. Durch sie wird klarer, wer (o<strong>de</strong>r was) im Grab gelegen hat und lassen die<br />
Aussageabsicht <strong>de</strong>s Schreibers 11 <strong>de</strong>utlich wer<strong>de</strong>n. Die Lesarten in a), b) und c) lassen sich aus<br />
<strong>de</strong>r Variante im NA somit als nachträglich beigefügte Erläuterungen zum besseren<br />
Verständnis erklären. So wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r Zeit zunächst „? ??????“, später „t? s?µa t??<br />
??????” bzw. „? ??s???“ ergänzt<br />
1.3 Textkritik zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,7<br />
1.3.1 Der Text im Nestle-Aland (NA)<br />
11 In diesem Fall wohl die Aussageintention <strong>de</strong>s „Abschreibers“.
Die im NA vom Herausgeber bevorzugte Textversion lautet:<br />
11<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
☺? <br />
? ? ☺ <br />
? ☯␛, ? <br />
☺.<br />
Deutsche Übersetzung: Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und <strong>de</strong>m Petrus: Er geht euch<br />
voran nach Galileia; dort wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.<br />
Die positiven Textzeugen wer<strong>de</strong>n an dieser Stelle im NA nicht einzeln aufgeführt. Es han<strong>de</strong>lt<br />
sich jedoch um <strong>de</strong>n Mehrheitstext, da keine <strong>de</strong>r Varianten als solcher ausgewiesen wird. 12<br />
1.3.2 Variante a)<br />
☺? <br />
? ? ? <br />
☺? ?<br />
☯␛, ? ☺.<br />
Deutsche Übersetzung: Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und <strong>de</strong>m Petrus: Er ist<br />
auferstan<strong>de</strong>n <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Toten und - seht doch! - er geht euch voran nach Galileia; dort<br />
wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch die Minuskelfamilie f 1 (ständiger Zeuge erster Ordnung)<br />
und wenige weitere Handschriften [ = pc].<br />
1.3.3 Variante b)<br />
☺? <br />
? ☺ <br />
? ☯␛, ?<br />
? ☺.<br />
12 Vgl. NA, S. 14*.
12<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Deutsche Übersetzung: Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und <strong>de</strong>m Petrus: Seht doch! Ich<br />
gehe euch voran nach Galileia; dort wer<strong>de</strong>t ihr mich sehen, wie ich euch gesagt habe.<br />
Diese Variante wird bezeugt durch <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong>x Bezae Cantabrigiensis [ = D] (05) aus <strong>de</strong>m 5.<br />
Jh. (ständiger Zeuge erster Ordnung) und <strong>de</strong>m lateinischen Co<strong>de</strong>x k aus <strong>de</strong>m 4./5. Jh. als<br />
weiteren Zeugen.<br />
1.3.4 Bewertung <strong>de</strong>r Varianten<br />
Die bei<strong>de</strong>n Textvarianten a) und b) bieten Ergänzungen bzw. Umformulierungen <strong>de</strong>s Textes<br />
<strong>de</strong>s NA. Das „“ könnte in bei<strong>de</strong>n Varianten eingefügt wor<strong>de</strong>n sein, um die<br />
Aufmerksamkeit <strong>de</strong>s Lesers zu wecken bzw. sie auf die nachfolgen<strong>de</strong> Textpassage zu lenken.<br />
Variante a) betont die Auferstehung, während Variante b) die Ankündigung in <strong>de</strong>r ersten<br />
Person erfolgen lässt. Dies könnte geschehen sein, um die Botschaft <strong>de</strong>s Engels <strong>de</strong>utlicher als<br />
Botschaft Jesu auszuweisen.<br />
Die Varianten a) und b) sind mit jeweils nur einem ständigen Zeugen erster und keinem<br />
ständigen Zeugen zweiter Ordnung relativ schlecht bezeugt und dürften daher nicht <strong>de</strong>r<br />
ursprünglichen Lesart entsprechen. Der Text <strong>de</strong>s NA gilt hingegen als Mehrheitstext und wird<br />
durch die an<strong>de</strong>ren Grundregeln <strong>de</strong>r Philologie gestützt. Er bietet die kürzere Lesart, außer<strong>de</strong>m<br />
die schwierigere Lesart, da die Ergänzungen <strong>de</strong>r Varianten zum besseren Verständnis<br />
eingefügt wur<strong>de</strong>n.. Durch Variante a) wird klarer, dass Jesus auferstan<strong>de</strong>n ist und Variante b)<br />
ver<strong>de</strong>utlicht die „Herkunft“ <strong>de</strong>r verkün<strong>de</strong>ten Botschaft an die Jünger.<br />
2. Übersetzungskritik zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8<br />
2.1 Einführung
13<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Für die folgen<strong>de</strong> Übersetzungskritik wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r griechische Text <strong>de</strong>s NA, die<br />
Einheitsübersetzung (wird im weiteren Text als „EÜ“ abgekürzt) und die Studienübersetzung<br />
<strong>de</strong>s Münchener Neuen Testaments (im Folgen<strong>de</strong>n abgekürzt als „MüNT“) verwandt. 13<br />
Die EÜ hat <strong>de</strong>n Anspruch <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Sprache entsprechend zu übersetzen und<br />
zur Verkündigung geeignet zu sein. 14 Sie ist in „gehobenem Gegenwarts<strong>de</strong>utsch“ 15<br />
geschrieben. Das MüNT verfährt nach <strong>de</strong>m Grundsatz: „So griechisch wie möglich, so<br />
<strong>de</strong>utsch wie nötig“ <strong>16</strong> und lässt <strong>de</strong>m griechischen Original seine Eigenarten, Ecken und<br />
Kanten.<br />
In dieser Arbeit sollen die Übersetzungen vor allem in Hinsicht auf Wortbe<strong>de</strong>utungen und<br />
Syntax untersucht wer<strong>de</strong>n. Auf stilistische Unterschie<strong>de</strong> 17 zwischen Original und Übersetzung<br />
kann nicht eingegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>r Übersetzungskritik wer<strong>de</strong> ich Vers für Vers vorgehen, jeweils die bei<strong>de</strong>n<br />
Übersetzungen behan<strong>de</strong>ln und sie dann beurteilen.<br />
2.2 Allgemeine Beobachtungen 18<br />
Die EÜ übersetzt wesentlich freier als das MüNT und glättet <strong>de</strong>n Text. Das MüNT ist für<br />
unsere heutigen Lesegewohnheiten etwas ungewohnt, da es die griechische Wortstellung<br />
beibehält, die oft nicht mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen übereinstimmt. Partizipialkonstruktionen wer<strong>de</strong>n<br />
beibehalten und nicht in einen Nebensatz aufgelöst. Die EÜ „<strong>de</strong>utscht ein“, so dass sie<br />
flüssiger zu lesen ist.<br />
2.3 Übersetzungskritik zu <strong>de</strong>n einzelnen Versen<br />
EÜ: MüNT:<br />
13<br />
Für die genauen literarischen Angaben vgl. Kap. 5, Literaturverzeichnis.<br />
14<br />
Vgl. EÜ, S. V.<br />
15<br />
EÜ, S. VI.<br />
<strong>16</strong><br />
MüNT, S. VII.<br />
17<br />
Die neutestamentlichen Schriften sind im Koine-Griechischen verfasst, <strong>de</strong>r Umgangssprache <strong>de</strong>r<br />
hellenistischen Kulturwelt. Zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Schriften gibt es Niveauunterschie<strong>de</strong>; gera<strong>de</strong> das<br />
Markusevangelium zeichnet sich jedoch durch einen eher einfacheren Stil aus. (Vgl. Roloff, Jürgen:<br />
Einführung in das neue Testament. Reclam, Stuttgart, 2000, S. 21.) Die EÜ hingegen ist in gehobenem<br />
Deutsch geschrieben.<br />
18<br />
Es lässt sich einiges allgemein über die Übersetzungen aussagen. Dies will ich zu Beginn gesammelt tun, um<br />
mich nicht bei je<strong>de</strong>m Vers zu wie<strong>de</strong>rholen.
Vers 1:<br />
Als <strong>de</strong>r Sabbat vorüber war, kauften Maria<br />
aus Magdala, Maria, die Mutter <strong>de</strong>s Jakobus,<br />
und Salome wohlriechen<strong>de</strong> Öle, um damit<br />
zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.<br />
14<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Und als vorüber war <strong>de</strong>r Sabbat, Maria, die<br />
Magdalenerin, und Maria, die [<strong>de</strong>s] Jakobus,<br />
und Salome kauften Essenzen, damit<br />
kommend sie ihn salbten.<br />
Sowohl die EÜ als auch das MüNT übersetzen mit „vorüber<br />
war“. Diese Be<strong>de</strong>utung konnte ich so in keinem Wörterbuch 19 fin<strong>de</strong>n, aber sie ist inhaltlich<br />
stimmig. Es wer<strong>de</strong>n die Be<strong>de</strong>utungen „verstreichen“, „vorübergehen“ und „vergehen“<br />
angegeben. Außer<strong>de</strong>m fügen bei<strong>de</strong> Übersetzungen ein „als“ ein, welches im grch. Text keine<br />
Entsprechung hat. Dies dient <strong>de</strong>m besseren Verständnis <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Textes, da wir nur<br />
dadurch das Zeitverhältnis ausdrücken können. Die gewählte Übersetzung stimmt meines<br />
Erachtens mit <strong>de</strong>r Aussageabsicht <strong>de</strong>s griechischen Textes überein.<br />
Das MüNT übersetzt wortgetreu „Maria, die Magdalenerin“ und „Maria, die [<strong>de</strong>s] Jakobus“.<br />
Dies könnte für <strong>de</strong>n heutigen Leser missverständlich sein: „die Magdalenerin“ könnte als<br />
Familienname bzw. –zugehörigkeit statt als Herkunftsbezeichnung verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, „die<br />
[<strong>de</strong>s] Simons könnte auch Simons Tochter o<strong>de</strong>r Frau sein. Daher halte ich die Lösung <strong>de</strong>r EÜ<br />
für besser, welche –übereinstimmend mit <strong>de</strong>r Intention <strong>de</strong>s grch. Originals – die Verhältnisse<br />
ein<strong>de</strong>utig beschreibt.<br />
Unterschiedlich wird auch das Wort übersetzt. Bei<strong>de</strong> Übersetzungen<br />
scheinen mir möglich, da bei<strong>de</strong> die hohe Qualität <strong>de</strong>s Öls <strong>de</strong>utlich machen, mit <strong>de</strong>m Jesus<br />
gesalbt wer<strong>de</strong>n sollte. In bei<strong>de</strong>n Varianten drückt sich so die Wertschätzung für <strong>de</strong>n Toten<br />
aus.<br />
Im zweiten Teil <strong>de</strong>s Verses fügt die EÜ „Jesus“ für ein und ergänzt „um“<br />
sowie „zum Grab“.<br />
Die Nennung <strong>de</strong>s Namens Jesu ver<strong>de</strong>utlicht, um wen es geht. Dies erschließt sich jedoch aus<br />
<strong>de</strong>m Kontext und ist eigentlich überflüssig, aber durch die Namensnennung wird die<br />
Textpassage auch verständlich, wenn man <strong>Mk</strong> 15 nicht vorher liest, z.B. bei <strong>de</strong>r Lesung im<br />
Gottesdienst.<br />
19 Vgl.: Kassühlke, Robert: Kleines Wörterbuch zum Neuen Testament. Griechisch – Deutsch. Deutsche<br />
Bibelgesellschaft, Stuttgart, dritte, verbesserte Auflage, 2001, S. 44 (wird im weitern Verlauf mit „Kassühlke“<br />
abgekürzt) und Preuschen, Erwin: Griechisch-<strong>de</strong>utsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament. Walter <strong>de</strong><br />
Gruyter, Berlin, 6., verbesserte Auflage, 1976, S. 54 (wird im Folgen<strong>de</strong>n als „Preuschen“ abgekürzt).
15<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die Ergänzung <strong>von</strong> „um“ fin<strong>de</strong> ich gut, da durch sie <strong>de</strong>utlich wird, dass die Frauen die<br />
Absicht hatten, Jesus zu salben. Im MüNT hingegen ist die Übersetzung in diesem Punkt<br />
missverständlich, da man <strong>de</strong>n Text –bevor man die nachfolgen<strong>de</strong>n Verse liest– auch so<br />
verstehen könnte, als wür<strong>de</strong>n die Frauen Jesus nach ihrer Ankunft salben.<br />
Die Ergänzung „zum Grab“ ist über flüssig, da im folgen<strong>de</strong>n Satz die Ankunft am Grab genau<br />
geschil<strong>de</strong>rt wird.<br />
Vers 2:<br />
Am ersten Tag <strong>de</strong>r Woche kamen sie in aller<br />
Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging.<br />
Und sehr früh am Ersten <strong>de</strong>r Woche kommen<br />
sie zum Grab, als aufgegangen war die<br />
Sonne.<br />
Die EÜ fügt „Tag“ in ihre Übersetzung ein, um <strong>de</strong>n Text verständlicher zu machen.<br />
Allerdings halte ich <strong>de</strong>n Text <strong>de</strong>s MüNT „am Ersten <strong>de</strong>r Woche“ für verständlich und wür<strong>de</strong><br />
ihn wegen <strong>de</strong>r größeren Nähe zum Original vorziehen.<br />
Die Übersetzung 20 <strong>von</strong> geschieht im MüNT wörtlich („sehr früh“), in <strong>de</strong>r<br />
EÜ wird hingegen die Formulierung „in aller Frühe“ gewählt, die allerdings <strong>de</strong>n Sinn genauso<br />
trifft.<br />
Auffallend ist die unterschiedliche Übertragung <strong>de</strong>r Verbform . Das MüNT<br />
gibt sie originalgetreu im Präsens wie<strong>de</strong>r, während die EÜ „kamen“ schreibt. Der Grund dafür<br />
dürfte wohl sein, dass <strong>de</strong>r Rest <strong>de</strong>r Erzählung im Vergangenheitstempus geschrieben wur<strong>de</strong><br />
und die Übersetzer an die Textumgebung anpassen. Ich halte dies in diesem<br />
Fall für eine legitime Vorgehensweise, da es keinen Grund für einen Tempuswechsel gibt und<br />
die angepasste Übersetzung sich besser in <strong>de</strong>n Text einfügt.<br />
Vers 3:<br />
Sie sagten zueinan<strong>de</strong>r: Wer könnte uns <strong>de</strong>n<br />
Stein vom Eingang <strong>de</strong>s Grabes wegwälzen?<br />
Und sie sagten zu sich: Wer wird w egwälzen<br />
uns <strong>de</strong>n Stein aus <strong>de</strong>r Tür <strong>de</strong>s Grabes?<br />
Die EÜ lässt das am Satzanfang unübersetzt. Dies ist möglich, weil auch<br />
einfach nur <strong>de</strong>n Beginn eines Satzes kennzeichnen kann. 21<br />
20 Wenn bei einem Be<strong>de</strong>utungsnachweis einer Vokabel kein expliziter Verweis auf ein Wörterbuch zu fin<strong>de</strong>n ist,<br />
habe ich das Wort im Kassühlke nachgeschlagen.<br />
21 Vgl. Kassühlke, S. 95.
<strong>16</strong><br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Unterschie<strong>de</strong> gibt es auch in <strong>de</strong>r Übersetzung <strong>von</strong> ☺:<br />
„zueinan<strong>de</strong>r“(EÜ) und „zu sich“(MüNT). Bei<strong>de</strong> Versionen sind vorstellbar, da<br />
als Reflexivpronomen „sich“ und als Reziprokpronomen „einan<strong>de</strong>r“ heißen<br />
kann. Inhaltlich ergibt sich ein kleiner Unterschied: Bei „zueinan<strong>de</strong>r“ sprechen sich die<br />
Frauen ein<strong>de</strong>utig gegenseitig an; „zu sich“ sprechen hat keinen zwingen<strong>de</strong>n Bezug auf an<strong>de</strong>re,<br />
in diesem Fall könnten die Frauen auch je<strong>de</strong> zu sich selbst sprechen.<br />
Das MüNT übersetzt originalgetreu futurisch, während die EÜ<br />
daraus eine Konstruktion mit Modalverb („könnte wegwälzen“) macht. Dies be<strong>de</strong>utet eine<br />
leichte Inhaltsverschiebung, da in diesem Fall aus <strong>de</strong>r Tatsache, dass jemand <strong>de</strong>n Stein<br />
wegwälzen wird, eine Möglichkeit wird. Der Eintritt <strong>de</strong>s Vorgangs wird unsicherer.<br />
Der Begriff wird <strong>von</strong> <strong>de</strong>r EÜ mit „Eingang“, vom MüNT mit „Tür“ übersetzt.<br />
Bei<strong>de</strong> Varianten sind möglich 22 , die Auswahl hat keinerlei inhaltliche Auswirkung und liegt<br />
im Belieben <strong>de</strong>s Übersetzers.<br />
Vers 4:<br />
Doch als sie hinblickten, sahen sie, daß <strong>de</strong>r<br />
Stein schon weggewälzt war; er war sehr<br />
groß.<br />
Und aufschauend erblicken sie, daß<br />
weggewälzt war <strong>de</strong>r Stein; <strong>de</strong>nn er war sehr<br />
groß.<br />
EÜ und MüNT übersetzen in diesem Vers das satzeinleiten<strong>de</strong> unterschiedlich.<br />
Während das MüNT bei <strong>de</strong>m häufig verwandten „und“ bleibt, setzt die EÜ an dieser Stelle<br />
„doch“ ein, was keine wörtliche Wie<strong>de</strong>rgabe ist. Meiner Meinung nach soll es <strong>de</strong>utlich<br />
machen, wie auffallend die Tatsache ist, dass <strong>de</strong>r Stein bereits weggewälzt wur<strong>de</strong>. Zusammen<br />
mit <strong>de</strong>r temporalen Auflösung <strong>de</strong>r Partizipialkonstruktion bil<strong>de</strong>t diese Einfügung ein<br />
erzählerisches Mittel zur Spannungssteigerung.<br />
Für fin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>n Wörterbüchern die Be<strong>de</strong>utung „aufblicken“ bzw.<br />
„emporblicken“ und „wie<strong>de</strong>r sehend wer<strong>de</strong>nd“ 23 . Da vorher nichts <strong>von</strong> einer „Sehstörung“ <strong>de</strong>r<br />
Frauen berichtet wird, fällt die zweit e Be<strong>de</strong>utung hier wohl aus. Die erste Be<strong>de</strong>utung<br />
impliziert in bei<strong>de</strong>n Fällen, dass die Frauen <strong>de</strong>n Kopf bzw. die Augen heben. Daher trifft die<br />
EÜ (hinblickten“) nicht <strong>de</strong>n ursprünglichen Sinn, die Variante „aufschauend“ <strong>de</strong>s MüNT<br />
hingegen schon.<br />
22 Vgl. Kassühlke, S. 89.<br />
23 Vgl. Kassühlke, S. 10 und Preuschen, S. 20.
17<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die Verbformen und sind<br />
Präsensformen. Erstere wird nur <strong>von</strong> <strong>de</strong>r EÜ, die zweite <strong>von</strong> EÜ und MüNT als<br />
Vergangenheit übersetzt (vgl. dazu Übersetzungskritik zu Vers 2, ).<br />
Die EÜ fügt das Wort „schon“ ein. Es bietet keinen neuen inhaltlichen Gehalt, son<strong>de</strong>rn<br />
ver<strong>de</strong>utlicht nur die Tatsache, dass <strong>de</strong>r Stein bereits weg ist. Ich halte diese Ergänzung für<br />
überflüssig.<br />
Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite lässt die EÜ (dt.=<strong>de</strong>nn; nämlich; also doch; wirklich;<br />
allerdings) unübersetzt. Das MüNT übersetzt es mit „<strong>de</strong>nn“. Dies halte ich allerdings für eine<br />
schlechte Lösung, weil „<strong>de</strong>nn“ eine begrün<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Konjunktion ist. In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Übersetzung entsteht <strong>de</strong>swegen <strong>de</strong>r Eindruck, <strong>de</strong>r Grund dafür, dass <strong>de</strong>r Stein bereits<br />
weggewälzt ist, sei sein schweres Gewicht. Die Intention <strong>de</strong>s Schreibers dürfte es eher<br />
gewesen, das Erstaunen darüber auszudrücken, dass <strong>de</strong>r schwere Stein schon weggeräumt<br />
war. Daher halte ich die Version <strong>de</strong>r EÜ für besser, weil sie mehr Sinn ergibt.<br />
Vers 5:<br />
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf<br />
<strong>de</strong>r rechten Seite einen jungen Mann sitzen,<br />
<strong>de</strong>r mit einem weißen Gewand beklei<strong>de</strong>t war;<br />
da erschraken sie sehr.<br />
Und hineingehend ins Grab, sahen sie einen<br />
jungen Mann sitzend zur Rechten, umworfen<br />
mit weißem Gewand, und sie erschraken.<br />
EÜ („auf <strong>de</strong>r rechten Seite“) und MüNT (zur Rechten“) unterschei<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r Übersetzung<br />
<strong>von</strong> ⌧. Da (als Präposition mit Dativ) die Be<strong>de</strong>utungen<br />
„in“, „auf“, „an“, „bei“, „unter“ und „zwischen“ haben kann, wür<strong>de</strong> ich <strong>de</strong>n Ausdruck<br />
wörtlich mit „auf <strong>de</strong>r Rechten“ übersetzen. Bei<strong>de</strong> Übersetzungen weichen da<strong>von</strong> ab das<br />
MüNT nur leicht, die EÜ ergänzt „Seite“) bieten aber dafür eine verständlichere Textvariante,<br />
die die Abweichung vom genauen Originaltext rechtfertigt.<br />
übersetzt das MüNT mit „umworfen“. Dies klingt für <strong>de</strong>n<br />
heutigen Sprachgebrauch befremdlich, so dass ich die Variante <strong>de</strong>r EÜ vorziehen wür<strong>de</strong>,<br />
obwohl sie nicht ganz wörtlich ist. 24<br />
24<br />
Als wörtliche Be<strong>de</strong>utung für weist <strong>de</strong>r Kassühlke auf S. 148 „mit etw. umgeben;<br />
umlegen,<br />
anlegen, anziehen“ und <strong>de</strong>r Preuschen auf S. 141 „(1) lege herum; (2) lege um, ziehe an“ aus. Ich halte die<br />
Variante <strong>de</strong>r EÜ jedoch für besser als z.B. „angezogen mit ...“ und kann auch nicht da<strong>von</strong> ausgehen, dass die<br />
mir zur Verfügung stehen<strong>de</strong>n Wörterbücher alle möglichen Be<strong>de</strong>utungen aufschlüsseln.
18<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Sowohl die EÜ als auch das MüNT übersetzen ⌧ mit „sie<br />
erschraken“. Die wörtliche Be<strong>de</strong>utung 25 ist jedoch „erstaunt sein“, „erschrocken sein“ o<strong>de</strong>r<br />
„sich entsetzen“. Die ersten bei<strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utungen setzen eine an<strong>de</strong>re Zeitigkeit voraus: Die<br />
Frauen sahen und waren (gleichzeitig) erstaunt / erschrocken (die Be<strong>de</strong>utung „erstaunt“ dürfte<br />
jedoch zu schwach sein). Daher ist das „da“, welches die EÜ einfügt und welches ein<strong>de</strong>utig<br />
eine Abfolge <strong>de</strong>r Geschehnisse „Sehen – Erschrecken“ voraussetzt, falsch.<br />
Ich glaube aber, dass bei diesem Ereignis die Übersetzung mit „sich entsetzen“ treffen<strong>de</strong>r<br />
wäre. Die EÜ versucht diesem Sachverhalt mit <strong>de</strong>r Ergänzung <strong>von</strong> „sehr“ zu entsprechen.<br />
Meines Erachtens ist die Formulierung „und sie entsetzten sich“ für bei<strong>de</strong> Textausgaben<br />
vorzuziehen.<br />
Vers 6:<br />
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr<br />
sucht Jesus <strong>von</strong> Nazaret, <strong>de</strong>n Gekreuzigten.<br />
Er ist auferstan<strong>de</strong>n; er ist nicht hier. Seht, da<br />
ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte.<br />
Der aber sagte ihnen: Erschreckt nicht! Jesus<br />
sucht ihr, <strong>de</strong>n Nazarener, <strong>de</strong>n Gekreuzigten;<br />
erweckt wur<strong>de</strong> er, nicht ist er hier; siehe, <strong>de</strong>r<br />
Ort, wohin sie ihn legten!<br />
Die EÜ schreibt in diesem Vers „Jesus <strong>von</strong> Nazaret“, das MüNT „Jesus ..., <strong>de</strong>n Nazarener“.<br />
Der Ausdruck <strong>de</strong>s MüNT ist heute missverständlich (vgl. Übersetzungskritik zu Vers 1). Die<br />
Variante <strong>de</strong>r EÜ ist zwar nicht wortgetreu, aber klarer für <strong>de</strong>n Leser. Noch besser hätte ich<br />
allerdings „Jesus aus Nazaret“ (parallel zu „Maria aus Magdala“ in Vers 1), weil so am<br />
<strong>de</strong>utlichsten wird, dass es sich bei Nazaret um einen Ort / eine Stadt han<strong>de</strong>lt.<br />
Bei <strong>de</strong>m Wort han<strong>de</strong>lt es sich um eine Präsensform, in beid en Übersetzungen<br />
steht jedoch „sagte“ (vgl. dazu Übersetzungskritik zu Vers 2, ).<br />
Bemerkenswert ist meiner Meinung nach die Übersetzung <strong>de</strong>r EÜ <strong>von</strong> <br />
(„Er ist auferstan<strong>de</strong>n“). Bei han<strong>de</strong>lt es sich um die 3. Person, Sg., Aorist<br />
Passiv <strong>von</strong> , das u.a. die Be<strong>de</strong>utung „auferwecken (vom Tod)“, im Passiv<br />
auch „auf(er)stehen)“ hat. 26 Daher sind bei<strong>de</strong>r Varianten, die EÜ und MüNT zeigen, möglich.<br />
Ich glaube jedoch, dass die passivische Formulierung „er wur<strong>de</strong> vom To<strong>de</strong> auferweckt“ die<br />
beste Übersetzung wäre, da sie auf das Han<strong>de</strong>ln und die Größe Gottes verweist und zusätzlich<br />
<strong>de</strong>utlicher ist als „erweckt“ (wie im MüNT). Das Wun<strong>de</strong>rbare <strong>de</strong>r Auferstehung Christi wür<strong>de</strong><br />
durch <strong>de</strong>n Verweis auf Jesu Tod stärker hervortreten.<br />
25 Vgl. Kassühlke, S. 56/7.<br />
26 Vgl. Kassühlke, S. 52.
19<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Die EÜ übersetzt ☺ mit „Seht, da ist die Stelle“, das MüNT mit „sieh,<br />
<strong>de</strong>r Ort“. Bei<strong>de</strong>s ist möglich, da „siehe, seht doch! hört zu! hier ist/sind“ und<br />
sowohl „Stelle“ als auch „Ort“ heißen kann. Da sich <strong>de</strong>r junge Mann jedoch an<br />
mehrere (drei) Frauen wen<strong>de</strong>t, halte ich die Benutzung <strong>de</strong>s Plurals wie in <strong>de</strong>r EÜ für<br />
sinnvoller.<br />
Unterschiedlich ist auch die Übersetzung <strong>von</strong> : „wo“ in <strong>de</strong>r EÜ und „wohin“ im<br />
MüNT. Bei<strong>de</strong> Varianten sind möglich und richten sich nach <strong>de</strong>m weiteren Verlauf <strong>de</strong>s Satzes.<br />
„Wo“ betont dabei mehr <strong>de</strong>n Ort, „wohin“ mehr <strong>de</strong>n Akt <strong>de</strong>s Hinlegens. Ebenso kann<br />
„hinlegen“(EÜ) o<strong>de</strong>r „legen“(MüNT) be<strong>de</strong>uten. Allerdings ist <br />
die 3. P. Pl. <strong>de</strong>s Aorists, weswegen die Übersetzung <strong>de</strong>r EÜ mit „man ... hingelegt hatte“ <strong>de</strong>n<br />
Originaltext nicht trifft.<br />
Vers 7:<br />
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor<br />
allem Petrus: Er geht euch voraus nach<br />
Galiläa; dort wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen, wie er es<br />
euch gesagt hat.<br />
Doch geht fort, sprecht zu seinen Schülern<br />
und <strong>de</strong>m Petros: Vorangeht er euch in die<br />
Galilaia; dort wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen, gleichwie<br />
er gesprochen hatte zu euch.<br />
Das Wort wird in <strong>de</strong>r EÜ mit „nun aber“, im MüNT mit „doch“ übersetzt;<br />
„doch“ und „aber“ sind bei<strong>de</strong>s Übersetzungsmöglichkeiten <strong>von</strong> . Die EÜ fügt<br />
zusätzlich ein „nun“ en, was aber <strong>de</strong>n Inhalt nicht beeinflusst. Auch die Varianten „geht“(EÜ)<br />
und „geht fort“(MüNT) für <strong>de</strong>n Imperativ ☺ sind bei<strong>de</strong> stimmig, ebenso<br />
„sagt“ und „sprecht“ für .<br />
Das MüNT schreibt für „Schüler“, die EÜ hingegen die uns heute<br />
geläufige Be<strong>de</strong>utung „Jünger“. Mögen diese bei<strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utungen im Griechischen einmal das<br />
selbe gemeint haben, so hat sich <strong>de</strong>r Terminus „Jünger“ heute für <strong>de</strong>n „Schüler - bzw.<br />
Jüngerkreis“ um Jesus verfestigt. Zu Gunsten <strong>de</strong>s Wie<strong>de</strong>rerkennungswertes für <strong>de</strong>n Leser<br />
wür<strong>de</strong> ich <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r EÜ vorziehen; <strong>de</strong>r Laie könnte sonst –mit <strong>de</strong>m ihm bekannten<br />
Begriff „Jünger“ im Hintergrund – bei „Schüler“ an eine zweite, <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Jüngern<br />
unterschie<strong>de</strong>ne Gruppe <strong>de</strong>nken.<br />
Die Wendung wird in <strong>de</strong>r EÜ mit „vor allem Petrus“, im MüNT<br />
mit „und <strong>de</strong>m Petros“ übersetzt. Die Hervorhebung <strong>de</strong>s Petrus in <strong>de</strong>r EÜ entspricht sprachlich<br />
nicht <strong>de</strong>m Originaltext. Allerdings ist dies eine sinnvolle Abweichung vom grch. Wortlaut, da
20<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
bei einer Aufzählung mit „und“ Petrus ein vom Jüngerkreis zu unterschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r wäre. Da er<br />
aber Teil dieses Kreises war, kann seine ausdrückliche Nennung nur die Hervorhebung seiner<br />
Son<strong>de</strong>rstellung unter <strong>de</strong>n Jüngern meinen. Daher halte ich die Version <strong>de</strong>r EÜ für besser als<br />
die <strong>de</strong>s MüNT, da diese missverständlich ist.<br />
Die EÜ übersetzt mit „nach Galiläa“, das MüNT im<br />
Gegensatz dazu mit „in die Galilaia“. Bei<strong>de</strong>s ist möglich, da sowohl „in“ als auch<br />
„nach“ heißen kann 27 . Verwen<strong>de</strong>t man die Übersetzung „nach“ (wie die EÜ), so lässt man im<br />
Deutschen folgerichtig <strong>de</strong>n Artikel (in diesem Fall ) unübersetzt. 28 Die Formulierung<br />
<strong>de</strong>s MüNT erscheint uns heute fremd, so dass ich die <strong>de</strong>r EÜ vorziehen wür<strong>de</strong>.<br />
Verschie<strong>de</strong>n wird auch die Textzeile ☺ übertragen. Die<br />
EÜ schreibt „wie er es euch gesagt hat“, das MüNT „gleichwie er gesprochen hatte zu euch“.<br />
Für konnte ich bei<strong>de</strong> Möglichkeiten 29 fin<strong>de</strong>n.<br />
hingegen kann zwar „sagen“ o<strong>de</strong>r „sprechen“, nicht aber „sprechen zu“ heißen.<br />
Daher ist die Übersetzung <strong>de</strong>r EÜ originalgetreuer als die <strong>de</strong>s MüNT, welche jedo ch die<br />
inhaltliche Aussage nicht verfälscht.<br />
Die EÜ fügt in ihren Text noch ein „es“ ein. Dies entspricht nicht <strong>de</strong>m Original, ist auch für<br />
die <strong>de</strong>utsche Satzkonstruktion nicht notwendig und kann <strong>de</strong>shalb weggelassen wer<strong>de</strong>n.<br />
Vers 8:<br />
Da verließen sie das Grab und flohen; <strong>de</strong>nn<br />
Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.<br />
Und sie sagten niemand etwas da<strong>von</strong>, <strong>de</strong>nn<br />
sie fürchteten sich.<br />
Und herausgehend flohen sie vom Grab,<br />
<strong>de</strong>nn (es) hielt sie Zittern und Entsetzen; und<br />
keinem sagten sie etwas; <strong>de</strong>nn sie fürchteten<br />
sich.<br />
Deutliche Unterschie<strong>de</strong> lassen sich bei <strong>de</strong>r Übersetzung <strong>de</strong>s Versbeginns feststellen.<br />
Die EÜ lässt die Frauen das Grab verlassen und dann fliehen, während sie im MüNT vom<br />
Grab weg fliehen. In <strong>de</strong>r EÜ hat die Flucht <strong>de</strong>r Frauen nichts mit <strong>de</strong>m Grab zu tu n, während<br />
er im MüNT als <strong>de</strong>r Ort, vor <strong>de</strong>m sie sich fürchten <strong>de</strong>utlich wird. Auf Grund <strong>de</strong>r Stellung im<br />
grch. Text, wo näher an steht, glaube ich, dass es sich auf<br />
27 Vgl. Kassühlke, S. 55.<br />
28 Parallel dazu sagt man im Deutschen: „Ich gehe in die Schweiz“ und „Ich gehe nach Deutschland“, nicht aber<br />
„Ich gehe nach das Deutschland“.<br />
29 Vgl. Kassühlke, S. 95 und Preuschen, S. 98.
21<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
bezieht. Daher halte ich die Version <strong>de</strong>s MüNT für besser, wür<strong>de</strong> jedoc h<br />
im Deutschen die Partizipialkonstruktion auflösen.<br />
Das grch. Wort wird <strong>von</strong> <strong>de</strong>r EÜ mit Schrecken wie<strong>de</strong>rgegeben. <br />
heißt jedoch –wie das MüNT richtig angibt– „das Zittern/Beben“ 30 , was ein viel plastischeres<br />
Bild ergibt. Der „Schrecken“ kann sich außer<strong>de</strong>m nur auf einen kurzen Moment beziehen<br />
o<strong>de</strong>r, im Sinne <strong>von</strong> „erschrecken“, einen harmlosen Schreck bezeichnen. Wenn man hingegen<br />
zittert, dauert das eine ganze Weile an und es geschieht nur, wenn man sich richtig fürchtet.<br />
Angesichts <strong>de</strong>ssen, was <strong>de</strong>n Frauen wi<strong>de</strong>rfahren ist, halte ich die „stärkere“ Übersetzung für<br />
angemessen.<br />
Für schreiben bei<strong>de</strong> Übersetzungen „Entsetzen“. Dies ist zwar schon ein<br />
starker Gefühlsausdruck, doch die wörtliche Übersetzung 31 (=„Außersichsein“) ist noch<br />
drastischer. „Außersichsein“ beschreibt die Ausnahmesituation <strong>de</strong>r Frauen und die damit<br />
verbun<strong>de</strong>nen Gefühle besser als „Entsetzen“. Es macht <strong>de</strong>utlich, dass die Frauen so betroffen<br />
waren, dass sie völlig aus <strong>de</strong>m Gleichgewicht („außer sich“) gerieten.<br />
Die doppelte Verneinung dient im Griechischen zur<br />
Verstärkung. Sie wird im Deutschen, wo sie als positive Aussage missverstan<strong>de</strong>n 32 wer<strong>de</strong>n<br />
könnte, nicht wörtlich wie<strong>de</strong>rgegeben, son<strong>de</strong>rn aufgelöst. Daher sind die Lösungen <strong>de</strong>r EÜ<br />
und <strong>de</strong>s MüNT bei<strong>de</strong> richtig.<br />
Die EÜ fügt ein „da<strong>von</strong>“ ein, vermutlich zur Ver<strong>de</strong>utlichung, dass die Frauen genau <strong>von</strong> <strong>de</strong>m<br />
zuvor geschil<strong>de</strong>rten Vorfall nichts erzählen. Eine Entsprechung im grch. Text fin<strong>de</strong>t sich<br />
nicht. Die Ergänzung ist überflüssig, da auch ohne sie klar, wo<strong>von</strong> die Frauen nicht sprechen.<br />
2.4 Vor- und Nachteile <strong>de</strong>r einzelnen Übersetzungen 33<br />
2.4.1 Die Einheitsübersetzung<br />
30 Vgl. Kassühlke, S. 193 und Preuschen, S. 175.<br />
31 Vgl. Kassühlke, S. 58. Die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren dort aufgeführten Varianten „Erstaunen“ und „Ratlosigkeit“<br />
kommen durch <strong>de</strong>n Kontext nicht in Frage, weil sie zu „harmlos“ sind.<br />
32 Wenn ich im Deutschen sage, dass ich nicht nichts getan habe, so heißt das eben, dass ich e twas gemacht habe.<br />
33 Ich möchte in diesem Zusammenhang ungern <strong>von</strong> „Stärken“ und vor allem „Schwächen“ sprechen, da bei<strong>de</strong><br />
Übersetzungen ihre Eigenarten haben und unterschiedlichen Zwecken dienen. Für je<strong>de</strong>n Gebrauch wählt man<br />
daher die passen<strong>de</strong> Übersetzung aus, an<strong>de</strong>re zeigen für diese Verwendung dann „Schwächen“, aber gera<strong>de</strong><br />
diese können sich in einem an<strong>de</strong>ren Kontext als „Stärken“ entpuppen.
22<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Vor- und Nachteile <strong>de</strong>r EÜ ergeben sich fast zwangsweise aus <strong>de</strong>r Aufgabe, die sie selbst<br />
erfüllen will. Sie dient <strong>de</strong>r Verkündigung und will auch für <strong>de</strong>n Laien verständlich sein.<br />
Daraus folgt, dass sie viele Unebenheiten <strong>de</strong>s grch. Textes glättet und Stellen unserem<br />
heutigen Sprachgebrauch angleicht. Gera<strong>de</strong> diese „Anpassung“ ist sehr ambivalent zu werten.<br />
Zum einen hat sie <strong>de</strong>n Nachteil, dass sie grch. Begriffe ungenau übersetzt o<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r<br />
Übersetzung durch die bekannten Begriffe auf diese eingeengt ist. Zum an<strong>de</strong>ren bietet sie <strong>de</strong>n<br />
Lesern ein verständliches Deutsch und Bezeichnungen, die er auf Grund ihres<br />
Bekanntheitsgra<strong>de</strong>s auch einordnen kann. Im vorliegen<strong>de</strong>n Beispiel gilt das für <strong>de</strong>n Begriff<br />
„Jünger“; <strong>de</strong>m Leser ist ohne Erklärung völlig klar, um welchen Personenkreis es sich<br />
han<strong>de</strong>lt, weil er ihn in <strong>de</strong>n Evangelien so häufig liest.<br />
Es ist klar, dass es sich bei <strong>de</strong>r EÜ um eine inhaltlich korrekte, nicht aber wörtliche<br />
Übersetzung han<strong>de</strong>lt. Zur kritischen Textarbeit können <strong>de</strong>swegen an<strong>de</strong>re Übersetzungen<br />
dienlicher sein.<br />
2.4.2 Das Münchener Neue Testament<br />
Das MüNT bietet eine möglichst originalgetreue Übersetzung. Sie will aus bekannten Formen<br />
ausbrechen und zum Nach<strong>de</strong>nken anstoßen. Dies hat zur Folge, dass Eigentümlichkeiten <strong>de</strong>s<br />
grch. Textes beibehalten wer<strong>de</strong>n: Die Wortstellung klingt oft ungewohnt. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n<br />
die Partizipialkonstruktionen wörtlich übertragen, wodurch <strong>de</strong>r Text oft genug etwas holprig<br />
wird. Ich halte die Auflösung <strong>de</strong>r Partizipien für besser, da sie besser zu lesen sind und eine<br />
originalgetreue Wie<strong>de</strong>rgabe darstellen können.<br />
Das MüNT eignet sich daher nicht zum „Vorlesen“ in Katechese und Gottesdienst. Der Leser<br />
dieser Übersetzung benötigt ein größeres Vorwissen als <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r EÜ, da er auf<br />
Begrifflichkeiten stößt, die <strong>de</strong>m Laien heute unbekannt sind. Dadurch erhält er jedoch die<br />
Chance, sich kritischer und intensiver mit <strong>de</strong>m Text zu befassen und so zu einem tieferen<br />
Verständnis zu gelangen. Der Leser wird nicht in bekannte Begriffe gepresst. Das MüNT will<br />
ja auch eine Übersetzung sein, mit <strong>de</strong>r man arbeitet. Dafür ist es gut geeignet, weil es das<br />
Verständnis <strong>de</strong>s Originaltextes erleichtert.<br />
3. Synoptischer Vergleich <strong>von</strong> <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 mit Mt 28,1-10
3.1 Gegenüberstellung <strong>de</strong>r Texte<br />
<strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 Mt 28,1-10<br />
1. Als <strong>de</strong>r Sabbat vorüber war, kauften Maria<br />
aus Magdala, Maria, die Mutter <strong>de</strong>s Jakobus,<br />
und Salome wohlriechen<strong>de</strong> Öle, um damit<br />
zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.<br />
2. Am ersten Tag <strong>de</strong>r Woche kamen sie in<br />
aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne<br />
aufging.<br />
3. Sie sagten zueinan<strong>de</strong>r: Wer könnte uns <strong>de</strong>n<br />
Stein vom Eingang <strong>de</strong>s Grabes wegwälzen?<br />
4. Doch als sie hinblickten, sahen sie, daß <strong>de</strong>r<br />
Stein schon weggewälzt war; er war sehr<br />
groß. 5. Sie gingen in das Grab hinein und<br />
sahen auf <strong>de</strong>r rechten Seite einen jungen<br />
Mann sitzen, <strong>de</strong>r mit einem weißen Gewand<br />
beklei<strong>de</strong>t war; da erschraken sie sehr.<br />
6. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht!<br />
Ihr sucht Jesus <strong>von</strong> Nazaret, <strong>de</strong>n<br />
Gekreuzigten. Er ist auferstan<strong>de</strong>n; er ist nicht<br />
hier.<br />
Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt<br />
hatte.<br />
7. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern,<br />
23<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
1. Nach <strong>de</strong>m Sabbat kamen in <strong>de</strong>r<br />
Morgendämmerung <strong>de</strong>s ersten Tages <strong>de</strong>r<br />
Woche Maria aus Magdala und die an<strong>de</strong>re<br />
Maria, um nach <strong>de</strong>m Grab zu sehen.<br />
2. Plötzlich entstand ein gewaltiges<br />
Erdbeben; <strong>de</strong>nn ein Engel <strong>de</strong>s Herrn kam<br />
vom Himmel herab, trat an das Gab, wälzte<br />
<strong>de</strong>n Stein weg und setzte sich darauf.<br />
3. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und<br />
sein Gewand war weiß wie Schnee. 4. Die<br />
Wächter begannen vor Angst zu zittern und<br />
fielen wie tot zu Bo<strong>de</strong>n.<br />
5. Der Engel aber sagte zu <strong>de</strong>n Frauen:<br />
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht<br />
Jesus, <strong>de</strong>n Gekreuzigten. 6. Er ist nicht hier;<br />
<strong>de</strong>nn er ist auferstan<strong>de</strong>n, wie er gesagt hat.<br />
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er<br />
lag.<br />
7. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und
vor allem Petrus:<br />
Er geht euch voraus nach Galiläa; dort<br />
wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt<br />
hat.<br />
8. Da verließen sie das Grab und flohen;<br />
<strong>de</strong>nn Schrecken und Entsetzen hatte sie<br />
gepackt. Und sie sagten niemand etwas<br />
da<strong>von</strong>, <strong>de</strong>nn sie fürchteten sich.<br />
24<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
sagt ihnen: Er ist <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Toten<br />
auferstan<strong>de</strong>n.<br />
Er geht euch voraus nach Galiläa, dort<br />
wer<strong>de</strong>t ihr ihn sehen. Ich habe es euch<br />
gesagt.<br />
3.2 Übereinstimmungen zwischen <strong>Mk</strong> und Mt<br />
8. Sogleich verließen sie das Grab und eilten<br />
voll Furcht und großer Freu<strong>de</strong> zu seinen<br />
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu<br />
verkün<strong>de</strong>n.<br />
Die Perikope stimmt inhaltlich grob überein, auch die Länge ist ungefähr gleich.<br />
In bei<strong>de</strong>n Evangelien kommen Frauen am frühen Morgen <strong>de</strong>s ersten Tages <strong>de</strong>r Woche zum<br />
Grab, welches sich als leer erweist. Ein Bote bzw. Engel in weißen Gewän<strong>de</strong>rn taucht auf und<br />
teilt ihnen mit, dass Jesus nicht da, son<strong>de</strong>rn auferstan<strong>de</strong>n ist. Er for<strong>de</strong>rt die Frauen auf, sich<br />
die Stelle anzusehen, wo Jesus gelegen hat. Darauf folgt <strong>de</strong>r Auftrag, zu seinen Jüngern zu<br />
gehen und ihnen zu sagen, dass Jesus ihnen, wie angekündigt, nach Galiläa vorausgeht.<br />
Anschließend verlassen die Frauen das Grab.<br />
Der Zeitpunkt <strong>de</strong>s Ereignisses muss <strong>von</strong> Be<strong>de</strong>utung gewesen sein, da bei<strong>de</strong> Evangelien ihn<br />
<strong>de</strong>tailliert schil<strong>de</strong>rn. Es wer<strong>de</strong>n zwar unterschiedliche Umschreibungen gewählt, aber gemeint<br />
ist bei<strong>de</strong> Male <strong>de</strong>r Moment <strong>de</strong>s Sonnenaufgangs (am ersten Tag <strong>de</strong>r Woche).<br />
Nur eine Peson wird in bei<strong>de</strong>n Evangelien namentlich erwähnt und näher bestimmt; das ist<br />
Maria aus Magdala. Dies könnte für ihre hohe Be<strong>de</strong>utung sprechen o<strong>de</strong>r dafür, dass sie stets<br />
mit dm Auffin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s leeren Grabes verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>, so das ihre Anwesenheit unstrittig<br />
war.<br />
<strong>Mk</strong> wie Mt scheinen viel Wert auf das weiße Gewand und strahlen<strong>de</strong> Aussehen <strong>de</strong>s<br />
Engels/jungen Manns zu legen. Ich vermute, dass ihn dies in beson<strong>de</strong>rer Weise als Boten<br />
Gottes ausweist.<br />
Eine genaue textliche Übereinstimmung fin<strong>de</strong>t sich an <strong>de</strong>r zentralen Stelle <strong>de</strong>r Perikope (Mt<br />
28,5+6 und <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,6). Sie bezeichnen Jesus als und<br />
fügen ein Wort später hinzu.
25<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
I<strong>de</strong>ntisch ist weiterhin die Ankündigung in Vers 7: ☺ <br />
. Auch dies ist eine beson<strong>de</strong>rs wichtige Stelle <strong>de</strong>r Perikope.<br />
In <strong>de</strong>m Teil <strong>de</strong>r Perikope, wo es um die Auferstehung und die Ankündigung für die Jünger<br />
geht (Vers 5-7 bei Mt und Vers 6-7 bei <strong>Mk</strong>), weisen neben <strong>de</strong>n erwähnten wörtlichen<br />
Übereinstimmungen auch größere inhaltliche Parallelen als <strong>de</strong>r restliche Text auf.
3.3 Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>Mk</strong> und Mt<br />
26<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Auffallend sind die vielen Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Evangelien, vor allem in <strong>de</strong>n<br />
Details. Aber es sind nicht nur Einzelheiten und Formulierungen, die verschie<strong>de</strong>n sind,<br />
son<strong>de</strong>rn auch einige inhaltliche Aspekte.<br />
Bei Mt sind es nur noch zwei Frauen, die zum Grab kommen. In diesem Evangelium treten<br />
die einzelnen Personen in <strong>de</strong>n Hintergrund. Die „zweite“ Maria wird nur noch mit <strong>de</strong>m<br />
Vornamen genannt, die ausdrückliche Nennung <strong>de</strong>s Petrus weggelassen. Es war wohl für ihn<br />
nicht sinnvoll, Petrus eine Son<strong>de</strong>rstellung zuzuweisen.<br />
Der Grund, warum die Frauen an diesem Morgen zum Grab kommen, ist nicht (wie bei <strong>Mk</strong>)<br />
die Absicht <strong>de</strong>r Salbung, son<strong>de</strong>rn sie wollen nach <strong>de</strong>m Grab sehen. Was sie dort genau<br />
nachschauen wollten bleibt unklar. Mt scheint weniger Wert auf das Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Menschen<br />
zu legen, son<strong>de</strong>rn mehr auf das wun<strong>de</strong>rbare Wirken Gottes.<br />
Das Matthäusevangelium ist dramatischer geschrieben als das Markusevangelium. Die Er<strong>de</strong><br />
Bebt, als <strong>de</strong>r Engel <strong>de</strong>s Herrn herabkommt und <strong>de</strong>n Stein wegwälzt (Mt 28, 2). Bei <strong>Mk</strong><br />
hingegen ist <strong>de</strong>r Stein bereits weggewälzt und <strong>de</strong>r junge Mann erwartet ruhig sitzend die<br />
Ankunft <strong>de</strong>r Frauen.<br />
Während Mt <strong>de</strong>n Menschen nicht viel Aufmerksamkeit schenkt, beschreibt er <strong>de</strong>n Engel<br />
<strong>de</strong>tailliert. <strong>Mk</strong> nennt einfach nur das weiße Gewand, bei Mt ist es weiß wie Schnee und die<br />
ganze Gestalt leuchtet wie ein Blitz. Die Wächter, die die <strong>Mk</strong> überhaupt nicht erwähnt<br />
wer<strong>de</strong>n, zittern vor Angst und wer<strong>de</strong>n ohnmächtig. So ist <strong>de</strong>r ganze Auftritt <strong>de</strong>s Engels viel<br />
beeindrucken<strong>de</strong>r als bei <strong>Mk</strong>.<br />
Auffallend ist, dass das Grab bei <strong>de</strong>r Ankunft <strong>de</strong>r Frauen noch verschlossen ist und sogar<br />
bewacht wird. So erscheint das Verschwin<strong>de</strong>n Jesu als wahres Wun<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>nn die Möglichkeit,<br />
er sei vielleicht gar nicht tot gewesen und weggegangen, wird ausgeschlossen. Auch ist es<br />
unmöglich, dass <strong>de</strong>r Leichnam gestohlen wur<strong>de</strong>. Vielleicht wollte Mt so auf die Gerüchte<br />
reagieren, die Jünger Jesu hätten dies getan und sich die Auferstehung nur ausgedacht.<br />
Auf je<strong>de</strong>n Fall wird bei Mt die Unterhaltung <strong>de</strong>r Frauen darüber, wer ihnen nun <strong>de</strong>n Stein<br />
wegwälzen könnte, überflüssig, so dass er sie weglässt.<br />
Bei seiner Botschaft an die Jünger fügt Mt in Vers 7 zusätzlich zu <strong>Mk</strong> die Worte<br />
ein. Diese Aussage hat er zwar in
27<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Vers 6 schon einmal getroffen, aber durch die Dopplung wird die hohe Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Auferstehung betont. Sie ist so wichtig, dass sie bei <strong>de</strong>n Worten, die <strong>de</strong>n Jüngern übermittelt<br />
wer<strong>de</strong>n sollen, nicht fehlen dürfen.<br />
Die Dringlichkeit dieser Botschaft betont Mt, in<strong>de</strong>m er die Frauen, im Gegensatz zu <strong>Mk</strong>,<br />
auffor<strong>de</strong>rt, schnell zu <strong>de</strong>n Jüngern zu gehen. Die Nachricht ist so wichtig, dass sie auf <strong>de</strong>m<br />
schnellsten Wege überbracht wer<strong>de</strong>n muss. Ich glaube, Mt hat dies auf die gesamte<br />
Verkündigung bezogen, da er in endzeitlicher Naherwartung gelebt haben dürfte. Die<br />
Botschaft Christi muss <strong>de</strong>shalb für ihn schnell verbreitet wer<strong>de</strong>n, damit sie möglichst viele<br />
erreicht.<br />
Es könnte daher auch die Ermahnung –beson<strong>de</strong>rs an Jesu Anhänger, aber auch an alle an<strong>de</strong>ren<br />
Menschen– mitschwingen, nicht zu zögern, Jesus nachzufolgen und sein e Botschaft zu<br />
verkün<strong>de</strong>n.<br />
Auffallend ist, dass sich im Matthäusevangelium <strong>de</strong>r Engel selbst für seine Botschaft verbürgt<br />
(„Ich habe es euch gesagt“), während <strong>Mk</strong> auf eine Ankündigung Jesu verweist („wie er es<br />
euch gesagt hat“). Da aber (bei Mt) <strong>de</strong>r Engel ein Bote Gottes ist, steht hinter ihm quasi Gott<br />
selbst als Bürge für die überbrachte Botschaft, an <strong>de</strong>r kein Zweifel besteht. Wie bereits oben<br />
erwähnt, stellt Mt das Wirken Gottes in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund seines Evangeliums. Da ist es nur<br />
natürlich, dass er Gott selbst (durch einen Mittle) die Heil bringen<strong>de</strong> Botschaft verkün<strong>de</strong>n<br />
lässt.<br />
Deutliche inhaltliche Unterschie<strong>de</strong> zeigen sich am Schluss <strong>de</strong>r Perikope:<br />
Die Frauen fliehen im Markusevangelium voller Entsetzen vom Grab und sprechen mit<br />
nieman<strong>de</strong>m über das Geschehen. Im Matthäusevangelium hingegen fürchten sich die Frauen<br />
zwar, empfin<strong>de</strong>n jedoch auch große Freu<strong>de</strong>. Diese Gefühle sind an sich wi<strong>de</strong>rsprüchlich, aber<br />
in diesem Fall bil<strong>de</strong>n sie zusammen die natürliche Reaktion auf die Ereignisse. Sie sind so<br />
unbegreiflich und zeugen <strong>von</strong> einer solchen Macht (Gottes), dass man sich fürchten muss.<br />
Gleichzeitig be<strong>de</strong>uten sie die wahrhaft erlösen<strong>de</strong> Gewissheit, dass Jesus nicht im Tod<br />
gefangen bleibt und das Heil in ihm zu uns Menschen gekommen ist. Die empfun<strong>de</strong>ne Furcht<br />
kann sicher auch mit „Ehrfurcht“ in Verbindung gebracht wer<strong>de</strong>n. Bereits im Alten Testament<br />
zeigt sich, dass Furcht die angemessene Reaktion auf die Schau Gottes ist, wie wir u.a. am<br />
Beispiel <strong>de</strong>s Mose sehen können. Die Frauen erkennen die Größe und Macht Gottes. Wen<br />
sollen sie da fürchten, wenn nicht Gott?<br />
Im Gegensatz zu <strong>Mk</strong>, bei <strong>de</strong>m die Frauen in <strong>de</strong>r Furcht verharren, öffnet die große Freu<strong>de</strong> bei<br />
Mt die Frauen, so dass sie zu Überträgern <strong>de</strong>r Botschaft wer<strong>de</strong>n und zu <strong>de</strong>n Jüngern eilen. So
28<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
setzt das Matthäusevangelium <strong>de</strong>n Schlussakzent dieser Perikope bei Freu<strong>de</strong>, Hoffnung und<br />
Aufbruch, während bei <strong>Mk</strong> am En<strong>de</strong> die Stimmung <strong>von</strong> Furcht und Verschlossenheit geprägt<br />
ist.<br />
3.4 Grün<strong>de</strong> für die Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>Mk</strong> und MT<br />
Mt hatte bei <strong>de</strong>r Abfassung seines Evangeliums nach heutigem Kenntnisstand das<br />
Markusevangelium und die Logienquelle Q als schriftliche Vorlagen, zusätzlich griff er auf<br />
mündliche Überlieferungen über Jesus zurück. Man nimmt an, dass er bei seiner Arbeit das<br />
Grundgerüst <strong>de</strong>s Markusevangeliums beibehielt und es mit Material aus Q auffüllte. 34<br />
So erklären sie auch die Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Evangelien. Mt hat die <strong>Mk</strong> -<br />
Fassung ergänzt und überarbeitet.<br />
Für ihn Unwichtiges hat er weggelassen, z.B. die Namensnennungen o<strong>de</strong>r das Gespräch <strong>de</strong>r<br />
Frauen. Dies waren vor allem Einzelheiten, die nicht in Zusammenhang mit Jesus o<strong>de</strong>r Gott<br />
stan<strong>de</strong>n. Mt lenkt <strong>de</strong>n Blick <strong>de</strong>s Lesers stärker auf das Wun<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Auferstehung, er verfolgt<br />
ein theologisches Anliegen. Daher kürzt er seine Vorlage hauptsächlich zu Beginn <strong>de</strong>r<br />
Perikope, während er gegen En<strong>de</strong> immer genauer, z.T. auch dramatischer wird.<br />
An<strong>de</strong>re Details hat er ergänzt, da sie ihm <strong>von</strong> beson<strong>de</strong>rer Be<strong>de</strong>utung schienen, so z.B. vieles<br />
um die Figur <strong>de</strong>s Engels o<strong>de</strong>r im Gespräch mit <strong>de</strong>n Frauen.<br />
Einiges hat Mt im Vergleich zu <strong>Mk</strong> aber auch völlig verän<strong>de</strong>rt. Wie bereits erwähnt gibt er<br />
<strong>de</strong>m Schluss eine völlig neue Wendung. Durch dieses verän<strong>de</strong>rte En<strong>de</strong> erscheint die gesamte<br />
Perikope in einem an<strong>de</strong>ren Licht: Durch Gottes mächtiges, wun<strong>de</strong>rbares Wirken kann <strong>de</strong>r<br />
Mensch voller Hoffnung sein, seine Botschaft verkün<strong>de</strong>n und leben.<br />
Es wird <strong>de</strong>utlich, dass Mt die Arbeit eines Redaktors geleistet hat. Er stellte das Material<br />
zusammen, wählte aus und überarbeitete es.<br />
34 Roloff, Jürgen: Einführung in das neue Testament. Reclam, Stuttgart, 2000, S. <strong>16</strong>4.
4. Zwei Kommentare zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8<br />
29<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Im folgen<strong>de</strong>n Kapitel sollen zwei Kommentare zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 dargestellt und miteinan<strong>de</strong>r<br />
verglichen wer<strong>de</strong>n. Ich habe mich für die Kommentare mit D. Gustav Wohlenberg 35 und<br />
Walter Schmithals 36 entschie<strong>de</strong>n.<br />
Die Erscheinungsjahre dieser Kommentare liegen fast 70 Jahre auseinan<strong>de</strong>r, so dass man<br />
daran auch die Verän<strong>de</strong>rungen bezüglich Herangehensweise, Metho<strong>de</strong>n und Interpretation im<br />
Laufe dieser Zeit aufzeigen kann.<br />
4.1 Der Kommentar <strong>von</strong> D. Gustav Wohlenberg<br />
D. Gustav Wohlenberg betreibt in seinem Kommentar keine Text- o<strong>de</strong>r Übersetzungskritik,<br />
obgleich er seine Belegstellen oft im grch. Original angibt. Im Großen und Ganzen han<strong>de</strong>lt<br />
sich um eine Auslegung <strong>de</strong>r Perikope; seine exegetische Abhandlung geht <strong>de</strong>n Text<br />
systematisch <strong>von</strong> Anfang bis En<strong>de</strong> durch.<br />
Wohlenberg fällt auf, das die ersten bei<strong>de</strong>n Frauen, die in Vers 1 namentlich erwähnt wer<strong>de</strong>n,<br />
nur wenige Worte zuvor in <strong>Mk</strong> 15,47 genannt wer<strong>de</strong>n, was eine unnötige Doppelung ergibt.<br />
Er erklärt dies damit, <strong>de</strong>r Verfasser wolle das kommen<strong>de</strong> Neue durch vollständige<br />
Wie<strong>de</strong>raufnahme <strong>de</strong>s Erzählfa<strong>de</strong>ns kräftig markieren.<br />
Es wird vermutet, <strong>Mk</strong> habe <strong>de</strong>n Besuch <strong>de</strong>r Frauen am Grab erst am Morgen <strong>de</strong>s ersten Tages<br />
<strong>de</strong>r Woche stattfin<strong>de</strong>n lassen und diesen Zeitpunkt betont, weil er Rücksicht auf die bereits<br />
vorhan<strong>de</strong>ne Praxis <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Sonntags nehmen wollte.<br />
Die Aussage, dass <strong>de</strong>r Stein sehr groß gewesen sei, bezieht sich laut Wohlenberg nicht nur auf<br />
die Äußerung <strong>de</strong>r Sorge <strong>de</strong>r Frauen in Vers 3, son<strong>de</strong>rn auch darauf, dass <strong>de</strong>r Stein<br />
weggewälzt, nicht etwa weggenommen o<strong>de</strong>r -geworfen wur<strong>de</strong>, wodurch die Frauen <strong>de</strong>n Mut<br />
fan<strong>de</strong>n, das Grab zu betreten.<br />
35 Wohlenberg, D. Gust av: Das Evangelium <strong>de</strong>s Markus, ausgelegt <strong>von</strong> D. Gustav Wohlenberg. (= Kommentar<br />
zum Neuen Testament, hrsg. <strong>von</strong> D. Dr. Theodor Zahn, Bd. II). A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung Nachf.,<br />
Leipzig, 1. und 2. Auflage, 1910, S. 382-385.<br />
(Im Folgen<strong>de</strong>n als Wohlenberg abgekürzt.)<br />
36 Schmithals, Walter: Das Evangelium nach Markus. Kapitel 9,2-<strong>16</strong>,18. (=Ökumenischer<br />
Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 2/2, hrsg. <strong>von</strong> Erich Gräßer und Karl Kertelge).<br />
Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh; Echter Verlag, Würzburg, 1979, S. 706-717.<br />
(Im Folgen<strong>de</strong>n mit „Schmithals abgekürzt.)
30<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Er warnt jedoch davor, aus <strong>de</strong>r Aussage <strong>von</strong> <strong>de</strong>r beachtlichen Größe <strong>de</strong>s Steins bereits einen<br />
Beweis für die Auferstehung herauslesen zu wollen.<br />
Wohlenberg führt aus, die Worte ... könnten<br />
auch fragend gemeint sein und so die Verwun<strong>de</strong>rung über das Unwissen <strong>de</strong>r Frauen<br />
ausdrücken, da Jesus seine Auferstehung angekündigt hatte. Er verweist dabei auf <strong>Mk</strong> 14,28.<br />
Im letzten Teil seiner Ausführungen wen<strong>de</strong>t sich Wohlenberg <strong>de</strong>m ursprünglichen<br />
Markusschluss (Vers 8) zu. Seiner Meinung nach kann dieser nicht <strong>von</strong> <strong>Mk</strong> als En<strong>de</strong> seines<br />
Evangeliums gedacht wor<strong>de</strong>n sein, da man zu Recht auf <strong>de</strong>n Bericht <strong>von</strong> Auferstehung und<br />
Begegnung mit <strong>de</strong>n Jüngern warte. Außer<strong>de</strong>m sei <strong>de</strong>m Leser klar, dass die Frauen nicht für<br />
immer in Furcht und im Schweigen verharrt sind, son<strong>de</strong>rn sich mit <strong>de</strong>n Jüngern getroffen<br />
haben müssen. Allerdings habe <strong>Mk</strong> <strong>de</strong>n Schluss seines Evangeliums nicht mehr selbst<br />
verfasst.<br />
4.2 Der Kommentar <strong>von</strong> Walter Schmithals<br />
Walter Schmithals setzt seinem Kommentar eine Übersetzung <strong>de</strong>r Periko pe voran, arbeitet<br />
damit jedoch im weiteren Verlauf nicht, wer<strong>de</strong> text- noch übersetzungskritisch.<br />
Zu Beginn seine Ausführung erläutert er motivgeschichtlich <strong>de</strong>n Zusammenhang <strong>von</strong> Kreuz<br />
und Auferstehung Jesu. Sie bil<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n urchristlichen Bekenntnisform eln ein fest gefügtes<br />
Begriffspaar. Selbst wenn nur eines <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Ereignisse genannt wird, wer<strong>de</strong> das an<strong>de</strong>re<br />
mitgedacht und vorausgesetzt, da sie nur in Beziehung aufeinan<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung haben.<br />
Nach Schmithals liegt <strong>de</strong>n Ostererzählungen das urchristliche Bekenntnis zu Grun<strong>de</strong>. Da die<br />
Oster-Botschaft älter als die Osterberichte <strong>de</strong>r Evangelien sei, lieferten die Erzählungen keine<br />
Begründungen <strong>de</strong>s Bekenntnisses, son<strong>de</strong>rn entfalteten und legten es aus. Vielmehr seien<br />
Kreuz und Auferstehung historisch nicht beweisbar (nur <strong>de</strong>r Glaube <strong>de</strong>r Jünger sei es); sie<br />
könnten nur im existentiellen Akt <strong>de</strong>s Glaubens erfahren wer<strong>de</strong>n.<br />
Die alten Bekenntnisse berichten <strong>von</strong> Jesu Auferweckung und Erscheinungen, die mit<br />
Erhöhung verbun<strong>de</strong>n waren. Diese Bekenntnisse beruhen nach Schmithals auf <strong>de</strong>n<br />
Erscheinungen, die Berichte über das leere Grab sind sekundär, wenn auch das jüdische
31<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Denken bei Begräbnis und Auferstehung das leere Grab voraussetzt. Die jüdische Tradition<br />
sei dabei <strong>von</strong> großem Einfluss gewesen.<br />
Er glaubt, dass <strong>Mk</strong> an vielen Stellen auf das <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> vertraute Bekenntnis zurückgreift<br />
–so auch in dieser Perikope– und <strong>de</strong>m Leser neben <strong>de</strong>r erschrecken<strong>de</strong>n Aussage „Er ist nicht<br />
hier“ auch die positive Botschaft <strong>de</strong>utlich wird: Jesus <strong>von</strong> Nazareth, gekreuzigt und<br />
auferweckt. So wer<strong>de</strong> klar, wo Jesus zu fin<strong>de</strong>n ist: „Überall, wo bis heute das christliche<br />
Bekenntnis gesprochen, wo <strong>de</strong>r Glaube <strong>de</strong>r Christenheit bezeugt, wo im Sinne dieses<br />
Bekenntnisses <strong>de</strong>r Auferstan<strong>de</strong>ne verkündigt wird.“ 37<br />
Das Osterereignis sei nicht verstehbar, nicht beweisbar, son<strong>de</strong>rn müsse in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
gelebt wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Verlauf seines Kommentars arbeitet Schmithals literar -, redaktions- und<br />
kompositionskritisch.<br />
Er geht da<strong>von</strong> aus, dass <strong>Mk</strong> sich auf eine Sammlung <strong>von</strong> Erzählungen als Vorlage stützte und<br />
erläutert <strong>de</strong>n redaktionellen Kontext <strong>von</strong> <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,7 als eigene Einfügung <strong>de</strong>s <strong>Mk</strong> in eine<br />
Vorlage.<br />
Als problematisch sieht Schmithals <strong>de</strong>n Abschluss <strong>de</strong>r Perikope in Vers 8b. Vers 8a bil<strong>de</strong><br />
bereits <strong>de</strong>n stilvollen Schluss, <strong>de</strong>r sich zum Leser öffnet und <strong>von</strong> ihm seine Stellungnahm e<br />
einfor<strong>de</strong>rt. Das sich Vers 8b nicht auf Vers 7, son<strong>de</strong>rn auf die gesamte Perikope beziehe, sei<br />
<strong>de</strong>r Einschub <strong>von</strong> Vers 7 an dieser Stelle beson<strong>de</strong>rs ungeschickt. Vers 8b müsse sich auf eine<br />
ursprüngliche Fortsetzung <strong>de</strong>r Ostergeschichte beziehen, die im erhalt enen Text <strong>de</strong>s<br />
Markusevangeliums fehle.<br />
Außer<strong>de</strong>m weist Schmithals auf einige Ungereimtheiten im Text hin, z.B. warum die Frauen<br />
alleine zum Grab gehen, obwohl sie nicht in <strong>de</strong>r Lage sind, <strong>de</strong>n Stein wegzuwälzen, und<br />
erklärt sie mit <strong>de</strong>m Vorwissen <strong>de</strong>s Erzählers (in diesem Fall, dass sich <strong>de</strong>n Frauen bei ihrer<br />
Ankunft am Grab das Problem nicht mehr stellen wird).<br />
Als problematisch sieht Schmithals <strong>de</strong>n Abschluss <strong>de</strong>r Perikope in Vers 8b. Vers 8a bil<strong>de</strong><br />
bereits <strong>de</strong>n stilvollen Schluss, <strong>de</strong>r sich zum Leser öffnet und vo n ihm seine Stellungnahme<br />
einfor<strong>de</strong>rt.<br />
Immer wie<strong>de</strong>r kommt Schmithals in seinen Ausführungen auf das Motiv <strong>de</strong>s Kreuzes zurück<br />
und <strong>de</strong>utet es theologisch aus. Die Frauen im Markusevangelium haben es fälschlicherweise<br />
als das En<strong>de</strong> gesehen, ihre Einstellung is t pragmatisch. Schmithals weist jedoch darauf hin,<br />
37 Schmithals, S. 712.
32<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
dass das Kreuz Jesu durch <strong>de</strong>ssen eschatologisches Tun <strong>de</strong>n eschatologischen Rang<br />
bekommen hat, <strong>de</strong>n Jes 53 bereits anzeigt. Sinnbildlich für das Heilbringen<strong>de</strong> dieses Kreuzes<br />
stän<strong>de</strong>n die Frauen im Licht <strong>de</strong>r aufgehen<strong>de</strong>n Sonne – und durch ihre Unwissenheit zugleich<br />
in tiefer Finsternis.<br />
Am En<strong>de</strong> seiner Ausführungen wen<strong>de</strong>t sich Schmithals <strong>de</strong>m Markusschluss zu. Er hält Vers 8<br />
für <strong>de</strong>n ursprünglichen Schluss, da <strong>Mk</strong> in 14,28 und <strong>16</strong>,7 selbst auf das Fehlen <strong>de</strong>r<br />
Erscheinungsberichte reflektiere; sie seien <strong>de</strong>r Ersatz für das Nichterzählte. Er glaubt, <strong>Mk</strong><br />
habe die fehlen<strong>de</strong>n Berichte zwar in seiner Vorlage gefun<strong>de</strong>n, aber aus theologischen bzw.<br />
redaktionellen Grün<strong>de</strong>n gestrichen.<br />
4.3 Vergleich <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Kommentare<br />
Der Kommentar Wohlenbergs zu <strong>Mk</strong> <strong>16</strong>,1-8 ist wesentlich kürzer als <strong>de</strong>r <strong>von</strong> W. Schmithals,<br />
da sich Schmithals mehreren Themengebieten zuwen<strong>de</strong>t.<br />
Wohlenberg betreibt keinerlei Motiv - o<strong>de</strong>r Literarkritik und beschäftigt sich nicht mit <strong>de</strong>r<br />
redaktionellen Arbeit <strong>de</strong>s Mar kus. Er geht nur auf einzelne Formulierungen <strong>de</strong>r Perikope ein,<br />
bleibt dabei eng am Text und ein Teil seiner Überlegungen sind für mich nicht beson<strong>de</strong>rs<br />
einleuchtend, z.B. seine Überlegungen zum Markusschluss. Ich vermisse außer<strong>de</strong>m eine<br />
gründliche theologische Auslegung.<br />
Insgesamt gesehen bleibt <strong>de</strong>r Kommentar nur an <strong>de</strong>r Oberfläche und ich habe ihn ohne<br />
Verständnisgewinn für die Perikope gelesen.<br />
Schmithals hingegen beleuchtet wesentlich mehr Aspekte als Wohlenberg und macht die<br />
Arbeit <strong>de</strong>s Markus <strong>de</strong>utlich. Man gewinnt eine gute Einsicht in die Entstehung <strong>de</strong>s Textes und<br />
seine Aussageabsichten.<br />
Schmithals <strong>de</strong>utet <strong>de</strong>n Text gründlich aus und seine theologischen Ausführungen gehen in die<br />
Tiefe. Dadurch wird <strong>de</strong>r Kommentar zu einer Bereicherung beim Studium <strong>de</strong>s Text es. Für <strong>de</strong>n<br />
Gläubigen wird <strong>de</strong>r Markustext greifbar und <strong>de</strong>r Bezug zum Gemein<strong>de</strong>leben aufgezeigt.<br />
Dadurch eignet sich <strong>de</strong>r Kommentar auch für die Predigtvorbereitung, da er viele Anregungen<br />
bietet.
33<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Alles in allem halte ich <strong>de</strong>n Kommentar für eine gründliche, gewinnbringen<strong>de</strong> und<br />
ausgewogene Arbeit.<br />
5. Literaturverzeichnis<br />
a) Textausgaben / Übersetzungen :<br />
Nestle-Aland: Das Neue Testament. Griechisch und Deutsch.<br />
Griechischer Text: 27. Auflage <strong>de</strong>s Novum Testamentum Graece in <strong>de</strong>r Nachfolge <strong>von</strong><br />
Eberhard und Erwin Nestle gemeinsam verantwortet <strong>von</strong> Barbara und Kurt Aland, Johannes<br />
Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger.<br />
Deutsche Texte: Revidierte Fassung <strong>de</strong>r Lutherbibel <strong>von</strong> 1984 und Einheitsübersetzung <strong>de</strong>r<br />
Heiligen Schrift 1979.<br />
Hrsg. im Institut für Neutestamentliche Textforschung Münster / Westfalen <strong>von</strong> B. Aland und<br />
K. Aland, 3. Auflage, 2000.<br />
Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung. Hrsg. im Auftrag <strong>de</strong>r Bischöfe<br />
Deutschlands, Österreichs, <strong>de</strong>r Schweiz, <strong>de</strong>s Bischofs <strong>von</strong> Luxemburg, <strong>de</strong>s Bischofs <strong>von</strong><br />
Lüttich und <strong>de</strong>s Bischofs <strong>von</strong> Brozen-Brixen. © 1980 Katholische Bibelanstalt GmbH,<br />
Stuttgart. Her<strong>de</strong>r Verlag, Freiburg im Breisgau, 1991.<br />
Münchener Neues Testament. Studienübersetzung, erarb. vom Collegium Biblicum München<br />
e.V., hrsg. <strong>von</strong> Josef Hainz. Patmos Verlag, Düsseldorf, 1. Auflage, 1988.<br />
Peisker, Carl Heinz: Evangelien-Synopse <strong>de</strong>r Einheitsübersetzung. Oncken Verlag, Wuppertal<br />
und Kassel, 1. Auflage, 1983.<br />
b) Wörterbücher:<br />
Kassühlke, Robert: Kleines Wörterbuch zum Neuen Testament. Griechisch – Deutsch.<br />
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, dritte, verbesserte Auflage, 2001.
34<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Preuschen, Erwin: Griechisch-<strong>de</strong>utsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament. Walter<br />
<strong>de</strong> Gruyter, Berlin, 6., verbesserte Auflage, 1976.<br />
c) Sekundärliteratur:<br />
Roloff, Jürgen: Einführung in das neue Testament. Reclam, Stuttgart, 2000.<br />
Schmithals, Walter: Das Evangelium nach Markus. Kapitel 9,2-<strong>16</strong>,18. (=Ökumenischer<br />
Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 2/2, hrsg. <strong>von</strong> Erich Gräßer und Karl<br />
Kertelge). Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh; Echter Verlag, Würzburg, 1979.<br />
Whittaker; Molly u.a.: Einführung in die griechische Sprache <strong>de</strong>s Neuen Testaments.<br />
Grammatik und Übungsbuch. IANUA LINGUA GRAECE C. Van<strong>de</strong>nhoeck & Ruprecht,<br />
Göttingen, 7. durchgesehene Auflage, 2000.<br />
Wohlenberg, D. Gustav: Das Evangelium <strong>de</strong>s Markus, ausgelegt <strong>von</strong> D. Gustav Wohlenberg.<br />
(= Kommentar zum Neuen Testament, hrsg. <strong>von</strong> D. Dr. Theodor Zahn, Bd. II). A.<br />
Deichert’sche Verlagsbuchhandlung Nachf., Leipzig, 1. und 2. Auflage, 1910 .
Erklärung:<br />
35<br />
mehr Skripte und Mitschriften gibt's auf www.<strong>vaticarsten</strong>.<strong>de</strong>...<br />
Hiermit versichere ich, die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit eigenständig und ohne die Verwendung<br />
an<strong>de</strong>rer als <strong>de</strong>r angegebenen Hilfsmittel verfasst zu haben.<br />
Thalheim, 10.6.2003