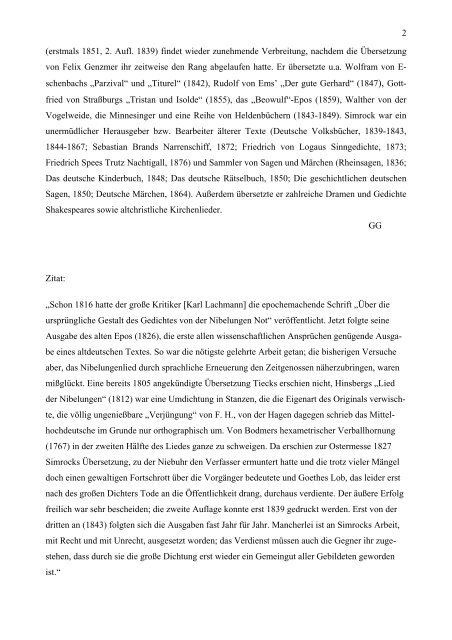Karl Simrock - Nibelungenrezeption.de
Karl Simrock - Nibelungenrezeption.de
Karl Simrock - Nibelungenrezeption.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(erstmals 1851, 2. Aufl. 1839) fin<strong>de</strong>t wie<strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong> Verbreitung, nach<strong>de</strong>m die Übersetzung<br />
von Felix Genzmer ihr zeitweise <strong>de</strong>n Rang abgelaufen hatte. Er übersetzte u.a. Wolfram von E-<br />
schenbachs „Parzival“ und „Titurel“ (1842), Rudolf von Ems’ „Der gute Gerhard“ (1847), Gott-<br />
fried von Straßburgs „Tristan und Isol<strong>de</strong>“ (1855), das „Beowulf“-Epos (1859), Walther von <strong>de</strong>r<br />
Vogelwei<strong>de</strong>, die Minnesinger und eine Reihe von Hel<strong>de</strong>nbüchern (1843-1849). <strong>Simrock</strong> war ein<br />
unermüdlicher Herausgeber bzw. Bearbeiter älterer Texte (Deutsche Volksbücher, 1839-1843,<br />
1844-1867; Sebastian Brands Narrenschiff, 1872; Friedrich von Logaus Sinngedichte, 1873;<br />
Friedrich Spees Trutz Nachtigall, 1876) und Sammler von Sagen und Märchen (Rheinsagen, 1836;<br />
Das <strong>de</strong>utsche Kin<strong>de</strong>rbuch, 1848; Das <strong>de</strong>utsche Rätselbuch, 1850; Die geschichtlichen <strong>de</strong>utschen<br />
Sagen, 1850; Deutsche Märchen, 1864). Außer<strong>de</strong>m übersetzte er zahlreiche Dramen und Gedichte<br />
Shakespeares sowie altchristliche Kirchenlie<strong>de</strong>r.<br />
Zitat:<br />
„Schon 1816 hatte <strong>de</strong>r große Kritiker [<strong>Karl</strong> Lachmann] die epochemachen<strong>de</strong> Schrift „Über die<br />
ursprüngliche Gestalt <strong>de</strong>s Gedichtes von <strong>de</strong>r Nibelungen Not“ veröffentlicht. Jetzt folgte seine<br />
Ausgabe <strong>de</strong>s alten Epos (1826), die erste allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen<strong>de</strong> Ausgabe<br />
eines alt<strong>de</strong>utschen Textes. So war die nötigste gelehrte Arbeit getan; die bisherigen Versuche<br />
aber, das Nibelungenlied durch sprachliche Erneuerung <strong>de</strong>n Zeitgenossen näherzubringen, waren<br />
mißglückt. Eine bereits 1805 angekündigte Übersetzung Tiecks erschien nicht, Hinsbergs „Lied<br />
<strong>de</strong>r Nibelungen“ (1812) war eine Umdichtung in Stanzen, die die Eigenart <strong>de</strong>s Originals verwischte,<br />
die völlig ungenießbare „Verjüngung“ von F. H., von <strong>de</strong>r Hagen dagegen schrieb das Mittelhoch<strong>de</strong>utsche<br />
im Grun<strong>de</strong> nur orthographisch um. Von Bodmers hexametrischer Verballhornung<br />
(1767) in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s Lie<strong>de</strong>s ganze zu schweigen. Da erschien zur Ostermesse 1827<br />
<strong>Simrock</strong>s Übersetzung, zu <strong>de</strong>r Niebuhr <strong>de</strong>n Verfasser ermuntert hatte und die trotz vieler Mängel<br />
doch einen gewaltigen Fortschrott über die Vorgänger be<strong>de</strong>utete und Goethes Lob, das lei<strong>de</strong>r erst<br />
nach <strong>de</strong>s großen Dichters To<strong>de</strong> an die Öffentlichkeit drang, durchaus verdiente. Der äußere Erfolg<br />
freilich war sehr beschei<strong>de</strong>n; die zweite Auflage konnte erst 1839 gedruckt wer<strong>de</strong>n. Erst von <strong>de</strong>r<br />
dritten an (1843) folgten sich die Ausgaben fast Jahr für Jahr. Mancherlei ist an <strong>Simrock</strong>s Arbeit,<br />
mit Recht und mit Unrecht, ausgesetzt wor<strong>de</strong>n; das Verdienst müssen auch die Gegner ihr zugestehen,<br />
dass durch sie die große Dichtung erst wie<strong>de</strong>r ein Gemeingut aller Gebil<strong>de</strong>ten gewor<strong>de</strong>n<br />
ist.“<br />
GG<br />
2