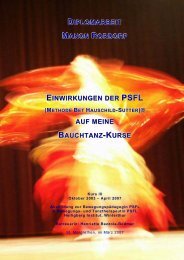Ingrid Essig, Ruth Fässler, Katrin Flury - Heiligberg Institut
Ingrid Essig, Ruth Fässler, Katrin Flury - Heiligberg Institut
Ingrid Essig, Ruth Fässler, Katrin Flury - Heiligberg Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das starke Geschlecht.<br />
Wieso sind in den Grundlagenstunden PSFL für Laien<br />
die Männer in der klaren Minderheit?<br />
Diplomarbeit von<br />
<strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong>, <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong> und <strong>Katrin</strong> Fluri<br />
Kurs 3<br />
<strong>Heiligberg</strong> <strong>Institut</strong><br />
Bewegungs-/Tanztherapie PSFL (Methode Bet Hauschild-Sutter) ®<br />
Frühjahr 2007
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Vorwort Seite 1<br />
2 Fragestellungen 3<br />
3 Vorgehensweise/Material 4<br />
4 Gibt es ein typisch männliches Verhalten? 6<br />
5 Die Probanden / Arbeitsberichte 9<br />
5.1 Proband S.F. / Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri 9<br />
5.1.1 Voraussetzungen..........................................................................9<br />
5.1.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)..................................10<br />
5.1.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri................................11<br />
5.1.4 Verlauf aus Sicht des Probanden S.F..............................................14<br />
5.1.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006).............................19<br />
5.1.6 Vergleich zwischen Sicht Proband S.F. und Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri... 21<br />
5.1.7 Fazit......................................................................................... 24<br />
5.2 Proband O.F. / Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong> 25<br />
5.2.1 Voraussetzungen........................................................................25<br />
5.2.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)..................................25<br />
5.2.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong>.............................. 27<br />
5.2.4 Verlauf aus Sicht des Probanden O.F..............................................30<br />
5.2.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006).............................34<br />
5.2.6 Vergleich zwischen Sicht Proband O.F. und Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong>..36<br />
5.2.7 Fazit......................................................................................... 37<br />
5.3 Proband U.H. / Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong> 38<br />
5.1.1 Voraussetzungen........................................................................38<br />
5.1.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)................................. 38<br />
5.1.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong>.............................. 41<br />
5.1.4 Verlauf aus Sicht des Probanden U.H............................................ 44<br />
5.1.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006).............................50<br />
5.1.6 Vergleich zwischen Sicht Proband U.H. und Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong>..52<br />
5.1.7 Fazit 54<br />
6 Vergleich der drei Probanden 55<br />
7 Auswertung der Umfrage, Beantwortung der Teilfragestellungen 57<br />
8 Beantwortung der Hauptfragestellung – Fazit 63<br />
9 Quellenangaben 64<br />
Herzlichen Dank 65<br />
Anhang 66–98
1 Vorwort<br />
Männer – das starke Geschlecht. Frauen – das schwache Geschlecht. Noch immer ist diese<br />
Einstellung gegenüber den Geschlechtern in vielen Bereichen unseres Alltagslebens<br />
spürbar und sie beeinflusst unser Denken und Handeln massgeblich. «Stark» und<br />
«schwach» beschreiben nebst anderem auch ein Körperkonzept. Körperliche Macht, körperliche<br />
Überlegenheit war während Jahrtausenden eine der wichtigsten Voraussetzungen<br />
fürs Überleben. Aus der Geschichte wissen wir, dass zum Beispiel in der patriarchalen Welt<br />
der alten Griechen wie auch bei den Römern Krieg (gegen Völker) und Macht (über Völker)<br />
im Zentrum des Denkens standen. Für die Frauen aber stand viel mehr das persönliche<br />
Überleben im Vordergrund; sie sicherten das Fortbestehen des Volkes, waren aber<br />
durch Schwangerschaft und Geburt einem hohen Risiko ausgesetzt.<br />
(Körperliche) Stärke wird auch heute noch mit einem entsprechend (männlichen) positiven<br />
Bild verbunden. Schwäche hingegen wird eigentlich immer als negative Eigenschaft<br />
gesehen, sei sie nun körperlicher oder anderer Art. Die Verbindung von «schwach» und<br />
«weiblich» hat die bekannten Folgen für unsere Gesellschaft gebracht: die grundsätzliche<br />
Abwertung sogenannt weiblicher Eigenschaften, was unseres Erachtens für beide<br />
Geschlechter nachteilig ist.<br />
Heute steht für die Männer bei der Bewältigung des Alltags nicht mehr die körperliche<br />
Stärke und Überlegenheit im Vordergrund. Wo heute noch Krafteinsatz und Kampfgeist<br />
gefragt sind, ist bei «härteren» Sportarten. Die Männer spielen Fussball, Eishockey, boxen<br />
im Ring, laufen Marathon, mühen sich im Fitnesszentrum an den Kraftgeräten ab … Frauen<br />
hingegen machen Gymnastik, Tanzen und gehen walken. Geht es um «härtere» sportliche<br />
Betätigung, winken die Frauen schneller ab als die Männer. Gerade umgekehrt ist es,<br />
wenn es um Bewegungserfahrung auf sanftere Weise geht. Pauschal ausgedrückt: Männer<br />
und Frauen haben offensichtlich einfach andere Interessensschwerpunkte, seien die nun<br />
durch die Natur gegeben oder von der Gesellschaft anerzogen.<br />
So erstaunt es wenig, dass es praktisch «nur» Bewegungs- und TanztherapeutINNEN gibt.<br />
Und auch in den ausgeschriebenen Laienkursen nehmen fast ausschliesslich «nur» Frauen<br />
teil.<br />
Die PSFL (Methode Bet Hauschild-Sutter) ® stellt unseres Erachtens eine vorzügliche Möglichkeit<br />
dar, Bewegung auf etwas sanftere, aber nicht minder intensive Art kennen zu lernen;<br />
sie ist sozusagen die ideale Kombination von körperlicher (Hoch-)Leistung und Schulung<br />
des Bewegungs-/Körperbewusstseins. In unserer Diplomarbeit beschränken wir uns<br />
auf die Grundlagen PSFL, gehen also nicht auf das Training PSFL ein. Grundlagen auch in<br />
dem Sinne, als dass wir die Basis der PSFL als Ausgangssituation nehmen wollen. Die<br />
Grundlagen lassen sich gegebenenfalls stufenlos nach oben angleichen – bis zum Training<br />
PSFL –, sodass auch jemand, der grösseren körperlichen Anforderungen gewachsen ist,<br />
auf seine Rechnung kommt. Im Laufe der Diplomarbeit wird sich herausstellen, welchen<br />
Anforderungen sich jeder einzelne Proband stellen möchte und kann.<br />
Wir wollen im Rahmen dieser Diplomarbeit den Fragen nachgehen, wieso Männer in den<br />
angebotenen Laienkursen in der klaren Minderheit sind. Ist die PSFL (Methode Bet Hauschild-Sutter)<br />
® einfach mehr auf den weiblichen Körper (und auf die Frauen ganz allge-<br />
1 Vorwort | Seite 1
mein), auf dessen Voraussetzungen und Bedürfnisse abgestimmt? Oder liegt es an der Art,<br />
wie die Methode vermittelt wird? Fällt es Männern generell schwer, sich auf Bewegungsabläufe<br />
einzulassen, wenn ihnen deren Sinn nicht unmittelbar aufgezeigt wird? Oder sind<br />
es ganz einfach grundsätzliche Vorurteile gegenüber sanften Bewegungsformen?<br />
49 Prozent der Menschen sind Männer; das heisst, die PSFL-Methode findet bei 49 Prozent<br />
der Bevölkerung entschieden zu wenig Anklang. Soll die PSFL sich mehr verbreiten, eine<br />
grössere «Anhängerschaft» finden (was wir als angehende Fachfrauen als unsere Aufgabe<br />
sehen), so betrachten wir es als unerlässlich, dass auch der männliche Bevölkerungsteil<br />
sich angesprochen fühlt. Aber wie muss sich die PSFL präsentieren, damit sie Anklang findet<br />
bei den Männern? Diese Fragestellung enthält unzählige Aspekte, und mit diesen wollen<br />
wir uns in unserer Diplomarbeit intensiv und so umfassend wie möglich auseinandersetzen.<br />
1 Vorwort | Seite 2
2 Fragestellungen<br />
a) Hauptfragestellung<br />
Wieso sind in den Grundlagenstunden PSFL für Laien die Männer in<br />
der klaren Minderheit?<br />
b) Teilfragestellungen<br />
I) Inwiefern sind die Methode selbst und die Art und Weise, wie die Methode vermittelt<br />
wird, für Männer geeignet?<br />
II) Falls die Methode geeignet ist, wieso sind die Männer trotzdem eindeutig in der Minderzahl?<br />
III) Welche Art von Gruppen wären besonders geeignet für Männer (nur Männer, Männer/Frauen<br />
gemischt, Einzelstunden)?<br />
IV) Ist es ein Hindernis für Männer, wenn Frauen anleiten?<br />
V) Beruht die kleine Anzahl Männer, die sich auf die Grundlagen PSFL einlassen, auf<br />
grundsätzlichen Vorurteilen gegenüber sanften Bewegungsformen (Gymnastik,<br />
Yoga, Tanz usw. ist Frauensache, o.ä.), oder haben Männer wirklich keine Freude<br />
an dieser Art von Bewegung?<br />
VI) Inwiefern könnte die Methode – falls nötig – den Bedürfnissen der Männer angepasst<br />
werden?<br />
VII) Was müsste getan werden, damit die Grundlagen PSFL auch bei den Männer Fuss<br />
fassen und damit ein grosser Markt erschlossen werden kann?<br />
2 Fragestellungen | Seite 3
3 Vorgehensweise / Material<br />
3.1 Laienstunden mit Probanden<br />
3.1.1 Allgemein<br />
Um unserer Fragestellung nachzugehen, erteilte jede Diplomandin in Einzellektionen<br />
einem Mann themenorientiert in dem Zeitraum eines halben Jahres (im Durchschnitt 1x<br />
wöchentlich) 20 Grundlagenstunden PSFL von je 60 Minuten Länge.<br />
Nach jeder Stunde liessen wir den «Fragebogen klein» vom Probanden ausfüllen, nach<br />
jeder fünften Stunde (nach Abschluss eines Themenblocks, siehe unten) zusätzlich den<br />
«Fragebogen gross». Daneben notierten wir Diplomandinnen uns schwerpunktmässig<br />
eigene Beobachtungen während und nach der Stunde auf dem «Beobachtungsblatt für<br />
Diplomandin». Diese Fragebogen bzw. das Beobachtungsblatt haben wir speziell für die<br />
Diplomarbeit erstellt (siehe Anhang).<br />
Am Anfang und am Ende des genannten Zeitraumes füllte jede Diplomandin für ihren Probanden<br />
das Blatt «Bestandesaufnahme» (Fragebogen für Lösungsarbeit und Einzelstunden<br />
PSFL, C. Pittini, <strong>Heiligberg</strong> <strong>Institut</strong>; siehe Anhang) aus. Dieses wurde mit Fotos<br />
unterlegt. Die Bestandesaufnahmen und die Fotos dienten dazu, eventuelle physische Veränderungen<br />
bei den Probanden festzuhalten.<br />
Unsere Vorgehensweise gestaltete sich anfangs so, dass wir den Probanden prinzipiell<br />
nichts darüber mitteilten, wieso wir etwas (nicht) taten. Die Probanden sollten sich ohne<br />
fundierte Kenntnisse über die Methode auf die Arbeit einlassen. Damit wollten wir eine<br />
möglichst authentische Ausgangslage schaffen. Im Alltag sieht die Situation ja auch oft so<br />
aus, dass man sich für einen Kurs anmeldet, um etwas Neues kennen zu lernen, von dem<br />
man noch keine grossen Vorkenntnisse hat. Wir Diplomandinnen wussten am Anfang<br />
unserer Ausbildung zur Bewegungspädagogin/Tanztherapeutin auch nicht, was für Erfahrungen<br />
wir machen würden, wenn wir uns so intensiv mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen.<br />
Es ging bei unseren Probanden also auch darum, dass sie sich einfach auf<br />
etwas Neues einlassen, mit möglichst wenig «Vorurteilen». Im Rahmen der Diplomarbeit<br />
galt es dann, herauszufinden, inwiefern sich diese Vorgehensweise für die Probanden eignet<br />
und was allenfalls verändert werden müsste, damit die PSFL bei den Männern generell<br />
mehr Anklang findet.<br />
3.1.2 Stundenaufbau<br />
Grundsätzlich gestaltete jede Diplomandin ihre PSFL-Stunden selbstständig. Wir legten<br />
jedoch gemeinsam die Themenblöcke fest und von diesen jeweils die erste Stunde.<br />
3 Vorgehensweise/Material | Seite 4
3.1.3 Die vier Schwerpunkthemen<br />
– Kreisaufbau mit Vorbereitungen; alles in Wandlage (5 Stunden)<br />
– Kraftaufbau: Rumpf, Rücken, Bauch, Seitendehnungen; Wandlage und/oder<br />
frei im Raum (5 Stunden)<br />
– Schultergürtel, Arme, Nacken, Brustbein; Wandlage und/oder frei im Raum<br />
(5 Stunden)<br />
– Beine, Becken, Hüfte, Gesäss, Füsse (5 Stunden)<br />
plus allgemeine Koordination und Rhythmusgefühl (im Speziellen Diagonale und<br />
sonstige Grundlagen-PSFL-spezifische Bewegungsabläufe sowie Einsatz von Musik)<br />
Während der Diplomarbeit tauschten wir regelmässig unsere Erfahrungen untereinander<br />
aus. Besonders interessierte uns dabei, ob es bei den Probanden Veränderungen im Körperbild,<br />
in der Haltung und der Beweglichkeit sowie in der Fortbewegung geben würde,<br />
aber auch in Bezug auf die Körperwahrnehmung, den Ausdruck, die Emotion, das Wohlbefinden<br />
(z.B. Stressabbau, Schmerzverminderung etc.), das Selbstbewusstsein sowie ganz<br />
allgemein in Bezug auf die Lebensqualität.<br />
Anhand dieser Daten und der Fragebogen/Beobachtungsblätter gaben wir Antwort auf die<br />
unter 2a und 2b gestellten Fragen. Wir besprachen die ausgefüllten Fragebogen miteinander,<br />
zogen Vergleiche und fassten die Daten zusammen. Wir verglichen auch die drei Probanden<br />
untereinander, unter Berücksichtigung ihres Alters, ihrer körperlichen Voraussetzungen<br />
und ihrer Bewegungserfahrungen. Wo gab es Parallelen, wo gab es grosse Unterschiede<br />
und warum?<br />
3.2 Umfrage<br />
Wir stellten einen Fragebogen (siehe Anhang) zusammen, den wir an ungefähr 60 Männer<br />
verschickten. Erstaunlicherweise kamen 74 ausgefüllte Fragebogen zurück, wobei die Fragebogen<br />
auch durch Ehefrauen/Partnerinnen weitergeleitet und «gestreut» wurden. Wir<br />
wählten unsere Zielgruppe so aus, dass Männer in verschiedenen Alterskategorien und mit<br />
verschiedenen physischen/psychischen Voraussetzungen an der Umfrage teilnahmen, um<br />
einen möglichst repräsentativen Teil der männlichen Bevölkerung zu erfassen. Unsere drei<br />
Probanden stellen ja sozusagen nur die Spitze des Eisberges dar. Die Umfrage ist als<br />
erweiterndes Element der Diplomarbeit zu betrachten. Mit ihr wollten wir herausfinden,<br />
wie Männer im Allgemeinen zu sanften Bewegungsformen stehen, welche Bedürfnisse auf<br />
Bewegungsebene bestehen etc. Darüber hinaus ging es uns darum, herauszufinden, wie<br />
Grundlagenstunden PSFL gestaltet werden müssten, so dass sie bei Männern Anklang fänden.<br />
3 Vorgehensweise/Material | Seite 5
4 Gibt es ein typisch männliches Verhalten?<br />
Sokrates bleibt Sokrates, eine Fähigkeit,<br />
welche die wenigsten Männer besitzen.<br />
Zuerst sind sie Kinder, dann werden sie Männer,<br />
und wenn sie Männer geworden sind,<br />
werden sie Politiker, Feldherren, Dichter,<br />
Helden oder sonst etwas, nur nicht sich selber.<br />
Friedrich Dürrenmatt<br />
Die Menschheit ging davon aus, dass sich die Geschlechter grundsätzlich unterscheiden.<br />
Doch im letzten Jahrhundert entstanden verschiedene Bewegungen, die eine Gleichheit<br />
der Geschlechter anstreben wollten: zum Beispiel Feminismus, 68er-Bewegung und Kommunismus.<br />
Sie gingen davon aus, dass die geschlechtstypischen Verhaltensunterschiede<br />
anerzogen und das Produkt einer jahrhundertelangen Sozialisation seien.<br />
Zweifel an der Richtigkeit dieser Annahme kamen aus den Erfahrungen, die in den Kinderläden<br />
(selbstverwaltete, alternative Kindergärten) der 68er-Zeit gesammelt wurden, und<br />
aus der israelischen Kibbuzbewegung. An beiden Orten sollte das traditionelle Rollenverhalten<br />
von Jungen und Mädchen aufgebrochen werden. Sie boten ihnen eine repressionsfreie,<br />
geschlechtsneutrale Erziehung bzw. wollten eine absolute Gleichberechtigung zwischen<br />
den Geschlechtern schaffen. Die Resultate der Kinderläden und der Kibbuze glichen<br />
sich sehr. Erstaunlicherweise war das Verhalten der Kinder weit stärker geschlechtstypisch<br />
ausgeprägt und unterlag viel mehr den gängigen Klischees als zum Beispiel in traditionellen<br />
Kindergärten.<br />
Das Verhalten, die Wahrnehmung und das Denken der Knaben unterscheiden sich bereits<br />
im frühkindlichen Alter von jenem der Mädchen. Sie sind vom ersten Lebtag an in der<br />
Regel impulsiver, schwerer zu beruhigen und rascher emotional aufgedreht. Dies erfordert<br />
von den Bezugspersonen, den Knaben mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Sie erhalten<br />
dadurch im Durchschnitt mehr Reizzufuhr. Im Alter von etwa drei Jahren suchen sich die<br />
Kinder gleichgeschlechtliche Spielkameraden.<br />
Die Eigenheiten der Jungen begründen das Wesen des Mannes und lassen sich nicht als<br />
Resultat einer falschen Erziehung, von Rollenerwartungen oder gesellschaftlichen Stereotypien<br />
wegerklären. Jungen sind fasziniert von Symbolen der Zivilisation wie Autos,<br />
Armee, Polizei, Höhlen, Computer. Spontane kindliche Zeichnungen sind Ausdruck ihrer<br />
inneren und äusseren Welt. Buben drücken in ihren Zeichnungen deutlich mehr die Faszination<br />
für eine äussere Welt aus als Mädchen.<br />
Die Idealisierung des Mythos «Held», dem die Männer nachstreben, ist unerreichbar. Die<br />
Jungen kennen die Gefühle der Unsicherheit, Angst, Verletztheit, Hilflosigkeit. Sie kennen<br />
aber kaum Männer in ihrem sozialen Umfeld, die ihnen diese Gefühle zeigen und vorleben.<br />
In ihrer männlichen Idealisierung erachten sie eine Panzerung des Gefühlsleben und des<br />
Körpers als notwendig.<br />
4 Gibt es ein typisch männliches Verhalten? | Seite 6
Die heutige Psychologie fordert ein Umdenken der Männer: Sie müssen lernen, ihre Gefühle<br />
zu zeigen, das Persönliche wichtiger zu nehmen, auf Macht zu verzichten, über sich zu<br />
reden, sich ihrer Gewaltneigung bewusst zu werden und weniger rational zu denken.<br />
Diese Forderung entspricht der Seele des Mannes nur teilweise, schreibt Allan Guggenbühl<br />
in seinem Buch «Männer, Mythen, Mächte» (kursiv= zusammenfassend):<br />
In der Seele des Menschen sind zwei Haupteinstellungen erkennbar – die psychologische<br />
und die mythologische. Der Mensch lebt in diesem Spannungsfeld beider Kräfte. Einerseits<br />
der Psyche, die als autonome Kraft unsere Befindlichkeit, unsere Wünsche und Fantasien<br />
von innen her beeinflusst, andererseits der Mythen, die die Aussenwelt regieren und uns<br />
in ihren Bann ziehen. Frauen orientieren sich an der Psychologie, während bei den Männern<br />
die Mythologie im Zentrum steht.<br />
Mythen sind numinose, archetypische Erklärungsgeschichten – mächtige seelische Wirklichkeiten,<br />
an denen wir uns orientieren, teilhaben können und die uns ein Gefühl von Sinn<br />
vermitteln. C. G. Jung mit seiner Lehre der Archetypen des kollektiven Unbewussten<br />
drückt aus, dass sich hinter scheinbar individuellen Verhaltensweisen oft kollektive Muster<br />
verbergen. Es ist eine unpersönliche, kollektive Tiefenschicht im Menschen, welche als<br />
Grundmuster der Seele unser Verhalten und Erleben steuert.<br />
Männliche Eigenschaften, die Durst nach Imperien, Eroberungen, Macht und Positionen<br />
wecken, haben auch gute Seiten. Sie bezeichnen eine seelische Einstellung. Aufgrund dieser<br />
Eigenschaften partizipieren Männer an den aktuellen Themen ihres weiteren Umfelds.<br />
Sie stimmen sich über Aktualitäten in die kollektive seelische Situation ihrer Zeit ein. Die<br />
gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen regen sie an und wecken Emotionen.<br />
Themen wie Politik, Sport und Technik stehen im Zentrum. Aus der Sicht der Psychologie<br />
wird auf unverfängliche Themen ausgewichen, aus mythologischer Sicht schimmert das<br />
Interesse an Mythen durch.<br />
Guggenbühl ist überzeugt, dass die Männer ihrer Mythen bewusst werden sollten. Somit<br />
können die Kräfte, die in der Seele wirken, ausgelebt werden.<br />
Der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau basiert stark auf deren Hormonhaushalt.<br />
Viele männliche Verhaltensweisen muss man im Zusammenhang mit hormonellenbiologischen<br />
Unterschieden sehen. Allgemein fördert ein hoher Testosteronspiegel dominante<br />
und aggressive Verhaltensweisen.<br />
Ebenso kann eine Überproduktion in der Nebennierenrinde beim weiblichen Geschlecht<br />
eine Vermännlichung (Imponiergehabe, Kampf, Begattungslust) bewirken.<br />
Neurologische Forschungen zeigen, dass das Gehirn bei Männern und Frauen verschieden<br />
funktioniert. Die Gehirne der Männer sind grösser, die der Frauen kleiner, aber stärker verkabelt.<br />
All das lässt vermuten, dass im weiblichen Gehirn die beiden Hemisphären stärker<br />
miteinander agieren. Das heisst, dass Frauen eine symmetrischere Hirnorganisation besitzen,<br />
ein vernetzteres Denken haben als Männer. Bei Männern weisen also die linke und<br />
rechte Hirnhälfte grössere Unterschiede auf als bei Frauen. Ein klarer Vorteil der Asymmetrie<br />
ist eine schnellere Verarbeitung der Informationen.<br />
Selbst bei den traditionellen Überlegenheiten – Männer beim räumlichen Vorstellungsvermögen<br />
sowie Frauen bei den sprachlichen Fertigkeiten – werden die Unterschiede aber<br />
immer kleiner. Die Plastizität des Gehirns spielt hier eine grosse Rolle. Durch Training kann<br />
4 Gibt es ein typisch männliches Verhalten? | Seite 7
man sich verbessern. Gemäss der Hirnforschung tragen die Unterschiede unwesentlich zur<br />
Alltagsbewältigung bei.<br />
Um nochmals auf Guggenbühl zurückzukommen: Es gibt eine kleine Gruppe von differenzierten<br />
Männern, die bereit sind, ihre persönlichen Gefühle und Beziehungen zu reflektieren,<br />
wenn sie an psychischen Schwierigkeiten leiden. Ihnen gegenüber steht die grosse<br />
Schar jener Männer, die sich instinktiv einer Therapie entziehen. Die Männer suchen ihre<br />
Selbstverwirklichung über mythische Vorbilder und daher fühlt sich die männliche Seele<br />
bei einer Therapie, die das Persönliche und die eigene Biografie in den Vordergrund stellt,<br />
nicht angesprochen. Bei Männern muss sich die mythische Dimension mitbeteiligen, damit<br />
sie die Leiden, den Schatten, die Schwierigkeiten und die Ängste, die sie im Zusammenhang<br />
mit der Auseinandersetzung mit den Mythen erleben, einbringen können. Die Männer<br />
könnten somit wieder an existenzielle Herausforderungen herangeführt werden, ihr<br />
öffentliches Selbst betrachten und den Blick in die Weite ihres mythischen Umfeldes richten.<br />
Dieses Nach-aussen-gerichtet-Sein haben wir in der Arbeit mit unseren Probanden immer<br />
wieder erlebt (dazu Kapitel 5 und 6), aber auch in der Umfrage kam diese Tendenz zum<br />
Vorschein (siehe Kapitel 7).<br />
4 Gibt es ein typisch männliches Verhalten? | Seite 8
5 Die Probanden / Arbeitsberichte<br />
Die drei Arbeitsberichte gliedern sich pro Proband folgendermassen:<br />
Zuerst wird der jeweilige Proband im Abschnitt «Proband A / Diplomandin 1» von der<br />
Diplomandin vorgestellt und der Ist-Zustand jedes Probanden zu Beginn dieser Diplomarbeit<br />
anhand der «Bestandesaufnahme Ausgangslage» (siehe Anhang) festgehalten<br />
(«Bestandesaufnahme am Anfang [April 2006]»). Danach zeigt jede Diplomandin ihre<br />
Sicht des Verlaufs der zwanzig Stunden auf («Verlauf aus Sicht der Diplomandin»).<br />
Anschliessend wird die Sicht des Probanden mittels Grafiken und/oder Text dargestellt<br />
(«Verlauf aus Sicht des Probanden A»). Die entsprechenden Resultate wurden anhand der<br />
verschiedenen Fragebogen (siehe Anhang) ermittelt.<br />
Die «Bestandesaufnahme am Schluss (Dezember 2006)» dient der Feststellung/Überprüfung<br />
eventueller Veränderungen.<br />
Im letzten Teil vergleicht die Diplomandin ihre Sichtweise mit den Ergebnissen der Fragebogen<br />
(«Vergleich zwischen Sicht Proband A und Diplomandin 1»). Wo gibt es Differenzen<br />
und wo Übereinstimmungen? Gibt es Korrelationen in Bezug auf die Antworten auf die verschiedenen<br />
Fragen?<br />
Ein Fazit rundet die Einzelarbeit der Diplomandin ab.<br />
5.1 Proband S. F. / Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri<br />
5.1.1 Voraussetzungen<br />
S.F. ist 31 Jahre alt und hatte zu Beginn dieser Diplomarbeit weder körperliche noch psychische<br />
Beschwerden oder Krankheiten. Seine Statur ist sehr schlank und feingliedrig,<br />
trotzdem ist er kräftig (vor allem im Oberkörper). Er fühlt sich gesund und widerstandsfähig.<br />
In seiner Jugendzeit spielte er leidenschaftlich Tischtennis (im Alter von 14 bis 19<br />
Jahren). Nach dieser Zeit spielte – bis vor etwa einem Jahr – Bewegung und Sport keine<br />
Rolle mehr in seinem Leben. Seine mehrmonatigen Auslandreisen und der Ausgang mit<br />
Freunden waren ihm wichtiger. Er absolvierte die Ausbildung zum Tourismusfachmann und<br />
arbeitete danach zwischen seinen Reisen temporär. Ausser gelegentlichen Bergwanderungen<br />
bewegte er sich bis vor Kurzem kaum. Trotzdem empfand er sich nicht als «eingerostet»<br />
oder unbeweglich. In seiner jetzigen beruflichen Tätigkeit – seit Februar 2006 – sitzt<br />
S.F. vor allem am Computer. Er ist in einem Kinderhilfswerk für das Fundraising verantwortlich<br />
und arbeitet momentan durchschnittlich 80 Stunden pro Woche. Womöglich<br />
hat er deshalb vermehrt das Bedürfnis nach Bewegung, wobei ihm vor allem spielerische<br />
Einzelsportarten gefallen. So spielt er seit einiger Zeit Badminton in unregelmässigen<br />
Abständen (durchschnittlich 1x pro Woche), mit längerer Pause, bedingt durch eine Fussverletzung.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 9
Mitgemacht an dieser Diplomarbeit hat S.F. aus Neugier und Interesse; zudem aus dem<br />
Gefühl heraus, dass Bewegung gut tut, auch wenn bis anhin diese eine eher untergeordnete<br />
Rolle im Alltag spielte.<br />
Die Bewegungsstunden mussten für eine längere Zeit unterbrochen werden, da<br />
S.F. im Oktober 2006 nach einem Misstritt das linke Fussgelenk nicht belasten konnte.<br />
5.1.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)<br />
Bewegung bedeutet für S.F. ein Gefühl des Lebens, der Kraft und der Erkenntnis, dass kleine<br />
Schritte einen schlussendlich auch über grosse Distanzen bringen. Seine Hauptmotivation<br />
zur körperlichen Bewegung sind: Abbau von Energie, Spass an Bewegungsabläufen,<br />
Lust auf Schweiss und Ausgleich zu einseitigen Belastungen.<br />
Sanfte Bewegungsformen wie die PSFL-Methode, Yoga oder Ähnliches sieht er als ein gutes<br />
Mittel zur Schulung der Körperwahrnehmung. Sie werden, seiner Meinung nach, aber oft<br />
schlecht kommuniziert, da VermittlerInnen sektiererische Tendenzen aufwiesen. Grundsätzlich<br />
liebt er eher individuelle Formen der Bewegung (Tischtennis, alleine tanzen).<br />
Ein Albtraum ist für ihn der Zwang des Mitmachens von Bewegungen in einer Gruppe,<br />
wenn ihn die Bewegungen nicht emotional berühren (z.B. Synchronschwimmen).<br />
Im Stehen (Foto 1–4): Füsse sind leicht nach aussen abgewinkelt, leichte Knickfüsse,<br />
Beckenschaufeln werden nach vorne gedrückt, welches eine leichte Rücklage des Oberkörpers<br />
bewirkt. Beine ohne Längendifferenz, Gewichtsbelastung auf rechtem Bein grösser.<br />
Knie sind gelöst, nicht durchgedrückt. Linke Schulter leicht hochgezogen und beide Schultern<br />
tendenziell nach vorne gezogen. Arme im Lot, Handhaltung normal. Kopf in leichter<br />
Schiefhaltung nach rechts. Muskeltonus ausgeglichen, Mimik gelöst.<br />
Foto 1<br />
S.F. von vorne,<br />
Füsse nach aussen<br />
abgedreht.<br />
Foto 2<br />
S.F. von hinten,<br />
linke Schulter ist<br />
leicht hochgezogen.<br />
Foto 3<br />
S.F. von links,<br />
steht in Rücklage.<br />
Foto 4<br />
S.F. von rechts,<br />
steht in Rücklage.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 10
Foto 5 Foto 6<br />
S.F. ist im oberen Rücken sehr beweglich.<br />
Berührt mit beiden Schultern den Boden.<br />
Foto 9<br />
Sehr bewegliche<br />
Wirbelsäule: Hände<br />
berühren den Boden.<br />
Kopf baumelt,<br />
jedoch nicht gelöst.<br />
Foto 10<br />
Muskeltonus in dieser<br />
Lage angespannt.<br />
Foto 11<br />
Rücklage des Oberkörpers<br />
ist aufgehoben.<br />
S.F. gibt schwer lokalisierbare Schmerzen im mittleren bis unteren Rücken an. Diese treten<br />
seit etwa drei Jahren gelegentlich auf und äussern sich in einem stechenden «Zwick»<br />
bei schnellem Aufstehen nach langem Sitzen. Der Schmerz bleibe jeweils nur kurze Zeit<br />
und löse sich dann von selbst wieder.<br />
Im Gehen: Schultergürtel wirkt gehalten und wird kaum bewegt, Arme schwingen trotzdem<br />
in der Gegenbewegung mit.<br />
In der Wandlage (Foto 10): Die Dehnung der hinteren Beinmuskulatur und das Absacken<br />
des Blutes aus den Beinen werden als sehr unangenehm empfunden. Muskeltonus<br />
leicht angespannt in dieser Lage.<br />
5.1.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri<br />
Foto 7<br />
Becken kippt nach hinten. Grosser Kraftaufwand<br />
/ grosse Dehnung der Beine ist zum<br />
aufrechten Sitzen nötig.<br />
Foto 12<br />
Ohne explizite Anweisung<br />
zeigen beide<br />
Handflächen nach<br />
vorne. Schultern hochgezogen.<br />
Wir vereinbarten, die Stunden grundsätzlich einmal pro Woche abzuhalten. Dieser Rhythmus<br />
war jedoch nicht immer einzuhalten, da S.F. während dieser Zeit unter einer grossen<br />
Arbeitsbelastung stand, die die regelmässige Durchführung der Stunden verunmöglichte.<br />
Zusätzlich mussten wir nach der 13. Stunde einige Wochen pausieren, da S.F.<br />
seinen Fuss verletzte.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 11
Die ersten fünf Stunden fanden – was die Wandlage betraf – in einem kleinen, überfüllten<br />
Zimmer statt. Die Bewegungen im Raum (Anfangsteil und Diagonale) wurden in einem<br />
anderen, grossen Raum abgehalten. Dieser entsprach viel mehr unseren Bedürfnissen, so<br />
dass wir nach den ersten fünf Stunden kaum mehr die Wandlage benutzten, die das kleine<br />
Zimmer bedingt hätte.<br />
In den folgenden Abschnitten zeige ich den Verlauf der vier Schwerpunktthemen aus meiner<br />
Sicht auf:<br />
Kreisaufbau (1. bis 5. Stunde): Obwohl S.F. motiviert und interessiert zur ersten Stunde<br />
erschien, verliefen die ersten fünf Stunden harzig. S.F. fiel es schwer, sich während den<br />
Bewegungsabläufen zu konzentrieren. Die Wandlage entsprach ihm nicht. Er führte die<br />
Bewegungsabläufe schnell und eher ungenau durch. Seine Mimik wirkte auf mich ungeduldig;<br />
seine Bewegungen fahrig. Sein Körper war von Beginn an sehr dehnbar, auch konnte<br />
er die Anweisungen problemlos ausführen. Mein Eindruck war, dass er mit den Gedanken<br />
ganz woanders war und er die Aufforderung, seinem Körper nachzuspüren, für sich als<br />
unwichtig empfand. Dabei wurde er ungeduldig, wenn ich dem Nachspüren viel Zeit einräumte.<br />
Es wirkte auf mich so, dass er keinen Grund sah, den Kreisaufbau immer wieder<br />
zu wiederholen, da er ihn ja bereits erfasst hatte. Meistens wurde er im Verlauf der Stunde<br />
zunehmend unkonzentrierter und ungeduldiger.<br />
Kraftaufbau: Rumpf, Rücken, Bauch, Seitendehnungen (6. bis 10. Stunde): Da zwei<br />
unserer Probanden grosse Schwiergkeiten hatten, sich auf Bewegungen einzulassen,<br />
deren Hintergrund und Wirkung sie nicht kannten, vereinbarten wir Diplomandinnen – entgegen<br />
der Abmachung zu Beginn der Diplomarbeit – unsere Probanden über Wirkung und<br />
Zweck der Bewegungen teils zu informieren. Mit diesem neuen Wissen und dem Thema<br />
«Kraft» stieg die Motivation von S.F. an. Auch fanden die Stunden in dieser Zeit zwei<br />
Mal wöchentlich statt, was sich zusätzlich positiv auf S.F.s Motivation auswirkte. Er wirkte<br />
präsent, interessiert und konnte sich viel besser konzentrieren. Auch hatte ich den Eindruck,<br />
er setze sich mit seinem Körper auseinander. Ich gestaltete die Stunden mit mehr<br />
Trainingselementen, da er darauf sehr gut ansprach. Der gesamte Teil mit dem Thema<br />
Kraftaufbau motivierte S.F. meiner Ansicht nach am meisten, woraus die konstruktivste<br />
Phase und eine anhaltende Kontinutiät der Qualität innerhalb der Stunden entstand.<br />
Schultergürtel, Arme, Nacken, Brustbein (11. bis 15. Stunde): Das Hauptthema war<br />
S.F.s gehaltener Schultergürtel. Beim Gehen pendelten seine Arme zwar in der Gegenbewegung<br />
mit, sein Schultergürtel blieb jedoch starr. Wir arbeiteten an der Gegenbewegung<br />
und der Lockerung des Schulterbereichs. Mein Eindruck war, dass eine Sensibilisierung<br />
des Körperbewusstseins stattfand, worauf er sich auch während des Alltags mit diesem<br />
Thema auseinander setzte. Vor der 14. Stunde verletzte S.F. durch einen Misstritt seinen<br />
linken Fussknöchel. Nach einer mehrwöchigen Pause – da er seinen Fuss schonen<br />
musste – setzten wir die Stunden fort. Im Alltag war seine Verletzung kaum mehr spürbar<br />
und fast ausgeheilt. Während den Stunden nahm er die Einschränkung im Fussgelenk<br />
jedoch deutlich wahr. Diese beschäftigte ihn und hinderte ihn daran, sich auf andere Körperteile<br />
zu konzentrieren. Ein erneuter Versuch mit der Wandlage wirkte sich negativ auf<br />
seine Motivation und seine Konzentration während den Stunden aus.<br />
Beine, Becken, Hüfte, Gesäss, Füsse (16. bis 20. Stunde): Der Beginn dieses Blocks<br />
gestaltete sich schwierig. S.F. hatte kaum Zeit für sich und war unter der andauernden<br />
Arbeitsbelastung gestresst. Die Grundlagenstunde PSFL stand in einem krassen Ge-<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 12
gensatz zu seinem sonstigen Alltagsrhythmus. Plötzlich Zeit zu haben, um in sich hineinzuspüren<br />
und sich auf seinen Körper zu konzentrieren, löste eine grosse Ungeduld in<br />
S.F. aus. Es fiel ihm schwer, sich mit seinem Körper zu befassen und nicht bereits gedanklich<br />
seine nächsten Arbeitsschritte im Büro zu planen. Es geschah aber auch, dass seine<br />
Stimmung durch die Bewegungsstunde aufgehellt wurde. Das Auf und Ab seiner Motivation<br />
und Konzentration während den Stunden zeigte sich auch in diesem Themenblock.<br />
Grundsätzlich wurde S.F. von der Musik angespornt, wobei ihm vor allem die Diagonale<br />
gefiel. Hier hatte er auch weniger Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und schweifte<br />
mit den Gedanken weniger ab. Die besten Wirkungen konnte ich erzielen, wenn ich die<br />
Diagonale mit einer komplexen Schrittfolge begann, die ihn eher überforderte, ihn ausprobieren<br />
liess, und sie dann vereinfachte. Mit dem ersichtlichen Ziel wurde sein Interesse<br />
geweckt. Zu einfache Diagonalen liessen ihn abschweifen, er langweilte sich bald. Wichtig<br />
war für S.F. auch, das Ziel und den Nutzen der Bewegung zu kennen. Er fand<br />
es sinnlos, Bewegungen durchzuführen, ohne zu wissen, was sie ihm bringen würden. Er<br />
empfand die Art meiner Korrekturen, indem ich etwas wiederholte oder ihn anwies, selber<br />
auszuprobieren, eigenartig und teils bevormundend.<br />
S.F. konnte meine Bewegungsanweisungen gut umsetzen: Er konnte alle Körperteile ohne<br />
Einschränkungen funktional und unabhängig voneinander bewegen. Seine Bewegungen<br />
waren geschmeidig und durchlässig, was deutlich beim Becken-Kippen sichtbar wurde, da<br />
sich der Kopf mitbewegte. S.F. wirkte sicher und klar orientiert im Raum, ohne diesen<br />
zu dominieren. In der Diagonalen fasste er komplexe Bewegungsabläufe rasch auf und war<br />
interessiert, Neues zu lernen. Auch fiel es ihm leicht, sich in verschiedenen Bewegungsqualitäten<br />
(Stossen, Schwingen, Pendeln, Tupfen etc.) auszudrücken.<br />
Ich empfand diese zwanzig Stunden als ein dauerndes Wechselbad der Stimmungen<br />
und Motivation meinerseits und auch von S.F. Ich ärgerte mich öfters über S.F.s Ungeduld<br />
oder sein Unvermögen zur Konzentration während der Stunden. Auch hatte ich den<br />
Eindruck, dass die Qualität der Stunden unter seiner hohen Arbeitsbelastung litt. Sehr<br />
viele Störfaktoren (Arbeitsbelastung, Stress, allgemeiner Zeitmangel, Fussverletzung,<br />
Bauchschmerzen, Katerstimmung, Schlafmangel) verhinderten eine<br />
aufbauende Vorgehensweise. Die Stunden zum zweiten Schwerpunktthema empfand<br />
ich am konstruktivsten; in der übrigen Zeit konnte eine Stunde sehr gut ankommen, die<br />
nächste wieder gar nicht. Ich hatte teils Mühe, mich nicht beeindrucken zu<br />
lassen und nicht von S.F.s Unkonzentriertheit angesteckt zu werden. Öfters konnte ich<br />
nicht beurteilen, ob ich unkonzentriert war oder ob mich S.F. dermassen aus der Ruhe<br />
brachte.<br />
Die besten Ziele erreichte ich, wenn ich ohne zu zögern stur mein Programm durchzog und<br />
nicht zu sehr auf seine Bedürfnisse einging. Ich erlebte, dass er durch zu leichte Kleidung<br />
fror und deshalb seine ganze Konzentration während der Stunde verflog. Hier nervte ich<br />
mich, dass es anscheinend nötig war, ihm zu sagen, sich warm anzuziehen, damit er konzentriert<br />
bleiben konnte. Dies fand ich unglaublich.<br />
Durch S.F.s tiefe Frustrationstoleranz und seine unstetige Stimmung traten körperliche<br />
Veränderungen in den Hintergrund. S.F.s Koordinationsfähigkeit hing stark mit seiner<br />
momentanen Konzentration und seiner Stimmung zusammen.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 13
Ersichtlich war eine vermehrte Gegenbewegung des Schultergürtels im Verlauf der<br />
Stunden. S.F. war schon zu Beginn dieser Diplomarbeit in der Wirbelsäule und im Becken<br />
sehr beweglich. Während dem Gehen kippte sein Oberkörper nach hinten, aufrechtes<br />
Gehen empfand er als Vorlage. Seine Atmung war teilweise gehalten und flach. Er hatte<br />
Schwierigkeiten, mit aufrechtem Körper und gestreckten Beinen auf dem Boden zu sitzen,<br />
da seine hintere Beinmuskulatur verkürzt ist. Er konnte weder mit gestreckten noch mit<br />
angewinkelten Beinen für längere Zeit in dieser Position bleiben.<br />
Die Stunden mit S.F. lehrten mich vieles und ich konnte wichtige Erkenntnisse für mein<br />
weiteres Tun erlangen. Ich denke, S.F. war kein pflegeleichter Proband, er forderte mich<br />
heraus, setzte sich mit den Stunden auseinander, stellte kritische Fragen und beantwortete<br />
die Fragebogen schonungslos ehrlich, was ich sehr schätzte.<br />
Ich glaube nicht, dass S.F. diese Art der Stunden fortsetzen würde. Vielleicht haben sie<br />
ihm aber einen Ansporn gegeben, sich vermehrt mit seinem Körper auseinanderzusetzen.<br />
Ich kann mir vorstellen, dass ihm eine Stunde, die eher in Richtung Bewegungsgestaltung<br />
geht, besser entspricht. Die Grundlagen sind ihm zu sanft, Stunden mit Trainingselementen<br />
entsprechen ihm vermutlich mehr.<br />
5.1.4 Verlauf aus Sicht des Probanden S.F.<br />
Die folgenden Fragen («Fragebogen klein») wurden vom Probanden nach jeder Stunde<br />
anhand der Skala von 1 bis 10 (1 = niedrigster Wert; 10 = höchster Wert) beantwortet.<br />
In den unten stehenden Grafiken wird der Verlauf der einzelnen Antworten sichtbar. Die<br />
Antworten zu den offenen Fragen (9 und 15) sind Originalzitate von S.F.<br />
(nicht aufgelistete Stunden = keine Angaben)<br />
«Fragebogen klein» von S.F.:<br />
1.<br />
Wie war Ihre Motivation am Anfang<br />
der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
2.<br />
Wie haben Sie sich während der Stunde<br />
konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 14
3.<br />
Wie haben Sie sich gegen Ende der<br />
Stunde konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.<br />
Wie verspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
7.<br />
Wie schlaff/ermüdet fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
4.<br />
Wie entspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
6.<br />
Wie angeregt/wach fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
8.<br />
Wie gut ist Ihr körperliches Wohlbefinden<br />
in Bezug auf die Körperwärme?<br />
9. Wie ist Ihr körperliches Befinden allgemein? (wohlig, schwindlig, kribbelig …;<br />
fühlen sich einzelne Körperteile irgendwie anders an? Etc.)<br />
1. Std: gut, gelenkiger als zu Beginn der Stunde. Flexibler Rücken, generell nicht viel besser. 2 äusserst<br />
rege, agil und elastisch, energetisch voll und positiv, tatendrängig und rundum super 3 Kopfschmerzen<br />
und Hunger, kalte Füsse wegen kalter Umgebung 4 wohlig, warm, entspannt 5 wohlig, wenig müde, bedingt<br />
durch «ewiges Rumliegen» 6 wohlig und ausgedehnt 7 aufgewärmt 8 ausgedehnt 9 verkatert<br />
10 Bauchschmerzen 11 aufgewärmt, angeregt 12 angenehm, erschöpft vom Badminton 13 gut<br />
14 wenig müde 15 Fussknöchel schmerzt 16 gut 17 angenehm 18 geistig aufgedunsen, Rücken wärmer<br />
als sonst, allgemein gut 19 kalte Gliedmassen. Müde durch Schlafmangel 20 körperlich rundum<br />
angenehm, angespannt, bzw. sämtliche Teile integriert im Körperempfinden.<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 15
10.<br />
Wie gut ist Ihr psychisches Wohlbefinden,<br />
wie gut ist Ihre Stimmung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
14.<br />
Haben Sie sich während der Stunde<br />
oft Gedanken gemacht über den Sinn<br />
der Bewegungen?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
12.<br />
Wie verständlich war für Sie die<br />
verbale Anleitung?<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
15. Hätten Sie gerne mehr Erklärungen?<br />
11.<br />
Wie angenehm war für Sie die verbale<br />
Anleitung?<br />
13.<br />
Wie angenehm waren für Sie die<br />
Bewegungen ganz allgemein?<br />
1. Std: unbedingt, fühle mich wie in der Schule, ich lerne, aber niemand erklärt, wozu es gut sein soll<br />
2 alles i.O., nur 2Min. Motivationstief 6 Ziele wurden am Anfang der Stunde erklärt, was half 9 nein,<br />
i.O. 16 war extrem ungeduldig und daher mühsam anzuleiten – mehr Erklärungen daher nicht nötig 17<br />
nein, abgesehen von kleinen Verständnisschwierigkeiten 18 empfand Stunde als exotisch, daher wieder<br />
Sinnfrage, die bei vorhergehenden Stunden inexistent war.<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 16
Die folgenden Fragen wurden vom Probanden nach jeder fünfte Stunde zusätzlich («Fragebogen<br />
gross») beantwortet. Auf diesem wurden einige Fragen auch anhand der Skala<br />
von 1 bis 10 (1 = niedrigster Wert; 10 = höchster Wert) beantwortet. Die entsprechenden<br />
Resultate sind in der Grafik (Seite 19) ersichtlich.<br />
«Fragebogen gross» von S.F.:<br />
Wie verständlich ist für Sie die verbale Anleitung? Ist es angenehm, verbal so<br />
präzise angeleitet zu werden?<br />
5. Std: ein wenig lächerlich, wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht.<br />
10. Std: teilweise etwas lächerlich, wohl aber gewöhnungsbedingt, wesentlich weniger als zu Beginn.<br />
15. Std: teilweise störend, wenn gewisse Ausdrücke eine minime Lächerlichkeit beinhalten.<br />
20. Std: grundsätzlich sehr verständlich – Sprache zum Teil ein wenig gewöhnungsbedürftig in Bezug<br />
auf einige Ausdrücke (Tupf-Schritt, «nasse Lumpe»). Wiederholungen der Anleitungen nervten<br />
verschiedentlich, da entwürdigend wirkend.<br />
Wie empfinden Sie es, dass Ihnen die Bewegungen nicht vorgemacht werden und<br />
Sie von daher nicht (immer) sicher sein können, ob Sie die Bewegung «richtig»<br />
machen oder nicht?<br />
5. Std: wurst<br />
10. Std: angenehm<br />
15. Std: ist nicht immer der Fall, bzw. Diplomandin macht teilweise Bewegungen vor. Generell aber gut.<br />
20. Std: spielte keine Rolle bzw. hatte keine Angst davor, etwas «falsch» zu machen.<br />
Wie empfinden Sie die Wandlage?<br />
5. Std: eher unangenehm, da Beine übermässig blutentleert und müde werden.<br />
10. Std: nicht meine erste Präferenz der Übungen.<br />
15. Std: war schon lange nicht mehr an der Wand.<br />
20. Std: schrecklich, da Blutstauungen in Beinen, Kopf, Hals und Händen.<br />
Wie empfinden Sie die Seitenlage?<br />
5. Std: fühle mich ein wenig unbeholfen.<br />
10. Std: angenehm, da gewohnte Schlafstellung.<br />
15. Std: einschläfernd, und je nach Bodenkontakt als unangenehm, da kalt.<br />
20. Std: hängt sehr stark von den einzelnen Übungen ab, mit Wechsel auf Rückenlage als angenehm.<br />
Plumpsen auf eine Seite bzw. kalte Unterlage war unangenehm.<br />
Wie empfinden Sie die Bauchlage?<br />
10. Std: schlechtes Timing der Frage, da Bauchschmerzen.<br />
20. Std: kann mich nicht erinnern, jemals so «gelegen» zu sein.<br />
Wie empfinden Sie den Einstieg in die Stunde?<br />
5. Std: äusserst gut, freue mich, da Anteil steigend.<br />
15. Std: mir gefällt das Prinzip des sanften Beginns und langsamen Dreinkommens sehr.<br />
20. Std: angenehm, da langsames Herantasten bzw. sinnvoller Aufbau.<br />
Wie empfinden Sie die Diagonale?<br />
5. Std: ist Tanzen, daher lustig und angenehm.<br />
10. Std: gut<br />
15. Std: mein Favorit, bin ein Riesenfan davon. Hopp Diagonale! Mögen wir noch viel Stunden gemeinsam<br />
verbringen dürfen.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 17
20. Std: sehr motivierend, unter der Bedingung, dass Musik gut gewählt, was in 99% der Fall war,<br />
daher, abgesehen von einzelnen Hängern, sehr stimulierend.<br />
Gefallen Ihnen die Bewegungsabläufe oder hätten Sie lieber einzelne Übungen?<br />
10. Std: Aufbau mit Ziel und Aufbau der einzelnen Elemente ist definitiv mehr ansprechend als bites<br />
and pieces.<br />
15. Std: Bausteinprinzip find ich gut und sinnvoll, da nachvollziehbar und logisch.<br />
Sind die Bewegungen grundsätzlich angenehm oder nicht?<br />
5. Std: durch die repetitiven Elemente auf dem Boden liegend, die sich durch viele Stunden ziehen,<br />
wird mein persönlicher Gedankenausflug in andere Welten massiv begünstigt.<br />
10. Std: grundsätzlich ja, schon.<br />
15. Std: grundsätzlich angenehm.<br />
20. Std: grundsätzlich ja. Mit diversen Ausnahmen, die aber auch stark mit den individuellen Empfindungen<br />
im Moment der Stunde zusammenhingen.<br />
Sind die Grundlagenstunden grundsätzlich so, wie Sie sie sich vorgestellt haben?<br />
5.–20. Std: ich hatte überhaupt keine Vorstellungen.<br />
Entsprechen die Grundlagen PSFL Ihrem Bewegungsbedürfnis oder nicht? Was<br />
fehlt allenfalls?<br />
5. Std: bis anhin eher nicht. Hinterfrage zu viel und schalte ab, wenn ich keine stimmigen Antworten<br />
drauf erhalte. Mir ist diese meditative Seite der Stunde ein wenig zu soft und sie scheint mir<br />
eher sinnlos. Obwohl ich danach eigentlich in guter Verfassung bin.<br />
10. Std: im Vergleich zum Anfang wohl eher mehr, dennoch nicht ganz bejahen könnend, da (noch) zu<br />
wenig Veränderungen feststellend.<br />
15. Std: Sensibilisierungseffekt für Bewegungen im Alltag ist zweifellos vorhanden und daher ja. Dennoch<br />
würde ich es über einen längeren Zeitraum wohl als zu sanft empfinden. Natürlich nicht<br />
unter Berücksichtigung des Niveau-Anhebens.<br />
20. Std: grundsätzlich entspräche die Form den eigenen Bedürfnissen, wenn die Konzentration auf die<br />
einzelnen Stunden gelenkt werden könnte, bzw. die Reife und Erkenntnis des Teilnehmers<br />
stärker vorhanden wäre. Dadurch, dass zu viele Ablenkungsfaktoren im täglichen Leben vorherrschen,<br />
ist ein «Sich-Fallen-Lassen» im Moment nicht möglich. Das Lernen von Konzentration<br />
auf die jeweilige Stunde wäre primär vonnöten.<br />
Haben Sie an sich irgendwelche Veränderungen feststellen können seit dem<br />
Anfang des «Unterrichts», Veränderungen physischer und psychischer Art oder<br />
Verhaltens- und Einstellungsveränderungen? Worin sehen Sie den Hintergrund<br />
für diese eventuelle Veränderungen?<br />
10. Std: grössere Veränderungen in Bezug auf körperliches Allgemeinbefinden (noch) nicht, wohl aber<br />
wesentlich bessere Einstellung zu Stunden mit grösserer Motivation als zu Beginn.<br />
15. Std: Sensibilisierungseffekt für Bewegungen im Alltag.<br />
20. Std: beweglicher würd ich sagen, ja bewusster ebenfalls und sicherlich auch sensibilisierter mit<br />
Augenmerk auf die «Problemzonen des Mannes»: Schultergürtel, Oberschenkel-Innenbänder.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 18
Wie schätzen Sie sich ein auf einer Skala von 1 bis 10?<br />
(1 = gar nicht, 10 = sehr)<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
beweglich kräftig konditionell<br />
fit<br />
Koordination Rhythmusgefühl<br />
vor der 1. Stunde nach der 10. Stunde nach der 20. Stunde<br />
nach der 5. Stunde nach der 15. Stunde<br />
5.1.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006)<br />
Abschlussfragebogen: Zu Beginn der PSFL-Stunden wurde bei S.F. ein Interesse<br />
geweckt, das durch eine Phase relativer Begeisterung und Vertiefung abgelöst wurde,<br />
gefolgt von Unruhe, bedingt durch Stress im Arbeitsalltag.<br />
S.F. sieht die Grundlagenstunden PSFL als Sensibilisierungsmassnahme, die das Bewegungsverhalten<br />
nachhaltig beeinflussen und verbessern kann. Als Ersatz für sportliche<br />
Aktivitäten taugen die Stunden seiner Meinung nach nicht.<br />
In Bodenlage an der Wand bewegte er sich ungern. Er empfand die Wandlage «... als Horror,<br />
da imobil fühlend. Angst um Wandbemalung und Therapie-Kreis-Abzeichen von Socken».<br />
S.F. kann sich nicht vorstellen, weitere Grundlagenstunden PSFL zu besuchen, da sie seinem<br />
Bewegungsbedürfnis zu wenig entsprechen. Er fühle sich zu ungestüm für diese<br />
Art von Bewegung; kann sich aber vorstellen, einem Mann die Grundlagenstunden PSFL<br />
weiterzuempfehlen. Kein Hindernis wäre für ihn, dass nur wenige Männer in einer Grundlagen-Gruppe<br />
zu erwarten sind. Er würde eine gemischte Gruppe einer reinen Männergruppe<br />
gegenüber vorziehen. S.F. stellt sich eine Grundlagenstunde PSFL von einem Mann<br />
angeleitet als nüchterner vor, was ihm besser entspräche.<br />
Körperlich fühlt sich S.F. beweglicher. Er ist sich seiner körperlichen Defizite während<br />
dieses halben Jahres bewusster geworden. Ausserdem fand eine allgemeine Sensibilisierung<br />
des körperlichen Befindens und des Bewusstseins der Bewegung im Alltag statt.<br />
Auch wurde S.F.s Wertschätzung gegenüber des «Instruments Körper» erhöht.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 19
Schwierigkeiten während den Stunden bereitete S.F. vor allem die Konzentration; auch die<br />
Fussverletzung war hinderlich. Dadurch, dass sich S.F. während den Stunden praktisch nie<br />
durchgängig konzentrieren konnte, wurde er sich seiner unausgewogenen Lebensweise in<br />
Bezug auf Arbeit, Bewegung und Gesundheit bewusst.<br />
Grundsätzlich sieht S.F. den Einfluss der Stunden auf seinen Körper als sehr positiv, wobei<br />
es auch negative Auseinandersetzungen und Momente gab.<br />
Im Stehen (Fotos 1–4): Leichte Veränderungen sichtbar im Vergleich zum April 2006.<br />
Rücklage beim Stehen ist weniger extrem, zudem wirkt das Brustbein aufgerichteter. Auch<br />
ist sich S.F. seiner Haltung grundsätzlich bewusster geworden. Dass die rechte Schulter<br />
hochgezogen ist und der Kopf leicht schief steht, bringen S.F. und ich in Verbindung mit<br />
dem Halten der Maus vor dem Computer.<br />
Im Gehen bewegt sich der Schultergürtel wesentlich mehr in der Gegenbewegung.<br />
Schmerzen im Rücken gibt S.F. im Abschlussfragebogen keine mehr an.<br />
Foto 1<br />
S.F. von vorne<br />
Füsse weniger nach<br />
aussen abgedreht.<br />
Foto 2<br />
S.F. von hinten<br />
linke Schulter ist<br />
immer noch leicht<br />
hochgezogen.<br />
Foto 3<br />
S.F. von links<br />
Brustbein wirkt aufgerichteter.<br />
Foto 4<br />
S.F. von rechts<br />
steht weniger in<br />
Rücklage.<br />
Foto 5 Foto 6<br />
Foto 7 Foto 8<br />
S.F. ist im oberen Rücken sehr beweglich. Becken kippt nach wie vor nach hinten. Durch<br />
Berührt mit beiden Schultern den Boden. Keine Anwinkeln der Beine kann der Oberkörper auf-<br />
sichtbare Veränderung.<br />
gerichtet werden.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 20
Foto 9<br />
Sehr bewegliche<br />
Wirbeläule: Hände<br />
berühren knapp den<br />
Boden. Kopf<br />
baumelt gelöster.<br />
5.1.6 Vergleich zwischen Sicht Proband S.F. und Diplomandin <strong>Katrin</strong> Fluri<br />
Was deutlich in den Grafiken sichtbar wird, ist die Launenhaftigkeit des Probanden<br />
während dieser Zeit. Verschiedene Einflüsse wie Kälte, Müdigkeit usw. wirkten sich enorm<br />
auf seine Motivation und Konzentration aus. Deutlich wird auch, wie die allgemeine psychische<br />
Stimmung mit der Konzentration während der Stunde korrelliert. Hier in der Grafik<br />
ersichtlich.<br />
Vergleich zwischen:<br />
Konzentration während der Stunde<br />
Allgemeine psychische Verfassung<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Foto 10 Foto 11 Foto 12<br />
Ohne explizite Anweisung<br />
zeigen jetzt beide<br />
Handflächen Richtung<br />
Kopf. Schultern weniger<br />
hochgezogen.<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
Jede Stunde konnte wieder anders verlaufen, Konstanz war kaum möglich. Mein Eindruck<br />
bezüglich Stundenverlauf wurde von S.F. in den Fragebogen bestätigt. Diese geben<br />
ziemlich genau wider, wie meiner Ansicht nach die Stunden verliefen und sich die verschiedenen<br />
Themen gegenseitig beeinflussten. Die Verfassung von S.F. innerhalb der Stunde war<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 21
jeweils unübersehbar. Seine Ungeduld oder Freude waren in der Körperhaltung und der<br />
Mimik bzw. Gestik deutlich abzulesen. Langeweile oder Unlust zeigten sich durch Trommeln<br />
mit den Fingern oder sehr kraftlose, träge Bewegungen. Auch konnte seine Verfassung<br />
während einer Stunde laufend wechseln. Manche Anleitungen überhörte er, da er mit seinen<br />
Gedanken weit abgeschweift war. Er führte die Bewegungsabläufe sehr schnell<br />
durch und wartete dann auf weitere Anweisungen. Ich musste mich sehr konzentrieren, um<br />
nicht seinem Tempo hinterher zu rennen. Seine Ungeduld auszuhalten, war schwierig.<br />
Obwohl mein Eindruck war, dass S.F. über ein gutes Rhythmusgefühl verfügt, liess er sich<br />
nicht immer auf die Musik ein und wartete in der Diagonalen den Takt der Musik nicht ab.<br />
Kreisaufbau (1. bis 5. Stunde): In der Wandlage konnte sich S.F. nur schwer konzentrieren<br />
(Seite 14, Grafik 2), was er als unangenehm empfand. Die ersten fünf Stunden verliefen<br />
im Wechsel; in einer Stunde waren Konzentration, Stimmung und Motivation sehr<br />
hoch, in der nächsten Stunde tief, in der darauffolgenden wieder hoch, usw. Konzentration,<br />
Stimmung, Motivation verliefen analog der Beantwortung der Fragen «Wie angenehm<br />
waren für Sie die Bewegungen ganz allgemein?» und «Wie angenehm war für Sie die verbale<br />
Anleitung?». Auch die Körperwärme spielte eine grosse Rolle und bewegte sich in der<br />
gleichen Abfolge (zu den einzelnen Punkten siehe Seite 14–16, Grafiken 1, 2, 8, 10, 11<br />
und 12). Die Gedanken während den Stunden über den Sinn der Bewegungen nahmen<br />
jedoch von Stunde zu Stunde ab (Seite 16, Grafik 14).<br />
Kraftaufbau: Rumpf, Rücken, Bauch, Seitendehnungen (6. bis 10. Stunde): Durch<br />
die höheren Anforderungen bezüglich Kraft und Koordination blieb S.F.s Konzentration in<br />
diesem Themenblock auf einem relativ hohen Niveau. Vor allem gegen Ende der Stunde<br />
blieb seine Konzentration konstant hoch. Auch die verbale Anleitung wurde mit jeder Stunde<br />
als angenehmer empfunden.<br />
Exemplarisch die 6. Stunde (siehe Grafik unten): Hier wird ersichtlich, wie die verschiedenen<br />
Punkte zusammenspielen. Alle «positiven» Bereiche (blau) waren in der Skala<br />
hoch eingestuft (ausser Motivation am Anfang); die «negativen» (rot) tief.<br />
6. Stunde<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
14 Gedanken über Sinn<br />
13 Wie angenehm sind Bewegungen?<br />
12 Verbale Anleitung verständlich?<br />
11 Verbale Anleitung angenehm?<br />
10 Wie gut ist Ihre Stimmung?<br />
8 Wohlbefinden in Bezug auf Körperwärme<br />
7 Wie schlaff/ermüdet nach Stunde?<br />
6 Wie angeregt/wach nach Stunde?<br />
5 Verspannung nach Stunde<br />
4 Entspannung nach Stunde<br />
3 Konzentration gegen Ende Stunde<br />
2 Konzentration während Stunde<br />
1 Motivation Anfang Stunde<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 22
Schultergürtel, Arme, Nacken, Brustbein (11. bis 15. Stunde): Die Auswirkung des<br />
erneuten Versuchs mit der Wandlage in der 13. Stunde zeigt sich deutlich in den Grafiken<br />
in Bezug auf seine Motivation (Grafik 1), Konzentration (Grafik 2 und 3) und die Gedanken<br />
über den Sinn der Bewegungen (Grafik 14). Die Einschränkung aufgrund der Fussverletzung<br />
beschäftigte S.F. während der 14. und 15. Stunde (Grafik 13 und 9. Frage, Seite<br />
15 bzw. 16).<br />
Beine, Becken, Hüfte, Gesäss, Füsse (16. bis 20. Stunde): Das Auf und Ab der Motivation<br />
und der Konzentration während den Stunden hielt weiter an. Das körperliche Wohlbefinden<br />
bezüglich der Körperwärme war, mit Ausnahme der 19. Stunde, hoch eingestuft,<br />
«kalte Füsse» waren kein Thema mehr. Ein etwas anderer Aufbau der 18. Stunde wirkte<br />
sich sofort auf die Häufigkeit seiner Gedanken über den Sinn der Bewegungen aus (Grafik<br />
14).<br />
Hier ein Beispiel dafür (19. Stunde), wie sich die verschiedenen Punkte gegenseitig im<br />
«negativen» Sinn beeinflussten.<br />
19. Stunde<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4 Entspannung nach Stunde<br />
3 Konzentration Ende Stunde<br />
2 Konzentration während Stunde<br />
1 Motivation Anfang Stunde<br />
14 Gedanken über den Sinn<br />
13 Wie angenehm sind Bewegungen?<br />
12 Verbale Anleitung verständlich?<br />
11 Verbale Anleitung angenehm?<br />
10 Wie gut ist Ihre Stimmung?<br />
8 Wohlbefinden in Bezug auf Körperwärme<br />
7 Wie schlaff/ermüdet nach Stunde?<br />
6 Wie angeregt/wach nach Stunde?<br />
5 Verspannung nach Stunde<br />
Die Musik und die Diagonale nahmen bei S.F. einen hohen Stellenwert ein. Hier<br />
fiel es ihm leichter, sich zu konzentrieren. Wichtig war für S.F., das Ziel und den Nutzen<br />
der Bewegung zu kennen. Mehrmals erwähnte er in den Fragebogen, wie lächerlich ihm<br />
die verbale Anleitung teils erschien (vgl. «Fragebogen gross» Seite 17). Obwohl er es<br />
schätzte, verbal angeleitet zu werden, kamen ihm einige Wörter absurd vor.<br />
Auffallend sind die vielen Gedanken über den Sinn der Bewegungen in den ersten fünf<br />
Stunden, obwohl er jeweils angab, nach den Stunden ein wohliges Körpergefühl zu haben<br />
(Grafik 14). Er fühlte sich während den ganzen 20 Stunden kaum verspannt (Grafik 5),<br />
eher angeregt/wach und entspannt (Grafik 4 und 6). Bis zur zehnten Stunde fühlte er<br />
sich weder schlaff noch ermüdet (Grafik 7; alle Grafiken Seite 15).<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 23
5.1.7 Fazit<br />
Die grössten Fortschritte wurden in der Diagonale erzielt. Schwerpunktverlagerungen<br />
des Körpers wurden geübt, die Gegenbewegung im Schultergürtel vermehrt angewendet.<br />
Eine Sensibilisierung des Körperbewusstseins fand statt und konnte im Alltag<br />
teilweise integriert werden; körperliche Defizite wurden erkannt. Durch die Schwierigkeiten<br />
zur Konzentration wurde sich S.F. seines Verhaltens in Bezug auf Arbeit, Bewegung<br />
und Gesundheit bewusster. Diese Auseinandersetzung war mit negativen<br />
Momenten verbunden.<br />
Die Wandlage wurde bis zum Schluss abgelehnt. Der Themenblock Kraft/Rumpf mit den<br />
meisten Trainingselementen kam am besten an.<br />
Schwierigkeiten bereitete S.F. das Unvermögen zur Konzentration, die wechselhafte<br />
Stimmung und der Umgang mit äusseren und inneren Stressoren, was sich während der<br />
Stunde in Form von Ungeduld zeigte. Wichtig waren Ruhe und ein angenehmer Raum mit<br />
einer angemessenen Temperatur. Die Stimmung, das Konzentrationsvermögen und die<br />
Motivation von S.F. korrelierten in den meisten Stunden.<br />
Die anfängliche Unkenntnis über Wirkung und Ziel der Bewegungen löste bei S.F. Ablehnung<br />
aus. Er war interessiert an der Wirkung und machte sich – vor allem bei Stunden,<br />
die er als exotisch empfand – oft Gedanken über den Sinn und Zweck der Bewegungen.<br />
Wenn ihm ein Bewegungsablauf schwer fiel, hinterfragte er eher die Form der Bewegung<br />
als sein eigenes Unvermögen. Für mich stellte sich die Frage, ob Männer allgemein eher<br />
ausserhalb von sich nach Gründen suchen, wenn sie etwas nicht können.<br />
Einige Ausdrücke der verbalen Anleitung empfand S.F. als lächerlich, die Korrekturen als<br />
bevormundend.<br />
Eine konstante Qualität in den Grundlagenstunden PSFL war aufgrund der hohen<br />
Arbeitsbelastung von S.F. nicht möglich, d.h. ein effizienter Aufbau mit entsprechendem<br />
Fortschritt wurde dadurch erschwert.<br />
Da die Themenblöcke und die Art der Stunden im Rahmen dieser Diplomarbeit vorgegeben<br />
waren, konnte ich nicht optimal auf S.F.s Bedürfnisse (mehr Trainingselemente und<br />
freiere Bewegung) eingehen. Ich liess – trotz unserer Vorgaben – einige Trainingselemente<br />
in die Stunden einfliessen und verlangte schwierigere Schrittkombinationen in der<br />
Diagonalen. Dies wirkte sich auf S.F. motivierend aus und löste in ihm einen grösseren<br />
Respekt gegenüber den Grundlagenstunden PSFL aus.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 24
5.2 Proband O. F. / Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong><br />
5.2.1 Voraussetzungen<br />
O.F. ist 71-jährig und generell bei guter Gesundheit. Er ist eher schlanker Statur (hatte<br />
nie Gewichtsprobleme). O.F. hat einige körperliche Beschwerden, die ab und zu auftreten,<br />
ihn aber generell in der Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Die rechte Schulter<br />
schmerzt bei gewissen Bewegungen wegen eines Unfalls; der Lendenbereich, die Fussund<br />
Daumengelenke sind schmerzanfällig. O.F. fühlt sich soweit gesund. Als Rentner verbringt<br />
er im Sommer viel Zeit beim Wandern in den Bergen; auch kleinere Spaziergänge<br />
und Botengänge im Alltag gehören zu seinem Bewegungsspektrum. Seit seiner Pensionierung<br />
fördert O.F. seine Beweglichkeit gezielt durch allmorgendliche Gymnastik, welche<br />
ihn 20 bis 30 Minunten beansprucht. Er führte während seines Arbeitslebens einen Gewerbebetrieb<br />
als Spengler/Sanitärinstallateur, wo er sich anfänglich noch intensiv körperlich<br />
betätigte; später übernahm er vermehrt administrative Arbeiten. O.F. hatte schon immer<br />
Freude an der Bewegung. Das Bergwandern nutzte er früher als Ausgleich zum intensiven<br />
Arbeitsalltag und um sich seiner Familie zu widmen. Zwischen seinem 30. und 50. Lebensjahr<br />
ging O.F. regelmässig langlaufen. In der Männerriege, die er seit Jahren regelmässig<br />
besucht, pflegt er die Kameradschaft, hat Freude am Spiel und am Krafteinsatz. O.F.<br />
beobachtet an sich selbst, dass er im unteren Rücken steif ist.<br />
Die Probandenrolle übernahm er nicht aus Begeisterung, etwas Neues kennen zu lernen,<br />
sondern vorwiegend aus Pflichtgefühl.<br />
5.2.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)<br />
O.F. fühlt sich grundsätzlich gesund und fit. In der rechten Schulter spürt er Schmerzen<br />
bei Abduktion sowie Ante- und Retrorotation des rechten Armes; dies seit einem Unfall vor<br />
etwa elf Jahren. Eine Sehne im rechten Schultergürtel wurde dabei zerquetscht. Eine Operation<br />
hätte keinen Erfolg versprochen; deshalb liess er diese Schulter nicht behandeln.<br />
Im Lendenbereich verspürt er immer wieder Schmerzen, starke Verspannungen (Hexenschüsse),<br />
die er durch den Chiropraktiker behandeln lässt. Diese Zone kann aber auch<br />
über längere Zeit schmerzfrei sein. Seit einiger Zeit plagen ihn Schmerzen in den Fussund<br />
Daumengelenken. Diese schwellen immer wieder an und ab. Als ich ihn auf die Kyphose<br />
aufmerksam machte, meinte er, darauf hätte ihn schon sein Primarschullehrer hingewiesen.<br />
Damals galt noch die Haltung: Bauch rein, Brust raus. Dieser Satz geht mir durch<br />
den Kopf, wenn ich die Fotos betrachte. Seine Haltung wirkt auf mich stramm.<br />
Das Gehen wirkt etwas steif und starr, die Gegenbewegung der Arme ist vorhanden, der<br />
Schultergürtel bleibt dabei aber unbeweglich. Die Beine sind beide gleich lang; beim Gehen<br />
ist ein Hinken ersichtlich.<br />
In der Nullstellung sind die Füsse leicht auswärts gedreht; die Knie durchgedrückt; das<br />
Becken leicht nach hinten gekippt; leichte Kyphose in der BWS, minime Skoliose im Brustund<br />
Lendenbereich (beides auf den Fotos nicht erkennbar); die rechte Schulter ist etwas<br />
hochgezogen, beide Schultern sind leicht vorgezogen; die Arme sind eng am Körper anlie-<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 25
Foto 1<br />
O.F. von vorne,<br />
Pronation der Hände.<br />
Foto 2<br />
O.F. von hinten.<br />
Foto 5 Foto 6<br />
Normal bewegliche Brustwirbelsäule.<br />
Foto 9<br />
LWS sehr unbeweglich.<br />
Foto 10<br />
Wandlage: Kopf fällt<br />
stark in Nacken;<br />
Becken abgehoben –<br />
Knie nur leicht<br />
gebeugt.<br />
Foto 3<br />
O.F. von der linken<br />
Seite, Knie durchgedrückt.<br />
Foto 4<br />
O.F. von der rechten<br />
Seite.<br />
Foto 7 Foto 8<br />
Oberkörper neigt stark zur Seite.<br />
Um Stabilität zu erreichen, hält sich O.F. an<br />
den Beinen fest.<br />
Foto 11<br />
Foto 12<br />
Becken auf Unterlage – Arme neben Kopf:<br />
Knie stark gebeugt. stehend von der Seite;<br />
leichte Vorlage, Knie<br />
gestreckt<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 26
gend und die Handhaltung zeigt eine Pronation – als Folge der vorgezogenen Schultern;<br />
der Hals ist überstreckt; leichte Schiefhaltung des Kopfes nach rechts; der Stand ist im<br />
Lot; der Körpertonus wirkt erhöht.<br />
Bei der Wandlage ist es O.F. nicht möglich, das Gesäss direkt an die Wand zu geben und<br />
die Beine senkrecht zu strecken. Versucht er, die Beine zu strecken, wird das Becken abgehoben<br />
(Foto 10). Sobald das Becken Bodenkontakt hat, sind die Knie stark gebeugt (Foto<br />
11). Der Kopf sinkt aufgrund der Kyphose in den Nacken. Die Gesäss-, hintere Oberschenkel-<br />
und Lendenwirbelbereichsmuskulatur ist stark verkürzt (gut ersichtlich auf Foto 9).<br />
Im Sitzen mit angewinkelten Beinen neigt der Oberkörper stark zur Seite. Die beiden<br />
Hüftgelenke – vor allem das rechte – sind nur beschränkt beweglich. Um eine Stabilität<br />
des Rumpfes zu erreichen, ist ein Festhalten an den Beinen nötig (gut ersichtlich auf Foto<br />
7 und 8).<br />
In der Seitenlage, beim Senken des Rückens Richtung Boden, zeigt sich deutlich, dass die<br />
Brustwirbelsäule der beweglichste Teil der Wirbelsäule ist (siehe Foto 5 und 6).<br />
5.2.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong><br />
Am Anfang konnten wir unsere Stunden in regelmässigen Abständen abhalten. Dank der<br />
Pensionierung des Probanden gab es kaum zeitliche Koordinationsprobleme. Das war ein<br />
grosser Vorteil. Zwischen April und Dezember 2006 musste sich O.F. unerwartet zwei Operationen<br />
unterziehen. Dadurch entstand nach der 13. Stunde ein Unterbruch von ca. zwei<br />
Monaten. Danach hatten wir beide – der Proband und ich – grosse Wiedereinstiegsschwierigkeiten.<br />
Der Unterbruch war am Anfang sichtbar in O.F.s Bewegungen. Nach der zweiten<br />
Operation (17. Stunde) gab es keinen Unterbruch mehr. Die operierte Hand konnte er<br />
danach aber nicht voll einsetzen.<br />
Ich freute mich, O.F. mit meiner Arbeit etwas vertrauter zu machen, und war erstaunt, wie<br />
er sich darauf einlassen konnte. Ich spürte keine Hemmungen seinerseits. Er gab mir den<br />
Eindruck, dass er sich wohl fühlte. Das Ausfüllen der Fragebogen nach jeder absolvierten<br />
Stunde empfand O.F. als überflüssig und lästig: «Immer dieselben Werte eintragen!»<br />
Es brauchte von mir Überzeugungsarbeit, was ich wiederum auch als mühsam empfand.<br />
O.F. empfand die verbale Anleitung angenehm und nicht befremdend.<br />
O.F. zeigte sich immer sehr konzentriert und gewissenhaft. Er wollte die Anleitungen stets<br />
möglichst genau ausführen. Zu Beginn der Stunde im Stehen spürte ich manchmal eine<br />
gewisse Ungeduld oder Langeweile, aber nur, wenn der Fokus auf der Körperwahrnehmung<br />
lag. Dies verunsicherte mich anfänglich. Die Bewegungen im Raum stiessen bei O.F.<br />
grundsätzlich auf Interesse und er liess sich auf die Herausforderungen wie Rückwärtsgehen<br />
mit Gegenbewegung oder andere koordinative Bewegungen ein.<br />
Bei der Schulung der Eigenwahrnehmung spürte ich immer wieder Ungeduld, eine Abwehrhaltung<br />
oder einen leicht verärgerten Ausdruck. Sein Kommentar dazu: «Ich spüre<br />
nichts». Empfindungen wie Schwere, mehr Bodenkontakt, mehr Leichtigkeit oder Gelöstheit<br />
etc. waren für ihn nicht nachvollziehbar. Trotzdem vermittelten ihm die Bewegungen<br />
ein gutes Gefühl, das er aber nicht näher beschreiben konnte.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 27
Wenn die Stunde Bewegungsabläufe beinhaltete, die aufgrund seiner physiologischen<br />
Strukturen Ausführungsschwierigkeiten unterlagen (wie Beine strecken in Rückenlage<br />
oder bei der Arbeit an der Stange, Oberkörper aufrichten [Wirbel um Wirbel aufrollen] vor<br />
allem in den folgenden Ausgangslagen: auf den Fersen sitzend, Oberkörper über den Beinen<br />
eingerollt), meinte er jeweils, ich hätte mir eben eine jüngere Person aussuchen müssen,<br />
eine alte Person könne man nicht mehr ändern. Dies blieb abzuwarten.<br />
Die 20 Lektionen waren – wie in Kapitel «Vorgehensweise/Material» erwähnt – in vier Themenblöcke<br />
eingeteilt, die wir aber in Folge der Operation dann nicht planmässig einhielten.<br />
Die ersten fünf Stunden bestanden aus dem Kreisaufbau. Obwohl der Aufbau sehr variierte,<br />
empfand es O.F. als eintönig und immer gleich. Er konnte die einzelnen Bewegungen<br />
demzufolge nicht differenziert wahrnehmen. Wir benutzten in dieser Phase praktisch<br />
nur die Wandlage, die für ihn nicht sehr angenehm war (später wechselten wir in den<br />
Raum). Die Gesäss-, hintere Oberschenkelmuskulatur und der Lendenbereich sind bei O.F.<br />
sehr verkürzt (siehe Foto 9, Bestandesaufnahme am Anfang). Daher ist es nicht verwunderlich,<br />
dass er diese Lage, aber auch die Beinarbeit, als anstrengend empfand. Ausserdem<br />
engte ihn diese Lage ein. Beim Aufrollen des Oberkörpers (auf den Fersen sitzend)<br />
war sehr gut ersichtlich, dass der Lendenwirbelbereich total steif ist. Es gelang ihm nicht,<br />
hochzukommen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.<br />
Allgemeine Beobachtungen, die sich während des ganzen Verlaufes immer wieder zeigten:<br />
Die verbalen Anleitungen konnte O.F. mit hoher Konzentration präzis umsetzen. Die Körperteile<br />
wurden immer richtig zugeordnet. Im Raum fühlte er sich sicher, war präsent. Für<br />
ihn gestaltete sich die Raumorientierung weder auf dem Boden noch im freien Raum als<br />
schwierig.<br />
Der Hals- und Kieferbereich war vielfach angespannt und somit waren die Bewegungen<br />
nicht durchlässig bis in die Halswirbelsäule. Wenn ich ihn auf die Gegenbewegung in der<br />
HWS hinwies, wurde die Bewegung «gemacht». Mit dem Kopf konnte O.F. vieles steuern.<br />
Loslassen und Kontrolle abgeben waren für O.F. aber eher schwierig. Viele Bewegungsabläufe<br />
wirkten auf mich wie eine grosse körperliche Anstrengung, sowohl bei zur Lösung<br />
gedachten als auch bei kräftigenden Abläufen. Bei der Nachfrage, ob dies nun sehr<br />
anstrengend war, verneinte er jedes Mal. O.F.s Verhalten wirkte auf mich sehr leistungsorientiert.<br />
Lösende Momente geschahen wenige, er gähnte auch praktisch nie.<br />
Das Thema des zweiten Blocks war der Kraftaufbau (Rumpf, Rücken, Bauch, Seitendehnungen).<br />
In diesen Stunden bewegten wir uns meistens frei im Raum. Diese Lage behagte<br />
O.F. viel mehr. Die Stunden gefielen ihm besser. Vor allem jene, die einen Trainingsanteil<br />
aufwiesen. Bei der Arbeit zum Muskelaufbau war O.F. der Meinung: je schneller, desto<br />
mehr Nutzen. Er begann jeweils sofort mit der Ausführung. Die Atmung wurde laut und es<br />
wirkte wie eine Übung und sah nicht nach einem erspürenden Bewegungsablauf aus.<br />
Durch die Anleitung, mit der Ein- und Ausatmung zu arbeiten, gelang es ihm, das Tempo<br />
zu drosseln und sich auf die Atmung einzulassen. Die Bewegung mit der Atmung zu koordinieren,<br />
schien für ihn oft sehr schwierig zu sein. In der sechsten Stunde fiel mir während<br />
der Diagonalen auf, dass das Hinken beim Gehen weniger sichtbar war – für O.F. keine<br />
wahrnehmbare Veränderung.<br />
Im nächsten Teil begann ich mit der Arbeit an den Beinen, Hüften, Becken, Füssen. Ich zog<br />
diesen Block dem dritten Block (Schultergürtel, Arme, Nacken, Brustbein) vor, da ich mir<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 28
dachte, dass diese Bewegungen unmittelbar nach der Operation nicht möglich sein würden.<br />
Nach drei Stunden mussten wir dann wegen besagter Operation zwei Monate pausieren. Bei<br />
diesem Themenblock kam vor allem O.F.s instabiles Gleichgewicht zum Ausdruck. Ein<br />
Thema, das O.F. sehr gut kennt. Bei Dunkelheit nimmt er beim Gehen ein Schwanken wahr.<br />
Er empfand die Anleitung «Beine in Streckung bringen» oder «mit gestreckten Beinen»<br />
eher lästig, weil es für ihn ein Ding der Unmöglichkeit war. Ich merkte, dass diese Sätze bei<br />
mir schon automatisiert sind und dass die verbale Anleitung je nach Teilnehmer abgeändert<br />
werden sollte, um nicht ein ständiges Insuffizienzgefühl hervorzurufen. Die Unbeweglichkeit<br />
der Hüfte war sehr auffallend; dies zeigte sich vor allem beim Hüftekreisen in verschiedenen<br />
Lagen, beim Räkeln und bei Schrittfolgen in der Diagonalen.<br />
Obwohl O.F. nach der langen Pause betonte, dass wieder alles in Ordnung sei (ohne<br />
Schmerzen und Einschränkungen), begann ich nun trotzdem mit der Arbeit am Schultergürtel.<br />
Wir wussten damals noch nicht, dass nach der 17. Stunde die zweite Operation<br />
dazwischen fallen würde. Diese verursachte dann aber keine weitere Verzögerung des<br />
Ablaufes mehr.<br />
Nach der zweimonatigen Pause wirkten O.F.s Bewegungen anfänglich wieder steifer, die<br />
Muskulatur angespannter, das Kreisen der Gelenke weniger rund, das Fallenlassen zurückhaltender.<br />
Er empfand die Stunden nach der Operation fast wieder wie ein Neustart und<br />
vieles von vorher war vergessen. Dies wurde ihm beim Ausfüllen des Fragebogens nach<br />
der 15. Stunde bewusst. Bewegungsabläufe, die schwerpunktmässig den Schultergürtel<br />
betrafen, waren für O.F. aber grundsätzlich einfacher auszuführen. Der Schultergürtel liess<br />
mehr Bewegungsfreiheit zu und koordinative Abläufe mit den Armen gelangen ihm sehr<br />
gut.<br />
O.F. spürte im letzten Viertel in manchen Stunden Schmerzen in den Gelenken, vor allem<br />
in den Knien, der Hüfte und den Füssen. Diese schränkten ihn aber im Bewegungsverhalten<br />
nicht ein, oder er biss auf die Zähne. Er wies mich kaum auf seine Schmerzen hin und<br />
klagte während der Stunden nie. Ich musste immer wieder nachfragen, ob diese oder jene<br />
Bewegung Schmerzen bereitete. Die Stunden brachten diesbezüglich keine Verbesserungen.<br />
Anders verhielt es sich bezüglich der starken Verspannungen bzw. Schmerzen im<br />
Lendenwirbelbereich (16. und 19. Stunde), die während dieser letzten Phase zweimal auftraten.<br />
Ich widmete mich während dieser beiden Stunden diesem Thema. Die Schmerzen<br />
konnten gelindert werden oder verschwanden sogar.<br />
Als ich das Thema Gleichgewicht in einer Stunde behandelte, war O.F. sehr aufmerksam<br />
dabei. Wenn er etwas erlernen konnte, was für ihn ersichtlich zu einer Besserung seines<br />
Zustandes verhalf, war sein Verhalten etwas anders, nämlich interessierter und motivierter.<br />
Solche Veränderungen waren aber schwer erkennbar, da er ein sehr ausgeglichenes<br />
Auftreten an den Tag legte.<br />
Die Diagonalen waren immer eine Herausforderung. Ich hatte aber den Eindruck, dass<br />
ihm die Musik und die Bewegungen Freude bereiteten. O.F. war immer sehr bemüht, alles<br />
richtig auszuführen. Einfache Schrittvariationen waren grosse koordinative und rhythmische<br />
Herausforderungen für ihn. Die Bewegungen waren etwas steif und ungelenk. Das<br />
instabile Gleichgewicht war bei langsamen Bewegungen sofort ersichtlich. Die Ansprüche<br />
bei der Diagonalen gaben ihm ein Ziel, stachelten seinen Ehrgeiz an, sich zu verbessern.<br />
Das instabile Gleichgewicht war bei langsamen Bewegungen sofort ersichtlich. Ohne meine<br />
Aufforderung übte er aber zum Beispiel Rückwärtsgehen mit Gegenbewegung.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 29
O.F. war froh, als die letzte Stunde abgeschlossen werden konnte. Es bereitete ihm mittlerweile<br />
Mühe, immer abrufbar zu sein. Obwohl ihm die Bewegungen grundsätzlich ein<br />
gutes Gefühl vermittelten (das er aber nicht näher beschreiben konnte), möchte er sich<br />
doch lieber wieder dem Spiel und/oder der Kraft zuwenden.<br />
5.2.4 Verlauf aus Sicht des Probanden O.F.<br />
«Fragebogen klein» von O.F.:<br />
1.<br />
Wie war Ihre Motivation am Anfang<br />
der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
3.<br />
Wie haben Sie sich gegen Ende der<br />
Stunde konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
2.<br />
Wie haben Sie sich während der Stunde<br />
konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4.<br />
Wie entspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 30
5.<br />
Wie verspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
7.<br />
Wie schlaff/ermüdet fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
9. Wie ist Ihr körperliches Befinden allgemein? (wohlig, schwindlig, kribbelig …;<br />
fühlen sich einzelne Körperteile irgendwie anders an? Etc.)<br />
Wohlig, fit. Kein Unterschied zwischen den einzelnen Körperteilen spürbar. Schmerzen im Lendenwirbelbereich,<br />
in den Fussgelenken, in der rechten Schulter sind nicht spürbar während und nach den Bewegungen;<br />
schmerzfrei nach den Stunden mit Fokus Lendenwirbelbereich (16. und 19. Stunde).<br />
10.<br />
Wie gut ist Ihr psychisches Wohlbefinden,<br />
wie gut ist Ihre Stimmung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
6.<br />
Wie angeregt/wach fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
8.<br />
Wie gut ist Ihr körperliches Wohlbefinden<br />
in Bezug auf die Körperwärme?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
11.<br />
Wie angenehm war für Sie die verbale<br />
Anleitung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 31
12.<br />
Wie verständlich war für Sie die<br />
verbale Anleitung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
14.<br />
Haben Sie sich während der Stunde<br />
oft Gedanken gemacht über den Sinn<br />
der Bewegungen?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
15. Hätten Sie gerne mehr Erklärungen?<br />
Keine Erklärungen zu den Bewegungsabläufen erforderlich<br />
16. Evtl. Bemerkungen zu einzelnen Fragen<br />
zum Teil «komische» Fragen in den Fragebogen wie über das Körperempfinden; überflüssig, nach jeder<br />
Stunde den gleichen Bogen auszufüllen und dieselben Werte einzusetzen; finde gewisse Lagen und Bewegungen<br />
anatomisch sinnlos, z.B. in Seitenlage Rücken Richtung Boden sinken lassen, beidseitig Schultern<br />
kreisen, Seiten dehnen.<br />
«Fragebogen gross» von O.F.:<br />
13.<br />
Wie angenehm waren für Sie die<br />
Bewegungen ganz allgemein?<br />
Die verbale Anleitung war für O.F. sehr verständlich und auch angenehm. Wenn er etwas<br />
missverstand, lag es am reduzierten Hörvermögen von O.F. Dass Bewegungen nicht vorgemacht<br />
wurden, war für O.F. überhaupt nichts Aussergewöhnliches. Er erklärte mir, dass<br />
auch in der Männerriege zum Teil so angeleitet würde. Ohne Kommentar seitens der Diplomandin<br />
nahm O.F. an, dass die Bewegungen korrekt ausgeführt wurden. (Anmerkung der<br />
Diplomandin: einige Male bei Unsicherheiten liess sich O.F. rückversichern, ob die Bewegungen,<br />
so wie er sie ausführte, wirklich richtig gemacht wurden.)<br />
Die verschiedenen Lagen empfand er ganz unterschiedlich. Die Wandlage engte O.F. ein.<br />
Er fühlte sich dabei in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Er empfand die Lage sehr unbe-<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 32
quem und anstrengend bei der Beinarbeit, da es ihm nicht mehr möglich war, die Knie zu<br />
strecken.<br />
Die Seitenlage und die Bauchlage sowie die Lage allgemein im freien Raum empfand<br />
O.F. viel angenehmer. Er fühlte sich freier dabei.<br />
Ich gestaltete den Einstieg in die Stunden meistens spontan – je nach Bedürfnis. Ich<br />
benutzte dazu nie Musik. Ich wollte dabei vor allem die Koordination fördern und die<br />
Atmung anregen. Er schätzte die koordinative Herausforderung und das konditionelle Einbewegen.<br />
Weniger behaglich war ihm die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmung.<br />
Bei den Diagonalen blieb ich meistens bei einfacheren Grundschritten (ausser am<br />
Anfang), inklusive rückwärts Gehen. Er bekundete Mühe beim langsamen Gehen, da nahm<br />
er seine Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht wahr. Sich zur Musik zu bewegen, gefiel<br />
ihm. Für O.F. war dies etwas zwischen Marsch und Tanz.<br />
Die Bewegungsabläufe befremdeten ihn anfänglich zum Teil etwas. Während des Verlaufes<br />
veränderte sich dies aber, und etwa ab der Hälfte der Stunden begannen sie ihm<br />
grundsätzlich zu gefallen. Übungen mit Krafteinsatz hätte er aber trotzdem bevorzugt.<br />
Einige Bewegungen blieben bis zum Schluss ungewohnt, zum Beispiel das Schulternkreisen<br />
in Seitenlage (oberer Rücken Richtung Boden). Gewisse Lagen und Bewegungen fand<br />
er anatomisch sinnlos. Die Einstellung zu den Grundlagenstunden PSFL veränderte sich bei<br />
O.F. mit der Zeit: Das Pflichtgefühl vermischte sich mit Freude.<br />
O.F. hatte sich pflichtbewusst auf das Unbekannte eingelassen. Er stellte sich unter dem<br />
Begriff «Grundlagenstunde PSFL» überhaupt nichts vor und liess sich einfach überraschen.<br />
Die Stunden entsprachen nur teilweise seinem Bewegungsbedürfnis, nämlich dann,<br />
wenn es sich um Schmerzlinderung handelte. Sonst bevorzugt O.F. Kraft- und Ausdauersport,<br />
aber auch Spiel und Spass.<br />
Veränderungen – seien sie im physischen oder psychischen Bereich oder Verhaltens- und<br />
Einstellungsveränderungen – konnte O.F. nach Ablauf des «Unterrichts» keine feststellen.<br />
Die Stunden beeinflussten weder das psychische Wohlbefinden noch das Bewegungsverhalten<br />
im Alltag grundsätzlich.<br />
Vorhandene Schmerzen konnten teilweise während einer Stunde reduziert werden oder sie<br />
verschwanden ganz. O.F. ist überzeugt, dass die Bewegungsabläufe bei einer Rehabilitation<br />
sehr gut eingesetzt werden könnten oder um bei Muskelschmerzen eine Linderung zu<br />
erzielen. Er nutzt jetzt die Möglichkeit, diese Bewegungen bei allfälligen Schmerzen selber<br />
einzusetzen. Jederzeit würde er die Grundlagenstunden PSFL Männern zur Rekonvaleszenz,<br />
bei starken Verspannungen und Schmerzen anderer Art weiterempfehlen.<br />
O.F. bewegt sich lieber in einer reinen Männergruppe, wobei er eine Frau als Leiterin ganz<br />
und gar akzeptieren würde.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 33
Wie schätzen Sie sich ein auf einer Skala von 1 bis 10?<br />
(1 = gar nicht, 10 = sehr)<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
beweglich kräftig konditionell<br />
fit<br />
Koordination Rhythmusgefühl<br />
vor der 1. Stunde nach der 10. Stunde nach der 20. Stunde<br />
nach der 5. Stunde nach der 15. Stunde<br />
Die Werte blieben über die ganze Zeit recht konstant. Die einzige grösser variierende Zahl<br />
war der Wert des Rhythmusgefühls nach der fünften Stunde. Die tiefe Wertung entstand<br />
wahrscheinlich dadurch, dass ich anfänglich höhere Anforderungen in der Diagonalen<br />
gestellt hatte. Diesbezüglich hätte O.F. aus meiner Sicht auch die Koordination anders werten<br />
sollen.<br />
5.2.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006)<br />
Innerhalb der acht Monate musste sich O.F. einer stationären und einer ambulanten Operation<br />
unterziehen. Die erste Operation veränderte sein alltägliches Bewegungsverhalten.<br />
Er durfte keine körperlichen Anstrengungen mehr betreiben; so fielen die morgendliche<br />
Gymnastik, Bergwanderungen sowie die wöchentliche Fitnessstunde aus. Die Wunden der<br />
Operationen verheilten. Die Schmerzen aber, welche schon bei der «Bestandesaufnahme<br />
am Anfang» festgehalten wurden, hatten sich nicht reduziert.<br />
Wie die folgenden Fotos zeigen, sind körperliche Veränderungen eingetreten.<br />
In der Wandlage bringt O.F. sein Gesäss näher zur Wand (Foto 10). Die Knie sind gestreckter.<br />
Wenn er den Oberkörper nach vorne beugt, sind auch hier die Knie gestreckter. Der<br />
Rücken wirkt runder, vor allem die Lendenwirbelsäule (Foto 9).<br />
Beim Sitzen mit angewinkelten Beinen neigt sich der Oberkörper nicht mehr so stark zur<br />
Seite. O.F. muss sich nicht mehr an den Beinen festhalten, um das Gleichgewicht zu stabilisieren<br />
(Foto 7 und 8).<br />
Hält O.F. die Arme neben dem Kopf, steht er jetzt im Lot (Foto 12). Die leichte Vorlage ist<br />
nicht mehr ersichtlich. Die Brustwirbelsäule zeigt sich beweglicher (Foto 5 und 6).<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 34
Foto 1<br />
O.F. von vorne<br />
Foto 9<br />
Beine gestreckter –<br />
Lendenwirbelsäule<br />
wirkt runder.<br />
Foto 2<br />
O.F. von hinten<br />
Foto 5 Foto 6<br />
Brustwirbelsäule ist beweglicher.<br />
Foto 3<br />
O.F. von links<br />
Foto 10<br />
Foto 11<br />
Gesäss näher an Wand, Arme neben Kopf; von<br />
Knie etwas gestreckter. vorne.<br />
Foto 4<br />
O.F. von rechts<br />
Foto 7 Foto 8<br />
Rücken neigt sich nur noch wenig.<br />
Foto 12<br />
Arme neben Kopf;<br />
von der Seite.<br />
O.F. steht im Lot.<br />
15 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 35
5.2.6 Vergleich zwischen Sicht Proband O.F. und Diplomandin <strong>Ruth</strong> <strong>Fässler</strong><br />
Die Stunden zeichneten sich durch hohe Stabilität aus in Bezug auf Konzentration, Bewegungsausführung,<br />
Motivation und psychisches Wohlbefinden. Wenn Veränderungen<br />
stattfanden, dann geschahen sie langsam und kaum ersichtlich zwischen den einzelnen<br />
Stunden. Ich kann deshalb gut verstehen, dass diese Unterschiede vom Probanden O.F.<br />
kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden. Ich selber war auch sehr erstaunt über diese<br />
sichtbaren Unterschiede bei dem Vergleich der Fotos zwischen der Bestandesaufnahme<br />
am Anfang und am Ende.<br />
Es ist für mich deshalb verständlich, dass die Werte (siehe Grafiken «Fragebogen klein und<br />
gross») sehr konstant blieben. Wenn ich diese Werte mit dem Verlauf vergleiche, stelle ich<br />
fest, dass sich O.F. überschätzte oder die Begriffe anders verstand als wir. Beginnen wir<br />
mit der Beweglichkeit. Obwohl dem Probanden selber ganz klar war, dass der Lendenwirbelbereich<br />
versteift ist, die Knie nicht mehr gestreckt werden können und das Becken<br />
nicht sehr beweglich ist, schätzte er sich als sehr beweglich ein. Er betrachtete wohl den<br />
Körper an und für sich und nicht die einzelnen Gelenke.<br />
Die Werte bei der Kraft und der Kondition zu vergleichen, ist schwierig, da in den Stunden<br />
diese Bereiche zum Teil kaum Thema waren. Was ich hier bemerken möchte, ist, dass<br />
sich O.F. wirklich ausdauernd mit zum Teil anstrengenden Bewegungsabläufen auseinandersetzte<br />
und beharrlich dabei blieb.<br />
In den Diagonalen waren die Koordination und das Rhythmusgefühl am einfachsten zu<br />
beobachten. Erstaunlich auch hier die hohen Werte. Schrittfolgen waren für O.F. rhythmisch<br />
und koordinativ oft schwierig umzusetzen, zum Beispiel das Rückwärtsgehen mit<br />
Gegenbewegung oder die komplexere Tupf/Tupf/Schritt-Variation. Am Schluss aller Stunden,<br />
als wir das komplexe Thema noch einmal aufgriffen, klappte es auf einmal – zu meiner<br />
Verwunderung. Die Herausforderungen spornten ihn an. Ziele zu kennen und so Leistung<br />
zu steigern, war offensichtlich etwas Wünschenswertes für O.F.<br />
Eine Auseinandersetzung zwischen dem Probanden und der Diplomandin über die<br />
Methode passierte nicht. Seine Einstellung war eher unkritisch. Obwohl er einige Male<br />
betonte, dass es zum Teil anatomisch sinnlose Bewegungen auszuführen gab, wollte er<br />
nie eine nähere Auskunft dazu oder hatte dies zumindest nicht angedeutet. Auf meine<br />
Fragen erhielt ich knappe, zum Teil ausweichende Antworten. O.F. bedeuteten die Fragen<br />
auf den Fragebogen nicht viel. Vor allem Begriffe wie «psychisches Wohlbefinden»,<br />
«Körperwahrnehmung» und «Körperempfinden» hatten für ihn keine klare Bedeutung.<br />
Die Grafiken zeigen aber auch in diesen Bereichen hohe, konstante Werte. Die Bewegungsabläufe<br />
wirkten aber auf mich oft wenig entspannt oder gelöst. Angeleitete Bewegungen,<br />
die ein Fallenlassen eines Körperteils beinhalteten, wurden oft auch «geführt».<br />
Trotzdem erscheint zum Beispiel in der Grafik mit der Frage «Wie entspannt fühlen Sie<br />
sich?» ein konstant hoher Wert. Auch das Schulen der Eigenwahrnehmung war schwierig.<br />
O.F. reagierte ungeduldig und beim Nachspüren konnte er keine Unterschiede erkennen.<br />
Aus meiner Sicht ergeben sich in diesen Bereichen andere Werte als die von O.F. angegebenen.<br />
Die Fähigkeiten bezüglich differenzierter Körperwahrnehmung und Erkennen der<br />
eigenen Bedürfnisse sind bei O.F. nicht sehr ausgeprägt.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 36
Die beiden Verläufe – aus Sicht des Probanden sowie der Diplomandin – zeigen, dass das<br />
Körperliche im Vordergrund stand; der psychische Anteil nahm einen geringeren Stellenwert<br />
ein.<br />
5.2.7 Fazit<br />
Diese Diplomarbeit ermöglichte mir eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grundlagen<br />
PSFL. Ich profitierte dabei in zweierlei Hinsicht: im Austausch mit meinen Kolleginnen<br />
und bei der Arbeit mit meinem Probanden.<br />
Obwohl mein Proband für weitere Grundlagenstunden PSFL nicht zu gewinnen wäre, könnte<br />
ich ihn mir bestens dabei vorstellen, vor allem bezüglich der Möglichkeit, über Bewegungen<br />
körperliche Veränderungen und somit auch eine Wirkung auf die Psyche zu<br />
erzielen. Trainingsstunden würden O.F. viel eher zusagen, da er Bewegungen mit Kraft und<br />
Ausdauer schätzt. Ein Hindernis dabei wäre aber seine Unbeweglichkeit und die verkürzten<br />
Sehnen und Muskeln vor allem im Lendenwirbelbereich und in den Beinen. Die Diagonale<br />
mit den komplexen Schrittfolgen, die eine gewisse Koordination, Rhythmusgefühl<br />
und Gleichgewicht voraussetzen, wäre zudem eine Überforderung. Falls ich O.F. weiterhin<br />
Einzelarbeit anbieten würde, käme nur eine Mischform in Frage: Grundlagen mit vielen Trainingselementen<br />
und eine defizitorientierte Gestaltung der Stunden mit Themen wie zum<br />
Beispiel Gleichgewicht und Koordination. Das gäbe O.F. einen ersichtlichen Grund und er<br />
würde sich herausgefordert fühlen.<br />
Ich werde O.F. im Moment aber keine Einzellektionen anbieten, was er bestimmt nicht<br />
bedauert. An einem öffentlich ausgeschriebenen Kurs für Grundlagenstunden PSFL würde<br />
er nie teilnehmen. Er betonte aber immer wieder, dass er sich diese Arbeit bestens in der<br />
Rekonvaleszenz vorstellen könnte. Ausserdem bevorzugt O.F. eine reine Männergruppe<br />
und würde sich als einziger Mann unter vielen Frauen unwohl fühlen.<br />
Weitere Gründe, weshalb O.F. in einer Grundlagenstunde PSFL nicht anzutreffen wäre, sind<br />
die fehlenden spielerischen, kräftigenden und ausdauernden Elemente. Ich denke<br />
aber, dass ihm auch eine Trainingsstunde PSFL, welche das Kräftigende und Ausdauernde<br />
anbietet, nicht vollumfänglich gefallen würde. Das Spielerische sowie der Austausch und<br />
Kontakt mit den Kollegen würden ihm fehlen.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 37
5.3 Proband U.H. / Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong><br />
5.3.1 Voraussetzungen<br />
U.H. war zu Beginn der Diplomarbeit 43-jährig und bei guter Gesundheit. Er ist sehr<br />
schlank (hatte noch nie Gewichtsprobleme). Sporadisch leidet er unter Rückenschmerzen,<br />
was er seinem Bewegungsmangel zuschreibt. Vor allem im Frühling schränkt seine Pollenallergie<br />
die Lebensqualität ein, da sie ihn extrem müde macht und ihn auch daran hindert,<br />
sich im Freien zu bewegen. Zudem besteht eine Allergie auf gewisse Lebensmittel.<br />
Er fühlt sich aber grundsätzlich gesund.<br />
Als IT-Consultant verbringt er die meiste Arbeitszeit (durchschnittlich 52 Stunden/Woche)<br />
vor dem Computer (45 Stunden) bzw. am Steuer (7 Stunden). U.H. ist sich<br />
bewusst, dass er sich zu wenig bewegt. Grundsätzlich hat er viel Freude an Bewegung. Er<br />
hat zwölf Jahre auf Vereinsebene Badminton gespielt und da an verschiedenen Wettkämpfen<br />
teilgenommen. U.H. ist ein leidenschaftlicher Skifahrer (2 Wochen/Jahr), geht inlineskaten<br />
(unregelmässig) und tanzt gerne in der Disco. Seit einem Jahr spielt er wieder regelmässig<br />
Badminton. U.H. beobachtet an sich selbst, dass er im unteren Rücken sehr unbeweglich<br />
und die Bauchmuskulatur zu wenig trainiert ist. Generell besteht ein Bedürfnis<br />
nach mehr Bewegung. Etwa mal plagt ihn auch das schlechte Gewissen.<br />
Aus beruflichen Gründen besteht einfach oft keine Möglichkeit für Bewegungsaktivitäten,<br />
was er selbst als sehr negativ empfindet. Er möchte aber prinzipiell wieder mehr für seine<br />
Gesundheit tun, vor allem, was Bewegung betrifft. Die Probandenrolle für die Diplomarbeit<br />
kam U.H. aus diesen Gründen sehr gelegen.<br />
5.3.2 Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)<br />
U.H. war grundsätzlich und von Anfang an sehr engagiert in dem Projekt. Er hinterfragte<br />
viel und war allgemein ein kritischer Proband. Das hatte für mich zur Folge, dass ich mich<br />
sehr intensiv mit der Methode auseinandersetzen musste – prinzipiell natürlich ein Vorteil,<br />
auch wenn es mir manchmal etwas mühsam erschien und ich meine Kompetenz in Frage<br />
gestellt sah.<br />
Vorbehalte gegenüber der Methode an und für sich bestanden bei U.H. keine.<br />
Die Bestandesaufnahme vom April 2006 zeigt ein paar kleine Anomalien in seinem Körperbau;<br />
so hat er in der Halswirbelsäule eine minimale Skoliose nach links und in der<br />
Lendenwirbelsäule eine minimale Skoliose nach rechts (Foto 4), wobei die Wirbelsäule<br />
sonst eine sehr schöne Doppel-S-Form vorweist. Seine linke Schulter ist ca. 1,5 cm<br />
höher als die rechte und das linke Schlüsselbein liegt steiler als das rechte (Foto 1). Diese<br />
Schulter hält sozusagen nur lose zusammen, da vor etwa 15 Jahren bei einem Sturz<br />
zwei Bänder gerissen sind, die weder genäht wurden noch von selbst wieder zusammengewachsen<br />
sind. Dass die linke Schulter dennoch höher liegt als die rechte, könnte daran<br />
liegen, dass die Haltefunktion der fehlenden Bänder durch Muskelkraft und allgemeinen<br />
Muskelzusammenzug kompensiert wird (daher vielleicht auch die allgemeinen Verspan-<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 38
nungen im Schultergürtel). Aufgrund eines Armbruchs ist sein linker Arm im Ellenbogengelenk<br />
krumm gegen innen gebogen, der Unterarm gegen aussen, was sich auch auf die<br />
Handstellung auswirkt (Foto 2; Supination).<br />
Diese Unregelmässigkeiten hatten und haben meiner Ansicht nach keine Auswirkung auf<br />
U.H.s Bewegungsmuster. Sie verursach(t)en auch keinerlei Schmerzen.<br />
Foto 1<br />
Linke Schulter höher<br />
als rechte.<br />
Foto 2<br />
Stellung linker Arm;<br />
Supination der Hand.<br />
Foto 3<br />
Durchgestreckte Knie,<br />
leichte Rücklage.<br />
Foto 4<br />
Skoliose in unterer<br />
Brustwirbelsäule nach<br />
rechts.<br />
Im Stehen waren U.H.s Knie durchgestreckt (dementsprechend das Becken nach vorne<br />
geneigt) und er befand sich mit dem Oberkörper in einer leichten Rücklage (Foto 3).<br />
Auffallend ist die ungleichmässige Abnützung seiner Schuhe (Foto 8). U.H. klagte über<br />
Schmerzen beim Abrollen des rechten Fusses. Aufgrund dieser Schmerzen rollte er den<br />
Fuss nicht über die Sohle ab, sondern über die Aussenkante. Sein Gang wirkte wohl daher<br />
zum Teil etwas gehalten, das heisst, im Schultergürtel fand kaum Gegenbewegung statt;<br />
die Arme führten trotzdem eine Gegenbewegung aus.<br />
U.H.s Beweglichkeit im mittleren/oberen Rücken (Foto 5/6) war sehr gut.<br />
Foto 5 Foto 6<br />
Foto 7<br />
Gute Beweglichkeit im mittleren/oberen Rücken. Wenig bewegliche<br />
Lendenwirbelsäule.<br />
Foto 8<br />
Abnützung des rechten<br />
Schuhes.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 39
Im unteren Teil hingegen war U.H.s Wirbelsäule recht steif (Foto 7/9/10). Interessant<br />
ist, dass U.H. seine Beweglichkeit am Anfang besser einstufte (6 Punkte) als am Schluss<br />
(5 Punkte, Grafik Seite 48), obwohl der Verlauf gerade umgekehrt war. Das hat wohl damit<br />
zu tun, dass U.H. an seine Grenzen stiess und sich auch mit mir verglich.<br />
Auf dem Rücken liegen und dabei die Beine an die Wand stellen war nur bedingt möglich;<br />
U.H. musste dafür das Becken recht weit die Wand hinaufschieben (Foto 11). Zudem<br />
fand er diese Lage unangenehm.<br />
Foto 9<br />
Rücken Beugen mit<br />
gestreckten Knien.<br />
Foto 10<br />
Rücken Beugen mit<br />
gelösten Knien.<br />
Foto 11<br />
Beine an Wand.<br />
Foto 12<br />
Unterschiedliche Haltung<br />
der Arme aufgrund<br />
von Ellenbogenbruch<br />
(links).<br />
Bemerkenswert in der Position auf Foto 12 ist die unterschiedliche Haltung der Arme<br />
(aufgrund des falsch zusammengewachsenen Ellenbogens nach einem Unfall). Die Schultern<br />
sind gelöst, die Handflächen schauen sich an (ohne besondere Aufforderung dazu).<br />
Äusserst unangenehm fand U.H., mit gestreckten Beinen und geradem Oberkörper dazusitzen,<br />
was ich auch auf die mangelhafte Dehnung im unteren Rücken, Gesäss und auf der<br />
Rückseite der Oberschenkel zurückführte. Meiner Ansicht nach fehlte es U.H. auch an Haltemuskulatur<br />
(auch bei anderen Bewegungsabläufen, die viel Haltemuskulatur erforderten,<br />
zeigte U.H. Defizite), was er jedoch überhaupt nicht so sah. Er meinte immer, das<br />
Foto 13<br />
Foto 14<br />
Einigermassen ent- So aufrecht wie mögspannt<br />
aufrecht sitzen. lich sitzen, extrem<br />
anstrengend.<br />
Foto 15<br />
Beweglichkeit der<br />
linken Hüfte.<br />
Foto 16<br />
Beweglichkeit der<br />
rechten Hüfte.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 40
Ganze habe nur mit der fehlenden Dehnung zu tun. Die Fotos 13 und 14 stammen vom<br />
Dezember 2006.<br />
Deutliche Unterschiede bestanden in der Beweglichkeit der linken und rechten Hüfte<br />
(Foto 15/16). Waren die Beine wie in Foto 15 nach links eingeschlagen, so brachte U.H.<br />
den linken Sitzbeinhöcker recht nahe zum Boden. Anders sah es aus, wenn U.H. die Beine<br />
rechts einschlug; das Becken war völlig schief (Foto 16).<br />
5.3.3 Verlauf aus Sicht der Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong><br />
Erster Zyklus: Kreisaufbau (5 Std.): U.H. war sehr gespannt auf die Stunden. Ich empfand<br />
die Stimmung von Anfang an als angenehm, eine gute Mischung zwischen Konzentration<br />
und Beschwingtheit. Meiner Meinung nach kann U.H. sehr detailliert und präzise<br />
Auskunft geben über seine Körperempfindungen. Mir fiel von Anfang an auf, dass U.H.s<br />
Zufriedenheit in und nach der Stunde eng mit seiner «Leistungsstärke» zusammenhing.<br />
Das Richtigmachen war viel wichtiger als das Nachspüren. Er mühte sich oft übermässig<br />
ab, verkrampfte dabei seinen ganzen Körper (v.a. Kiefer- und Schulterbereich), sein<br />
Gesicht lief rot an und die Adern standen hervor. U.H. wirkte sehr kopflastig, konnte<br />
kaum einmal etwas einfach «geschehen lassen». Sein Krafteinsatz war in vielen Fällen<br />
unangemessen gross, seine Bewegungen langsam und meistens maximal. Sobald er einen<br />
Bewegungsablauf aber besser kannte (das stetige Wiederholen schien ihn überhaupt nicht<br />
zu stören), wirkte er gelassener und gelöster. Machte ich ihn auf seine Verkrampfungen<br />
(meist indirekt) aufmerksam, reagierte er eher gereizt und er rechtfertigte sich. Ich stellte<br />
immer wieder fest, dass U.H. die Bewegungen ganz präzise analysierte und genau<br />
sagen konnte, wo sich was bewegt, welche Muskeln er brauchte, wo es an Dehnung fehlt<br />
etc. Trotzdem merkte er es oft nicht, wenn er sich im Schultergürtel, im Kiefer oder in den<br />
Händen verkrampfte.<br />
U.H. verhielt sich anfangs eher gehemmt, v.a. im Stehen; er fühle sich «affig» (Zitat),<br />
so dazustehen und sich zu bewegen.<br />
U.H.s Bewegungen waren allgemein eher gross und kontrolliert. Ich empfand seine<br />
Bewegungen anfangs als abgehackt und nicht harmonisch. Kleine und schnelle Bewegungen<br />
machte er keine, sofern ich es nicht explizit verlangte. Auch dann waren die Bewegungen<br />
noch nicht wirklich schnell. Hüftkreisen ging zum Beispiel auch nur langsam,<br />
verlangte ich es schneller, fiel er aus der Bewegung raus. Ich machte immer wieder den<br />
Vorschlag, er solle die Bewegung einfach mal ausführen, ohne darüber nachzudenken, was<br />
er machte. Dazu liess er sich aber nur selten «überreden». Im Verlaufe der 20 Lektionen<br />
gab es hier aber punktuell recht grosse Veränderungen. U.H.s Bewegungsrepertoire wurde<br />
allgemein abwechslungsreicher.<br />
Es kam in den ersten fünf Stunden auch ab und an zu kleineren Auseinandersetzungen.<br />
U.H. empfand es als frustrierend, praktisch kein Feedback von mir zu erhalten. Er wollte<br />
wissen, ob er die Bewegungen richtig macht, wie ich seine Leistung einschätze und was er<br />
verbessern könne. Nachspüren war für ihn sinnlos, wenn er sich anschliessend<br />
nicht darüber äussern konnte. Zudem meinte er, die Unterschiede zwischen «vorher»<br />
und «nachher» seien für ihn so selbstverständlich, darüber müsse man gar nicht reden.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 41
Er räumte aber auch ein, dass er zu gewissen Erfahrungen vielleicht einfach keinen Zugang<br />
hätte. Einerseits konnte ich seine Widerstände verstehen, andererseits konnte und<br />
wollte ich nicht nachgeben, weil ich damit die Diplomarbeit «gefährdet» sah.<br />
Wir Diplomandinnen entschlossen uns dann, unsere diesbezügliche Verhaltensweise flexibler<br />
zu gestalten und mehr Informationen zu geben, da wir darauf angewiesen waren,<br />
dass unsere Probanden den ganzen Zyklus mitmachten. In der Folge konnte ich bei U.H.<br />
eine eindeutig gesteigerte Motivation feststellen. Grundsätzlich wirkte U.H. immer sehr<br />
konzentriert und engagiert.<br />
Sobald U.H. die Aufmerksamkeit auf eine Bewegung oder einen Ablauf richtete, flachte seine<br />
Atmung merklich ab. Er gähnte eigentlich nie und atmete nur selten tief durch.<br />
Ich lenkte seine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Atmung. In Gesprächen schälte sich<br />
heraus, dass für U.H. «die Atmung so etwas Selbstverständliches ist, da muss man doch<br />
nicht darüber reden» (Zitat). Grundsätzlich war seine Atmung kaum wahrnehmbar.<br />
Im Laufe des zweiten Themenbogens (Kraftaufbau: Rumpf, Rücken Bauch; Seitendehnung,<br />
5 Std.) wurden U.H.s Bewegungen bereits fliessender, sein Körper allgemein<br />
durchlässiger. Seine Atmung blieb weiterhin recht unterdrückt, aber U.H. wirkte beweglicher<br />
(v.a. in der Lendenwirbelsäule), was auch mit den damals sommerlichen Temperaturen<br />
im Zusammenhang stehen mag. Die anfänglichen Hemmungen waren verschwunden.<br />
Es stellte sich eine gewisse Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit ein. U.H. machte<br />
bereits viele Bewegungen im Voraus, bevor ich mit dem Verbalisieren fertig war. Diese<br />
«Routine» führte dazu, dass U.H. die einzelnen Bewegungen zu analysieren und hinterfragen<br />
begann. Oft äusserte er sich in dem Stil (Beispiel): «Wenn ich das mache, dann<br />
kann ich das Bein nicht strecken. Das Bein kann ich nur strecken, wenn ich nach hinten<br />
lehne, dann beginnen aber meine Muskeln zu zittern … ». Er versuchte immer wieder, die<br />
geeignetste Technik für einen Bewegungsablauf herauszufinden. Zeitweise redete er meines<br />
Erachtens zu viel drein, er wollte alles analysieren, was mich manchmal recht nervte.<br />
Der Fluss der Stunde kam in solchen Situationen zum Erliegen, was ich als sehr schade<br />
empfand. Wir einigten uns darauf, etwelche Diskussionen auf nach der Stunde zu verlegen;<br />
das war für uns beide ein zufriedenstellender Kompromiss.<br />
Im zweiten Themenbogen kam zum Vorschein, dass U.H. Haltemuskulatur im Rumpf<br />
eindeutige Defizite aufweist, was ihn recht frustrierte, obwohl er sich dessen schon längst<br />
bewusst war. Die Folge davon war, dass er sich erneut übermässig anstrengte und ich ihn<br />
immer wieder darauf aufmerksam machen musste, dass gewisse Bewegungsabläufe der<br />
Haltemuskulatur mehr bringen, wenn man sie langsam und sanft macht; sonst brauche es<br />
nämlich nur die Bewegungsmuskulatur. Darauf konnte er sich aber nur schlecht einlassen.<br />
Leistung war wichtiger. Diese Haltung forderte immer wieder meine Geduld heraus, auch<br />
wenn ich sie aufgrund der diesbezüglichen Konditionierung, die wir alle in unserer<br />
Gesellschaft mehr oder weniger erleben, verstehen kann. Ich geriet auch in Versuchung,<br />
die Stunden eher trainingsmässig zu gestalten, weil ich erstens das Gefühl hatte, ich<br />
könne «mehr bieten», und zweitens U.H. an der Anstrengung auch Spass hatte und eine<br />
gewisse Herausforderung empfand. Ich war mir immer wieder unsicher, wie anstrengend<br />
bzw. erspürend ich die Stunden gestalten sollte, entschied mich dann immer wieder spontan<br />
mehr in Richtung des einen oder anderen.<br />
Inzwischen hatte U.H. eine richtiggehende Aversion gegen die Diagonale entwickelt. Er<br />
fühlte sich sehr oft überfordert, hatte grosse Mühe mit der Koordination und empfand<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 42
die Musik als einengend und störend (obwohl er sonst sehr gerne Musik hört und auch gerne<br />
dazu tanzt). Während er mühelos die beiden Arme je in eine andere Richtung kreisen<br />
konnte, fiel es ihm ungemein schwer, einen einfachen Bewegungsablauf (z.B. rechts beginnend:<br />
vier Schritte vorwärts, rechtes Bein nach hinten in Waagrechte geben [auch mit<br />
Fuss am Boden abstützen möglich], rechten Arm nach vorne in die Waagrechte geben<br />
[Seitendehnung], Körper in einer Geraden aufrichten, Arm seitlich nach unten, auf 1. Taktschlag<br />
wieder mit dem rechten Bein beginnen) in der Diagonalen abgestimmt auf die Musik<br />
auszuführen. Er erlebte an dieser Stelle viel Frust und verlor dann die Lust an der Sache.<br />
Die Abläufe «fühlten sich jenseits des wirklichen Lebens an», meinte er. Ich empfand die<br />
Diagonale als sehr zäh und auch ich hatte mit der Zeit keinen grossen Spass mehr daran.<br />
Meine Ansprüche musste ich drastisch runterkurbeln und die Diagonale in ganz kleinen<br />
Schritten aufbauen, erst auch ohne Musik, weil diese U.H. regelmässig aus dem Bewegungsfluss<br />
brachte. Meines Erachtens stand er sich hier selbst im Weg, da er ein ausgesprochenes<br />
Kontrollbedürfnis zeigte. Eine Bewegung einfach einmal entstehen zu lassen,<br />
kam für ihn nicht in Frage. Er nahm sich sehr viel Zeit dafür, die Bewegungen zu analysieren,<br />
um – wie es mir schien – Sicherheit zu gewinnen. Er missachtete in solchen Situationen<br />
ohne zu zaudern meine «Anweisungen» und machte, was er wollte. Solche<br />
Momente waren recht spannungsgeladen. Ich kam ihm zum Teil entgegen. Ich liess zum<br />
Beispiel manchmal die Musik weg, beharrte aber in jeder Stunde auf eine wenn auch nur<br />
kurze Diagonale. So konnte ich U.H.s Motivationsniveau einigermassen halten. Dennoch<br />
drängte er mich immer wieder dazu, auf die Diagonale zu verzichten, und ich musste mir<br />
selbst gegenüber hart sein, dass ich seinem Wunsch nicht nachgab. Die Diagonale blieb<br />
bis am Schluss der mit Abstand unbeliebteste Teil der Stunde, für beide.<br />
In der Diagonalen war ersichtlich, dass U.H.s Gleichgewicht bei asymmetrischen, eher<br />
langsamen Bewegungen schnell verloren ging. Auch hier erlebte er viel Unsicherheit und<br />
Frust. Mir schien es, als würde er sich ein bisschen schämen wegen seines schwachen<br />
Gleichgewichts. Hier wäre über die 20 Lektionen hinaus noch viel zu tun, wenngleich sich<br />
während des Zyklus bereits Verbesserungen eingestellt haben.<br />
Positiv aufgefallen ist mir von Anfang an U.H.s gute Orientierung im Raum, egal, in welcher<br />
Lage. Er bewegte sich im Raum selbstsicher und wirkte präsent, aber nicht dominierend.<br />
Er konnte gut einschätzen, wie viel Raum es für eine Bewegung braucht, und die<br />
Bewegung entsprechend einteilen.<br />
Dritter Zyklus: Schultergürtel, Arme, Nacken, Brustbein (5 Std.)<br />
U.H. besitzt einen sehr beweglichen, aber dennoch oft verkrampften Schulterbereich. Vor<br />
allem das linke Schultergelenk ist aufgrund zwei gerissener Bänder eher hyperflexibel.<br />
Deshalb habe ich in diesen fünf Themenstunden den Fokus eher auf die Kräftigung und<br />
Lockerung des Schultergürtels gesetzt als auf dessen Beweglichkeit. Die Arbeit an<br />
Schultergürtel, Armen, Nacken und Brustbein verlief problemlos; U.H. war motiviert.<br />
Die Stunden hatten einen grundsätzlich konzentrativen Charakter. Was die Diagonale<br />
betrifft, fand in keiner Weise eine «Anfreundung» statt.<br />
Im vierten und letzen Zyklus (Beine, Becken, Hüften, Füsse; 5 Std.) schwand der Elan<br />
auf beiden Seiten merklich. Die Stunden wurden immer wieder verschoben. Diesbezüglich<br />
erschwerend war schon immer gewesen, dass wir weit auseinander wohnen, so dass wir<br />
die Termine für die Bewegungsstunden sehr gezielt planen mussten. Hatten wir dann aber<br />
mal einen Einstieg gefunden, erlebte ich die Stunden als sehr intensiv und positiv, ich<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 43
konnte von Stunde zu Stunde Veränderungen feststellen (zum Beispiel bezüglich Bewegungsfluss,<br />
Konzentration, Atmung, Wechsel zwischen Spannung und Lösung etc.), woran<br />
ich richtig Spass hatte. Ich machte recht anstrengende Stunden, die aber auch längere<br />
erspürende Sequenzen enthielten. Allgemein empfand ich die Stunden als dynamischer.<br />
Berührungsängste in Bezug auf Becken-/Hüftarbeit konnte ich bei U.H. keine feststellen.<br />
Das Thema lässt einem einen grossen Bewegungsfreiraum, so dass ich die Stunden zum<br />
Teil auch improvisiert gestalten konnte, was mir sehr gefiel. Ich empfand aber auch einen<br />
gewissen Druck, dass man dann nach 20 Stunden doch einige Fortschritte feststellen<br />
sollte, auch wenn mir von Anfang an bewusst war, dass grössere Veränderungen<br />
viel Zeit brauchen. Trotzdem beschlich mich das Gefühl, meine Diplomarbeit sei umsonst,<br />
wenn ich nichts Konkretes präsentieren können würde. Ich bin froh um all die Fragebogen,<br />
die mein Proband ausgefüllt hat – da kann ich nachlesen, was für Prozesse stattgefunden<br />
haben. Auch die Fotos zeigen zum Teil grössere Veränderungen.<br />
U.H. lieferte mir viele Rückmeldungen. Als störend empfand ich, dass er manchmal einfach<br />
mit Reden loslegte, während er gerade an einem Bewegungsablauf arbeitete. Grundsätzlich<br />
schätzte ich sein Feedback. Er machte mich dadurch auf viele Dinge aufmerksam,<br />
die mir vielleicht entgangen wären. U.H. erwartete jedoch eine Stellungnahme von mir, die<br />
ich meistens nicht zu geben bereit war. Ich wollte so den Fokus mehr auf die Eigenwahrnehmung<br />
lenken, womit sich U.H. aber nicht zufrieden gab. Daraus resultierten die bereits<br />
weiter oben erwähnten Spannungen. Dass solche Spannungen überhaupt entstehen können,<br />
führe ich darauf zurück, dass es Einzelunterricht war und man sich in dieser Situation<br />
naturgegeben näher kommt als in einer Gruppe.<br />
5.3.4 Verlauf aus Sicht des Probanden U.H.<br />
«Fragebogen klein» von U.H.:<br />
1.<br />
Wie war Ihre Motivation am Anfang<br />
der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
2.<br />
Wie haben Sie sich während der Stunde<br />
konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 44
3.<br />
Wie haben Sie sich gegen Ende der<br />
Stunde konzentrieren können?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.<br />
Wie verspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
7.<br />
Wie schlaff/ermüdet fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
4.<br />
Wie entspannt fühlen Sie sich jetzt<br />
nach der Stunde?<br />
6.<br />
Wie angeregt/wach fühlen Sie sich<br />
jetzt nach der Stunde?<br />
8.<br />
Wie gut ist Ihr körperliches Wohlbefinden<br />
in Bezug auf die Körperwärme?<br />
9. Wie ist Ihr körperliches Befinden allgemein (wohlig, schwindlig, kribbelig …;<br />
fühlen sich einzelne Körperteile irgendwie anders an? Etc.)<br />
2 normal, entspannt, leicht müde 3 angenehm relaxt 4 schwindlig, «schwacher Kreislauf», abgespannt,<br />
müde 5 schwammig, ganz leicht schwindlig und ganz leicht Übelkeit (nach kurzer Zeit wieder verschwunden)<br />
6 gut 7 angenehm 8 In meiner linken Rückenseite ist eine deutliche Verspannung spürbar. Ähnlich<br />
wie starker Muskelkater 9 sehr gut 10 gut 11 rundum prima 12 müde, schlaff 13 prima 14 ermüdet,<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 45
körperlich und geistig 15 gut 16 rundum Wohlgefühl 17 wohlig 18 leichte Übelkeit, leicht schwindlig<br />
während Boden-/Wandübung. Nach Beendigung der Übung fühle ich mich wieder wohl 19 gut, etwas<br />
hungrig 20 ok<br />
10.<br />
Wie gut ist Ihr psychisches Wohlbefinden,<br />
wie gut ist Ihre Stimmung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
14.<br />
Haben Sie sich während der Stunde<br />
oft Gedanken gemacht über den Sinn<br />
der Bewegungen?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
12.<br />
Wie verständlich war für Sie die<br />
verbale Anleitung?<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
11.<br />
Wie angenehm war für Sie die verbale<br />
Anleitung?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
13.<br />
Wie angenehm waren für Sie die<br />
Bewegungen ganz allgemein?<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5.Std 10.Std 15.Std 20.Std<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 46
15. Hätten Sie gerne mehr Erklärungen?<br />
1 Feedback zu Atmung hat gefehlt 2 Ja, ich hätte gerne mehr Erklärung, im Sinn von Feedback, z.B. kam<br />
die Anweisung, auf die Atmung/Anspannung zu achten / zu beobachten, jedoch nie ein Austausch über<br />
meine Beobachtung. Ein Feedback nach Beendigung einer Stunde empfinde ich als hilfreich/sinnvoll, da<br />
es für mich a) motivierend und b) mit eine Komponente ist, um meine «körperliche Fitness» einzuschätzen.<br />
Im Moment hänge ich hier zu sehr im «luftleeren Raum». Ich empfinde so, dass ich in der Situation<br />
eines Lernenden bin. Und meines Erachtens gehört Feedback zum Lernen dazu, dann ist es für mich<br />
effektiver. 3 Positive Veränderung: gemeinsames Reflektieren nach der Stunde 5 war ok 11 das war ok<br />
heute 12 Am Anfang der Stunde kam z.B. eine kurze Erklärung, wieso diese Übung gemacht wurde, das<br />
hat bei mir einen Aha-Effekt ausgelöst.<br />
16. Evtl. Bemerkungen zu einzelnen Fragen<br />
1 die Frage nach sonstigem körperlichen Wohlbefinden fehlt. Meine Antwort wäre: ganz leichtes Schwindelgefühl<br />
aufgrund von Bewegung mit Kopfkreisen und zu flacher Atmung ((Anmerkung: diese Frage<br />
wurde dann in den folgenden Fragebogen integriert)). Zu Frage 13: «Gedanken machen» im Sinn von:<br />
Was soll das? Warum muss ich jetzt dieses oder jenes tun? 4 Seit mehreren Tagen habe ich leichte<br />
Schwindelgefühle. Ursache und Auslöser nicht genau bekannt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen<br />
Kopfbewegungen und dem Einsetzen von Schwindelgefühlen. Zwei Stunden intensives Badmintonspielen<br />
am Vortag war ohne Probleme bzw. Schwindelgefühle möglich 6 Zu Frage 14: Eine Frage stellte sich mir:<br />
Warum in dieser komplizierten Art und Weise vom Rücken auf den Bauch drehen? 8 Vor der Bewegungsstunde<br />
habe ich zwei Stunden Badminton gespielt. 12 Die Schrittübung (Diagonale) wurde eher in meinem<br />
Tempo, mehr unter der Berücksichtigung meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten durchgeführt, das<br />
hat Spass gemacht 14 Ich stelle immer mehr fest, dass Bewegung im genauen Takt zur Musik keinen<br />
Spass macht. Es frustet und überfordert mich. Die Diagonale an und für sich macht Spass, nur der<br />
Gleichklang zur Musik ist das Problem. 16 Zu 12: Nachdem für mich klar war, was zu tun ist, hat sich<br />
die Frage des Sinns für mich geklärt 17 Insgesamt waren die Übungen anstrengend für mich, teilweise<br />
bin ich deutlich an meine Grenzen gekommen 18 Die Diagonale ist noch immer nicht «mein Freund».<br />
20 Die Diagonale wird wohl nie mein Liebling werden.<br />
Insgesamt fällt auf, dass U.H.s Werte und Angaben recht beständig sind. Generell war die<br />
Motivation am Anfang nicht sehr hoch, doch seine Konzentration hielt trotzdem meistens<br />
bis am Schluss an. Wie Werte bei Frage 4 und Frage 5 sind komplementär (dies ist kein<br />
Zufall, U.H. hat beim Ausfüllen des Fragebogens auf Logik geachtet). Ein recht unregelmässiger<br />
Verlauf ist bei Frage 6 und 7 feststellbar. Dies hat sehr viel mit U.H. allgemeiner<br />
Verfassung zu tun (steht auch im Zusammenhang mit der Arbeitsbelastung und der Pollenallergie).<br />
Bei den Fragen 8 bis 14 antwortete U.H. mit wenigen Ausnahmen mit fast<br />
immer den gleichen Werten. Die Stunden unterlagen meines Erachtens tatsächlich nicht<br />
allzu grossen Schwankungen, wie das bei Proband S.F. der Fall war.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 47
«Fragebogen gross» von U.H.:<br />
Wie schätzen Sie sich ein auf einer Skala von 1 bis 10?<br />
(1 = gar nicht, 10 = sehr)<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
beweglich kräftig konditionell<br />
fit<br />
Koordination Rhythmusgefühl<br />
vor der 1. Stunde nach der 10. Stunde nach der 20. Stunde<br />
nach der 5. Stunde nach der 15. Stunde<br />
Auffallend bei U.H.s Selbsteinschätzung ist, dass die Werte grundsätzlich abnehmen,<br />
d.h. er schätzte sich im Laufe der 20 Stunden immer schlechter ein. Insofern erstaunt es<br />
nicht, dass U.H. immer wieder das Gefühl hatte, die Stunden zeigten im seine Grenzen auf.<br />
Dass U.H. die Werte tendenziell niedriger setzte, empfand ich als realistisch. Die Tatsache,<br />
dass die Stunden für U.H. nicht von Anfang an «von Erfolg gekrönt» waren, war für ihn<br />
keineswegs nur frustrierend, sondern spornte ihn auch dazu an, seine Grenzen weiter hinauszuschieben.<br />
Er war bereit, dem Erfolg Zeit zu lassen, sich auf einen Prozess einzulassen,<br />
der kurzfristig nicht nur positive Aspekte mit sich bringt.<br />
U.H. notierte dann auf dem letzten Fragebogen auch Verbesserungen, z.B. dass sich seine<br />
Beweglichkeit verbessert habe (obwohl er bei den Kreuzchenantworten einen niedrigeren<br />
Wert angegeben hat als am Anfang). Er schreibt den Stunden auch einen grundsätzlich<br />
positiven Effekt auf sein Körperempfinden zu, Körperempfinden im Sinn von Befindlichkeit,<br />
wie er zusätzlich notierte. Nur minime oder gar keine Veränderung stellte er in Bezug<br />
auf seine Körperwahrnehmung fest. Diesbezüglich stellte ich immer wieder grosse<br />
Abwehr fest. Beim Seitenvergleich sagte er oft, dass er natürlich einen Unterschied feststelle,<br />
so spürte er eben, dass zum Beispiel das linke Bein bereits bewegt wurde und das<br />
rechte noch nicht, er verstand aber nicht, worauf ich hinauswollte. Vergleichende Adjektive<br />
wie «schwerer», «präsenter», «wärmer», «lebendiger» etc. benutzte er nie. Dass ich ihm diesbezüglich<br />
Hilfestellung leistete, bewirkte eigentlich nichts ausser Widerstand.<br />
U.H. war der Meinung, dass die Stunden auf sein psychisches Wohlbefinden im Allgemeinen<br />
keinen Einfluss hatten. Während und nach den Stunden fühlte er sich aber oft<br />
«ausgeglichen».<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 48
Einen Einfluss der 20 Lektionen auf das Bewegungsverhalten im Alltag verneinte U.H.<br />
Ab und zu mache er nun aber einzelne kleine Übungen, z.B. beim Autofahren, v.a. für die<br />
Rücken- und Bauchmuskulatur. Meines Erachtens ist die Aufmerksamkeit gegenüber seiner<br />
Körperhaltung gestiegen. Er setzt sich auch mehr mit seiner Beweglichkeit auseinander,<br />
so probiert er immer mal wieder, wie weit er beim Rückenbeugen mit den Händen bis<br />
zum Boden kommt. Für den Arbeitsplatz hat er sich ein Sitzkissen gekauft, was er als viel<br />
angenehmer empfindet als einen normalen Stuhl. Dennoch schenkt er während dem Arbeiten<br />
seinem Körper kaum Aufmerksamkeit. Dies liegt auch an der Arbeitssituation; U.H. ist<br />
notorisch überlastet.<br />
Die im Kapitel «Bestandesaufnahme am Anfang (April 2006)» erwähnten Schmerzen beim<br />
Abrollen des Fusses sind geringer geworden. Die Schmerzen treten laut U.H. weniger oft<br />
und weniger stark auf. Worauf dies zurückzuführen ist, weiss U.H. nicht genau. Er vermutet,<br />
die Verbesserung sei eingetreten, weil er sich grundsätzlich mehr bewege, sich mehr<br />
Mühe gebe, über die Fusssohle abzurollen (statt über die Fussaussenkante), auch wenn<br />
das eben zum Teil schmerzhaft sei, und sich auch seine Fussstellung verändert habe<br />
(Zehen schauten etwas mehr nach aussen, Füsse seien nicht mehr so parallel wie vorher,<br />
meinte er. Ich kann eine solche Beobachtung nicht bestätigen).<br />
U.H. hatte keine Probleme mit der verbalen Anleitung. Dass die Bewegungsabläufe nicht<br />
vorgemacht wurden, empfand er nur ganz am Anfang etwas befremdend, spürte aber<br />
schon bald, dass er die Bewegungen (vor allem mit geschlossenen Augen) intensiver<br />
wahrnahm. Er fragte nach, wenn er etwas nicht verstand. Manche Bewegungsabläufe stufte<br />
er als sehr kompliziert ein. Da kam ich ums Vorzeigen manchmal nicht herum. Ein<br />
erschwerender Faktor waren hier sicher auch die unterschiedlichen Muttersprachen, die<br />
wir sprechen. U.H. stammt aus Hessen und versteht kaum Schweizerdeutsch. So musste<br />
ich auf Hochdeutsch umstellen, womit ich anfänglich Mühe hatte. Für gewisse PSFL-typischen<br />
Redewendungen (z.B. «mit de Bei plätschere») fand ich kaum ein deutsches Pendant.<br />
Mit der Zeit bekam ich aber Übung und es passierten weniger Missverständnisse.<br />
Die Wandlage empfand U.H. als grundsätzlich angenehm. Den Vorteil der Wandlage sah<br />
U.H. darin, dass in dieser Position andere Bewegungen gemacht werden konnten als im<br />
freien Raum. Sie war für ihn gleichzeitig Unterstützung und Einschränkung. Bewegungen<br />
im Raum empfand er grundsätzlich als angenehmer.<br />
Das Gleiche gilt für die Seitenlage. Hier empfand er als unangenehm, dass seine Atmung<br />
eingeschränkt wurde (ansonsten erwähnte er die Atmung kaum).<br />
Ich habe bereits erwähnt, dass U.H. der Diagonalen nichts abgewinnen konnte. Anfänglich<br />
(Fragebogen nach 5 Stunden) war es aber auch hier sein Ziel (wie ganz generell), die<br />
Grenzen seines Bewegungsrepertoires zu erweitern, und er sah die Diagonale noch in<br />
einem grundsätzlich positiven Licht. Im Fragebogen nach 15. Stunden antwortete er, dass<br />
die Diagonale überhaupt keinen Spass mehr mache und er sähe «keinen grossen Sinn<br />
darin, die Übungen fortzusetzen», was ich dann aber trotz des Widerstandes tat. Auch<br />
im letzten Fragebogen nach 20 Stunden «macht ihm die Diagonale einfach keinen Spass».<br />
Dies schreibe ich zum Teil auch mir zu. Ich hatte viel zu hohe Ansprüche am Anfang und<br />
überforderte U.H. mit den Schrittfolgen ziemlich. Es fiel mir schwer, langsamer vorwärts<br />
zu gehen, zum Teil aus purer Ungeduld, zum Teil auch, weil ich sah, wie viel Potenzial in<br />
U.H. steckte. Manchmal liess ich mich durch seine Widerstände provozieren. In Stunden,<br />
in denen ich die Diagonale «bombensicher» aufbaute und die Anforderungen meines<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 49
Erachtens sehr niedrig hielt, gab es denn auch Erfolgserlebnisse. Im Rückblick würde ich<br />
die Diagonale von Anfang an weniger anspruchsvoll gestalten.<br />
Der Einsatz von Musik passte U.H. grundsätzlich. Er empfand die Musik als motivierend,<br />
stimmungsaufhellend. Grosse Mühe mit Musik hatte er in der Diagonalen. Sollte er die<br />
Bewegungsabläufe an den Rhythmus der Musik anpassen, fühlte er sich regelmässig überfordert<br />
und er ärgerte sich. Er benötige seine «eigene Zeiteinteilung». Er fühlte sich eingeengt,<br />
was zu seinem generellen Frust bezüglich der Diagonalen sicher beitrug.<br />
Den Einstieg in die Stunde fand U.H. durchwegs in Ordnung, so lange es keine Diagonale<br />
war. Das Einbewegen/Aufwärmen hätte von ihm aus länger sein dürfen. Eine Aussage<br />
von ihm war aber auch, dass er «keinen besonderen Einstieg in die Stunde wahrnehme».<br />
Für ihn beginne die Stunde einfach und «die Übungen bauten sinnvoll aufeinander<br />
auf».<br />
Auf die Frage, ob er die Bewegungsabläufe allgemein als angenehm empfindet, antwortet<br />
U.H. anfangs mit nein. Es gäbe sowohl angenehme, aber auch strenge Übungen, bei<br />
denen er den «inneren Schweinehund» überwinden müsse. Ich hatte diese Antwort erwartet,<br />
da ihm die Anstrengung ja oft ins Gesicht geschrieben stand. Nichtsdestotrotz meinte<br />
er, dass ihm die Bewegungen aufgrund seines generellen Bewegungsmangels grundsätzlich<br />
gut täten. Im Laufe der 20 Stunden änderte sich seine Meinung dahin, dass die<br />
Bewegungen meistens angenehm, manchmal aber auch anstrengend wären. Das Gute an<br />
der ganzen Sache sah er vor allem darin, dass die Bewegungen sinnvoll wären und letztendlich<br />
gut täten.<br />
U.H. war der Meinung, dass die Bewegungsabläufe im Allgemeinen seinen Möglichkeiten<br />
entsprachen, ihm aber auch die Defizite aufzeigten und ihn so entsprechend forderten.<br />
Seine Schwächen sah er bei der Diagonalen, aber auch bei der Beweglichkeit und der<br />
Kraft. Seiner Meinung nach hat er bei manchen Bewegungen gute Fortschritte gemacht,<br />
aber er meinte, er sei noch ein gutes Stück davon entfernt, dass ihm «bestimmte Sachen<br />
besonders gut gelingen würden». Er würde weiterhin Grundlagenstunden PSFL besuchen<br />
und sie weiterempfehlen, auch Männern, da er die Stunden als «sinnvoll und hilfreich»<br />
erachtet.<br />
Obwohl sich U.H. gemäss des Fragebogens am Anfang am liebsten in kleinen Gruppen<br />
bewegt – Sport für ihn also auch eine starke soziale Komponente beinhaltet – fühlte er in<br />
diesen 20 Einzellektionen wohl. Es war (und ist) für ihn nicht von Bedeutung, ob und viele<br />
Männer sich in einer Gruppe befinden, und auch nicht, ob die Stunde von einem Mann<br />
oder einer Frau geleitet wird.<br />
5.3.5 Bestandesaufnahme am Ende (Dezember 2006)<br />
U.H.s linke Schulter ist immer noch ca. 1,5 cm höher als die rechte, und das linke Schlüsselbein<br />
liegt steiler als das rechte. Was schon im April 2006 so war, mir aber erst jetzt aufgefallen<br />
ist, ist, dass U.H.s linke Schulter weiter nach vorne gezogen ist als die rechte<br />
(ersichtlich auf Foto 17/18), womit der ganze Arm und auch die Hand sich weiter vorne<br />
befinden (Foto 19).<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 50
Foto 17 Foto 18<br />
Linke Schulter immer noch weiter oben und<br />
weiter vorne.<br />
Foto 21 Foto 22<br />
Verbesserte Beweglichkeit im mittleren/oberen<br />
Rücken.<br />
Foto 25<br />
Beine näher an Wand,<br />
Becken weiter unten.<br />
Foto 26<br />
Rücken Beugen mit<br />
gestreckten Knien.<br />
Foto 19<br />
Linker Arm weiter<br />
vorne.<br />
Foto 23<br />
Beweglichkeit der<br />
linken Hüfte.<br />
Foto 27<br />
Rücken Beugen mit<br />
gelösten Knien.<br />
Foto 20<br />
Beine durchgestreckt.<br />
Weniger Rücklage.<br />
Foto 24<br />
Beweglichkeit der<br />
rechten Hüfte.<br />
Foto 28<br />
Schultern hochgezogen.<br />
Was die Schuhe betrifft, so gibt es leider kein Vergleichspaar. U.H. hat sich zwar neue<br />
Schuhe gekauft, die aber noch nicht lange genug getragen, als dass sie schon abgenützt<br />
wären. Die Schmerzen beim Fussabrollen haben grundsätzlich nachgelassen (wie oben<br />
erwähnt).<br />
Im Stehen sind U.H.s Beine immer noch durchgestreckt (Foto 20). Die Rücklage<br />
scheint mir etwas weniger.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 51
Die Beweglichkeit im mittleren/oberen Rücken hat sich meines Erachtens verbessert,<br />
ersichtlich vor allem auf Foto 21 im Vergleich zur Foto 5/6. Der Oberkörper liegt eindeutig<br />
flacher auf dem Boden. Diese erweiterte Beweglichkeit im mittleren/oberen Rücken ist<br />
für U.H. deutlich spürbar; es fühle sich für ihn besser an.<br />
Der grösste Unterschied ist jedoch beim Beugen des Oberkörpers nach vorne sichtbar<br />
(Foto 26/27). Die Fotos 9 und 10 zeigen eine deutlich kleinere Beweglichkeit über den<br />
unteren Rücken. Im Allgemeinen wurde das Auf- und Abrollen der Wirbelsäule im Verlauf<br />
der 20 Stunden immer runder. Nach U.H.s Aussage ist es schon «eine Weile her», dass er<br />
in diesem Bereich so beweglich war.<br />
Diese erweiterte Beweglichkeit zeigt sich auch in der Wandlage (vgl. Foto 11 und Foto 25).<br />
U.H. kann jetzt die Beine an der Wand mehr durchstrecken als noch im April 2006, ohne<br />
dass es für ihn unangenehm wird.<br />
Der deutliche Unterschied in der Beweglichkeit der linken und rechten Hüfte (Foto<br />
23/24 bzw. Foto 15/16) ist geblieben. U.H. spürt diesen Unterschied deutlich; die Beine<br />
rechts einzuschlagen, ist für ihn recht unangenehm, und er braucht viel Kraft, um sich in<br />
dieser Position zu halten. Hüfte-/Leistenarbeit war insofern etwas problematisch, als dass<br />
sich U.H. schnell verspannte oder gar Schmerzen (v.a. in der Leistengegend) auftraten.<br />
Hier war immer wieder Vorsicht geboten.<br />
Beim Vergleich zwischen Foto 12 und Foto 28 fällt auf, dass U.H.s Arme auf der Letzteren<br />
viel mehr durchgestreckt sind, die Schultern sind weiter hochgezogen. Ich habe jeweils<br />
nur gesagt, er soll die Arme über den Kopf halten, von mehr oder weniger strecken habe<br />
ich nichts gesagt. Ebenso wenig habe ich dabei die Schultern erwähnt. Ich führe die Veränderung<br />
der Haltung auf Folgendes zurück: Während den Grundlagenstunden PSFL<br />
musste U.H. die Arme unzählige Male über den Kopf halten. Ich hatte auch immer wieder<br />
betont, U.H. solle sich beim Räkeln lang ziehen. Wie automatisch zog er meistens gleichzeitig<br />
die Schultern hoch. Der Effekt des Räkelns ist sicher, dass U.H. sich mehr streckt,<br />
gleichzeitig zieht er aber eben auch die Schultern hoch.<br />
5.3.6 Vergleich zwischen Sicht Proband U.H. und Diplomandin <strong>Ingrid</strong> <strong>Essig</strong><br />
Am Anfang war ich überrascht, wie gut U.H. seine Beweglichkeit (6), seine Koordination<br />
(8) und sein Rhythmusgefühl (8) einschätzte (siehe Seite 48). Unter Beweglichkeit<br />
verstand U.H. eher Flinkheit und Schnellkraft, unter Koordination eher Technik, denn auf<br />
diesen Gebieten ist er in verschiedenen Sportarten wirklich gut (z.B. Badminton). Was<br />
aber die Beweglichkeit seiner Wirbelsäule angeht oder die allgemeine Beweglichkeit der<br />
Gelenke und was die Arm-/Beinkoordination angeht, so sah ich doch zum Teil grosse<br />
Defizite. Bezüglich des Rhythmusgefühls nehme ich an, dass die Einschätzung vor allem auf<br />
Erfahrungen beim Tanzen in der Disco basiert. Mit der exakten Abstimmung von (sich wiederholenden)<br />
Bewegungen auf den Rhythmus hatte er zuvor kaum Erfahrungen. Wie<br />
gesagt, wurden U.H.s Einschätzungen mit der Zeit meines Erachtens realistischer.<br />
Tatsache war, dass ich U.H. bezüglich der Körperwahrnehmung nicht in sensibilisiertere<br />
Gefilde locken konnte. Die diesbezügliche Abwehr blieb bis am Schluss gross.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 52
Seine Antworten bezüglich des psychischen Wohlbefindens fielen für mich erwartungsgemäss<br />
konstant aus. Ab und zu empfand ich U.H. während den Stunden als recht<br />
aufgedreht, was er zwar selbst auch wahrnahm, er liess sich in den Fragebogen aber nicht<br />
darüber aus.<br />
Meines Erachtens sind die Auswirkungen auf U.H.s Bewegungsverhalten im Alltag<br />
grösser, als er dies selbst empfindet. Die Auswirkungen gehen in der Tat nicht in die Richtung,<br />
dass er sich nun im grossen Stil anders bewegen würde, aber durch die Auseinandersetzung<br />
mit dem Thema hat er eine grössere Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber<br />
entwickelt und er beobachtet das Bewegungsverhalten anderer Menschen öfter und intensiver.<br />
Die verbale Anleitung auf Hochdeutsch war für mich eine ziemliche Knacknuss. U.H.<br />
empfand das jedoch nicht so; für ihn waren meine sprachlichen Schwierigkeiten eine logische<br />
Folge der unterschiedlichen Muttersprachen.<br />
U.H.s Ablehnung gegenüber der Diagonalen konnte ich schon nach Kurzem wahrnehmen.<br />
Wie gesagt, ich fühle mich diesbezüglich nicht ganz unbeteiligt. Sein Widerstand war für<br />
mich recht demotivierend und ich musste mich immer wieder dazu überwinden, die Diagonale<br />
seriös vorzubereiten und durchzuführen. Oft dachte ich auch: «Ach, lassen wir das<br />
doch.» Die Diagonale verlangte viel Hartnäckigkeit von meiner Seite.<br />
Der Einsatz von Musik war für mich eine Herausforderung. Musik zu bringen, die einer<br />
bestimmten Person passt, finde ich schwieriger, als Musik für eine Gruppe auszuwählen,<br />
denn da gibt es immer den einen oder die andere, dem/der die Musik gefällt. Offensichtlich<br />
empfand U.H. die Musik als passend, denn sein diesbezügliches Feedback war immer<br />
positiv (ausser, was die Diagonale betrifft).<br />
Den Einstieg in die Stunde gestaltete ich oft spontan. Ich hielt mich an das Thema der<br />
Stunde, ging aber gleichzeitig auf die Bedürfnisse und Stimmung von U.H. ein. Der Einstieg<br />
diente dazu, sich mit den Gedanken und dem Körper ins Hier und Jetzt zu begeben<br />
und sich auf die Konzentration einzustellen. Konzentrieren konnte sich U.H. meistens sehr<br />
gut, diesbezüglich legte U.H. viel Disziplin an den Tag (wie auch generell). Viel Ausdauer<br />
zeigte U.H. auch bei schwierigen und anstrengenden Bewegungsabläufen, zum Teil<br />
fast zu viel. Sein Streben nach Leistung konnte ich zwar verstehen, trotzdem wollte ich<br />
dagegenhalten, da die Bewegungen – bzw. die Wirkung der Bewegungen – bei grosser<br />
Anstrengung meines Erachtens weniger gut erspürt werden können. Doch dafür hatte U.H.<br />
kein Gehör. Er empfand da im Gegensatz zu mir auch kein Defizit. Ich konnte ihn in den<br />
20 Stunden nicht dazu bringen, die Möglichkeiten zu erahnen, die es noch gäbe.<br />
Ich hatte nie den Eindruck, dass U.H. sich in der Rolle des Einzelprobanden unwohl fühlte.<br />
Meinerseits sah ich mich als Frau nie in Frage gestellt, und ich fühlte mich wohl in den<br />
Stunden. U.H. brachte mir auch Bewunderung entgegen. Anfänglich genierte er sich ein<br />
wenig, doch diese Hemmungen überwand er schnell – das wäre auch in einer Gruppe so,<br />
wie aus den Fragebögen herauszulesen ist.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 53
5.3.7 Fazit<br />
Grundsätzlich sehe ich in U.H. einen geeigneten Teilnehmer für Grundlagenstunden<br />
PSFL. Laut seinen eigenen Angaben stellt er sich diese Stunden als etwas vor, bei denen<br />
er längere Zeit bleiben könnte. Die Grundlagenstunden PSFL verlangen viel Konzentration,<br />
was U.H. sehr entgegen kommt. Auch wenn U.H.s Beweglichkeit nicht dem Niveau entspricht,<br />
das ich mir fürs Training PSFL vorstelle, so sehe ich ihn doch eher dort angesiedelt,<br />
weil er da einfach mehr «powern» könnte, was ihm mehr entspricht als das Erspüren.<br />
Was die Rumpfmuskulatur betrifft, ist er eher auf Grundlagen-PSFL-Niveau; ich denke<br />
aber, dass er diesbezüglich in den Trainingsstunden schnelle und grosse Fortschritte<br />
machen würde. Bezüglich der Diagonalen wäre U.H. im Training PSFL absolut am falschen<br />
Ort – von daher wäre eine Fortführung der Grundlagen-Lektionen angezeigt, aber mit baldigem<br />
Übertritt ins Training, sobald die Diagonale einigermassen sitzen würde und die entsprechenden<br />
Aversionen abgebaut wären.<br />
Alleine würde sich U.H. nicht für einen Grundlagen-PSFL-Kurs anmelden, wohl auch<br />
nicht für einen Trainings-PSFL-Kurs. Mit jemandem zusammen ist es für ihn aber vorstellbar.<br />
Er interessiert sich grundsätzlich für konzentrative und intensive Bewegung, die<br />
gezielt Punkte angeht und bearbeitet (wie z.B. Rumpfmuskulatur, Beweglichkeit der Wirbelsäule,<br />
Lockerung des Schultergürtels). Sich bis zur Erschöpfung anstrengen, ist kein<br />
Thema für U.H. Ab und zu macht er das auch gerne (dazu spielt er auch Badminton, geht<br />
inlineskaten oder fährt Ski), aber nicht prinzipiell. Bewegung muss für ihn hauptsächlich<br />
Spass machen.<br />
Ein Punkt, wo es die Grundlagen PSFL schwer hätten bei U.H., ist die Art und Weise, wie<br />
eine PSFL-Kursleiterin mit der Verteilung von Information umgeht, d.h. wie viel die<br />
Kursteilnehmer darüber erfahren, was sie gerade wozu machen, dass sie prinzipiell nicht<br />
direkt korrigiert werden und sie kein Feedback über ihre Bewegungsmuster erhalten. Dieser<br />
Punkt hat U.H. von Anfang an gestört und er hat ihn in den Fragebögen auch wiederholt<br />
vehement kritisiert. Er fühlte sich unsicher und von der Fachfrau im Stich gelassen.<br />
Meine vorläufige Meinung diesbezüglich ist, dass man diesen Punkt flexibler gestalten sollte,<br />
will man mehr Männer in die Grundlagenstunden PSFL locken. Männer haben offenbar<br />
mehr das Bedürfnis nach Klarheit in solchen Bereichen, sie wollen ganz klar wissen, wo sie<br />
(auch leistungsmässig) stehen. U.H. betonte immer wieder, wie wichtig es für ihn wäre,<br />
von mir ein Feedback zu bekommen.<br />
5 Die Probanden/Arbeitsberichte | Seite 54
6 Vergleich der drei Probanden<br />
Wir – die Diplomandinnen – wählten Männer verschiedenen Alters für unsere Arbeit aus,<br />
um auch generationenbedingte Verhaltensweisen im Vergleich einbeziehen zu können. Der<br />
Jüngste war bei Arbeitsbeginn 31 Jahre alt; der Mittlere zählte 43 Jahre und der Älteste<br />
71 Jahre. Nebst dem unterschiedlichen Alter wiesen sie auch unterschiedliche Ausgangslagen<br />
im Bewegungsverhalten, in der Beweglichkeit, der Körperwahrnehmung, der Koordination<br />
etc. auf.<br />
Wir tauschten uns während des Verlaufes immer wieder untereinander aus und konnten<br />
bereits früh Parallelen entdecken.<br />
Bei allen drei Probanden war schon bald ersichtlich, dass Elemente mit Krafteinsatz sehr<br />
beliebt waren. Wir bauten dann auch vermehrt Trainingselemente in den Unterricht ein,<br />
obwohl U.H. und O.F. – gemäss den jeweiligen Diplomandinnen – nicht (oder noch nicht)<br />
geeignete Teilnehmer für eine Trainingsstunde wären. An der Kraft läge es bestimmt bei<br />
beiden nicht oder dann nur teilweise (Rumpfmuskulatur bei U.H.). Zum einen aber gelingt<br />
ihnen das Erspüren der eigenen Wahrnehmung nicht sehr gut, zum andern liegt auch ein<br />
Mangel an allgemeiner Beweglichkeit vor. Für beide wäre die Diagonale mit den komplexen<br />
Schrittfolgen (Koordination, Rhythmus, Gleichgewicht) eine zu grosse Herausforderung.<br />
Die Diagonale wurde von den Probanden unterschiedlich bewertet. S.F. empfand die Musik<br />
als sehr anspornend. Er erzielte die grössten Fortschritte in der Diagonalen und sensibilisierte<br />
dabei sein Körperbewusstsein. Bei U.H. hingegen entwickelte sich eine Aversion. Vor allem<br />
koordinative Bewegungsabläufe zu einem vorgegebenen Rhythmus auszuführen, lösten bei<br />
ihm Frustrationen aus. Der Proband O.F. bewegte sich gerne zur Musik, trotz der Schwierigkeiten<br />
in Verbindung der Koordination mit dem Rhythmus bei relativ leichten Schrittfolgen.<br />
Herausforderungen waren ein grosser Ansporn für alle drei Probanden. Ein Ziel zu kennen<br />
und darauf hinzuarbeiten, weckte bei allen mehr Interesse und Verständnis für die<br />
Bewegungsabläufe oder Schrittfolgen. Bei Bewegungsabläufen, welche für sie keinen Sinn<br />
ergaben, zu einfach waren oder durch «Üben» bereits gefestigt worden waren, verloren<br />
sie schneller das Interesse. Mit höher gesteckten Zielen fühlten sie sich motivierter. Sie<br />
konnten sich dabei steigern und eine Verbesserung erzielen. Die Ziele, von denen wir hier<br />
sprechen, sind gegen aussen gerichtet z.B. Verbesserung der Koordination, Aufbau der<br />
Kraft, Beweglichkeit, etc.<br />
Den Erfahrungen über die Eigenwahrnehmung massen die Probanden im Allgemeinen<br />
nicht so viel Bedeutung zu. Zum Teil stiessen entsprechende Hinweise von Seiten der<br />
Diplomandinnen auf Ablehnung, Desinteresse, Ungeduld. Um das Erspüren zu erfahren,<br />
muss die Sicht nach innen gerichtet werden. Gerade dies aber schien den Probanden zu<br />
missfallen. Es schien ihnen unverständlich, sich auf eine in ihren Augen unvoraussehbare,<br />
innere Wirkung einzulassen. Die Probanden konnten sich dabei keine Ziele stecken.<br />
Gegenüber der Methode waren zwei der Probanden sehr kritisch eingestellt, hinterfragten<br />
die Wirkung der Bewegungen und forderten vermehrt Erklärungen dazu. Das direkte<br />
Korrigieren fehlte ihnen zum Teil. Mittels einer Wertung mit «richtig» oder «falsch» hätten<br />
sie sich besser orientieren können. Ein Proband fand die Sprache zum Teil lächerlich und<br />
6 Vergleich der drei Probanden | Seite 55
die Korrekturen als bevormundend. Wir haben uns nach wenigen Stunden darauf geeinigt,<br />
vermehrt Informationen fliessen zu lassen, was den Probanden allgemein entgegen kam.<br />
Bei zwei der Probanden zeichneten sich hohe, konstante Werte bei der Konzentration ab.<br />
Diese beiden wiesen zudem ein hohes Kontrollbedürfnis und wenig Eigenwahrnehmung<br />
auf. Der dritte Proband hingegen zeigte starke Konzentrationsschwankungen von Stunde<br />
zu Stunde. Die Stimmung und das Wohlbefinden wirkte sich auf die Konzentration aus: je<br />
tiefer der Wert der Konzentration, desto tiefer die Werte des Wohlbefindens und der Stimmung<br />
und umgekehrt. Es scheint, dass sich diese Punkte gegenseitig beeinflussten.<br />
Die Wandlage wurde nicht von allen sehr geschätzt. S.F. lehnte diese Lage bis zum Schluss<br />
ab. Er fühlte sich dabei sehr eingeengt. Auch für O.F. war diese Lage eher beengend, zusätzlich<br />
auch noch körperlich anstrengend. Die Unbeweglichkeit und die fehlende Dehnung der<br />
Gesäss- und hinteren Oberschenkelmuskulatur trugen wesentlich zu diesem Gefühl bei. U.H.<br />
hingegen empfand die Lage grundsätzlich angenehm, obwohl auch er die freie Lage im Raum<br />
bevorzugte. Der Vorteil der Wandlage lag für ihn darin, dass sie ihm ganz andere Bewegungserfahrungen<br />
ermöglichte. Sie war für ihn unterstützend, aber auch einschränkend.<br />
Die Meinungen der Probanden unterscheiden sich, wenn es sich um die Frage einer eigenen<br />
Teilnahme oder Weiterempfehlung der Grundlagenstunden PSFL handelt.<br />
Proband U.H. stellt sich die Grundlagen PSFL als etwas vor, was er über längere Zeit weiter<br />
verfolgen könnte. Er würde eine gemischte Form, d.h. Grundlagen mit Trainingselementen,<br />
oder sogar reine Trainingsstunden vorziehen.<br />
O.F. hingegen würde sich für reine Prävention nie an einem Kurs beteiligen. Für ihn steht<br />
Kraft, Spiel und Ausdauersport im Vordergrund. Für Rehabilitation könnte er sich eine Teilnahme<br />
vorstellen oder würde die Grundlagenstunden PSFL für diesen Zweck anderen Männern<br />
weiterempfehlen.<br />
Auch für S.F. stellt sich heraus, dass die Grundlagenstunden PSFL nicht seinem Bewegungsbedürfnis<br />
entsprechen. Diese ruhige, konzentrative Bewegungsart findet wenige<br />
Berührungspunkte mit seiner ungestümen Wesensart. Trotzdem könnte er aber diese<br />
Stunden gewissen Männern weiterempfehlen.<br />
Trotz der zum Teil positiven Veränderungen im körperlichen und psychischen Bereich kristallisiert<br />
sich klar heraus, dass reine Grundlagenstunden PSFL die Bedürfnisse dieser drei<br />
Probanden zu wenig abdecken. Den Anteilen der Kraft, des Spieles und der Ausdauer werden<br />
zu wenig Rechnung getragen.<br />
Eine gemischte Gruppe würde S.F. und U.H. nicht an einer Teilnahme hindern. Sie ziehen<br />
sogar diese Form einer reinen Männergruppe vor. Für O.F. ist das Gegenteil der Fall. Er zieht<br />
generell eine reine Männergruppe den gemischten Gruppen gegenüber vor.<br />
Eine Frau als Leiterin wird von allen Probanden akzeptiert. S.F. stellt sich aber von einem<br />
Mann angeleitete Stunden nüchterner vor, was ihm mehr behagen würde. An die verbale<br />
Anleitung haben sich während des Verlaufes alle gewöhnt und mit den notwendigen<br />
Anpassungen (mehr Informationen; wie bereits oben beschrieben) fanden wir eine Form,<br />
die die Probanden angenehm empfanden.<br />
Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir mit den drei Probanden sammeln konnten,<br />
waren uns auch bei der Auseinandersetzung mit der Umfrage behilflich.<br />
6 Vergleich der drei Probanden | Seite 56
7 Auswertung der Umfrage<br />
Beantwortung der Teilfragestellungen<br />
In diesem Abschnitt geht es um den Vergleich der Ergebnisse aus der Arbeit mit den drei<br />
Probanden und den Antworten aus den Fragebogen der Umfrage, an der 74 Männer (in der<br />
Folge «Teilnehmer» oder «TN» genannt) teilgenommen haben.<br />
Wir gehen zuerst auf die Teilfragestellungen (siehe auch Seite 3) ein. Die Hauptfragestellung<br />
wird im nächsten Kapitel – so weit möglich – beantwortet.<br />
Mit 74 Teilnehmern wurden unsere Erwartungen an die Anzahl der ausgefüllten Fragebogen<br />
weit übertroffen. Die 74 TN stellen trotzdem nur eine verschwindend kleine Minderheit<br />
dar, die erhobenen Daten sind entsprechend mit Vorsicht zu geniessen. Dennoch<br />
haben sich einige Tendenzen abgezeichnet, die dann oft auch in der Arbeit mit den Probanden<br />
bestätigt wurden.<br />
Teilfragestellung I: Inwiefern sind die Grundlagen-PSFL-Methode selbst und die<br />
Art und Weise, wie sie vermittelt wird, für Männer geeignet?<br />
Gemäss Umfrage passen die Bewegungsinteressen der meisten Teilnehmer nicht zu den<br />
Grundlagen PSFL. Die meisten bewegen sich am liebsten in der Natur und sie treiben gerne<br />
Ausdauersportarten. Wichtig scheinen auch der spielerische und der kräftigende Aspekt<br />
der Bewegung zu sein. Konzentrative Bewegung ist bei den wenigsten angesagt. Auch die<br />
Rahmenbedingung «in der Gruppe, aber individuell» ist nicht sehr beliebt. Bezüglich den<br />
Grundlagen PSFL weniger wichtig, aber dennoch interessant ist, dass sich eine Mehrheit<br />
der TN lieber ohne Musik bewegt (je älter die Teilnehmer, umso eher fühlen sie sich von<br />
der Musik gestört). In Frage käme für viele allenfalls das Training PSFL, da dies vor allem<br />
dem kräftigenden Aspekt entgegenkommt.<br />
Auch unsere drei Probanden sehen in den Grundlagen PSFL nicht die bevorzugte Bewegungsart.<br />
Als ergänzende und ihrer Ansicht nach unter gewissen Umständen sehr sinnvolle<br />
körperliche Betätigung (Rehabilitation, Ausgleich zu Sport, Spannungsausgleich) käme<br />
sie aber in Frage.<br />
Auf welche Art bewegen Sie sich gerne?<br />
Grafik 1<br />
Wo und wie bewegen Sie sich gerne?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
in der Natur<br />
ausdauernd<br />
alleine<br />
in der Gruppe<br />
kräftigend<br />
spielerisch<br />
ohne Musik<br />
in der Halle<br />
entspannend<br />
mit Musik<br />
im Wettkampf<br />
konzentrativ<br />
in der Gruppe, aber individuell<br />
tänzerisch<br />
Kampfsport<br />
im Wasser<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 57
Die Hauptmotivation für Bewegung der TN ist Spass. Als Zweites folgt Gesundheit und<br />
als Drittes Ausgleich zum Berufsalltag, Entspannung. Letztere kommen den Grundlagen<br />
PSFL sehr entgegen. Ein Ansatzpunkt bezüglich «Zielpublikum Männer» wäre hier, die<br />
Männer vermehrt darauf anzusprechen, mit welchen Zielen sie PSFL-Grundlagen-Stunden<br />
besuchen würden, und weniger darauf, wo ihre Interessen bezüglich Bewegung im<br />
Moment liegen. Wir denken, dass hier mit klar formulierten Fakten bezüglich der gesundheits-<br />
und entspannungsfördernden Eigenschaften der Grundlagen PSFL der eine oder<br />
andere zu begeistern wäre.<br />
Grafik 2<br />
Die Umfrage ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Männer die Bewegungen vorgezeigt<br />
haben will. Die Konzentration auf sich selbst ist trotzdem den meisten wichtig<br />
(Grafik 4). Die überwiegende Mehrheit der TN möchte aber nicht einfach rein verbal<br />
angeleitet werden (auch wenn dies die Konzentration auf sich selbst ja fördert), sondern<br />
die Bewegung vorgezeigt bekommen (Grafik 3). Bei den Probanden gab es diesbezüglich<br />
ein etwas anderes Bild: nach einer gewissen «Angewöhnungszeit» stiess sich keiner der<br />
Drei mehr entscheidend an der verbalen Anleitung ohne Vorzeigen (ausser bei komplizierteren<br />
Bewegungsabläufen, hier ist Kompromissbereitschaft von Seiten der PSFL-Kursleiterin<br />
gefragt, mindestens in einer Anfangsphase). Dieser Unterschied mag darauf beruhen,<br />
dass die TN bei der Umfrage ein zu wenig genaues Bild davon erhalten haben, was «verbale<br />
Anleitung» denn genau heisst, im Gegensatz zu den Probanden, die diese ja selbst<br />
miterlebt haben. Wir lernen daraus, dass das verbale Anleiten besser erklärt und mehr in<br />
Zusammenhang mit der Eigenkonzentration gebracht werden sollte.<br />
Grafik 3 Grafik 4<br />
Möchten Sie lieber verbal angeleitet werden<br />
oder dass Ihnen die Bewegungen vorgezeigt<br />
werden?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
n verbal<br />
vorgezeigt<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
Aus welchem Grund bewegen Sie sich in<br />
der Freizeit? Was ist Ihre Hauptmotivation?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
Zeitvertreib<br />
ästhetische Gründe<br />
Naturerlebnis<br />
Kameradschaft<br />
Spass<br />
Gesundheit<br />
Ausgleich, Entspannung<br />
Fortbewegung im Alltag<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
Möchten Sie sich während der Bewegung auf<br />
sich selber konzentrieren können?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
nein, unwichtig<br />
ja, wichtig<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 58
Teilfragestellung II: Falls die Methode geeignet ist, wieso sind die Männer trotzdem<br />
eindeutig in der Minderzahl?<br />
Bei der Umfrage gaben 36 TN an, die Beschreibung der Grundlagen PSFL spreche sie an,<br />
und auffälligerweise genau auch 36 TN sagten, sie spreche sie nicht an. Die Gründe für<br />
das Ja/Nein sind in den unten stehenden Grafiken ersichtlich. Bemerkenswert ist, dass alle<br />
TN, die bereits Erfahrungen mit sanften Bewegungsformen gemacht haben (9 TN), sich<br />
auch von den Grundlagen PSFL angesprochen fühlen. Von diesen 9 TN hat nur einer eine<br />
körperliche Einschränkung. Es ist also anscheinend nicht so, dass Männer erst dann<br />
sanftere Bewegungsarten betreiben, wenn körperliche Einschränkungen vorhanden sind.<br />
Von den 74 TN haben insgesamt 12 eine körperliche Einschränkung, von denen wiederum<br />
sprechen 9, also drei Viertel dieser Gruppe, auf die Grundlagen PSFL an. Dies zeigt, dass<br />
Männer mit körperlichen Einschränkungen (die aber nicht schon Erfahrungen gemacht<br />
haben mit sanften Bewegungsformen) den Grundlagen PSFL gegenüber grundsätzlich<br />
offener eingestellt sind als die völlig gesunden (eher sportorientierten). Von den TN, die<br />
gerne konzentrativ arbeiten (13), fühlen sich 10 von den Grundlagen PSFL angesprochen.<br />
Unter den 5 Kampfsportlern zeigen auffälligerweise 4 Interesse für die Grundlagen PSFL.<br />
Grafik 5a<br />
Grafik 5b<br />
Spricht Sie die Beschreibung der Grundlagen<br />
PSFL an? Aus welchen Gründen ja? (36 x ja)<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
Neugier, neue Bewegungsart kennen lernen<br />
Spannungsregulation, Entspannung, inneres Gleichgewicht<br />
Körperwahrnehmung stärken<br />
Beweglichkeit fördern<br />
Einheit von Körper, Geist und Seele<br />
Stressabbau<br />
Schmerzen reduzieren<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
Spricht Sie die Beschreibung der Grundlagen<br />
PSFL an? Aus welchen Gründen nicht? (36 x nein)<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
andere Bedürfnisse beim Sport (schwitzen, Ausdauer, Spass)<br />
kein Interesse, kein Bedürfnis<br />
zu steril, langweilig, technisch, intellektuell<br />
keine Zeit<br />
weiss nicht; kann mir nichts darunter vorstellen<br />
Zweifel an Effizienz<br />
zu esoterisch, psychologisch, persönlich<br />
kenne eigenen Körper genug<br />
persönlicher Ausdruck soll nicht von Experten verändert werden<br />
Angst vor «Loslassen»<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 59
Verbindung von Grafik 1 und Grafiken 5a/b:<br />
Interessant ist, dass sich zwar die Hälfte der TN von den Grundlagen PSFL angesprochen<br />
fühlen, diese sich aber dennoch mehrheitlich auf andere Art bewegen (nur 9 TN haben<br />
Erfahrung mit sanften Bewegungsarten). Die Bewegungsformen in Grafik 1, die den<br />
Grundlagen PSFL am meisten entsprechen (konzentrativ, in der Gruppe, aber individuell,<br />
tänzerisch), werden am wenigsten genannt, wenn es um die bevorzugte(n) Bewegungsart(en)<br />
geht. Daraus lässt sich folgenden Schluss ziehen: Das Interesse wäre zum Teil vorhanden<br />
(vgl. Grafik 5a), es scheint aber andere Hinderungsfaktoren zu geben, einen Kurs<br />
zu besuchen, bei dem nicht männertypische Bewegungsarten gelehrt bzw. gelernt werden.<br />
Die Grundlagen PSFL kommen den Bewegungsbedürfnissen vieler Männer nicht nach.<br />
Männer schwitzen gerne, trainieren ihre Ausdauer, wollen Spass beim Sport, Spannung,<br />
Spiel und Wettkampf. Die Grundlagen PSFL können zudem kein Naturerlebnis bieten. Die<br />
TN der Umfrage zweifeln an der Effizienz der Methode und/oder können sich nichts Konkretes<br />
vorstellen (vgl. Grafik 5b) oder haben schlicht kein Interesse. Siehe dazu auch Teilfragestellung<br />
V/Grafik 9 weiter unten.<br />
Unsere Probanden geben diesbezüglich ein ähnliches Bild. U.H. interessiert sich für sanfte<br />
Bewegungsarten, praktiziert sie sonst aber nicht. O.F. ist sanften Bewegungsarten gegenüber<br />
eher skeptisch eingestellt, praktiziert hat er noch nie etwas in diese Richtung. S.F.<br />
findet die Grundlagen PSFL prinzipiell gut, er ist trotzdem skeptisch eingestellt, da er<br />
meint, dass Kurse in dieser Richtung oft einen esoterischen, sektiererischen Touch hätten.<br />
An der Zusammenstellung der Gruppen und an der Kursleiterin liegt es jedenfalls nicht,<br />
wie die folgenden Grafiken zeigen. Diese geben Auskunft zur<br />
Teilfragestellung III: Welche Art von Gruppen wären besonders geeignet für<br />
Männer (nur Männer, Männer/Frauen gemischt, Einzelstunden)? und<br />
Teilfragestellung IV: Ist es ein Hindernis für Männer, wenn Frauen anleiten?<br />
Grafik 6 Grafik 7<br />
Möchten Sie beim Erlernen einer neuen<br />
Bewegungsart/-form lieber von einem Mann<br />
oder einer Frau angeleitet werden?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
Mann<br />
Grafik 8<br />
Frau<br />
Empfänden Sie es als störend, nebst vielen<br />
Frauen der einzige Mann in einer Bewegungsgruppe<br />
zu sein? (n=Anzahl Nennungen)<br />
ja<br />
nein<br />
egal<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
In welchem sozialen Umfeld betätigen Sie<br />
sich körperlich am liebsten?<br />
(n=Anzahl Nennungen)<br />
egal<br />
Männergruppe<br />
gemischte Gruppe<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 60
Teilfragestellung V: Beruht die kleine Anzahl Männer, die sich auf die Grundlagen<br />
PSFL einlassen, auf grundsätzlichen Vorurteilen gegenüber sanften Bewegungsformen<br />
(Gymnastik, Yoga, Tanz usw. ist Frauensache, o.ä.), oder haben Männer<br />
wirklich keine Freude an dieser Art von Bewegung?<br />
Dies beruht zum Teil tatsächlich auf Vorurteilen bzw. Interesselosigkeit (vgl. auch Grafik<br />
5b). Männer, die sanfte Bewegungsformen gewohnt sind, interessieren sich auch für die<br />
Grundlagen PSFL. Dies lässt auf eine generell offene Haltung gegenüber sanften Bewegungsarten<br />
schliessen. Grundsätzlich können die Grundlagen PSFL keinen Ersatz für Sport<br />
bieten, das scheint in den Augen vieler Männer ein Manko zu sein. Als Ausgleich zum (oft<br />
sehr belasteten) Arbeitsalltag suchen sich Männer eher Bewegungsformen aus, bei denen<br />
sie sich austoben können. Als Zusatz kämen die Grundlagen PSFL aber trotzdem für einige<br />
in Frage. Potenzielle Kursteilnehmer sehen wir deshalb bei Männern, die (auch wenn<br />
sie sonst Sport treiben) aus vorwiegend gesundheitlichen Gründen (Rückenschulung,<br />
Reha, Spannungsausgleich u.ä.) Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität suchen. Mehr<br />
dazu im nächsten Kapitel.<br />
Hier soll noch erwähnt werden, dass sich von den 74 TN erfreulicherweise nur 3 grundsätzlich<br />
nicht gerne bewegen.<br />
Grafik 9<br />
Was denken Sie über sanfte Bewegungsformen<br />
wie die Grundlagen PSFL, Gymnastik,<br />
Yoga oder Ähnliches? (n=Anzahl Nennungen)<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75<br />
kenne ich nicht kenne ich<br />
interessiert mich nicht<br />
interessiert mich<br />
Teilfragestellung VI: Inwiefern könnte die Methode – falls nötig – den Bedürfnissen<br />
der Männer angepasst werden?<br />
Teilfragestellung VII: Was müsste getan werden, damit die Grundlagen PSFL<br />
auch bei den Männern Fuss fassen und damit ein grosser Markt erschlossen werden<br />
kann?<br />
Bei allen unseren Probanden haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die Stunden für<br />
sie grundsätzlich umso attraktiver gestalteten, je mehr Trainingselemente darin enthalten<br />
waren. Da sich viele Männer sowieso gerne mit körperlichem Einsatz bewegen, wäre es<br />
also angezeigt, die Männer vor allem für Trainingsstunden zu mobilisieren. Männer wollen<br />
(müssen?) leisten. Guggenbühl hat diese Verhaltensweise intensiv untersucht (siehe Kapitel<br />
«Gibt es ein typisch männliches Verhalten?») und ist der Meinung, dass sich Männer<br />
naturgemäss mehr gegen aussen orientieren, und dies auch tun müssen, um ihrem Leben<br />
gerecht zu werden. Diese Aussagen bestätigen unsere Erfahrungen im Rahmen der<br />
Diplomarbeit. Die Männer wollen Spass, Zerstreuung und abschalten können beim Bewegen.<br />
Und sie wollen Informationen darüber, was sie tun. Dies zeigte sich bei der Arbeit mit<br />
den Probanden immer wieder, und auch die Resultate der Umfrage zeigen in diese Richtung.<br />
«Männerfreundliche Grundlagen PSFL» müssten sich diesen Tatsachen anpassen.<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 61
Das heisst im Klartext: die Männer mit schwierigen Aufgaben fordern und ihre Neugier<br />
wecken, mehr Erklärungen darüber abgeben, welcher Bewegungsablauf für was gut ist,<br />
mehr anspornen/loben etc.<br />
Männer scheint es verstärkt zu verunsichern, wenn sie nicht genau wissen, woran sie sind.<br />
Vielleicht herrscht auch eine Angst davor, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Dies<br />
kommt in der Grafik 5b (weiter oben) zum Ausdruck («zu esoterisch, psychologisch, persönlich»,<br />
«kenne eigenen Körper genug», «Angst vor Loslassen».). Zwei von uns drei<br />
Diplomandinnen haben mit ihren Probanden die Erfahrung gemacht, dass Bestätigung von<br />
Seiten der Diplomandin sehr wichtig war. Die Probanden wollten wissen, ob sie «es richtig<br />
machten oder nicht». Unsere Erfahrung war, dass die Freude an der Sache stieg, als wir<br />
begannen, mehr Stellung zu dem zu nehmen, was die Probanden taten, und mehr Informationen<br />
darüber zu geben, was wofür gut oder schädlich ist, ob es dem Stressabbau hilft,<br />
die Muskulatur kräftigt, die Beweglichkeit oder die Durchblutung fördert etc.<br />
7 Auswertung der Umfrage/Beantwortung der Teilfragestellungen | Seite 62
8 Beantwortung der Hauptfragestellung – Fazit<br />
Wieso sind in den Grundlagenstunden PSFL für Laien die Männer in der klaren<br />
Minderheit?<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass manche Männer für die Grundlagen PSFL<br />
durchaus zu gewinnen wären. Für einige bräuchte es nicht einmal Anpassungen der<br />
Methode. Will man aber einen grösseren Markt erschliessen, müssten wohl die bereits<br />
erwähnten Anregungen verwirklicht werden:<br />
– Ziel am Anfang der Stunde mitteilen<br />
– Kompromissbereitschaft bezüglich verbaler Anleitung / Vorzeigen; d.h., Hinweise<br />
darauf geben, wie die Bewegung mechanisch abläuft (was wird wo wie fest bewegt?)<br />
– Auf den Sinn und Zweck der Bewegung hinweisen<br />
– Allgemein grösserer Informationsfluss von der Kursleiterin zu den Teilnehmern<br />
– Mehr Feedback von Seiten der Kursleiterin, mehr Kritik/Ansporn<br />
– Mehr Trainingselemente in die Stunden einfliessen lassen<br />
– Weniger Fokus auf Nachspüren<br />
– Raum geben für Fragen und Anregungen<br />
Eine entsprechende Präsentation der Methode in der (männlichen) Öffentlichkeit wäre<br />
gefragt.<br />
Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir eine Idee ausgearbeitet, wie die Grundlagenstunden<br />
PSFL für Männer gestaltet werden könnten:<br />
Ein Kurs besteht aus zwei Modulen. Das erste Modul bietet vor allem Spiel und Spass, Wettkampf,<br />
Ausdauerdisziplinen, wenn möglich draussen in der Natur. Hier können die Männer<br />
ihren Bedürfnissen nach Herausforderung, Kampf, Krafteinsatz etc. nachgehen. Dieser Teil<br />
kann auch von einem/r Fitnesstrainer/in o.ä. gestaltet werden.<br />
Das zweite Modul wäre dann eine eher klassische Grundlagenstunde PSFL für Spannungsregulation,<br />
Stressabbau, Förderung der Eigenkonzentration und -wahrnehmung, der Koordination<br />
und des Gleichgewichts, Rückenschulung (Prophylaxe und Reha) etc., angeleitet<br />
von einer PSFL-Fachfrau.<br />
Beide Module dauern ungefähr eine Stunde. Zwischen den Modulen besteht die Möglichkeit<br />
zum Duschen und etwas zu trinken. Die Männer (und auch Frauen) können sich für<br />
eines der beiden oder beide Module anmelden, immer mit der Möglichkeit, zu wechseln.<br />
Vor allem in der Garderobe entstehen so Gelegenheiten zum Austausch. Vielleicht überzeugt<br />
der eine den anderen, auch mal eine Grundlagenstunde PSFL zu besuchen, oder<br />
aber umgekehrt. Uns dünkt wichtig, dass die Männer sich untereinander austauschen –<br />
Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal einfach eine gute Sache. Und Überzeugungsarbeit<br />
unter Männern gestaltet sich wohl einfacher als von Frau zu Mann. Ein solches Modulkonzept<br />
schafft die Möglichkeit, dass sich Männer aus verschiedenen Bewegungsbereichen<br />
kennen lernen und gegenseitig voneinander profitieren können. Wir sehen darin eine Möglichkeit,<br />
dass mehr Männer Grundlagenstunden PSFL besuchen würden.<br />
8 Beantwortung der Hauptfragestellung – Fazit | Seite 63
9 Quellenangaben<br />
Guggenbühl, Allan (1994), Männer, Mythen, Mächte. Stuttgart: Kreuz-Verlag<br />
Gehirn & Geist (Nr. 5/2003), Frau und Mann – der grosse Unterschied, Teil I. S. 50–56.<br />
Heidelberg: Verlag Spektrum der Wissenschaft<br />
Gehirn & Geist (Nr. 6/2003), Frau und Mann – der grosse Unterschied, Teil II. S. 56–61.<br />
Heidelberg: Verlag Spektrum der Wissenschaft<br />
Die Weltwoche (Nr. 41/2006), Die Metaphysik der Frau. S. 42–47.<br />
Zürich: Verlag Jean Frey AG<br />
9 Quellenangaben | Seite 64
Herzlichen Dank<br />
Wir möchten im Besonderen unseren drei Probanden danken, die mit mehrheitlich viel<br />
Ausdauer, zum Teil schwankender Motivation, aber nie verzagend, sich für unsere Diplomarbeit<br />
zur Verfügung gestellt haben. Wir waren drei gute Teams und die Arbeit war für uns<br />
alle auf mehreren Ebenen lehrreich.<br />
Einen herzlichen Dank geht an alle Teilnehmer der Umfrage. Sie waren bereit, etwas von<br />
sich mitzuteilen, womit sie uns in unserer Arbeit entscheidend unterstützten (auch wenn<br />
die Auswertung der Umfrage einige Tücken für uns bereithielt).<br />
Herzlichen Dank auch an unsere Schulleiterin Carmen Pittini, die uns mit Rat, Unterstützung<br />
und viel Begeisterung bei der Realisierung dieser Diplomarbeit zur Seite stand.<br />
Und wir drei Diplomandinnen danken uns untereinander für die gegenseitige Motivierung<br />
und Unterstützung, die Begeisterung für die Sache, das Durchhaltevermögen, den intensiven<br />
Austausch, die Ernsthaftigkeit und den Humor, die super gut funktionierende Teamarbeit,<br />
die Herzlichkeit und nicht zuletzt für die Knochenarbeit, die halt eben auch geleistet<br />
werden musste.<br />
Herzlichen Dank | Seite 65
Anhang<br />
Mustervorlagen der Fragebogen:<br />
Bestandesaufnahme Ausgangslage (von C. Pittini, <strong>Heiligberg</strong> <strong>Institut</strong>)<br />
Bestandesaufnahme am Ende (von C. Pittini, <strong>Heiligberg</strong> <strong>Institut</strong>)<br />
Fragebogen klein *<br />
Fragebogen gross am Anfang *<br />
Fragebogen gross nach 5 Stunden *<br />
Fragebogen gross nach 10 Stunden *<br />
Fragebogen gross nach 15 Stunden *<br />
Fragebogen gross zum Abschluss *<br />
Beobachtungsblatt für Diplomandin *<br />
Fragebogen zum Bewegungsverhalten des Mannes (Umfrage) *<br />
* Diese Fragebogen wurden von uns drei Diplomandinnen getextet und gestaltet.<br />
Anhang | Seite 66
Anhang | Seite 67
Anhang | Seite 68
Anhang | Seite 69
Anhang | Seite 70
Anhang | Seite 71
Anhang | Seite 72
Anhang | Seite 73
Anhang | Seite 74
Anhang | Seite 75
Anhang | Seite 76
Anhang | Seite 77
Anhang | Seite 78
Anhang | Seite 79
Anhang | Seite 80
Anhang | Seite 81
Anhang | Seite 82
Anhang | Seite 83
Anhang | Seite 84
Anhang | Seite 85
Anhang | Seite 86
Anhang | Seite 87
Anhang | Seite 88
Anhang | Seite 89
Anhang | Seite 90
Anhang | Seite 91
Anhang | Seite 92
Anhang | Seite 93
Anhang | Seite 94
Anhang | Seite 95
Anhang | Seite 96
Anhang | Seite 97
Anhang | Seite 98