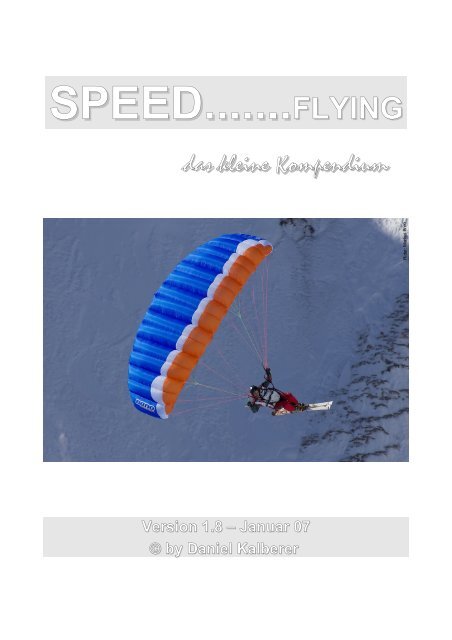Speedriding Kompendium (PDF) von Daniel Kalberer - sehr
Speedriding Kompendium (PDF) von Daniel Kalberer - sehr
Speedriding Kompendium (PDF) von Daniel Kalberer - sehr
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SPEED.......FLYING<br />
SPEED....... FLYING<br />
das kleine <strong>Kompendium</strong><br />
Version 1.8 – Januar 07<br />
© by <strong>Daniel</strong> <strong>Kalberer</strong><br />
Rider: Markus Breu
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort...................................................................................................................................2<br />
Geschichte.............................................................................................................................2<br />
Konstruktion – Aerodynamik..................................................................................................3<br />
Klappstabiles Profil............................................................................................................3<br />
Wing Load – oder die Frage der Motorisierung ................................................................4<br />
Ausrüstung.............................................................................................................................5<br />
Voraussetzung.......................................................................................................................6<br />
Flugtechnik.............................................................................................................................7<br />
Start....................................................................................................................................7<br />
Pitchcontrol........................................................................................................................8<br />
Rollen.................................................................................................................................9<br />
Landung...........................................................................................................................10<br />
Groundtrainer.......................................................................................................................11<br />
Gelände................................................................................................................................11<br />
Verhaltenskodex..................................................................................................................13<br />
Rechtliche Situation.............................................................................................................13<br />
Zukunft.................................................................................................................................14<br />
Vorwort<br />
Selten waren die Meinungen so geteilt, wie über die kleinen Flügel. Sehen die einen darin ein<br />
Fluggerät für Jedermann – ist es für andere der typische Wolf im Schafspelz. Das kleine<br />
<strong>Speedriding</strong> <strong>Kompendium</strong> soll Wissen vermitteln und Risiken aufzeigen. Es ist aber sicher kein<br />
Ersatz für eine fachkundige praktische Einweisung. Der Text hat nicht den Anspruch der Weisheit<br />
letzter Schluss zu sein; Ergänzungen und auch kritische Einwände sind jederzeit willkommen. dk<br />
Geschichte<br />
Speed.. – riding – flying – gliding wie wir den neuen Sport auch nennen, es tönt spektakulär und<br />
völlig neu. Doch die ganze Sache ist nicht wirklich eine Erfindung vom letzten Winter. So manch<br />
alter Fallschirmspringer winkt gelangweilt ab - das haben wir schon vor Jahren gemacht. Stimmt,<br />
doch auch bei den Fallschirmen hat sich zwischenzeitlich einiges getan. Die heutigen<br />
Sprungschirme sind auf Bonsaigrösse geschrumpft. Mit diesen kleinen Schirmen nach dem Freifall<br />
der Geländekontur entlang zu fliegen, ist für viele eine grosse Faszination. In den Staaten wird auf<br />
der Skipiste um Tore geflogen, was sich Bladerunning nennt. Dagegen wird in den Alpen seit<br />
Jahren das sogenannte Mountain-Swooping praktiziert. Die Springer werden über einem<br />
Gebirgsmassiv abgesetzt, um dann spektakulär über Felsgräte, Couloirs und Felswände ins Tal zu<br />
rauschen. Viele haben noch die Bilder aus dem Soul Flyer Video vor Augen, worin sich Springer<br />
und Skifahrer regelrechte Duelle geliefert haben. Doch es dauerte, bis die Idee, der Kombination<br />
Schirm/Ski den wirklichen Durchbruch fand. Vom französischen Val Fréjus breitet sich der Virus<br />
aber endgültig aus.<br />
2
Konstruktion – Aerodynamik<br />
Obwohl im Skigebiet die Schirme sofort zur Spezies Paragleiter klassifiziert werden, haben Sie ein<br />
erstaunliches Eigenleben entwickelt. Wo liegen die Wurzeln? Heutige Gleitschirme erinnern kaum<br />
mehr an die Matratzen aus den 80iger und auch an den Sprungschirmen ist die Evolution nicht<br />
spurlos vorüber gegangen. Swooping heisst das magische Wort. Durch steile Drehung wird so viel<br />
kinetische Energie wie möglich aufgebaut, um in einem Höllentempo jenseits der 100er Marke dem<br />
Boden entlang zu flaren. Anstelle der Drehung kann man natürlich auch den „Landeplatz“ neigen<br />
und so im Gebirge dem Relief „nachswoopen“. Das Ganze mit Skiern und wir sind wieder beim<br />
Thema.<br />
Klappstabiles Profil<br />
Viele werden sich Fragen, warum man Fallschirm-Konzepte nimmt, denn Gleitschirme haben doch<br />
ein ausgereiftes Startverhalten und sind obendrein noch viel leistungsfähiger. Ein bikonvexes<br />
Gleitschirmprofil ist leistungsmässig optimiert, hat aber die Eigenschaft einzuklappen. Was beim<br />
Gleitschirm sogar gewünscht sein kann (Stichwort; Dynamikdämpfung durch Klapper) würde sich<br />
bei einer Skalierung der Schirmgrösse auf die Hälfte fatal auswirken. Sicherlich, es bedarf grosser<br />
Turbulenzen, um einen Schirm mit einer solchen Flächenbelastung einzuklappen, aber es wäre<br />
eine Frage der Zeit, bis der Fall eintritt. Auch die Fallschirmspringer sind schon auf die Idee<br />
gekommen, die leistungsfähigeren Profile einzusetzen, sind aber zum gleichen Schluss<br />
gekommen: Bei kleinen Fallschirmen ist die Stabilität eine Grundvoraussetzung, um sie sicher zu<br />
fliegen. Aber was ist das Geheimnis, dass man sich bei Fallschirmen sogar mit dem ganzen<br />
Gewicht an einen Tragegurt hängen kann? Die Folge wird eine spektakuläre Steilkurve sein, der<br />
Schirm klappt aber nicht ein. Man kann argumentieren, die Gewichtsverteilung sei homogener<br />
durch die Gabelung der Leinen nach hinten. Alle Leinen des A-Gurtes lenken in der<br />
auftriebsrelevanten vorderen Hälfte des Flügels an. Aber wer schon einmal einen A/B Klapper mit<br />
einem Gleitschirm gemacht hat wird beipflichten, dass das zu <strong>sehr</strong> sportlichen Situationen führen<br />
kann. Des Rätsels Lösung ist, dass Sprungschirmprofile nicht bikonvex sind sondern eine gerade<br />
verlaufende Profil-Unterkante haben.<br />
Abtrieberzeugendes bikonvexen Gleitschimprofil<br />
Klappstabiles Fallschirmprofil<br />
Die Folgerung aus dieser Tatsache entspricht nicht der allgemeinen Lehrmeinung, sie ist aber <strong>sehr</strong><br />
plausibel. Die Theorie vom Abwind, der auf das Obersegel trifft und so die Kappe eindrückt hinkt.<br />
Der Klapper entsteht nicht hauptsächlich durch die Druckkraft, welche aufs Obersegel wirkt,<br />
sondern durch den Abtrieb, der durch die Umströmung des Profils entsteht. Wenn nun die<br />
Profilunterseite gerade ist, kann sich die Strömung nach der unteren Eintrittskante nicht wieder<br />
anlegen.<br />
Dank diesem konstruktiven Kniff sind die Kappen extrem klappstabil. Schwere Turbulenzen<br />
können aber dazu führen, dass die Luft aus der Kappe herausgedrückt wird, was die Schirme mit<br />
3
Durchsacken quittieren. Ein extremer Dynamikaufbau wie bei einem einseitigen Klapper lässt sich<br />
aber nicht feststellen. Darum ist das Fallschirmkonzept vom Prinzip her <strong>sehr</strong> sicher.<br />
Die gutmütigen Profile verzeihen einiges!<br />
Wing Load – oder die Frage der Motorisierung<br />
Die Geschwindigkeit ist direkt abhängig <strong>von</strong> der Flächenbelastung. Wird im Acrobereich mit<br />
~5kg/m2 belastet, so können die extremen Grössen bei Sprungschirme durchaus mit dem<br />
doppelten beladen werden! Die Wahl der Flügel erfolgt also nicht mehr primär nach Pilotengewicht,<br />
sondern nach dem Pilotenkönnen. Bei der Skalierung zu immer kleineren Flächen machen sich<br />
jedoch einige Effekte negativ bemerkbar. Die Auftriebsleistung nimmt mit der Verkleinerung<br />
deutlich ab. Die Flügel flaren aus dem Normalflug nicht mehr so gut. Es geht sogar soweit, dass<br />
extrem kleine Sprungschirme nicht mehr aus dem Trimmflug heraus gelandet werden können. Die<br />
fehlende aerodynamische Leistungsfähigkeit wird durch kinetische Energie aus einer Kurve<br />
kompensiert, um sicher landen zu können. Zudem werden bei kleinen Schirmen die Steuerwege<br />
immer radikaler. Das lässt sich damit erklären, dass nicht nur die Fläche verkleinert wird, sondern<br />
auch die Leinen eine Verkürzung erfahren. Somit werden die dämpfenden Pendelbewegungen<br />
verkleinert und Steuerimpulse extrem direkt umgesetzt. Diese Tatsache wirkt sich vor allem bei<br />
leichtgewichtigen Anfängern negativ aus. Die Schirmgrösse mit derselben Flächenbelastung wie<br />
beim Normalpiloten, hat ein viel giftigeres Flugverhalten und führt schnell zu einer gefährlichen<br />
Überforderung. Daraus folgt: Schirme prinzipiell nicht zu klein wählen!<br />
4
Achtung! 8m2 sind auch für Profis <strong>sehr</strong> anspruchsvoll<br />
Wir haben bewusst nur die eigentlichen Speedglider auf dem Fallschirmkonzept betrachtet.<br />
Parallel wurden aber auch kleine Schirme mit deutlich mehr Leistung entwickelt. Nicht einfach<br />
skalierte Serienschirme, sondern Gleitschirmen die speziell auf diese Grösse konstruiert sind. Für<br />
den reinen Speedflying Einsatz haben die Schirme meist zu viel Leistung. Couloirs können somit<br />
nicht inline geflogen werden. Es muss dauernd mit Steilkurven die Leistung vernichtet werden, um<br />
dem Gelände folgen zu können. Dafür ist die Flugleistung (GZ >4.5) deutlich besser und man hat<br />
mehr Reserven um Hindernisse zu überfliegen. Im Moment lässt es sich noch nicht abschätzen<br />
wohin sich der Trend der kleinen Gleitschirme entwickelt.<br />
Ausrüstung<br />
Da der Sport ausschlisslich neben der Piste praktiziert wird, ist eine komplette Freeride Ausrüstung<br />
die Basis. Spezielle Freeride Skis erleichtern das Fahren im unpräparierten Gelände. Thema<br />
Snowboard – kurz: suboptimal – Durch das Ausdrehen der Hüfte in Fahrtrichtung, gibt es zwangsläufig<br />
eine Gewichtsverlagerung, welche durch Gegenbremsen kompensiert werden muss. Im Flug<br />
kann das Brett quer gestellt werden, um dann kurz vor Bodenkontakt sofort wieder in Fahrtrichtung<br />
auszudrehen. Vor allem ungeplante Geländeberührungen können mit dieser Technik zu<br />
Problemen führen. Weiter gehören Helm und Rückenprotektor zur Grundausrüstung. Natürlich<br />
braucht es auch ein geeignetes Fluggerät. Sprungschirme haben den grossen Nachteil, dass ihr<br />
Füllverhalten auf Freifallöffnungen konzipiert ist. Zudem müssen die Gurten angepasst werden und<br />
die unummantelten Leinen saugen sich bei warmer Witterung wie Schwämme voll mit Wasser.<br />
Spezielle Speedglider sind diesbezüglich viel unkomplizierter. Die Konstruktionen sind auf das<br />
Fliegen mit Skis ausgelegt. Was sich auch bei der Materialwahl zeigt, so ist zum Beispiel das<br />
Obersegel und die Leinen mit einem wasserabstossendem Finish versehen. Die auf dem Markt<br />
befindlichen Geräte haben einen Lasttest hinter sich und bieten <strong>von</strong> der Festigkeit genügend<br />
Reserven. Bei den Gurtzeugen besitzen die Bergsteigerversionen ohne Sitzbrett, die maximale<br />
5
Bewegungsfreiheit. Der fehlende Rückenschutz kann durch den oben beschrieben Rücken-<br />
Protektor aus dem Ski und Snowboardsport ersetzt werden. Die meisten Hersteller liefern das<br />
System komplett mit Schirm Gurtzeug und Schnellpacksack.<br />
Ausrüstung mit zwei aktuellen Systemen: JN Hellracer vs GIN Nano<br />
Voraussetzung<br />
Man muss differenzieren ob vom <strong>Speedriding</strong> in freier Wildbahn oder kleinen Hüpfer in der<br />
geschlossenen Versuchswerkstatt (vgl. Abschnitt Gelände) spricht. Für das eigentliche Speedriden<br />
ist ein gutes skifahrerisches Können Bedingung und auch fliegerisch sollte man überdurchschnittliche<br />
Erfahrung besitzen. Es gilt bei <strong>sehr</strong> hohem Tempo die Flugrute dem Gelände und<br />
den Hindernissen anzupassen. Zudem müssen die alpinen Gefahren; vorrangig Wetter- und<br />
Lawinensituation richtig eingeschätzt werden können. Im Weiteren gilt es Abmachungen und<br />
Gesetzte, die für Hänggleiter gelten, ebenfalls zu beachten: Wildschutzzonen – Luftraum usw.<br />
Dagegen kann man unter Aufsicht kleine Hüpfer am flach auslaufenden Übungshang auch ohne<br />
fliegerische Vorkenntnisse machen. Ob sich die fehlenden Kompetenzen auf diesem Weg<br />
erarbeiten lassen, wird sich in Zukunft zeigen.<br />
6
Flugtechnik<br />
Start<br />
Für einen Gleitschirmflieger ist ein sauber ausgelegter Schirm der halbe Start, so war auch die<br />
Meinung bei den Speedglidern. Doch diese Technik ist nicht nur ineffizient, sondern bringt auch<br />
keinen spürbaren Vorteil. Folgendes Vorgehen hat sich bewährt: Den Schirm in einer ruhigen Ecke<br />
der Bergstation sauber auslegen und die ganzen Startvorbereitung wie beim Gleitschirm treffen;<br />
einhängen und checken. Danach den Schirm raffen und zum Startplatz fahren.<br />
...gerafft hinlegen ...Stabilo nach aussen falten ...richtig ausdrehen<br />
Man legt den Schirm hin, faltet die Stabilos nach aussen und streckt die Leinen - auf die richtige<br />
Seite ausdrehen - Luftraumcheck und los geht’s. Die Schirme steigen ohne grossen Widerstand<br />
hoch, schneller Kontrollblick und nach der Beschleunigungsphase hebt man durch Anbremsen<br />
zügig ab. Dieses phänomenale Aufziehverhalten der Minis ist auf die kurzen Leinen und die<br />
geringe Fläche zurückzuführen. Durch die kleine Fläche ist die Abhebegeschwindigkeit höher und<br />
somit die Startstrecke deutlich länger als mit dem Gleitschirm. Das wird einem überhaupt nicht<br />
bewusst, denn Ski sei dank - ist man erstaunlich schnell in der Luft. Sollte etwas nicht in Ordnung<br />
sein, vor der Beschleunigungsphase einfach abschwingen.<br />
Unglaublich - auch aus solchen Test-Situationen starten die Schirme mustergültig!<br />
7
Spätestens bei Abwind - wenn man um seinen Schirm watschelt und vergeblich versucht das Tuch<br />
schön auszubreiten - wird man die Raff-Technik zu schätzen wissen. Man legt den Schirm in eine<br />
windgeschützte Mulde und beim Start lässt sich der Rückenwind durch etwas mehr Schwung gut<br />
kompensieren. Allgemein sollten Startplätze ohne Hindernisse gewählt werden und jederzeit einen<br />
Abbruch ermöglichen. Reicht einmal die Gleitleistung nicht aus, muss man immer einen Notlandeplatz<br />
einplanen.<br />
Pitchcontrol<br />
Im Gegensatz zum Gleitschirm haben Speedglider ihr bestes Gleiten bei ~30-40% Bremse. Löst<br />
man vom optimalen Gleiten die Bremse wird der Gleitpfad <strong>sehr</strong> steil und die Geschwindigkeit<br />
nimmt ungewohnt zu. Das entgegengesetzte Flaren basiert auf zwei Effekte; zum einen durch<br />
Leistung auf der Bremse (also durch aerodynamische Güte des Flügels) zum anderen durch das<br />
Umsetzen der aufgebauten Bewegungsenergie.<br />
Diese Tatsache ist für Gleitschirmpiloten <strong>sehr</strong> ungewohnt und bedarf einiges an Kopfarbeit, um die<br />
im Rückenmark gespeicherten Reflexe umzuprogrammieren. Wird es einmal eng bei einer<br />
Landung, gilt es in erster Linie so rasch als möglich, mit beidseitigen Bremsen (>50%),<br />
Geschwindigkeit abzubauen! Dadurch wird zusätzlich Zeit, für ein mögliches Ausweichmanöver<br />
gewonnen.<br />
Out of control => beherztes, beidseitiges Bremsen!<br />
Die eigentliche Gleitwinkelsteuerung über die Bremse eröffnet ungeahnte Spielmöglichkeiten und<br />
ermöglicht erst den eigentlichen Konturenflug in der Falllinie.<br />
mit maximalem Gleiten zur nächsten Rinne<br />
8
Rollen<br />
Beim den ersten Aufziehversuchen wird jedem sofort klar, dass die Bremsimpulse im Vergleich<br />
zum Gleitschirm fast verzögerungsfrei umgesetzt werden. Das hat ein <strong>sehr</strong> ausgeprägtes Rollen<br />
zur Folge. Bei so manchem Leser läuten nun die Alarmglocken, wenn er Instabilität in der<br />
Längsachse hört. Doch Newton eilt zur Hilfe, oder besser gesagt seine Beschreibung des<br />
Trägheitsprinzips. Durch die hohe Vorwärtsfahrt ist das System bestrebt, in seinem<br />
Bewegungszustand zu verharren. Bei einem mässigen Steuerimpuls rollt nur der Schirm, bei<br />
nahezu demselben Gleitpfad, zur Seite. Es lässt sich je nach Geschwindigkeit eine Art Messerflug<br />
realisieren. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: durch die kurzen Leinen ist die Kappe dem Boden<br />
<strong>sehr</strong> nahe und Hindernisse lassen sich so vorzüglich einfangen!!!<br />
Kombiniert man das Rollen mit dem Nicken, fängt der Spass aber erst richtig an. Benötigt man<br />
beim Gleitschirm mehr als eine halbe Umdrehung, bis der Schirm auf die Nase geht, befindet man<br />
sich mit den Minis bei entsprechendem Bremsimpuls, schon nach einer ¼ Drehung in einem<br />
deftigen Sturzflug. So kann man wunderbar Geländestufen folgen.<br />
Die hohe Schule des Fliegen mit kleinen Schirmen stellt der aus der Fallschirmszene stammende<br />
Hookturn dar. Bei ganz grossen Geländestufen kann man anstelle der Bremse den A-Tragegurt zu<br />
Steuerung nehmen. Es wird dadurch noch mehr Geschwindigkeit aufgebaut. Doch hier sind die<br />
Grenzen zur Überforderung schnell erreicht. Was sich auch bei den Fallschirmspringer zeigt, trotz<br />
ihrer immensen Erfahrung ist eine verpatzte Hookturn-Landung Unfallursache Nummer eins!<br />
Es ist keine Frage ob man sich verschätzt, sondern wann!<br />
9
Landung<br />
Wie der Start ist die Landung <strong>sehr</strong> einfach. Die Schirme flaren <strong>sehr</strong> schön; und falls man sich<br />
etwas verschätzt hat, wird durch die Kombination Schnee und Ski doch einiges an Energie<br />
absorbiert. Man muss jedoch vorausschauend fliegen und den Gleitwinkelbereich genau kennen,<br />
um sich nicht in eine Sackgasse zu manövrieren.<br />
Das Steuersystem ist in den paar kurzen Sätzen erklärt, doch der Umgang mit der<br />
Geschwindigkeit bedarf einiges an Training. Wurden die Schirme vom Konzept her als <strong>sehr</strong> sicher<br />
bezeichnet, muss man an dieser Stelle relativieren. Zum System gehört nicht nur der Schirm,<br />
sondern auch der Pilot und der ist ein grosser Unsicherheitsfaktor. Die Kappen sind für kleine<br />
Hüpfer durchaus grundschulungstauglich. Betonung auf kleine Hüpfer; grobe Steuerausschläge<br />
werden dabei höchstens mit einem etwas unsanften Bodenkontakt quittiert. Derselbe Pilotenfehler<br />
in etwas grössere Höhe, wird nicht mehr nur mit einem kleinen Klaps auf den Hintern bestraft!<br />
Für alle gilt „Step by Step“ an die Manöver heranzugehen, doch ganz speziell ist die Empfehlung<br />
an die Gleitschirmroutinier, welche schon alles kennen! Neben den rein motorischen Fähigkeiten<br />
sollte man <strong>von</strong> Anfang an den Blick wandern lassen und sich nicht nur auf die Flugroute fixieren<br />
– die Gefahr eines Tunnelblickes ist recht gross – fliegt man in der Gruppe ist es <strong>sehr</strong> wichtig die<br />
Übersicht zu bewahren!<br />
Auch das Wetter sollte nicht ausser acht gelassen werde, die Stabilität und Sicherheit der Schirme<br />
ist zwar ausgezeichnet, doch alles hat seine Grenzen; bei Föhn, Fronten und Gewitter haben auch<br />
diese Schirme nichts in der Luft verloren.<br />
10
Groundtrainer<br />
Die Speedglider lassen vorzüglich auch als Groundtrainer einsetzten. Auch bei stärkerem Wind<br />
kann man damit sicher spielen. Die Erklärung liegt darin, dass die Schirme bei gelösten Bremsen<br />
<strong>sehr</strong> wenig Auftrieb produzieren und somit bei Böen nicht gross zum Aushebeln neigen. So<br />
mancher kommt nun auf die Idee mit den Schirmen auch einen Fussstart zu probieren. An der<br />
Düne kann das völlig problemlos machen – bei genügend Wind mag das am Übungshang mit<br />
englischem Rasen auch noch gehen – bei schwachem Wind und normalem alpinen Startgelände<br />
muss eindringlich <strong>von</strong> einem Fussstart abgeraten werden! Für Unbelehrbare noch etwas Physik<br />
auf den Weg: Bei Verdopplung der Geschwindigkeit nimmt die Aufprallenergie um das vierfache<br />
zu!<br />
Gelände<br />
Bei der Diskussion wird oftmals nicht differenziert wo man den Sport ausübt. Es macht ein grosser<br />
Unterschied ob man an einem flachen Hang ein paar Hüpfer macht oder im Stechflug durch eine<br />
Fels durchsetzte Rinne donnert. Leider gibt es in den Alpen nur <strong>sehr</strong> wenige Gebiete die in einen<br />
absolut hindernisfreien Talkessel münden. Der Normalfall ist ein Gelände mit unzähligen<br />
Hindernissen und eher kurzen Runs <strong>von</strong> ein paar hundert Höhenmetern. Von der Neigung sind die<br />
geeigneten Gelände immer auch prädestinierte Lawinenhänge! Mit den alpinen Gefahren sollte<br />
man sich also gut auskennen. Zur Flugvorbereitung gehört neben dem Meteocheck auch das<br />
Konsultieren der Lawinenprognose. Exzellentes Lehrmittel zum Thema: http://www.whiterisk.ch<br />
Es ist zudem hilfreich anhand <strong>von</strong> Karten sich ein Bild vom Gelände zu machen. Viele<br />
Gefahrenzonen lassen sich da schon vorgängig erkennen. Bei einer Besichtigungsfahrt ohne<br />
Schirm, kann man seine Flugroute mit den Notlandeplätzen definitiv planen. Im unbekannten<br />
Gelände einfach auf gut Glück drauf los zu fliegen ist verantwortungslos!<br />
11
Carving mit Schirm - für einen guten Skifahrer schnell erlernt – aber ist das schon <strong>Speedriding</strong>?!<br />
Es sollten sämtliche Aktivitäten nur in Absprache mit dem Bahnbetreiber und/oder den örtlichen<br />
Locals erfolgen. Orientiert die Leute über euer Vorhaben und zeigt die Sicherheitsvorkehrungen<br />
auf. Die Schirme haben definitiv nichts auf der belebten Piste zu suchen. Die Gefahr einen<br />
Skifahrer zu übersehen ist einfach zu gross – ein solcher Unfall wäre der super GAU für den noch<br />
jungen Sport. Verbote und Restriktionen wären die unmittelbare Folge!<br />
12
Verhaltenskodex<br />
Piloten<br />
● Locals kontaktieren (Neuland: Bahnbetreiber)<br />
● Lawinenwarnungen beachten<br />
● Gesetze & Wildschutzzonen strikte einhalten<br />
● Kritische Selbsteinschätzung (Lernmethode: Step by Step)<br />
Händler /Flugschulen/Hersteller<br />
● Keine Geräte ohne praktische Schulung/Einweisung verkaufen oder vermieten!<br />
● Für das Kundenvolumen die entsprechenden Fluggebiete erschliessen und betreuen.<br />
Rechtliche Situation<br />
Eine Mischung aus Kite und Gleitschirm wird das <strong>Speedriding</strong> oftmals beschreiben. Ein Kite<br />
unterliegt in keinem Land einer Lizenzpflicht, bei Gleitschirmen ist das mehr oder weniger<br />
reglementiert.<br />
● Frankreich<br />
Im Land des Vol libré gibt es wie auch für die Gleitschirme keine Lizenzpflicht. Es wird auf<br />
Selbstregulierung gesetzt – ob das auch so gut funktioniert wie beim Paragliding, wird die<br />
Zukunft zeigen. Aktuell wird nach einem <strong>sehr</strong> fundierten Ausbildungskonzept <strong>von</strong> Seiten<br />
des Verbandes gearbeitet.<br />
● Schweiz<br />
Als einziges Alpenland ist die rechtliche Situation klar. Die Schirme werden als Fluggeräte<br />
eingestuft und somit gilt die Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien. Um<br />
solche Fluggeräte zu betreiben ist eine bestandene Gleitschirmprüfung und eine<br />
Haftpflichtversicherung notwendig. Art.8: Starts und Landungen auf öffentlichen Strassen<br />
und Skipisten sind untersagt. http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/748.941.de.pdf<br />
● Österreich<br />
Tendenziell auf der Linie der Schweiz aber noch keine offizielle Weisung bekannt. Es gilt<br />
die 30m Bodenabstand Regelung, sprich darüber wird es als Fluggerät taxiert darunter als<br />
Kite? Momentan kann man versicherungstechnisch mit einer Paragliding-Lizenz sicher<br />
nichts falsch machen. Parallel dazu haben die Piloten zusammen mit den Deutschen mit<br />
dem DÖSV einen unabhängigen Verband gegründet.<br />
● Deutschland<br />
Um die unklare Situation zu Bereinigen wurde der DÖSV als offizielle Vertreter der<br />
Speedflyer gegründet. Wie eine Zusammenarbeit mit dem DHV aussieht werden die<br />
laufenden Verhandlungen zeigen.<br />
13
Zukunft<br />
Für die Kommunikation ist es zunächst einmal wichtig einen definitiven Namen für das Kind zu<br />
finden. <strong>Speedriding</strong> ist die Urbezeichnung der Franzosen, im englisch Sprachraum wird der Begriff<br />
als etwas holprig empfunden. Speedgliding und Speedflying sind eigentlich zwei Begriffe aus der<br />
Drachenszene. Zudem finden einige die Speed-Begriffe etwas zu aggressiv.<br />
Wie im Moment die Entwicklungen laufen, wird es zwei Lager geben. Zum einen der<br />
Schulungshang wo auch Nichtflieger unter Aufsicht etwas schnuppern können. In Zusammenarbeit<br />
mit den Bahnbetreiber wird ein geeignetes Gelände präparieret und <strong>von</strong> der restlichen Piste<br />
getrennt. Für Skidestinationen könnte das eine willkommene Ergänzung sein und wird sicherlich zu<br />
einem Publikumsmagnet. So könnten in Zusammenarbeit <strong>von</strong> Ski- und Flugschulen interessante<br />
Synergien entstehen. Auf der anderen Seite ist für das freie Fliegen eine erweiterte<br />
Gleitschirmausbildung sicherlich nicht der falsche Weg. Ob man die Ausbildung oder Teile da<strong>von</strong><br />
nur mit den Mini-Schirm machen kann, werden die Verbände entscheiden müssen.<br />
Gerätetechnisch werden für die ersten Schritte eher grosse Flächen (14/15m2) eingesetzt.<br />
Auf der anderen Seite sind mit den heutigen Konzepten die minimalen Grössen erreicht. Schirme<br />
unter 12m 2 sind allgemein <strong>sehr</strong> anspruchsvoll zu fliegen. Anstelle der reinen Steigerung der<br />
Geschwindigkeit ist das maximieren des Leistungsfensters ein sinnvolles Entwicklungsziel –<br />
Gleitzahl „eins-zu-Stein“ um auch dem steilstem Gelände geradlinig zu folgen und ein<br />
ansprechendes Gleitverhalten für den Flug zum nächsten Spot.<br />
Wir dürfen jedenfalls gespannt sein wie sich der faszinierende Sport entwickelt. Zum Schluss ein<br />
Zitat <strong>von</strong> einem Lawinenexperten, welches auch hier seine Gültigkeit hat:<br />
No Risk - No Fun<br />
No Limit - No Life<br />
14
Viel Spass!<br />
<strong>Daniel</strong> <strong>Kalberer</strong> – dipl. Ing FH – Fluglehrer SHV<br />
© by <strong>Daniel</strong> <strong>Kalberer</strong> - NoGravity.ch – kommerzielle Nutzung nur mit Genehmigung des Urhebers erlaubt.<br />
15