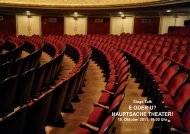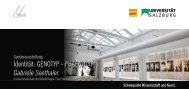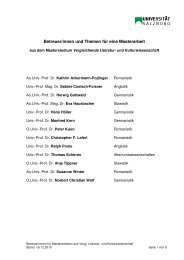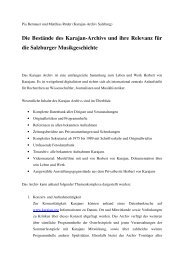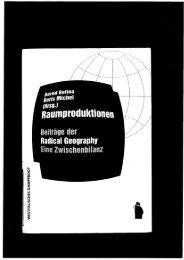Unter Krummstab, Löwe und Adler. Salzburgs Musikgeschichte im ...
Unter Krummstab, Löwe und Adler. Salzburgs Musikgeschichte im ...
Unter Krummstab, Löwe und Adler. Salzburgs Musikgeschichte im ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst<br />
Forschungsplattform Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong><br />
Symposion<br />
<strong>Unter</strong> <strong>Krummstab</strong>, <strong>Löwe</strong> <strong>und</strong> <strong>Adler</strong>.<br />
<strong>Salzburgs</strong> <strong>Musikgeschichte</strong><br />
<strong>im</strong> Zeichen des Provinzialismus<br />
Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Frohnburg, Hellbrunner Allee 53<br />
Konzertsaal<br />
21.–23. September 2012
Freitag, 21. September 2012<br />
14:00 Eröffnung<br />
Vorsitz: Nils Grosch<br />
14:30 Thomas Hochradner<br />
Salzburg <strong>im</strong> Zeichen des Provinzialismus?<br />
Wahrnehmungsperspektiven einer musikgeschichtlichen Etappe<br />
15:15 Monika Oebelsberger<br />
Schullieder <strong>und</strong> Schulmethoden in Salzburg – ein Beitrag zur<br />
Geschichte der Musikpädagogik <strong>im</strong> frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
16:30 Elke Michel-Blagrave<br />
Fürst Ernst von Schwarzenberg als Widmungsempfänger<br />
Salzburger Komponisten<br />
17:15 Margit Haider-Dechant<br />
Joseph Woelfls Salzburger Jahre<br />
19:30 Konzert mit Werken von Ignaz Assmayr, Otto Bach, Anton Diabelli,<br />
Heinrich Esser, Benedikt Hacker, Hans Schläger, Joseph Woelfl u.a.<br />
Mozarteum Quartett Salzburg<br />
Laura Nicorescu, Sopran<br />
Cordelia Höfer-Teutsch, Klavier<br />
Margit Haider-Dechant, Klavier<br />
2
Samstag, 22. September 2012<br />
Vorsitz: Andrea Lindmayr-Brandl<br />
09:00 Carena Sangl<br />
Musikpflege <strong>im</strong> Salzburg der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
nach Quellen des Musikarchivs <strong>im</strong> Franziskanerkloster<br />
09:45 P. Petrus Eder OSB<br />
Musikpflege an der Erzabtei St. Peter in Salzburg<br />
11:00 Lars E. Laubhold<br />
Repertoire <strong>und</strong> Repertoireentwicklung in der Musik am Salzburger<br />
Dom in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
11:45 Eva Neumayr<br />
Kirchenmusik am Salzburger Dom in den ersten Jahrzehnten des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
12:30 Gemeinsames Mittagessen (Catering)<br />
Vorsitz: Ernst Hintermaier<br />
14:00 Gerhard Walterskirchen<br />
„Kein vergleichbares Institut <strong>im</strong> Bereich der österreichischen<br />
Monarchie“. Geschichte der Kapellknaben <strong>und</strong> des Kapellhauses in<br />
der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
14:45 Milada Jonášová<br />
Benedikt Hacker – Verleger <strong>und</strong> Geschäftspartner des Verlags<br />
Hoffmeister <strong>und</strong> Kühnel<br />
16:00 Wolfgang Dreier<br />
Zwischen Suggestion <strong>und</strong> Systematik – regionale Musikkonzepte<br />
<strong>im</strong> Spiegel zeitgenössischer Beobachtung <strong>und</strong> Sammlung<br />
16:45 Dominik Šedivý<br />
Traditionalismus nach Beethoven: Ignaz Assmayr als Symphoniker<br />
3
Sonntag, 23. September 2012<br />
Vorsitz: Armin Brinzing<br />
09:00 Erich Wolfgang Partsch<br />
Anton Diabelli als Gitarrenkomponist <strong>und</strong> -verleger<br />
09:45 Irene Holzer<br />
Anton Diabelli – ‚Musikalischer Provinzialismus‘ als erfolgreiches<br />
Geschäftsmodell<br />
11:00 Rainer Schwob<br />
Salzburg auf dem Weg zur Mozartstadt. Zur Mozart-Rezeption<br />
in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
11:45 Anja Morgenstern<br />
„der Welt <strong>und</strong> besonders den Mozartischen Verehrern ein Werck<br />
geliefert“ – Georg Nikolaus <strong>und</strong> Constanze Nissens Beitrag zur<br />
Entstehung des Mozart-Kultes in Salzburg<br />
12:30 Ende des Symposions<br />
4
Thomas Hochradner<br />
Salzburg <strong>im</strong> Zeichen des Provinzialismus? Wahrnehmungsperspektiven<br />
einer musikgeschichtlichen Etappe<br />
„Die Epigonen der Klassiker <strong>und</strong> Romantiker“ betitelte 1935 Constantin<br />
Schneider sein Kapitel zu <strong>Salzburgs</strong> <strong>Musikgeschichte</strong> des frühen 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts; aufgespalten in bürgerliche <strong>und</strong> volkskulturelle Praxen,<br />
zunehmend geprägt vom Vereinsleben, wird die Thematik 2005 in der<br />
Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong> präsentiert. Die Bandbreite dieser<br />
Annäherungen trägt <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e zwei gr<strong>und</strong>verschiedenen Ansätzen der<br />
Musikgeschichtsschreibung Rechnung: sie kann als qualitativ selektierende<br />
Kompositionsgeschichte oder auch als konstitutives soziokulturelles<br />
Phänomen verstanden werden. Beides wirft Licht auf eine Zeitspanne, die für<br />
Stadt <strong>und</strong> Land Salzburg vom Verlust der politischen Selbstständigkeit, von<br />
militärischen Operationen, von wirtschaftlichem Rückgang, vom großen<br />
Stadtbrand 1818, schließlich auch von Einbußen der kulturellen Strahlkraft<br />
gekennzeichnet ist. Aufgr<strong>und</strong> all dieser Gegebenheiten muss sich das<br />
Mikroskop des Musikhistorikers justieren: Schon bald nach 1800 werden die<br />
Koordinaten des Musiklebens in Salzburg gänzlich neu gesetzt <strong>und</strong> lassen<br />
sich zwar als Fortführung früherer Strukturen, doch mehr noch in Distanz zur<br />
Zeit des Erzstiftes <strong>und</strong> Kurfürstentums beschreiben.<br />
Thomas Hochradner<br />
Ao. Univ.-Prof. für Historische Musikwissenschaft an der Universität Mozarteum Salzburg.<br />
Mitbegründer <strong>und</strong> erster Leiter des ›Instituts für Musikalische Rezeptions- <strong>und</strong><br />
Interpretationsgeschichte‹, seit 2011 Leiter der ›Forschungsplattform Salzburger<br />
<strong>Musikgeschichte</strong>‹. Lehrveranstaltungen <strong>und</strong> Publikationen besonders zur <strong>Musikgeschichte</strong><br />
des 17. bis 20. Jahrh<strong>und</strong>erts mit Schwerpunkten in den Bereichen Barockmusik,<br />
Kirchenmusik, Rezeptionsgeschichte, Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong> <strong>und</strong><br />
Volksmusikforschung.<br />
Zuletzt veröffentlicht: Thomas Hochradner / Michaela Schwarzbauer (Hg.), Eberhard<br />
Preußner (1899–1964). Musikhistoriker, Musikpädagoge, Präsident, Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag<br />
2011 (Veröffentlichungen der Forschungsplattform ‚Salzburger<br />
<strong>Musikgeschichte</strong>‘ 1, zugleich Veröffentlichungen der Universität Mozarteum Salzburg 2).<br />
5
Monika Oebelsberger<br />
Schullieder <strong>und</strong> Schulmethoden in Salzburg – ein Beitrag zur<br />
Geschichte der Musikpädagogik <strong>im</strong> frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Komplexe staatspolitische <strong>und</strong> vor allem kirchenpolitische Interessen auf der<br />
einen Seite <strong>und</strong> ein an der Entwicklung des Individuums orientiertes<br />
humanistisches Ideengut auf der anderen Seite kennzeichnen die<br />
Entwicklung (musik-)pädagogischer Bestrebungen um 1800 <strong>im</strong> süddeutschen<br />
Raum. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> erschienen <strong>im</strong> Jahre 1800 in Salzburg Gregor<br />
Kraemers H<strong>und</strong>ert neue Schulgesänge nebst einigen Bemerkungen über den<br />
Schulgesang <strong>und</strong> einem Anhang, wozu Philipp Schmelz, Organist zu St.<br />
Peter, Melodien schrieb. ‚Heilsame‘ <strong>und</strong> lehrreiche Texte sollten mit Hilfe<br />
dieses Liederbuches mit modernen <strong>und</strong> populären Melodien für das einfache<br />
Volk aufbereitet werden <strong>und</strong> Verbreitung finden. Damit wurde dem<br />
Schulgesang eine ‚menschenbildende‘ Kraft zuerkannt, die über die Funktion<br />
des Schulgesanges als religiöse Übung weit hinausging <strong>und</strong> in diesem<br />
Anspruch <strong>im</strong> deutschsprachigen Raum erstmals in Form eines<br />
‚Schulliederbuches‘ veröffentlicht wurde.<br />
Im Rahmen des Referates soll, ausgehend von diesem Schulliederbuch,<br />
die Bedeutung der Musikpädagogik in Salzburg zu Beginn des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> deren Einbindung in allgemeinpädagogische<br />
Strömungen dieser Zeit herausgearbeitet werden.<br />
Monika Oebelsberger<br />
Von 1980 bis 2001 AHS-Lehrerin an verschiedenen Gymnasien in Innsbruck <strong>und</strong> seit<br />
2001 Professorin <strong>und</strong> Abteilungsleiterin für Musikpädagogik an der Universität Mozarteum.<br />
Sie wirkt als National Coordinator der EAS (European Association for Music in Schools),<br />
Obfrau der MFÖ (Musikpädagogische Forschung Österreich) <strong>und</strong> leitet das Europäische<br />
Doktorandenkolleg für Musikpädagogik in Salzburg.<br />
6
Elke Michel-Blagrave<br />
Fürst Ernst von Schwarzenberg als Widmungsempfänger Salzburger<br />
Komponisten<br />
In der Musiksammlung der Adelsfamilie Schwarzenberg in Krumau befinden<br />
sich Quellen der Musikpflege in Salzburg, die oft auch die einzige Quelle für<br />
Salzburger Produktion dieser Zeit darstellen. Es handelt sich um Werke von<br />
Ignaz Assmayr, Andreas Brunnmayr, Joseph Joach<strong>im</strong> Fuetsch, Benedikt<br />
Hacker, Joseph Hess, Sigism<strong>und</strong> von Neukomm, Sebastian Oehlinger,<br />
Thaddäus Susan <strong>und</strong> Carl Maria von Weber. Sie haben Fürst Ernst in<br />
Salzburg Kompositionen gewidmet.<br />
Fürst Ernst war für eine geistliche Laufbahn best<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> 9-jährig bereits<br />
Domicellar in Köln, erhielt 1795 eine Prebenda in Salzburg, wurde 1818<br />
Bischof von Raab <strong>und</strong> starb in Wien am 14.03.1821, genau zwei Jahre nach<br />
seiner Weihe zum Bischof. 1804 kaufte er sein „petite paradis“: Schloss mit<br />
Gutshof <strong>und</strong> Park Aigen bei Salzburg. Das Schloss Aigen wurde eine beliebte<br />
Residenz von Fürst Ernst, Kristallisationspunkt für Begegnungen <strong>und</strong><br />
Kontakte <strong>und</strong> Zentrum von Festen <strong>und</strong> Feiern: „Bey dem vortrefflichen Klavier<br />
wird manche St<strong>und</strong>e der Tonkunst angenehm von dem Fürsten <strong>und</strong> den<br />
Salzburger Sängern geweiht.“ Das Pianoforte stammte aber nicht von einem<br />
Salzburger Klavierbauer, sondern aus der Wiener Werkstatt von Johann<br />
Schantz (1762–1828) <strong>und</strong> bildete den Mittelpunkt des Gesellschaftsz<strong>im</strong>mers<br />
des Schlosses, dessen Beschreibung wir aus den Nachlass-Akten<br />
rekonstruieren können.<br />
In den Fürst Ernst von Hacker gewidmeten Werken ist der Klaviersatz stets<br />
einfach gehalten <strong>und</strong> bietet keine technischen Probleme. Sie bestehen aus<br />
harmonischen Begleitmustern für Lieder, die <strong>im</strong> Männerquartett gesungen<br />
wurden. Dagegen beansprucht z.B. der Klavierbegleitsatz von Assmayr <strong>und</strong><br />
Oehinger eher fortgeschrittene Pianisten, die den technischen<br />
Schwierigkeitsgrad der Mittelstufe meistern. Eine Sonderstellung nehmen<br />
drei Werke für das Pianoforte allein ein; hier sind Werke von Assmayr,<br />
Fuetsch <strong>und</strong> Neukomm hervorzuheben.<br />
Elke Michel-Blagrave<br />
Geboren 1960 in Germershe<strong>im</strong> an Rhein. Nach dem Abitur studierte sie Kirchenmusik in<br />
Frankfurt am Main <strong>und</strong> kam mit einem DAAD-Stipendium 1983 nach Salzburg, um an der<br />
7
Hochschule Mozarteum Aufführungspraxis Alter Musik bei Nikolaus Harnoncourt <strong>und</strong><br />
Orgel bei Heribert Metzger zu studieren. An der Paris-Lodron-Universität belegte sie<br />
Kunstgeschichte <strong>und</strong> Musikwissenschaft. Die Magisterarbeit schrieb sie über Sebastian<br />
Hasenknopf <strong>und</strong> seine Cantiones Sacrae (1588). Nach vielen Berufsjahren als<br />
Kirchenmusikerin an der Christuskirche Berchtesgaden <strong>und</strong> Klavierlehrerin schreibt sie<br />
parallel dazu bei Thomas Hochradner an der Universität Mozarteum eine Dissertation über<br />
die Klaviermusik in Salzburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Margit Haider-Dechant<br />
Joseph Woelfls Salzburger Jahre<br />
Der am 24. Dezember 1773 in Salzburg geborene Joseph Johann Baptist<br />
Woelfl, Schüler von Leopold, Nannerl <strong>und</strong> Wolfgang Amadeus Mozart sowie<br />
von Michael Haydn, gehört zu den bedeutendsten Komponisten <strong>und</strong><br />
Pianisten seiner Zeit. 1798 verwies er bei einem Klavierwettbewerb in Wien<br />
Ludwig van Beethoven auf den zweiten Platz, setzte sich in Warschau, Wien,<br />
Dresden, Berlin, Hamburg <strong>und</strong> Paris an die Spitze des jeweiligen<br />
Musiklebens, um schließlich in London zum bedeutendsten Komponisten<br />
Englands aufzusteigen. Er begründete die Englische Klavierschule, leitete<br />
den Musikalischen Klassizismus ein <strong>und</strong> war wichtiges Vorbild für Felix<br />
Mendelssohn Bartholdy <strong>und</strong> Franz Liszt. In meiner soeben erschienenen<br />
Publikation Joseph Woelfl. Verzeichnis seiner Werke wird die Existenz von<br />
620 Kompositionen nachgewiesen; sie bildet die Basis für eine<br />
Gesamtausgabe in 60 Bänden.<br />
Woelfls prof<strong>und</strong>e Ausbildung durch die führenden Musiker des Salzburger<br />
Hofs sollte die Gr<strong>und</strong>lage für seine europaweiten Erfolge als Pianist <strong>und</strong><br />
Komponist werden. Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit seine<br />
Abstammung für die Aufnahme in höchste europäische Adelskreise hilfreich<br />
war. Auch weisen die bis heute wenig beleuchteten Jahre des jungen Joseph<br />
Woelfl eine bis jetzt noch kaum beachtete Komponente von <strong>Salzburgs</strong><br />
<strong>Musikgeschichte</strong> in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts auf. Die häufigen<br />
Erwähnungen Joseph Woelfls in Briefen <strong>und</strong> Tagebüchern der Familie<br />
Mozart vermitteln zudem ein lebendiges Zeugnis für die engen Kontakte der<br />
beiden Familien. Zusätzlich zu den in Salzburg entstandenen bekannten <strong>und</strong><br />
8
teilweise <strong>im</strong> Neusatz verlegten Harmoniemusiken werden Woelfls Beiträge<br />
zur Kirchenmusik erstmals präsentiert.<br />
Margit Haider-Dechant<br />
Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Leiterin einer Konzertfachklasse für Klavier an der<br />
Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz. R<strong>und</strong>funk- <strong>und</strong> Fernsehaufzeichnungen von<br />
weltweiten Konzerten mit vielfältigem Repertoire. Ehrenprofessur der Russischen<br />
Föderation. Ehrenmitglied des Richard-Wagner-Verbandes Barcelona. Spezialistin für<br />
Joseph Woelfl (1773–1812). Artikel „Joseph Woelfl“ in MGG 2 , 2012 Publikation von<br />
Joseph Woelfl. Verzeichnis seiner Werke mit detaillierten Angaben zu 620 Kompositionen.<br />
Carena Sangl<br />
Musikpflege <strong>im</strong> Salzburg der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts nach<br />
Quellen des Musikarchivs <strong>im</strong> Franziskanerkloster<br />
Auch wenn Salzburg durch die ungünstigen Zeitverhältnisse in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts an den Rand gedrängt war, belegen doch<br />
Quellen, dass man das musikalische <strong>und</strong> vor allem kirchenmusikalische<br />
Zeitgeschehen nicht ganz aus den Augen verlieren wollte <strong>und</strong> sich noch des<br />
alten Ruhms bewusst war. Die Handschriften Anton Jähndls <strong>im</strong><br />
Franziskanerarchiv sind z.B. ein Zeugnis relativ stiller, aber ungebrochener<br />
Mozartverehrung. Das Franziskanerkloster selbst war in mehrerlei Hinsicht in<br />
seiner Existenz bedroht <strong>und</strong> v.a. <strong>im</strong> Personalbestand drastisch reduziert.<br />
Trotzdem wurde die „Franziskanermusik“ höchstens den Möglichkeiten<br />
angepasst, aber nie gänzlich vernachlässigt, weil es stets weniger um<br />
Repräsentation als um „Erbauung der Herzen“ ging. Das belegen<br />
Handschriften aus den ‚schlechten‘ Jahren, z.B. von P. Albert Schwarz, der,<br />
schon längere Zeit in Salzburg, 1818 zum Guardian gewählt wurde. Als<br />
schließlich 1825 das Noviziat nach Salzburg verlegt wurde <strong>und</strong> sich das<br />
Kloster wieder füllte, wurden auch praktisch die Möglichkeiten günstiger. Mit<br />
P. Peter Singer, der ab 1840 als Novizenmeister <strong>und</strong> musikalisch vielseitig<br />
bis zur Berühmtheit wirkte, gab es neben der Anfachung des Mozartkultes<br />
eine lebende Persönlichkeit, deren Existenz Salzburg sicher half, die Krise<br />
einer Provinzialität abgemildert zu durchleben.<br />
9
Carena Sangl<br />
Geboren in Erlangen, studierte in München Musikpädagogik, Musikwissenschaft <strong>und</strong><br />
klassischen Sologesang <strong>und</strong> ist in diesen Disziplinen freiberuflich tätig. Nach dem<br />
Abschluss mit dem Mag. art. 1996 promovierte sie 2001 mit einer musik- <strong>und</strong><br />
kirchenhistorischen Studie über die cäcilianische Bewegung in Salzburg. Neben einer<br />
Vorlesung über den Cäcilianismus an der Paris-Lodron-Universität Salzburg <strong>im</strong><br />
Wintersemester 2002/03 publizierte sie Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik <strong>im</strong> 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Seit 2007 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für RISM Tirol-Südtirol &<br />
OFM Austria tätig.<br />
P. Petrus Eder OSB<br />
Musikpflege an der Erzabtei St. Peter in Salzburg<br />
Die letzten Jahre <strong>und</strong> die zwei Jahrzehnte nach dem Tod Michael Haydns<br />
waren die bedeutendsten für die neuzeitliche <strong>Musikgeschichte</strong> der Erzabtei<br />
St. Peter. Zwischen dem Ende der Hofkapelle <strong>und</strong> der Gründung des<br />
Mozarteums hatte St. Peter musikalisch eine Führungsposition in Salzburg<br />
inne. Der kürzlich erfolgte Abschluss der Katalogisierungsarbeiten des<br />
Musikalienarchivs St. Peter ermöglicht eine genauere Beurteilung dieser<br />
Epoche, besonders da die Napoleonischen Kriege zu einem Versiegen<br />
sonstiger schriftlicher Aufzeichnungen geführt haben. Das Jahr 1848 führt<br />
hier keine <strong>Unter</strong>brechung herbei. Einen gewissen Abschluss findet diese<br />
Phase erst während der Regierungszeit Abt Romuald Horners (1876–1901)<br />
mit der Choralreform.<br />
P. Petrus Eder OSB<br />
Benediktiner der Erzabtei St. Peter in Salzburg, über lange Zeit Stiftsorganist, nunmehr<br />
Pfarrer in Grödig. Studium der Theologie in Salzburg, danach der Musikwissenschaft in<br />
Tübingen, Dissertation über Die modernen Tonarten <strong>und</strong> die phrygische Kadenz (Tutzing<br />
2004). Autor zahlreicher Beiträge insbesondere über die Musikpflege <strong>im</strong><br />
Benediktinerorden <strong>und</strong> in der Erzabtei St. Peter, Herausgeber mehrerer Noteneditionen,<br />
darunter Salzburger Klaviermusik <strong>im</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert (Denkmäler der Musik in<br />
Salzburg 16, Salzburg 2005). Mitglied der Akademie für Mozart-Forschung der Stiftung<br />
Mozarteum Salzburg.<br />
10
Lars E. Laubhold<br />
Repertoire <strong>und</strong> Repertoireentwicklung in der Musik am Salzburger Dom<br />
in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Gelten die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts aufgr<strong>und</strong> der <strong>im</strong> Zuge der<br />
napoleonischen Zeit eingetretenen gesellschaftlichen Veränderungen als<br />
eine Zeit des kulturellen Verfalls in Salzburg, so bildete doch die<br />
Metropolitankirche als Sitz des Erzbischofs einen Ort institutioneller<br />
Kontinuität <strong>und</strong> behielt eine gewisse Bedeutung als Zentrum geistlicher<br />
Musikpflege bei. Mit der jüngst abgeschlossenen RISM-Katalogisierung jener<br />
<strong>im</strong> Salzburger Dommusikarchiv aufbewahrten Musikalien, die vor der<br />
Gründung des „Dommusikverein <strong>und</strong> Mozarteum“ <strong>im</strong> Jahr 1841 entstanden<br />
sind, ist seit kurzem eine Basis zur Beurteilung des am Dom gepflegten<br />
Repertoires <strong>und</strong> seiner Veränderungen auch in der Zeit nach der<br />
Säkularisation des Erzstiftes gelegt. Neben den Musikalien selbst stehen<br />
darüber hinaus auch zeitgenössische Bestandskataloge, die 1822 <strong>im</strong> Zuge<br />
einer umfassenden Bestandsrevision neu angelegt wurden, als Informationsquelle<br />
zur Verfügung. Aus dem Abgleich dieser Quellengruppen wird<br />
versucht Aufschlüsse über die Musikpflege am Salzburger Dom, über<br />
Kontinuitäten <strong>und</strong> Neuentwicklungen zu gewinnen.<br />
Lars E. Laubhold<br />
Musikforscher, Instrumentenmacher <strong>und</strong> Restaurator. 2000–2007 Studium der Musikwissenschaft<br />
an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. 2001–2005 freier Mitarbeiter am<br />
Forschungsinstitut für Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong>, dort hauptverantwortlich für<br />
Koordination <strong>und</strong> Redaktion der neuen Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong> (Salzburg 2005).<br />
Redaktionsarbeit für diverse Institutionen, u.a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der<br />
Universität Salzburg. Derzeit Mitarbeiter der RISM Arbeitsgruppe Salzburg, die <strong>im</strong> Rahmen<br />
eines FWF-Projekts das Musikrepertoire am Salzburger Dom <strong>im</strong> 18. <strong>und</strong> frühen 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert erforscht. Publikationen als Autor <strong>und</strong> Herausgeber zu Themen der<br />
Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong>, der musikalischen Interpretationsforschung <strong>und</strong> des<br />
frühneuzeitlichen Trompeterwesens.<br />
11
Eva Neumayr<br />
Kirchenmusik am Salzburger Dom in den ersten Jahrzehnten des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Ist in wissenschaftlichen Publikationen von der Musikpflege in Salzburg in<br />
den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts die Rede, so wird gemeinhin<br />
der „Niedergang“ jeglicher Musikausübung nach der Auflösung der Hofmusik<br />
beschworen. Genaue wissenschaftliche <strong>Unter</strong>suchungen fehlen aber.<br />
Welches Repertoire in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts am<br />
Salzburger Dom gepflegt wurde, verraten vor allem die vor kurzem für die<br />
RISM-Datenbank aufgenommenen Quellen des Dommusikarchivs aus dieser<br />
Zeit. Im Vortrag wird eine erste Darstellung versucht, welche Musiker <strong>und</strong><br />
Musikergruppen die Musik am Dom nach der Auflösung der Hofmusik weiter<br />
pflegten <strong>und</strong> welche Bedeutung sie für die Musikkultur in Salzburg besaßen.<br />
Dabei spielt auch die frühe Mozart- <strong>und</strong> Haydn-Rezeption in Salzburg mit den<br />
Brennpunkten Requiem <strong>und</strong> Schöpfung eine Rolle.<br />
Eva Neumayr<br />
Studierte Musikwissenschaft <strong>und</strong> Anglistik an der Paris-Lodron-Universität Salzburg <strong>und</strong><br />
Musik- <strong>und</strong> Gesangspädagogik an den Musikuniversitäten Salzburg <strong>und</strong> Wien. Sie<br />
promovierte 1998 bei Siegfried Mauser mit einer Arbeit über die Propriumskompositionen<br />
Johann Ernst Eberlins (1702–1762). Seit 2007 beschäftigt sie sich als Forschungsassistentin<br />
für die RISM Arbeitsgruppe Salzburg am Archiv der Erzdiözese Salzburg mit<br />
dem Repertoire der Hofkapelle am Salzburger Dom <strong>im</strong> 18. <strong>und</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert. Einen<br />
weiteren Schwerpunkt ihrer Forschungs- <strong>und</strong> Lehrtätigkeit bilden die Beiträge von Frauen<br />
zur <strong>Musikgeschichte</strong>.<br />
12
Gerhard Walterskirchen<br />
„Kein vergleichbares Institut <strong>im</strong> Bereich der österreichischen<br />
Monarchie“. Geschichte der Kapellknaben <strong>und</strong> des Kapellhauses in der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Kurz nach Regierungsübernahme durch Ferdinand von Toskana hatten<br />
Verhandlungen zwischen der kurfürstlichen Regierung <strong>und</strong> dem Konsistorium<br />
das Ergebnis erbracht, Dommusik <strong>und</strong> Hofmusik zu trennen. Neben der<br />
Dompfarre führte der Kurfürst die Franziskanerkirche als eigene Hofpfarre<br />
<strong>und</strong> bestellte unabhängig von den Chorknaben am Dom eigene „kurfürstliche<br />
Kapellknaben“. Damit begann der jahrzehntelange Existenzkampf des Kapellhauses.<br />
Als Salzburg 1805 zu Österreich kam, gab es keinen Hof <strong>und</strong> keine<br />
Hofmusik mehr, <strong>und</strong> die Weiterführung der Kapellknaben <strong>und</strong> des Kapellhauses,<br />
die einen wesentlichen Bereich der Hofmusik ausgemacht hatten,<br />
wurde wegen unumgänglicher Sparmaßnahmen in Frage gestellt. 1806<br />
betrug der Personalstand der Dommusik, der Instrumentalisten <strong>und</strong><br />
Vokalsolisten, nur noch vierzehn. Domkapellmeister Luigi Gatti wurde 1809<br />
beauftragt, der Regierung ein Personal- <strong>und</strong> Besoldungsschema für die<br />
Weiterführung der Dommusik vorzulegen. Gatti war wohl an der Sicherung<br />
<strong>und</strong> Dotierung der Instrumentalisten interessiert, nicht jedoch an der der<br />
Kapellknaben. Er verstieg sich zu der Ansicht, dass durch Verringerung der<br />
Anzahl der Knaben nicht nur das „Aerarium“ sondern auch der Musikdienst<br />
„ungemein gewinnen würde“. <strong>Unter</strong> bayerischer Besetzung verschl<strong>im</strong>merte<br />
sich die Lage noch mehr, 1812 gab es nur noch zwei Kapellknaben, selbst an<br />
Feiertagen konnte nur noch choraliter gesungen werden. Erst als 1821 das<br />
Konsistorium die Aufsicht über das Kapellhaus übernahm, besserte sich die<br />
Lage, <strong>und</strong> Erzbischof Augustin Gruber gewann den Kaiserhof in Wien zur<br />
Mitfinanzierung des Kapellinstituts, zunächst mit acht Knaben, ab 1835 bis<br />
zur Gründung des Dommusikvereins (1841) mit zehn Knaben.<br />
Gerhard Walterskirchen<br />
Geb. in Kemmelbach (NÖ). Studium der Musik- <strong>und</strong> Instrumentalpädagogik an der Hochschule<br />
Mozarteum, Musikwissenschaft <strong>und</strong> Pädagogik an der Paris-Lodron-Universität<br />
Salzburg. Bis 2004 Assistenzprofessor am Institut für Musikwissenschaft der Universität<br />
Salzburg. Generalsekretär der Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft, Mitherausgeber der<br />
„Denkmäler der Musik in Salzburg“, der „Veröffentlichungen zur Salzburger<br />
13
<strong>Musikgeschichte</strong>“ <strong>und</strong> der Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong> (Salzburg 2005). Zahlreiche<br />
Aufsätze zu Themen der Salzburger <strong>Musikgeschichte</strong>.<br />
Milada Jonášová<br />
Benedikt Hacker – Verleger <strong>und</strong> Geschäftspartner des Verlags<br />
Hoffmeister <strong>und</strong> Kühnel<br />
1803 eröffnete Benedikt Hacker eine eigene Buchhandlung in Salzburg<br />
(einschließlich Notenleihanstalt <strong>und</strong> Musiksalon), die bald zur angesehensten<br />
der Stadt wurde. In dieser Zeit ist Hacker auch Geschäftspartner des Verlags<br />
Hoffmeister <strong>und</strong> Kühnel in Leipzig geworden. Aus der Korrespondenz<br />
zwischen Hacker <strong>und</strong> dem Leipziger Verlag, die <strong>im</strong> Sächsischen Staatsarchiv<br />
in Leipzig erhalten geblieben ist, werden verschiedene Salzburger Details zur<br />
Verlagspraxis der Zeit behandelt.<br />
Milada Jonášová<br />
Studium der Musikwissenschaft in Prag, Cremona (2000), Berlin (2002/03) <strong>und</strong> Salzburg<br />
(2003), 2008 <strong>und</strong> 2011 DAAD-Forschungsaufenthalte in Tübingen <strong>und</strong> München. Seit<br />
1999 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Musikwissenschaft der<br />
Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag. 2008 Promotion mit der<br />
Dissertation Zeitgenössische Kopien von Mozarts Opern in der Musiksammlung des<br />
Prämonstratenserklosters Strahov zu Prag. Laufendes Forschungsprojekt: Mozarts Prager<br />
Kopisten, ihre Kopien in tschechischen, deutschen <strong>und</strong> österreichischen Archivbeständen.<br />
2009 Mozartpreisträgerin der Sächsischen Mozartgesellschaft. Seit 2010 Mitglied der<br />
Akademie für Mozart-Forschung der Stiftung Mozarteum Salzburg.<br />
Wolfgang Dreier<br />
Zwischen Suggestion <strong>und</strong> Systematik – regionale Musikkonzepte <strong>im</strong><br />
Spiegel zeitgenössischer Beobachtung <strong>und</strong> Sammlung<br />
„Es ist ein Bedingniß für jeden Sänger, daß er seine natürliche, sey es Brust<br />
oder Kopfst<strong>im</strong>me mit der Falsettst<strong>im</strong>me so gut zu vereinigen wisse, daß man<br />
14
eine von der anderen nicht unterscheiden könne. – Allein! bey den Alpensängern<br />
ist es gerade der umgekehrte Fall.“<br />
Ausgehend von Benedikt Hackers um 1816 veröffentlichter Beschreibung<br />
des Jodelns wird diskutiert, inwieweit zeitgenössische Berichte tatsächliche<br />
Rückschlüsse auf Gestaltungsprinzipien regionaler Musikkonzepte zulassen.<br />
Damit in eine quellenkritische Beziehung zu setzen ist der Umstand, dass<br />
uns von so genannter „Volksmusik“, also vom ländlichen, teils in Bräuche <strong>und</strong><br />
Tanzunterhaltungen eingebetteten Laienmusizieren in der ersten Hälfte des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts, anders als von Stücken etablierter Komponisten, keine<br />
tatsächlichen Pr<strong>im</strong>ärquellen vorliegen. Bis weit ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert hinein<br />
verfügen wir großteils lediglich über Abschriften dessen, was in ländlichen<br />
Regionen angeblich gesungen, gespielt <strong>und</strong> getanzt wurde. Dass diese heute<br />
in den Volksliedarchiven zugänglichen Zeugnisse einer punktuell <strong>und</strong> nach<br />
subjektiv gestalteten Regelwerken durchgeführten „Reliktforschung“<br />
(J. Moser, 1989) weitgehend quellenkritiklos die Gr<strong>und</strong>lage für heutige<br />
Rekonstruktionsversuche eines angeblichen Repertoires bilden, ist durchaus<br />
hinterfragungswürdig.<br />
Wolfgang Dreier<br />
Studium der Musikwissenschaft an den Universitäten Salzburg <strong>und</strong> Newcastle upon Tyne<br />
(UK). Doktorat 2011 an der Paris-Lodron-Universität Salzburg mit einer Dissertation in<br />
Vergleichend-Systematischer Musikwissenschaft, Rigorosum mit Auszeichnung. 2003–<br />
2005 in der Abteilung Kommunikation der Salzburger Festspiele (Dramaturgieassistenz,<br />
Programmheftredaktion, Textsatz). Seit 2005 Archivleiter des Salzburger Volksliedwerkes,<br />
seit 2008 überdies Archiv- <strong>und</strong> Bibliotheksleitung sowie EDV-Support <strong>im</strong> Forum Salzburger<br />
Volkskultur (Vollzeit). Musikwissenschaftliche Aufsätze <strong>und</strong> Rezensionen für diverse<br />
Zeitschriften, Sammelbände <strong>und</strong> Jahrbücher, Vorträge bei Symposien, Kongressen <strong>und</strong><br />
Lehrgängen. Layoutierungs-, Redaktions- <strong>und</strong> Herausgebertätigkeit (u.a. Im Blickpunkt:<br />
Tobi Reiser, gemeinsam mit Thomas Hochradner, Salzburg 2011). Interessensgebiete:<br />
Psychoakustik, Musikpsychologie, Popularmusikforschung, digitale Erschließung <strong>und</strong><br />
Vernetzung von Bibliotheken <strong>und</strong> Wissenssammlungen, EDV mit Schwerpunkt<br />
OpenSource.<br />
15
Dominik Šedivý<br />
Traditionalismus nach Beethoven: Ignaz Assmayr als Symphoniker<br />
Ignaz Assmayr (1790–1862) ist, wenn überhaupt, vor allem als Komponist<br />
geistlicher Musik <strong>und</strong> weltlicher Oratorien bekannt. Doch hat sich der<br />
Salzburger, der 1846 Hofkapellmeister zu Wien wurde, auch zwe<strong>im</strong>al <strong>im</strong><br />
symphonischen Fach betätigt. Die Aufführung seiner ersten Symphonie in<br />
B-Dur <strong>im</strong> Dezember 1843 zählt zu den größten Erfolgen Assmayrs. Zur Zeit<br />
eines zunehmenden musikalischen Fortschrittsdenkens trat der <strong>im</strong> Kirchenstil<br />
seines Lehrers Michael Haydn wurzelnde Komponist mit eindeutig<br />
traditionalistischen Bekenntnissen hervor.<br />
Wie auch bei einigen Zeitgenossen schlug die Rezeption, die bis in die<br />
1840er Jahre hinein überwiegend positiv war, zu Beginn der zweiten<br />
Jahrh<strong>und</strong>erthälfte <strong>im</strong>mer mehr um, so dass ein durchaus ambivalentes Bild<br />
von Assmayr entstand. Dass sich dabei, in Verbindung mit gerechtfertigter<br />
Kritik, auch ein wachsender Unmut gegenüber dem konservativen<br />
öffentlichen Musikleben <strong>und</strong> seinen offiziellen Vertretern entlud, wird aus<br />
zeitgenössischen Texten deutlich. Für eine vorurteilslose, historische<br />
Beurteilung drängt sich somit die Notwendigkeit eines geeigneten Umgangs<br />
mit den zwiespältigen historischen Verhältnissen der Zeit auf.<br />
Dominik Šedivý<br />
Studierte Musikwissenschaft in München <strong>und</strong> Wien, wo er 2006 mit einer Arbeit über<br />
Tropentechnik promovierte. Ferner studierte er privat Komposition. Er unterrichtete an den<br />
musikwissenschaftlichen Instituten in Wien <strong>und</strong> Klagenfurt <strong>und</strong> ist seit 2011 Universitätsassistent<br />
am FB Kunst-, Musik- <strong>und</strong> Tanzwissenschaft der Paris-Lodron-Universität<br />
Salzburg. Seine fachlichen Interessen sind <strong>Musikgeschichte</strong> des 19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
(Schwerpunkt Österreich), Kompositions- <strong>und</strong> Musiktheorie sowie Musikphilosophie.<br />
16
Erich Wolfgang Partsch<br />
Anton Diabelli als Gitarrenkomponist <strong>und</strong> -verleger<br />
Der Beitrag akzentuiert die Bedeutung Diabellis für das Wiener Musikleben<br />
<strong>im</strong> Allgemeinen <strong>und</strong> die Gitarrengeschichte <strong>im</strong> Besonderen anhand seiner<br />
unterschiedlichen, aber miteinander vernetzten Rollen als Pädagoge,<br />
Komponist <strong>und</strong> Verleger. In engem Kontakt mit Künstlern wie Mauro Giuliani<br />
trug er wesentlich zur Etablierung des Instrumentes bei. Als Pädagoge<br />
förderte er die Didaktik (Schulwerke, Aufsicht der Guitarre nach Legnanischer<br />
Form) <strong>und</strong> <strong>Unter</strong>richtsliteratur, indem er geschickt Stücke für alle<br />
erdenklichen Schwierigkeitsgrade mit zum Teil modisch-fantasievollen Titeln<br />
vorlegte (Apollo am Damentoilette mit „leichten <strong>und</strong> angenehmen Melodien“).<br />
Das Repertoire reicht somit von kleinen Studien für Anfänger bis hin zu<br />
klassisch orientierten mehrsätzigen Sonaten (op. 29). Ebenso hat er die<br />
Kammermusik forciert <strong>und</strong> – biedermeierlichen Erwartungshaltungen<br />
entgegenkommend – für unterschiedlichste Besetzungen attraktive Werke<br />
veröffentlicht. Hierin zeigt sich aber auch der geschäftstüchtige <strong>und</strong><br />
besonnene Verleger, der durch eine Vielzahl populärer Titel (Tanzmusik<br />
sowie diverse Lied- <strong>und</strong> Opernbearbeitungen) die Herausgabe qualitativ<br />
anspruchsvoller Werke ebenso zu finanzieren vermochte. Diabellis<br />
musikalische <strong>und</strong> ökonomische Strategien sollen schließlich anhand einiger<br />
signifikanter Beispiele näher erläutert werden.<br />
Erich Wolfgang Partsch<br />
1959 in Wien geboren, Studium der Musikwissenschaft <strong>und</strong> Pädagogik. 1983 Promotion.<br />
Koordinator der ›Forschungsstelle Anton Bruckner‹ der Österreichischen Akademie der<br />
Wissenschaften. Vizepräsident der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft.<br />
Lehraufträge an der Universität Wien (Musikwissenschaft, Germanistik). Ausstellungen,<br />
Vorträge <strong>im</strong> In- <strong>und</strong> Ausland, derzeit r<strong>und</strong> 140 Publikationen. Forschungsschwerpunkte:<br />
Musikkultur <strong>im</strong> Biedermeier, Anton Bruckner, Gustav Mahler <strong>und</strong> die Musik um 1900.<br />
17
Irene Holzer<br />
Anton Diabelli – ‚Musikalischer Provinzialismus‘ als erfolgreiches<br />
Geschäftsmodell<br />
Anton Diabelli gilt als der Salzburger Komponist der Biedermeierzeit. Noch<br />
<strong>im</strong> Fürsterzbistum geboren <strong>und</strong> musikalisch durch Johann Michael Haydn<br />
geprägt, ist er bis heute das berühmteste Aushängeschild seines<br />
Geburtsortes Mattsee. Die Betonung seiner Salzburger Herkunft verschleiert<br />
jedoch die Tatsache, dass Diabelli bereits 1802 das Fürsterzbistum verließ<br />
<strong>und</strong> den größten Teil seines Lebens in Wien verbrachte. Aber gerade diese<br />
Zeit, die gerne unter dem Stichwort „Verleger“ zusammengefasst <strong>und</strong> mit<br />
netten Anekdoten über Beethovens „Diabolus“ <strong>und</strong> dem Verweis auf den<br />
frühen Förderer Schuberts ausgeschmückt wird, repräsentiert Diabellis<br />
Salzburger Herkunft <strong>und</strong> seine dort erhaltene Musikausbildung. Selbst kein<br />
besonders großes Kompositionstalent, erkannte er die Vorlieben der Wiener<br />
Musikszene seiner Zeit <strong>und</strong> veröffentlichte neben neuen Werken bekannter<br />
Komponisten h<strong>und</strong>erte Arrangements beliebter Arien, Lieder oder<br />
Instrumentalstücke. Seine Neigung zu musikalischer sowie technischer<br />
S<strong>im</strong>plizität <strong>und</strong> Leichtigkeit bei gleichzeitig f<strong>und</strong>amentierten<br />
Kompositionskenntnissen wurde damit zum erfolgreichen Geschäftsmodell.<br />
Irene Holzer<br />
Studierte Musikwissenschaft <strong>und</strong> Germanistik an der Paris-Lodron-Universität Salzburg<br />
<strong>und</strong> promovierte 2010 ebendort mit einer Studie über Adrian Willaerts<br />
Messkompositionen. 2006 legte sie eine revidierte Fassung des Werkverzeichnisses von<br />
Anton Diabelli vor. 2007/08 arbeitete sie als Assistentin für ältere <strong>Musikgeschichte</strong> an der<br />
Universität Basel; anschließend war sie DOC-Stipendiatin der Österreichischen Akademie<br />
der Wissenschaften. Holzer lehrte an den Universitäten Basel <strong>und</strong> Bratislava. Seit 2012 ist<br />
sie Stipendiatin der Universität Salzburg.<br />
18
Rainer Schwob<br />
Salzburg auf dem Weg zur Mozartstadt. Zur Mozart-Rezeption in der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Um 1800 kann in Mittel- <strong>und</strong> Westeuropa ein beträchtliches Interesse an<br />
Mozarts Leben <strong>und</strong> Musik konstatiert werden: Man veranstaltet<br />
„Gedächtnisfeyern“, sammelt „Mozart-Reliquien“, befragt Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
Gastgeber Mozarts nach Anekdoten <strong>und</strong> führt eine ansehnliche Auswahl aus<br />
seinen Werken regelmäßig auf. Doch zeichnen sich gerade die Salzburger<br />
nicht durch besonderes Engagement für Mozarts Musik aus, während sich<br />
zugleich das Interesse Auswärtiger an der Geburtsstadt des allmählich<br />
Kanonisierten in Grenzen hält. Dies ist erstaunlich, lebten doch mit Mozarts<br />
Schwester Maria Anna <strong>und</strong> (ab den 1820ern) seiner Witwe Constanze die<br />
zwei kompetentesten Auskunftsgeber zu seiner Person in Salzburg. Erst ab<br />
den 1830er Jahren scheint man den berühmten Sohn der Stadt wieder für<br />
sich zu entdecken – es ist sicher kein Zufall, dass sich Salzburg zu eben<br />
dieser Zeit mithilfe des aufkommenden (Städte-)Tourismus aus seiner tiefen<br />
politischen <strong>und</strong> ökonomischen Krise erholt. – Dieser Rezeptionsprozess soll<br />
<strong>im</strong> Beitrag vor allem aus der „Außensicht“ zeitgenössischer Musik- <strong>und</strong><br />
Kulturzeitschriften dargestellt werden.<br />
Rainer Schwob<br />
Studium Musikwissenschaft <strong>und</strong> Alte Geschichte in Graz <strong>und</strong> Wien, 2003 Dissertation zur<br />
Monteverdi-Rezeption <strong>im</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert, Ausbildungen in Klavier <strong>und</strong> Orgel. Seit 2002<br />
Lehrbeauftragter am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien, 2003–2009<br />
Mitarbeiter an zwei Forschungsprojekten zu „Mozart <strong>im</strong> Spiegel des frühen Musikjournalismus“<br />
(Projektleiter: Gernot Gruber), 2009–2011 Archivar am Ernst Krenek Institut in<br />
Krems/Donau. Schwerpunkte: Kanonbildung <strong>und</strong> Rezeption, Mozart-Rezeption, Musik<br />
über Musik, Interpretationsanalyse, Nachtmusik.<br />
Aktuelle Publikation: W. A. Mozart <strong>im</strong> Spiegel des Musikjournalismus. Edition, Bd. 1:<br />
Deutschsprachiger Raum. 1782–1800, hg. <strong>und</strong> kommentiert von Rainer J. Schwob,<br />
Stuttgart: Carus 2012 [<strong>im</strong> Druck].<br />
19
Anja Morgenstern<br />
„der Welt <strong>und</strong> besonders den Mozartischen Verehrern ein Werck<br />
geliefert“ – Georg Nikolaus <strong>und</strong> Constanze Nissens Beitrag zur<br />
Entstehung des Mozart-Kultes in Salzburg<br />
Auf ihrer mehrjährigen großen Europareise kam das Ehepaar Constanze <strong>und</strong><br />
Georg Nikolaus Nissen <strong>im</strong> August 1824 auch nach Salzburg, um Maria Anna<br />
von Berchtold zu Sonnenburg, die Schwester Wolfgang Amadé Mozarts, zu<br />
besuchen. Angeregt durch die Schenkung von mehreren h<strong>und</strong>ert Briefen der<br />
Mozart-Familie aus dem Besitz der Mozart-Schwester, entschloss sich Georg<br />
Nikolaus Nissen, eine Biographie W. A. Mozarts zu verfassen. Nach Nissens<br />
Tod <strong>im</strong> März 1826 setzte Constanze Nissen alles daran, dieses ehrgeizige<br />
Buchprojekt zum Abschluss zu bringen. Dabei halfen ihr Persönlichkeiten<br />
inner- <strong>und</strong> außerhalb <strong>Salzburgs</strong>, bis die erste große Mozart-Biographie<br />
schließlich Anfang 1829 <strong>im</strong> Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien.<br />
Anschließend kümmerte sich Constanze Nissen um deren Verbreitung <strong>und</strong><br />
plante sogar eine englische Übersetzung des Buches.<br />
Die Witwe Mozarts genoss zunehmend den Status einer „Celebrität“ der<br />
Stadt. Durchreisende Musiker <strong>und</strong> Mozart-Verehrer besuchten sie. Daraus<br />
entstanden fre<strong>und</strong>schaftliche Bekanntschaften, u.a. mit dem Londoner<br />
Instrumentenbauer Johann Andreas Stumpff, dem preußischen<br />
Generalmusikdirektor Gasparo Spontini <strong>und</strong> dem englischen Verleger<br />
Vincent Novello. Besonders erwähnenswert ist der Besuch des<br />
Musikerehepaares Ernst <strong>und</strong> Caroline Krähmer, die am 10. September 1834<br />
ein Erinnerungs-Konzert für W. A. Mozart unter Anwesenheit von Constanze<br />
Nissen <strong>im</strong> Theater gaben. Zwe<strong>im</strong>al wurde sie vom kunstliebenden<br />
bayerischen König Ludwig I. zu Mozart-Aufführungen nach München<br />
eingeladen.<br />
Ende der 1830er-Jahre engagierte sich Constanze Nissen für die<br />
Errichtung des Mozart-Denkmals. Sie unterstützte das eigens dafür<br />
gegründete Komitee bei Spendenaufrufen <strong>und</strong> Danksagungen <strong>im</strong> In- <strong>und</strong><br />
Ausland. Mit einem von ihr gestifteten Gedenkgottesdienst <strong>im</strong> Dom erinnerte<br />
Constanze Nissen 1841 an den 50. Todestag ihres ersten Ehemanns. Die<br />
Gründung des „Dom-Musik-Verein <strong>und</strong> Mozarteum“ <strong>im</strong> selben Jahr begleitete<br />
sie ebenfalls mit großem Interesse. Sie übereignete der neugegründeten<br />
20
Institution „als Andenken“ an Mozart das autographe Kyrie-Fragment KV 322<br />
sowie Buch- <strong>und</strong> Geldspenden.<br />
Das Referat möchte einen Einblick in die verschiedenen Aktivitäten<br />
Constanze Nissens in ihren Salzburger Lebensjahren 1824–1842 geben <strong>und</strong><br />
dabei ihre Rolle für die Entwicklung des Mozart-Kultes der Stadt beleuchten.<br />
Anja Morgenstern<br />
Geboren 1970 in Leipzig. 2003 Promotion an der Universität Leipzig mit der Dissertation<br />
Die Oratorien von Johann S<strong>im</strong>on Mayr (1763–1845). Studien zu Biographie, Quellen <strong>und</strong><br />
Rezeption. 2001–2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Felix Mendelssohn Bartholdy-<br />
Briefausgabe am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig. Seit 2007 wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin an der Digitalen Mozart-Edition (DME) der Stiftung Mozarteum<br />
Salzburg <strong>und</strong> Leiterin des Projektes Online-Edition von Briefen <strong>und</strong> Dokumenten.<br />
Daneben als Herausgeberin von musikalischen Editionen tätig (Vokalmusik von Johann<br />
Sebastian Bach <strong>und</strong> Carl Philipp Emanuel Bach).<br />
21