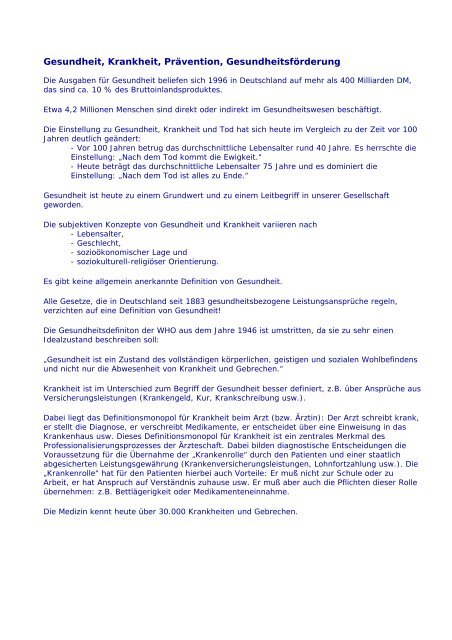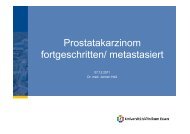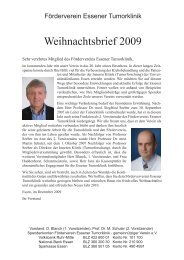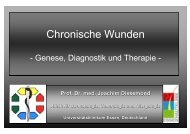Gesundheit, Krankheit, Prävention, Gesundheitsförderung
Gesundheit, Krankheit, Prävention, Gesundheitsförderung
Gesundheit, Krankheit, Prävention, Gesundheitsförderung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gesundheit</strong>, <strong>Krankheit</strong>, <strong>Prävention</strong>, <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
Die Ausgaben für <strong>Gesundheit</strong> beliefen sich 1996 in Deutschland auf mehr als 400 Milliarden DM,<br />
das sind ca. 10 % des Bruttoinlandsproduktes.<br />
Etwa 4,2 Millionen Menschen sind direkt oder indirekt im <strong>Gesundheit</strong>swesen beschäftigt.<br />
Die Einstellung zu <strong>Gesundheit</strong>, <strong>Krankheit</strong> und Tod hat sich heute im Vergleich zu der Zeit vor 100<br />
Jahren deutlich geändert:<br />
- Vor 100 Jahren betrug das durchschnittliche Lebensalter rund 40 Jahre. Es herrschte die<br />
Einstellung: „Nach dem Tod kommt die Ewigkeit.“<br />
- Heute beträgt das durchschnittliche Lebensalter 75 Jahre und es dominiert die<br />
Einstellung: „Nach dem Tod ist alles zu Ende.“<br />
<strong>Gesundheit</strong> ist heute zu einem Grundwert und zu einem Leitbegriff in unserer Gesellschaft<br />
geworden.<br />
Die subjektiven Konzepte von <strong>Gesundheit</strong> und <strong>Krankheit</strong> variieren nach<br />
- Lebensalter,<br />
- Geschlecht,<br />
- sozioökonomischer Lage und<br />
- soziokulturell-religiöser Orientierung.<br />
Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von <strong>Gesundheit</strong>.<br />
Alle Gesetze, die in Deutschland seit 1883 gesundheitsbezogene Leistungsansprüche regeln,<br />
verzichten auf eine Definition von <strong>Gesundheit</strong>!<br />
Die <strong>Gesundheit</strong>sdefiniton der WHO aus dem Jahre 1946 ist umstritten, da sie zu sehr einen<br />
Idealzustand beschreiben soll:<br />
„<strong>Gesundheit</strong> ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens<br />
und nicht nur die Abwesenheit von <strong>Krankheit</strong> und Gebrechen.“<br />
<strong>Krankheit</strong> ist im Unterschied zum Begriff der <strong>Gesundheit</strong> besser definiert, z.B. über Ansprüche aus<br />
Versicherungsleistungen (Krankengeld, Kur, Krankschreibung usw.).<br />
Dabei liegt das Definitionsmonopol für <strong>Krankheit</strong> beim Arzt (bzw. Ärztin): Der Arzt schreibt krank,<br />
er stellt die Diagnose, er verschreibt Medikamente, er entscheidet über eine Einweisung in das<br />
Krankenhaus usw. Dieses Definitionsmonopol für <strong>Krankheit</strong> ist ein zentrales Merkmal des<br />
Professionalisierungsprozesses der Ärzteschaft. Dabei bilden diagnostische Entscheidungen die<br />
Voraussetzung für die Übernahme der „Krankenrolle“ durch den Patienten und einer staatlich<br />
abgesicherten Leistungsgewährung (Krankenversicherungsleistungen, Lohnfortzahlung usw.). Die<br />
„Krankenrolle“ hat für den Patienten hierbei auch Vorteile: Er muß nicht zur Schule oder zu<br />
Arbeit, er hat Anspruch auf Verständnis zuhause usw. Er muß aber auch die Pflichten dieser Rolle<br />
übernehmen: z.B. Bettlägerigkeit oder Medikamenteneinnahme.<br />
Die Medizin kennt heute über 30.000 <strong>Krankheit</strong>en und Gebrechen.
Man versucht, <strong>Gesundheit</strong> und <strong>Krankheit</strong> auf Bevölkerungsebene mit sogenannten Indikatoren zu<br />
messen. Zu diesen zählen beispielhaft die folgenden:<br />
Indikator Definition Beispiel<br />
Mortalität<br />
(Sterblichkeit)<br />
Morbidität<br />
(<strong>Krankheit</strong>shäufigkeit)<br />
Invalidität<br />
Anzahl der Gestorbenen<br />
in der Bevölkerung (z.B.<br />
pro Jahr)<br />
Anteil der Kranken an<br />
der Bevölkerung<br />
Häufigkeit des Ausfalls<br />
von Körperfunktionen<br />
1991 betrug die Sterbeziffer der<br />
männlichen Bevölkerung in<br />
Deutschland 11,4 pro 1.000 Personen<br />
Inzidenz, Prävalenz (siehe unten)<br />
Schwerbehindertenanteil<br />
Es können aber auch Indikatoren bestimmt werden, die z.B.<br />
- die Effektivität und Arbeitsweise von <strong>Gesundheit</strong>sdiensten messen (z.B. Anzahl der Arzt-<br />
Patient-Kontakte, veranlasste Leistungen, Zahl der behandelten <strong>Krankheit</strong>sepisoden),<br />
- <strong>Krankheit</strong> und sozialen Status verknüpfen (z.B. Personen „unter Risiko“, soziale<br />
Charakteristika in bestimmten <strong>Krankheit</strong>sgruppen).<br />
Mortalität (Sterblichkeit):<br />
Die Sterblichkeit in entwickelten Industriegesellschaften variiert<br />
- schichtenspezifisch,<br />
- bei Männern stärker als bei Frauen und<br />
- bei Jüngeren stärker als bei Älteren.<br />
- Je ungünstiger der sozioökonomische Status, desto höher ist die Sterblichkeit.<br />
Faktoren wie<br />
- Verfügbarkeit,<br />
- Inanspruchnahme und<br />
- Qualität<br />
medizinischer Leistungen spielen heute für die Sterblichkeit nur eine untergeordnete Rolle.<br />
Der Haupteinfluss auf die Sterblichkeit ergibt sich aus<br />
- schichtenspezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen,<br />
- Lebensstilen,<br />
- physischen und sozioemotionalen Belastungen.<br />
In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer deutlichen Abnahme der Mortalität in den<br />
Industriegesellschaften gekommen. Dies hat im wesentlichen drei Gründe:<br />
- Zunahme der Lebenserwartung im fortgeschrittenen Alter mit schnellem Anwachsen der<br />
ältesten Bevölkerungsgruppen,<br />
- höhere Lebenserwartung bei Frauen,<br />
- Verringerung der altersspezifischen Mortalität wichtiger chronisch-degenerativer<br />
Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, KHK).<br />
Legt man die Lebenserwartung in Westeuropa zugrunde, so können durch geeignete<br />
gesundheitspolitische Massnahmen die meisten Lebensjahre in der Gruppe der über 65-jährigen<br />
gewonnen werden, da in den jungen Gruppen die Sterblichkeit bereits niedrig ist.
Die Mortalität lässt sich heute vor allem bezüglich der folgenden Risiken durch geeignete<br />
Massnahmen vermindern:<br />
- Lungenkrebs,<br />
- Leberzirrhose,<br />
- Kraftfahrzeugunfälle.<br />
Allerdings ist die maximale Lebenserwartung nicht unbegrenzt ausdehnbar. Aus Erfahrungen mit<br />
Tieren unter geschützten Bedingungen (Tierstall mit gefilterter Luft usw.) weiss man, dass es<br />
maximale Lebensspannen von Säugetieren gibt. Man schätzt die maximale Lebensspanne für den<br />
Menschen auf 115 Jahre und die maximale durchschnittliche Lebenserwartung auf 90 Jahre.<br />
Die Lebensdauer lässt sich auch anschaulich mit sogenannten Lebensbäumen abbilden. Der<br />
nachfolgende Lebensbaum bezieht sich auf die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1991:
Morbidität (<strong>Krankheit</strong>shäufigkeit):<br />
Im letzten Jahrhundert haben sich dramatische Veränderungen im <strong>Krankheit</strong>sspektrum ergeben.<br />
So kam es zu einer deutlichen Zunahme chronischer <strong>Krankheit</strong>en (vor allem durch den ständig<br />
wachsenden Anteil älterer Menschen) und einer Abnahme von Infektionskrankheiten (u.a. durch<br />
Antibiotika-Einsatz ab etwa 1940).<br />
Die Morbidität wird mit verschiedenen Masszahlen der Epidemiologie bestimmt:<br />
Masszahl Definition Beispiel<br />
Prävalenz<br />
Inzidenz<br />
Krankenbestand zu einem<br />
Zeitpunkt in der Bevölkerung<br />
Anteil aller Neuerkrankungen<br />
in einem Zeitraum in der<br />
Bevölkerung<br />
Anteil aller Patienten mit einer KHK<br />
(koronaren Herzkrankheit) an der<br />
Gesamtbevölkerung in Deutschland<br />
Anteil aller Patienten mit einer im Jahr 2001<br />
neu diagnostizierten KHK an der<br />
Gesamtbevölkerung in Deutschland<br />
In dem aufgezeigten Beispiel einer chronischen <strong>Krankheit</strong> mit langer Lebenszeit unter der<br />
<strong>Krankheit</strong> (KHK) ist die Inzidenz deutlich geringer als die Prävalenz. Beide Parameter können sich<br />
auch annähern, z.B. bei akuten, schnell verlaufenden <strong>Krankheit</strong>en (z.B. Masern).<br />
Aussagen zur Morbidität lassen sich aber auch über andere Masszahlen gewinnen, z.B. die Daten<br />
der Krankenkassen:<br />
- Der Krankenstand ist am höchsten in den Wintermonaten und am niedrigsten im<br />
Sommer (Ferienzeit),<br />
- der Krankenstand nimmt mit der Betriebsgrösse zu,<br />
- der Krankenstand nimmt von den Arbeitern über die Facharbeiter und Meister/Poliere zu<br />
den Angestellten hin ab,<br />
- der Krankenstand steigt im Wochenverlauf an.<br />
<strong>Prävention</strong><br />
Unter <strong>Prävention</strong> versteht man vorbeugende Massnahmen, die <strong>Krankheit</strong>en verhindern, verzögern<br />
oder Auswirkungen lindern sollen.<br />
Man unterscheidet drei Ziele der <strong>Prävention</strong>:<br />
<strong>Prävention</strong> Definition Beispiel<br />
Primäre P.<br />
Ausschaltung von<br />
<strong>Krankheit</strong>sursachen<br />
Aufgabe des Rauchens und damit<br />
Verminderung des Risikos einer<br />
Lungenkrebsentwicklung<br />
Sekundäre P. Früherkennung und -behandlung Mamma-Karzinom-Screening<br />
Tertiäre P.<br />
Vermeidung der Folgen von<br />
Reha-Maßnahme nach Tumor-OP<br />
<strong>Krankheit</strong> oder ihres Fortschreitens
Nach der Methodik des präventiven Vorgehens lassen sich ebenfalls Unterscheidungen treffen:<br />
Methodik Definition Beispiel<br />
Medizinische<br />
<strong>Prävention</strong><br />
Verhaltensprävention<br />
Verhältnisprävention<br />
Einsatz medizinischer Mittel der<br />
Diagnostik und Therapie<br />
Verhaltensänderung durch<br />
erzieherische, bildende, beratende und<br />
verhaltenstherapeutische Massnahmen<br />
sowie soziale und rechtliche<br />
Sanktionen<br />
Erhaltung, Schaffung und<br />
Wiederherstellung<br />
gesundheitsdienlicher Verhältnisse in<br />
der natürlichen, der Arbeits- und der<br />
sozialen Umwelt, sozialer Wandel<br />
Screening-<br />
Untersuchungen<br />
Aufklärung in der Schule<br />
über die Gefahren des<br />
Rauchens und Alkohol-<br />
Trinkens<br />
Einsatz ungefährlicherer<br />
Arbeitsmethoden zur<br />
Verhinderung von<br />
Unfällen am Arbeitsplatz<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung bedeutet die Aktivierung von <strong>Gesundheit</strong>sresourcen des Einzelnen durch<br />
<strong>Gesundheit</strong>saufklärung und –beratung. Dies soll erfolgen über ein höheres Mass an<br />
Selbstbestimmung über die eigene <strong>Gesundheit</strong>. Ein Beispiel hierfür sind Rückenschulprogramme<br />
für Beschäftigte an Büroarbeitsplätzen, die z.B. von Krankenkassen angeboten werden.<br />
Autor: W. Popp; Stand: 7. November 2001