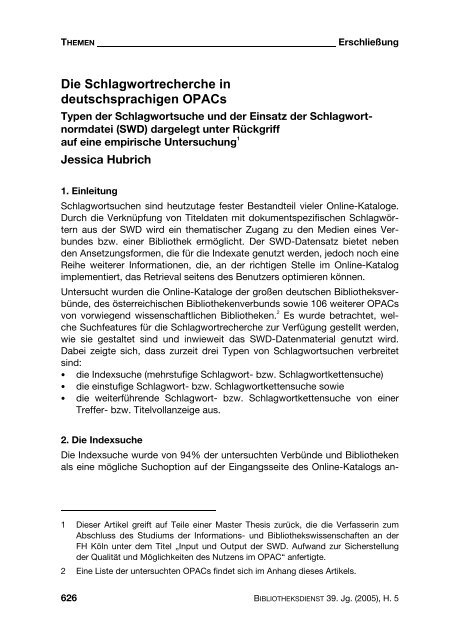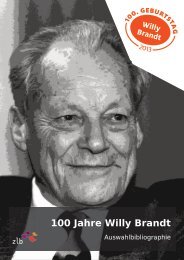Die Schlagwortrecherche in deutschsprachigen OPACs
Die Schlagwortrecherche in deutschsprachigen OPACs
Die Schlagwortrecherche in deutschsprachigen OPACs
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
THEMEN Erschließung<br />
<strong>Die</strong> <strong>Schlagwortrecherche</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>deutschsprachigen</strong> <strong>OPACs</strong><br />
Typen der Schlagwortsuche und der E<strong>in</strong>satz der Schlagwortnormdatei<br />
(SWD) dargelegt unter Rückgriff<br />
auf e<strong>in</strong>e empirische Untersuchung 1<br />
Jessica Hubrich<br />
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Schlagwortsuchen s<strong>in</strong>d heutzutage fester Bestandteil vieler Onl<strong>in</strong>e-Kataloge.<br />
Durch die Verknüpfung von Titeldaten mit dokumentspezifischen Schlagwörtern<br />
aus der SWD wird e<strong>in</strong> thematischer Zugang zu den Medien e<strong>in</strong>es Verbundes<br />
bzw. e<strong>in</strong>er Bibliothek ermöglicht. Der SWD-Datensatz bietet neben<br />
den Ansetzungsformen, die für die Indexate genutzt werden, jedoch noch e<strong>in</strong>e<br />
Reihe weiterer Informationen, die, an der richtigen Stelle im Onl<strong>in</strong>e-Katalog<br />
implementiert, das Retrieval seitens des Benutzers optimieren können.<br />
Untersucht wurden die Onl<strong>in</strong>e-Kataloge der großen deutschen Bibliotheksverbünde,<br />
des österreichischen Bibliothekenverbunds sowie 106 weiterer <strong>OPACs</strong><br />
von vorwiegend wissenschaftlichen Bibliotheken. 2 Es wurde betrachtet, welche<br />
Suchfeatures für die <strong>Schlagwortrecherche</strong> zur Verfügung gestellt werden,<br />
wie sie gestaltet s<strong>in</strong>d und <strong>in</strong>wieweit das SWD-Datenmaterial genutzt wird.<br />
Dabei zeigte sich, dass zurzeit drei Typen von Schlagwortsuchen verbreitet<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
die Indexsuche (mehrstufige Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche)<br />
die e<strong>in</strong>stufige Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche sowie<br />
die weiterführende Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche von e<strong>in</strong>er<br />
Treffer- bzw. Titelvollanzeige aus.<br />
2. <strong>Die</strong> Indexsuche<br />
<strong>Die</strong> Indexsuche wurde von 94% der untersuchten Verbünde und Bibliotheken<br />
als e<strong>in</strong>e mögliche Suchoption auf der E<strong>in</strong>gangsseite des Onl<strong>in</strong>e-Katalogs an-<br />
1 <strong>Die</strong>ser Artikel greift auf Teile e<strong>in</strong>er Master Thesis zurück, die die Verfasser<strong>in</strong> zum<br />
Abschluss des Studiums der Informations- und Bibliothekswissenschaften an der<br />
FH Köln unter dem Titel „Input und Output der SWD. Aufwand zur Sicherstellung<br />
der Qualität und Möglichkeiten des Nutzens im OPAC“ anfertigte.<br />
2 E<strong>in</strong>e Liste der untersuchten <strong>OPACs</strong> f<strong>in</strong>det sich im Anhang dieses Artikels.<br />
626 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
geboten. 3 Unter „Indexsuche“ wird e<strong>in</strong>e mehrstufige Schlagwort- bzw.<br />
Schlagwortkettensuche verstanden, die den Benutzer über e<strong>in</strong> Register von<br />
E<strong>in</strong>zelschlagwörtern und/oder Schlagwortketten zu den relevanten Titeln führt.<br />
Auf die Titeldaten kann entweder über e<strong>in</strong>e Hyperl<strong>in</strong>kverknüpfung direkt vom<br />
Index aus zugegriffen werden oder nach Übernahme der Indexdaten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Standard-Suchmaske nach Initiierung des Suchprozesses. Letzteres verlängert<br />
zwar den Recherchevorgang, erweitert jedoch zugleich die Recherchemöglichkeiten:<br />
der Benutzer kann mehrere Schlagwörter bzw. Schlagwortketten<br />
mit den booleschen Operatoren verknüpfen und auch mit anderen Elementen<br />
wie Daten aus der Formalerschließung komb<strong>in</strong>ieren. 4<br />
2.1 Zugriffsmöglichkeiten auf die Registere<strong>in</strong>träge<br />
Indices <strong>in</strong> Onl<strong>in</strong>e-Katalogen bestehen aus e<strong>in</strong>er Liste alphabetisch geordneter<br />
Daten, auf die i.d.R. l<strong>in</strong>ear zugegriffen wird. <strong>Die</strong> alphabetische Reihenfolge der<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Suchmaske e<strong>in</strong>gegebenen Begriffe gibt vor, an welcher Stelle der Index<br />
aufgeblättert wird. Existiert die e<strong>in</strong>gegebene Buchstabenfolge nicht im<br />
Index, wird der Benutzer zu dem ihr am nächsten stehenden E<strong>in</strong>trag geführt,<br />
wobei die alphabetisch nachfolgenden Schlagwörter mit angezeigt werden.<br />
Null-Treffer-Mengen im engeren S<strong>in</strong>ne des Wortes s<strong>in</strong>d nicht möglich. 5<br />
Der beschränkte Zugriff auf die Indexe<strong>in</strong>träge ist bei Indices, die nur E<strong>in</strong>zelwörter<br />
enthalten, relativ unproblematisch, da auf alle E<strong>in</strong>träge gleichermaßen<br />
zugegriffen werden kann. Prekär ist er h<strong>in</strong>gegen bei Datene<strong>in</strong>heiten, die sich<br />
aus mehreren Gliedern zusammensetzen wie beispielsweise Schlagwortketten.<br />
Um e<strong>in</strong>e bestimmte Schlagwortkette im Index f<strong>in</strong>den zu können, muss<br />
der e<strong>in</strong>gegebene Begriff zw<strong>in</strong>gend am Anfang der Kette stehen bzw. die Reihenfolge<br />
der e<strong>in</strong>gegebenen Suchbegriffe muss der Reihenfolge der mite<strong>in</strong>ander<br />
komb<strong>in</strong>ierten Schlagwörter <strong>in</strong> der Schlagwortkette entsprechen. Um die<br />
Zugriffsmöglichkeiten auf die Ketten zu erhöhen, werden Schlagwortketten<br />
daher permutiert, d.h. die Reihenfolge der Glieder e<strong>in</strong>er Schlagwortkette wird<br />
nach bestimmten Regeln, die <strong>in</strong> den Regeln für den Schlagwortkatalog<br />
3 Indexsuchen, die sich an e<strong>in</strong>e vorhergehende Recherche anschließen und von der<br />
Treffer- oder Titelvollanzeige aus <strong>in</strong>itiiert werden, werden hier zur „weiterführenden<br />
Suche“ gezählt.<br />
4 <strong>Die</strong>se Art der Indexsuche ist vorwiegend <strong>in</strong> SISIS-<strong>OPACs</strong> realisiert.<br />
5 In manchen <strong>OPACs</strong> wie <strong>in</strong> den LIBERO-<strong>OPACs</strong> und BOND-<strong>OPACs</strong> werden, statt<br />
dass der Index wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Buch „aufgeblättert“ wird, nur Indexausschnitte gezeigt,<br />
d.h. aus dem Index werden die Begriffe herausgefiltert, die den Suchbegriffen<br />
oder Teilen der Suchbegriffe entsprechen, so dass es hier durchaus zu Null-Treffern<br />
kommen kann.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 627
THEMEN Erschließung<br />
(RSWK) festgelegt s<strong>in</strong>d, geändert. Es werden mehrere permutierte Ketten gebildet,<br />
die jeweils e<strong>in</strong>en eigenen E<strong>in</strong>trag im Index erhalten. Schlagwortketten<br />
waren <strong>in</strong> 82% der gesichteten Schlagwortkettenregister permutiert.<br />
In e<strong>in</strong>igen <strong>OPACs</strong> s<strong>in</strong>d auch nicht-l<strong>in</strong>eare Indexsuchen möglich. So wird <strong>in</strong><br />
den Indices von SISIS-<strong>OPACs</strong> i.d.R. neben der vore<strong>in</strong>gestellten l<strong>in</strong>earen Recherche,<br />
die <strong>in</strong> der Registeroberfläche mit dem Term<strong>in</strong>us „Anzeigen ab“ bezeichnet<br />
wird, auch e<strong>in</strong>e Indexsuche angeboten, bei der die Prämisse der<br />
festgelegten Reihenfolge von Buchstabe und Wort aufgehoben ist. 6 Sie wird<br />
über den Button „Start Indexsuche“ aktiviert. (vgl. Abb. 1)<br />
Abb. 1: Suchfeatures im Index e<strong>in</strong>es SISIS-<strong>OPACs</strong><br />
Möchte e<strong>in</strong> Benutzer der Universitäts- und Landesbibliothek Münster beispielsweise<br />
Literatur zu Kants Kritik der re<strong>in</strong>en Vernunft f<strong>in</strong>den und gibt <strong>in</strong><br />
Google-Manier „Kant Kritik“ <strong>in</strong> die Suchmaske e<strong>in</strong>, so wird er nicht, wie bei<br />
der vore<strong>in</strong>gestellten l<strong>in</strong>earen Suche zu dem E<strong>in</strong>trag „Kant, Manuel“ im Index<br />
geführt (vgl. Abb. 2a), sondern es wird e<strong>in</strong>e Zwischentrefferliste erzeugt, die<br />
alle Registere<strong>in</strong>träge auflistet, die sowohl „Kant“ als auch „Kritik“ enthalten<br />
(vgl. Abb. 2b). Allerd<strong>in</strong>gs ist fraglich, ob dem Benutzer der Unterschied zwischen<br />
„Anzeige ab“ und „Indexsuche“ e<strong>in</strong>leuchtet, zumal er sich, wenn er sie<br />
aktiviert, eh schon <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Index bef<strong>in</strong>det. 7<br />
6 <strong>Die</strong>se Option ist nicht <strong>in</strong> allen Indices von SISIS-<strong>OPACs</strong> <strong>in</strong>tegriert. So fehlt sie beispielsweise<br />
bei der Universitätsbibliothek Dortmund und dem Schlagwortkettenregister<br />
der Universitäts- und Landesbibliothek Münster (der Schlagwort<strong>in</strong>dex der<br />
Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat h<strong>in</strong>gegen diese Funktion).<br />
7 E<strong>in</strong> ähnliches Feature weist auch der Onl<strong>in</strong>e-Katalog der Schweizerischen Landesbibliothek<br />
Bern auf. Dort wird es „Wort-<strong>in</strong>-Index-Suche“ genannt und als alternative<br />
Option zur „Indexsuche“ angeboten. Ob diese Bezeichnung e<strong>in</strong>deutiger ist, bleibt<br />
fraglich.<br />
628 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
a) b)<br />
Abb. 2a: Ausschnitt aus dem Indexe<strong>in</strong>trag bei l<strong>in</strong>earer Suche im OPAC<br />
der Universitäts- und Landesbibliothek Münster nach E<strong>in</strong>gabe<br />
von „Kant Kritik“<br />
b: Ausschnitt aus Indexe<strong>in</strong>trag bzw. Zwischentrefferliste<br />
der nicht-l<strong>in</strong>earen „Indexsuche“<br />
2.2 Aufbereitung und Informationswert der Daten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>fachen Indices<br />
Precision und Recall der Treffermenge e<strong>in</strong>er Indexsuche werden wesentlich<br />
durch die Art der Indexe<strong>in</strong>träge bestimmt. Zu unterscheiden s<strong>in</strong>d Schlagwort<strong>in</strong>dices<br />
und Schlagwortketten<strong>in</strong>dices.<br />
Schlagwort<strong>in</strong>dices <strong>in</strong>formieren den Benutzer über das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Verbund bzw.<br />
e<strong>in</strong>er Bibliothek verwendete Indexierungsvokabular. Für themenspezifische<br />
Suchen s<strong>in</strong>d sie nur bed<strong>in</strong>gt geeignet; denn e<strong>in</strong> Thema lässt sich meist nicht<br />
durch e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zelnen Begriff beschreiben. In ihrer e<strong>in</strong>fachsten Ausprägung<br />
bestehen sie aus e<strong>in</strong>er Liste von E<strong>in</strong>zelschlagwörtern, die entweder <strong>in</strong> wort<strong>in</strong>vertierter<br />
und/oder phrasen<strong>in</strong>vertierter Form dem Benutzer dargeboten werden<br />
und mit den Titeln, denen sie im Rahmen der Sacherschließung zugeordnet<br />
wurden, verknüpft s<strong>in</strong>d.<br />
In e<strong>in</strong>em wort<strong>in</strong>vertierten Index werden Schlagwörter, die sich aus mehreren<br />
Wörtern zusammensetzen wie Adjektiv-Substantiv-Verb<strong>in</strong>dungen, Schlagwörter<br />
mit Homonymzusatz und mehrgliedrige Schlagwörter, nicht als e<strong>in</strong> komplexes<br />
Wortgefüge abgebildet, sondern <strong>in</strong> ihren E<strong>in</strong>zelkomponenten zerlegt. E<strong>in</strong><br />
Schlagwort wie „philosophische Anthropologie“ erhält also zwei E<strong>in</strong>träge: „philosophische“<br />
und „Anthropologie“. <strong>Die</strong> Unterscheidungskraft e<strong>in</strong>es Schlagworts<br />
sowie Teile se<strong>in</strong>es Begriffsumfangs gehen verloren, der Wert des SWD-<br />
Vokabulars für die Recherche wird reduziert. Es kommt bei der Indexsuche teils<br />
zu relativ großen Treffermengen mit verhältnismäßig ger<strong>in</strong>ger Precision.<br />
In e<strong>in</strong>em phrasen<strong>in</strong>vertierten Register wird h<strong>in</strong>gegen jedes Schlagwort als<br />
Ganzes <strong>in</strong>klusive se<strong>in</strong>er formalen Spezifika <strong>in</strong> das Register übernommen. Polyseme<br />
und Homonyme können klar vone<strong>in</strong>ander unterschieden werden. <strong>Die</strong><br />
Entscheidung für den richtigen Begriff wird im Fall der Homonyme und Polyseme<br />
durch die Anzeige der nachfolgenden Begriffe bzw. der Möglichkeit, zu<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 629
THEMEN Erschließung<br />
vorhergehenden Begriffen „zurückzublättern“ unterstützt. 8 Ansetzungsketten<br />
wie „Kant, Immanuel / Kritik der re<strong>in</strong>en Vernunft“, die aus zwei Gliedern bestehen,<br />
werden nicht immer <strong>in</strong> e<strong>in</strong> solches Register <strong>in</strong>tegriert, sondern teils<br />
nur ihre e<strong>in</strong>zelnen Glieder. Dadurch geht ihr eigener semantischer Gehalt verloren.<br />
<strong>Die</strong>s hat e<strong>in</strong>en unglaublichen Ballast bei der Indexsuche zur Folge. So<br />
werden beispielsweise alle <strong>in</strong>dexierten Werke von Kant, die mittels e<strong>in</strong>es solchen<br />
mehrgliedrigen Schlagworts vone<strong>in</strong>ander differenziert werden könnten,<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Index, <strong>in</strong> dem ke<strong>in</strong>e Ansetzungsketten gespeichert s<strong>in</strong>d wie bei der<br />
Universitätsbibliothek Ma<strong>in</strong>z, unter „Kant, Immanuel“ gefasst. Entsprechend<br />
hoch ist die Trefferanzahl: 1160 – kaum e<strong>in</strong> Benutzer wird wohl bereit se<strong>in</strong>,<br />
e<strong>in</strong>e solch große Anzahl von Titeln durchzusehen!<br />
<strong>Die</strong> Treffermenge, die durch e<strong>in</strong>e phrasen<strong>in</strong>vertierte Indexsuche erzielt wird,<br />
weist i.d.R. e<strong>in</strong>e bessere Precision auf als bei e<strong>in</strong>em wort<strong>in</strong>vertierten Register,<br />
ohne dass damit zugleich die Vollständigkeit der relevanten Titel bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
wird. Allerd<strong>in</strong>gs kommt es bei häufig verwendeten Schlagwörtern wie<br />
„Ethik“ nach wie vor zu e<strong>in</strong>er Anzeige von sehr vielen Titeln, von denen nicht<br />
alle auch für den Benutzer <strong>in</strong>teressant s<strong>in</strong>d.<br />
Im Gegensatz zu Schlagwort<strong>in</strong>dices s<strong>in</strong>d Schlagwortketten<strong>in</strong>dices immer<br />
phrasen<strong>in</strong>vertierte Indices, die dem Benutzer e<strong>in</strong>en Überblick über die Gegenstände<br />
der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Verbund bzw. e<strong>in</strong>er Bibliothek vorhandenen Dokumente<br />
verschaffen, sofern diese mittels syntaktischer Indexierung erschlossen<br />
wurden. Sie s<strong>in</strong>d für die sachliche Suche geeignet und können auch zur Präzisierung<br />
des der Recherche zugrunde liegenden Themas dienlich se<strong>in</strong>:<br />
„<strong>Die</strong> Indexlisten aus SW-Ketten unterstützen durch die Möglichkeit zum orientierenden<br />
Blättern die thematische Suche, denn im Gegensatz zum direkten Zugriff auf isolierte<br />
E<strong>in</strong>zelwörter […] erhält der Suchende über den vor der Titelanzeige aufgeblätterten SW-<br />
Ketten-Index H<strong>in</strong>weise auf thematische Zusammenhänge, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong> Suchbegriff<br />
steht. Der Benutzer kann so durch (passives) Überfliegen und Auswählen der relevanten<br />
Ketten die Suche präzisieren bzw. die Treffermenge reduzieren, ohne selbst weitere<br />
Suchbegriffe expressis verbis kennen oder ermitteln oder e<strong>in</strong>geben zu müssen.“ 9<br />
8 <strong>Die</strong> Möglichkeit zum Zurückblättern und Vorblättern wird nicht <strong>in</strong> allen <strong>OPACs</strong><br />
angeboten.<br />
9 Hans Ullrich Weidemüller: S<strong>in</strong>n und Uns<strong>in</strong>n von Ketten im OPAC. In: Zukunft der<br />
Sacherschließung im OPAC. Vorträge des 2. Düsseldorfer OPAC-Kolloquiums am<br />
21. Juni 1995. Hrsg. v. Elisabeth Niggemann und Klaus Lepsky. Düsseldorf 1996. S.<br />
65f. Zum Nutzen von Schlagwortketten <strong>in</strong> Indices siehe auch Holger Flachmann: Zur<br />
Effizienz bibliothekarischer Inhaltserschließung: Allgeme<strong>in</strong>e Probleme und die Regeln<br />
für den Schlagwortkatalog (RSWK). In: BIBLIOTHEKSDIENST 38 (2004), H. 6.<br />
S. 745–791. Insbes. S. 774–784.<br />
630 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
In se<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachsten Ausprägung besteht das Schlagwortkettenregister aus<br />
Schlagwortketten, die „<strong>in</strong> alphabetischer Ordnung des ersten [Schlagworts]<br />
und der folgenden Unterschlagwörter aufgelistet“ 10 s<strong>in</strong>d; E<strong>in</strong>zelschlagwörter<br />
s<strong>in</strong>d nur dann aufgeführt, wenn durch sie zugleich der Inhalt e<strong>in</strong>es Dokuments<br />
zum Ausdruck gebracht wird. Ketten mit e<strong>in</strong>er hohen Anzahl von Unterschlagwörtern<br />
können häufig aus technischen Gründen nicht vollständig abgebildet<br />
werden. E<strong>in</strong> Teil ihrer Informationen geht so verloren (vgl. Abb. 3). 11<br />
Abb. 3: Ausschnitt aus dem<br />
SWK-Index der Universitäts-<br />
und Landesbibliothek<br />
Münster<br />
Da Dokumente möglichst spezifisch erschlossen werden, kommt es <strong>in</strong><br />
Schlagwortkettenregistern teils zu sehr differenzierten Ketten, die mit nur wenigen<br />
Titeln verknüpft s<strong>in</strong>d. 12 Treffermengen e<strong>in</strong>er Indexsuche mit Schlagwortketten<br />
weisen daher i.d.R. e<strong>in</strong>e relativ hohe Precision, aber e<strong>in</strong>en recht niedrigen<br />
Recall auf.<br />
Durchgesetzt hat sich das Schlagwortkettenregister gegenüber dem Schlagwortregister<br />
bisher nicht: Während 91% der untersuchten Onl<strong>in</strong>e-Kataloge<br />
e<strong>in</strong>en Schlagwort<strong>in</strong>dex aufwiesen, waren es nur 3% mit e<strong>in</strong>em Schlagwortketten<strong>in</strong>dex.<br />
Unter den Schlagwort<strong>in</strong>dices war am meisten der phrasen<strong>in</strong>vertierte<br />
Index verbreitet: 91% der Onl<strong>in</strong>e-Kataloge hatten e<strong>in</strong>en phrasen<strong>in</strong>vertierten<br />
Index, nur 26% e<strong>in</strong>en wort<strong>in</strong>vertierten. 13 Ansetzungsketten waren <strong>in</strong> 82% der<br />
phrasen<strong>in</strong>vertierten Register <strong>in</strong>tegriert. 14<br />
10 Holger Flachmann: Zur Effizienz bibliothekarischer Inhaltserschließung. Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Probleme und die Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK). In: BIBLIOTHEKSDIENST<br />
38 (2004), H. 6. S. 745–791. Hier: S. 777.<br />
11 <strong>Die</strong>ses Problem betrifft <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> e<strong>in</strong>iger Bibliothekssysteme auch die <strong>in</strong> den<br />
Schlagwortregistern <strong>in</strong>tegrierten Ansetzungsketten.<br />
12 Vgl. auch Urs Bisig: OPAC und die verbale Sacherschließung. E<strong>in</strong> Beitrag zur<br />
RSWK-Diskussion. In: ABI-Technik 14 (1994), H. 2. S. 117–130. Hier: S. 118.<br />
13 9% der untersuchten <strong>OPACs</strong> wiesen sowohl e<strong>in</strong>en phrasen- als auch e<strong>in</strong>en wort<strong>in</strong>vertierten<br />
Index auf.<br />
14 <strong>Die</strong> ger<strong>in</strong>ge Anzahl der Schlagwortketten<strong>in</strong>dices ist mitunter technisch bed<strong>in</strong>gt: E<strong>in</strong>ige<br />
Bibliotheksysteme wie beispielsweise SISIS s<strong>in</strong>d nicht auf Schlagwortkettenregister<br />
e<strong>in</strong>gerichtet und können diese nicht darstellen. Dass die Universitäts- und<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 631
THEMEN Erschließung<br />
2.3 Steigerung des Informationswerts von Indices durch deren<br />
Anreicherung mit Informationen aus dem SWD-Datensatz<br />
Bisher wurde stillschweigend davon ausgegangen, dass der Benutzer das für<br />
ihn relevante Schlagwort bzw. die für ihn relevante Schlagwortkette im Index<br />
f<strong>in</strong>det und dass die Bedeutung der <strong>in</strong> den Indices gespeicherten Daten e<strong>in</strong>deutig<br />
ist. Beides trifft nur e<strong>in</strong>geschränkt zu.<br />
Suchanfragen s<strong>in</strong>d häufig nicht präzise formuliert. Sie umfassen entweder nur<br />
Teile e<strong>in</strong>es Themas oder gehen über dieses h<strong>in</strong>aus. Übere<strong>in</strong>stimmungen zwischen<br />
Suchvokabular und den SWD-Ansetzungsformen s<strong>in</strong>d nicht immer gegeben.<br />
Nach treffenden alternativen Term<strong>in</strong>ologien zu suchen, fällt den meisten<br />
Benutzern schwer. 15 Infolgedessen ist die Suche nach dem richtigen Schlagwort<br />
bzw. der richtigen Schlagwortkette häufig mit viel <strong>in</strong>tellektuellem und zeitlichem<br />
Aufwand verbunden, ohne dass sie stets von Erfolg gekrönt ist. Das l<strong>in</strong>eare<br />
Brows<strong>in</strong>g im Index kann kaum Hilfestellung leisten, weil es voraussetzt, dass der<br />
Benutzer <strong>in</strong> etwa an der richtigen Stelle den Index aufblättert. Stärkere wegweisende<br />
Funktionen kann hier das Relationsgefüge der SWD übernehmen.<br />
Durch die Anreicherung des Registers um Synonyme, Quasisynonyme und<br />
semantisch äquivalente Schlagwortketten wird das Begriffsspektrum des Registers<br />
erweitert und die Auff<strong>in</strong>dbarkeit e<strong>in</strong>es Schlagworts bzw. e<strong>in</strong>er Schlagwortkette<br />
erhöht: Literatur zum Moralischen Gottesbeweis kann beispielsweise<br />
über „Moralischer Gottesbeweis“, „Deontologischer Gottesbeweis“ oder<br />
„Ethikotheologischer Gottesbeweis“ gefunden werden. Nichtvorzugsbenennungen<br />
können auf unterschiedliche Weise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Index <strong>in</strong>tegriert se<strong>in</strong>.<br />
Möglich ist e<strong>in</strong>e Darstellung, bei der Synonyme den Ansetzungsformen<br />
gleichgesetzt werden, d.h. sie s<strong>in</strong>d nicht gesondert gekennzeichnet und <strong>in</strong><br />
Schlagwortregistern wie die Vorzugsbenennungen mit Titeln verknüpft; <strong>in</strong><br />
Schlagwortkettenregistern s<strong>in</strong>d zusätzliche Ketten enthalten, bei denen die<br />
Vorzugsbenennung, sofern sie am Anfang e<strong>in</strong>er (permutierten) Kette steht,<br />
durch ihre Synonyme ersetzt ist. <strong>Die</strong>se Ketten s<strong>in</strong>d gleichfalls mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k<br />
zu den Titeln h<strong>in</strong>terlegt, so dass sich der Benutzer immer die Treffermenge<br />
direkt anzeigen lassen kann. <strong>Die</strong> Unterscheidungskraft zwischen<br />
Schlagwort und Synonym geht dabei verloren.<br />
Landesbibliothek Münster als SISIS-Anwender nichtsdestotrotz e<strong>in</strong>en Schlagwortketten<strong>in</strong>dex<br />
<strong>in</strong> ihrem OPAC <strong>in</strong>tegriert hat, geht auf die Leistung der EDV-Abteilung<br />
der Universitäts- und Landesbibliothek Münster zurück.<br />
15 Vgl. Ursula Schulz: E<strong>in</strong>ige Forderungen an die Qualität von Normdateien aus der<br />
Sicht er <strong>in</strong>haltlichen Erschließung für Onl<strong>in</strong>e-Kataloge. Teil 3: Thematischer Zugriff<br />
und term<strong>in</strong>ologische Pfade. In: BIBLIOTHEKSDIENST 27 (1993), H. 8. S. 1160–1180.<br />
Hier: S. 1162.<br />
632 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
Beibehalten wird sie h<strong>in</strong>gegen, wenn die Nichtvorzugsbenennungen zum e<strong>in</strong>en<br />
optisch von der Ansetzungsform abgehoben werden, zum anderen ke<strong>in</strong>e<br />
direkte Verknüpfung mit den Titeln aufweisen, sondern stattdessen auf die<br />
Ansetzungsform verweisen. <strong>Die</strong>s verlängert allerd<strong>in</strong>gs den Recherchevorgang<br />
für den Benutzer, da er, bevor er zu den gewünschten Treffermengen gelangt,<br />
sich zuerst noch die Ansetzungsform anzeigen lassen muss. <strong>Die</strong> Frage stellt<br />
sich, <strong>in</strong>wiefern dies notwendig ist. Für den Benutzer hat die Unterscheidung<br />
zwischen Synonym und Schlagwort <strong>in</strong> Bezug auf die Recherche ke<strong>in</strong>en besonderen<br />
Informationswert, sofern beide gleichermaßen zu Treffern führen.<br />
E<strong>in</strong>e ganz andere Funktion als äquivalente Verweisungen können hierarchische,<br />
assoziative und chronologische Relationen im Index e<strong>in</strong>nehmen, wobei<br />
mehrgliedrige Oberbegriffe e<strong>in</strong>e Sonderposition darstellen; denn hierbei handelt<br />
es sich im Gegensatz zu den anderen Relationen um Begriffe, die noch<br />
nicht bereits im Index vorhanden s<strong>in</strong>d, so dass sie auch ähnlich wie die Synonyme<br />
zusätzliche E<strong>in</strong>stiegsmöglichkeiten zum Auff<strong>in</strong>den der relevanten<br />
Schlagwörter und Schlagwortketten bieten und daher Benutzern erst recht<br />
nicht vorenthalten werden sollten. Hierarchische, assoziative und chronologische<br />
Verweisungen dienen der Orientierung des Benutzers und unterstützen<br />
ihn bei der Spezifizierung von Suchanfragen und der Suche nach dem im S<strong>in</strong>ne<br />
des Themas relevanten Begriff bzw. der relevanten Schlagwortkette, <strong>in</strong>dem<br />
sie ihm e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> das Begriffsumfeld geben. Der eigene <strong>in</strong>tellektuelle<br />
Aufwand wird reduziert, die Recherche optimiert. Auf Relationen kann der Benutzer<br />
auf unterschiedliche Weise aufmerksam gemacht werden. Verbreitet ist<br />
neben dem H<strong>in</strong>weis auf „Oberbegriff“ bzw. „übergeordneter Begriff“, „Unterbegriff“<br />
bzw. „untergeordneter Begriff“ und „verwandter Begriff“ vor allem die<br />
„Siehe-auch“-Verweisung, unter der sowohl Ober- als auch Unter- und verwandte<br />
Begriffe subsumiert werden.<br />
<strong>Die</strong> Relevanz e<strong>in</strong>es Begriffs kann nur dann beurteilt werden, wenn se<strong>in</strong> Bedeutungsumfang<br />
klar zutage tritt. Der Großteil des SWD-Vokabulars ist für sich aussagekräftig,<br />
aber e<strong>in</strong>ige Benennungen s<strong>in</strong>d mehrdeutig und werden daher <strong>in</strong> der<br />
SWD durch Def<strong>in</strong>itionen, Benutzungsh<strong>in</strong>weise und nicht zuletzt auch durch die<br />
beigefügten Notationen und Codes spezifiziert. In Indices <strong>in</strong>tegriert können derartige<br />
Informationen verh<strong>in</strong>dern, dass e<strong>in</strong> Benutzer versehentlich das falsche<br />
Schlagwort wählt, weil er mit dem Begriff e<strong>in</strong>e andere Bedeutung verb<strong>in</strong>det.<br />
In Schlagwortregistern können diese Zusatz<strong>in</strong>formationen direkt h<strong>in</strong>ter oder<br />
unter den E<strong>in</strong>zeldeskriptoren stehen, wodurch sie zugleich gut sichtbar wären.<br />
Bei Schlagwortkettenregistern ist es fraglich, <strong>in</strong>wiefern es s<strong>in</strong>nvoll ist, Def<strong>in</strong>itionen,<br />
Benutzungsh<strong>in</strong>weise, Codes und Notationen den Ketten beizufügen;<br />
denn schließlich muss klar herausgestellt werden, auf welches Schlagwort<br />
sich die jeweilige Zusatz<strong>in</strong>formation bezieht. Angesichts der Komplexität der<br />
Ketten ist dies nicht e<strong>in</strong>fach zu realisieren, ohne dass zugleich die Übersicht-<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 633
THEMEN Erschließung<br />
lichkeit der Daten gefährdet und damit ihr Wert für den Benutzer verr<strong>in</strong>gert<br />
wird. Alternativ ist daher e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation von Schlagwort- und Schlagwortkettenregister<br />
denkbar, wo die E<strong>in</strong>zeldeskriptoren e<strong>in</strong>mal mit den entsprechenden<br />
Daten versehen werden und e<strong>in</strong>mal als Glied <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Kette stehen.<br />
Daten könnten auch aus dem eigentlichen Index <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en „Norme<strong>in</strong>trag“ 16 als<br />
e<strong>in</strong>e Form von zweitem Index ausgelagert werden, der vom Primär<strong>in</strong>dex über<br />
e<strong>in</strong>e Hyperl<strong>in</strong>kverknüpfung aufgerufen werden kann. Man muss sich jedoch im<br />
Klaren se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> solches Zusatzregister i.d.R. von Benutzern nicht weiter<br />
beachtet wird, wenn sie im Glauben s<strong>in</strong>d, dass die für sie wichtigen Informationen<br />
bereits im normalen Index vorhanden s<strong>in</strong>d:<br />
„Das pr<strong>in</strong>zipielle Problem ist sicherlich, dass viele Benutzer direkt […] zu Titeln gehen<br />
werden. <strong>Die</strong>s gilt <strong>in</strong>sbesondere für viele sche<strong>in</strong>bar e<strong>in</strong>deutige Begriffe, für die <strong>in</strong> der<br />
SWD trotzdem umfangreiche Bemerkungen notwendig und vorhanden s<strong>in</strong>d.“ 17<br />
Andere Informationen aus dem SWD-Datensatz wie Identifikationsnummer, Indikatoren<br />
oder Quelle können dem Benutzer getrost vorenthalten werden, da sie<br />
für ihn i.d.R. mit ke<strong>in</strong>em Mehrwert verbunden s<strong>in</strong>d: Identifikationsnummern s<strong>in</strong>d<br />
re<strong>in</strong> <strong>in</strong>terne Informationen zur Verwaltung e<strong>in</strong>es Normdatensatzes. Indikatoren<br />
bestimmen zwar e<strong>in</strong> Schlagwort, <strong>in</strong>dem sie ihn e<strong>in</strong>er bestimmten Schlagwortkategorie<br />
zuweisen und daher von anderen unterschieden werden können, aber<br />
sie setzen voraus, dass sich der Benutzer mit Schlagwörtern genauer auskennt,<br />
was im Regelfall nicht zutrifft. Quellen enthalten zwar wichtige H<strong>in</strong>weise auf den<br />
Begriffsumfang e<strong>in</strong>es Schlagworts, aber es wird sich wohl kaum e<strong>in</strong> Benutzer<br />
die Mühe machen, das entsprechende Nachschlagewerk zur Klärung der Begriffsbedeutung<br />
zu konsultieren, zumal er hierfür mit den <strong>in</strong> den Quellenangaben<br />
verwendeten Abkürzungen vertraut se<strong>in</strong> muss.<br />
2.4 <strong>Die</strong> Gestaltung der Indexsuche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Anzahl von untersuchten<br />
Onl<strong>in</strong>e-Katalogen<br />
In den untersuchten <strong>OPACs</strong> wurden weiterführende Angaben aus dem SWD-<br />
Datensatz wie Relationen, Codes, Notationen, Def<strong>in</strong>itionen und Verwendungsh<strong>in</strong>weise<br />
<strong>in</strong> 85% der Schlagwort<strong>in</strong>dices und <strong>in</strong> 12% der Schlagwortketten<strong>in</strong>dices<br />
mit e<strong>in</strong>bezogen.<br />
16 Der Begriff „Norme<strong>in</strong>trag“ bezeichnet hier nicht den SWD-Norme<strong>in</strong>trag, sondern<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>trag mit Daten aus dem Normdatensatz, der vom Register aus angesprochen<br />
werden kann.<br />
17 Sacherschließung <strong>in</strong> Onl<strong>in</strong>e-Katalogen. Hrsg. von Friedrich Geißelmann. Berl<strong>in</strong>:<br />
Deutsches Bibliotheks<strong>in</strong>stitut, 1994. S. 59. Das Zitat bezieht sich eigentlich darauf,<br />
dass Benutzer nicht die SWD nutzen, sondern direkt e<strong>in</strong>e Schlagwortsuche durchführen.<br />
<strong>Die</strong> Aussage trifft jedoch gleichermaßen auf die beschriebene Situation <strong>in</strong><br />
Indices zu.<br />
634 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
Besonders hoch war mit 83% der Anteil der berücksichtigten Synonyme (SY)<br />
<strong>in</strong> Schlagwort<strong>in</strong>dices. In 95% der Fälle konnten Synonyme von den Ansetzungsformen<br />
klar unterschieden werden: entweder waren sie farbig anders<br />
h<strong>in</strong>terlegt als die Ansetzungsformen oder sie führten über e<strong>in</strong>e Siehe-<br />
Verweisung zu den Ansetzungsformen oder sie wurden explizit als „Synonym“<br />
o.ä. bezeichnet. Zur Ansetzungsform äquivalente Schlagwortketten (SWK-SY)<br />
waren <strong>in</strong> 59% der Indices <strong>in</strong>tegriert. Mehrgliedrige Oberbegriffe (MO) fanden<br />
sich <strong>in</strong> 28% der Schlagwort<strong>in</strong>dices, Oberbegriffe (OB) <strong>in</strong> 34%, Unterbegriffe<br />
(UB) <strong>in</strong> 2% und verwandte Begriffe (VB) <strong>in</strong> 35% (vgl. Abb. 4). 18 Oberbegriffe<br />
und verwandte Begriffe konnten weitgehend nur <strong>in</strong> SISIS-<strong>OPACs</strong> und <strong>in</strong><br />
ALEPH-<strong>OPACs</strong> e<strong>in</strong>gesehen werden, Unterbegriffe lediglich <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> der<br />
StB Köln und der SLB Bern. Es gab ke<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zigen OPAC, <strong>in</strong> dem sowohl<br />
Oberbegriffe als auch Unterbegriffe im Index mit angegeben waren.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
SW-Indices<br />
SY<br />
SWK-SY<br />
MO<br />
OB<br />
UB<br />
VB<br />
Abb. 4: Relationen im<br />
Schlagwort<strong>in</strong>dex<br />
In den ALEPH-<strong>OPACs</strong> fanden mehrgliedrige Oberbegriffe nur <strong>in</strong> den so genannten<br />
„Norme<strong>in</strong>trägen“ Erwähnung. Bei diesen Norme<strong>in</strong>trägen handelt es sich um<br />
e<strong>in</strong>e Art von Sekundär<strong>in</strong>dices, zu denen man ausschließlich über die im Index<br />
gespeicherten SWD-Ansetzungsformen gelangt, 19 d.h. um auf e<strong>in</strong>en mehrgliedrigen<br />
Oberbegriff stoßen zu können, muss man den Unterbegriff kennen. <strong>Die</strong><br />
Funktion von mehrgliedrigen Oberbegriffen als Mittel zum Transport von Verweisungen<br />
wird aufgehoben. Mehrgliedrige Oberbegriffe bieten auf diese Weise<br />
18 <strong>Die</strong> Daten <strong>in</strong> den so genannten „Norme<strong>in</strong>trägen“ der ALEPH-<strong>OPACs</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den folgenden<br />
Prozentzahlen mitberücksichtigt. Allerd<strong>in</strong>gs muss darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden,<br />
dass nicht immer geprüft wurde, ob mehrgliedrige Oberbegriffe auch <strong>in</strong> den<br />
Norme<strong>in</strong>trägen zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d.<br />
19 H<strong>in</strong>ter den Ansetzungsformen steht i.d.R. e<strong>in</strong> mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k h<strong>in</strong>terlegter<br />
„[Norme<strong>in</strong>trag]“.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 635
THEMEN Erschließung<br />
ke<strong>in</strong>e zusätzlichen E<strong>in</strong>stiegsmöglichkeiten für den Benutzer und unterstützen ihn<br />
auch nicht bei der Suche nach dem relevanten Schlagwort. <strong>Die</strong> zusätzliche Information,<br />
die diesen Begriffen <strong>in</strong>härent ist, wird für den Benutzer wertlos.<br />
<strong>Die</strong> Norme<strong>in</strong>träge der ALEPH-<strong>OPACs</strong> enthielten neben mehrgliedrigen Oberbegriffen<br />
noch zahlreiche weitere Informationen aus dem SWD-Datensatz, die <strong>in</strong><br />
den <strong>OPACs</strong> anderer Systeme gar nicht zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, wie Codes, Notationen<br />
und Def<strong>in</strong>itionen, und die den Benutzern, die sich nicht den Norme<strong>in</strong>trag anzeigen<br />
lassen, vorenthalten werden. 20 In manchen Onl<strong>in</strong>e-Katalogen gehen die <strong>in</strong><br />
ihnen angegebenen Informationen weit über das h<strong>in</strong>aus, was für Benutzer <strong>in</strong>teressant<br />
se<strong>in</strong> könnte: Im ALEPH-OPAC der Universitätsbibliothek Koblenz-<br />
Landau enthält der Index-Norme<strong>in</strong>trag zu „Deutscher Idealismus“ neben Ländercode,<br />
Zeitcode, Synonym und Oberbegriff auch alle wichtigen Verwaltungs<strong>in</strong>formationen<br />
wie Identifikationsnummer, Korrekturdatum und Austauschdatum<br />
(vgl. Abb. 5).<br />
Abb. 5: Norme<strong>in</strong>trag im<br />
ALEPH-OPAC der<br />
Universitätsbibliothek<br />
Koblenz-Landau<br />
Der E<strong>in</strong>trag wirkt sehr komplex; die für den Benutzer relevanten Informationen<br />
wie Ländercode und Oberbegriff fallen kaum auf, s<strong>in</strong>d sozusagen für den Laien<br />
versteckt. Zudem gibt es ke<strong>in</strong>e weiteren Navigationsmöglichkeiten. Wenn<br />
e<strong>in</strong> Benutzer feststellt, dass er sich eigentlich nicht nur für den deutschen<br />
20 <strong>Die</strong>se Norme<strong>in</strong>träge wurden aus Zeitgründen nicht vollständig überprüft, so dass<br />
hier ke<strong>in</strong>e Angaben darüber gemacht werden können, <strong>in</strong> wie vielen der ALEPH-<br />
<strong>OPACs</strong> Def<strong>in</strong>itionen, Benutzungsh<strong>in</strong>weise usw. mit aufgeführt waren.<br />
636 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
Idealismus <strong>in</strong>teressiert, sondern auch für den Idealismus im Allgeme<strong>in</strong>en, so<br />
kann er sich weder den Indexe<strong>in</strong>trag zu Idealismus direkt anschauen noch<br />
sich Treffer anzeigen lassen, sondern muss hierfür zum Primär<strong>in</strong>dex zurückgehen<br />
und den entsprechenden Suchbegriff <strong>in</strong> die Suchmaske e<strong>in</strong>geben, um<br />
an die entsprechende Indexstelle geführt zu werden. 21 Auf Begriffe, die mit<br />
demselben Ländercode, demselben Zeitcode oder derselben Notation versehen<br />
wurden, kann er gar nicht zugreifen.<br />
In Schlagwortkettenregistern s<strong>in</strong>d zusätzliche Informationen aus dem SWD-<br />
Datensätzen seltener anzutreffen als <strong>in</strong> Schlagwort<strong>in</strong>dices: Synonyme fanden<br />
sich bei 14% der gesichteten <strong>OPACs</strong>, den Ansetzungsformen äquivalente<br />
Schlagwortketten bei 6%. Unterbegriffe waren nur <strong>in</strong> den Schlagwortketten<strong>in</strong>dices<br />
der Stadtbibliothek Köln und der Schweizerischen Landesbibliothek<br />
Bern nachgewiesen, wobei es sich im Fall der Schweizerischen Landesbibliothek<br />
um ke<strong>in</strong>en re<strong>in</strong>en Schlagwortketten<strong>in</strong>dex handelt, 22 sondern um e<strong>in</strong>e<br />
Komb<strong>in</strong>ation von Schlagwort- und Schlagwortketten<strong>in</strong>dex. Verwandte Begriffe<br />
und mehrgliedrige Oberbegriffe waren alle<strong>in</strong> im OPAC der Schweizerischen<br />
Landesbibliothek aufgeführt ebenso wie Def<strong>in</strong>itionen und Benutzungsh<strong>in</strong>weise<br />
<strong>in</strong> Form von Anmerkungen. Codes und Notationen fanden <strong>in</strong> den gesichteten<br />
Schlagwortkettenregistern ke<strong>in</strong>e Erwähnung.<br />
Synonyme und Relationen waren unterschiedlich <strong>in</strong> die Schlagwortketten<strong>in</strong>dices<br />
e<strong>in</strong>gebettet. Häufig waren auch nicht alle Synonyme und Relationen<br />
gleichermaßen berücksichtigt, sondern nur e<strong>in</strong>e Auswahl. 23 <strong>Die</strong> Schlagwortketten<strong>in</strong>dices<br />
im OPAC der Stadtbibliothek Gött<strong>in</strong>gen und der Stadtbücherei<br />
Tüb<strong>in</strong>gen zeichnen sich dadurch aus, dass sich neben den permutierten<br />
Schlagwortketten mit den üblichen Ansetzungsformen zusätzliche Ketten mit<br />
Synonymen – und im Fall der Stadtbücherei Tüb<strong>in</strong>gen auch mit den Ansetzungsformen<br />
äquivalenten Schlagwortketten – bef<strong>in</strong>den, so dass, wer themenspezifische<br />
Literatur zur Bibliothek sucht, diese auch unter „Bücherei“<br />
f<strong>in</strong>det – allerd<strong>in</strong>gs nicht vollständig, wie auch <strong>in</strong> Abb. 6 und 7 erkennbar wird.<br />
21 Unter den gesichteten ALEPH-<strong>OPACs</strong> waren nur wenige, die mittels e<strong>in</strong>es Hyperl<strong>in</strong>ks<br />
e<strong>in</strong>e Weitersuche vom Norme<strong>in</strong>trag erlaubten. Zu ihnen zählt beispielsweise<br />
der Onl<strong>in</strong>e-Katalog der Universitätsbibliothek St. Gallen.<br />
22 Bei der StB Köln wurde nicht extra geprüft, ob die aufgeführten E<strong>in</strong>zelschlagwörter<br />
begriffs- oder gegenstandsbezogen s<strong>in</strong>d, bei der SLB Bern hat sich dies von selbst<br />
ergeben.<br />
23 Da dies nicht gesondert geprüft wurde, können ke<strong>in</strong>e weiteren Aussagen gemacht<br />
werden, wie groß diese Auswahl ist. Im OPAC der StB Gött<strong>in</strong>gen und der StB Tüb<strong>in</strong>gen<br />
schien sie jedoch relativ ger<strong>in</strong>g zu se<strong>in</strong>.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 637
THEMEN Erschließung<br />
Abb. 6: Indexe<strong>in</strong>trag der Stadtbücherei<br />
Tüb<strong>in</strong>gen nach E<strong>in</strong>gabe<br />
des Begriffs „Bücherei“<br />
Abb.7: Indexe<strong>in</strong>trag der Stadtbücherei<br />
Tüb<strong>in</strong>gen nach E<strong>in</strong>gabe<br />
des Begriffs „Bibliothek“<br />
Im Gegensatz dazu s<strong>in</strong>d die Relationen <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> der Stadtbibliothek<br />
Köln und der Schweizerischen Landesbibliothek Bern <strong>in</strong> Form von Verweisungen<br />
dargestellt und relativ unabhängig von den permutierten Schlagwortketten.<br />
Im Index der Stadtbibliothek Köln werden die Relationen vor den eigentlichen<br />
Schlagwortketten direkt unter den im Index mit aufgeführten E<strong>in</strong>zelschlagwörtern<br />
angegeben. Alle Relationen s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k h<strong>in</strong>terlegt,<br />
der den Benutzer zu dem entsprechenden Indexe<strong>in</strong>trägen und Schlagwortketten<br />
führt. Zu großen Treffermengen wird damit vorgebeugt. Allerd<strong>in</strong>gs können<br />
bei e<strong>in</strong>er großen Anzahl von Synonymen und Unterbegriffen diese nicht alle<br />
auf e<strong>in</strong>em Bildschirm abgebildet werden. So ziehen sich beispielsweise die<br />
Verweisungen zu „Ethik“ über zwei Bildschirmseiten; erst am Ende der zweiten<br />
wird die erste Schlagwortkette sichtbar, <strong>in</strong> der „Ethik“ das Anfangskettenglied<br />
darstellt (vgl. Abb. 8a). E<strong>in</strong> eiliger und e<strong>in</strong> mit Aufbau und Inhalt des Index<br />
nicht vertrauter Benutzer wird sich jedoch nicht unbed<strong>in</strong>gt die folgende<br />
Seite auch anzeigen lassen. Er nimmt also die Schlagwortketten nicht wahr;<br />
die Folge s<strong>in</strong>d eventuell zu zahlreiche und zu unpräzise Treffermengen.<br />
Bei der Schweizerischen Landesbibliothek Bern h<strong>in</strong>gegen s<strong>in</strong>d die Relationen<br />
und auch die Def<strong>in</strong>itionen aus dem eigentlichen Index <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Form von Zusatz<strong>in</strong>dex<br />
ausgelagert, der vom Pr<strong>in</strong>zip her dem Norme<strong>in</strong>trag <strong>in</strong> den ALEPH-<br />
<strong>OPACs</strong> gleicht (vgl. Abb. 8b u. c). <strong>Die</strong> Verb<strong>in</strong>dung zum „Sekundär<strong>in</strong>dex“ wird<br />
über e<strong>in</strong> „ “ hergestellt. Ob dem Benutzer gleich die Bedeutung dieses Zeichens<br />
e<strong>in</strong>leuchtet, bleibt fraglich.<br />
638 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
…<br />
a) c)<br />
b)<br />
Abb. 8 a: Zwei Ausschnitte aus dem Index der Stadtbibliothek Köln<br />
b: Ausschnitt aus dem Index der Schweizerischen Landesbibliothek Bern<br />
c: E<strong>in</strong>trag im „Sekundär<strong>in</strong>dex“ der Schweizerischen Landesbibliothek<br />
Der Vorteil dieser Art der Darstellung liegt dar<strong>in</strong>, dass Schlagwortketten selbst<br />
bei E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> den Index mit nur dem ersten Hauptschlagwort auch bei<br />
Schlagwörtern mit e<strong>in</strong>em umfangreichen Begriffsumfeld wie „Ethik“ für den<br />
Benutzer immer sichtbar bleiben und zur Spezifizierung von Themen mit herangezogen<br />
werden können. Allerd<strong>in</strong>gs stellt sich hier das gleiche Problem<br />
wie bei den ALEPH-<strong>OPACs</strong>: wenn e<strong>in</strong> Benutzer statt zu dem Sekundär<strong>in</strong>dex<br />
direkt zu den Titeldaten geht, bleiben ihm wichtige Informationen verborgen.<br />
3. <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>stufige Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche<br />
<strong>Die</strong> e<strong>in</strong>stufige Schlagwortsuche wurde von 96% der untersuchten <strong>OPACs</strong> angeboten<br />
und stellt die von Benutzern am meisten genutzte Form von Schlagwortsuche<br />
dar, zumal sie <strong>in</strong> Onl<strong>in</strong>e-Katalogen häufig exponierter platziert ist<br />
als die Indexsuche. 24 Unter „e<strong>in</strong>stufiger Schlagwortsuche“ wird hier e<strong>in</strong>e<br />
Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche verstanden, die den Benutzer nach<br />
Initiierung des Suchprozesses direkt zu e<strong>in</strong>er Trefferliste führt. In der e<strong>in</strong>stufigen<br />
Schlagwortsuche im engeren S<strong>in</strong>ne kann nach E<strong>in</strong>zelschlagwörtern ge-<br />
24 So ist die vore<strong>in</strong>gestellte Suche <strong>in</strong> PICA- und ALEPH-<strong>OPACs</strong> die e<strong>in</strong>stufige Suche.<br />
Der OPAC der StB Köln ist e<strong>in</strong>er der wenigen Onl<strong>in</strong>e-Kataloge, die dem Benutzer<br />
explizit e<strong>in</strong>e Indexsuche als E<strong>in</strong>stieg anbietet.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 639
THEMEN Erschließung<br />
sucht werden, wobei mehrere Schlagwörter mittels boolescher Operatoren<br />
postkoord<strong>in</strong>ierend mite<strong>in</strong>ander verknüpft werden können. <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>stufige<br />
Schlagwortkettensuche h<strong>in</strong>gegen ermöglicht auch die gezielte Suche nach<br />
präkomb<strong>in</strong>ierten Ketten, birgt jedoch aufgrund der Differenziertheit der Ketten<br />
die Gefahr, dass der Recall des Rechercheergebnisses ger<strong>in</strong>g ist. 25<br />
Beide Recherchetypen setzen differenzierte Vorkenntnisse beim Benutzer<br />
voraus: Um erfolgreich recherchieren zu können, muss er zum e<strong>in</strong>en das<br />
Thema, das Ausgangspunkt für die Recherche ist, bereits spezifiziert haben,<br />
zum anderen mit dem SWD-Vokabular vertraut se<strong>in</strong>. Schlagwortkettensuchen<br />
s<strong>in</strong>d nur dann s<strong>in</strong>nvoll, wenn der Benutzer die für ihn relevanten Ketten kennt.<br />
<strong>Die</strong>s trifft <strong>in</strong> der Praxis relativ selten zu. Angeboten werden sie auch lediglich<br />
<strong>in</strong> 3% der untersuchten <strong>OPACs</strong>, wobei das Angebot dieses Features mit dem<br />
Angebot der Indexsuche mit Schlagwortketten gekoppelt ist. 26 Da die e<strong>in</strong>stufige<br />
Schlagwortkettensuche kaum genutzt wird, wird auf sie im Folgenden nicht<br />
weiter e<strong>in</strong>gegangen.<br />
3.1 Der Nutzen der SWD im Rahmen der e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche<br />
Obwohl die e<strong>in</strong>stufige Schlagwortsuche sich primär für erfahrene Benutzer<br />
eignet, wird sie oft von Benutzern <strong>in</strong> Anspruch genommen, die weder e<strong>in</strong>e genaue<br />
Vorstellung von ihrem Thema noch Kenntnis vom SWD-Vokabular haben.<br />
Für die Gestaltung der Schlagwortsuche und der Trefferanzeigen 27 bedeutet<br />
dies, dass sie auf zwei verschiedene Benutzergruppen zugeschnitten<br />
se<strong>in</strong> müssen. Zusatz<strong>in</strong>formationen aus dem SWD-Datensatz können hier e<strong>in</strong>erseits<br />
zur Erweiterung der Möglichkeiten und der Ergebnisse der postkoord<strong>in</strong>ierenden<br />
Schlagwortsuche beitragen, andererseits als e<strong>in</strong>e wichtige Orientierung<br />
für die Modifizierung von Suchanfragen bei zu ger<strong>in</strong>gen, zu großen<br />
und/oder zu unpräzisen Treffermengen dienen und damit vom Benutzer als<br />
Basis für e<strong>in</strong>e weiterführende Schlagwortsuche herangezogen werden.<br />
25 Bei der Schlagwortkettensuche müssen nicht zw<strong>in</strong>gend Schlagwortketten <strong>in</strong> der für<br />
diese typische Syntax <strong>in</strong> die Suchmaske e<strong>in</strong>gegeben werden. Oft reicht die E<strong>in</strong>gabe<br />
e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>zelschlagworts, um zu Treffern zu gelangen, die dieses Schlagwort als<br />
Glied <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Schlagwortkette aufweisen. In manchen <strong>OPACs</strong> wie beispielsweise im<br />
Onl<strong>in</strong>e-Katalog der Stadtbücherei Rhe<strong>in</strong>e können Schlagwortketten (mit der typischen<br />
Schlagwortkettensyntax) auch <strong>in</strong> das Suchfeld für die Schlagwortsuche e<strong>in</strong>gegeben<br />
werden. Schlagwort- und Schlagwortkettensuche gehen hier direkt <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander<br />
über.<br />
26 Vgl. den OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, der Schleswig-<br />
Holste<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek Kiel und der Universitätsbibliothek Kiel.<br />
27 Geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d hier sowohl die Kurztitelanzeigen als auch die Titelvollanzeigen.<br />
640 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
Durch die Integration von Notationen und Codes als zusätzliche Suchoptionen<br />
bei der e<strong>in</strong>stufigen Suche vermögen die mit diesen Codes und Notationen<br />
vertrauten Benutzer differenziertere und besser auf ihre eigenen Bedürfnisse<br />
zugeschnittene Suchanfragen zu stellen, gerade wenn Schlagwörter wie zum<br />
Beispiel Zeitschlagwörter „<strong>in</strong> ihrer Vielfalt von Wort- und Ziffernbestandteilen<br />
für das Retrieval schlecht geeignet s<strong>in</strong>d“ 28 . Mittels Codes und Notationen lassen<br />
sich die Suchergebnisse auf bestimmte Sprachen, Länder, Zeiträume und<br />
Themengebiete e<strong>in</strong>schränken. <strong>Die</strong>s setzt allerd<strong>in</strong>gs voraus, dass die Codes<br />
und Notationen weitläufig vergeben s<strong>in</strong>d, so dass auch e<strong>in</strong> guter Recall erzielt<br />
werden kann. Wo dies nicht zutrifft wie im Fall der Sprachcodes, der laut<br />
RSWK nur fakultativ und zurzeit „<strong>in</strong> der SWD nur für Werke der Antike angewandt“<br />
29 wird, empfiehlt es sich, diese Option lediglich im Rahmen e<strong>in</strong>er weiterführenden<br />
Suche anzubieten, so dass der Benutzer gar nicht erst die Möglichkeit<br />
erhält, die Suche zu sehr e<strong>in</strong>zuschränken.<br />
Während durch Notationen und Codes die Precision e<strong>in</strong>es Suchergebnisses<br />
gesteuert werden kann, vermag die Integration des SWD-Relationsgefüges <strong>in</strong><br />
den Prozess der e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche den Recall der Treffermengen<br />
zu verbessern. <strong>Die</strong>s gilt <strong>in</strong>sbesondere für die Synonyme und <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem<br />
Maße auch für die mehrgliedrigen Oberbegriffe; denn durch sie werden das<br />
Begriffsspektrum und damit die Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten erweitert.<br />
<strong>Die</strong> Anzahl der Null-Treffermengen wird reduziert. E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter automatischer<br />
E<strong>in</strong>bezug von Oberbegriffen, Unterbegriffen und verwandten Begriffen<br />
empfiehlt sich h<strong>in</strong>gegen nicht; denn bei Begriffen, die mit vielen Titeln<br />
verknüpft s<strong>in</strong>d und zudem über e<strong>in</strong> umfassendes Begriffsumfeld verfügen wie<br />
„Ethik“, kommt es sonst zu sehr großen Treffermengen, die eventuell sogar<br />
nicht angezeigt werden können. Auch bei Schlagwörtern, die selten zur Beschreibung<br />
des Gegenstands e<strong>in</strong>es Dokuments herangezogen werden und <strong>in</strong><br />
der SWD e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Anzahl an Relationen aufweisen, ist die automatische<br />
Integration <strong>in</strong> die Suche nicht ganz unproblematisch: Interessiert sich e<strong>in</strong> Benutzer<br />
beispielsweise für Philosoph<strong>in</strong>nen und gibt im OPAC der Universitäts-<br />
und Landesbibliothek Münster als Suchanfrage „Philosoph<strong>in</strong>“ e<strong>in</strong>, so werden<br />
ihm 130 Titel angezeigt, obwohl im Index steht, dass lediglich 19 Titel mit die-<br />
28 Friedrich Geißelmann und Hans-Joachim Zerbst: Sacherschließung <strong>in</strong> Onl<strong>in</strong>e-<br />
Katalogen: Stand der Diskussion. In: <strong>Die</strong> Herausforderung der Bibliotheken durch<br />
elektronische Medien und neue Organisationsformen. 85. Deutscher Bibliothekartag<br />
<strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen 1995. Hrsg. von Sab<strong>in</strong>e Wefers. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Klostermann, 1996.<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie; 63). S. 193–207. Hier:<br />
S. 198.<br />
29 Regeln für den Schlagwortkatalog: RSWK. Bearb, von d. Expertengruppe RSWK-<br />
SWD. 3., überarb. u. erw. Aufl. <strong>in</strong> der Fassung der 2. Erg.-Lfg. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>;<br />
Leipzig; Berl<strong>in</strong>: <strong>Die</strong> Deutsche Bibliothek, 2002. § 18,3.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 641
THEMEN Erschließung<br />
sem Schlagwort verbunden s<strong>in</strong>d, d.h. es ist e<strong>in</strong> enormer Ballast gegeben. <strong>Die</strong><br />
Differenz zwischen Indexangabe und Treffermenge nach Durchführung e<strong>in</strong>er<br />
e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche ist darauf zurückzuführen, dass im OPAC der<br />
Universitäts- und Landesbibliothek Münster das Verweisungsgefüge der SWD<br />
berücksichtigt wird und daher neben „Philosoph<strong>in</strong>“ zugleich auch nach dem<br />
verwandten Begriff „Philosoph“ gesucht wurde. <strong>Die</strong> Verbesserung des Recalls<br />
führt zu e<strong>in</strong>er erheblichen Verschlechterung der Precision.<br />
Alternativ ist daher e<strong>in</strong> Modell denkbar, <strong>in</strong> dem Oberbegriffe, Unterbegriffe<br />
und verwandte Begriffe „immer dann als Option im Retrieval ersche<strong>in</strong>en, wenn<br />
ke<strong>in</strong> oder nur wenig Treffer erzielt werden.“ 30 Auch im Fall von sehr großen<br />
Treffermengen könnte auf sie verwiesen werden. <strong>Die</strong>s kann mittels e<strong>in</strong>es Zwischentextes<br />
vor der eigentlichen Titelanzeige geschehen, <strong>in</strong> dem die entsprechenden<br />
Relationen aufgeführt s<strong>in</strong>d, was allerd<strong>in</strong>gs den Recherchevorgang<br />
verlängert und von Benutzern teils als lästig empfunden werden könnte. Vielen<br />
Benutzern wäre auch bereits mit e<strong>in</strong>em entsprechenden, mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k<br />
h<strong>in</strong>terlegten kurzen H<strong>in</strong>weis auf e<strong>in</strong>en um Relationen angereicherten Index zu<br />
Beg<strong>in</strong>n der Trefferliste gedient. 31 Als kle<strong>in</strong>er Nebeneffekt könnte damit<br />
zugleich das Bewusstse<strong>in</strong> des Benutzers bezüglich der Bedeutung des Index<br />
gesteigert werden. An dieser exponierten Stelle könnten auch Def<strong>in</strong>itionen<br />
und Benutzungsh<strong>in</strong>weise genannt werden, sofern es sich bei dem e<strong>in</strong>gegebenen<br />
Begriff um e<strong>in</strong> erklärungsbedürftiges Schlagwort handelt. Dem Benutzer<br />
wird, ohne dass es den mit dem SWD-Vokabular vertrauten Benutzer stören<br />
würde, dadurch die besondere Bedeutung des Schlagworts vor Augen geführt;<br />
e<strong>in</strong> erfolgloses Durchsehen der Treffermenge h<strong>in</strong>sichtlich relevanter Titel<br />
würde dem e<strong>in</strong> oder anderen erspart bleiben.<br />
3.2 <strong>Die</strong> Gestaltung der e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche <strong>in</strong> den untersuchten<br />
<strong>OPACs</strong><br />
Weiterführende Angaben aus den SWD-Normdatensätzen waren <strong>in</strong> 80% der<br />
untersuchten e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuchen berücksichtigt. Auffallend ger<strong>in</strong>g<br />
war dabei der Anteil der für die postkoord<strong>in</strong>ierende Suche zur Verfügung stehenden<br />
Codes und SWD-Notationen, was im Fall der Notationen darauf zurückzuführen<br />
ist, dass viele Bibliotheken andere Systematiken verwenden. Auf<br />
den Ländercode konnte lediglich <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> Der Deutschen Bibliothek zu-<br />
30 Elisabeth Niggemann: Tanz um den Katalog. Onl<strong>in</strong>e-Kataloge zwischen Benutzerfreundlichkeit<br />
und Regeltreue. In: Bücher für die Wissenschaft. Bibliotheken zwischen<br />
Tradition und Fortschritt. Festschrift für Günter Gattermann zum 65. Geburtstag.<br />
Hrsg. von Gerd Kaiser <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit He<strong>in</strong>z F<strong>in</strong>ger und Elisabeth Niggemann.<br />
München u.a.: Saur, 1994. S. 527–545. Hier: S. 543.<br />
31 Ähnlich könnte der Benutzer auch auf Homonyme aufmerksam gemacht werden.<br />
642 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
gegriffen werden, auf SWD-Notationen im OPAC Der Deutschen Bibliothek<br />
und der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. Sprachcodes konnten <strong>in</strong><br />
11% der Kataloge recherchiert werden. 32<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
SW-<br />
Suche<br />
ges.<br />
SY OB UB VB<br />
Abb. 9: Relationen <strong>in</strong> der<br />
e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche<br />
Größere Anwendung fanden die <strong>in</strong> der SWD enthaltenen Verweisungen, wobei<br />
sich teils große Unterschiede <strong>in</strong> der Behandlung der e<strong>in</strong>zelnen Relationstypen<br />
erkennen ließen: Synonyme (SY) waren <strong>in</strong> 75% der Schlagwortsuchen mit<br />
e<strong>in</strong>bezogen, Unterbegriffe (UB) <strong>in</strong> 37%, verwandte Begriffe (VB) <strong>in</strong> 27% und<br />
Oberbegriffe (OB) <strong>in</strong> lediglich 6% (vgl. Abb. 9). 33 <strong>Die</strong> Nutzung des SWD-Relationsgefüges<br />
beschränkte sich nahezu ausschließlich auf die automatische<br />
Integration von Relationen, d.h. sowohl das e<strong>in</strong>gegebene Suchwort als auch<br />
se<strong>in</strong>e Verweisungen werden gesucht, wodurch der Recall zum Nachteil der<br />
Precision erhöht wird. 34<br />
In manchen PICA-<strong>OPACs</strong> waren Verweisungen sowie vere<strong>in</strong>zelt auch weitere<br />
Informationen aus den Normdatensätzen wie Indikator, Identifikationsnummer<br />
und Erläuterung zusätzlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Art von Index aufgeführt, der dem Norme<strong>in</strong>trag<br />
<strong>in</strong> den Indexsuchen der ALEPH-<strong>OPACs</strong> ähnelt. Zu den E<strong>in</strong>trägen <strong>in</strong><br />
diesen Zusatz<strong>in</strong>dices gelangt man über die zu Beg<strong>in</strong>n oder am Ende e<strong>in</strong>er<br />
32 <strong>Die</strong> statistischen Angaben beziehen die <strong>in</strong> den „Norme<strong>in</strong>trägen“ der PICA-<strong>OPACs</strong><br />
genannten Relationen mit e<strong>in</strong>. Codes und Notationen, die alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er weiterführenden<br />
Suche zur Verfügung stehen, s<strong>in</strong>d hier nicht berücksichtigt.<br />
33 Inwiefern die e<strong>in</strong>stufige Suche auch mehrgliedrige Oberbegriffe und den Ansetzungsformen<br />
äquivalente Schlagwortketten mit e<strong>in</strong>schließt, wurde aus Zeit-gründen<br />
nicht überprüft.<br />
34 In e<strong>in</strong>igen <strong>OPACs</strong> wurden nicht alle Relationen gleichermaßen mite<strong>in</strong>bezogen: In<br />
den Katalogen der Stadtbibliothek Coburg und der Stadtbücherei Tüb<strong>in</strong>gen werden<br />
Relationen, das s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Fall Synonyme, nur <strong>in</strong>soweit mitgesucht, wie sie<br />
auch im Schlagwortketten<strong>in</strong>dex nachgewiesen s<strong>in</strong>d.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 643
THEMEN Erschließung<br />
Trefferliste aufgeführten Schlagwörter, 35 die den gesuchten Begriffen entsprechen<br />
und anhand e<strong>in</strong>er spezifischen Kennzeichnung von den Titelanzeigen<br />
e<strong>in</strong>deutig unterschieden werden können: Statt e<strong>in</strong>es Buches ist vor den Begriffen<br />
e<strong>in</strong> Pfeil abgebildet. Ob dem Benutzer die Bedeutung dieses Pfeils direkt<br />
e<strong>in</strong>leuchtet, ist fraglich.<br />
<strong>Die</strong> gesuchten Begriffe s<strong>in</strong>d zum e<strong>in</strong>en die Ansetzungsform des vom Benutzer<br />
<strong>in</strong> die Suchmaske e<strong>in</strong>gegebenen Suchbegriffs, zum anderen die parallel mitgesuchten<br />
Relationen, d.h. wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em OPAC wie der Universitätsbibliothek<br />
Kiel, bei der synonyme und verwandte Begriffe automatisch <strong>in</strong> die Suche mite<strong>in</strong>bezogen<br />
werden, nach „Philosoph<strong>in</strong>“ gesucht, so werden zu Beg<strong>in</strong>n der<br />
Trefferliste die Schlagwörter „Philosoph<strong>in</strong>“ und „Philosoph“ aufgeführt (vgl.<br />
Abb. 10), was zur Irritation des Benutzers führen kann; denn erstens hat er<br />
nicht nach „Philosoph<strong>in</strong>“ und „Philosoph“ gesucht, sondern lediglich nach<br />
„Philosoph<strong>in</strong>“ und zweitens ersche<strong>in</strong>t bei Begriffen mit e<strong>in</strong>em größeren Begriffsumfeld<br />
wie „Ethik“ der Beg<strong>in</strong>n der eigentlichen Trefferanzeigen erst auf<br />
e<strong>in</strong>er der folgenden Bildschirmseiten. 36<br />
Abb. 10: Trefferanzeige des <strong>OPACs</strong> der Universitätsbibliothek Kiel<br />
nach E<strong>in</strong>gabe des Schlagworts „Philosoph<strong>in</strong>“<br />
35 Ob die Begriffe am Anfang der Trefferliste stehen oder am Ende, wurde im Rahmen<br />
der Untersuchung nicht gesondert notiert, so dass hier auch diesbezüglich ke<strong>in</strong>e<br />
genaueren Aussage gemacht werden können.<br />
36 In der Universitätsbibliothek Kiel beg<strong>in</strong>nt die Trefferanzeige ab dem 15. Treffer und<br />
wird erst auf der zweiten Bildschirmseite sichtbar. 14 Treffer beziehen sich auf<br />
Schlagwörter oder Systemstellen (aber nicht Systemstellen der SWD-Notation!). In<br />
den PICA-<strong>OPACs</strong>, <strong>in</strong> denen der E<strong>in</strong>trag am Ende der Liste steht, stellt sich das<br />
Problem, dass dieser vom Benutzer gar nicht wahrgenommen wird.<br />
644 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
Im vorliegenden Beispiel stellt sich als e<strong>in</strong> weiteres Problem, dass e<strong>in</strong><br />
Schlagwort („Philosoph<strong>in</strong>“) gleich dreimal aufgeführt ist. Beim Blick auf die<br />
Norme<strong>in</strong>träge zeigt sich, dass diese <strong>in</strong> zwei Fällen identisch s<strong>in</strong>d (vgl. Abb.<br />
11a u. b) und vom Inhalt her nicht über das Schlagwort an sich h<strong>in</strong>ausgehen.<br />
Erst der dritte Treffer (vgl. Abb. 11c) enthält die Verweisung. Der Norme<strong>in</strong>trag<br />
ist nicht mit Hyperl<strong>in</strong>ks h<strong>in</strong>terlegt, so dass e<strong>in</strong>e Weitersuche von diesem E<strong>in</strong>trag<br />
aus nicht möglich ist.<br />
a) b) c)<br />
Abb. 11a–c: „Norme<strong>in</strong>träge“ zu Treffer 1–3 („Philosoph<strong>in</strong>“)<br />
im OPAC der Universitätsbibliothek Kiel<br />
Dass der Inhalt des Norme<strong>in</strong>trags im Verhältnis zur Trefferanzeige ke<strong>in</strong>e Zusatz<strong>in</strong>formationen<br />
enthält und damit ke<strong>in</strong>en Mehrwert darstellt, ist fallspezifisch.<br />
Häufig gehen die <strong>in</strong> den Zusatz<strong>in</strong>dices genannten Informationen über die auf der<br />
Seite der Trefferanzeige genannten h<strong>in</strong>aus und können damit als Hilfe für e<strong>in</strong>e<br />
weiterführende Suche genommen werden. So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Norme<strong>in</strong>trägen der<br />
Universitätsbibliothek Kiel neben Synonymen und verwandten Begriffen teils<br />
auch Oberbegriffe erwähnt, so dass sich der Blick <strong>in</strong> den Norme<strong>in</strong>trag durchaus<br />
lohnt. Das vorliegende Beispiel zeigt jedoch sehr deutlich, dass das System<br />
technisch noch längst nicht ausgereift ist. Den Benutzer unterstützt es nur sehr<br />
e<strong>in</strong>geschränkt auf der Suche nach der für ihn relevanten Literatur, die Schlagwörter<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Fremdkörper unter den Trefferanzeigen, werden aber formal zu<br />
den Treffern gezählt, <strong>in</strong>dem sie auch mit durchnummeriert s<strong>in</strong>d (vgl. Abb. 10).<br />
4. <strong>Die</strong> weiterführende Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuche<br />
Weiterführende Schlagwortsuchen bauen auf vorhergehenden Recherchen<br />
auf und dienen der Modifizierung von Suchanfragen zum Zwecke der Verbesserung<br />
von Recall und Precision, sei es <strong>in</strong> Form von Spezifizierungen oder <strong>in</strong><br />
Form von neuen Suchen. Sie unterscheiden sich von den bisher beschriebenen<br />
Suchfeatures vor allem dadurch, dass sie von e<strong>in</strong>er Treffer- und/oder e<strong>in</strong>er<br />
Titelvollanzeige aus <strong>in</strong>itiiert werden. E<strong>in</strong> Zurückgehen auf die ursprüngliche<br />
Suchmaske ist nicht notwendig, vorhandene Rechercheergebnisse können<br />
genutzt werden.<br />
Weiterführenden Schlagwortsuchen waren <strong>in</strong> 95% der untersuchten <strong>OPACs</strong><br />
<strong>in</strong>tegriert. In den Onl<strong>in</strong>e-Katalogen der Universitätsbibliothek Duisburg, der<br />
Universitätsbibliothek Essen und der Universitätsbibliothek Hagen stellen sie<br />
die e<strong>in</strong>zige Möglichkeit dar, auch thematisch unter Rückgriff auf Schlagwörter<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 645
THEMEN Erschließung<br />
zu suchen, da auf der E<strong>in</strong>gangsseite dieser <strong>OPACs</strong> ke<strong>in</strong>e Suchmasken für<br />
Schlagwortsuchen bereitstehen. 37 In den OLIX-<strong>OPACs</strong> fehlte diese Option.<br />
4.1 <strong>Die</strong> Typen der weiterführenden Schlagwortsuche und der Nutzen<br />
der SWD im Rahmen dieser Suchfeatures<br />
<strong>Die</strong> weiterführende Schlagwortsuche gleicht teils vom Pr<strong>in</strong>zip her e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>stufigen,<br />
postkoord<strong>in</strong>ierenden Schlagwortsuche, bei der der vorhergehende Suchbegriff<br />
mittels boolescher Operatoren mit anderen Schlagwörtern, mit Notationen<br />
oder Codes komb<strong>in</strong>iert und dadurch – je nachdem, welcher der booleschen<br />
Operatoren verwendet wird – der Recall oder die Precision des Rechercheergebnis<br />
verbessert werden kann. Informationen aus den SWD-Datensätzen können<br />
hier die gleichen Funktionen übernehmen wie bei der e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche:<br />
Mittels Notationen und Codes können präzisere Suchanfragen gestellt,<br />
durch E<strong>in</strong>bezug von Synonymen kann die Anzahl der Null-Treffermengen<br />
verr<strong>in</strong>gert und durch Verweise auf Relationen können Anregungen für Anschlussrecherchen<br />
gegeben werden.<br />
<strong>Die</strong> weiterführende Schlagwortsuche von der Titelvollanzeige aus ist häufig e<strong>in</strong>e<br />
L<strong>in</strong>ksuche, die auf den <strong>in</strong> der Titelvollanzeige genannten Daten aufbaut und naturgemäß<br />
ke<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ationen mit Notationen, Codes oder Schlagwörtern zulässt.<br />
Bei der L<strong>in</strong>ksuche <strong>in</strong> ihrer e<strong>in</strong>fachsten Form s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong> der Titelvollanzeige<br />
angeführten E<strong>in</strong>zelschlagwörter bzw. Schlagwortketten mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k h<strong>in</strong>terlegt,<br />
bei dessen Aktivierung dem Benutzer direkt e<strong>in</strong>e Trefferanzeige angezeigt<br />
wird, die alle Titel enthält, die mit dem entsprechenden Schlagwort bzw.<br />
der entsprechenden Schlagwortkette erschlossen wurden. Der Benutzer ist damit<br />
auf e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Anzahl von Begriffen festgelegt; im schlimmsten Fall gehen<br />
die Schlagwörter nicht weit über das h<strong>in</strong>aus, was der Benutzer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Primärsuche<br />
e<strong>in</strong>gegeben hat. Recall und Precision der erzielten Treffermengen gleichen<br />
denen e<strong>in</strong>er Indexsuche. Im Fall der L<strong>in</strong>ksuche über e<strong>in</strong> Schlagwort kann<br />
es an der Precision, im Fall der L<strong>in</strong>ksuche über e<strong>in</strong>e Schlagwortkette am Recall<br />
mangeln. Informationen aus dem SWD-Datensatz können bei der L<strong>in</strong>ksuche nur<br />
schwer e<strong>in</strong>gebracht werden, zumal sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Titelvollanzeige e<strong>in</strong> Fremdkörper<br />
wären. Denkbar wäre, auf Relationen zu Beg<strong>in</strong>n der Treffermenge zu verweisen.<br />
Statt direkt zu Treffern kann e<strong>in</strong>e L<strong>in</strong>ksuche den Benutzer auch <strong>in</strong> den Index<br />
führen, 38 wodurch differenziertere Suchmöglichkeiten gegeben s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> Effek-<br />
37 <strong>Die</strong> Möglichkeit zur weiterführenden Schlagwortsuche ist <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> der Universitätsbibliothek<br />
Duisburg und der Universitätsbibliothek Hagen lediglich von der<br />
Titelvollanzeige aus gegeben. Der OPAC der Universitätsbibliothek Essen bietet<br />
auch e<strong>in</strong>e weiterführende Schlagwortsuche von der Trefferanzeige aus an.<br />
38 So ist beispielsweise die L<strong>in</strong>ksuche bei der Schweizerischen Landesbibliothek gestaltet.<br />
646 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
tivität e<strong>in</strong>er solchen Suche hängt von der Qualität des Index ab, die, wie bereits<br />
im Rahmen der Indexsuche gezeigt wurde, durch e<strong>in</strong>e Integration von<br />
weiteren SWD-Komponenten neben den Ansetzungsformen ungeme<strong>in</strong> gesteigert<br />
werden kann.<br />
E<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation der beiden genannten L<strong>in</strong>ksuchen f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> vielen<br />
ALEPH-<strong>OPACs</strong>: Der Benutzer wird über den e<strong>in</strong>em Schlagwort h<strong>in</strong>terlegten<br />
Hyperl<strong>in</strong>k nicht direkt zu e<strong>in</strong>er Trefferliste oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Index geführt, sondern<br />
zu e<strong>in</strong>em Zwischentext, wo er zwischen verschiedenen Arten der weiterführenden<br />
Schlagwortsuche wählen kann. 39 So ersche<strong>in</strong>t beispielsweise im OPAC<br />
der Universitätsbibliothek Duisburg nach Aktivierung des mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k<br />
h<strong>in</strong>terlegten Schlagworts „Ethik“ e<strong>in</strong> Fenster, durch das der Benutzer entscheiden<br />
kann, ob er e<strong>in</strong>e weiterführende e<strong>in</strong>stufige Schlagwortsuche mit „Ethik“<br />
durchführen möchte, die der e<strong>in</strong>fachen L<strong>in</strong>ksuche entspricht und hier mit<br />
„andere Dokumente <strong>in</strong> der Datenbank f<strong>in</strong>den“ umschrieben wird, ob er im Index<br />
oder im Norme<strong>in</strong>trag – letzterer ist hier mit „Service aut“ 40 bezeichnet –<br />
suchen möchte oder ob er se<strong>in</strong>e Suche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Suchmasch<strong>in</strong>e fortsetzen<br />
möchte (vgl. Abb. 12). Der Verweis auf die Verwendung e<strong>in</strong>er Suchmasch<strong>in</strong>e<br />
ist <strong>in</strong>des nicht unproblematisch, da damit der Rahmen des <strong>OPACs</strong> verlassen<br />
und die Schlagwörter zu re<strong>in</strong>en Stichwörtern werden.<br />
Abb. 12: Suchmöglichkeiten bei<br />
L<strong>in</strong>ksuche im OPAC<br />
der Universitätsbibliothek Duisburg<br />
39 In manchen ALEPH-<strong>OPACs</strong> wie zum Beispiel im OPAC der Universitätsbibliothek<br />
Hagen wird auf dem bei der L<strong>in</strong>ksuche zwischen Titelvollanzeige und Trefferliste geschalteten<br />
Bildschirm lediglich e<strong>in</strong>e Option angeboten: <strong>Die</strong> weiterführende Suche im<br />
Schlagwort<strong>in</strong>dex, was <strong>in</strong> diesem konkreten Fall den Suchvorgang unnötig verlängert.<br />
40 Ob e<strong>in</strong> Benutzer mit dem Begriff „Service aut“ sofort e<strong>in</strong>e Form von Norme<strong>in</strong>trag<br />
verb<strong>in</strong>det, ist fraglich.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 647
THEMEN Erschließung<br />
E<strong>in</strong>e weitere, elaboriertere Form der L<strong>in</strong>ksuche bietet der Onl<strong>in</strong>e-Katalog der<br />
Stadt- und Landesbibliothek Wien. Hier führt die Verl<strong>in</strong>kung der Schlagwortkette<br />
41 wie bei der Universitätsbibliothek Duisburg zu e<strong>in</strong>em Zwischentext.<br />
<strong>Die</strong>ser be<strong>in</strong>haltet jedoch nicht spezielle Suchfeatures, sondern die <strong>in</strong> der Kette<br />
verwendeten E<strong>in</strong>zelschlagwörter samt Indikator, Notation und Anzeige der<br />
Treffermenge (vgl. Abb. 13). <strong>Die</strong> Schlagwörter werden spezifiziert, der Benutzer<br />
über den zu erwartenden Recall <strong>in</strong>formiert, wobei ihm die Option offen<br />
bleibt, e<strong>in</strong>e ganz neue Suche durchzuführen.<br />
Abb. 13: Suchergebnisse nach Aktivierung des Hyperl<strong>in</strong>ks h<strong>in</strong>ter<br />
„s.Ethik; s.Kulturphilosophie“ im OPAC<br />
der Stadt- und Landesbibliothek Wien<br />
Lässt er sich die „Suchergebnisse“ anzeigen, wird er zu e<strong>in</strong>em differenzierten<br />
„Norme<strong>in</strong>trag“ 42 weitergeleitet, der neben der Notation auch Def<strong>in</strong>itionen,<br />
Quellen und Benutzungsh<strong>in</strong>weise <strong>in</strong> Form von Erläuterungen enthält sowie<br />
äquivalente, verwandte und Unterbegriffe (vgl. Abb. 14). <strong>Die</strong> Unterbegriffe f<strong>in</strong>den<br />
nicht explizit Erwähnung; auf sie kann jedoch über e<strong>in</strong>en Hyperl<strong>in</strong>k zugegriffen<br />
werden. <strong>Die</strong>s hat angesichts der Vielzahl von Unterbegriffen bei Ethik<br />
den Vorteil, dass alle Daten gut sichtbar auf e<strong>in</strong>en Bildschirm passen. Nach<br />
den Unterbegriffen kann auch gleich recherchiert werden; e<strong>in</strong>e Weitersuche<br />
mit den verwandten Begriffen ist <strong>in</strong>des nicht möglich. Der OPAC der Stadt-<br />
und Landesbibliothek Wien präsentiert e<strong>in</strong> vorzügliches Beispiel dafür, wie die<br />
Daten aus der SWD bei der L<strong>in</strong>ksuche zur Benutzerführung genutzt werden<br />
können. Unter den 111 untersuchten <strong>OPACs</strong> war er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Art e<strong>in</strong>malig.<br />
41 Bei der StB Wien ist statt des E<strong>in</strong>zelschlagworts oder der Schlagwortkette e<strong>in</strong> h<strong>in</strong>ter<br />
der Schlagwortkette sichtbarer Pfeil mit e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k h<strong>in</strong>terlegt. Da diese Form<br />
der Verl<strong>in</strong>kung nicht weit verbreitet ist, kann dies dazu führen, dass der Benutzer<br />
leicht die damit gegebene Möglichkeit der Weitersuche übersieht.<br />
42 Mit „Norme<strong>in</strong>trag“ ist hier e<strong>in</strong>e Auflistung von Daten aus dem SWD-Normdatensatz<br />
geme<strong>in</strong>t, ohne dass diese Vollständigkeit aufweisen müssen.<br />
648 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
4.2 <strong>Die</strong> Gestaltung der weiterführenden Schlagwortsuche <strong>in</strong><br />
den untersuchten <strong>OPACs</strong><br />
Abb. 14: „Norme<strong>in</strong>trag“<br />
zu Ethik im Rahmen der<br />
L<strong>in</strong>ksuche im OPAC<br />
der Stadt- und<br />
Landesbibliothek Wien<br />
<strong>Die</strong> weiterführenden Schlagwortsuchen <strong>in</strong> den gesichteten Onl<strong>in</strong>e-Katalogen<br />
konzentrierten sich auf weiterführende Schlagwort- bzw. Schlagwortkettensuchen<br />
ohne E<strong>in</strong>bezug sonstiger Zusatz<strong>in</strong>formationen aus den SWD-Normdatensätzen.<br />
Notationen, Erläuterungen und Relationen waren – abgesehen<br />
von dem OPAC der Stadtbibliothek Wien und den <strong>OPACs</strong>, <strong>in</strong> denen die L<strong>in</strong>ksuche<br />
direkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Indexsuche übergeht – lediglich <strong>in</strong> PICA-<strong>OPACs</strong> 43 <strong>in</strong> Form<br />
von Norme<strong>in</strong>trägen berücksichtigt, zu denen man nach e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen L<strong>in</strong>ksuche<br />
durch die zu Beg<strong>in</strong>n oder am Ende der Trefferliste erwähnten und mit<br />
e<strong>in</strong>em Hyperl<strong>in</strong>k h<strong>in</strong>terlegten Schlagwörtern gelangt. Codes konnten im Rahmen<br />
von postkoord<strong>in</strong>ierenden Suchen nur von 5% der <strong>OPACs</strong> genutzt werden,<br />
Notationen nur <strong>in</strong> den <strong>OPACs</strong> Der Deutschen Bibliothek.<br />
Weiterführende postkoord<strong>in</strong>ierende Schlagwortsuchen waren <strong>in</strong> 50% der Onl<strong>in</strong>e-Kataloge<br />
möglich, wobei im Onl<strong>in</strong>e-Katalog der Schleswig-Holste<strong>in</strong>ischen<br />
Landesbibliothek Kiel und der Universitätsbibliothek Kiel sogar Schlagwortketten<br />
mit <strong>in</strong> die Suche e<strong>in</strong>bezogen werden konnten. <strong>Die</strong> Verwendung von<br />
booleschen Operatoren war <strong>in</strong> den LIBERO-<strong>OPACs</strong> e<strong>in</strong>geschränkt. In ALEPH-<br />
43 Auffallend ist, dass mit 434 der PICA-<strong>OPACs</strong> die Anzahl der PICA-<strong>OPACs</strong>, die e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> Norme<strong>in</strong>träge nach der L<strong>in</strong>ksuche erlaubten, höher ist als die, die e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> Norme<strong>in</strong>träge nach e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>stufigen Schlagwortsuche ermöglichten<br />
(13%). In ke<strong>in</strong>em PICA-OPAC wurden beide Optionen angeboten.<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 649
THEMEN Erschließung<br />
<strong>OPACs</strong> war diese Suchoption nur von der Trefferanzeige und nicht von der<br />
Titelvollanzeige aus gegeben, <strong>in</strong> OLIX-<strong>OPACs</strong> und BIBER-<strong>OPACs</strong> fehlte sie<br />
ganz.<br />
L<strong>in</strong>ksuchen wiesen h<strong>in</strong>gegen 87% der <strong>OPACs</strong> auf. L<strong>in</strong>ksuchen mit E<strong>in</strong>zelschlagwörtern<br />
wurden von 78% angeboten, mit Schlagwortketten von 16%.<br />
Weiterführende Schlagwortkettensuchen waren <strong>in</strong>sbesondere bei Stadtbibliotheken<br />
vorzuf<strong>in</strong>den, die das Bibliothekssystem BOND oder BIBER nutzen. Der<br />
Onl<strong>in</strong>e-Katalog des Bibliotheksverbunds Bayern zeichnet sich vor den anderen<br />
dadurch aus, dass die Schlagwortkette, statt direkt zu Treffern zu führen,<br />
<strong>in</strong> die Suchmaske der Standardsuche übernommen wird, so dass zum e<strong>in</strong>en<br />
komb<strong>in</strong>ierte Suchen möglich s<strong>in</strong>d, zum anderen an der Schlagwortkette auch<br />
Veränderungen vorgenommen werden können, <strong>in</strong>dem man beispielsweise<br />
statt e<strong>in</strong>er viergliedrigen Schlagwortkette nur Ketten sucht, die die ersten beiden<br />
Glieder aufweist. Der Recall kann dadurch eventuell verbessert werden.<br />
L<strong>in</strong>ksuchen, die <strong>in</strong> Indexsuchen übergehen, f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> 22% der <strong>OPACs</strong><br />
(88% der ALEPH-<strong>OPACs</strong>), e<strong>in</strong>e direkte Ansicht der Normdatene<strong>in</strong>träge über<br />
die L<strong>in</strong>ksuche wird <strong>in</strong> 15% (63% der ALEPH-<strong>OPACs</strong>) ermöglicht. Auf Suchmasch<strong>in</strong>en<br />
verweisen 29% der ALEPH-<strong>OPACs</strong>.<br />
5. Zusammenfassung<br />
<strong>Die</strong> dargelegten Ausführungen haben gezeigt, dass die <strong>Schlagwortrecherche</strong>n<br />
<strong>in</strong> den bibliothekarischen <strong>OPACs</strong> sehr unterschiedlich gestaltet s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> <strong>in</strong><br />
der SWD enthaltenen Codes, Notationen und Relationen haben bisher nur<br />
wenig E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die bibliothekarischen Onl<strong>in</strong>e-Kataloge gefunden. Unter 111<br />
<strong>OPACs</strong> fand sich ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger, der das gesamte SWD-Datenmaterial zur Verbesserung<br />
des Retrievals e<strong>in</strong>setzte. Am meisten wurden noch Synonyme und<br />
<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße auch hierarchische und assoziative Relationen zur Optimierung<br />
des Recalls genutzt. Recherchen unter Rückgriff auf Notationen und<br />
Codes waren nur vere<strong>in</strong>zelt möglich. Wünschenswert wäre e<strong>in</strong>e stärkere Vere<strong>in</strong>heitlichung<br />
der Schlagwortfeatures unter E<strong>in</strong>satz der mit der SWD gegebenen<br />
Optimierungsmöglichkeiten.<br />
Anhang<br />
Liste der untersuchten <strong>OPACs</strong><br />
OPAC der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe<br />
OPAC der Bayerischen Staatsbibliothek München<br />
OPAC der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
OPAC der Deutschen Bibliothek Leipzig<br />
OPAC der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden<br />
650 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
OPAC der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda<br />
OPAC der Humboldt-Universität Berl<strong>in</strong><br />
OPAC der Landesbibliothek Coburg<br />
OPAC der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Schwer<strong>in</strong><br />
OPAC der Lippischen Landesbibliothek Detmold<br />
OPAC der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover<br />
OPAC der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Gött<strong>in</strong>gen<br />
OPAC der Österreichischen Nationalbibliothek<br />
OPAC der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer<br />
OPAC der Rhe<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek Koblenz<br />
OPAC der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken<br />
OPAC der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden<br />
OPAC der Schleswig-Holste<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek Kiel<br />
OPAC der Schweizerischen Landesbibliothek Bern<br />
OPAC der Stadtbücherei Bamberg<br />
OPAC der Stadtbücherei Bochum<br />
OPAC der Stadtbücherei Bonn<br />
OPAC der Stadtbibliothek Bremen<br />
OPAC der Stadtbibliothek Coburg<br />
OPAC der Stadtbibliothek Darmstadt<br />
OPAC der Stadtbücherei Düren<br />
OPAC der Stadtbibliothek Emsdetten<br />
OPAC der Stadtbücherei Gelsenkirchen<br />
OPAC der Stadtbibliothek Gött<strong>in</strong>gen<br />
OPAC der Stadtbibliothek Köln<br />
OPAC der Stadtbibliothek Leipzig<br />
OPAC der Stadtbibliothek Magdeburg<br />
OPAC der Stadtbibliothek Ma<strong>in</strong>z<br />
OPAC der Stadtbücherei Münster<br />
OPAC der Stadtbücherei Rhe<strong>in</strong>e<br />
OPAC der Stadtbücherei Stuttgart<br />
OPAC der Stadtbücherei Tüb<strong>in</strong>gen<br />
OPAC der Stadtbücherei Würzburg<br />
OPAC der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund<br />
OPAC der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam<br />
OPAC der Stadt- und Landesbibliothek Wien<br />
OPAC der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen<br />
OPAC der Thür<strong>in</strong>ger Universitäts- und Landesbibliothek Jena<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Augsburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Bayreuth<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Bielefeld<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Braunschweig<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 651
THEMEN Erschließung<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Chemnitz<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Cottbus<br />
OPAC der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berl<strong>in</strong><br />
OPAC der Universitätsbibliothek Dortmund<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Duisburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Erfurt<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Essen<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Frankfurt/Oder<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Frankfurt/Ma<strong>in</strong> (Lokalsystem Frankfurt)<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Freiburg <strong>in</strong> Breisgau<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Graz<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Greifswald<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Hagen<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Heidelberg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Hildesheim<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Ilmenau<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Innsbruck<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Kaiserslautern<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Karlsruhe<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Kassel<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Kiel<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Klagenfurt<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Koblenz-Landau<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Konstanz<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Leipzig<br />
OPAC der Universitätsbibliothek L<strong>in</strong>z<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Lüneburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Magdeburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Ma<strong>in</strong>z<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Mannheim<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Marburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek München<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Oldenburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Osnabrück<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Paderborn<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Passau / Staatsbibliothek Passau<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Potsdam<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Regensburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Rostock<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Siegen<br />
652 BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5
Erschließung THEMEN<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Salzburg<br />
OPAC der Universitätsbibliothek St. Gallen<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Stuttgart<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Trier<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Tüb<strong>in</strong>gen<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Weimar<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Wien<br />
OPAC der Universitätsbibliothek Würzburg<br />
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn<br />
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt<br />
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf<br />
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Münster<br />
OPAC der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle<br />
OPAC der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln<br />
OPAC der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart<br />
OPAC der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern<br />
OPAC des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB)<br />
OPAC des Geme<strong>in</strong>samen Bibliothekenverbunds der Länder Bremen, Hamburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />
und Thür<strong>in</strong>gen (GBV)<br />
OPAC des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(HBZ)<br />
OPAC des Hessischen Bibliotheks-Informationssystems (HEBIS)<br />
OPAC des Kooperativen Bibliotheksverbunds Berl<strong>in</strong>-Brandenburg (KOBV)<br />
OPAC des Österreichischen Bibliothekverbunds (Gesamtkatalog)<br />
OPAC des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds (SWB)<br />
BIBLIOTHEKSDIENST 39. Jg. (2005), H. 5 653