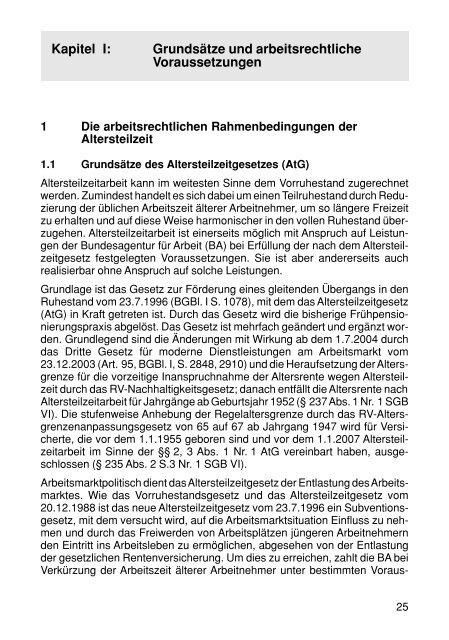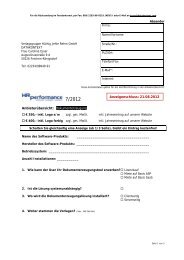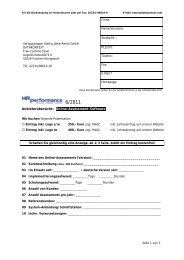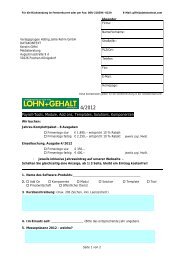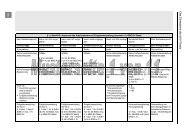Kapitel I: Grundsätze und arbeitsrechtliche ... - DATAKONTEXT
Kapitel I: Grundsätze und arbeitsrechtliche ... - DATAKONTEXT
Kapitel I: Grundsätze und arbeitsrechtliche ... - DATAKONTEXT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 25<br />
<strong>Kapitel</strong> I: <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> <strong>und</strong> <strong>arbeitsrechtliche</strong><br />
Voraussetzungen<br />
1 Die <strong>arbeitsrechtliche</strong>n Rahmenbedingungen der<br />
Altersteilzeit<br />
1.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> des Altersteilzeitgesetzes (AtG)<br />
Altersteilzeitarbeit kann im weitesten Sinne dem Vorruhestand zugerechnet<br />
werden. Zumindest handelt es sich dabei um einen Teilruhestand durch Reduzierung<br />
der üblichen Arbeitszeit älterer Arbeitnehmer, um so längere Freizeit<br />
zu erhalten <strong>und</strong> auf diese Weise harmonischer in den vollen Ruhe stand überzugehen.<br />
Altersteilzeitarbeit ist einerseits möglich mit Anspruch auf Leistungen<br />
der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit (BA) bei Erfüllung der nach dem Altersteilzeitgesetz<br />
festgelegten Voraussetzungen. Sie ist aber andererseits auch<br />
realisierbar ohne Anspruch auf solche Leistungen.<br />
Gr<strong>und</strong>lage ist das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den<br />
Ruhestand vom 23.7.1996 (BGBl. I S. 1078), mit dem das Altersteilzeitgesetz<br />
(AtG) in Kraft getreten ist. Durch das Gesetz wird die bisherige Frühpensionierungspraxis<br />
abgelöst. Das Gesetz ist mehrfach geändert <strong>und</strong> ergänzt worden.<br />
Gr<strong>und</strong>legend sind die Änderungen mit Wirkung ab dem 1.7.2004 durch<br />
das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom<br />
23.12.2003 (Art. 95, BGBl. I, S. 2848, 2910) <strong>und</strong> die Heraufsetzung der Altersgrenze<br />
für die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente wegen Altersteilzeit<br />
durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz; danach entfällt die Altersrente nach<br />
Altersteilzeitarbeit für Jahrgänge ab Geburtsjahr 1952 (§ 237 Abs. 1 Nr. 1 SGB<br />
VI). Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz<br />
von 65 auf 67 ab Jahrgang 1947 wird für Versicherte,<br />
die vor dem 1.1.1955 geboren sind <strong>und</strong> vor dem 1.1.2007 Altersteilzeitarbeit<br />
im Sinne der §§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 AtG vereinbart haben, ausgeschlossen<br />
(§ 235 Abs. 2 S.3 Nr. 1 SGB VI).<br />
Arbeitsmarktpolitisch dient das Altersteilzeitgesetz der Entlastung des Arbeitsmarktes.<br />
Wie das Vorruhestandsgesetz <strong>und</strong> das Altersteilzeitgesetz vom<br />
20.12.1988 ist das neue Altersteilzeitgesetz vom 23.7.1996 ein Subventionsgesetz,<br />
mit dem versucht wird, auf die Arbeitsmarktsituation Einfluss zu nehmen<br />
<strong>und</strong> durch das Freiwerden von Arbeitsplätzen jüngeren Arbeitnehmern<br />
den Eintritt ins Arbeitsleben zu ermöglichen, abgesehen von der Entlastung<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung. Um dies zu erreichen, zahlt die BA bei<br />
Verkürzung der Arbeitszeit älterer Arbeitnehmer unter bestimmten Voraus-<br />
25
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 26<br />
setzungen (Ersatzeinstellung) Zuschüsse zu dem Arbeitsentgelt <strong>und</strong> zu den<br />
zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträgen, die der Arbeitgeber aufgr<strong>und</strong><br />
eines Tarifvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder einer Einzelvereinbarung<br />
erbringt. Wesentlich ist, dass der ältere Arbeitnehmer mit Beendigung des<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses direkt in die vorgezogene Altersrente gehen<br />
kann. Aus Sicht des älteren Arbeitnehmers liegt bei Inanspruchnahme des<br />
Gesetzes zwar im gewissen Umfange Vorruhestand vor, das Arbeitsverhältnis<br />
bleibt jedoch im Gegensatz zu anderen Vorruhestandsmodellen mit Zahlung<br />
einer Abfindung oder eines Überbrückungsgeldes noch längere Zeit<br />
befristet bestehen. Die üblichen Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer bleiben gr<strong>und</strong>sätzlich für die Dauer des befristeten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
unberührt.<br />
Altersteilzeitarbeit wird stets durch einen zwischen Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
abgeschlossenen Altersteilzeitarbeitsvertrag vereinbart. Durch den<br />
Vertrag wird das bisherige Arbeitsverhältnis in ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis<br />
geändert. Die Vertragsfreiheit ist jedoch in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt.<br />
Bei der Vereinbarung sind die Vorgaben aus dem AtG zu beachten.<br />
Arbeits-, Arbeitsförderungs- <strong>und</strong> Rentenrecht stehen in einem engen<br />
Zusammenhang. Missachten die Vertragsparteien die Vorgaben des AtG, ist<br />
die Altersteilzeitvereinbarung fehlerhaft. Vereinbaren die Vertragsparteien<br />
keine Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG, führt das dazu, dass auch die Voraussetzungen<br />
für die Förderung der Altersteilzeitarbeit durch die BA nicht<br />
erfüllt sind <strong>und</strong> dem Arbeitnehmer deswegen nach Beendigung der Altersteilzeitarbeit<br />
die vorgezogene Altersrente nach Altersteilzeitarbeit verweigert wird.<br />
Auch die steuerlichen Vorteile können entfallen.<br />
1.2 Geltungsdauer des AtG – Altersteilzeit nach dem 31.12.2009<br />
Das AtG gilt für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die nach dem 14.2.1996<br />
begonnen worden sind. Förderleistungen der BA werden nur erbracht, wenn<br />
die Arbeitszeit ab Vollendung des 55. Lebensjahres spätestens ab 31.12.2009<br />
vermindert <strong>und</strong> damit die Einstellung eines sonst arbeitslosen Arbeitnehmers,<br />
eines Ausgebildeten oder, bei Betrieben mit nicht mehr als 50 Beschäftigten,<br />
die Einstellung eines Auszubildenden ermöglicht wird (§§ 1 Abs. 2 AtG).<br />
Für die Zeit ab 1.1.2010 sind damit Leistungen der BA nur noch zu erbringen,<br />
wenn die Voraussetzungen des § 2 <strong>und</strong> des § 3 Abs. 1 Nr. 2 AtG (für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse,<br />
die ab 1.7.2004 beginnen, nur noch: des § 2) erstmals<br />
vor diesem Zeitpunkt vorgelegen haben (§ 16 AtG), d.h., dass die Altersteilzeitarbeit<br />
spätestens am 31.12.2009 beginnen muss. Zurzeit ist auch nicht<br />
zu erwarten, dass die Förderung in der bisherigen Form fortgesetzt werden<br />
wird.<br />
26
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 27<br />
Altersteilzeitarbeit wird aber weiter aktuell bleiben, weil das AtG im Übrigen<br />
nach dem 31.12.2009 in Kraft bleibt <strong>und</strong> damit Altersteilzeitarbeit auch danach<br />
möglich ist. Durch Art. 26a des Jahressteuergesetzes 2008 (BGBl. I 2007,<br />
3187) ist § 1 AtG ein neuer Abs. 3 angefügt worden, der dies klarstellt:<br />
„Altersteilzeit im Sinne dieses Gesetzes liegt unabhängig von einer Förderung<br />
durch die B<strong>und</strong>esagentur auch vor bei einer Teilzeitarbeit älterer Arbeitnehmer,<br />
die ihre Arbeitszeit ab Vollendung des 55. Lebensjahres nach dem<br />
31. Dezember 2009 vermindern. Für die Anwendung des § 3 Nr. 28 des Einkommensteuergesetzes<br />
kommt es nicht darauf an, dass die Altersteilzeitarbeit<br />
vor dem 1. Januar 2010 begonnen wurde <strong>und</strong> durch die B<strong>und</strong>esagentur<br />
nach § 4 gefördert wird.“<br />
Es müssen demnach nur die weiteren Voraussetzungen für Altersteilzeit<br />
gemäß § 2 AtG erfüllt sein (hierzu auch DA der BA unter 1.1. <strong>und</strong> 1.2 zu § 1).<br />
Sozialversicherungsrechtlich gilt, dass für Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit<br />
i.S.d. AtG leisten, die in den einzelnen Versicherungszweigen geltenden sozialversicherungsrechtlichen<br />
Regelungen uneingeschränkt weiterhin Anwendung<br />
finden. Wenn die Aufstockungsbeträge <strong>und</strong> die Zusatzbeiträge zur Rentenversicherung<br />
gemäß § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei sind, hat das nach § 1 der<br />
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) Beitragsfreiheit zur Folge. Das<br />
sieht auch das R<strong>und</strong>schreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger<br />
vom 9.3.2004 vor.<br />
1.3 Gesetzliche Änderungen der Altersteilzeit zum 1.7.2004<br />
1.3.1 Die Änderungen<br />
Durch Art. 95 des Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt<br />
vom 23.12.2003 (BGBl. I, S. 2910) ist das Altersteilzeitgesetz mit Wirkung<br />
zum 1.7.2004 in mehreren Punkten geändert worden. Die alte <strong>und</strong> neue<br />
Rechtslage werden in den jeweiligen <strong>Kapitel</strong>n unter vollständiger Berücksichtigung<br />
des neuen R<strong>und</strong>schreibens der Spitzenverbände vom 9.3.2004 <strong>und</strong><br />
der neuen AtG-DA der BA (Stand 1.1.2008) ausführlich dargestellt.<br />
Vorbeschäftigungszeiten in der Europäischen Union<br />
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 AtG ist dahingehend ergänzt worden, dass auch eine versicherungspflichtige<br />
Beschäftigung nach den Vorschriften eines Mitgliedsstaates<br />
der Europäischen Union, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des<br />
Rates der Europäischen Union Anwendung findet, bei der Berechnung der<br />
erforderlichen Vorversicherungszeit von 1.080 Kalendertagen in den letzten<br />
fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeitarbeit zu berücksichtigen ist.<br />
27
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 28<br />
Aufstockungsbeträge – Einführung des Regelarbeitsentgelts<br />
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 in der neuen Fassung ist Voraussetzung für die Altersteilzeit,<br />
dass der Arbeitgeber aufgr<strong>und</strong> eines Tarifvertrages, einer Regelung<br />
der Kirchen <strong>und</strong> der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, einer<br />
Betriebsvereinbarung oder einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer<br />
a) das Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeit um mindestens 20 v.H. aufstockt,<br />
wobei die Aufstockung weitere Entgeltbestandteile umfassen kann,<br />
<strong>und</strong><br />
b) für den Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung<br />
mindestens in Höhe des Beitrags entrichtet, der auf 80 v.H. des<br />
Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag<br />
zwischen 90 v.H. der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze<br />
<strong>und</strong> dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze.<br />
Damit entfällt die bisherige Gegenrechnung, ob der sog. „Mindestnettobetrag“<br />
erreicht wird. Anstelle des „bisherigen Arbeitsentgelts“ wird der Begriff des<br />
„Regelarbeitsentgelts“ eingeführt. Gemäß § 6 Abs. 1 AtG in der neuen Fassung<br />
ist das Regelarbeitsentgelt das auf einen Monat entfallende, vom Arbeitgeber<br />
regelmäßig zu zahlende sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt,<br />
soweit es die Beitragsbemessungsgrenze des SGB III nicht überschreitet. Entgeltbestandteile,<br />
die nicht laufend gezahlt werden, sind nicht berücksichtigungsfähig.<br />
Die Erstattungsleistungen der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit richten<br />
sich ab 1.7.2004 nach diesen Regelungen (§ 4 Abs. 1 n.F.).<br />
Bisherige wöchentliche Arbeitszeit<br />
Wie bisher ist unter bisheriger wöchentlicher Arbeitszeit die Arbeitszeit zu verstehen,<br />
die mit dem Arbeitnehmer vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeitswochenfrist<br />
vereinbart worden ist, höchstens jedoch die Arbeitszeit, die<br />
im Durchschnitt der letzten 24 Monate vor dem Übergang in die Altersteilzeit<br />
vereinbart war (§ 6 Abs. 2 S. 1 <strong>und</strong> 2 AtG). Eine Vereinfachung bringt die Aufhebung<br />
von § 6 Abs. 2 S. 3 <strong>und</strong> Abs. 3 AtG: Die bisherige regelmäßige<br />
wöchentliche Arbeitszeit ist ab 1.7.2004 unabhängig von der tariflichen regelmäßigen<br />
wöchentlichen Arbeitszeit festzustellen; die entsprechende Vergleichsrechnung<br />
entfällt damit.<br />
Überforderungsschutz<br />
Nach § 7 Abs. 3 AtG bleiben bei den Berechnungsvorschriften des § 7 Abs. 1<br />
<strong>und</strong> 2 schwerbehinderte Menschen <strong>und</strong> Gleichgestellte i. S. des SGB IX außer<br />
Ansatz. Die Neuregelung in § 7 Abs. 4 AtG stellt klar, dass dieser Personenkreis<br />
bei der Ermittlung der Zahl der in Altersteilzeitarbeit beschäftigten Arbeitnehmer<br />
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 AtG (5%-Quote) zu berücksichtigen ist.<br />
28
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 29<br />
Anpassung <strong>und</strong> Änderung der Fördervorschriften<br />
In der gesetzlichen Neuregelung wird die Regelung über die Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> die Höhe der Förderleistungen in § 4 Abs. 1 AtG an die Neuregelung<br />
in § 3 Abs. 1 AtG angepasst. Für die Höhe der Leistungen ist in § 12 Abs. 2<br />
AtG eine Festbetragsregelung für die gesamte Förderdauer eingeführt worden.<br />
Die monatlichen Festbeträge werden nur angepasst, wenn sich das<br />
berücksichtigungsfähige Regelarbeitsentgelt um mindestens 10 % verringert.<br />
Das bedeutet, dass Erhöhungen des Regelarbeitsentgelts im Laufe der Altersteilzeit<br />
auf Gr<strong>und</strong> tariflicher, betrieblicher oder vertraglicher Gehaltserhöhungen<br />
zu Lasten des Arbeitgebers gehen, da eine Aufstockung der Förderleistungen<br />
in diesem Fall nicht erfolgt.<br />
Bislang werden die Aufstockungsleistungen bei einer Wiederbesetzung mit<br />
einem Bezieher von Arbeitslosengeld II nur dann erbracht, wenn der Träger<br />
der Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende eine im Ermessen stehende Zusage<br />
hierzu erteilt hat. Diese Unterscheidung hat sich in der Praxis nicht bewährt.<br />
Deshalb wird die Erstattung auch für diesen Personenkreis ab 1.1.2008 Pflichtleistung<br />
(§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 i.V.m. Art. 11 des Gesetzes zur Änderung des 4.<br />
Buches SGB <strong>und</strong> anderer Gesetze). Wegen der Einzelheiten der Förderungsvoraussetzungen<br />
wird im Übrigen auf die Darlegungen in <strong>Kapitel</strong> VIII verwiesen.<br />
Insolvenzsicherung im Blockmodell<br />
Um zu verhindern, dass der Arbeitnehmer im Blockmodell durch Insolvenz des<br />
Unternehmens Verluste in seinem Wertguthaben erleidet (vgl. hierzu unten<br />
5.4.2.2), wird bei Beginn der Altersteilzeit nach dem 30.6.2004 in § 8a AtG eine<br />
spezielle Insolvenzsicherung für Wertguthaben in der Altersteilzeit verbindlich<br />
vorgeschrieben; die Regelung hat keine Rückwirkung für Altersteilzeitverhältnisse,<br />
die bis zum 30.6.2004 begonnen haben (§ 15g AtG; s. zur Insolvenzsicherung<br />
ausführlich unten 4.6).<br />
1.3.2 Anzuwendendes Recht – altes <strong>und</strong> neues Recht<br />
Maßgeblich für das anzuwendende Recht ist nicht der Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages,<br />
sondern der Zeitpunkt, in dem mit der Altersteilzeitarbeit<br />
begonnen wurde (§ 15 S. 1 AtG).<br />
Bei einem Beginn der Altersteilzeitarbeit bis zum 30.6.2004 sind die alten<br />
Vorschriften, ausgenommen § 15 AtG, <strong>und</strong> das R<strong>und</strong>schreiben der Spitzen -<br />
organisationen der Sozialversicherung vom 6.9.2001 weiterhin anzuwenden.<br />
Auch die Verpflichtung zur Insolvenzsicherung gemäß § 8a AtG gilt für diese<br />
Altfälle nicht. Auf Antrag des Arbeitgebers erbringt aber die BA Leistungen nach<br />
§ 4 AtG in der neuen Fassung, wenn die hierfür ab dem 1.7.2004 maßgebenden<br />
Voraussetzungen erfüllt sind (Abs. 2).<br />
29
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 30<br />
Unproblematisch ist auch der Fall, in dem sowohl der Abschluss des Altersteilzeitvertrages<br />
als auch der Beginn der Altersteilzeitarbeit nach dem<br />
30.6.2004 liegen. Es gilt das neue Recht. Hierfür gilt das neue Rdschr. der<br />
Spitzenverbände vom 9.3.2004.<br />
Bei Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages vor dem 1.7.2004 <strong>und</strong><br />
Beginn der Altersteilzeitarbeit nach dem 30.6.2004 gelten gr<strong>und</strong>sätzlich die<br />
neuen Regelungen, d.h. auch die Verpflichtung zur Insolvenzsicherung gemäß<br />
§ 8a AtG. Da das Gesetz keine Übergangsregelung für „Alt-Vereinbarungen“<br />
enthält, bereiten diese Fälle im Hinblick auf die Höhe der Aufstockungsleistungen<br />
Schwierigkeiten. Fraglich ist, ob Differenzen zwischen den vereinbarten<br />
Aufstockungsleistungen <strong>und</strong> den Fördererleistungen nach dem neuen<br />
Recht zu Lasten des Arbeitgebers gehen. Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:<br />
Der Altersteilzeitarbeitsvertrag wird ohne Altersteilzeittarifvertrag<br />
abgeschlossen (es gibt keinen einschlägigen Tarifvertrag oder bei<br />
fehlender Tarifbindung des Arbeitgebers ist nicht auf den Altersteilzeittarifvertrag<br />
Bezug genommen):<br />
Wird im Vertrag hinsichtlich der Leistungen lediglich auf die (alten) gesetzlichen<br />
Regelungen Bezug genommen <strong>und</strong> werden entsprechend nur die<br />
gesetzlich vorgeschriebenen Aufstockungsbeträge gezahlt, gilt das neue<br />
Recht, auch wenn es für den Arbeitnehmer ungünstiger ist, da der Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
in diesem Fall keine eigenständige Regelung enthält. Werden<br />
hingegen höhere Aufstockungsleistungen als die gesetzlichen vertraglich<br />
vereinbart bzw. gewährt, sind diese höheren Leistungen vertraglich konstitutiv<br />
vereinbart. Es ist eine Vergleichsrechnung anzustellen. Mindestens stehen<br />
dem Arbeitnehmer die Leistungen nach neuem Recht zu; sind die vertraglich<br />
vereinbarten Leistungen höher, hat er Anspruch auf diese Leistungen. Dieser<br />
nicht von der BA geförderte Mehraufwand geht zu Lasten des Arbeitgebers.<br />
Anwendung eines Altersteilzeittarifvertrages<br />
Ein Altersteilzeittarifvertrag kann kraft beiderseitiger Tariffindung oder durch<br />
Bezugnahme im Altersteilzeitarbeitsvertrag auf den einschlägigen Altersteilzeittarifvertrag<br />
anwendbar sein. Da die Tarifverträge in aller Regel die Höhe<br />
der Aufstockungsleistungen nicht unter Bezugnahme auf das Altersteilzeitgesetz,<br />
sondern eigenständig insbesondere durch höhere als die gesetzlichen<br />
Aufstockungsleistungen regeln, wirken diese Tarifverträge konstitutiv. Das<br />
bedeutet für beide Fälle der Tarifgeltung: Es ist eine Vergleichsrechnung anzustellen.<br />
Der Arbeitnehmer muss mindestens das erhalten, was ihm nach<br />
neuem Recht zusteht; sind die Leistungen aus dem Altersteilzeittarifvertrag<br />
höher, hat er einen Anspruch auf diese höheren Leistungen. Wird in dem<br />
Altersteilzeittarifvertrag hingegen ausnahmsweise lediglich deklaratorisch auf<br />
die gesetzlichen Leistungen Bezug genommen, so sind die neuen gesetz-<br />
30
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 31<br />
lichen Vorschriften ohne weiteres anzuwenden. Eine Vergleichsrechnung<br />
erübrigt sich.<br />
Diese Rechtslage gilt im Falle der Tarifbindung von Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
nur so lange, bis die laufenden Altersteilzeittarifverträge an die neue<br />
Rechtslage angepasst sind. Hierauf muss – da bei fehlender Tarifbindung des<br />
Arbeitnehmers diese Tarifautomatik nicht ohne weiteres gilt – zur Klarstellung<br />
in dem Altersteilzeitarbeitsvertrag ausdrücklich hingewiesen werden. Vom<br />
Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten Tarifverträge an hat der Arbeitnehmer<br />
ausschließlich Anspruch auf die Leistungen nach diesem geänderten<br />
Tarifvertrag. Eine bisher für ihn übergangsweise geltende u.U. günstigere<br />
Rechtslage entfällt damit.<br />
Betriebsvereinbarungen über Altersteilzeit<br />
Es gelten die Ausführungen zum Altersteilzeittarifvertrag entsprechend. Beruht<br />
die Betriebsvereinbarung auf einer Öffnungsklausel im Tarifvertrag gelten<br />
diese <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> direkt. Bei einer (freiwilligen) Betriebsvereinbarung kommt<br />
es darauf an, ob diese eigenständige konstitutive Regelungen enthält oder<br />
lediglich auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen Bezug nimmt.<br />
1.4 Anhebung der Altersgrenzen<br />
Die Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente wegen<br />
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit wird für die Jahrgänge ab Januar<br />
1946 angehoben, die volle Anhebung auf das 63. Lebensjahr gilt ab Jahrgang<br />
Dezember 1948 (Anlage 19 zu § 237 SGB VI). Die Altersrente nach<br />
Altersteilzeitarbeit entfällt für Jahrgänge ab Geburtsjahr 1952 (§ 237 Abs. 1<br />
Nr. 1 SGB VI). Die Regelung ist am 1.1.2006 in Kraft getreten. § 237 Abs. 5<br />
SGB VI gewährt einen Vertrauensschutz u.a. für Altersteilzeitvereinbarungen,<br />
die vor dem 1.1.2004 getroffen worden sind.<br />
Eine weitere Änderung bringt das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom<br />
20.4.2007 (Inkrafttreten 1.1.2008). Danach wird die Regelaltersgrenze von<br />
2012 an ab Jahrgang 1947 bis zum Jahr 2029 stufenweise von 65 auf 67 angehoben.<br />
Das gilt nicht für Versicherte, die vor dem 1.1.1955 geboren sind <strong>und</strong><br />
vor dem 1.1.2007 Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 AtG vereinbart<br />
haben. Ihnen wird Vertrauensschutz gewährt (§ 235 Abs. 2 S. 3 Nr. 1<br />
SGB VI). Das AtG wurde an diese rentenrechtlichen Regelungen angepasst.<br />
Siehe zu den Rentenzugangsvoraussetzungen ausführlich <strong>Kapitel</strong> IX.<br />
31
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 32<br />
2 Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG <strong>und</strong> des<br />
Sozialrechts<br />
2.1 Gesetzliche Voraussetzungen (Überblick)<br />
Altersteilzeitarbeit, im sozialversicherungsrechtlichen Sinne, liegt nur vor,<br />
wenn die Arbeitszeit aufgr<strong>und</strong> von Altersteilzeitarbeit im Sinne von § 2 <strong>und</strong> § 3<br />
Abs. 1 Nr. 1 AtG für mindestens 24 Monate auf die Hälfte vermindert worden<br />
ist (§ 237 Abs. 1 Nr. 3 b SGB VI). Auch die Steuerfreiheit der Aufstockungsleistungen<br />
gemäß § 3 Nr. 28 EStG gilt nur unter diesen Voraussetzungen.<br />
Die Altersteilzeitarbeit muss zumindest bis zu dem Zeitpunkt dauern, in dem<br />
eine – auch gekürzte – vorzeitige Altersrente in Anspruch genommen werden<br />
kann (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG). Bei einem vorzeitigen Rentenzugang aus anderen<br />
Gründen, z.B. Schwerbehinderte, Frauen, liegt Altersteilzeitarbeit auch<br />
vor, wenn sie nicht 24 Monate dauert. Die Altersteilzeit endet spätestens mit<br />
Erreichen der Regelaltersgrenze.<br />
Die im Folgenden dargestellten Voraussetzungen des AtG müssen daher vorliegen,<br />
damit später die vorgezogene Rente nach Altersteilzeitarbeit beansprucht<br />
werden kann <strong>und</strong> die Aufstockungsleistungen steuerfrei sind. Hiervon<br />
zu unterscheiden ist die Frage, ob ein Anspruch auf Förderleistungen durch<br />
die BA besteht. Altersteilzeitarbeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne<br />
liegt auch ohne Wiederbesetzung des freigemachten oder durch Umsetzung<br />
frei gewordenen Arbeitsplatzes bzw. ohne die Beschäftigung eines Auszubildenden<br />
vor. Diese Voraussetzung muss nur dann erfüllt sein, wenn die Förderleistungen<br />
nach § 4 AtG bzw. nach § 10 Abs. 2 AtG von der BA beansprucht<br />
werden. Altersteilzeitarbeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne liegt<br />
daher auch dann vor, wenn der Anspruch auf Förderleistungen nach § 5 Abs. 1<br />
Nr. 2 <strong>und</strong> 3, Abs. 2 bis 4 AtG nicht besteht, ruht oder erlischt (RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 6.9.2001, Nr. 2.1.1 <strong>und</strong> vom 9.3.2004, 2.1.2.).<br />
Beispiele:<br />
Der in Altersteilzeit beschäftige Arbeitnehmer übt bei einem anderen Arbeitgeber<br />
eine nicht nur geringfügige Beschäftigung aus<br />
oder<br />
leistet während der Arbeitsphase im Blockmodell oder während einer kontinuierlichen<br />
Arbeitsleistung Mehrarbeit in nicht nur geringfügigem Umfang<br />
oder<br />
er leistet im Blockmodell in der Freistellungsphase eine vorübergehend<br />
geringfügige Mehrarbeit, sofern dadurch im Hinblick auf § 2 Abs. 1 Nr. 2<br />
32
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 33<br />
AtG der Charakter der Altersteilzeitarbeit nicht verändert wird. Die Prüfung<br />
hat jeweils im Einzelfall zu erfolgen. Entscheidend ist ein betriebsbedingter<br />
wesentlicher Anlass, z.B. wenn eine projektbezogene Arbeit, die bei Beendigung<br />
der Arbeitsphase noch nicht abgeschlossen ist, zum Abschluss<br />
gebracht werden soll.<br />
Die in § 8a AtG eingeführte Pflicht zur Insolvenzsicherung des Wertgutachtens<br />
im Blockmodell ist eine <strong>arbeitsrechtliche</strong> Verpflichtung <strong>und</strong> sozialrechtlich<br />
nicht Voraussetzung für die Altersteilzeitarbeit (vgl. hierzu 4.6).<br />
Mehrarbeit in der Freistellungsphase oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze<br />
führt zu einer Unterbrechung der Altersteilzeitarbeit.<br />
Altersteilzeitarbeit ist auch in den Fällen nicht ausgeschlossen, in denen<br />
bereits das Arbeitsentgelt aus der Altersteilzeitarbeit die Berechnungsgr<strong>und</strong>lage<br />
für die Rentenversicherungsbeiträge erreicht bzw. überschreitet (mindestens<br />
90 v.H. des bisherigen Arbeitsentgelts, ab 1.7.2004 höchstens 80 %<br />
des Regelarbeitsentgelts, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze) <strong>und</strong><br />
demzufolge keine zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge aus einem<br />
Unterschiedsbetrag anfallen (RdSchr. der Spitzenverbände vom 6.9.2001,<br />
2.1.1).<br />
Zu den genauen Voraussetzungen für Förderleistungen der BA s. <strong>Kapitel</strong> VIII.<br />
2.2 Die Voraussetzungen im Einzelnen<br />
2.2.1 Begünstigter Personenkreis<br />
2.2.1.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG liegt nur dann vor, wenn bei der Vereinbarung<br />
die vom AtG in § 2 AtG aufgestellten Voraussetzungen beachtet werden.<br />
Der Arbeitnehmer muss das 55. Lebensjahr vollendet haben, innerhalb<br />
der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1.080<br />
Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung im Sinne des<br />
SGB III gestanden haben <strong>und</strong> während der Altersteilzeitarbeit weiterhin versicherungspflichtig<br />
im Sinne des SGB III beschäftigt sein. Schließlich muss<br />
die Altersteilzeitvereinbarung festlegen, dass die bisherige Arbeitszeit für die<br />
Dauer der Altersteilzeitarbeit auf die Hälfte der bisherigen wöchentlichen<br />
Arbeitszeit vermindert wird. Außerdem muss die Arbeitszeit aufgr<strong>und</strong> der<br />
Altersteilzeitarbeit, wenn ein Rentenzugang nach 24-monatiger Altersteilzeitarbeit<br />
ermöglicht werden soll, mindestens für 24 Kalendermonate <strong>und</strong> zumindest<br />
bis zum frühestmöglichen Eintritt in den Ruhestand vermindert werden<br />
(§ 237 Abs. 1 Nr. 3 b SGB VI). Eine kürzere Dauer kann nur vereinbart werden,<br />
wenn die Voraussetzungen für eine andere vorgezogene Altersrente, z.B.<br />
für Frauen oder Schwerbehinderte, im Zeitpunkt der planmäßigen Beendigung<br />
der Altersteilzeitarbeit erfüllt sind. Der Arbeitgeber muss mindestens die<br />
33
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 34<br />
gesetzlich vorgeschriebenen Aufstockungsleistungen zahlen (§ 3 Abs. 1<br />
Ziff. 1a <strong>und</strong> b AtG). Das Arbeitsentgelt sowie die Aufstockungsbeträge müssen<br />
auch im Blockmodell fortlaufend gezahlt werden.<br />
Ist beabsichtigt, Förderleistungen durch die BA für die Altersteilzeitarbeit in<br />
Anspruch zu nehmen, muss zusätzlich zu den Aufstockungsleistungen aus<br />
Anlass des Übergangs des Arbeitnehmers in Altersteilzeitarbeit eine Wiederbesetzung<br />
erfolgen (s. hierzu ausführlich <strong>Kapitel</strong> VIII).<br />
2.2.1.2 Arbeitgeber – Arbeitnehmer<br />
Altersteilzeitarbeit wird zwischen dem Arbeitgeber <strong>und</strong> dem Arbeitnehmer vereinbart.<br />
Wer Arbeitgeber ist, ist arbeitsrechtlich zu beurteilen <strong>und</strong> ergibt sich<br />
aus dem Arbeitsvertrag. Danach ist Arbeitgeber jede natürliche oder juristische<br />
Person (Personen-/Kapitalgesellschaft, nicht jedoch der Konzern), die mindestens<br />
einen Arbeitnehmer gegen Arbeitsentgelt in einem Arbeitsverhältnis<br />
beschäftigt (oder beschäftigten will). Arbeitnehmer im Sinne des AtG ist, wer<br />
eine Erwerbstätigkeit in persönlicher Abhängigkeit zu einem Arbeitgeber ausübt.<br />
Persönlich abhängig ist, wer in den Betrieb oder die Arbeitsorganisation<br />
eingegliedert ist <strong>und</strong> dem Weisungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich Zeit,<br />
Dauer, Ort <strong>und</strong> Art der Arbeitsleistung unterliegt (vgl. § 7 Abs. 1 SGB IV). Maßgeblich<br />
ist dabei nicht die Bezeichnung im Vertrag, sondern die tatsächliche<br />
Handhabung des Vertragsverhältnisses. Hierunter fallen:<br />
alle Tarifangestellten <strong>und</strong> -arbeiter,<br />
außertarifliche Angestellte,<br />
leitende Angestellte.<br />
Keine Arbeitnehmer sind<br />
Arbeitgeber oder Organe der Gesellschaft, z.B. Vorstand der Aktiengesellschaft;<br />
Geschäftsführer einer GmbH, es sei denn, sie sind sozialversicherungspflichtig<br />
beschäftigt (s. hierzu die sozialversicherungsrechtliche<br />
Behandlung sog. Fremdgeschäftsführer),<br />
Selbstständige,<br />
(„echte“) freie Mitarbeiter,<br />
arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne von § 12a TVG, Heimarbeiter.<br />
Seit 1.1.2000 gilt das AtG auch für Teilzeitbeschäftigte. Voraussetzung ist, dass<br />
sie während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses sozialversicherungspflichtig<br />
im Sinne von SGB III beschäftigt sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG). Bei einer bis-<br />
34
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 35<br />
herigen Arbeitszeit von weniger als 30 St<strong>und</strong>en wöchentlich muss daher die<br />
in § 8 SGB IV festgelegte Entgeltgrenze von 400 Euro überschritten werden.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der Ausnahmevorschrift in § 4 Abs. 2 AtG sind ferner Personen<br />
begünstigt, die nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI (Mitgliedschaft in einer berufsständischen<br />
Versorgungseinrichtung) oder nach § 231 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 SGB VI<br />
(u.a. Angestellte im Zusammenhang mit der Erhöhung der Jahresarbeitsverdienstgrenze)<br />
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
befreit sind (DA der BA 4.1 Abs. 2 <strong>und</strong> 5.3 Abs. 2). In diesen Fällen<br />
stehen den zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträgen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1b<br />
AtG vergleichbare Aufwendungen des Arbeitgebers zu einer berufsständischen<br />
Versorgungseinrichtung oder zur Lebensversicherung bis zur Höhe des<br />
Beitrags gleich, den die BA zu tragen hätte, wenn der Arbeitnehmer nicht von<br />
der Versicherungspflicht befreit wäre (§ 4 Abs. 2 AtG; RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, 2.1.1.5).<br />
Arbeitnehmer, die als Bezieher einer Versorgung nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 SGB<br />
VI in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei sind (z.B. Flugzeugführer,<br />
die ein Ruhegehalt wegen Erreichens des 41. Lebensjahres nach<br />
§ 45 Abs. 2 Nr. 6 Soldatengesetz beziehen), haben demgegenüber keinen<br />
Zugang zur Altersteilzeitarbeit nach dem AtG, weil sie bereits vor Beginn einer<br />
etwaigen Altersteilzeitarbeit eine Versorgung beziehen, die im Gr<strong>und</strong>satz der<br />
einem vollen Erwerbsleben entsprechenden Versorgung gleichwertig ist (DA<br />
der BA Nr. 1 zu § 1 unter Hinweis auf BSG, Urt. vom 21.3.2007 – B 11a AL<br />
9/06 R).<br />
2.2.1.3 Vollendung des 55. Lebensjahres<br />
Der Arbeitnehmer muss zu Beginn der Altersteilzeitarbeit das 55. Lebensjahr<br />
vollendet haben. Die BA fördert durch Leistungen nach dem AtG die Teilzeit<br />
älterer Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit ab Vollendung des 55. Lebensjahres<br />
spätestens ab dem 31.12.2009 vermindern <strong>und</strong> damit die Einstellung eines<br />
sonst arbeitslosen Arbeitnehmers ermöglichen (§§ 1 Abs. 2, 16 i.d.F. des 2.<br />
Änderungsgesetzes zum AtG). Sollte diese Förderdauer nicht später nochmals<br />
gesetzlich verlängert werden, läuft damit die Förderung für Arbeitnehmer,<br />
die bis zum 31.12.2009 das 55. Lebensjahr vollenden, d.h. bis zum<br />
Geburtsdatum 31.12.1954. Ein Rentenzugang nach 24-monatiger Altersteilzeitarbeit<br />
gemäß § 237 Abs. 1 Nr. 3 b SGB VI ist allerdings nur noch möglich<br />
für Versicherte, die vor dem 1.1.1952 geboren sind (§ 237 Abs. 1 SGB VI).<br />
2.2.1.4 Vorbeschäftigungszeiten<br />
Der Arbeitnehmer muss innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit<br />
mindestens 1.080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung im Sinne des SGB III (vgl. §§ 24 ff. SGB III) gestanden haben<br />
35
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 36<br />
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 AtG). § 2 Abs. 1 Nr. 3 AtG ist mit Wirkung ab 1.7.2004 dahingehend<br />
ergänzt worden, dass auch versicherungspflichtige Beschäftigungen<br />
in einem EU-/EWR-Mitgliedsstaat bzw. der Schweiz zur Erfüllung der Vorbeschäftigungszeiten<br />
zu berücksichtigen sind (DA der BA 2.1 Abs. 4; s. ausführlich<br />
zur Altersteilzeit bei Auslandsentsendung unten 6.).<br />
Beschäftigungszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen.<br />
Ein Arbeitnehmer, der mehrere Beschäftigungsverhältnisse ausübt, kann auch<br />
bei unterschiedlichen Arbeitgebern jeweils ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
aufnehmen. Hinsichtlich der Ermittlung der zusätzlichen beitragspflichtigen<br />
Einnahme nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 163 Abs. 5 S. 1 SGB VI ist<br />
§ 22 Abs. 2 SGB IV zu beachten (DA der BA 2.1. Abs. 11 zu § 2).<br />
Hat der Arbeitnehmer Entgeltersatzleistungen im Sinne von § 26 Abs. 2 SGB<br />
III, z.B. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe,<br />
bezogen, so werden die Zeiten zur Erfüllung der Vorbeschäftigungszeiten<br />
herangezogen; § 427 Abs. 3 SGB III gilt entsprechend (§ 2 Abs. 1<br />
Nr. 3 S. 2 <strong>und</strong> 3 AtG). Zeiten ohne Entgeltzahlung, die länger als einen Monat<br />
dauern, unterbrechen das Versicherungspflichtverhältnis (§ 7 Abs. 3 S. 1 SGB<br />
IV).<br />
Vorbeschäftigungszeiten deutscher Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag<br />
mit einem deutschen Arbeitgeber haben <strong>und</strong> im Ausland eingesetzt worden<br />
sind, zählen nur mit, wenn <strong>und</strong> soweit diese aufgr<strong>und</strong> einer Entsendung im<br />
Rahmen einer Ausstrahlung (sog. Ortskräfte) sozialversicherungspflichtig im<br />
Sinne des SGB III beschäftigt waren. Unterliegen diese Arbeitnehmer nicht<br />
dieser Versicherungspflicht, erfüllen sie allein aufgr<strong>und</strong> der Auslandsbeschäftigung<br />
nicht die Vorbeschäftigungszeiten (DA der BA 2.1 Abs. 5 zu § 2).<br />
Altersteilzeitarbeit während der Arbeitsphase kann bei ihnen vorliegen, wenn<br />
<strong>und</strong> solange sie im Rahmen der Ausstrahlung oder einer Ausnahmevereinbarung<br />
der Versicherungspflicht in der deutschen Renten- <strong>und</strong> Arbeitslosenversicherung<br />
unterliegen. Altersteilzeitarbeit kann darüber hinaus auch bei<br />
Deutschen vorliegen, die im Ausland bei einer amtlichen Vertretung des B<strong>und</strong>es<br />
oder der Länder oder bei deren Leitern, deutschen Mitgliedern oder<br />
Bediensteten beschäftigt <strong>und</strong> in der deutschen Renten- <strong>und</strong> Arbeitslosenversicherung<br />
versichert sind. In der Freistellungsphase eines Blockmodells<br />
besteht eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt nach § 7a Abs. 1a SGB IV<br />
selbst dann fort, wenn der Versicherte seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen<br />
Aufenthaltsort in dieser Zeit bereits endgültig ins Ausland verlegt hat.<br />
Hat der Arbeitnehmer innerhalb der Fünf-Jahresfrist eine Entgeltersatzleistung<br />
i.S. des § 26 Abs. 2 SGB III (z.B. Krankengeld, Versorgungskrankengeld) oder<br />
Alg/Alhi oder Alg II bezogen, so werden auch diese Zeiten zur Erfüllung der<br />
Vorbeschäftigungszeiten herangezogen. Gleiches gilt für die Zeiten der Kindererziehung<br />
(z.B. von Pflegekindern) nach § 26 Abs. 2a SGB III (DA der BA<br />
2.1 Abs. 6 zu § 2).<br />
36
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 37<br />
2.2.2 Beginn der Altersteilzeitarbeit<br />
Altersteilzeitarbeit kann nur für die Zukunft abgeschlossen werden; sie beginnt<br />
nach Abschluss der schriftlichen Vereinbarung mit Vorliegen der hierfür maßgeblichen<br />
Voraussetzungen. Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG liegt daher<br />
nur vor, wenn der Altersteilzeitarbeitsvertrag vor dem Beginn der Altersteilzeitarbeit<br />
abgeschlossen wird, d.h. wenn die Altersteilzeitarbeit nach<br />
Abschluss der Vereinbarung beginnt. Eine Rückdatierung des Vertrages ist<br />
unzulässig. Das gilt nicht nur bei kontinuierlicher, sondern auch bei diskontinuierlicher<br />
Verteilung der Arbeitszeit (Blockmodell). Im Blockmodell muss der<br />
Vertrag vor Beginn der Ansparphase von Wertguthaben für die spätere Freistellung<br />
abgeschlossen sein. Bereits abgelaufene Arbeitszeiten, in denen tatsächlich<br />
keine Altersteilzeitarbeit ausgeübt worden ist, können nicht nachträglich<br />
in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis umgewandelt werden (RdSchr. der<br />
Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.6 <strong>und</strong> Weisungen der BA). Wertguthaben<br />
aus der Zeit vor Beginn der Altersteilzeitarbeit können aber unter bestimmten<br />
Voraussetzungen durch schriftliche Vereinbarung zur Verkürzung der Arbeitsphase<br />
herangezogen werden.<br />
Altersteilzeitarbeit im Sinn des AtG kann vor der endgültigen Ratifizierung<br />
eines Tarifvertrages im Hinblick auf die zu erwartenden Regelungen vereinbart<br />
<strong>und</strong> aufgenommen werden, wenn die Altersteilzeitarbeit für einen Zeitraum<br />
von bis zu drei Jahren vereinbart wird. Für einen längeren Zeitraum gilt<br />
dies nur, wenn in dem Tarifvertrag eine Rückwirkung vorgesehen ist (RdSchr.<br />
der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.6.).<br />
Wird der Arbeitnehmer nach Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung, aber vor<br />
dem vereinbarten Beginn der Altersteilzeitarbeit arbeitsunfähig krank <strong>und</strong><br />
erhält er zum vereinbarten Beginn nach Ende der Entgeltfortzahlung von<br />
sechs Wochen Krankengeld, kann das Altersteilzeitarbeitsverhältnis erst zum<br />
Zeitpunkt der Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> der Wiederaufnahme<br />
der Arbeit beginnen (s. hier <strong>Kapitel</strong> V).<br />
2.2.3 Dauer der Altersteilzeitarbeit<br />
Altersteilzeitarbeit kann ab Vollendung des 55. Lebensjahres längstens bis<br />
zum Erreichen der Regelaltersgrenze, damit ggf. auch für länger als zehn<br />
Jahre vereinbart werden. Für die Förderung durch die BA ergibt sich diese<br />
Altersgrenze direkt aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 AtG. Das gilt uneingeschränkt aber<br />
nur, wenn die auf die Hälfte verminderte Arbeitszeit in Form der traditionellen<br />
Teilzeit für die gesamte Dauer der Altersteilzeitarbeit, etwa beim bisher Vollbeschäftigten<br />
in Form einer Halbtagsbeschäftigung, gleichmäßig verteilt wird<br />
(kontinuierliche Altersteilzeitarbeit). Eine Förderung erfolgt aber längstens für<br />
sechs Jahre. Wichtig: Wird Altersteilzeitarbeit ohne Anwendung eines persönlich,<br />
fachlich <strong>und</strong> räumlich einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrages ver-<br />
37
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 38<br />
einbart, so darf im Blockmodell Altersteilzeitarbeit nur für die Gesamtdauer von<br />
maximal drei Jahren (Arbeitsphase <strong>und</strong> Freistellungsphase) vereinbart werden<br />
(s. dazu unten 2.2.5.2).<br />
2.2.4 Halbierung der bisherigen Arbeitszeit<br />
2.2.4.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Die bisherige Arbeitszeit des Arbeitnehmers muss in der Vereinbarung auf die<br />
Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert werden (§ 2 Abs. 1<br />
Nr. 2 a.E. AtG). Diese Voraussetzung kann nach den Weisungen der BA auch<br />
erfüllt werden, wenn bei einem nahtlosen Arbeitgeberwechsel ein Arbeitsverhältnis<br />
(mit dem neuen Arbeitgeber) begründet wird, dem bereits die reduzierte<br />
Arbeitszeit zugr<strong>und</strong>e liegt. Voraussetzung ist, dass der neue Arbeitgeber tatsächlich<br />
eine Beschäftigungsmöglichkeit mit höherem Arbeitsvolumen für den<br />
älteren Arbeitnehmer zur Verfügung hat, aber wegen der Beschäftigungseffekte<br />
des AtG eine entsprechende Verminderung vorgenommen wurde.<br />
Geringfügige Mehrarbeit, die im kontinuierlichen Teilzeitmodell oder in der<br />
Arbeitsphase des Blockmodells geleistet wird, ist förderungsrechtlich un -<br />
schädlich. Mehrarbeit bei einer Altersteilzeit im Blockmodell kann gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nur in der Arbeitsphase anfallen. Ausnahmsweise steht dem Vorliegen von<br />
Altersteilzeit eine vorübergehend geringfügige Mehrarbeit nicht entgegen,<br />
sofern dadurch im Hinblick auf § 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG der Charakter der Altersteilzeitarbeit<br />
nicht verändert wird. Die Prüfung hat jeweils im Einzelfall zu erfolgen.<br />
Entscheidend ist ein betriebsbedingter wesentlicher Anlass, z.B. wenn<br />
eine projektbezogene Arbeit, die bei Beendigung der Arbeitsphase noch nicht<br />
abgeschlossen ist, zum Abschluss gebracht werden soll. Im Zweifel ist das mit<br />
der zuständigen Agentur für Arbeit abzuklären (DA der BA 2.2 Abs. 16 <strong>und</strong> 17<br />
zu § 2).<br />
Auch wenn der Altersteilzeitarbeitnehmer entgegen § 5 Abs. 3 S. 1 AtG Mehrarbeit<br />
oder eine Nebentätigkeit in einem mehr als geringfügigen Umfang leistet<br />
<strong>und</strong> deswegen die Förderung der BA zum Ruhen oder Erlöschen kommt,<br />
kann Altersteilzeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne vorliegen.<br />
Ehrenamtliche Tätigkeiten können neben einer Altersteilzeitbeschäftigung<br />
sozialversicherungsrechtlich unschädlich ausgeübt werden (RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, 2.1.4).<br />
2.2.4.2 Bisherige wöchentliche Arbeitszeit<br />
Bei der maßgeblichen bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit ist zu unterscheiden,<br />
ob mit der Altersteilzeit vor dem 1.7.2004 (alte Rechtslage) oder ab dem<br />
1.7.2004 (neue Rechtslage) begonnen worden ist. Nach der neuen Rechtsla-<br />
38
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 39<br />
ge sind die Regelungen über die Begrenzung durch die tarifliche Arbeitszeit<br />
nicht mehr anzuwenden (s. unten).<br />
Die „bisherige wöchentliche Arbeitszeit“ ist gesetzlich festgelegt <strong>und</strong> unterliegt<br />
nicht der Parteidisposition, d.h. nur bei strikter Beachtung der gesetzlichen<br />
Regelung liegt Altersteilzeit i.S.d. Gesetzes vor. „Bisherige wöchentliche<br />
Arbeitszeit“ ist danach zunächst die zuletzt vor Übergang in die Altersteilzeitarbeit<br />
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (§ 6 Abs. 2 S. 1 AtG), jedoch der Höhe<br />
nach begrenzt auf die im Durchschnitt der letzten 24 Monate vor dem Übergang<br />
in die Altersteilzeitarbeit vereinbarte Arbeitszeit (§ 6 Abs. 2 S. 2 AtG). Ist<br />
die vereinbarte Arbeitszeit niedriger als der Durchschnittswert der letzten 24<br />
Monate, ist nur die zuletzt vereinbarte niedrigere Arbeitszeit Basis für die Halbierung<br />
der Arbeitszeit, da es sich bei der Regelung in § 6 Abs. 2 S. 2 AtG nur<br />
um eine Höchstgrenze handelt, die sich selbst nicht erhöhend auswirkt. Der<br />
errechnete Durchschnittswert kann auf die nächste volle St<strong>und</strong>e aufger<strong>und</strong>et<br />
werden (§ 6 Abs. 2 S. 4 AtG); die Regeln der kaufmännischen R<strong>und</strong>ung sind<br />
nicht anzuwenden (Weisungen der B<strong>und</strong>esanstalt). War mit dem Arbeitnehmer<br />
(mindestens) in den letzten 24 Monaten vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit<br />
eine tarifliche (regelmäßige) Arbeitszeit vertraglich vereinbart<br />
(Vollzeitarbeitnehmer), ist die vereinbarte Arbeitszeit maßgeblich, auch wenn<br />
die tarifliche Arbeitszeit in den letzten 24 Monaten unterschiedlich war (zustimmend<br />
BAG, Urt. vom 11.4.2006 – 9 AZR 369/05 –, NZA 2006, 425; Weisungen<br />
der BA). Diese Regeln sind verbindlich.<br />
Die Regelung, wonach Arbeitszeiten, die über die tarifliche Arbeitszeit hinausgegangen<br />
sind, nicht berücksichtigt werden dürfen (§ 6 Abs. 2 S. 3 AtG),<br />
gilt nur noch für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die bis zum 30.6.2004 begonnen<br />
worden sind. Für Altersteilzeitarbeitsverhältnissen mit einem späteren<br />
Beginn fällt diese Beschränkung weg.<br />
Eine tarifliche regelmäßige Arbeitszeit ist gegeben, wenn<br />
Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer tarifgeb<strong>und</strong>en sind oder<br />
der Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt worden ist oder<br />
nur der Arbeitgeber tarifgeb<strong>und</strong>en ist <strong>und</strong> in dem Arbeitsvertrag auf den<br />
Tarifvertrag verwiesen wird.<br />
Zugr<strong>und</strong>e zu legen ist die Arbeitszeit, die im Tarifvertrag als regelmäßige<br />
wöchentliche Arbeitszeit bezeichnet ist. Ist im Altersteilzeitarbeitsvertrag unter<br />
Bezugnahme auf eine tarifliche Bemessungsvorschrift eine bestimmte St<strong>und</strong>enzahl<br />
als durchschnittliche Wochenarbeitszeit angegeben, liegt darin keine<br />
konstitutive Regelung. Der Altersteilzeitarbeitnehmer kann verlangen, mit der<br />
sich aus der richtigen Anwendung der Tarifnorm ergebenden Arbeitszeit<br />
beschäftigt zu werden (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 14.8.2007 – 9 AZR<br />
18/07 –, noch nicht veröff.). Sieht der Tarifvertrag eine wöchentliche Arbeits-<br />
39
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 40<br />
zeit nicht oder für Teile eines Jahres eine unterschiedliche wöchentliche<br />
Arbeitszeit vor, ist die Arbeitszeit maßgeblich, die sich im Jahresdurchschnitt<br />
wöchentlich ergibt. Legt ein Tarifvertrag nur Ober- <strong>und</strong> Untergrenzen für die<br />
Arbeitszeit fest (Arbeitszeitkorridor), so ist der individuelle wöchentliche Jahresdurchschnitt<br />
zu berechnen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 AtG). Besteht keine tarifliche<br />
Arbeitszeit im dargelegten Sinn, so kommt es auf die tarifliche Arbeitszeit für<br />
gleiche oder ähnliche Beschäftigungen oder, falls eine solche tarifliche Regelung<br />
nicht besteht, auf die für gleiche oder ähnliche Beschäftigungen übliche<br />
Arbeitszeit an (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 AtG).<br />
Beispiel:<br />
Bisherige wöchentliche Arbeitszeit<br />
Alte Rechtslage (Beginn der Altersteilzeit bis 30.6.2004)<br />
Beginn der Altersteilzeit am 1.6.2004<br />
Tarifliche Arbeitszeit: 37 St<strong>und</strong>en<br />
Arbeitszeit Arbeitszeit<br />
1.6.02–31.8.03 1.9.03–31.5.04<br />
34 Std. 40 Std.<br />
Arbeitszeit vor Übergang in die Altersteilzeit: 40 St<strong>und</strong>en<br />
Ø 24 Monate: 15 x 34 = 510 (06/02–08/03)<br />
9 x 37 = 333 (09/03–05/04; Begrenzung auf tarifl. AZ<br />
843:24 = 35,1 aufger<strong>und</strong>et: 36,0 Std.<br />
Neue Rechtslage (Beginn der Altersteilzeit ab 1.7.2004)<br />
Beginn der Altersteilzeit am 1.7.2004<br />
Arbeitszeit Arbeitszeit<br />
1.7.02–30.9.03 1.10.03–30.6.04<br />
34 Std. 40 Std.<br />
Ø 24 Monate: 15 x 34 = 510 (07/02 – 09/03)<br />
9 x 40 = 360 (10/03 – 06/04)<br />
870:24 = 36,2 aufger<strong>und</strong>et: 37,0 Std.;<br />
keine Begrenzung auf tarifl. AZ<br />
40
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 41<br />
Bei der Berechnung der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit ist nicht nur die<br />
Zeit zu berücksichtigen, in welcher der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung zur<br />
Verfügung zu stellen hat, d.h. Arbeitspflicht hat. Das bedeutet, dass auch Zeiten<br />
ohne Arbeitsleistung bzw. Arbeitspflicht, z.B. Urlaub, Arbeitsunfähigkeit mit<br />
der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, in die Berechnung einzubeziehen<br />
sind. Dagegen ist unbezahlter Sonderurlaub bei der Berechnung vollständig<br />
außer Acht zu lassen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 1.10.2002, AP Nr. 1 zu<br />
§ 6 AtG = DB 2003, 1683).<br />
Außer Betracht bleiben bei der Bestimmung der bisherigen wöchentlichen<br />
Arbeitszeit <strong>arbeitsrechtliche</strong> Regelungen über die Erbringung oder Verteilung<br />
der vereinbarten Arbeitszeit, z.B. regelmäßig wechselnde tatsächliche Arbeitszeiten<br />
(Weisungen der BA).<br />
Die sich im Rahmen einer Arbeitszeitflexibilisierung ergebende Arbeitszeit ist<br />
als hälftige Arbeitszeit auch dann anzuerkennen, wenn bei unterschiedlichen<br />
wöchentlichen Arbeitszeiten während des Kalenderjahres, etwa bei unterschiedlicher<br />
tariflicher regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit im Sommer <strong>und</strong><br />
Winter, die wöchentliche Arbeitszeit im maßgebenden Verteilzeitraum die Hälfte<br />
der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit geringfügig über- oder unterschreitet.<br />
Beispiel (aus den Weisungen der BA):<br />
Bisherige wöchentliche Arbeitszeit<br />
(hier gleichzeitig tarifliche regelmäßige<br />
wöchentliche Arbeitszeit)<br />
39 St<strong>und</strong>en<br />
Tarifliche Arbeitszeit von Januar bis März 37 St<strong>und</strong>en<br />
April bis September 41 St<strong>und</strong>en<br />
Oktober bis Dezember 37 St<strong>und</strong>en<br />
Verteilung der Altersteilzeitarbeit:<br />
Arbeitsphase von April bis September wöchtl. 41 St<strong>und</strong>en<br />
Freizeitphase von Januar bis März –<br />
Ergebnis:<br />
Oktober bis Dezember –<br />
Der Arbeitnehmer arbeitet im Jahresdurchschnitt 20,5 St<strong>und</strong>en, obwohl die<br />
hälftige bisherige Arbeitszeit 19,5 St<strong>und</strong>en beträgt. 20,5 St<strong>und</strong>en sind als<br />
Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit anzuerkennen.<br />
41
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 42<br />
2.2.4.3 Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit nach Beginn der<br />
Altersteilzeitarbeit<br />
Eine Verlängerung der tariflichen oder betrieblichen Arbeitszeit nach<br />
Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung führt nicht zu einer Verlängerung der<br />
regelmäßigen Arbeitszeit. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat dies in sieben Urteilen<br />
vom 11.4.2006 so entschieden. In den Verfahren ging es um die Auswirkungen<br />
von Pflichtst<strong>und</strong>enerhöhungen für in Altersteilzeit befindliche Lehrer<br />
(z.B. – 9 AZR 369/05 – NZA 2006, 245 <strong>und</strong> – 9 AZR 664/05 –; s. hierzu auch<br />
Nimscholz, PuR 2007, 12). Seine Aussagen haben aber allgemeine Bedeutung:<br />
Abzustellen ist auf die „bisherige wöchentliche Arbeitszeit“, also die<br />
Arbeitszeit, die mit dem Arbeitnehmer vor dem Übergang in die Altersteilzeit<br />
vereinbart war (ungenau ist insoweit der amtliche Leitsatz in der Sache – 9<br />
AZR 369/05 –, wonach es auf den Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
ankommt). Eine spätere allgemeine Erhöhung der tariflichen oder vertraglichen<br />
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit während der laufenden<br />
Altersteilzeit erlaubt es nicht, den Alterteilzeitvertrag entsprechend anzupassen,<br />
da dann keine Altersteilzeit i.S.d. des Gesetzes vorliegt. Dies wird auch<br />
bestätigt unter Ziff. 16.2 der Durchführungsanweisung (DA) der BA. In den Fällen<br />
hat das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht aber eine entsprechende anteilige Kürzung<br />
des für den Mindestnettobetrag maßgeblichen Bruttoentgelts in der Arbeitsphase<br />
zugelassen (z.B. – 9 AZR 368/05, 371/05, 420/05 <strong>und</strong> 429/05). In der<br />
Freistellungsphase hat der Arbeitnehmer dagegen Anspruch auf die durch<br />
seine Vorarbeit in der Arbeitsphase erworbenen Entgeltansprüche. Diese sind<br />
zeitversetzt „spiegelbildlich“ zu bemessen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
4.10.2005 – 9 AZR 449/04 –, NZA 2006, 506).<br />
Das B<strong>und</strong>esministerium des Innern vertritt im Einvernehmen mit dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Soziales <strong>und</strong> dem B<strong>und</strong>esministerium der Finanzen<br />
mit R<strong>und</strong>schreiben vom 13.10.2006 an die Obersten B<strong>und</strong>esbehörden die<br />
Auffassung, dass jede nachträgliche Änderung zum „Nichtvorliegen von<br />
Altersteilzeit i.S. des AtG“ führt. Es handele sich weder förderungsrechtlich<br />
noch im sozialversicherungsrechtlichen Sinne um eine Altersteilzeitbeschäftigung<br />
mit der Folge, dass<br />
die steuerliche Privilegierung der Aufstockungsleistungen entfällt,<br />
die Beitragsfreiheit der Aufstockungsleistungen entfällt,<br />
Förderleistungen der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit an den Arbeitgeber nicht zu<br />
erbringen sind <strong>und</strong><br />
den betreffenden älteren Beschäftigten der Rentenzugang nach § 237<br />
SGB VI – Altersrenten nach Altersteilzeit – verschlossen bleibt.<br />
Die Höhe des Arbeitsentgelts ist dabei nicht entscheidend.<br />
42
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 43<br />
Die BA führt dazu in ihrer Dienstanweisung zu § 2 AtG unter Ziff. 2.2 Abs. 18<br />
aus:<br />
„Im Gegensatz zur Reduzierung der Arbeitszeit führt eine allgemeine<br />
tarifliche oder betriebliche Erhöhung der Arbeitszeit während der Altersteilzeit<br />
nicht zu einer Erhöhung der reduzierten Arbeitszeit i.S. des § 2<br />
Abs. 1 Nr. 2 AtG. Wird die Arbeitszeit des Arbeitnehmers gleichwohl der<br />
betrieblichen Arbeitszeit angepasst, führt die Notwendigkeit der Halbierung<br />
der Arbeitszeit nicht zu einer Verkürzung der Arbeitsphase, sondern<br />
nur zu einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit in der Arbeitsphase.<br />
Bis zum Ende der Arbeitsphase muss ein entsprechender Zeitausgleich<br />
erfolgen.“<br />
Die DA erlaubt damit keine vertragliche Änderung der im Alterteilzeitvertrag<br />
festgelegten „bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit“, sondern lässt nur den Aufbau<br />
eines (zusätzlichen) Wertguthabens zu, das aber bis zum Ende der<br />
Arbeitsphase wieder abgebaut werden muss (Nimscholz, PuR 2007, 11). Es<br />
handelt sich dabei um Wertguthaben im Sinne des § 7 Abs. 1a SGB IV. Damit<br />
kann den betrieblichen Bedürfnissen nach einer gleich langen Arbeitszeit aller,<br />
auch der sich in der Arbeitsphase befindlichen Arbeitnehmer Rechnung getragen<br />
werden. Ein Anspruch auf eine entsprechende Vereinbarung über die Bildung<br />
von Wertguthaben in der Arbeitsphase besteht nicht.<br />
Beispiel:<br />
Altersteilzeitvereinbarung 2 Jahre<br />
(vom 1.1.2005 bis 31.12.2006)<br />
Bisherige Arbeitszeit 35 Std. wöchentlich<br />
Verminderte Arbeitszeit 17,5 Std. wöchentlich<br />
(während der gesamten Dauer der Altersteilzeit)<br />
Arbeitszeitverteilung geplant<br />
7 Std. täglich x 200 Tage (1 Jahr) = 1.400 Std.<br />
Arbeitszeiterhöhung ab 1.7.2005<br />
von 35 auf 40 Std. wöchentlich (oder von 7 auf 8 Std. täglich)<br />
Tatsächliche Verteilung der Arbeitszeit<br />
(vom 01.01. bis 30.06.2006) 7 Std. x 100 Tage = 700 Std. <strong>und</strong><br />
(vom 01.07. bis 31.12.2005) 8 Std. x 87,5 Tage = 700 Std.<br />
(= 12,5 Tage mit 100 Std. Zeitausgleich/Freizeit mit üblicher Vergütung <strong>und</strong><br />
Wertguthabenbildung)<br />
43
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 44<br />
Denkbar ist aber auch, dass keine Arbeitszeitanpassung erfolgt <strong>und</strong> der Altersteilzeitbeschäftigte<br />
abweichend von der allgemeinen Erhöhung der Arbeitszeit<br />
wie einzelvertraglich vereinbart weiterhin täglich 7 St<strong>und</strong>en arbeitet.<br />
Die Frage, welche Auswirkungen eine Reduzierung der tariflichen oder<br />
betrieblichen wöchentlichen Arbeitszeit nach Beginn der Altersteilzeit hat, ist<br />
bislang von der Rechtsprechung nicht geklärt. Aus der Begründung des BAG<br />
zum Verbot der Verlängerung der Arbeitszeit in der Altersteilzeit, dass „ausschließlich<br />
die bei Abschluss des Altersteilzeitvertrages geltende Wochenst<strong>und</strong>enzahl<br />
für die Gesamtdauer der Altersteilzeit maßgebend ist“, das ergebe<br />
sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG, wird zum Teil geschlossen, dass auch eine<br />
Minderung der Arbeitszeit während der Altersteilzeit nicht zulässig ist, was<br />
nicht zuletzt wegen der möglichen rentenrechtlichen Auswirkungen von<br />
Bedeutung ist.<br />
Die Deutsche Rentenversicherung B<strong>und</strong> hat sich jedoch auf Anfrage von Datakontext<br />
mit Schreiben vom 20.7.2007 (Az.: 3020-50226/449 u. 323-163,12)<br />
der Rechtsauffassung der BA in ihrer Dienstanweisung zu § 2 AtG unter Ziff.<br />
2.2 Abs. 18 angeschlossen, die wie folgt lautet:<br />
„Kommt es während der Arbeitsphase des Blockmodells zu einer Reduzierung<br />
der wöchentlichen Arbeitszeit (z.B. durch Haustarifvertrag) <strong>und</strong><br />
wird hiervon auch das Altersteilzeitarbeitsverhältnis erfasst, ist eine<br />
Anpassung der (reduzierten) Arbeitszeit i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 2 möglich;<br />
eine Anpassung der Altersteilzeitvereinbarung ist aber nicht zwingend.<br />
Wird die Arbeitszeit angepasst, hat dies keine Auswirkung auf den<br />
Beginn der Freistellungsphase.“<br />
Daraus ergibt sich, dass eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit während<br />
der Altersteilzeitarbeit auch nicht renten- oder steuerschädlich ist.<br />
2.2.4.4 Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit aufgr<strong>und</strong> tariflicher<br />
Quotenregelungen<br />
Ist mit der Alterszeitarbeit bereits vor dem 1.7.2004 begonnen worden, bereiten<br />
in der Praxis die Tarifverträge, die für einen bestimmten Prozentsatz der<br />
Belegschaft eine höhere Arbeitszeit zulassen, Probleme (tarifliche Quotenregelungen).<br />
Das ist insbesondere in der Metallindustrie Tarifpraxis. Die Problematik<br />
ist durch R<strong>und</strong>erlass der BA vom 20.2.2002 (IIa2 – 7317 (10) A) wie<br />
folgt gelöst: Die Verknüpfung der Mitteilungspflicht mit der Quotenregelung hat<br />
zur Folge, dass der Arbeitgeber die Quote nicht jederzeit, sondern nur zu den<br />
tariflich vorgesehenen Zeitpunkten erreichen muss (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Beschl. vom 17.6.1997 – 1 ABR 3/97 –, NZA 1998, 213). Wird somit die Quote<br />
zu den jeweiligen Stichtagen eingehalten, ist ein zwischenzeitliches Überschreiten<br />
der Quote aus <strong>arbeitsrechtliche</strong>r Sicht unschädlich. Dann ist die<br />
erhöhte Arbeitszeit zugr<strong>und</strong>e zu legen. Das gilt nach dem R<strong>und</strong>erlass in<br />
44
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 45<br />
Abstimmung mit den Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger<br />
auch für die Bewertung aus sozialversicherungsrechtlicher <strong>und</strong> rentenrechtlicher<br />
Sicht. Maßgeblich ist dabei der letzte Stichtag vor dem Übergang in die<br />
Altersteilzeitarbeit.<br />
In Abstimmung mit dem (früheren) B<strong>und</strong>esministerium für Arbeit sind Altersteilzeitvereinbarungen,<br />
denen entgegen § 6 Abs. 2 S. 3 AtG eine höhere bisherige<br />
Arbeitszeit zugr<strong>und</strong>e liegt, förderungsrechtlich nicht als Altersteilzeitarbeit<br />
im Sinne des AtG anzuerkennen; sie müssten entsprechend angepasst<br />
werden. Altersteilzeitvereinbarungen, die gegen § 6 Abs. 2 S. 3 AtG verstoßen<br />
<strong>und</strong> nicht angepasst werden, können auch nicht als Altersteilzeitarbeit im<br />
Sinne des Sozialversicherungsrechts, des Steuerrechts bzw. des Rentenrechts<br />
anerkannt werden. Diese <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> sind ab dem 1.1.2002 anzuwenden.<br />
Soweit Altersteilzeitvereinbarungen, die vor diesem Zeitpunkt vereinbart<br />
wurden, entgegen § 6 Abs. 2 AtG wegen Überschreitens der tariflichen Quote<br />
eine höhere tarifliche Arbeitszeit zugr<strong>und</strong>e liegt, hat es hiermit sein Bewenden,<br />
sofern die Altersteilzeitarbeit vor dem 1.1.2002 begonnen hat.<br />
Bei einem Beginn der Altersteilzeitarbeit ab 1.7.2004 stellt sich diese Problematik<br />
nicht mehr, weil nach neuem Recht die bisherige regelmäßige<br />
Arbeitszeit nicht mehr auf die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit<br />
begrenzt ist.<br />
2.2.5 Verteilzeitraum beim Blockmodell<br />
2.2.5.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
In der Praxis wird meist eine unterschiedliche, diskontinuierliche Verteilung der<br />
Arbeitszeit im sog. Blockmodell vereinbart: Die Altersteilzeitarbeit beginnt mit<br />
einer Arbeitsphase, in der der Arbeitnehmer seine bisherige Arbeitszeit beibehält,<br />
der Arbeitszeitausgleich auf die Hälfte der Arbeitszeit erfolgt in der<br />
anschließenden Freistellungsphase. Möglich sind auch unterschiedliche<br />
wöchentliche Arbeitszeiten, z.B. zwei Wochen volle Arbeitszeit, zwei Wochen<br />
frei. Bei diesen Modellen sind Einschränkungen bei der Dauer der Altersteilarbeit<br />
zu beachten. Das AtG beschränkt nämlich die Dauer des Verteilzeit -<br />
raumes für die Arbeitszeit, beim Blockmodell für die Gesamtdauer von Arbeitsphase<br />
<strong>und</strong> Freistellungsphase.<br />
Das AtG unterscheidet danach, ob eine tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
Altersteilzeitarbeit besteht oder nicht. Ohne eine tarifliche Gr<strong>und</strong>lage sind die<br />
Möglichkeiten für eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit erheblich eingeschränkt.<br />
Nach dem AtG ist zu prüfen, ob der Arbeitgeber von dem Geltungsbereich<br />
eines Altersteilzeit-Tarifvertrages erfasst wird. Das ist der Fall,<br />
wenn es einen Altersteilzeit-Tarifvertrag gibt, der in räumlicher, fachlicher, persönlicher<br />
<strong>und</strong> zeitlicher Hinsicht gelten würde, wenn der Arbeitgeber tarifge-<br />
45
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 46<br />
b<strong>und</strong>en wäre. Tarifverträge aus anderen Branchen oder Regionen können<br />
nicht herangezogen werden.<br />
Welcher der Durchführungswege (Blockzeit oder kontinuierliche Altersteilzeitarbeit)<br />
gewählt wird, ist im Altersteilzeitarbeitsvertrag festzulegen. Meist<br />
wird von beiden Seiten Altersteilzeitarbeit im Blockmodell gewollt sein. Soweit<br />
aber nicht ein anzuwendender Altersteilzeit-Tarifvertrag dem Arbeitnehmer<br />
ausdrücklich einen Anspruch insbesondere auf Altersteilzeitarbeit im Blockmodell<br />
einräumt, sind die §§ 106 GewO, 315 BGB anzuwenden. Das bedeutet,<br />
dass der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit durch sein Weisungsrecht<br />
unter Wahrung des billigen Ermessens festlegt; m.a.W.: Der Arbeitgeber kann<br />
dann nicht zu einer bestimmten Form der Altersteilzeitarbeit gezwungen werden.<br />
So hat etwa der Arbeitnehmer nach TV ATZ des öffentlichen Dienstes i.d.<br />
Fassung vom 30.6.2000 keinen Anspruch auf Altersteilzeitarbeit im Blockmodell<br />
(Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Urt. vom 31.10.2007 – 6 Sa<br />
136/07 –).<br />
2.2.5.2 Bereiche ohne einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
Gibt es keinen Altersteilzeit-Tarifvertrag, unter dessen räumlichen <strong>und</strong> fachlichen<br />
Geltungsbereich der Betrieb oder das Unternehmen fallen würde, wenn<br />
es tarifgeb<strong>und</strong>en wäre, ist der höchstzulässige Verteilzeitraum gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
auf drei Jahre beschränkt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 1. Halbs. AtG). Die Arbeitszeit darf<br />
im Durchschnitt von bis zu drei Jahren die Hälfte der bisherigen wöchentlichen<br />
Arbeitszeit nicht überschreiten <strong>und</strong> ggf., um Versicherungspflicht im Sinne des<br />
SGB III zu gewährleisten, die Grenzen des § 8 SGB IV nicht unterschreiten.<br />
Im Blockmodell darf in diesem Fall die Altersteilzeitarbeit insgesamt nur maximal<br />
drei Jahre dauern (1 1/2 Jahre Arbeitsphase <strong>und</strong> 1 1/2 Jahre Freistellungsphase).<br />
Merke:<br />
Ohne tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lage darf Altersteilzeitarbeit im Blockmodell<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nur bis zur Gesamtdauer von drei Jahren vereinbart werden!<br />
Hiervon abweichende Vereinbarungen sind unzulässig <strong>und</strong> damit nicht förderfähig<br />
<strong>und</strong> renten- <strong>und</strong> steuerschädlich, da keine Altersteilzeit i.S.d. AtG vereinbart<br />
worden ist.<br />
Eine 6-jährige Altersteilzeit ohne tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lage kann aber durch<br />
Kombination von Block <strong>und</strong> (Konti-)Teilzeit erreicht werden. Die Beschränkung<br />
in § 2 Abs. 2 AtG bezieht sich nur auf den Verteilzeitraum <strong>und</strong> nicht auf die<br />
Dauer der Altersteilzeit. Das bedeutet, dass während der Gesamtdauer der<br />
Altersteilzeitarbeit Blockmodell <strong>und</strong> Teilzeitmodell kombiniert werden können,<br />
z.B. 1,5 Jahre Vollarbeitsphase, 3 Jahre (Konti-)Teilzeit <strong>und</strong> 1,5 Jahre Freistellungsphase<br />
(DA der BA 2.3 Abs. 1, Unterabs. 2 zu § 2).<br />
46
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 47<br />
2.2.5.3 Ausnahmen<br />
Das AtG lässt in § 2 Abs. 2 S. 5 abweichend von diesen <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong>n auch<br />
ohne einen Altersteilzeit-Tarifvertrag in bestimmten Branchen <strong>und</strong> für bestimmte<br />
Personengruppen die Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit im Blockmodell<br />
mit einem Verteilzeitraum von mehr als drei <strong>und</strong> bis zu zehn Jahren durch<br />
Betriebsvereinbarung, oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch einzelvertragliche<br />
Vereinbarung zu. Voraussetzung ist, dass in dem Bereich des<br />
Arbeitgebers tarifvertragliche Regelungen über die Verteilung der Arbeitszeit<br />
(nicht: Altersteilzeit!) nicht getroffen sind oder üblicherweise nicht getroffen<br />
werden (§ 2 Abs. 2 S. 5 AtG).<br />
Das trifft insbesondere für „Freiberufler“ bzw. für folgende Bereiche (Branchen)<br />
zu (s. hierzu die Weisungen der BA):<br />
Arbeitgeber- <strong>und</strong> Unternehmensverbände,<br />
Freie Wohlfahrtspflege, z.B. Mitgliedsorganisationen des Paritätischen<br />
Wohlfahrtsverbandes, soweit dort keine Verbands- oder Firmentarifverträge<br />
gelten,<br />
Gewerkschaften,<br />
Industrie- <strong>und</strong> Handelskammern, Handwerkskammern,<br />
Makler, Handelsvertreter, Auskunfteien, Werbeagenturen,<br />
Management-Holdings von Konzernen, die wegen der Vielfältigkeit der<br />
Konzernaktivitäten nicht eindeutig dem Geltungsbereich eines Tarifvertrages<br />
zugeordnet werden können;<br />
Notare;<br />
politische Parteien (einige SPD-Landesbezirke ausgenommen);<br />
Privatschulen (mit Ausnahme der B<strong>und</strong>esschulen des DGB <strong>und</strong> einiger Firmentarifverträge);<br />
Rechtsanwälte (mit Ausnahme einiger regional begrenzter Tarifverträge);<br />
Schaustellergewerbe, Zirkus- <strong>und</strong> Kirmesunternehmen (mit Ausnahme der<br />
Unterhaltungskünstler in Varietés);<br />
Software-Entwicklung (mit Ausnahme einiger Firmentarifverträge);<br />
Sportvereine (mit Ausnahme vereinzelter Haustarifverträge);<br />
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater;<br />
zahntechnische Labore.<br />
47
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 48<br />
Weitere Wirtschaftszweige, für die tarifliche Regelungen zur Verteilung der<br />
Arbeitszeit nicht getroffen sind, können bei der Agentur für Arbeit erfragt werden.<br />
Für sog. außertarifliche Angestellte, die von den tarifvertraglichen Regelungen<br />
ausgenommen sind, gibt es im Allgemeinen keine tarifliche Regelung<br />
über die Verteilung der Arbeitszeit. Besteht ein Betriebsrat, kann eine längere<br />
Altersteilzeit im Blockmodell über drei Jahre <strong>und</strong> bis zu zehn Jahre nur vereinbart<br />
werden, wenn eine Betriebsvereinbarung dies vorsieht. Das gilt aus<br />
steuer- <strong>und</strong> sozialversicherungsrechtlichen Gründen auch für Fälle ohne Förderung<br />
durch die BA. Nur wenn ein Betriebsrat nicht besteht, kann Altersteilzeitarbeit<br />
im Blockmodell auch einzelvertraglich über drei Jahre hinaus vereinbart<br />
werden.<br />
Mit leitenden Angestellten (§ 5 Abs. 3 <strong>und</strong> 4 BetrVG) können die langen Verteilzeiträume<br />
stets einzelvertraglich, <strong>und</strong> zwar für bis zu zehn Jahre vereinbart<br />
werden.<br />
2.2.5.3 Bereiche mit einschlägigem Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
Durch Altersteilzeit-Tarifvertrag, unter dessen räumlichen, fachlichen, persönlichen<br />
<strong>und</strong> zeitlichen Geltungsbereich der Betrieb oder das Unternehmen<br />
fällt, kann dagegen ein Verteilzeitraum von bis zu sechs Jahren zugelassen<br />
werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 2. Halbs.). Altersteilzeitvereinbarungen auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage eines Tarifvertrages können auch einen Gesamtzeitraum von mehr<br />
als sechs Jahren (bis zu zehn Jahre) umfassen, wenn die Arbeitszeit im Durchschnitt<br />
des Förderzeitraumes von sechs Jahren die Hälfte der bisherigen<br />
Arbeitszeit nicht überschreitet <strong>und</strong> eine versicherungspflichtige Beschäftigung<br />
im Sinne des SGB III vorliegt (DA der BA 2.2 Abs. 6 <strong>und</strong> 7 zu § 2).<br />
Das gilt auch für Tarifverträge zur Altersteilzeit, die bereits gekündigt sind <strong>und</strong><br />
lediglich nachwirken. Während der Nachwirkung können auch neue Altersteilzeitvereinbarungen<br />
abgeschlossen werden (DA der BA 2.3 Abs. 2 Unterabs.<br />
2 zu § 2). Dagegen kann der Tarifvertrag nach seinem Ablauf nicht mehr<br />
herangezogen werden, wenn die Nachwirkung im Tarifvertrag ausdrücklich<br />
ausgeschlossen ist.<br />
Altersteilzeitvereinbarungen auf der Gr<strong>und</strong>lage eines Tarifvertrages können<br />
auch einen Gesamtzeitraum von mehr als sechs Jahren umfassen (§ 2 Abs. 3<br />
AtG). In diesem Fall kann die Altersteilzeitarbeit – wie sonst auch – für die<br />
Dauer von sechs Jahren gefördert werden. Der Förderzeitraum von sechs Jahren<br />
liegt dann innerhalb des Gesamtzeitraums der Altersteilzeitarbeit. Die Voraussetzungen<br />
des AtG sind erfüllt, wenn die Arbeitszeit im Durchschnitt des<br />
Förderzeitraums die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht<br />
überschreitet <strong>und</strong> eine versicherungspflichtige Beschäftigung i.S. des SGB III<br />
vorliegt. Es reicht aus, wenn die Aufstockungsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1<br />
48
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 49<br />
AtG (Entgeltaufstockung <strong>und</strong> zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge) nur<br />
in dem Zeitraum von sechs Jahren erbracht werden (DA der BA 2.3 Abs.3 zu<br />
§ 2).<br />
Wird der freigemachte Arbeitsplatz verspätet wiederbesetzt, ist eine bis zu 6jährige<br />
Förderung auch dann noch möglich, wenn im verbliebenden Zeit raum<br />
noch mindestens eine 3-jährige Freistellungsphase vorhanden ist. Der Förderzeitraum<br />
innerhalb des Gesamtzeitraums der vereinbarten Altersteilzeit<br />
muss daher nicht zwingend zusammenhängend sein. Wichtig ist nur, dass für<br />
den zu fördernden Gesamtzeitraum (Arbeits- <strong>und</strong> Freistellungsphase) auch<br />
die entsprechenden Aufstockungsleistungen durchgängig erbracht werden<br />
(DA der BA).<br />
Bei der Anwendung eines Altersteilzeit-Tarifvertrages, unter dessen Geltungsbereich<br />
der Arbeitgeber fällt, auf den konkreten Fall sind die folgenden<br />
Fallgruppen zu unterscheiden.<br />
Tarifbindung des Arbeitgebers<br />
Der Arbeitgeber ist Mitglied des tarifschließenden Arbeitgeberverbandes oder<br />
– bei einem Haus- oder Firmentarifvertrag – selbst Tarifvertragspartei:<br />
Ist auch der Arbeitnehmer tarifgeb<strong>und</strong>en (Mitglied der tarifschließenden<br />
Gewerkschaft), so gelten die tariflichen Regelungen, auch die über einen längeren<br />
Verteilzeitraum, ohne weiteres unmittelbar <strong>und</strong> zwingend für das Altersteilzeitverhältnis.<br />
Aus der Systematik des AtG <strong>und</strong> allgemeinem Tarifrecht<br />
ergibt sich, dass der Arbeitgeber die Geltung des Tarifvertrages mit seinem<br />
längeren Verteilzeitraum auch mit den nicht tarifgeb<strong>und</strong>enen Arbeitnehmern<br />
im Altersteilzeitvertrag vereinbaren kann; allerdings muss dann der gesamte<br />
Tarifvertrag einschließlich der Regelungen über Aufstockungsleistungen etc.<br />
übernommen werden. Wird mit den nicht tarifgeb<strong>und</strong>enen Arbeitnehmern die<br />
Geltung des Altersteilzeit-Tarifvertrages nicht vereinbart, so darf mit diesen<br />
Arbeitnehmern Altersteilzeitarbeit auch nur für einen gesetzlichen Verteilzeit -<br />
raum von bis zu drei Jahren vereinbart werden. Eine Übernahme des Tarifvertrages<br />
durch Betriebsvereinbarung ist rechtlich ausgeschlossen, es sei<br />
denn, der Tarifvertrag sieht den Abschluss einer Betriebsvereinbarung ausdrücklich<br />
vor (§ 77 Abs. 3 BetrVG). Der Arbeitgeber ist zu der einzelvertraglichen<br />
Übernahme des Tarifvertrages nicht verpflichtet; er verstößt nicht gegen<br />
den Gleichbehandlungsgr<strong>und</strong>satz, wenn er die nicht tarifgeb<strong>und</strong>enen Arbeitnehmer<br />
insgesamt nicht nach dem Tarifvertrag behandelt. Er darf aber nicht<br />
Gruppen von Arbeitnehmern einbeziehen <strong>und</strong> ohne Sachgründe willkürlich<br />
einzelne Arbeitnehmer hiervon ausnehmen. Tarifvertragliche Regelungen, die<br />
dem Arbeitgeber verbieten, die Geltung des Tarifvertrages mit sog. Außenseitern<br />
abzuschließen, sind nach der Rechtsprechung des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts<br />
wegen Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 3 GG unwirksam.<br />
49
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 50<br />
Keine Tarifbindung des Arbeitgebers<br />
Der nicht tarifgeb<strong>und</strong>ene Arbeitgeber hat „im Geltungsbereich“ eines einschlägigen<br />
Altersteilzeittarifvertrages die Möglichkeit, die einschlägige tarifvertragliche<br />
Regelung durch Betriebsvereinbarung <strong>und</strong>, (nur) wenn ein<br />
Betriebsrat nicht besteht, einzelvertraglich zu übernehmen (§ 2 Abs. 2 S. 2<br />
AtG). Wenn <strong>und</strong> soweit der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für eine Betriebsvereinbarung<br />
enthält, können auch nicht tarifgeb<strong>und</strong>ene Arbeitgeber mit dem<br />
Betriebsrat eine entsprechende Betriebsvereinbarung abschließen (§ 2 Abs. 2<br />
S. 3 AtG). Der Begriff „Geltungsbereich des Tarifvertrages“ umfasst nach Einführung<br />
der Insolvenzsicherung des § 8a AtG sozialrechtlich nur noch den<br />
fachlichen <strong>und</strong> zeitlichen (nicht mehr aber den persönlichen <strong>und</strong> räumlichen)<br />
Geltungsbereich des Tarifvertrages, der gelten würde, wenn die Parteien tarifgeb<strong>und</strong>en<br />
wären (DA der BA 2.3 Abs. 4 Unterabs. 2 zu § 2). So kann in derselben<br />
Branche der Altersteilzeittarifvertrag einer anderen Region übernommen<br />
werden, z.B. für einen Betrieb des papierverarbeitenden Gewerbes in<br />
Bayern auch ein Tarifvertrag zur Altersteilzeit in Sachsen Anhalt. Unzulässig<br />
wäre hingegen z.B. die Übernahme eines Altersteilzeit-Tarifvertrages der Versicherungswirtschaft<br />
durch einen Arbeitgeber des Groß- <strong>und</strong> Außenhandels.<br />
Übernommen werden können auch Tarifverträge zur Altersteilzeit, die im Zeitpunkt<br />
des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung bereits gekündigt sind<br />
<strong>und</strong> lediglich nachwirken.<br />
Die tarifliche Regelung über die Altersteilzeitarbeit ist als Ganzes zu übernehmen;<br />
unzulässig ist es, einzelne Punkte herauszugreifen, etwa nur die<br />
Regelung über den Verteilzeitraum. Das gilt auch für die Höhe der Aufstockungsleistungen<br />
<strong>und</strong> für die Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen. Sind in dem Tarifvertrag<br />
aber auch Regelungspunkte enthalten, die zur Altersteilzeitarbeit keine<br />
Berührungspunkte haben (z.B. reine Entgeltfragen), muss der Tarifvertrag hinsichtlich<br />
dieser Punkte nicht übernommen werden (DA der BA).<br />
2.2.5.4 Betriebsübergang (§ 613a BGB)<br />
Arbeitnehmer, die auf der Gr<strong>und</strong>lage eines Tarifvertrages mit ihrem Arbeitsgeber<br />
Altersteilzeitarbeit mit einem mehr als 3-jährigen Verteilzeitraum (Blockmodell)<br />
vereinbart haben <strong>und</strong> die von der Ausgliederung eines Betriebsteils<br />
unter Anwendung von § 613a BGB betroffen sind, können den Verteilzeitraum<br />
weiterhin in Anspruch nehmen. Das gilt auch dann, wenn beim neuen Arbeitgeber<br />
kein Tarifvertrag zur Altersteilzeit Anwendung findet. Entsprechendes<br />
gilt, wenn die Altersteilzeitarbeit rechtswirksam mit Wirkung für die Zukunft mit<br />
dem bisherigen Arbeitgeber vereinbart wurde, die Altersteilzeitarbeit aber erst<br />
beim neuen Arbeitgeber beginnen soll oder beginnt (DA der BA 2.3 Abs. 2<br />
Unterabs. 3 zu § 2).<br />
50
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 51<br />
2.2.6 Fortdauer der Versicherungspflicht<br />
2.2.6.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG liegt ferner nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer<br />
bei der halbierten Arbeitszeit während der gesamten Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
versicherungspflichtig beschäftigt im Sinne des<br />
SGB III ist (§ 2 Abs.1 Nr.2 a.E. AtG). Darauf ist besonders bei Teilzeitbeschäftigten<br />
zu achten. Bei einer bisherigen Arbeitszeit von weniger als 30 St<strong>und</strong>en<br />
wöchentlich muss die in § 8 SGB IV festgelegte Entgeltgrenze von 400<br />
Euro überschritten werden (§ 8 SGB IV). Dadurch wird sichergestellt, dass im<br />
Falle der vorzeitigen Beendigung der Altersteilzeitarbeit der Schutz der<br />
Arbeitslosenversicherung gewährleistet ist (DA der BA 2.2 Abs. 6 zu § 2). Das<br />
ist insbesondere in Insolvenzfällen von Bedeutung, weil das AtG bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen,<br />
die vor dem 1.7.2004 begonnen haben, eine Insolvenzsicherung<br />
nicht vorsieht. Zu beachten ist bei einer Altersteilzeitbeschäftigung<br />
von weniger als 15 St<strong>und</strong>en wöchentlich, dass die Versicherungspflicht<br />
entfällt (<strong>und</strong> damit auch der Anspruch des Arbeitgebers auf Erstattungsleistungen,<br />
wenn der ältere Arbeitnehmer neben seiner Altersteilzeitbeschäftigung<br />
Arbeitslosengeld bezieht (§ 27 Abs. 5 SGB III)).<br />
§ 15 f AtG enthält wegen der Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung<br />
durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eine<br />
Übergangsregelung, die am 1.4.2003 in Kraft getreten ist. Um zu verhindern,<br />
dass aufgr<strong>und</strong> der Neuregelung des § 8 SGB IV bei bereits abgeschlossenen<br />
bzw. angebahnten Altersteilzeitvereinbarungen eine versicherungspflichtige<br />
Beschäftigung nicht mehr gegeben ist, gelten Arbeitnehmer, bei denen mit der<br />
Durchführung der Altersteilzeit vor dem 1.4.2003 begonnen wurde <strong>und</strong> die bis<br />
zu diesem Zeitpunkt in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach<br />
dem SGB III gestanden haben (Arbeitsentgelt > 325 EUR bis 400 EUR), auch<br />
nach dem 1.4.2003 als versicherungspflichtig beschäftigt, wenn sie die bis zum<br />
31.3.2003 geltenden Voraussetzungen für das Vorliegen einer versicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung weiter erfüllen.<br />
Bei einer Arbeitszeit von weniger als 15 St<strong>und</strong>en wöchentlich darf der Arbeitnehmer<br />
neben seiner Altersteilzeitbeschäftigung kein Arbeitslosengeld oder<br />
keine Arbeitslosenhilfe beziehen, da sonst die Versicherungspflicht <strong>und</strong> damit<br />
auch der Anspruch des Arbeitgebers auf die Erstattungsleistungen entfällt<br />
(§ 27 Abs. 5 SGB III). Der Arbeitnehmer sollte vor Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
hierüber belehrt werden. Der Arbeitnehmer kann allerdings<br />
wegen § 32 Abs. 1 SGB nicht verpflichtet werden, die Inanspruchnahme<br />
zu unterlassen. Vorsorglich sollte deswegen in diesen Fällen vereinbart<br />
werden, dass das Altersteilzeitarbeitsverhältnis für den Fall, dass der Arbeitnehmer<br />
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe in Anspruch nimmt, ohne Kündigung<br />
an dem Tag, der dem ersten Tag der Inanspruchnahme vorangeht,<br />
automatisch endet <strong>und</strong> als normales Teilzeitarbeitsverhältnis fortgesetzt wird;<br />
51
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 52<br />
überdies sollten für diesen Fall Schadensersatzansprüche vorbehalten werden,<br />
soweit die BA wegen der vorzeitigen Beendigung vom Arbeitgeber<br />
erbrachte Aufstockungsleistungen nicht erstattet. Ist eine solche Vereinbarung<br />
unterblieben, ist zu überlegen, ob das Altersteilzeitarbeitsverhältnis wegen der<br />
Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe gekündigt werden<br />
kann.<br />
Da die Altersteilzeitarbeit Versicherungspflicht im Sinne des SGB III begründen<br />
muss, liegt keine Altersteilzeitarbeit mehr vor, wenn ein Anspruch auf eine<br />
Rente wegen voller Erwerbsminderung zuerkannt ist (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB<br />
III). Die Versicherungsfreiheit tritt mit Beginn der Rente ein. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
wird unterbrochen. Für die Zeit vom Rentenbeginn bis zum<br />
Zugang des Rentenbescheides (mit dem dritten Tage der Aufgabe zur Post)<br />
verbleibt es bei dem Bestehen von Altersteilzeitarbeit (RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, 2.1.7.4). Endet das Beschäftigungsverhältnis, so<br />
liegt ein sog. Störfall vor.<br />
Während der Freistellungsphase im Blockmodell ruht der Anspruch auf Krankengeld<br />
mit der Folge, dass die Beiträge nach dem geminderten Beitragssatz<br />
gemäß § 243 Abs. 1 SGB V zu entrichten sind (B<strong>und</strong>essozialgericht, Urt. vom<br />
25.8.2004 – B 12 KR 22/02 R-, ZTR 2005, 114 = EzBAT TV Altersteilzeit<br />
Nr. 34).<br />
2.2.6.2 Reduzierung der Arbeitszeit bei Rente wegen teilweiser<br />
Erwerbsminderung<br />
Wird die versicherungspflichtige Beschäftigung nach § 7 Abs. 1 SGB IV in reduziertem<br />
Umfang weitergeführt, weil dem Arbeitnehmer während der Altersteilzeitarbeit<br />
eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung zuerkannt wird,<br />
besteht ab diesem Zeitpunkt eine neue bisherige Arbeitszeit. Für die sich<br />
anschließende Freistellungsphase bestehen drei Möglichkeiten der Entsparung<br />
von Wertguthaben (RdSchr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.7.3):<br />
spiegelbildlich (jeweils bemessen an den bisherigen durchschnittlichen<br />
Arbeitszeiten in der Arbeitsphase),<br />
durchschnittlich (bemessen an den unterschiedlichen bisherigen Arbeitszeiten<br />
in der Arbeitsphase),<br />
nach dem letzten niedrigeren Arbeitsentgelt (das verbleibende Wertguthaben<br />
ist im Rahmen eines Störfalls zu verbeitragen).<br />
2.2.6.3 Verzicht auf die Arbeitsleistung während der Arbeitsphase<br />
Verzichtet der Arbeitgeber im Blockmodell aus betriebsbedingten Gründen<br />
während der Arbeitsphase – nicht nur vorübergehend – auf die tatsächliche<br />
52
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 53<br />
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers, kann das dazu führen, dass die Voraussetzungen<br />
des § 7a Abs. 1 a SGB VI nicht erfüllt sind. Folge wäre, dass ein<br />
Beschäftigungsverhältnis während der Freistellung nicht gegeben ist mit der<br />
Konsequenz, dass in dieser Zeit auch die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen<br />
nach dem AtG nicht vorliegen. Dem Unternehmen drohen<br />
außerdem, wenn das nicht beachtet wird, erhebliche Haftungsrisiken. Die Ausführungen<br />
in <strong>Kapitel</strong> III unter 3.2, auf die verwiesen wird, müssen aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> unbedingt beachtet werden.<br />
Mit einem solchen Fall hat sich das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht im Urt. vom<br />
10.2.2004 – 9 AZR 401/02 – (BAGE 109, 294 = NZA 2004, 606) befasst: Der<br />
Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer den Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
angeboten, der dann auch zu Stande gekommen ist. Noch am<br />
Tage des Abschlusses der Vereinbarung <strong>und</strong> vor dem Beginn der Altersteilzeit<br />
hatte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich für die gesamte Dauer<br />
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses (Arbeitsphase <strong>und</strong> Freistellungsphase)<br />
freigestellt. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat entschieden, dass damit die Voraussetzungen<br />
für Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes <strong>und</strong> für<br />
einen vorzeitigen Rentenbezug wegen Altersteilzeit nicht gegeben sind. Da in<br />
dem Angebot eines Arbeitgebers auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
gegenüber dem Arbeitnehmer die Erklärung liegt, er könne bei Annahme<br />
dieses Angebots einen Anspruch auf vorzeitige Altersrente wegen Altersteilzeit<br />
erwerben, haftet der Arbeitgeber für diese objektiv falsche Erklärung.<br />
Der Arbeitnehmer ist so zu stellen, als wäre die „Altersteilzeitvereinbarung“<br />
nicht abgeschlossen worden.<br />
2.2.6.4 Arbeitsunfähigkeit des Altersteilzeitarbeitnehmers in der<br />
Arbeitsphase – medizinische Rehabilitationsmaßnahme<br />
Wird der Altersteilzeitarbeitnehmer während der Arbeitsphase arbeitsunfähig<br />
krank, kann er keine Wertguthaben für die Freistellungsphase erarbeiten. Für<br />
die Dauer der Entgeltfortzahlung nach dem EFZG liegt dennoch Altersteilzeit<br />
im Sinne des AtG vor. Für diese Zeit sind die Aufstockungsleistungen weiter<br />
zu erbringen; ein gesetzlicher Anspruch danach besteht nicht. Aus einem<br />
Tarifvertrag kann sich aber eine Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, die<br />
Aufstockungsleistungen auch nach Ablauf der gesetzlichen Entgeltfortzahlung<br />
zu zahlen (so B<strong>und</strong>esarbeitsgericht zu § 8 TV ATZ des öff. Dienstes i.V.m. § 91<br />
TVV für Angestellte, abgeschlossen zwischen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung<br />
Hamburg e.V. <strong>und</strong> ver.di i.d.F. vom 23.3.2003: Weiterzahlung, solange<br />
der Arbeitnehmer Anspruch auf „Krankenbezüge“ hat, Urt. vom 15.8.2006 – 9<br />
AZR 639/05 –, ZTR 2007, 31).<br />
Altersteilzeitarbeit im Sinne des Sozialversicherungsrechts nach Ablauf der<br />
Entgeltfortzahlung setzt voraus, dass für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit die<br />
Aufstockungsleistungen zum Entgelt <strong>und</strong> die zusätzlichen Rentenversiche-<br />
53
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 54<br />
rungsbeiträge weiterhin erbracht werden. Im Förderfall erfolgt dies durch die<br />
BA, die dann anstelle des Arbeitgebers die Aufstockungsleistungen zum Entgelt<br />
<strong>und</strong> die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge in der gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Höhe übernimmt. Eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers<br />
hierzu besteht nicht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 15.8.2006 – 9 AZR<br />
639/05 –); eine entsprechende Verpflichtung kann sich aber aus einem Tarifvertrag<br />
oder einer Betriebsvereinbarung oder aus dem Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
ergeben (zur Antragspflichtversicherung in der Rentenversicherung s.<br />
<strong>Kapitel</strong> V). Der Arbeitgeber bekommt dann die Aufstockungsleistungen zum<br />
Entgelt <strong>und</strong> die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge in der gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Höhe von der BA erstattet (siehe <strong>Kapitel</strong> VIII).<br />
2.2.7 Kontinuierliche Entgeltzahlung<br />
Das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit sowie der Aufstockungsbetrag<br />
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1a AtG müssen für die gesamte Dauer der Altersteilzeitarbeit,<br />
d.h. auch während der Freistellungsphase, fortlaufend gezahlt werden.<br />
Hierbei muss die Angemessenheit der Arbeitsentgeltzahlung in der Freistellungsphase<br />
gewährleistet bleiben (vgl. hierzu § 7 Abs. 1a S. 1 Nr. 2 SGB IV).<br />
Der Zinssatz bei Verzug des Arbeitgebers beträgt 5 Prozentpunkte über dem<br />
Basiszinssatz (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 23.2.2005 – 10 AZR 602/03 –,<br />
NZA 2005, 694). Schuldet der Arbeitgeber nettolohnbezogene Leistungen, so<br />
hat er ihrer Berechnung – soweit keine besonderen Bemessungsbestimmungen<br />
getroffen sind – gr<strong>und</strong>sätzlich die auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen<br />
Lohnsteuermerkmale zugr<strong>und</strong>e zu legen. Einer ihn belastenden Änderung der<br />
Lohnsteuerklasse kann er ggf. den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten.<br />
Die Wahl der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV ist regelmäßig<br />
nicht missbräuchlich (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 13.6.2006 – 9 AZR<br />
423/05 –, NZA 2007, 275; s. hierzu auch B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
17.1.2006 – 9 AZR 558/04 –, NZA 2006,1001).<br />
2.2.8 Zahlung der Aufstockungsbeträge<br />
2.2.8.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG setzt weiterhin voraus, dass der Arbeitgeber<br />
mindestens die gesetzlichen Aufstockungsleistungen (Aufstockung des<br />
Bruttoarbeitsentgelts <strong>und</strong> zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung)<br />
erbringt. Dabei ist zwischen sog. Altfällen (Beginn der Altersteilzeitarbeit vor<br />
dem 1.7.2004) <strong>und</strong> sog. Neufällen (Beginn der Altersteilzeitarbeit ab<br />
1.7.12004) zu unterscheiden (ausführlich zur Berechung der Aufstockungsleistungen<br />
<strong>Kapitel</strong> II). Probleme können sich bei der Berechnung ergeben,<br />
wenn der Arbeitnehmer im Rahmen einer Entgeltumwandlung auf Teile seines<br />
Entgelts zugunsten einer betrieblichen Altersvorsorge oder für eine Direkt-<br />
54
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 55<br />
versicherung auf laufendes Entgelt verzichtet. Da die Altersteilzeit-Tarifverträge<br />
<strong>und</strong> -Betriebsvereinbarungen insoweit in aller Regel keine eindeutigen<br />
Festlegungen enthalten, ist zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten im Altersteilzeit-Arbeitsvertrag<br />
eindeutig festzulegen, von welchem Bruttoarbeitsentgelt<br />
ausgegangen werden soll (s. hierzu <strong>Kapitel</strong> II, Ziff. 2.3.2 <strong>und</strong> 7.7).<br />
2.2.8.2 Beginn der Altersteilzeit bis zum 30.6.2004<br />
Beginnt die Altersteilzeitarbeit vor dem 1.7.2004, gelten die bisherigen Regelungen:<br />
Der Arbeitgeber muss aufgr<strong>und</strong> eines Tarifvertrages, einer Regelung<br />
der öffentlichen Kirchen <strong>und</strong> der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften,<br />
einer Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen Vereinbarung mit<br />
dem Arbeitnehmer mindestens die gesetzlich vorgesehenen Aufstockungsbeträge<br />
zum Arbeitsentgelt <strong>und</strong> zur Rentenversicherung zahlen. Arbeitnehmer,<br />
die ihre bisherige Arbeitszeit verringert haben, ohne einen Altersteilzeitvertrag<br />
abzuschließen, haben keinen Anspruch auf die gesetzlichen oder<br />
tariflichen Aufstockungsbeträge. Durch den Ausschluss von den gesetzlichen<br />
oder tariflichen Leistungen, die Altersteilzeitarbeitnehmer erhalten, werden<br />
insbesondere teilzeitbeschäftigte Frauen weder unmittelbar noch mittelbar diskriminiert<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 20.8.2002, NZA 2003, 510 = DB<br />
2003, 727: zum TV ATZ des öff. Dienstes).<br />
Das Teilzeitbruttoarbeitsentgelt muss um mindestens 20 v.H., jedoch mindestens<br />
auf 70 v.H. des bisherigen (pauschalierten) Mindestnettobetrages aufgestockt<br />
werden; das ist das Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer für eine<br />
Arbeitsleistung bei bisheriger wöchentlicher Arbeitszeit erhalten würde.<br />
Der Arbeitgeber muss neben der Entgeltaufstockung zusätzliche Beiträge zur<br />
gesetzlichen Rentenversicherung zahlen, <strong>und</strong> zwar mindestens in der Höhe<br />
des Beitrags, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 v.H. des bisherigen<br />
Arbeitsentgelts im Sinne des § 6 Abs. 1 AtG <strong>und</strong> dem Arbeitsentgelt für<br />
die Altersteilzeitarbeit entfällt, höchstens jedoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze<br />
(§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 AtG).<br />
Zu den Einzelheiten s. die Darstellung in <strong>Kapitel</strong> II.<br />
2.2.8.3 Beginn der Altersteilzeit nach dem 30.6.2004<br />
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 in der neuen Fassung ist Voraussetzung für die Altersteilzeit,<br />
dass der Arbeitgeber aufgr<strong>und</strong> eines Tarifvertrages, einer Regelung<br />
der Kirchen <strong>und</strong> der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, einer<br />
Betriebsvereinbarung oder einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer<br />
a) das Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeit um mindestens 20 v.H.<br />
aufstockt, wobei die Aufstockung weitere Entgeltbestandteile umfassen<br />
kann, <strong>und</strong><br />
55
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 56<br />
b) für den Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung<br />
mindestens in Höhe des Beitrags entrichtet, der auf 80 v.H.<br />
des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den<br />
Unterschiedsbetrag zwischen 90 v.H. der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze<br />
<strong>und</strong> dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur<br />
Beitragsbemessungsgrenze.<br />
Damit entfällt die bisherige Gegenrechnung, ob der sog. „Mindestnettobetrag“<br />
erreicht wird. Anstelle des „bisherigen Arbeitsentgelts“ wird der Begriff des<br />
„Regelarbeitsentgelts“ eingeführt. Gemäß § 6 Abs. 1 AtG ist das Regelarbeitsentgelt<br />
das auf einen Monat entfallende, vom Arbeitgeber regelmäßig zu<br />
zahlende sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt, soweit es die Beitragsbemessungsgrenze<br />
des SGB III nicht überschreitet. Entgeltbestandteile,<br />
die nicht laufend gezahlt werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Bei<br />
betrieblichen oder tariflichen Einmalzahlungen sollte geprüft werden, ob nicht<br />
eine monatliche Auszahlung in Höhe von 1/12 rechtlich möglich ist. Die Erstattungsleistungen<br />
der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit richten sich ab 1.7.2004 nach<br />
diesen Regelungen (§ 4 Abs. 1 AtG).<br />
Verweist ein Tarifvertrag auf die früheren Berechnungsregeln für das Mindestnettoentgelt,<br />
kann das bedeuten, dass auch bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen,<br />
die nach dem 30.6.2007 beginnen, die alten Berechnungsregeln<br />
zu § 15 AtG weiter anzuwenden sind. Das gilt etwa für die Berechnung des<br />
Mindestnettobetrags des Altersteilzeitentgelts gemäß § 5 Abs. 3 des TV ATZ<br />
des öff. Dienstes (Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, Urt. vom 17.4.2007<br />
– 8 Sa 23/07 –, Revision eingelegt unter – 9 AZR 466/07 –).<br />
2.2.9 Unterbrechung der Altersteilzeit<br />
Zu einer Unterbrechung der Altersteilzeit ohne Störfall kann es in folgenden<br />
Fällen kommen:<br />
Zubilligung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, s. dazu oben<br />
2.2.6.1,<br />
betriebsbedingte notwendige Rückkehr zur Beschäftigung mit bisheriger<br />
wöchentlicher Arbeitszeit in der Arbeits- <strong>und</strong> Freistellungsphase; es muss<br />
ein sachlicher Gr<strong>und</strong> vorliegen. Die Unterbrechung muss vertraglich vereinbart<br />
werden. In Förderfällen empfiehlt sich eine Beratung durch die<br />
Agentur für Arbeit,<br />
unbezahlter Urlaub während der Arbeitsphase (s. hierzu <strong>Kapitel</strong> V: Behandlung<br />
von Fehlzeiten während der Altersteilzeitarbeit) <strong>und</strong><br />
zum Ganzen: RdSchr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.7.6; DA der BA<br />
2.2 Abs. 19 zu § 2).<br />
56
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 57<br />
2.2.10 Ende der Altersteilzeitarbeit<br />
2.2.10.1 Ende bei Renteneintritt<br />
Durch den Altersteilzeitvertrag wird das bisher in aller Regel unbefristete<br />
Arbeitsverhältnis vertraglich in ein befristetes Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
geändert. Es endet dann automatisch mit Fristablauf. Altersteilzeitarbeit im<br />
Sinne des AtG liegt aber nur vor,<br />
wenn die Arbeitszeit aufgr<strong>und</strong> von Altersteilzeitarbeit im Sinne von § 2 <strong>und</strong><br />
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AtG vermindert worden ist (§ 237 Abs. 1 Nr. 3b SGB VI)<br />
<strong>und</strong><br />
die Vereinbarung zumindest bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt reicht, zu<br />
dem der Arbeitnehmer eine – auch gekürzte – Altersrente in Anspruch nehmen<br />
kann (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG).<br />
Die Altersteilzeitarbeit muss gr<strong>und</strong>sätzlich zumindest bis zu dem Zeitpunkt vereinbart<br />
werden, in dem der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine – ggf. auch<br />
gekürzte – Altersrente hat. Voraussetzung für die vorgezogene Altersrente<br />
nach Altersteilzeitarbeit ist, dass die Arbeit aufgr<strong>und</strong> von Altersteilzeitarbeit für<br />
mindestens 24 Monate vermindert worden ist (§ 237 Abs. 1 Nr. 3b SGB VI).<br />
Im Blockmodell müssen damit die Arbeits- <strong>und</strong> die Freizeitphase jeweils mindestens<br />
12 Kalendermonate dauern, damit ein Rentenzugang wegen 24monatiger<br />
Altersteilzeitarbeit erfolgen kann. Besteht ein Anspruch auf eine vorgezogene<br />
Altersrente vor Ablauf von 24 Monaten, muss die Arbeitszeit für<br />
diese kürzere Dauer auf die Hälfte reduziert werden.<br />
In vielen Tarifverträgen ist festgelegt, dass das Altersteilzeitverhältnis endet,<br />
wenn der Arbeitnehmer in Altersteilzeit Anspruch auf eine Rente wegen Alters<br />
oder auf eine ungekürzte Altersrente hat. Eine Rente wegen Alters ist auch die<br />
Rente für schwerbehinderte Menschen oder die Altersrente für Frauen. Ihr<br />
Altersteilzeitverhältnis endet daher bereits in dem Zeitpunkt, in dem sie die<br />
Voraussetzungen für eine ungekürzte vorgezogene Altersrente gemäß § 236a<br />
SGB VI bzw. § 237a SGB VI erfüllen. Hierin liegt keine unzulässige Benachteiligung<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 18.11.2003 – 9 AZR 122/03 –, FA<br />
2004, 46; Urt. vom 27.4.2004 – 9 AZR 18/03 –, BAGE 110, 208 = NZA 2005,<br />
821).<br />
Es muss deswegen in jedem Einzelfall berechnet werden, wann der Arbeitnehmer<br />
frühestens die – auch gekürzte – vorgezogene Altersrente nach Altersteilzeitarbeit<br />
in Anspruch nehmen kann. Aus Haftungsgründen ist die Einholung<br />
einer Rentenauskunft dringend zu empfehlen. Vereinbarungen, nach<br />
denen der Arbeitnehmer bereits vor Erreichen dieses Rentenalters ausscheiden<br />
soll, erfüllen nicht die Voraussetzungen des AtG. Wann der Arbeitnehmer<br />
eine vorgezogene Rente wegen Alters beanspruchen kann, ergibt sich aus<br />
dem SGB VI (s. dazu unter <strong>Kapitel</strong> VII).<br />
57
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 58<br />
2.2.10.2 Ansprüche bei vorzeitiger Beendigung<br />
Eine tarifvertragliche Regelung, nach welcher der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
im Fall der vorzeitigen Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses eine<br />
etwaige Differenz zwischen der erhaltenen Vergütung <strong>und</strong> dem Entgelt für den<br />
Zeitraum der tatsächlichen Beschäftigung beanspruchen kann, das er ohne<br />
Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte, umfasst nur die Arbeits-, nicht jedoch<br />
die Freistellungsphase im Blockmodell. Differenzansprüche für die Monate der<br />
Arbeitsphase vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann der Altersteilzeiter<br />
nur als Insolvenzgläubiger geltend machen (so Landesarbeitsgericht<br />
Baden-Württemberg, Urt. vom 26.1.2004 – 15 Sa 113/03 –).<br />
Endet die Altersteilzeit mit ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit vorzeitig,<br />
hat der Beamte gr<strong>und</strong>sätzlich auch dann einen Anspruch auf Besoldung<br />
für höchstens sechs Monate entsprechend dem zeitlichen Umfang der vorgesehenen<br />
Beschäftigung, wenn die Dienstleistung während der „Arbeitsphase“<br />
gänzlich unterbleibt (B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht, Urt. vom 30.10.2002<br />
– 2 A 2/01 –, ZTR 2003, 206).<br />
2.2.10.3 Verlängerung der Altersteilzeit<br />
Aus Sicht des Sozialversicherungsrechts, Rentenrechts, Steuerrechts <strong>und</strong><br />
Förderrechts ist eine einvernehmliche Verlängerung der Altersteilzeit gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
möglich. Bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell muss aber beachtet<br />
werden, dass die Verteilung der Arbeitszeit im Blockmodell im Durchschnitt<br />
eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nur auf der Gr<strong>und</strong>lage eines Tarifvertrages<br />
möglich ist (s. hierzu 2.2.5.2). Außerdem muss der anzuwendende<br />
Tarifvertrag die Verlängerung auch tatsächlich zulassen, z.B. sechs oder zehn<br />
Jahre, <strong>und</strong> darf während der gesamten Dauer der Altersteilzeit die Hälfte der<br />
bisherigen Arbeitszeit nicht überschritten werden (s. hierzu oben 2.2.5). Bei<br />
einer Verlängerung der Arbeitsphase muss auch die Freistellungsphase spiegelbildlich<br />
verlängert werden. Erlöschenstatbestände nach § 5 Abs. 1 AtG sind<br />
zu beachten.<br />
2.2.11 Ungekürzte Altersrente von Schwerbehinderten, Berufs- <strong>und</strong><br />
Erwerbsunfähigen bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand<br />
Durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit<br />
vom 20.12.2000 (BGBl I, 1827) ist der Bestandsschutz für Schwerbehinderte<br />
bei der Heraufsetzung der Altersrente zum 1.1.2001 neu geregelt worden.<br />
Danach wird die Altersgrenze von 60 Jahren u.a. nicht angehoben für<br />
Versicherte, die<br />
58
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 59<br />
bis zum 16.1.1950 geboren sind <strong>und</strong> am 16.11.2000 schwerbehindert,<br />
berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31.12.2000 geltenden<br />
Recht waren oder<br />
vor dem 1.1.1942 geboren sind <strong>und</strong> 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine<br />
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben.<br />
Damit das keine Auswirkungen auf die Förderung bereits laufender Altersteilzeitvereinbarungen<br />
hat, bestimmt § 15e AtG, dass der Anspruch auf die Leistungen<br />
nach § 4 AtG abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 2 AtG nicht erlischt, wenn<br />
mit der Altersteilzeit vor dem 17.11.2000 begonnen worden ist <strong>und</strong> Anspruch<br />
auf eine ungeminderte Rente wegen Alters besteht, weil die Voraussetzungen<br />
nach § 236a S. 5 Nr. 1 SGB VI vorliegen.<br />
3 Die Einführung <strong>und</strong> Durchführung von<br />
Altersteilzeitarbeit<br />
3.1 Vorüberlegungen: Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für die Altersteilzeit<br />
In den vorstehenden Ausführungen sind die Voraussetzungen für Altersteilzeitarbeit<br />
im Sinne des AtG dargelegt. Diese müssen erfüllt sein, damit die<br />
Altersteilzeitarbeit arbeits-, sozialversicherungs- <strong>und</strong> steuerrechtlich anerkannt<br />
wird. Außerdem sind die Voraussetzungen für eine Förderung durch die<br />
BA im Überblick dargelegt. Dagegen enthält das AtG keinerlei Regelungen darüber,<br />
ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, Altersteilzeitarbeit einzuführen, <strong>und</strong><br />
ob der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Altersteilzeitarbeit hat, ggf. unter welchen<br />
Voraussetzungen.<br />
Das Gesetz selbst verpflichtet den Arbeitgeber nicht, Altersteilzeitarbeit im<br />
Betrieb oder Unternehmen einzuführen. Eine solche Verpflichtung kann sich<br />
aus einem Altersteilzeit-Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung über<br />
Altersteilzeitarbeit ergeben. Das bedeutet: Gibt es keine solchen Regelungen<br />
in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung, so muss der Arbeitgeber<br />
keine Altersteilzeitarbeit einführen. Er kann dies aber freiwillig tun, wobei<br />
er dann aber unter Umständen (bei Gruppenbildung) den Gleichbehandlungsgr<strong>und</strong>satz<br />
beachten muss. Auch ein Rechtsanspruch des Arbeitnehmers<br />
auf Altersteilzeitarbeit ergibt sich aus dem Gesetz nicht. Auch das kann<br />
entweder durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung näher geregelt sein,<br />
ebenso ggf. die näheren Voraussetzungen für einen solchen Anspruch.<br />
Vor Einführung der Altersteilzeitarbeit <strong>und</strong> dem Abschluss von Vereinbarungen<br />
muss das Unternehmen daher in jedem Fall prüfen, ob bei der Einführung<br />
<strong>und</strong> Durchführung von Altersteilzeitarbeit im Betrieb allein die Regelungen im<br />
AtG oder ob tarifvertragliche Regelungen über die Altersteilzeit anzuwenden<br />
sind oder ob ggf. auf entsprechende tarifvertragliche Regelungen zurückgegriffen<br />
werden kann <strong>und</strong> soll. Das hat insbesondere Bedeutung dafür,<br />
59
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 60<br />
ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, Altersteilzeitarbeit einzuführen (hierzu<br />
3.2.1),<br />
ob <strong>und</strong> ggf. unter welchen Voraussetzungen die Arbeitnehmer einen<br />
Anspruch auf Altersteilzeitarbeit haben (s. hierzu 3.4.),<br />
wie hoch die Aufstockungsleistungen sind (s. hierzu 2.2.8),<br />
für welche Zeitdauer Altersteilzeitarbeit im Blockmodell vereinbart werden<br />
kann, ob mithin bei einer Dauer der Altersteilzeitarbeit im Blockmodell von<br />
mehr als drei Jahren Altersteilzeit im Sinne des AtG vorliegt oder nicht<br />
(s. hierzu 2.2.5),<br />
wie die Rückabwicklung im Störfall zu berechnen ist (hierzu 7.6) <strong>und</strong><br />
ob <strong>und</strong> inwieweit der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte bei der Ein- <strong>und</strong><br />
Durchführung von Altersteilzeit hat (s. hierzu unten 9.).<br />
3.2 Prüfung der Tarifsituation<br />
Vor Überlegungen, Altersteilzeitarbeit einzuführen, ist aus den geschilderten<br />
Gründen immer zu prüfen, ob es einen Altersteilzeit-Tarifvertrag gibt, in dessen<br />
räumlichen, fachlichen, persönlichen <strong>und</strong> zeitlichen Geltungsbereich der<br />
Betrieb oder das Unternehmen fällt.<br />
3.2.1 Vorliegen eines einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrages<br />
Gibt es einen Altersteilzeit-Tarifvertrag, unter dessen räumlichen, fachlichen<br />
<strong>und</strong> zeitlichen Geltungsbereich der Betrieb oder das Unternehmen fällt, so ist<br />
zu unterscheiden:<br />
Der Arbeitgeber <strong>und</strong> auch der Arbeitnehmer sind tarifgeb<strong>und</strong>en:<br />
Der Arbeitgeber gehört dem tarifschließenden Arbeitgeberverband an oder er<br />
hat einen Altersteilzeit-Haus-/Firmentarifvertrag geschlossen <strong>und</strong> der Arbeitnehmer<br />
ist Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft. Der Altersteilzeit-<br />
Tarifvertrag gilt mit seinem jeweiligen Inhalt zwischen den Parteien unmittelbar<br />
<strong>und</strong> zwingend <strong>und</strong> legt die Mindestbedingungen (Aufstockungsbeträge)<br />
verbindlich fest. Der Arbeitgeber ist (nur) verpflichtet, Altersteilzeitarbeit einzuführen,<br />
wenn der Tarifvertrag das direkt anordnet oder dem Betriebsrat ein<br />
erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der Einführung der Altersteilzeitarbeit<br />
zubilligt <strong>und</strong> eine entsprechend abgeschlossene Betriebsvereinbarung das<br />
vorsieht. Der Arbeitnehmer hat unter diesen Voraussetzungen einen Anspruch<br />
auf Altersteilzeitarbeit, wenn dies der Tarifvertrag ohne Einschränkung vorsieht<br />
<strong>und</strong> die weiteren Voraussetzungen des Tarifvertrages erfüllt sind. Altersteilzeitarbeit<br />
in Form der Blockzeit kann über die gesetzliche Dauer von drei Jah-<br />
60
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 61<br />
ren hinaus vereinbart werden, wenn der Tarifvertrag das entweder ausdrücklich<br />
oder über eine Öffnungsklausel zulässt.<br />
Nur der Arbeitgeber ist tarifgeb<strong>und</strong>en:<br />
Ein einschlägiger Altersteilzeit-Tarifvertrag ist nur dann auf Arbeitnehmer anzuwenden,<br />
die nicht der tarifschließenden Gewerkschaft angehören,<br />
wenn dessen Geltung einzelvertraglich vereinbart ist, ggf. über eine Globalverweisung<br />
im Arbeitsvertrag auf alle Tarifverträge der Branche. Der<br />
Tarifvertrag darf solche Verweisungen in Arbeitsverträgen nicht organisierter<br />
Arbeitnehmer nicht verbieten; oder<br />
wenn die Anwendung aller einschlägigen Tarifverträge betriebsüblich ist;<br />
oder<br />
bei Allgemeinverbindlichkeitserklärung (§ 5 TVG); s. hierzu das Verzeichnis<br />
unter www.bmas.de.<br />
Der Altersteilzeit-Tarifvertrag kann die Einführung von Altersteilzeitarbeit<br />
unmittelbar anordnen. Altersteilzeitarbeit ist dann nur noch nach Maßgabe des<br />
Tarifvertrages durchzuführen. Andere Tarifverträge sehen lediglich die Möglichkeit<br />
der Einführung vor: So entscheidet etwa der Arbeitgeber nach dem TV<br />
ATZ Einzelhandel BY (§ 3 Nr. 1 Abs. 3 S. 1 vom 9.3.2001), im Anschluss an die<br />
Erörterungen mit dem Betriebsrat, frei darüber, ob er Altersteilzeit einführt <strong>und</strong><br />
über die Mindestdauer des § 3 Nr. 1 Abs. 3 Satz 2 TV ATZ Einzelhandel BY hinaus<br />
fortsetzt (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 5.6.2007 – 9 AZR 498/06 – nicht<br />
veröff.). Nach dem Tarifvertrag zur Förderung der Altersteilzeit für die Zeitungsverlage<br />
in Bayern kann der Arbeitgeber frei entscheiden, ob er Altersteilzeitverhältnisse<br />
begründen will. Begründet er Altersteilzeitverhältnisse, unterliegen<br />
diese den tariflichen Vorschriften (Landesarbeitsgericht München, Urt.<br />
vom 30.5.2007 – 7 Sa 1195/06 –, Revision eingelegt unter – 9 AZR 677/07 –).<br />
Soweit dem Betriebsrat durch den einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrag Mitbestimmungsrechte<br />
bei der Einführung oder Durchführung der Altersteilzeitarbeit<br />
eingeräumt werden, genügt es, dass der Arbeitgeber tarifgeb<strong>und</strong>en ist,<br />
da es sich insoweit um sog. Betriebsnormen handelt (§ 3 Abs. 2 TVG).<br />
Der Arbeitgeber ist nicht tarifgeb<strong>und</strong>en:<br />
Der Arbeitgeber ist nicht zur Einführung von Altersteilzeitarbeit verpflichtet. Will<br />
er diese einführen, ist zu überlegen, ob der Altersteilzeit-Tarifvertrag übernommen<br />
werden soll. § 2 Abs. 2 S. 2 <strong>und</strong> 3 AtG bestimmt hierzu: Die tarifvertragliche<br />
Regelung kann durch Betriebsvereinbarung oder, (nur) wenn ein<br />
Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer übernommen werden. Der zu übernehmende Tarifvertrag<br />
muss dann allerdings als Mindestregelung in Gänze übernommen werden.<br />
Nur dann darf Altersteilzeitarbeit im Blockmodell über drei Jahre hinaus<br />
61
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 62<br />
vereinbart werden! Können aufgr<strong>und</strong> eines solchen Tarifvertrages abweichende<br />
Regelungen in einer Betriebsvereinbarung getroffen werden, kann<br />
auch in Betrieben eines nicht tarifgeb<strong>und</strong>enen Arbeitgebers davon Gebrauch<br />
gemacht werden. Die Übernahme durch Betriebsvereinbarung durch den<br />
Betriebsrat ist nicht erzwingbar.<br />
In beiden Fällen kann der Altersteilzeittarifvertrag auch durch eine allgemeine<br />
Bezugnahmeklausel vereinbart sein. Bei einer so genannten dynamischen<br />
Klausel (z.B. „Für das Arbeitsverhältnis gelten die für das Unternehmen<br />
anwendbaren/einschlägigen Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung“)<br />
wird gr<strong>und</strong>sätzlich festgeschrieben, dass das gesamte Tarifwerk auf das<br />
Arbeitsverhältnis zur Anwendung kommen soll. Hierzu zählt auch ein Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 10.5.2005 – 9 AZR 249/04<br />
–, nicht veröff.: zum TV Altersteilzeit Deutschlandradio).<br />
Von einem später abgeschlossenen Tarifvertrag, in dem für bestimmte Altersgruppen<br />
am Ende des Altersteilzeitverhältnisses Abfindungszahlungen vorgesehen<br />
sind, werden einzelvertraglich zuvor vereinbarte Altersteilzeitarbeitsverhältnisse<br />
nur dann erfasst, wenn nach dem im Tarifvertrag erkennbar<br />
verlautbarten Willen der tarifschließenden Parteien auch schon abgeschlossene<br />
Altersteilzeitverhältnisse einbezogen werden sollten (B<strong>und</strong>es arbeitsge -<br />
richt, Urt. vom 1.12.2004 – 4 AZR 103/04 –, nicht veröff.). Ein Haustarifvertrag,<br />
der im Rahmen der Tariföffnungsklausel des § 10 B<strong>und</strong>esentgelttarifvertrag<br />
der chemischen Industrie abgeschlossen wurde, darf nicht in bestehende<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse eingreifen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
15.2.2006 – 4 AZR 4/05 –, nicht veröff.)<br />
Die Vereinbarung der Tarifvertragsparteien vom 16.11.1998, die den Beschäftigten,<br />
die eine Altersteilzeitvereinbarung nach dem Tarifvertrag Altersteilzeit<br />
Bodenpersonal vom 1.10.1996 abgeschlossen haben, ein Optionsrecht für<br />
neue Tarifbedingungen einräumt, bezog sich nur auf den zeitlich nachfolgenden<br />
Tarifvertrag vom 31.3.2000, nicht auf später abgeschlossene Tarifverträge<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 15.2.2005 – 9 AZR 52/04 –, EzA § 4 TVG<br />
Altersteilzeit Nr. 13).<br />
3.2.2 Fehlen eines einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrages<br />
Gibt es keinen einschlägigen Altersteilzeit-Tarifvertrag, ist der Arbeitgeber –<br />
ebenso wie bei seiner fehlenden Tarifbindung – nicht verpflichtet, Altersteilzeitarbeit<br />
einzuführen. Es bestehen zwei Handlungsmöglichkeiten:<br />
Nach den allgemeinen Regeln des Tarifrechts kann gr<strong>und</strong>sätzlich auch ein<br />
fachfremder Tarifvertrag für den Betrieb übernommen werden. Für die<br />
Altersteilzeitarbeit hat dies aber wenig praktische Bedeutung, da hierdurch<br />
eine längere als die gesetzliche Dauer der Blockzeit von drei Jahren gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nicht erreicht werden kann. Tarifliche Regelungen über die Dauer<br />
62
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 63<br />
der Blockzeit können nur „im Geltungsbereich“ eines Altersteilzeit-Tarifvertrages<br />
übernommen werden (§ 2 Abs. 2 S. 2 AtG; zu den Ausnahmen<br />
s. oben unter 2.2.5.3).<br />
Die rechtlichen Vorgaben ergeben sich allein aus dem AtG. Das Unternehmen<br />
ist zwar nicht gehindert, dem Arbeitnehmer freiwillig einzelvertraglich<br />
oder durch freiwillige Betriebsvereinbarung höhere Aufstockungsleistungen<br />
zu gewähren, als das AtG vorsieht. Soweit das AtG aber<br />
abweichende Regelungen nur durch Altersteilzeit-Tarifvertrag erlaubt, etwa<br />
bei der Dauer der Altersteilzeitarbeit, darf in der Altersteilzeitvereinbarung<br />
vom AtG nur abgewichen werden, soweit das AtG dies ausnahmsweise<br />
erlaubt. Das bedeutet: Auch in diesem Fall darf Altersteilzeitarbeit im Blockmodell<br />
nur für die Dauer von insgesamt drei Jahren vereinbart werden!<br />
3.3. Altersteilzeit-Tarifverträge (Überblick)<br />
3.3.1 Bedeutung der Altersteilzeit-Tarifverträge<br />
Zurzeit gibt es ca. 260 Flächen- <strong>und</strong> Haustarifverträge zur Förderung der<br />
Altersteilzeit. Bei der Entwicklung des Altersteilzeitkonzeptes für das Unternehmen<br />
ist die Frage der Tarifgeltung <strong>und</strong> -bindung von besonderer Bedeutung,<br />
wenn Altersteilzeitarbeit im Blockmodell eingeführt werden soll (s. dazu<br />
2.2.5.1. – 2.2.5.3). Ohne einschlägigen Tarifvertrag darf Altersteilzeitarbeit im<br />
Blockmodell für maximal drei Jahre vereinbart werden (Arbeitsphase <strong>und</strong><br />
anschließende Freistellungsphase jeweils 1 1/2 Jahre). Gr<strong>und</strong>sätzlich nur<br />
durch Altersteilzeit-Tarifvertrag kann dagegen eine Dauer von bis zu sechs<br />
Jahren oder sogar eine solche von bis zu zehn Jahren zugelassen werden,<br />
wenn die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraumes von sechs<br />
Jahren, der innerhalb der vereinbarten Altersteilzeitarbeit liegt, die Hälfte der<br />
bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht überschreitet (§ 2 Abs. 3 AtG); zu<br />
den Ausnahmen (Bereiche, in denen üblicherweise keine Tarifverträge bestehen<br />
<strong>und</strong> AT-Angestellte sowie leitende Angestellte) s. 2.2.5.3.<br />
3.3.2 Die tariflichen Regelungen im Überblick<br />
Vorreiter der Tarifentwicklung war die Chemische Industrie mit ihrem Tarifvertrag<br />
vom 29.3.1996, der unterdessen modifiziert worden ist. Einige Tarifverträge<br />
ermöglichen lediglich die Blockbildung der Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2<br />
AtG (Bankgewerbe, Groß- <strong>und</strong> Außenhandel, Energieversorgung – einige<br />
regionale Bereiche ausgenommen – <strong>und</strong> Wohnungswirtschaft). Die Tarifverträge,<br />
die nach der bis zum 31.12.1999 geltenden Fassung Altersteilzeitarbeit<br />
auf Vollbeschäftigte beschränkt hatten, sind unterdessen überarbeitet. Das ist<br />
z.B. durch den Tarifvertrag für die Chemische Industrie in der Fassung vom<br />
22.3.2000 <strong>und</strong> durch den Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 30.6.2000 zum<br />
63
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 64<br />
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit für den Bereich des öffentlichen<br />
Dienstes mit Wirkung ab 1.7.2000 geschehen.<br />
Die folgende Darstellung kann nur einen groben Überblick ohne Anspruch auf<br />
Vollständigkeit geben. Bei Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen im Geltungsbereich<br />
von Altersteilzeit-Tarifverträgen ist es unverzichtbar, die vollständigen<br />
Tarifverträge heranzuziehen.<br />
3.3.2.1 Anspruchsberechtigter Personenkreis<br />
Die Tarifverträge enthalten in aller Regel Verfahrensvorschriften zur Bestimmung<br />
des anspruchsberechtigten Personenkreises, zum Verfahren bei der<br />
Anwendung des Überforderungsschutzes <strong>und</strong> zur Auswahl, wenn mehr Arbeitnehmer<br />
den Wunsch nach Altersteilzeitarbeit haben, als nach dem Überforderungsschutz<br />
vorgesehen ist, z.B. Auswahl nach Lebensalter, Dauer der<br />
Betriebszugehörigkeit etc.<br />
Bei der Festlegung, ob <strong>und</strong> ggf. welche Arbeitnehmer ab Vollendung des 55.<br />
Lebensjahres den Übergang in die Altersteilzeitarbeit fordern können, sind vier<br />
Modelle erkennbar:<br />
Es besteht ein Anspruch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für<br />
Altersteilzeit vorliegen, solange die Überforderungsgrenze nicht überschritten<br />
wird, z.B. Versicherungswirtschaft bei mindestens zehnjähriger<br />
Unternehmenszugehörigkeit.<br />
Der Anspruch besteht im Rahmen der Überforderungsgrenze ab einem<br />
bestimmten Lebensalter (55. Lebensjahr: Chemische Industrie; 57.<br />
Lebensjahr: Druckindustrie <strong>und</strong> papier-, pappe- <strong>und</strong> kunststoffverarb.<br />
Industrie: Schichtarbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen; 58.<br />
Lebensjahr: Glasindustrie Bayern; 59. Lebensjahr: Erfrischungsgetränke<br />
Rheinland-Pfalz/Saarland; Kali- <strong>und</strong> Steinsalzbergbau; Metallindustrie:<br />
59–60: Anspruch für zwei Jahre; Zuckerindustrie: durch BV niedriger; 60.<br />
Lebensjahr: Öffentlicher Dienst, Metallindustrie – TV Beschäftigungsbrücke).<br />
Die Anspruchsberechtigung kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung<br />
festgelegt werden, z.B. Bauwirtschaft, Lederwarenindustrie, Metallindustrie;<br />
Mineralbrunnen Hessen, Süßwarenindustrie, Zuckerindustrie.<br />
Anspruchsausschluss bei betrieblichen Gründen: Dt. Bahn AG – oder bei<br />
personenbezogenen Gründen: Lufthansa AG; Dt. Post AG.<br />
3.3.2.2 Aufstockungsleistungen zum Entgelt<br />
Die Höhe der Aufstockungszahlung ist unterschiedlich geregelt. Der Mindestnettobetrag<br />
beträgt u.a. (Quelle: BdA – Tarifabteilung):<br />
64
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 65<br />
70 %: (gesetzliche Mindesthöhe): Bauwirtschaft; Dachdeckerhandwerk;<br />
Ernährungsindustrie Nieders./Bremen m. DAG; Steine u. Erden Bayern,<br />
75 %: Versicherungen,<br />
80 %: Druckindustrie, u.U. 85 % für Schichtarbeitnehmer; Energieversorgung<br />
Baden-Württemberg <strong>und</strong> Ost – AVEU-Bereich; Erzbergbau Ost:<br />
80–85 %; Holzverarbeitung Nordrhein; Süßwaren; Buch- <strong>und</strong> Zeitschriftenverlage<br />
NRW,<br />
82 %: Bleistiftindustrie: plus Abfindung; Einzelhandel Bayern: 82,5 %; Energieversorgung<br />
Bayern; Erfrischungsgetränke Hessen, Rheinland-Pfalz,<br />
Saarland; Groß- <strong>und</strong> Außenhandel: 82,5 %; Lederindustrie: 82,5 %; Metallindustrie;<br />
Mineralbrunnen Hessen; Obst- <strong>und</strong> Gemüseverarbeitung; Steine<br />
u. Erden Rhein. Unternehmerverb.,<br />
83 %: Lederwarenindustrie: 83,5 %; Öffentlicher Dienst; IBM Deutschland,<br />
85 %: Chemische Industrie; Deutsche Bahn AG; Erdöl- <strong>und</strong> Erdgasgewinnung;<br />
Erzbergbau Ost: 80–85 %; Glasindustrie; Kali- <strong>und</strong> Steinsalzbergbau;<br />
Kautschukindustrie: mind. 85 %, max. 95 %; Keramische Industrie;<br />
Kunststoffverarbeitung Baden-Württemberg <strong>und</strong> Bayern; Lufthansa AG:<br />
100 % bei Verzicht auf Ergebnisbeteiligung; Papierindustrie; papier-,<br />
pappe- <strong>und</strong> kunststoffverarbeitende Industrie; Preussen Elektra AG;<br />
Schuh industrie; Stahlindustrie; Textilreinigungsgewerbe; Zementindustrie;<br />
Zuckerindustrie;<br />
89 %: Dt. Post AG,<br />
zwischen 80 % <strong>und</strong> 95 %: Volkswagen AG – je nach Entgeltstufe.<br />
Rechtsprechung zu einzelnen Altersteilzeit-Tarifverträgen:<br />
Der Tarifvertrag der Wintershall AG zur Förderung der Altersteilzeit vom<br />
12.03.1999/26.04.1999 (TV Altersteilzeit) schließt einen Anspruch auf Leistungsprämie<br />
aus einer betrieblichen Gesamtzusage für Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
nicht aus, obwohl die außertarifliche Leistungsprämie in § 7 Abs. 1<br />
S 2 TV Altersteilzeit nicht ausdrücklich genannt ist. Diese Auslegung wird<br />
durch die Regelung der Entgeltumwandlung im Tarifvertrag der Wintershall AG<br />
über Altersvorsorge vom 9.04.2002 bestätigt (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
24.10.2006 – 9 AZR 713/05 –, nicht veröff.).<br />
§ 8 TV ATZ des öff. Dienstes knüpft an die tariflichen Regelungen an, nach<br />
denen sich die während der Altersteilzeit zu zahlende Altersteilzeitvergütung<br />
bemisst. Diese setzt sich aus den Bestandteilen „Teilzeitentgelt“ (§ 4 AltTZTV)<br />
<strong>und</strong> „Aufstockungsleistungen“ (§ 5 AltTZTV) zusammen. Im Falle krankheitsbedingter<br />
Arbeitsunfähigkeit während der Arbeitsphase besteht der Anspruch<br />
65
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 66<br />
auf die Aufstockungsleistungen nach § 8 Abs. 1 S 1 Halbs. 1 AltTZTV längs -<br />
tens für die Dauer der Entgeltfortzahlung. § 8 Abs. 1 S. 1 Halbs 2 AltTZTV enthält<br />
lediglich eine Berechnungsregelung. Der 2. Halbsatz betrifft die Aufstockung<br />
des § 5 Abs. 1 <strong>und</strong> Abs. 2 AltTZTV. Diese Leistungen sind an den<br />
Arbeitnehmer längstens bis zum Ablauf der Fristen für die Zahlung von „Krankenbezügen“<br />
(Entgeltfortzahlung <strong>und</strong> Krankengeldzuschuss nach dem Klammerzusatz<br />
von § 8 Abs. 1 S 1 Halbs 2 AltTZTV) zu erbringen (im Fall: Dauer<br />
<strong>und</strong> Höhe der bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit vom Arbeitgeber<br />
geschuldeten Leistungen richteten sich wegen der Dauer des zwischen den<br />
Parteien bestehenden Arbeitsverhältnisses nach § 71 Manteltarifvertrag für<br />
Angestellte (MTV Ang), geschlossen zwischen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung<br />
Hamburg e.V. <strong>und</strong> ver.di, in der Fassung vom 23.3.1993). Die Dauer der<br />
Krankenbezüge ist in § 71 MTV Ang. auf die Dauer von 26 Wochen begrenzt<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 15.8.2006 – 9 AZR 639/05 – ZTR 2007, 31).<br />
Zum Anspruch auf Aufstockung der Altersteilzeitvergütung gemäß Abschnitt I<br />
§ 10 Nr 4 des Tarifvertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen<br />
im Zusammenhang mit der Umgestaltung der B<strong>und</strong>eswehr (TV UmBw)<br />
vom 18.7.2001, wonach der Aufstockungsbetrag für den Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
so hoch sein muss, dass der Arbeitnehmer 88 v.H. des Nettobetrags<br />
seines bisherigen Arbeitsentgelts erhält (nur die auf Gr<strong>und</strong> des Kabinettsbeschlusses<br />
vom 14.6.2000 beschlossenen Maßnahmen, die unter anderem zur<br />
Auflösung oder Verkleinerung einer Dienststelle führen, werden vom Geltungsbereich<br />
des TV UmBw umfasst: B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
12.9.2006 – 9 AZR 213/06 –, ZTR 2007,191).<br />
Der Tarifvertrag Nr. 37d über die Altersteilzeit (TV ATZ) bei der Deutschen<br />
Post AG vom 02.04.1998 i.d.F. des Tarifvertrages Nr. 114 stellt klar, dass unregelmäßige<br />
Entgeltbestandteile unabhängig von den in § 5 Abs. 1 <strong>und</strong> Abs. 2<br />
TV ATZ für die Berechnung des Altersteilzeitarbeitsentgeltes zugr<strong>und</strong>e zu<br />
legenden Vergütungsbestandteilen zu zahlen sind. Da Zuschläge für Nacht-,<br />
Sonn- <strong>und</strong> Feiertagsarbeit monatlich je nach Art <strong>und</strong> Umfang der geleisteten<br />
Dienste anfallen, handelt es sich bei ihnen um „unregelmäßige Entgeltbe -<br />
standteile“ i.S.d. § 5 Abs. 3 UAbs. 2 TV ATZ. Die Auslegung des Begriffes „tatsächliches<br />
Aufkommen“ ergibt, dass unregelmäßige Entgeltbestandteile nur<br />
insoweit gezahlt werden müssen, als sie der Arbeitnehmer durch tatsächliche<br />
Arbeitsleistungen erworben hat. Deshalb sind sie auch zusätzlich zum Altersteilzeitarbeitsentgelt<br />
i.S.d. § 5 Abs. 1 <strong>und</strong> Abs. 2 TV ATZ zu gewähren, soweit<br />
sie durch zuschlagspflichtige Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erworben<br />
worden sind. Dies ist bei den Urlaubszuschlägen jedoch nicht der Fall, weil<br />
der Arbeitnehmer während des Urlaubs keine Ansprüche auf diese Zuschläge<br />
erwirbt. Durch die Verwendung des Wortes „tatsächlich“ haben die Tarifvertragsparteien<br />
klargestellt, dass nur durch tatsächliche Arbeitsleistung<br />
erworbene Zuschläge das nach § 5 Abs. 1 <strong>und</strong> Abs. 2 TV ATZ errechnete<br />
Altersteilzeitarbeitsentgelt erhöhen sollen. Gleiches gilt für den Krankenzu-<br />
66
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 67<br />
schlag nach § 28 Abschn. II Abs. 1 Buchst b MTV-DP AG, der in gleicher Weise<br />
errechnet wird wie der Urlaubszuschlag (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
21.11.2006 – 9 AZR 523/05 –, nicht veröff.).<br />
3.3.2.3 Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrages<br />
In der Mehrzahl der Tarifverträge wird der bis zum 30.6.2004 gesetzlich vorgeschriebene<br />
Mindest-Rentenversicherungsbeitrag auf der Basis von 90 %<br />
des bisherigen Arbeitsentgelts übernommen. Für die Arbeitnehmer günstigere<br />
Regelungen sehen vor:<br />
92 %: Süßwaren,<br />
95 %: Bleistiftindustrie: mit Modifikat.; Energieversorgung Bayern: mit<br />
Modifikat.; Erdöl- <strong>und</strong> Erdgasgewinnung; Erfrischungsgetränke Hessen,<br />
Rheinland/Pfalz; Holzverarbeitung Nordrhein; Metallindustrie: mit Modifikat.;<br />
Mineralbrunnen Hessen, Stahlindustrie,<br />
100 %: Volkswagen AG + halber Ausgleich Rentenabschlag.<br />
Die Regelungen enthalten teilweise Wahlmöglichkeiten <strong>und</strong> zusätzliche Regelungen<br />
zum Ausgleich für Rentenabschläge, z.B. Chemische Industrie, Kautschukindustrie,<br />
Erzbergbau Ost, Papierindustrie.<br />
Nach Auffassung des LAG Nürnberg (Urt. vom 27.11.2002 – 3 Sa 123/02 –)<br />
soll, wenn das Gehalt über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, nach § 6 des<br />
Altersteilzeitabkommens für die private Versicherungswirtschaft vom<br />
11.6.1997 ein Anspruch auf Zahlung des Aufstockungsbetrags bis zu 100 %<br />
der Beitragsbemessungsgrenze bestehen.<br />
Voraussetzung für die Förderung ist nach neuem Recht, dass der Arbeitgeber<br />
aus Anlass des Übergangs des Arbeitnehmers in die Altersteilzeitarbeit für den<br />
Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens<br />
in Höhe des Beitrags entrichtet, der auf 80 vom H<strong>und</strong>ert des Regelarbeitsentgelts<br />
für die Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag<br />
zwischen 90 vom H<strong>und</strong>ert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze<br />
<strong>und</strong> dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze<br />
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1b) AtG).<br />
3.3.2.4 Öffnungsklauseln<br />
Viele Tarifverträge regeln in einem ersten Teil, wann <strong>und</strong> unter welchen Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> mit welcher Dauer Altersteilzeitarbeit vereinbart werden<br />
kann, <strong>und</strong> sodann in einer Öffnungsklausel, dass weitergehende Vereinbarungen<br />
im Rahmen des AtG durch freiwillige Betriebsvereinbarung oder freiwillige<br />
einzelvertragliche Vereinbarung zulässig sind (z.B. §§ 1, 15 des Altersteilzeitabkommens<br />
für das private Versicherungsgewerbe). Über die Öff-<br />
67
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 68<br />
nungsklausel kann dann freiwillig eine längere Dauer der Blockzeit, als sie für<br />
den tariflichen Anspruch geregelt ist, im Rahmen der §§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1,<br />
2. Alt. AtG vereinbart werden.<br />
3.3.3 Außerkrafttreten des Tarifvertrages<br />
Der Tarifvertrag kann entweder durch Ablauf einer Befristung oder durch Kündigung<br />
beendet werden. Er wirkt nach (§ 4 Abs. 4 TVG), es sei denn, die Nachwirkung<br />
ist – wie häufig – im Tarifvertrag ausdrücklich ausgeschlossen. Bei<br />
Ausschluss der Nachwirkung gilt: Eine Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche<br />
Vereinbarung kann nicht mehr auf der Gr<strong>und</strong>lage des Tarifvertrages<br />
abgeschlossen werden, sondern nur noch im Rahmen des AtG. Ob Altersteilzeitvereinbarungen,<br />
die noch innerhalb der Laufzeit des Tarifvertrages abgeschlossen<br />
werden, aber erst nach Ablauf des nicht nachwirkenden Tarifvertrages<br />
beginnen, möglich sind, ist durch Auslegung des Tarifvertrages zu<br />
ermitteln. Soweit der Tarifvertrag keine Anhaltspunkte für eine Beschränkung<br />
enthält, dürften solche Vereinbarungen gr<strong>und</strong>sätzlich zulässig sein.<br />
3.4 Anspruch auf Altersteilzeitarbeit<br />
3.4.1 Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für den Anspruch<br />
Aus dem AtG selbst ergibt sich kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Altersteilzeitarbeit<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 12.12.2000, NZA 2001, 1209;<br />
Urt. vom 26.6.2001, NZA 2002, 98; s. auch B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
3.12.2002, DB 2003, 1851). Umgekehrt kann auch der Arbeitnehmer nicht hierzu<br />
gezwungen werden.<br />
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen, die ihre bisherige Arbeitszeit ohne<br />
einen Altersteilzeitarbeitsvertrag verringern, haben keinen Anspruch auf den<br />
tariflichen Aufstockungsbetrag. Durch den Ausschluss von den tariflichen Leistungen,<br />
die Altersteilzeitarbeitnehmer erhalten, werden teilzeitbeschäftigte<br />
Frauen weder unmittelbar noch mittelbar diskriminiert (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 20. 8.2002, DB 2003, 727 = NZA 2003, 510).<br />
3.4.2 Anspruch aus einem Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
Ein Anspruch kann sich aus einem Tarifvertrag ergeben, soweit dieser<br />
anwendbar ist:<br />
Viele Tarifverträge sehen einen Anspruch ab einem bestimmten Lebensalter<br />
vor, z.B. Metallindustrie, Öffentlicher Dienst, Süßwarenindustrie, teilweise<br />
beschränkt auf bestimmte Arbeitnehmergruppen, z.B. Druckindustrie für<br />
Schichtarbeiter. In anderen Tarifverträgen kann das maßgebliche Lebensalter<br />
oder eine längere Dauer der Altersteilzeitarbeit durch Betriebsvereinbarung<br />
68
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 69<br />
geregelt werden, z.B. Lederwarenindustrie, Norddeutsche Metallindustrie,<br />
Papierindustrie, Zuckerindustrie.<br />
Eine tarifliche Regelung, wonach dem Arbeitnehmer Altersteilzeit gewährt<br />
werden „kann“, räumt dem Arbeitgeber kein freies Ermessen ein. Der Arbeitgeber<br />
hat vielmehr nach billigem Ermessen in entsprechender Anwendung von<br />
§ 315 BGB zu entscheiden, ob er einen Altersteilzeitvertrag abschließen will<br />
oder nicht. Dabei kann der Arbeitgeber die mit der Altersteilzeit verb<strong>und</strong>enen<br />
Mehrbelastungen durch Aufstockungsbetrag <strong>und</strong> Übernahme der Beiträge zur<br />
Sozialversicherung berücksichtigen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
10.5.2005 – 9 AZR 294/04 –, EzA § 4 TVG Altersteilzeit Nr. 15 zum TV Altersteilzeit<br />
Deutschlandradio im Anschluss an B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
12.12.2000 – 9 AZR 706/99 –, BAGE 96,363: zum TV Altersteilzeit des öffentlichen<br />
Dienstes).<br />
Viele Tarifverträge räumen einen Anspruch auf Abschluss solcher Altersteilzeitarbeitsverträge<br />
ein, die enden sollen, sobald der Arbeitnehmer berechtigt<br />
ist, eine Altersrente ohne Abschläge in Anspruch zu nehmen (§ 236a SGB<br />
VI). Das hat zur Folge, dass Schwerbehinderte oder Frauen, die eine ungekürzte<br />
Rente vor Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch nehmen können,<br />
nur Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages bis zu diesem<br />
früheren Zeitpunkt haben. Diese Ungleichbehandlung ist nicht<br />
unzulässig, weil hierfür sachliche Gründe bestehen. Diese liegen im Zweck<br />
der gesetzlichen Regelung der Altersteilzeit (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
18.11.2003 – 9 AZR 122/03 –, FA 2004, 58 zum TV ATZ in der Eisen-, Metall<strong>und</strong><br />
Elektroindustrie NRW). Andererseits haben sie auch Anspruch auf eine<br />
Abfindung, wenn nach dem Altersteilzeitvertrag der Arbeitnehmer am Ende<br />
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses eine Abfindung erhält, die danach<br />
berechnet wird, wie viele Monate zwischen dem Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
<strong>und</strong> dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Arbeitnehmer<br />
Anspruch auf ungeminderte Altersrente hätte (Landesarbeitsgericht Berlin,<br />
Urt. vom 20.2.2004 – 13 Sa 2465/03 –, NZA-RR 2004, 398: Weil der Schwerbehinderte<br />
die Rente „vorzeitig“ in Anspruch genommen hatte, war der<br />
Zugangsfaktor um 0,003 für insgesamt 15 Monate gekürzt worden).<br />
Die Tarifverträge enthalten teilweise Regelungen darüber, in welcher Form<br />
die Altersteilzeitarbeit geleistet werden kann, insbesondere, ob <strong>und</strong> unter welchen<br />
Voraussetzungen ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine bestimmte<br />
Form der Altersteilzeitarbeit (Konti- oder Blockmodell) besteht. Nach Auffassung<br />
des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz (Urt. vom 26.6.2007 – 9 Sa<br />
920/06 –, Revision eingelegt unter – 9 AZR 620/07 –) richtet sich etwa der tarifliche<br />
Anspruch auf Begründung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach<br />
§ 2 des Tarifvertrages zur Förderung der Altersteilzeit der Chemischen<br />
Industrie i.d.F. vom 14.5.2004 (TV ATZ) auf ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
nach dem Altersteilzeitarbeitsmodell I <strong>und</strong> nicht auf ein solches im sog. Block-<br />
69
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 70<br />
modell. „Betrieb“ im Sinne des § 3 TV ATZ (Überforderungsschutz) ist nur ein<br />
selbständiger Betrieb im Sinne des BetrVG, nicht jedoch ein Betriebsteil nach<br />
§ 4 Abs. 1 BetrVG.<br />
Soweit eine entsprechende tarifliche Regelung nicht besteht, hat der Arbeitnehmer<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich keinen Anspruch auf eine bestimmte Form der Altersteilzeitarbeit,<br />
insbesondere auf Altersteilzeitarbeit in Form des Blockmodells.<br />
Auch in diesem Fall wird man dem Arbeitgeber aber kein völlig freies Entscheidungsrecht<br />
einräumen können, sondern für die Ablehnung einer geforderten<br />
Form der Altersteilzeitarbeit sachliche Gründe fordern müssen (§ 315<br />
BGB); insoweit gelten die <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> zur Frage, ob der Arbeitnehmer eine<br />
individualrechtlichen Anspruch auf Altersteilzeit hat, entsprechend.<br />
Der TV ATZ des öffentlichen Dienstes sieht einen Anspruch der Beschäftigten<br />
vor, den der Arbeitgeber aus bestimmten Gründen ablehnen kann.<br />
Danach darf der Arbeitgeber Anträge von Arbeitnehmern, die das 60. Lebensjahr<br />
vollendet haben, nur aus dringenden dienstlichen bzw. betrieblichen Gründen<br />
ablehnen (§ 2 Abs. 3 des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit im<br />
öffentlichen Dienst – TV ATZ –). Eine Ablehnung mit der Begründung, es fehlten<br />
die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Wiederbesetzung der Stelle,<br />
kann zwar für Beamte ausreichen (B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht, Urt. vom<br />
29.4.2004 – 2 C 21.3. <strong>und</strong> 22.3: Landesbeamte in Schleswig-Holstein). Anders<br />
ist das aber bei Angestellten <strong>und</strong> Arbeitern des öffentlichen Dienstes zu beurteilen,<br />
die kraft Mitgliedschaft in der tarifschließenden Gewerkschaft einen<br />
Anspruch aus dem TV ATZ haben. Die Aufwendungen des Arbeitgebers, die<br />
typischerweise mit jedem Altersteilzeitarbeitsverhältnis verb<strong>und</strong>en sind, stellen<br />
für sich allein regelmäßig noch keine dringenden betrieblichen/ dienstlichen<br />
Gründe dar (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 21.11.2006 – 9 AZR 393/06<br />
–, NZA 2007, 1236; Landesarbeitsgericht Köln, Urt. vom 20.11.2006 – 2 Sa<br />
833/06), andernfalls würde der tarifliche Anspruch auf Altersteilzeitarbeit vereitelt.<br />
Zu den typischen Aufwendungen gehören die finanziellen Lasten, die<br />
dem Arbeitgeber auf Gr<strong>und</strong> der gesetzlichen <strong>und</strong> tariflichen Vorschriften mit<br />
jedem Altersteilzeitarbeitsverhältnis entstehen. Das sind: die tariflich vorgeschriebene<br />
Aufstockung des Entgelts auf 83 v.H. des Nettoentgelts, die Abführung<br />
zusätzlicher Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung <strong>und</strong> die gebotenen<br />
Rückstellungen beim Blockmodell (BFH, 30. November 2005 – I R<br />
110/04 – BFHE 212, 83). Letztere verbleiben in voller Höhe beim Arbeitgeber,<br />
soweit er nicht durch Nachbesetzung des Arbeitsplatzes Förderleistungen der<br />
B<strong>und</strong>esagentur erhält. Nicht ausgeschlossen hat allerdings das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
dass im Einzelfall eine unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung<br />
eintreten kann, die unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Lage<br />
den Arbeitgeber berechtigt, die Begründung eines Altersteilzeitarbeitsvertrags<br />
aus dringenden entgegenstehenden betrieblichen Gründen abzulehnen.<br />
Unter welchen Umständen dies in Betracht kommt, hat es aber offengelassen.<br />
70
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 71<br />
Im Übrigen haben Arbeitnehmer ab Vollendung ihres 60. Lebensjahres nach<br />
§ 2 Abs. 2 TV ATZ Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrags<br />
mit ungekürzter Laufdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bis zum Übergang<br />
in den Ruhestand. § 2 Abs. 4 Satz 1 TV ATZ räumt dem Arbeitgeber keine<br />
Befugnis ein, die Dauer eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses auf zwei Jahre<br />
zu begrenzen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. Vom 2.1.11.2006 – 9 AZR 393/06 –).<br />
§ 2 Abs. 3 TV ATZ ist jedoch auf Arbeitnehmer nicht anzuwenden, die zwar<br />
das 55. Lebensjahr, aber noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet haben<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 12.12.2000, NZA 2002, 98; Urt. vom<br />
3.12.2002, DB 2003, 1851 = ZTR 20032, 504). Der Arbeitgeber hat in diesem<br />
Fall nach billigem Ermessen in entsprechender Anwendung von § 315 BGB<br />
zu entscheiden, ob er einen Altersteilzeitvertrag abschließen will oder nicht.<br />
Dabei kann er die mit der Altersteilzeit verb<strong>und</strong>enen Mehrbelastungen durch<br />
Aufstockungsbetrag <strong>und</strong> Übernahme der Beiträge zur Sozialversicherung<br />
berücksichtigen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 10.5.2005 – 9 AZR 294/04 –,<br />
nicht veröff.). Der bloße Einwand, die Aufstockungsleistungen nach § 5 des<br />
Tarifvertrages seien zu kostspielig, soll hingegen nicht ausreichen (Landesarbeitsgericht<br />
Berlin, Urt. vom 13.1.2005 – 16 Sa 1639/04 –, NZA-RR 2005,<br />
329). Da es für das Ziel, das die Tarifvertragsparteien mit dem TV ATZ des<br />
öffentlichen Dienstes verfolgen, durchaus einen Unterschied macht, ob der<br />
jeweilige Arbeitnehmer einem rentennahen Jahrgang oder einem noch relativ<br />
rentenfernen Jahrgang angehört, ist die unterschiedliche Behandlung der<br />
Arbeitnehmer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, <strong>und</strong> der Arbeitnehmer,<br />
die (erst) das 55. Lebensjahr vollendet haben, keineswegs eine (diskriminierende)<br />
Ungleichbehandlung, sondern eine an sachlichen Kriterien ausgerichtete<br />
Differenzierung, die zumindest gem. § 10 S. 1 AGG zulässig ist (Landesarbeitsgericht<br />
Rhld. Pfalz, Urt. vom 26.6.2007 – 3 Sa 153/07 –, Revision<br />
eingelegt unter – 9 AZR 511/07 –).<br />
Ähnlich ist die Rechtslage bei den Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation<br />
evangelischer Kirchen in Niedersachsen für Einrichtungen, die sich<br />
dem ARRGD angeschlossen haben. Der Begriff „dringende dienstliche oder<br />
betriebliche Gründe“ schränkt die Umstände, die der Arbeitgeber zur Abwehr<br />
des erhobenen Anspruchs anführen kann, zunächst nicht ein. Verlangt wird<br />
lediglich, dass sie sich auf die Verhältnisse des Betriebes beziehen. Für den<br />
Regelungsgegenstand „Altersteilzeit“ ergibt sich daraus, dass die mit dieser<br />
Vertragsgestaltung notwendig verb<strong>und</strong>ene finanzielle Belastung des Arbeitgebers<br />
nach dem Willen des Richtliniengebers regelmäßig nicht als Ablehnungsgr<strong>und</strong><br />
geeignet ist (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 23.1.2007 – 9 AZR<br />
624/06 –, ZTR 2007, 436).<br />
Nach §§ 1, 3 des TV zur Förderung der Altersteilzeit im Einzelhandel des<br />
Saarlandes kommt ein Anspruch des Arbeitnehmers darauf, dass der Arbeitgeber<br />
über seinen Antrag auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
nach billigem Ermessen entscheidet, erst dann in Betracht, wenn der Arbeit-<br />
71
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 72<br />
geber zuvor in seinem Betrieb Altersteilzeit überhaupt eingeführt hat; die Entscheidung,<br />
ob Altersteilzeit eingeführt wird, ist gerichtlich nicht nachprüfbar<br />
(Landesarbeitsgericht Saarland, Urt. vom 4.12.2002 – 2 Sa 40/02 –).<br />
3.4.3 Anspruch aus einer Betriebsvereinbarung oder aus<br />
Individualrecht<br />
Außerdem kann sich ein Anspruch ergeben aus<br />
einer Betriebsvereinbarung:<br />
Die Betriebsvereinbarung kann aufgr<strong>und</strong> einer Öffnungsklausel im Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
oder freiwillig vereinbart sein. Ein Arbeitgeber, der mit<br />
Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung in seinem Unternehmen die<br />
Entscheidung trifft, Altersteilzeit einzuführen, ist bis zur Beendigung dieser<br />
Betriebsvereinbarung daran geb<strong>und</strong>en. Er kann mit den Mitteln des Betriebsverfassungsrechts<br />
nicht gezwungen werden, eine freiwillige Leistung länger<br />
zu erbringen, als er auf Gr<strong>und</strong> der in der Betriebsvereinbarung selbst eingegangenen<br />
Bindung verpflichtet ist. Fällt die Leistungsverpflichtung des Arbeitgebers<br />
infolge der Kündigung der Betriebsvereinbarung weg, scheidet eine<br />
Nachwirkung i.S.v. § 77 Abs. 6 BetrVG aus. Für die weitere Anwendung der<br />
vorliegenden Betriebsvereinbarung reicht es nicht aus, dass der Arbeitnehmer<br />
seinen Antrag vor Ablauf der Betriebsvereinbarung gestellt hat. Es ist<br />
vielmehr erforderlich, dass das beantragte Altersteilzeitarbeitsverhältnis noch<br />
innerhalb der Geltungsdauer der Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit beginnen<br />
sollte (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 5.6.2007 – 9 AZR 498/06 – nicht<br />
veröff.).<br />
Individualarbeitsrecht:<br />
Ohne entsprechenden Tarifvertrag oder ohne Betriebsvereinbarung kann sich<br />
ein Anspruch aus dem Gr<strong>und</strong>satz der Gleichbehandlung ergeben, wenn der<br />
Arbeitgeber bei der Bewilligung von Altersteilzeitarbeit nach bestimmten<br />
<strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong>n verfährt, z.B. Altersteilzeitarbeit für eine bestimmte Arbeitnehmergruppe<br />
oder einen Bereich einführt; er kann dann einzelne Arbeitnehmer dieser<br />
Gruppe oder des Bereiches nur dann von der Altersteilzeitarbeit ausnehmen,<br />
wenn er hierfür sachliche Gründe hat, z.B. auf die Weiterbeschäftigung<br />
dieses Arbeitnehmers aus betriebsorganisatorischen Gründen angewiesen<br />
ist. Kommt Altersteilzeitarbeit nur für einen Teil der Arbeitnehmer eines Bereiches<br />
oder einer Abteilung in Betracht, etwa wegen Reduzierung des Personals<br />
in diesem Bereich, so muss der Arbeitgeber die Auswahl nach billigem<br />
Ermessen (§ 315 BGB) treffen. Auswahlgesichtspunkte sind etwa das Lebensalter<br />
(wer ist näher dran am Rentenbezug?) <strong>und</strong> die Dauer der Betriebszugehörigkeit.<br />
72
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 73<br />
3.4.4 Entscheidung über den Antrag<br />
Auch wenn sich danach weder aus Tarifvertrag noch aus Betriebsvereinbarung<br />
oder Individualrecht ein Anspruch auf Altersteilzeitarbeit ergibt, heißt das<br />
nicht, dass der Arbeitgeber nach freiem Belieben über einen Antrag entscheiden<br />
kann. Er muss sich vielmehr mit dem Antrag auseinandersetzen <strong>und</strong> hierüber<br />
sachlich entscheiden. Bei seiner Entscheidung darf er nicht gegen das<br />
Diskriminierungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)<br />
verstoßen, z.B. jemanden allein wegen seines Geschlechts, einer Behinderung<br />
oder wegen seiner ethnischen Herkunft bei seiner Entscheidung benachteiligen.<br />
Die gesetzliche Voraussetzung, dass der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
bei Beginn der Altersteilzeitarbeit das 55. Lebensjahr vollendet haben muss,<br />
ergibt sich aus dem sozialpolitischen Zweck des Gesetzes <strong>und</strong> verstößt nicht<br />
gegen das AGG. Die Einführung von Altersteilzeit im Unternehmen kann der<br />
Arbeitnehmer aber ohne entsprechende Rechtsgr<strong>und</strong>lage nicht erzwingen, da<br />
das in die Vertragsfreiheit des Arbeitgebers eingreifen würde. Der Arbeitgeber,<br />
der über einen Antrag des Arbeitnehmers auf Abschluss eines Altersteilzeitvertrages<br />
zu entscheiden hat <strong>und</strong> keine tarifvertraglichen Vorgaben zu<br />
beachten hat, ist hierbei nicht auf Gr<strong>und</strong> arbeitsvertraglicher Nebenpflicht an<br />
die Maßstäbe billigen Ermessens geb<strong>und</strong>en. Hierzu bedarf es einer besonderen<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage insbesondere in einem Tarifvertrag (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 10.2.2004 – 9 AZR 89/03 –, EzA § 4 TVG Altersteilzeit Nr. 4).<br />
Sieht der Tarifvertrag vor, dass der Arbeitgeber Altersteilzeit gewähren „kann“,<br />
so hat er über den Antrag nach billigem Ermessen zu entscheiden. Das bedeutet,<br />
dass die wesentlichen Umstände des Einzelfalles <strong>und</strong> die beiderseitigen<br />
Interessen angemessen zu berücksichtigen sind. Es genügt jeder sachliche<br />
Gr<strong>und</strong>, der sich auf den Übergang zur Altersteilzeit bezieht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 12.12.2002, NZA 2001, 1209; Urt. vom 10.5.2005 – 9 AZR<br />
294/04 –, nicht veröff.). Ausreichend ist die Begründung des Arbeitgebers, er<br />
beabsichtige nicht, Altersteilzeitarbeit einzuführen, wenn der Arbeitgeber sich<br />
auch hieran hält. Betriebsorganisatorische Maßnahmen zur Ermöglichung<br />
der Altersteilzeitarbeit können nicht verlangt werden. In der Rechtsprechung<br />
bislang anerkannt worden sind:<br />
die gr<strong>und</strong>sätzliche Entscheidung, Verträge über Altersteilzeitarbeit mit<br />
Arbeitnehmern nur dann abzuschließen, wenn ein abzubauender Stellenüberhang<br />
besteht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 12.12.2000),<br />
die wirtschaftliche Belastung durch notwendige Ersatzeinstellungen<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 12.12.2000, a.a.O.),<br />
Schwierigkeiten bei der Wiederbesetzung der Stelle mit möglichen Folgen<br />
für die Förderung durch die BA (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 26.6.2001,<br />
a.a.O.),<br />
73
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 74<br />
eine wegen der Personalsituation für Lehrer in den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
mit den Gewerkschaften abgeschlossene Vereinbarung, zur Vermeidung<br />
betriebsbedingter Kündigungen die Arbeitszeit zu verkürzen bei gleichzeitiger<br />
Möglichkeit der Erhöhnung im Falle eines entsprechenden Bedarfs<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 3.12.2002 –, DB 2003, 1851 = ZTR 20032,<br />
504),<br />
die Bedingung, dass der Arbeitnehmer die frühestmögliche Altersgrenze<br />
in Anspruch nimmt, auch wenn das mit einer Rentenminderung verb<strong>und</strong>en<br />
ist (Landesarbeitsgericht Berlin, Urt. vom 11.2.2000 – 6 Sa 2394/99, nicht<br />
veröff.),<br />
das Bestehen einer strikten Einstellungssperre (Landesarbeitsgericht Berlin,<br />
Urt. vom 1.10.1999, EzBAT TV Altersteilzeit Nr. 1),<br />
wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers, z.B. wenn der Arbeitgeber<br />
nicht gewillt ist, die mit einer Altersteilzeit verb<strong>und</strong>enen finanziellen Mehrbelastungen<br />
durch Aufstockungsbetrag <strong>und</strong> Übernahme der Beiträge zur<br />
Sozialversicherung zu tragen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 10.5.2005,<br />
a.a.O.; Landesarbeitsgericht Hamburg, Urt. vom 26.7.2000, EzBAT TV<br />
Altersteilzeit Nr. 5).<br />
3.4.5 Gerichtliche Durchsetzung des Altersteilzeitanspruches<br />
Der Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages kann gerichtlich<br />
geltend gemacht werden. Die Klage geht dahin, den Arbeitgeber zur<br />
Annahme eines in der Klage enthaltenen Angebots auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
zu verurteilen. Der Antrag muss hinreichend bestimmt<br />
sein, insbesondere muss die Rechtsgr<strong>und</strong>lage für den Anspruch auf Abschluss<br />
des Altersteilzeitarbeitsvertrages konkret angegeben sein. Außerdem ist anzugeben,<br />
zu welchem Zeitpunkt der Abschluss des Vertrages verlangt wird. Die<br />
bisherige Rechtsprechung, wonach eine Verurteilung des Arbeitgebers, den<br />
Antrag des Arbeitnehmers auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
rückwirkend für den Zeitpunkt der Geltendmachung oder der Klageerhebung<br />
anzunehmen, nicht möglich ist (vgl. hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
3.12.2002 – 9 AZR 457/01 – DB 2003, 1851), gilt seit dem Inkrafttreten des<br />
§ 311a Abs. 1 BGB i.d.F. des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes nicht<br />
mehr. Ab dem 1.1.2002 ist eine rückwirkende Verurteilung zulässig (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 27.4.2004 – 9 AZR 522/03 –, BAGE 110, 232 = NZA<br />
2004, 1225 zum Anspruch auf Teilzeit). Dieser hier vertretenen Auffassung hat<br />
sich das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht angeschlossen (Urt. von 23.1.2007 – 9 AZR<br />
393/06 –, NZA 2007, 1236 <strong>und</strong> – 9 AZR 624/06 –, ZTR 2007, 436). Eine rückwirkende<br />
Verurteilung des Arbeitgebers führt dazu, dass der Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
rückwirkend zustande kommt, <strong>und</strong> verstößt deswegen auch nicht<br />
gegen den Gr<strong>und</strong>satz, dass die Altersteilzeitvereinbarung immer vor dem<br />
74
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 75<br />
Beginn der Altersteilzeitarbeit abgeschlossen sein muss. Das Sozialrecht<br />
müsse in diesem Fall dem Arbeitsrecht folgen. Da in der Praxis die bisherige<br />
Arbeitszeit bis zur rechtskräftigen arbeitsgerichtlichen Entscheidung beibehalten<br />
sein wird, ist die Abrechnung dahin rückwirkend zu berichtigen, dass<br />
der Arbeitnehmer entsprechend Wertguthaben erworben hat; die überzahlte<br />
Vergütung muss er dann nach den <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong>n der ungerechtfertigten Bereicherung<br />
zurückgewähren. Der Arbeitgeber ist im Rahmen der Pfändungsfreigrenzen<br />
berechtigt, mit diesen Forderungen gegen die Vergütungsforderung<br />
des Arbeitnehmers aufzurechnen.<br />
Den Entscheidungen ist uneingeschränkt zuzustimmen, soweit die rechtskräftige<br />
Verurteilung zum Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung vor<br />
Beginn der Freistellungsphase erfolgt. Die Rückwirkung ist in diesem Fall sozialversicherungsrechtlich<br />
möglich, weil es noch nicht zum Ausgleich eines in<br />
der Arbeitsphase verdienten Wertguthabens gekommen ist. Dagegen wird<br />
angezweifelt, ob eine Rückwirkung ab Beginn der Freistellungsphase sozialversicherungsrechtlich<br />
noch möglich ist. So lag aber der vom B<strong>und</strong>esarbeitsgericht<br />
entschiedene Fall in der Sache – 9 AZR 393/06 –: Beantragt hatte der<br />
Arbeitnehmer Altersteilzeitarbeit im Blockmodell für die Zeit vom 1.2.2004 bis<br />
zum 30.11.2008. Die Freistellungsphase hätte demnach am 1.7.2006 begonnen,<br />
die Verurteilung erfolgte erst am 23.1.2007.<br />
3.5 Überforderungsschutz<br />
3.5.1 Begrenzung des Anspruchs auf Altersteilzeitarbeit<br />
Haben Arbeitnehmer nach einem Altersteilzeit-Tarifvertrag einen Anspruch auf<br />
Altersteilzeitarbeit, kann das bei ungünstiger Altersstruktur der Belegschaft<br />
oder kleinen Betrieben zu einem Personalverlust <strong>und</strong> zu finanziellen Belastungen<br />
führen, die den Arbeitgeber überfordern. Das soll die Regelung in § 3<br />
Abs. 1 Nr. 3 AtG verhindern. Danach muss bei einer über 5 % der Arbeitnehmer<br />
des Betriebes hinausgehenden Inanspruchnahme der Altersteilzeitarbeit<br />
die freie Entscheidung des Arbeitgebers, ob er Altersteilzeitarbeit gewähren<br />
will, sichergestellt sein oder eine Ausgleichskasse der Arbeitgeber oder eine<br />
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien bestehen, wobei beide Voraussetzungen<br />
in Tarifverträgen verb<strong>und</strong>en werden können. Der Überforderungsschutz<br />
greift nicht bereits dann ein, wenn der Arbeitgeber überhaupt eine<br />
die 5-v.H.-Quote übersteigende Zahl von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen eingegangen<br />
ist. Die Quote muss vielmehr durch das „neue“ Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
überschritten werden. Bereits beendete Altersteilzeitarbeitsverhältnisse<br />
sind nicht zu berücksichtigen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
23.1.2007 – 9 AZR 393/06 –, NZA 2007, 1236).<br />
Diese Obergrenze ist auch für Tarifverträge verbindlich, zulässig ist aber ein<br />
niedrigerer Überforderungsschutz (z.B. 3 %: Erfrischungsgetränke Hessen –<br />
75
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 76<br />
für Betriebe ab 50 AN – <strong>und</strong> Rheinland/Pfalz, Saar; Glasindustrie; Kunststoffverarbeitung<br />
Bayern; Mineralbrunnen Hessen; Süßwarenindustrie für Betriebe<br />
bis 200 AN, bis 100 AN 2 %). Der Tarifvertrag kann auch weitere Beschränkungen<br />
für einzelne Jahrgänge vorsehen, z.B. bestimmte %-Sätze eines<br />
Jahrgangs als Obergrenze (z.B. § 3 Abs. 1 Tarifvertrag Altersteilzeit in der Chemischen<br />
Industrie).<br />
Der gesetzliche Überforderungsschutz greift ein, wenn mehr als 5 % der<br />
Arbeitnehmer des Betriebes Altersteilzeitarbeit beanspruchen wollen. Gr<strong>und</strong>lage<br />
für die Bemessung ist nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift<br />
der Betrieb <strong>und</strong> nicht das Unternehmen (anders die Rechtsansicht der Tarifvertragsparteien<br />
des privaten Versicherungsgewerbes in ihren Erläuterungen<br />
zu § 1 Abs. 6 Altersteilzeitabkommen). Die Berechnung der Zahl der Arbeitnehmer<br />
ergibt sich aus § 7 Abs. 2 <strong>und</strong> 3 AtG: Maßgeblich ist der Durchschnitt<br />
der letzten 12 Kalendermonate vor dem Beginn der Altersteilzeitarbeit des<br />
Arbeitnehmers. Schwerbehinderte <strong>und</strong> Gleichgestellte sowie Auszubildende<br />
bleiben außer Ansatz. Teilzeitbeschäftigte sind zu berücksichtigen bei einer<br />
regelmäßigen Arbeitszeit<br />
von nicht mehr als 20 St<strong>und</strong>en mit 0,5,<br />
von nicht mehr als 30 St<strong>und</strong>en mit 0,75,<br />
über 30 St<strong>und</strong>en mit 1,0.<br />
In seinen Urt. vom 18.9.2001 (DB 2002, 486) <strong>und</strong> 30.9.2003 (DB 2004, 935)<br />
befasst sich das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht mit dem Überforderungsschutz in § 3<br />
Abs. 1 TV ATZ der Chemischen Industrie, der im Wortlaut § 3 Abs. 1 Nr. 3 AtG<br />
entspricht. Danach gilt: Bei dem Überforderungsschutz handelt es sich um<br />
eine negative Anspruchsvoraussetzung, d.h., der Arbeitnehmer hat nur dann<br />
einen Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages, wenn er die<br />
persönlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt <strong>und</strong> auch nach Abschluss seines<br />
Vertrages die als Überlastungsschutz bestimmte Grenze der Arbeitnehmer<br />
des Betriebes nicht überschritten wird. Bei der Berechnung der Grenze sind<br />
auch die nicht oder anders organisierten Arbeitnehmer des Betriebes zu<br />
berücksichtigen. Die Urteile lassen – ohne dass dies ausdrücklich angesprochen<br />
wird – den Schluss zu, dass auch eine Einbeziehung nicht nur der außertariflichen<br />
Angestellten, sondern auch der leitenden Angestellten zulässig ist;<br />
da der gesetzliche Überforderungsschutz „allein nach dem Merkmal Zugehörigkeit<br />
zur Belegschaft“ bzw. auf „Arbeitnehmer des Betriebes“ begrenzt ist.<br />
Außertarifliche <strong>und</strong> leitende Angestellte können aber durch Regelung in einem<br />
Altersteilzeittarifvertrag bei der Berechnung der Quote ausgenommen werden<br />
(vom B<strong>und</strong>esarbeitsgericht im Urt. von 30.9.2003 geprüft <strong>und</strong> für den TV ATZ<br />
der Chemischen Industrie verneint). Ob durch Tarifvertrag wirksam festgelegt<br />
werden kann, dass bei der Berechnung der Quote nur organisierte Arbeitnehmer<br />
des Betriebes mitzählen, hatte das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht nicht zu ent-<br />
76
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 77<br />
scheiden. Im Hinblick auf Art. 9 Abs. 3 GG ist das nach meiner Auffassung zu<br />
verneinen, da eine solche Regelung nicht verfassungskonform wäre (hierzu<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 21.1.1987, AP Nr. 46 zu Art. 9 GG).<br />
Die Regelung soll den Arbeitgeber vor einer Überforderung schützen. Sie greift<br />
daher nicht ein, wenn der Arbeitgeber durch freiwillige Betriebsvereinbarung<br />
einen Anspruch auf Altersteilzeitarbeit einräumt, ohne dass in der Betriebsvereinbarung<br />
ein Überforderungsschutz geregelt ist. Dagegen gilt der Überforderungsschutz<br />
auch für Firmen- oder Haustarifverträge, da diese wie Verbandstarifverträge<br />
erzwingbar sind.<br />
3.5.2 Auswahl bei Überschreitung der Grenze<br />
Das AtG regelt nicht, wie die Auswahl zu treffen ist, wenn mehr als 5 % der<br />
Arbeitnehmer Altersteilzeitarbeit beanspruchen. Soweit ein Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
anzuwenden ist, können sich Auswahlkriterien aus diesem ergeben.<br />
So bestimmt etwa der Tarifvertrag zur Förderung der Altersteilzeit in der Chemischen<br />
Industrie, dass die Arbeitnehmer Vorrang haben, die einem früheren<br />
Geburtsjahrgang angehören, bei gleichem Geburtsjahrgang die Arbeitnehmer<br />
mit längerer Betriebszugehörigkeit <strong>und</strong> bei gleicher Betriebszugehörigkeit die<br />
älteren Arbeitnehmer (§ 3 Abs. 4). Die Auswahl unter mehreren Bewerbern<br />
darf nicht nach Kriterien erfolgen, die an die Organisationszugehörigkeit des<br />
Arbeitnehmers anknüpfen. Unzulässig wegen Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 3<br />
GG wäre etwa eine tarifliche Regelung, wonach der Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit<br />
nur mit tarifgeb<strong>und</strong>enen Arbeitnehmern oder vorrangig mit diesen<br />
vereinbaren darf; auch eine entsprechende Praxis ist unzulässig (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 21.1.1987, AP Nr. 47 zu Art. 9 GG = NZA 1987, 237).<br />
Auf die 5 % sind Altersteilzeitvereinbarungen mit nicht organisierten Arbeitnehmern<br />
nur dann nicht anzurechnen, wenn sie zu ungünstigeren Bedingungen<br />
als im Tarifvertrag vereinbart werden, z.B. ein geringerer Aufstockungsbetrag<br />
zugesagt wird (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, a.a.O.).<br />
Die Auswahl muss nach einheitlichen Kriterien vorgenommen werden.<br />
Schweigt der Tarifvertrag hierzu, so ist die Auswahl nach dem Zeitpunkt des<br />
Entstehens des Anspruchs auf Altersteilzeitarbeit zu treffen. Das ältere Recht<br />
geht dem jüngeren vor. Derjenige, der zuerst die tariflichen Voraussetzungen<br />
für den Eintritt in den Ruhestand erfüllt, ist gegenüber den Bewerbern zu bevorzugen,<br />
die diese Voraussetzungen erst später erfüllen. Der Gr<strong>und</strong>satz des Vorrangs<br />
des älteren Rechts wird durch das Prinzip des Vertrauensschutzes<br />
begrenzt. Es ist Sache des einzelnen Arbeitnehmers, seinen Anspruch auf Eintritt<br />
in Altersteilzeit so rechtzeitig geltend zu machen, dass er mit seinem älteren<br />
Recht zum Zug kommt. Dabei kommt es nicht auf die zeitliche Reihenfolge<br />
der Anträge auf Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung, sondern auf den<br />
Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung an. Ein Arbeitnehmer kann mit einer<br />
frühzeitigen Bewerbung nicht Arbeitskollegen mit älteren Rechten verdrängen.<br />
77
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 78<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich haben Arbeitnehmer, die einen tariflichen Anspruch auf Altersteilzeit<br />
haben, keinen Vorrang. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber<br />
– unabhängig vom Bestehen tariflicher Ansprüche – allen Arbeitnehmern,<br />
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
bezogen auf das 60. Lebensjahr anbietet, sofern betriebliche Gründe<br />
nicht entgegenstehen. Darin liegt kein unredliches Verhalten, mit dessen Hilfe<br />
gezielt Ansprüche anderer ausgeschlossen werden sollen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 29.5.2002 – 5 AZR 105/01 –, EzA NachwG § 2 Nr. 4; Urt. vom<br />
30.9.2003, a.a.O.). Ein – vom Arbeitnehmer zu beweisender – Rechtsmissbrauch<br />
kann nur dann angenommen werden, wenn der Arbeitgeber ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
allein mit dem Zweck abschließt, einem Antrag eines<br />
bestimmten Arbeitnehmers, den dieser auf tariflicher Gr<strong>und</strong>lage stellen will,<br />
zuvorzukommen. Gleiches könnte gelten, wenn der Arbeitgeber systematisch<br />
auf freiwilliger Gr<strong>und</strong>lage Altersteilzeit gewährt, um von vornherein zu verhindern,<br />
dass Arbeitnehmer Ansprüche aus dem Tarifvertrag geltend machen. In<br />
dem bloßen Angebot, auch für Arbeitnehmer außerhalb von tariflichen Ansprüchen<br />
Altersteilzeitarbeitsverträge abzuschließen, liegt noch keine unredliche<br />
Handlungsweise (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 30.9.2003, a.a.O.).<br />
3.5.3 Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Auswahl<br />
Dem Betriebsrat steht auch dann, wenn der Tarifvertrag keine konkreten Kriterien<br />
für die Auswahl festlegt, bei der Auswahl der Bewerber kein Mitbestimmungsrecht<br />
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8 <strong>und</strong> 10 oder einer anderen Bestimmung<br />
des § 87 Abs. 1 BetrVG zu (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, a.a.O., S. 238). Der Tarifvertrag<br />
kann aber in einer Öffnungsklausel ein Mitbestimmungsrecht des<br />
Betriebsrats anordnen.<br />
4 Der Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
4.1 Abschlussfreiheit<br />
Altersteilzeitarbeit setzt stets einen zwischen Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
vereinbarten Altersteilzeitvertrag voraus. Der Arbeitgeber kann nicht zur Einführung<br />
der Altersteilzeitarbeit gezwungen werden, soweit er hierzu nicht<br />
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung verpflichtet ist. Der Arbeitnehmer<br />
kann den Abschluss des Vertrages nur dann fordern, wenn ihm aufgr<strong>und</strong><br />
eines Tarifvertrages, einer freiwilligen Betriebsvereinbarung oder ausnahmsweise<br />
individualrechtlich ein solcher Anspruch zusteht <strong>und</strong> die erforderlichen<br />
Voraussetzungen für diesen Anspruch vorliegen (s. hierzu oben 3.4.)<br />
Andererseits ist auch der Arbeitnehmer in seiner Entscheidung frei, ob er in<br />
Altersteilzeit gehen <strong>und</strong> einen Altersteilzeitarbeitsvertrag abschließen will.<br />
Nach § 8 Abs. 1 AtG darf dem Arbeitnehmer nicht gekündigt werden, weil er<br />
78
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 79<br />
die Anspruchsvoraussetzungen für die Altersteilzeitarbeit erfüllt, sie aber nicht<br />
in Anspruch nimmt. Auch andere Nachteile wegen der Weigerung, in Altersteilzeit<br />
zu gehen, sind gemäß § 612a BGB (Maßregelungsverbot) unzulässig.<br />
Die Möglichkeit der Altersteilzeitarbeit darf auch nicht im Rahmen einer Sozialauswahl<br />
zu Lasten des Arbeitnehmers gewichtet werden.<br />
4.2 Fürsorgepflicht bei Vertragsabschluss –<br />
Haftung des Arbeitgebers<br />
Bei jeder Vorruhestandsvereinbarung, die auf Veranlassung des Unternehmens<br />
abgeschlossen wird <strong>und</strong> die zu sozialversicherungsrechtlich negativen<br />
Folgen für die Altersversorgung führt, die beide Seiten nicht vorhergesehen<br />
haben, z.B. ein Verlust einer Zusatzversorgung oder niedrigere Rentenansprüche,<br />
lösen später Auseinandersetzungen darüber aus, ob das Unternehmen<br />
seine Fürsorgepflicht verletzt hat. Deswegen ist vor Auskünften über die<br />
sozialrechtlichen Folgen solcher Vereinbarungen zu warnen. Jedenfalls ist in<br />
jedem Fall (schriftlich!) deutlich zu machen, dass etwaige Auskünfte nur ungefähre<br />
Angaben enthalten, rechtlich nicht verbindlich sind <strong>und</strong> verbindliche<br />
Auskünfte des Rentenversicherungsträgers, der Träger der Zusatzversorgung<br />
<strong>und</strong> der Agentur für Arbeit nicht ersetzen (vgl. hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 21.2.2002, EzA § 1 KSchG Wiedereinstellungsanspruch; zu Belehrungspflichten<br />
des Arbeitgebers bei Lohnsteuerklassenwechsel mit der Folge<br />
eines geringeren Aufstockungsbetrages Landesarbeitsgericht Rhld.-Pfalz,<br />
Urt. vom 29.3.2007 – 9 Sa 811/06 –).<br />
Mit einem solchen Fall aus dem Bereich der Altersteilzeit hat sich das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht<br />
im Urt. vom 10.2.2004 – 9 AZR 401/02 (BAGE 109, 294 = NZA<br />
2004, 605) befasst: Das Unternehmen hatte dem Arbeitnehmer den Abschluss<br />
eines Altersteilzeitarbeitsvertrages angeboten, der dann auch zu Stande<br />
gekommen ist. Noch am Tage des Abschlusses der Vereinbarung hatte das<br />
Unternehmen den Arbeitnehmer für die gesamte Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
(Arbeitsphase <strong>und</strong> Freistellungsphase) freigestellt. Das<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat entschieden, dass damit die Voraussetzungen für<br />
Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes <strong>und</strong> für einen vorzeitigen<br />
Rentenbezug wegen Altersteilzeit nicht gegeben sind. Da in dem Angebot<br />
eines Arbeitgebers auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages gegenüber<br />
dem Arbeitnehmer die Erklärung liegt, er könne bei Annahme dieses<br />
Angebots einen Anspruch auf vorzeitige Altersrente wegen Altersteilzeit erwerben,<br />
haftet der Arbeitgeber für diese objektiv falsche Erklärung. Der Arbeitnehmer<br />
ist so zu stellen, als wäre die „Altersteilzeitvereinbarung“ nicht abgeschlossen<br />
worden. In diesem Fall hätte das Arbeitsverhältnis im Zweifel<br />
fortbestanden.<br />
Es besteht kein Anlass bei Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages, auf<br />
die Folgen der Vereinbarung für mögliche Ansprüche auf Leistungen der<br />
79
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 80<br />
Arbeitsagentur hinzuweisen, da ja gr<strong>und</strong>sätzlich am Ende des Vereinbarungszeitraumes<br />
der Übergang in den Bezug von Rentenzahlungen vorgesehen<br />
ist (Landesarbeitsgericht Berlin, Urt. vom 25.11.2004 – 18 Sa<br />
1632/04 –, nicht veröff.).<br />
4.3 Abschluss des Vertrages – Form <strong>und</strong> Zeitpunkt<br />
Der Altersteilzeitarbeitsvertrag muss als befristeter Arbeitsvertrag schriftlich<br />
abgeschlossen, d.h. von beiden Seiten auf einer Urk<strong>und</strong>e unterschrieben werden.<br />
Das ergibt sich aus § 623 BGB bzw. aus § 14 Abs. 4 des Gesetzes über<br />
Teilzeit <strong>und</strong> befristete Arbeitsverträge. Danach bedarf die Befristung eines<br />
Arbeitsvertrages zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.<br />
Altersteilzeitarbeit beginnt nach Abschluss der schriftlichen Vereinbarung<br />
mit Vorliegen der hierfür maßgeblichen Voraussetzungen. Die Vereinbarung<br />
kann nur für die Zukunft abgeschlossen werden. Bei diskontinuierlicher Verteilung<br />
der Arbeitszeit gilt dies ab Beginn der für die Ansparung (Vorarbeit) von<br />
Wertguthaben für eine Freistellung schriftlich vereinbarten Arbeitsphase des<br />
Blockmodells. Bereits abgelaufene Arbeitszeiten, in denen tatsächlich keine<br />
Altersteilzeitarbeit ausgeübt worden ist, können nicht nachträglich in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
umgewandelt werden (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
23.1.2007 – 9 AZR 624/06 –, ZTR 2007, 436). Eine Rückdatierung von Altersteilzeitverträgen<br />
ist rechtlich ausgeschlossen (RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, 2.1.6).<br />
4.4 Inhalt des Vertrages<br />
4.4.1 Notwendiger Inhalt<br />
In dem Altersteilzeitvertrag muss Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG vereinbart<br />
werden. Insoweit wird auf die Ausführungen zu Ziff. 2.2 Bezug genommen.<br />
Der Vertrag muss vor Beginn der Altersteilzeitarbeit abgeschlossen werden.<br />
Der notwendige Inhalt <strong>und</strong> der Umfang der Vereinbarung richten sich<br />
danach, ob der Vertrag auf der Gr<strong>und</strong>lage eines Altersteilzeit-Tarifvertrages<br />
geschlossen wird oder nicht. Im ersteren Fall genügt es, die individuellen Punkte<br />
niederzulegen <strong>und</strong> im Übrigen auf den Tarifvertrag Bezug zu nehmen; im<br />
anderen Fall muss der Altersteilzeitvertrag die Bedingungen der Altersteilzeitarbeit<br />
umfassend regeln. Außerdem kann es erforderlich sein, einzelne<br />
Punkte hinsichtlich der Rechtsstellung des Altersteilzeitarbeitnehmers zu<br />
regeln, insbesondere was seine Rechtsstellung in der Freistellungsphase<br />
beim Blockmodell betrifft. Der Vertrag muss die Dauer der Altersteilzeit individualrechtlich<br />
festlegen, wenn sich die Dauer nicht aus tariflichen oder betrieblichen<br />
Regelungen ergibt. Ergibt sich die Dauer des Altersteilzeitverhältnisses<br />
allein aus dem geschlossenen Altersteilzeitarbeitsvertrag, kann die Dauer<br />
80
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 81<br />
auch nur durch Änderungsvertrag geändert werden (vgl. hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 18.11.2003 – 9 AZR 660/02 –, nicht veröff.).<br />
Siehe auch die Beispiele im Anhang.<br />
4.4.2 Festlegung der Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
In der Praxis gibt es häufiger Streitigkeiten über die Bemessungsgr<strong>und</strong>lage<br />
für die Aufstockungsleistungen des Arbeitgebers. Vor allem geht es dabei um<br />
die Frage, ob neben der Gr<strong>und</strong>vergütung zusätzliche Entgeltbestandteile, z.B.<br />
Zulagen, Zuschläge für Nacht-, Sonn- <strong>und</strong> Feiertagsarbeit, einmalige Zuwendungen,<br />
in die Berechnung einzubeziehen sind. Die gesetzliche Regelung<br />
erfasst insoweit nicht alle Sachverhalte. Bemessungsgr<strong>und</strong>lage bei „Altverträgen“<br />
(Beginn der Altersteilzeitarbeit bis 30.6.2004) ist das „Vollzeitarbeitsentgelt“,<br />
das ist das Arbeitsentgelt, das der altersteilzeitarbeitende Arbeitnehmer<br />
für eine Arbeitsleistung bei tariflicher regelmäßiger Arbeitszeit zu<br />
beanspruchen hätte (§ 6 Abs. 1 S. AtG a.F.); in „Neufällen (Beginn ab 1.7.1004)<br />
ist das „Regelarbeitsentgelt“ maßgeblich. Regelarbeitsentgelt i.S.d. Gesetzes<br />
ist das auf einen Monat entfallende, vom Arbeitgeber regelmäßig zu zahlende<br />
sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt, soweit es die Beitragsbemessungsgrenze<br />
nicht übersteigt; Entgeltbestandteile, die nicht laufend<br />
gezahlt werden, sind nicht berücksichtigungsfähig (§ 6 Abs. 1 AtG n.F.); zur<br />
Berechnung s. im Einzelnen <strong>Kapitel</strong> XI unter 4 <strong>und</strong> 7).<br />
Ist ein Altersteilzeit-Tarifvertrag Gr<strong>und</strong>lage für die Vereinbarung, wird in diesem<br />
in aller Regel die Bemessungsgr<strong>und</strong>lage genau festgelegt sein (s. hierzu<br />
den Überblick unter 3.2.2.2). In diesem Fall genügt die Bezugnahme auf<br />
den Tarifvertrag; zur Vermeidung von Streitigkeiten ist aber auch empfehlenswert,<br />
die tarifliche Regelung noch einmal wörtlich in den Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
aufzunehmen. Werden neben den tariflichen Leistungen zusätzliche<br />
freiwillige Leistungen erbracht, muss klargestellt werden, ob <strong>und</strong> in<br />
welchem Umfang auch diese Leistungen in die Berechnung einzubeziehen<br />
sind. Fehlt es an einer tariflichen Gr<strong>und</strong>lage, ist in jedem Fall die gesamte<br />
Bemessungsgr<strong>und</strong>lage im Vertrag zu vereinbaren. Das gilt insbesondere,<br />
wenn neben einer Gr<strong>und</strong>vergütung weitere Zulagen, Zuschläge oder eine Einmalzahlung<br />
gezahlt werden. Bei Regelung der Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen in<br />
einer Betriebsvereinbarung sollte auf diese im Vertrag Bezug genommen werden.<br />
Eine betriebliche Einheitsregelung sollte wörtlich in den Vertrag aufgenommen<br />
werden (vgl. zur Problematik der Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 22.11.2006 – 9 AZR 623/05 –: zur Auslegung des TV<br />
ATZ der deutschen Post AG, nicht veröff.).<br />
81
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 82<br />
4.4.3 Förderung als Voraussetzung für Aufstockungsleistungen?<br />
Gemäß § 8 Abs. 2 AtG kann der Arbeitgeber seine Verpflichtung zur Zahlung<br />
der Aufstockungsleistungen nicht für den Fall ausschließen, dass die Förderungsvoraussetzungen<br />
deswegen nicht bestehen oder entfallen,<br />
weil der Arbeitsplatz des Altersteilzeitarbeitnehmers nicht entsprechend<br />
den gesetzlichen Vorschriften wieder besetzt worden ist (§ 3 Abs. 1 Nr. 2<br />
AtG) oder<br />
weil der Arbeitgeber die Förderungsleistungen deswegen nicht erhält, weil<br />
er den Antrag nach § 12 AtG nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht<br />
rechtzeitig gestellt oder seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt hat, ohne<br />
dass dafür eine Verletzung der Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers<br />
ursächlich war.<br />
Die Förderung kann entfallen, wenn der auf dem freigemachten Arbeitsplatz<br />
beschäftigte Arbeitnehmer/Wiederbesetzer kündigt. Der Arbeitgeber hat es<br />
dann aber in der Hand, den Arbeitsplatz in der Frist des § 5 Abs. 2 AtG erneut<br />
wiederzubesetzen (so MünchArbR, Schüren, § 163 Rz. 68 ff.).<br />
Zulässig ist dagegen eine Vereinbarung, dass die Pflicht zur Zahlung der Aufstockungsleistungen<br />
wegfällt, wenn die Förderung an einer übermäßigen<br />
Nebentätigkeit des Altersteilzeitarbeitnehmers scheitert, nicht dagegen, wenn<br />
diese auf übermäßiger vom Arbeitgeber angeordneter Mehrarbeit beruht. Bei<br />
übermäßiger Nebentätigkeit des Arbeitnehmers dürfte der Anspruch wohl<br />
auch ohne vertragliche Regelung wegen Wegfalls der Geschäftsgr<strong>und</strong>lage<br />
entfallen (Schüren, a.a.O., Rz. 69 f.).<br />
4.4.4 Abfindungsvereinbarungen<br />
Der Altersteilzeitarbeitnehmer scheidet aufgr<strong>und</strong> des Altersteilzeitvertrages in<br />
der Regel vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis aus. Er verzichtet auf den<br />
gesetzlichen Kündigungsschutz, da er mit der Änderung des bisher unbefristeten<br />
in ein befristetes Arbeitsverhältnis einverstanden ist. Außerdem kann<br />
durch die vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersrente wegen Altersteilzeit<br />
eine Rentenminderung eintreten, für die der Arbeitnehmer einen Ausgleich fordert.<br />
Wird der Altersteilzeitvertrag auf Veranlassung des Arbeitgebers abgeschlossen,<br />
kann hierfür die Zahlung einer Abfindung für den Verlust des<br />
Arbeitsplatzes vereinbart werden, die unter den Voraussetzungen der §§ 3 Nr.<br />
9, 34 EStG steuerbegünstigt ist. Nach den Lohnsteuerrichtlinien ist zwischen<br />
Austritt <strong>und</strong> Zahlung einer Abfindung neben dem sachlichen kein zeitlicher<br />
Zusammenhang erforderlich. Laut Verwaltungsanweisung soll ein Zeitraum<br />
von fünf Jahren zwischen Auszahlung <strong>und</strong> Ausscheiden ohne weitere Prüfung<br />
akzeptiert werden. Die Steuerfreiheit gemäß § 3 Nr. 9 EStG ist allerdings auf<br />
Gr<strong>und</strong> des Gesetzes zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm vom<br />
82
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 83<br />
22.12.2005 (BGBl I S. 3682) weggefallen. Vertrauensschutz wird gewährt für<br />
vor dem 1.1.2006 entstandene Ansprüche (Abfindungsvereinbarungen, die bis<br />
zu diesem Zeitpunkt getroffen worden sind) oder für Abfindungen wegen einer<br />
vor dem 1.1.2006 getroffenen gerichtlichen Entscheidung oder einer am<br />
31.12.2005 anhängigen Klage, sofern die Abfindung vor dem 1.1.2008 ausgezahlt<br />
worden ist. Das kann gerade bei Altersteilzeitvereinbarungen zu Problemen<br />
führen, wenn der vereinbarte Auszahlungszeitpunkt nach dem<br />
31.12.2007 liegt <strong>und</strong> der Auszahlungszeitpunkt nicht rechtzeitig bis zum<br />
31.1.2005 vorverlegt worden ist. Es sprechen gute Gründe dafür, derartige<br />
Änderungsvereinbarungen für Abfindungsvereinbarungen, die bis zum<br />
31.12.2005 abgeschlossen worden sind, auch nach dem 31.12.2005 zuzulassen,<br />
weil der Anspruch bereits bei Abschluss der Vereinbarung entstanden<br />
ist <strong>und</strong> lediglich der Fälligkeitszeitpunkt nachträglich verändert wird <strong>und</strong> das<br />
Gesetz nach seinem Wortlaut nur auf den Auszahlungszeitpunkt abstellt.<br />
Erhält nach dem Altersteilzeitvertrag der Arbeitnehmer in Altersteilzeit am<br />
Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses eine Abfindung, die danach<br />
berechnet wird, wie viele Monate zwischen dem Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
<strong>und</strong> dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Arbeitnehmer<br />
Anspruch auf ungeminderte Altersrente hätte, hat auch der Arbeitnehmer<br />
Anspruch auf eine Abfindung, dessen Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorzeitig<br />
wegen einer Rente für schwerbehinderte Menschen endet (Landesarbeitsgericht<br />
Berlin, Urt. vom 202.2004 – 13 Sa 2465/03 –, NZA-RR 2004, 398: Weil<br />
der Schwerbehinderte die Rente „vorzeitig“ in Anspruch genommen hatte, war<br />
der Zugangsfaktor um 0,003 für insgesamt 15 Monate gekürzt worden).<br />
Abfindungen aus Anlass der Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses,<br />
z.B. zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme<br />
einer Altersrente, sind als Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes<br />
anzusehen <strong>und</strong> gehören damit nicht zum Arbeitsentgelt i.S. der<br />
Sozialversicherung (Rdschr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 3.6).<br />
Wegen der arbeits-, sozialversicherungs- <strong>und</strong> steuerrechtlichen Fragen im<br />
Zusammenhang mit Abfindungsvereinbarungen wird auf <strong>Kapitel</strong> III <strong>und</strong> IV verwiesen.<br />
4.5 Einvernehmliche Änderung des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
Probleme können entstehen, wenn der Arbeitnehmer am Ende der Arbeitsphase<br />
noch nicht entbehrlich ist, z.B. weil ein Projekt entgegen der Planung<br />
noch nicht abgeschlossen werden konnte. Hier gibt es verschiedene Handlungsmöglichkeiten:<br />
Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis kann am Ende der Arbeitsphase für eine<br />
gewisse Zeit unterbrochen werden. Das ist aber nur möglich, wenn <strong>und</strong><br />
soweit das Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach der vertraglichen Vereinba-<br />
83
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 84<br />
rung vor Vollendung der Regelaltersgrenze enden soll. Der verbliebene<br />
Zeitraum vor diesem Zeitpunkt kann für eine Unterbrechung genutzt werden<br />
(s. hierzu oben 2.2.9).<br />
Unter den gleichen Voraussetzungen kann bei Altersteilzeit mit tarifvertraglicher<br />
Gr<strong>und</strong>lage auch die Arbeitsphase <strong>und</strong> damit die Freistellungsphase<br />
verlängert werden, wenn <strong>und</strong> soweit die tarifliche Gesamtdauer für<br />
Altersteilzeit noch nicht ausgeschöpft ist.<br />
Bei Altersteilzeitarbeit ohne tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lage kann am Ende der<br />
Arbeitsphase (max. 1 1/2 Jahre) zunächst (Konti-)Teilzeit (von bis zu 3 Jahren)<br />
vereinbart werden <strong>und</strong> im Anschluss daran die Freistellungsphase<br />
(max. 1 1/2 Jahre). Die Gesamtdauer darf aber 6 Jahre nicht übersteigen<br />
(s. hierzu oben 2.2.5.2).<br />
Zur Möglichkeit der Verlängerung s. ausführlich oben 2.2.10.3.<br />
4.6 Insolvenzsicherung<br />
4.6.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Bei der Durchführung in einem Blockmodell erarbeitet der Altersteilzeitmitarbeiter<br />
in der Arbeitsphase ein Wertguthaben, aus dem in der Freistellungsphase<br />
die Entlohnung erfolgt. In einem Insolvenzfall sind nur das Arbeitsentgelt<br />
<strong>und</strong> die Aufstockungsbeträge zum Entgelt <strong>und</strong> die zusätzlichen<br />
RV-Beiträge der letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis<br />
abgesichert. Der Gesetzgeber hatte zunächst auf eine verbindliche<br />
Verpflichtung der Insolvenzsicherung von Wertguthaben verzichtet <strong>und</strong><br />
nur in dem durch das Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler<br />
Arbeitszeitregelungen vom 6.4.1998 eingefügten § 7d SGB IV die Arbeitsvertragsparteien<br />
aufgefordert, Vorkehrungen zur Absicherung von Arbeitszeitguthaben<br />
zu treffen. Sanktionen gegen Arbeitgeber, die Wertguthaben nicht<br />
gegen Insolvenz sicherten, sah das Gesetz nicht vor. Erst für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse,<br />
die ab dem 1.7.2004 begonnen haben oder beginnen, ist in<br />
§ 8a AtG eine spezielle gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Insolvenzsicherung<br />
von Wertguthaben eingeführt worden (§ 8a AtG). Dagegen gilt<br />
für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor diesem Zeitpunkt begonnen haben,<br />
nur die allgemeine sozialversicherungsrechtliche Vorschrift des § 7d Abs. 1<br />
SGB IV, die den Arbeitnehmer nur unzureichend gegen einen Verlust des erarbeiteten<br />
Wertguthabens schützt. Danach besteht eine Pflicht zur Insolvenzsicherung<br />
nur, wenn<br />
das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darauf entfallenden<br />
Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag einen<br />
Betrag in Höhe des Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße <strong>und</strong><br />
84
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 85<br />
der vereinbarte Zeitraum, in dem das Wertguthaben auszugleichen ist, 27<br />
Kalendermonate nach der ersten Gutschrift übersteigt.<br />
In einem Tarifvertrag oder auf Gr<strong>und</strong> eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung<br />
können ein von dem Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße<br />
abweichender Betrag des Wertguthabens <strong>und</strong> ein von 27 Kalendermonaten<br />
abweichender Zeitraum vereinbart werden.<br />
4.6.2 Die Regelung in § 8a AtG<br />
Um zu verhindern, dass der Arbeitnehmer im Blockmodell durch Insolvenz des<br />
Unternehmens Verluste in seinem Wertguthaben erleidet, schreibt § 8a AtG<br />
eine spezielle Insolvenzsicherung für Wertguthaben in der Altersteilzeit für<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die nach dem 30.6.2004 begonnen haben,<br />
verbindlich vor; die Regelung hat keine Rückwirkung für Altersteilzeitverhältnisse,<br />
die bis zum 30.6.2004 begonnen haben (§ 15g AtG); zum Rang des<br />
Wertguthabens in der Insolvenz ohne den Insolvenzschutz („Alt-Altersteilzeitarbeitsverhältnisse“<br />
s. unten 5.4.4.2): Ergibt sich aus der Vereinbarung zur<br />
Einführung der Altersteilzeitarbeit, dass ein Wertguthaben aufgebaut werden<br />
soll, das den Betrag des dreifachen Regelarbeitsentgelts einschließlich des<br />
darauf entfallenden Arbeitgeberanteils zur Gesamtsozialversicherung überschreitet,<br />
muss der Arbeitgeber das Wertguthaben in geeigneter Weise gegen<br />
das Risiko seiner Zahlungsunfähigkeit absichern. Diese Grenze wird faktisch<br />
bei jedem Altersteilzeitverhältnis erreicht (ausgenommen solche, die nur bis<br />
zu zwei Monate dauern).<br />
Die ordnungsgemäße Insolvenzsicherung ist nicht sozialrechtliche Voraussetzung<br />
der Altersteilzeit, sondern <strong>arbeitsrechtliche</strong> Verpflichtung des Arbeitgebers<br />
(hierzu Hampel, DB 2004, 707). Das betrifft sowohl die rentenrechtlichen<br />
Voraussetzungen der Rente wegen Altersteilzeit als auch die Förderung<br />
durch die BA sowie die Steuerfreiheit der Aufstockungsleistungen. Weder das<br />
neue RdSchr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004 noch das Merkblatt der BA<br />
„Gleitender Übergang in den Ruhestand“, gültig ab 1.7.2004, fordert die Insolvenzsicherung<br />
als Voraussetzung. Die BA hat demzufolge insoweit im Rahmen<br />
des Erstattungsverfahrens keine Prüfkompetenz. Der in Altersteilzeit<br />
befindliche Arbeitnehmer hat aber einen <strong>arbeitsrechtliche</strong>n Anspruch, den<br />
Insolvenzschutz seines Wertguthabens in einem vorgegebenen Verfahren<br />
durchsetzen, wenn die Voraussetzungen einer hinreichenden Insolvenzsicherung<br />
nach den gesetzlichen Vorgaben im Einzelfall nicht vorliegen.<br />
Das Ausmaß der Absicherung ist verbindlich vorgegeben. Eine Verrechnung<br />
von steuer- <strong>und</strong> beitragsfreien Aufstockungsleistungen mit den beitragspflichtigen<br />
Entgelten im Wertguthaben ist nicht zulässig (§ 8a Abs. 1 AtG).Es<br />
reicht daher nicht aus, nur den arbeitsvertraglichen oder tariflichen Anspruch<br />
abzusichern. Ob allerdings im Insolvenzfall der Arbeitnehmer einen Anspruch<br />
85
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 86<br />
auf das gesamte Wertguthaben hat oder nur auf den Teil des Wertguthabens,<br />
der ihm nach der tariflichen Regelung zusteht, ist in der Literatur umstritten<br />
(siehe hierzu Nimscholz, ZInsO 2005, 522).<br />
Gemäß § 8a AtG ist das „Wertguthaben einschließlich das darauf entfallenden<br />
Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag“ abzusichern.<br />
Es ist daher zunächst das in der Arbeitsphase erarbeitete, aber nicht ausgezahlt<br />
Entgelt in das Wertguthaben einzustellen <strong>und</strong> abzusichern. Darüber hinaus<br />
ist der in der Freistellungsphase anfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung<br />
aus dem beitragspflichtigen Teil des Wertguthabens abzusichern.<br />
Bei der Ermittlung des abzusichernden Arbeitgeberanteils bleiben<br />
daher Teile des Entgelts, die wegen Überschreitung der jeweiligen BBG beitragsfrei<br />
sind, unberücksichtigt. Werden die Bezüge im Verlauf der Altersteilzeit<br />
etwa durch eine Tariferhöhung erhöht, ist ab dem Monat des Wirksamwerdens<br />
der Tariferhöhung das Wertguthaben <strong>und</strong> der darauf anfallende<br />
Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen entsprechend zu<br />
erhöhen <strong>und</strong> somit auch abzusichern. Ändern sich die Beitragsbemessungsgrenzen<br />
oder die Beitragssätze, ist eine Korrekturrechnung erforderlich. Eine<br />
rückwirkende Anpassung des Wertguthabens ist gesetzlich nicht erforderlich,<br />
aber möglich.<br />
Zu den abzusichernden Arbeitgeberanteilen an den Sozialversicherungsbeiträgen<br />
gehört zunächst der Arbeitgeberanteil an den Rentenversicherungsbeiträgen.<br />
Die zusätzlichen, vom Arbeitgeber allein zu tragenden Rentenversicherungsbeiträge<br />
müssen nicht abgesichert werden. Auch die Zuschüsse<br />
des Arbeitgebers zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen von Arbeitnehmern,<br />
die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI von der Rentenversicherungspflicht<br />
befreit sind, müssen abgesichert werden, da gem. § 172 SGB VI<br />
der Arbeitgeber diese Anteile zu übernehmen hat.<br />
Neben dem Arbeitgeberanteil an den Rentenversicherungsbeiträgen sind die<br />
Arbeitgeberanteile an der Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherung abzusichern. Die<br />
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankenversicherungsbeitrag gem. § 257<br />
SGB V <strong>und</strong> der Pflegeversicherungsbeitrag gem. § 61 SGB XI gehören nicht<br />
zu den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung gem. § 8a AtG, weil der<br />
Schutz des § 8a AtG nur die Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherungsträger<br />
sichern soll. Dennoch sollten sie, um die Arbeitnehmer im Betrieb gleich<br />
zu behandeln, mit gegen Insolvenz abgesichert werden.<br />
Da Beiträge zur Unfallversicherung allein vom Arbeitgeber zu tragen sind,<br />
müssen sie nicht mit abgesichert werden.<br />
86
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 87<br />
Beispiel 1 zur Ermittlung des abzusichernden Wertguthabens<br />
(Stand 2006):<br />
(Teilzeitentgelt unterhalb der BBG der KV)<br />
Bisheriges Entgelt: 3.000,00 EUR<br />
Regelarbeitsentgelt: 1.500,00 EUR<br />
Ins Wertguthaben einzustellendes Arbeitsentgelt: 1.500,00 EUR<br />
Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen für 1.500,00 EUR<br />
KV 7 %: 105,00 EUR<br />
PV 0,85 %: 12,75 EUR<br />
RV 9,75 %: 146,25 EUR<br />
ALV 3,25 %: 48,75 EUR<br />
Arbeitgeberanteil gesamt: 312,75 EUR<br />
Abzusichern sind insgesamt: 1.812,75 EUR<br />
Beispiel 2 zur Ermittlung des abzusichernden Wertguthabens<br />
(Stand 2006):<br />
(Teilzeitentgelt oberhalb der BBG der RV)<br />
Bisheriges Entgelt: 12.000,00 EUR<br />
Regelarbeitsentgelt: 6.000,00 EUR<br />
Ins Wertguthaben einzustellendes Arbeitsentgelt: 6.000,00 EUR<br />
Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen für 6.000,00 EUR<br />
KV 7 %: -,- EUR<br />
PV 0,85%: -,- EUR<br />
RV 9,75% von 5.250,00 EUR: 511,86 EUR<br />
ALV 3,25% von 5.250,00 EUR: 170,66 EUR<br />
Arbeitgeberanteil gesamt: 682,52 EUR<br />
Abzusichern sind insgesamt: 6.682,52 EUR<br />
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber in diesem Beispiel die Zuschüsse zur<br />
KV/PV mit gegen Insolvenz absichern.<br />
Bei der Ermittlung der Höhe dürfen Aufstockungsbeträge <strong>und</strong> zusätzliche<br />
Rentenversicherungsbeiträge (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a <strong>und</strong> b AtG) nicht angerechnet<br />
werden. Unklar ist, ob der Abzug nur bei Ermittlung der Berechnungsgr<strong>und</strong>lage<br />
für die Sozialversicherung unzulässig ist oder auch bei der Berechnung<br />
des abzusichernden, noch nicht zur Auszahlung gelangten Arbeitsentgelts.<br />
Abzusichern ist in jedem Fall das bereits erarbeitete <strong>und</strong> im Störfall an<br />
den Arbeitnehmer auszuzahlende Entgelt (im Gr<strong>und</strong>satz 50 % des erarbeite-<br />
87
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 88<br />
ten Entgelts). Das Gleiche gilt für den Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag,<br />
da er Bestandteil des Entgelts ist, <strong>und</strong> für den Arbeitgeberanteil<br />
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Nicht zum Wertguthaben<br />
gehören zukünftige Aufstockungsbeträge, da diese kein Arbeitsentgelt sind<br />
<strong>und</strong> damit nicht zum Wertguthaben gehören. Problematisch ist, ob von dem<br />
vom Arbeitnehmer erarbeiteten <strong>und</strong> im Störfall auszuzahlenden Arbeitsentgelt<br />
bereits geleistete Aufstockungsbeträge abgezogen werden dürfen, wenn dies<br />
im Tarifvertrag oder im Altersteilzeitvertrag für den Fall der vorzeitigen Beendigung<br />
der Altersteilzeit ausdrücklich vorgesehen ist. Da solche Regelungen<br />
bzw. Vereinbarungen weiterhin zulässig sind, dürfte der Abzug arbeitsrechtlich<br />
möglich sein mit der Folge, dass nur der verbleibende Teilbetrag gegen<br />
Insolvenz gesichert werden müsste. Die Diskussion hierzu ist im Fluss. Ob<br />
sich die Rechtsprechung der hier vertretenen Auffassung anschließen wird,<br />
bleibt abzuwarten.<br />
Die Verpflichtung zur Insolvenzsicherung entsteht mit der ersten Gutschrift,<br />
d.h. in dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf das in der Freistellungsphase<br />
auszuzahlende Arbeitsentgelt entsteht.<br />
§ 8a AtG legt nicht fest, in welcher Art die Insolvenzsicherung zu erfolgen hat.<br />
Das Gesetz enthält lediglich eine Negativliste. Nicht ausreichend sind:<br />
bilanzielle Rückstellungen,<br />
zwischen Konzernunternehmen(§ 18 AktG) begründete Einstandspflichten,<br />
insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen oder Schuldbeitritte.<br />
Dem Arbeitgeber steht es im Übrigen frei, welches Insolvenzsicherungsmodell<br />
er wählt. Denkbar sind u.a.:<br />
Bankbürgschaften,<br />
Absicherung durch dingliche Sicherheiten (z.B. Verpfändung von den Wertpapieren,<br />
insbesondere Fonds, zu Gunsten der Arbeitnehmer),<br />
Sicherungsmodelle der Versicherungswirtschaft ggf. im Zusammenhang<br />
mit Modellen der Tarifvertragsparteien oder<br />
das Modell der doppelseitigen Treuhand.<br />
Unternehmensexterne Modelle, die auch schon auf dem Markt angeboten werden,<br />
sind entweder Fondslösungen, Kautionsversicherungen, Bankbürgschaften<br />
oder den Sozialkassen der Bauwirtschaft nachgebildete Modelle.<br />
Lösungen über Lebensversicherungen, die für eine Insolvenzsicherung von<br />
Wertguthaben in Betracht kommen, sind wegen der damit verb<strong>und</strong>enen steuerlichen<br />
Probleme – Kapitalbindung für mindestens 12 Jahre seit Vertragsschluss<br />
– zurzeit noch nicht praktikabel.<br />
88
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 89<br />
Bis auf Bürgschaftsmodelle <strong>und</strong> die Kautionsversicherung sind alle diese<br />
Modelle mit einem mehr oder weniger großen Liquiditätsabfluss verb<strong>und</strong>en.<br />
Bürgschaftsmodelle haben den Nachteil, dass zwar die Liquidität dem Unternehmen<br />
verbleibt, die Bürgschaft aber auf den abzusehenden Höchstbetrag<br />
lauten muss <strong>und</strong> somit regelmäßig hohe Kosten verursacht. Dabei variiert der<br />
Provisionssatz je nach Aufwand <strong>und</strong> Abschätzung des Risikos durch das Kreditinstitut.<br />
Auch wird die Bürgschaftssumme auf die Kreditlinie des Unternehmens<br />
angerechnet.<br />
Vereinzelt gibt es darüber hinaus einige unternehmensspezifische Lösungen<br />
auf Investmentfondbasis oder auf Basis einer Verpfändungsvereinbarung zwischen<br />
Geschäftsleitung <strong>und</strong> Betriebsrat, die den Vorteil haben, dass dem<br />
Unternehmen Liquidität verbleibt. Diese Lösung kommt aber nur für große<br />
Unternehmen in Betracht.<br />
Einen Überblick über die unterschiedlichen Modelle der Insolvenzsicherung<br />
enthält die vom Wirtschafts- <strong>und</strong> Arbeitsministerium in NRW herausgegebene<br />
Broschüre: „Die Insolvenzsicherung von Arbeitszeitguthaben, eine Übersicht“.<br />
Die Broschüre kann unter der Veröffentlichungsnummer 1169 bestellt<br />
werden bei der GWN GmbH, Herrn Wendlinger, Am Krausenbaum 11, 41464<br />
Neuss.<br />
Das von dem Arbeitgeber gewählte Insolvenzsicherungsmodell sollte bereits<br />
im Altersteilzeitarbeitsvertrag angegeben werden.<br />
Der Arbeitgeber hat gegenüber dem Arbeitnehmer erstmals mit der ersten Gutschrift<br />
<strong>und</strong> anschließend alle sechs Monate unaufgefordert die zur Sicherung<br />
ergriffenen Maßnahmen in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen. Dazu<br />
genügt z.B. die Mitteilung in der Lohn- <strong>und</strong> Gehaltsabrechnung, wenn die Person<br />
des Erklärenden genannt <strong>und</strong> der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung<br />
der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht wird. Eine<br />
andere gleichwertige Art <strong>und</strong> Form des Nachweises können Arbeitgeber <strong>und</strong><br />
Betriebsrat vereinbaren; hierzu dürften auch Abweichungen im Turnus der Mitteilung<br />
gehören. Damit der Altersteilzeiter die korrekte Absicherung überprüfen<br />
kann, sollte die Mitteilung neben dem Stand des abgesicherten Wertguthabens<br />
auch einen Nachweis über die abgesicherten Arbeitgeberanteile an<br />
den Sozialversicherungsbeiträgen enthalten. Außerdem ist der Betriebsrat<br />
nach § 80 Abs. 2 BetrVG zu unterrichten (s. hierzu unten 9.3.4.1).<br />
Der Arbeitnehmer kann in folgenden Fällen Sicherheitsleistung in Höhe des<br />
bestehenden Wertguthabens fordern (§ 8a Abs. 4 AtG):<br />
Der Arbeitgeber kommt seiner Informationspflicht nicht nach oder<br />
die nachgewiesenen Maßnahmen sind nicht geeignet oder<br />
89
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 90<br />
der Arbeitgeber weist auf schriftliche Aufforderung des Arbeitnehmers nicht<br />
innerhalb eines Monats eine geeignete Insolvenzsicherung des bestehenden<br />
Wertguthabens in Textform nach.<br />
Der Arbeitnehmer hat dabei ein Wahlrecht, welche Sicherheit er fordern will,<br />
<strong>und</strong> kann die Sicherheitsleistung gerichtlich durchsetzen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 30.10.006 – 3 AZB 39/06 –, NZA 2007, 647). Mögliche Sicherungsmittel<br />
sind<br />
Stellung eines tauglichen Bürgen,<br />
Hinterlegung von Geld oder zur Sicherheitsleistung geeigneter Wertpapiere.<br />
§ 8a AtG ist zwingendes Recht, d.h. abweichende Vereinbarungen zum Nachteil<br />
des Arbeitnehmers sind unwirksam (Abs. 5). Das gilt auch für abweichende<br />
Regelungen in Betriebsvereinbarungen <strong>und</strong> Tarifverträgen, da die Vorschrift<br />
keine Öffnungsklausel enthält.<br />
4.6.3 Haftung bei Nichterfüllung der Insolvenzsicherung<br />
Fraglich ist, ob <strong>und</strong> unter welchen Voraussetzungen eine persönliche Haftung<br />
der Organe der Gesellschaft wegen unterbliebener Insolvenzsicherung in<br />
Betracht kommt. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat zur Haftung von GmbH-<br />
Geschäftsführern bislang nur in „Altfällen“ (Insolvenzsicherung gemäß § 7d<br />
Abs. 1 SGB IV) entschieden <strong>und</strong> nur unter besonderen Umständen eine persönliche<br />
Haftung bejaht (Urt. vom 13.12.2005 – 9 AZR 436/04 –, NZA 2006,<br />
729; Urt. vom 21.11.2006 – 9 AZR 206/06 –, NZA 2007, 693; Urt. vom<br />
13.2.2007 – 9 AZR 106/06 – DB 2007, 1690): Die unterbliebene Absicherung<br />
des Wertguthabens gegen Insolvenz durch eine GmbH stellt keine unerlaubte<br />
Handlung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB dar. Ein Wertguthaben, das ein Arbeitnehmer<br />
in Altersteilzeit anspart, ist kein sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1<br />
BGB. Dass der Geschäftsführer einer GmbH den Arbeitnehmer im<br />
Zusammenhang mit der Verlängerung des Altersteilzeitarbeitsvertrages nicht<br />
darauf hingewiesen hat, dass sein bisher erworbenes Wertguthaben nicht<br />
gegen eine Insolvenz der Schuldnerin abgesichert war, erfüllt nicht den Tatbestand<br />
des Betruges. Der Geschäftsführer haftet auch nicht nach § 823<br />
Abs. 2 BGB i.V.m. § 266 Abs. 1 StGB. Zwischen dem Arbeitnehmer <strong>und</strong> dem<br />
Beklagten als Geschäftsführer der GmbH besteht kein Vermögensbetreuungsverhältnis<br />
i.S.d. § 266 StGB. § 7d Abs. 1 SGB IV ist auch kein Schutzgesetz<br />
i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB, dessen Verletzung zu einer Haftung des<br />
Geschäftsführers wegen unterbliebener Insolvenzsicherung des vom Arbeitnehmer<br />
erworbenen Wertguthabens führen könnte. Es fehlt eine klare Zuweisung<br />
der Verantwortung für den Insolvenzschutz als Voraussetzung für eine<br />
individuelle Haftung des Geschäftsführers einer GmbH auf Schadensersatz,<br />
da auch der Arbeitnehmer selbst durch § 7d Abs. 1 SGB 4 verpflichtet wird, an<br />
90
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 91<br />
der Gewährleistung seines Schutzes mitzuwirken. Besondere Umstände, die<br />
zu einer persönlichen Haftung führen, können insbesondere gegeben sein,<br />
wenn z.B. das Organ persönlich Vertrauen in Anspruch nimmt etwa in dem<br />
Sinne, er werde für die Ansprüche im Falle der Insolvenz einstehen, oder wenn<br />
das Organ den Arbeitnehmer durch Erklärungen davon abhält, der Frage der<br />
Insolvenzsicherung weiter nachzugehen. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hatte in<br />
seinem Urt. vom 13.2.2007 – 9 AZR 207/06 (NZA 2007, 125) einen solchen<br />
Fall zu beurteilen: Der dem Altersteilzeitverhältnis zugr<strong>und</strong>e liegende Tarifvertrag<br />
zur Altersteilzeit der Metall- <strong>und</strong> Elektroindustrie Südwest schreibt eine<br />
Insolvenzsicherung des Wertguthabens vor, wenn dieses 150 St<strong>und</strong>en übersteigt.<br />
In einer dazu abgeschlossenen Betriebsvereinbarung war vereinbart,<br />
dass der Arbeitgeber entsprechend dem Tarifvertrag Maßnahmen zur Insolvenzsicherung<br />
nachweist. Der betroffene Kläger hatte behauptet, der<br />
Geschäftsführer habe gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden auf Nachfrage<br />
erklärt, dass eine entsprechende Insolvenzsicherung der Wertguthaben<br />
erfolgt sei. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hält diesen Vortrag für erheblich. Sollte<br />
die Behauptung des Klägers zutreffen, haftet der Geschäftsführer gemäß<br />
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB persönlich wegen Betruges zu Lasten<br />
der betroffenen Arbeitnehmer.<br />
Ob diese Einschränkungen der persönlichen Haftung wegen unterbliebener<br />
Insolvenzsicherung auch für die Regelung in § 8a AtG oder für tarifliche<br />
Bestimmungen, die eine besondere Insolvenzsicherung vorschreiben, gelten,<br />
ist zweifelhaft (offengelassen vom B<strong>und</strong>esarbeitsgericht im Urt. vom<br />
13.12.2005, a.a.O.). Es spricht viel dafür, dass § 8a AtG bzw. eine vergleichbare<br />
tarifliche Regelung Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB sind. Anders<br />
als bei § 7d SGB IV wird nämlich in § 8a AtG die Pflicht zur Insolvenzsicherung<br />
allein dem Arbeitgeber zugewiesen; bei einer tariflichen Regelung wird<br />
das meist auch der Fall sein. Jedenfalls bei einer Verletzung der gesetzlichen<br />
oder tariflicher Informationspflichten oder unrichtiger Auskunft wird eine persönliche<br />
Haftung zu bejahen sein.<br />
4.6.4 Gesetzesvorhaben zur Verbesserung der sozialrechtlichen<br />
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen<br />
Es ist geplant, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeitregelungen<br />
generell zu verbessern. Hierzu liegt ein 1. Referentenentwurf vom<br />
6.6.2007 vor. Danach ist u.a. eine vollständige Insolvenzsicherung für alle<br />
Wertguthaben vorgesehen. Nach § 7b Abs. 1 SGB IV des Entwurfes soll eine<br />
Wertguthabenvereinbarung zukünftig ohne getroffene Vorkehrungen bei Zahlungsunfähigkeit<br />
des Arbeitgebers nichtig sein <strong>und</strong> bis zum schriftlichen Nachweis<br />
des vereinbarten Insolvenzschutzes im Zweifel als nicht geschlossen gelten.<br />
Wertguthabenvereinbarungen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes ohne<br />
Vorkehrungen bei Zahlungsunfähigkeit vereinbart worden sind, werden<br />
91
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 92<br />
unwirksam, wenn nicht die Vorkehrungen für eine Insolvenzsicherung (rückwirkend)<br />
innerhalb einer Übergangsfrist von sechs Monaten getroffen werden<br />
(§ 116 Abs. 2 SGB IV des Entwurfes). Im Übrigen sind nach dem Entwurf Wertguthaben<br />
immer als Arbeitsentgeltguthaben zu führen (§ 7a Abs. 1 S. 7 SGB<br />
IV des Entwurfes). Es ist noch nicht abzusehen, ob, mit welchem Inhalt <strong>und</strong><br />
wann der kontrovers diskutierte Entwurf umgesetzt werden wird. Informationen<br />
über den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens können der<br />
Homepage www.datakon text.com entnommen werden.<br />
5 Rechtsstellung des Arbeitnehmers während der<br />
Altersteilzeitarbeit<br />
5.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Die Rechtsstellung des Altersteilzeitarbeitnehmers während der Altersteilzeitarbeit<br />
hängt von der Ausgestaltung der Altersteilzeitarbeit ab. Sonderprobleme<br />
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertguthaben <strong>und</strong> wegen der<br />
Freistellung sind in erster Linie beim Blockmodell praktisch bedeutsam. Bei<br />
kontinuierlicher Verteilung der Arbeitszeit in der Form einer klassischen Teilzeitarbeit<br />
sind die Rechtsprobleme geringer. Die Arbeitspflicht besteht während<br />
der gesamten Dauer der Altersteilzeitarbeit fort. Der Arbeitnehmer ist hinsichtlich<br />
Sonderzuwendungen, Urlaub etc. genauso zu behandeln wie die<br />
anderen Teilzeitbeschäftigten des Betriebes. Da der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
während der gesamten Dauer der Altersteilzeitarbeit mit der halben Arbeitszeit<br />
weiterarbeitet, ohne Wertguthaben für eine folgende Freistellungsphase<br />
zu erwerben <strong>und</strong> ohne Freistellungsphase in der zweiten Hälfte der Altersteilzeitarbeit,<br />
gibt es auch sonst weniger Fragestellungen als beim Blockmodell.<br />
Der Arbeitnehmer bleibt Arbeitnehmer des Betriebes, behält sein Betriebsratsamt<br />
oder sonstige Mandate <strong>und</strong> zählt wie andere Teilzeitbeschäftigte bei<br />
Schwellenwerten, z.B. §§ 5, 38, 92a, 99, 111 BetrVG, § 23 Abs. 1 S. 2 <strong>und</strong> 3<br />
KSchG, mit. Der Arbeitnehmer nimmt auch an tariflichen oder betrieblichen<br />
Gehaltserhöhungen <strong>und</strong> an Verlängerungen oder Verkürzungen der Arbeitszeit<br />
teil, wenn diese Regelungen auf sein Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.<br />
Der Arbeitnehmer in Altersteilzeitarbeit kann sich auch auf den Gleichbehandlungsgr<strong>und</strong>satz<br />
berufen. Maßstab ist dabei die Behandlung der sonstigen<br />
Teilzeitbeschäftigten. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hatte sich mehrfach mit<br />
Fällen zu befassen, in denen ihnen zu Unrecht Leistungen unter Berufung auf<br />
die Altersteilzeit versagt worden sind. Unzulässig ist etwa der Ausschluss von<br />
Altersteilzeitarbeitnehmern von einer jährlichen Leistungsprämie; auch ein<br />
Freiwilligkeitsvorbehalt rechtfertigt diesen Ausschluss nicht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 24.10.2006 – 9 AZR 713/05 <strong>und</strong> – 9 AZR 681/05 –, DB 2007,<br />
695). Ebenso wenig durften angestellte Lehrkräfte in Altersteilzeit von einer<br />
Altersermäßigung ausgenommen werden (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
13.6.2006 – 9 AZR 588/05 –, ZTR 2006, 664).<br />
92
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 93<br />
5.2 Langandauernde Arbeitsunfähigkeit – medizinische<br />
Rehabilitationsmaßnahme<br />
Probleme bei Arbeitsunfähigkeitszeiten entstehen bei der Altersteilzeitarbeit<br />
bei kontinuierlicher Altersteilzeitarbeit sowie bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit<br />
während der Arbeitsphase (vgl. hierzu ausführlich <strong>Kapitel</strong> V: Behandlung von<br />
Fehlzeiten während der Altersteilzeitarbeit).<br />
Bei Arbeitsunfähigkeit oder medizinischer Rehabilitationsmaßnahme hat der<br />
Arbeitgeber zunächst das Entgelt einschließlich des Aufstockungsbeitrages<br />
zum Entgelt <strong>und</strong> des Unterschiedsbetrags für die Rentenversicherung nach<br />
den Regeln des EFZG bis zur Dauer von 6 Wochen fortzuzahlen. Anschließend<br />
erhält der Arbeitgeber die Entgeltersatzleistung (Krankengeld, Versorgungskrankengeld,<br />
Verletztengeld oder Übergangsgeld) oder ein Krankentagegeld<br />
von einer privaten Krankenversicherung. Hat die BA dem Arbeitgeber<br />
bislang den Aufstockungsbetrag <strong>und</strong> Unterschiedsbetrag zur Rentenversicherung<br />
erstattet, so erhält der Arbeitnehmer für die Dauer des Bezugs der<br />
Entgeltersatzleistung oder des Krankentagegeldes die Aufstockungsleistungen<br />
– allerdings nur in der gesetzlichen Höhe – direkt von der BA. Der Arbeitgeber<br />
kann aber auch die Aufstockungsleistungen zum Entgelt <strong>und</strong> die zusätzlichen<br />
RV-Beiträge während der Zeit des Krankengeld-/Krankentagegeldbezuges<br />
weiterzahlen <strong>und</strong> den Anspruch auf Erstattung gegenüber der<br />
B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit selbst gem. § 12 Abs. 2 Satz 3 AtG geltend machen.<br />
Dann ist erforderlich, dass der Arbeitsplatz des Altersteilzeitarbeitnehmers bei<br />
kontinuierlicher Arbeitszeitverteilung während der Gesamtdauer des Krankengeldbezuges<br />
<strong>und</strong> in einem Blockmodell spiegelbildlich wiederbesetzt ist<br />
(zum Antragsverfahren s. <strong>Kapitel</strong> VIII, 15.3).<br />
Probleme entstehen, wenn die Fördervoraussetzungen bei Ablauf der Entgeltfortzahlung<br />
nicht vorliegen, weil der Arbeitsplatz noch nicht wieder besetzt<br />
ist. Das ist insbesondere im Blockmodell der Fall, wenn die Arbeitsunfähigkeit<br />
während der Arbeitsphase länger als sechs Wochen dauert. Nach Ablauf des<br />
Entgeltfortzahlungszeitraumes wird keine Arbeitsleistung mehr erbracht,<br />
durch die für die Freistellungsphase Wertguthaben erzielt werden könnte. Um<br />
eine vorzeitige Beendigung des Versicherungsschutzes in der Freistellungsphase<br />
zu verhindern, besteht die Möglichkeit (s. hierzu RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, 2.1.7.2),<br />
die vorgesehene Freistellungsphase zu verkürzen, indem die in der Arbeitsphase<br />
ausgefallene Zeit nachgearbeitet wird (bei einer Versicherungspflicht<br />
aufgr<strong>und</strong> eines Krankengeldbezuges bzw. eines Antrags für Zeiten<br />
der Arbeitsunfähigkeit mit Aufstockungsleistungen ist nur die Hälfte nachzuarbeiten),<br />
oder<br />
dass der Arbeitgeber das Wertguthaben in der Höhe vermehrt, in der durch<br />
die Arbeitsunfähigkeit Wertguthaben nicht angespart werden konnte; dies<br />
93
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 94<br />
muss vor Eintritt der Freistellungsphase erfolgen. Ein Anspruch hierauf<br />
besteht nicht, kann sich aber aus einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung<br />
oder aus einer entsprechenden Vereinbarung aus dem Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
ergeben.<br />
Entsprechendes gilt auch in den Fällen einer Kurzarbeit oder eines witterungsbedingten<br />
Arbeitsausfalls.<br />
Die Streckung des Wertguthabens durch eine geringere Entsparung oder die<br />
Reduzierung des fälligen Arbeitsentgelts in der Arbeitsphase zugunsten der<br />
Erhöhung des Wertguthabens für die Freistellungsphase ist hingegen nicht<br />
zulässig. Eine Reduzierung des in der Arbeitsphase oder des in der Freistellungsphase<br />
fälligen laufenden Arbeitsentgelts hätte zur Folge, dass sowohl<br />
die Höhe des steuer- <strong>und</strong> beitragsfreien Aufstockungsbetrages als auch die<br />
Höhe der für die Berechnung der zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge<br />
maßgeblichen beitragspflichtigen Einnahme in das Belieben der Vertragsparteien<br />
(Arbeitgeber/Arbeitnehmer) gestellt wären. Das ist jedoch durch das AtG<br />
ausgeschlossen (R<strong>und</strong>schreiben der Spitzenverbände vom 9.3.2004,<br />
2.1.7.2).<br />
Zur Weiterzahlung der Aufstockungsbeträge s. oben 2.2.6.4 <strong>und</strong> <strong>Kapitel</strong> V.<br />
5.3 Progressionsvorbehalt – Erstattung durch den Arbeitgeber<br />
Steuernachforderungen, die sich aus dem Progressionsvorbehalt (§ 32b<br />
Abs. 1 Nr. 1 EStG) wegen der Aufstockungsleistungen ergeben, sind vom<br />
Arbeitgeber als sog. Progressionsschaden nur dann zu ersetzen, wenn der<br />
Arbeitgeber dies in der Altersteilzeitvereinbarung zugesagt hat. Allein aus der<br />
Zusage, während der Altersteilzeit das Arbeitsentgelt auf einen Prozentsatz<br />
des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts aufzustocken,<br />
ergibt sich diese Verpflichtung nicht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
25.6.2002, DB 2002, 2493 = ZIP 2003, 183; Urt. vom 1.10.2002 – 9 AZR 298/01<br />
–, nicht veröff.). Ein solcher Anspruch ergibt sich auch nicht aus § 5 des TV<br />
ATZ des öff. Dienstes i.d.F. vom 15.3.1999 (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
18.3.2003, ZTR 2003, 451).<br />
5.4 Rechtsstellung des Arbeitnehmers im Blockmodell<br />
5.4.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Die unter 5.1 darlegte Rechtsstellung des Altersteilzeitarbeitnehmers gilt<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich auch für Altersteilzeitarbeit im Blockmodell. Seine Rechtsstellung<br />
im Blockmodell weist jedoch zahlreiche Besonderheiten auf, die sich aus<br />
dem Blockmodell, bestehend aus einer Arbeits- <strong>und</strong> einer Freistellungsphase,<br />
ergeben. Auf diese Besonderheiten wird im Folgenden näher eingegangen.<br />
94
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 95<br />
5.4.2 Aufbau des Wertguthabens in der Arbeitsphase<br />
Im Blockmodell wird in der Arbeitsphase, in welcher der Arbeitnehmer mit der<br />
„bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AtG) weiterarbeitet,<br />
das Wertguthaben für die anschließende Freistellungsphase erarbeitet. Das<br />
in der Arbeitsphase aufgebaute Wertguthaben kann in Arbeitszeit oder in Geld<br />
geführt werden. Abrechnungstechnisch ist insbesondere im Hinblick auf tarifliche<br />
Lohn- <strong>und</strong> Gehaltserhöhungen das in Geld geführte Konto vorzuziehen.<br />
Das Wertguthaben ist dynamisch, d.h. Lohn- <strong>und</strong> Gehaltserhöhungen, die<br />
während der Altersteilzeit eintreten, sind ab dem Zeitpunkt der Änderung zu<br />
berücksichtigen, soweit sie für den Altersteilzeiter gelten, z.B. durch Tarifbindung<br />
oder Bezugnahme auf einen Tarifvertrag.<br />
Abzustellen ist auf die „bisherige wöchentliche Arbeitszeit“, also die Arbeitszeit,<br />
die mit dem Arbeitnehmer vor dem Übergang in die Altersteilzeit vereinbart<br />
war. Eine spätere allgemeine Erhöhung der tariflichen oder betrieblichen<br />
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit während der laufenden Arbeitsphase<br />
führt weder automatisch zu einer Änderung dieser Arbeitszeit, noch ist es<br />
erlaubt, den Altersteilzeitvertrag entsprechend anzupassen, da dann keine<br />
Altersteilzeit i.S.d. des Gesetzes vorliegt. Möglich ist aber eine Erhöhung der<br />
Arbeitszeit während der Arbeitsphase, wenn dadurch ein zusätzliches Wertguthaben<br />
neben dem Wertguthaben aus der Altersteilzeitarbeit aufgebaut<br />
wird, das aber nicht zu einer Verkürzung der Arbeitsphase führen darf, sondern<br />
innerhalb der Arbeitsphase, z.B. durch Ausgleichstage, ausgeglichen<br />
werden muss (s. hierzu <strong>und</strong> zum Fall der Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit<br />
ausführlich oben 2.2.4.3; s. im Übrigen zum Wertguthaben ausführlich<br />
<strong>Kapitel</strong> VI).<br />
5.4.3 Pfändung des Aufstockungsbetrages <strong>und</strong> von Wertguthaben<br />
Da es sich bei dem Aufstockungsbetrag zum Entgelt nicht um Versorgungsleistungen,<br />
sondern um Arbeitsentgelt handelt, ist der Aufstockungsbetrag normales<br />
Einkommen i.S.v. § 850 ZPO, das nach Maßgabe der §§ 850a ff.<br />
gepfändet werden kann. Das gilt auch für die in der Freistellungsphase im<br />
Blockmodell weiterhin vom Arbeitgeber zu zahlende Vergütung (Boewer,<br />
Handbuch der Lohnpfändung; Rz. 465 f.; Glatzel, AR-Blattei Altersteilzeit,<br />
Rz. 24). Pfändungsbeschlüsse, die sich auf die Vergütung beziehen, erfassen<br />
auch den Aufstockungsbetrag zum Entgelt (§ 832 ZPO). Das Gleiche gilt, wenn<br />
das Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis nach der Pfändung des Arbeitseinkommens<br />
bei dem bisherigen Arbeitgeber begonnen wird (Stöber, Forderungspfändung,<br />
Rz. 881a). Leistet eine Ausgleichskasse oder eine gemeinsame<br />
Einrichtung der Tarifvertragsparteien den Aufstockungsbetrag (§ 9 AtG), ist<br />
diese Drittschuldnerin. Eine Zusammenrechnung des Arbeitsentgelts für die<br />
Altersteilzeitarbeit <strong>und</strong> des Aufstockungsbetrages kann nach § 850e Nr. 2 ZPO<br />
95
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 96<br />
erfolgen. Soweit die BA den Aufstockungsbetrag gewährt (§ 10 Abs. 2 AtG),<br />
richtet sich die Pfändung nach § 54 SGB I (laufende Geldleistungen).<br />
Vereinbaren Arbeitnehmer <strong>und</strong> Arbeitgeber wie beim Blockmodell, den Lohn<br />
für die vom Arbeitnehmer zu erbringende Arbeitsleistung nicht auszuzahlen,<br />
sondern einem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben, so fließt dem Arbeitnehmer<br />
mit der Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto noch kein Arbeitslohn zu, der der<br />
Pfändung unterliegt. Erst die Auszahlung des (noch nicht verbrauchten) Guthabens<br />
führt beim Arbeitnehmer zum Zufluss von Arbeitslohn, der auch dem<br />
Lohnsteuerabzug unterliegt. Das gilt sowohl für die planmäßigen Auszahlungen<br />
in der Freistellungsphase als auch für die sofortige Auszahlung im Störfall<br />
oder für die Auszahlung von Restguthaben, die sich zum Ende der Freistellungsphase<br />
noch auf dem Arbeitszeitkonto befinden <strong>und</strong> ausgezahlt<br />
werden. Das im Störfall noch auszuzahlende Wertguthaben unterliegt der<br />
Pfändung als nicht wiederkehrend zahlbare Vergütung i.S. von § 850i ZPO.<br />
Der Schuldner kann einen Pfändungsschutz nur auf Antrag nach § 850i ZPO<br />
erreichen (Boewer, a.a.O., Rz. 467, 1014; hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt.<br />
vom 24.9.2003 – 10 AZR 640/02 –, ZIP 2004, 124)<br />
5.4.4 Rechtsstellung des Arbeitnehmers während der<br />
Freistellungsphase<br />
5.4.4.1 Wegfall der Arbeitspflicht – Ausgleich des Wertguthabens<br />
Der Altersteilzeitarbeitnehmer im Blockmodell hat in der Arbeitsphase die auf<br />
die anschließende Freistellungsphase entfallende Arbeitszeit vorgearbeitet.<br />
Der Arbeitszeitausgleich erfolgt dadurch in der Freizeitphase, dass das erarbeitete<br />
Wertguthaben in die Freistellungsphase eingebracht wird. Der Arbeitnehmer<br />
hat daher keine Arbeitspflicht mehr; er unterliegt nicht mehr dem Weisungsrecht<br />
des Arbeitgebers. Eine Beschäftigung in der Freistellungsphase<br />
ist Mehrarbeit <strong>und</strong> nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer möglich. Mehrarbeit<br />
oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze stellt dabei eine Unterbrechung<br />
der Altersteilzeitarbeit dar <strong>und</strong> sollte vorher schriftlich vereinbart werden (s.<br />
zur Unterbrechung oben). Zuweilen wird der Arbeitnehmer in der Freistellungsphase<br />
auch als freier Mitarbeiter beschäftigt, wenn auf seine Fachkenntnisse<br />
nicht verzichtet werden kann. Dabei sind aber mögliche Folgen für<br />
die Förderung durch die BA zu beachten (siehe hierzu <strong>Kapitel</strong> VIII).<br />
5.4.4.2 Wertguthaben <strong>und</strong> Insolvenz des Unternehmens<br />
Wird die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell durchgeführt (Arbeitsphase <strong>und</strong><br />
anschließende Freizeitphase) droht dem Arbeitnehmer im Falle der Insolvenz<br />
des Arbeitgebers der Verlust des erarbeiteten Wertguthabens. Wertguthaben<br />
aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die nach dem 30.6.2004 begonnen<br />
haben, sind für den Fall der Insolvenz des Unternehmens gesetzlich durch die<br />
96
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 97<br />
Insolvenzsicherung gemäß § 8a AtG geschützt (siehe hierzu oben 4.6). Wie<br />
bedeutsam diese Schutzregelung für die Arbeitnehmer ist, zeigt die neueste<br />
Rechtsprechung des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts zum insolvenzrechtlichen Rang<br />
von Wertguthaben aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die vor dem 1.7.2004<br />
begonnen haben. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht kommt zu insolvenzrechtlichen<br />
Lösungen, ohne die Besonderheiten von Wertguthaben bei der Altersteilzeit<br />
im Blockmodell zu berücksichtigen. Das hat fatale Folgen für die betroffenen<br />
Arbeitnehmer, soweit ihre Ansprüche nicht (ausnahmsweise) durch Tarifvertrag<br />
oder freiwillige Vereinbarung mit dem Arbeitgeber gegen Insolvenz gesichert<br />
worden sind.<br />
Die Abgrenzung einfache Insolvenzforderung (§ 108 Abs. 2 InsO) oder Masseforderung<br />
(§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO) erfolgt nach Auffassung des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts<br />
danach, wann die Arbeitsleistung erbracht worden ist. Unerheblich<br />
ist dagegen, wann der Arbeitnehmer die Zahlung verlangen kann. Der<br />
Arbeitnehmer tritt in der Arbeitsphase in Vorleistung. Er erarbeitet hierdurch<br />
im Umfang seiner Vorleistung Entgeltansprüche, die für die spätere Freistellungsphase<br />
angespart werden. Die vom Arbeitgeber in der Freistellungsphase<br />
zu erbringenden Leistungen stellen sich als eine in der Fälligkeit hinausgeschobene<br />
Vergütung dar, welche für die während der Arbeitsphase<br />
geleistete, über die hälftige Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit erbracht<br />
wird (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urteile vom 23.2.2005 – 10 AZR 600 – 603/03 –,<br />
EzA § 55 InsO Nr. 7; – 10 AZR 672/03 –, DB 2005, 1227; Urt. vom 19.12.2006<br />
– 9 AZR 230/06 –, BB 2006, 1281). Das gilt sowohl für das hälftige Arbeitsentgelt<br />
als auch für den Aufstockungsbetrag (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
19.10.2004 – 9 AZR 645 – 647/03 –, NZA 2005, 408 = DB 2005, 779). Das<br />
bedeutet, dass die in der Arbeitsphase für die Zeit vor der Insolvenzeröffnung<br />
erarbeiteten Ansprüche (Wertguthaben) einfache Insolvenzforderungen sind.<br />
Die für die Zeit nach Insolvenzeröffnung erarbeiteten Ansprüche (Wertguthaben)<br />
sind dagegen Masseforderungen. Zahlungen, die der Arbeitgeber während<br />
der Freistellungsphase – spiegelbildlich – zu dem Teil der Arbeitsphase<br />
zu leisten hat, für den Masseforderungen entstanden sind, sind ebenfalls Masseforderungen,<br />
wobei die Masseforderungen sowohl das fortzuzahlende hälftige<br />
Arbeitsentgelt als auch den Aufstockungsbetrag umfassen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 19.10.2004, a.a.O). Die Praxis wird sich an dieser rein<br />
insolvenzrechtlichen Lösung des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts orientieren müssen.<br />
Der Insolvenzverwalter kann nicht durch Kündigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
während der Freistellungsphase aus dringenden betrieblichen<br />
Erfordernissen erreichen, dass eine etwaige Masseforderung nunmehr als<br />
Schadensersatzforderung nur noch einfache Insolvenzforderung ist; vgl. im<br />
Übrigen zu Kündigung unten 7.5.4.1.<br />
97
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 98<br />
5.4.4.3 Fortbestehen von Nebenpflichten<br />
Der Arbeitnehmer ist während der Freistellungsphase von der Arbeitspflicht<br />
befreit. Andererseits dauert das Arbeitsverhältnis bis zur Beendigung des<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses fort. Daraus folgt, dass die sich aus der<br />
Treue pflicht ergebenden Nebenpflichten fortbestehen. Hierzu gehören etwa<br />
die Pflichten,<br />
Verhaltensweisen zu unterlassen, die zum Wegfall der Förderungsvoraussetzungen<br />
führen, z.B. Nebentätigkeiten über den Umfang einer geringfügigen<br />
Beschäftigung hinaus zu unterlassen, soweit er hierzu nicht ausnahmsweise<br />
berechtigt ist (Besitzstand gemäß § 5 Abs. 3 S. 4 AtG),<br />
Konkurrenztätigkeit oder Wettbewerb zu unterlassen,<br />
die arbeitsvertragliche Geheimhaltungspflicht einzuhalten,<br />
geschäftsschädigende Äußerungen zu unterlassen.<br />
Handelt der Arbeitnehmer pflichtwidrig, kann ihm auch ohne Regelung im<br />
Altersteilzeitarbeitsvertrag dann fristlos gekündigt werden, wenn eine<br />
besonders schwerwiegende Pflichtverletzung vorliegt <strong>und</strong> der Arbeitnehmer<br />
durch sein Verhalten die Vertrauensgr<strong>und</strong>lage für das Arbeitsverhältnis zerstört<br />
hat (§ 626 Abs. 1 BGB). So hat etwa das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein<br />
in seinem Urt. vom 18.1.2005 – 2 Sa 413/04 – (NZA-RR 2005,<br />
367) die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers<br />
in der Freistellungsphase wegen Ladendiebstahls bzw. dringenden<br />
Verdachts des Ladendiebstahls in einem Laden des Arbeitsgebers für wirksam<br />
erklärt. Eine fristgemäße Kündigung ggf. nach Abmahnung ist dagegen<br />
nur möglich, wenn das Recht zur ordentlichen Kündigung im Vertrag für beide<br />
Seiten vorbehalten worden ist.<br />
5.4.4.4 Sonderzuwendungen – Gratifikationen – Tantieme<br />
Der Altersteilzeitarbeitnehmer hat in der Freistellungsphase einen anteiligen<br />
Anspruch auf Sonderzuwendung wie andere teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.<br />
Betriebliche oder tarifliche Regelungen, wonach die Sonderzuwendung<br />
nicht zu zahlen ist, wenn „das Arbeitsverhältnis ruht“, dürften nicht einschlägig<br />
sein. Zwar ruht die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers, die Vergütungspflicht<br />
des Arbeitgebers besteht aber fort. Dagegen entfällt der Anspruch bzw. kann<br />
gekürzt werden, wenn die Sonderzuwendung an die Arbeitsleistung oder an<br />
die Anwesenheit des Arbeitnehmers im Betrieb (sog. Anwesenheitsprämie)<br />
anknüpft.<br />
Bei betrieblichen Sonderzuwendungen hat der Arbeitgeber die Möglichkeit,<br />
den Kreis der Anspruchsberechtigten <strong>und</strong> die Leistungsvoraussetzungen<br />
jedes Jahr neu zu bestimmen <strong>und</strong> auch die Altersteilzeitarbeitnehmer in der<br />
98
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 99<br />
Freistellungsphase von der Leistung auszunehmen, wenn er die Sonderzuwendung<br />
als freiwillige Leistung bezeichnet, die ohne Rechtsanspruch für die<br />
Zukunft gewährt wird (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 12.01.2000, DB 2000,<br />
1717 = NZA 2000, 944).<br />
Bei Ergebnis- oder Umsatzbeteiligungen oder Tantiemen ist auszulegen, ob<br />
der Anspruch an die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmergruppe<br />
anknüpft, ein Anspruch scheidet dann aus. Eine Besonderheit<br />
gilt beim zusätzlichen Urlaubsgeld: Ist nach der tariflichen oder betrieblichen<br />
Regelung ein Anspruch nur gegeben, wenn der Urlaub angetreten wird („…<br />
zahlbar bei Urlaubsantritt“, „… zahlbar für jeden Urlaubstag …“), entfällt der<br />
Anspruch, weil der Arbeitnehmer in der Freistellungsphase keinen Urlaubsanspruch<br />
hat.<br />
5.4.4.5 Urlaub, Urlaubsabgeltung – tarifliche Freistellung –,<br />
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall <strong>und</strong> an Feiertagen<br />
Während der Arbeitsphase hat der Arbeitnehmer in der Altersteilzeit Anspruch<br />
auf den tariflichen, vertraglichen oder gesetzlichen Urlaub wie jeder andere<br />
Arbeitnehmer. Das gilt unabhängig davon, ob er Altersteilzeitarbeit in Form der<br />
kontinuierlichen Arbeitszeit oder im Blockmodell leistet. In der Freistellungsphase<br />
hat er weder einen Anspruch auf Urlaub (Erholungs- <strong>und</strong> Bildungsurlaub)<br />
noch einen Anspruch auf Urlaubsabgeltung, weil er keine Arbeitspflicht<br />
mehr hat, von der er freigestellt werden könnte (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt.<br />
vom 15.3.2005 – 9 AZR 143/04 –, NZA 2005, 994 = DB 2005, 1858). In der<br />
Freistellungsphase sind alle Urlaubsansprüche mit der Freistellung abgegolten<br />
(Landesarbeitsgericht Hamburg, Urt. vom 26.6.2002 – 4 Sa 30/02 –, DB<br />
2002, 2442, rechtskr.). Auch ein Anspruch auf tarifliche oder gesetzliche Freistellung<br />
bei besonderen Anlässen, z.B. Hochzeit, Sterbefall (vgl. § 616 BGB),<br />
besteht nicht. Tritt der Übergang in die Freistellungsphase im Laufe des Jahres<br />
ein, so ist der Urlaub wie im Ein- <strong>und</strong> Austrittsjahr nach den für das Arbeitsverhältnis<br />
geltenden Regelungen (Tarifvertrag oder B<strong>und</strong>esurlaubsgesetz)<br />
anteilig zu gewähren.<br />
Nach § 7 Abs. 4 BUrlG ist eine Urlaubsabgeltung nur zu zahlen, wenn der<br />
Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden<br />
kann. Da das Altersteilzeitarbeitsverhältnis rechtlich erst zum vereinbarten<br />
Endtermin <strong>und</strong> nicht bereits mit dem Übergang von der Arbeitsphase in<br />
die Freistellungsphase endet (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 15.3.2005 – 9<br />
AZR 143/04 –, NZA 2005, 994), ist der Arbeitgeber gesetzlich auch im Fall einer<br />
Erkrankung des Mitarbeiters am Ende der Arbeitsphase nicht verpflichtet,<br />
Resturlaub bei Beginn der Freistellungsphase abzugelten. Der Arbeitnehmer<br />
im Altersteilzeitarbeitsverhältnis hat regelmäßig keinen Anspruch auf Abgeltung<br />
von Urlaubsansprüchen, die er nicht während der Arbeitsphase realisiert<br />
hat (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 10.5.2005 – 9 AZR 196/04 –, AP Nr. 88<br />
99
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 100<br />
zu § 7 BUrlG Abgeltung). Eine Abgeltung des in der Arbeitsphase noch nicht<br />
gewährten Urlaubs bei Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses wird<br />
in der Praxis daran scheitern, dass der Urlaubsanspruch unterdessen verfallen<br />
ist, da das Altersteilzeitarbeitsverhältnis in aller Regel nach Ablauf des<br />
Übertragungszeitraums (§ 7 Abs. 3 BUrlG) endet (hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 15.3.2005, a.a.O.). Ein Abgeltungsanspruch aus Schadenersatz<br />
wegen Verzugs kann sich aber ergeben, wenn der Arbeitnehmer den<br />
Arbeitgeber zuvor in Verzug gesetzt hat. In Verzug kommt der Arbeitgeber,<br />
wenn der Arbeitnehmer ihn auffordert, den Urlaub zu einer bestimmten Zeit zu<br />
gewähren. Hinweis- <strong>und</strong> Aufklärungspflichten bestehen insoweit gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nicht (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 10.5.2005, a.a.O.).<br />
Wird der Arbeitnehmer während der Freistellungsphase arbeitsunfähig krank,<br />
entsteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, da die Arbeitsunfähigkeit nicht<br />
die alleinige Bedingung für die Abwesenheit des Arbeitnehmers ist; er erhält<br />
aber sein Altersteilzeitvergütung weiter. Er hat deswegen auch keinen<br />
Anspruch auf Krankengeld mit der Folge, dass die Beiträge nach dem geminderten<br />
Betragssatz gemäß § 243 Abs. 1 R. 1 SGB V zu entrichten sind<br />
(B<strong>und</strong>essozialgericht, Urt. vom 25.8.2004 – B 12 KR 22/02 R –, ZTR 2005,<br />
114 = EzBAT TV Altersteilzeit Nr. 34).<br />
5.4.4.6 Betriebliche Altersversorgung<br />
Von der Versorgungsordnung des Unternehmens (Betriebsvereinbarung oder<br />
Gesamtzusage) <strong>und</strong> der Altersteilzeitvereinbarung hängt es ab, in welchem<br />
Umfang Altersteilzeitarbeit bei der Bemessung der betrieblichen Altersversorgung<br />
zugunsten des Arbeitnehmers anspruchserhöhend wirkt. Dabei können<br />
Regelungen für Teilzeitbeschäftigte für die gesamte Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
herangezogen werden. Stellt die Versorgungsordnung<br />
allein auf die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit ab, zählt die Freistellungsphase<br />
voll mit, da der Arbeitnehmer dem Unternehmen während dieser<br />
Zeit weiterhin angehört. Die Frage muss in den Gesprächen mit dem Arbeitnehmer<br />
erörtert werden. Zumeist wird er den Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung<br />
davon abhängig machen, dass er keine Verluste bei der betrieblichen<br />
Altersversorgung erleidet, da er durch die Altersteilzeitarbeit im Regelfall<br />
ohnehin schon Minderungen der gesetzlichen Rente hinnehmen muss. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong>e sehen manche Betriebsvereinbarungen vor, dass die Reduzierung<br />
der Arbeitszeit aufgr<strong>und</strong> der Altersteilzeitvereinbarung bezüglich der<br />
Höhe der betrieblichen Altersversorgung unberücksichtigt bleibt. Bei der Altersteilzeitarbeit<br />
im öffentlichen Dienst ist festgelegt, dass Altersteilzeitarbeit nach<br />
dem AtG für die Zusatzversorgung mit einem Beschäftigungsquotienten von<br />
0,9 zu berücksichtigen ist (§ 43 a Abs. 3 S. 4 der Satzung der VBL).<br />
Unter bestimmten Voraussetzungen können Anwartschaften auf eine betriebliche<br />
Altersversorgung durch Kapitalzahlung abgef<strong>und</strong>en werden. § 3 Abs. 1<br />
100
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 101<br />
BetrAVG bestimmt nunmehr, dass entscheidend für die Zulässigkeit einer<br />
Abfindungsregelung – anders als bei Berechnung der Höhe der Abfindung<br />
gemäß § 3 Abs. 2 BetrAVG – der bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze<br />
zu leistende maßgebliche Monatsbetrag der laufenden Versorgungsleistung<br />
bzw. die dann zu zahlende Kapitalleistung ist. Der Monatsbetrag bzw. die<br />
Kapitalleistung ist an der monatlichen Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV zu messen.<br />
Die Regelung über die Abfindung von unverfallbaren Anwartschaften ist für<br />
Abfindungen ab dem 1.1.2005 geändert worden. Für Abfindungen bis zum<br />
31.12.2004 wurde zwischen dem einseitigen Abfindungsverlangen <strong>und</strong> der<br />
Abfindungsvereinbarung, die einvernehmlich zwischen Arbeitgeber <strong>und</strong><br />
Arbeitnehmern zu schließen war, differenziert (hierzu die Voraufl. unter S. 82).<br />
Diese Unterscheidung ist aufgegeben worden. Nach § 3 Abs. 2 BetrAVG hat<br />
ausschließlich der ehemalige Arbeitgeber das Recht, die unverfallbare Anwartschaft<br />
abzufinden, wenn der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden<br />
laufenden Leistung bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze 1<br />
von H<strong>und</strong>ert, bei Kapitalleistungen 12/10 der monatlichen Bezugsgröße nicht<br />
übersteigen würde (in 2008: 1 v.H.: West: 24,85 EUR, Ost: 21,00 EUR; 12/10fache:<br />
West: 2.982,00, Ost: 2.520,00 EUR). Der Arbeitgeber soll dadurch die<br />
Möglichkeit erhalten, den erheblichen Verwaltungsaufwand für kleinste<br />
Anwartschaften zu vermeiden. Die Anrechnung kann jederzeit erklärt werden,<br />
also bei Ausscheiden, aber auch nach dem Ausscheiden. Die Anrechnung<br />
erfolgt durch einseitige zugangsbedürftige Erklärung des Arbeitgebers gegenüber<br />
dem Arbeitnehmer. Aus Beweisgründen sollte die Anrechnung schriftlich<br />
erfolgen <strong>und</strong> der Zugang beim Arbeitnehmer beweiskräftig dokumentiert werden.<br />
Werden die dargestellten Grenzen überschritten, ist eine Abfindung ausgeschlossen<br />
<strong>und</strong> auch nicht mehr – wie früher – einvernehmlich möglich.<br />
Nach § 3 Abs. 2 S. 3 BetrAVG ist die Anrechung ausgeschlossen, wenn der<br />
Arbeitnehmer von seinem Recht auf Übertragung der Anwartschaft auf einen<br />
neuen Arbeitgeber Gebrauch gemacht hat (sog. Portabilität). Das bedeutet,<br />
dass der Arbeitgeber so lange sein Abfindungsrecht nicht ausüben kann, wie<br />
der Arbeitnehmer nach § 4 Abs. 3 BetrAVG die Möglichkeit hat, seinen Mitnahmeanspruch<br />
geltend zu machen (innerhalb eines Jahres nach Beendigung<br />
des Arbeitsverhältnisses). Auf diesen Mitnahmeanspruch kann der Arbeitnehmer<br />
nicht verzichten (§ 17 Abs. 3 S. 3 BetrAVG).<br />
Der Arbeitnehmer hat nur in einem einzigen Fall ein Abfindungsrecht. Versorgungsanwärter,<br />
die Beiträge zur gesetzlichen Versicherung erstattet erhalten<br />
hatten, konnten bislang nur einvernehmlich mit ihrem Arbeitgeber eine Abfindung<br />
vereinbaren. Sie haben nach der jetzt geltenden Gesetzesfassung ein<br />
einseitiges Abfindungsrecht (§ 3 Abs. 3 BetrAVG).<br />
Nicht geregelt ist, welcher Zeitpunkt für die Ermittlung der Zulässigkeit einer<br />
Abfindungsvereinbarung maßgeblich ist; die Frage ist wegen der jährlichen<br />
101
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 102<br />
Änderung der monatlichen Bezugsgröße praktisch wichtig. Die Frage ist<br />
umstritten; richtig dürfte sein, auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers<br />
abzustellen (vgl. hierzu Blomeyer, NZA 1998, 912).<br />
Wichtig ist: § 3 Abs. 1 Ziff. 5 BetrAVG schreibt vor, dass die Abfindung für die<br />
Anwartschaft gesondert auszuweisen <strong>und</strong> einmalig zu zahlen ist. Sie darf also<br />
nicht mit anderen Abfindungsleistungen in einem Betrag genannt sein oder<br />
ratenweise ausgezahlt werden.<br />
5.4.4.7 Wettbewerbsverbote<br />
Nach § 60 HGB bzw. aus der Treuepflicht trifft den Arbeitnehmer während des<br />
rechtlichen Bestandes des Arbeitsverhältnisses ein Wettbewerbsverbot. Bei<br />
einer Freistellungsvereinbarung (Blockmodell) sollte klar geregelt werden, ob<br />
das Verbot fortbestehen soll oder nicht. Besteht ein Interesse an der Aufrecht -<br />
erhaltung, sollte das Fortbestehen bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses<br />
ausdrücklich festgelegt werden. Das gilt besonders dann, wenn<br />
eine allgemeine Ausgleichsklausel vereinbart wird.<br />
Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer ohne die<br />
Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots nicht gehindert,<br />
sein Erfahrungswissen auch für eine Beschäftigung im Dienste eines Wettbewerbers<br />
zu nutzen. Ist ein Wettbewerbsverbot im Sinne der §§ 74–75 c HGB<br />
vereinbart, muss überlegt werden, ob dieses Wettbewerbsverbot einvernehmlich<br />
aufgehoben werden soll. Bleibt das Verbot aufrechterhalten, drohen<br />
dem Arbeitgeber nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Forderungen auf<br />
Karenzentschädigung, wenn der Arbeitnehmer sich dem Wettbewerb enthält.<br />
Allgemeine Ausgleichsklauseln erfassen gr<strong>und</strong>sätzlich das Wettbewerbsverbot<br />
nicht. Andererseits ist für das Unternehmen bei Know-how-Trägern <strong>und</strong><br />
Spitzenkräften ein Festhalten am Wettbewerbsverbot trotz der finanziellen Aufwendungen<br />
unter Umständen unverzichtbar. Ein einseitiger Verzicht des<br />
Arbeitgebers auf das Wettbewerbsverbot hilft nur wenig, da der Arbeitgeber<br />
noch ein Jahr lang nach der Erklärung die Karenzentschädigung zahlen muss.<br />
Der Arbeitnehmer kann wegen Artikel 12 GG vertraglich auch nicht verpflichtet<br />
werden, eine mögliche vorgezogene Altersrente in Anspruch zu nehmen<br />
<strong>und</strong> daneben weder selbstständig noch als Arbeitnehmer tätig zu werden (vgl.<br />
im Übrigen zum Wettbewerbsverbot ausführlich Ostrowicz, Arbeitsvertrag <strong>und</strong><br />
Entgeltansprüche, 2. Aufl., S. 219 ff.).<br />
5.4.5 Betriebsübergang während der Freistellungsphase<br />
Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat in seinem Urt. vom 19.10.2004 – 9 AZR 645/03<br />
– (NZA 2005, 527) offengelassen, ob Alterszeitarbeitsverhältnisse in der Freistellungsphase<br />
gemäß § 613a BGB auf den Betriebserwerber übergehen<br />
(dafür: Landesarbeitsgericht Hamm (Westfalen), Urt. vom 13.10.2006 – 4 Sa<br />
102
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 103<br />
180/06 – ; ErfK/Rolfs, § 8 AtG Rz.8; ablehnend Hanau, RdA 2003, 231). Jedenfalls<br />
haftet der Erwerber für die Ansprüche aus dem Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
<strong>und</strong> muss den Anspruch auf das laufende Arbeitsentgelt <strong>und</strong> die Aufstockungsleistungen<br />
erfüllen. Wird der Betrieb nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens<br />
übernommen, gelten die besonderen Verteilungsgr<strong>und</strong>sätze des<br />
Insolvenzrechts, die im Interesse der gleichmäßigen Befriedigung aller Gläubiger<br />
als Spezialregelung den allgemeinen Haftungsgr<strong>und</strong>sätzen in § 613a<br />
Abs. 1 S. 1 <strong>und</strong> Abs. 2 BGB vorgehen. Das bedeutet, dass der Erwerber für<br />
Wertguthaben, die vor Insolvenzeröffnung erarbeitet worden sind, auch nur in<br />
Höhe einer einfachen Insolvenzforderung haftet (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt.<br />
vom 19.10.2004, a.a.O.). Er haftet im Übrigen nur für die ab Insolvenzeröffnung<br />
entstandenen Masseforderungen (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
19.12.2006 – 9 AZR 230/06 –, BB 2007, 1281); zur insolvenzrechtlichen Einordnung<br />
von Wertguthaben s. im Übrigen ausführlich oben 5.4.4.2 .<br />
5.4.6 Betriebs- <strong>und</strong> Personalratsmitglieder – sonstige Amtsträger<br />
Die Freistellungsphase wirkt sich auf das Wahlrecht, die Wählbarkeit <strong>und</strong> das<br />
Amt von gesetzlichen Mandatsträgern aus, z.B.<br />
Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats,<br />
Mitglieder im Aufsichtsrat des Unternehmens,<br />
Schwerbehindertenvertretung,<br />
Datenschutzbeauftragter,<br />
Sicherheitsfachkraft <strong>und</strong> Betriebsarzt.<br />
Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase befinden, haben weder das<br />
aktive noch das passive Wahlrecht zum Betriebsrat. Mit Eintritt in die Freistellungsphase<br />
scheiden sie aus dem Betriebsrat aus. Das ergibt sich daraus,<br />
dass sie „dem Betrieb nicht mehr angehören, da sie nicht mehr in die Betriebs<br />
organisation eingegliedert sind“ <strong>und</strong> ihre Rückkehr in den Betrieb – anders<br />
als bei der Elternzeit oder der Ableistung von Wehr- oder Ersatzdienst – nicht<br />
vorgesehen ist (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 16.4.2003, DB 2003, 2128 =<br />
NZA 2003, 1345 zur Frage der Berücksichtigung bei dem Schwellenwert in<br />
§ 9 BetrVG). Das Amtsende ergibt sich aus dem Verlust des Arbeitnehmerstatus<br />
im Sinne des Gesetzes <strong>und</strong> damit des Wahlrechts <strong>und</strong> der Wählbarkeit<br />
(§ 24 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG). Der Arbeitnehmer in der Freistellungsphase übt<br />
keine Beschäftigung im Sinne von § 6 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 BetrVG aus. Das Betriebsratsamt<br />
endet automatisch, ohne dass ein Rücktritt erforderlich ist.<br />
Das Gleiche gilt für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, da sie nicht mehr<br />
beschäftigter Arbeitnehmer im Sinne von § 76 BetrVG sind (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Beschl. vom 25.10.2000, NZA 2001, 461; RdSchr. der Spitzenver-<br />
103
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 104<br />
bände vom 9.3.2004, 2.1.4). Die Rechtsstellung in der Freistellung führt automatisch<br />
zum Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat. Wird von einem sich in der<br />
Altersteilzeitarbeit befindlichen Arbeitnehmer in der Freistellungsphase weiterhin<br />
das Amt als Aufsichtsrat der unternehmenseigenen Pensionskasse ausgeübt,<br />
steht dies dem Vorliegen von Altersteilzeitarbeit im sozialversicherungsrechtlichen<br />
Sinne gr<strong>und</strong>sätzlich nicht entgegen. Es kann entweder eine<br />
Beschäftigung in einem eigenständigen Unternehmen neben der Beschäftigung,<br />
in der die Altersteilzeitarbeit stattfindet, oder eine selbstständige Tätigkeit<br />
ausgeübt werden (RdSchr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.4).<br />
Für Personalratsmitglieder gilt Entsprechendes. Wahlberechtigt <strong>und</strong> wählbar<br />
sind die „Beschäftigten“ der Dienststelle (z.B. §§ 4, 13, 14 BPersVG). Diese<br />
Voraussetzung ist nicht mehr gegeben, wenn der Altersteilzeitarbeitnehmer in<br />
die Freistellungsphase eintritt (B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht, Beschl. vom<br />
15.5.2002 – 6 P 8/01 –, AP Nr. 1 zu § 19 BPersVG = ZTR 2002, 551; Beschl.<br />
vom 15.5.2002 – 6 P 18/01 –, AP Nr. 1 zu § 10 LPVG NW = ZTR 2002, 553).<br />
Gleiches gilt auch für die Schwerbehindertenvertretung: Schwerbehinderte<br />
sind nur wahlberechtigt <strong>und</strong> wählbar, wenn sie „Beschäftigte im Betrieb oder<br />
in der Dienststelle“ sind (§ 94 Abs. 2 <strong>und</strong> 3 SGB IX); ihr Amt endet, wenn sie<br />
die Wählbarkeit verlieren (§ 94 Abs. 7 S. 3 SGB IX; wie hier Kuhlmann, Behindertenrecht,<br />
2002, S. 2). Da der Schwerbehinderte auch in der Freistellungsphase<br />
noch einen Arbeitsplatz im Sinne von § 73 Abs. 1 SGB IX innehat, wird<br />
er bei der Berechnung der Pflichtquote <strong>und</strong> der Ausgleichsabgabe mitgerechnet<br />
(Kuhlmann, a.a.O., S. 3).<br />
Das Amt des internen Datenschutzbeauftragten endet dagegen nicht automatisch<br />
mit dem Eintritt in die Freistellungsphase, da der Datenschutzbeauftragte<br />
nicht notwendig Arbeitnehmer des Unternehmens sein muss. Das<br />
Unternehmen kann aber die Bestellung aus wichtigem Gr<strong>und</strong> widerrufen, da<br />
das Amt während der Freistellungsphase nicht mehr wahrgenommen werden<br />
kann. Wird die Bestellung durch den Arbeitgeber nicht widerrufen, steht die<br />
Ausübung des Amtes dem Vorliegen von Altersteilzeitarbeit ab Beginn der Freistellung<br />
entgegen (RdSchr. der Spitzenverbände vom 9.3.2004, 2.1.4).<br />
Betriebsärzte <strong>und</strong> Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Arbeitnehmer sind,<br />
können zum Ende der Arbeitsphase mit Zustimmung des Betriebsrats abberufen<br />
werden (§ 9 Abs. 3 ASiG). Werden sie vom Arbeitgeber nicht abberufen,<br />
steht auch in diesem Fall die Ausübung des Amtes dem Vorliegen von Altersteilzeitarbeit<br />
ab Beginn der Freistellung entgegen (RdSchr. der Spitzenverbände<br />
vom 9.3.2004, a.a.O.).<br />
5.4.7 Berücksichtigung bei Schwellenwerten<br />
Umstritten ist, ob Altersteilzeitarbeitnehmer während der Freistellungsphase<br />
noch bei gesetzlichen Schwellenwerten mitzuzählen sind.<br />
104
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 105<br />
Beispiele:<br />
§§ 17, 23 Abs. 1 S. 3 KSchG<br />
§ 9, 38, 92 a, 95 Abs. 2, 99, 106, 111, 112 a BetrVG<br />
§ 73 SGB IX<br />
Bei der Ermittlung der Zahl der Betriebsratsmitglieder nach § 9 BetrVG zählen<br />
die Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase befinden, nicht mit,<br />
da sie dem Betrieb nicht mehr angehören (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
16.4.2003, DB 2003, 2128 = NZA 2003, 1345). Das Gleiche gilt nicht nur für<br />
die anderen betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerte, die auf den<br />
Betrieb abstellen (§§ 38, 92a Abs. 2, 95 Abs. 2 BetrVG), <strong>und</strong> für die Frage, ob<br />
von einer Betriebsänderung erhebliche Teile der Belegschaft betroffen sind<br />
(§§ 111 S. 1, 112 a BetrVG), sondern auch in den Fällen, in denen auf das<br />
Unternehmen abgestellt wird (z.B. § 99, 106, 111 BetrVG), da es auch in diesen<br />
Fällen auf die Zahl der „beschäftigten“ bzw. „wahlberechtigten“ Arbeitnehmer<br />
ankommt. Dagegen kommt es bei dem Schwellenwert in § 111 S. 2<br />
BetrVG (Hinzuziehung eines Beraters in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern)<br />
allein auf die Zahl der Arbeitnehmer im Unternehmen an; das spricht<br />
dafür, dass in diesem Fall die Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase<br />
befindet, mitzurechnen sind.<br />
Bei § 23 Abs. 1 S. 3 KSchG ist nach meiner Auffassung zu unterscheiden: Wird<br />
der Arbeitsplatz bei Beginn der Freizeitphase wiederbesetzt, zählt der Arbeitsplatz<br />
mit, aber nur einmal. Erfolgt dagegen keine Wiederbesetzung, zählt der<br />
Arbeitsplatz ab Beginn der Freistellungsphase nicht mehr mit, da der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
von diesem Zeitpunkt an nicht mehr im Unternehmen<br />
„beschäftigt“ wird. Für § 17 KSchG gilt das nach meiner Auffassung nach Sinn<br />
<strong>und</strong> Zweck der Anzeigepflicht entsprechend.<br />
Bei dem Begriff des Arbeitsplatzes (§ 73 Abs. 1 SGB IX) dürfte nichts anderes<br />
gelten, da auch in dieser Regelung auf die Zahl der Arbeitnehmer, die „beschäftigt<br />
werden“, abgestellt wird.<br />
6 Altersteilzeit bei Auslandstätigkeit (Entsendungen)<br />
6.1 Allgemeines<br />
Es gibt unterschiedliche Fallkonstellationen, die Rechtsfragen auf den Gebieten<br />
des Arbeits-, Sozialversicherungs- <strong>und</strong> Steuerrechts aufwerfen:<br />
Arbeitsphase <strong>und</strong> Freistellungsphase in Deutschland nach Auslandstätigkeit<br />
105
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 106<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Freistellungsphase im Ausland<br />
Arbeitsphase im Ausland, Freistellungsphase in Deutschland<br />
Arbeitsphase in Deutschland, Freistellungsphase im Ausland<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, dass Altersteilzeit nach dem AtG nur vorliegt, wenn der<br />
Betreffende innerhalb der letzten 5 Jahre vor Beginn der Altersteilzeit mindestens<br />
1080 Kalendertage (= 3 Jahre) in einer versicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung nach dem SGB III oder nach den Vorschriften des Mitgliedsstaates,<br />
in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates der Europäischen<br />
Union Anwendung findet, gestanden hat (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 AtG). Dies gilt<br />
insbesondere für die Förderung durch die BA, hat aber auch Bedeutung für<br />
sozialversicherungs- <strong>und</strong> steuerrechtliche Belange. Insoweit werden also im<br />
europäischen Ausland ausgeübte versicherungspflichtige Beschäftigungen<br />
zur Erfüllung der genannten Voraussetzung berücksichtigt.<br />
Nach Ziff. 2.1 zu § 2 AtG der Durchführungsanweisungen (DA) der B<strong>und</strong>esagentur<br />
für Arbeit (BA) sind versicherungspflichtige Beschäftigungen in einem<br />
EU-/EWR-Mitgliedsstaat bzw. der Schweiz zur Erfüllung der Vorbeschäftigungszeiten<br />
zu berücksichtigen.<br />
Außerdem muss danach der Arbeitnehmer nach Bestehen eines lokalen ausländischen<br />
Beschäftigungsverhältnisses (z.B. bei Beschäftigung in einem<br />
EU-/EWR-Mitgliedsstaat bzw. der Schweiz) <strong>und</strong> nach Anwendung der dortigen<br />
Arbeitslosenversicherungspflicht zunächst nach Deutschland zurückkehren<br />
<strong>und</strong> sein deutsches Arbeitsverhältnis muss wieder aufleben, bevor er in<br />
die Altersteilzeit gehen kann.<br />
Sofern Altersteilzeitarbeit während einer Auslandsbeschäftigung erfolgen soll,<br />
ist nach den DA der BA (Ziff. 2.1 Abs. 9) Folgendes bedeutsam:<br />
Bei einer Entsendung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne (Ausstrahlung<br />
nach § 4 SGB IV) in einen EU-/EWR-Mitgliedsstaat bzw. die Schweiz, in Staaten,<br />
mit denen bilaterale Abkommen über soziale Sicherheit bestehen, sowie<br />
in Staaten des sog. vertragslosen Auslands <strong>und</strong> bei fortbestehender Versicherungspflicht<br />
in der deutschen Arbeitslosenversicherung kann Altersteilzeit<br />
im Ausland nur vorliegen, wenn während der Entsendung das deutsche<br />
Arbeitsverhältnis fortbesteht. Sofern ein eigenständiges Arbeits- bzw.<br />
Beschäftigungsverhältnis bei einer Mutter-/Tochtergesellschaft im Ausland<br />
begründet wird <strong>und</strong> im Inland nur noch ein ruhendes Arbeitsverhältnis besteht,<br />
wird die Arbeitsleistung in dieser Zeit nicht aufgr<strong>und</strong> der Altersteilzeitbeschäftigung<br />
im Inland, sondern aufgr<strong>und</strong> eines daneben bestehenden Arbeitsverhältnisses<br />
im Ausland erbracht, das vom Geltungsbereich des AtG nicht erfasst<br />
wird. In diesem Fall liegt keine Altersteilzeitarbeit im Sinne des AtG vor.<br />
106
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 107<br />
6.2 Arbeitsrechtliche Voraussetzungen<br />
Auch mit einem von einem in Deutschland ansässigen Unternehmen ins Ausland<br />
entsandten Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in Deutschland<br />
besteht, kann unter den gesetzlichen <strong>und</strong> üblichen betrieblichen Voraussetzungen<br />
(z.B. TV) ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis abgeschlossen werden. Ob<br />
eine Entsendung dadurch beendet wird, richtet sich nach den Voraussetzungen,<br />
die das betreffende Unternehmen mit dem Arbeitnehmer abgeschlossen<br />
hat.<br />
Das gilt auch für den Fall der vorübergehenden Versetzung von einem inländischen<br />
Betrieb zu einer Niederlassung desselben Arbeitgebers ins Ausland.<br />
Bei Versetzung zu einem Tochterunternehmen des Konzerns (= Arbeitgeberwechsel)<br />
<strong>und</strong> ruhendem Beschäftigungsverhältnis im Inland kommt es zur<br />
Beendigung des inländischen Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Die ggf. aufgr<strong>und</strong><br />
einer Ausnahmevereinbarung (z.B. SV-Abkommen) fortbestehende<br />
Versicherungspflicht in der deutschen Renten- <strong>und</strong> Arbeitslosenversicherung<br />
führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhaltes. Es ist denkbar, die Versetzung<br />
zu kürzen oder den Aufenthalt im Ausland bis zum Ende der Freistellungsphase<br />
<strong>und</strong> dem Beginn des Anspruchs auf Altersrente zu verlängern.<br />
Es kommt dabei immer auf die Vereinbarungen an.<br />
6.3 Förderung durch die BA<br />
Als Wiederbesetzer i.S. des § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a AtG kann gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
auch ein in einem anderen Staat der Europäischen Union arbeitslos<br />
gemeldeter Arbeitnehmer anerkannt werden; das zu begründende Beschäftigungsverhältnis<br />
muss aber der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung<br />
nach § 25 SGB III unterliegen.<br />
6.4 Sozialversicherungsrechtliche Aspekte<br />
Altersteilzeit im Ausland während der Arbeitsphase<br />
Nach den Verlautbarungen der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger<br />
(Ziff. 2.1.1.4 des R<strong>und</strong>schreibens vom 9.3.2004) gilt Folgendes:<br />
Altersteilzeitarbeit kann – während der Arbeitsphase – auch bei einer Beschäftigung<br />
im Ausland vorliegen, wenn <strong>und</strong> solange Arbeitnehmer aufgr<strong>und</strong> einer<br />
Entsendung im Rahmen einer Ausstrahlung (§ 4 SGB IV) oder einer Ausnahmevereinbarung<br />
der Versicherungspflicht in der deutschen Renten- <strong>und</strong><br />
Arbeitslosenversicherung unterliegen. Altersteilzeitarbeit kann darüber hinaus<br />
auch bei Deutschen vorliegen, die im Ausland bei einer amtlichen Vertretung<br />
des B<strong>und</strong>es oder der Länder oder bei deren Leitern, deutschen Mitgliedern<br />
oder Bediensteten beschäftigt <strong>und</strong> in der deutschen Renten- <strong>und</strong> Arbeitslosenversicherung<br />
versichert sind.<br />
107
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 108<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, dass der Beschäftigte im Rahmen eines inländischen<br />
Beschäftigungsverhältnisses entsandt sein muss. Es muss eine Beschäftigung<br />
im sozialversicherungsrechtlichen Sinn (§ 7 SGB IV) im Inland (fort-)<br />
bestehen. Dies bedeutet, dass der im Ausland Beschäftigte organisatorisch in<br />
den Betrieb des inländischen Arbeitgebers eingegliedert bleiben bzw. sein<br />
muss. Außerdem muss er dem Weisungsrecht des inländischen Arbeitgebers<br />
in Bezug auf Zeit, Dauer, Ort <strong>und</strong> Art der Ausführung der Arbeit – unter Umständen<br />
in einer durch den Auslandseinsatz bedingten gelockerten Form – unterstehen.<br />
Schließlich muss sich der Arbeitsentgeltanspruch des Arbeitnehmers<br />
gegen den inländischen Arbeitgeber richten.<br />
Weitere Einzelheiten zur Entsendung ergeben sich aus den Richtlinien der<br />
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom 23.4.2007.<br />
Wohnsitz im Ausland während der Freistellungsphase<br />
Nach Auffassung der Spitzenverbände besteht in der Freistellungsphase eines<br />
Blockmodells eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt nach § 7 Abs. 1a SGB<br />
IV selbst dann noch fort, wenn der Versicherte seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen<br />
Aufenthaltsort in dieser Zeit bereits endgültig ins Ausland verlegt hat.<br />
Damit sind die Beiträge in Deutschland zu entrichten, so dass auch rentenrechtlich<br />
keine Probleme entstehen.<br />
6.5 Steuerrechtliche Auswirkungen<br />
Der Arbeitslohn <strong>und</strong> der Aufstockungsbetrag stellen während der Arbeits- <strong>und</strong><br />
der Freistellungsphase Vergütungen dar, auf die die DBA-Regelungen entsprechend<br />
Art. 15 OECD-MA anzuwenden sind. Während der Freistellungsphase<br />
handelt es sich dabei einheitlich um nachträglich gezahlten Arbeitslohn.<br />
Dieser ist entsprechend der Aufteilung der Vergütungen zwischen dem Wohnsitzstaat<br />
<strong>und</strong> dem Tätigkeitsstaat während der Arbeitsphase aufzuteilen.<br />
Beispiel:<br />
Ausgangssachverhalt: Arbeitnehmer A ist für seinen in Deutschland ansässigen<br />
Arbeitgeber B tätig. Zwischen A <strong>und</strong> B ist für die Jahre 01 <strong>und</strong> 02 eine<br />
Altersteilzeit nach dem Blockmodell vereinbart, d.h. im ersten Jahr liegt die<br />
Arbeitsphase, das zweite Jahr umfasst die Freistellungsphase.<br />
Fall 1:<br />
A arbeitet im Jahr 01 für 60 vereinbarte Arbeitstage auf einer langjährigen<br />
Betriebsstätte seines Arbeitgebers in Korea. Der Arbeitslohn wird während dieser<br />
Zeit von der Betriebsstätte getragen. Die übrigen 180 vereinbarten Arbeits-<br />
108
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 109<br />
tage ist A in Deutschland tätig. Seinen deutschen Wohnsitz behält A bei. Die<br />
Freistellungsphase verbringt A ausschließlich im Inland.<br />
In 01 steht Korea als Tätigkeitsstaat des Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht<br />
anteilig mit 60/240 zu, da die Voraussetzung des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe<br />
C DBA-Korea nicht erfüllt ist. Deutschland stellt die Vergütungen insoweit<br />
unter Beachtung des § 50d Abs. 8 EStG <strong>und</strong> des Progressionsvorbehalts<br />
frei (Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a DBA-Korea). Für die übrigen 180/240 der Vergütungen<br />
steht Deutschland das Besteuerungsrecht zu. Entsprechend der<br />
Aufteilung während der Arbeitsphase steht Korea das Besteuerungsrecht für<br />
die Vergütungen des A im Jahr 02 zu 60/240 <strong>und</strong> zu 180/240 Deutschland zu.<br />
Fall 2:<br />
A ist während der Arbeitsphase <strong>und</strong> während der Freistellungsphase i.S. des<br />
DBA-Dänemark in Dänemark ansässig. Er arbeitet während der Arbeitsphase<br />
ausschließlich in Deutschland.<br />
Da sich A im Jahr 01 mehr als 183 Tage in Deutschland aufgehalten hat, steht<br />
Deutschland als Tätigkeitsstaat für das Jahr 01 das Besteuerungsrecht in vollem<br />
Umfang zu (Art. 15 Abs. 1 DBA-Dänemark). Das Besteuerungsrecht in<br />
der Freistellungsphase folgt der Aufteilung zwischen dem Ansässigkeitsstaat<br />
<strong>und</strong> dem Tätigkeitsstaat des A während der Arbeitsphase. Entsprechend steht<br />
Deutschland auch im Jahr 02 das volle Besteuerungsrecht zu.<br />
Fall 3:<br />
Im Jahr 01 hat A seinen Wohnsitz in Deutschland <strong>und</strong> arbeitet auch ausschließlich<br />
im Inland. Anfang 02 zieht A nach Spanien.<br />
Im Jahr 01 unterliegt A im Inland der unbeschränkten Steuerpflicht. Ein DBA-<br />
Fall ist nicht gegeben. Im Jahr 02 steht ausschließlich Deutschland das<br />
Besteuerungsrecht zu, da die Tätigkeit im Jahr 01 in Deutschland ausgeübt<br />
worden ist (Art. 15 Abs. 1 DBA-Spanien).<br />
In diesem Zusammenhang wird auf das R<strong>und</strong>schreiben des BMF vom<br />
14.9.2006 (GZ IV B 6 – S 1300 – 367/06) verwiesen.<br />
6.6 Behandlung von Störfällen beim Blockmodell<br />
6.6.1 Allgemeines<br />
Unabhängig davon, ob der Störfall (vorzeitige Beendigung der Altersteilzeit,<br />
Todesfall etc.) während der Arbeits- oder Freistellungsphase mit Aufenthalt im<br />
Ausland oder in Deutschland eingetreten ist, hat der Betreffende oder im<br />
Todesfall der Erbberechtigte einen Rechtsanspruch auf das erwirtschaftete<br />
<strong>und</strong> nicht aufgebrauchte Wertguthaben. Der Bruttobezug ist insgesamt als einmalige<br />
Zuwendung/sonstiger Bezug im Rahmen der üblichen Entgeltabrech-<br />
109
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 110<br />
nung zu erfassen <strong>und</strong> abzuwickeln. Die steuer- <strong>und</strong> beitragsrechtliche<br />
Behandlung wird nachfolgend dargestellt.<br />
6.6.2 Beitragsberechnung<br />
Wie bei allen anderen Altersteilzeitfällen ist auch bei Auslandstätigkeiten bzw.<br />
Auslandsaufenthalten für die Möglichkeit des Eintritts eines Störfalles nicht nur<br />
nach § 8 Abs. 1 Nr. 7 BVV das Wertguthaben laufend zu führen, sondern nach<br />
§ 23b SGB IV auch der beitragspflichtige Teil je Versicherungszweig (nach dem<br />
so genannten Summenfelder- oder Options- oder Beitragspflichtmodell) zu<br />
dokumentieren.<br />
Im Störfall sind dann auf der Basis des so ermittelten Teils des Entgelts nach<br />
den Beitragssätzen zum Zeitpunkt der Fälligkeit die Beiträge zu berechnen.<br />
Die ermittelten Beiträge sind an die Krankenkasse abzuführen, bei der der<br />
Betreffende versichert ist. Das gilt auch, wenn sich der Altersteilzeiter im Ausland<br />
aufhält, beispielsweise während der Freistellungsphase. Es muss davon<br />
ausgegangen werden, dass die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Wertguthabenbildung<br />
maßgebend sind, so dass im Rahmen der „Ausstrahlung“ nach § 4<br />
SGB IV für die Beitragsansprüche die Versicherungsträger in Deutschland<br />
zuständig sind.<br />
6.6.3 Steuerberechnung<br />
Wenn das Wertguthaben ausschließlich aus der Tätigkeit während der Arbeitsphase<br />
in Deutschland stammt <strong>und</strong> beim Eintritt des Störfalls während des Aufenthaltes<br />
in der Freistellungsphase im Ausland fällig wird, steht das Besteuerungsrecht<br />
dem deutschen Staat zu. Damit gelten die üblichen Steuerregelungen<br />
für das Wertguthaben.<br />
Sofern jedoch im Falle der Entsendung ins Ausland das zu zahlende erarbeitete<br />
Wertguthaben teilweise aus einer Zeit der Beschäftigung im Inland <strong>und</strong><br />
im Ausland (Versetzungszeit) oder gar in vollem Umfang nur im Ausland als<br />
Tätigkeitsstaat stammt, gilt Folgendes:<br />
Bei einem fälligen Wertguthaben im Störfall kommt es darauf an, in welchem<br />
Land das Wertguthaben erarbeitet wurde. Der Teil, der während einer Zeit der<br />
aktiven Tätigkeit im Inland als Besteuerungsland erzielt wurde, ist in Deutschland<br />
zu besteuern, während die Steuern des für die aktive Tätigkeit im Ausland<br />
erwirtschafteten Arbeitslohnes dem zuständigen ausländischen Tätigkeitsstaat<br />
zustehen.<br />
110
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 111<br />
7 Die Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
7.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Durch den Altersteilzeitarbeitsvertrag wird das bisher unbefristete Arbeitsverhältnis<br />
in ein befristetes geändert. Diese Änderung ist zulässig, da § 8 Abs. 3<br />
AtG den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über die Befristung in § 14 Teilzeit-<br />
<strong>und</strong> Befristungsgesetz vorgeht. Danach ist eine Vereinbarung zwischen<br />
Arbeitnehmer <strong>und</strong> Arbeitgeber über die Altersteilzeitarbeit, die die Beendigung<br />
des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, in dem<br />
der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Rente wegen Alters hat, zulässig.<br />
Die Befristung hat zur Folge, dass die ordentliche fristgemäße Kündigung des<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses in der Altersteilzeitvereinbarung nur möglich<br />
ist, wenn das in der Altersteilzeitvereinbarung für beide Seiten ausdrücklich<br />
vereinbart worden ist. Anderenfalls kann das Altersteilzeitarbeitsverhältnis nur<br />
aus wichtigem Gr<strong>und</strong> fristlos gekündigt werden (§ 626 BGB). Viele Tarifverträge<br />
<strong>und</strong> Betriebsvereinbarungen sehen einen Ausschluss der fristgemäßen<br />
Kündigung vor.<br />
Eine Ausnahme gilt für die Kündigung durch den Insolvenzverwalter. § 113<br />
InsO gewährt ihm eine verkürzte Kündigungsfrist von drei Monaten. Er hat dieses<br />
besondere Kündigungsrecht auch dann, wenn im (befristeten) Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
eine Kündigungsmöglichkeit nicht vorgesehen ist (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 16.6.2005 – 6 AZR 476/04 –, DB 2005, 2303).<br />
Nachteil einer allgemeinen Kündigungsklausel ist, dass der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
bei späteren betriebsbedingten Kündigungen in die Sozialauswahl<br />
einzubeziehen ist (§ 1 Abs. 3 KSchG). Allerdings wird diese wegen seines<br />
Lebensalters <strong>und</strong> der Dauer seiner Betriebszugehörigkeit meist zu seinen<br />
Gunsten ausgehen.<br />
Nicht unmittelbar von der Zweckbefristung gemäß § 8 Abs. 3 AtG sind Regelungen<br />
erfasst, dass das Altersteilzeitverhältnis endet, wenn der Arbeitnehmer<br />
in Altersteilzeit Anspruch auf eine Rente wegen Alters oder auf eine ungekürzte<br />
Altersrente hat, soweit dies dazu führt, dass das Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
bei Schwerbehinderten oder Frauen, soweit diese einen Anspruch auf ungekürzte<br />
vorgezogene Altersrente gemäß §§ 236a, 237a SGB VI haben, vor<br />
Erreichen der Regelaltersgrenze endet. § 8 Abs. 3 AtG ist auf diesen Fall<br />
jedoch entsprechend anzuwenden Hierin liegt auch keine unzulässige<br />
Benachteiligung vor (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 18.11.2003 – 9 AZR<br />
122/03 –, FA 2004, 46; Urt. vom 27.4.2004 – 9 AZR 18/03 –, BAGE 110, 208<br />
= NZA 2005, 821).<br />
111
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 112<br />
7.2 Ende kraft Gesetzes<br />
Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis kann sozialversicherungsrechtlich nur bis<br />
zum Erreichen der Regelaltersgrenze vereinbart werden <strong>und</strong> endet spätestens<br />
mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer<br />
die Regelaltersgrenze erreicht. Hiervon zu unterscheiden ist die<br />
Frage, bis zu welchem Zeitpunkt von der BA Förderleistungen erbracht werden<br />
(s. hierzu § 5 Abs. 1 Nr. 1 – 3 AtG <strong>und</strong> die Ausführung in <strong>Kapitel</strong> VIII).<br />
7.3 Ende aufgr<strong>und</strong> der Befristungsabrede<br />
Die Dauer <strong>und</strong> der Beendigungszeitpunkt der Altersteilzeitarbeit sind im Altersteilzeitarbeitsvertrag<br />
zu vereinbaren. Dabei ist die gesetzliche Grenze zu<br />
beachten. Die Beendigung kann auch für einen früheren Zeitpunkt vereinbart<br />
werden. Dabei ist aber zu beachten, dass die Altersteilzeitarbeit gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
zumindest bis zum Zeitpunkt des frühestmöglichen Beginns einer – auch<br />
gekürzten – Altersrente dauern muss. In den meisten Vereinbarungen wird die<br />
Beendigung wie in § 5 Abs. 1 Ziff. 2 <strong>und</strong> 3 AtG geregelt: Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
endet danach entweder<br />
mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, für den der Arbeitnehmer<br />
eine ungekürzte Rente wegen Alters oder eine vergleichbare Leistung<br />
einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens<br />
beanspruchen kann, oder<br />
mit Beginn des Kalendermonats, für den er eine gekürzte Rente wegen<br />
Alters, eine Knappschaftsausgleichsleistung, eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher<br />
Art oder, wenn er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer<br />
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens<br />
bezieht.<br />
Unzulässig ist eine Vereinbarung, wonach das Zustandekommen des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
von der Förderung durch die BA abhängig gemacht<br />
wird oder das Altersteilzeitarbeitsverhältnis bei Beendigung der Förderung<br />
automatisch endet (aufschiebende oder auflösende Bedingung). Allenfalls<br />
kann die Zahlung der Aufstockungsleistungen unter bestimmten Voraussetzungen<br />
von der Förderung abhängig gemacht werden (s. dazu oben 4.4.3).<br />
7.4 Einvernehmliche Aufhebung des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
Treten bei der Durchführung des Altersteilzeitvertrages rentenrechtliche Probleme<br />
auf, z.B. durch Mehrarbeit, oder entfällt nachträglich die Förderung<br />
durch die BA, können die Vertragsparteien nach dem Gr<strong>und</strong>satz der Vertragsfreiheit<br />
den abgeschlossenen Altersteilzeitvertrag jederzeit einvernehmlich<br />
ändern, etwa durch Unterbrechung oder Verlängerung der Altersteilzeit-<br />
112
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 113<br />
arbeit, oder den Altersteilzeitvertrag wieder aufheben. Das darf aber nicht rückwirkend<br />
geschehen (s. dazu oben 2.2.2 <strong>und</strong> 4.3).<br />
Abzuraten ist von einer rückwirkenden Umwandlung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
in ein „normales“ Vollzeitarbeitsverhältnis während der Arbeitsphase.<br />
Formalrechtlich erscheint das zwar möglich, da die Arbeitsleistung wie<br />
bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis erbracht worden ist. Das Verbot des rückwirkenden<br />
Abschlusses von Altersteilzeitvereinbarungen ergibt sich aus der<br />
Natur der Altersteilzeit <strong>und</strong> greift hier wohl nicht ein. Eine rückwirkende Änderung<br />
führt jedoch zu erheblichen Problemen auf dem Gebiet des Steuer- <strong>und</strong><br />
Sozialversicherungsrechts <strong>und</strong> bei der Behandlung der Aufstockungsbeträge<br />
<strong>und</strong> der Beitragsabwicklung.<br />
Zur einvernehmlichen Änderung des Altersteilzeitarbeitsvertrages s. oben 4.5.<br />
7.5 Kündigung <strong>und</strong> Kündigungsschutz<br />
7.5.1 Besonderer Kündigungsschutz nach § 8 Abs. 1 AtG<br />
§ 8 Abs. 1 AtG schützt den Arbeitnehmer davor, dass der Arbeitgeber ihn über<br />
eine Änderungskündigung in die Altersteilzeitarbeit zwingt, wenn er etwa einen<br />
tarifvertraglichen Anspruch auf Altersteilzeitarbeit hat. Die Möglichkeit der<br />
Inanspruchnahme ist kein Kündigungsgr<strong>und</strong>. Der Arbeitgeber kann aber auch<br />
nicht deswegen kündigen, weil der Arbeitnehmer Altersteilzeitarbeit beansprucht;<br />
eine solche Kündigung wäre wegen Verstoßes gegen das Maßregelungsverbot<br />
unwirksam (§ 612a BGB).<br />
7.5.2 Wegfall der Förderung als Kündigungsgr<strong>und</strong><br />
Die Beendigung der Förderung durch die BA ist kein Kündigungsgr<strong>und</strong>; sie<br />
kann den Arbeitgeber nur unter bestimmten Voraussetzungen berechtigen, die<br />
Aufstockungszahlungen einzustellen. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis kann<br />
auch nicht deswegen gekündigt werden, weil die Aufstockungsleistungen weiter<br />
gezahlt werden müssen, obwohl die Förderleistungen eingestellt worden<br />
sind. Hat der Arbeitgeber den Wegfall der Förderung zu vertreten, scheidet<br />
die Kündigung bereits aus diesem Gr<strong>und</strong>e aus; soweit der Arbeitnehmer hierfür<br />
ursächlich ist, können die Aufstockungsleistungen jedenfalls bei einer entsprechenden<br />
vertraglichen Vereinbarung eingestellt werden.<br />
7.5.3 Kündigung aus wichtigem Gr<strong>und</strong><br />
Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis kann fristlos gekündigt werden, wenn ein<br />
wichtiger Gr<strong>und</strong> im Sinne von § 626 BGB vorliegt. Hierfür gelten die allgemeinen<br />
<strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong>. In Betracht kommen in erster Linie schwerwiegende Verstöße<br />
gegen arbeitsvertragliche Verpflichtungen, z.B. Straftaten gegen den<br />
113
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 114<br />
Arbeitgeber oder Kollegen, Spesenbetrug, beharrliche Arbeitsverweigerung,<br />
Selbstbeurlaubung etc. Der Arbeitnehmer hat etwa einen wichtigen Gr<strong>und</strong>,<br />
wenn der Arbeitgeber die Vergütung trotz Androhung der fristlosen Kündigung<br />
wiederholt mit erheblicher Verzögerung auszahlt. In besonderen Fällen kann<br />
auch eine fristlose Kündigung aus personenbedingten oder aus betriebsbedingten<br />
Gründen möglich sein; insoweit muss auf die Spezialliteratur verwiesen<br />
werden.<br />
7.5.4 Fristgemäße Kündigung<br />
Die fristgemäße Kündigung ist – wie oben dargelegt – nur möglich, wenn das<br />
im Altersteilzeitvertrag vereinbart worden ist. Eine Ausnahme gilt für den Insolvenzverwalter<br />
(s. dazu oben 7.1).<br />
7.5.4.1 Betriebsbedingte Kündigung<br />
Ob eine betriebsbedingte Kündigung der Altersteilzeitarbeitsverhältnisse ohne<br />
weiteres möglich ist, ist zweifelhaft. Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer verfolgen<br />
mit der Altersteilzeitvereinbarung den Zweck, dem Arbeitnehmer, ggf. mit Subvention<br />
durch die BA, mit einem finanziellen Ausgleich den vorzeitigen Rentenbezug<br />
wegen Altersteilzeit zu ermöglichen. Hiervon würde sich der Arbeitgeber<br />
bei einer späteren betriebsbedingten Kündigung lösen <strong>und</strong> damit die<br />
Erreichung des gemeinsamen Vertragszwecks vereiteln (§ 162 BGB). Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e schließen viele Tarifverträge <strong>und</strong> Betriebsvereinbarungen die<br />
fristgemäße Kündigung aus. Nach meiner Auffassung sind auch ohne entsprechende<br />
Vereinbarungen Einschränkungen beim Kündigungsrecht geboten.<br />
Eine betriebsbedingte Kündigung während der Freistellungsphase im Blockmodell<br />
ist von vornherein ausgeschlossen, da der Arbeitsplatz des Altersteilzeitarbeitnehmers<br />
nicht mehr wegfallen kann, sondern nur der des Wiederbesetzers;<br />
der Altersteilzeitarbeitnehmer ist dann auch nicht in die<br />
Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG) einzubeziehen. Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht<br />
hat sich dieser Auffassung in seinem Urt. vom 5.12.2002 (NZA 2003, 789 =<br />
DB 2003, 1334 = ZIP 2003, 1169) angeschlossen. Die Stilllegung des Betriebes<br />
stellt kein dringendes betriebliches Erfordernis dar, das nach § 1 Abs. 2<br />
KSchG die Kündigung eines Arbeitnehmers, mit dem Block-Altersteilzeit vereinbart<br />
ist <strong>und</strong> der sich bereits in der Freistellungsphase befindet, sozial rechtfertigen<br />
kann. Dies gilt auch für eine Kündigung durch den Insolvenzverwalter.<br />
Nicht ausgeschlossen ist die betriebsbedingte Kündigung in der Arbeitsphase<br />
des Blockmodells bei späterer Stilllegung des Betriebes (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht,<br />
Urt. vom 16.6.2005 – 6 AZR 476/04 –, DB 2005, 2303) oder Auflösung<br />
des Unternehmens, soweit im Altersteilzeitarbeitsvertrag die Möglichkeit einer<br />
114
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 115<br />
ordentlichen Kündigung vorbehalten ist oder die Kündigung durch den Insolvenzverwalter<br />
erfolgt (s. dazu oben 7.1.). Die auch im Rahmen der betriebsbedingten<br />
Kündigung anzustellende einzelfallbezogene Interessenabwägung<br />
wirkt sich, wenn überhaupt, allenfalls in seltenen Ausnahmefällen zu Gunsten<br />
des Arbeitnehmers aus. Die Voraussetzungen für einen „Härtefall“ sind so<br />
hoch anzusetzen, dass kaum mehr Raum für eine praktische Anwendung der<br />
Interessenabwägung bleibt (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 16.6.2005,<br />
a.a.O.). Die Nachteile durch eine Kündigung sind jedenfalls dann hinzunehmen,<br />
wenn der Arbeitnehmer statt Altersrente nach Altersteilzeit auch eine<br />
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit beziehen kann oder wenn das Wertguthaben<br />
des Arbeitnehmers insolvenzgesichert ist. In solchen Fällen werden oft<br />
zugleich die Voraussetzungen für den Ausnahmefall einer fristlosen betriebsbedingten<br />
Kündigung mit sozialer Auslauffrist gegeben sein. Ist das der Fall,<br />
kann auch ohne Kündigungsklausel im Altersteilzeitarbeitsvertrag gekündigt<br />
werden.<br />
7.5.4.2 Verhaltensbedingte Kündigung<br />
Ist das Recht zur fristgemäßen Kündigung im Altersteilzeitvertrag vorbehalten,<br />
kann gr<strong>und</strong>sätzlich dem Altersteilzeitarbeitnehmer auch fristgemäß<br />
gekündigt werden, wenn verhaltensbedingte Gründe die Kündigung rechtfertigen<br />
(§ 1 Abs. 2 KSchG). Das gilt uneingeschränkt bei schuldhaften Vertragspflichtverletzungen,<br />
wenn die Arbeitszeit kontinuierlich verteilt wird. Beim<br />
Blockmodell gilt das uneingeschränkt nur für die Arbeitsphase. Da in der Freistellungsphase<br />
keine Arbeitspflicht mehr besteht, kommen in dieser Zeit<br />
Pflichtwidrigkeiten im Zusammenhang mit der Arbeitspflicht (Haupt- <strong>und</strong><br />
Nebenpflichten), z.B. Schlechtleistung, Unpünktlichkeit, unentschuldigtes<br />
Fehlen, Verletzung der Anzeige- <strong>und</strong> Nachweispflichten bei Arbeitsunfähigkeit,<br />
als Kündigungsgr<strong>und</strong> nicht in Betracht. Eine Kündigung rechtfertigen kann<br />
aber die Verletzung von den Nebenpflichten, die auch während der Freistellungsphase<br />
weiter bestehen, z.B. Verstoß gegen ein Konkurrenz- oder Wettbewerbsverbot,<br />
geschäftsschädigendes Verhalten.<br />
7.5.4.3 Personenbedingte Kündigung<br />
Personenbedingte Gründe als Kündigungsgr<strong>und</strong>, etwa wiederholte oder langandauernde<br />
Arbeitsunfähigkeit, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Inhaftierung,<br />
erhebliche Leistungsminderung, können ebenfalls nur in der Arbeitsphase<br />
zum Tragen kommen. Wegen der allgemeinen Anforderungen an<br />
solche Kündigungen muss auf die Spezialliteratur verwiesen werden. Hat der<br />
Arbeitgeber im Altersteilzeitvertrag die Fortzahlung der Aufstockungsleistungen<br />
für den Fall länger andauernder Arbeitsunfähigkeit zugesagt, kann er<br />
wegen dieser Fortzahlung nicht kündigen. Er kann dann allenfalls kündigen,<br />
wenn<br />
115
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 116<br />
die erforderliche negative Prognose vorliegt <strong>und</strong><br />
erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Betriebsablaufstörungen<br />
zu erwarten sind; die Fortzahlung der Aufstockungsleistungen kann<br />
hier nicht berücksichtigt werden; <strong>und</strong><br />
die Interessenabwägung zu Lasten des Arbeitnehmers ausgeht. Steht die<br />
Freizeitphase oder die vorgezogene Altersrente kurz bevor, wird dem<br />
Arbeitgeber in aller Regel zumutbar sein, die Kündigung zurückzustellen.<br />
7.6 Vorzeitige Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
(Störfall) – Ausgleich des Wertguthabens<br />
Störfälle im Sinne des Sozialversicherungsrechts nach vorgearbeiteter<br />
Arbeitszeit haben auch <strong>arbeitsrechtliche</strong> Wirkungen.<br />
Beispiele:<br />
Vorzeitige Beendigung durch Bewilligung einer Erwerbsunfähigkeitsrente,<br />
wenn das nach Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Vereinbarung<br />
die automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge hat,<br />
vorzeitige Kündigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses,<br />
einvernehmliche Aufhebung des Altersteilzeitvertrages,<br />
Tod des Arbeitnehmers.<br />
Das Altersteilzeitgesetz enthält keine Bestimmungen zu den <strong>arbeitsrechtliche</strong>n<br />
Folgen einer vorzeitigen Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.<br />
Da in diesen Fällen das Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorzeitig endet,<br />
bevor die vom Arbeitnehmer vorgearbeitete Zeit in der Freistellungsphase ausgeglichen<br />
worden ist, ist die vom Arbeitnehmer erbrachte Vorleistung auszugleichen<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 14.10.2003, BAGE 108, 95 = NZA<br />
2004, 1320). Es muss eine Rückabwicklung nach den Regeln der ungerechtfertigten<br />
Bereicherung erfolgen (§ 812 BGB). Der Arbeitnehmer hat, soweit<br />
der Freizeitausgleich noch nicht erfolgt ist, einen Anspruch auf Zahlung der<br />
Differenz zwischen der erhaltenen Vergütung <strong>und</strong> dem Entgelt für den Zeitraum<br />
seiner tatsächlichen Beschäftigung, das er ohne Eintritt in die Altersteilzeitarbeit<br />
erzielt hätte.<br />
Vorrang für die Rückabwicklung haben entsprechende Regelungen in Tarifverträgen,<br />
soweit diese auf das Altersteilzeitverhältnis anwendbar sind. Viele<br />
Altersteilzeit-Tarifverträge legen den Ausgleich näher fest. In der Tarifpraxis<br />
gibt es Tarifverträge, nach denen nicht durch Freistellung verbrauchte Arbeits-<br />
116
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 117<br />
zeiten ohne Rücksicht auf erhaltene Aufstockungsbeträge vergleichbar nicht<br />
ausgeglichenen Plus-St<strong>und</strong>en auf einem Arbeitszeitkonto in Geld abzugelten<br />
sind (hierzu B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 13.3.2002 – 5 AZR 43/01 –, Debler,<br />
NZA 2001,12 <strong>und</strong> 80). Den Tarifvertragsparteien steht es aber frei, in einer<br />
Ausgleichsregelung die dem Arbeitnehmer zugeflossenen Aufstockungsleistungen<br />
auf das Entgelt anzurechnen, das ihm für seine Vollzeittätigkeit zugestanden<br />
hätte (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 14.10.2003, a.a.O. zum TV zur<br />
Regelung der Altersteilzeit für die Arbeitnehmer der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit<br />
vom 5.5.1998; Urt. vom 18.11.2003 – 9 AZR 270/03 –, BAGE 108, 345 = NZA<br />
2004, 1223 zum TV ATZ des öffentlichen Dienstes). Nach § 9 Abs. 3 TV ATZ<br />
hat der Arbeitnehmer im Störfall Anspruch auf die etwaige Differenz „zwischen<br />
den nach §§ 4 <strong>und</strong> 5 TV ATZ erhaltenen Bezügen <strong>und</strong> Aufstockungsleistungen“<br />
<strong>und</strong> den „Bezügen für den Zeitraum seiner tatsächlichen Beschäftigung,<br />
die er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte“. Mit dem Gleichheitssatz<br />
unvereinbar ist jedoch eine Regelung, die zu einer Kürzung des Entgelts für<br />
die Arbeitszeit führte, das der Arbeitnehmer ohne den Wechsel in das Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
erhalten hätte (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
14.10.2003, a.a.O.).<br />
Das B<strong>und</strong>esarbeitsgericht hat in seinem Urt. vom 18.11.2003 – 9 AZR 270/03<br />
–, a.a.O. entschieden, dass der Arbeitgeber nicht berechtigt ist, die zusätzlichen<br />
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung (Arbeitnehmer- <strong>und</strong><br />
Arbeitgeberanteil) bei der Differenzberechnung als erhaltene Aufstockungsleistung<br />
zu Lasten des Arbeitnehmers anzurechnen. Der Arbeitgeber trägt die<br />
Beitragslast allein, wie sich aus § 168 Abs. 1 Nr. 7 SGB VI i.V.m. § 173 SGB<br />
VI ergibt. § 5 Abs. 4 TV ATZ ist insoweit nur deklaratorisch. Nach § 5 Abs. 4<br />
TV ATZ ist der Arbeitgeber wie in § 3 Abs. 1 Nr. 1 b) AtG verpflichtet, zusätzliche<br />
Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten. Sinn <strong>und</strong> Zweck der tariflichen<br />
Regelung in § 9 Abs. 3 TV ATZ rechtfertigen es allenfalls, bei der Differenzberechnung<br />
zu Lasten des Arbeitnehmers die Arbeitnehmeranteile zu<br />
berücksichtigen. Auch das ist jedoch durch § 5 Abs. 4 TV ATZ ausgeschlossen.<br />
Gibt es keine tarifliche Ausgleichsregelung oder regelt der Tarifvertrag den<br />
Störfall nicht, sollte die Rückabwicklung im Störfall aus Gründen der Klarheit<br />
vertraglich geregelt werden. Dabei können die <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong> zu den tarifvertraglichen<br />
Regelungen übernommen werden. Fehlt eine vertragliche Vereinbarung,<br />
so ist nach allgemeinen <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong>n über die ungerechtfertigte Bereicherung<br />
(§§ 812 ff. BGB) zu verfahren. Der Arbeitnehmer in Altersteilzeit soll<br />
im Störfall nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt werden, als habe<br />
er nicht in Altersteilzeit gearbeitet. Das bedeutet nach meiner Auffassung, dass<br />
der Arbeitgeber gr<strong>und</strong>sätzlich berechtigt ist, die Erstattungsleistungen einschließlich<br />
des von ihm übernommenen Arbeitnehmeranteils anzurechnen<br />
(streitig: anderer Auffassung LAG Niedersachsen, Urt. vom 25.6.2003 – 2 Sa<br />
1556/02 –, NZA-RR 2004, 254). Nicht anzurechnen sind hingegen die zusätz-<br />
117
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 118<br />
lichen Rentenversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. Soweit der Arbeitgeber<br />
wegen der vorzeitigen Beendigung keine Förderleistungen mehr für bereits<br />
gewährte Aufstockungsleistungen zum Entgelt erhält, kann er hiermit gegen<br />
die Ansprüche des Arbeitnehmers aufrechnen.<br />
7.7 Arbeitslosigkeit nach Beendigung des<br />
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
Im Regelfall wird der Arbeitnehmer nach Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses<br />
in die Altersrente gehen. Der Bezug von Arbeitslosengeld<br />
nach Ende der Altersteilzeit ist jedoch rechtlich nicht ausgeschlossen, soweit<br />
nach dem SGB III die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Arbeitslosengeldanspruch<br />
vorliegen. Das kommt vor allem in Betracht, wenn das Altersteilzeitverhältnis<br />
vor Erreichen der Regelaltersgrenze endet. Zwar zielt die<br />
Altersteilzeit primär darauf ab, dass die betreffenden Arbeitnehmer vom<br />
Erwerbsleben gleitend in die Altersrente übergehen, zwingend ist das jedoch<br />
nicht. § 10 Abs. 1 AtG (Bemessung des Arbeitslosengeldes nach Altersteilzeitarbeit)<br />
zeigt, dass auch nach den Vorstellungen des Gesetzgebers der<br />
Bezug von Arbeitslosengeld im Anschluss an eine Altersteilzeit möglich ist. Die<br />
sozialrechtlichen <strong>und</strong> steuerrechtlichen Wirkungen von Altersteilzeitarbeit werden<br />
dadurch gr<strong>und</strong>sätzlich nicht in Frage gestellt. Allerdings kann die Inanspruchnahme<br />
des Arbeitslosengeldes dazu führen, dass der Arbeitgeber das<br />
Arbeitslosengeld gem. § 147a SGB III zu erstatten hat. In diesem Fall kann<br />
dem Arbeitgeber ein Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB gegen den<br />
Arbeitnehmer zustehen (vgl. zu Vorstehendem Sozialgericht Mannheim, Urt.<br />
vom 24.6.2003 – S 9 AL 229/03 –, NZA-RR 2004, 109). Dem Arbeitnehmer<br />
droht die Verhängung einer Sperrzeit. Das Landessozialgericht Nordrhein-<br />
Westfalen führt hierzu in seinem Urt. vom 1.6.2005 L 12 AL 221/04 –, nicht<br />
veröff.) in Übereinstimmung mit der DA der BA 1.72 IV zu § 144 SGB III aus:<br />
Es trete bei Bezug von Arbeitslosengeld nach Altersteilzeit nicht immer eine<br />
Sperrzeit ein. Vielmehr sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob nicht ein wichtiger<br />
Gr<strong>und</strong> für den Abschluss des Altersteilzeitvertrages vorliege. Ein solcher<br />
könne zum Beispiel vorliegen, wenn der betreffende Arbeitnehmer zum<br />
Abschluss des Altersteilzeitvertrages gedrängt worden sei <strong>und</strong> er subjektiv<br />
keine Alternative gesehen habe, um seine Arbeit nicht sogar vorzeitig zu verlieren.<br />
Gehe der Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung auf eine Initiative des<br />
Arbeitnehmers zurück, sei von der Verhängung einer Sperrzeit nur abzusehen,<br />
wenn eine „besondere Härte“ vorliege. Ein solcher Fall liege etwa vor,<br />
wenn der Arbeitnehmer vor Abschluss des Altersteilzeitvertrages eine Rentenauskunft<br />
eingeholt habe <strong>und</strong> sich nach Beginn der Altersteilzeitarbeit im<br />
persönlichen Bereich Dinge ereigneten, die nachträglich den Entschluss<br />
begründeten, doch nicht den ursprünglich beabsichtigten Rentenantrag zu<br />
stellen (a.A. Sozialgericht Mannheim, Urt. vom 24.6.2003 – S 9 AL 229/03 –,<br />
NZA-RR 2004, 109: keine Sperrzeit). Der Arbeitnehmer kann wegen der Sperr-<br />
118
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 119<br />
zeit keine Schadensersatzansprüche gegen den Arbeitgeber wegen unterbliebener<br />
Belehrung erheben, da kein Anlass bei Abschluss des Altersteilzeitarbeitsvertrages<br />
besteht, auf die Folgen der Vereinbarung für mögliche<br />
Ansprüche auf Leistungen der Arbeitsagentur hinzuweisen, da ja gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
am Ende des Vereinbarungszeitraumes der Übergang in den Bezug von<br />
Rentenzahlungen vorgesehen ist (Landesarbeitsgericht Berlin, Urt. vom<br />
25.11.2004 – 18 Sa 1632/04 –, nicht veröff.).<br />
8 Arbeitsvertrag mit dem Wiederbesetzer<br />
8.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Der Arbeitgeber muss, will er die Förderleistungen der BA erhalten, den vom<br />
Altersteilzeitarbeitnehmer freigemachten Arbeitsplatz wiederbesetzen (s. ausführlich<br />
<strong>Kapitel</strong> VIII). Der Wiederbesetzer muss bei kontinuierlicher Verteilung<br />
der Arbeitszeit des Altersteilzeitarbeitnehmers mindestens vier Jahre beschäftigt<br />
werden (§ 5 Abs. 2 S. 2 AtG); beim Blockmodell wird die erforderliche<br />
Beschäftigungsdauer schon nach zwei Jahren erfüllt.<br />
8.2 Unbefristetes oder befristetes Arbeitsverhältnis<br />
Das Gesetz schreibt nicht vor, dass der Wiederbesetzer unbefristet eingestellt<br />
werden muss. Da die erforderliche Wiederbesetzung im Blockmodell bereits<br />
nach zwei Jahren erfüllt ist, kann das Arbeitsverhältnis auch ohne sachlichen<br />
Gr<strong>und</strong> für diese Dauer befristet werden. Diese Befristung ist auch nach dem<br />
neuen Gesetz über Teilzeitarbeit <strong>und</strong> befristete Arbeitsverträge zulässig, wenn<br />
zuvor mit demselben Arbeitgeber kein Arbeitsverhältnis bestanden hat (§ 14<br />
Abs. 2). Wird das Arbeitsverhältnis befristet abgeschlossen, ist auch hier zu<br />
überlegen, ob die Möglichkeit zur fristgemäßen Kündigung vertraglich vorbehalten<br />
werden soll. Unterbleibt eine solche Vereinbarung, kann nur aus wichtigem<br />
Gr<strong>und</strong> fristlos gekündigt werden (§ 626 BGB). Von Vorteil ist, dass der<br />
Arbeitnehmer dann bei späteren betriebsbedingten Kündigungen nicht in die<br />
Sozialauswahl einzubeziehen ist. Damit wird zugleich ausgeschlossen, dass<br />
die Fördervoraussetzungen gefährdet werden, wenn dem Wiederbesetzer<br />
wegen der Sozialauswahl vor anderen Arbeitnehmern gekündigt werden muss<br />
<strong>und</strong> ein weiterer Wiederbesetzer nicht rechtzeitig gef<strong>und</strong>en wurde.<br />
8.3 Dauer der Arbeitszeit<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich muss für den Arbeitsplatz des Wiederbesetzers zumindest die<br />
Arbeitszeit vereinbart werden, die beim Altersteilzeitarbeitnehmer entfällt. Bei<br />
kontinuierlicher Verteilung der Arbeitszeit des Altersteilzeitarbeitnehmers ist<br />
dies die halbe bisherige Arbeitszeit des Altersteilzeitarbeitnehmers, beim<br />
Blockmodell für die Freistellungsphase die volle bisherige Arbeitszeit. Die<br />
119
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 120<br />
Agenturen für Arbeit akzeptieren jedoch eine geringfügige Reduzierung der<br />
bisherigen Arbeitszeit; toleriert wird eine Reduzierung des bisherigen Arbeitszeitvolumens<br />
von bis zu 10 %.<br />
8.4 Sonstige Förderungsmöglichkeiten<br />
Neben der Förderung der Altersteilzeitarbeit durch Erstattung der Arbeitgeberleistungen<br />
können auch andere Förderungsleistungen bei der Agentur für<br />
Arbeit beantragt werden (Stand 1.1.2008), insbesondere<br />
für Trainingsmaßnahmen (§§ 48–52 SGB III),<br />
Eingliederungszuschüsse (§§ 217–222 SGB III),<br />
für einen Eingliederungsvertrag (§§ 229–234 SGB III)<br />
Zuschüsse für Einstiegsqualifizierung (§ 235b SGB III),<br />
Eingliederungszuschüsse für ältere Arbeitnehmer (§ 412f SGB III),<br />
Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer (§ 421j SGB III),<br />
Qualifizierungszuschüsse für jüngere Arbeitnehmer (§ 421o SGB III),<br />
Eingliederungszuschüsse für jüngere Arbeitnehmer (§ 421p SGB III),<br />
Außerdem können im Rahmen der Gr<strong>und</strong>sicherung Leistungen zur Beschäftigungsförderung<br />
für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen beansprucht<br />
werden (§ 16a SGB II).<br />
Wegen der Leistungsvoraussetzungen wird auf die genannten Vorschriften<br />
sowie auf die entsprechenden Weisungen der BA verwiesen.<br />
9 Mitwirkungs- <strong>und</strong> Mitbestimmungsrechte des<br />
Betriebsrats bei Einführung <strong>und</strong> Durchführung der<br />
Altersteilzeitarbeit<br />
9.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Neben den individualrechtlichen Vorfragen muss bei der Planung von betrieblichen<br />
Altersteilzeitregelungen die Frage geprüft werden, ob <strong>und</strong> in welchem<br />
Umfang Beteiligungsrechte des Betriebsrats zu beachten sind. Dabei ist zu<br />
unterscheiden, ob der Betriebsrat von der Arbeitgeberseite freiwillig in die Planung<br />
einbezogen wird oder ob dem Betriebsrat Beteiligungsrechte <strong>und</strong> Mitbestimmungsrechte<br />
zustehen, die eingehalten werden müssen. Mitbestimmungsrechte<br />
können sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz oder aus<br />
einem Altersteilzeit-Tarifvertrag ergeben. Ein Verstoß gegen Beteiligungsrechte<br />
kann erhebliche Nachteile bis hin zur Unwirksamkeit getroffener Maßnahmen<br />
haben. Außerdem sehen viele Altersteilzeit-Tarifverträge den<br />
120
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 121<br />
Abschluss freiwilliger Betriebsvereinbarungen sowie Unterrichtungsrechte<br />
des Betriebsrats vor. Dabei gilt die Besonderheit, dass Regelungen in Tarifverträgen,<br />
in denen dem Betriebsrat Beteiligungsrechte eingeräumt werden,<br />
sog. Betriebsnormen sind. Das bedeutet: Ist der Arbeitgeber tarifgeb<strong>und</strong>en,<br />
gelten diese Regelungen unmittelbar <strong>und</strong> zwingend für alle Arbeitnehmer des<br />
Betriebs, unabhängig davon, ob sie Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft<br />
sind oder nicht (§ 3 Abs. 2 TVG).<br />
9.2 Arten der Beteiligungsrechte des Betriebsrats<br />
Dem Betriebsrat stehen im Überblick folgende Beteiligungsrechte zu:<br />
Unterrichtungs- <strong>und</strong> Informationsrechte:<br />
Der Arbeitgeber ist bei allen Mitbestimmungsrechten <strong>und</strong> in weiteren im<br />
Betriebsverfassungsgesetz geregelten Fällen vor einer Entscheidung bzw. vor<br />
der Durchführung einer Maßnahme verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig<br />
<strong>und</strong> umfassend über die geplante Maßnahme zu unterrichten. Der allgemeine<br />
Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats ist in § 80 Abs. 2 BetrVG geregelt.<br />
Erörterungs-, Beratungs- <strong>und</strong> Anhörungsrechte:<br />
Der Betriebsrat kann Vorschlags-, Beratungs- <strong>und</strong> Anhörungsrechte haben,<br />
z.B. in allgemeinen Angelegenheiten (§ 80 Abs. 1 BetrVG). Bei diesen Rechten<br />
geht es nicht um eine Beteiligung des Betriebsrats bei der Entscheidung<br />
selbst, sondern um eine Beteiligung im Vorfeld von Maßnahmen, die Zustimmung<br />
des Betriebsrats für diese Maßnahmen ist nicht erforderlich. Anhörungs<strong>und</strong><br />
Beratungsrechte sind bei der Personalplanung (§ 92 BetrVG) zu beachten.<br />
Nach § 92 a BetrVG hat der Betriebsrat ein Vorschlags- <strong>und</strong> Beratungsrecht<br />
zur Beschäftigungssicherung, u.a. zur Förderung von Teilzeitarbeit <strong>und</strong><br />
Altersteilzeit. Besonders ausgestaltet ist das Anhörungsrecht bei Kündigungen<br />
(§ 102 BetrVG). Der Verstoß gegen dieses Anhörungsrecht führt zur<br />
Unwirksamkeit der Kündigung.<br />
Zustimmungsverweigerungsrecht:<br />
Wiederum eine Stufe höher ist das Zustimmungsverweigerungsrecht des<br />
Betriebsrats anzusiedeln. Dabei ist zwar vor Durchführung der Maßnahme die<br />
Zustimmung des Betriebsrates zu der Maßnahme erforderlich, der Betriebsrat<br />
kann die Zustimmung jedoch nur aus bestimmten, im Gesetz ausdrücklich<br />
festgelegten Gründen verweigern. Wichtigster Fall ist das Beteiligungsrecht<br />
des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG: Einstellung,<br />
Eingruppierung, Umgruppierung <strong>und</strong> Umsetzung). Ein Initiativrecht steht dem<br />
Betriebsrat in diesen Fällen nicht zu.<br />
121
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 122<br />
Mitbestimmungsrechte:<br />
Die stärkste Form des Beteiligungsrechts ist das Mitbestimmungsrecht im<br />
engeren Sinne (z.B. §§ 87 Abs. 1 Nr. 1–12, 112 BetrVG). Mitbestimmung<br />
bedeutet, dass eine Einigung mit dem Betriebsrat über die Maßnahme erforderlich<br />
ist; im Nichteinigungsfall entscheidet die betrieblich zu errichtende Eini -<br />
gungsstelle, die Entscheidung der Einigungsstelle ist verbindlich. Der Arbeitgeber<br />
kann in diesen Angelegenheiten ohne den Betriebsrat keine<br />
rechtswirksamen Entscheidungen treffen. Der Betriebsrat hat in diesen Fragen<br />
auch ein Initiativrecht.<br />
9.3 Gesetzliche Beteiligungsrechte bei Altersteilzeitregelungen/<br />
-vereinbarungen<br />
9.3.1 Ausgangspunkt<br />
Ob <strong>und</strong> in welchem Umfang erzwingbare Beteiligungsrechte des Betriebsrats<br />
bei Altersteilzeitregelungen zu beachten sind, ist unter zwei Aspekten zu prüfen.<br />
Zum einen kommen Beteiligungsrechte bei der generellen Einführung <strong>und</strong><br />
Durchführung betrieblicher Altersteilzeitregelungen in Betracht. Zum anderen<br />
können Beteiligungsrechte bei individuellen Altersteilzeitvereinbarungen<br />
bestehen.<br />
9.3.2 Beteiligungsrechte bei der Einführung betrieblicher<br />
Altersteilzeitregelungen<br />
9.3.2.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Aus dem Betriebsverfassungsgesetz selbst ergibt sich kein erzwingbarer<br />
Anspruch des Betriebsrats auf Einführung einer betrieblichen Altersteilzeitregelung.<br />
Auch bei den vom Arbeitgeber im Rahmen der Altersteilzeitarbeit zu<br />
erbringenden Leistungen besteht kein Mitbestimmungsrecht. § 3 Abs. 1 AtG<br />
sieht folgende Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für eine Altersteilzeitvereinbarung vor:<br />
Tarifvertrag,<br />
Betriebsvereinbarung,<br />
oder arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit dem Arbeitnehmer.<br />
Soweit ein Tarifvertrag die vom Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1a <strong>und</strong> b AtG<br />
zu erbringenden Leistungen abschließend regelt, scheidet bereits deswegen<br />
ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus (§ 77 Abs. 3 BetrVG), es sei<br />
denn, der Tarifvertrag enthält eine Öffnungsklausel für die Betriebsparteien.<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage für die vom Arbeitgeber zu erbringenden Leistungen kann<br />
auch eine Betriebsvereinbarung sein. Es kann sich insoweit nur um freiwillige<br />
Betriebsvereinbarungen handeln, da im BetrVG eine Rechtsgr<strong>und</strong>lage für das<br />
122
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 123<br />
Mitbestimmungsrecht nicht erkennbar ist. Die Frage ist in der Rechtsprechung<br />
allerdings bislang ungeklärt.<br />
9.3.2.2 Mitbestimmung bei Sozialeinrichtungen<br />
(§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG)<br />
Die Durchführung betrieblicher Altersteilzeitregelungen ist nicht mitbestimmungspflichtig.<br />
Altersteilzeitregelungen sind wie die ehemaligen Frühpensionierungsregelungen<br />
keine Sozialeinrichtungen im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 8<br />
BetrVG, da es an einem zweckgeb<strong>und</strong>enen Sondervermögen fehlt. Ein Mitbestimmungsrecht<br />
scheidet insoweit aus.<br />
9.3.2.3 Mitbestimmung bei der betrieblichen Lohngestaltung<br />
(§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG)<br />
Aufstockungsleistungen des Arbeitgebers bei Altersteilzeitarbeit gehören<br />
ebenso wenig wie Abfindungen im Rahmen von Altersvereinbarungen zur<br />
betrieblichen Lohngestaltung im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG. Abfindungen<br />
werden für den Verlust des Arbeitsplatzes <strong>und</strong> nicht als Entlohnung<br />
für geleistete Arbeit gezahlt, die Aufstockungsleistungen als Ausgleich für die<br />
Bereitschaft, die Arbeitszeit zu reduzieren. Der Betriebsrat kann insbesondere<br />
eine Erhöhung der Aufstockungsleistungen nicht erzwingen, da sich das<br />
Mitbestimmungsrecht allein auf die sog. Verteilungsgr<strong>und</strong>sätze im Rahmen<br />
der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel bezieht.<br />
9.3.2.4 Personalplanung (§ 92 BetrVG)<br />
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat gemäß § 92 BetrVG über die Personalplanung,<br />
insbesondere über den gegenwärtigen <strong>und</strong> künftigen Personalbedarf<br />
sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen, anhand<br />
von Unterlagen rechtzeitig <strong>und</strong> umfassend zu unterrichten; er hat mit dem<br />
Betriebsrat über Art <strong>und</strong> Umfang der erforderlichen Maßnahmen <strong>und</strong> über die<br />
Vermeidung von Härten zu beraten. Zur Personalplanung gehören u.a. die Planung<br />
des Personalbedarfs, der Personalbeschaffung <strong>und</strong> des Personalabbaus,<br />
so auch, ob <strong>und</strong> durch welche Maßnahmen ein Personalabbau sozialverträglich<br />
durchgeführt werden kann <strong>und</strong> ob Pläne bestehen, mit den Arbeitnehmern<br />
des Betriebes Altersteilzeitvereinbarungen zu vereinbaren, sowie ob<br />
beabsichtigt ist, die frei werdenden Arbeitsplätze wiederzubesetzen oder<br />
abzubauen.<br />
123
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 124<br />
9.3.2.5 Vorschlags- <strong>und</strong> Beratungsrecht zur Beschäftigungssicherung<br />
(§ 92 a BetrVG)<br />
Nach der neuen Regelung in § 92 a BetrVG kann der Betriebsrat Vorschläge<br />
zur Sicherung <strong>und</strong> Förderung der Beschäftigung machen. Diese können u.a.<br />
die Förderung von Teilzeitarbeit <strong>und</strong> Altersteilzeit zum Gegenstand haben.<br />
Regelungen erzwingen kann der Betriebsrat nicht. Der Arbeitgeber ist aber<br />
verpflichtet, die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält er die Vorschläge<br />
des Betriebsrats für ungeeignet, hat er die Ablehnung zu begründen;<br />
in Betrieben mit mehr als 300 Arbeitnehmern hat das schriftlich zu geschehen.<br />
9.3.2.6 Auswahlrichtlinien (§ 95 BetrVG)<br />
Die Regelung über die Auswahlrichtlinien ist bereits ihrem Wortlaut nach nicht<br />
auf Altersteilzeitregelungen anzuwenden, da es bei der Regelung nicht um<br />
„Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen, Kündigungen“ geht.<br />
9.3.3 Gesetzliche Mitbestimmungsrechte bei der Durchführung<br />
betrieblicher Altersteilzeitregelungen<br />
9.3.3.1 Auswahl der Arbeitnehmer<br />
Dem Betriebsrat steht auch dann, wenn der Tarifvertrag keine konkreten Kriterien<br />
für die Auswahl festlegt, bei der Auswahl der Bewerber kein Mitbestimmungsrecht<br />
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8 <strong>und</strong> 10 oder einer anderen Bestimmung<br />
des § 87 Abs. 1 BetrVG zu (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, a.a.O., S. 238). Der Tarifvertrag<br />
kann aber in einer Öffnungsklausel ein Mitbestimmungsrecht des<br />
Betriebsrats anordnen. Sieht der Tarifvertrag lediglich den Abschluss freiwilliger<br />
Betriebsvereinbarungen vor, kann der Abschluss von keiner Seite erzwungen<br />
werden.<br />
9.3.3.2 Betriebsänderung – Interessenausgleich <strong>und</strong> Sozialplan<br />
(§§ 111, 112 BetrVG)<br />
Bislang ungeklärt ist, ob betriebliche Altersteilzeitregelungen, ggf. in Verbindung<br />
mit anderen Vorruhestandsregelungen, z.B. durch Aufhebungsvereinbarungen,<br />
eine Betriebsänderung darstellen können, wenn die freigemachten<br />
Arbeitsplätze der Altersteilzeitarbeitnehmer nicht wiederbesetzt werden.<br />
Gemäß § 111 BetrVG hat der Unternehmer in Unternehmen mit in der Regel<br />
mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern den Betriebsrat über geplante<br />
Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder<br />
erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig <strong>und</strong><br />
umfassend zu unterrichten <strong>und</strong> die geplanten Betriebsänderungen mit dem<br />
Betriebsrat zu beraten. Als Betriebsänderung im Sinne dieser Regelung gilt<br />
124
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 125<br />
unter anderem die Einschränkung <strong>und</strong> Stilllegung des ganzen Betriebes oder<br />
von wesentlichen Betriebsteilen. Neben der Einschränkung oder Stilllegung<br />
der Produktionsmittel gehört in diese Fallgruppe auch der reine Personalabbau.<br />
Das bedeutet: Auch der reine Personalabbau kann selbst dann, wenn er<br />
nicht mit unternehmens- oder betriebsorganisatorischen Maßnahmen anderer<br />
Art verb<strong>und</strong>en ist, unter bestimmten Voraussetzungen eine Betriebsänderung<br />
im Sinne § 111 BetrVG sein. Das löst neben einem Unterrichtungs- <strong>und</strong><br />
Beratungsanspruch des Betriebsrats die Verpflichtung aus, das Verfahren<br />
über einen Interessenausgleich zu betreiben, unter bestimmten Voraussetzungen<br />
auch einen Sozialplan abzuschließen (§ 112 BetrVG).<br />
§ 111 S. 1 BetrVG legt lediglich fest, dass von dem Personalabbau „erhebliche<br />
Teile der Belegschaft“ betroffen sein müssen. Nach ständiger Rechtsprechung<br />
des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts sind dabei in Anlehnung an § 17 KSchG folgende<br />
Zahlen der von der Entlassung betroffenen Mitarbeiter maßgeblich:<br />
Zahl der AN im Betrieb Mindestzahl der entlassenen AN<br />
> –20 <strong>und</strong> < 60 > 5 AN<br />
60 <strong>und</strong> < 500 10 % oder > als 25 AN<br />
500–600 mind. 30 AN<br />
über 600 mind. 5 % der AN<br />
Beim reinen Personalabbau gelten gemäß § 112 a BetrVG besondere höhere<br />
Schwellenwerte. Das bedeutet, dass nur dann Sozialplanpflicht besteht,<br />
wenn bei der Entlassung von Arbeitnehmern folgende Schwellenwerte überschritten<br />
werden:<br />
Zahl der AN im Betrieb Mindestzahl der Entlassungen<br />
bis 59 AN 20 %, mindestens aber 6 AN<br />
60 bis 249 AN 20 %, mindestens aber 37 AN<br />
250 bis 499 AN 15 %, mindestens aber 60 AN<br />
500 <strong>und</strong> mehr AN 10 %, mindestens aber 60 AN<br />
Der Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen in größerem Umfang kann<br />
dann, wenn der freigemachte Arbeitsplatz nicht wiederbesetzt wird, d.h. wenn<br />
Förderleistungen der BA nicht in Anspruch genommen werden, auch dem Personalabbau<br />
dienen. Zweifelhaft ist dennoch, ob das Ausscheiden von Altersteilzeitarbeitnehmern<br />
eine Betriebsänderung ist oder ob ggf. diese Arbeitnehmer<br />
bei der Ermittlung der Schwellenwerte mitzuzählen sind. Das ist der Fall,<br />
125
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 126<br />
wenn sie aufgr<strong>und</strong> einer „Entlassung“ aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden.<br />
Bei der Regelung der Massenentlassungsanzeige heißt es in § 17 Abs. 1 S. 2<br />
KSchG: Den Entlassungen stehen andere Beendigungen des Arbeitsverhältnisses<br />
gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden, d.h. auch Aufhebungsverträge<br />
<strong>und</strong> vom Arbeitgeber veranlasste Eigenkündigungen der<br />
Arbeitnehmer. Nach § 112a Abs. 1 S. 2 BetrVG gilt als Entlassung auch das<br />
vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebsänderung veranlasste Ausscheiden<br />
von Arbeitnehmern aufgr<strong>und</strong> von Aufhebungsverträgen. Zählt man den<br />
Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen hierzu, kann eine Sozialplanregelung<br />
allenfalls die wirtschaftlichen Folgen regeln, die sich aus der Beendigung<br />
des Arbeitsverhältnisses selbst ergeben, nicht jedoch aus der Altersteilzeitvereinbarung<br />
als solcher. Das bedeutet, dass dem Mitarbeiter allenfalls<br />
dann ein Abfindungsanspruch zuerkannt werden kann, wenn <strong>und</strong> soweit seine<br />
Altersrente aufgr<strong>und</strong> des vorgezogenen Ruhestands vermindert wird; insoweit<br />
kommen Sozialplanregelungen in Betracht.<br />
Es bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung die Frage beurteilen wird. Werden<br />
mit dem Betriebsrat freiwillige Betriebsvereinbarungen abgeschlossen,<br />
sollte für den Fall, dass die freigemachten Stellen nicht wiederbesetzt werden<br />
sollen, in der Betriebsvereinbarung eine Regelung vereinbart werden, dass<br />
mit den Leistungen aus der Betriebsvereinbarung zugleich etwaige Forderungen<br />
wegen einer Betriebsänderung erfüllt sind.<br />
9.3.4 Beteiligung bei der individuellen Vereinbarung<br />
Durch die Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit mit dem Arbeitnehmer wird<br />
zunächst die Dauer der individuellen Arbeitszeit des Arbeitnehmers geändert,<br />
nämlich auf die Hälfte reduziert, <strong>und</strong> zugleich das bisher unbefristete Arbeitsverhältnis<br />
in ein befristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt. Beim Blockmodell<br />
wird der Arbeitnehmer in der zweiten Hälfte der Altersteilzeitarbeit von der weiteren<br />
Arbeitsleistung freigestellt. Der Arbeitnehmer scheidet, sofern das Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
nicht ausnahmsweise vor seiner Beendigung gekündigt<br />
wird, ohne Kündigung mit Ablauf der Befristung aus dem Arbeitsverhältnis aus.<br />
9.3.4.1 Überwachung der Einhaltung der Insolvenzsicherungspflicht –<br />
Unterrichtung<br />
Bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die ab dem 1.7.2004 beginnen, besteht<br />
eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Insolvenzsicherung (§ 8a<br />
AtG, s. hierzu oben 4.5.2). Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat<br />
u.a. darüber zu wachen, dass diese Verpflichtung eingehalten wird. In diesem<br />
Rahmen hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über die getroffen Maßnahmen<br />
der Insolvenzsicherung gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG zu unterrichten. Das Überwachungsrecht<br />
berechtigt den Betriebsrat aber weder zu Sanktionen noch zu<br />
126
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 127<br />
individualrechtlichen Schritten, z.B. einer gerichtlichen Geltendmachung der<br />
Ansprüche.<br />
9.3.4.2 Änderung der individuellen Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG)<br />
Ein Mitbestimmungsrecht bei der Änderung der Dauer der individuellen<br />
Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG besteht nicht; maßgeblich ist hier<br />
allein die individualrechtliche Vereinbarung. Mitzubestimmen hat der Betriebsrat<br />
nach dieser Vorschrift aber bei „Beginn <strong>und</strong> Ende der täglichen Arbeitszeit<br />
einschließlich der Pausen sowie bei der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen<br />
Wochentage“. Das bedeutet: Wie die geänderte (verkürzte) Arbeitszeit<br />
verteilt wird, kann damit mitbestimmungspflichtig sein. Dabei sind folgende<br />
Fälle zu unterscheiden:<br />
Bei kontinuierlicher Verteilung der Arbeitszeit kann sich die Lage der Arbeitszeit<br />
verändern. Das ist etwa der Fall, wenn die tägliche Arbeitszeit halbiert oder<br />
die Arbeit in der Woche von fünf auf zweieinhalb Tage verteilt wird; in letzterem<br />
Fall ändert sich die Lage jedenfalls hinsichtlich des halben Tages. Der<br />
Betriebsrat hat in diesen Fällen ein Mitbestimmungsrecht bei der Lage der<br />
Arbeitszeit wie bei den anderen Teilzeitbeschäftigten. Besteht eine Rahmenvereinbarung<br />
über die Lage der Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten, fallen<br />
auch die Altersteilzeitarbeitnehmer hierunter. Mitbestimmungsrechte im Einzelfall<br />
bestehen außerdem nicht, wenn im Betrieb eine flexible Arbeitszeit<br />
besteht, die den Arbeitnehmern im Rahmen einer vorgegebenen Betriebsöffnungszeit<br />
die Festlegung der individuellen Arbeitszeit, ggf. nach Absprache in<br />
der Organisationseinheit, überlässt. Nicht mitbestimmungspflichtig ist schließlich<br />
die Halbierung der Arbeitszeit in der Weise, dass der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
wochenweise im Wechsel arbeitet <strong>und</strong> nicht arbeitet, ohne dass sich<br />
die Lage der Arbeitszeit an den Arbeitstagen ändert.<br />
Bei diskontinuierlicher Verteilung der Arbeitszeit (Blockmodell) hat der<br />
Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, es sei<br />
denn, die Vertragsparteien ändern zugleich im Einzelfall die Lage der Arbeitszeit.<br />
Besteht danach ein Mitbestimmungsrecht, kann dieses dennoch durch den<br />
Tarifvertrag ausgeschlossen sein. Sieht etwa der Tarifvertrag vor, dass Arbeitgeber<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer die Verteilung der Arbeitszeit einzelvertraglich regeln<br />
können, dürfte das zugleich eine abschließende Regelung dahingehend darstellen,<br />
dass das Mitbestimmungsrecht auch hinsichtlich der Verteilung der<br />
Arbeitszeit ausscheidet.<br />
Meist wird die Frage der Lage der Arbeitszeit, falls erforderlich, einvernehmlich<br />
mit dem Betriebsrat geregelt werden können. Bei Abschluss einer<br />
Betriebsvereinbarung über Altersteilzeitarbeit sollte aus diesen Gründen auf<br />
jeden Fall die Klausel aufgenommen werden, dass der Betriebsrat der Ver-<br />
127
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 128<br />
änderung der individuellen Lage der Arbeitszeit der Altersteilzeitarbeitnehmer<br />
vorab zustimmt, soweit Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer hierüber Einvernehmen<br />
erzielen. In Zweifelsfällen sollte der Betriebsrat bei der Verteilung der Arbeitszeit<br />
beteiligt werden. Bei Einvernehmen zwischen Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
werden Streitigkeiten wegen eines Mitbestimmungsrechtes die Ausnahme<br />
sein.<br />
9.3.4.3 Verkürzung der betriebsüblichen Arbeitszeit<br />
(§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG)<br />
Die vertragliche Halbierung der individuellen Arbeitszeit ist keine „vorübergehende<br />
Verkürzung der betriebsüblichen Arbeitszeit“, da sie auf Dauer bis zum<br />
Ausscheiden des Arbeitnehmers vereinbart wird. Ein Mitbestimmungsrecht<br />
scheidet demnach aus.<br />
9.3.4.4 Einstellung <strong>und</strong> Versetzung (§ 99 BetrVG)<br />
Der Übergang von der bisherigen Arbeitszeit zur Altersteilzeitarbeit ist keine<br />
Einstellung im Sinne von § 99 Abs. 1 BetrVG (BVerwG, Urt. vom 12.6.2001,<br />
NZA 2001, 1091). Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist gr<strong>und</strong>sätzlich keine Einstellung<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom 25.1.2005 – 1 ABR 59/03 –, NZA<br />
2005, 945). Die Veränderung der Dauer oder Lage der Arbeitszeit ist auch<br />
keine zustimmungspflichtige Versetzung, da der Arbeitsbereich (§ 95 Abs. 3<br />
BetrVG) nicht geändert wird (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Beschl. vom 19.2.91, EzA<br />
§ 95 BetrVG 1972 Nr. 23; Beschl. vom 23.11.93, EzA § 95 BetrVG 1972<br />
Nr. 28). Auch die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht beim<br />
Blockmodell in der zweiten Hälfte der Altersteilzeitarbeit ist keine Versetzung<br />
(B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Beschl. vom 28.3.2000, NZA 2000, 1355).<br />
9.3.4.5 Kündigung (§ 102 BetrVG)<br />
Ein Anhörungsrecht des Betriebsrats nach § 102 BetrVG scheidet aus, da der<br />
Altersteilzeitarbeitnehmer nicht durch Kündigung ausscheidet, es sei denn,<br />
ihm wird ausnahmsweise während der Altersteilzeitarbeit gekündigt (s. dazu<br />
unten).<br />
9.4 Beteiligungsrechte des Betriebsrats aus Altersteilzeit-<br />
Tarifverträgen<br />
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats können sich aus dem einschlägigen<br />
Altersteilzeit-Tarifvertrag ergeben. Zuweilen sehen Tarifverträge über Altersteilzeitregelungen<br />
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats vor, insbesondere<br />
bei der Frage der Überforderungsgrenze, d. h. bei der Festlegung, wie viel Prozent<br />
der Belegschaft berechtigt sind, von der Regelung Gebrauch zu machen,<br />
128
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 129<br />
<strong>und</strong> wie die Auswahl unter den Arbeitnehmern zu treffen ist. Nicht um Mitbestimmungsrechte<br />
handelt es sich, wenn der Tarifvertrag den Abschluss freiwilliger<br />
Betriebsvereinbarungen vorsieht.<br />
9.5 Betriebsvereinbarungen über Altersteilzeitarbeit<br />
9.5.1 <strong>Gr<strong>und</strong>sätze</strong><br />
Neben dem AtG <strong>und</strong> einem einschlägigen <strong>und</strong> anzuwendenden Altersteilzeit-<br />
Tarifvertrag kann Rechtsgr<strong>und</strong>lage für die Einführung <strong>und</strong> Ausgestaltung der<br />
Altersteilzeitarbeit eine Betriebsvereinbarung sein. Nur wenn <strong>und</strong> soweit der<br />
Altersteilzeit-Tarifvertrag in einer Öffnungsklausel den Abschluss einer verbindlichen<br />
Betriebsvereinbarung vorsieht, kann der Betriebsrat im Wege der<br />
Mitbestimmung den Abschluss erzwingen, ggf. auch durch Anrufung der Eini -<br />
gungsstelle. Ansonsten sind Betriebsvereinbarungen über Altersteilzeit freiwillig;<br />
das gilt auch, wenn der Altersteilzeit-Tarifvertrag nur den Abschluss einer<br />
freiwilligen Betriebsvereinbarung erlaubt.<br />
Die Altersteilzeit-Tarifverträge lassen den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen,<br />
wenn überhaupt, meist bei der Durchführung <strong>und</strong> hier<br />
zumeist beim Überforderungsschutz zu (Bleistiftindustrie; Energieversorgung<br />
Bayern; Ernährungsindustrie Niedersachsen; Bremen mit DAG; Leder- <strong>und</strong><br />
Lederwarenindustrie; Metallindustrie – ohne TV Beschäftigungsbrüche;<br />
Schuh industrie; Zuckerindustrie). Im Einzelfall kann auch die Anspruchsberechtigung<br />
oder die Dauer der Altersteilzeitarbeit als solche Gegenstand einer<br />
Betriebsvereinbarung sein (Bauwirtschaft: freiwillige Betriebsvereinbarung;<br />
Lederwarenindustrie; Metallindustrie Norddeutschland; Mineralbrunnen Hessen;<br />
Öffentlicher Dienst: ab 55. Lebensjahr; Papierindustrie; Zuckerindustrie).<br />
Soweit danach tarifvertraglich kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats<br />
vorgesehen ist, kann von keiner der beiden Seiten der Abschluss einer – freiwilligen<br />
– Betriebsvereinbarung erzwungen werden.<br />
In der Praxis ist der Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung zu empfehlen,<br />
wenn Altersteilzeitarbeit nicht nur in Einzelfällen, sondern als Personalkonzept<br />
in größerem Umfang eingeführt werden soll.<br />
9.5.2 Inhaltliche Grenzen für Altersteilzeit-Betriebsvereinbarungen<br />
9.5.2.1 Erzwingbare Betriebsvereinbarung<br />
Wenn <strong>und</strong> soweit nach dem einschlägigen <strong>und</strong> anzuwendenden Altersteilzeit-<br />
Tarifvertrag der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zugelassen wird, ergeben<br />
sich die rechtlichen Grenzen aus dem AtG <strong>und</strong> dem Tarifvertrag selbst.<br />
129
02_<strong>Kapitel</strong> I 30.04.2008 18:37 Uhr Seite 130<br />
Die Mindestregelungen des AtG, insbesondere über die Höhe der Aufstockungsleistungen,<br />
sind immer einzuhalten. Andernfalls liegt nicht nur ein Verstoß<br />
gegen das AtG vor, sondern es ist auch keine Altersteilzeitarbeit im Sinne<br />
des AtG gegeben.<br />
Die Grenzen aus dem Altersteilzeit-Tarifvertrag selbst sind zu beachten. Nur<br />
soweit der Tarifvertrag in seiner Öffnungsklausel eine Gestaltung durch die<br />
Betriebsparteien erlaubt, kann eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung<br />
getroffen werden. Die Betriebsvereinbarung ist gr<strong>und</strong>sätzlich erzwingbar, es<br />
sei denn, der Tarifvertrag erlaubt nur freiwillige Betriebsvereinbarungen.<br />
9.5.2.2 Freiwillige Betriebsvereinbarungen<br />
Beim Abschluss freiwilliger Betriebsvereinbarungen sind die Vorgaben aus<br />
dem AtG <strong>und</strong> ggf. aus einem einschlägigen <strong>und</strong> anzuwendenden Altersteilzeit-Tarifvertrag<br />
zu beachten. Die Betriebsvereinbarung sollte sich auf Verfahrensvorschriften<br />
beschränken; zweckmäßig ist es außerdem aus Gründen<br />
der Verständlichkeit, die geltenden gesetzlichen oder tariflichen Vorgaben, insbesondere<br />
die Höhe der Aufstockungsbeträge, in die Betriebsvereinbarung zu<br />
übernehmen. Die im Tarifvertrag festgelegten Aufstockungsbeträge können<br />
auch durch freiwillige Betriebsvereinbarung nicht erhöht werden. Es gilt der<br />
Tarifvorrang nach § 77 Abs. 3 BetrVG, da es sich bei den Aufstockungsbeträgen<br />
um „Arbeitsentgelt“ im Sinne der Vorschrift handelt. Eine Erhöhung der<br />
tariflichen Aufstockungsleistungen ist aber individualrechtlich oder durch<br />
Gesamtzusage des Arbeitgebers möglich <strong>und</strong> zulässig.<br />
Ein Arbeitgeber, der mit Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung in<br />
seinem Unternehmen die Entscheidung trifft, Altersteilzeit einzuführen, ist bis<br />
zur Beendigung dieser Betriebsvereinbarung daran geb<strong>und</strong>en. Er kann mit<br />
den Mitteln des Betriebsverfassungsrechts nicht gezwungen werden, eine freiwillige<br />
Leistung länger zu erbringen, als er auf Gr<strong>und</strong> der in der Betriebsvereinbarung<br />
selbst eingegangenen Bindung verpflichtet ist. Fällt die Leistungsverpflichtung<br />
des Arbeitgebers infolge der Kündigung der Betriebsvereinbarung<br />
weg, scheidet eine Nachwirkung i.S.v. § 77 Abs. 6 BetrVG aus. Für die<br />
weitere Anwendung der vorliegenden Betriebsvereinbarung reicht es nicht<br />
aus, dass der Arbeitnehmer seinen Antrag vor Ablauf der Betriebsvereinbarung<br />
gestellt hat. Es ist vielmehr erforderlich, dass das beantragte Altersteilzeitarbeitsverhältnis<br />
noch innerhalb der Geltungsdauer der Betriebsvereinbarung<br />
zur Altersteilzeit beginnen sollte (B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, Urt. vom<br />
5.6.2007 – 9 AZR 498/06 – nicht veröff.).<br />
130