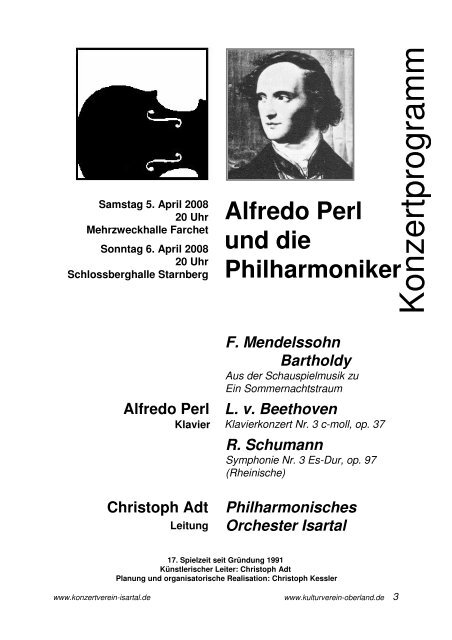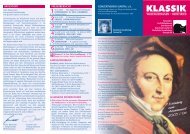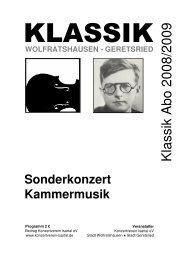Alfredo Perl - Konzertverein Isartal e.V.
Alfredo Perl - Konzertverein Isartal e.V.
Alfredo Perl - Konzertverein Isartal e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Samstag 5. April 2008<br />
20 Uhr<br />
Mehrzweckhalle Farchet<br />
Sonntag 6. April 2008<br />
20 Uhr<br />
Schlossberghalle Starnberg<br />
www.konzertverein-isartal.de<br />
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong><br />
Klavier<br />
Christoph Adt<br />
Leitung<br />
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong><br />
und die<br />
Philharmoniker<br />
F. Mendelssohn<br />
Bartholdy<br />
Aus der Schauspielmusik zu<br />
Ein Sommernachtstraum<br />
L. v. Beethoven<br />
Klavierkonzert Nr. 3 c-moll, op. 37<br />
R. Schumann<br />
Symphonie Nr. 3 Es-Dur, op. 97<br />
(Rheinische)<br />
Philharmonisches<br />
Orchester <strong>Isartal</strong><br />
17. Spielzeit seit Gründung 1991<br />
Künstlerischer Leiter: Christoph Adt<br />
Planung und organisatorische Realisation: Christoph Kessler<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
Konzertprogramm<br />
3
Spendenaufruf<br />
Anzeige<br />
Das Chak-e-Wardak Hospital in<br />
Afghanistan:<br />
Wo Hilfe unbezahlbar ist – aber dennoch finanzierbar<br />
Seit 1989 arbeitet Karla Schefter nahezu ununterbrochen in<br />
Afghanistan – und hat in dieser Zeit fast im Alleingang ein<br />
beispielloses Hilfsprojekt auf die Beine gestellt. Ein 60-Betten<br />
Hospital etwa 65km südwestlich von Kabul, in einem dicht<br />
besiedelten, fruchtbaren Tal in 2400m Höhe gelegen, das<br />
einzige Hospital für ca. 400.000 Menschen in der Provinz<br />
Wardak. Über 80.000 Patienten jährlich, 70% davon Frauen<br />
und Kinder, 2 OP’s, Röntgenstation, EKG, Ultraschall, Physiotherapie,<br />
eigene Küche, Bäckerei, Wäscherei, 3 Dieselgeneratoren;<br />
dazu ein komplettes Ausbildungszentrum für Frauen<br />
und eine kleine Siedlung mit Wohnhäusern für das Personal –<br />
all dies wird fast vollständig durch private Spenden finanziert.<br />
Karla Schefter kümmert sich 9 Monate jedes Jahres persönlich<br />
vor Ort um die korrekte Verwendung der Spendengelder –<br />
nichts geht verloren. Das Hospital hat auch den Anti-Terrorkrieg<br />
unbeschädigt überstanden und arbeitet weiterhin ohne<br />
Beeinträchtigungen.<br />
Das vom Geretsrieder HNO-Arzt Dr. Tilman Hilber und Karla<br />
Schefter im Jahr 1993 gegründete „Komitee zur Förderung<br />
medizinischer und humanitärer Hilfe in Afghanistan e.V.“<br />
kümmert sich in rein ehrenamtlicher Arbeit um die Beschaffung<br />
von Geld- und Sachspenden, es ist durch Freistellungsbescheid<br />
des Finanzamtes Groß-Gerau vom 19.7.2006 als<br />
mildtätig anerkannt.<br />
Dr. Christoph Kessler ist Mitglied des Vorstands und<br />
besuchte zuletzt im September 2006 das Krankenhaus in<br />
Chak-e-Wardak/Afghanistan.<br />
Karla Schefter ist in unserer Gegend keine Unbekannte: Ihre<br />
Vorträge im Gymnasium Oberhaching, beim Zonta-Club Starnberg,<br />
St. Michael Wolfratshausen und der Pfarrgemeinde<br />
Münsing haben zahlreiche Menschen des Landkreises berührt.<br />
Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende!<br />
Für Spenden über 50 € erhalten Sie bei Angabe Ihrer<br />
Adresse eine Spendenquittung zugeschickt.<br />
Spendenkonto Nr. 181 000 090,<br />
BLZ 44050199, Stadtsparkasse Dortmund<br />
Empfänger: Afghanistan-Komitee CPHA<br />
4 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Programm<br />
Felix Mendelssohn<br />
Bartholdy<br />
(1809-1847)<br />
Ludwig van Beethoven<br />
(1770-1827)<br />
Robert Schumann<br />
(1810-1856)<br />
www.konzertverein-isartal.de<br />
Aus der Schauspielmusik zu<br />
Ein Sommernachtstraum<br />
Scherzo<br />
Notturno<br />
Hochzeitsmarsch<br />
Klavierkonzert Nr. 3 c-moll,<br />
op. 37<br />
Allegro con brio<br />
Largo<br />
Allegro<br />
Pause<br />
Symphonie Nr. 3 Es-Dur, op. 97<br />
(Rheinische)<br />
Lebhaft<br />
Scherzo. Sehr mäßig<br />
Nicht schnell<br />
Feierlich<br />
Lebhaft<br />
Im Rahmen des Konzerts wird dem Pianisten <strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> die Ehrenmitgliedschaft des<br />
<strong>Konzertverein</strong>s <strong>Isartal</strong> e.V. verliehen.<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
Programmfolge<br />
5
Einladung zum Orchester<br />
6<br />
Freude am Orchesterspielen ?<br />
Das Philharmonische Orchester <strong>Isartal</strong> lädt Musikliebhaber mit guten<br />
instrumentalen Fähigkeiten zum Mitspielen im Philharmonischen Orchester<br />
ein. Alle Streicher (Violine, Viola, Cello, Kontrabass) sind herzlich<br />
willkommen, bei den Bläsern besonders Hörner.<br />
Wir proben jeweils donnerstags, 19:45-22:00 Uhr im Pädagogischen<br />
Zentrum des Gymnasiums Icking.<br />
Im Sommer haben wir vor, den Film Deep Blue (BBC, 2004) symphonisch<br />
life zu begleiten, der Film wird parallel auf eine Großleinwand projiziert. Der<br />
Film zeigt die Wunder der Tiefsee, die Orchestermusik wurde extra dazu<br />
für großes symphonisches Orchester komponiert. Der Event in Anwesenheit<br />
der Komponisten wird am 12. Juli 2008 im Bergwaldtheater Wolfratshausen<br />
stattfinden.<br />
Ab September bereiten wir die Aufführung von Beethovens Neunter<br />
Symphonie vor, die zur Einweihung der Neuen Loisachhalle aufgeführt<br />
werden wird. Die Aufführungen sind für Samstag, 21. März und Sonntag,<br />
22. März 2009 geplant. Bei diesem Großereignis werden auch der<br />
Philharmonische Chor – der sich aus mehreren Chören der Region und<br />
interessierten Sängerinnen und Sängern zusammensetzt - sowie namhafte<br />
Solisten auftreten. Es werden insgesamt über 200 Musiker mitwirken.<br />
Weitere symphonische Programme sind in Vorbereitung.<br />
Die Leitung des Orchesters hat Christoph Adt.<br />
Kontakt für Streicher: Dr. Hans Horsmann, Tel. 08171-910017, oder<br />
Susanne Kessler, Tel. 08171-76350<br />
Kontakt für Bläser: Stephanie Loderbauer, Tel. 08151-3920.<br />
Das Philharmonische Orchester <strong>Isartal</strong> unter seinem Dirigenten Christoph Adt im Ickinger Probenraum<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Felix Mendelssohn Bartholdy<br />
(1809-1847)<br />
Susanne Kessler<br />
Shakespearesche Kontraste<br />
Zur Schauspielmusik zu Ein Sommernachtstraum<br />
Entstehungszeit: 1826 entstand die Ouvertüre, die anderen Teil erst 1843<br />
Erstaufführung: Oktober 1843 im Theater des Neuen Palais in Potsdam<br />
Felix Mendelssohn wurde 1809 in Hamburg geboren als Sohn eines jüdischen Bankiers<br />
und Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn, des Freundes von Kant, Herder und<br />
Lessing. Ab 1811 lebte die Familie in Berlin. Nach erstem Musikunterricht bei seiner Mutter<br />
wurde er 1819 Schüler von Carl Friedrich Zelter. 1822 trat die Familie zum protestantischen<br />
Christentum über und nahm den Zunamen Bartholdy an. 1829 führte der 20-jährige Student<br />
mit der Berliner Singakademie Bachs Matthäus-Passion erstmals nach 100 Jahren wieder<br />
auf und leitete damit die Bach-Renaissance ein. Eine zweijährige Bildungsreise führte ihn<br />
u.a. nach Österreich, Italien und England. 1833 wurde er Kapellmeister in Düsseldorf, ab<br />
1835 Leiter des Gewandhausorchesters in Leipzig. 1837 heiratete er Cécile Jeanrenaud.<br />
1841 holte ihn Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin, ab 1845 leitete er wieder das Leipziger<br />
Gewandhausorchester. Der Tod seiner Schwester Fanny, verheiratete Hensel, mit der er<br />
zeitlebens in enger Verbindung stand, löste in ihm schwere Depressionen aus. Ein halbes<br />
Jahr später, im November 1847, starb er mit nur 38 Jahren an einem Gehirnschlag.<br />
Das Interesse an Wiederentdeckung und Verbreitung von Shakespeares Dramen zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel<br />
(Schriftsteller, Indologe, Philosoph und Mitbegründer der Romantik) ergriff auch den<br />
jugendlichen Mendelssohn. Mit Freunden und Familienmitgliedern wurden Dramen<br />
gelesen und mit verteilten Rollen gespielt. In diesem Kontext entstand im Sommer<br />
1826 eines der erstaunlichsten und genialsten Frühwerke eines Siebzehnjährigen: die<br />
Ouvertüre zum Schauspiel Ein Sommernachtstraum. Die anderen Teile zur Schauspielmusik<br />
entstanden erst 1843, als der preußische König Friedrich Wilhelm IV.<br />
Mendelssohn beauftragen ließ, eine komplette Musik für eine Inszenierung durch<br />
Ludwig Tieck im Theater des Neuen Palais in Potsdam zu schreiben, wo sie im Oktober<br />
1843 zum Schauspiel erstmals erklang. Trotz des Zwischenraums von 17 Jahren ist<br />
kein Stilbruch zu erkennen. Die Ouvertüre (op. 21) und die weiteren zwölf Nummern<br />
(op. 61) – darunter auch Nummern mit Chor und Solisten – gelten als wie aus einem<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
7<br />
Werke
Werke<br />
Guss, was zu sowohl positiven als auch negativen Bekundungen Anlass gab:<br />
Mendelssohn habe als Frühvollendeter seine Originalität gefunden, sei aber zu keiner<br />
Fortentwicklung fähig gewesen – Mendelssohn sei Meister in Einfühlung und Anpassung.<br />
Carl Dahlhaus merkt an, in Mendelssohns Stil seien Elfenton und Liedmelos …<br />
zwei stereotype Kennmarken, die in der Sommernachtstraum-Musik – dramatisch<br />
bedingt – lediglich thematisch und zu wesentlichen Elementen geworden seien.<br />
Zu heftigen Diskussionen führte immer wieder die Frage nach dem Zweck einer Schauspielmusik:<br />
Soll sie Atmosphäre umreißen, Dramatik nachzeichnen oder vorbereiten,<br />
Personen charakterisieren? Erhellen oder verfälschen wie auch immer geartete Musikstücke<br />
die Intentionen des Dichters? Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war die Mendelssohnsche<br />
Musik mit Shakespeares Drama eng verbunden, selbst in der Inszenierung<br />
durch Max Reinhardt bei den Salzburger Festspielen 1927, bis die nationalsozialistische<br />
Politik Mendelssohn Musik ächtete. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis das<br />
Mendelssohn-Bild sich von diesen Beschädigungen erholen konnte.<br />
Hochzeitsvorbereitungen, Liebes-Verwicklungen und Verwirrungen, ins Spiel gebracht<br />
durch die Macht des Elfenreiches und seiner Zaubermittel, münden in eine Dreifachhochzeit<br />
– so könnte man in knappster Kürze den Inhalt des Schauspiels umreißen.<br />
Das Scherzo ist als Zwischenaktmusik vor dem Auftritt der Elfen und Feen konzipiert,<br />
deren federartige, huschende Leichtigkeit und zauberische, überirdisch-irreale Atmosphäre<br />
es bildhaft darstellt und vorbereitet.<br />
Leichfüßig federnder 3/8-Takt und humorvolles, quasi verhalten „kicherndes“ Staccato<br />
sind Merkmale des Themas – bei freier Sonatenrondoform und künstlerisch feinsinniger<br />
und phantasievoller Themenverarbeitung ein Charakterstück und ein Scherzo par<br />
excellence!<br />
Das schlichte, lyrische Notturno ist eine Art Lied ohne Worte, eine Traummusik der<br />
schlafenden Liebenden, umgeben vom Zauber des Elfenreiches. Es lebt von seiner<br />
liedhaften, höchst romantischen Hornmelodie über betörender, klangvoll-weicher<br />
Bläsergrundierung. Im Mittelteil entwickeln die Streicher die Melodie-Elemente in Moll<br />
weiter. Helle Holzbläserklänge alternieren und leiten zum Zauber der Hornmelodie<br />
zurück, die im Reprisenteil leicht variiert und mit reicherer Begleitung erscheint.<br />
Schmetternde Trompetensignale leiten den Hochzeitsmarsch ein. Im Tutti prangt die<br />
eingängige, allerorts bekannte Melodie:<br />
Die Zwischenteile sind kammermusikalischer, von Streichern und Holzbläsern geführt.<br />
Die Coda breitet den signalartigen, punktierten Rhythmus noch einmal aus, die hellen<br />
Holzbläser fügen flirrende Trillerketten hinzu.<br />
8 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Ludwig van Beethoven<br />
um 1804<br />
Reinhard Szyszka<br />
Durchbruchswerk in ureigenster Tonart<br />
Zu Beethovens Klavierkonzert c-moll<br />
Widmung: GRAND CONCERTO pour le Pianoforte 2 Violons … composé et dedié A Son Altesse<br />
Royale Monseigneur le Prince LOUIS FERDINAND DE PRUSSE par Louis van Beethoven Op. 37,<br />
À Vienne au Bureau d‘Arts et d‘Industrie (Plattendruck der Einzelstimmen)<br />
Entstehungszeit: 1800 (Concerto 1800 Da L. v. Beethoven: das autographe Manuskript des c-moll-<br />
Konzerts – seit 1868 in der Berliner Staatsbibliothek – war während des zweiten Weltkriegs in Schlesien<br />
ausgelagert und ist seither verschollen<br />
Uraufführung: Am 5. April 1803 spielte Beethoven in Wien sein Konzert zum ersten Mal<br />
Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren, Vater und Großvater waren Musiker in<br />
der dortigen kurfürstlichen Kapelle. Mit vier Jahren erhielt er Klavierunterricht beim Vater, der<br />
aus ihm ein Wunderkind machen wollte. Mit 10 Jahren wurde er Schüler von Neefe, dem<br />
ersten Lehrer, der ihn entscheidend menschlich und musikalisch förderte. Mit 17 Jahren reiste<br />
er nach Wien, um Mozarts Schüler zu werden, musste jedoch wegen des Todes der Mutter,<br />
Trunksucht des Vaters und Sorge für seine jüngeren Brüder zurückkehren.1792 übersiedelte<br />
er endgültige nach Wien, nahm Unterricht bei Haydn. Erste Erfolge hatte er als Pianist, dann<br />
mit eigenen Werken. Um 1798 traten erste Anzeichen des Gehörleidens auf, das bis 1820 zur<br />
völligen Taubheit führte. Spätwerke wie 9. Symphonie, Missa solemnis, letzte Klaviersonaten<br />
und späte Quartette komponierte er in völliger Taubheit. Beethoven starb 1827, wahrscheinlich<br />
an Bleivergiftung und Lungenentzündung, in Wien.<br />
Der Schatten Mozarts lag schwer über dem jungen Ludwig van Beethoven. Und wie<br />
auch nicht: aus Bonn war er 1792 nach Wien gezogen, um dort Mozarts Geist aus<br />
Haydns Händen in Empfang zu nehmen. Er fand eine musikinteressierte Öffentlichkeit<br />
vor, die ihn mit offenen Armen aufnahm. 1795 stellte er sich in ersten Konzertauftritten<br />
als Komponist und Pianist vor und galt seither als Erbe und legitimer Nachfolger<br />
Mozarts. Doch Mozart und auch Haydn hatten in allen Bereichen der Musik Bedeutendes,<br />
Gültiges geschaffen. Wie sollte da ein junger, aufstrebender Komponist Fuß<br />
fassen können? Musste nicht jedes neue Werk den Vergleich zu den älteren Meistern<br />
herausfordern?<br />
Beethoven war sich des enormen Maßstabs, den Mozart und Haydn gesetzt hatten,<br />
wohl bewusst; er besaß das Selbstbewusstsein, die Herausforderung anzunehmen.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
9<br />
Werke
Werke<br />
Bei Haydn, Albrechtsberger und anderen hatte er sich das nötige kompositionstechnische<br />
Rüstzeug geholt, und nun fühlte er sich als musikalische Persönlichkeit<br />
stark genug, allen Vergleichen standzuhalten – nicht als zweiter Mozart oder Haydn,<br />
sondern als erster, einziger Beethoven.<br />
Dieses Selbstbewusstsein zeigte sich, als Beethoven im Jahr 1800 ein Konzert für<br />
Klavier und Orchester in c-moll ankündigte. Eine solche Ankündigung musste in Tonart<br />
und Gattung ein schier unerreichbares Vorbild evozieren: Mozarts Klavierkonzert<br />
c-moll KV 491. Und Beethoven wusste, warum er gerade mit diesem Werk den Ver-<br />
gleich suchte. Wenige Jahre zuvor hatte er das Mozart-Konzert im Wiener Augarten<br />
gehört und seinem Begleiter Johann Baptist Cramer zugerufen: Cramer! Cramer! Wir<br />
werden niemals im Stande sein, etwas Ähnliches zu machen. Nun, nachdem Beethoven<br />
auf zwei eigene Klavierkonzerte (C-Dur op. 15, und B-Dur op. 19) und viele<br />
andere Werke zurückblicken konnte, sah er sich anscheinend doch im Stande, etwas<br />
Ähnliches zu machen, und setzte sich mit dem c-moll-Werk dem direkten Vergleich<br />
mit Mozart aus.<br />
Bei einem öffentlichen Konzert im Hofburgtheater am 2. April 1800 wollte Beethoven<br />
sein neues Klavierkonzert als Pianist und Komponist erstmalig zu Gehör bringen.<br />
Doch lag zu diesem Zeitpunkt nur der erste Satz vor, und Beethoven spielte stattdessen<br />
sein C-Dur-Konzert op. 15, das er zu diesem Zweck einer gründlichen Revision<br />
unterzogen hatte. Auch bei einem zweiten Anlauf 1802 war das c-moll-Konzert noch<br />
nicht fertig, und erst ein weiteres Jahr später, am 5. April 1803, konnte die Uraufführung<br />
des Klavierkonzerts in c-moll op. 37 mit Beethoven am Klavier stattfinden.<br />
Skizze von Beethoven aus dem c-moll-Konzert (London, Britisches Museum, Mus. Add. 29 801)<br />
Der Solopart lag zu diesem Zeitpunkt nur als Skizze vor, und der Komponist spielte<br />
ihn aus dem Gedächtnis, dabei teilweise improvisierend, so wie es auch Mozart bei<br />
seinen Klavierkonzerten gehalten hatte. Bei einer Zweitaufführung am 19. Juli 1804<br />
saß Beethovens Schüler Ferdinand Ries am Klavier, und zu diesem Zeitpunkt muss<br />
auch der Klavierpart fertig ausgearbeitet gewesen sein. 1809 fügte der Komponist<br />
schließlich noch ausgeschriebene Kadenzen zu allen drei Sätzen hinzu.<br />
Hier zeigt sich eine Tendenz des Komponisten Beethoven, die sein ganzes Schaffen<br />
durchziehen sollte: der Meister brauchte und nahm sich Zeit für seine Werke, skizzierte,<br />
verwarf, feilte, verbesserte, und verlor dabei den ursprünglichen Zeitplan nur<br />
allzu leicht aus dem Blickfeld. Anders als Mozart, der oft in höchstem Zeitdruck schuf<br />
(bei der Oper La clemenza di Tito KV 621 lagen weniger als 2 Monate zwischen Kompositionsauftrag<br />
und Uraufführung), ließ sich Beethoven die Zeit, die er glaubte zu benötigen,<br />
auch wenn dadurch Konzerttermine platzten oder der Anlass der Komposition<br />
bei der Fertigstellung längst überholt war. Und so wurde auch das Klavierkonzert in cmoll<br />
op.37 im Grunde erst neun Jahre später als geplant endgültig fertig.<br />
Das c-moll-Konzert wird oft als ein Durchbruchswerk angesehen, vergleichbar der<br />
Eroica unter den Sinfonien, mit dem sich Beethoven endgültig von seinen Vorbildern<br />
Mozart und Haydn befreit und zu seinem eigenen Stil vorstößt. Und ohne die beiden<br />
10 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
vorangegangenen Klavierkonzerte Beethovens gering zu achten, lässt sich konstatieren,<br />
dass ihm mit dem c-moll-Werk etwas ganz Besonderes gelungen ist.<br />
In Mozarts ureigenster Gattung, dem Klavierkonzert, ist hier ein gleichwertiges Werk<br />
entstanden, das ohne jede Nachahmung des Salzburger Meisters auskommt und die<br />
Tür in die Zukunft weit aufstößt. Die Komponisten der Romantik waren von diesem<br />
Werk tief beeindruckt und ließen sich so zu ihren eigenen Klavierkonzerten inspirieren.<br />
c-moll gilt als Beethovens ureigenste Tonart. Gleich bei seiner ersten Publikation, den<br />
drei Klaviertrios op. 1, stand eines der Werke in c-moll. Dann folgten die Klaviersonaten<br />
op. 10/1 und Grande Sonate Pathétique op. 13 sowie das Streichquartett op. 18<br />
Nr. 4; später sollten noch die Coriolan-Ouvertüre op. 62, die 5. Sinfonie op. 67 und die<br />
letzte Klaviersonate op. 111 als berühmte c-moll-Kompositionen hinzukommen.<br />
Gemeinsam ist diesen Werken eine trotzige, aufbegehrende Haltung, markante<br />
Rhythmik und prägnante, unmittelbar eingängige Thematik. All diese Züge finden wir<br />
auch beim Klavierkonzert in c-moll vor.<br />
Das K. K. Theater an der Wien (Kolorierter Stich, Historisches Museum der Stadt Wien)<br />
Der erste Satz Allegro con brio beginnt im Piano. Die Streicher tragen im Unisono<br />
das eindringliche Hauptthema vor, das den Hörer sogleich fesselt:<br />
Die Holzbläser antworten sequenzierend,<br />
jedoch reich harmonisiert:<br />
Im Wechselspiel zwischen Streichern und Bläsern wird das Thema fort gesponnen,<br />
wobei Beethoven die Synkopen noch durch Sforzati betont:<br />
Nach 16 Takten findet der Themenkomplex im Fortissimo einen ersten Abschluss.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
11<br />
Werke
Werke<br />
Über ein Zwischenspiel im Wechsel zwischen Streichern und Bläsern<br />
kehrt Beethoven zum Hauptthema zurück, doch diesmal mit vollem Orchester, Forte<br />
und im strahlenden Es-Dur. Es kommt zu neuen Fortspinnungen, wieder mit betonten<br />
Synkopen, ehe die erste Violine und die erste Klarinette das zweite Thema vortragen:<br />
Die tiefen Streicher, die Hörner und die Fagotte geben die harmonische Grundierung.<br />
Auch dieses Thema wird bald vom vollen Orchester aufgenommen, nach C-Dur<br />
gewendet, bleibt aber, seinem Charakter gemäß, immer im Piano. Das Hauptthema<br />
kehrt wieder, erst in C-Dur, dann in f-moll. Über verschiedene Wendungen moduliert<br />
Beethoven nach c-moll zurück, wo das Hauptthema zuletzt im Kanon zwischen Bläsern<br />
und Streichern erscheint:<br />
Dann endlich hat der Solopianist seinen Auftritt, der freilich umso eindrucksvoller<br />
ausfällt. Drei auffahrende Tonleiter-Raketen in Oktaven durchmessen fast den<br />
gesamten Tonumfang damaliger Klaviere, bevor das Hauptthema in Oktaven erklingt:<br />
12<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
Diesen überaus<br />
prägnanten und unverwechselbaren<br />
Einstieg<br />
greift der Liedermacher<br />
Georg Kreisler zu<br />
Beginn seines Liedes<br />
Zwei alte Tanten tanzen<br />
Tango parodierend auf.<br />
Von da an hat das Soloinstrument die Führung inne. Beethoven wiederholt das bisher<br />
dargebotene musikalische Material und erweitert es durch das Wechselspiel mit dem<br />
Klavier. Man sehe sich nur einmal an, wie sich das kleine Zwischenspiel, das wir vorhin<br />
im Wechsel von Streichern und Bläsern kennen gelernt haben, jetzt im Wechsel von<br />
Streichern und Klavier ausmacht:<br />
www.konzertverein-isartal.de
Auch das zweite Thema wird vom Klavier aufgegriffen, wieder in Es-Dur. Doch<br />
während zuvor das Orchester “eigenmächtig“ nach C-Dur moduliert hatte, “erzwingt“<br />
das Klavier nun, dass das Orchester beim “korrekten“ Es-Dur, der Durparallele zu cmoll,<br />
bleibt. In dieser Tonart geht die Exposition im lebhaften Wechselspiel von<br />
virtuosen Klavierfiguren und thematischem Material des Orchesters zu Ende.<br />
In der Durchführung, die ohne Absatz an die Exposition anschließt, moduliert das<br />
Orchester sogleich nach D-Dur. Wieder, wie zu Beginn, steigt das Klavier mit drei<br />
auffahrenden Tonleiter-Raketen ein, doch diesmal in D-Dur. Beethoven verkürzt nun<br />
das Hauptthema auf die letzten 5 Töne:<br />
Dieses Motiv, das von ferne an den Beginn von Mozarts Jupiter-Sinfonie KV 551<br />
erinnert, wandert im Folgenden durch die Tonarten und durch die Instrumente. In<br />
überaus phantasievollen, dabei stets überzeugenden Modulationen wandelt der<br />
Meister das Motiv ab und stellt es den Figurationen des Klaviers gegenüber.<br />
Unablässig vorandrängend, kommt die Durchführung bald an ihr Ende, und in einer<br />
Klavierskala abwärts über dreieinhalb Oktaven wird die Reprise erreicht.<br />
Hier erklingt zunächst das Hauptthema im triumphierenden Fortissimo des gesamten<br />
Orchesters. Danach kommt es, den Regeln des Sonatensatzes entsprechend, zu einer<br />
verkürzten Wiederholung der Exposition, doch Beethoven bringt in überquellender<br />
Phantasie stets neue Varianten der bekannten Themen ein, so dass sich niemals das<br />
Gefühl des “schon gehört“ einstellt. Auch das zweite Thema erklingt wieder, in C-Dur,<br />
denn eine Mollfassung dieses Themas erscheint wirklich nicht vorstellbar.<br />
Eine kurze Orchesterpassage, die auf dem Hauptthema basiert, leitet über zur Kadenz<br />
des Soloklaviers. Diese beginnt mit dem Hauptthema im Kanon, wie wir es zu Beginn<br />
schon vom Orchester gehört haben. Virtuose Akkordbrechungen schließen sich an;<br />
auch das zweite Thema hat seinen Auftritt, diesmal in G-Dur. Gegen Ende der Kadenz<br />
hat der Pianist in beiden Händen lange Trillerketten mit Daumen und Zeigefinger zu<br />
spielen, und darüber bzw. darunter bringt er mit dem kleinen Finger ein Motiv aus dem<br />
Hauptthema zu Gehör, ohne dass die Triller dabei abreißen dürfen:<br />
Solchen Trillerketten mit gleichzeitigem Spiel einer Gegenstimme mit derselben Hand<br />
begegnen wir erst in Beethovens Spätwerk wieder, in den Klaviersonaten op. 109 und<br />
op. 111. Die Kadenz endet, durchaus untypisch, im Pianissimo. Und für den Schluss<br />
des Satzes hat Beethoven noch eine besondere Überraschung parat. Das Motiv aus<br />
den letzten 5 Tönen des Hauptthemas, welches wir aus der Durchführung so gut<br />
kennen, erklingt in der Pauke, begleitet von liegenden Streicherakkorden. Das Klavier<br />
antwortet mit leisen Kaskadenfiguren. Doch schnell steigert sich die Lautstärke, und<br />
gemeinsam bringen Klavier und Orchester den Satz in der Grundtonart c-moll triumphal<br />
zu Ende.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
13<br />
Werke
Werke<br />
Beginn der Kadenz im Autograph (Paris, Bibliothèque du Conservatoire de Musique, Ms. 26)<br />
Zu dieser Tour de force bietet der langsame Satz Largo in jeder Hinsicht den denkbar<br />
größten Gegensatz: im Takt (3/8 statt Alla Breve), in der Tonart (E-Dur statt c-moll) und<br />
vor allem in der Grundhaltung (ruhiges, melodisches Verströmen statt energisches,<br />
virtuoses Zupacken). Das Klavier beginnt mit einem Thema, das in vollgriffigen<br />
Akkorden vorgestellt wird:<br />
In Klaviersatz und Melodieführung erinnert dieses Thema entfernt an den langsamen<br />
Satz aus Beethovens Sonata quasi una fantasia op. 27/1 (das ist das Schwesterwerk<br />
der bekannten Mondscheinsonate).<br />
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Satz der Kontrasttonart G-Dur zu.<br />
Bereits in der einleitenden Klavierpassage steht ein Teil in dieser Tonart:<br />
Doch sowie das Orchester mit Flöten, Fagotten, Hörnern und gedämpften Streichern<br />
dem Klavier antwortet, ist E-Dur wieder erreicht:<br />
14<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Bald nimmt das Klavier den Faden wieder auf mit langen Ketten von Terzenparallelen<br />
in der rechten Hand:<br />
Der Satz ist in dreiteiliger Liedform A – B – A angelegt. Der Mittelteil steht, wie sollte<br />
es anders sein, in G-Dur, und bietet ein besonders apartes Klangbild. Das Klavier<br />
sorgt mit rauschenden, harfenartigen Akkordbrechungen für das harmonische<br />
Grundgerüst:<br />
Darüber werfen sich Fagott und Flöte die melodischen Bälle zu, und die Streicher<br />
unterstützen mit Pizzikato-Akkorden:<br />
Die Musik moduliert zurück nach E-Dur, und der Anfangsteil kehrt wieder, freilich nicht<br />
als simple Wiederholung, sondern überaus phantasievoll variiert und ausgeziert.<br />
Schließlich mündet auch dieser Satz in eine Kadenz des Soloklaviers. Diese ist, im<br />
Gegensatz zur Kadenz des ersten Satzes, in Stichnoten notiert, also im freien Tempo zu<br />
spielen.<br />
Danach geht der Satz ruhig zu Ende, und Beethoven kann es nicht lassen, noch einen<br />
kräftigen Schlussakkord zu setzen, gewissermaßen als Überleitung zum abschließenden<br />
Rondo im Tempo Allegro. Hier kehren wir zur Grundtonart c-moll und zum 2/4-Takt<br />
zurück. Das Klavier stellt das energische, eingängige Thema mit dem charakteristischen<br />
Abwärtssprung zwischen dem 2. und 3. Ton über eine verminderte Septime vor:<br />
Einen ähnlichen Abwärtssprung gibt es auch im Rondothema des Finalsatzes von<br />
Beethovens Klaviersonate op. 2 Nr. 2. So verschieden der ruhig-elegante Sonatensatz<br />
und das vorwärts drängende Konzertrondo auch sind, eines haben sie gemeinsam:<br />
das Klavier pflegt den Spitzenton über virtuose Läufe oder Akkordbrechungen von<br />
unten anzusteuern und so eine unerhörte Spannung für den erwarteten Sprung nach<br />
unten und die Wiederkehr des Rondothemas aufzubauen.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
15<br />
Werke
Werke<br />
Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1772-1806)<br />
(Schabkunstblatt von A. Geiger nach einem<br />
Gemälde von J. Grassy<br />
Das Orchester greift das Thema auf; die Melodie liegt in der Oboe. Das Ritornell<br />
selbst ist in der Form A – B – A angelegt. Das Klavier stellt den B-Teil vor, und die<br />
Rückführung zum Thema (A-Teil) ist erstmalig durch eine kleine Kadenz mit<br />
chromatischem Anlauf auf den Spitzenton spannungsvoll verzögert:<br />
Das Orchester antwortet mit einer verkürzten Wiederholung der Teile B und A und<br />
führt so das Ritornell zu Ende; dabei blitzt erstmalig das Thema in Dur auf.<br />
Fanfaren eröffnen das erste Couplet:<br />
Dann stellt das Klavier das erste Seitenthema in Es-Dur vor, welches durch seine<br />
Lombardischen Rhythmen (d.i. die Umkehr der normalen punktierten Rhythmen)<br />
gekennzeichnet ist:<br />
Orchester und Klavier führen dieses Thema phantasievoll durch. Dann gewinnen im<br />
Klavier virtuose Triolen die Überhand, und mit einem chromatischen Aufwärtslauf über<br />
fast drei Oktaven wird das as’ und der Abwärtssprung um eine verminderte Septime in<br />
das Hauptthema erreicht. Der zweite Durchgang durch das Ritornell beginnt – natürlich<br />
nicht als bloße Wiederholung, sondern mit subtilen Veränderungen. Wo beim<br />
ersten Mal das Klavier allein glänzte, begleiten jetzt die Streicher im Pizzikato, und die<br />
Kadenz, die den Wiedereintritt des A-Teils verzögert, ist diesmal noch bedeutend<br />
erweitert.<br />
16<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
Ferdinand Ries (1784-1838) (nach einer<br />
Litographie von Howe)<br />
www.konzertverein-isartal.de
Zu Beginn des zweiten Couplets stellt die Klarinette ein neues Thema in As-Dur vor:<br />
Auch dieses Thema wird durchgeführt; dabei treten Klarinette und auch Fagott dem<br />
Klavier als weitere Soloinstrumente gegenüber. Wenn dieser Abschnitt vorüber ist,<br />
kommt es im Orchester zu einem kurzen Fugato über eine Variante des Rondothemas:<br />
Gelegentlich wird dabei das Thema auf seine ersten sechs oder sogar nur auf seine<br />
ersten drei Töne verkürzt. Als nach einer Weile das Klavier den Faden wieder aufnimmt,<br />
hat sich das Thema nach E-Dur verirrt. Beethoven aber moduliert überlegen nach cmoll<br />
zurück, und mit dem unvermeidlichen chromatischen Anlauf von unten in den<br />
Abwärtssprung beginnt der dritte Durchgang des Ritornells. Diesmal freilich verzichtet<br />
der Komponist auf das sattsam bekannte A – B – A und begnügt sich mit dem A-Teil.<br />
Die Großform des Satzes ist ein Bogenrondo; daher ähnelt das dritte Couplet dem<br />
ersten. Es beginnt wieder mit Fanfaren, doch das Thema mit den Lombardischen<br />
Rhythmen steht diesmal in C-Dur. Wenn der Hörer den vierten Durchgang durch das<br />
Ritornell erwartet, ist Des-Dur erreicht. Erschrocken über diese “falsche“ Tonart, zieht<br />
sich das Klavier nach wenigen Takten zurück und überlässt dem Orchester das Feld.<br />
Dieses moduliert in die “richtige“ Tonart zurück und macht nach einer Verbreiterung<br />
Raum für die dritte und letzte Kadenz des Satzes:<br />
Die rhythmisch frei zu spielende Kadenz steigt aus der Basslage des Klaviers hinauf<br />
in den Diskant und wieder hinunter zur Mittellage, wo sich das Zeitmaß bis zum<br />
Adagio verbreitert. Wenn das Klavier das Tempo wieder aufnimmt, hat sich einiges<br />
verändert: die Tempobezeichnung ist nun Presto, die Tonart ist C-Dur, und der Takt<br />
ist 6/8. Das so energische, geradtaktige Hauptthema kommt jetzt im hüpfenden<br />
Dreiertakt daher:<br />
Diese Themengestalt beherrscht die Schlussstretta, mit der Klavier und Orchester<br />
den Satz und damit das Konzert glänzend zu Ende bringen.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
17<br />
Werke
Werke<br />
Robert Schumann<br />
(1810-1856)<br />
Susanne Kessler<br />
Mitreißende Lebensfreude und feierlicher Prunk<br />
Zu Schumanns 3. Symphonie<br />
Entstehungszeit: 2. November 1850 – 9. Dezember 1850 in Düsseldorf<br />
Uraufführung: 6. Februar 1851 in Düsseldorf unter der Leitung des Komponisten<br />
Robert Schumann, geb.1810 in Zwickau, gab Jurastudium zugunsten der Musik auf. Nach<br />
Lähmung eines Fingers durch verhängnisvolle Übetechnik war die Pianistenkarriere gescheitert.<br />
1834 gründete er die „Neue Zeitschrift für Musik“, für die er jahrelang schriftstellerisch<br />
tätig war. 1840 heiratete er gegen den Willen ihres Vaters Clara Wieck, die damals bedeutendste<br />
Pianistin und geniale Interpretin seiner Klavierwerke. Als Dirigent wirkte er in Dresden<br />
und Düsseldorf. Nach Anfällen von psychischer Zerrüttung stürzte er sich 1854 von einer<br />
Rheinbrücke, wurde gerettet und verbrachte die letzten Jahre in zunehmendem geistigem<br />
Verfall in einer Pflegeanstalt in Endenich (Bonn), wo er 1856 starb.<br />
Schaffenskraft und Inspiration gingen bei Robert Schumann stets mit positiver psychischer<br />
Gestimmtheit einher. So waren die beiden Jahre nach seiner Eheschließung mit<br />
Clara (1840/41) voller kompositorischer Aktivität mit weit über hundert Liedern, zwei<br />
Symphonien, einem Klavierkonzert und Kammermusik. Die Lehrtätigkeit am Leipziger<br />
Konservatorium ab 1843 und die Leitung der Liedertafel in Dresden ab 1844 nebst<br />
Privatunterricht befriedigten ihn nicht, meist stand er im Schatten seiner berühmten<br />
Gattin. 1850 erfüllte sich sein lang gehegter Wunsch nach einer angesehenen<br />
Position: Schumann wurde nach Düsseldorf als Städtischer Musikdirektor berufen.<br />
Im September siedelte die Familie nach Düsseldorf um. Schumann fühlte sich nach<br />
eigenem Bericht von einem so frischen künstlerischen Geist … angeweht…. Man fühlt<br />
sich hier dem großen Weltgetriebe näher. Im Oktober entstand das Violoncellokonzert.<br />
Die ersten Abonnementskonzerte unter seiner Leitung wurden mit Begeisterung<br />
aufgenommen. In nur zwei Tagen, vom 7. bis 9. November, skizzierte er den ersten<br />
Satz einer neuen Symphonie in Es-Dur. Nach knapp fünf Wochen, am 9. Dezember<br />
überraschte er seine Frau mit der fertigen Partitur. Eine Woche später wurde sie an<br />
den Kopisten zwecks Stimmenabschrift geschickt. Am 6. Februar 1851 erklang sie<br />
erstmals in einem Abonnementskonzert in Düsseldorf unter Leitung des Komponisten.<br />
18<br />
www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Das Publikum scheint nach zeitgenössischen Berichten das Werk zunächst eher lau,<br />
ja verletzend kalt aufgenommen zu haben. Nach der zweiten Aufführung in Köln und<br />
einer dritten am 13. März in Düsseldorf fand sich das Publikum vertrauter mit dem<br />
schönen Werk, … es war freudig überrascht von dieser Fülle neu entdeckten<br />
Reichthums.<br />
Die Rheinische ist eigentlich Schumanns vierte Symphonie. (Die heute als Vierte geltende<br />
in d-moll – schon 1841 entstanden – wurde nach Umarbeitung erst 1851 als<br />
vierte veröffentlicht.) Der Beiname Rheinische scheint auf Berichte seines Düsseldorfer<br />
Konzertmeisters und späteren Biographen W. J. Wasiliewski zurückzugehen,<br />
mit dem Schumann während der Komposition Mendelssohns Violinkonzert probte und<br />
zahlreiche Gespräche und Spaziergänge pflegte. Wasiliewski berichtete, dass<br />
Schumann im November 1850 von einer Kardinalserhebung im Kölner Dom sehr<br />
beeindruckt gewesen sei und diese Feierlichkeit zum Vorbild für den vierten Satz<br />
genommen habe. Die Rheinische Zeitung sah in der neuen Tondichtung …ein Stück<br />
rheinischen Lebens in frischer Heiterkeit, und Schumann selbst urteilte, die<br />
volksthümlichen Elemente seien ihm wohl gelungen.<br />
Wie in den meisten Werken Schumanns spielt der Themendualismus eine untergeordnete<br />
Rolle, wie auch die Sonatenhauptsatzform nur Formgerüst bietet. Stattdessen<br />
geht es Schumann – wie auch Schubert in seinen späteren Werken – um immer neue<br />
Ausbreitung des musikalischen Materials in ferne Tonartbereiche. Die Themen der<br />
Sätze sind miteinander verbunden durch das Quartintervall, sie gibt allen Themen<br />
melodische Struktur.<br />
Köln um 1840, Stahlstich von M. J. Starling<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
19<br />
Werke
Werke<br />
Geehrter Herr,<br />
Mein Schreiben betrifft heute die Herausgabe eines größeren Werkes. Ich habe in letzter<br />
Zeit eine Symphonie [die Es-Dur-Symphonie] componirt, auch schon hier und in Cöln<br />
aufgeführt. Es kommt mir nicht zu, über das Werk, wie über dessen Aufnahme mehr zu<br />
sagen; ich glaube nur, es könnte ohne Gefahr für den Verleger in die Öffentlichkeit treten.<br />
Die Symphonie hat fünf Sätze, ist aber deshalb nicht länger, als andere mittleren<br />
Umfangs. Wünschen Sie, so kann ich Ihnen Partitur wie ausgeschriebene Stimmen zur<br />
Ansicht mittheilen.<br />
Wie derartig größere Stücke nur nach und nach fruchttragend sind, weiß ich, und würde<br />
bei dem Honoraransatz gewiß darauf Rücksicht nehmen.<br />
Vor der Hand wollte ich Sie nur von der Existenz des Werkes benachrichtigen. Vielleicht<br />
haben Sie Lust zur Herausgabe, was mich freuen würde.<br />
Hochachtungsvoll, Ihr ergebener R. Schumann<br />
Brief Robert Schumanns an den Verleger Simrock vom 1. März 1851<br />
Ungewöhnlich ist die Erweiterung auf fünf Sätze, zumal der vierte, der prunkvollfeierliche,<br />
an Kirchenmusik gemahnende, aus dem Rahmen fällt. Er ist der eigentliche<br />
langsame Satz der Symphonie nach dem quasi Andantino-Scherzo (Schumann vermeidet<br />
stets die italienischen zugunsten deutscher Tempobezeichnungen) und dem<br />
zweiten, relativ kurzen, gesanglich-melodischen quasi Allegretto-Satz, der auch als<br />
eine Art Intermezzo bezeichnet wurde. Die ernste Strenge des vierten Satzes und<br />
seine Polyphonie beugen sich nicht dem leichten Verständnis. So schrieb Clara<br />
Schumann in ihr Tagebuch: Welcher der fünf Sätze mir der liebste, kann ich nicht<br />
sagen… Der vierte jedoch ist derjenige, welcher mir noch am wenigsten klar ist; er ist<br />
äußerst kunstvoll, das höre ich, doch kann ich nicht so recht folgen, während mir an<br />
den anderen Sätzen wohl kaum ein Takt unklar blieb, überhaupt für den Laien ist die<br />
Symphonie, vorzüglich der zweite und dritte Satz sehr leicht zugänglich.<br />
Der erste Satz (Lebhaft), der gewichtigste der Symphonie, hat fast die doppelte<br />
Länge der anderen Sätze. Ohne Einleitung wird er eröffnet vom lebhaft vorwärts<br />
drängenden Hauptthema, das den ganzen ersten Satz fast rondoartig beherrscht.<br />
Vitalität und mitreißenden Schwung erhält es durch die weit ausgreifenden Intervalle,<br />
die prägnanten Punktierungen und vor allem durch seine rhythmisch-metrische<br />
Mehrdeutigkeit: In den ersten sechs Takten weichen die Betonungen dem<br />
vorgezeichneten Dreivierteltakt aus, sodass sie dem Hörer als drei „große“ Dreihalbe-<br />
Takte erscheinen, ein sog. hemiolischer Rhythmus, den Schumann oftmals, später vor<br />
allem Brahms gern verwandte. Erst ab dem 7. Takt schwingt das Thema im<br />
vorgegebenen Dreivierteltakt walzerartig weiter.<br />
20 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Dem kraftvollen Überleitungsmotiv,<br />
das später in der Durchführung<br />
eine Rolle spielen wird,<br />
folgt noch einmal das Hauptthema, kraftvoll von Violinen und Hörnern geführt. Das<br />
lyrisch wiegende Seitenthema in g-moll wirkt zurückhaltender, fast nachdenklich. Es<br />
wird von den Holzbläsern angestimmt, von den Streichern variierend fortgesponnen.<br />
Ansteigende Tonleitern, Akzente und das<br />
Hauptthema, kräftig vom Horn vorgetragen,<br />
führen den Schwung weiter, eine Schlussfloskel<br />
kündigt das Ende der Exposition an.<br />
Der hemiolische Rhythmus des ersten Themas, melodisch auf einen Oktavsprung<br />
reduziert, leitet in die Durchführung.<br />
Diese beginnt mit einem Ausbruch in wildem Forte-Fortissimo. In Schumanns Durchführungen<br />
treffen weniger die Gegensätze der Themen aufeinander, sondern die<br />
Motive werden – wie schon bei Schubert – durch weite Tonart-Landschaften geleitet,<br />
hier zunächst das Tonleitermotiv und das Seitenthema. Nach einer Steigerung über<br />
Paukenwirbel beginnt die Reise des Hauptthemas in Celli und Bässen in die weit von<br />
der Ausgangstonart entfernten Gefilde von as-moll, H-Dur, Fis-Dur und c-moll.<br />
Markant beginnen die Hörner mit dem Themenkopf des Hauptthemas die Rückleitung<br />
zur Reprise, an deren Beginn das Hauptthema in strahlendem Forte-Fortissimo ertönt.<br />
Die Reprise ist verkürzt, das Hauptthema wird nicht wiederholt, wie in der Exposition<br />
folgt es aber nochmals nach dem Seitenthema. Der mitreißende Schwung des Satzes<br />
kommt am Ende der Coda zur Ruhe.<br />
Der dreiteilige zweite Satz (Scherzo. Sehr mäßig) – Scherzi sind meist schnelle<br />
Sätze mit burleskem bis dämonischem Charakter – überrascht als ein Stück im<br />
Volkston in behaglichem, fast ländlerartigem Dreivierteltakt, dessen Metrum allerdings<br />
immerfort in Frage gestellt wird durch melodische Schwerpunkte auf der punktierten<br />
Note der zweiten Zählzeit. Das beschauliche Dreiklangsthema in klarem C-Dur,<br />
dessen Auftaktquart die Verbindung zu den anderen Sätzen schafft, wird angestimmt<br />
von tiefen Streichern und Fagotten und greift allmählich auf die anderen<br />
Instrumentengruppen über.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
21<br />
Werke
Werke<br />
Den Scherzo-Charakter erfüllt neben der metrischen Schwerpunktverschiebung ein<br />
Motiv, das mit seinem luftigen, getupften Staccato einen Gegensatz zur Kantilene<br />
bildet, sich aber als eine figurale Variante des ersten Themas entpuppt und durchführungsartig<br />
auch das Trio durchzieht.<br />
Den Trio-Mittelteil in a-moll bestimmt ein balladenhaft-gesangliches Thema im Legato-<br />
Charakter. Es breitet sich in den Bläsern über einem Terz-Orgelpunkt auf C aus,<br />
kontrapunktiert vom Staccato-Motiv, das lebendig durch die Stimmen der<br />
Streichinstrumente huscht.<br />
In einem zweiten Trioteil werden die Elemente der Themen verarbeitet: das erste<br />
Thema wird mit den Triolen des Balladenthemas durchführungsartig konfrontiert.<br />
Der dritte Satz (Nicht schnell) (in A-B-A-Form) ist reich an melodischem Fluss und<br />
strömendem Wohlklang in weichem As-Dur, er ist durchweg kammermusikalisch sparsam<br />
instrumentiert, Trompeten, Posaunen und Pauke pausieren. Die Klarinetten und<br />
Fagotte eröffnen ihn in klangvoller Zweistimmigkeit mit dem elegischen ersten Thema:<br />
Sogleich schließt sich ein zweites Thema der Streicher an, das sich über zehn Takte<br />
fließend ausbreitet:<br />
Der Satz ist sehr dicht komponiert, kaum ein Takt ist ohne Bezug zu einem der Themen.<br />
Der Mittelteil enthält eine eigene, in noch weiteren Bögen dahin strömende Melodie:<br />
22 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Durchführungsartig wird das dritte Thema kombiniert mit den Auftakt-Sechzehnteln<br />
des zweiten. Die Reprise des A-Teils verwendet alle drei Themen, das dolce-Thema<br />
der Klarinetten und Fagotte wird kontrapunktiert von der Sechzehntelbewegung,<br />
gefolgt von den weiten Bögen des dritten. Mit dem Themenkopf des zweiten klingt der<br />
Satz in ruhiger Gelassenheit aus.<br />
Der vierte Satz (Feierlich) in es-moll (trotz Es-Dur-Vorzeichnung) wirkt wie eine<br />
strenge Insel inmitten von Heiterkeit und Vitalität, nach Schumanns wenigen<br />
programmatischen Bemerkungen zur Symphonie ist man fast versucht zu sagen: wie<br />
der Kölner Dom inmitten rheinischen Frohsinns.<br />
Er trug ursprünglich die Überschrift Im Charakter der Begleitung einer feierlichen<br />
Ceremonie. Den feierlich-sakralen Charakter vermitteln voluminöse Bläserklänge, der<br />
Aufbau in Form einer Fuge, die kunstvollen kontrapunktischen Techniken und die<br />
Intonation des Fugenthemas in der Art einer Choralmelodie. Das Thema selbst ist<br />
einem Fugenthema aus Bachs Wohltemperierten Klavier verwandt. Hörner und<br />
Posaunen exponieren das Thema, das vom aufsteigenden Quartintervall geprägt ist,<br />
in mehrstimmigem Satz, begleitet von Pizzicati der Streicher.<br />
Holzbläser und Streicher beginnen die erste Fugendurchführung mit einer Engführung,<br />
d.h. im Kanon im Halbtakt-Abstand. Das polyphone Gewebe wird dichter durch zahl-<br />
reiche Einsätze des Themenkopfs. Eine zweite Durchführung verarbeitet eine – vorher<br />
schon erklungene – verkleinerte Variante des Themenkopf in Achtelwerten, die mit<br />
dem originalen Themenkopf in den Fugeneinsätzen wechselt.<br />
In einen zweiten Abschnitt wird der Themenkopf in drei Geschwindigkeitsvarianten<br />
verarbeitet: in Achteln, Vierteln und Halben. Steigerung erfahren Lautstärke und<br />
polyphone Dichte. Eine Art Reprise, wieder im piano beginnend, hat symphonischen<br />
Charakter, zu dem die Streicher mit Klangflächen beitragen. In der Coda erklingt eine<br />
neue Variante mit fanfarenartigen Punktierungen, die in reinem Bläserklang an Richard<br />
Wagner erinnert. Theatralisch-prunkvoll gedehnte Blechbläserakkorde beenden den<br />
Satz.<br />
Das Finale (Lebhaft) entspricht in heiter-beschwingtem Charakter dem ersten Satz.<br />
Wie oft bei Schumann fungiert der Schlusssatz als Zusammenfassung durch<br />
Verarbeitung von Themen aller Sätze, und zwar bereits in der Exposition. Das<br />
Quartintervall zu Beginn des Hauptthemas ist aufwärts mit Tonschritten ausgefüllt. Die<br />
Melodie aus kleinen Intervallen in marschähnlichem Daktylos-Rhythmus (Wechsel von<br />
einer Halben und zwei Vierteln) treibt in raschem Tempo energisch voran.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
23<br />
Werke
Werke<br />
Mehrere Motive im Ablauf der Exposition sind prägnant und werden für die weitere<br />
Entwicklung wichtig: Ein tänzerisches Überleitungsmotiv lockert sogleich den starren<br />
Rhythmus mit Punktierungen und Synkopen auf.<br />
Das Seitenthema scheint zunächst inne zu halten, wird aber sogleich von dynamischeren<br />
Motiven beiseite gedrängt, erst später erscheint es vollständig:<br />
Dann bringen synkopische Motive und Akkordfolgen – Konturen des synkopischen<br />
Fugenthemas des vierten Satzes sind nicht zu übersehen – das Taktgefüge beinahe<br />
ins Wanken.<br />
In viertes Motiv, abgeleitet vom zweiten, spielt später in der Durchführung eine<br />
wichtige Rolle:<br />
Die Durchführung ist als große Steigerung konzipiert. Der Beginn im Piano überrascht<br />
mit dem Thema des vorigen Satzes, in schnellen Achtelwerten und im Staccato huscht<br />
es leise durch die Streicherstimmen. Steigernd und in dichter Verarbeitung wird es mit<br />
dem daktylische Rhythmus des Hauptthemas und dem vierte Motiv in wechselnden<br />
Tonarten konfrontiert. Und wieder verblüfft ein neues, fanfarenartiges Thema der<br />
Bläser in H-Dur, das melodisch dem Hauptgedanken des Scherzos, im Charakter aber<br />
dem ersten Satz verwandt ist:<br />
Durch verschiedene Tonarten leitet es, angefeuert vom Daktylus-Rhythmus, zurück<br />
nach Es-Dur in die Reprise mit dem triumphierend im Tutti erklingenden Hauptthema.<br />
Die Coda beginnt mit machtvollen drei Blechbläserakkorden. Bei ihrem dritten Einsatz<br />
zitieren sie den Hauptthemenkopf in Umkehrung und lassen dann die ernste<br />
Choralmelodie des vierten Satzes wieder erstehen, die dann in engem Kanon erklingt.<br />
Der schwungvolle, punktierte Rhythmus setzt sich jedoch durch. Eine Stretta beendet<br />
den Satz mit strahlenden Dreiklangsfanfaren in jubelndem Fortissimo.<br />
24 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong><br />
Klavier<br />
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong>, 1965 in Santiago, Chile, geboren, studierte dort zunächst bei Carlos Botto,<br />
später bei Günter Ludwig in Köln und Maria Curcio in London. Als Preisträger<br />
bedeutender Wettbewerbe wurde er bald zu einem der führenden Pianisten seiner<br />
Generation.<br />
1996/1997 brachte er, von der Kritik hoch gelobt, sämtliche Beethoven-Sonaten in<br />
London, Santiago und Moskau zur Aufführung, es erschien seine Einspielung der 32<br />
Beethoven-Sonaten und der Diabelli-Variationen. Über <strong>Perl</strong>s Beethoven-Interpretation<br />
hieß es: ...mit großer unabgenutzter Frische, mit äußerster Zärtlichkeit und<br />
unaffektierter Brillanz demonstrierte er tröstlich, wie wenig die Tradition erfüllten und<br />
erfühlten Beethovenspiels auch in unseren prosaischen Zeiten aufhört (Joachim<br />
Kaiser).<br />
Weitere Einspielungen sind, im Recitalbereich, drei CDs mit Musik von Franz Liszt,<br />
sowie in der Kammermusik Brahms‘ Sonaten für Klarinette und Klavier mit Ralph<br />
Manno und Beethovens Sonaten für Klavier und Cello mit Guido Schiefen. Er nahm<br />
Griegs Klavierkonzert und die Symphonie Concertante von Szymanowski auf, so wie<br />
kürzlich die Klavierkonzerte und den Totentanz von Liszt mit dem BBC Symphony<br />
Orchestra unter Yakov Kreizberg. Seine Aufnahme für BBC von den 24 Preludes von<br />
Chopin ist auf DVD erhältlich.<br />
Seine weltweite Konzerttätigkeit führte ihn in die bedeutendsten Konzertsäle: Barbican<br />
Centre und Royal Albert Hall in London, Concertgebouw Amsterdam, Rudolfinum Prag,<br />
Großer Musikvereinssaal Wien, Herkulessaal München, Hamarikyu Asahi Hall Tokio,<br />
Teatro Colón Buenos Aires, National Arts Center Ottawa, Sydney Town Hall u.v.a.<br />
1997 gab er eine Reihe von Solokonzerten im Rahmen des ersten Klavierzyklus der<br />
Hypo-Kulturstiftung im Konzerthaus Berlin, der Hamburger Musikhalle, im Gewandhaus<br />
Leipzig, der Düsseldorfer Tonhalle, in der Alten Oper Frankfurt und im<br />
Prinzregententheater München.<br />
Er trat bei renommierten Festivals auf wie dem Rheingau Musik Festival, dem Bath<br />
International Music Festival, den Schwetzinger Festspielen, dem Kissinger Sommer<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
25<br />
Solist
Solist<br />
und den Haydn-Festspielen in Eisenstadt.<br />
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> spielte mit einer Vielzahl namhafter Orchester, darunter London Symphony<br />
Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande,<br />
Residentieorkest Den Haag, Melbourne Symphony Orchestra, Gewandhausorchester<br />
Leipzig sowie Mozarteum-Orchester Salzburg und MDR-Sinfonieorchester Leipzig,<br />
Niederländisches Philharmonisches Orchester, Wiener Symphoniker, Stuttgarter<br />
Philharmoniker, Sydney Symphony, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.<br />
2002 brachte er mit den Münchner Symphonikern die gesamten Klavierkonzerte<br />
Beethovens zur Aufführung und erntete damit höchstes Lob von Publikum und Presse:<br />
<strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> hat in diesem Zyklus seinen Rang in der Oberklasse der Beethoven-<br />
Interpretation bekräftigt (SZ, 29.01.2002).<br />
In der Reihe Klassik Wolfratshausen war er bereits 2001 mit Beethovens 4. Klavierkonzert<br />
unter Leitung von Günther Weiß zu hören.<br />
26 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Christoph Adt<br />
Dirigent<br />
Wolfgang Rihm zeigte sich begeistert, als Christoph Adt 1995 bei den Tagen für Neue Musik<br />
Stuttgart seine Orchesterstücke Ungemaltes Bild und Spur aufführte: Während der letzten<br />
Proben konnte ich Christoph Adts Arbeit bewundern und ihn als überaus professionellen<br />
Orchestererzieher kennen lernen. Joachim Kaiser, bei dem der angehende Musiker an der<br />
Stuttgarter Musikhochschule studiert hatte, bescheinigte ihm die Fähigkeit, unter schwierigsten<br />
Verhältnissen seine hochmusikalischen Vorstellungen und Interpretationsabsichten mit<br />
freundlicher Beharrlichkeit durchsetzen zu können.<br />
Dirigent<br />
Mit mehreren Preisen, darunter dem 1. Preis beim Internationalen Dirigierwettbewerb in Lugano,<br />
schloss Christoph Adt seine Ausbildungszeit an der Stuttgarter Musikhochschule (Kapellmeisterstudium<br />
bei Thomas Ungar und Ferdinand Leitner) ab. Es folgte eine Zeit als Assistent des<br />
Chefdirigenten beim NDR Rundfunkorchester Hannover. Gleichzeitig übernahm der junge<br />
Dirigent einen Lehrauftrag für Dirigieren an der Stuttgarter Musikhochschule sowie die<br />
kommissarische Leitung des Hochschulorchesters (1994-1997). Als Christoph Adt 1998 einem<br />
Ruf als Professor an die Münchner Musikhochschule folgte, hinterließ er nicht nur an der<br />
Stuttgarter Musikhochschule eine Lücke, sondern auch im Stuttgarter Musikleben, wo er u.a. als<br />
Leiter des jungen Kammerorchesters Stuttgart hochgelobte künstlerische Arbeit geleistet hatte.<br />
Mit dem Ensemble war Christoph Adt außerdem in Russland, China und Kanada auf Tournee.<br />
Inzwischen hat sich Christoph Adt nicht nur als hochbegabter Orchesterpädagoge, sondern<br />
auch als feinsinniger Dirigent einen Namen gemacht. Einladungen und Gastspiele führten den<br />
engagierten Musiker durch ganz Europa, als Gastdirigent an das Rumänische Rundfunkorchester<br />
nach Bukarest sowie nach Japan, wo er 1998 mit der Japan Philharmonic in Tokio<br />
auftrat. Mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks studierte er Xenakis Anastenaria und Die<br />
Glocken von Alexander Nevsky ein. Im vorigen Jahr leitete er im Gustav-Mahler-Musiksaal in<br />
Toblach eine Aufführung von Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel und war mit dem<br />
Deutschen Requiem von Johannes Brahms mit der Enescu-Philharmonie in Bukarest zu hören.<br />
Christoph Adt ist bis heute ein gefragter Pädagoge. Er ist regelmäßig Dozent bei den<br />
Crescendo-Kursen im ungarischen Sártospatak.<br />
Seit Frühjahr 2002 ist Christoph Adt Dirigent des Philharmonischen Chores und Orchesters<br />
<strong>Isartal</strong> und Musikalischer Leiter des <strong>Konzertverein</strong>s <strong>Isartal</strong> e.V. sowie Kuratoriumsmitglied des<br />
Kulturvereins Oberland e.V. Mit den Stabat mater-Aufführungen im Frühjahr 2006 übernahm er<br />
erstmals die Gesamtleitung des Philharmonischen Chores Oberland und des Philharmonischen<br />
Orchesters Oberland.<br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
27
Philharmonisches Orchester <strong>Isartal</strong><br />
Philharmonisches Orchester <strong>Isartal</strong><br />
Das Philharmonische Orchester <strong>Isartal</strong> ist die große Orchestergruppierung des<br />
<strong>Konzertverein</strong>s <strong>Isartal</strong> e.V. Das Orchester besteht – je nach Besetzung der<br />
aufgeführten Werke – aus bis zu 90 Musikern. Dirigent und Musikalischer Leiter ist<br />
Professor Christoph Adt, Hochschule für Musik und Theater München. Die Bläser<br />
betreut Dankwart Schmidt, ehemaliger Soloposaunist der Münchner Philharmoniker.<br />
Das Orchester hat in den vergangenen 17 Jahren ein vielfältiges und umfangreiches<br />
Repertoire erarbeitet, das über 100 Werke – symphonische Werke oder Konzerte,<br />
aber auch Opern und geistliche Werke – umfasst. Dazu gehören Symphonien von<br />
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Bruckner<br />
und Tschaikowsky, Solokonzerte wie Schumanns Klavier- und Violoncellokonzert,<br />
Dvoráks Violoncellokonzert, beide Klavierkonzerte von Johannes Brahms,<br />
Tschaikowskys Violinkonzert, ferner Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, Mahlers<br />
Kindertotenlieder, Chaussons Poème de l´amour et de la mer, Carl Nielsens 4.<br />
Symphonie Das Unauslöschliche, als Highlights der Moderne Strawinskys<br />
Ballettsuiten Der Feuervogel und Pulcinella sowie die IV. Symphonie (1913) von<br />
Albéric Magnard. Mit Schnittkes Moz-Art à la Haydn setzte das Orchester die<br />
Aufführung zeitgenössischer Komponisten fort. Im Sommer 2007 wurde erstmals mit<br />
Tschaikowskys Schwanensee ein Ballett auf die Bühne gebracht, es tanzte die<br />
Compagnie Ballet Classique München in der Choreographie von Rosina Kovács.<br />
Gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor <strong>Isartal</strong> wurden 1997 und 2003 von<br />
Brahms Ein deutsches Requiem, von Mozart szenisch Die Zauberflöte, zur<br />
Jahrtausendwende Beethovens Neunte Symphonie, von Bach die Matthäus-Passion<br />
und zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Wolfratshausen im September 2003 szenisch Carl<br />
Orffs Carmina burana aufgeführt. Im Frühjahr 2006 wurde Rossinis Stabat mater mit<br />
über 200 Mitwirkenden in Benediktbeuern und Starnberg aufgeführt mit anschließender<br />
Frankreich-Tournee in die Partnerstädte von Wolfratshausen, Geretsried und<br />
Starnberg, Barbezieux, Chamalières und Dinard. Zur Einweihung der Neuen<br />
Loisachhalle im Frühjahr 2009 wurden Chor und Orchester eingeladen, das<br />
Eröffnungskonzert mit Beethovens Neunter Symphonie zu gestalten. 1999 war das<br />
Orchester zu einer Japanreise nach Iruma (bei Tokyo) eingeladen.<br />
Bedeutende Solisten musizierten mit dem Philharmonischen Orchester <strong>Isartal</strong>, u.a.<br />
Alfons Kontarsky mit beiden Klavierkonzerten von Johannes Brahms an einem<br />
Abend, <strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> mit Beethovens 4. Klavierkonzert, Isabelle Faust mit Beethovens<br />
Violinkonzert, Wen-Sinn Yang mit Schumanns Violoncellokonzert, Ingolf Turban mit<br />
dem 1. Violinkonzert von Paganini und Dana Borşan mit Beethovens 5. Klavierkonzert<br />
und Brahms‘ 1. Klavierkonzert.<br />
Christoph Adt übernahm den Taktstock im Frühjahr 2002 im Sinn des regionalen<br />
Kulturauftrags, die Bandbreite hiesiger Musiker im Philharmonischen Orchester<br />
<strong>Isartal</strong> zu integrieren. Sein Engagement wissen wir sehr zu schätzen, verhilft er doch<br />
den Musikern zur Klarheit über die inneren Zusammenhänge der Musik und<br />
vermittelt motivierende Hilfe und detaillierten Zugang zur musikalischen und auch<br />
technischen Bewältigung der Werke. Dieses professionelle Heranführen von Laien<br />
an die Schattierungen klassischer Werke durch detaillierte Probenarbeit ist ein Wert,<br />
den wir sehr achten und erhalten möchten.<br />
28 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de
Orchestermitglieder<br />
Violine<br />
Martin Schütz<br />
Melanie Daffner<br />
Pinchas Adt<br />
Judith Altmann<br />
Friederike Bernwieser<br />
Jakob Brenner<br />
Anne Bschorer<br />
Karolin Chapman<br />
Julie Daffner<br />
Sybille Dimbath<br />
Viola Einsiedel<br />
Barbara Helck<br />
Gisela Hofmann<br />
Hans Horsmann<br />
Anna Maria Immertreu<br />
Christiane Kurtz<br />
Eva Meier de West<br />
Julian Merkle<br />
Osamu Nambu<br />
Eva Schinko<br />
Wally Stenzler<br />
Arjan Versteeg<br />
Svenja Wagner<br />
Viola<br />
Johannes Schempp<br />
Heidi Aumüller<br />
Werner Hofmann<br />
Rainer Janssen<br />
Ernst Rothe<br />
Kontakte<br />
Bodil Schnurrer<br />
Heinrich von<br />
Stackelberg<br />
Ilse Wagner<br />
Erika Weber<br />
Violoncello<br />
Marijke Baumann<br />
Manuel Adt<br />
Moritz Boege<br />
Katrin Book<br />
Georg Dielmann<br />
Irmgard Hailmann<br />
Christoph Kessler<br />
Reinhard Lampe<br />
Harald Sachers<br />
Kontrabass<br />
Rainer Maquart<br />
Thomas Beier<br />
Monika Kamjunke<br />
Ekkehard Klement<br />
Ruth Lackner<br />
Elisabeth Schregle<br />
Andreas Wohlmann<br />
Flöte<br />
Irene Bergmann<br />
Veronika Duhm<br />
Martina Mayer-Voigt<br />
Streicher: Dr. Hans Horsmann (Tel. 08171 - 91 00 17)<br />
Susanne Kessler (Tel. 08171 - 76 350)<br />
Bläser: Stephanie Loderbauer (Tel. 08151 - 39 20)<br />
Oboe<br />
Stephanie Loderbauer<br />
Sigrid Lanzl<br />
Klarinette<br />
Veronika Scharf<br />
Klaus Reichhart<br />
Judith Rupp<br />
Fagott<br />
Eleonore Distl<br />
Lore Polta<br />
Horn<br />
Markus Liebsch<br />
Barbara Kleinschmidt<br />
Esther Kretschmar<br />
Elke Pätsch<br />
Susanna Gärtner<br />
Trompete<br />
Tanja Bleyl<br />
Moritz Oberjatzas<br />
Klaus-Peter Scharf<br />
Posaune<br />
Christan Fuchs<br />
Franz Hohberger<br />
Steffen Lüdecke<br />
Paul Troxler<br />
Pauken<br />
Alexander Jung<br />
Philharmonisches Orchester <strong>Isartal</strong><br />
www.konzertverein-isartal.de www.kulturverein-oberland.de<br />
29<br />
Philharmonisches Orchester <strong>Isartal</strong>
<strong>Konzertverein</strong> <strong>Isartal</strong><br />
<strong>Konzertverein</strong> <strong>Isartal</strong> e.V.<br />
Der <strong>Konzertverein</strong> <strong>Isartal</strong> e.V. wurde 1991 ins Leben<br />
gerufen, um dem Philharmonischen Orchester <strong>Isartal</strong><br />
(damals noch Ickinger Laien-Philharmoniker unter Leitung<br />
von Matt Boynick) die organisatorische Grundlage zu bieten.<br />
Erster Vorsitzender wurde Dr. Christoph Kessler, der diese Funktion heute noch<br />
innehat. Auch Sybille Dimbath ist aus dem Ur-Vorstand noch als Schatzmeisterin<br />
dabei.<br />
Mit der Stadt Wolfratshausen stellte der <strong>Konzertverein</strong> die Reihe Klassik Wolfratshausen<br />
auf die Beine, der Verein übernahm die musikalische, die Stadt die finanziellorganisatorische<br />
Seite. Seit vor zwei Jahren die Stadt Geretsried offiziell dazu kam,<br />
heißt die Konzertreihe Klassik Wolfratshausen-Geretsried.<br />
Der Verein will kommunale Kulturarbeit leisten, hat diese aber längst auf regionale<br />
Projekte ausgeweitet, bei denen verschiedene Ensembles ihre Kräfte vereinen. Für<br />
solche Großvorhaben ist mittlerweile der Kulturverein Oberland e.V. mit zuständig,<br />
dessen Vorsitzender ebenfalls Dr. Christoph Kessler ist.<br />
Von drei dieser übergreifenden Projekte liegen CD-Mitschnitte vor: Ein deutsches<br />
Requiem von Brahms (1997) und Beethovens 9. Symphonie (2000); die dritte mit<br />
Rossinis Stabat mater ist in 2006 erschienen. 2007 fand erstmals ein Konzertaustausch<br />
statt: Der Musikkreis Starnberg, heute Musica Starnberg, gastierte mit einem<br />
Händel-Oratorium bei Klassik Wolfratshausen-Geretsried. Umgekehrt bot das<br />
Philharmonische Orchester <strong>Isartal</strong> seinen Brahms-Abend im März 2007 (1. Klavierkonzert,<br />
4. Symphonie) in der Schlossberghalle in Starnberg dar und tritt am 6. April<br />
2008 mit <strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> als Solisten im Rahmen der neu initiierten Konzertreihe<br />
STAklassikABO dort auf. In 2009 ist eine Fortführung der Zusammenarbeit - vermittelt<br />
durch den Kulturverein Oberland e.V. - mit einem Konzert des Amaryllis Quartetts<br />
Bern im Rahmen der neuen Konzertreihe geplant.<br />
Neun Konzerte gibt der <strong>Konzertverein</strong> derzeit pro Jahr. Das Orchester-Repertoire wird<br />
stetig erweitert, der musikalische Leiter, Christoph Adt, bezieht häufig Werke der<br />
Moderne ein, um die Entwicklung des Klangkörpers und seiner Mitglieder zu fördern.<br />
Für die Musiker bedeutet das höchst intensive Probenarbeit. Ergänzend werden<br />
bedeutende Gastensembles in die Klassikreihe eingeladen, wie das Artemis Quartett<br />
Berlin, Quatuor Ébène Paris, Carmina Quartett, Henschel Quartett, Guarneri Trio<br />
Prag, Leipziger Streichquartett, Kuss Quartett Berlin, Gelius Trio München, das<br />
Münchner Streichsextett oder das Benaïm Quartett Paris.<br />
Über seine Dirigenten – Prof. Christoph Adt und seinen Vorgänger Prof. Günther<br />
Weiß, beide Professoren an der Musikhochschule München – kamen immer wieder<br />
bedeutende Solisten, um mit dem Philharmonischen Orchester <strong>Isartal</strong> zu konzertieren.<br />
Unter den Künstlern, die so auch die Leistung des semi-professionellen Laienorchesters<br />
würdigten, waren etwa die Geiger Isabelle Faust und Ingolf Turban, die Pianisten<br />
Alfons Kontarsky und <strong>Alfredo</strong> <strong>Perl</strong> sowie der Cellist Wen-Sinn Yang. In 2006 trat die<br />
Perkussionistin und 1. ARD-Preisträgerin Marta Klimasara auf. Mit Beethovens 5.<br />
Klavierkonzert konzertierte Dana Borşan (Bukarest) mit dem Orchester in Wolfratshausen<br />
und Penzberg, mit Brahms‘ 1. Klavierkonzert in Geretsried und Starnberg.<br />
30 www.kulturverein-oberland.de<br />
www.konzertverein-isartal.de