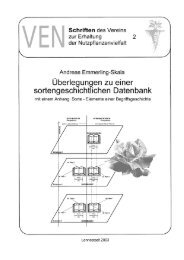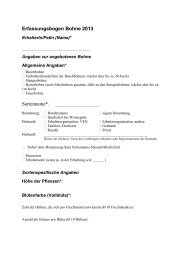Einblick in die Arbeiten der Kartoffelgenbank Groß Lüsewitz
Einblick in die Arbeiten der Kartoffelgenbank Groß Lüsewitz
Einblick in die Arbeiten der Kartoffelgenbank Groß Lüsewitz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die ältesten noch vorhandenen Sorten gehen<br />
auf <strong>die</strong> 2. Hälfte des vorigen Jahrhun<strong>der</strong>ts zurück,<br />
s<strong>in</strong>d also nach <strong>der</strong> großen Phytophthora-<br />
Epidemie entstanden.<br />
Abb. 10: Wichtige ältere Sorten<br />
Neben den staatlich f<strong>in</strong>anzierten Genbanken<br />
widmen sich verschiedene Nicht-Regierungs-<br />
Organisationen mit vielen engagierten Mitarbeitern,<br />
wie <strong>der</strong> Ausrichter <strong>die</strong>ser Veranstaltung,<br />
mit Enthusiasmus <strong>der</strong> Erhaltung alter, gefährdeter<br />
Landsorten. Es ist erstaunlich, welche<br />
Fülle an längst verloren geglaubten Formen<br />
durch <strong>die</strong>se Organisationen zusammengetragen<br />
werden.<br />
Bei <strong>der</strong> Kartoffel zeigen sich aber gerade hier<br />
<strong>die</strong> Probleme bei <strong>der</strong> vegetativen Erhaltung von<br />
virusanfälligen und wenig toleranten Sorten.<br />
Bei <strong>der</strong>en ständigem Anbau im Garten, <strong>der</strong> ja<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>der</strong> Speisekartoffelerzeugung<br />
<strong>die</strong>nt, kommt es zu e<strong>in</strong>er oft extremen Anhäufung<br />
aller möglichen Viruskrankheiten, welche<br />
<strong>die</strong> Existenz <strong>der</strong> Sorte gefährden können.<br />
Wie werden nun Kartoffelsorten und Wildkartoffeln<br />
<strong>in</strong> Genbanken erhalten?<br />
E<strong>in</strong>e Kartoffelsorte ist <strong>die</strong> vegetative Nachkommenschaft<br />
e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigen Pflanze, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Pflanzenzüchtung als Klon bezeichnet. Alle<br />
Pflanzen e<strong>in</strong>er Sorte s<strong>in</strong>d genetisch gleich,<br />
abgesehen von gelegentlichen Mutationen<br />
(sprunghaft auftretenden erblichen Verän<strong>der</strong>ungen),<br />
<strong>die</strong> manchmal zu neuen Sorten geführt<br />
haben (z.B. Erstl<strong>in</strong>g - Rote Erstl<strong>in</strong>g, K<strong>in</strong>g<br />
Edward - Red K<strong>in</strong>g Edward).<br />
Jede Kartoffelsorte stellt e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Komb<strong>in</strong>ation<br />
von Erbanlagen (Genen) dar, <strong>die</strong> bei<br />
generativer, d.h. geschlechtlicher Vermehrung<br />
über Samen durch Aufspaltung <strong>der</strong> Gene auf<br />
<strong>die</strong> Säml<strong>in</strong>gsnachkommen verloren geht. Die<br />
Erhaltung von Kartoffelsorten kann also nur auf<br />
vegetativem Wege erfolgen, entwe<strong>der</strong> durch<br />
– Anbau im Freiland<br />
– <strong>in</strong>-vitro-Kultur o<strong>der</strong><br />
– Kryokonservierung von Kartoffelpflanzen.<br />
Erhaltung des Kulturkartoffelsortimentes<br />
durch Freilandanbau<br />
10 Pflanzen pro Sorte<br />
Voraussetzung:<br />
Gesundheitslage, d. h. ger<strong>in</strong>ges Vorkommen<br />
virusübertragen<strong>der</strong> Blattläuse, ist <strong>in</strong> <strong>Groß</strong> <strong>Lüsewitz</strong><br />
gewährleistet<br />
Wichtigste Maßnahmen:<br />
1. Vorkeimung,<br />
2. Elim<strong>in</strong>ierung sichtbar viruskranker Pflanzen,<br />
3. Krautziehen nach <strong>der</strong> Blüte (Juli) zur Unterb<strong>in</strong>dung<br />
<strong>der</strong> Virusabwan<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>die</strong><br />
Knollen bei Neu<strong>in</strong>fektion<br />
Dabei Tolerierung latenten Befalls mit den<br />
"leichten" Viren PVS bzw. PVX. Virusfreimachung<br />
erfolgt erst bei Etablierung e<strong>in</strong>er<br />
Sorte <strong>in</strong>-vitro.<br />
Vorteile:<br />
1. ständige Kontrolle <strong>der</strong> Sortenechtheit<br />
2. Knollen für Evaluierung und Abgabe immer<br />
verfügbar<br />
Nachteile:<br />
1. Arbeitsspitzen bei Pflanzung, Krautziehen,<br />
Ernte<br />
2. Bereitstellung virusfreien Materials ist problematisch<br />
Trend: Weniger Feld-, mehr <strong>in</strong>-vitro-Kultur<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>in</strong>-vitro-Kultur werden ausgehend von<br />
Keim- o<strong>der</strong> Sproßspitzen auf e<strong>in</strong>em Nährmedium<br />
<strong>in</strong> Kulturgefäßen Pflänzchen angezogen.<br />
Diese bilden unter geeigneten Bed<strong>in</strong>gungen<br />
nach 4 Monaten unter Absterben <strong>der</strong> Blätter<br />
kle<strong>in</strong>e Mikroknollen, <strong>die</strong> dann bei Lagerung <strong>in</strong><br />
Dunkelheit und 4 °C e<strong>in</strong>e Ruheperiode von 12-<br />
15 Monaten haben, ehe sie auskeimen und <strong>der</strong><br />
Zyklus von neuem beg<strong>in</strong>nt.<br />
Samensurium 14/2003 - 29 -