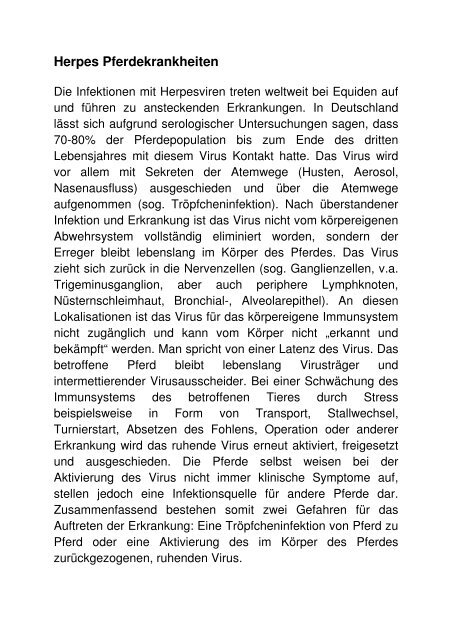weiterlesen? - Pferdezentrum Fister
weiterlesen? - Pferdezentrum Fister
weiterlesen? - Pferdezentrum Fister
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Herpes Pferdekrankheiten<br />
Die Infektionen mit Herpesviren treten weltweit bei Equiden auf<br />
und führen zu ansteckenden Erkrankungen. In Deutschland<br />
lässt sich aufgrund serologischer Untersuchungen sagen, dass<br />
70-80% der Pferdepopulation bis zum Ende des dritten<br />
Lebensjahres mit diesem Virus Kontakt hatte. Das Virus wird<br />
vor allem mit Sekreten der Atemwege (Husten, Aerosol,<br />
Nasenausfluss) ausgeschieden und über die Atemwege<br />
aufgenommen (sog. Tröpfcheninfektion). Nach überstandener<br />
Infektion und Erkrankung ist das Virus nicht vom körpereigenen<br />
Abwehrsystem vollständig eliminiert worden, sondern der<br />
Erreger bleibt lebenslang im Körper des Pferdes. Das Virus<br />
zieht sich zurück in die Nervenzellen (sog. Ganglienzellen, v.a.<br />
Trigeminusganglion, aber auch periphere Lymphknoten,<br />
Nüsternschleimhaut, Bronchial-, Alveolarepithel). An diesen<br />
Lokalisationen ist das Virus für das körpereigene Immunsystem<br />
nicht zugänglich und kann vom Körper nicht „erkannt und<br />
bekämpft“ werden. Man spricht von einer Latenz des Virus. Das<br />
betroffene Pferd bleibt lebenslang Virusträger und<br />
intermettierender Virusausscheider. Bei einer Schwächung des<br />
Immunsystems des betroffenen Tieres durch Stress<br />
beispielsweise in Form von Transport, Stallwechsel,<br />
Turnierstart, Absetzen des Fohlens, Operation oder anderer<br />
Erkrankung wird das ruhende Virus erneut aktiviert, freigesetzt<br />
und ausgeschieden. Die Pferde selbst weisen bei der<br />
Aktivierung des Virus nicht immer klinische Symptome auf,<br />
stellen jedoch eine Infektionsquelle für andere Pferde dar.<br />
Zusammenfassend bestehen somit zwei Gefahren für das<br />
Auftreten der Erkrankung: Eine Tröpfcheninfektion von Pferd zu<br />
Pferd oder eine Aktivierung des im Körper des Pferdes<br />
zurückgezogenen, ruhenden Virus.
Die Herpesinfektionen sind weder anzeige- noch meldepflichtig<br />
und werden durch verschiedene Herpesviren ausgelöst. Die<br />
Nummerierung der Herpesviren erfolgte in der Reihenfolge ihrer<br />
Entdeckung. Es werden 8 Herpesviren beschrieben, dabei<br />
kommen die equinen Herpesviren der Typen EHV-1, -2, -3 und<br />
-4 bei Pferden und EHV-5 bis EHV-8 in der Regel nur bei Eseln<br />
vor.<br />
Krankheitsbilder<br />
Die verschiedenen Herpesviren können unterschiedliche<br />
Organsysteme betreffen und führen somit zu verschiedenen<br />
Krankheitssymptomen. Es treten Entzündungen der Atemwege<br />
(Rhinopneumonitis), Spätabort, Paretisch- paralytische<br />
Verlaufsform, Keratokonjunktivitis und Equines<br />
Herpesexanthem auf.<br />
Entzündung der Atemwege (Rhinopneumonitis)<br />
Zu respiratorischen Erkrankungen kommt es meist nur bei<br />
Jungtieren oder geschwächten Tieren durch Tröpfcheninfektion.<br />
Es sind in der Regel zunächst die oberen Atemwege (Rhinitis,<br />
Pharyngitis) betroffen, aber auch Manifestation im Bereich der<br />
Bronchien sind nicht selten. Die Entzündung der Atemwege<br />
wird durch Infektionen des Equinen Herpesvirus 1 und 4<br />
ausgelöst. Bei Erkrankungen der oberen Luftwege spielt v.a.<br />
bei Fohlen auch das Equine Herpes Virus 2 eine Rolle. Die<br />
klinischen Symptome reichen von inapperenten Fällen über<br />
subklinische Verläufe bis zu hochgradigen Zuständen.<br />
Symptome: Die Inkubationszeit beträgt 2-10 Tage. Erstes<br />
Symptom einer Herpeserkrankung ist meist Fieber bis über<br />
39°C. Während der ca. 1 -7 Tage andauernden Fieberphase<br />
fallen Mattigkeit und verringerter Appetit auf. Die<br />
Mandibularlymphknoten sind umfangsvermehrt und
druckempfindlich. Kurz nach dem Auftreten des Fiebers folgen<br />
Nasen- und Augenausfluss begleitet von zeitweisem Husten.<br />
Unter sehr guten Haltungsbedingungen und ohne das Auftreten<br />
von Komplikationen beispielsweise in Form von bakteriellen<br />
Sekundärinfektionen od. viralen Mischinfektionen können die<br />
Symptome nach etwa zwei Wochen abklingen. Bei bakteriellen<br />
Sekundärinfektion oder Ausbreitung des Krankheitsgeschehens<br />
auf die Bronchien kann die Erkrankungsdauer bis zu fünf<br />
Wochen betragen.<br />
Spätabort<br />
Der Virusabort der Stuten durch EHV-1 tritt in der<br />
Spätträchtigkeit zwischen dem siebten und elften<br />
Trächtigkeitsmonat auf. Die Aborte können einzeln auftreten<br />
oder mehrere Stuten eines Bestandes betreffen. Die Stute zeigt<br />
dabei in der Regel keine Krankheitssymptome. Es treten<br />
normalerweise keine Vorzeichen auf und der Abort verläuft sehr<br />
schnell. Der Virus befällt die Schleimhäute der Gebärmutter und<br />
Plazenta, die Plazenta löst sich von der Uteruswand, so dass<br />
die Nährstoffversorgung des ungeborenen Fohlens<br />
unterbrochen wird, und es abstirbt. Neben dem Abort kann es in<br />
Folge von Herpesinfektionen mit EHV-1 auch zur Geburt toter<br />
oder lebensschwacher Fohlen kommen, die dann meist<br />
innerhalb der ersten Lebenstage aufgrund einer virusbedingten<br />
Pneumonie oder Ausfälle anderer Organe (Leber, Niere)<br />
verenden.<br />
Paretisch- paralytische Verlaufsform (Lähmungen, "Parese-<br />
Paralyse-Syndrom")<br />
EHV-1-Infektionen können auch zu neurologischen<br />
Erkrankungen führen. Pferde jeden Alters können betroffen
sein. In der Regel wird ein perakuter oder akuter Verlauf<br />
beobachtet. Die Erkrankung geht also nur über wenige Tage.<br />
Nach einem initialen Fieberanstieg auf bis über 40°C treten oft<br />
zunächst respiratorische Symptome in Form von Nasen-,<br />
Augenausfluss und Husten auf. Das Bewusstsein ist ungestört.<br />
Zeitlich geringgradig versetzt sind Bewegungsstörungen der<br />
Hinterhand zu beobachten. Es kommt zu Blutungen in die<br />
Nervensubstanz des Rückenmarks (ischämische Vaskulitits im<br />
Rückenmark). Daraus resultieren Koordinationsstörungen der<br />
Hinterhand (Ataxie), Sensibilitätsstörungen, reduzierte<br />
Schweifspannung (sog. „Lämmerschwanz“),<br />
Bewegungsunwillen, über hundesitzige Stellung kann es bis hin<br />
zu Bewegungsunfähigkeit, Festliegen und Tod des betroffenen<br />
Pferdes kommen. Je nachdem, in welchen Bereichen die<br />
Blutungen in das Nervengewebe erfolgen, stellen sich<br />
außerdem Lähmungen von Penis, Anus oder Blase ein.<br />
Keratokonjunktivitis<br />
Das Equine Herpesvirus 2 kann zur Entzündung der Bindehaut<br />
und Hornhaut des Auges (sog. Keratokonjunktivitis) führen.<br />
Equines Herpesexanthem<br />
Das Equine Herpesvirus 3 löst eine Genitalinfektion aus, die<br />
auch als Equines Herpesexanthem, Equines Koitalexanthem<br />
(ECE), Deckexanthem oder Bläschenausschlag bzw.<br />
Mosaikausschlag bezeichnet wird. Die Übertragung erfolgt über<br />
den Deckakt. Symptome sind gerötete, vermehrt durchblutete<br />
Scheidenschleimhaut, stecknadelkopf- bis erbsengroße<br />
Bläschen, Pusteln oder Erosionen des Scheidenvorhofs bzw.<br />
des Penis oder der Vorhaut.
Wegen der Vollständigkeit werden alle Formen kurz<br />
angeschnitten, der Schwerpunkt wurde jedoch auf die drei<br />
zuerst genannten gelegt, auf die sich auch die nachfolgenden<br />
Abschnitte beziehen.<br />
Herpes-Testmethoden für Pferde<br />
Die Diagnose wird aufgrund der klinischen Symptome zunächst<br />
als Verdachtsdiagnose gestellt. Um den Verdacht zu<br />
untermauern, sollte ein direkter und indirekter Virusnachweis<br />
erfolgen. Bei dem direkten Nachweis wird der Virus selbst, das<br />
Antigen nachgewiesen, bei dem indirekten Nachweis werden<br />
die gegen das Virus gerichteten Antikörper nachgewiesen.<br />
Für den direkten Virusnachweis wird von dem klinische<br />
Symptome zeigenden Patienten ein Tupfer der<br />
Nüsternschleimhaut entnommen. Die Probe wird mittels einer<br />
sog. PCR (Polymerase Kettenreaktion) untersucht und für eine<br />
Zellkultur zum direkten Virusnachweis verwendet. Diese<br />
Untersuchungsmethode dauert mehrere Tage, und es ist nicht<br />
immer der Nachweis des Virus möglich. Das bedeutet, dass ein<br />
positiver Test (Virus konnte nachgewiesen werden) eine<br />
eindeutige Aussage beinhaltet (Virus liegt vor), ein negativer<br />
Test (Virus konnte nicht nachgewiesen werden) jedoch eine<br />
Herpesinfektion nicht völlig ausschließt.<br />
Zusätzlich sollte parallel ein indirekter Virusnachweis über den<br />
Nachweis von Antikörpern gegen Herpesviren im Blut des<br />
Patienten durchgeführt werden. Für den Virusneutralisationstest<br />
werden Serumproben gewonnen. Es wird ein sogenanntes<br />
Serumpaar untersucht. Das bedeutet, dass eine Blutprobe zu<br />
Krankheitsbeginn und eine zweite 14 Tage später untersucht<br />
werden. Da Herpesviren unter der Pferdepopulation wie bereits<br />
anfangs erwähnt weit verbreitet sind, ist in der Regel immer ein<br />
Antikörpergehalt nachzuweisen. Hinzu kommt, dass ein<br />
aufgrund einer Impfung erworbener Antikörpertiter nicht von<br />
einem aufgrund einer Feldinfektion entstandenen Antikörpertiter
zu unterscheiden ist, da es keinen sog. Markerimpfstoff gegen<br />
Herpesviren gibt. Sinn dieser Untersuchung besteht daher<br />
darin, aufgrund der zweiten Probe einen signifikanten Anstieg<br />
des Herpestiters nachzuweisen, der dann zeigt, dass der<br />
betroffene Patient sich aktuell mit dem Erreger<br />
auseinandersetzt und neue Antikörper gebildet hat. Bei<br />
Krankheitssymptomen steigt der Antikörpertiter in der Regel<br />
deutlich an. Da bei der paretischen-paralytischen Verlaufsform<br />
der Titer in kurzer Zeit sehr schnell und hoch ansteigt, ist bei<br />
dieser Form der Herpesinfektion eine mehrmalige Gewinnung<br />
von Serumproben in 2-4 tägigen Abständen zu empfehlen.<br />
Bei grenzwertigen Ergebnissen sollte die Diagnostik andere<br />
Erkrankungen nicht ausschließen<br />
Eine Sektion ist bei abortierten Fohlen, verendeten oder<br />
euthanasierten Pferden anzuraten, um einen direkten<br />
Virusnachweis aus Blut, Sekreten oder Gehirnflüssigkeit<br />
vornehmen zu können.<br />
Quarantäne<br />
Aufgrund der Tröpfcheninfektion und der horizontalen<br />
Übertragung des Virus von Pferd zu Pferd muss bei Verdacht<br />
auf Herpes das betroffene Pferd oder der entsprechende<br />
Stalltrakt sofort isoliert werden. Wenn es der Personalschlüssel<br />
zulässt, ist es empfehlenswert, dass die Personen, die die<br />
isolierten Pferde versorgen, nicht die Stallungen mit gesunden<br />
Tieren betreten. Hygienemaßnahmen sind unbedingt<br />
einzuhalten, um die Gefahr der Verbreitung des Erregers zu<br />
minimieren. Es sollte daher Schutzkleidung beim Umgang mit<br />
erkrankten oder verdächtigen Tieren getragen werden, nach<br />
dem Verlassen der Tiere sollten die Hände gewaschen u.<br />
desinfiziert werden. Ein Wechseln der Schuhe oder<br />
Desinfizieren ist anzuraten. Arbeitsgeräte im Umgang mit den<br />
isolierten Pferden sollten im entsprechenden Stalltrakt
verbleiben. Die Quarantäne bleit bis drei Wochen nach dem<br />
Auftreten der letzten Krankheitssymptome bestehen. Der<br />
Isolationsbereich sollte anschließend gründlich gereinigt und<br />
desinfiziert werden, da sich das Virus auch außerhalb seines<br />
Wirtes ansteckungsfähig bleibt und mehrere Monate<br />
nachweisbar ist. Die Reinigung und Desinfektion von Putzzeug<br />
und Arbeitsgeräten ist anzuraten.<br />
Therapie<br />
Eine spezifische antivirale Therapie, bei der das Virus selbst<br />
„bekämpft“ wird, gibt bei Herpeserkrankungen nicht. Somit<br />
können die betroffenen Pferde nur symptomatisch therapiert<br />
werden. Im Vordergrund der Behandlung steht die<br />
Unterstützung des körpereigenen Abwehrsystems. Somit ist<br />
eine gute Haltung und Fütterung sowie Schonung der<br />
betroffenen und verdächtigen Patienten von großer Wichtigkeit.<br />
Es können sog. Paraimmunitätsinducer (z. B. Zylexis®, früher<br />
Baypamun®) oder entsprechende Futterzusatzmittel eingesetzt<br />
werden. Je nach aufgetretenen Symptomen kommen<br />
entzündungshemmende Präparate (NSAIDs, Kortison) und<br />
kreislaufunterstützende Maßnahmen (Infusionen) zum Einsatz.<br />
Beim Auftreten bakterieller Sekundärinfektionen werden<br />
Antibiotika eingesetzt. Sinnvoll ist es, erst eine bakterielle<br />
Untersuchung durchzuführen, um den vorhandenen Keim zu<br />
isolieren und mit Hilfe eines Antibiogramms ein Antibiotikum<br />
auszuwählen, für das das aufgetretene Bakterium sensibel ist.<br />
Bei der paretisch-paralytischen Verlaufsform werden B-<br />
Vitamine und gerinnungsfördernde Medikamente empfohlen.<br />
Aus der Humanmedizin wird auch ein Virostatikum (Aciclovir)<br />
eingesetzt, dass die Vermehrung des Virus hemmen soll. Eine<br />
„Notimpfung“ ist kritisch zu sehen, da sie bei vorhandenen<br />
Symptomen zur Verschlechterung des Krankheitsgeschehens<br />
führen kann.
Prophylaxe<br />
Das Allgemeinbefinden des Pferdes soll gefördert werden<br />
durch eine gute Haltung und Fütterung. Da Stress eine wichtige<br />
Rolle bei der Erkrankung mit Herpesviren spielt, ist eine<br />
Reduktion stressfördernder Faktoren sehr wichtig. Dazu<br />
gehören beispielsweise das Unterlassen unnötiger Transporte<br />
und der Konstitution des Pferdes angepasstes Training. Das<br />
Immunsystem sollte außerdem gestärkt werden, beispielsweise<br />
durch mehrmalige intramuskuläre Injektionen eines<br />
Paraimmunitätsinducers wie beispielsweise Zylexis® oder die<br />
Zufütterung entsprechender Präparate. Vorbeugende<br />
regelmäßige Impfungen gegen Herpes sind sinnvoll. Hierauf<br />
wird im nachfolgenden Abschnitt Impfungen näher<br />
eingegangen.<br />
Sollten neue Tiere eingestallt werden, sind diese zunächst<br />
unter Quarantäne zu stellen, um sicher zu stellen, dass keine<br />
Krankheitssymptome auftreten.<br />
Ställe, in denen erkrankte Pferde aufgetreten sind, sind zu<br />
meiden, um eine direkte oder indirekte Verbreitung des<br />
Erregers zu vermeiden.<br />
Impfung (Vakzinierung)<br />
Wichtigstes Bekämpfungsmittel gegen Herpeserkrankungen<br />
stellt die vorbeugende Impfung dar. Durch eine Impfung wird<br />
die Bildung von gegen EHV-1 und EHV-4 gerichtete Antikörper<br />
induziert. Die Impfung schützt das geimpfte Pferd nicht vor<br />
einer Infektion und einer daraus resultierenden Erkrankung,<br />
doch der Verlauf ist in der Regel nicht so drastisch und<br />
Virusaborte treten kaum auf. Geimpfte Pferde scheiden<br />
außerdem bei einer Neuinfektion oder Reaktivierung des<br />
latenten Virus nur ca. 10% des Virus aus im Vergleich zu einem<br />
nicht geimpften Pferd. Durch die deutliche Reduktion der<br />
Virusausscheidung wird das Feldvirus minimiert. Der
Infektionsdruck wird auf diese Weise entscheidend gesenkt. Es<br />
ist sinnvoll, den gesamten Bestand zu impfen.<br />
Momentan existieren nur gegen EHV-1 und EHV-4 Impfstoffe,<br />
die als Lebend- und Totimpfstoff verfügbar sind. Der attentuierte<br />
Lebendimpfstoff Prevaccinol® enthält abgeschwächtes, noch<br />
vermehrungsfähiges EHV-1 ,die inaktivierten Impfstoffe<br />
Resequin NN plus® (Kombinationsimpfstoff gegen Herpes und<br />
Influenza) und Duvaxyn EHV1,4® führen zur Antikörperbildung<br />
gegen Herpesvirus 1 und 4. In der Regel werden sogenannte<br />
inaktivierte Impfstoffe eingesetzt. Geimpft werden können<br />
Fohlen ab einem Lebensalter von 5 Monaten, wenn bekannt ist,<br />
dass die Mutterstute NICHT gegen Herpes geimpft worden ist.<br />
Fohlen geimpfter Mutterstuten sollten erst ab dem 8.<br />
Lebensmonat erstmalig geimpft werden. Ein zu frühes Impfen<br />
in Gegenwart mütterlicher, passiv über das Kolostrum<br />
erhaltener, homologer Antikörper führt zu Wechselwirkungen<br />
mit den maternalen Antikörpern und einer Unterdrückung der<br />
Immunreaktion. Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei<br />
Impfungen im Abstand von 4-8 Wochen und einer dritten<br />
Impfung nach 6 Monaten. Die nachfolgenden<br />
Wiederholungsimpfungen finden alle 6 Monate statt.<br />
Trächtige Stuten sollten dreimalig während der Trächtigkeit (4.,<br />
6., 8. Trächtigkeitsmonat) mit Duvaxyn 1,4 geimpft werden.<br />
Früher wurde meist Prevaccinol im 3./4. Trächtigkeitsmonat und<br />
7./8. Trächtigkeitsmonat eingesetzt. Die Impfungen trächtiger<br />
Stuten sollen einem Virusabort vorbeugen und den<br />
heranwachsenden Embryo vor einer Herpesinfektion schützen.<br />
Die von der Stute aufgrund der Impfungen produzierten<br />
Antikörper werden außerdem in die Kolostralmilch<br />
abgegebenen und von dem neugeborenen Fohlen mit dem<br />
Kolostrum aufgenommen. Das Fohlen einer gut geimpften<br />
Mutterstute erhält somit eine passive Immunität, die es bei<br />
ausreichender Kolostrumaufnahme in den ersten<br />
Lebensmonaten schützt.
Es ist auf die Impffähigkeit des Pferdes zum Impftermin zu<br />
achten. Es sollte nach Möglichkeit vorher entwurmt worden und<br />
unbedingt frei von Infektionsanzeichen sein. Nach der Impfung<br />
sollte das Pferd 2-3 Tage geschont werden, eine völlige<br />
Boxenruhe ist normalerweise nicht erforderlich. Kurz vor einem<br />
Wettkampf sollte keine Impfung erfolgen.