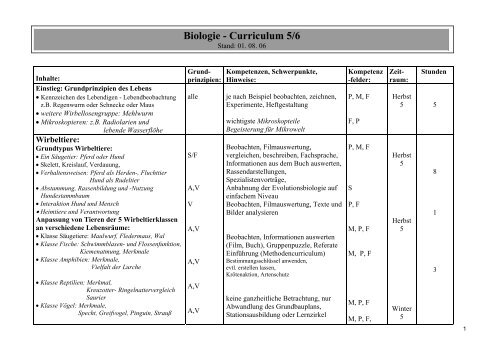Biologie - Curriculum 5/6
Biologie - Curriculum 5/6
Biologie - Curriculum 5/6
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalte:<br />
Einstieg: Grundprinzipien des Lebens<br />
Kennzeichen des Lebendigen - Lebendbeobachtung<br />
z.B. Regenwurm oder Schnecke oder Maus<br />
weitere Wirbellosengruppe: Mehlwurm<br />
Mikroskopieren: z.B. Radiolarien und<br />
lebende Wasserflöhe<br />
Wirbeltiere:<br />
Grundtypus Wirbeltiere:<br />
Ein Säugetier: Pferd oder Hund<br />
Skelett, Kreislauf, Verdauung,<br />
Verhaltensweisen: Pferd als Herden-, Fluchttier<br />
Hund als Rudeltier<br />
Abstammung, Rassenbildung und -Nutzung<br />
Hundestammbaum<br />
Interaktion Hund und Mensch<br />
Heimtiere und Verantwortung<br />
Anpassung von Tieren der 5 Wirbeltierklassen<br />
an verschiedene Lebensräume:<br />
Klasse Säugetiere: Maulwurf, Fledermaus, Wal<br />
Klasse Fische: Schwimmblasen- und Flossenfunktion,<br />
Kiemenatmung, Merkmale<br />
Klasse Amphibien: Merkmale,<br />
Vielfalt der Lurche<br />
Klasse Reptilien: Merkmal,<br />
Kreuzotter- Ringelnattervergleich<br />
Saurier<br />
Klasse Vögel: Merkmale,<br />
Specht, Greifvogel, Pinguin, Strauß<br />
<strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 5/6<br />
Stand: 01. 08. 06<br />
Grund-<br />
prinzipien:<br />
alle<br />
S/F<br />
A,V<br />
V<br />
A,V<br />
A,V<br />
A,V<br />
A,V<br />
Kompetenzen, Schwerpunkte,<br />
Hinweise:<br />
je nach Beispiel beobachten, zeichnen,<br />
Experimente, Heftgestaltung<br />
wichtigste Mikroskopteile<br />
Begeisterung für Mikrowelt<br />
Beobachten, Filmauswertung,<br />
vergleichen, beschreiben, Fachsprache,<br />
Informationen aus dem Buch auswerten,<br />
Rassendarstellungen,<br />
Spezialistenvorträge,<br />
Anbahnung der Evolutionsbiologie auf<br />
einfachem Niveau<br />
Beobachten, Filmauswertung, Texte und<br />
Bilder analysieren<br />
Beobachten, Informationen auswerten<br />
(Film, Buch), Gruppenpuzzle, Referate<br />
Einführung (Methodencurriculum)<br />
Bestimmungsschlüssel anwenden,<br />
evtl. erstellen lassen,<br />
Krötenaktion, Artenschutz<br />
keine ganzheitliche Betrachtung, nur<br />
Abwandlung des Grundbauplans,<br />
Stationsausbildung oder Lernzirkel<br />
Kompetenz<br />
-felder:<br />
P, M, F<br />
F, P<br />
P, M, F<br />
S<br />
P, F<br />
M, P, F<br />
M, P, F<br />
M, P, F<br />
M, P, F,<br />
Zeitraum:<br />
Herbst<br />
5<br />
Herbst<br />
5<br />
Herbst<br />
5<br />
Winter<br />
5<br />
Stunden<br />
5<br />
8<br />
1<br />
3<br />
1
Verhalten bei Wirbeltieren:<br />
Eichhörnchen-Nussknacken: angeb. und erlernt<br />
Prägung bei Vögeln<br />
Lernen lernen: Vorbereitung von Klassenarbeiten<br />
(Terminkontrolle, Lernstoffeinteilung<br />
.. Lerntechnik)<br />
Fortpflanzung im Vergleich:<br />
Abhängigkeit bzw. Loslösen vom Wasser<br />
Entwicklungsstufen: Fisch, Amphib, Reptil,<br />
Vogel<br />
Fortpflanzung beim Menschen, Pubertät<br />
(Geschlechtsorgane, Zeugung, Schwangerschaft,<br />
Geburt, Schwangerschafts- und Pubertätsproblematik)<br />
Grundtypus Wirbeltier im Vergleich mit<br />
anderen Klassen:<br />
Bauplan, Bewegung, Nahrung, Atmung,<br />
Fortpflanzung bei je einem typischen Vertreter<br />
der 5 Klassen: Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel,<br />
Säugetiere (hier Mensch)<br />
Überwinterung:<br />
Wechselwarme Gleichwarme:<br />
Überwinterung: Isolation, Energiespeicher,<br />
Winterstarre, Winterruhe<br />
Winterschlaf<br />
Überwinterung bei Vögeln: Standvögel,<br />
Zugvögel und Zugstrecken<br />
Überwinterung bei Pflanzen: Scharbockskraut<br />
Die Lebensweise der Pflanzen<br />
Pflanzen wachsen und gedeihen:<br />
Keimung und Wachstum<br />
Von der Blüte zur Frucht:<br />
Blütenbau, Bestäubung, Befruchtung,<br />
z.B. bei der Kirsche<br />
W<br />
R,A<br />
S/F<br />
R,W<br />
I/K<br />
A,<br />
R<br />
W<br />
V<br />
V,A<br />
S/F<br />
A, S/F<br />
R<br />
Beobachten, Filmauswertung,<br />
Texte und Bilder analysieren<br />
Kuckuckfilm<br />
Strategien entwickeln helfen<br />
(Methodencurriculum<br />
Versuch mit Gries-Ei, Anbahnung<br />
evolutionsbiologischer Sachverhalte,<br />
Film- Bild- Textauswertung, Lernzirkel<br />
Keine Empfängnisverhütung<br />
Film- Bild- Textauswertung<br />
Vergleichen, strukturieren, Fachsprache<br />
Diagramme auswerten,<br />
Experimente, ev. Internetrecherche<br />
Computeranwendung,<br />
Satellitenbilder auswerten<br />
Untersuchung am lebenden Objekt,<br />
Stärkenachweis<br />
Experimente, Protokolle, Diagramme<br />
Gebrauch der Lupen, Stereolupen,<br />
P, F<br />
F, M<br />
M<br />
P<br />
F, M<br />
S<br />
F<br />
M, P, S<br />
M, P, S,.F<br />
P<br />
M, P, S<br />
M, P, S<br />
Winter<br />
5<br />
Frühj.<br />
5<br />
Sommer<br />
5<br />
Herbst<br />
6<br />
Winter<br />
6<br />
Frühj.<br />
6<br />
Frühj.<br />
6<br />
3<br />
2<br />
6<br />
6<br />
5<br />
3<br />
3<br />
2
Vielfalt bei Blütenpflanzen:<br />
Pflanzen ausgewählter Familien: Rosengewächse,<br />
Kreuz- und Schmetterlingsblütler bestimmen<br />
charakteristische Merkmale zur Einordnung<br />
kennenlernen<br />
Bäume und Sträucher<br />
Blattsammlung einheimischer Bäume und<br />
Sträucher<br />
Leitbündel-Fertigpräparate<br />
Verbreitung von Samen und Früchten<br />
Nutztiere und Nutzpflanzen<br />
Nutztiere<br />
Wildschwein und Hausschwein<br />
alternativ: Legehennenhaltung<br />
Nutzpflanzen<br />
Getreide, Kartoffel oder Zuckerrübe<br />
Weinrebe<br />
Wirbellose Tiere:<br />
Grundtypus Insekt:<br />
Bau des Insektenkörpers<br />
Bienenkörper im Vergleich mit Wirbeltier<br />
Überblick Gliederfüßler (Spinne, Krebs)<br />
Staatenbildung<br />
Organisation des Bienenstaats: Lebenslauf der<br />
Trachtbiene<br />
Bienensprache<br />
Fortpflanzung und vollkommene Entwicklung bei<br />
Bienen<br />
Unvollkommene Entwicklung bei Heuschrecken<br />
V<br />
alle<br />
V<br />
V<br />
S/F<br />
A,W<br />
A,W<br />
S/F, A<br />
R<br />
I/K<br />
P<br />
zeichnen<br />
Bestimmungsbuch benützen, Lerngang,<br />
Tabelle anlegen<br />
Freiarbeit (auch im Freien), Experimente<br />
Lerngang<br />
Mikroskopieren<br />
Experimente<br />
Achtung vor dem Leben entwickeln<br />
Exkursion auf Bauernhof, Wochenmarkt,<br />
Erdkunde<br />
vergleichen, strukturieren, Fachsprache<br />
Lebendbeobachtung, Bienen am<br />
Bienenstand, Rücksichtnahme am<br />
Bienenstand, Filmauswertung,<br />
Arbeitsblätter, Gruppenarbeit<br />
dto.<br />
Filmauswertung, Arbeitsblätter<br />
Filmauswertung<br />
Waben untersuchen<br />
Vergleichen, Bestimmungsschlüssel<br />
M, S, F<br />
P ,F<br />
M<br />
P, S<br />
P, F<br />
P<br />
F<br />
Ko<br />
L<br />
M, P, F<br />
M, F<br />
M, P, S<br />
Frühj.<br />
6<br />
Herbst<br />
6<br />
Winter<br />
6<br />
Winter<br />
6<br />
Frühj.<br />
6<br />
Frühj.<br />
6<br />
Frühj.<br />
6<br />
3<br />
3<br />
1<br />
2<br />
2<br />
3<br />
6<br />
2<br />
3
Wechselwirkung Insekt - Mensch:<br />
Biene als Honigmacher, Bestäuber, u.s.w.<br />
Nützling, Haustier, Imkerei<br />
Floh und evtl. Pest<br />
Anopheles und Malaria<br />
Die Vielfalt der Insekten:<br />
Gelbrandkäfer<br />
Vergleich von Atemtechniken weiterer<br />
Wasserinsekten<br />
Abwandlung der Beintypen als Anpassung an<br />
Lebensraum und Verhalten<br />
Weitere Wirbellose:<br />
Regenwurm: Bau und Verhalten<br />
Zecken mit FSME und Borreliose<br />
Schnecken: Bau und Lebensweise<br />
Naturschutz:<br />
Hecke oder Obstbaum als Lebensraum,<br />
oder Streuobstwiese<br />
W<br />
V/A<br />
V<br />
A<br />
L<br />
A, W<br />
W<br />
Beobachten, Experiment, Gruppenarbeit<br />
Expertenbefragung<br />
Zeitungsberichte, Filmauswertung<br />
Filmauswertung<br />
Gruppenarbeit, Experimente<br />
Vergleichen, Stereomikroskop<br />
Praktikum<br />
Impfinformation<br />
Praktikum<br />
Informationsbeschaffung,<br />
Freilandarbeit, beobachten,<br />
protokollieren<br />
Verantwortung für die Natur entwickeln<br />
F, P<br />
F, M<br />
S, P<br />
M<br />
P<br />
P<br />
Frühj.<br />
6<br />
Sommer<br />
6<br />
Sommer<br />
6<br />
Sommer<br />
6<br />
Wiederholung: Grundprinzipien des Lebens Vernetzung des Wissens Sommer<br />
6<br />
Grundprinzipien: Kompetenzfelder:<br />
A Angepasstheit M methodisch<br />
V Variabilität S sozial<br />
R Reproduktion Sch Schulcurriculum (kursiv geschriebene Inhalte)<br />
S/F Struktur/Funktion F fachliche Kompetenz<br />
AB aktueller Bezug P praktisch<br />
I/K Information und Kommunikation L lokaler Bezug<br />
W Wechselwirkung Ko Kooperation mit außerschulischen Institutionen<br />
3<br />
2<br />
6<br />
3<br />
1<br />
4
THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8 Stand: 1. 08. 06<br />
74 Stunden - Klassenarbeiten u.s.w. 65 Stunden/Schuljahr: 2/3 Kernbereich + 1/3 Schulbereich<br />
Übersicht<br />
2-stündig in Klasse 7,<br />
statt jeweils 1-stündig in Kasse 7 und 8<br />
Zelle: - lichtmikroskopischer Unterschied: tier. pflanzl. Zelle<br />
- Bedeutung von Zellkern und Chloroplasten<br />
- experimentelle Existenz der Zellmembran erschließen<br />
- Wachstum unter Zellteilungen<br />
Photosynthese:<br />
- qualitative und quantitative Experimente zum Gaswechsel und zur Stärkesynthese<br />
- Wortgleichung<br />
Mensch: Ernährung, Verdauung, Essstörungen<br />
Herz, Kreislauf<br />
Lungen- und Zellatmung<br />
Menstruation<br />
Empfängnisverhütung<br />
Pubertät<br />
Sucht<br />
Bakterien und Viren:<br />
- Verlauf einer Infektionskrankheit<br />
- Antikörperbedeutung bei der Immunantwort<br />
- Immunisierung als Krankheitsvorbeugung<br />
HIV: Gefahren und Schutzmöglichkeiten<br />
bisher, jetzt gestrichen<br />
Insekten bereits in Klasse 6 vorgezogen<br />
Spinnen,<br />
Krebse,<br />
Saprophyten,<br />
fleischfressende Pflanzen,<br />
Parasiten,<br />
Symbionten,<br />
Mycorrhiza,<br />
Flechten,<br />
Ökosystem<br />
Grundprinzipien: Kompetenzfelder:<br />
A Angepasstheit M methodisch<br />
V Variabilität S sozial<br />
R Reproduktion Sch Schulcurriculum<br />
S/F Struktur/Funktion F fachliche Kompetenz<br />
AB aktueller Bezug P praktisch<br />
I/K Information und Kommunikation L lokaler Bezug<br />
W Wechselwirkung Ko Kooperation mit außerschulischen Institutionen<br />
1
Inhalte: Grundprinzipien:<br />
I. Zelluläre Organisation der<br />
Lebewesen:<br />
1. Bau und Funktion des Lichtmikroskops<br />
S/F<br />
2. Pflanzenzellen:<br />
a) Küchenzwiebelzelle<br />
A, S/F<br />
b) Wasserpestblattzelle<br />
3. Tierische Zellen:<br />
a) Mundschleimhautzelle<br />
A, S/F<br />
b) Heuaufguss-Einzeller<br />
c) Blutzellen<br />
4. Zellteilungen<br />
5. Versuche zur Membranfunktion<br />
II. Wie beziehen Pflanzen Energie?<br />
1. Versuche von Priestley<br />
2. Bläschenzählmethode<br />
3a) Normale und panaschierte Blätter im Vergleich<br />
b) Blattfarbstoffe<br />
4. Blatt als Zucker-/Stärkefabrik<br />
Kartoffelknolle als Stärke-Langzeitspeicher<br />
5. Zellatmung bei Pflanze und Tier<br />
THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />
W<br />
R<br />
W<br />
Kompetenzen, Schwerpunkte, Hinweise: Kompetenzfelder:<br />
- Mikroskopieren<br />
- wissenschaftliches Zeichnen<br />
- einfache Färbetechnik<br />
- zellulärer Aufbau der Lebewesen<br />
- Pflanzenzelle ist nicht gleich Pflanzenzelle<br />
Tierzelle ist nicht gleich Tierzelle<br />
- Fertigpräparate<br />
- Wurzelspitzen der Küchenzwiebel/Hefezellen<br />
mikroskopieren<br />
- Entwicklung von der Zygote zum Embryo<br />
- Plasmolyse von Küchenzwiebelzellen unter<br />
mikroskopischer Kontrolle<br />
- Bild-/Textauswertung<br />
- Quantitative Erfassung der Sauerstoffbildung<br />
bei verschiedenen Licht-/CO2-Bedingungen<br />
- nur Chloroplasten führendes Gewebe ist zur<br />
Photosynthese fähig<br />
- Chromatographie<br />
- Stärkenachweis mit JJK<br />
in Blatt- und Speichergewebe<br />
- brennende Kerze als „Modell“<br />
- Während bei der Photosynthese Lichtenergie<br />
in chemisch gespeicherte Energie in Form von<br />
Kohlenhydraten gewandelt wird, kann mit der<br />
Zellatmung diese chemisch gespeicherte Energie<br />
freigesetzt werden und steht dann für Arbeiten<br />
der Zelle zur Verfügung.<br />
M<br />
M, P<br />
Sch<br />
P, M<br />
Sch<br />
P, M<br />
M,P<br />
F<br />
Sch<br />
M, P<br />
M,P<br />
Zeitraum:<br />
Herbst<br />
Herbst<br />
Stunden:<br />
8<br />
6<br />
2
Inhalte: Grundprinzipien:<br />
III. Körperbau des Menschen:<br />
1. Verdauung<br />
a) Mund mit Zähnen und Enzym,<br />
Speiseröhre u.s.w.<br />
S/F<br />
b) Verdauungsexperimente<br />
Gallensaft- und Enzymwirkung<br />
2a) Gesunde/einseitige Ernährung<br />
b) Welthunger-Problem<br />
c) Essstörungen<<br />
3. Wortgleichung der Zellatmung - innere Atmung<br />
4. Lungenatmung - äußere Atmung<br />
5a) Blutkreislauf<br />
b) Erste Hilfe bei Gefäßverletzungen<br />
6a) Blut<br />
b) Blutgerinnung<br />
IV Sexualität des Menschen:<br />
1. Menstruationszyklus<br />
2. Empfängnisverhütung<br />
3. Pubertät<br />
THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />
S/F<br />
S/F<br />
S/F<br />
R<br />
W<br />
Kompetenzen, Schwerpunkte, Hinweise: Kompetenzfelder:<br />
- Organe und ihre Funktion<br />
- Zahnhygiene<br />
- Oberflächenvergrößerungsprinzip<br />
- Fehling, JJk, Sudan III (Lehrerversuche)<br />
- Nahrungsmittel und ihre Inhaltsstoffe<br />
im Hinblick auf eine gesunde<br />
Ernährung beurteilen<br />
- Bedeutung der Kohlenhydrate im<br />
Energiestoffwechsel<br />
- Lungenaufbau, Atemvolumen,<br />
Bedeutung der Atemmuskulaturen<br />
- Oberflächenvergrößerungsprinzip<br />
- Herz als Saug-Druckpumpe,<br />
- großer und kleiner Blutkreislauf<br />
- Transportsystem, flüssiges Gewebe<br />
- Blutgruppen, Bluttransfusionen<br />
Geschlechtsorgane Wiederholung aus Kl. 6<br />
- Bilder entsprechend den Buchvorlagen<br />
- Hypophyse FSH, Eierstock Östrogen<br />
Sch<br />
M, P<br />
Sch<br />
Ko, S<br />
F<br />
F<br />
F<br />
F<br />
Sch<br />
F<br />
S<br />
Zeitraum: Stunden:<br />
Winter<br />
Frühjahr<br />
20<br />
6<br />
3
Inhalte: Grundprinzipien:<br />
V. Sucht:<br />
1. Legale Drogen<br />
a) Rauchen<br />
b) Alkohol<br />
c) Medikamenten-Missbrauch<br />
2. Illegale Drogen<br />
I/K<br />
a) klassische und Ecstasy<br />
b) Drogenkonsum Kriminalität/AIDS-Risiko<br />
VI. Bakterien und Viren<br />
1. Tabelle<br />
2. Aufbau von Bakterie und Virus im Vergleich<br />
3. Bakterien-Beispiele: Cholera-B., Borreliose-B. S/F<br />
4. Viren-Beispiele: Grippe-V., FSME-V.<br />
5. Immunreaktionen<br />
a) Spezifische Immunabwehr<br />
b) Immunisierungen<br />
c) Fehlreaktionen des Immunsystems<br />
6. Pilze als Antibiotika-Lieferanten<br />
5. HIV<br />
a) Krankheitsbild<br />
b) Risikogruppen<br />
c) HIV-Test<br />
d) Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensweisen<br />
THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />
I/K<br />
Kompetenzen, Schwerpunkte,<br />
Hinweise:<br />
Waschflaschen-Versuch<br />
Alkopops<br />
Doping<br />
Kontakt mit Suchtpräventationslehrer<br />
Übersichtstabelle:<br />
Bakterielle und virale Infektionskrankheiten<br />
Borreliose und FSME aufgrund lokaler<br />
Vorkommen<br />
- Antikörper und Gedächtniszellen<br />
- Jenners Experimente mit Kuhpocken,<br />
- aktive und passive Immunisierung<br />
- Allergien<br />
- Penicilline Breitbandantibiotika<br />
- Probleme durch häufigen Einsatz, durch Einsatz<br />
zur Vorbeugung und bei Tierfutter<br />
- AIDS<br />
- diagnostische Lücke bis 12 Wochen beim<br />
indirekten Nachweis von HIV über Antikörper<br />
- Safer Sex<br />
Kompetenzfelder:<br />
Ko<br />
Sch<br />
F<br />
L<br />
F<br />
Sch<br />
Sch<br />
Sch<br />
Ko<br />
Zeitraum:<br />
Frühjahr<br />
Sommer<br />
Stunden:<br />
12<br />
13<br />
4
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
Kerncurriculum im Fach <strong>Biologie</strong> Klasse 9 / 10 (Stand Juli 2008)<br />
Allgemeines:<br />
1.) Stufenspezifische Hinweise:<br />
Am Ende der Klasse 10 haben die SchülerInnen die Fähigkeiten, auf der Grundlage ihres<br />
biologischen Basiswissens eigene Meinungen zu bilden und verantwortlich zu handeln.<br />
Das Verständnis der Lebensphänomene durch Betrachtungen auf zellulärer und modellhaft<br />
sowie auf molekularer Ebene unter Einbeziehung von grundlegenden naturwissenschaftlichen<br />
Fragestellungen wie Energieumwandlung oder Umweltschutz wird vertieft.<br />
Die Zusammenarbeit mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern ist dafür notwendig.<br />
Medizinische und genetische Kenntnisse bilden eine Voraussetzung für eine bewusste<br />
Lebensführung.<br />
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Verantwortung gegenüber sich selbst, den<br />
Mitmenschen und der Umwelt.<br />
2.) Grundlegende biologische Prinzipien wie:<br />
Struktur und Funktion<br />
Zelluläre Organisation<br />
Energieumwandlung<br />
Regulation<br />
Information und Kommunikation<br />
Reproduktion<br />
Variabilität<br />
Wechselwirkung zwischen Lebewesen<br />
dienen zur Analyse und Erklärung biologischer Phänomene und bilden den „Roten Faden“ bei der<br />
Behandlung der relevanten Themen.<br />
3.) Schulcurriculum:<br />
4.) Stundenzahlen:<br />
„Schüler- und praxisbezogene Methoden“<br />
36 Unterrichtswochen pro Schuljahr –> Klasse 9 36 Std.<br />
Klasse 10 72 Std.<br />
Summe: 108 Std.<br />
- 1 -
Übersicht<br />
Thema<br />
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
Kerncurriculum (Entwurf)<br />
Klasse 9 Klasse 10<br />
Richtstundenzahl <br />
Kerncurr. <br />
Schulcurr.<br />
Zelluläre Organisation 8 3<br />
Körper des Menschen –<br />
Nerven- und Hormonsystem<br />
15 5<br />
- 2 -<br />
Thema<br />
Ökosysteme I<br />
(aus Curicculum 9)<br />
Ökosysteme II<br />
(<strong>Curriculum</strong> 10)<br />
Richtstundenzahl <br />
Kerncurr. <br />
Schulcurr.<br />
4 2<br />
18 6<br />
Reproduktion und Vererbung 28 8<br />
Puffer 5 Puffer 6<br />
Summe: 36 72
Kerncurriculum<br />
Zelluläre Organisation der Lebewesen<br />
Präparate verschiedener Zelltypen<br />
herstellen und analysieren<br />
den Ablauf der Mitose beschreiben und ihre<br />
Bedeutung erläutern<br />
mikroskopische Präparate von<br />
Mitosestadien herstellen und analysieren<br />
Zelldifferenzierung als Grundlage für die<br />
Gewebe- und Organbildung beschreiben<br />
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
Bildungsplan - Klasse 9<br />
Std.<br />
11<br />
4<br />
3<br />
2<br />
2<br />
- 3 -<br />
didakt.-method. Hinweise<br />
Wdh. Zellorganellen<br />
Keine Verwendung von Rasierklingen!<br />
diploider Chromosomensatz<br />
Mitosestadien benenne<br />
z.B. Wurzelspitze Zwiebel<br />
Organisationsstufen Zelle <br />
Gewebe … Organismus<br />
Schulcurriculum<br />
Chromosomenmodell<br />
Stammzellen,<br />
Differenzeirungsstörungen<br />
(z.B. Krebs)
Der Körper des Menschen und seine<br />
Gesunderhaltung<br />
(Die Schülerinnen und Schüler werden auf Grund ihres<br />
Wissens über Bau und Funktion des menschlichen<br />
Organismus befähigt, ihr eigenes Verhalten in Hinblick auf<br />
eine gesunde Lebensführung zu reflektieren.)<br />
Nervensystem<br />
die Sinnesorgane des Menschen im<br />
Überblick beschreiben<br />
den Aufbau des Auges beschreiben und<br />
den Zusammenhang zwischen Bau und<br />
Funktion erläutern<br />
ein Wirbeltierauge präparieren<br />
Experimente zur Funktion des Auges<br />
durchführen und auswerten<br />
das Wirkungsprinzip der Sinneszellen als<br />
Signalwandler beschreiben<br />
wissen, dass Reize in elektrische Signale<br />
umgewandelt werden, die zum Zentralnervensystem<br />
weitergeleitet und dort<br />
verarbeitet werden<br />
den Bau des Nervensystems im Überblick<br />
und die grundlegende Bedeutung des<br />
peripheren, des zentralen und des<br />
vegetativen Nervensystems beschreiben.<br />
Hormonsystem<br />
das Hormonsystem des Menschen im<br />
Überblick beschreiben und das<br />
Wirkungsprinzip der Hormone modellhaft<br />
erklären.<br />
das Regelungsprinzip der Hormone über<br />
fördernde und hemmende Wirkungen<br />
erklären und auf die Blutzuckerregulation<br />
anwenden.<br />
die grundlegende Bedeutung des Hormon-<br />
und Nervensystems für Steuerung und<br />
Regelung im Organismus erläutern und<br />
erklären, wie Störungen zu Krankheiten<br />
führen.<br />
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
20<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
4<br />
4<br />
1<br />
1<br />
2<br />
- 4 -<br />
Schweineauge<br />
Sehwahrnehmung, Blinder<br />
Fleck, opt. Täuschung<br />
z.B. Fkt. der Stäbchen im<br />
Überblick<br />
Bau und Fkt. Neuron,<br />
Synapse,<br />
Bau Gehirn im Überblick<br />
Gehirn, Rückenmark,<br />
Motorische und sensorische<br />
Nerven<br />
Hormondrüsen<br />
Regelkreislauf<br />
z.B. Schilddrüse<br />
experimenteller Zugang<br />
ein weiteres<br />
Sinnesorgan<br />
Reflexe<br />
umfassende<br />
Betrachtungen zu<br />
Diabetes
Ökosysteme I<br />
Kerncurriculum<br />
ein schulnahes Ökosystem erkunden und<br />
wichtige Daten erfassen.<br />
die Wechselwirkung zwischen Lebewesen eines<br />
Ökosystems anhand von Nahrungsketten und<br />
Nahrungsnetzen darstellen und den Energiefluss<br />
erläutern<br />
Ökosysteme II<br />
Die Schülerinnen und Schüler haben auf der Grundlage<br />
ihres ökologischen Wissens und der in anderen Fächern<br />
erworbenen Kenntnisse ein Bewusstsein entwickelt, dass<br />
nachhaltiger Umweltschutz eine wesentliche globale<br />
Aufgabe ist (Agenda 21)<br />
mit ihrem Wissen über Fotosynthese und<br />
Zellatmung die Bedeutung der<br />
Energieumwandlung in einem Ökosystem<br />
erläutern.<br />
an Beispielen erläutern, dass sich die<br />
Stabilität eines Ökosystems aus dem<br />
Zusammenwirken vieler Faktoren ergibt<br />
und dass Eingriffe bei einzelnen Faktoren<br />
weitreichende und unerwartete Folgen<br />
haben können.<br />
Ursachen für das Aussterben von<br />
Lebewesen an Beispielen erläutern<br />
Reproduktion und Vererbung<br />
Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass eine gezielte<br />
Veränderung der Erbinformation möglich ist. Sie erkennen<br />
Nutzen und Risiken dieser Eingriffe.<br />
die Bedeutung des Zellkerns und der<br />
Chromosomen für die Vererbung erklären.<br />
Mitose und Meiose hinsichtlich Ablauf und<br />
Bedeutung vergleichen.<br />
die MENDELschen Regeln auf einfache<br />
Erbgänge und zur Stammbaumanalyse<br />
anwenden.<br />
den Aufbau der Proteine mit einem<br />
einfachen Modell beschreiben und die<br />
Bedeutung der Proteine als Wirk- und<br />
Bausubstanzen im Organismus erklären<br />
den Aufbau der DNA mit einem einfachen<br />
Modell beschreiben<br />
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
Bildungsplan - Klasse 10<br />
Std.<br />
6<br />
3<br />
3<br />
24<br />
(18+6)<br />
8+3<br />
8+3<br />
2<br />
36<br />
(28+8)<br />
1<br />
3+2<br />
10<br />
2+2<br />
2<br />
- 5 -<br />
didakt.-method. Hinweise<br />
Temp.- und pH-Bestimmung,<br />
Lichtverhältnisse, Wasser,<br />
Artenkenntnise<br />
Räuber – Beute,<br />
Nahrungspyramide<br />
keine genaue Betrachtung der<br />
Elektronentransportkette<br />
biot. und abiot. Faktoren,<br />
Klimaregeln<br />
z.B. Wasserhaushalt von<br />
Pflanzen<br />
haploider Chromosomensatz<br />
1.-3. Mendel-Regel<br />
Dominant-rezessiv;<br />
intermediär; X-chromosomale<br />
Erbgänge<br />
AS-Sequenz;<br />
Struktur im Überblick<br />
Doppelhelix, Bausteine<br />
Schulcurriculum<br />
Experimenteller Zugang<br />
z.B. Blattquerschnitte,<br />
DC von Blattfarbstoffen<br />
genaue Betrachtung<br />
osmotischer Vorgänge,<br />
Meiosepräparate<br />
mikroskopieren;<br />
Meiosefehler und<br />
Folgen<br />
(z.B. DOWN-Syndrom)<br />
Enzymatik<br />
evtl. Praktikum: Isolation<br />
von DNA
wissen und verstehen, dass die<br />
Erbinformation auf der Basensequenz<br />
beruht und dass diese Basensequenz in<br />
spezifische Proteine übersetzt wird<br />
Mutation und Selektion als wichtige<br />
Evolutionsfaktoren erläutern können<br />
an Beispielen erläutern, dass<br />
Veränderungen der Erbsubstanz zu<br />
Erbkrankheiten führen können und<br />
die Bedeutung der genetischen Beratung<br />
kennen<br />
Nutzen und Risiken der Gentechnik<br />
THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />
2<br />
4<br />
4+2<br />
+2<br />
- 6 -<br />
Triplett-Code<br />
Mutagene;<br />
z.B. Sichelzellanämie,<br />
Birkenspanner<br />
z.B: Methoden Gendiagnostik;<br />
Dilemma-Diskussion<br />
pränatale Diagnostik<br />
einfache Betrachtung<br />
einer gentech. Methode;<br />
Chancen und Risiken