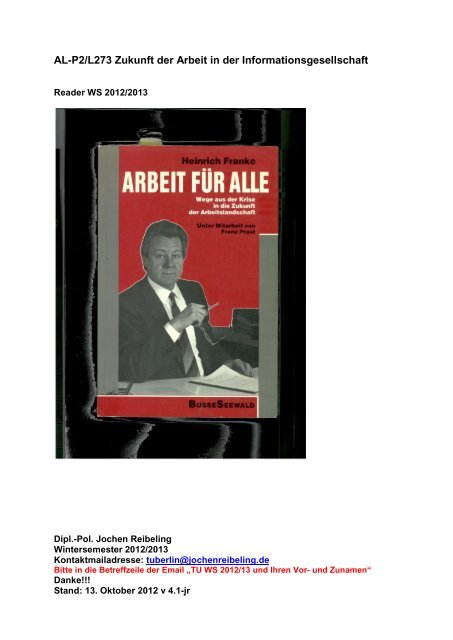Zukunftswerkstatt - Arbeit hat Zukunft
Zukunftswerkstatt - Arbeit hat Zukunft
Zukunftswerkstatt - Arbeit hat Zukunft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AL-P2/L273 <strong>Zukunft</strong> der <strong>Arbeit</strong> in der Informationsgesellschaft<br />
Reader WS 2012/2013<br />
Dipl.-Pol. Jochen Reibeling<br />
Wintersemester 2012/2013<br />
Kontaktmailadresse: tuberlin@jochenreibeling.de<br />
Bitte in die Betreffzeile der Email „TU WS 2012/13 und Ihren Vor- und Zunamen“<br />
Danke!!!<br />
Stand: 13. Oktober 2012 v 4.1-jr
Dipl.-Pol. Jochen Reibeling Wintersemester 2012/13<br />
AL-P2/L273 Die <strong>Zukunft</strong> der <strong>Arbeit</strong> in der Informationsgesellschaft<br />
Zeit: donnerstags, 14-16 Uhr c.t., (Beginn: 18.10.2012)<br />
Raum: FR 7528<br />
18. Oktober 2012 Organisation und Einführung<br />
25.Oktober 2012 Was ist des Menschen <strong>Arbeit</strong>? Versuch der Klärung<br />
eines Begriffs<br />
01. November 2012 Aktuelle Auseinandersetzungen mit dem Thema <strong>Arbeit</strong><br />
8. November 2012 Erwerbsarbeit im gesellschaftlichen Wandel<br />
15. November 2012 Von der Dienstleistungs- zur Informationsgesellschaft<br />
22. November 2012 Leben ohne Erwerbsarbeit – ALG II versus BGE<br />
29. November 2012 (Aus)Bildung für den (<strong>Arbeit</strong>s-)Markt<br />
6. Dezember 2012 (Um-)Wege in <strong>Arbeit</strong> – das duale System<br />
13. Dezember 2012 (Um-)Wege in <strong>Arbeit</strong> II – das Übergangssystem<br />
10. Januar 2013 Ausbilden für den Markt? Wie wichtig ist Bildung für die<br />
<strong>Arbeit</strong>swelt?<br />
17. Januar 2013 “Brain Waste“ – zur Situation von MigrantenInnen auf dem<br />
deutschen <strong>Arbeit</strong>smarkt<br />
24. Januar 2013 “Hier schaff ich selber, was ich einmal werde“<br />
Entwicklung einer <strong>Arbeit</strong>swelt für übermorgen I<br />
31. Januar 2013 “Hier schaff ich selber, was ich einmal werde“<br />
Entwicklung einer <strong>Arbeit</strong>swelt für übermorgen II<br />
07. Februar 2013 “Hier schaff ich selber, was ich einmal werde“<br />
Entwicklung einer <strong>Arbeit</strong>swelt für übermorgen III<br />
14. Februar 2013 Seminarresümee und –kritik<br />
Klärung von Fragen vorab via tuberlin@jochenreibeling.de
Scheinanforderungen<br />
1.Teilnahmeschein<br />
Aktive Teilnahme am Seminar ist ausdrücklich erwünscht. Das beinhaltet das Lesen<br />
der Texte genauso wie die Teilnahme an der Diskussion bzw. den weiteren<br />
Aktivitäten im Seminar. Auch wenn es wohl ab und an in der Sauna oder auf dem<br />
Weihnachtsmarkt schöner sein dürfte. Nutzen Sie die Zeit für Ihren Kopf und<br />
erweitern Sie gemeinsam mit der Seminargruppe Ihre Sichtweise.<br />
2. Leistungsschein<br />
Sie können sich auf zwei unterschiedlichen Wegen den begehrten<br />
Leistungsnachweis sichern.<br />
Weg a) 8-seitiges Essay, Kurzreferat (max. 8 Min.) und Kurzprotokoll (max. 2 Seiten)<br />
Weg b) 12-15-seitige „klassische“ Hausarbeit und Kurzprotokoll (max. 2 Seiten).<br />
Bevor Sie nun gedanklich die Messer wetzen, Ihre Nachtgebete künftig ohne meinen<br />
Namen beenden oder den Topf auf´s Feuer setzen – gemach, gemach.<br />
Ist nicht so schlimm. Sie bekommen das hin und kommen auch ins Freibad!<br />
Nun die knallharten Fakten für Weg a)<br />
Wie bereits erwähnt, 8 Seiten in max. Schriftgröße 12. Font beliebig, ohne Deckblatt<br />
gezählt. Literaturangaben fallen selbstverständlich auch raus. Zitationsregeln bitte<br />
nach Harvard.<br />
Inhaltlich stellen Sie bitte ein Buch oder einen Aufsatz vor und zeigen den<br />
Zusammenhang zum Seminarinhalt bzw. die Relevanz zu behandelten Themen auf.<br />
Sie erkennen dabei knallhart den Leitgedanken bzw. inhaltlichen Schwerpunkt des<br />
Autors/der Autorin und stellen diesen in unserer Alltagssprache dar.
Bitte stellen Sie im Anschluss daran Ihren eigenen Standpunkt dazu dar und<br />
begründen Sie diesen. Sollten Sie dabei irgendwo her eine „nette Idee“ finden, die Ihr<br />
Vorgehen unterstützt bzw. Ihnen die Denkleistung erleichtert- seien Sie so fair und<br />
gehen Sie würdigend darauf ein und nennen den/die wahren geistigen Urheber.<br />
Plagiate finde ich reizend- für meine Halsschlagader.<br />
Glaube nämlich, dass in diesem Seminar intelligente Menschen, die eine eigene<br />
Sicht auf die Themen des Seminars entwickeln können und auch wollen. Punkt<br />
Ideen für Ihr persönliches Essay können Sie anhand der Literaturliste des Seminars<br />
selbst entwickeln oder sich ganz eigenständig eine Quelle erschließen.<br />
Die einzusendende Datei benennen Sie bitte wie folgt:<br />
Angabe des Datums beginnend mit dem Jahr, dann Titel mit Unterstrich getrennt und<br />
anschließend Ihre um das @xyz.xx eingekürzte Emailadresse. Idealerweise<br />
verwandeln Sie das ganze dann noch in ein pdf-Dokument. MS-Office bzw.<br />
OpenOffice-Dateien nehme ich aber auch an.<br />
Es sollte dann so aussehen:<br />
„20090310_Meineschöneverschneite<strong>Zukunft</strong>_gisbertschenk.pdf/doc/odt“<br />
Macformate bekomme ich leider nicht ausgelesen.<br />
Es folgt der steinige Weg b)<br />
Wie bereits erwähnt, 12-15 Seiten in max. Schriftgröße 12. Font beliebig, ohne<br />
Deckblatt gezählt. Literaturangaben bzw. Gliederung fallen selbstverständlich auch<br />
raus. Zitationsregeln bitte nach Harvard.<br />
Inhaltlich setzen Sie sich mit dem Thema eines Seminartermins auseinander.<br />
D.h. mit dem Impulsreferat, der anschließenden Diskussion bzw. mit dem „Problem“<br />
an sich. Gern können Sie auch ein Thema nach Absprache in eigener Sichtweise<br />
bearbeiten.<br />
Meine Ausführungen zum Umgang mit „fremder Denkleistung“ gelten auch hier.<br />
Ebenso die Verfahrensweise zur Benennung der Datei.
Hinweis zur Abfassung der Kurzprotokolle<br />
Diese geben einen kurzen Überblick für die Fehlenden der protokollierten Sitzung<br />
bzw. erleichtern die Vorbereitung auf die kommende Sitzung.<br />
Sie nennen die Kernaussagen der Diskussion und ziehen –entgegen gängiger<br />
protokollarischer Praxis- ein eigenes Fazit. Wieso? Sie konnten schließlich nur in<br />
Teilen am Diskussionsprozess teilhaben- Ihre Meinung ist aber auch von Interesse!<br />
Die Nennung von Uhrzeiten der Begrüßung bzw. Verabschiedung ist nicht<br />
notwendig.<br />
Die einzusendende Datei benennen Sie bitte wie folgt:<br />
Angabe des Datums beginnend mit dem Jahr, dann Seminarthema(verständlich<br />
gekürzt!) mit Unterstrich getrennt und anschließend Ihre um das @xyz.xx<br />
eingekürzte Emailadresse. Idealerweise verwandeln Sie das ganze dann noch in ein<br />
pdf-Dokument. MS-Office bzw. OpenOffice-Dateien nehme ich aber auch an.<br />
Es sollte dann so aussehen:<br />
„20090310_Meineschöneverschneite<strong>Zukunft</strong>_gisbertschenk.pdf/doc/odt“<br />
Macformate bekomme ich leider nicht ausgelesen.<br />
Das Protokoll senden Sie mir bitte an die Seminaremailadresse bis Mittwoch 22:00<br />
Uhr (vor dem jeweiligen Seminarfolgetermin). Ich werde dieses dann für die<br />
Seminargruppe per Mail verteilen.<br />
Und? Immer noch so schlimm?<br />
:
Bewertungskriterien<br />
Fragestellung<br />
- Ist die Fragestellung klar formuliert?<br />
- Wurde die Relevanz der Fragestellung aufgezeigt?<br />
- Wurde die Fragestellung folgerichtig umgesetzt?<br />
- Handelte es sich um eine Fragestellung, die auch im Rahmen der Möglichen<br />
blieb?<br />
Struktur der <strong>Arbeit</strong><br />
- Ist die Gliederung angemessen tief und breit?<br />
- Ist die Anordnung von Kapiteln und Unterkapitel sinnvoll erfolgt?<br />
- Ist ein roter Faden erkennbar?<br />
Argumentation<br />
- Ist die Argumentation logisch?<br />
- sind „bewiesene“ Tatsachen und Meinungen klar gekennzeichnet?<br />
Literatur<br />
- Wurde genug Literatur verwendet?<br />
- Wurde zentrale Literatur verwendet?<br />
- Wurden unterschiedliche Literaturquellen verwendet (Monographien,<br />
Fachzeitschriften, …)<br />
- Welcher Grad der Verarbeitung von Literatur ist erkennbar?<br />
Form<br />
- Druckbild<br />
- Rechtschreibung<br />
- Satzbau und Formulierungen<br />
- Umgang mit Fachbegriffen<br />
Belegverfahren<br />
- Ist die Zitierweise formal richtig?<br />
- Ist das Literaturverzeichnis formal richtig und einheitlich?<br />
- Wurden alle Aussagen belegt? Stichwort Vollständigkeit?<br />
Quellenkritik<br />
- Wurden Fakten und Urteile unterschieden?
1. Vorbemerkungen<br />
Kurz-Leitfaden zum wissenschaftlichen <strong>Arbeit</strong>en<br />
im Fachgebiet <strong>Arbeit</strong>slehre Wirtschaft / Haushalt<br />
• Der vorliegende Leitfaden ist eine Zusammenfassung zu Formalitäten und Grundlagen<br />
des wissenschaftlichen <strong>Arbeit</strong>ens im Bereich <strong>Arbeit</strong>slehre Wirtschaft / Haushalt.<br />
• Die Vorgaben beziehen sich grundsätzlich auf verschiedene Typen der wissenschaftl. <strong>Arbeit</strong>en,<br />
d.h. Seminar- und Bachelorarbeiten aber auch Artikel für das <strong>Arbeit</strong>slehre-Wiki.<br />
• Zur Verdeutlichung der gewünschten praktischen Umsetzung des Leitfadens dient eine<br />
mit „sehr gut“ bewertete Seminararbeit, die ebenfalls als Download auf der Homepage<br />
des Fachgebiets zur Verfügung steht.<br />
• Die hier gegebenen Hinweise zur formalen Gestaltung haben – mit Ausnahme des Umfangs<br />
und der Formatierung – empfehlenden Charakter. So sind andere Zitierweisen<br />
und Formen der Literaturangaben möglich, sofern diese in der Wissenschaft anerkannt<br />
sind und in der <strong>Arbeit</strong> einheitlich Anwendung finden. Mangelnde Einheitlichkeit war in<br />
der Vergangenheit der häufigste formale Fehler in wissenschaftlichen <strong>Arbeit</strong>en.<br />
2. Umfang und Formatierung<br />
• Die maximale Textlänge für eine Bachelorarbeit beträgt 50 Seiten (+/- 5), für eine Seminararbeit<br />
10 Seiten pro Person (+/- 1), inklusive aller Abbildungen und Tabellen.<br />
• Zu verwenden ist einseitig beschriebenes DIN A 4 Papier (weiß bzw. Recycling-Papier).<br />
• Die Seitenränder betragen oben 2,5 cm, unten 2 cm, links 3,5 cm, rechts 1,5 cm.<br />
• Zu verwenden sind gängige Schriften (z.B. Times New Roman, Garamond, Calibri, Arial)<br />
• für den normalen Text in Schriftgröße 12 pt und Zeilenabstand 1,5 Zeilen, für den<br />
Fußnotentext in Schriftgröße 10 pt und Zeilenabstand einzeilig. Wörtliche Zitate, die<br />
sich über mehr als drei Zeilen erstrecken sind einzeilig niederzuschreiben.<br />
• Die Überschriften sind durch Fettdruck hervorzuheben. Ansonsten sind Hervorhebungen<br />
(fett oder kursiv) auf wenige sinnvolle Anwendungen zu begrenzen.<br />
• Silbentrennung und Blocksatz sind zu nutzen.<br />
• Bachelorarbeiten sind in doppelter, gebundener Ausführung abzugeben, Seminararbeiten<br />
als geheftetes und gelochtes Einzelexemplar (bitte keine Mappen o.ä. nutzen, da<br />
die <strong>Arbeit</strong>en als Prüfungsdokumente in Ordnern inventarisiert werden). Zusätzlich muss<br />
den <strong>Arbeit</strong>en eine digitalisierte Version der <strong>Arbeit</strong> (= pdf-Format) beigefügt werden.<br />
3. Aufbau der <strong>Arbeit</strong>, Seitennummerierung und Gliederung<br />
• Der Aufbau der <strong>Arbeit</strong> beinhaltet das Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis (= Gliederung<br />
mit Seitenangaben), den eigentlichen Text und das Literaturverzeichnis sowie ggf. einen<br />
Anhang für ergänzendes Material. Abkürzungs- und Tabellenverzeichnis sind bei Seminararbeiten<br />
entbehrlich.<br />
• Die übliche Seitennummerierung bei Hauarbeiten beginnt auf dem Inhaltsverzeichnis<br />
mit römisch II (Seite I ist das Deckblatt, auf dem jedoch keine Nummer steht). Die erste<br />
Textseite ist mit arabisch 1 zu nummerieren, danach erfolgt die Nummerierung fortlaufend.
• Beispiel für ein Deckblatt<br />
4 Literatur und Literaturverzeichnis<br />
• Beispiel für eine Gliederung<br />
(gemäß dekadischem System):<br />
1 Einleitung ( -> Relevanz,<br />
Problemstellung, Gang der <strong>Arbeit</strong>)<br />
2 Überschrift Grundlagenkapitel<br />
2.1 ...<br />
2.2 ...<br />
3 Überschrift Hauptteil I<br />
3.1 ...<br />
3.2 ...<br />
3.2.1 ...<br />
3.2.2 ...<br />
4 Schlussteil<br />
• Wichtig ist, dass jede Gliederungsebene mindestens<br />
zwei Gliederungspunkte aufweist (also<br />
kein Kapitel 2.1 ohne Kapitel 2.2).<br />
• Nach jeder Überschrift sollte mindestens eine<br />
halbe Seite Text folgen. Daher ist vor der Gefahr<br />
einer zu starken Untergliederung der <strong>Arbeit</strong>en<br />
zu warnen.<br />
• Die Formulierung einer Überschrift darf nicht<br />
deckungsgleich mit dem Thema <strong>Arbeit</strong> sein.<br />
• Eine gute Literaturbasis ist Grundvoraussetzung einer guten wissenschaftlichen <strong>Arbeit</strong>.<br />
Von besonderer Bedeutung sind dabei Artikel aus anerkannten wissenschaftlichen<br />
Zeitschriften (deutsche und auch internationale).<br />
• Als Recherchehilfe wird die Nutzung des Datenbank-Informationssystems (DBIS) der<br />
TU Berlin, speziell die entsprechende Fächerübersicht, empfohlen (http://rzblx10.uniregensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=tubb&colors=63&ocolors=40&lett=l).<br />
Auch das Suchen mit Google Scholar (http://scholar.google.de) kann sinnvoll sein. Zudem<br />
sollte jeder Studierende in aktuellen Ausgaben relevanter Zeitschriften recherchieren.<br />
• Das Literaturverzeichnis ist eine alphabetische Auflistung sämtlicher in der <strong>Arbeit</strong> zitierter<br />
Quellen (und nur dieser!). Generell sind im Literaturverzeichnis alle Autoren einer<br />
Quelle anzugeben (keine Abkürzung mit et al.) wobei statt der Vornamen auch Initialen<br />
angegeben werden können. Ebenfalls aufzuführen sind der Untertitel und bei Büchern<br />
die Auflagenzahl, wenn es sich nicht um eine Erstauflage handelt. Die Besonderheiten<br />
der möglichen Varianten werden im Folgenden verdeutlicht:<br />
a) Bücher<br />
Niederhauser, J. (2000): Die schriftliche <strong>Arbeit</strong>. 3., völlig neu erarb. Aufl., Mannheim u.a.:<br />
Dudenverlag.<br />
b) Artikel aus Zeitschriften<br />
Oberliesen, R.; Zöllner, H. (2007): Kerncurriculum für den Lernbereich Beruf - Haushalt<br />
- Technik - Wirtschaft/<strong>Arbeit</strong>slehre: ein lernbereichsspezifisches Referenzmodell, in: Unterricht<br />
<strong>Arbeit</strong> + Technik, 9. Jg., H. 33, S. 49-52.
c) Artikel aus Sammelbänden<br />
Rausch, H. (2001): Informationen beschaffen. In: Schweizer, G.; Selzer, H. M. (Hrsg.):<br />
Methodenkompetenz lehren und lernen. Beiträge zur Methodendidaktik in <strong>Arbeit</strong>slehre, Wirtschaftslehre,<br />
Wirtschaftsgeographie. Dettelbach: Röll-Verlag.<br />
d) Internetquellen<br />
Fachbereich Wirtschaft/Haushalt (2008): Kriterien eines guten Wiki-Artikels,<br />
http://www.arbeitslehre.de/wiki/<strong>Arbeit</strong>slehreWiki:F%C3%BCr_Lehrende#Qualit.C3.A4<br />
tskriterien, abgerufen am 27.10.2008.<br />
5 Zitierweisen<br />
• Innerhalb der Geisteswissenschaften <strong>hat</strong> sich die amerikanische Zitierweise, d.h. Literaturangabe<br />
direkt im Fließtext durchgesetzt.<br />
• Die Literaturangabe wird in der Form (Autor Jahr, Seitenzahl) angegeben.<br />
• Zitate sowie weiterführende ggf. kritische Ergänzungen können auch als Fußnote erscheinen.<br />
Sie sind gegenüber dem Haupttext optisch abzugrenzen (d.h. Trennlinie,<br />
Schriftgröße 10 und einfacher Zeilenabstand).<br />
• Bei direkten Zitaten, die nicht länger als drei Zeilen sind, ist die übernommene Textpassage<br />
in Anführungsstriche zu setzen. Bei längeren Zitaten, die sich über mehr als drei Zeilen<br />
erstrecken, wird zur besseren Übersichtlichkeit ein deutliches Abheben vom übrigen<br />
Text empfohlen, d.h. einfacher Zeilenabstand und eingerückter Abschnitt. In diesem Fall<br />
können Anführungszeichen entfallen.<br />
• Direkte Zitate sind sehr sparsam zu verwenden!<br />
• Grundsätzlich <strong>hat</strong> jeder Studierende die Aufgabe, sich die Originalquellen der zitierten<br />
Aussagen zu besorgen (rechtzeitig an Fernleihen denken!). Wird das Zitat von einem anderen<br />
Autoren übernommen, so handelt es sich um ein Sekundärzitat. Dies ist nur zulässig,<br />
wenn die Originalquelle nicht beschafft werden kann. Im Literaturverzeichnis und<br />
beim Zitat selbst sind dann sowohl die Originalquelle als auch die genutzte Sekundärquelle<br />
aufzuführen.<br />
Bsp.:<br />
Schon Chamberlin wies hin auf die besondere Bedeutung produktpolitischer Überlegungen<br />
für die volkswirtschaftliche Theorie des Qualitätswettbewerbs (vgl. Chamberlin<br />
1948, zitiert nach Hansen/Hennig-Thurau/Schrader 2001, S. 8.)<br />
6 Abbildungen und Tabellen<br />
• Abbildungen und Tabellen sind zur Verbesserung des Textverständnisses ausdrücklich<br />
erwünscht. Sie sind jeweils zu nummerieren, so dass im Text darauf verwiesen werden<br />
kann:<br />
Bsp.:<br />
Grundlegend lassen sich zwei Formen der Zufriedenheitsmessung unterscheiden (Vgl.<br />
Abbildung 1).<br />
• Unter den Abbildungen und Tabellen ist der Titel sowie ggf. ein Quellenverweis anzugeben:<br />
Bsp.:<br />
Abbildung 1: Das System von Rahmenfaktoren der Produktpolitik (Quelle: Hansen/Hennig-Thurau/Schrader<br />
2001, S. 48)
7 Gender<br />
• Verstärkte Beachtung soll in wissenschaftlichen Texten eine geschlechtergerechte<br />
Schreibweise im Sinne des Gender Mainstreaming finden. Informationen dazu erhalten<br />
Sie z.B. unter: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/sprache.pdf<br />
8 Eidesstattliche Erklärung<br />
• Am Ende der <strong>Arbeit</strong> muss folgende Erklärung auf der letzten Seite angegeben werden:<br />
„Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende <strong>Arbeit</strong> selbstständig und ohne fremde<br />
Hilfe angefertigt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet<br />
habe.“<br />
9 Beurteilungskriterien<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
• Der Bewertung von wissenschaftlichen <strong>Arbeit</strong>en am Fachbereich Wirtschaft/Haushalt<br />
berücksichtigt folgende Kriterien:<br />
a) Gliederung: formale Logik; sachadäquater Aufbau<br />
b) Inhalt: Logik der Gedankenführung, Zielstrebigkeit und Ausgewogenheit der<br />
Darstellung, Themenbezogenheit, Themenabdeckung, Entsprechung zwischen<br />
Darstellung und Gliederung, Eigenständigkeit der Gedanken, Kritikfähigkeit,<br />
Qualität von Schlussfolgerungen, Objektivität der Argumentation, ggf. Ausweis<br />
von Interessenstandpunkten<br />
c) Sprache und formale Gestaltung: Verständlichkeit, Klarheit, Präzision, Übersichtlichkeit,<br />
Korrektheit<br />
d) Angemessenheit der Literaturerfassung: Problembezug, Relevanz, Aktualität,<br />
Internationalität, Umfang, Korrektheit des Literaturverzeichnisses<br />
e) Zitierweise: Aussagen sind mit Quellen belegt, Benutzung von Originalliteratur,<br />
angemessene Anwendung direkter Zitate, formale Korrektheit<br />
• Bei Bachelorarbeiten wird die Bewertung in schriftlichen Gutachten dokumentiert, die jeder<br />
Studierende erhält. Bei Seminararbeiten erfolgt die Offenlegung der Bewertung im<br />
Rahmen eines persönlichen Gesprächs.
Textgrundlage 25.10.2012 – <strong>Arbeit</strong>
01.11.2012 ‐ Die <strong>Zukunft</strong> der <strong>Arbeit</strong>
08.11.2012 Strukturwandel der <strong>Arbeit</strong>
15.11.2012 ‐ Die <strong>Arbeit</strong> in der Dienstleistungsgesellschaft
Einleitung:SozialeDienste–ArenenundImpulsgebersozialenWandels 35<br />
MartinBaethge<br />
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1 DersektoraleWandelzurDienstleistungsökonomie<br />
DenAusgangspunktfürdieDebatteüberdieDienstleistungsgesellschaftalsneuerGesell<br />
schaftsformation,inderdienegativenErscheinungenderIndustriegesellschaftineiner„ter<br />
tiärenZivilisation“(Fourastie1949)überwundenwerdenkönnten,bildetdieTheoriesekt<br />
oralen Wandels (vgl. Häussermann/Siebel in diesem Band; Fourastie 1949; Bell 1973;<br />
Gershuny 1981). Fourastie sieht die Diensleistungstätigkeiten zum dominanten Beschäfti<br />
gungssektor aufsteigen, in dem am Ende des 20. Jahrhunderts 80 bis 90 Prozent aller Er<br />
werbstätigenarbeitenwerden.DieTheoriesektoralenWandelslässtsichalsEvolutionstheo<br />
riemenschlicher<strong>Arbeit</strong>undÖkonomievonihrenAnfängenherverstehen,inderdiegroßen<br />
EntwicklungsphasennachdemjeweilsdominierendenWertschöpfungssektorinderGesell<br />
schaft bezeichnet werden: Jahrtausende lang dominierte landwirtschaftliche Produktion<br />
(primärerSektor)dieWirtschaftallerGesellschaften.VoretwadreihundertJahrenentstand<br />
inEuropadas,wasseitdemalsindustrielleProduktion(sekundärerSektor)bezeichnetund<br />
im 20. Jahrhundert zum dominanten Wirtschaftssektor in den meisten westlichen und ei<br />
nemTeilderöstlichenLändernwerdensollte:diemaschinelleHerstellungvonGütern.Ab<br />
Mitte des 20. Jahrhunderts verliert in immer mehr westlichen Ländern die Industrie ihr<br />
ÜbergewichtinderWirtschaftandenDienstleistungsbereich(tertiärerSektor),denmanzu<br />
nächstnuralsSammelbegrifffüralleErwerbsarbeitenbegreifenkann,diewederunmittel<br />
barelandwirtschaftlichenochindustrielleHerstellungstätigkeitenbeinhalten.Fürdieweite<br />
re Argumentation ist es wichtig im Auge zu behalten, dass das Definitionskriterium das<br />
quantitativeGewichtdesjeweiligenSektorsist,sodassheuteinallenfrühindustrialisierten<br />
GesellschaftenalledreiSektorengleichzeitignebeneinanderexistieren.DasNebeneinander<br />
geradevonIndustrieundDienstleistungssektoristfürdieGestaltungder<strong>Arbeit</strong>sverhält<br />
nissefolgenreich.<br />
Am Beispiel Deutschland lässt sich die Entwicklung zur Dienstleistungsökonomie<br />
(Tertiarisierungsprozess) veranschaulichen. Aufgrund seines spezifischen Industrialisie<br />
rungspfades(vgl.Abelshauser2004;Streeck1997)indemeinehochgradigexportorientierte<br />
industrielleQualitätsproduktiondenTonangabunddenLeitsektorderWirtschaftbistief<br />
ins20.Jahrhundert(eventuellinqualitativerHinsichtbisheute)stellt,giltDeutschlandeher<br />
als Nachzügler denn als Vorreiter der Tertiarisierung. Insofern stellen die im Folgenden<br />
präsentiertenErwerbstätigendatenauchkeineswegsdiehöchsteDienstleistungsausprägung<br />
derangloamerikanischenundeuropäischenGesellschaftendar.<br />
A. Evers et al. (Hrsg.), Handbuch Soziale Dienste, DOI 10.1007/978-3-531-92091-7_2,<br />
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
36 MartinBaethge<br />
Bis1880,demZeitpunkt,andemdieeigentlicheTakeoffPhasederIndustrialisierung<br />
in Deutschland einsetzt, war die Erwerbsstruktur noch eindeutig von der Landwirtschaft<br />
bestimmt,indernochdieHälftederErwerbstätigenbeschäftigtwar(vgl.Abb.1).Erstum<br />
dieWendezum20.JahrhundertschneidensichdieErwerbstätigenkurvenundgewinntdie<br />
industrielle Produktion das Übergewicht. In der Zeit bis zum ersten Weltkrieg bleibt der<br />
Anteil der Dienstleistungsbeschäftigung deutlich hinter den beiden anderen Sektoren zu<br />
rückundverharrtzwischeneinemFünftelundeinemViertel.AberbereitsseitderWende<br />
zum20.JahrhundertlässtsichbisindiesechzigerJahreeinparallelerAnstiegvonsekundä<br />
remundtertiäremBeschäftigungssektorbeobachten,undzwarsowohlrelativalsauchabso<br />
lut. Diese Parallelität verweist darauf, dass die Expansion der Industrie eine Ausweitung<br />
auchderDienstleistungsbeschäftigungundeineErhöhungderErwerbstätigkeitinsgesamt<br />
durchEinbezugvonvorhernichterwerbstätigenBevölkerungsteilen(z.B.Frauen)nachsich<br />
zog(vgl.Baethge1999).<br />
<br />
Abbildung1: ErwerbstätigenachWirtschaftsbereichen1870bis2006inDeutschland.<br />
(AnteileanErwerbstätigeninsgesamtinProzent)<br />
in %<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1870 1913 1950 1960 1970 1980 1991* 1996 2001 2006<br />
Primärer Sektor Sekundärer Sektor (inkl. Baugewerbe) Tertiärer Sektor<br />
*Bis1991früheresBundesgebiet,ab1991Deutschland.<br />
Quellen:Destatis/gesiszuma/WZB2008;fürDatenvor1950:Maddison1995;eigeneBerechnungen.<br />
<br />
Nach dem zweiten Weltkrieg kommt eine starke Beschleunigung in den Wandel der sek<br />
toralen Erwerbstätigkeitsstruktur. Bereits in den 1950erahren, in der Wiederaufbauphase,<br />
verliertderprimäreSektorfastdieHälfteseinesErwerbstätigenbestands,umdannkontinu<br />
ierlich weiter bis auf 2,4Prozent um die Jahrtausendwende abzunehmen. Der industrielle<br />
Sektor erfährt bis Mitte der 1960erJahre noch einen leichten Anstieg auf annähernd<br />
48Prozent,gehtabdaaberrapidezurückundverliertbis2006fast50ProzentseinesAnteils
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 37<br />
andenErwerbstätigen(noch25,5Prozent).DierasantesteEntwicklungnimmtdieErwerbs<br />
tätigkeitimDienstleistungssektor.Von1950(33ProzentAnteil)bis2006erhöhtderSektor<br />
seinen Erwerbstätigenanteil kontinuierlich und ziemlich geradlinig auf 72Prozent, also<br />
knappdreiViertelallerErwerbstätigen.<br />
GegenüberderIndustriegewinntderSektorseitAnfangder1970erJahreeinÜberge<br />
wicht,dasnachderJahrtausendwendesichinfastdemdreifachenAnteilanderErwerbstä<br />
tigkeitsstruktur ausdrückt. 1 Ob sich sie Entwicklung linear abgeschwächt fortsetzen wird,<br />
kannimAugenblickoffenbleiben,eineTrendumkehrerscheintausgeschlossen. 2 <br />
LangeEntwicklungsreihensindgutdazu,langfristigeTrendsaufzuzeigen,imvorlie<br />
gendenFalldiedersektoralenBeschäftigung.UmdenGründenfürihreDynamikaufdie<br />
Spurzukommen,bedarfesdesBlicksaufdieEntwicklungderfunktionalenTätigkeitsbe<br />
reicheimDienstleistungssektor,dieannäherungsweisedurchdieBranchendifferenzierung<br />
abgebildetwerden.Daranwirdsichzeigen,dassFourasties„ungeheurerHungernachTer<br />
tiärem“wenigerinderVerschiebungdermenschlichenBedürfnisstrukturvonmateriellen<br />
GüternaufimmaterielleDienstebegründetistalsvielmehrauchstarkstrukturellenErfor<br />
dernissen einer hochentwickelten Industriegesellschaft folgt, etwa in der öffentlichen Bil<br />
dungsundKommunikationsinfrastruktur,ForschungundEntwicklungunddemGesund<br />
heitswesen.<br />
<br />
<br />
1Manmussbeachten,dasshiereinersektoralenZuordnungderErwerbstätigengefolgtwird,d.h.die<br />
Erwerbstätigen,dieinLandwirtschaftundIndustrieDienstleistungstätigkeitenwahrnehmen,sinddem<br />
primärenundsekundärenSektorzugerechnet(vgl.HaiskenDeNewetal.1997).Würdemansie(als<br />
z.B. Warenkaufleute der Landwirtschaft, Industriekaufleute, Konstruktionsingenieure u.a.) statistisch<br />
zum Dienstleistungssektor zählen, so dürfte der Erwerbstätigenanteil der Dienstleistungsbereiche bei<br />
gut80Prozentliegen.<br />
2ZweigroßePrognosenderErwerbstätigenentwicklunggehenvoneinerabgeschwächtenFortsetzung<br />
des Trends und einerweiteren Anteilsabnahme der Industriebeschäftigtenaus(vgl.Boninetal.2007<br />
undWolteretal.2010;sieheauchAbb.2).
38 MartinBaethge<br />
Abbildung2: ProzentualeAnteileeinzelnerWirtschaftsbereicheander<br />
Erwerbstätigenzahlinsgesamt1991–2020<br />
<br />
Datenab2010geschätzt<br />
Quelle:Drosdowski/Wolter2010,Kap.11;eigenePräsentation.<br />
<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020<br />
Sonstige öff. u. priv. Dienstleister<br />
Gesundheits-, Veterinär-, Sozialw esen<br />
Erziehung und Unterricht<br />
Öff. Verw ., Verteidigung, Sozialversich.<br />
Grundstücksw esen, Verm., Untern.DL<br />
Kredit- und Versicherungsgew erbe<br />
Verkehr und Nachrichtenübermittlung<br />
Gastgew erbe<br />
Handel;Instandh.u.Rep.<br />
Baugew erbe<br />
Energie- und Wasserversorgung<br />
Verarbeitendes Gew erbe<br />
Bergbau, Steine u. Erden<br />
Land- und Forstw irtschaft, Fischerei<br />
% Anteil 2006<br />
Blickt man auf die Entwicklung der Dienstleistung in ihrer Hauptexpansionsphase in<br />
Deutschland seit den 1960erJahren so entdeckt man, dass sie in den verschiedenen Bran<br />
chen oder Berufsfeldern keineswegs einem einheitlichen und gleichmäßigen Muster über<br />
dieZeitfolgte.Truginden1960erundfrühen1970erJahrenderöffentlicheDienstvoral<br />
lem mit dem starken Ausbau des Bildungssektors und anderer Infrastrukturbereiche das<br />
HauptgewichtderExpansion,sowareninden1980erJahrendieunternehmensbezogenen<br />
DienstleistungendieLokomotivederDienstleistungsexpansion,undseitden1990erJahren<br />
lässtsichdiestärksteAusweitungderErwerbstätigkeitindenBerufsfeldernInformatikund<br />
Datenverarbeitung,MedienundKommunikationsowieimFeldOrganisation,Verwaltung<br />
undübrigeWissenschaften(außertechnischeundnaturwissenschaftlicheBerufe)beobach<br />
ten(vgl.Boninetal.2007:83).<br />
Abbildung2bestätigtfürdieletztenbeidenJahrzehntediegroßeUnterschiedlichkeit<br />
der Erwerbsentwicklung nach Wirtschaftsbereichen. 3 Der größte Dienstleistungsbereich<br />
<br />
3EinProblemderunterschiedlichenDatenquellenliegtdarin,dasssienichtdieErwerbstätigkeitnach<br />
einheitlichen Klassifikationen aggregieren, zum Teil nach Branchen, zum Teil nach Wirtschaftsberei<br />
<br />
7,2 %<br />
10,3 %<br />
5,8 %<br />
6,7 %<br />
13,5 %<br />
3,2 %<br />
5,4 %<br />
4,6 %<br />
15,1 %<br />
5,7 %<br />
0,7 %<br />
19,3 %<br />
0,2 %<br />
2,1 %
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 39<br />
(Handel, Instandhaltung, Reparatur), bleibt zwischen 1991 und 2010 in etwa stabil, jeder<br />
sechste bis siebte Erwerbstätige in der Bundesrepublik arbeitet in diesem Wirtschaftsbe<br />
reich.DiestärksteExpansionerfahrendieWirtschaftsbereiche„Grundstückswesen,Vermie<br />
tung,unternehmensbezogeneDienstleistungen“und„Gesundheits,VeterinärundSozial<br />
wesen“,diebeideihrenAnteilanderGesamtheitderErwerbstätigeninnerhalbderzwanzig<br />
Jahre in etwa verdoppelten. Zugewinne verzeichnen auch das Gastgewerbe sowie Erzie<br />
hungundUnterrichtunddie„sonstigenöffentlichenundprivatenDienstleistungen“(vgl.<br />
Abb.2).<br />
DieHeterogenitätderDienstleistungenlässtsichinviergroßenFunktionsclusterbün<br />
deln:<br />
<br />
1. Personenbezogene Dienstleistungen: Gesundheits und Sozialwesen, Erziehung und<br />
UnterrichtsowieGastgewerbe.Siestellen2006guteinFünftelderErwerbstätigenins<br />
gesamt(20,7Prozent–Abb.2);<br />
2. Unternehmensbezogene Dienstleistungen: Grundstückswesen, Vermietungen, unter<br />
nehmensbezogeneDienstleistungen(13,5ProzentderErwerbstätigen2006)und<br />
3. MarktundKommunikationsvermittelndeDienstleistungen:Handel,KreditundVer<br />
sicherungsgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung (fast ein Viertel aller Er<br />
werbstätigen2006–vgl.Abb.2);<br />
4. SicherungöffentlicherInfrastrukturundVerwaltung:ÖffentlicheVerwaltung,Vertei<br />
digung, Sozialversicherung,Sonstige öffentliche und private Dienstleister (14Prozent<br />
derErwerbstätigen2006).<br />
<br />
Mankanndavonausgehen,dassdiegroßenDienstleistungsfunktionsbereichejeweilseige<br />
nen institutionellen Regulationen folgen, die sowohl etwas mit ihren Funktionen als auch<br />
mit ihren Institutionalisierungspfaden zu tun haben. Am deutlichsten wird das an dem<br />
Sachverhalt,obeinDienstleistungsbereichvordringlichöffentlichoderprivatorganisiertist.<br />
Das4.Cluster(öffentlicheVerwaltungu.a.)undgroßeTeiledeserstenClusters(personen<br />
bezogeneDienste)sindöffentlichorganisiertundunterliegenehereinerpolitischenalseiner<br />
Marktsteuerung,auchwennindenletztenbeidenJahrzehntenindieseDienstleistungsbe<br />
reiche Marktelemente und Privatisierungsaktivitäten eingedrungen sind. Demgegenüber<br />
folgendieCluster2und3derinstitutionellenLogikeinerMarktsteuerung.<br />
Die funktionale Differenzierung der Dienstleistungsbranchen macht auch sichtbar,<br />
dassgroßeDienstleistungsfelderengmitderindustriellenProduktionverknüpftsind.Dies<br />
giltbesondersfürdieunternehmensbezogenenDienstleistungen,dieteilsalsAusgründun<br />
gen aus Industrie und anderen Dienstleistungsunternehmen entstanden sind (z.B. große<br />
TeilevonInformatikundDatenverarbeitung,Consulting),teilsalsZuliefererfürIndustrie<br />
unternehmenfungieren(beispielsweiseIngenieurbürosundanderewissenschaftlicheBera<br />
tungsundEntwicklungsagenturen)(vgl.insgesamtBaethge1999).<br />
AuchdieDienstleistungsarbeitsmärkteunterscheidensichrechtgrundlegendvonde<br />
nen der industriellen Produktion. Waren letztere die Domäne von Männern, so verbindet<br />
<br />
chen,zumTeilnachBerufsfeldern,jenachdem,welchesErkenntnisinteressebeiderDatenpräsentation<br />
imVordergrundsteht.
40 MartinBaethge<br />
sich die Expansion des Dienstleistungssektors mit der kontinuierlichen Ausweitung der<br />
Frauenerwerbstätigkeit.AndennachErwerbstätigenzahlgrößtenWirtschaftszweigenlässt<br />
sichanaktuellenZahlendieGegenläufigkeitdergeschlechtertypischen<strong>Arbeit</strong>smärktevon<br />
IndustrieundDienstleistungenzeigen(vgl.Abb.3).<br />
<br />
Abbildung3: FrauenanteilanErwerbstätigenindengrößtenIndustrieund<br />
DienstleistungsWirtschaftszweigen2008<br />
<br />
<br />
*ohneHandelmitKraftfahrzeugenundohneTankstellen<br />
Quelle:StatistischesBundesamt;Mikrozensus2008;eigeneDarstellung.<br />
<br />
DieTatsache,dassdiegrößtenDienstleistungsbranchenüberwiegendaufFrauenerwerbstä<br />
tigkeitbasieren,<strong>hat</strong>AuswirkungensowohlaufRegulationsformenderBeschäftigungsver<br />
hältnissealsauchaufdieZeitstrukturen.InBezugaufbeideAspektewirktsichbisheute<br />
aus,dassweibliche<strong>Arbeit</strong>skräfteinderVergangenheitwenigeralsmännlichegewerkschaft<br />
lich organisierbar waren. Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienperspektive<br />
gewinntzunehmendalsarbeitsmarktpolitischesRegulationserfordernisanBedeutungund<br />
<strong>hat</strong>bereitsindenletztenJahreneineReihesozial,familienundbildungspolitischerAktivi<br />
täten freigesetzt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, Kap. A, C und H). Bei<br />
Vorherrschenindustrieller<strong>Arbeit</strong>smärktewardasunmöglich(vgl.Abschnitt3).<br />
FunktionelleundinstitutionelleHeterogenitätsowievielfältigeengeKopplungenmit<br />
derindustriellenProduktionverbietensowohldieAnnahme,dassDienstleistungstätigkei
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 41<br />
teneineEinheitbildeten,alsauchdieintheoretischenKonzeptenzurDienstleistungsgesell<br />
schaft postulierten Vorstellungen einer substantiellen Entgegensetzung ihrer Regulations<br />
formenzurIndustriegesellschaft.WennimFolgendenvon<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsge<br />
sellschaft gesprochen wird, so meint das die <strong>Arbeit</strong> in einer Gesellschaft, in der die über<br />
wiegendeMehrheitderErwerbstätigennichtmehrinlandwirtschaftlicheroderindustrieller<br />
Produktion tätig ist. In diesem Sinne ist es weniger missverständlich, von <strong>Arbeit</strong> in einer<br />
nachindustriellenGesellschaftzusprechen.<br />
2 TheoretischeAnsätzezurAnalysevonDienstleistungsarbeit<br />
Es liegt nahe,zunächst einen Blick auf theoretische Konzepte zu werfen, diesich auf den<br />
sektoralenWandelzurDienstleistungsgesellschaftbeziehen.ZurErklärungdessektoralen<br />
StrukturwandelsinderNeuzeithabenvorallemzweitheoretischeAnsätzeindersozialwis<br />
senschaftlichenDiskussionimZusammenhangderVeränderungvon<strong>Arbeit</strong>eineRollege<br />
spielt:zumeinendieAnnahmenderKlassikerder„Dienstleistungsgesellschaft“Fourastie<br />
(1949)undClark(1940),zumandereninderanMarxorientiertenSoziologiedasTheorem<br />
derkapitalistischen„Landnahme“.<br />
FourastiesTheorieverstehtsichalsökonomischeEvolutionstheorieundbasiertaufei<br />
nerkonstitutivenKopplungvonzweiAnnahmen:zumeinenzurProduktivitätsentwicklung<br />
der<strong>Arbeit</strong>,zumanderenzumWandelderBedürfnisstrukturderMenschen.Aufgrundzu<br />
nehmender Technisierung und Verwissenschaftlichung der Produktionsmethoden in der<br />
Industrie,steigtdie<strong>Arbeit</strong>sproduktivitätindermateriellenGüterproduktionimmerweiter<br />
an,undeskommtzueinemimmergrößerenWarenangebot.Diesesführt–hierkommtdie<br />
zweiteAnnahmeinsSpiel–zuSättigungseffektenbeidenKonsumenten,dienunihreBe<br />
dürfnisseauf(immaterielle)Diensterichten.AndersalsinderindustriellenProduktion,wo<br />
HerstellungundKonsumvonGüterningetrenntengesellschaftlichenSphärenstattfinden,<br />
ist Erstellung und Verzehr von Dienstleistungen räumlich eng gekoppelt („uno actu“<br />
Prinzip),wassowohlderTechnisierungalsauchderRationalisierungvonDienstleistungen<br />
Grenzen setzt. Diese Annahme weitgehender Technisierungs und Rationalisierungsresis<br />
tenzbedeuteteingeschränkteProduktivitätindenDienstleistungsbereichenundführt zur<br />
UmschichtungderBeschäftigtenausder hochproduktivenIndustrieindenniedrigerpro<br />
duktivenDienstleistungssektor.<br />
Gegen die Annahme Fourasties sind verschiedenartige Einwände ins Feld geführt<br />
worden: Selbst wenn die <strong>Arbeit</strong>sproduktivität in den meisten Dienstleistungen weniger<br />
großistalsinLandwirtschaftundIndustrie,wardieVorstellungweitgehenderTechnisie<br />
rungsundRationalisierungsresistenzvonDienstleistungstätigkeitschonzuFourastiesZei<br />
ten obsolet, wenn man etwa an die große Bürorationalisierung im ersten Drittel des 20.<br />
Jahrhundertsdenkt(vgl.Baethge/Wilkens2001:9f.).EinanderesgrundlegendesArgument<br />
gegen die Vorstellung, dass der „ungeheure Hunger nach Tertiärem“ (Fourastié) durch<br />
kommerzielle Dienstleistungen unbegrenzt befriedigt werden und zur beliebigen Auswei<br />
tungvonDienstleistungsbeschäftigungführenkönnte,bestehtimVerweisaufdenPreisfür<br />
DienstleistungenunddiebegrenzteKaufkraftderKonsumenten,dieeinenMassenkonsum<br />
vonkommerziellenDienstleistungsangebotenimWegestünden.Implizithabenmitunter
42 MartinBaethge<br />
schiedlichenBegründungenBaumol(1967)undGershuny(1981)diesesArgumententfaltet<br />
(vgl.zurArgumentationsweiseHäusermann/SiebelindiesemBand)–dererstemitVerweis<br />
aufdieKostenklemme,dieentstehenmuss,wennimmerwenigerhochproduktiveundhoch<br />
bezahlte Industriebeschäftigte immer mehr niedrig produktiven und gering bezahlten<br />
Dienstleisterngegenüberstehen(wersolldanndieDienstleistungenbezahlen?);derzweite<br />
mit dem Hinweis auf den Ersatz von kommerziellen Diensten durch Eigenarbeit in einer<br />
„Selbstbedienungswirtschaft“. Mit beiden Einwänden sind modelltheoretisch Grenzen für<br />
dieExpansionvonDienstleistungenbezeichnet,vondenenallerdingsunklarbleibt,welche<br />
tatsächlich bremsenden Wirkungen sie entfalten. Bis heute haben sie zumindest keine<br />
TrendumkehrinderBeschäftigungsstrukturentwicklungbewirkt(vgl.Abb.2).<br />
TrotzderFragwürdigkeitseinerzentralenPrämissen<strong>hat</strong>Fourastievieleaufdenersten<br />
Blick treffende langfristige Entwicklungstendenzen für die frühindustrialisierten Gesell<br />
schaften des Westens vorhergesagt: die Dominanz der Dienstleistungsbeschäftigung, die<br />
Verlängerung von Bildungs und Ausbildungszeiten, die Verwissenschaftlichung und<br />
IntellektualisierungvonErwerbsarbeitunddaszunehmendeGewichtvonDienstleistungen<br />
imprivatenKonsum;nachBerufstätigkeitenklassifiziert,habenheuteeineganzeReihevon<br />
westlichenGesellschaftendievonFourastieprognostizierten80ProzentandenErwerbstä<br />
tigenerreicht(s.Abschnitt1).<br />
DiesallesabersindrelativallgemeineundquantitativeKategorienaufderMakroebe<br />
ne,dieseitherdenbegrifflichenGrundbestandvonTheoriennachindustriellerGesellschaft<br />
abgeben(z.B.Bell1975).DenKernvonFourastiesTheorieaberbildetdieVorstellungeines<br />
qualitativhöherenStadiumsderGesellschaft,einer„tertiärenZivilisation“,indersichdie<br />
Erwerbsarbeit verbessert und zu höheren Formen qualifizierter intellektueller Tätigkeiten<br />
geführthabenwirdundnachDeckungmateriellerhöhereimmaterielleBedürfnissebefrie<br />
digtwerden. 4 Diequalitativen<strong>Zukunft</strong>sannahmen,dieHoffnungeneinertertiärenZivilisa<br />
tion,stehenausheutigerSichtaufschwachenBeinen.VoneinemgoldenenZeitaltertertiärer<br />
ZivilisationsinddiemeistenGesellschaftenweiterentferntalsvor30oder40Jahren:Weder<br />
isteszujenerAngleichungderEinkommenaufhohemNiveaugekommen,dieVorausset<br />
zung für die Befriedigung der höheren Bedürfnisse nach Diensten ist, noch ist Sicherung<br />
materiellerBedürfnisseunddieBeseitigung vonNoterreicht.ImGegenteilnimmtinden<br />
meistenwestlichenGesellschaftendieEinkommensungleichheitzu.Massenarbeitslosigkeit,<br />
prekäreBeschäftigungsverhältnisseundunqualifizierte<strong>Arbeit</strong>auchimDienstleistungssek<br />
torhaltenseitlangemanundbedrohengrößerwerdendeGruppenderBevölkerung(SOFI<br />
u.a.2005;Bosch/Weinkopf2007;Castel/Dörre2009).<br />
<br />
4Andenfrühen<strong>Arbeit</strong>enVeblens(1953,zuerst1899)undBaudrillardswirddeutlich,dassesnichtder<br />
Wandel einer allgemeinen Bedürfnisstruktur des Menschen ist, der die Konsumumschichtungen in<br />
RichtungDienstleistungenhervorgebracht<strong>hat</strong>,sonderndassdieKonsumstileundgewohnheitensich<br />
entlang„einersymbolischenLogiksozialerDistinktion“(Deutschmann2002:30)verändernundeinem<br />
ständigen Zirkel von sozialer Distinktion und Egalisierung unterliegen. Gegen Baudrillards<br />
AutomatismusvorstellungderBedürfnisentwicklungwendetDeutschmannmitGalbraithein,dassdie<br />
SchaffungvonBedürfnissendurchdieHerstellerdietreibendeKraftseinkönne.Unabhängigvondie<br />
serKontroversebleibtandieserStellefestzuhalten,dassdieVeränderungvonBedürfnisstrukturenbe<br />
nennbarensozialenundökonomischenWirkfaktorenfolgtundnichteinemallgemeinenEvolutionsge<br />
setz.
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 43<br />
Sieht man geringfügige Beschäftigung, die oft unter der Sozialversicherungsschwelle<br />
liegt, als Ausdruck für prekäre <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse 5 an, so verteilte sich die Mehrheit der<br />
2008andievierMillionengeringfügigBeschäftigterzumüberwiegendenTeilaufDienstleis<br />
tungsbereiche:abgesehenvonprivatenHaushalten,derenAngestelltezu60Prozentgering<br />
fügigbeschäftigtsind,weisenimJahr2008derEinzelhandel(16Prozent),dasGastgewerbe<br />
(19Prozent),GrundstückundWohnungswesen(15Prozent)undsonstigeDienstleistungen<br />
(16Prozent)weitüberproportionaleAnteilegeringfügigBeschäftigterunterihrenErwerbs<br />
tätigen auf; demgegenüber ist die geringfügige Beschäftigung in fast allen Industriebran<br />
chenweitunterdurchschnittlich 6 .EineFüllequalitativerStudienbestätigt–auchiminterna<br />
tionalenMaßstab–wiesehrgeringqualifizierte,unsichereundkaumdasExistenzminimum<br />
einbringende Beschäftigung in bestimmten Dienstleistungsbranchen (Einzelhandel, Hotel<br />
undGaststättengewerbe,Pflegetätigkeiten,Reinigungsgewerbe)kumuliert(vgl.Ehrenreich<br />
2001).<br />
DenGrundfürdieSchwächederqualitativenPrognosenmagmandarinsehen,dass<br />
dieVäterderDienstleistungsgesellschaftsTheoriediebeschriebenenTendenzengleichsam<br />
alsnaturgesetzlicheEntwicklungdermenschlichen<strong>Arbeit</strong>undihrerProduktivitätverstan<br />
denhaben.FürseineVoraussageneinerbesserenQualitätder<strong>Arbeit</strong>hätteFourastiealler<br />
dingsauftheoretischenAnnahmenfußenmüssen,diedieMikroprozesseder<strong>Arbeit</strong>erklä<br />
renkönnen,wieVorstellungenübergesellschaftlicheOrganisationsformenvon<strong>Arbeit</strong>.Ge<br />
sellschaftliche Produktionsweise und Eigentumsverhältnisse spielen jedoch in der Theorie<br />
keineRolle.<br />
Bei ihnen setzen Erklärungen an, die auf Marx’ Analyse der kapitalistischen Gesell<br />
schaftBezugnehmen.InderanMarxorientiertenTheorietraditionlässtsichdieExpansion<br />
der Dienstleistungen mit dem Theorem der „Landnahme“ erklären, obwohl die marxsche<br />
Theorie allenfalls im Zusammenhang der „ursprünglichen Akkumulation“ im Übergang<br />
vonFeudalismuszumKapitalismussoetwaswieeinensektoralenWechselvonLandwirt<br />
schaftzuindustriellerProduktionthematisiert(Marx,DasKapital,Bd.1,S.741ff.).Dasauf<br />
RosaLuxemburg(1913)zurückgehendeTheoremderLandnahmebesagt–fürunserenZu<br />
sammenhangvereinfachtausgedrückt–,dassdemKapitaleineTendenzimmanentist,seine<br />
AnlagesphärenaufandereRegionenundFelderalsdieindustrielleProduktionauszudeh<br />
nen,wenndieGrenzenderinnerenExpansioninder(nationalen)Produktionerreichtsind<br />
und eine Überakkumulationskrise droht. Lutz (1984) und Dörre (2009) zeigen, dass sich<br />
LandnahmenichtaufdieErschließungexternerMärktebeschränkt,sondernauchdienicht<br />
industriellenWirtschaftsbereicheinnerhalbderGesellschaftenanzielenkann.Hierauslässt<br />
sich vielleicht weniger die historische Expansion des Dienstleistungssektors erklären, als<br />
vielmehrderaktuelleKampfumdieRegulationsformenvonDienstleistungsarbeitwiedie<br />
Privatisierung traditionell öffentlich organisierter Dienste wie das Gesundheits und Sozi<br />
alwesen,Bildung,bishinzuobrigkeitlichenOrdnungsfunktionenwieStrafvollzug,polizei<br />
licheundmilitärischeFunktionen(zuletzteremvgl.Knöbl2006).OhnedassdeminderFor<br />
schungbishersystematischnachgegangenwäre,kannmandavonausgehen,dassdieRegu<br />
<br />
5SiesinddiesnichtinjedemFall,dasieinEinzelfällenauchindividuellemInteresse(z.B.anZuver<br />
dienstoder„Übergangsjobinteresse“beiStudierenden)geschuldetseinkönnen.<br />
6ZahlennachMikrozensus2008;vgl.AutorengruppeBildungsberichterstattung2010,Tab.H34web.
44 MartinBaethge<br />
lationsformen auch Auswirkungen auf die quantitative Dynamik der Dienstleistungsbe<br />
schäftigunghaben.<br />
InseinerNeuinterpretationdesLandnahmeTheoremsbetontDörredessenqualitative<br />
Seite,diesichaufdieinhaltlicheGestaltungjenes„Außen“kapitalistischerProduktionbe<br />
zieht,dasindengesellschaftlichenInstitutionenvonz.B.InfrastrukturundBildungdieVo<br />
raussetzungenüberhauptfürkapitalistischeProduktionschafft(vgl.Dörre2009:41ff.).Wie<br />
sehr die qualitative Erweiterung des LandnahmeTheorems für die Analyse gerade jener<br />
Dienstleistungsfelder, die sich nicht auf den unmittelbaren Kreislauf von Produktion und<br />
Konsum wie der Großteil der personenbezogenen und der öffentlichen Infrastruktur<br />
Dienstleistungen(Cluster1und4)beziehen,<strong>hat</strong>jüngstRichardMünchamBeispielderneu<br />
erenEntwicklungenimBildungswesensichtbargemacht(Münch2009).<br />
DasTheoremderkapitalistischenLandnahmekanndenBlickfürPerspektiveninder<br />
AnalysevonDienstleistungsarbeitöffnen,diedieinderklassischenDienstleistungstheorie<br />
ausgeblendetenqualitativenEntwicklungeninder<strong>Arbeit</strong>erschließenhelfen.DieengeKopp<br />
lung von unternehmensbezogenen und marktvermittelnden Dienstleistungen mit der industriellen<br />
ProduktionimKreislaufvonProduktionundKonsumsowiedievielfältigeninnerenVerflechtungen<br />
auchvonstaatlichenInfrastrukturwievonvielenpersonenbezogenenDienstenmitdemBedarfdes<br />
privatwirtschaftlichenSektorsmachtdieEinbeziehungdergesellschaftlichenOrganisationder<strong>Arbeit</strong><br />
und der Eigentumsverhältnisse unabweisbar für die Analyse von Dienstleistungsarbeit: Was pas<br />
siertmitDienstleistungstätigkeiten,wennsiedemPrinzipderKapitalverwertungundden<br />
Wettbewerbsregeln des Marktes unterworfen werden? Wie werden unter der Herrschaft<br />
einzelwirtschaftlicherundreinmonetärerOutputundProduktivitätsmessungQualitätund<br />
ProduktivitätvonDienstleistungsarbeitenbestimmt?DasdieseFragenimBereichvonEr<br />
ziehung,GesundheitsundanderensozialenDienstendramatischeZuspitzungenerfahren<br />
könnten,warinwissenschaftlichenundberufspolitischenDiskursenseitlangemklar(Badu<br />
ra/Gross 1976). Dass sie heute in der großen weltweiten Wirtschaftskrise im Zentrum des<br />
Kapitalsselbst, in der Finanzwirtschaft,thematisiert werden, kann man als Zeichen dafür<br />
werten, wie sehr der Widerspruch zwischen Profit und Wettbewerbslogik auf der einen<br />
undgesellschaftlichenNutzendimensionenvonDienstleistungenaufderanderenSeitees<br />
kaliertist.<br />
3 WidersprüchezwischenNutzenfunktionenund(industrialistischen)<br />
RegulationsformenalsAnalyseperspektivevon<br />
Dienstleistungsarbeit<br />
UnterderPrämisse,dassdieaktuelleWeltwirtschaftskrisenichtnureinertemporärenEnt<br />
gleisung der finanzmarktpolitischen Steuerungsinstrumente zuzuschreiben, sondern in ei<br />
nem konstitutiven Systemwiderspruch wurzelt, der auch in anderen Dienstleistungsberei<br />
chenzugravierendenVerwerfungenführenkann,erscheinteineErörterungdesVerhältnis<br />
sesvonNutzenfunktionenundVerwertungslogikinDienstleistungenangesagt.DiesesVer<br />
hältnisistfürdieRegulationsformenvonDienstleistungsarbeitgrundlegend,dadavonaus
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 45<br />
zugehenist,dassdieNutzenfunktionendemVerwertungsinteresseGrenzensetzen 7 ,deren<br />
MissachtungbeiderRegulationvonDienstleistungsarbeitKrisensymptomeaufdemMarkt<br />
zeitigenundsichletztlichauchgegendieVerwertungsinteressenderDienstleistungsunter<br />
nehmenselbstrichtenmüssten.DieFinanzmarktkrisedemonstriertdaseindrucksvoll.<br />
DieRegulationsformender<strong>Arbeit</strong>sindnichtnurinDeutschlandbisindieGegenwart<br />
hineinwesentlichamModellindustriellkapitalistischerProduktionsarbeitausgerichtet,die<br />
sichvonvielenDienstleistungsarbeitsfeldernunterscheidet.<br />
TrotzallerHeterogenitätderDienstleistungsarbeitenlassensichindenTätigkeitsstruk<br />
turenUnterschiedezurindustriellen<strong>Arbeit</strong>finden,diefürdieOrganisationundGestaltung<br />
der<strong>Arbeit</strong>sverhältnissefolgenreichsind:SolassensichdiemeistenindustriellenProdukti<br />
onsarbeiteninderTätigkeitstypologieKohns(1977)demTypus„UmgangmitSachen“,die<br />
meistenDienstleistungstätigkeitendenTypen„UmgangmitMenschen“und/oder„Umgang<br />
mitSymbolen“zuordnen. 8 <br />
<br />
DerTermius„UmgangmitSachen“bezeichnetalleTätigkeiten,diedurchdieBearbei<br />
tungvonnatürlichenodervonMenschengeschaffenenGegenständennützlicheDinge<br />
herstellenoder–imFallevonMaschinenwiederherstellenunderhalten;<br />
dieKategorie„Umgangmit Personen“umfasstdieTätigkeiten,diesichaufProzesse<br />
desHeilens,Pflegens,BeratensundUnterrichtensvonPersonenbeziehen,und<br />
derTätigkeitstyp„UmgangmitSymbolen“beinhaltetTätigkeiten,derenInhaltimWe<br />
sentlicheninOperationendesRechnens,Schreibens,InformationenAnalysierenund<br />
Verarbeitensbesteht.<br />
<br />
DernaheliegendeEinwand,dasssichinderRealitätdiedreiTätigkeitstypenineinzelnen<br />
<strong>Arbeit</strong>sprozessenüberlappen,istaufdenerstenBlicksorichtigwietrivialundverfehltden<br />
SinnderbegrifflichenUnterscheidung.DieserzieltaufdenSachverhalt,dassjenachdem,<br />
welcherTätigkeitstypimZentrumeines<strong>Arbeit</strong>sprozessessteht,dieLogikdes<strong>Arbeit</strong>ens,die<br />
Formder<strong>Arbeit</strong>sorganisationsowiedie<strong>Arbeit</strong>UmweltInteraktion,dementsprechendauch<br />
dieAnforderungenandas<strong>Arbeit</strong>sverhaltenderIndividuenundanihreKompetenzenande<br />
resindbzw.mitBlickauffunktionaleImperativeseinmüssten.BeimTypus„Umgangmit<br />
Sachen“folgtdie<strong>Arbeit</strong>slogikdenetabliertenMethodender(manuellenodermaschinellen)<br />
Bearbeitung von Gegenständen, beim „Umgang mit Personen“ steht die Interaktionslogik<br />
fürdieGestaltungkommunikativerSituationenimZentrumundbeim„UmgangmitSym<br />
bolen“ sind es die Regeln des Analysierens und Kombinierens von Zeichen, die das Ar<br />
beitshandelnleiten.AmBeispielillustriert:Esleuchtetvermutlichschnellein,dasssowohl<br />
die<strong>Arbeit</strong>slogikalsauchdieInteraktionzwischen<strong>Arbeit</strong>endemundseinersächlichenund<br />
<br />
7IndermarxschenTheorietraditionkönntemanformulieren:derSubsumtionderkonkretenunterdie<br />
abstrakte<strong>Arbeit</strong>oderdesGebrauchswertder<strong>Arbeit</strong>unterihrenTauschwertsindGrenzenindenTätig<br />
keitsinhaltengesetzt.<br />
8MitfortschreitenderInformatisierungdringtallerdingsderTypusUmgangmitSymbolenauchimmer<br />
mehrindieindustriellenProduktionstätigkeitenein.UmgangmitSachenverschmilztebensosehrim<br />
mermehrmit„UmgangmitSymbolen“,wieesauchderTypus„UmgangmitMenschen“tut.ZumEr<br />
scheinungszeitpunktvonKohns„ClassandConformity“.
46 MartinBaethge<br />
personellenUmweltbeiderBearbeitungeinesWerkstücksanderssindalsbeiderPflegeei<br />
nesKrankenundwiederumbeideandersalsbeimLöseneinerMathematikaufgabe.<br />
In der eingangs angesprochenen langen Entwicklungsperspektive sektoralen Struk<br />
turwandels <strong>hat</strong> der Typus „Umgang mit Sachen“ die Geschichte der <strong>Arbeit</strong> bis in die in<br />
dustrielleGesellschaftdeszwanzigstenJahrhundertshineindominiert.Diebeidenanderen<br />
Tätigkeitstypen spielten in der Erwerbsstruktur eine untergeordnete Rolle und gewannen<br />
erst im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts zunehmendes und schließlich dominantes<br />
quantitativesGewicht(vgl.Abschnitt1,Abb.1).IhreExpansionverdankensieimFalleper<br />
sonenbezogenerDienstleistungen,diemanhierinetwamitdemTypus„UmgangmitPer<br />
sonen“gleichsetzenkann,derExternalisierunghäuslicherFunktionenausdemFamilienzu<br />
sammenhang(Bildung,Betreuung,Pflege)unddemAusbauwohlfahrtsstaatlicherInstituti<br />
onen (Gesundheits und Bildungswesen). Im Falle des Typus „Umgang mit Symbolen“<br />
spielten Prozesse der Separierung kaufmännischer, informatorischer und verwaltender<br />
Funktionen von den Produktionsprozessen und die zunehmende Verwissenschaftlichung<br />
undInformatisierungallerLebensbereichedieentscheidendeRolle(vgl.Dostal2001:54f.).<br />
AufgrundderüberragendenBedeutungderindustriellenProduktionfürWirtschafts<br />
wachstumundWohlfahrtsproduktion<strong>hat</strong>dasindustrialistischeRegulationsmodellvonAr<br />
beitim20.JahrhundertinDeutschlandweitgehendalleErwerbssphärendominiert.Eslässt<br />
sichdurchfolgendeMerkmaledefinieren:<br />
<br />
einestarkvomhierarchischorganisiertenGroßundMittelunternehmengeprägteBe<br />
triebsund<strong>Arbeit</strong>sorganisation,mitklarenKompetenzabgrenzungenzwischenFunk<br />
tionsbereichenundAbteilungen;<br />
einProduktionskonzeptderStandardisierungvonProduktenundProzessen(vgl.Co<br />
hen 2001) mit entsprechenden Formen der Leistungsmessung und Entlohnung sowie<br />
AnforderungenanDisziplinundOrdnung,umdieeconomiesofscalenutzenzukön<br />
nen(deutlichsterAusdruckdiesesKonzepts:tayloristische<strong>Arbeit</strong>sorganisation);<br />
ein bestimmtes, sehr striktes <strong>Arbeit</strong>szeitRegime mit betrieblich gebundenen 8<br />
StundenTag bzw. 40StundenWoche, das als Normalarbeitsverhältnis zur beschäfti<br />
gungsstrukturellenundgesellschaftlichenNormgewordenist;<br />
einandas(Normal)<strong>Arbeit</strong>sverhältnisgebundenesSozialversicherungssystem,dasdie<br />
HöhederAltersversorgungandiegeleistete<strong>Arbeit</strong>szeitbindetundVollzeitarbeitbe<br />
günstigt;<br />
einespezifische,amFacharbeiterprofilausgerichteteBerufsausbildung,diewesentlich<br />
durchihreunmittelbareEinbindunginbetriebliche<strong>Arbeit</strong>sprozessebestimmtist,und<br />
einefrüheSozialisationindas<strong>Arbeit</strong>s,OrganisationsundNormengefügeindustriel<br />
lerProduktionbewirkt;<br />
ein auf Beruflichkeit und interne <strong>Arbeit</strong>smärkte ausgerichtetes Modell der sozialen<br />
Mobilität,daseherSicherheitundBetriebstreuealsRisikobereitschaftundMobilitäts<br />
aspirationenprämiert;<br />
ein sozialpartnerschaftliches Aushandlungsmodell von Interessen auf Betriebs und<br />
Branchenebene,dasstarkeOrganisationenvonSozialpartnernvoraussetzt.
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 47<br />
Mit dieser idealtypischen Skizze der industriegesellschaftlichen Ordnung der <strong>Arbeit</strong> wird<br />
nicht behauptet, dass die <strong>Arbeit</strong>srealität in den industriellen Produktionsbetrieben deren<br />
MaximenimmerbuschstabengetreugefolgtoderauchheutenochinallenBetriebstypenan<br />
ihrausgerichtetwäre.DieindustrialistischeOrdnungder<strong>Arbeit</strong>stelltwiealleinstitutionel<br />
len Ordnungen einen normativen Orientierungsrahmen für organisationales Handeln dar,<br />
dessenVerbindlichkeitundBefolgungnachdenstofflichenBedingungender<strong>Arbeit</strong>sprozes<br />
seundihrerkonkretenEinbettunginMarktkonstellationenvariierenkann.Alsbetriebliches<br />
Organisationskonzept<strong>hat</strong>dieseOrdnungder<strong>Arbeit</strong>inDeutschlandihreeindeutigsteAus<br />
prägung und Blütezeit in der langen Phase fordistischer Produktion (Massenproduktion<br />
undMassenkonsum)gehabt.HeutehabenzunehmendeKundenorientierung,dieinvielen<br />
Bereichen eine Individualisierung der Produktion nach sich zieht (vgl. Reichwald et al.<br />
2000),undinterneTertiarisierungderProduktiondurchAusbauderindirektenBereichein<br />
derIndustriedieindustrialistischeOrdnungder<strong>Arbeit</strong>gelockert(vgl.Kern/Schumann1984;<br />
Piore/Sabel1985;Sauer/Döhl1997),ohnesieaufzuheben,inanderenBereichen<strong>hat</strong>sieihre<br />
Stabilitätbehaltenbzw.sogareineRenaissanceerfahren(Schumann2004).<br />
DieAufweichungderindustrialistischenOrdnungder<strong>Arbeit</strong>inderIndustrieproduk<br />
tion selbst <strong>hat</strong> nicht verhindert, dass sie nicht auch im Dienstleistungsbereich normative<br />
Verbindlichkeit erreicht hätte, und zwar schon längst bevor sie im industriellen Sektor in<br />
Frage gestellt wurde (vgl. Baethge/Oberbeck 1986): vor allem in den Bürobereichen kauf<br />
männischer und verwaltender Tätigkeiten durch dequalifizierende <strong>Arbeit</strong>steilung, imEin<br />
zelhandeldurchServicereduktion,TechnisierungundstarkeFunktionsdifferenzierung;aber<br />
auchinkundenoderklientennahenBereichenimVersicherungsundKreditgewerbedurch<br />
StandardisierungvonAngebotenund(technischgestützte)Kommunikationsformen;selbst<br />
imBereichderPflegetätigkeitendurchkleinteiligfragmentierteLeistungsmessung.<br />
Das industrialistische Regulationsmodell von <strong>Arbeit</strong> kollidiert in vielen Punkten so<br />
wohlmitanderenTraditionenderRegulierungimDienstleistungssektoralsauchmitaktu<br />
ellenFunktionsbedingungenvonDienstleistungsarbeit.<br />
Historischgesehenerscheintesnichtalszufällig,dassdiegrößtenBereichesowohlder<br />
personenbezogenenDienstleistungenwiedasGesundheits,BetreuungsundPflegewesen<br />
als auch der Wissensdienste (Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, selbst der<br />
Informationsübermittlung) der privatwirtschaftlichen Organisation von <strong>Arbeit</strong> entzogen<br />
warenundineinemöffentlichrechtlichenRahmeninstitutionalisiertwurden.Diesesinden<br />
letztenJahrhundertennebenderMarktregulationentstandenealternativeNormierungssys<br />
temvon<strong>Arbeit</strong>musswederpersealsdiefürdieFunktionslogikvonDienstleistungenop<br />
timale Organisationsform noch als historisch invariant und von Marktregulationsformen<br />
unbeeinflusst angesehen werden. Die Debatten, die beispielsweise zur Privatisierung der<br />
Telekommunikationsdienstegeführthaben,undähnlicheinjüngererZeitüberdieDeregu<br />
lierung personenbezogener Dienstleistungen stimulieren in der nachindustriellen Gesell<br />
schaft die Frage nach neuen institutionellen Regulierungsformen von <strong>Arbeit</strong> zwischen<br />
MarktundpolitischerSteuerung.<br />
DaDienstleistungsarbeitundarbeitsmärktestarkvonFrauenerwerbstätigkeitgeprägt<br />
sind(vgl.Abb.3),stehenvorallemdieammännlichenNormalarbeitsverhältnisorientierten<br />
Formender<strong>Arbeit</strong>smarktundInteressenregulationseitlangeminderKritik,dasssiedie<br />
spezifischen Bedürfnislagen weiblicher <strong>Arbeit</strong>kräfte verfehlten. Wie sehr das industriali
48 MartinBaethge<br />
stische Regulationsmodell auf der Betriebsebene funktionale Erfordernisse von Dienstleis<br />
tungsarbeitverfehlt,seianzweiBeispielen–BetriebsorganisationundZeitregime–sichtbar<br />
gemacht.<br />
<br />
3.1.1 ZurBetriebsorganisation<br />
Angesichts der ausgreifenden internen Tertiarisierung der Industrie (Ausbau von For<br />
schungundEntwicklungunddasMarktundKundenbereichs)sindDezentralisierungvon<br />
Verantwortlichkeit, organisatorische Verselbständigung oder Auslagerung von Dienstleis<br />
tungen,derWegzukleinerenEinheiten,sindAntwortenderUnternehmenaufdieseSitua<br />
tion,dieauchundnichtzuletztdurchdieneuenInformationsundKommunikationstechni<br />
kenbefördertwerden.Die„grenzenlosenUnternehmungen“(Picotetal.1998)der<strong>Zukunft</strong><br />
sindkeinegroßenTankermehr,sondernNetzwerkevoneigenständigoperierendenkleinen<br />
Einheiten(vgl.Reichwaldetal.2000).<br />
Eine Tendenz zu Großbetrieben beschränkte sich im Dienstleistungssektor lange Zeit<br />
auf die Zentralverwaltungen von Dienstleistungsunternehmen (z.B. Banken, Versicherun<br />
gen),Einzelhandel,Industrieverwaltungen).Sie<strong>hat</strong>seit1960erJahrendesletztenJahrhun<br />
dertsauchEinzugimGesundheitswesengefunden,bildetaberbisheutenichtdenPrototyp<br />
betrieblicherOrganisationindenDienstleistungsfelderninsgesamt.Entsprechenddemuno<br />
actuPrinzipvonErstellungundKonsumvonDienstleistungenistderGroßteilvonDienst<br />
leistungen,vorallemdiepersonenbezogenen,lokalgebunden.DieserSachverhaltsetztdem<br />
GrößenwachstumvonDienstleistungsbetriebeneineGrenze:Einzelhandelsgeschäfte,Hotels<br />
und Gaststätten oder Banken und Sparkassen, auch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen,<br />
Schulen und Kindergärten sind typischerweisein Klein,allenfalls Mittelbetrieben organi<br />
siert. Sowohl auf der Ebene des Produkts als auch der Organisation entstehen dadurch<br />
„quasinatürliche“BegrenzungenfürdieindustrialistischeOrdnung:aufderProduktions<br />
ebeneinRichtungStandardisierungundSkalenerträge,aufderEbeneder<strong>Arbeit</strong>sorganisa<br />
tioninRichtungHierarchisierungundTiefeder<strong>Arbeit</strong>steilung.<br />
BeideBegrenzungenhabenaufderSteuerungsebenederkommerziellenUnternehmen<br />
ReaktionenzurÜberwindungderGrenzenhervorgerufen.ZuihnengehörendieBündelung<br />
aller wichtigen Entscheidungen in der Unternehmenszentrale und detaillierte Steuerungs<br />
vorgaben für die Prozessorganisation auf der operativen <strong>Arbeit</strong>sebene der Betriebe, Stan<br />
dardisierung von Funktionen (z.B. in telekommunikativen Diensten wie Callcenter) oder<br />
vonProduktenundSortimenten(z.B.imEinzelhandel),verstärkteFunktionsdifferenzierung<br />
undTechnisierungder<strong>Arbeit</strong>sabläufe(vgl.dieBeiträgeinBaethge/Wilkens2001).Aufdie<br />
semWegkönnenauchbeiKleinbetriebensowohlSkalenerträgealsaucharbeitsorganisato<br />
rischeRationalisierungseffekteerzieltwerden–oftallerdingsumdenPreisvonQualitäts<br />
undServicereduktionundDequalifizierungdesPersonals.<br />
<br />
3.1.2 ZumZeitregime<br />
Auch das Zeitregime des Industrialismus folgt der Logik einer bestimmten Entwicklungs<br />
phasestarkmechanisierterundautomatisierterProduktion.Dassdierigide,fremdbestimm<br />
teZeitorganisationdesindustriellenFabrikregimeseinbesondererStimulusfürKreativität<br />
und innovative Ideen wäre, die bei einer immer stärker informations, forschungs und<br />
wissensbasierten Ökonomie zunehmend wichtiger werden, widerlegtein Blick aufdie In
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 49<br />
novationszentren. Wer sich die Zeitorganisation in Forschungslabors (vgl. Kalkowski/<br />
Mickler2009)oderSoftwarebetrieben(Reichwaldetal.2004)anschaut,wirdindenerfolg<br />
reichsten gerade nicht die industriellen Muster von Zeit und <strong>Arbeit</strong>sorganisation vorfin<br />
den.Folglichhabensichlängstandere,stärkerindividualisierteFormenderLeistungssteue<br />
rungundkontrolledurchgesetztalsdieStechuhr.<br />
FürmoderneDienstleistungenfastjedwedenTypstreffendieBedingungendesindust<br />
riellenZeitregimes 9 nichtnurnichtzu,dieÜbertragungderZeitordnungerweistsichinvie<br />
lenFällensogaralsdysfunktional.Diesnichtallein,weilindenmeistenDienstleistungsbe<br />
reichenkeineMaschinenlaufzeitenden<strong>Arbeit</strong>srhythmusbestimmen,sondernweilmoderne<br />
TechnikundDienstleistungsfunktioneneffizientereundflexiblere<strong>Arbeit</strong>szeitensowohler<br />
fordernalsauchermöglichen.StelltedieindustrielleProduktionstechnikeinerelativstarre<br />
Technologie dar, welche Raumgebundenheit der <strong>Arbeit</strong>skräfte verlangt, so zeichnet sich<br />
moderneInformationsundKommunikationstechnikalsdieBasistechnologieindenDienst<br />
leistungengeradedadurchaus,dasssiedieRaumundZeitbindungder<strong>Arbeit</strong>aufzulösen<br />
gestattetunddamitvielfältigeMöglichkeitenderZeitorganisationeröffnet–vondiversen<br />
FormenderTeilzeitarbeitbishinzuräumlichzwischenBetriebundWohnungverteilterAr<br />
beit(vgl.Reichwaldetal.2001).<br />
Auchvonder BeschäftigtenseiteerscheintdastraditionelleZeitregimewenigbedürf<br />
nisangemessen.VielleichtwardiesauchfrüherinderHochzeitderIndustriegesellschaftder<br />
Fall – zumindest soweit es Schicht und Nachtarbeit betraf. Heute aber, nachdem mit<br />
Durchsetzung der Dienstleistungsökonomie auch die Frauenerwerbstätigkeit angestiegen<br />
ist,stelltsichdasProblemeinerZeitorganisation,dieeinebessereVereinbarkeitvon<strong>Arbeit</strong><br />
und Privatleben gestattet, mit einem höheren gesellschaftlichen Druck, und das nicht nur<br />
für weibliche <strong>Arbeit</strong>skräfte. Flexiblere Zeitstrukturen könnten beiden Seiten, den Kunden<br />
oderKlientenunddenBeschäftigten,zugutekommen.AllerdingsbestehtdieKehrseiteder<br />
FlexibilisierungderZeitstrukturenoftindemAusbauauchunfreiwilligerTeilzeitarbeitund<br />
geringfügiger Beschäftigung, die heute in den Dienstleistungsbranchen stärker vertreten<br />
sindalsinderIndustrie.AndemNiedriglohnanteilandenBeschäftigtenderWirtschafts<br />
zweigelässtsichdieKehrseitederFlexibilisierungveranschaulichen.DieNiedriglohnantei<br />
le,diesichnachKalina/Weinkopf(2008)nichtalleinaufunqualifizierteodergeringqualifi<br />
zierteBeschäftigtebeziehenundübereinFünftelderBeschäftigteninDeutschlandausma<br />
chen,konzentrierensichüberproportionalaufdieDienstleistungsberufsfelder(vgl.Abb.4).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
9ZudenBedingungensindzurechnen:hochgradigstandardisierteProduktionsabläufe,maschinenge<br />
bundene<strong>Arbeit</strong>,großbetrieblicheKooperationvonBelegschaften(vgl.Baethge2001).
50 MartinBaethge<br />
Abbildung4: NiedriglohnanteilnachausgewähltenWirtschaftsgruppen2006(inProzent)<br />
Produzierendes Gewerbe<br />
Bauwirtschaft<br />
Infrastruktur- und<br />
Transportdienstleistungen<br />
Unternehmensnahe<br />
Dienstleistungen<br />
Marktvermittelnde<br />
Dienstleistungen<br />
Haushalts- und<br />
personenbezogene<br />
Dienstleistungen<br />
Gesamt (Deutschland)<br />
in %<br />
Quelle:Kalina/Weinkopf2008:453.<br />
14,7<br />
19,7<br />
15,4<br />
4 Qualifikationsanforderungsprofilevon<br />
Dienstleistungsbeschäftigung<br />
29<br />
27,1<br />
25,3<br />
22,2<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
BeiallerHeterogenitätvonDienstleistungstätigkeitenlassensichinderQualifikationsstruk<br />
turdochUnterschiedezurindustriellen<strong>Arbeit</strong>erkennen.Sieberuhenaufzweiqualifikatori<br />
schen Basisdimensionen, die gegenüber früheren Zeiten zwar für Erwerbsarbeit nicht<br />
grundsätzlichneu,aberinihremGewichtundihrerAusgestaltungfürdiealltägliche<strong>Arbeit</strong><br />
docheineneueStufedarstellen:KommunikationundWissen.<br />
<br />
WarKommunikationimBereichderErwerbsarbeitinfrüherenPhaseneineFormder<br />
<strong>Arbeit</strong>zurHerstellungvonProdukten,sowirdsiebeiDienstleistungendarüberhinaus<br />
zumInhaltderTätigkeitselbst.SiebeziehtsichdamitnichtvorrangigaufdieKoopera<br />
tionmitMitarbeitern,VorgesetztenundKollegenindergemeinsamenBearbeitungei<br />
nesGegenstandsodereinerAufgabe,sondernaufKundenundKlientenalsInteressen<br />
tenanundAdressatenvonDienstleistungen.InvielenFeldernistdieKommunikation<br />
dieDienstleistungselbst,fälltErstellungundKonsumtionderLeistungineinemAkt<br />
zusammen.DiesgiltbeispielsweisefüralleBeratungs,Lehr,Lern,undTherapieleis<br />
tungen.InderPerspektiveaufKunden/KlientenwandeltKommunikationihrenCha<br />
rakter,siewirdinhaltlichvielfältigerdimensioniertundumfassteinbreitesSpektrum<br />
vonPersonen,derenBedürfnisseundEigentümlichkeitenzuerfassenundzuberück<br />
sichtigensind.
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 51<br />
Wissen: Industrie und nachindustrielle Gesellschaft unterscheiden sich nicht darin,<br />
dassletzterewissensbasiertist,erstereabernicht.DerUnterschiedliegtindemWandel<br />
derWissensformenundderDynamikderWissensveränderung.DerWandelderWis<br />
sensformenistoftalseinsolchervonErfahrungswissenzutheoretischemoderanalyti<br />
schenWissenodervonimplizitemzuexplizitemWissen(Nonaka/Takeuchi1997)cha<br />
rakterisiertworden.EinesolcheKlassifizierungtrifftdenSachverhaltnichtgenau,weil<br />
essichnichtumdieErsetzungvonErfahrungdurchschulischgelerntesWissenhan<br />
delt, sondern um ein neues Mischungsverhältnis von arbeitsintegrierten und erfah<br />
rungsbasierten Aneignungsprozessen von Wissen und Handlungskompetenzen auf<br />
dereinenundsystematischundaußerhalbvon<strong>Arbeit</strong>sprozessenerworbenemWissen<br />
und theoretischem Reflexionsvermögen auf der anderen Seite. Letzteres bildet heute<br />
mehr und mehr die Voraussetzung dafür, überhaupt Erfahrungen im <strong>Arbeit</strong>sprozess<br />
machen zu können. Deswegen kann man das explizite Wissen, gesellschaftlich gese<br />
hen,alsdiedominanteWissensformbezeichnen(vgl.Bell1975).<br />
<br />
Untersuchungen über die Qualifikationsanforderungen an Erwerbstätige in den unter<br />
schiedlichen Beschäftigungssektoren scheinen die theoretischen Annahmen zur Verschie<br />
bungderQualifikationenzubestätigen.Tabelle1zeigt,dassdieAnforderungenansoziale<br />
Kompetenzen deutlich nach den drei Hauptsektoren der Beschäftigung gestaffelt sind. In<br />
allen vier geprüften Dimensionen der Sozialkompetenz weisen die Produktionsberufe die<br />
niedrigsten,diesekundärenDienstleistungsberufediedurchgängigmehralsdoppeltsoho<br />
henhöchstenBesetzungenauf,währenddieprimärenDienstleistungeninderMitteliegen.<br />
Die Differenzen reflektieren den Sachverhalt, dass es sich bei den sekundären Dienstleis<br />
tungenüberwiegendumTätigkeitendesTypus„UmgangmitMenschen“handelt(Gesund<br />
heitsundSozialberufe,ErziehungsundWissenschaftsberufstätigkeiten).<br />
<br />
Tabelle1: AnforderungenanSozialkompetenzen<br />
Andere über-zeugen<br />
und Kompromisse<br />
aushandeln<br />
Quelle:Hall2007:180;eigenePräsentation.<br />
Freie Reden oder<br />
Vorträge halten<br />
Kontakt zu Kunden,<br />
Klienten oder<br />
Patienten<br />
Besondere<br />
Verantwortung für<br />
andere Menschen<br />
Produktionsberufe<br />
Primäre<br />
21,9 4,8 29,6 24,6<br />
Dienstleistungsberufe<br />
Sekundäre<br />
30,4 9,8 63,5 33,3<br />
Dienstleistungsberufe 55,8 29,5 70,5 57,7<br />
Gesamt 38,3 16,4 57,9 40,8<br />
<br />
Ähnlich,wennauchmitwenigerstarkenDifferenzenzwischendendreiSektoren,verhältes<br />
sichmitdenAnforderungenanMethodenkompetenzen,diemanalseinenKernbereichsys<br />
tematischen Wissens betrachten kann. Auch bei ihnen weisen die Produktionsberufe im<br />
Durchschnitt die niedrigsten, die sekundären Dienstleistungsberufe die höchsten Anteile<br />
auf (vgl. Tab. 2). Man kann die Verteilungen der Tabelle 2 als Beleg dafür nehmen, dass<br />
DienstleistungsberufeinderRegelhöhereWissenskompetenzenalsProduktionstätigkeiten
52 MartinBaethge<br />
verlangen,dasssichaberauchindiesendiezunehmendeWissensbasierungder<strong>Arbeit</strong>sab<br />
läufedurchsetzt.<br />
<br />
Tabelle2: Anforderungen an Methodenkompetenzen<br />
Quelle:Hall2007:180;eigenePräsentation.<br />
<br />
DieQualifikationsanforderungender<strong>Arbeit</strong>splätzelassensichineinemzweitenSchrittzu<br />
komplexeren Qualifikationsniveaus, die ein Erwerbstätiger für den von ihm wahrgenom<br />
menen <strong>Arbeit</strong>splatz mitbringen muss, verdichten. Die Betrachtung des qualifikatorischen<br />
AnforderungsniveausinsgesamtgibtAufschlussüberdieDifferenzenimQualifikationsni<br />
veausowohlzwischendenindustriellgewerblichenunddenDienstleistungsberufsfeldern<br />
alsauchinnerhalbderDienstleistungstätigkeiten.NachHall(2007)lässtsichdasNiveauder<br />
QualifikationsanforderungenderTätigkeitenindreiStufenunterteilen 10 :(1)Tätigkeiten,die<br />
keine abgeschlossene Ausbildung voraussetzen und auf Basis kurzer Einarbeitungszeiten<br />
ausgeübtwerdenkönnen;(2)Tätigkeiten,fürdieeineabgeschlossenedualeoderschulische<br />
Berufsausbildungerforderlichist(inklusiveMeister,TechnikerodergleichwertigerFach<br />
schulabschluss) 11 ;(3)Tätigkeiten,fürdieeinHochoderFachhochschulabschlussinderRe<br />
gelnötigist.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Schwierige<br />
Sachverhalte<br />
vermitteln<br />
UnvorhergeseheneProbleme<br />
lösen<br />
Schwierige<br />
Entschei-dungen<br />
treffen<br />
Wissens-lücken<br />
er-kennen und<br />
schließen<br />
Sehr viele<br />
versch. Aufgaben<br />
zu<br />
erledigen<br />
Produktionsberufe<br />
Primäre<br />
18,7 44,1 34,0 20,8 63,2<br />
Dienstleistungsberufe<br />
Sekundäre<br />
25,5 40,8 32,0 21,7 65,2<br />
Dienstleistungsberufe 60,6 67,7 55,6 39,0 81,4<br />
Gesamt 37,7 52,2 41,8 28,3 71,1<br />
<br />
10 Zur Differenzierung wurde ein komplexer subjektiver Ansatz verwendet, d.h. die Erwerbstätigen<br />
wurdengefragt,welcheArtvonAusbildungfürdievonihnenausgeübteTätigkeitinderRegelerfor<br />
derlich ist (abgeschlossene Ausbildung, Fachhochschul oder Universitätsabschluss, Fortbildungsab<br />
schlussoderkeinAusbildungsabschluss);ergänzendwurdedieStellunginBetrieb,dieDauerderEi<br />
narbeitungszeitundderBereichbesondererKurseherangezogen(vgl.Hall2007:165).<br />
11HallführtdenFortbildungsabschlusszunächstalsseparateQualifikationsstufe.
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 53<br />
Tabelle3: BerufsfeldernachQualifikationsanforderungsniveauder<strong>Arbeit</strong>splätze<br />
Qualifikationsniveau 2004<br />
Berufsfelder<br />
Kein Berufs-<br />
Berufs- Akademischer<br />
abschluss ausbildung1) Abschluss<br />
1 Land-, Tier-, Forstwirtschaft, Gartenbau 12,7 81,1 6,1<br />
2 Bergleute, Mineralgewinner 11,8 88,2<br />
3 Steinbearbeitung, Baustoffherstellung, Keramik-, Glasberufe 29,7 70,3<br />
4 Chemie-, Kunststoffberufe 35,2 64,8<br />
5 Papierherstellung, -verarbeitung, Druck 22,8 74,3 3,0<br />
6 Metallerzeugung, -bearbeitung 15,3 84,7<br />
7 Metall-, Anlagenbau, Blechkonstruktion, Installation, Montierer/-innen 19,8 80,1 0,2<br />
8 Industrie-, Werkzeugmechaniker/-innen 8,1 91,7 0,2<br />
9 Fahr-, Flugzeugbau, Wartungsberufe 7,7 91,8 0,5<br />
10 Feinwerktechnische, verwandte Berufe 5,6 92,2 2,2<br />
11 Elektroberufe 4,8 94,7 0,5<br />
12 Spinnberufe, Textilhersteller/-innen, Textilveredler/-innen 41,7 58,3<br />
13 Textilverarbeitung, Lederherstellung 27,8 72,2<br />
14 Back- Konditor-, Süßwarenherstellung 17,6 81,3 1,1<br />
15 Fleischer/innen 20,9 79,1<br />
16 Köche und Köchinnen 38,3 61,7<br />
17 Getränke, Genussmittelherstellung, übrige Ernährungsberufe 32,7 67,3<br />
18 Bauberufe, Holz-, Kunststoffbe- und -verarbeitung 11,8 88,0 0,2<br />
19 Warenprüfer/-innen, Versandfertigmacher/innen 50,0 49,1 0,9<br />
20 Hilfsarbeiter/-innen o.n.T. 71,7 28,3 0,0<br />
21 Ingenieure und Ingenieurinnen 0,5 9,3 90,3<br />
22 Chemiker/-innen, Physiker/-innen, Naturwissenschaftler/-innen 2,4 9,6 88,0<br />
23 Techniker/-innen 1,6 89,8 8,6<br />
24 Technische Zeichner/innen, verwandte Berufe 100,0<br />
25 Vermessungswesen 5,7 74,3 20,0<br />
26 Technische Sonderkräfte 5,5 90,4 4,1<br />
27 Verkaufsberufe (Einzelhandel) 31,8 67,8 0,4<br />
28 Groß-, Einzelhandelskaufleute 6,5 85,0 8,5<br />
29 Bank-, Versicherungsfachleute 1,1 84,3 14,6<br />
30 Sonstige kaufmänn. Berufe (ohne Groß-, Einzelh., Kreditgewerbe) 8,0 78,6 13,4<br />
31 Werbefachleute 5,8 48,4 45,8<br />
32 Verkehrsberufe 36,7 62,9 0,5<br />
33 Luft-, Schifffahrtsberufe 12,9 67,7 19,4<br />
34 Packer/-innen, Lager-, Transportarbeiter/-innen 48,5 50,6 0,9<br />
35 Geschäftsführung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung 1,1 44,1 54,8<br />
36 Verwaltungsberufe im ÖD 2,2 62,1 35,7<br />
37 Finanz-, Rechnungswesen, Buchhaltung 4,8 70,6 24,6<br />
38 IT-Kernberufe 1,2 47,8 51,0<br />
39 Kaufmännische Büroberufe 9,3 85,0 5,7<br />
40 Bürohilfsberufe, Telefonisten und Telefonistinnen 37,3 56,2 6,4<br />
41 Personenschutz-, Wachberufe 33,3 65,8 0,9<br />
42 Hausmeister/-innen 25,0 75,0<br />
43 Sicherheitsberufe 2,5 61,5 36,0<br />
44 Rechtsberufe 20,3 79,7<br />
45 Künstler/-innen, Musiker/-innen 14,5 47,4 38,2<br />
46 Designer/-innen, Fotografen und Fotografinnen,Reklamehersteller/-innen 7,2 54,2 38,6<br />
47 Gesundheitsberufe mit Approbation 0,5 9,0 90,5<br />
48 Gesundheitsberufe ohne Approbation 5,2 92,5 2,4<br />
49 Soziale Berufe 6,5 53,8 39,7<br />
50 Lehrer/-innen 1,7 13,1 85,2<br />
51 Publ., Bibliotheks-, Übersetzungs-, verw. Wissenschaftsberufe 10,3 28,6 61,1<br />
52 Berufe in der Körperpflege 1,8 98,2<br />
53 Hotel-, Gaststättenberufe, Hauswirtschaft 39,3 59,4 1,3<br />
54 Reinigungs-, Entsorgungsberufe 72,9 27,1 0,0<br />
Gesamt 14,8 65,4 19,8<br />
Quelle:Tiemannetal.2008:23f.<br />
<br />
NachdieserDreierstufungderQualifikationsniveauszeigtsich,dassfürdieüberwiegende<br />
Zahl der landwirtschaftlichen und gewerblichtechnischen Berufsfelder (in Tab. 3 die Be<br />
rufsgruppen118und20)einmittlererAbschluss schulischeroderdualerAusbildungdie<br />
Regelvoraussetzung für die Wahrnehmung einer Tätigkeit bildet, nur selten ein akademi<br />
scherAbschlussgefordertwird,aberinfünfBerufsfeldern(4,12,16,17,20)einDritteloder<br />
mehrBeschäftigtekeinerAusbildungbedürfen(vgl.Tab.1).<br />
ImGegensatzzudengewerblichtechnischenBerufsfeldernweisendiederDienstleis<br />
tungstätigkeiten (Berufsfelder 19 sowie 2154) ein weniger einheitliches Qualifikationsni<br />
veauauf.Zwardominierenauchhierin23von35Berufsfeldernmitjeweilsüber50Prozent<br />
der Erwerbstätigen der mittlere Abschluss, aber gleichzeitig finden sich acht Berufsfelder<br />
mit überwiegend akademischem Qualifikationsniveau und kommt es insgesamt zu einer<br />
doppelten Polarisierung: zum einen zwischen Berufsfeldern mit hohen Anteilen mittlerer
54 MartinBaethge<br />
und niedriger Qualifikationsanforderungen, zum anderen zwischen solchen mit mittleren<br />
undhohenAnforderungen(vgl.Tab.3).<br />
InterpretiertmandasQuerschnittsbildalsErgebniseinerlängerfristigenEntwicklung,<br />
so lässt sich der Strukturwandel zur Dienstleistungsbeschäftigung ziemlich eindeutig als<br />
TrendzurErhöhungdesdurchschnittlichenQualifikationsniveausklassifizieren.Dassdie<br />
ser Trend aber nicht als geradliniger Weg zur Höherqualifizierung gedeutet werden darf,<br />
davonzeugendiequantitativbedeutsamenArealegeringqualifizierter<strong>Arbeit</strong>indenReini<br />
gungs und Entsorgungsberufen, bei den Bürohilfs, den Lager und Transporttätigkeiten,<br />
den Verkaufs, Verkehrsberufen und den Tätigkeiten im Hotel und Gaststättengewerbe<br />
sowiederHauswirtschaft,selbstbeieinigenSozialundPflegeberufen(vgl.Tab.3). 12 Bezo<br />
gen auf die Berufsfeldsystematik die zwar nicht mit einer Sektoren und Branchengliede<br />
rungderErwerbstätigkeitgleichzusetzen,wohlaberaufsiebeziehbarist 13 ,lässtsichfürden<br />
Dienstleistungssektor festhalten, dass bei Dominanz des mittleren Qualifikationssegments<br />
in der Erwerbsstruktur Tätigkeiten auf akademischem Niveau zunehmen, zugleich aber<br />
auch ein nicht unbeträchtlicher Sockel geringqualifizierter <strong>Arbeit</strong> bleibt. Die Polarisierung<br />
derQualifikationsstrukturimDienstleistungssektorerweistsichmehralseinezwischenden<br />
BerufsfeldernalsinnerhalbeinesBerufsbereichs.<br />
5 Fazit–Dienstleistungstätigkeitenalsinteraktive<strong>Arbeit</strong>:<br />
EntfremdungundProfessionalisierung<br />
Woimmersieauchausgeübtwerden:fastüberallsindDienstleistungstätigkeiteninteraktive<br />
<strong>Arbeit</strong>. 14 Dasheißteine<strong>Arbeit</strong>,dieunmittelbarbedürfnisbezogenaufeinkonkretesGegen<br />
übergerichtetist,dessenWilledieRichtschnurfürdas<strong>Arbeit</strong>shandelnabgibt,selbstwenn<br />
derWillenichtinpräzisen<strong>Arbeit</strong>sanweisungenartikuliertwerdenkann.DasBedürfnisdes<br />
<br />
12DasAusmaßderTätigkeitenmitniedrigerQualifikationistinsgesamtuntergewichtet,daPersonen<br />
miteiner<strong>Arbeit</strong>szeitvonunterzehnWochenstundennichtindiezugrundeliegendeStichprobeeinbe<br />
zogenwordensind.DieAutorenschätzenaufBasisdesMikrozensus,dasssichderAnteilderGering<br />
qualifizierten an allen Erwerbstätigen bei Einbeziehung der Gruppe mit unter zehn Wochenstunden<br />
<strong>Arbeit</strong>szeitumzweiProzentpunkteaufinsgesamt17Prozenterhöhenwürde(vgl.Tiemannetal.2008:<br />
23).<br />
13 Die Abweichungen betreffen vor allen die Tätigkeiten auf dem Niveauvon Hochschulabschlüssen,<br />
vondenenvieleausdenBerufsfeldern21(Ingenieure),22(Naturwissenschaftlerinnen),35(Geschäfts<br />
führungu.a.)und38(ITKernberufedemsekundärenSektorbzw.denIndustriebranchen),zuzuordnen<br />
sind,aberinderüberwiegendenZahlalsDienstleistungstätigkeiten.<br />
14Mankönnteargumentieren,dassdieInteraktivitätfürdieFüllevonHintergrundsoderbackoffice<br />
TätigkeitenbeistarkarbeitsteiligenDienstleistungsorganisationenz.B.imEinzelhandeloderinBanken<br />
und Versicherungsinnendiensten keine Bedeutung <strong>hat</strong>, weil ihnen der unmittelbare Kundenkontakt<br />
fehlt.BiszueinemgewissenGradistdasArgumentstichhaltig,aberebennurbiszueinemgewissen<br />
Grad.IndemMaße,indembeistarkarbeitsteiligorganisiertenDienstleistungsprozessenderKunden<br />
kontakt auf Vorleistungen aus dem „Hintergrund“ angewiesen ist, gilt auch für die entsprechenden<br />
UnterstützungstätigkeiteneineindirekteInteraktivität.Unmittelbareinsichtiglässtsichdasschonseit<br />
langem im Verhältnis von Innen und Außendienst bei Versicherungen zeigen (vgl. relativ früh<br />
Baethge/Oberbeck1986:237ff.).
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 55<br />
Gegenüber–handeleessichumeinenKundenimWarenaustausch,umeinenKlientenim<br />
BeratungsundBetreuungsgeschäftodereinenPatientenimPflegeundGesundheitswesen<br />
– zu präzisieren und gemeinsam Wege zu seiner Befriedigung zu erarbeiten, macht den<br />
KernderInteraktivitätvonDienstleistungsarbeitaus.DementsprechendistdieArenavon<br />
Dienstleistungsarbeit auch nicht ein anonymer Markt wie für den Großteil von Industrie<br />
produkten15 ,sonderndiepersönlicheKommunikation,wieimmerdieseauchgestaltetist–<br />
obalsfacetofaceoderdurchtechnischeMedienvermittelteKommunikation.<br />
DiebesondereQualitätderInteraktivitätfürdieBeziehungzwischen<strong>Arbeit</strong>skraftund<br />
Dienstleistungskonsumenten haben früh Badura/Gross (1977) mit der Figur des Kun<br />
den/Patienten als KoProduzent der Dienstleistung herausgearbeitet: Am ArztPatienten<br />
VerhältniswirdjenerGrundsachverhaltinteraktiverDienstleistungsarbeitdeutlich,dassalle<br />
Kompetenz und Einsatzintensität des Dienstleistungsarbeiters ins Leere zu laufen droht,<br />
wenn der Patient/Klient nicht seinen Teil zum Gelingen beiträgt. Das Theorem des<br />
KoproduzententumslässtsichauffastallepersonenbezogenenDienstleistungenanwenden<br />
–vonderKindergartenarbeit(imVerhältniszuKindundEltern)überdieSchulezujedwe<br />
der Form therapeutischen Handelns bis hin zur Betreuung alter Menschen. Das Theorem<br />
<strong>hat</strong> aber auch Bedeutung für alle anderen Spielarten von Beratung. Nicht zuletzt an der<br />
Interaktivität der Dienstleistungsarbeit haben sich Hoffnungen auf soziale Emanzipation<br />
orientiert,dieGrossdieFragestellenließ,obdieVerheißungderDienstleistungsgesellschaft<br />
„sozialeBefreiungoderSozialherrschaft“sei(soderTitelseinesBuchesvon1983).<br />
Eswärezukurzgegriffen,sozialemanzipativeEffekteoderauchnureinenachhaltige<br />
VerbesserungdersozialenSituationderMehrheitinderGesellschaftalsSelbstläuferdessä<br />
kularenWandelszuinteraktiver(Dienstleistungs)<strong>Arbeit</strong>zuerwarten.Esbedarfdazupoli<br />
tischerundsozialerGestaltungderDienstleistungsmärkteundarbeitsverhältnisse16 ,umdie<br />
zweitePerspektivederaltenFragevonGross,sozialeAbhängigkeitundökonomischeÜber<br />
fremdungdesPrivaten,zuverhindern.<br />
InjüngsterZeit<strong>hat</strong>dieDebatteüberdieRollevonKundenundKlientenininterakti<br />
ven <strong>Arbeit</strong>sprozessen im Zusammenhang von Internetnutzung und Internetdiensten eine<br />
Neuauflage in der Kategorie des „Prosumenten“ (prosumer) erfahren (vgl. Blättel<br />
Mink/Hellmann2010).AusgehendvondemBegriffdes„prosumer“vonToffler(1980)wird<br />
auchhiernichtswenigerbehauptetalsdasHeraufkommeneinerneuenKulturundZivilisa<br />
tion,diedurcheinhohesMaßan„productionforselfuse“,durchselbstbestimmte<strong>Arbeit</strong><br />
undPartizipationandenHerbzw.Erstellungsprozessengeprägtist–nichtnur,abervor<br />
allemdurchdieneuenelektronischenMedien(vgl.Hellmann2010:14ff.).IndieserDebatte<br />
verwischen die Grenzen zwischen Industriearbeit und Dienstleistungen, da in beiden Ar<br />
beitssphärendiemedialenKommunikationsweisensichangeglichenhaben.Gegeneineall<br />
zuüberschwänglicheEuphorieüberneuePartizipationsundSelbstbestimmungsgradedes<br />
<br />
15SelbstinderindustriellenProduktionistimZusammenhangderInternetNutzungfüreinekunden<br />
nahe, eventuell sogar individualisierte Produktion die Interaktivität als Wertschöpfungsmodus ent<br />
deckt(Reichwald/Piller2006).Allerdingsbeziehtsichdiesewenigeraufdie<strong>Arbeit</strong>sebenealsvielmehr<br />
aufdiezwischenKundenundUnternehmen.<br />
16HierscheintnurderwesentlicheUnterschiedzudemaufdieMikroprozesseabhebendeninterakti<br />
onstheoretischenKonzeptvon„interaktiver<strong>Arbeit</strong>“vonDunkel/Weihrich(2010)zuliegen,dasdiesys<br />
temischenMakroaspekteausblendet.
56 MartinBaethge<br />
ProsumentengebenHanekop/WittkemiteinerReihevonBeispielenzubedenken,dassauch<br />
inderInternetökonomiedieSelbstbedienung„marktvermittelt“seiundofteineneueStufe<br />
derRationalisierungderKundenschnittstelledarstelle(Hanekop/Wittke2010:102).AmBei<br />
spiel„kollaborativerProduktion“vonnichtkommerziellorientierteninternetcommunities<br />
wie Wikipedia und OpenSourceSoftware (OSS) Nutzergemeinschaften skizzieren sie die<br />
BedingungeneinergleichberechtigtenProduktionundKonsumtionvonInternetangeboten.<br />
GegenüberdenMöglichkeiten,dieseBedingungeninkommerziellenundkommodifizierten<br />
Prozessenzurealisieren,bleibensieeherskeptisch.<br />
MitderEntwicklungzurDienstleistungsökonomiekönntedieKategoriederEntfrem<br />
dunginder<strong>Arbeit</strong>eineneueDimensiongewinnen.Marx<strong>hat</strong>tesieausdenMomentender<br />
VergegenständlichungunddesPrivateigentums vor dem Hintergrund frühindustrieller Ar<br />
beitsformenbegründet:Entfremdete<strong>Arbeit</strong>entstehtausderEntäußerungdes<strong>Arbeit</strong>enden<br />
ineinenGegenstand,derihmselbstnichtgehörtundihmfremdgegenübertritt(vgl.MEW<br />
Ergänzungsband1844/1968,S.512ff.).Marx<strong>hat</strong>teEntfremdungalsobjektivenStrukturtatbe<br />
standdeskapitalistischen<strong>Arbeit</strong>sverhältnissesgefasst,obwohlerihninBegriffensubjekti<br />
verWahrnehmungundBefindlichkeitbeschreibt. 17 Inderkritischen<strong>Arbeit</strong>sundIndustrie<br />
soziologieistimmerwieder versuchtworden,dieprozessualeSeiteundsubjektiveErfah<br />
rungsdimension von Entfremdung zu operationalisieren und empirischer Erfassung zu<br />
gänglich zu machen. Im Zentrum standen dabei die extremen, tayloristischen <strong>Arbeit</strong>stei<br />
lungsformen,diezuDequalifizierung,Reduktionkomplexer<strong>Arbeit</strong>svollzügeaufeinfachste<br />
Handgriffe,EinschränkungvonHandlungsspielräumeninder<strong>Arbeit</strong>,Minimierungderin<br />
dividuellenVerantwortungzugunstenexterner(auchtechnischer)SteuerungderProzesse<br />
unddamitauchzuMotivationszerstörungführte(vgl.u.a.Bravermann).DassmitdenFor<br />
menrestriktiver<strong>Arbeit</strong>dieSubjektivitätdes<strong>Arbeit</strong>ersundeineIdentifikationmitderTätig<br />
keitinjenervonderEntfremdungskategoriedesfrühenMarxhypostasiertenWeisetatsäch<br />
lichausgelöschtwordenwäre,<strong>hat</strong>sichinderRadikalitätempirischnichtbestätigt.Zudem<br />
zeigtdieneuereIndustriesoziologie,dassdietayloristische<strong>Arbeit</strong>szerlegungnichtdasnon<br />
plusultrader<strong>Arbeit</strong>steilungintechnischhochentwickeltenProduktionsprozessenist.Viel<br />
faltundpartielleRücknahmerestriktiver<strong>Arbeit</strong>enprägendiecomputerbasierteIndustrie<br />
produktion (Kern/Schumann 1970, 1984; Piore/Sabel 1985; Schumann et al. 1994). Da aber<br />
auchdieskeineindeutigindie<strong>Zukunft</strong>verlängerbarerTrendistundrestriktiveFormender<br />
<strong>Arbeit</strong>immerwiederneuentstehen(Schumann2000,2004),bleibtdasMenetekelderEnt<br />
fremdungaufderAgenda.<br />
AufgrunddesinteraktivenCharaktersvonDienstleistungsarbeitgewinntdasEntfrem<br />
dungsMenetekeleineneueQualitätderBedrohlichkeit,weilhierentfremdete<strong>Arbeit</strong>nicht<br />
die<strong>Arbeit</strong>endenalleinbetrifft,sondernebensodieKonsumentenihrer<strong>Arbeit</strong>.DemKäufer<br />
materiellerProduktekannesletztendlichgleichgültigsein,inwiestarkentfremdetenFor<br />
menvonIndustriearbeiteinAutoodereinComputerproduziertwordensind,sofernihre<br />
<br />
17Die„Entäußerungder<strong>Arbeit</strong>“bestehtdarin,„dassdie<strong>Arbeit</strong>dem<strong>Arbeit</strong>eräußerlichist,d.h.nichtzu<br />
seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner <strong>Arbeit</strong> nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl,<br />
sondernunglücklichfühlt,keinefreiephysischeundgeistigeEnergieentwickelt,sondernseinePhysis<br />
abkasteitundseinenGeistruiniert.Der<strong>Arbeit</strong>erfühltsichdahererstaußerder<strong>Arbeit</strong>beisichundin<br />
der<strong>Arbeit</strong>außersich.ZuHauseister,wennernichtarbeitet,undwennerarbeitet,isternichtzuHau<br />
se“(MEWErgänzungsband,Schriftenbis1844,ErsterTeil,Berlin1968,S.514).
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 57<br />
technische Qualität und Funktionstüchtigkeit gesichert sind. Bei interaktiver Dienstleis<br />
tungsarbeit ist das anders. Hier gefährdet Standardisierung der Leistungsangebote und<br />
hochgradige<strong>Arbeit</strong>steilungimDienstleistungsprozessunterUmständenschnelldieQuali<br />
tätderBetreuungoderBeratungunduntergräbtdasVertraueninKompetenzundKommu<br />
nikation.ImAlltag<strong>hat</strong>dieseErfahrungjederschoneinmalgemacht,derbeistationärerBe<br />
handlungimKrankenhausOpferarbeitsteiligerKompetenzenundschlecht(weilzudetail<br />
liert)koordinierterDienstplänegewordenist,oderdenmaninÄmternvonPontiuszuPila<br />
tusgeschickt<strong>hat</strong>.DieBeispielesindbeliebiginanderenDienstleistungsbereichenfortsetzbar<br />
– etwa bei Informationsvermittlung in CallCenter oder bei Strukturvertrieben von Versi<br />
cherungen.<br />
DergemeinsameNennermehroderwenigeralleranführbarerBeispielebestehtdarin,<br />
dassDienstleistungsarbeitausihreminteraktivenCharakterherausGrenzenfür<strong>Arbeit</strong>stei<br />
lung, Standardisierung und Dequalifizierung gesetzt sind. Diese Grenzen variieren von<br />
DienstleistungsbereichzuDienstleistungsbereichundsindschwerzubestimmen.Siehaben<br />
in der Regel etwas zu tun mit der Komplexität des Problems, das in der Interaktion zwi<br />
schen Dienstleister und Kunden/Klienten gelöst werden soll. In jedem Fall aber steht bei<br />
Entscheidungenüber<strong>Arbeit</strong>steiligkeit,StandardisierungundTechnisierungvonDienstleis<br />
tungendieQualitätderBedürfnisbefriedigungundKommunikationsformeninderGesell<br />
schaftmitaufdemSpiel.DiesgiltinsbesonderefürpersonenbezogeneDienstleistungen,die<br />
zumgrößtenTeilausgelagerteundkommodifizierteFunktionenvonPrivathaushaltenbe<br />
treffen(z.B.Erziehung,Pflege,Betreuung,Verköstigung).<br />
DienstleistungsarbeitvollziehtsichaufdereinenSeite–umaufdiemarxscheEntfrem<br />
dungskategorie zurückzukommen – nicht in der „Entäußerung an den Gegenstand“, son<br />
dern<strong>hat</strong>einkonkretesGegenüber,dasimmerwiederspontaneInteraktionenherausfordert,<br />
was ein anderes Verhältnis zur <strong>Arbeit</strong> konstituiert als die Bearbeitung toter Gegenstände.<br />
Ähnlichlässtsichargumentieren,dassauchdaszweitekonstitutiveMerkmalderEntfrem<br />
dungskategorie, das Privateigentum, auf viele, zumal personenbezogene Dienstleistungen<br />
nichtzutreffe.DiesfreilichsetztdasEntfremdungsproblemnichtautomatischaußerKraft,<br />
daimZugejenervonDörreartikulierten„qualitativen“Landnahmedieprivatwirtschaftli<br />
chen<strong>Arbeit</strong>steilungsundOrganisationsmusterlängstinvielenöffentlichenundhalböffent<br />
lichen Beschäftigungsfeldern Eingang gefunden haben und die <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse dort<br />
ähnlichprägenwieinderPrivatwirtschaft(vgl.Datheetal.2009).<br />
Lässt sich also das Entfremdungsproblem nicht einfach nominalistisch überspielen,<br />
stelltsichdieFrage,wieesaufderEbenederOrganisationvonDienstleistungsarbeitzuent<br />
schärfenist.<br />
HierzugehörenzumeinenpolitischdefinierteNormen,dieeinbestimmtesQualitäts<br />
undSicherheitsniveaufürdieDienstleistungsnutzergewährleisten. 18 AberpolitischeRegu<br />
lationen,sounverzichtbarsiesind,reichennichtaus.SowenigsichinteraktiveLeistungsers<br />
tellungsprozesse von betrieblichen Herrschaftspositionen her wirksam steuern lassen, so<br />
wenig ist ihre Alltagsrealität von politischen Regulationen her gestaltbar. Es bedarf dazu<br />
einer<strong>Arbeit</strong>sorganisation,diebeidenDienstleistungsbeschäftigtenKompetenzundMotiva<br />
<br />
18IndenletztenJahrensindAnsätzedazuimSinnevonKundenschutzrechtenbeispielsweisefürPfle<br />
geheime,selbstfürdenSektorderFinanzdienstleistungeninderBundesrepublikzubeobachten.
58 MartinBaethge<br />
tionimmerwiederfreisetztunderhält.ZuihrgehörenklareVerantwortungszuweisungen,<br />
die den Dienstleistungstätigen Selbstständigkeit in den Organisationen bei der Durchfüh<br />
rung ihrer <strong>Arbeit</strong> und Handlungsspielräume ebenso sichern wie eine eigene Position ge<br />
genüberVorgesetzten,fernersichselbstorganisierendeGruppenarbeitundFormenderAn<br />
erkennung.<br />
Neben der <strong>Arbeit</strong>sorganisation spielt die Professionalisierung von Dienstleistungsar<br />
beit für deren Dauerhaftigkeit als Beruf eine wichtige Rolle. Die Mehrheit der Dienstleis<br />
tungstätigkeitenauchaufdermittlerenEbensetzenhohefachliche,methodischeundsoziale<br />
Kompetenzenvoraus(Abschnitt4).ÜberdieseKompetenzenhinausgehörtzumKernder<br />
ProfessionalitätvorallemderBeschäftigtenindensozialenDienstleistungsberufeneinBe<br />
rufsethos, das sich vorrangig gegenüber dem Wohl des Patienten/Klienten und nicht des<br />
BetriebsoderderOrganisationverpflichtetweiß.FürdiefreienakademischenProfessionen<br />
der Ärzte und Rechtsanwälte ist ein solches Berufsethos seit langem selbstverständlich.<br />
DienstleistungstätigkeitennähernsichnichtzuletztwegenderVerbindungvonKompetenz<br />
undfunktionalerDefinitioneherdentraditionellenProfessionenanalsdenFacharbeiterbe<br />
rufen.AuchhierzuliegteinzentralerUnterschiedzumgewerblichtechnischenBereichin<br />
dustrieller Produktion, dessen berufliches Selbstverständnis in technischer Exzellenz, Si<br />
cherheit und Zuverlässigkeit der Produkte als Basis für betriebliche Verwertungsprozesse<br />
wurzelte.<br />
ProfessionellesEthosistnichtalsindividuellemoralischeBringschuldzudefinieren,es<br />
musseingebettetseinineinengesellschaftlichenKonsens,derininstitutionalisiertenAus<br />
bildungsgängenundberuflichenAnerkennungsformenseinenNiederschlagfindet.<br />
<br />
<br />
Literatur<br />
<br />
Abelshauser,W.(2004):DeutscheWirtschaftsgeschichteseit1945,München:Beck.<br />
AutorengruppeBildungsberichterstattung(2010):BildunginDeutschland2010,Bielefeld.<br />
Badura,B./Gross,P.(1976):SozialpolitischePerspektiven,München:Piper.<br />
Baethge,M.(1999):PEM13:DienstleistungenalsChance:EntwicklungspfadefürBeschäfti<br />
gung,Göttingen.S.6ff.<br />
Baethge,M.(2001):AbschiedvomIndustrialismus:Kontureneinerneuengesellschaftlichen<br />
Ordnungder<strong>Arbeit</strong>.In:Baethge,M./Wilkens,I.(Hrsg.):S.2344.<br />
Baethge,M./Oberbeck,H.(1986):<strong>Zukunft</strong>derAngestellten,Frankfurt/NewYork:Campus.<br />
Baethge, M./Wilkens, I. (2001): „Goldenes Zeitalter“– „Tertiäre Krise“: Perspektiven von<br />
DienstleistungsbeschäftigungzumBeginndes21.Jahrhunderts.In:Dieselben(Hrsg.),<br />
diegroßeHoffnungfürdas21.Jahrhundert?Opladen:Leske+Budrich.<br />
Baethge,M./Wilkens,I.(Hrsg.)(2001):DiegroßeHoffnungfürdas21.Jahrhundert?,Opla<br />
den:Leske+Budrich.<br />
Baudrillard,J.(1970):Lasocietédeconsummation,Paris:Gallimard.<br />
Baumol,W.(1967):MacroeconomicsofUnbalancedGrowth:TheAnatomyofUrbanCrisis.<br />
In:AmericanEconomicReviews57.<br />
Bell,D.(1975):DienachindustrielleGesellschaft,Frankfurt:Suhrkamp.
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 59<br />
BlättelMinke,B./Hellmann,K.U.(Hrsg.)(2010):ProsumerRevisited.Wiesbaden:VSVerlag<br />
fürSozialwissenschaften.<br />
Bonin,H./Schneider,M./Quinke,H./Arens,T.(2007):<strong>Zukunft</strong>vonBildungund<strong>Arbeit</strong>.Per<br />
spektivenvon<strong>Arbeit</strong>skräftebedarfundangebotbis2020(IZAResearchReportNo.9)<br />
Bonn.<br />
Bosch,G./Weinkopf,C.(Hrsg.)(2007):<strong>Arbeit</strong>enfürwenigGeld.Niedriglohnbeschäftigung<br />
inDeutschland,Frankfurt/NewYork:Campus.<br />
Bravermann, H. (1977): Die <strong>Arbeit</strong> im modernen Produktionsprozeß. Frankfurt/M: Suhr<br />
kamp.<br />
Castel,R./Dörre,K.(Hrsg.)(2009):Prekarität,Abstieg,Ausgrenzung.DiesozialeFrageam<br />
Beginndes21.Jahrhunderts.Frankfurt/NewYork:Campus.<br />
Cohen,D.(2001):UnseremodernenZeiten,Frankfurt/NewYork:Campus.<br />
Dathe,D./Hohendanner,C./Priller,E.(2009):WenigLicht,vielSc<strong>hat</strong>ten–derdritteSektor<br />
alsarbeitsmarktpolitischesExperimentierfeld.In:WZBrief<strong>Arbeit</strong>03/Oktober2009.<br />
Destatis/gesiszuma/WZB(2008):Datenreport2008,Bonn.<br />
Deutschmann, Chr. (2002): Postindustrielle Industriesoziologie, Weinheim/München:<br />
Juventa.<br />
Dörre, K. (2009): Die neue Landnahme. Dynamiken und Grenzen des Finanzmarktkapita<br />
lismus. In: Dörre, K./Lessenich, S./Rosa, H. (Hrsg.) Soziologie Kapitalismus Kritik,<br />
Frankfurt/M:Suhrkamp,S.2186.<br />
Dostal,W.(2001):QuantitativeEntwicklungenundneueBeschäftigungsformenimDienst<br />
leistungsbereich.In:Baethge/Wilkens(Hrsg.):DiegroßeHoffnungfürdas21.Jahrhun<br />
dert?Opladen:Leske+Budrich,S.4569.<br />
Drosdowski,T./Wolter,M.:ProjektiondersozioökonomischenEntwicklungDeutschlands<br />
bis 2020. In: Bartelheimer, P./Fromm, S. (Hrsg.): Zweiter Bericht zur sozio<br />
ökonomischenEntwicklunginDeutschland,Kapitel11,Wiesbaden(imErscheinen).<br />
Dunkel, W./Weihrich, M. (2010): <strong>Arbeit</strong> als Interaktion. In: Böhle, F./Voß, G./Wachtler, G.<br />
(Hrsg.):Handbuch<strong>Arbeit</strong>ssoziologie,Wiesbaden:VSVerlagfürSozialwissenschaften,<br />
S.177200,<br />
Ehrenreich,B.(2001):<strong>Arbeit</strong>poor.UnterwegsinderDienstleistungsgesellschaft,München:<br />
AntjeKunstmannVerlag.<br />
Fourastie,J.(1952):LegrandespoirduXXmesiècle,Paris(deutsch:DiegroßeHoffnungdes<br />
20.Jahrhunderts,Köln1954).<br />
Gershuny, J. (1981): Die Ökonomie in der nachindustriellen Gesellschaft. Produktion und<br />
VerbrauchvonDienstleitungen,Frankfurt/M.:Suhrkamp.<br />
Gross,P.(1983):DieVerheißungderDienstleistungsgesellschaft.SozialeBefreiungoderSo<br />
zialherrschaft?Opladen:WestdeutscherVerlag.<br />
HaiskenDeNew,J.P./Horn,G.A./Schupp,J./Wagner,G.(1997):RückstandbeimAnteilder<br />
Dienstleistungstätigkeiten aufgeholt. Ein Vergleich mit den USA anhand von Haus<br />
haltsbefragungen.In:DIWWochenbericht34/97.Berlin.<br />
Hall,A.(2007):Tätigkeiten,beruflicheAnforderungenundQualifikationsniveauinDienst<br />
leistungsberufen. In: Walden, G. (Hrsg.): Qualifizierungsentwicklung im Dienstleis<br />
tungsbereich,Bonn,S.153208.
60 MartinBaethge<br />
Hanekop,H./Wittke,V.(2010):KollaborationderProsumenten.DievernachlässigteDimen<br />
siondesProsumingKonzepts.In:BlattelMink/Hellmann(Hrsg.):a.a.O.:S.96114.<br />
Häusermann,H./Siebel,W.(1995):Dienstleistungsgesellschaften,Frankfurt/M.:Suhrkamp.<br />
Häusermann,H./Siebel,W.:imBand.<br />
Hellmann, K.U. (2010): Prosumer Revisited: Zur Aktualität einer Debatte. In: Blättel<br />
Mink/Hellmann(Hrsg.),ProsumerRevisited,Wiesbaden:VSVerlagfürSozialwissen<br />
schaften,S.1348.<br />
Kalkowski, P./Mickler, O. (2009): Antinomien des Projektmanagements. Eine <strong>Arbeit</strong>sform<br />
zwischenDirektiveundFreiraum.Berlin:editionsigma.<br />
Kern, H./Schumann, M. (1970): Industriearbeit und <strong>Arbeit</strong>erbewußtsein, Teil I., Frank<br />
furt/M.:Suhrkamp.<br />
Kern,H./Schumann,M.(1984):DasEndeder<strong>Arbeit</strong>steilung?Rationalisierunginderindu<br />
striellenProduktion.München:Beck.<br />
Knöbl, W. (2006): Krieg als Geschäft. Gewaltmärkte und ihre Paradoxien. In: Westend–<br />
NeueZeitschriftfürSozialforschung3,I.,S.8898.<br />
Kohn,M.(1977):Reassessment2ndeditionof„ClassandConformity“,Chicago:University<br />
ofChicagoPress.<br />
Lutz,B.(1984):DerkurzeTraumimmerwährenderProsperität,Frankfurt/M.:Suhrkamp.<br />
Luxemburg,R.(1913):DieAkkumulationdesKapitals.EinBeitragzurökonomischenErklä<br />
rungdesImperialismus.In:GesammelteWerke,Bd.5,Berlin1975.<br />
Maddision, A. (1995): Monitoring the World Economy 19201992. (OECD Development<br />
centreStudies.Paris.<br />
Marx,K.(1867,1973):DasKapitalBd.1(MEW23),Berlin.<br />
Marx,K.[Dieentfremdete<strong>Arbeit</strong>].In:Marx/EngelsWerke,Ergänzungsband,Schriftenbis<br />
1844–ErsterTeil,Berlin1968,S.510522.<br />
Münch,R.(2009):GlobaleEliten,lokaleAutoritäten.BildungundWissenschaftunterdem<br />
RegimevonPISA,McKinley&Co.Frankfurt/M.:Suhrkamp.<br />
Nonaka,I./Takeuchi,H.(1997):DieOrganisationdesWissens.Frankfurt/NewYork:Cam<br />
pus.<br />
Picot, A./Reichwald, R./Wigang, R. (1998): Die grenzenlose Unternehmung, Wiesbaden:<br />
Gabler.<br />
Piore,M./Sabel,Ch.(1985):DasEndederMassenproduktion.Berlin:Wagenbach.<br />
Reichwald,R./Piller,F.(2006):InteraktiveWertschöpfung:OpenInnovation,Individualisie<br />
rungundneueFormender<strong>Arbeit</strong>steilung,Wiesbaden:Gabler.<br />
Reichwald, R./Baethge, M./Brakel, O./Cramer, J./Fischer, B./Paul, G. (2004): Die neue Welt<br />
derMikrounternehmen,Wiesbaden:Gabler.<br />
Reichwald, R./Hermann, M./Bieberbach, F. (2001): Telekooperatives <strong>Arbeit</strong>en in SOHO’s<br />
Vernetzung von Dienstleistungen über Informations und Kommunikationstechnolo<br />
gie.In:Baethge,M./Wilkens,I.(Hrsg.):DiegroßeHoffnungfürdas21.Jahrhundert?<br />
Opladen:Leske+Budrich,S.109128.<br />
Reichwald, R./Möslein, K./Sachenbacher, H./Engelberger, H. (2000): Telekooperation. Ver<br />
teilte<strong>Arbeit</strong>sundOrganisationsformen,Berlin,Heidelberg,NewYork.<br />
Sauer, D./Döhl, V. (1997): Die Auflösung des Unternehmens? Entwicklungstendenzen der<br />
Unternehmensreorganisationinden90erJahren.In:ISFMünchen;INIFESStadtbergen;
Die<strong>Arbeit</strong>inderDienstleistungsgesellschaft 61<br />
IfSFrankfurt/Main;SOFIGöttingen(Hrsg.):JahrbuchSozialwissenschaftlicheTechnik<br />
berichterstattung1996–Schwerpunkt:Reorganisation.Berlin,S.1976.<br />
Schumann, M. (2000): Industriearbeit zwischen Entfremdung und Entfaltung. In: SOFI<br />
MitteilungenNr.28,S.103122.<br />
Schumann,M.(2004):Vorwort.In:Kuhlmann,M./Sperling,H.J./Balzer,S.(Hrsg.):Konzepte<br />
innovativer<strong>Arbeit</strong>spolitik,Berlin,S.1127.<br />
Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI)/Institut für <strong>Arbeit</strong>smarkt und Berufsforschung<br />
(IAB)/Institut für sozialwissenschaftliche Forschung (ISF)/Internationales Institut für<br />
empirische Sozialökonomie (INFES) (Hrsg.)(2005): Berichterstattung zur sozioökono<br />
mischenEntwicklunginDeutschland,Wiesbaden.<br />
Streeck,W.(1997):GermanCapitalism:DoesitExist?CanitSurvive?In:Crouch,C./Streeck,<br />
W.(eds.),PoliticalEconomyofModernCapitalism.MappingConvergence&Diversity,<br />
London:Sage,S.3354.<br />
Toffler,A.(1980):TheThirdWave.TheClassicStudyofTomorrow,NewYork:Morrow.<br />
Veblen,T.(1953):TheTheoryoftheLeisureClass,NewYork(zuerst1899).<br />
Walden,G.(2007):QualifikationsentwicklungimDienstleistungsbereich,Bonn.
22.11.2012 ‐ Mythen der <strong>Arbeit</strong>/ <strong>Arbeit</strong> als Integration
Mythen der <strong>Arbeit</strong><br />
Die <strong>Arbeit</strong>slosenstatistik ist gefälscht - stimmt's?<br />
Um Erfolge in der <strong>Arbeit</strong>smarktpolitik vorzugaukeln, fälschen Politiker die<br />
Erwerbslosenzahlen. Oder? <strong>Arbeit</strong>sforscher Joachim Möller hält die positiven<br />
Beschäftigtenzahlen keineswegs für eine Statistik-Lüge. Im Gegenteil: Die<br />
deutsche Zählung sei sogar vergleichsweise transparent.<br />
Der Vorwurf, Politiker fälschten die <strong>Arbeit</strong>slosenzahlen, ist wohl so alt wie die<br />
Statistiken selbst. "Schlechte Meldungen kann die Bundesregierung nicht<br />
gebrauchen. Deshalb bleibt sie dabei, die <strong>Arbeit</strong>slosenzahlen schön zu rechnen",<br />
sagte Linke-Chef Klaus Ernst kürzlich. Ähnliche Schlussfolgerungen werden nicht nur<br />
1
von den Oppositionsparteien immer wieder nahegelegt. Was ist von den<br />
<strong>Arbeit</strong>smarktzahlen denn nun wirklich zu halten?<br />
Tatsächlich bestimmt die Politik, wer offiziell als arbeitslos gezählt wird. Diese Regeln<br />
sind im Laufe der Jahre mehrfach geändert worden. Ein Schuft, wer denkt, dass<br />
dabei bisweilen auch das Motiv eine gewisse Rolle gespielt <strong>hat</strong>, die Statistik etwas<br />
aufzuhübschen. Zumindest dürfte dies der Grund dafür sein, dass in der<br />
Öffentlichkeit eine tiefe Skepsis verbreitet ist.<br />
Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass es auch ein schlagendes Gegenbeispiel<br />
gibt: Durch das Hartz-IV-Gesetz wurden unter der Regierung Schröder<br />
Hunderttausende erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger erstmals überhaupt in der<br />
<strong>Arbeit</strong>slosenstatistik sichtbar. Seitdem ist die deutsche <strong>Arbeit</strong>slosenstatistik<br />
transparenter als in den meisten anderen Ländern. Gerade in den als<br />
arbeitsmarktpolitisch erfolgreich geltenden Ländern Dänemark, Großbritannien oder<br />
den Niederlanden wird die offizielle <strong>Arbeit</strong>slosigkeit wesentlich enger abgegrenzt und<br />
folglich kleiner gerechnet als hierzulande.<br />
Deutsche Zählung vergleichsweise streng<br />
Ein guter Maßstab ist die Statistik der internationalen <strong>Arbeit</strong>sorganisation (ILO), die<br />
auf einem für alle Länder identischen Erhebungsverfahren beruht. Aufschlussreich ist<br />
die Tatsache, dass die Statistik der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> mehr <strong>Arbeit</strong>slose<br />
ausweist als die ILO. In Schweden, Großbritannien und den Niederlanden liegen die<br />
offiziellen Zahlen dagegen deutlich unter den ILO-Zahlen für das jeweilige Land. Die<br />
deutsche Zählung ist also vergleichsweise streng.<br />
Dennoch bilden die <strong>Arbeit</strong>slosenzahlen das Problem der sogenannten<br />
Unterbeschäftigung nur teilweise ab. Hinzuzurechnen ist die Stille Reserve. Zur<br />
"Stillen Reserve im engeren Sinne" gehören alle, die eigentlich gerne arbeiten<br />
würden, sich jedoch aus den verschiedensten Gründen nicht arbeitslos melden.<br />
Manche haben nach langer Jobsuche die Hoffnung aufgegeben, überhaupt noch mal<br />
eine Anstellung zu finden, andere wollen nach Jahren der Kindererziehung zwar<br />
wieder zurück in den Beruf, haben aber ohnehin keinen Anspruch auf<br />
<strong>Arbeit</strong>slosengeld und erwarten sich auch keine Vorteile vom Kontakt zur<br />
2
<strong>Arbeit</strong>sagentur. Diese "Stille Reserve im engeren Sinne" umfasst derzeit knapp eine<br />
halbe Million Menschen.<br />
1,4 Millionen <strong>Arbeit</strong>slose als Stille Reserve<br />
Außerdem gibt es noch die "Stille Reserve in Maßnahmen": Teilnehmer an<br />
Weiterbildungen oder anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden per<br />
Gesetz nicht als arbeitslos gezählt. Die Zahl liegt bei einer knappen Million.<br />
Insgesamt beläuft sich die "Stille Reserve" so auf rund 1,4 Millionen. Noch nicht<br />
mitgezählt sind Teilnehmer an <strong>Arbeit</strong>sbeschaffungsmaßnahmen, Ein-Euro-Jobber<br />
und einige andere, die nach statistischer Definition als Beschäftigte zählen. Dabei<br />
handelt es sich um rund 200.000 Menschen.<br />
Bei großzügiger Berechnung beträgt das Defizit an regulärer Beschäftigung unter<br />
dem Strich zurzeit also rund 4,5 Millionen. Man kann darüber diskutieren, ob man mit<br />
der Zahl zu hoch liegt, weil es vielleicht unter den als arbeitslos registrierten<br />
Personen einige geben mag, die dem <strong>Arbeit</strong>smarkt nicht wirklich zur Verfügung<br />
stehen - an dieser Stelle wird es aber schnell spekulativ.<br />
Wichtig ist mir Folgendes: Die Stille Reserve ist kein Beleg für die Behauptung von<br />
der Statistik-Lüge. Die Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> weist in ihren Statistikberichten<br />
explizit darauf hin, dass sich das Problem der Unterbeschäftigung nicht auf die Zahl<br />
der registrierten <strong>Arbeit</strong>slosen beschränkt. Diese Berichte sind für jedermann online<br />
zugänglich. Die Zahl der Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wird<br />
darin detailliert aufgeschlüsselt.<br />
Ältere und Maßnahmenteilnehmer nicht sauber erfasst<br />
Auch das Institut für <strong>Arbeit</strong>smarkt- und Berufsforschung veröffentlicht in seinen<br />
halbjährlichen <strong>Arbeit</strong>smarktprojektionen nicht nur eine Prognose für die Zahl der<br />
<strong>Arbeit</strong>slosen - das Ausmaß der Stillen Reserve wird hier ebenfalls benannt. Der<br />
zentrale Punkt ist dabei: Wenn heute der niedrigste Stand der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit seit<br />
der Wiedervereinigung registriert wird, dann ist dies auch zugleich ein<br />
Rekordniedrigstand der Unterbeschäftigung. Die in den letzten fünf Jahren insgesamt<br />
erfreuliche Entwicklung ist kein Statistik-Fake, sondern sehr wohl aussagekräftig.<br />
3
Ist dann also alles gut im Bereich der <strong>Arbeit</strong>slosenstatistik? Nicht ganz. Bei zwei<br />
Statistikfragen hätte ich mir gewünscht, dass die Politik anders entschieden hätte.<br />
Der eine Punkt ist, dass Hartz-IV-Empfänger über 58, denen ein Jahr lang kein<br />
konkretes Jobangebot gemacht wurde, nicht mehr als arbeitslos zählen. Dabei<br />
handelt es sich um knapp 100.000 Fälle. In den Zahlen zur Unterbeschäftigung sind<br />
sie enthalten, aber sie sollten zur Zahl der registrierten <strong>Arbeit</strong>slosen gehören.<br />
Wenn man Ältere, die eigentlich arbeiten wollen und sich arbeitslos melden, nicht<br />
mehr in der <strong>Arbeit</strong>slosenstatistik mitzählt, entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass<br />
an der Statistikschraube gedreht wird. Übrigens <strong>hat</strong> auch die Bundesagentur für<br />
<strong>Arbeit</strong> vor dieser Regelung gewarnt - eben weil ihr daran gelegen ist, dass ihre<br />
Zahlen ein möglichst präzises Bild zeichnen.<br />
Kritisch sehe ich zudem eine weitere Regelung bei der <strong>Arbeit</strong>slosenstatistik.<br />
<strong>Arbeit</strong>slose, mit deren Vermittlung Dritte durch die <strong>Arbeit</strong>sagenturen beauftragt<br />
werden - bei den Hartz-IV-Empfängern durch die Jobcenter oder Optionskommunen -<br />
, zählen automatisch als Maßnahmenteilnehmer und werden damit ebenfalls nicht in<br />
der Zahl der registrierten <strong>Arbeit</strong>slosen erfasst. Dabei liegt ihre Zahl bei deutlich mehr<br />
als 100.000. Auch wenn diese Personen in den Zahlen der Unterbeschäftigung<br />
auftauchen: Der sauberen Erfassung der <strong>Arbeit</strong>slosenzahlen dient das sicherlich<br />
nicht.<br />
IAB<br />
Der Volkswirt Joachim Möller (Jahrgang 1953) ist seit 2007 Direktor des Instituts für <strong>Arbeit</strong>smarkt- und<br />
Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Die Forschungsstelle gehört zur Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>. In<br />
seiner regelmäßigen Kolumne auf KarriereSPIEGEL rückt er falsche Gewissheiten über die<br />
<strong>Arbeit</strong>swelt zurecht.<br />
Quelle: www.spiegel.de vom 12.07.2011<br />
4
29.11.2012 ‐ wird noch bekanntgegeben
06.12.2012 ‐ wird noch bekanntgegeben
13.12.2012 ‐ Übergänge zwischen Schule und Berufsausbildung
Übergänge zwischen Schule und Berufsausbildung<br />
Verena Eberhard und Joachim Gerd Ulrich<br />
1 Einleitende Bemerkungen zu den institutionellen Rahmenbedingungen<br />
des Übergangs von der Schule in Berufsausbildung<br />
Wer die individuellen Übergänge der Jugendlichen zwischen allgemeinbildender<br />
Schule und Berufsausbildung und ihre Entwicklung seit der Wiedervereinigung<br />
verstehen möchte, darf die Institutionen bzw. Regeln nicht außer Acht lassen,<br />
nach denen in Deutschland der Zutritt in eine voll qualifizierende Berufsausbildung<br />
unterhalb der akademischen Ausbildung eröffnet wird. 16 Denn aus diesen<br />
Regeln bzw. „Institutionen ergeben sich ja oft gerade erst die Strukturen der<br />
Möglichkeiten und der primären Ziele der Akteure sowie die ganz spezielle ‚Logik‘<br />
des sozialen Sinns in einer Situation, der dann den alles bestimmenden Bezugsrahmen<br />
des Handelns bildet“ (Esser 2000, 45).<br />
Was sind nun die spezifischen Merkmale der Zugangsregeln in eine nichtakademische<br />
berufliche Ausbildung? Hervorstechendstes Merkmal ist sicherlich,<br />
dass der Eintritt in die berufliche Ausbildung im Gegensatz zum Hochschulzugang<br />
zu großen Teilen über den <strong>Arbeit</strong>smarkt gesteuert wird. Denn trotz tendenzieller<br />
Bedeutungsverluste in den Jahren zwischen 1992 und 2005 dominiert das<br />
duale System in Deutschland weiterhin die nichtakademische Berufsausbildung<br />
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008).<br />
Verantwortlich für die Übergangsregeln ist somit nicht allein der Staat, sondern<br />
ein „korporatistisch-staatliches Steuerungssystem“ (Baethge 2006, Baethge<br />
2008, 546), in dem der Staat der Wirtschaft die Rolle des Eingangswächters in<br />
die Berufsausbildung übertragen <strong>hat</strong>. Zwar verzichtet der Staat damit weitgehend<br />
auf die Steuerungshoheit beim Ausbildungszugang, doch bringt dieser Verzicht<br />
ihm zugleich beträchtliche Vorteile ein (Kath 2005, 229 f.). So spart er durch die<br />
Beteiligung der Privatwirtschaft an der Finanzierung der beruflichen Bildung<br />
enorme Kosten ein (Klemm 2008, 260). Zudem ist die Einbindung der Wirtschaft<br />
mit unverkennbaren Vorteilen für die Jugendlichen verbunden: Eine betriebliche<br />
Berufsausbildung sichert den unmittelbaren Kontakt des Lernortes mit<br />
den aktuellen organisatorischen und technischen Entwicklungen bei der Erzeu-<br />
16 Wir folgen an dieser Stelle der soziologischen Definition, nach der es sich bei Institutionen um<br />
allgemeinverbindliche Regeln handelt (Esser 2000, 303) und nicht etwa, wie im umgangssprachlichen<br />
Sinne, um Organisationen. Unter Organisationen verstehen wir hier wiederum alle nichtstaatlichen<br />
und staatlichen Gruppierungen und Gebilde, die bestimmte Zwecke verfolgen.<br />
133
gung von Gütern und Dienstleistungen (Küppers/Leuthold/Pütz 2001, 72 f.). Des<br />
Weiteren werden die Gefahren einer am Bedarf der Wirtschaft vorbeigehenden<br />
Berufsausbildung gelindert, und die Einbettung in das Beschäftigungssystem<br />
eröffnet den Auszubildenden relativ gute Chancen, unmittelbar nach Abschluss<br />
der Ausbildung in ein <strong>Arbeit</strong>sverhältnis wechseln zu können (Gangl 2003,<br />
Konietzka 2007, Müller/Shavit 1998). Dies sind gewichtige Gründe, warum die<br />
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen mit ihren gemeinsam verantworteten<br />
Zugangsregelungen in die berufliche Ausbildung öffentlich weitgehend<br />
Akzeptanz finden und eine Beteiligung der privaten Wirtschaft an der Berufsausbildung<br />
in Deutschland grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird.<br />
Allerdings gibt es in Deutschland auch einen breiten bildungspolitischen<br />
Konsens, dass der überwiegend marktgesteuerte Zugang zur beruflichen Ausbildung<br />
grundsätzlich keine Jugendlichen von der Möglichkeit ausschließen darf,<br />
sich beruflich zu qualifizieren und darüber ihre gesellschaftliche Teilhabe zu<br />
sichern. Die Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs wurde 1980 vom Bundesverfassungsgericht<br />
dadurch unterstrichen, dass es eine gesetzlich geregelte, zeitlich<br />
befristete betriebliche Umlage zur Überwindung von temporären Angebotsdefiziten<br />
auf dem Ausbildungsstellenmarkt für verfassungskonform erklärte (Kath<br />
1999, 102 f.).<br />
Eine Garantie auf einen betrieblich finanzierten Ausbildungsplatz steht jedoch<br />
in einem Spannungsverhältnis mit der von der Wirtschaft eingeforderten<br />
Regel, die Beteiligung der Betriebe an der Berufsausbildung könne und dürfe in<br />
einem marktgesteuerten System nur freiwillig erfolgen. Andernfalls seien massive<br />
negative Auswirkungen auf die Ausbildungsmotivation und –qualität zu befürchten<br />
– mit der wenig attraktiven Aussicht, dass der Staat letztlich doch den<br />
Bereich der Berufsausbildung weitgehend in die eigene Hand überführen muss<br />
(Kath 1999, 103). Die Ordnung der beruflichen Bildung ist somit von institutionellen<br />
Widersprüchen gekennzeichnet – einerseits ist sie von der „Leitidee“<br />
(Lepsius 1995, 395) der Freiwilligkeit der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung<br />
geprägt, anderseits vom Anspruch auf ein ausreichendes Berufsbildungsangebot.<br />
Denn zwischen „dem Ausbildungsangebot der Betriebe und der Ausbildungsplatznachfrage<br />
von Schulabgängern besteht grundsätzlich keine Deckungsgleichheit.<br />
Die Betriebe orientieren das Volumen ihres Qualifikationsbedarfs<br />
unter Berücksichtigung von allgemeiner und Branchenkonjunkturlage überwiegend<br />
an einer Prognose des zukünftig benötigten Beschäftigungspotenzials, während<br />
sich der Umfang der Nachfrage nach beruflicher Qualifizierung als Ergebnis<br />
von demographischer Entwicklung und Bildungsverhalten der Schulabgänger<br />
einstellt“ (Kath 1999, 100; vgl. auch Weil/Lauterbach 2009, 327).<br />
134
Diese Widersprüche bleiben solange latent, wie Ausbildungsstellenangebot<br />
und Ausbildungsnachfrage in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen, so dass<br />
Reflexionen über eine Umlagefinanzierung in der Büchse der Pandora verschlossen<br />
bleiben können. Virulent werden sie erst in Zeiten eines Nachfrageüberhangs,<br />
sei dieser durch die demografische Entwicklung und/oder durch wirtschaftskonjunkturelle<br />
Krisen ausgelöst. In diesem Fall droht die Legitimation des<br />
letztlich widersprüchlichen Institutionengefüges, über das der Zugang in Berufsausbildung<br />
erfolgt, beschädigt zu werden (Baethge 2008, 582 ff.), und damit<br />
drohen auch jene Organisationen in die Kritik zu geraten, die diese Institutionen<br />
in ihrer aktuellen Form vertreten und belassen wollen (Meyer/Rowan 2009, 43<br />
f.).<br />
Eine solche Legitimationskrise der bestehenden Zugangsregelungen in Berufsausbildung<br />
ist in Deutschland allerdings durch zwei entscheidende Merkmale<br />
geprägt:<br />
Auf der einen Seite führt sie innerhalb des korporatistischen Systems nur<br />
bedingt zu einer Interessenkollision von Staat und Wirtschaft: Der Staat ist<br />
zwar allein schon aus Kostengründen daran interessiert, über das duale Berufsbildungssystem<br />
möglichst viele Jugendliche eines Jahrgangs qualifizieren<br />
zu lassen, doch scheut er andererseits davor zurück, Zwangsmaßnahmen<br />
zu vollstrecken, die auf den Widerstand der Wirtschaft stoßen und somit die<br />
grundsätzliche Akzeptanz des Systems gefährden könnten. Denn die damit<br />
verbundenen langfristigen Kosten könnten deutlich höher ausfallen als der<br />
kurzfristige Nutzen einer umlagefinanzierten Befriedigung der Ausbildungsplatznachfrage.<br />
Auf der anderen Seite ist die Legitimationskrise stets durch ihren temporären<br />
Charakter gekennzeichnet: Die konjunkturellen und demografischen<br />
Verhältnisse sind nicht stabil, und ihre Dynamik lässt somit auch in Krisenzeiten<br />
stets Raum für die Aussicht auf ein erneutes Gleichgewicht von Angebot<br />
und Nachfrage. Dies nährt die Hoffnung, Krisenzeiten überbrücken<br />
zu können, ohne größere, kostenintensive institutionelle Änderungen vornehmen<br />
zu müssen.<br />
Entsprechende Überbrückungsmaßnahmen werden dabei umso wahrscheinlicher<br />
der Öffentlichkeit zu vermitteln sein, je weniger bedeutsam die Krise erscheint<br />
und je stärker die Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt mit Ursachen in<br />
Verbindung gebracht werden können, die nicht unmittelbar den Institutionen<br />
selbst angelastet werden können. Über die „Definition der Situation“ (wie ist die<br />
Lage auf dem Ausbildungsmarkt einzuschätzen?) bestimmt sich somit letztlich<br />
auch die Legitimation der Institutionen. Aus diesem Grunde besteht bei den an<br />
135
der Gestaltung der beruflichen Ausbildung beteiligten Organisationen ein großes<br />
Interesse, für legitimationserhaltende Situationsdefinitionen und Deutungen zum<br />
Geschehen auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu werben und diesen Deutungen<br />
in der Öffentlichkeit eine hohe Akzeptanz zu verschaffen. Dies gelingt wiederum<br />
umso eher, je plausibler und gerechter die Verhältnisse im Lichte der Situationsdefinitionen<br />
und Deutungen erscheinen (Esser 2000, 97 ff.).<br />
Dabei stellen allerdings jene Jugendlichen eine besondere Herausforderung<br />
dar, die bei der Ausbildungsplatzsuche erfolglos bleiben. Legitimierende, die<br />
bestehenden Institutionen nicht gefährdende Situationsbeschreibungen und Deutungen<br />
sind in diesem Fall nur dann möglich, wenn deren Bewerbungsmisserfolg<br />
vor allem auf personenbezogene Ursachen (z.B. mangelnde Ausbildungsreife der<br />
Bewerber) anstatt auf institutionelle Mängel (z.B. fehlendes Angebot) zurückgeführt<br />
werden kann und wenn der quantitative Umfang der tatsächlich ausbildungsreifen,<br />
aber erfolglosen Bewerber relativ marginal erscheint. Tatsächlich<br />
wurde vom Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in<br />
Deutschland stets an der These festgehalten, jedem ausbildungswilligen und<br />
ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten,<br />
und zugleich wurden stets massive Zweifel an der Ausbildungsfähigkeit der<br />
Schulabgänger geäußert. 17 Deshalb schien es in den vergangenen Jahren auch<br />
nicht erforderlich zu sein, für die zahlreichen erfolglosen Ausbildungsstellenbewerber<br />
im entsprechenden Umfang vollqualifizierende Ersatzangebote in außerbetrieblicher<br />
oder schulischer Form bereitzustellen, und damit erübrigte sich<br />
auch eine Debatte darüber, wie und durch wen dieses kompensatorische Angebot<br />
zu finanzieren sei (Bosch 2008, 242).<br />
Damit erweist sich die bildungsbiografische Situation für diejenigen Jugendlichen<br />
allerdings als besonders schwierig, denen der Zutritt in einer Berufsausbildung<br />
nicht gelingt. Zum einen müssen sie sich mit in der Öffentlichkeit<br />
kursierenden „Identitätszumutungen“ (Gildemeister/Robert 1987, 73) auseinandersetzen,<br />
die Zweifel an ihrer Qualifikation und Motivation aufkommen lassen<br />
(Eberhard/Krewerth/Ulrich 2005; vgl. auch Hupka-Brunner u.a. 2009). Und auf<br />
der anderen Seite gibt es keine bundesweit einheitlichen, eindeutigen und verlässlichen<br />
Regeln, wie mit erfolglosen Ausbildungsstellenbewerbern zu verfahren<br />
ist – obwohl angesichts der Konjunkturanfälligkeit des dualen Systems und<br />
der bisherigen demografischen Entwicklung damit gerechnet werden musste,<br />
dass größere Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage auftreten. Die<br />
diffusen Verhältnisse im Umgang mit erfolglosen Ausbildungsbewerbern an der<br />
17 Mitglieder des Ausbildungspaktes sind neben den drei für berufliche Bildung zuständigen Bundesministerien<br />
(Wirtschaft, <strong>Arbeit</strong> und Soziales, Bildung) der Deutsche Industrie- und Handelskammertag,<br />
der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Zentralverband des Deutschen Handwerks,<br />
die Bundesvereinigung der Deutschen <strong>Arbeit</strong>geberverbände und die Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>.<br />
136
genannten „Ersten Schwelle“ führten in den vergangenen Jahren vielmehr dazu,<br />
dass vielen Ausbildungsplatzbewerbern der Eintritt in eine vollqualifizierende<br />
Berufsausbildung verwehrt blieb und sie auf teilqualifizierende Bildungsgänge<br />
des Übergangssystems ausweichen mussten (Bosch 2008, 243). Dies gilt insbesondere<br />
für Westdeutschland.<br />
2 Aktuelle Deutungen zum Übergangsgeschehen, welche die bestehenden<br />
Institutionen legitimieren<br />
Deutungen zum Übergangsgeschehen sind stets von hoher (interessens-)politischer<br />
Relevanz, da sie die Grundlage für bildungspolitische Problemlösungsstrategien<br />
bilden. 18 Deshalb wird die Ausbildungsmarkt- und Übergangsforschung<br />
stets auch unabhängig von ihren eigenen <strong>Arbeit</strong>sergebnissen mit Deutungen<br />
Dritter zu den Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt und zum Übergangsgeschehen<br />
konfrontiert (Ulrich 2004b). Viele dieser Erklärungsversuche zielen<br />
auf eine Individualisierung der Ursachen von Ausbildungslosigkeit hin (unzureichende<br />
Eignung der Jugendlichen, fehlender Ausbildungswille). Sie tragen somit<br />
dazu bei, die bestehenden Institutionen zu legitimieren (vgl. auch Solga 2005a,<br />
28 f.). Die Forschung kann diese Deutungen jedoch, was die Entwicklung in den<br />
vergangenen Jahren betrifft, nicht oder nur zum Teil bestätigen. Denn selbst<br />
wenn die Markt- und Übergangsanalysen auf „ausbildungsreife“ Ausbildungsbewerber<br />
beschränkt werden, fielen die Eintrittschancen in eine Berufsausbildung<br />
in den vergangenen Jahren relativ gering aus. Zugleich ließen sich sowohl<br />
im zeitlichen Längs- als auch im regionalen Querschnitt starke Angebotseffekte<br />
auf die Wahrscheinlichkeit identifizieren, ob Jugendliche eine vollqualifizierende<br />
Berufsausbildung aufnahmen oder nicht (Ulrich/Eberhard 2008).<br />
In den bislang geübten Deutungsmustern zu den Ursachen der Ausbildungslosigkeit<br />
spiegeln sich somit beträchtliche, institutionell bedingte Benachteiligungen<br />
von Jugendlichen wider, die eine Berufsausbildung unterhalb der akademischen<br />
Ebene anstreben. Wir wollen dies im Folgenden an zwei Beispielen<br />
nachzeichnen: zum einen am Argument der fehlenden „Ausbildungsreife“, das<br />
auf die mangelnde Qualifikation der Ausbildungsstellenbewerber zielt, und zum<br />
anderen am Argument der beschränkten Ausbildungsplatznachfrage, welches das<br />
Interesse und die Motivation der Jugendlichen an einer vollqualifizierenden<br />
Berufsausbildung in Zweifel zieht. Anschließend wollen wir anhand einer Grup-<br />
18 Wir definieren „Deutungen“ als subjektive Hypothesen/Theorien darüber, welche Ursachen beobachteten<br />
Phänomenen zugrundeliegen. Deutungen finden für die Vorhersage künftiger Geschehnisse<br />
und somit auch für die Entwicklung von Problemlösungsstrategien Verwendung. Aus diesem Grunde<br />
sind sie stets auch von (interessens)-politischer Relevanz.<br />
137
pe von Ausbildungsstellenbewerbern, denen von offizieller Seite die Befähigung<br />
zur Aufnahme einer Ausbildung und damit eine ausreichende Ausbildungsreife<br />
attestiert wurde, analysieren, wie hoch die Chancen dieser Jugendlichen auf eine<br />
vollqualifizierende Berufsausbildungsstelle im Jahr 2008 tatsächlich waren, von<br />
welchen Determinanten ihre Ausbildungschancen abhingen und wie groß letztlich<br />
die Widersprüche zwischen ihrer bildungsbiografischen Situation und den<br />
institutionellen Interpretationen ausfielen.<br />
2.1 Erstes Beispiel: Das Argument der „fehlenden Ausbildungsreife“<br />
und seine Funktion für die Rechtfertigung des Selektionsprozesses<br />
beim Übergang in Berufsausbildung<br />
Am 26. April 2007 erschien in der Bild-Zeitung ein Artikel, der mit der Überschrift<br />
„Ein Handwerksmeister klagt in BILD: So doof sind unsere Schulabgänger“<br />
tituliert wurde. Berichtet wurde von den Erfahrungen eines Betriebsinhabers,<br />
der seine Ausbildungsstellenbewerber einem Einstellungstest unterzogen<br />
<strong>hat</strong>te. Darin wurden die Bewerber u.a. mit einer Dreisatz-Rechenaufgabe konfrontiert.<br />
Sie lautete: „Acht <strong>Arbeit</strong>er vollenden eine <strong>Arbeit</strong> in zwölf <strong>Arbeit</strong>stagen.<br />
Wie lange brauchen fünf <strong>Arbeit</strong>er?“. Wie aus dem Bericht weiter hervorging,<br />
waren die meisten Bewerber offenbar nicht in der Lage, diese Aufgabe zu lösen.<br />
Der Artikel ist typisch für eine Vielzahl von weiteren Presseberichten, die<br />
sich mit der Eignung der Schulabgänger auseinandersetzten (Eberhard 2006, 5).<br />
Die Argumentation ist dabei in der Regel wie folgt aufgebaut:<br />
Prämisse 1: Die Beherrschung der Dreisatzrechnung (oder ähnlicher Fertigkeiten)<br />
stellt eine Mindestvoraussetzung dar, ohne die ein Zugang in Berufsausbildung<br />
nicht erfolgen kann.<br />
Prämisse 2: Ein großer Anteil der heutigen Ausbildungsstellenbewerber ist<br />
nicht in der Lage, den Dreisatz (bzw. ähnliche Fertigkeiten) zu beherrschen.<br />
Schlussfolgerung: Also kann diesen Jugendlichen der Zugang in eine duale<br />
Berufsausbildung nicht gewährt werden.<br />
Tatsächlich scheint die inhaltliche und logische Validität dieses Arguments so<br />
hoch zu sein, dass es in der Öffentlichkeit kaum in Frage gestellt wird:<br />
Hinweise, die das Argument stützen:<br />
So wird Prämisse 1 zum Beispiel durch den Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife<br />
gestützt, der vom Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs<br />
in Deutschland (2006) publiziert wurde. Darin wurden jene Qualifikationen defi-<br />
138
niert, welche die unverzichtbaren Kriterien der allgemeinen, für alle dualen Ausbildungsgänge<br />
relevanten Ausbildungsreife bilden. 19 Zu den schulischen Basiskenntnissen<br />
zählen demnach unter anderem „Mathematische Grundkenntnisse“<br />
(ebd., 28f.) und hierunter wiederum die Fähigkeit, „Dreisatzrechnung“ zu beherrschen.<br />
Die Tatsache, dass dem Ausbildungspakt mit Ausnahme der Gewerkschaften<br />
alle gewichtigen Organisationen angehören, die für die Durchführung<br />
und für die Gestaltung der Berufsausbildung verantwortlich zeichnen, scheint<br />
dabei die Forderung nach der Beherrschung rechnerischer Grundkenntnisse<br />
ebenso zu legitimieren wie die Feststellung, dass die im Kriterienkatalog definierten<br />
Anforderungen lediglich als Mindeststandards definiert wurden und insgesamt<br />
deutlich unter den Anforderungen eines Hauptschulabschlusses liegen.<br />
Prämisse 2 wird nicht nur durch die Erfahrungen gestützt, die Betriebe im<br />
Rahmen von Einstellungstests machen (z.B. Klein 2007, Lehner/Neumann/Rolff<br />
2009), sondern auch durch repräsentative Untersuchungen. Spätestens seit der<br />
ersten PISA-Untersuchung ist es unstrittig, dass viele Schulabgänger die Mindeststandards<br />
in den Kulturtechniken (Lesen, Rechnen, Schreiben) nicht beherrschen<br />
(Deutsches PISA-Konsortium 2001).<br />
Dementsprechend scheint auch die Schlussfolgerung richtig und zwingend<br />
zu sein, Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz zunächst auf einen teilqualifizierenden<br />
Bildungsgang des so genannten „Übergangssystems“ zu verweisen<br />
(Beicht 2009, Münk/Rützel/Schmidt 2008).<br />
Hinweise, die das Argument in Frage stellen:<br />
Gleichwohl gibt es bislang keinen Beleg dafür, dass Ausbildungsstellenbewerber,<br />
die in Testsituationen den Dreisatz nicht beherrschen, in einer Berufsausbildung<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern und deshalb vom Zugang in eine<br />
vollqualifizierende Berufsausbildung ausgeschlossen werden müssen (vgl. auch<br />
Dietrich u.a. 2009, 332). Zudem werden bei Abiturienten zum Teil ähnliche<br />
Rechendefizite beobachtet und öffentlich diskutiert, ohne dass dies jedoch ihre<br />
Zugangschancen in eine vollqualifizierende hochschulische Berufsausbildung<br />
substanziell mindert. So erschien z.B. am 11. Oktober 2009 in der „Welt am<br />
Sonntag“ unter dem Titel „Das Leid mit den Zahlen“ ein Artikel, in dem beklagt<br />
wurde, dass Abiturienten unter massiven Defiziten bei der Beherrschung grundlegender<br />
mathematischer Techniken leiden (hierzu zählen z.B. einfache geometrische<br />
Aufgaben, Potenz- und Bruchrechnen). Hochschulprofessoren machen<br />
demnach ähnliche Erfahrungen wie Ausbildungsbetriebe (vgl. Lehn 2009).<br />
19 Analytisch unterschieden wurden schulische Basiskenntnisse, psychologischen Leistungsmerkmale,<br />
physische Merkmale, psychologische Merkmale des <strong>Arbeit</strong>sverhaltens und der Persönlichkeit<br />
sowie Aspekte der Berufswahlreife.<br />
139
140<br />
Selbst mit der Dreisatzrechnung scheinen sich viele Studierende schwer zu tun, wie<br />
die Autoren dieses Beitrages im Rahmen einer eigenen kleinen Fallstudie feststellen<br />
mussten. Wir baten Studierende, die in der Bild-Zeitung genannte Dreisatzaufgabe<br />
für Ausbildungsstellenbewerber zu lösen („Acht <strong>Arbeit</strong>er vollenden eine <strong>Arbeit</strong> in<br />
zwölf <strong>Arbeit</strong>stagen. Wie lange brauchen fünf <strong>Arbeit</strong>er?“), und räumten ihnen hierfür<br />
jeweils drei Minuten Zeit ein. Geplant war ursprünglich, mindestens 30 Probanden<br />
einzeln zu befragen, und anschließend die Varianz richtiger und falscher Lösungen<br />
mit weiteren Merkmalen (Abiturnote, Studienfach, Geschlecht) in Verbindung zu<br />
bringen. Allerdings musste das Vorhaben bereits nach der Befragung von 18 Personen<br />
abgebrochen werden. Denn es gab bis dahin keine korrelationsstatistisch verwertbare<br />
Lösungsvarianz, da keinem der 18 Probanden gelungen war, die richtige<br />
Lösung (19,2 Tage = 8 x 12/5) zu benennen. Immerhin 13 Probanden <strong>hat</strong>ten einen<br />
Abiturnotendurchschnitt von unter 2,0 erreicht, acht sogar einen Schnitt von unter<br />
1,5. Gleichwohl bezeichneten acht Studierende die Aufgabe als schwierig oder sehr<br />
schwierig; weitere sieben gingen von einem zumindest mittleren Schwierigkeitsgrad<br />
aus. Zu den von den Probanden gewählten Fächern zählten unter anderem Psychologie,<br />
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.<br />
Auch wenn es sich bei der von uns befragten Gruppe lediglich um eine „Auswahl<br />
‚aufs Geratewohl‘“ (Hellmund/Klitzsch/Schumann 1992) handelte, stellt<br />
sich doch die Frage, warum Hauptschüler, welche den Dreisatz nicht beherrschen,<br />
auf das „Übergangssystem“ verwiesen werden, während Abiturienten mit<br />
ähnlichen Rechendefiziten offenbar kaum Probleme beim Zugang in eine hochschulische<br />
Berufsausbildung haben (und in ihrem jeweiligen Studium, so schien<br />
es uns, durchaus erfolgreich waren).<br />
Die Antwort ist in einer institutionellen Privilegierung der Abiturienten<br />
beim Zugang in Berufsausbildung zu suchen. Mit dem Abiturzeugnis wird ihnen<br />
einerseits die Hochschulreife per Deklaration und andererseits das Recht auf<br />
einen Hochschulzugang zugeteilt. Eine solche institutionelle Setzung kommt<br />
faktisch einer staatlichen Ausbildungsplatzgarantie gleich, sofern sich die Abiturienten<br />
bei der Fächer- und Studienortwahl flexibel zeigen (vgl. Übersicht 1).<br />
Dagegen werden die Übergangsbedingungen für Nichtstudienberechtigte<br />
durch den Marktcharakter des dualen Ausbildungssystems geprägt. Deshalb ist<br />
das Hauptschul- oder Realschulabschlusszeugnis faktisch auch kein „Ausbildungsreife-Zeugnis“<br />
(so wie das Abitur als Zeugnis der Hochschulreife gilt),<br />
obwohl es in einigen Regionen zumindest als „Berufsschulreife“-Zertifikat bezeichnet<br />
wird. Vielmehr müssen die Jugendlichen ihre Ausbildungsreife für eine<br />
betriebliche Berufsausbildung noch einmal gesondert nachweisen, wenn sie sich<br />
bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> als Ausbildungsstellenbewerber registrieren<br />
lassen und deren beraterische und vermittelnde Unterstützung in Anspruch nehmen<br />
wollen. Bescheinigt ihnen aber nun die Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> die „Aus-
ildungsreife“ und verleiht ihnen den offiziellen Status eines Ausbildungsstellenbewerbers,<br />
wird damit nicht der Anspruch auf eine vollqualifizierende Berufsausbildung<br />
zugewiesen. Vielmehr müssen sie sich nun auf dem Ausbildungsmarkt<br />
bewähren. Und bleiben sie bei ihren Bewerbungen erfolglos, haben<br />
sie keine Garantie auf ein vollqualifizierendes Ersatzangebot.<br />
Abbildung 1: Regelung der Zugänge in die hochschulische und in die nichtakademische<br />
Berufsausbildung<br />
Abiturienten,<br />
Absolventen<br />
von Fachoberschulen<br />
(FOS),<br />
höheren<br />
Handelsschulen <br />
Nichtstudienberechtigte<br />
Absolventen<br />
(Real- und<br />
Hauptschulabsolventen)<br />
Quelle: eigene Grafik<br />
Abiturzeugnis,<br />
FOS-Zeugnis<br />
Haupt-/<br />
Realschulzeugnis<br />
(Fach-)<br />
Hochschulreife<br />
ja<br />
„Ausbildungsreife?“<br />
nein<br />
(Fach)-<br />
Hochschulzugangsberechtigung<br />
Anerkennung<br />
als „Ausbildungsstellenbewerber“<br />
Verweis<br />
auf das<br />
„Übergangssystem“ <br />
erfolgreich<br />
Verweis auf<br />
den Ausbildungsmarkt<br />
nicht<br />
erfolgreich<br />
Faktische<br />
Ausbildungsgarantie <br />
Ausbildungsbeginn<br />
In diesem Sinne zeichnen sich beträchtliche institutionell bedingte Ungleichheiten<br />
beim Zugang in eine vollqualifizierende Berufsausbildung zwischen Jugendlichen<br />
mit und ohne Studienberechtigung ab.<br />
Die Fragwürdigkeit der Zugangsregelungen wird noch einmal durch die<br />
Tatsache unterstrichen, dass die anspruchsvollste Aufgabe beim Zugang in Berufsausbildung<br />
ausgerechnet an diejenigen Jugendlichen gerichtet wird, die dafür<br />
die ungünstigsten individuellen und sozialen Voraussetzungen mitbringen: Sich<br />
möglicherweise über mehrere Jahre auf einem Ausbildungsstellenmarkt zu be-<br />
?<br />
141
wegen, der nur relativ geringe Erfolgsaussichten bietet und deshalb ein hohes<br />
Maß an individuellem Beharrungsvermögen, Frustrationstoleranz und Flexibilität<br />
(bis hin zum Verzicht auf den Wunschberuf und dem Wegzug aus der Heimatregion)<br />
erfordert: eine solche Aufgabe wird insbesondere Hauptschulabsolventen<br />
mit nur mittelmäßigen Schulleistungen abverlangt, die mit 16 Jahren noch minderjährig<br />
sind und oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen<br />
(Krekel/Ulrich 2009, 27). Die ungleich einfachere Aufgabe (bei faktischer Erfolgsgarantie),<br />
über das Internet und den Postweg die bürokratischen Formalitäten<br />
zur Platzierung am gewünschten Ausbildungsort und in der gewünschten<br />
Disziplin abzuwickeln, geht dagegen an die leistungsstarken Abiturienten, die<br />
bei dieser „Suche“ nach einem (hochschulischen) Berufsausbildungsplatz zudem<br />
bereits längst volljährig sind und überdurchschnittlich oft aus privilegierten sozialen<br />
Verhältnissen stammen.<br />
Angesichts der demotivierenden Wirkungen, die langwierige Suchzeiten auf<br />
die individuelle Stabilität des Ausbildungswunsches haben (Bosch 2008, 243;<br />
Krekel/Ulrich 2009), sind solche institutionell bedingten Benachteiligungen der<br />
„ohnehin Benachteiligten“ (Hauptschulabsolventen aus wenig privilegierten<br />
Verhältnissen und mit nur mittelmäßigen schulischen Leistungen) als dysfunktional<br />
in Hinblick auf das bildungspolitische Ziel zu werten, den Anteil der jungen<br />
Erwachsenen ohne Berufsabschluss zu senken (vgl. auch Solga 2005b).<br />
Gleichwohl bleiben die Zugangsregelungen weitgehend unhinterfragt und sind<br />
damit ein gutes Beispiel dafür, wie Institutionen auch durch Tradition Legitimation<br />
erfahren. Sie erscheinen so selbstverständlich, dass ihre innere Logik und<br />
Alternativen nicht mehr reflektiert werden (Esser 2000).<br />
Zudem setzt sich die institutionelle Benachteiligung erfolgloser Ausbildungsbewerber<br />
insofern fort, als deren Ausbildungsnachfrage in der offiziellen<br />
Ausbildungsmarktbilanzierung zu großen Teilen nicht abgebildet wird und somit<br />
auch kein unmittelbarer Handlungsbedarf sichtbar ist, für vollqualifizierende<br />
Ersatzangebote zu sorgen. Damit wenden wir uns dem zweiten Beispiel zu.<br />
2.2 Zweites Beispiel: Das Argument der „eingeschränkten Ausbildungsnachfrage“<br />
und seine Auswirkungen auf die Bereitstellung von vollqualifizierenden<br />
Ausbildungsplatzangeboten<br />
Nach § 86 des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) soll der Berufsbildungsbericht im<br />
Rahmen seiner Ausbildungsmarktbilanzierung für das vorangegangene Jahr<br />
Angaben enthalten über<br />
142
„die Zahl der am 30. September (…) nicht besetzten, der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong><br />
zur Vermittlung angebotenen Ausbildungsplätze und die Zahl der zu diesem Zeitpunkt<br />
bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> gemeldeten Ausbildungsplätze suchenden<br />
Personen“ (Lakies/Nehls 2007).<br />
Durch die jeweilige Addition dieser beiden Größen mit der Zahl der bis zum 30.<br />
September neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, die das Bundesinstitut für<br />
Berufsbildung jährlich erhebt, ergeben sich die beiden Bilanzierungsgrößen<br />
„Ausbildungsplatzangebot“ und „Ausbildungsplatznachfrage“.<br />
Während die Zahl der am 30. September nicht besetzten, der Bundesagentur<br />
für <strong>Arbeit</strong> zur Vermittlung angebotenen Ausbildungsplätze in der Ausbildungsmarktstatistik<br />
der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> als „erfolgloses Ausbildungsplatzangebot“<br />
leicht zu identifizieren ist, wirft die Identifikation „der zu diesem Zeitpunkt<br />
bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> gemeldeten Ausbildungsplätze suchenden<br />
Personen“ Fragen auf. Die Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> (2008) unterscheidet<br />
vier Vermittlungsformen (vgl. Abbildung 2):<br />
a. Unter „einmündende Bewerber“ werden Personen subsummiert, die eine<br />
Berufsausbildungsstelle antreten.<br />
b. „Andere ehemalige Bewerber“ umfassen Personen, die nicht in eine Berufsausbildungsstelle<br />
einmündeten, sondern etwas anderes begannen oder unbekannt<br />
verblieben und deren Vermittlungsauftrag zum 30. September nicht<br />
mehr bestand.<br />
c. Bei den „Bewerber mit bekannter Alternative zum 30.9.“ handelt es sich um<br />
Personen, die zwar in Alternativen (z.B. berufsvorbereitende Maßnahmen,<br />
Jobben, Praktikum) einmündeten, für die die Vermittlungsbemühungen aber<br />
auf deren Wunsch hin weiter laufen.<br />
d. „Unversorgte/unvermittelte Bewerber“ sind schließlich jene Personen, für<br />
die die Vermittlungsbemühungen ebenfalls weiterlaufen, ohne dass eine Alternative<br />
zum 30. September bekannt ist.<br />
Da der Gesetzestext von den zum 30. September „Ausbildungsplätze suchenden<br />
Personen“ und dabei die aktuelle Verbleibsform unberücksichtigt lässt, müssten<br />
die beiden unter c) und d) genannten Bewerbergruppen zu den erfolglosen Ausbildungsplatzbewerbern<br />
gerechnet werden. Die langjährige Praxis der Berufsbildungsberichterstattung<br />
und die weiterhin geübte Praxis der Ausbildungsmarktbilanzierung<br />
im Rahmen des Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs<br />
in Deutschland wich bzw. weicht davon jedoch ab:<br />
143
Als erfolglose, unversorgte Ausbildungsstellenbewerber werden nur die unter<br />
d) subsumierten Personen betrachtet, während die unter c) genannten Personen<br />
als „versorgt“ gelten, obwohl die Vermittlungsbemühungen unverändert<br />
weiter laufen. 2008 zählten zur zuletzt genannten Gruppe c) 81.246 und damit<br />
rund fünfeinhalb mal mehr Personen, als in der Gruppe d) der 14.479 offiziell<br />
Unversorgten zu finden waren (Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> 2008). Da nun die Zahl<br />
der „Unversorgten“ so niedrig ausfiel, entstand der Eindruck, „als sei es für junge<br />
Menschen mit Ausbildungswunsch kein großes Problem mehr, eine Lehrstelle<br />
zu finden“ (Ebner 2009). Der Begriff des „Versorgt-Seins“ eines Ausbildungsstellenbewerbers<br />
schließt also auch alternative Verbleibe außerhalb einer vollqualifizierenden<br />
Berufsausbildung ein und dies selbst in jenen Fällen, in denen<br />
sich die alternativ verbliebenen Ausbildungsstellenbewerber in Hinblick auf<br />
ihren Wunsch nach einer vollqualifizierenden Berufsausbildung offenbar nicht<br />
als „versorgt“ sehen, sondern auch noch am 30. September in eine vollqualifizierende<br />
Berufsausbildung einmünden möchten.<br />
144
Abbildung 2: Größen der Ausbildungsmarktbilanzierung zum Stichtag<br />
30. September (mit Angaben zu den Ergebnissen im Jahr 2008)<br />
4<br />
Ausbildungsplatzangebot<br />
3<br />
2 1<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Bilanzierung<br />
bei der BA gemeldete<br />
Ausbildungsstellen<br />
Bilanzierungsgrößen der früheren Berufsbildungsberichterstattung<br />
und Ausbildungspaktes<br />
Legende:<br />
Angebotsseite 2008 Nachfragerseite 2008<br />
1,2,3 = Offizielles Ausbildungs- 635.766 1,2,3 = Offizielle Ausbildungsplatz- 630.738<br />
platzangebotnachfrage<br />
1,2 = Erfolgreich besetztes Aus- 616.259 1,2 = Erfolgreiche Ausbildungsplatz- 616.259<br />
bildungsplatzangebotnachfrage<br />
1 = Besetzte Ausbildungsplätze, 124.184 1 = Erfolgreiche Ausbildungsplatz- 334.129<br />
die der BA nicht bekannt<br />
nachfrager, die der BA nicht be-<br />
waren (rechnerische Zahl)<br />
kannt waren (rechnerische Zahl)<br />
2,3 = Bei der BA gemeldete Aus- 511.582 2,3,4,5 = Bei der BA gemeldete Ausbil- 620.209<br />
bildungsstellendungsstellenbewerber<br />
2 = Mit Mitwirkung der BA 492.075 2 = Mit Mitwirkung der BA erfolg- 282.130<br />
erfolgreich besetzte Plätze<br />
reiche Ausbildungsnachfrager<br />
(rechnerische Zahl)<br />
(rechnerische Zahl)<br />
3 = Offiziell unbesetztes betrieb- 19.507 3 = Offiziell erfolglose Ausbil- 14.479<br />
liches Ausbildungsangebot<br />
dungsplatznachfrager(„unversorgte Bewerber“)<br />
4 = Weiter suchende Bewerber mit<br />
Alternative zum 30.09.<br />
81.846<br />
5 = Andere ehemalige Bewerber<br />
(mit Alternative oder unbekannt<br />
verblieben)<br />
241.754<br />
4 = Erfolglose Ausbildungsplatz- bis zu 6 = Erfolglose Ausbildungsinteres- rund<br />
angebote, die nicht bei der 42.400 sierte, die nicht bei der BA 80.000<br />
BA gemeldet waren<br />
gemeldet waren<br />
Die Größenverhältnisse der Balken entsprechen den tatsächlichen Relationen. Die Angaben zu den<br />
Posten 4 (links) und 6 (rechts) basieren auf Schätzungen von BIBB-Untersuchungen.<br />
Quelle: Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>, Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
Ausbildungsplatznachfrage<br />
Bei der BA gemeldete<br />
Ausbildungsstellenbewerber<br />
145
Der institutionelle Umgang mit den Wünschen der erfolglosen Ausbildungsstellenbewerber<br />
nach einer vollqualifizierenden Berufsausbildung wirkt somit eher<br />
defensiv als offensiv; und ein solcher Umgang wird selbst dann praktiziert, wenn<br />
es sich um Bewerber handelt, „deren Eignungen dafür geklärt ist bzw. deren<br />
Voraussetzungen dafür gegeben sind“ (Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> 2008, 5). Die<br />
defensive Haltung spiegelt sich dabei allerdings nicht nur in der restriktiven<br />
Berechnung wider, wer am 30. September zu den „unversorgten Bewerbern“ zu<br />
zählen ist, sondern auch in der Festlegung des Bilanzierungsstichtages selbst.<br />
Am 30. September sind bereits mehrere Wochen seit dem Beginn des neuen<br />
Ausbildungsjahres vergangen; zu diesem Zeitpunkt dürften viele erfolglose Bewerber<br />
resigniert und ihren Ausbildungswunsch auf das nächste Jahr verschoben<br />
haben. Dieses Problem wurde bereits in den 70er-Jahren zu Beginn der Berufsbildungsberichterstattung<br />
offen erörtert:<br />
146<br />
„... ergibt sich eine Nachfragegröße, die gemessen an den eigentlichen Ausbildungswünschen<br />
der Betroffenen eher zu niedrig – da unter den Ausbildungsplatzsuchenden<br />
bei den <strong>Arbeit</strong>sämtern diejenigen nicht mehr enthalten sind, die ihren Ausbildungswunsch<br />
wegen mangelnden Angebots schon aufgegeben haben – als zu<br />
hoch ist“ (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1977, 24).<br />
Deshalb lässt sich eine weitgehend ausreichende „Versorgung“ ausbildungsreifer<br />
Ausbildungsbewerber rechnerisch auch dann sicherstellen, wenn das vollqualifizierende<br />
Ausbildungsangebot weit unter der Zahl der ausbildungsinteressierten<br />
Schulabgänger liegt. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Bilanzierung<br />
spät, also ein bis zwei Monate nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres, erfolgt<br />
und dass erfolglose Ausbildungsbewerber bis dahin in teilqualifizierende Maßnahmen<br />
oder sonstige Alternativen (z.B. Jobben, Praktika) einmündeten.<br />
So stellte der „Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“<br />
selbst im Jahr 2005 eine „leichte Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt<br />
fest“, da mehr Bewerber in berufsvorbereitenden Maßnahmen und sonstigen Alternativen<br />
eingemündet waren und die Zahl der „Unversorgten“ auf diese Weise gegenüber<br />
dem Vorjahr verringert werden konnte (Ulrich 2006). 2005 war das Jahr, in<br />
dem die Zahl der Ausbildungsplatzangebote im dualen System mit einem Umfang<br />
von nur noch 562.816 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung sank;<br />
gegenüber 1992 betrug der Rückgang 159.009 Plätze (vgl. Spalte 4 in Tabelle 1).<br />
Die Zahl der Einmündungen in das Duale System lag um 19.940 niedriger als 1992<br />
(Sp. 5). Dabei fiel die Zahl der nichtstudienberechtigten Abgänger und Absolventen<br />
aus allgemeinbildenden Schulen um 125.382 höher aus (Sp. 2), die der Abgänger<br />
aus teilqualifizierenden beruflichen Schulen um 146.015 (Sp. 3). Beide Gruppen,<br />
welche die Hauptklientel der dualen Berufsausbildung bilden, summierten sich 2005<br />
auf einen Gesamtumfang von 1.007.229 Personen (1992: 735.108).
Tabelle 1: Statistische Entwicklungen im Bereich der beruflichen Bildung von 1992 – 2009<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>, Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
147
148<br />
Trotz der beträchtlichen Lücke zwischen Angebot und Nachfrage betrug die offizielle<br />
Differenz zwischen der Zahl der Ausbildungsplatzangebote (Sp. 4) und Ausbildungsplatznachfrage<br />
(Sp. 8) nur 27.852; denn lediglich 40.115 Personen galten letztlich<br />
als unversorgt.<br />
Von den 740.688 bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> gemeldeten und geeignet befundenen<br />
Ausbildungsstellenbewerbern (Sp. 9) waren allerdings nur 360.383 bzw.<br />
48,7 % in eine Berufsausbildungsstelle eingemündet (Sp. 10); der Anteil alternativ<br />
verbliebener Bewerber (Sp. 11 und Sp. 12) bezifferte sich auf insgesamt 340.190<br />
bzw. 45,9 %. Insgesamt begannen 2005 mehr als eine halbe Millionen Personen<br />
teilqualifizierende Bildungsgänge des Übergangssystems (Sp. 7), mit 516.988 <strong>hat</strong>te<br />
sich die Zahl gegenüber dem Wert von 1992 (249.133) mehr als verdoppelt. Zwar<br />
wurden auch mehr Eintritte in vollqualifizierende schulische Berufsausbildungen<br />
gezählt (+83.157; vgl. Sp. 6), doch reichte dieser Zuwachs bei Weitem nicht aus, um<br />
den Bedarf an vollqualifizierenden Berufsausbildungsplätzen zu decken.<br />
Die Funktion des „Übergangssystems“ bestand insofern in den letzten Jahren<br />
insbesondere darin, die Ausbildungsplatznachfrage, die durch das duale Berufsausbildungssystem<br />
nicht befriedigt werden konnte, umzulenken und damit den<br />
Legimitationsdruck auf das duale Berufsausbildungssystem, von dem grundsätzlich<br />
eine ausreichende Versorgung der ausbildungsinteressierten Schulabgänger<br />
erwartet wird, zu lindern (Beicht 2009, Bosch 2008, Krekel/Ulrich 2009, Ulrich<br />
2008). Zugleich wurde damit aber der tatsächliche Versorgungsbedarf von ausbildungsreifen<br />
Jugendlichen mit vollqualifizierender Berufsausbildung nicht<br />
mehr sichtbar (vgl. Abbildung 3). Da die hohen Teilnehmerzahlen im Übergangssystem<br />
die Zweifel an der „Ausbildungsreife“ der Jugendlichen weiter<br />
nährten, stabilisierten und legitimierten sich die Übergangsinstitutionen in vollqualifizierende<br />
und lediglich teilqualifizierende Berufsausbildung gegenseitig.<br />
Für die Übergangsforschung im Bereich der beruflichen Ausbildung ist in<br />
Folge dieser Regelungen eine besondere Vorsicht bei der Interpretation statistischer<br />
Einflussgrößen erforderlich. Sie darf die „Sortierlogiken“, wer unter den<br />
gegebenen Umständen einen vollqualifizierenden Berufsausbildungsplatz erhält<br />
und wer nicht, nicht mit Kausalinterpretationen verwechseln, welche individuellen<br />
schulischen Voraussetzungen und Qualifikationen heute erforderlich sind,<br />
um eine Ausbildung bewältigen zu können und um den Ausbildungserfolg sicherzustellen<br />
(vgl. dazu auch Dellenbach/Hupka/Stalder 2004, 53 ff.). Dies gilt<br />
insbesondere für jene Jugendlichen, denen die Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> die für<br />
den angestrebten Ausbildungsberuf erforderliche Eignung zuerkannt <strong>hat</strong>. Wir<br />
wollen im Folgenden anhand einer zum Jahreswechsel 2008/2009 durchgeführten<br />
Untersuchung von Ausbildungsstellenbewerbern die zurzeit wirksamen Sortierlogiken<br />
beim Übergang in eine vollqualifizierende Berufsausbildung analysieren<br />
und zugleich überprüfen, inwieweit sich die in den vorangegangenen Ab-
schnitten geäußerte Kritik an den bisherigen Übergangsinstitutionen durch die<br />
Untersuchungsergebnisse bestätigen lassen.<br />
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der Schulentlassenen, des offiziellen<br />
Umfangs von Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage (linke<br />
Hälfte) sowie der Eintritte in teilqualifizierende Bildungsgänge<br />
des so genannten „Übergangssystems“ und in vollqualifizierende<br />
Schulberufsausbildungen (rechte Hälfte)<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>, Bundesinstitut für Berufsbildung und<br />
eigene Berechnungen<br />
3 Gegenwärtige „Sortierlogiken“ bei der Versorgung von Ausbildungsstellenbewerbern<br />
3.1 Untersuchungsaufbau der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2008<br />
Bei der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2008 handelt es sich um eine schriftlichpostalische<br />
Repräsentativerhebung von rund 5.000 Personen. Grundgesamtheit<br />
waren die 620.002 gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber des Berichtsjahres<br />
2007/08, die ihren Wohnsitz im Inland <strong>hat</strong>ten. Die Stichprobe wurde von der<br />
Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> (BA) gezogen. Die anonym durchgeführte Befragung<br />
fand von Ende Dezember 2008 bis März 2009 statt. Insgesamt wurden 13.000<br />
Personen angeschrieben. Die Auswahl erfolgte per Zufall. Der Rücklauf betrug<br />
5.197 (40 %). In die Auswertung gelangten 5.087 Fragebögen; ausgeschlossen<br />
149
wurden verspätet eingegangene, sehr unvollständig ausgefüllte Fragebögen und<br />
Bögen, die regional nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Die Ergebnisse<br />
wurden über eine Soll-Ist-Anpassung gewichtet und konnten auf die Grundgesamtheit<br />
hochgerechnet werden. Gewichtungsmerkmale waren die Herkunftsregion,<br />
das Geschlecht und die offizielle Verbleibseinstufung der Bewerber. Damit<br />
ließen sich auch weitere Merkmalsverteilungen der Grundgesamtheit, die nicht<br />
in das Gewichtungs- und Hochrechnungsmodell einbezogen waren (z. B. Schulabschluss<br />
und Nationalität), sehr gut reproduzieren.<br />
3.2 Ergebnisse<br />
Bewertung der verschiedenen Verbleibsformen durch die Jugendlichen:<br />
Von den 620.002 bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> gemeldeten, im Inland wohnenden<br />
Ausbildungsstellenbewerbern des Jahres 2008 galten zum Stichtag<br />
30. September 605.526 als „versorgt“, obwohl sich darunter 323.483 Personen<br />
befanden, für die keine Einmündung in eine Berufsausbildungsstelle festgestellt<br />
werden konnte. Dass auch diese Bewerber als „versorgt“ betrachtet werden, wird<br />
im Wesentlichen damit begründet, dass das Motiv für den alternativen Verbleib<br />
über die Geschäftsstatistik nicht feststellbar ist (Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> 2008,<br />
5). Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass alternative Verbleibe außerhalb<br />
einer Berufsausbildung selbstbestimmt und freiwillig erfolgten. Dieses<br />
Argument ist grundsätzlich korrekt, denn bei der Berufsfindung handelt es sich<br />
um einen komplexen Prozess, in dem verschiedene Bildungsalternativen durchgespielt,<br />
in Betracht gezogen und zum Teil auch wieder verworfen werden<br />
(Fobe/Minx 1996, 7 ff.).<br />
Im Rahmen der BA/BIBB-Bewerberbefragung ist allerdings eine Motiverkundung<br />
für die jeweilige Verbleibsform möglich. Wir wollen dabei zunächst<br />
untersuchen, wie die Ausbildungsstellenbewerber ihren aktuellen Verbleib bewerten.<br />
Es zeigt sich, dass hochgerechnet nur 332.000 bzw. knapp 54 % diesen<br />
Verbleib als erste („war immer mein Wunsch“) oder zumindest als zweite Wahl<br />
(„eine Alternative, die ich von vornherein in Betracht gezogen habe“) empfinden.<br />
158.800 (26 %) sprechen dagegen allenfalls von einer dritten Wahl („nicht<br />
unbedingt gewollte, inzwischen aber akzeptierte Alternative“ bzw. „sinnvolle<br />
Überbrückung“) und 100.500 (16 %) sogar von einer „Notlösung“ oder „Sackgasse“<br />
(vgl. die untere Zeile in Tabelle 2).<br />
150
Tabelle 2: Subjektive Bewertung ihres Verbleibs durch die Ausbildungsstellenbewerber<br />
Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2008<br />
151
Bei diesen Bewertungen lässt sich des Weiteren eine starke Varianz der Bewertung<br />
abhängig vom aktuellen Verbleib erkennen: Der Verbleib in Bildungsangeboten,<br />
die zu einem vollqualifizierenden Bildungsabschluss führen, werden wesentlich<br />
positiver eingeschätzt als Maßnahmen des „Übergangssystems“ oder der<br />
Verbleib außerhalb des Bildungssystems (z.B. Jobben, <strong>Arbeit</strong>, arbeitslos). Deutlich<br />
wird zudem, dass die Bewerber zwar eine betriebliche Ausbildung präferieren,<br />
durchaus aber auch mit einem außerbetrieblichen Ersatzangebot zufrieden<br />
sind bzw. den Beginn einer vollqualifizierenden schulischen Berufsausbildung<br />
dem Verbleib im Übergangssystem vorziehen Dabei variieren die Einschätzungen<br />
kaum mit den individuellen Merkmalen der Befragten: Ob ein Bewerber mit<br />
seiner gegenwärtigen Lage zufrieden ist, hängt damit nicht so sehr von personenspezifischen<br />
Merkmalen, sondern vor allem von der Verbleibsform ab.<br />
Die Aussagen der Jugendlichen verweisen darauf, dass viele alternative<br />
Verbleibe außerhalb einer betrieblichen Berufsausbildung nicht unmittelbar und<br />
primär angestrebt wurden, sondern im Wesentlichen als Ausweichreaktion erfolgten<br />
(vgl. auch Hupka/Sacchi/Stalder 2006, 6). Dies ergibt sich auch aus einem<br />
anderen Ergebnis: Unter den 323.483 Bewerbern, die offiziell als „versorgt“<br />
galten, obwohl sie nicht in eine Berufsausbildungsstelle eingemündet waren,<br />
befanden sich 134.200 (41 %), die zum Untersuchungszeitpunkt Ende 2008 –<br />
und damit nach dem Nachvermittlungsgeschäft – noch immer keine Berufsausbildung<br />
absolvierten und die ihren alternativen Verbleib zugleich darauf zurückführten,<br />
dass ihre Bewerbungen erfolglos geblieben waren. 76.400 (24 %) zeigten<br />
sich daran interessiert, selbst zu diesem späten Zeitpunkt in das bereits seit<br />
mehreren Monaten laufende Ausbildungsjahr einzusteigen, weitere 108.300 (33<br />
%) wollten zumindest in den kommenden Jahren mit einer Berufsausbildung<br />
anfangen. 20 All diese Jugendlichen wurden in der Marktbilanzierung des Nationalen<br />
Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland nicht als<br />
erfolglose Ausbildungsplatznachfrager geführt, so dass mit rechnerisch 100,8<br />
Angeboten auf 100 Ausbildungsplatznachfrager das offizielle Verhältnis von<br />
Angebot und Nachfrage (sog. „Angebots-Nachfrage-Relation“) wieder einmal<br />
ausgeglichen erschien (vgl. Ulrich/Flemming/Granath 2009, 27 ff.).<br />
Die Regel, sämtliche alternativ verbliebene Bewerber nicht als erfolglose<br />
Ausbildungsnachfrager zu behandeln, stützt somit den Mythos eines ausgeglichenen<br />
Ausbildungsmarktes. Sie benachteiligt aber all diejenigen ausbildungsreifen<br />
Bewerber, die sich bei fehlendem Bewerbungserfolg flexibel zeigen und<br />
notgedrungen auf teilqualifizierende Bildungsgänge oder (zum Teil geringfügige)<br />
Beschäftigungen ausweichen und damit als „versorgt“ gelten.<br />
20 Bewerber, die eine Ausbildung bereits einmal begonnen, aber bis zum Untersuchungszeitpunkt<br />
abgebrochen <strong>hat</strong>ten, wurden bei diesen Berechnungen ausgeschlossen.<br />
152
Determinanten des Verbleibs in vollqualifizierender Berufsausbildung<br />
Nach welcher Logik verbleiben nun Ausbildungsstellenbewerber, deren Eignung<br />
für den Beginn einer vollqualifizierenden Berufsausbildung „geklärt ist bzw.<br />
deren Voraussetzungen dafür gegeben sind“, innerhalb und außerhalb einer Berufsausbildung?<br />
In Tabelle 3 werden im Rahmen dreier binärer logistischer Regressionsmodelle<br />
drei unterschiedliche, schrittweise erweiterte Zielzustände unterschieden:<br />
Modell 1: Einmündung in eine betriebliche Ausbildungsstelle in Ausbildungsberufen<br />
des Dualen Systems gemäß BBiG/HwO;<br />
Modell 2: Einmündung in eine betriebliche oder nichtbetriebliche (außerbetriebliche,<br />
schulische) Ausbildungsstelle in Ausbildungsberufen gemäß<br />
BBiG/HwO;<br />
Modell 3: Einmündung in irgendeine Form vollqualifizierender Berufsausbildung<br />
(betrieblich oder nichtbetrieblich in BBiG/HwO-Berufen), in sog.<br />
Schulberufe oder in eine Hochschulausbildung).<br />
Wie nun die Ergebnisse zeigen, gilt für alle drei Modelle, dass die Verbleibs-<br />
und Sortierlogiken einer komplexen Kombination von a) individuellen Leistungs-<br />
und Motivationsmerkmalen, b) regionale und sonstige Gelegenheiten<br />
sowie c) weiteren personenbezogenen Merkmalen folgen, welche nicht unmittelbar<br />
leistungsbezogen sind, aber dennoch mit der Ausbildungschance korrelieren<br />
(z.B. Geschlecht, Herkunft).<br />
Individuelle Leistungs- und Motivationsmerkmale<br />
Als Leistungsmerkmale zählen hierzu der erreichte Schulabschluss, die letzten<br />
Schulnoten (in der BBA/BIBB-Bewerberbefragung wurden die Noten in Deutsch<br />
und Mathematik abgefragt) sowie als motivationale Determinanten der gezeigte<br />
Einsatz bei der Lehrstellensuche und die Bereitschaft, sich in mehreren unterschiedlichen<br />
Berufen zu bewerben. All diese Merkmale haben sich auch in sonstigen<br />
Übergangsstudien als erklärungsträchtig erwiesen (Diehl/Friedrich/Hall<br />
2009, Eberhard/Krewerth/Ulrich 2006).<br />
Regionale und sonstige Gelegenheiten<br />
Von besonderer Bedeutung ist hier vor allem die regionale Ausbildungsmarktsituation<br />
vor Ort, wie sie sich in der rechnerischen Zahl der betrieblichen Ausbil-<br />
153
dungsplatzangebote 21 je 100 Ausbildungsinteressierte 22 im jeweiligen <strong>Arbeit</strong>sagenturbezirk<br />
spiegelt. Je mehr Angebote es in der Region gibt, desto größer ist<br />
die Einmündungschance in eine betriebliche, aber eben auch in irgendeine Form<br />
vollqualifizierender Berufsausbildung.<br />
Dabei erweist es sich allerdings als auffällig, dass losgelöst von der Marktlage<br />
vor Ort die Tatsache, ob ein Bewerber in West- oder Ostdeutschland wohnt,<br />
mit einer unterschiedlich hohen Übergangschance verbunden ist: Ostdeutsche<br />
Ausbildungsstellenbewerber <strong>hat</strong>ten 2008 zwar keine (signifikant) größere Chance,<br />
in eine betriebliche Ausbildungsstelle einzumünden (sofern die entsprechenden<br />
Marktverhältnisse kontrolliert werden), wohl aber eine deutlich größere<br />
Chance, in irgendeine Form einer vollqualifizierenden Berufsausbildungsstelle<br />
einzumünden. Die Ursache ist hier ebenfalls institutioneller Natur 23 : In Ostdeutschland<br />
ist das „Übergangssystem“ weniger bedeutsam, während das kompensatorische<br />
Ausbildungsangebot in Form von vollqualifizierenden nichtbetrieblichen<br />
Ausbildungsplätzen als Folge des wiedervereinigungsbedingten Umbruchs<br />
eine weitaus größere Bedeutung erlangte und bis heute beibehalten <strong>hat</strong>.<br />
Dementsprechend mündete 2008 (wie auch in den Jahren zuvor) in Ostdeutschland<br />
ein höherer Anteil der Bewerber in eine Berufsausbildung ein, als dies in<br />
Westdeutschland der Fall war – obwohl das betriebliche Angebot in den vergangenen<br />
Jahren im Osten wesentlich niedriger ausfiel als in den alten Ländern. 24<br />
Dass darüber hinaus auch der Verstädterungsgrad der Wohnregion (Einwohnerdichte)<br />
von Bedeutung ist und Bewerber, die in Großstädten wohnen,<br />
grundsätzlich schlechtere Ausbildungschancen haben, ist insbesondere Folge<br />
einer starken Einpendelbereitschaft von Ausbildungsstellenbewerbern, die im<br />
ländlichen Umland von Ballungsgebieten wohnen. Die großstädtischen Ausbildungsplätze<br />
sind deshalb stark umworben, und sie werden von den Unternehmen<br />
oft auch an Bewerber aus dem Umland vergeben.<br />
21 Geschätzt über die Differenz zwischen der Zahl der in der Region registrierten Ausbildungsplatzangebote<br />
abzüglich der Zahl der gemeldeten außerbetrieblichen Ausbildungsstellen.<br />
22 Definiert als die Summe aus der Zahl aller gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber in der Region<br />
zuzüglich der rechnerischen Zahl der erfolgreichen Ausbildungsplatznachfrager, die nicht bei der<br />
Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> als Ausbildungsstellenbewerber registriert worden waren. Die zuletzt<br />
genannte Größe wurde ermittelt, indem von der Gesamtzahl aller in der Region neu abgeschlossenen<br />
Ausbildungsverträge die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber abgezogen wurde, die in<br />
eine Berufsausbildungsstelle mündeten.<br />
23 Vgl. dazu auch Imdorf/Seibert/Hupka (2009) mit Ergebnissen für die Schweiz.<br />
24 Vgl. zu den „historischen“ Gründen auch Eberhard/Ulrich (2009).<br />
154
Tabelle 3: Determinanten des Verbleibs in vollqualifizierender Berufsausbildung<br />
Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2008<br />
Modell 3: betrieblich,<br />
Modell 2: betriebliche oder nicht-<br />
nichtbetrieblich, schulisch,<br />
betriebliche BBIG-Ausbildung<br />
hochschulisch<br />
e ß Std.f Z p e ß Std.f Z p e ß Std.f Z p<br />
Modell 1: betriebliche<br />
Berufsausbildung nach BBiG<br />
Individuelle Leistungs- und Motivationsmerkmale<br />
mittlerer Abschluss (Referenz: maximal Hauptschule) 1,990 0,158 8,66 0,000 1,204 0,088 2,55 0,006 1,294 0,094 3,55 0,000<br />
Studienberechtigung (Referenz: maximal Hauptschule) 4,130 0,498 11,75 0,000 1,791 0,202 5,18 0,000 2,960 0,346 9,30 0,000<br />
(schlechtere) Deutschnote 0,854 0,042 -3,24 0,001 0,859 0,039 -3,32 0,001 0,817 0,037 -4,42 0,000<br />
(schlechtere) Mathematiknote 0,747 0,028 -7,81 0,000 0,795 0,028 -6,54 0,000 0,834 0,029 -5,19 0,000<br />
in mehreren Berufen beworben 1,388 0,104 4,37 0,000 1,267 0,089 3,37 0,001 1,171 0,082 2,24 0,013<br />
keine rechte Mühe gemacht 0,517 0,060 -5,65 0,000 0,527 0,055 -6,11 0,000 0,545 0,055 -6,01 0,000<br />
Regionale und sonstige Gelegenheiten<br />
(günstigere) Ausbildungsmarktrelation 1,016 0,004 4,16 0,000 1,013 0,004 3,58 0,000 1,016 0,004 4,36 0,000<br />
Wohnort in Ostdeutschland 1,177 0,131 1,47 0,071 1,879 0,195 6,07 0,000 2,137 0,233 6,95 0,000<br />
(höhere) Einwohnerdichte 0,988 0,005 -2,54 0,006 0,990 0,004 -2,40 0,008 0,992 0,004 -1,82 0,035<br />
Praktika absolviert 1,208 0,090 2,52 0,006 1,247 0,088 3,14 0,001 1,199 0,085 2,57 0,005<br />
Einstiegsqualifizierung absolviert 1,928 0,286 4,42 0,000 1,990 0,288 4,76 0,000 1,730 0,253 3,74 0,000<br />
Weitere personenbezogene Merkmale<br />
männliches Geschlecht 1,350 0,097 4,16 0,000 1,389 0,094 4,84 0,000 1,268 0,086 3,50 0,000<br />
18 bis 20 Jahre (Referenz: nicht volljährig) 0,737 0,063 -3,58 0,000 1,025 0,083 0,30 0,380 0,915 0,074 -1,10 0,137<br />
21 bis 22 Jahre (Referenz: nicht volljährig) 0,553 0,059 -5,54 0,000 0,855 0,085 -1,57 0,058 0,732 0,073 -3,12 0,001<br />
22 Jahre und älter (Referenz: nicht volljährig) 0,364 0,049 -7,58 0,000 0,658 0,079 -3,50 0,000 0,554 0,066 -4,94 0,000<br />
ohne Migrationshintergrund (Referenz: Aussiedler) 1,304 0,159 2,18 0,015 1,242 0,141 1,91 0,028 1,053 0,118 0,46 0,322<br />
türkisch-arabischer Herkunft (Referenz: Aussiedler) 0,646 0,124 -2,27 0,012 0,762 0,130 -1,60 0,055 0,710 0,117 -2,08 0,019<br />
ehemalige Anwerbestaaten (Referenz: Aussiedler) 0,671 0,151 -1,77 0,038 0,630 0,130 -2,24 0,013 0,542 0,108 -3,07 0,001<br />
sonstige Herkunft (Referenz: Aussiedler) 0,691 0,156 -1,64 0,050 0,745 0,151 -1,45 0,073 0,688 0,136 -1,90 0,029<br />
Zufallseffekt Ebene 2<br />
Varianz der Regressionskonstante 0,007 0,021 0,000 0,000 0,008 0,020<br />
N der Ebene 1 (Probanden) 4.134 4.134 4.134<br />
N der Ebene 2 (Regionen) 176 176 176<br />
Logistische Zwei-Ebenen-Modelle (mit zufälligen Effekten). Std.f. = Standardfehler.<br />
155
Neben den regionalen Gelegenheiten 25 werden die Übergangschancen auch<br />
durch jene Gelegenheiten positiv beeinflusst, die sich durch bereits bestehende<br />
Kontakte zu Betrieben eröffnen: Hierzu zählen vor allem vorab geleistete Praktika<br />
oder eine vorab absolvierte Einstiegsqualifizierung. In vielen Betrieben ist es<br />
üblich geworden, Jugendliche zunächst im Rahmen von Probearbeiten zu beobachten,<br />
bevor sie einen Ausbildungsvertrag erhalten.<br />
Weitere personenbezogene Merkmale, die nicht unmittelbar leistungsbezogen<br />
sind, aber dennoch mit der Ausbildungschance korrelieren<br />
Zu diesen Merkmalen zählen das Geschlecht, das Alter und die ethnische Herkunft<br />
der Ausbildungsstellenbewerber. Die bloße Tatsache, dass diese Merkmale<br />
selbst unter Kontrolle der individuellen Leistungsvoraussetzungen statistisch<br />
signifikant mit der Ausbildungschance verbunden sind, muss nicht zwingend auf<br />
eine Diskriminierung bestimmter Gruppen hinweisen (vgl. auch Kalter 2006).<br />
So sind die geringeren Ausbildungschancen der jungen Frauen Folge ihrer<br />
weiterhin sehr starken Ausrichtung ihrer Ausbildungswünsche auf die Dienstleistungsberufe<br />
(vgl. Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> 2008). Diese Berufe werden zudem<br />
auch von jenen jungen Männern präferiert, die im Schnitt schulische bessere<br />
Leistungen erzielen als ihre Geschlechtsgenossen. Dies führt dazu, dass die<br />
Dienstleistungsberufe stärker umworben werden und dass selbst überdurchschnittliche<br />
Noten bisweilen nicht ausreichen, um eine betriebliche Ausbildungsstelle<br />
zu finden.<br />
Wie zuletzt Studien aus der Schweiz zeigten, sind die schlechteren Chancen<br />
von älteren Bewerbern und von Bewerbern mit Migrationshintergrund aber zum<br />
Teil spezifischen betrieblichen Logiken bei ihrer Lehrlingsselektion zuzuschreiben<br />
(Imdorf 2007a, Imdorf 2009). So sind die Unternehmen z.B. an Bewerbern<br />
interessiert, die einerseits keine Kinder mehr sind, andererseits auch noch keine<br />
Erwachsene, sondern noch „formbare“ Jugendliche. Damit erscheinen ihnen<br />
Ausbildungsstellenbewerber mit 16 Jahren zwar oft noch als zu jung, Bewerber<br />
mit 19 Jahren dagegen aber bisweilen bereits als zu alt. Tatsächlich zeigt sich<br />
auch in der BA/BIBB-Bewerberbefragung, dass bereits die Gruppe der 18- bis<br />
20-jährigen Bewerber signifikant geringere Chancen auf eine betriebliche Ausbildungsstelle<br />
<strong>hat</strong> als die Gruppe der nichtvolljährigen Bewerber.<br />
25 Der hier verwendete regionale Ausbildungsmarktindikator kann die Nachfrage auswärtiger Ausbildungsstellenbewerber<br />
nicht vollständig abbilden. Dies trägt zum signifikanten Effekt des Verstädterungsgrades<br />
bei, allerdings auch das Phänomen, dass die Auspendelbereitschaft großstädtischer<br />
Bewerber niedriger ausfällt als die Einpendelbereitschaft der Bewerber aus dem Umland (vgl. dazu<br />
auch Ulrich/Ehrenthal/Häfner 2006)<br />
156
In dieser Schweizer Studie wurde zudem deutlich, dass Betriebe an einem<br />
möglichst reibungs- und störungsfreien Ablauf ihrer Berufsausbildung interessiert<br />
sind und bei der Lehrlingsauswahl jenen Bewerbern den Vorzug geben, von<br />
denen sie annehmen, dass diese als spätere Lehrlinge den Produktionsprozess der<br />
Waren und Dienstleistungen ebenso wenig stören wie die Sozialbeziehungen im<br />
Betrieb und die Beziehungen zu den Kunden. Dies führt oft dazu, dass sich die<br />
Betriebe bei der Einstellung von Migranten zögerlich zeigen, da sie befürchten,<br />
dass diese bei der Integration in die Belegschaft mehr Probleme bereiten oder<br />
auch den Kontakt zur Kundschaft in irgendeiner Form belasten könnten (Imdorf<br />
2007b). Und auch in der BA/BIBB-Bewerberbefragung lassen sich signifikant<br />
schlechtere Ausbildungschancen für Aussiedler gegenüber Jugendlichen ohne<br />
Migrationshintergrund feststellen, während aber die Aussiedler zugleich signifikant<br />
bessere Chancen als Bewerber mit sonstigem Migrationshintergrund aufweisen.<br />
26<br />
4 Diskussion<br />
Auch wenn die Hintergründe für die jeweiligen Sortierlogiken beim Verbleib<br />
von Ausbildungsstellenbewerbern nicht bis in die letzten Details aufgeklärt sind,<br />
so ist im Ganzen doch eine institutionell bedingte Benachteiligung dieser Jugendlichen<br />
unübersehbar. Während die Sicherung der Zugangschancen von studierwilligen<br />
Abiturienten in die Hochschulen weitgehend sozialisiert ist (vgl.<br />
auch Kruip 2003a), müssen sich die Ausbildungsstellenbewerber über einen<br />
Markt Zugang in eine Berufsausbildung verschaffen.<br />
Die dabei wirksamen Selektionsmechanismen folgen nur zum Teil<br />
meritokratischen Prinzipien, nach denen die jeweils leistungsstärksten Personen<br />
mit den besten individuellen Voraussetzungen die höchste Eintrittschance in eine<br />
Berufsausbildungsstelle haben (vgl. auch Solga 2005a). So spielen nicht nur die<br />
Schulabschlüsse und Schulnoten eine Rolle, sondern z.B. auch die ethnische<br />
Herkunft und der Wohnort der Jugendlichen. Doch ist die partielle Verletzung<br />
meritokratischer Verteilungsprinzipien innerhalb der Gruppe der Ausbildungsstellenbewerber<br />
noch nicht einmal der kritischste Punkt in der Ungleichbehand-<br />
26 Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Eltern der Jugendlichen mit Migrationshintergrund<br />
häufig selbst nicht auf ein entsprechendes Erfahrungswissen beim Eintritt in das deutsche Berufsbildungssystem<br />
zurückgreifen können und in den Migrantenfamilien entsprechende Gespräche über die<br />
Zugangsprobleme und möglichen Erfolgsstrategien signifikant seltener stattfinden. Zudem fehlen den<br />
Eltern häufiger die sozialen Netzwerke, um ihren Kindern über Beziehungen den Zugang zu einer<br />
Berufsausbildungsstelle zu eröffnen (Beicht/Friedrich/Ulrich 2008). Eine sehr differenzierte Analyse<br />
des Einflusses der Herkunftsfamilie auf die Übergangschance in Berufsausbildung findet sich bei<br />
Hupka/Sacchi/Stalder (2006), welche die Schweizerischen Verhältnisse untersuchten.<br />
157
lung zwischen den Ausbildungsstellenbewerbern und Abiturienten mit Interesse<br />
an einer Hochschulausbildung. Vielmehr ist es die Tatsache, dass die Zahl der<br />
nichtakademischen Ausbildungsangebote insgesamt deutlich niedriger ausfällt<br />
als die Zahl der Ausbildungsinteressierten, obwohl diese Personen die Voraussetzungen<br />
für eine Berufsausbildung auch offiziell mitbringen. Das nicht ausreichende<br />
Angebot an Ausbildungsplätzen ist dabei vor allem den institutionellen<br />
Rahmenbedingungen zuzuschreiben: Der klassische marktwirtschaftlich geregelte<br />
Eintritt in eine betriebliche Berufsausbildung wird nicht in einem ausreichenden<br />
Maße durch einen konjunkturunabhängigen Zugang in vollqualifizierende<br />
Berufsausbildung (außerbetriebliche Ausbildung, schulische Ausbildung nach<br />
BBiG/HwO) ergänzt, um der tatsächlichen Nachfrage gerecht zu werden (vgl.<br />
dazu auch Kruip 2003b, 250 f.). Dies traf in den letzten Jahren für Westdeutschland<br />
noch stärker zu als für die neuen Bundesländer, in denen die außerbetriebliche<br />
Berufsausbildung stets eine deutlich stärkere Bedeutung <strong>hat</strong>te (Ulrich/Eberhard<br />
2008). 27 Neben dem Problem, dass das vollqualifizierende Berufsausbildungsangebot<br />
in den vergangenen Jahren grundsätzlich nicht ausreichte,<br />
ließen sich also auch regionale Unterschiede in den institutionellen Rahmenbedingungen<br />
des Übergangsgeschehens beobachten und damit auch regionale Ungleichheiten<br />
beim Zugang in Berufsausbildung.<br />
Somit gibt es keine bundesweit einheitliche und zugleich ausreichende institutionelle<br />
Absicherung für ausbildungsreife Jugendliche, die eine vollqualifizierende<br />
Berufsausbildung absolvieren möchten, am ausbildungsmarktgeregelten<br />
Zugang aber scheitern. Die „Alternativen“ für „ausbildungsreife“ Schulabgänger,<br />
denen kein vollqualifizierendes Ausbildungsangebot eröffnet wird, bestehen<br />
zunächst im Beginn eines teilqualifizierenden Bildungsgangs des so genannten<br />
„Übergangssystems“. Tatsächlich sind die Jugendlichen durchaus bereit, ihre<br />
Ausbildungswünsche stets auch an den begrenzten Optionsrahmen anzupassen<br />
(vgl. dazu auch Heinz u.a. 1987) und die entsprechenden Verbleibe zumindest<br />
als eine sinnvolle Überbrückung zu akzeptieren (vgl. auch Straßer/Ratschinski<br />
2008, 35). Dies ist insofern auch zweckmäßig, als sich solche Verbleibe gegenüber<br />
Verbleiben in <strong>Arbeit</strong>slosigkeit oder Beschäftigung als die bessere Alternative<br />
in Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit eines nachfolgenden Berufsausbildungsbeginns<br />
erwiesen haben (Beicht 2009, Beicht/Ulrich 2008, Hofmann-<br />
Lun/Gaupp 2008).<br />
27 Allerdings erfolgte die Finanzierung der zeitweise besonders zahlreichen außerbetrieblichen Ausbildungsplatzangebote<br />
in Ostdeutschland u.a. über die Ausbildungsprogramme für sozial benachteiligte<br />
und lernbeeinträchtigte Jugendliche nach dem Sozialgesetzbuch III und somit zum Teil unter<br />
Inkaufnahme einer Stigmatisierung der Jugendlichen. Zwar gab es auch ein gemeinsam vom Bund<br />
und den Ländern finanziertes Programm für offiziell „Marktbenachteiligte“, doch reichte dieses<br />
Programm nicht aus, das betriebliche Angebotsdefizit zu kompensieren (vgl. dazu ausführlich Ulrich<br />
2003).<br />
158
Doch sind mit diesem Verbleib Stigmatisierungsgefahren und Identitätszumutungen<br />
für die Jugendlichen verbunden (z.B. „nicht ausbildungsreif“), und<br />
zudem dürfte nur relativ wenigen Jugendlichen bewusst sein, dass sie mit einem<br />
solchen Schritt just jene Institutionen „unterstützen“, die ihnen zunächst den<br />
Eintritt in eine vollqualifizierende Berufsausbildung verwehrten. Denn ihre<br />
Nachfrage nach dualer Ausbildung wird mit der Einmündung in das Übergangssystem<br />
latent, und damit tragen diese „versorgten“ Jugendlichen selbst dann zu<br />
einem rechnerischen Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei, wenn sie sich<br />
intensiv, aber erfolglos um eine Berufsausbildungsstelle bemüht <strong>hat</strong>ten.<br />
Die Funktion des Übergangssystems bestand in den letzten Jahren also auch<br />
darin, die bestehenden Institutionen des Übergangs in vollqualifizierende Berufsausbildung<br />
abzusichern und Deutungen zum Geschehen auf dem Ausbildungsstellenmarkt<br />
zu ermöglichen, welche diese Institutionen legitimieren. Solche<br />
Deutungen können allerdings nur dann der Öffentlichkeit erfolgreich vermittelt<br />
werden, wenn sie plausibel erscheinen (Solga 2005a). Individualisierende<br />
Erklärungsansätze zur Ausbildungslosigkeit von Jugendlichen haben aus mindestens<br />
drei Gründen stets eine große Chance auf Akzeptanz. Erstens knüpfen sie an<br />
dem in jeder Zeit zu beobachtenden Bedürfnis einer Gesellschaft an, über den<br />
Reifezustand der Jugend kritisch nachdenken zu wollen (Eberhard 2006, 48 ff.).<br />
Zweitens entsprechen sie der bei Außenbeobachtern grundsätzlich zu beobachtenden<br />
Neigung, personenbezogene Gründe als Ursache für die Lage Dritter<br />
stärker in Betracht zu ziehen als situationsbezogene Einflussgrößen (Ulrich<br />
2004a). Und drittens wirken sie nachvollziehbar, weil Begriffe wie „ausbildungsreife<br />
Ausbildungsplatznachfrager“ und „versorgte Ausbildungsstellenbewerber“<br />
auch für Laien verständlich erscheinen.<br />
Dabei <strong>hat</strong> sich allerdings in der bildungspolitischen Analyse des Übergangsgeschehens<br />
längst eine Fachsprache etabliert, die von Laien nicht mehr<br />
valide in die Alltagssprache umgesetzt werden kann. So bezeichnen z.B. „Ausbildungsplatznachfrager“<br />
und „Ausbildungsstellenbewerber“ zwei unterschiedliche,<br />
sich nur partiell überschneidende Gruppen, und Begriffe wie „versorgte<br />
Ausbildungsstellenbewerber“ oder „vermittelte Ausbildungsstellenbewerber“<br />
entsprechen nicht dem Verständnis der Alltagssprache (Krekel/Ulrich 2009, 35-<br />
41). Für die Legitimation der bestehenden Institutionen zum Übergang von der<br />
Schule in die Berufsausbildung stellen solche Abweichungen allerdings so lange<br />
kein Problem dar, wie die durch sie ausgelösten Assoziationen keine Zweifel an<br />
der Funktionstüchtigkeit der beruflichen Ausbildung aufkommen lassen.<br />
Tatsächlich haben die bestehenden Institutionen beim Zugang in das duale<br />
Ausbildungssystem die vergangenen schwierigen Jahre, bedingt durch die bis<br />
2005 anhaltende massive Beschäftigungskrise und eine stetig steigende Zahl von<br />
Schulabgängern, erfolgreich überlebt. Zudem nutzten Wirtschaft und Staat die<br />
159
Krisensymptome des dualen Systems erfolgreich dazu, die Ausbildungsberufe in<br />
beschleunigtem Tempo zu modernisieren und rascher an den wirtschaftsstrukturellen<br />
Wandel anzupassen (vgl. dazu Bosch 2008). Durch den 2006 einsetzenden<br />
Aufschwung, durch die 2007 einsetzende Wende in der demografischen Entwicklung<br />
(große Deters/Ulmer/Ulrich 2008) und durch den zu erwartenden<br />
Wechsel von einem Anbieter- zu einem Nachfragermarkt dürfte zudem der Widerspruch<br />
zwischen den beiden Regeln einer freiwilligen Ausbildungsbeteiligung<br />
der Betriebe und einer ausreichenden Versorgung aller ausbildungsreifen und<br />
ausbildungsinteressierten Jugendlichen in den kommenden Jahren sukzessive in<br />
Vergessenheit geraten.<br />
Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich im Zuge dessen die Deutungen<br />
und Deutungsformen in Hinblick auf das Übergangsgeschehen ändern werden.<br />
Schon jetzt ist erkennbar, dass die Jugendlichen verstärkt als unverzichtbare<br />
„Ressource“ bei der Gewinnung von Humankapital und weniger als in der Vergangenheit<br />
als „Versorgungsfall“ betrachtet werden. Die aktuell diskutierten und<br />
zum Teil bereits umgesetzten Ideen, gerade auch benachteiligte Jugendliche über<br />
eine kontinuierliche persönliche Begleitung den Einstieg in die Berufsausbildung<br />
zu ermöglichen, deuten ebenso daraufhin wie sich vielerorts etablierende regionale<br />
Übergangsmanagement-Systeme (Krekel/Ulrich 2009, 27 ff.). Da die Betriebe<br />
bei einem Wechsel von einem Anbieter- hin zu einem Nachfragermarkt<br />
verstärkt untereinander um die immer weniger werdenden Schulabsolventen<br />
konkurrieren, werden viele von ihnen versuchen, sich durch eine frühzeitige<br />
Einbindung in die Berufsorientierung der allgemeinbildenden Schulen relative<br />
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Zugleich werden sie darauf hinwirken, die<br />
Dauer bis zum Eintritt der Schulabgänger in eine vollqualifizierende Berufsausbildung<br />
„nicht unnötig zu verlängern“. Somit wird die Wirtschaft zum einen auf<br />
eine „Dualisierung“ der Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen<br />
drängen, und zum anderen wird der Druck auf das „Übergangssystem“ zunehmen,<br />
das Angebot zu „verschlanken“ und die Abwerbung von Schulabgängern<br />
auf jene Fälle der Jugendlichen zu beschränken, die tatsächlich zunächst einer<br />
spezifischen individuellen Vorbereitung bedürfen, bevor sie für eine vollqualifizierende<br />
betriebliche Berufsausbildung gewonnen werden können.<br />
Sollte es tatsächlich zu einer grundlegenden Umkehrung der Verhältnisse<br />
auf dem Ausbildungsmarkt kommen, dürften das Schulberufssystem und das<br />
Übergangssystem quantitativ an Bedeutung verlieren. Und auch der alljährlich<br />
wiederkehrende „Statistikstreit“ darüber, wer nun zu den erfolglosen Ausbildungsplatznachfragern<br />
zu zählen ist und wer nicht (Bosch 2008, 242), dürfte in<br />
Folge der veränderten Verhältnisse an Schärfe verlieren. Entsprechende Entwicklungen<br />
sind bereits jetzt in Ostdeutschland beobachtbar, wo die Auswirkun-<br />
160
gen des demografischen Einbruchs auf die berufliche Bildungsbeteiligung schon<br />
heute massiv zu spüren sind (große Deters/Ulmer/Ulrich 2008).<br />
Literatur<br />
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland. Bielefeld.<br />
Baethge, M. (2006): Staatliche Berufsbildungspolitik in einem korporatistischen System.<br />
In: Weingart, P.; Taubert, N. C. (Hrsg.): Das Wissensministerium. Ein halbes Jahrhundert<br />
Forschungs- und Bildungspolitik in Deutschland. Weilerswist. S. 435-469.<br />
Baethge, M. (2008): Das berufliche Bildungswesen in Deutschland am Beginn des 21.<br />
Jahrhunderts. In: Cortina, K. S. u.a. (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Reinbek bei Hamburg. S. 541-597.<br />
Beicht, U. (2009): Verbesserung der Ausbildungschancen oder sinnlose Warteschleife?<br />
Zur Bedeutung und Wirksamkeit von Bildungsgängen am Übergang Schule Berufsausbildung.<br />
In: BIBB REPORT, 11/2009.<br />
Beicht, U.; Friedrich, M.; Ulrich, J. G. (Hrsg.) (2008): Ausbildungschancen und Verbleib<br />
von Schulabsolventen. Bielefeld.<br />
Beicht, U.; Ulrich, J. G. (2008): Ergebnisse der BIBB-Übergangsstudie. In: Beicht, U.;<br />
Friedrich, M.; Ulrich, J. G. (Hrsg.): Ausbildungschancen und Verbleib von Schulabsolventen.<br />
Bielefeld. S. 101-291.<br />
Bosch, G. (2008): Zur <strong>Zukunft</strong>sfähigkeit des deutschen Berufsbildungssystems. In: <strong>Arbeit</strong>,<br />
17 (4), S. 239-253.<br />
Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>: (2008): Bewerber und Berufsausbildungsstellen. Berichtsjahr<br />
2007/08. Nürnberg.<br />
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.) (1977): Berufsbildungsbericht<br />
1997. Bonn.<br />
Dellenbach, M.; Hupka, S.; Stalder, B. E.: (2004): Wege in die nachobligatorische Ausbildung:<br />
Der Kanton Bern im Vergleich zur restlichen Deutschschweiz. Ergebnisse<br />
des Jugendlängsschnitts TREE. Bern.<br />
Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen<br />
und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen.<br />
Diehl, C.; Friedrich, M.; Hall, A. (2009): Jugendliche ausländischer Herkunft beim Übergang<br />
in die Berufsausbildung: Vom Wollen, Können und Dürfen. In: Zeitschrift für<br />
Soziologie, 38 (1), S. 48-67.<br />
Dietrich, H. u.a. (2009): Ausbildung im dualen System und Maßnahmen der Berufsvorbereitung.<br />
In: Möller, J.; Walwei, U. (Hrsg.): Handbuch <strong>Arbeit</strong>smarkt 2009. Bielefeld.<br />
S. 317-357.<br />
Eberhard, V.: (2006): Das Konzept der Ausbildungsreife – ein ungeklärtes Konstrukt im<br />
Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen (Wissenschaftliche Diskussionspapiere,<br />
83). Bonn.<br />
Eberhard, V.; Krewerth, A.; Ulrich, J. G. (2005): „Man muss geradezu perfekt sein, um<br />
eine Lehrstelle zu bekommen“. Die Situation aus Sicht der Lehrstellenbewerber. In:<br />
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 34 (3), S. 10-13.<br />
161
Eberhard, V.; Krewerth, A.; Ulrich, J. G. (Hrsg.) (2006): Mangelware Lehrstelle. Zur<br />
aktuellen Lage der Ausbildungsplatzbewerber in Deutschland. Bielefeld.<br />
Eberhard, V.; Ulrich, J. G.: (2009): „Ausbildungsreif“ und dennoch ein Fall für das Übergangssystem?<br />
Determinanten der Einmündung von Ausbildungsstellenbewerbern in<br />
teilqualifizierende Bildungsgänge (Vortrag auf der BIBB-Fachtagung „Neue Jugend<br />
– neue Ausbildung“ am 28./29. Oktober 2009 in Bonn). Bonn.<br />
Ebner, C. (2009): Neue Wege für die duale Berufsausbildung – ein Blick auf Österreich,<br />
die Schweiz und Dänemark. In: WZBrief <strong>Arbeit</strong>, 04 (November 2009).<br />
Esser, H.: (2000): Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 5: Institutionen. Frankfurt/NY.<br />
Fobe, K.; Minx, B.: (1996): Berufswahlprozesse im persönlichen Lebenszusammenhang.<br />
Nürnberg.<br />
Gangl, M. (2003): Bildung und Übergangsrisiken beim Einstieg in den Beruf. Ein europäischer<br />
Vergleich zum <strong>Arbeit</strong>smarktwert von Bildungsabschlüssen. In: Zeitschrift für<br />
Erziehungswissenschaft, 6 (1), S. 72-89.<br />
Gildemeister, R.; Robert, G. (1987): Probleme beruflicher Identität in professionalisierten<br />
Berufen. In: Frey, H.-P.; Haußer, K. (Hrsg.): Identität. Stuttgart. S. 71-87.<br />
große Deters, F.; Ulmer, P.; Ulrich, J. G. (2008): Entwicklung des Nachfragepotenzials<br />
nach dualer Berufsausbildung. In: Ulmer, P.; Ulrich, J. G. (Hrsg.): Der demografische<br />
Wandel und seine Folgen für die Sicherstellung des Fachkräftenachwuchses.<br />
Bonn. S. 9-28.<br />
Heinz, W. R. u.a.: (1987): „Hauptsache eine Lehrstelle“. Jugendliche vor den Hürden des<br />
<strong>Arbeit</strong>smarktes. Weinheim.<br />
Hellmund, U.; Klitzsch, W.; Schumann, K. (1992): Grundlagen der Statistik. Landsberg /<br />
Lech<br />
Hofmann-Lun, I.; Gaupp, N. (2008): Geplanter Zwischenschritt oder Warteschleife?<br />
Zugänge in und Anschlüsse an Berufsvorbereitung. In: Reißig, B.; Gaupp, N.; Lex,<br />
T. (Hrsg.): Hauptschüler auf dem Weg von der Schule in die <strong>Arbeit</strong>swelt. München.<br />
S. 82-98.<br />
Hupka-Brunner, S. u.a.: (2009): PISA-Kompetenzen und Übergangswege: Ergebnisse aus<br />
der TREE-Studie (Vortrag auf der BIBB-Fachtagung „Neue Jugend – neue Ausbildung“<br />
am 28./29. Oktober 2009 in Bonn). Bonn.<br />
Hupka, S.; Sacchi, S.; Stalder, B. E.: (2006): Herkunft oder Leistung? Analyse des Eintritts<br />
in eine zertifizierende nachobligatorische Ausbildung anhand der Daten des<br />
Jugendlängsschnitts TREE. <strong>Arbeit</strong>spapier vom Juni 2006. Bern.<br />
Imdorf, C. (2007a): Der Ausschluss „ausländischer“ Jugendlicher bei der Lehrlingsauswahl<br />
– ein Fall von institutioneller Diskriminierung? In: Rehberg, K.-S. (Hrsg.): Die<br />
Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft<br />
für Soziologie in Kassel 2006. Frankfurt/Main. S. 2.048-2.058.<br />
Imdorf, C. (2007b): Individuelle oder organisationale Ressourcen als Determinanten des<br />
Bildungserfolgs? Organisatorischer Problemlösungsbedarf als Motor sozialer Ungleichheit.<br />
In: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 32 (3), S. 407-423.<br />
Imdorf, C.: (2009): Mit 16 noch zu jung und mit 19 bereits zu alt für eine Berufslehre?<br />
Können allein genügt nicht – Auswahlkriterien bei der Lehrlingsselektion (Vortrag<br />
auf der BIBB-Fachtagung „Neue Jugend – neue Ausbildung“ am 28./29. Oktober<br />
2009 in Bonn). Bonn.<br />
162
Imdorf, C.; Seibert, H.; Hupka, S. (2009): Wie Ausbildungssysteme Chancen verteilen.<br />
Berufsbildungschancen und ethnische Herkunft in Deutschland und der Schweiz unter<br />
Berücksichtigung des regionalen Verhältnisses von betrieblichen und schulischen<br />
Ausbildungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 61 (4).<br />
Kalter, F. (2006): Auf der Suche nach einer Erklärung für die spezifischen <strong>Arbeit</strong>smarktnachteile<br />
von Jugendlichen türkischer Herkunft. Zugleich eine Replik auf den Beitrag<br />
von Holger Seibert und Heike Solga: Gleiche Chancen dank einer abgeschlossenen<br />
Ausbildung? (ZfS 5/2005). In: Zeitschrift für Soziologie, 35 (2), S. 144-160.<br />
Kath, F. (1999): Finanzierung der Berufsausbildung im dualen System. Probleme und<br />
Lösungsvorschläge. In: Bildung, Vorstand der <strong>Arbeit</strong>sgemeinschaft Hochschultage<br />
Berufliche Bildung (Hrsg.): Hochschultage Berufliche Bildung 1998. Workshop<br />
Kosten, Finanzierung und Nutzen beruflicher Bildung. Neusäß. S. 99-110.<br />
Kath, F. (2005): Ordnung muss sein – aber wie soll sie gestaltet werden? In: Bundesinstitut<br />
für Berufsbildung (Hrsg.): Wir brauchen hier jeden, hoffnungslose Fälle können<br />
wir uns nicht erlauben! Wege zur Sicherung der beruflichen <strong>Zukunft</strong> in Deutschland.<br />
Bielefeld. S. 228-239.<br />
Klein, H. E. (2007): Betriebliche Einstellungstests prüfen schulische Grundbildung. In:<br />
Wirtschaft und Berufserziehung, 59 (11), S. 20-25.<br />
Klemm, K. (2008): Bildungsausgaben: Woher sie kommen, wohin sie fließen. In: Cortina,<br />
K. S. u.a. (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Reinbek<br />
bei Hamburg. S. 245-280.<br />
Konietzka, D. (2007): Berufliche Ausbildung und Übergang in den <strong>Arbeit</strong>smarkt. In:<br />
Becker, R.; Lauterbach, W. (Hrsg.): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde<br />
zu den Ursachen der Bildungsungleichheit. Wiesbaden. S. 273-302.<br />
Krekel, E. M.; Ulrich, J. G.: (2009): Jugendliche ohne Berufsabschluss. Handlungsempfehlungen<br />
für die berufliche Bildung. Berlin.<br />
Kruip, G. (2003a): Bildungsgutscheine – ein Weg zur Lösung des Gerechtigkeits- und<br />
Steuerungsproblems des Bildungssystems. In: Heimbach-Steins, M.; Kruip, G.<br />
(Hrsg.): Bildung und Beteiligungsgerechtigkeit. Sozialethische Sondierungen. Bielefeld.<br />
S. 109-129.<br />
Kruip, G. (2003b): Lebenslanges Lernen unter der Perspektive von Beteiligungsgerechtigkeit<br />
– Einführung. In: Heimbach-Steins, M.; Kruip, G. (Hrsg.): Bildung und Beteiligungsgerechtigkeit.<br />
Sozialethische Sondierungen. Bielefeld. S. 249-253.<br />
Küppers, B.; Leuthold, D.; Pütz, H.: (2001): Handbuch Berufliche Ausbildung. Leitfaden<br />
für Betriebe, Schulen, Ausbildungsstätten und Hochschulen. München.<br />
Lakies, T.; Nehls, H.: (2007): Berufsbildungsgesetz. Basiskommentar. Frankfurt/Main.<br />
Lehn, B. vom (2009): Das Leid mit den Zahlen. In: Welt am Sonntag, Nr. 41, 11.10.2009.<br />
Lehner, F.; Neumann, S.; Rolff, K.: (2009): Nachwuchsprobleme im Handwerk: eine<br />
Studie im nördlichen Ruhrgebiet (Forschung Aktuell, Nr. 01/2009). Gelsenkirchen.<br />
Lepsius, M. R. (1995): Institutionenanalyse und Institutionenpolitik. In: Kölner Zeitschrift<br />
für Soziologie und Sozialpsychologie, 47 (Sonderheft 35), S. 392-403.<br />
Meyer, J. W.; Rowan, B. (2009): Institutionalisierte Organisationen. Formale Struktur als<br />
Mythos und Zeremonie. In: Koch, S.; Schemmann, M. (Hrsg.): Neo-Institutionalismus<br />
in der Erziehungswissenschaft. Grundlegende Texte und empirische Studien.<br />
Wiesbaden. S. 28-56.<br />
163
Müller, W.; Shavit, Y. (1998): Bildung und Beruf im institutionellen Kontext. Eine vergleichende<br />
Studie in 13 Ländern. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, 1 (4),<br />
S. 501-533.<br />
Münk, D.; Rützel, J.; Schmidt, C. (Hrsg.) (2008): Labyrinth Übergangssystem. Bonn.<br />
Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland: (2006): Kriterienkatalog<br />
zur Ausbildungsreife. Nürnberg.<br />
Solga, H. (2005a): Meritokratie – die moderne Legitimation ungleicher Bildungschancen.<br />
In: Berger, P. A.; Kahlert, H. (Hrsg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das<br />
Bildungssystem Chancen blockiert. Weinheim und München. S. 19-38.<br />
Solga, H.: (2005b): Ohne Abschluss in die Bildungsgesellschaft. Die Erwerbschancen<br />
gering qualifizierter Personen aus soziologischer und ökonomischer Perspektive.<br />
Opladen.<br />
Straßer, P.; Ratschinski, G.: (2008): Wissenschaftliche Begleitung des Niedersächsischen<br />
Schulversuchs „Berufseinstiegsklasse“ (BEK). Zweiter Jahresbericht. Hannover.<br />
Ulrich, J. G. (2003): Benachteiligung – was ist das? Theoretische Überlegungen zu Stigmatisierung,<br />
Marginalisierung und Selektion. In: Lappe, L. (Hrsg.): Fehlstart in den<br />
Beruf? Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Einstieg ins <strong>Arbeit</strong>sleben. München.<br />
S. 21-35.<br />
Ulrich, J. G. (2004a): Bewerbungs- und Nachfrageverhalten von Jugendlichen. Anmerkungen<br />
aus attributionstheoretischer Sicht. In: Krekel, E. M.; Walden, G. (Hrsg.):<br />
<strong>Zukunft</strong> der Berufsausbildung in Deutschland: Empirische Untersuchungen und<br />
Schlussfolgerungen. Bielefeld. S. 155-198.<br />
Ulrich, J. G. (2004b): Wer ist schuld an der Ausbildungsmisere? Diskussion der Lehrstellenprobleme<br />
aus attributionstheoretischer Sicht. In: Berufsbildung in Wissenschaft<br />
und Praxis, 33 (3), S. 15-19.<br />
Ulrich, J. G. (2006): Wie groß ist die Lehrstellenlücke wirklich? Vorschlag für einen<br />
alternativen Berechnungsmodus. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 35<br />
(3), S. 12-16.<br />
Ulrich, J. G. (2008): Jugendliche im Übergangssystem – eine Bestandsaufnahme. In:<br />
bwp@, Spezial 4 – HT2008, WS 12.<br />
Ulrich, J. G.; Eberhard, V. (2008): Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes seit der<br />
Wiedervereinigung. In: Beicht, U.; Friedrich, M.; Ulrich, J. G. (Hrsg.): Ausbildungschancen<br />
und Verbleib von Schulabsolventen. Bielefeld. S. 13-57.<br />
Ulrich, J. G.; Ehrenthal, B.; Häfner, E. (2006): Regionale Mobilitätsbereitschaft und<br />
Mobilität der Ausbildungsstellenbewerber. In: Eberhard, V.; Krewerth, A.; Ulrich, J.<br />
G. (Hrsg.): Mangelware Lehrstelle. Zur aktuellen Lage der Ausbildungsplatzbewerber<br />
in Deutschland. Bielefeld. S. 99-120.<br />
Ulrich, J. G.; Flemming, S.; Granath, R.-O. (2009): Ausbildungsmarktbilanz 2008. In:<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht<br />
2009. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Bielefeld.<br />
S. 11-33.<br />
Weil, M.; Lauterbach, W. (2009): Von der Schule in den Beruf. In: Becker, R. (Hrsg.):<br />
Lehrbuch der Bildungssoziologie. Wiesbaden. S. 321-356.<br />
164
10.01.2013 ‐ Aktuelle Problemfelder der Berufsbildung in Deutschland
Aktuelle Problemfelder der Berufsbildung in<br />
Deutschland<br />
Sirikit Krone<br />
Das Berufsbildungssystem in Deutschland befindet sich in einem umfassenden<br />
Wandel; neue Entwicklungen und Anforderungen kennzeichnen die aktuelle<br />
Lage. Die zentralen Problemfelder der beruflichen Bildung sollen in diesem<br />
Beitrag dargelegt werden.<br />
1 Mangelnde Versorgung mit Ausbildungsplätzen<br />
Allen voran und in der tagespolitischen Debatte immer wieder thematisiert ist<br />
das seit Jahren bestehende Defizit an Ausbildungsplätzen zur Versorgung aller<br />
Jugendlichen, die eine Ausbildung im dualen System anstreben. Auch wenn sich<br />
die Lage im Jahr 2008 etwas entspannt <strong>hat</strong>, bleibt eine Unterversorgung bestehen.<br />
Zudem ist davon auszugehen, dass diese Erholung lediglich temporär ist<br />
und die aktuelle Wirtschaftskrise sich ähnlich negativ wie im Beschäftigungssystem<br />
insgesamt, zeitverzögert ebenfalls auf den Ausbildungsmarkt auswirken<br />
wird und mit einem Rückgang des Ausbildungsplatzangebots ab 2009 zu rechnen<br />
ist (vgl. BMBF 2009; Seibert/Kleinert 2009).<br />
Im Ausbildungsjahr 2008 wurden bis zum 30. September bundesweit<br />
616.259 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen (vgl. diese und die folgenden<br />
Zahlen aus: BMBF 2009). Dies bedeutet zwar im Vergleich zum Vorjahr einen<br />
Rückgang von 1,5 %, allerdings setzt sich damit trotzdem der seit 2006 anhaltende<br />
positive Trend bei der Versorgung der ausbildungsinteressierten Jugendlichen<br />
fort. Grund dafür ist der im vergangenen Jahr erstmals deutliche Rückgang<br />
der Anzahl junger Menschen, die einen Ausbildungsplatz nachfragten. Demografie<br />
bedingt ist die Gruppe der Schulabgängerinnen/Schulabgänger kleiner geworden<br />
und damit der rein rechnerische Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage<br />
zum ersten Mal seit Jahren hergestellt (vgl. Abb. 1).<br />
19
Abbildung 1: Gemeldete Bewerberinnen/Bewerber und neu abgeschlossene<br />
Ausbildungsverträge<br />
Quelle: BIBB 2009<br />
Trotz dieses positiven Trends kann noch lange keine Entwarnung am Ausbildungsmarkt<br />
gegeben werden. Zunächst geben die Daten insofern ein verzerrtes<br />
Bild der Realität wieder, als bei den Ausbildungsplatznachfragern nur diejenigen<br />
gezählt werden, die sich bei der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> suchend gemeldet<br />
haben und von dieser auch als ausbildungsreif eingestuft wurden. Insofern ist<br />
davon auszugehen, dass die Gruppe der Jugendlichen, die eine Ausbildung im<br />
dualen System beginnen möchten, deutlich größer ist. Nicht alle Schulabgängerinnen/Schulabgänger<br />
versuchen den Einstieg in die Ausbildung mit Einschaltung<br />
der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>. Hinzu kommen die Jugendlichen, die zunächst<br />
in Maßnahmen eingegliedert werden, um eine mangelhaft erscheinende<br />
Ausbildungsreife nachträglich herzustellen. Rechnet man diese Jugendlichen,<br />
deren Einstieg in eine Ausbildung gescheitert ist, die jedoch ihren Wunsch aufrechterhalten,<br />
obwohl sie zunächst in die angebotene Maßnahme der Bundesagentur<br />
für <strong>Arbeit</strong> einsteigen, so zeigt sich ein Ausbildungsplatzdefizit zwischen<br />
20
2005 und 2007 von konstant etwa 13 % (Autorengruppe Bildungsberichterstattung<br />
2008; 101) Vergleicht man die beruflichen Pläne der Schulabgängerinnen/Schulabgänger<br />
im Frühling eines Jahres mit den im Herbst desselben Jahres<br />
realisierten Bildungs- und Berufswegen, so wird auch hier der signifikante Mangel<br />
an Ausbildungsplätzen im dualen Ausbildungssystem deutlich.<br />
Abbildung 2: Geplante versus realisierte Ausbildungen im dualen System<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: BIBB 2009<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Betrachten wir das Jahr 2008, in welchem der Ausbildungsmarkt als rechnerisch<br />
ausgeglichen galt, zeigt sich, dass mit 56 % mehr als die Hälfte der Schulabgängerinnen/Schulabgänger<br />
im Frühjahr eine betriebliche Ausbildung im dualen<br />
System favorisierte. Realisieren konnten diese Pläne lediglich 30 % aller Schulabgängerinnen/Schulabgänger,<br />
d.h. nur gut die Hälfte derjenigen, deren Ziel es<br />
ursprünglich war. Die anderen sind gezwungen, (zunächst) in Alternativen, wie<br />
z.B. Maßnahmen der beruflichen Grundbildung, auszuweichen. Befragungsergebnisse<br />
unter Vollzeitschülerinnen/Vollzeitschülern an Berufskollegs zeigen,<br />
dass insbesondere Teilnehmerinnen/Teilnehmer der ein- und zweijährigen Ausbildungen<br />
an Berufsfachschulen sowie des Berufsgrundschuljahres vor ihrem<br />
Bildungsgangbeginn erfolglos auf Ausbildungsplatzsuche waren. (Harney/ Hartkopf<br />
2008; 16 f.)<br />
21
Die (ausreichende) Versorgung mit Ausbildungsplätzen ist regional höchst<br />
ungleich verteilt. Ein ausgeglichenes Nachfrage-Angebots-Verhältnis ist am<br />
ehesten in großstädtischen Zentren Westdeutschlands mit günstiger <strong>Arbeit</strong>smarktlage<br />
und hoher Dynamik anzutreffen. Am anderen Ende der Skala finden<br />
sich ebenfalls großstädtisch geprägte Regionen in Westdeutschland, allerdings<br />
solche mit einer hohen <strong>Arbeit</strong>slosigkeit, sowie alle Regionen Ostdeutschlands.<br />
Gerade in den neuen Ländern ist die Situation für die Jugendlichen eher kritisch,<br />
was zu vielen Abwanderungen insbesondere der jungen Menschen mit einem<br />
qualifizierten Schulabschluss führt.<br />
Profitieren von der oben skizzierten positiven Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes<br />
können insbesondere Mädchen, die verstärkt im prosperierenden<br />
tertiären Sektor suchen, Jugendliche ohne Migrationshintergrund sowie<br />
solche mit einem qualifizierten Schulabschluss. Daraus folgt umgekehrt, dass<br />
hier der größte Handlungsbedarf liegt: Die Anzahl derjenigen Jugendlichen,<br />
welche die Schule ohne Abschluss verlassen, muss dringend gesenkt werden, um<br />
ihnen eine realistische Chance am Ausbildungsmarkt zu eröffnen. Der Übergang<br />
in ein Ausbildungsverhältnis gelingt immerhin 30 % derjenigen, die mindestens<br />
einen Hauptschulabschluss haben, mit einem mittleren bzw. höheren Abschluss<br />
liegt die Übergangsquote bei 50 % (BIBB 2009, 91). Inwiefern der Demografie<br />
bedingte zukünftige Mangel an Fachkräften sich zugunsten der benachteiligten<br />
Gruppen bei der Ausbildungsplatzsuche auswirken wird, ist offen und von einer<br />
Reihe an Faktoren abhängig, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird.<br />
Das jahrelange Missverhältnis von Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt<br />
zu Ungunsten der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen <strong>hat</strong> dazu<br />
geführt, dass die Zahl der so genannten Altbewerberinnen/Altbewerber kontinuierlich<br />
angewachsen ist. Im Jahr 2008 stellte diese Gruppe bereits 52,4 % aller<br />
registrierten Bewerberinnen/Bewerber (BMBF 2009, 19). Diese jungen Menschen<br />
werden zunächst in alternativen Ausbildungs- und Qualifizierungswegen<br />
versorgt, halten jedoch an ihrem eigentlichen Wunsch einer betrieblichen Ausbildung<br />
fest und bewerben sich immer wieder.<br />
Damit reicht es nicht, die Zahl der Schulabgängerinnen/Schulabgänger zu<br />
errechnen, wenn es darum geht, den zukünftigen Bedarf an Ausbildungsplätzen<br />
zu prognostizieren. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass es noch<br />
einige Jahre dauern wird, bis die „Bugwelle“ der Altbewerberinnen/Altbewerber<br />
abgearbeitet sein wird. Hierzu bedarf es, neben den Maßnahmen, die staatlicherseits<br />
ergriffen wurden 1 , auch einer deutlichen Zunahme der zur Verfügung gestellten<br />
Ausbildungsplätze.<br />
1<br />
Vgl. z.B. die Einführung des Ausbildungsbonus zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für<br />
Altbewerberinnen und Altbewerber.<br />
22
Inwieweit die Unternehmen angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise diesem<br />
Bedarf gerecht werden, ist schwierig zu prognostizieren. Schätzungen des<br />
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) gingen für das Ausbildungsjahr<br />
2009/10 davon aus, dass das Angebot an Ausbildungsstellen zwischen 580.000<br />
und 600.000 liegen würde. Diese Prognosen haben sich jedoch nicht bestätigt:<br />
Bis August 2009 wurden 436.200 Ausbildungsplätze gemeldet, das sind 6,5 %<br />
weniger als im Vorjahr. Von den bis zum gleichen Zeitpunkt ca. 515.000 Bewerberinnen/Bewerbern<br />
waren noch knapp 100.000 nicht versorgt. Sicher ist das<br />
Ausbildungsverhalten der Betriebe auch davon abhängig, inwieweit sich der<br />
Fachkräftemangel für die Unternehmen bereits abzeichnet und entscheidungsrelevant<br />
wird. Dieser Zusammenhang wird weiter unten noch ausgeführt.<br />
2 Das Übergangssystem<br />
Wie bereits oben angesprochen, stellt bei den Bewerberinnen/Bewerbern um<br />
einen Ausbildungsplatz die Gruppe der so genannten Altbewerberinnen/Altbewerber<br />
bereits gut die Hälfte. Es gelingt vielen der Übergang in ein Ausbildungsverhältnis<br />
nicht beim ersten Anlauf und so tauchen sie mindestens ein<br />
zweites Mal, oft sogar mehrere Jahre hintereinander wieder in der Gruppe derjenigen<br />
auf, die zum neuen Ausbildungsjahr einen Ausbildungsplatz nachfragen.<br />
Da es der erklärte politische Wille ist, allen Jugendlichen trotzdem ein Angebot<br />
zu machen und sie zunächst anderweitig zu versorgen, <strong>hat</strong> sich in den vergangenen<br />
Jahren ein auf hohem quantitativen Niveau stetig wachsendes, so genanntes<br />
„Übergangssystem“ entwickelt.<br />
Was der Name zunächst vermuten lässt, nämlich dass es sich um ein System<br />
mit strukturierten Wegen für Schulabgängerinnen/Schulabgänger in den Ausbildungsmarkt<br />
handelt, ist nicht der Fall. Vielmehr sammeln sich hier eine Vielzahl<br />
an schulischen Bildungswegen und Maßnahmen, die bezüglich der Voraussetzungen,<br />
der Inhalte sowie der Abschlüsse sehr unterschiedlich angelegt sind.<br />
Gemeinsam ist ihnen eigentlich nur der Tatbestand, dass sie alle nicht zu einem<br />
anerkannten beruflichen Abschluss führen. Neben berufsfachschulischen Bildungsgängen<br />
gibt es eine Vielzahl an kompensatorischen ganztägigen berufsvorbereitenden<br />
Bildungsangeboten, und Berufsschulen erhalten damit immer mehr<br />
an der Schnittstelle des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in die<br />
Berufsbildung eine „Weichen- und Orientierungsfunktion“.<br />
Allerdings nutzt ein großer Anteil der Schülerinnen/Schüler, die das Schulberufssystem<br />
als Übergang besuchen, das für sie häufig intransparente Bildungsangebot<br />
dort nicht für eine gezielte Berufs- und Karriereplanung. Im Vordergrund<br />
stehen vielmehr die allgemeinen Erwartungen der Jugendlichen und ihrer<br />
23
Familien, durch denn<br />
Besuch der unterschiedlichen Bildungsgänge grundsätzlich<br />
die eigenen Ausbilduungs-<br />
bzw. Studienchancen zu verbessern.<br />
Die Zahl der Schulabgänger,<br />
die ein schulisches Berufsvorbereitunggs-<br />
oder<br />
Berufsgrundbildungsjahr<br />
beginnen, sich zum Besuch einer teilqualifizieerenden<br />
Berufsfachschule enntschließen<br />
oder in berufsvorbereitende Maßnahmeen<br />
bzw.<br />
eine Einstiegsqualifi fizierung einmünden, <strong>hat</strong> sich in den vergangenen 155<br />
Jahren<br />
etwa verdoppelt.<br />
Abbildung 3: Eintrritte<br />
in Bildungsgänge/Maßnahmen<br />
Quelle: BIBB 2009<br />
Die Zahl der Eintrittte<br />
in Bildungsgänge, die eine berufliche Grundbilduung<br />
ver-<br />
mitteln, ist in besoonderem<br />
Maße gestiegen. So ist die Zahl der Schhülerin<br />
nen/Schüler im Beruufsvorbereitungsjahr<br />
von 1992 bis zum Jahr 2007 um nahezu<br />
70 % gestiegen. Diee<br />
Zahl der Schülerinnen/Schüler im Berufsgrundschulljahr<br />
ist<br />
im gleichen Zeitrauum<br />
um knapp 47 % angestiegen. Die Zahl der Schhülerin-<br />
nen/Schüler im ersteen<br />
Schuljahr in Bildungsgängen, die eine berufliche Grund-<br />
bildung vermitteln, h<strong>hat</strong><br />
sich zwischen 1992 und 2007 sogar um über 70 % erhöht.<br />
Ziel dieser Bildungsgänge<br />
sowie auch der Einstiegsqualifizierung, welcche<br />
seit<br />
2004 angeboten wirrd,<br />
ist die Verbesserung der individuellen Kompetenzen<br />
der<br />
Jugendlichen, um ihhre<br />
Chancen zu erweitern, eine berufliche Ausbildunng<br />
oder<br />
eine Berufstätigkeitt<br />
aufzunehmen. Hierzu zählen Elemente der Allgemmeinbil-<br />
24
dung, wie z.B. nach Nachholen von Schulabschlüssen, Maßnahmen zur Berufsvorbereitung<br />
und beruflichen Orientierung sowie allgemein zur Steigerung der<br />
Motivation.<br />
Die Vielfalt der angebotenen Maßnahmen sowie der Träger und Bildungseinrichtungen,<br />
welche diese anbieten, ist jedoch durchaus kritisch zu beurteilen.<br />
Gerade für markt- und bildungsbenachteiligte Jugendliche als zentrale Zielgruppe<br />
schafft diese Vielfalt häufig eher Verwirrung denn Orientierung. Zudem fehlen<br />
strukturierte Wege aus dem Übergangssystem wieder hinaus, was aus dem<br />
zunächst angedachten Übergang für viele Betroffene zu langen Warteschleifen<br />
führt.<br />
Daraus resultieren nicht nur Nachteile und Risiken für die individuellen Lebensläufe<br />
der Betroffenen, sondern auch hohe gesellschaftliche Kosten (vgl.<br />
Bertelsmann Stiftung 2009). Menschen ohne schulische bzw. berufliche Abschlüsse<br />
sind häufiger von <strong>Arbeit</strong>slosigkeit bedroht und erhalten demnach häufiger<br />
staatliche Transferleistungen. Spätere Interventionen in Form von Nachqualifizierungen<br />
und öffentlich geförderten Programmen, sofern sie überhaupt wahrgenommen<br />
werden, sind in der Regel teuer und relativ wirkungsarm.<br />
Das Übergangssystem ist deshalb in den vergangenen Jahren verstärkt in die<br />
Kritik geraten 2 , wobei nicht die eigentliche Existenz eines solchen Systems kritisch<br />
zu beurteilen ist, wenn es dazu dient, wirklich Übergänge zu schaffen. Das<br />
Gegenteil ist jedoch häufig der Fall, da dieses System mit der Aufnahme eines<br />
großen Teils gering qualifizierter Schulabgänger auf Dauer überfordert ist. Tatsächlich<br />
höhere Übergangsraten in eine qualifizierende Berufsausbildung, wie<br />
z.B. bei der 2004 eingeführten Einstiegsqualifizierung 3 , gehen darüber hinaus zu<br />
Lasten der neuen Schulabgänger, da das Ausbildungsangebot bereits seit Jahren<br />
unter der Nachfrage der Jugendlichen liegt und damit Teile des neuen Schulabgängerjahrgangs<br />
wiederum in das Übergangssystem abgedrängt werden.<br />
Mangelnde Transparenz und Übersichtlichkeit der Maßnahmen im Übergangssystem<br />
behindern zudem eine entsprechende Beurteilung der Lernprozesse,<br />
die in ihnen ablaufen. Insofern bleiben lediglich outputorientierte Kennzahlen<br />
zur Bewertung und eine kritische inhaltliche Analyse, die zu einer höheren Effektivität<br />
im arbeitsmarktpolitischen Interesse sowie dem der Teilnehmerinnen/Teilnehmer<br />
führen könnte, ist so kaum möglich. Diese Kennzahlen des Outputs<br />
lassen jedoch einen positiven Effekt der Maßnahmen des Übergangssystems<br />
vermuten. Befinden sich im dritten Monat nach Schulende 24 % im Übergangssystem<br />
und demgegenüber 51 % in einer voll qualifizierenden Berufsausbildung<br />
2 Vgl. z.B. Euler/Severing 2006; Baethge, M. et al. 2007<br />
3 In 2004, dem Jahr der Einführung von Einstiegsqualifizierungen, wurden 7.200 Jugendliche gefördert.<br />
Nach einem vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2006 mit 18.924 Förderfällen, lag der aktuelle Wert<br />
in 2009 bei 16.300 (vgl. www.arbeitsagentur.de).<br />
25
(einschließlich Studium), so ist die Gruppe derjenigen in Berufsausbildung nach<br />
einem Jahr auf 69 % und nach zwei Jahren auf 73 % angestiegen. Der Anteil<br />
derjenigen, die im Übergangssystem verbleiben, sinkt im gleichen Zeitraum auf<br />
13 % bzw. 7 % (vgl. Beicht et al. 2008, 136 ff.)<br />
Abbildung 4: Verteilung der Jugendlichen nach Beendigung der<br />
allgemeinbildenden Schule (ausgewählte Bereiche)<br />
Quelle: Beicht et al. 2008: 136 ff.<br />
Diese Vermutung wird bestätigt durch Aussagen der Jugendlichen, die an Maßnahmen<br />
teilgenommen haben: Laut der in 2008 veröffentlichten BIBB-<br />
Übergangsstudie gab die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen<br />
eine positive Bewertung der Übergangsmaßnahmen bezüglich des fachlichen<br />
Nutzens, der Freude an der Teilnahme sowie des Nutzens für die persönliche<br />
Entwicklung und des weiteren beruflichen Werdegangs (vgl. Beicht et al. 2008,<br />
283). Vergleicht man den Erfolg anhand der Output-Kriterien zum weiteren<br />
Verbleib der Jugendlichen, so zeigt sich, dass etwa der Hälfte der Absolventen<br />
des Übergangssystems der Einstieg in eine betriebliche oder sonstige Berufsausbildung<br />
(inklusive Studium) gelingt, dies bereits innerhalb von drei Monaten<br />
nach Beendigung der Maßnahme. Im weiteren Verlauf steigt dieser Anteil nur<br />
minimal, das heißt,. dass der Übergang möglichst reibungslos und ohne großen<br />
26
Zeitverlust realisiert werden muss, da die Chancen kontinuierlich sinken. (vgl.<br />
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008, 167).<br />
Um das Übergangssystem insgesamt effektiver zu gestalten, den Verbleib<br />
möglichst kurz und den Übergang in eine Berufsausbildung für alle Jugendlichen,<br />
die dies anstreben, zu realisieren, sind neben den oben bereits angesprochenen<br />
quantitativen Problemen (zu wenig Ausbildungsplätze) auch eine Reihe<br />
struktureller Probleme zu lösen. Die Vielfalt der Träger sowie die daraus resultierende<br />
Vielfalt der Inhalte sind zu reduzieren und auf die Ausbildungsinhalte<br />
der betrieblichen bzw. vollzeitschulischen Ausbildung zu beziehen.<br />
Die damit hergestellte Transparenz schafft zum einen die nötige Orientierung<br />
für die Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Maßnahmen zur sinnvollen Planung<br />
ihrer beruflichen <strong>Zukunft</strong>. Zum anderen ermöglicht die Systematisierung<br />
des Angebots eine effektivere Gestaltung der Übergänge zwischen Maßnahmen<br />
und Ausbildung, um die vielfach geforderten Brücken zwischen den Systemen<br />
wirklich zu bauen. Zentral sind die effiziente Gestaltung der Schnittstellen sowie<br />
die Vermeidung von Warteschleifen und Verdoppelungen von Zwischenschritten<br />
auf dem Weg in das berufliche Ausbildungssystem. Inwieweit hierbei die Zertifizierung<br />
von Teilqualifikationen, ihre Anrechenbarkeit auf eine voll qualifizierende<br />
Ausbildung zielführend wäre, ist bisher empirisch nicht hinreichend geklärt.<br />
3 Fachkräftemangel<br />
Im scheinbaren Widerspruch zum oben dargelegten Mangel an Ausbildungsplätzen<br />
für junge Menschen und damit verbunden einer Vielzahl an Ausweichstrategien<br />
im Übergangssystem steht ein in Deutschland zunehmender Fachkräftemangel<br />
in einer Reihe von Branchen. Dieser drohende oder bereits manifeste<br />
Mangel an qualifiziertem Personal zeichnet sich bereits seit mehreren Jahren ab.<br />
Damit ist die Frage nach dem gesamtgesellschaftlichen sowie branchenspezifischen<br />
Fachkräftemangel immer mehr in den Fokus der aktuellen wirtschafts- und<br />
arbeitsmarktpolitischen Debatte Deutschlands gerückt. In Verbindung mit der<br />
hier relevanten Thematik der Entwicklung des Berufsbildungssystems ist von<br />
besonderem Interesse, in welchem Zusammenhang der Ausbildungsmarkt und<br />
das Fachkräftepotenzial stehen und inwiefern der Ausbau des Ausbildungssystems<br />
dazu beitragen kann, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken bzw. diesem<br />
im Vorfeld bereits zu begegnen.<br />
Eine wesentliche Ursache des Fachkräftemangels liegt sicherlich im demografischen<br />
Wandel. So ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten<br />
im Jahr 2009 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 213.000<br />
27
im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong>, 2010). Um das<br />
aktuelle Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Gesamtbevölkerung auch im<br />
Jahre 2050 zu halten, müsste eine Erwerbstätigenquote von 90 % erreicht werden,<br />
was sicherlich unrealistisch ist. Insofern sind vielmehr Bedingungen herzustellen,<br />
unter denen eine deutlich höhere Wertschöpfung erzielt wird mit in <strong>Zukunft</strong><br />
besser ausgebildeten Erwerbstätigen. Mittelfristige Prognosen sagen einen<br />
Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials bis zum Jahr 2020 voraus, trotz angenommener<br />
Zuwanderung aus dem Ausland von 100.000 Erwerbspersonen jährlich,<br />
um ca. 6 % innerhalb von 15 Jahren (Fuchs/Söhnlein 2007).<br />
Der aus Mangel an Fachkräften resultierende Wertschöpfungsverlust betrug<br />
nach einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie<br />
allein im Jahr 2006 ca. 18,5 Milliarden €; nach Berechnungen der DIHK<br />
im Jahr 2007 ca. 23 Milliarden € (vgl. BMWi Pressemitteilung vom 29.04.2008).<br />
Zunehmend mangelt es an qualifizierten <strong>Arbeit</strong>skräften insbesondere in den<br />
naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, nach einer aktuellen Studie<br />
im Auftrag des Vereins Deutscher Ingenieure lag der durchschnittliche Ingenieurbedarf<br />
im Jahre 2008 bei 87.500 (vgl. Verein Deutscher Ingenieure /Institut<br />
der deutschen Wirtschaft (Hrsg.) 2009). Das Institut der deutschen Wirtschaft<br />
beziffert die so genannte MINT-Fachkräftelücke (Differenz zwischen Fachkräfteangebot<br />
und -nachfrage in den vier MINT-Berufen Ingenieure, Techniker,<br />
Naturwissenschaftler und Datenverarbeitungsfachleuten) bundesweit für das Jahr<br />
2008 auf 144.000 Personen, im Juni 2009 nach Einsetzen der Wirtschaftkrise<br />
immerhin noch auf 61.000 Personen (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft<br />
2009).<br />
Die Schwerpunkte der <strong>Arbeit</strong>skräftenachfrage sowie deren Entwicklung in<br />
den letzten Jahren zeigen die Zahlen der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> zu den bei<br />
ihnen bekannten Stellen bzw. zu den über sie gesuchten <strong>Arbeit</strong>skräften. Ein hoher<br />
Fachkräftebedarf mit zunehmender Tendenz ist insbesondere im Gesundheits-<br />
und Sozialwesen zu verzeichnen. 14 % der im August 2009 bei der Bundesagentur<br />
für <strong>Arbeit</strong> gemeldeten, ungeförderten Stellen fielen in dieses Branchensegment<br />
(TOP TEN August 2009). 4 Wie die Zahlen zeigen, droht der Fachkräftemangel<br />
nicht nur für Berufe in der IT-Branche oder in den neuen Medien.<br />
Dies gilt vielmehr für Berufsbilder in einer Vielzahl an Branchen. Die Mehrzahl<br />
der Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische sind nicht entsprechend<br />
darauf vorbereitet. Eine eher kurzfristige Personalplanung schiebt diese<br />
Problematik zunächst auf bzw. produziert sie teilweise selbst. So zeigt sich in<br />
einer Reihe von industriellen Berufen ein deutlicher Zusammenhang zwischen<br />
4 http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/interim/arbeitsmarktberichte/<br />
berichtebroschueren/stellenangebot/index.shtml<br />
28
einem reduzierten Angebot an Ausbildungsplätzen und einer steigenden Nachfrage<br />
an gut qualifiziertem Fachpersonal (vgl. Baethge u.a. 2007). Verbunden<br />
mit dem demografisch bedingten Rückgang des Angebots an ausgebildeten<br />
Fachkräften produzieren die Betriebe so ihren Fachkräftemangel auch selbst.<br />
Abbildung 5: Entwicklung von bei der BA gemeldeten Stellen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: Statistik der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> 2009<br />
Allerdings ist die Problematik des drohenden Mangels an qualifiziertem Nachwuchs<br />
in vielen Betrieben durchaus präsent: So bezeichneten in einer Befragung<br />
von KMU im Jahre 2007 die Mehrzahl mit 79 % den Stellenwert des Fachkräftemangels<br />
im Bereich der KMU als ‚wichtig‘ bzw. sogar ‚sehr wichtig‘ (vgl. Huf<br />
2008). In mehreren Bereichen wurden Probleme bei Neueinstellungen benannt,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Werbe-, Dienstleistungskaufleute<br />
Verkäufer, Warenkaufleute<br />
Elektriker<br />
Kellner, Gastwirte<br />
Bürofachkräfte<br />
Krankenschwestern, Sprechstundenhilfen, Masseure<br />
Altenpfleger, Sozialarbeiter, Erzieherinnen<br />
<br />
29
insbesondere in der Fertigung und Produktion (36 %) sowie in Forschung und<br />
Entwicklung (24 %). In derselben Befragung antworteten die Unternehmensvertreter<br />
auf die Frage nach Nichteinstellung von Bewerbern, dass diese nicht über<br />
ausreichende inhaltliche Kompetenzen verfügen (73 %) bzw. die formalen Anforderungen<br />
nicht erfüllen (64 %).<br />
Der Wandel im Beschäftigungssystem <strong>hat</strong> in den vergangenen Jahren zu einer<br />
deutlichen qualitativen Zunahme der Qualifikationsprofile geführt. Diese<br />
gestiegenen Anforderungen führen nicht nur zu Vakanzen im Beschäftigungssystem<br />
sondern bereits zu Nichtbesetzungen von Ausbildungsplätzen. Viele Unternehmen<br />
klagen über die mangelnde Qualifikation der Schulabgänger und lassen<br />
ihre Ausbildungsplätze lieber unbesetzt bzw. fahren die Ausbildungskapazitäten<br />
zurück. Der Trend zur Höherqualifizierung wird sich in den nächsten Jahren<br />
noch fortsetzen, sowohl der Bedarf an Hochschulabsolventen als auch an gut<br />
ausgebildeten Absolventen im dualen Berufsbildungssystem wird dementsprechend<br />
steigen. Veränderungen in den Branchen- und Unternehmensstrukturen<br />
mit einem steigenden Anteil wissensintensiver Dienstleistungen in den Bereichen<br />
Forschung und Innovation, Beratung und Lehre erzeugen einen zunehmenden<br />
Bedarf an gut qualifizierten Fachleuten (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung<br />
2008).<br />
Die vermeintlich mangelnden Qualifikationen der Schulabgänger stellen jedoch<br />
nicht alle relevanten Probleme dar, die eine adäquate Besetzung der Ausbildungsplätze<br />
in den Betrieben verhindern. Nach einer aktuellen Studie des<br />
Bundesinstituts für Berufsbildung zeigen sich in der Einstellungspraxis der Unternehmen<br />
einige Defizite, die ebenfalls als Ursachen für erfolglose Vermittlungsprozesse<br />
zwischen Ausbildungsplatzanbietern und Stellensuchenden wirken.<br />
Genannt werden in diesem Kontext vier systemische Ungleichgewichte:<br />
Qualifikationsmismatch, beruflicher Mismatch, Informationsmismatch und regionaler<br />
Mismatch (vgl. Gericke u.a. 2009).<br />
Laut einer Studie des Instituts für <strong>Arbeit</strong>s- und Berufsforschung (IAB) aus<br />
dem Jahre 2004 blieben insgesamt etwa 10 % der angebotenen Ausbildungsstellen<br />
unbesetzt (Bellmann u.a. 2005), insbesondere in kleineren Betrieben und<br />
Unternehmen. In einer vom BIBB durchgeführten Betriebsbefragung aus dem<br />
Jahr 2008 gaben sogar 14,7 % (2007) bzw. 14,8 % (2008) der ausbildungswilligen<br />
Betriebe an, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten (Bundesinstitut<br />
für Berufsbildung 2008), davon waren insbesondere mittlere Betriebe<br />
betroffen.<br />
Die beschriebenen Problemfelder zeigen implizit bereits die Handlungsfelder<br />
auf, zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken und einem drohenden Mangel<br />
an qualifizierten <strong>Arbeit</strong>skräften vorzubeugen. Zentrale Handlungsträger werden<br />
hierbei sicher die Betriebe sein. Ihre Personalpolitik muss längerfristig angelegt<br />
30
sein und den Fachkräftebedarf auch in der Ausbildungspolitik berücksichtigen.<br />
Dabei reicht es nicht, die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen, auch die Besetzungspraxis<br />
muss die impliziten Matching-Probleme berücksichtigen und<br />
ihnen entgegenwirken. Öffentliche Förderprogramme wie Potenzial-, Demografie-<br />
und Ausbildungsförderungsprogramme können in diesem Kontext sehr hilfreich<br />
sein.<br />
4 Durchlässigkeit der Bildungssysteme<br />
Um dem prognostizierten Fachkräftemangel zu begegnen und sich den Anforderungen<br />
eines globalisierten Wettbewerbs erfolgreich stellen zu können, <strong>hat</strong> sich<br />
Deutschland das bildungspolitische Ziel einer Studienanfängerquote von 40 %<br />
gesetzt. Eine Reihe von Initiativen des Bundesministeriums für Bildung und<br />
Forschung (BMBF), wie zum Beispiel die Aufstiegsstipendien, das nationale<br />
Leistungspunktesystem DECVET oder der Hochschulpakt 2020 aus dem Jahr<br />
2007 unterstützen diese Entwicklung.<br />
Die Frage ist jedoch, ob Deutschland wirklich eine höhere Studierendenquote<br />
benötigt, was der direkte Vergleich mit dem Ausland durchaus nahe legt.<br />
Dieser Vergleich vernachlässigt allerdings, dass in Deutschland das System der<br />
dualen Berufsausbildung, welche den Jugendlichen eine qualifizierte Berufsausbildung<br />
auf hohem Niveau mit einer intensiven Anbindung an den <strong>Arbeit</strong>smarkt<br />
und einer hohen Betriebsnähe bietet, eine traditionelle Säule der beruflichen<br />
Bildung darstellt, in der jährlich rd. 50 % der Jugendlichen eines Altersjahrgangs<br />
nach dem Abschluss ihrer Schullaufbahn einmünden (vgl. BMBF 2009, 9). Die<br />
Dualität, welche die Kooperation der Lernorte Schule und Betrieb bzw. überbetriebliche<br />
Ausbildungsstätte umfasst, garantiert neben der fachtheoretischen<br />
Ausbildung einen berufspraktischen Schwerpunkt mit einer hohen Anwendungsnähe<br />
im Betrieb, die die Integrationskosten junger Menschen in die <strong>Arbeit</strong>s- und<br />
Berufswelt erheblich reduzieren. Hinzu kommt, dass viele der rd. 350 Berufsbilder<br />
des dualen Systems im Ausland im Rahmen eines Studiums vermittelt werden.<br />
Dieses gilt umso mehr für auf der dualen Berufsausbildung aufbauende<br />
Weiterbildungsqualifikationen zum Techniker, Meister bzw. Fach- oder Betriebswirt.<br />
Drohender Fachkräftemangel und steigender Bedarf an Hochqualifizierten<br />
sind also nicht nur eine Frage akademischer, sondern auch einer qualifizierten<br />
beruflichen Bildung. Allerdings sind die Teilsysteme der beruflichen Bildung<br />
bisher sehr stark voneinander getrennt und in der aktuellen Debatte zum Berufsbildungssystem<br />
in Deutschland wird immer wieder die Forderung nach mehr<br />
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Säulen der Berufsbildung gestellt.<br />
31
Übergänge sollten offener und flexibler gestaltet sein, zwischen unterschiedlichen<br />
dualen Ausbildungsgängen, zwischen schulischer und dualer Berufsausbildung<br />
und vor allem zwischen dualer und Hochschulausbildung. Diese<br />
mangelnde Durchlässigkeit zeigt sich bereits in der allgemeinbildenden Schule,<br />
frühe Bildungsungleichheiten, welche das dreigliedrige Schulsystem produziert,<br />
werden selten und nur partiell nachträglich ausgeglichen. Häufiger bedeutet<br />
Durchlässigkeit zwischen den Schulformen lediglich einen Abstieg in eine niedrigere<br />
Schulform (Solga/Dombrowski 2009, 19) Zur Kompensation wenig erfolglos<br />
abgeschlossener Schullaufbahnen wurden verschiedene Maßnahmen und<br />
Bildungswege eingerichtet, in welchen der Hauptschulabschluss nachgeholt<br />
werden kann, um den Jugendlichen im Ausbildungsmarkt überhaupt eine reale<br />
Chance zu ermöglichen.<br />
Zentral ist die Frage der Durchlässigkeit zwischen den Bildungssektoren der<br />
beruflichen und akademischen Bildung. Die Anerkennung beruflicher Abschlüsse<br />
als Zugangsvoraussetzung zum Hochschulstudium ist zwar zwischenzeitlich<br />
vollzogen, allerdings wird sie wenig genutzt. Lediglich 1,9 % der Studienanfänger<br />
an Fachhochschulen kommen über die Qualifikation eines Meister- oder<br />
Technikerabschlusses an die Hochschule, ihr Anteil an Universitäten liegt sogar<br />
lediglich bei 0,6 % (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008, 194) Diese<br />
Übergänge und Bildungspfade zwischen den Sektoren des Bildungssystems sind<br />
weiter auszubauen. Anstatt berufliche Bildung zu akademisieren, gilt es, den<br />
Übergang von dualer Ausbildung über Fortbildung und Anerkennung beruflicher<br />
Qualifikationen auf ein (Fach)Hochschulstudium zu unterstützen.<br />
Hierzu sind aktuell einige Maßnahmen und Programme in der Berufsbildungspolitik<br />
auf den Weg gebracht worden. 5 Im Rahmen der Förderinitiative<br />
„Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge“ (ANKOM)<br />
wird in elf regionalen Entwicklungsprojekten das Ziel verfolgt, den Hochschulzugang<br />
für erfolgreiche Absolventen des beruflichen Bildungssystems attraktiver<br />
sowie den Wechsel zwischen verschiedenen Bildungsbereichen transparenter<br />
und effektiver zu gestalten. An dem Modellvorhaben beteiligte Hochschulen<br />
haben Verfahren der Anrechnung beruflicher Kompetenzen eingeführt, wobei es<br />
sich dabei um sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bildungsinstitutionen<br />
erworbene formale abschlussbezogene als auch nonformale, nicht zertifizierte<br />
Lernergebnisse handeln kann. Zugleich wurden in der Zusammenarbeit der beteiligten<br />
Akteure die Kommunikation und der Austausch zwischen den Teilbereichen<br />
des Bildungssystems gefördert.<br />
Einen Ausbau der Begabungsförderung in der beruflichen Bildung erfolgte<br />
mit dem Programm „Aufstiegsstipendien“. Hierdurch erhalten Menschen eine<br />
5 Vgl. ausführlich zu den Initiativen des BMBF: Berufsbildungsbericht 2009, 37 ff.<br />
32
finanzielle Förderung ihres Hochschulstudiums, die sich in Ausbildung und Beruf<br />
als besonders talentiert erwiesen haben. Zum Wintersemester 2008/09 eingeführt<br />
fand das Programm eine sehr rege Nachfrage, so dass die Förderzahlen in<br />
den nächsten Runden aufgestockt wurden. Die Aufstiegsstipendien sind für diejenigen<br />
Studierenden gedacht, welche die Möglichkeit des Hochschulzugangs<br />
ohne Abitur und stattdessen durch Ausbildung, Fortbildung und Berufspraxis<br />
nutzen. Das Studium kann in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert werden,<br />
eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Damit wird eine sehr breite Gruppe erfolgreicher<br />
und bildungswilliger <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen/<strong>Arbeit</strong>nehmer angesprochen<br />
und dabei unterstützt, ein Studium aufzunehmen.<br />
Im Kontext der Europäisierung des Bildungssystems 6 wird auch in Deutschland<br />
die Entwicklung eines nationalen Leistungspunktesystems für die berufliche<br />
Bildung (DECVET), orientiert am Europäischen Leistungspunktesystem<br />
(ECVET), diskutiert und es wurde hierzu eine Pilotinitiative im Jahre 2007 gestartet.<br />
In zehn Pilotprojekten werden Verfahren zur Erfassung, Anrechnung und<br />
Anerkennung von Lernergebnissen und Kompetenzen entwickelt. Ziel ist es, die<br />
Übergänge an den zahlreichen Schnittstellen des deutschen Berufsbildungssystems<br />
zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Damit sollen einmal erworbene Kenntnisse<br />
und Fähigkeiten in einen anderen Bildungsgang übernommen werden und<br />
die Durchlässigkeit und Mobilität an folgenden als zentral definierten vier<br />
Schnittstellen erhöht werden: zwischen Berufsausbildungsvorbereitung und dualer<br />
Ausbildung, zwischen unterschiedlichen Ausbildungsgängen, zwischen dualer<br />
und vollzeitschulischer Berufsausbildung sowie zwischen dualer Berufsausbildung<br />
und beruflicher Bildung.<br />
Die kurz skizzierten Programme und Initiativen geben Anhaltspunkte dafür,<br />
wie die Teilsysteme der beruflichen und akademischen Bildung durchlässiger<br />
gestaltet und Übergänge transparenter und effektiver gestaltet werden können.<br />
Mittelfristiges Ziel muss es jedoch sein, systematisch und flächendeckend eine<br />
Durchlässigkeit des deutschen Berufsbildungssystems zu entwickeln und in die<br />
Praxis umzusetzen.<br />
5 Europäisierung der Berufsbildung<br />
Die benannten neuen Anforderungen an eine erhöhte Durchlässigkeit verschiedener<br />
Bildungssysteme gehen maßgeblich auf Entwicklungen und neue Konzepte<br />
europäischer Bildungspolitik zurück. Es bilden sich neue Qualifizierungswege<br />
und Lernortkooperationen, welche ehemals getrennte Segmente miteinander<br />
6 Vgl. ausführlich hierzu die Ausführungen im nächsten Abschnitt.<br />
33
verbindet. Im Zuge des Kopenhagenprozesses werden u.a. die Steigerung der<br />
Humankapitalinvestitionen, die Reduzierung des Anteils junger Menschen ohne<br />
weiterführende Schul- oder Berufsausbildung sowie die Verbesserung der Mobilität<br />
und Transparenz der Befähigungsnachweise angestrebt.<br />
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Prozess zwei der Instrumente für<br />
Zusammenarbeit und Vereinheitlichung der europäischen Berufsbildung: Das<br />
Europäische Kreditsystem für die berufliche Bildung ECVET und der Europäische<br />
Referenzrahmen für die Qualifikationsniveaus EQF, welche jeweils auf<br />
nationaler Ebene in allen Ländern konkretisiert wurden bzw. noch werden soll. 7<br />
Drei zentrale Funktionen werden mit den Instrumenten ECVET und EQF verfolgt.<br />
Erstens geht es um Transparenz der jeweils in den beteiligten Ländern<br />
produzierten Qualifikationen, um diese vergleichbar zu machen. Diese Lernergebnisse,<br />
welche auch lediglich Teile einer umfassenderen Qualifikation beinhalten<br />
können, sollen transferierbar sein. Dieser Transfer, als zweite Funktion, findet<br />
zwischen verschiedenen Bildungssegmenten statt oder entsprechend erworbene<br />
Kreditpunkte sind in einem anderen Mitgliedstaat auf dem weiteren Qualifikationsweg<br />
anrechenbar. Die Möglichkeiten, Teile der Ausbildung auch im<br />
Ausland zu absolvieren, ohne Unterbrechung oder Verluste, sollen damit optimiert<br />
werden. Drittens ist die Akkumulationsfunktion zu benennen. Ziel ist der<br />
Ausbau individualisierter Bildungsprozesse und Ausbildungswege in formellen<br />
wie informellen Lernkontexten. Das erworbene Wissen wird zeitlich und räumlich<br />
unabhängig und über einen nahezu beliebigen Zeitraum akkumuliert und zu<br />
zertifizierbaren Abschlüssen verwertet. Ausbildungs- und Weiterbildungsmodule,<br />
welche im europäischen Ausland erworben wurden, sollen so mühelos integriert<br />
werden und eine Vielzahl an unterschiedlichen Qualifikationsprofilen<br />
schrittweise erworben werden.<br />
Für deutsche Qualifikationsabschlüsse könnte die Nutzung des EQR sowie<br />
seine Umsetzung in einen Nationalen Qualifikationsrahmen zu grundlegenden<br />
Veränderungen im Berufsbildungssystem, insbesondere in Bezug auf die duale<br />
Ausbildung führen. Zur Herstellung der angestrebten Transparenz und insbesondere<br />
des Transfers von Lernergebnissen und um Qualifikationen innerhalb von<br />
individuell gestalteten Bildungsverläufen akkumulieren und auch länderübergreifend<br />
anerkennen zu können, ist eine Zergliederung der Berufsqualifikationen<br />
notwendige Voraussetzung. Diese Entwicklung wird sehr kontrovers diskutiert<br />
und von berufener Seite grundlegend kritisiert. Diese Kritiker sehen die prognostizierte<br />
Modularisierung der Ausbildung im Widerspruch zu dem in Deutschland<br />
auf dem Berufsprinzip basierenden dualen System, welches mittelfristig in Frage<br />
gestellt würde (vgl. z.B. Drexel 2008).<br />
7 Die Umsetzung in Deutschland ist bisher noch nicht abgeschlossen.<br />
34
Wie oben angesprochen, erweist sich jedoch gerade die duale Ausbildung<br />
als erfolgreicher Ausbildungspfad bezüglich der Übergänge in den <strong>Arbeit</strong>smarkt<br />
aufgrund einer hohen Betriebsnähe und Beruflichkeit. Das Potenzial des deutschen<br />
Berufsbildungssystems kann im internationalen Bildungsmarkt ausgebaut<br />
und gleichzeitig international anschlussfähig gemacht werden, wenn es sich auf<br />
seine Stärken besinnt. Die positiven Aspekte der Dualität in der Berufsbildung<br />
sollten weiter ausgebaut werden und auch auf den tertiären Bildungssektor übertragen<br />
werden. Der Ausbau des Angebots dualer Studiengänge weist da sicher in<br />
die richtige Richtung. Das in den letzten Jahren bundesweit rasant gestiegene<br />
Angebot (vgl. www.ausbildungsplus.de) stößt sowohl bei den Studienbewerberinnen/Studienbewerbern<br />
als auch bei kooperierenden Betrieben auf reges Interesse<br />
und eine hohe Nachfrage.<br />
6 Schlussbemerkung<br />
Die benannten Problemfelder zeigen den künftigen Handlungsbedarf für alle am<br />
Ausbildungsmarkt sowie in der Berufsbildung tätigen Akteure auf. Verbunden<br />
mit den Folgen des demografischen Wandels sowie den gestiegenen Anforderungen<br />
in einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen wird der Bedarf an Unterstützungs-<br />
und Orientierungsmaßnahmen im System der Berufsbildung zunehmen.<br />
Nicht nur, dass die Zahl der Jugendlichen zukünftig abnehmen wird, auch<br />
die Voraussetzungen, welche diese aufgrund ihres sozialen, familiären und schulischen<br />
Hintergrundes mitbringen, werden sich weiter verändern und den direkten<br />
Zugang zum Ausbildungsmarkt und einer erfolgreichen Berufslaufbahn erschweren.<br />
Darauf wird sich eine zukunftsweisende Berufsbildungspolitik einzustellen<br />
haben und die Übergänge an der ersten und zweiten Schwelle entsprechend<br />
den Bedarfen der jungen Menschen zu gestalten haben.<br />
35
Literatur<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung (2008): Ausbildungsstellenmarkt zwischen ungenutzten<br />
Ausbildungskapazitäten und steigendem Fachkräftebedarf. Kurzbericht zum BIBB-<br />
Ausbildungsmonitor I/2008 des Bundesinstituts für Berufsbildung in Kooperation<br />
mit TNS Infratest (Forschungsprojekt 2.1.202). Bonn.<br />
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2008): Bildung in Deutschland. Bielefeld.<br />
Baethge, M.; Solga, H.; Wieck, M. (2007): Berufsbildung im Umbruch. Studie im Auftrag<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin.<br />
Beicht, U.; Friedrich, M.; Ulrich, J. G. (Hrsg.) (2008): Ausbildungschancen und Verbleib<br />
von Schulabsolventen. Bielefeld.<br />
BIBB (Hrsg.) (2009): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009. Bonn.<br />
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2009): Berufsausbildung 2015 – Ein Leitbild. Bielefeld.<br />
Bellmann, L.; Hartung, S. (2005): Betriebliche Ausbildung – Zu wenig Stellen und doch<br />
sind nicht alle besetzt. IAB-Kurzbericht Nr. 27/2005. Nürnberg.<br />
BMBF (Hrsg.) (2009): Berufsbildungsbericht 2009. Bonn.<br />
Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> (2010): Der <strong>Arbeit</strong>s- und Ausbildungsmarkt in Deutschland –<br />
Monatsbericht Dezember und Jahr 2009. Nürnberg.<br />
Drexel, I. (2008): Berufsprinzip oder Modulprinzip? Zur künftigen Struktur beruflicher<br />
Bildung in Deutschland.. In: Verband für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs<br />
(Hrsg.): Berufskollegs stärken heißt die berufliche Bildung zu stärken. Krefeld.<br />
Euler, D.; Severing, E. (2006): Flexible Ausbildungswege in der Berufsausbildung. Bielefeld.<br />
Fuchs, J.; Söhnlein, D. (2007): Einflussfaktoren auf das Erwerbspersonenpotenzial. IAB-<br />
Discussion Paper No. 12/ 2007. Nürnberg.<br />
Gericke, N.; Krupp, T.; Troltsch, K. (2009): Unbesetzte Ausbildungsplätze – warum<br />
Betriebe erfolglos bleiben. BIBB-Report 10/2009. Bonn.<br />
Harney, K.; Hartkopf, E. (2008): Gruppierungsmerkmale und Einflussgrößen der Segmentation<br />
im beruflichen Schulsystem. FIAB-<strong>Arbeit</strong>spapier 12. Recklinghausen.<br />
Hug, M. (2008): Fachkräftemangel im Mittelstand. Haufe-Studienreihe. Freiburg.<br />
Institut der deutschen Wirtschaft (Hrsg.) (2009): MINT-Meter – Mint-Lücke in Deutschland<br />
und Indikatoren im internationalen Vergleich. Köln.<br />
Seibert, H.; Kleinert, C. (2009): Ungelöste Probleme trotz Entspannung. IAB-Kurzbericht<br />
10/2009. Nürnberg.<br />
Solga, H.; Dombrowski, R. (2009): Soziale Ungleichheiten in schulischer und außerschulischer<br />
Bildung. HBS-<strong>Arbeit</strong>spapier 171. Düsseldorf.<br />
Statistik der Bundesagentur für <strong>Arbeit</strong> (2009): TOP TEN der gemeldeten Stellen nach<br />
Branchen und Berufen. www.arbeitsagentur.de<br />
Verein Deutscher Ingenieure; Institut der deutschen Wirtschaft (Hrsg.) (2009): Ingenieurarbeitsmarkt<br />
2008/09 – Fachkräftelücke, Demografie und Ingenieure 50Plus. Köln.<br />
www.ausbildungplus.de<br />
36
17.01.2013 – wird noch bekanntgegeben
Textgrundlagen 24.01.-07.02.2013 gibt es nicht…<br />
Geschafft!
Ab hier ist nur noch Bonus….
Beilagezur Wochenzeitung<br />
24. Februar 2003<br />
AusPolitik<br />
und Zeitgeschichte<br />
3 Maria Thiele-Wittig<br />
Kompetent im Alltag:<br />
Bildung fçr Haushalt und Familie<br />
7 Michael-BurkhardPiorkowsky<br />
14 Lothar Krappmann<br />
Neue Hauswirtschaft fçr die postmoderne<br />
Gesellschaft<br />
Zum Wandel derÚkonomie des Alltags<br />
Kompetenzfærderung im Kindesalter<br />
20 Edda Mçller /HildegardMackert<br />
27 Dieter Korczak<br />
Bildung fçr Haushalt und Konsum<br />
als vorsorgender Verbraucherschutz<br />
Wassollen unsereKinder von uns lernen<br />
Neusser Thesen zur Bildungspolitik<br />
B9/2003
Herausgegeben von<br />
der Bundeszentrale<br />
fçr politische Bildung<br />
Berliner Freiheit 7<br />
53111 Bonn.<br />
Redaktion:<br />
Dr. Klaus W. Wippermann<br />
verantwortlich)<br />
Dr. Katharina Belwe<br />
Hans-Georg Golz<br />
Dr. Ludwig Watzal<br />
Hans G. Bauer<br />
Internet:<br />
www.das-parlament.de<br />
E-Mail: apuz@bpb.de<br />
Die Vertriebsabteilung der<br />
Wochenzeitung<br />
Saar-Blies-Gewerbepark / In der Lach 8,<br />
66271 Kleinblittersdorf-Hanweiler,<br />
Telefon 0 68 05) 61 54 39,<br />
Fax 0 68 05) 61 54 40,<br />
E-Mail: parlament@sdv-saar.de,<br />
nimmt entgegen:<br />
* Nachforderungen der Beilage<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte<br />
* Abonnementsbestellungen der<br />
Wochenzeitung<br />
einschlieûlich Beilage zum Preis<br />
von Euro 9,57 vierteljåhrlich,<br />
Jahresvorzugspreis Euro 34,90<br />
einschlieûlich Mehrwertsteuer;<br />
Kçndigung drei Wochen vor Ablauf<br />
des Berechnungszeitraumes;<br />
* Bestellungen von Sammelmappen<br />
fçr die Beilage<br />
zum Preis von Euro 3,58<br />
zuzçglich Verpackungskosten,<br />
Portokosten und Mehrwertsteuer.<br />
Die Veræffentlichungen<br />
in der Beilage<br />
Aus Politik Politik und Zeitgeschichte<br />
stellen keine Meinungsåuûerung<br />
des Herausgebers dar;<br />
sie dienen lediglich der<br />
Unterrichtung und Urteilsbildung.<br />
Fçr Unterrichtszwecke dçrfen<br />
Kopien in Klassensatzstårke<br />
hergestellt werden.<br />
ISSN 0479-611 X<br />
Editorial<br />
n Die sozialen Sicherungssysteme,<br />
der <strong>Arbeit</strong>smarkt und die demokratischen<br />
Institutionen des<br />
politischen Systems verlieren<br />
zunehmend an Integrationskraft.<br />
Zugleich entlåsst der Sozialstaat<br />
seine Bçrgerinnen und Bçrger<br />
mehr und mehr in die Eigenverantwortung.<br />
Dabei bleibt unberçcksichtigt,<br />
dass diese nicht in<br />
ausreichendem Maûe çber die<br />
Kompetenzen verfçgen, die<br />
steigenden Anforderungen des<br />
Alltags zu bewåltigen. Die Autorinnen<br />
und Autoren dieser Ausgabe<br />
plådieren vor diesem Hintergrund<br />
fçr ¹aktivierende Gesellschaftspolitikª:<br />
Die Menschen sollen<br />
durch Bildung besser dazu befåhigt<br />
werden, nicht nur ihren eigenen<br />
Alltag selbst bestimmt zu gestalten,<br />
sondern sich konstruktiv in<br />
gesellschaftliche Verånderungsprozesse<br />
einzubringen.<br />
n Die in Haushalten und Familien ±<br />
auf der Mikroebene ± tagtåglich zu<br />
treffenden Entscheidungen haben<br />
Auswirkungen auf die gesellschaftliche<br />
Entwicklung. Die hier agierenden<br />
Menschen sollten deshalb, so<br />
Maria Thiele-Wittig, stårker als<br />
gesellschaftliche Akteure wahrgenommen<br />
werden. Die Autorin<br />
versteht die Herausbildung von<br />
Kompetenzen zur Bewåltigung der<br />
gewandelten Anforderungen ± der<br />
¹Neuen Hausarbeitª ± daher als<br />
eine wichtige gesellschaftliche<br />
Aufgabe.<br />
n Die sich wandelnde Úkonomie<br />
des Alltags ± die zunehmende<br />
ækonomische Verantwortung der<br />
Privathaushalte ± subsumiert<br />
Michael-Burkhard Piorkowsky<br />
unter den Begriff der ¹Neuen<br />
Hauswirtschaftª. Privathaushalte<br />
nåhmen durch Gçternachfrage<br />
und Haushaltsproduktion Einfluss<br />
auf die sozioækonomische Makrostruktur;<br />
jede Entscheidung fçr<br />
eine einzelne Ausgabe oder Vermægensanlage<br />
sei immer zugleich<br />
eine Entscheidung gegen eine<br />
andere Verwendung und tangiere<br />
damit das ækonomische Gesamtsystem.<br />
Die Voraussetzung dafçr,<br />
dass Privathaushalte ihre Aufgaben<br />
als Akteure in Wirtschaft und<br />
Gesellschaft kompetent erfçllen<br />
kænnen, sieht Piorkowsky in einer<br />
grundlegenden Verbesserung des<br />
dafçr notwendigen Orientierungswissens:<br />
Der Autor fordert eine<br />
angemessene Thematisierung der<br />
Hauswirtschaft in ihrer Bedeutung<br />
fçr die Einzelnen und die Gesellschaft<br />
an den Schulen.<br />
n Lothar Krappmann geht noch<br />
einen Schritt weiter und plådiert<br />
dafçr, Alltagskompetenzen bereits<br />
im Kindesalter zu færdern. Nicht<br />
mangelnde Allgemeinbildung,<br />
etwa das fehlende Abitur, sei die<br />
Ursache fçr das Versagen vieler<br />
Menschen bei der Bewåltigung<br />
ihres Alltags. Vielmehr seien diese<br />
unfåhig, auf die Anforderungen<br />
und Verånderungen ihrer Lebenswelt<br />
angemessen zu reagieren. Es<br />
komme daher darauf an, die<br />
Familien bzw. die Haushalte durch<br />
die Vermittlung entsprechender<br />
Kompetenzen zu unterstçtzen. In<br />
diese Richtung zielt auch Dieter<br />
Korczak, der Thesen einer interdisziplinåren<br />
Studiengesellschaft<br />
zur Bildungspolitik einer zukunftsfåhigen<br />
Gesellschaft pråsentiert<br />
und kommentiert.<br />
n<br />
Nur informierte Verbraucherinnen<br />
und Verbraucher sind fåhig,<br />
ihre Rolle als Konsumenten aktiv<br />
und verantwortlich wahrzunehmen<br />
und damit sich selbst und die<br />
Gesellschaft vor den negativen<br />
Auswirkungen des Konsums zu<br />
schçtzen. Edda Mçller und<br />
Hildegard Mackert setzen sich<br />
vehement dafçr ein, Wissensvermittlung<br />
besser an der Erfahrungswelt<br />
der Schçlerinnen und Schçler<br />
sowie an ihren kçnftigen Aufgaben<br />
als Konsumenten, Familiengrçnder<br />
und Verantwortliche fçr ihren<br />
privaten Haushalt und die<br />
Gestaltung ihres Lebensalltags zu<br />
orientieren.<br />
Katharina Belwe
Maria Thiele-Wittig<br />
Kompetent im Alltag: Bildung fçr Haushalt<br />
und Familie<br />
Haushalte und Familien stellen grundlegende<br />
Lebens- und Handlungsbereiche der Gesellschaft<br />
dar. Die Menschen sind auf der Ebene der privaten<br />
Haushalte zugleich Akteure und Leistungstråger<br />
der Gesellschaft in ihren vielfåltigen Wechselbeziehungen.<br />
Der Wandel der Lebensbedingungen, sowohl im<br />
Kontext der Globalisierung als auch im Hinblick<br />
auf die Informations- und Wissensgesellschaft,<br />
geht mit neuen Herausforderungen fçr die Haushalts-<br />
und Lebensfçhrung einher. Alltagsbewåltigung,<br />
Lebensgestaltung und private Daseinsvorsorge<br />
werden komplexer und differenzierter.<br />
Orientierungs-, Auswahl- und Entscheidungsprobleme<br />
sowie der Umgang mit Risiken im schnellen<br />
Wandel sind die Folge. Die Notwendigkeit von<br />
Abstimmungs- und Aushandlungsprozessen fçr<br />
das alltågliche Zusammenleben nimmt zu. Es<br />
ergibt sich die Frage, wie die Menschen ausgerçstet<br />
sind bzw. werden, um kompetent mit dem<br />
Wandel umgehen zu kænnen. Wenn etwa Ûberschuldungsprobleme,<br />
Probleme der Beziehungsfåhigkeit,<br />
Suchtanfålligkeit oder Fehlernåhrung<br />
zunehmen, gerade auch bei Jugendlichen, werden<br />
Probleme der Bewåltigung der Herausforderungen<br />
offenbar, die sowohl die Betroffenen als auch die<br />
Gesellschaft belasten.<br />
Immer stårker geforderte Eigenverantwortlichkeit<br />
fçr die eigene Lebensgestaltung und deren Folgen,<br />
in Verbindung mit hæherer Lebenserwartung, låsst<br />
die Frage der Qualifizierung fçr die Herausforderungen<br />
des Wandels der Lebensbedingungen bzw.<br />
nach den Kompetenzen fçr die erweiterten Aufgaben<br />
der privaten Daseinsgestaltung dringlicher<br />
werden. Aktivierende Gesellschaftspolitik ist gefordert.<br />
Fragen der Alltags- und Lebensbewåltigung<br />
gewinnen auch eine neue Aktualitåt angesichts der<br />
gestiegenen Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben.<br />
Das macht die Reflexion der Zusammenhånge<br />
zwischen ¹privatª und ¹æffentlichª und der<br />
Balance von <strong>Arbeit</strong> und Leben bzw. Erwerbsarbeit<br />
und Familienarbeit erforderlich. Die stårkere Einbindung<br />
der Frauen in den Erwerbsbereich reduziert<br />
ihre <strong>Arbeit</strong>skapazitåt fçr unbezahlte <strong>Arbeit</strong><br />
in Haushalt und Familie und erhæht deren Einkommen<br />
und Kaufkraft. In der Folge nehmen die<br />
Verflechtungen mit Wirtschaft und Gesellschaft<br />
zu. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Bedeutung<br />
der Kompetenzen fçr die Gestaltung des Alltags,<br />
des Haushalt und der Familie an Bedeutung<br />
± fçr beide Geschlechter. Die Forderung nach<br />
verstårkter und fundierter Vermittlung von Alltagskompetenzen<br />
1 ± sowohl im Rahmen der schulischen<br />
Allgemeinbildung als auch çber unterschiedliche<br />
Formen auûerschulischer Bildung und<br />
Beratung ± ist vor diesem Hintergrund nur konsequent.<br />
I. Haushalte und Familien<br />
als Basiseinheiten der Gesellschaft<br />
In den Haushalten liegen essentielle Aufgaben des<br />
Lebensunterhalts und der Lebensgestaltung. 2<br />
Ûber ihre Versorgungs-, Pflege- und Erziehungsleistungen<br />
3 fungieren sie als grundlegende Leistungstråger<br />
der Gesellschaft. Gleichzeitig bzw. darçber<br />
hinaus beeinflussen sie mit der aktiven<br />
Gestaltung ihrer Lebensfçhrung die weitere Entwicklung<br />
der Gesellschaft.<br />
Der Umfang der unbezahlten <strong>Arbeit</strong> in Haushalt<br />
und Familie ist erheblich. Nach den Ergebnissen<br />
der Zeitbudgetuntersuchung von 1992 war der<br />
Umfang der unbezahlten <strong>Arbeit</strong> etwa eineinhalbmal<br />
so hoch wie derjenige der gesamten Erwerbsarbeit:<br />
95,5 Milliarden Stunden unbezahlte <strong>Arbeit</strong><br />
gegençber 60 Milliarden Stunden Erwerbsarbeit. 4<br />
1 Vgl. Deutsche Gesellschaft fçr Hauswirtschaft (Hrsg.),<br />
Kompetent im Alltag! Memorandum fçr eine haushaltsbezogene<br />
Bildung: frçhzeitig, aufbauend. Lebenslang. Wege<br />
zu einer zeitgemåûen und zukunftsorientierten Bildung,<br />
Bonn 2001.<br />
2 Vgl. Irmintraut Richarz, Bildung fçr den Haushalt in einer<br />
sich wandelnden Welt, Baltmannsweiler 1982, S. 48.<br />
3 Vgl. Rosemarie von Schweitzer, Die privaten Versorgungs-,<br />
Pflege und Erziehungsleistungen und ihre Wahrnehmung<br />
als Haushaltsproduktion, in: Hauswirtschaft und<br />
Wissenschaft, 36 (1988) 45, S. 230 ± 237.<br />
4 Vgl. D. Schåfer/N. Schwarz, Der Wert der unbezahlten<br />
<strong>Arbeit</strong> der privaten Haushalte ± Das Satellitensystem Haushaltsproduktion,<br />
in: Bundesministerium fçr Familie, Senioren,<br />
Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.), Zeit im<br />
Blickfeld, Stuttgart ± Berlin ± Kæln 1996, S. 43.<br />
3 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
Einen der wichtigsten Beitråge fçr die <strong>Zukunft</strong> der<br />
Gesellschaft bilden die grundlegenden Leistungen<br />
von Familie und Haushalt fçr das Humanvermægen<br />
5 bzw. die Entwicklung entsprechender Ressourcen.<br />
Haushalte und Familien sind auch diejenigen<br />
¹Institutionenª, die wesentliche Weichen fçr<br />
Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung stellen.<br />
Gesundheit ist ein Bereich, in dem nicht mehr<br />
nur der ¹Patientª betrachtet wird, sondern zunehmend<br />
auch die Pråvention bzw. eine gesundheitsbezogene<br />
Lebensfçhrung in den Blick genommen<br />
wird.<br />
Die verschiedenen Rollen, die Menschen in ausdifferenzierten<br />
Gesellschaften wahrnehmen (kænnen),<br />
fçllen sie zunehmend in Personalunion aus,<br />
seien es produktive oder Verbraucherrollen, Klienten-<br />
oder Bçrgerrollen u. v. a. m.<br />
In der aktiven Gestaltung des Mikrosystems<br />
(Familien-)Haushalt liegen erhebliche Aufbauund<br />
Balanceleistungen. Sie betreffen sowohl die<br />
Alltagsorganisation als auch Ausprågungen von<br />
Alltagskultur und Haushalts- und Lebensstilen,<br />
den Aufbau von Beziehungsmustern und sozialer<br />
Netze ebenso wie nachbarschaftliche Einbindung,<br />
Teilhabe an der Zivilgesellschaft u. v. a. m.<br />
Haushalte kænnen als Schaltstellen betrachtet werden,<br />
in denen die Akteure unterschiedliche Entscheidungen<br />
treffen oder unterlassen, Strategien<br />
entwickeln bzw. ihre Mikropolitik in Abhångigkeit<br />
von ihren Kompetenzen sehr unterschiedlich<br />
gestalten. Die Wirkungen gehen in beide Richtungen:<br />
Nicht nur Wirtschaft, Gesellschaft und<br />
Umwelt beeinflussen das Handeln auf Haushaltsebene,<br />
sondern die Menschen im Haushaltskontext<br />
wirken als Akteure auf Wirtschaft, Gesellschaft<br />
und Umwelt ein. Eine Mikro-Makro-<br />
Relation im Sinne von Wechselwirkungen ist zu<br />
beobachten. In diesem Kontext wird der Begriff<br />
der Daseinskompetenzen betont. 6 Franz-Xaver<br />
Kaufmann spricht von ¹komplexitåtsverarbeitenden<br />
Daseinskompetenzenª und weist darauf hin,<br />
dass Daseinskompetenzen ¹die Qualitåt der Beteiligung<br />
an allen gesellschaftlichen Teilsystemen<br />
unter den gegenwårtigen komplexen Bedingungen<br />
maûgeblich bestimmenª. 7<br />
5 Vgl. BMFSFJ (Hrsg.), Fçnfter Familienbericht: Familien<br />
und Familienpolitik im geeinten Deutschland ± <strong>Zukunft</strong> des<br />
Humanvermægens, BT-Drucksache 12/7560, Bonn 1994.<br />
6 Vgl. ebd., S. 243 f.<br />
7 Franz-Xaver Kaufmann, Zum Konzept der Familienpolitik,<br />
in: Bernhard Jans/Andr Habisch/Erich Stutzer<br />
(Hrsg.), Familienwissenschaftliche und familienpolitische<br />
Signale: Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Wingen,<br />
Grafschaft 2000, S. 46.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
II. Herausforderungen durch<br />
steigende Komplexitåt<br />
der Lebensbedingungen<br />
Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse<br />
werfen Fragen danach auf, wie sich die vielen Verånderungen<br />
auf der Ebene des Haushalts auswirken<br />
und wie Haushalte selbst Akteure des Wandels<br />
werden, etwa çber neue Haushalts- und<br />
Lebensformen und Lebensstile, çber Umsetzungen<br />
ækologischen Bewusstseins oder als Transformatoren<br />
kultureller Werte.<br />
Mit hæherem Lebensniveau gewinnen die Vernetzungen<br />
und Verflechtungen der Haushalte mit<br />
marktlichen und nichtmarktlichen Institutionen an<br />
Bedeutung. Interaktion und Austausch nehmen<br />
zu, die Lebens- und Aktionsråume expandieren.<br />
Entsprechend steht die Haushalts- und Lebensfçhrung<br />
der Menschen vor Aufgaben, die sich auffåchern<br />
und ausdifferenzieren.<br />
In diesem Kontext wurde der Begriff der ¹Neuen<br />
Hausarbeitª eingefçhrt. 8 Wåhrend durch Auslagerungsprozesse<br />
aus den Haushalten ein Teil der traditionellen<br />
Hausarbeit abgenommen <strong>hat</strong>, werden<br />
die Haushalte durch Zunahme der Auûenbeziehungen<br />
und Verflechtungen vor zahlreiche neue<br />
Aufgaben gestellt, deren <strong>Arbeit</strong>scharakter zunåchst<br />
kaum beachtet wurde. Im engeren Sinne<br />
sind es <strong>Arbeit</strong>seinsåtze an den Schnittstellen zu<br />
den verschiedenen Institutionen, von denen Haushalte<br />
Gçter und Dienstleistungen beziehen<br />
(Mårkte, Banken, Versicherungen, Verkehrseinrichtungen,<br />
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen).<br />
Vorgelagert sind vermehrte Anforderungen<br />
an Orientierungs- und Abstimmungsfåhigkeit der<br />
Menschen; nachgelagert sind Anforderungen an<br />
ihre Integrationsfåhigkeit angesichts der Auffåcherung<br />
und Ausdifferenzierung der Aufgaben der<br />
Haushalte. Die fçr die ¹Neue Hausarbeitª erforderlichen<br />
Kompetenzen unterscheiden sich von<br />
denen fçr traditionelle Hausarbeit, da sie sich auf<br />
die Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen<br />
und auf zunehmende Vermittlungsleistungen<br />
gegençber verschiedenen Institutionen beziehen. 9<br />
8 Maria Thiele-Wittig, . . . der Haushalt ist fast immer betroffen<br />
± ¹Neue Hausarbeitª als Folge des Wandels der Lebensbedingungen,<br />
in: Hauswirtschaft und Wissenschaft,<br />
(1987) 35, S. 119 ± 127.<br />
9 Maria Thiele-Wittig, Schnittstellen der privaten Haushalte<br />
zu Institutionen. Zunehmende Auûenbeziehungen der<br />
Haushalte im Wandel der Daseinsbewåltigung, in: Sylvia<br />
Gråbe (Hrsg.), Der private Haushalt im wissenschaftlichen<br />
Diskurs, Frankfurt/M. ± New York 1993, S. 371±388, hier insbes.<br />
S. 382 f.<br />
4
Haushalte sehen sich expandierenden Mårkten<br />
gegençber. Marketing und Werbung durchdringen<br />
mehr und mehr den Alltag. Jugendliche sind dabei<br />
eine besondere Zielgruppe, nicht nur als gegenwårtige,<br />
vielmehr auch als kçnftige Kunden sowie<br />
als ¹Markendurchsetzerª gegençber Eltern. Auf<br />
dem Dienstleistungsmarkt gibt es eine Expansion<br />
bei Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Reiseund<br />
Urlaubsangeboten, haushaltsnahen Dienstleistungen<br />
etc. Konsum ist nicht nur Genuss, sondern<br />
auf Seiten der Haushalte auch mit <strong>Arbeit</strong> verbunden.<br />
Bedarfsreflexion ist gefordert hinsichtlich der<br />
Wirkungen des Konsums auf Gesundheit und<br />
Umwelt, aber auch hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit,<br />
bspw. im Nord-Sçd-Konflikt. Auch Erwerbsarbeit<br />
ist aus Haushaltssicht mit hæheren<br />
Anforderungen verbunden. Die Risiken eines<br />
<strong>Arbeit</strong>splatzverlustes oder -wechsels nehmen zu.<br />
Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />
gewinnen an Bedeutung, ebenso die schon angesprochenen<br />
Balancen von Erwerbs- und Familienarbeit.<br />
Die Anforderungen der Erwerbsarbeit<br />
an Flexibilitåt und Mobilitåt stehen vielfach in<br />
Konkurrenz zu den Anforderungen der Familie<br />
nach Stabilitåt, Kontinuitåt und Verlåsslichkeit<br />
bzw. belasten Partnerschaften und wirken sich<br />
negativ auf die Verwirklichung von Kinderwçnschen<br />
aus.<br />
Zeit ist zur knappen Ressource geworden, angesichts<br />
der vielen Optionen und Anforderungen.<br />
Das Zusammenleben der Familienmitglieder muss<br />
zunehmend aktiv organisiert werden; die Zeit<br />
dafçr wird immer knapper. Neue Kommunikationssysteme<br />
haben unterschiedliche Auswirkungen.<br />
Diese erweiterten Aufgabenstellungen, um Balancen<br />
bzw. gleitende Balancen fçr das Spektrum der<br />
Lebensbedçrfnisse zu finden, lassen wachsende<br />
Bildungserfordernisse fçr Haushalt und Familie<br />
erkennen.<br />
III. Anforderungen durch<br />
zunehmend geforderte<br />
Eigenverantwortlichkeit<br />
Von Haushalten und Familien wird immer mehr<br />
Eigenverantwortung gefordert. Die Gestaltung des<br />
eigenen Alltags und der Lebensfçhrung wird zu<br />
einer immer komplexeren Aufgabe. Wahlmæglichkeiten<br />
und Wahlzwånge nehmen zu. Traditionell<br />
vorgezeichnete Lebenslåufe gelten immer weniger<br />
als Orientierung. Die Menschen in Haushalt und<br />
Familie mçssen permanent çber ihre Lebensfçhrung<br />
und Daseinssicherung entscheiden. Sie sind<br />
gezwungen, ihre private Daseinsvorsorge in diffe-<br />
renzierterer Form mit der staatlichen Daseinsvorsorge<br />
zu vernetzen (z. B. Alterssicherung, Gesundheit,<br />
Erwerbssicherung). Ihnen wird immer mehr<br />
Verantwortung fçr die Folgen dieser Entscheidungen<br />
aufgebçrdet.<br />
Um fundierte Entscheidungen treffen zu kænnen,<br />
brauchen die Menschen zweierlei: mehr Wissen<br />
und die Fåhigkeit zur Orientierung in einer sich<br />
schneller wandelnden Umwelt, um die Auswirkungen<br />
von Entscheidungen abschåtzen zu kænnen. 10<br />
IV. Neuer Fokus auf Alltag<br />
und Alltagskompetenzen:<br />
Bildung fçr Haushalt und Familie<br />
Haushalte sind in der Vergangenheit håufig ausgeblendet,<br />
vernachlåssigt oder als Restgræûe und<br />
Puffer angesehen worden. Ohne die in den Haushalten<br />
und Familien geleistete ¹Lebensarbeitª ±<br />
die Ausbalancierung des gesamten Spektrums der<br />
Lebensbedçrfnisse unter den Bedingungen der<br />
mobilisierbaren Ressourcen ± kann eine Gesellschaft<br />
jedoch nicht bestehen. Die hier getroffenen<br />
Lebensentscheidungen bleiben nicht ohne Auswirkungen<br />
auf die gesellschaftliche Entwicklung. In<br />
diesem Sinne sind die Menschen auf der Ebene<br />
von Haushalt und Familie stårker als Akteure<br />
wahrzunehmen, und der Blick ist auf ihre Handlungs-<br />
und Entscheidungsbasis fçr den Kontext<br />
von Haushalt und Familie zu richten.<br />
Læsungen von Alltagsproblemen nur durch Versuch<br />
und Irrtum erzielen zu wollen oder sich auf<br />
die begrenzten Erfahrungswerte zu verlassen, die<br />
zudem immer schneller veralten, ist riskant und<br />
verlustreich. Es gilt daher, neue Verhaltensmuster<br />
zu entwickeln und Handlungshilfen zu vermitteln.<br />
Die Bedeutung der Alltagsbewåltigung und<br />
Lebensgestaltung mit ihren komplexen Zusammenhången<br />
und Wechselwirkungen macht eine<br />
stårkere systematische Berçcksichtigung im Bildungssystem<br />
erforderlich, gerade auch mit Blick<br />
auf ihre pråventive Funktion. 11<br />
10 Es gilt, Zusammenhånge gesundheitsbezogener Lebensfçhrung,<br />
vorsorgenden Wirtschaftens bzw. nachhaltiger Lebensfçhrung,<br />
der Gestaltung einer Kultur des Aufwachsens,<br />
des Zusammenlebens und der Sorge fçr Nahestehende oder<br />
Abhångige zu beachten. Vgl. Siegfried Keil, Fçr eine Kultur<br />
des Aufwachsens in Familie und Gesellschaft, in: B. Jans u. a.<br />
(Anm. 7), S. 486.<br />
11 Vgl. Maria Thiele-Wittig, Neue Hausarbeit im Kontext<br />
der Bildung fçr Haushalts- und Lebensfçhrung, in: Ulrich<br />
Oltersdorf/Thomas Preuû (Hrsg.), Haushalte an der Schwelle<br />
zum nåchsten Jahrtausend. Aspekte haushaltswissenschaftlicher<br />
Forschung ± gestern, heute, morgen, Frankfurt/M. ±<br />
New York 1996, S. 342 ±362.<br />
5 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
Eine haushaltsorientierte Bildung kann prinzipiell<br />
das Potenzial fçr eine entsprechende Kompetenzvermittlung<br />
entwickeln, soweit sie vom Alltag und<br />
vom Spektrum der Lebensbedçrfnisse ausgeht. Sie<br />
ist geeignet, Handlungs- und Entscheidungsfåhigkeit<br />
sowie Eigenverantwortlichkeit zu stårken.<br />
Håufig werden einzelne Bereiche identifiziert, in<br />
denen fehlende Kompetenzen Probleme hervorrufen.<br />
Das fçhrt zu Forderungen nach entsprechender<br />
Bildung etwa in den Bereichen Ernåhrung,<br />
Gesundheit, Wohnen, Konsum, aber auch ± allgemeiner<br />
± in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt,<br />
Finanzen sowie Ehe und Familie. Jeder dieser<br />
Bereiche kann aufgrund der jeweils spezifischen<br />
Ausrichtung Profil gewinnen. Die Betrachtung<br />
einzelner Bereiche birgt jedoch die Gefahr der<br />
Vernachlåssigung der Zusammenhånge und Wechselwirkungen.<br />
Ein Spezifikum des Alltags ist seine Vieldimensionalitåt,<br />
sind die vielen Wechselwirkungen, da der<br />
Alltag einen wesentlichen Teil der Lebenswirklichkeit<br />
darstellt. Die haushaltsorientierte Bildung <strong>hat</strong><br />
in besonderem Maûe diese Ganzheitlichkeit zum<br />
Ziel. Integrative Betrachtung ist ihre Stårke. Haushaltsorientierte<br />
Bildung rçckt das gesamte Spektrum<br />
der Lebensbedçrfnisse in den Blick und hilft,<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
Bedçrfnisse und Bedarfe zu analysieren und zu<br />
reflektieren, abzuklåren und zu konkretisieren.<br />
Fçr die vielfåltigen alltagspraktischen Fragestellungen<br />
sind mehrere Ebenen von Bedeutung,<br />
sowohl die Ebene der konkreten <strong>Arbeit</strong> und entsprechender<br />
Fertigkeiten als auch die Ebene der<br />
Orientierung, der Reflexion und des verantwortlichen<br />
Entscheidens im Zusammenhang mit Analyse-<br />
und Kritikfåhigkeit und kultureller Kompetenz.<br />
Diese Tatsache macht diese Bildungsinhalte<br />
gerade auch fçr den Wandel zu ganztågigen Schulen<br />
interessant.<br />
Angesichts der gesellschaftlichen Transformationsprozesse<br />
mit erweiterten Aufgabenstellungen fçr<br />
die Alltagsbewåltigung und Daseinssicherung und<br />
ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen wird die<br />
Vermittlung entsprechender Qualifikationen zu<br />
einer immer dringenderen Aufgabe. Das gilt sowohl<br />
fçr eine grundlegende, systematische Vermittlung<br />
in der Schule, und zwar in den verschiedenen<br />
Schulformen und Schulstufen, als auch fçr<br />
die auûerschulische Bildung und Beratung. Entsprechende<br />
Vermittlung von Daseinskompetenzen<br />
ist als ein grundlegender Beitrag sowohl zur Allgemeinbildung<br />
als auch fçr spezifische Bildungs- und<br />
Beratungsangebote zu betrachten, im Sinne einer<br />
aktivierenden Gesellschaftspolitik.<br />
6
Michael-Burkhard Piorkowsky<br />
Neue Hauswirtschaft<br />
fçr die postmoderne Gesellschaft<br />
I. Problemstellung<br />
Das Konzept der Neuen Hauswirtschaft verfolgt<br />
zweierlei: die Begrçndung eines neuen Verståndnisses<br />
von Privathaushalten und Familien als den<br />
Basiseinheiten von Wirtschaft und Gesellschaft<br />
sowie die Etablierung entsprechender Inhalte im<br />
Bildungssystem. Die Motivation fçr dieses Anliegen<br />
resultiert vor allem aus Erkenntnissen çber<br />
einen erschreckend lçckenhaften Wissensstand<br />
von Jugendlichen und Erwachsenen çber die Úkonomie<br />
des Alltags sowie gravierende Folgen dieses<br />
Mangels. Eine entscheidende Ursache dafçr ist das<br />
defizitåre Bildungsangebot, das weit hinter dem<br />
rasanten gesellschaftlichen Wandel zurçckbleibt.<br />
Das Plådoyer zum Gegensteuern grçndet auf der<br />
Ûberzeugung, dass der gesellschaftliche Modernisierungsprozess<br />
nur gelingen kann, wenn bereits<br />
Kinder und Jugendliche in den allgemein bildenden<br />
Schulen systematisch mit den sozioækonomischen<br />
Grundlagen fçr eine erfolgreiche Lebensbewåltigung<br />
vertraut gemacht werden und damit<br />
auch anschlussfåhig sind fçr ein diesbezçgliches<br />
lebenslanges Lernen. 1<br />
Aktuelle Anstæûe fçr die Forderung nach einer<br />
grundlegenden sozioækonomischen Allgemeinbildung<br />
stehen im Zusammenhang mit der neueren<br />
Armutsforschung und der Umsetzung in konkrete<br />
Maûnahmen zur Armutspråvention. Empirische<br />
Studien zur Sozialhilfeabhångigkeit sowie zur<br />
Ûberschuldung privater Haushalte belegen, dass<br />
Verarmungsprozesse håufig nicht nur mit Problemen<br />
am <strong>Arbeit</strong>smarkt, sondern auch mit<br />
fehlenden Kompetenzen fçr die Gestaltung des<br />
Familienlebens und der Haushaltsfçhrung zusammenhången<br />
± angefangen von der Bedçrfnisreflexion<br />
und der Bedarfsabstimmung im Haushalt<br />
çber die Mobilisierung und den Einsatz von Ressourcen<br />
fçr die Familienarbeit und Haushaltspro-<br />
Ûberarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Bildungskonferenz<br />
der Deutschen Gesellschaft fçr Hauswirtschaft in<br />
Mçnster am 18. Juni 2002.<br />
1 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu auch den Beitrag<br />
von Lothar Krappmann in dieser Ausgabe.<br />
Zum Wandel der Úkonomie des Alltags<br />
duktion bis zur Kontrolle des Ausgabenverhaltens.<br />
2<br />
Das zuletzt genannte Ursachenbçndel fçr defizitåre<br />
Versorgungslagen bis hin zu Armut kann<br />
durch entsprechende nachsorgende Bildung von<br />
jçngeren und ålteren Erwachsenen weitgehend<br />
aufgelæst werden, wie die Projekte der Konzertierten<br />
Aktion der Hauswirtschafts- und Wohlfahrtsverbånde<br />
zur Armutspråvention zeigen. 3 Dass z. B.<br />
ungeplante, kumulierende Verschuldung eher in<br />
eine Ûberschuldung fçhrt als eine kontrollierte<br />
Kreditaufnahme, ist evident. Erwiesen ist, dass<br />
Ver- und Ûberschuldung privater Haushalte seit<br />
Jahren zunehmen. Die Zahl der çberschuldeten<br />
Privathaushalte, die ihre Verbindlichkeiten weder<br />
aus Vermægen noch aus laufendem Einkommen<br />
abtragen kænnen, stieg qualifizierten Schåtzungen<br />
zufolge von 1994 bis 1999 in Westdeutschland von<br />
1,5 Millionen auf 1,9 Millionen und in Ostdeutschland<br />
von 0,5 Millionen auf 0,8 Millionen. 4 Schåtzungsweise<br />
rund 850 000 Jugendliche haben<br />
Schulden, vor allem bei Freunden, Verwandten,<br />
Geldinstituten, Mobiltelefonanbietern und Netzbetreibern;<br />
und rund 250 000 Jugendliche sind<br />
vermutlich çberschuldet. 5<br />
2 Vgl. Michael-Burkhard Piorkowsky, Verarmungsgrçnde<br />
und Ansåtze der Armutspråvention bei Privathaushalten, in:<br />
Bundesministerium fçr Familie, Senioren, Frauen und Jugend<br />
(Hrsg.), Lebenslagen von Familien und Kindern. Dokumentation<br />
von Expertisen und Berichten, die im Auftrag<br />
des Bundesministeriums fçr Familie, Senioren, Frauen und<br />
Jugend im Rahmen der Erstellung des Ersten Armuts- und<br />
Reichtumsberichts der Bundesregierung erarbeitet wurden,<br />
Materialien zur Familienpolitik, Nr. 11, Berlin 2001.<br />
3 Vgl. ders., Armutspråvention durch Bildung fçr Haushalt<br />
und Familie, in: Haushalt & Bildung, 77 (2000) 3, S. 129±132;<br />
ders., Das Armutsprophylaxeprogramm der deutschen Bundesregierung.<br />
Ein Beispiel fçr den aktivierenden Sozialstaat,<br />
in: Reinbert Schauer/Robert Purtschert/Dieter Witt (Hrsg.),<br />
Nonprofit-Organisationen und gesellschaftliche Entwicklung:<br />
Spannungsfeld zwischen Mission und Úkonomie, Linz<br />
2002.<br />
4 Vgl. Bundesministerium fçr <strong>Arbeit</strong> und Sozialordnung<br />
(Hrsg.), Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und<br />
Reichtumsbericht der Bundesregierung, Berlin, April 2002,<br />
S. 69.<br />
5 Vgl. Evelyn Binder, Kinder werden mit Schulden groû.<br />
Immer mehr Jugendliche leben auf Pump. Wenig Sinn fçr<br />
Wert des Geldes, in: Kælner Stadt-Anzeiger vom 11. Juni<br />
2002, S. 29.<br />
7 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
Weitere Anstæûe liefert die seit Jahren laufende<br />
Diskussion çber ækonomischen, insbesondere<br />
finanzwirtschaftlichen ¹Analphabetismusª. 6 Verschiedene<br />
Erhebungen und Einschåtzungen von<br />
Experten deuten darauf hin, dass die meisten<br />
Bçrgerinnen und Bçrger z. B. nicht genau wissen,<br />
wie die Banken arbeiten, wie die Bærse funktioniert<br />
und wie das Rentensystem aufgebaut ist.<br />
Viele kænnen nicht zwischen einer Kapitallebensversicherung<br />
und einer Risikolebensversicherung<br />
unterscheiden. Etliche kænnen nicht erklåren, was<br />
der Effektivzins eines Kredits ist. Und manche<br />
junge Menschen, die erstmals ein Girokonto eræffnen,<br />
glauben sogar, der Dispositionskredit, der auf<br />
dem Kontoauszug ausgewiesen wird, gehære<br />
ihnen. Tatsåchlich sind wir fast alle finanzwirtschaftliche<br />
Analphabeten. Denn es gibt kein Fach<br />
oder Lernfeld ¹Finanzenª in den allgemein bildenden<br />
Schulen. Doch die Bildungslçcke låsst sich<br />
nicht allein durch finanzielle Allgemeinbildung<br />
schlieûen. Das Problem liegt tiefer, und seine<br />
Læsung bedarf deshalb eines gut durchdachten<br />
Konzeptes. Finanzentscheidungen sind eingebettet<br />
in die Úkonomie des Alltags. Und dieser Alltag<br />
stellt zunehmend neue, radikale Anforderungen,<br />
die mit den herkæmmlichen Kompetenzen und Bildungskonzepten<br />
kaum zu bewåltigen sind.<br />
II. Das Konzept der<br />
Neuen Hauswirtschaft<br />
Individuelle Lebensgestaltung und gesellschaftliche<br />
Wohlfahrtsproduktion sind untrennbar miteinander<br />
verbunden. Das war schon immer so. Aber<br />
im Zuge des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses<br />
gewinnen die Entscheidungen der Individuen<br />
bzw. der Haushalte und Familien, in denen<br />
sich die Einzelnen grundlegend organisieren und<br />
entwickeln, zunehmend an Bedeutung fçr die<br />
sozioækonomische Makrostruktur. Diese Einsicht<br />
basiert auf einer empirisch fundierten Theorie des<br />
Privathaushalts, die den Wandlungen von der<br />
modernen zur postmodernen Gesellschaft nachspçrt,<br />
sowie auf dem erkenntnistheoretischen<br />
Konzept des methodologischen Individualismus,<br />
der von einer strukturgebenden Funktion der Indi-<br />
6 Vgl. Rçdiger von Rosen, Wir brauchen ein Schulfach<br />
Wirtschaft, in: Frankfurter Rundschau vom 25. Mårz 1998,<br />
S. 24; Udo Reifner, Finanzielle Allgemeinbildung. Bildung<br />
als Mittel der Armutspråvention in der Kreditgesellschaft.<br />
Projektabschlussbericht zur ersten Phase des vom Bundesministerium<br />
fçr Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstçtzten<br />
Projekts, Institut fçr Finanzdienstleistungen e. V.,<br />
Hamburg, 22. 10. 2001; Marc Brost/Marcus Rohwetter, Wir<br />
alle ± finanzielle Analphabeten, in: Die Zeit vom 31. Oktober<br />
2002, S. 19 ± 20.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
viduen und Kleingruppen fçr die Gesellschaft ausgeht.<br />
7<br />
Der Begriff der Postmoderne ist schillernd. Er soll<br />
hier nicht ausfçhrlich erærtert werden. 8 Dass sich<br />
Wandlungen in zentralen gesellschaftlichen Bereichen<br />
vollziehen, ist unçbersehbar. Klar ist aber<br />
auch, dass es gegenwårtig keine vollståndige Ablæsung<br />
der Moderne durch die Postmoderne gibt,<br />
sondern neue Elemente, Systeme, Strukturen und<br />
Funktionen zunehmend an prågender Kraft gewinnen.<br />
Haushalte und Familien sind grundlegende<br />
und universelle Organisationsformen der Menschen<br />
fçr die unmittelbare Lebensgestaltung; und<br />
es sind die åltesten Institutionen çberhaupt. Aber<br />
die Formen und Funktionen der Haushalts- und<br />
Familiensysteme variieren historisch und kulturell<br />
erheblich. In einem agrarisch oder auch industriell<br />
geprågten Obrigkeitsstaat kommt ihnen eine<br />
andere Rolle zu als in einem modernen Sozialstaat.<br />
Gegenwårtig finden wir zur Kennzeichnung<br />
der Makroebene von Wirtschaft und Gesellschaft<br />
¹postmoderneª Zuschreibungen, wie Bçrgergesellschaft,<br />
Multioptionsgesellschaft und Wissensgesellschaft.<br />
Die Haushalts- und Familienforschung konstatiert<br />
eine Pluralisierung der Lebensformen und eine<br />
Individualisierung der Lebensverlåufe, verbunden<br />
mit einer Håufung aufeinander folgender Lebensabschnittsgemeinschaften<br />
und einem Rçckgang<br />
der Geburtenrate. 9 Institute und Kommissionen<br />
fçr <strong>Zukunft</strong>sfragen sehen uns bereits auf dem Weg<br />
von der ¹arbeitnehmerzentrierten Industriegesellschaft<br />
zur unternehmerischen Wissensgesellschaftª<br />
und propagieren ein ækonomisches Leitbild des<br />
Menschen als ¹Unternehmer seiner <strong>Arbeit</strong>skraft<br />
und Daseinsvorsorgeª. 10 Úffentlich gefordert und<br />
gefærdert wird seit Jahren eine ¹Neue Kultur der<br />
Selbstståndigkeitª, also die wachsende Bereitschaft<br />
zur Unternehmensgrçndung, z. B. mit der<br />
Initiative ¹Go!ª in Nordrhein-Westfalen. Und tatsåchlich<br />
entlåsst der Sozialstaat zunehmend seine<br />
Bçrgerinnen und Bçrger aus Versorgungs- und<br />
7 Vgl. Gçnter Bçschges, Methodologischer Individualismus<br />
und empirische Soziologie, in: ders./Werner Raub (Hrsg.),<br />
Soziale Bedingungen ± Individuelles Handeln ± Soziale Konsequenzen,<br />
Frankfurt/M. 1985.<br />
8 Vgl. dazu Michael-Burkhard Piorkowsky, Strukturwandel<br />
und gesellschaftliche Leistungspotentiale von Haushalten<br />
und Familien, in: Irmhild Kettschau/Barbara Methfessel/Michael-Burkhard<br />
Piorkowsky (Hrsg.), Familie 2000. Bildung<br />
fçr Familien und Haushalte zwischen Alltagskompetenz und<br />
Professionalitåt. Europåische Perspektiven, Baltmannsweiler<br />
2000.<br />
9 Vgl. ebd., S. 20 ± 24.<br />
10 Vgl. Kommission fçr <strong>Zukunft</strong>sfragen der Freistaaten<br />
Bayern und Sachsen (Hrsg.), Erwerbståtigkeit und <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
in Deutschland. Entwicklung, Ursachen, Maûnahmen.<br />
Teil III. Maûnahmen zur Verbesserung der Beschåftigungslage,<br />
Bonn, November 1997, S. 7.<br />
8
Versicherungssystemen und mahnt mehr Eigenverantwortung<br />
an.<br />
Beispielhaft seien aktuelle Maûnahmen und Ûberlegungen<br />
in den Bereichen Alterssicherung,<br />
<strong>Arbeit</strong>smarkt und Gesundheitswesen angesprochen:<br />
± In einer Informationsschrift zur Riester-Rente,<br />
die vor wenigen Monaten in zahlreichen Publikumszeitschriften<br />
eingeklebt war, heiût es:<br />
¹Prçfen Sie, ob und wie viel Sie fçr die neue<br />
Eigenvorsorge anlegen wollen. Klåren Sie, wie<br />
lange Sie noch ansparen kænnen und welche<br />
Anlagerisiken Sie in Kauf nehmen wollen.ª 11<br />
± Der neue Vorsitzende der Bundesanstalt fçr<br />
<strong>Arbeit</strong>, Florian Gerster, wird in einem Interview<br />
mit den Worten zitiert: ¹Wir brauchen ein<br />
biûchen Deregulierung.ª 12 Parallel dazu liefert<br />
die Hartz-Kommission mit den Konzepten der<br />
¹Ich-AGª und der ¹Familien-AGª den Rahmen<br />
fçr die Grçndung und Entwicklung von<br />
Miniunternehmen aus der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit. 13<br />
± Und die Bundesgesundheitsministerin Ulla<br />
Schmidt will mçndige Patientinnen und Patienten,<br />
die nicht nur vorsorgend etwas fçr ihre<br />
Gesundheit tun, sondern auch im Krankheitsfall<br />
den Behandlungsprozess ¹mitsteuern und<br />
nachfragen, was eigentlich berechnet wurdeª. 14<br />
Die sich damit wandelnde Úkonomie des Alltags<br />
wird hier als ¹Neue Hauswirtschaftª verstanden.<br />
Das bedeutet faktisch eine Zunahme an ækonomischer<br />
Funktionszuschreibung und Verantwortung<br />
der Individuen, Paarhaushalte und Familien ±<br />
unabhångig davon, ob sie es wollen oder nicht:<br />
zunåchst und unmittelbar mit ihren selbst organisierten<br />
Privathaushalten fçr die eigene Versorgung<br />
und sodann in der strukturgebenden Funktion fçr<br />
das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Dabei<br />
handelt es sich um eine ± ganz çberwiegend unbeabsichtigte<br />
± Folge der individuellen Entscheidungen<br />
fçr bzw. gegen bestimmte Lebensstile und<br />
Lebensformen, Bildungswege und Erwerbsbeteiligungen,<br />
Konsummuster und Freizeitaktivitåten<br />
sowie Vermægensdispositionen und sonstige Engagements.<br />
11 Bundesministerium fçr <strong>Arbeit</strong> und Sozialordnung<br />
(Hrsg.), Rund um die neue Rente. Ihre Fragen ± unsere Antworten,<br />
Berlin 2002, S. 20.<br />
12 Florian Gerster, ¹Wir brauchen ein biûchen Deregulierungª,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom<br />
31. Mårz 2002, S. 5.<br />
13 Vgl. Peter Hartz u. a., Moderne Dienstleistungen am<br />
<strong>Arbeit</strong>smarkt. Bericht der Kommission, Berlin 2002, S. 161 ±<br />
172.<br />
14 Vgl. Ulla Schmidt, ¹Kranksein ist keine Privatsacheª, in:<br />
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 24. Februar<br />
2002, S. 37.<br />
Der Begriff ¹Hauswirtschaftª ist mit Bedacht<br />
gewåhlt worden. Der traditionelle Begriff der<br />
Hauswirtschaft entspricht den åquivalenten<br />
Grundbegriffen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft<br />
in den ækonomischen Schwesterdisziplinen.<br />
Dass sich die so bezeichneten Realphånomene seit<br />
der Einfçhrung der Begriffe vor etwa 100 Jahren<br />
veråndert haben, ist wohl selbstverståndlich. Aber<br />
keine der drei Wirtschaftsdisziplinen <strong>hat</strong> ihren<br />
spezifischen Begriff aufgegeben. Die Betonung<br />
des Neuen schlieût an vergleichbare Kennzeichnungen<br />
wie New Economy, New Public Management<br />
und Neue Selbstståndigkeit an. Mit dem<br />
Begriff der Neuen Hauswirtschaft sollen folglich<br />
± wie im Begriff der Postmoderne ± alte und neue<br />
Strukturen und Funktionen repråsentiert werden.<br />
Das Konzept der Neuen Hauswirtschaft wird im<br />
Folgenden durch zwei Kernaussagen konkretisiert:<br />
1. Die Privathaushalte çben durch Gçternachfrage,<br />
Haushaltsproduktion und Faktorangebot<br />
einen prågenden Einfluss auf die sozioækonomische<br />
Makrostruktur aus.<br />
2. Die Privathaushalte sind die Hauptproduzenten<br />
von Humanvermægen und damit die wichtigsten<br />
sozioækonomischen Institutionen çberhaupt.<br />
III. Gçternachfrage, Produktion<br />
und Faktorangebot der Haushalte<br />
prågen die sozioækonomische<br />
Makrostruktur<br />
Zunåchst sei die Funktion der Haushalte als Nachfrager<br />
nach privaten und æffentlichen Gçtern<br />
nåher betrachtet. Die Haushalte treffen zum einen<br />
± gemåû ihren Pråferenzen und Finanzierungsmæglichkeiten<br />
und selbstverståndlich nicht ohne<br />
Einflçsse aus den sozialen Bezugsfeldern einschlieûlich<br />
der Werbung ± Entscheidungen çber<br />
die Gestaltung ihres privaten Konsums und<br />
beschaffen die von den Unternehmen angebotenen<br />
Waren und Dienste sowie Immobilien. In der<br />
Verwendungsrechnung des Sozialprodukts, in der<br />
± im Gegensatz zur Entstehungsrechnung (!) ± die<br />
Aktivitåten der Haushalte verbucht werden, entfallen<br />
knapp 60 Prozent auf den privaten Konsum,<br />
also auf solche Gçter, die von den Haushalten<br />
selbst bezahlt werden. Sie steuern damit zum<br />
einen in gewisser Weise die Produktion sowie<br />
± zumindest teilweise ± die Beschåftigung und Investition,<br />
und zwar auch in den vorgelagerten<br />
Wirtschaftsbereichen, und erzeugen ¹Konsumwellenª,<br />
wenn sich das Verbraucherverhalten kollek-<br />
9 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
tiv åndert. Zum anderen treten die Haushalte bzw.<br />
die erwachsenen Haushaltsmitglieder als Wahlbçrger<br />
im politischen Prozess auf und steuern durch<br />
ihre Wahlentscheidungen, wenn auch nur indirekt,<br />
die Produktion und Bereitstellung spezifisch<br />
æffentlicher Gçter und damit zusammenhångender<br />
Dienste, z. B. die kommunale Infrastruktur und<br />
æffentliche Sicherheit.<br />
Die Ausgaben fçr langlebige Konsumgçter einschlieûlich<br />
Immobilien sowie die Ersparnisse bzw.<br />
Finanzanlagen fçhren zu einem entsprechenden<br />
Vermægensaufbau. Je nach den berçcksichtigten<br />
Vermægenskomponenten und den Wertansåtzen<br />
lassen sich unterschiedliche Græûenordnungen<br />
ermitteln, die fçr den Haushaltssektor insgesamt<br />
bis zu rund 7,7 Billionen Euro betragen. 15 Als Indikator<br />
der Finanzierungsfunktion der Privathaushalte<br />
fçr die Unternehmen wird ihr Anteil an der<br />
gesamtwirtschaftlichen Ersparnis betrachtet, der<br />
etwa vier Fçnftel betrågt. 16 Damit sind die Privathaushalte<br />
indirekt der græûte Kapitalgeber der<br />
Unternehmen.<br />
Private Haushalte investieren aber nicht nur indirekt<br />
çber den Bankensektor in fremde Unternehmen,<br />
sondern auch unmittelbar in eigene, selbst<br />
gegrçndete Unternehmen. Die meisten Unternehmensgrçndungen<br />
finden nåmlich nicht an der<br />
Bærse, sondern im Haushalts- und Familienkontext<br />
statt. 17 Es kann davon ausgegangen werden,<br />
dass die jåhrlich etwa 300 000 Ûbergånge in selbstståndige<br />
Erwerbståtigkeit in rund 50 Prozent der<br />
Fålle als Kleinstunternehmen ohne weitere Beschåftigte<br />
vollzogen werden; in rund 40 Prozent<br />
der Fålle mit weniger als fçnf Mitarbeitern und in<br />
rund 10 Prozent der Fålle mit fçnf und mehr Mitarbeitern.<br />
Damit stellen die Grçnder und Grçnderinnen<br />
fçr sich und andere Erwerbsarbeitsplåtze<br />
bereit und tragen folglich zur gesamtwirtschaftlichen<br />
Beschåftigung bei. Zwar werden Unternehmen<br />
auch von abgeleiteten Betrieben, also von<br />
Unternehmen und Verbånden, gegrçndet, aber die<br />
zahlenmåûig bei weitem wichtigsten Unternehmensgrçnder<br />
sind die Privathaushalte. Gemessen<br />
an der Zahl der Unternehmen sind ebenfalls<br />
Privathaushalte bzw. die jeweiligen Haushaltsmitglieder<br />
die mit Abstand græûte Gruppe der Eigentçmer<br />
von Unternehmen. Nach Ergebnissen des<br />
Mikrozensus 2000 waren rund 3,6 Millionen Erwerbståtige<br />
± das waren rund zehn Prozent der<br />
15 Vgl. Jærg Sieweck, Unterschåtzter Wirtschaftsfaktor privater<br />
Haushalt, in: Sparkasse. Zeitschrift des Deutschen<br />
Sparkassen- und Giroverbandes, 116 (1999) 10, S. 465 ± 469.<br />
16 Vgl. ebd., S. 465.<br />
17 Vgl. Michael-Burkhard Piorkowsky, Die Evolution von<br />
Unternehmen im Haushalts- und Familienkontext, in:<br />
Zeitschrift fçr Betriebswirtschaft, Ergånzungsheft, (2002) 5,<br />
S. 1±19.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
Erwerbståtigen ± selbstståndig, und zwar çberwiegend<br />
in Miniunternehmen, die mit den privaten<br />
Haushalten der Unternehmer bzw. Unternehmerinnen<br />
eine sozioækonomische Einheit bilden und<br />
deshalb nicht losgelæst von den Hauswirtschaften<br />
betrachtet werden kænnen.<br />
Auch im Vereins- und Verbandssektor çberwiegen<br />
zahlenmåûig nicht die groûen, sondern die kleinen<br />
Einheiten. Und etliche groûe Organisationen<br />
haben sich aus kleinen, nicht selten informellen<br />
Zusammenschlçssen entwickelt. Privathaushalte<br />
bzw. Haushaltsmitglieder sind hier als Vereinsgrçnder<br />
und Tråger informeller Netzwerke von<br />
Bedeutung. Allein die Zahl der Bçrgerinitiativen<br />
und Selbsthilfeprojekte kann mit mindestens<br />
40 000 bis 60 000 beziffert werden; der durchschnittliche<br />
Mitgliederbestand betrågt zwischen 15<br />
und 35 Personen. In solchen Projekten sind prinzipiell<br />
¹Menschen wie du und ichª die ¹Macherinnenª<br />
und ¹Macherª. Durch das Engagement in<br />
Vereinen und Verbånden tragen die Privathaushalte<br />
folglich auch zur Bereitstellung kollektiver,<br />
gruppenbezogener Gçter bei. 18<br />
Schlieûlich sei hier der Beitrag der Privathaushalte<br />
zur Produktion personaler Gçter fçr den unmittelbaren<br />
Konsum hervorgehoben. Die Haushaltsproduktion<br />
ist auch in modernen und postmodernen<br />
Gesellschaften nicht marginal, sondern<br />
± gemessen am Zeitinput ± sogar dominant. Wird<br />
die gesamte gesellschaftliche <strong>Arbeit</strong>szeit betrachtet,<br />
also Erwerbs- und Haushaltsarbeitszeit einschlieûlich<br />
Ehrenamt, ergibt sich ein Volumen von<br />
etwa 124 Milliarden Stunden (1991/92); davon<br />
entfallen rund 60 Prozent auf Haushaltsarbeit und<br />
rund 40 Prozent auf Erwerbsarbeit. 19<br />
IV. Prokreation, Haushaltsproduktion<br />
und Konsum dienen<br />
der Humanvermægensbildung<br />
Private Konsumgçter, æffentliche Gçter und Haushaltsarbeit<br />
dienen nach herkæmmlicher Vorstellung<br />
dem Konsum im Sinne eines letzten Verbrauchs.<br />
Aber tatsåchlich handelt es sich nicht um<br />
18 Vgl. Adalbert Evers, Part of the welfare mix: the third<br />
sector as an intermediate area, in: Voluntas, 6 (1995) 2,<br />
S. 159±182; Burkhard von Velsen-Zerweck, Dynamisches<br />
Verbandsmanagement. Phasen- und krisengerechte Fçhrung<br />
von Verbånden. Mit einem Geleitwort von Dieter Witt und<br />
Ernst-Bernd Blçmle, Wiesbaden 1998, S. 71 ± 72.<br />
19 Vgl. Bundesministerium fçr Familie und Senioren/Statistisches<br />
Bundesamt (Hrsg.), Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung<br />
der Bevælkerung in Deutschland, Wiesbaden<br />
1994, S. 1.<br />
10
endgçltigen Gçterverbrauch, sondern um Input in<br />
die Bildung von Humanvermægen. Zu den traditionellen<br />
Familienfunktionen zåhlen die auf<br />
Nachwuchssicherung gerichtete prokreative oder<br />
generative Funktion (Zeugung), die Sozialisationsfunktion<br />
(Erziehung) und die ækonomische Funktion<br />
(Versorgung). Es gehært zu den biologischen<br />
Gegebenheiten, dass die Menschen ihren Nachwuchs<br />
selber produzieren. Die Aufgabe der Sicherung<br />
und Pflege des Nachwuchses besteht aber<br />
keineswegs allein darin, schiere <strong>Arbeit</strong>skraft in der<br />
Generationenfolge zu reproduzieren, sondern in<br />
der ¹Produktionª von Humanvermægen, also von<br />
Wissen, Fåhigkeiten und Fertigkeiten, die das<br />
ækonomische, soziale und kulturelle Vermægen<br />
menschlicher Gesellschaften ausmachen. Da die<br />
Sicherung und der Ausbau des Wissens das kritische<br />
Problem jeder Gesellschaft ist, erfçllen die<br />
Haushalte damit die wichtigste Aufgabe im gesellschaftlichen<br />
Gefçge çberhaupt.<br />
In modernen und postmodernen Gesellschaften<br />
werden die Funktionen der Prokreation und Sozialisation<br />
nicht mehr nur von den Kernfamilienhaushalten<br />
erfçllt. Die Vernetzung mit einer Vielzahl<br />
externer Institutionen ist unçbersehbar und auch<br />
unverzichtbar, angefangen von der Geburtsmedizin<br />
çber allgemein bildende und berufsbildende<br />
Schulen bis hin zu Unternehmen und Universitåten.<br />
Aber dennoch werden auch weiterhin die<br />
Haushalte in einem sehr grundlegenden und<br />
umfassenden Sinn die ¹Hauptproduzenten von<br />
Menschenª als soziale Wesen bleiben. Denn ohne<br />
primåre Sozialisation in den auf Intimitåt und permanente<br />
Kommunikation çber viele Jahre angelegten<br />
Kontexten der Binnensysteme der Haushalte<br />
und Familien kænnen die Fåhigkeiten zu<br />
Wissenserwerb und Wissensanwendung in den<br />
ståndig komplexer werdenden Bereichen von<br />
Wirtschaft und Gesellschaft nicht hinreichend<br />
erlernt werden. 20<br />
Um eine Vorstellung von der Bedeutung des<br />
Humanvermægens in ækonomischen Græûen zu<br />
gewinnen, ist von der Familienberichtskommission<br />
der Bundesregierung eine Modellrechnung durchgefçhrt<br />
worden. Bezugsgræûe war der Geburtsjahrgang<br />
1984, der im Jahr 1990 rund 633 000 Personen<br />
umfasste. Berçcksichtigt wurden die jåhrlichen<br />
Ausgaben fçr Konsumgçterkåufe und anteilig<br />
bewertete Leistungen der Haushaltsproduktion,<br />
die fçr die nachwachsende Generation bis zum<br />
19. Lebensjahr aufgewendet werden. Der so ermittelte<br />
Beitrag der Familien zur Humanvermægensbildung<br />
betrågt rund 7,7 Billionen Euro. Demgegençber<br />
betrågt der geschåtzte Wert des repro-<br />
20 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu den Beitrag von<br />
Lothar Krappmann in dieser Ausgabe.<br />
duzierbaren Sachvermægens zu Wiederbeschaffungspreisen<br />
lediglich rund 3,6 Billionen Euro. 21<br />
Humanvermægensbildung ist aber nicht nur das<br />
Ergebnis von Prokreation und Sozialisation, sondern<br />
generell das Resultat von Haushaltsproduktion<br />
und Konsum ± oder sollte dies zumindest sein.<br />
Gçterkonsum ist keine Gçtervernichtung, sondern<br />
dient der Erhaltung und Entwicklung der<br />
Vitalfunktionen der Haushaltsmitglieder, d. h. der<br />
Kompensation des permanenten Energieabflusses<br />
und dem Wachstum sowie der Gewinnung von<br />
Lebenszufriedenheit. Es kænnte zwar in Zweifel<br />
gezogen werden, dass jede Art konsumtiver Tåtigkeit<br />
zur Bildung von Humanvermægen fçhrt, z. B.<br />
bestimmte Arten von Medienkonsum, aber dieser<br />
Einwand gilt gleichermaûen fçr (vermeintlich)<br />
produktive Aktivitåten, z. B. bestimmte Verwaltungsarbeiten,<br />
und ist nur schwer zu prçfen. Tatsåchlich<br />
wird prinzipiell auch durch <strong>Arbeit</strong>, insbesondere<br />
Erwerbsarbeit, Humanvermægen gebildet,<br />
aber ohne Konsum ist <strong>Arbeit</strong> unmæglich.<br />
Aus einer nicht der ækonomischen Modelltradition<br />
folgenden Sicht ist sowohl die Differenzierung zwischen<br />
produzierenden Unternehmen und konsumierenden<br />
Haushalten als auch die Vorstellung,<br />
Produktion sei Gçtererzeugung und Konsum sei<br />
Gçtervernichtung, als zumindest einseitig zu beurteilen<br />
und zurçckzuweisen. Denn jeder Produktionsprozess<br />
ist ein Transformationsprozess, in dem<br />
die Einsatzgçter untergehen, um neue, andersartige<br />
Produkte hervorzubringen. Dass dies nur fçr<br />
Unternehmen und andere abgeleitete Betriebe,<br />
aber nicht fçr Privathaushalte gelten soll, ist Ausdruck<br />
eines veralteten Theorieverståndnisses. Hier<br />
wird der entgegengesetzte Standpunkt vertreten,<br />
dass sich nåmlich die Privathaushalte von vorgelagerten<br />
Betrieben lediglich mit Vorleistungen fçr<br />
ihren Haushaltsprozess versorgen, die Endkombination<br />
in einem arteigenen Haushaltsproduktionsprozess<br />
vornehmen und den Konsum organisieren,<br />
um Humanvermægen und Lebenszufriedenheit zu<br />
produzieren. Konsum ist demnach ± in Abwandlung<br />
einer von Josef Alois Schumpeter zur Charakterisierung<br />
von Kapitalvernichtung im Wettbewerb<br />
geprågten Metapher ± ein ¹Prozess der<br />
schæpferischen Zerstærungª bzw. sollte in diesem<br />
Sinne gestaltet werden kænnen. 22 Dazu bedarf es<br />
21 Vgl. Deutscher Bundestag, Familien und Familienpolitik<br />
im geeinten Deutschland. <strong>Zukunft</strong> des Humanvermægens.<br />
Fçnfter Familienbericht, Bundestags-Drucksache 12/7560,<br />
Bonn 1994, S. 144 ± 145.<br />
22 Vgl. Josef A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und<br />
Demokratie. Einleitung von Edgar Salin, zweite, erw. Aufl.,<br />
Mçnchen 1950, S. 134±142; vgl. dazu Michael-Burkhard<br />
Piorkowsky, Konsum aus Sicht der Haushaltsækonomik, in:<br />
Doris Rosenkranz/Norbert F. Schneider (Hrsg.), Konsum.<br />
Soziologische, ækonomische und psychologische Perspektiven,<br />
Opladen 2000.<br />
11 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
einer entsprechenden Bildung und håufig auch<br />
einer ergånzenden Beratung.<br />
V. Private Haushalte in der<br />
schulischen Allgemeinbildung<br />
In der auf Haushalt und Wirtschaft bezogenen<br />
schulischen Allgemeinbildung wird dies alles vællig<br />
unzureichend reflektiert, denn die Lehrplåne und<br />
Schulbçcher sind defizitår. 23 In der Primarstufe<br />
kænnen wirtschaftliche Themen lediglich aspekthaft<br />
im Sachunterricht behandelt werden. In den<br />
Sekundarstufen I und II gibt es in den Bundeslåndern<br />
nach Inhalt und Verpflichtungsgrad unterschiedliche<br />
Angebote von Fåchern mit wirtschaftlichem<br />
Inhalt. Das Fach Hauswirtschaft<br />
beschrånkt sich weitgehend auf die Betrachtung<br />
des Binnensystems des Privathaushalts und die<br />
Beschaffung von Marktgçtern. Ein Fach oder<br />
Lernfeld ¹Wirtschaftª ist eher die Ausnahme als<br />
die Regel. Was gegebenenfalls diesbezçglich an<br />
Gymnasien angeboten wird, zeigt eine Analyse<br />
der Lehrplåne fçr Gymnasien der 16 Bundeslånder.<br />
Die paradigmatische Ausrichtung und inhaltliche<br />
Konzeption der ækonomischen Bildung in den<br />
Wirtschaftsfåchern wird dort wie folgt zusammengefasst:<br />
1. Konsum und Markt, 2. (Erwerbs-)<br />
<strong>Arbeit</strong> und Produktion, 3. Gesamtwirtschaftliche<br />
Ungleichgewichte und Wirtschaftspolitik, 4.<br />
Soziale und ækologische Probleme, 5. Internationale<br />
Wirtschaftsbeziehungen. 24<br />
Das gegenwårtig dominierende Bild von Haushalt<br />
und Familie in den Wirtschaftsfåchern und den<br />
wirtschaftsnahen Fåchern ist an der Normalfamilie<br />
und dem Normalarbeitsverhåltnis mit sozialstaatlicher<br />
Absicherung der Risiken bei <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
und Krankheit sowie im Alter orientiert.<br />
23 Vgl. Hildegard Rapin (Hrsg.), Der private Haushalt im<br />
Unterricht. Eine Schulbuchanalyse aus haushaltswissenschaftlicher<br />
und didaktischer Sicht, Frankfurt/M. ± New York<br />
1990; Deutsche Gesellschaft fçr Hauswirtschaft e. V., <strong>Arbeit</strong>smaterialien<br />
zur Bildung fçr den Haushalt. Ûbersicht<br />
çber Wochenstundenzahlen sowie Themen und Inhalte des<br />
auf den Haushalt bezogenen Unterrichts in Richtlinien und<br />
Lehrplånen fçr die Sekundarstufe I in den Låndern der Bundesrepublik<br />
Deutschland, dritte, çberarb. und erw. Aufl.,<br />
Aachen, Oktober 1992; Sekretariat der Ståndigen Konferenz<br />
der Kultusminister der Lånder in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, Wirtschaftliche Bildung an allgemein bildenden<br />
Schulen. Bericht der Kultusministerkonferenz vom 19. 10.<br />
2002, Berlin o. J.<br />
24 Vgl. Hans Jçrgen Schlæsser/Birgit Weber, Wirtschaft in<br />
der Schule. Eine umfassende Analyse der Lehrplåne fçr<br />
Gymnasien, entstanden im Rahmen des Pilotprojekts<br />
¹Wirtschaft in die Schule!ª, mit einem Beitrag von Hans Kaminski,<br />
Bertelsmann Stiftung/Heinz Nixdorf Stiftung/Ludwig-Erhard-Stiftung<br />
(Hrsg.), Gçtersloh 1999.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
Betrachtet wird somit die Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft<br />
von Eltern mit Kindern,<br />
abhångig vollzeitbeschåftigtem Hauptverdiener<br />
mit hauptverantwortlich haushaltsfçhrender Partnerin<br />
und ± hinsichtlich der Konsum- und Finanzwirtschaft<br />
± die Ausgabenseite des Geldbudgets.<br />
Idealerweise sind die Haushaltsmitglieder folglich<br />
Nachfrager von Konsumgçtern und Erwerbsarbeitsplåtzen,<br />
sie erfçllen ihre Rollen im Beruf<br />
sowie im hauswirtschaftlichen Bereich und in der<br />
Familie und stçtzen sich dabei auf die materielle<br />
Infrastruktur und die monetåren Transfers des<br />
Sozialstaats.<br />
Auch in Reformvorschlågen von Wirtschaftsverbånden<br />
bleiben die oben angesprochenen Wandlungen<br />
von der modernen ¹Vollkasko-Gesellschaftª<br />
(Kurt H. Biedenkopf) zur postmodernen<br />
Gesellschaft mit eigenverantwortlichen Hauswirtschaften<br />
ganz weitgehend unberçcksichtigt. 25 Private<br />
Haushalte, auch Familienhaushalte, werden<br />
lediglich als ¹Elementeª eines Wirtschaftskreislaufs<br />
in ihren Funktionen als <strong>Arbeit</strong>nehmer und<br />
Konsumenten betrachtet. In dem zu Grunde gelegten<br />
traditionellen Modell des Gçter- und Geldkreislaufs<br />
zwischen Haushalten und Unternehmen<br />
werden ausschlieûlich ækonomische Transaktionen<br />
betrachtet, die mit Geldstræmen verbunden sind.<br />
Haushalte und Unternehmen sind immer schon<br />
vorhanden. Getauscht werden <strong>Arbeit</strong> gegen Geld<br />
und Geld gegen Konsumgçter. Haushaltsproduktion<br />
und Bildung von Humanvermægen werden<br />
nicht berçcksichtigt. Vereine, Verbånde, Selbsthilfegruppen<br />
und nachbarschaftliche soziale Netze<br />
kommen nicht vor. Dies entspricht einem nicht<br />
mehr zeitgemåûen Bild der Wirtschaft: Mehr als<br />
die Hålfte der ækonomischen Ressourcen und<br />
Transaktionen bleibt unberçcksichtigt, und dies<br />
betrifft sogar den wichtigeren Teil.<br />
Damit aber die Schçlerinnen und Schçler zunehmend<br />
ihren individuellen Lebensweg gestalten und<br />
die damit zusammenhångenden gesellschaftlichen<br />
Funktionen erkennen und erfçllen kænnen, benætigen<br />
sie nicht nur partielles Instrumentalwissen,<br />
sondern ± zunåchst und grundlegend ± Orientierungswissen.<br />
Die Orientierung muss in der Aufklårung<br />
çber die Voraussetzungen und Folgen der<br />
25 Vgl. Rçdiger von Rosen/Deutsches Aktieninstitut e. V.<br />
(Hrsg.), Memorandum zur ækonomischen Bildung. Ein Ansatz<br />
zur Einfçhrung des Schulfachs Úkonomie an allgemeinbildenden<br />
Schulen, Frankfurt/M. 1999; Bundesvereinigung<br />
der Deutschen <strong>Arbeit</strong>geberverbånde (BDA)/<br />
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Hrsg.), Wirtschaft ±<br />
notwendig fçr schulische Allgemeinbildung. Gemeinsame<br />
Initiative von Eltern, Lehrern, Wissenschaft, <strong>Arbeit</strong>gebern<br />
und Gewerkschaften, Berlin 2000; Hans Kaminski, Die Bedeutung<br />
der ækonomischen Bildung in allgemeinbildenden<br />
Schulen, in: Sparkasse. Zeitschrift des Deutschen Sparkassenund<br />
Giroverbandes, 117 (2000) 9, S. 389 ± 393.<br />
12
strukturgebenden Funktion der Individuen, Haushalte<br />
und Familien bestehen. Weil die Wirtschaft<br />
ein Zentralbereich in modernen und postmodernen<br />
Gesellschaften ist und die Privathaushalte die<br />
basalen Akteure sein mçssen, ist es notwendig,<br />
entweder ein eigenståndiges Fach oder Lernfeld<br />
¹Sozioækonomie/Wirtschaftª in allen Schulstufen<br />
und Schulformen zu etablieren, das eine angemessene<br />
Thematisierung der Hauswirtschaft in ihrer<br />
Bedeutung fçr die Einzelnen und die Gesellschaft<br />
bietet, oder ± falls eine Konsenslæsung im Fåcherverbund<br />
nicht gelingt ± ein solches eigenståndiges<br />
Fach oder Lernfeld ¹Haushalt/Hauswirtschaft/<br />
Familieª einzufçhren. 26 Die anstehende Revision<br />
26 Vgl. dazu Deutsche Gesellschaft fçr Hauswirtschaft e. V.<br />
(Hrsg.), Kompetent im Alltag. Memorandum fçr eine haushaltsbezogene<br />
Bildung: frçhzeitig, aufbauend, lebenslang.<br />
Wege zu einer zeitgemåûen und zukunftsorientierten Bildung,<br />
Aachen 2001; Michael-Burkhard Piorkowsky, Wirtschaftliche<br />
Allgemeinbildung in den Schulen, in: Dieter<br />
von Lehrplånen sowie die in Aussicht genommene<br />
Einfçhrung der Ganztagsschule bietet gute Mæglichkeiten,<br />
çber die Verankerung im Unterricht<br />
und die Ausbildung von Lehrkråften zu beraten.<br />
Internetverweise des Autors:<br />
Ûber ein Konzept fçr<br />
die Erwachsenenbildung informiert:<br />
www.neuehauswirtschaft.de<br />
Das Konzept wird umgesetzt ab Februar 2003:<br />
www.lernerfolg.vzbv.de<br />
Die Deutsche Gesellschaft fçr Hauswirtschaft e.V.<br />
ist unter folgender Adresse zu erreichen:<br />
www.dghev.de<br />
Korczak (Hrsg.), Bildungs- und Erziehungskatastrophe. Was<br />
unsere Kinder von uns lernen sollen, Interdisziplinåre Studien,<br />
Bd. 25, Opladen 2003 (i. E.).<br />
13 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
Lothar Krappmann<br />
Kompetenzfærderung im Kindesalter<br />
I. Prekåre Balancen im Alltagsleben<br />
Der Alltag der çberwiegenden Mehrheit der Menschen<br />
in der Bundesrepublik Deutschland ± das<br />
sind fçnf Sechstel der Menschen ± wird vom<br />
Zusammenleben mit anderen Menschen in einem<br />
privaten Haushalt geformt. 1 Die Art und Weise<br />
der Absprachen, die in diesem Haushalt çber alltågliche<br />
Ziele, Aufgaben und <strong>Arbeit</strong>sverteilungen<br />
getroffen werden, entscheidet weitgehend darçber,<br />
ob diese Menschen gemeinsam ¹gutes Lebenª verwirklichen<br />
kænnen. Aus der Perspektive dieses<br />
sozialwissenschaftlichen Zugangs soll in diesem<br />
Beitrag untersucht werden, welche Kompetenzen<br />
Menschen benætigen und wann und unter welchen<br />
Bedingungen sie diese ausbilden, um mit anderen<br />
gemeinsam zufriedenstellend leben zu kænnen.<br />
Es gibt Zweifel daran, dass alle Menschen voraussetzungslos<br />
in der Lage sind, ihren Alltag befriedigend<br />
zu gestalten. Wie berechtigt diese sind,<br />
zeigen Ûberschuldungen von Haushalten, Zerwçrfnisse<br />
mit Nachbarn, die bis vors Gericht getragen<br />
werden, Taschengeldstreitereien mit Kindern oder<br />
auch die schwierigen Probleme, die nach einem<br />
<strong>Arbeit</strong>splatzverlust oder bei Krankheit auftreten.<br />
Manche Ehe und Familie zerfållt aufgrund der<br />
Unfåhigkeit, landlåufig als trivial bewertete Alltagsprobleme<br />
bewåltigen zu kænnen, und nicht<br />
etwa deshalb, weil auûergewæhnliche Konflikte<br />
nicht gelæst werden. Zahlreiche Beobachtungen<br />
beståtigen, dass Menschen nicht nur bei extremer<br />
Beanspruchung, sondern generell in ihrem Alltag<br />
± ¹alltåglichª ± in kleinere und græûere Pannen,<br />
aber auch in schwer wiegende Krisen und Katastrophen<br />
geraten. Die Ursache dafçr liegt nicht in fehlender<br />
Bildung, etwa dem fehlenden Abitur. Vielmehr<br />
verfçgen diese Menschen nicht oder zu wenig<br />
çber Fåhigkeiten, die unter dem Begriff Alltagskompetenzen<br />
zusammengefasst werden kænnen. 2<br />
1 Zwar waren im Jahr 2000 mehr als ein Drittel der Haushalte<br />
Einpersonenhaushalte. Wenn jedoch Personen die Basis<br />
der Berechnung bilden, leben nur 17 Prozent der Bevælkerung<br />
in Einpersonenhaushalten und 83 Prozent in Mehrpersonenhaushalten,<br />
siehe Statistisches Bundesamt (Hrsg.),<br />
Datenreport 2002. Zahlen und Fakten çber die Bundesrepublik<br />
Deutschland, Bonn 2002.<br />
2 Unter verschiedenen Rçcksichten analysieren solche<br />
Alltagsprobleme Peter Bçchner/Burkhard Fuhs, Der Lebensort<br />
Familie. Alltagsprobleme und Beziehungsmuster, in:<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002<br />
Im Alltagsleben sehen sich Menschen mit Problemen<br />
konfrontiert, weil hier eine Situation falsch<br />
eingeschåtzt, dort ein Termin versåumt wird, weil<br />
die rechtliche Relevanz einer Handlung nicht<br />
erkannt oder der erforderliche Aufwand falsch<br />
kalkuliert wird. Derartige Probleme verweisen<br />
bereits darauf, dass die Bewåltigung des alltåglichen<br />
Lebens Anforderungen an die Menschen<br />
stellt, etwa die, aufmerksam und umsichtig zu sein,<br />
auch fçr scheinbar Banales; und sie signalisieren,<br />
dass dazu Wissen erforderlich ist: Man sollte sich<br />
im tagtåglichen Leben auskennen. Aber es ist<br />
noch komplizierter: Menschen kænnen auch vor<br />
lauter Umsicht und Absicherung handlungsunfåhig<br />
werden. So kann etwa der Schnåppchenjåger<br />
bei seinen tåglichen Kontrollgången durch die<br />
Låden die Erledigung wichtigerer Aufgaben versåumen.<br />
Zu aller Wachsamkeit muss noch ein<br />
Moment von Klugheit kommen; es gilt, die notwendigen<br />
Abwågungen zu steuern, um sich nicht<br />
in den Fallen des Alltags zu verfangen.<br />
Die beschriebenen Probleme kænnen auch zu<br />
kompletten Zusammenbrçchen fçhren, was auf<br />
tiefer liegende Unfåhigkeiten hinweist, etwa darauf,<br />
dass jemand in einer angespannten Situation<br />
nicht die richtigen Worte findet, dass Menschen<br />
nicht merken, was ein Problem, ein Fehler, eine<br />
mitmenschliche Beziehung im Augenblick von<br />
ihnen verlangt, oder dass sie die Hilfsbereitschaft<br />
anderer çberstrapazieren. Es geht also um soziokognitive<br />
Fåhigkeiten, eine soziale Situation richtig<br />
einzuschåtzen. Um im Alltag nicht anzuecken<br />
und Handlungsmæglichkeiten nicht falsch zu interpretieren,<br />
ist es wichtig, die Interessenlage anderer<br />
wahrnehmen zu kænnen, sich in ihre Lage einzufçhlen<br />
und dann gegebenenfalls Rçcksicht nehmen<br />
zu kænnen. Aber auch hier gibt es ein Zuviel des<br />
Perspektivenwechsels. Es gilt, einen Ausgleich<br />
unter verschiedenen Zielsetzungen zu erreichen,<br />
und dazu bedarf es auch, aber nicht nur soziokognitiver<br />
Kompetenz. Das erfordert zugleich die<br />
dies./Heinz-Hermann Krçger (Hrsg.), Vom Teddybår zum<br />
ersten Kuss, Opladen 1996; Gçnter Voû/Margit Weihrich,<br />
Tagaus ± tagein. Neue Beitråge zur Soziologie der alltåglichen<br />
Lebensfçhrung, Mçnchen 2001; Margit Weihrich/Gçnter<br />
Voû (Hrsg.), Tag fçr Tag. Alltag als Problem ± Lebensfçhrung<br />
als Læsung, Mçnchen 2002; Rosemarie von<br />
Schweitzer, Heilendes und krank machendes familiales Alltagsleben,<br />
in: Franz-Michael Konrad (Hrsg.), Kindheit und<br />
Familie, Mçnster 2001; Gunter E. Zimmermann, Ûberschuldung<br />
privater Haushalte, Freiburg i. Br. 1999.<br />
14
Fåhigkeiten, auszuhandeln, zu kompensieren,<br />
langfristig zu denken. In der einen Situation muss<br />
man groûzçgig sein kænnen, in einer anderen ist<br />
Beharrlichkeit erforderlich.<br />
Auch die Unfåhigkeit, Prioritåten zu setzen, kann<br />
zu Problemen fçhren: wenn man nicht weiû, was<br />
das Wichtigste ist, vor allem, was jetzt das Wichtigste<br />
ist, denn eine starre Rangordnung kann auch<br />
hinderlich sein. Aber welches Verhalten ist im<br />
guten Sinne flexibel, und wo beginnen Unzuverlåssigkeit,<br />
Wankelmut und Leichtsinn?<br />
Auûer Kontrolle geraten kann der Alltag ferner<br />
durch Verhalten, das, solange es wohldosiert angewandt<br />
wird, das Alltagsleben ungemein erleichtert,<br />
das aber, sofern nicht auf Grenzen geachtet wird,<br />
oft in erhebliche Schwierigkeiten fçhrt: Freundlichkeit<br />
ist so gut wie immer hilfreich, aber sie<br />
kann ± wenn sie die Form von Gutmçtigkeit<br />
annimmt ± auch dazu fçhren, dass Menschen von<br />
anderen ausgenutzt werden und ihr eigenes Leben<br />
aus den Augen verlieren. Oder: Ohne ein gewisses<br />
Maû an Vertrauen, das Menschen einander entgegenbringen,<br />
wçrde der Alltag nicht laufen, aber<br />
Gutglåubigkeit, etwa sich entgegen widersprechenden<br />
Zeichen immer weiter auf eine zugesagte<br />
Hilfe zu verlassen, kann in groûe Bedrångnis<br />
stçrzen.<br />
So erfordert der Alltag oft ein Verhalten, das<br />
nicht nur an den hæchsten Stufen soziokognitiver<br />
oder moralischer Kompetenz orientiert ist, sondern<br />
heftige, gelegentlich sogar fragwçrdige Mittel<br />
nicht meidet, um einerseits Ansprçchen<br />
Respekt zu verschaffen, andererseits nicht von<br />
einem Regelwerk zerrieben zu werden. Der kompetente<br />
Partner einer Aushandlung muss auch<br />
einmal ¹fçnf gerade seinª lassen kænnen, um den<br />
Alltag nicht an Prinzipien scheitern zu lassen, die<br />
in manchen Situationen mehr schaden als nçtzen.<br />
Diese Balanceakte, mit denen Menschen sich<br />
durch ihren Alltag lavieren, gehæren zum pragmatischen<br />
Handeln, das Menschen beherrschen mçssen,<br />
das aber nicht verantwortungslos ausgeçbt<br />
werden darf, denn hilfreiche Strategien sind willkommen,<br />
gewissenlose Vorgehensweisen jedoch<br />
nicht.<br />
Schlieûlich besteht der Alltag noch aus vielen<br />
Zufållen; da gibt es Glçck und Pech, Verlorenes<br />
und Verlegtes, Unfålle und Krankheiten, çberraschende<br />
Chancen und den seltenen Lottogewinn.<br />
Das alltågliche Leben besteht aus einer<br />
Abfolge solcher unvorhergesehener Widerfahrnisse,<br />
und sowohl die negativen als auch die positiven<br />
sind schwer in die eingespielten Ablåufe zu<br />
integrieren; sie verlangen nach Bewåltigungsstrategien,<br />
um von ihnen nicht aus der Bahn<br />
geworfen zu werden. Auch am glçcklichen Zufall<br />
kann der Alltag scheitern, wenn Menschen mit<br />
plætzlichen Wendungen der Dinge nicht umzugehen<br />
wissen. Die Unabsehbarkeit kleinerer und<br />
græûerer Geschehnisse verlangt Offenheit und<br />
Mut, sich auf Neues einzulassen sowie Chancen zu<br />
nutzen. Zugleich gilt es, Ressourcen zu bedenken<br />
und långerfristige Folgen nicht aus den Augen zu<br />
verlieren.<br />
Kompetentes Alltagshandeln setzt voraus,<br />
± aufmerksam zu sein und Bescheid zu wissen,<br />
aber sich im Streben nach Absicherung nicht zu<br />
låhmen;<br />
± Empfindlichkeiten miteinander kooperierender<br />
Menschen zu berçcksichtigen, aber doch auch<br />
eigene Interessen verfolgen zu kænnen;<br />
± Prioritåten richtig zu setzen und dennoch flexibel<br />
zu bleiben;<br />
± pragmatisch, aber nicht unmoralisch mit Problemen<br />
umgehen zu kænnen; und<br />
± sich auf Unerwartetes einlassen zu kænnen,<br />
aber doch die Ûbersicht nicht zu verlieren.<br />
Auch wenn sie çber diese Kompetenzen verfçgen,<br />
erreichen Menschen oft nicht mehr, als sich ¹halbwegsª<br />
erfolgreich durch den Alltag zu bewegen.<br />
Die richtigen Schwerpunkte zu setzen, klug mit<br />
unlæsbaren Problemen umzugehen, wohldosiert zu<br />
reagieren, ist eine Lebenskunst. 3<br />
Diese Herausforderungen kumulieren in den<br />
¹Einheiten eng verbundenen Lebensª: Jede Person<br />
dieses Alltags- und Lebensverbunds bringt<br />
ihre besondere selektive Aufmerksamkeit, ihre<br />
Sensibilitåt fçr andere, ihre Flexibilitåt und die<br />
Grenzen ihrer Anpassungsfåhigkeit, ihre Art, Probleme<br />
pragmatisch zu læsen, und die glçcklichen<br />
und unglçcklichen Widerfahrnisse, die ihr zustoûen,<br />
mit und macht diese zur gemeinsamen<br />
Angelegenheit.<br />
II. Der unbeachtete Alltag<br />
der Familie<br />
Was ist unter dem Begriff ¹Einheiten eng verbundenen<br />
Lebensª zu subsumieren? Typischerweise<br />
verstehen die Sozialwissenschaftler darunter die<br />
Familie. Sie konzentrieren sich in ihren Forschungen<br />
auf Themen wie die frçhen Bindungserfahrungen,<br />
die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung,<br />
3 Vgl. Charles Lindblom, The science of ¹muddling<br />
throughª, in: Public Administration Review, 19 (1959), S. 79±<br />
88; Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst. Eine<br />
Grundlegung, Frankfurt/M. 2001 8 .<br />
15 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002
die Konkurrenz des Ehepartner-Subsystems mit<br />
dem Eltern-Kind-System, auf Ablæsung und Beziehungstransformationen<br />
in der Adoleszenz, auf<br />
Rollendefinitionen und Konflikte der Eltern ±<br />
Themen, deren Bedeutung keineswegs geschmålert<br />
werden soll. Sie werden jedoch in einer Weise<br />
behandelt, in der die Alltagsebene der Auseinandersetzungen<br />
nicht oder zu wenig sichtbar wird.<br />
Fåhigkeiten, die erforderlich sind, um diesen Alltag<br />
und seine Probleme gemeinsam gut zu meistern,<br />
werden im Allgemeinen nicht analysiert. Der<br />
triviale, aber entscheidende Alltag wird çbergangen<br />
und damit ein wesentlicher Herd, Rahmen<br />
und Resonanzboden fçr Konflikte ebenso wie fçr<br />
Kooperation und Zuneigung.<br />
Diese Wahrnehmungslçcke hångt nicht zuletzt mit<br />
methodischen Vorgehensweisen zusammen. Vielfach<br />
werden vor allem jeweilige Zustånde gemessen<br />
oder Einstellungen mit standardisierten Fragebægen<br />
abgefragt, nicht aber Prozesse analysiert,<br />
wie es sich aufdrången wçrde, wenn das Alltagsleben<br />
Gegenstand der Forschung wåre. Dann stieûe<br />
man auf das Beziehungssystem Familie, auf den<br />
Haushalt und auf die alltåglichen Probleme, die<br />
Familien læsen mçssen, um gemeinsames ¹gutes<br />
Lebenª zu verwirklichen.<br />
Der Alltag wird ± wider bessere persænliche Erfahrung<br />
± fçr gesichertes Terrain gehalten. Es wird<br />
unterstellt, dass Menschen wissen, wie man das<br />
Leben meistert; es wird angenommen, dass sie<br />
Routinen ausbilden, Mustern folgen, mit denen<br />
allfållige Probleme bewåltigt werden kænnen.<br />
III. Kompetenzen fçr den Alltag<br />
Diejenigen, die sich mit der Entwicklung von<br />
kognitiven, sozialen und moralischen Kompetenzen<br />
wissenschaftlich auseinander setzen, neigen<br />
dazu, das, was man im Alltagsleben kænnen muss,<br />
fçr mitgelernt und mitvermittelt zu halten, wenn<br />
Menschen diese Kompetenzen çber alle Zwischenstufen<br />
bis zur hæchsten erworben haben. Wird man<br />
dadurch ¹kompetent im Alltagª, dass man Fåhigkeiten<br />
wie die zum Perspektivenwechsel oder zur<br />
prinzipienorientierten Urteilsbildung ins tågliche<br />
Leben çbertragen kann? 4<br />
4 Solche Modelle pråsentieren Fritz Oser/Wolfgang Althof,<br />
Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und<br />
Erziehung im Wertebereich, Stuttgart 1992; Robert L. Selman,<br />
Die Entwicklung des sozialen Verstehens, Frankfurt/M.<br />
1984; oder ± nåher an den Problemen des alltåglichen Wirtschaftens<br />
± Annette Claar, Die Entwicklung ækonomischer<br />
Begriffe im Jugendalter. Eine strukturgenetische Perspektive,<br />
Berlin 1990.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002<br />
Kompetenz wird in dieser Sichtweise definiert als<br />
Potenz, çber die ein Mensch verfçgt, um ein<br />
kognitives, soziales oder moralisches Problem in<br />
Abwågung aller Argumente pro und kontra zu<br />
læsen. Untersucht wird dies unter idealen Bedingungen<br />
und ohne die Restriktionen zu berçcksichtigen,<br />
denen Probanden im Alltag ausgesetzt sind:<br />
knappe Zeit, eingegangene Verpflichtungen, fehlende<br />
Erfahrung, Rçcksicht auf Beziehungen, vorhandene<br />
und nicht vorhandene finanzielle und<br />
andere Mittel. Gleichsam im gemçtlichen Sessel<br />
sitzend wird abgewogen, ob Heinz, um das bekannte<br />
Moraldilemma Lawrence Kohlbergs zu<br />
zitieren, 5 fçr seine todkranke Frau das einzig hilfreiche,<br />
aber unbezahlbare Medikament aus der<br />
Apotheke stehlen oder sich an Gesetz und Krankenkassenvorschriften<br />
halten soll.<br />
Diese Geschichte ist hervorragend dazu geeignet<br />
herauszufinden, welche Gedanken und Begrçndungen<br />
einem Menschen zu Gerechtigkeit und<br />
mitmenschlicher Fçrsorge im Kopf herumgehen,<br />
und das ist wahrhaftig nicht irrelevant. Aber fast<br />
jeder reale Heinz wçrde bei der Aktion, das Medikament<br />
beim nåchtlichen Einbruch aus einer gut<br />
gesicherten Apotheke zur Rettung seiner Frau zu<br />
entwenden, im Gefångnis landen und die Ehefrau<br />
nicht einmal mehr am Krankenbett træsten kænnen.<br />
Vor diesem Hintergrund drångt sich die Frage<br />
auf, ob die Kompetenzen, die in den entwicklungspsychologischen<br />
Modellen im Mittelpunkt stehen<br />
und deren Bedeutung fçr die Ausbildung menschlichen<br />
Denk- und Urteilsvermægens nicht<br />
bezweifelt werden soll, uns tatsåchlich helfen, den<br />
Alltag zu meistern?<br />
Die soziale Welt, in der mittels dieser Kompetenzen<br />
Probleme gelæst werden sollen, wird als rational<br />
und durch eindeutige Abhångigkeiten verflochten,<br />
çbersichtlich und durchschaubar, nicht<br />
unter dem Druck von Engpåssen, Versåumnissen<br />
und unerwarteten Ereignissen stehend und frei<br />
von Øngsten und Sehnsçchten, Zuneigungen und<br />
Vorurteilen, die in geringerem oder stårkerem<br />
Maûe das Handeln von Menschen beeinflussen,<br />
angesehen.<br />
In diesen Modellen ist der Alltag kein Fluss von<br />
Ereignissen, in dem man um des sozialen Ûberlebens<br />
willen mitschwimmen muss und in dem man<br />
nie an einen Punkt gelangt, an dem alles noch einmal<br />
von null auf çberlegt, entworfen und in den<br />
Griff genommen werden kann.<br />
5 Zuerst bekannt geworden durch den Aufsatz von Lawrence<br />
Kohlberg, Stufe und Sequenz, in: ders., Zur kognitiven<br />
Entwicklung des Kindes, Frankfurt/M. 1974.<br />
16
IV. Daseinskompetenz<br />
als Bildungsziel<br />
Derartige Ûberlegungen haben die Autoren des<br />
Fçnften Familienberichts veranlasst vorzuschlagen,<br />
als fundamentales Ziel der Bildung eine Fåhigkeit<br />
der Lebensbewåltigung einzufçhren, die sie Daseinskompetenz<br />
nennen. 6 Sie wollten unterstreichen,<br />
dass Leben, Wirtschaften und Es-sich-gutgehen-Lassen<br />
im gemeinsamen Haushalt noch eine<br />
andere Art und Weise erforderlich macht, sich<br />
Problemen zu nåhern und sie zu læsen, eine, die<br />
nicht auf dem mathematisch korrekten Umgang<br />
mit Informationen und Relationen beruht, sondern<br />
die sich bei Unvollståndigkeit der Informationen,<br />
Knappheit der Mittel, Ungewissheit der Entwicklung<br />
der Prozesse und Widersprçchlichkeit mæglicher<br />
Ziele, die sich also in typischen Alltagssituationen<br />
von Familien bewåhrt.<br />
Haushalte waren schon immer Orte, an denen<br />
Entscheidungen nicht nur nach Modellen von<br />
¹rational choiceª gefållt wurden bzw. werden<br />
konnten, weil die Voraussetzungen dafçr nicht<br />
gegeben waren. In der (Post-)Moderne ± unter<br />
dem Druck von Innovation und Wandlung, von<br />
Flexibilitåt und Mobilitåt ± ist dies erst recht der<br />
Fall. Die in einem Haushalt gemeinsam Lebenden<br />
und Wirtschaftenden mçssen heute unter kaum<br />
mehr durchschaubaren Bedingungen, angesichts<br />
angepriesener Chancen und eher verschwiegener<br />
Risiken, in Auseinandersetzung mit Sehnsçchten<br />
und Øngsten Plåne fçr gutes Leben entwerfen und<br />
Entscheidungen treffen. Die nicht mehr unbedingt<br />
an einem Ort lebende Mehrgenerationenfamilie<br />
kann nicht mehr auf die Traditionen zurçckgreifen,<br />
die einst einen Haushalt stçtzten; sie muss die<br />
Muster ihres gemeinsamen Lebens mit Daseinskompetenz<br />
anpassen, modifizieren und zum Teil<br />
neu erfinden. Diese Ûberlegungen beziehen sich<br />
nicht nur auf zersplitternde Patchwork-Familien,<br />
sondern auch auf tagtågliche Probleme in den vorherrschenden<br />
Zwei-Eltern-zwei-Kinder-Familien,<br />
die sich den Verånderungen von Bildung, Beruf,<br />
Technik, Medien, Freizeit und Moral nicht entziehen<br />
kænnen und immer wieder neu um tragfåhige<br />
Arrangements ihres Zusammenlebens ringen. 7<br />
Diese Verånderungen stellen keineswegs nur eine<br />
6 Siehe Sachverståndigenkommission fçr den Fçnften Familienbericht,<br />
Fçnfter Familienbericht: Familien und Familienpolitik<br />
im geeinten Deutschland ± <strong>Zukunft</strong> des Humanvermægens,<br />
hrsg. vom Bundesministerium fçr Familie und<br />
Senioren, Bonn 1994.<br />
7 Vgl. Ulrich Beck/Wilhelm Vossenkuhl/Ulf E. Ziegler, Eigenes<br />
Leben. Ausflçge in die unbekannte Gesellschaft, in der<br />
wir leben, Mçnchen 1995; Manuela du Bois-Reymond, Die<br />
moderne Familie als Verhandlungshaushalt. Eltern-Kind-Be-<br />
Bedrohung dar, sind nicht nur mit Verlust verbunden,<br />
sondern bieten auch Chancen, mehr aus dem<br />
Leben zu machen ± vorausgesetzt, das Zusammenleben<br />
kann so organisiert werden, dass es ¹gutes<br />
Lebenª erzeugt.<br />
Es liegt nahe, vom ¹normalen Chaosª des Familienalltags<br />
zu sprechen, das sich in die Vorstellungen<br />
von Handlungstheorien kaum einfçgen låsst,<br />
die aufgeklårte Voraussetzungen und wohlçberlegte<br />
Grçnde fçr Planung und Entscheidung verlangen.<br />
Das Bild des Chaos ist verfçhrerisch, suggeriert<br />
aber eine Situation, durch die Haushalte im<br />
Allgemeinen nicht charakterisiert sind. Der<br />
Gegensatz von rational ist nicht nur irrational, sondern<br />
auch lebensklug. 8 Der (post)moderne Haushalt<br />
ist nicht durch Chaos gekennzeichnet, er ist<br />
vielmehr ein Ort, an dem die dort Lebenden auf<br />
der ståndigen Suche nach Regeln und Verfahrensweisen,<br />
nach Routinen und Erlebnissen sind, die<br />
Entlastung bringen, Unsicherheit abbauen und<br />
Zufriedenheit stiften. Viele Haushaltsmitglieder<br />
nehmen wahr, dass ihnen bei ihren Bemçhungen<br />
immer wieder Fehler unterlaufen. Sie sind durchaus<br />
gewillt zu lernen; sie lesen Zeitschriften wie<br />
¹Finanztestª und ¹Psychologie heuteª, Ratgeberseiten<br />
und Buchserien. Aber die Bewåltigung des<br />
Alltags setzt mehr voraus als kognitives, gesichertes<br />
Wissen: Es kommt darauf an, Zusammenhånge<br />
zu erspçren, langfristige Entwicklungen einschåtzen<br />
zu lernen; Aufwand und Ertrag in ein Verhåltnis<br />
zu bringen; auf den richtigen Zeitpunkt fçr<br />
Læsungen warten zu kænnen und zu ertragen,<br />
wenn trotz aller Bemçhungen am Ende unbefriedigende<br />
Ergebnisse stehen. Es gilt, mit solchen<br />
Erfahrungen umgehen zu lernen, sich dadurch<br />
nicht frustrieren, sondern zu weiteren Anstrengungen<br />
motivieren zu lassen. Es ist wichtig, Sensibilitåt<br />
zu entwickeln fçr Unterschiede, Eigenheiten<br />
und Vorlieben, zu lernen, sich nicht nur an messbarer<br />
Effizienz zu orientieren, sondern auch<br />
Stimmungen und Gefçhle einzubeziehen. Kompetenzen<br />
des ¹guten gemeinsamen Lebensª ± Daseinskompetenzen<br />
± sind nicht allein anhand solcher<br />
Kriterien wie richtig oder falsch, mehr oder<br />
weniger, gerecht oder ungerecht zu messen. Eine<br />
wichtigere Rolle spielen Kriterien wie ¹lebbarª<br />
oder ¹gutes Lebenª, ¹belastendª, Entwicklungen<br />
¹færderndª oder ¹einschrånkendª.<br />
Es wird deutlich, dass diese Kompetenzen auch<br />
in weitgehend durchrationalisierten Produktions-<br />
ziehungen in West- und Ostdeutschland und in den Niederlanden,<br />
in: dies. u. a. (Hrsg.), Kinderleben. Modernisierung<br />
von Kindheit im interkulturellen Vergleich, Opladen 1994.<br />
8 Vgl. Gerd Gigerenzer, Decision making: Nonrational<br />
theories, in: Neil J. Smelser/Paul B. Baltes (Hrsg.), International<br />
encyclopedia of the social and behavioral sciences.<br />
Band 5, Amsterdam 2001.<br />
17 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002
und Verwaltungsståtten von groûer Bedeutung<br />
sind, geht es doch auch in diesen um die Auseinandersetzung<br />
mit Ungewissheit, Differenz und Wandel.<br />
Diese produktiv fçhren zu kænnen, ist die Basis<br />
menschlicher Lern- und Entwicklungspotenziale.<br />
V. Færderung von Alltagskompetenzen<br />
schon im Kindesalter?<br />
Sollten diese Daseinskompetenzen bereits im Kindesalter<br />
herausgebildet werden? Zweifellos sind<br />
Kinder direkt und indirekt dem Druck, sich Handlungszwången<br />
anzupassen und sich flexibel zu verhalten,<br />
ausgesetzt. 9 Wo und wie lernen sie, Leben<br />
mit anderen in vernçnftigem Umgang mit vorhandenen<br />
Mitteln gemeinsam zu gestalten? Ein Teil<br />
dieser Kompetenzen kænnte sicher in einem problem-<br />
und projektorientierten Unterricht vermittelt<br />
werden. Die Forderung, dass unsere Schulen<br />
ihre Curricula grundlegend revidieren sollten, um<br />
den Heranwachsenden nicht nur die Wissenschaftsund<br />
Sinntraditionen des Denkens zu erschlieûen,<br />
sondern neben vielem anderen auch Wissen, Fåhigkeiten<br />
und Orientierungen fçr die Lebenspraxis<br />
anzubieten, ist nicht neu. Wirtschaft, Recht, Haushalt,<br />
Umwelt, Ernåhrung, Gesundheit gehæren in<br />
die Schule. Man mag es kaum wiederholen.<br />
Leider gibt es die Erfahrung, dass Schule Themen<br />
nicht nur erschlieûen, sondern auch verderben<br />
kann, wenn sie daraus Unterrichtsstoff macht. Um<br />
dem vorzubeugen, werden solche Angebote,<br />
sofern es sie gibt, mæglichst nah an die Zeit herangeschoben,<br />
in der man dieses Wissen wirklich<br />
braucht: in die hæheren Klassen. Aber kann die<br />
Schule in der sich so schnell veråndernden Welt<br />
wirklich Heranwachsenden ein Wissen bieten, das<br />
sie in ein paar Jahren sinnvoll einsetzen kænnen?<br />
Greift die Vermittlung von Wissen nach dem Ausgefçhrten<br />
nicht zu kurz? Es geht um grundlegende<br />
Kompetenzen, und diese werden in frçhen<br />
Lebensjahren angelegt, in der Kindheit. Sollten<br />
aber die Kompetenzen des ¹guten gemeinsamen<br />
Lebensª, die Daseinskompetenzen, tatsåchlich bereits<br />
in der frçhen Kindheit vermittelt werden?<br />
Die Zweifel, ob dies ein sinnvolles, erreichbares<br />
Ziel ist, entstehen vermutlich aus der Vorstellung,<br />
Kinder mçssten in diesem Kænnen unterrichtet<br />
9 Vgl. Georg Breidenstein/Helga Kelle, Alltagspraktiken<br />
von Kindern in ethnomethodologischer Sicht, in: Michael-<br />
Sebastian Honig/Andreas Lange/Hans Rudolf Leu (Hrsg.),<br />
Aus der Perspektive von Kindern?, Weinheim 1999; Gerd<br />
Harms/Christa Preissing (Hrsg.), Kinderalltag, Berlin 1988;<br />
Helga Zeiher/Hartmut J. Zeiher, Wie Kinderalltage zustande<br />
kommen, in: Christa Berg (Hrsg.), Kinderwelten, Frankfurt/<br />
M. 1991.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002<br />
werden. Im Kern sind jedoch diese Kompetenzen<br />
± Aufmerksamkeit und Rçcksichtnahme, Prioritåten<br />
gepaart mit Flexibilitåt, Grundsåtze vereint<br />
mit Lebensklugheit, Bemçhung um Wissen nicht<br />
ohne den ¹Mut zur Lçckeª, der Blick fçr das<br />
Gegenwårtige und die <strong>Zukunft</strong> ± gar nicht lehrbar.<br />
Sie sind ¹ablesbarª von Vorbildern; sie sind ¹aufsaugbarª<br />
aus Handlungszusammenhången, an<br />
denen Kinder und Jugendliche beteiligt sind. In<br />
dieser Hinsicht gibt es fast keine Grenze hinsichtlich<br />
des Lebensalters ¹nach untenª. Immer dann,<br />
wenn ein Kindergarten, eine Spielgruppe von Kindern<br />
nicht ein Kindergarten oder eine Spielgruppe<br />
fçr Kinder, sondern mit Kindern ist, also die Beteiligung<br />
der Kinder færdert, entstehen Situationen,<br />
in denen Kompetenzen ablesbar und aufsaugbar<br />
sind. Dasselbe gilt im Ûbrigen auch fçr die Familie:<br />
Der (post)moderne, nach befriedigenden Formen<br />
des Zusammenlebens suchende Familienhaushalt<br />
ist ein wichtiger Ort des Lernens, an dem<br />
Kompetenzen ebenfalls nicht in erster Linie durch<br />
Belehrung, sondern vor allem durch Vorbild und<br />
Mitmachen vermittelt werden. 10<br />
VI. Kompetenzfærderung in<br />
Kindergarten, Schule und Familie<br />
Kann also alles so bleiben, wie es ist? Nein, denn<br />
die Færderung einer Bildung fçr die Bewåltigung<br />
des Alltags durch die Herausforderung von Initiative,<br />
von selbstregulierenden, Vorgehen und Erfolg<br />
kontrollierenden und Interessen koordinierenden<br />
Strategien der Kinder befindet sich noch långst<br />
nicht auf einem gutem Stand.<br />
Zum einen fehlt es in den Kindereinrichtungen an<br />
entwicklungspsychologischen Kenntnissen: çber<br />
wachsende Selbstwirksamkeitserfahrungen, çber<br />
sich langsam bildende Ûberzeugungen, Ziele erreichen<br />
zu kænnen, çber sich entwickelnde Einsichten<br />
in Zusammenhånge zwischen Mitteln und Erfolg<br />
und çber das sich erweiternde Repertoire von<br />
Aushandlungsfåhigkeiten. Unsere Erzieherinnen<br />
und Erzieher benætigen eine qualifiziertere Ausbildung.<br />
Zum anderen gibt es in der Pådagogik der Kindereinrichtungen<br />
kaum Modelle, um diese fçr praktisches<br />
Handeln grundlegenden Entwicklungen<br />
10 Vgl. Lothar Krappmann, Bildung als Ressource der<br />
Lebensbewåltigung. Der Beitrag von Familie, Schule und<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Bildungsprozess<br />
in Zeiten der Pluralisierung und Flexibilisierung<br />
der Lebensverhåltnisse, in: Richard Mçnchmeier/Hans-Uwe<br />
Otto/Ursula Rabe-Kleberg (Hrsg.), Bildung und Lebenskompetenz,<br />
Opladen 2002.<br />
18
gezielt zu færdern. 11 Viel ist çber die Rolle der<br />
erlebten Selbstwirksamkeit in Lernprozessen und<br />
in der Persænlichkeitsentwicklung bekannt, aber<br />
dieses Wissen wurde bislang nicht in didaktische<br />
Arrangements umgesetzt. Auf dieselben pådagogischen<br />
Umsetzungsmångel stoûen wir, wenn wir<br />
die Schulen betrachten, auch die Ganztagsschule,<br />
die nun die Antwort auf die PISA-Misere sein soll.<br />
Es bæten sich zweifellos gute Chancen, durch die<br />
zeitliche Ausdehnung des gemeinsam gestalteten<br />
Schullebens die Kompetenzen zur Bewåltigung<br />
des Alltags zu erhæhen. Aber dazu reicht es nicht,<br />
das Vormittagslernen am Nachmittag fortzusetzen.<br />
Ohne pådagogisch konzipierte Projekte, die<br />
Selbstwirksamkeit, Aushandlung, Handlungskontrolle<br />
und Planungsfåhigkeit durch gemeinsames<br />
Leben, Verwalten und Haushalten in Schule,<br />
Klasse und <strong>Arbeit</strong>sgemeinschaft herausfordern,<br />
dçrfte der Fortschritt eher gering sein.<br />
Wenn Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen<br />
und Lehrern vermehrt Grundlagenwissen vermittelt<br />
wird, kann auch Reflexion einsetzen, um die<br />
aufgenommenen Handlungsmuster zu sichern.<br />
Dann kænnen sie die Erfahrungen der Kinder mit<br />
diesen zusammen verbalisieren und dadurch bewusst<br />
machen, was und wie man etwas gemeinsam<br />
getan <strong>hat</strong>. Irving E. Sigel spricht von der notwendigen<br />
Distanzierung vom unmittelbar Erlebten, die<br />
in Gespråchen und gemeinsamem Nachdenken<br />
erfolgt und durch die Erfahrenes zu Gelerntem<br />
wird. 12<br />
Die Erfahrung, dass sich gemeinsames Leben<br />
angesichts knapper Mittel und unterschiedlicher<br />
Erwartungen aushandeln und gestalten låsst, kann<br />
dann zum Fundament fçr systematische Lernprozesse<br />
werden, denn åltere Kinder und Jugendliche<br />
benætigen umfangreichere Kenntnisse çber ækonomische,<br />
rechtliche, ækologische und Wohlbefinden<br />
færdernde Zusammenhånge, als ihnen heute vermittelt<br />
wird. Ein spiralfærmiges Curriculum wçrde<br />
die Herausforderungen an die Kompetenzentwicklung<br />
mehrmals aufgreifen und sie zunåchst<br />
in çberschaubare gemeinsame Handlungsvollzçge<br />
im Kindesalter wie das gemeinsame Frçhstçck<br />
im Kindergarten einbetten, dann in zunehmend<br />
reflektierteren Projekten in der Grundschule hervorlocken<br />
und einçben und schlieûlich in kritischer<br />
Auseinandersetzung in hæheren Schulstufen<br />
bewusst verfçgbar und kritisch beurteilbar machen.<br />
11 Schritte dazu sind zu finden in Wassilios E. Fthenakis/<br />
Martin R. Textor (Hrsg.), Pådagogische Ansåtze im Kindergarten,<br />
Weinheim 2000.<br />
12 Vgl. Irving E. Sigel, The distancing hypothesis, in: Marshall<br />
R. Jones (Hrsg.), Miami Symposium on the Prediction of<br />
Behavior. Effects of Early Experience, Coral Gables, FL<br />
1970.<br />
Nicht vergessen werden sollte, dass die Familie<br />
selbst die erste Bildungsståtte fçr den Erwerb von<br />
Kompetenzen zur Bewåltigung des Alltags ist.<br />
Dass so oft vorgeschlagen wird, in Schulen oder<br />
Familienbildungsståtten junge Månner und Frauen<br />
auf gelingendes Familienleben vorzubereiten, ist<br />
darauf zurçckzufçhren, dass nicht wenige Familien<br />
sich schwer tun, ein befriedigendes Familienleben<br />
zu verwirklichen. Nicht nur Unvermægen, sondern<br />
auch die schwierigen Rahmenbedingungen sind<br />
dafçr verantwortlich: Mçtter und Våter, Frauen<br />
und Månner reiben sich an zahlreichen Problemen<br />
auf, mit jedem zusåtzlichen Kind sinkt das Pro-<br />
Kopf-Einkommen der Familie, es gibt zu wenig<br />
auûerfamiliale Betreuungsmæglichkeiten fçr die<br />
Kinder, Familien- und Berufståtigkeit lassen sich<br />
nur schwer vereinbaren, die Zeit ist fçr alles zu<br />
knapp, die Mæglichkeiten der sozialen und kulturellen<br />
Partizipation sind eingeschrånkt.<br />
Die Familie ist die erste Bildungsståtte der Kinder,<br />
gerade auch im Hinblick auf Daseinskompetenzen.<br />
Dass es einer gewissen Anstrengung bedarf, familiåres<br />
Zusammenleben zu gestalten, wirkt durchaus<br />
stimulierend auf die Herausbildung von Kompetenzen.<br />
Die Fçlle der oben genannten Probleme<br />
vermindert jedoch die Chance, konstruktive<br />
Erfahrungen zu vermitteln, erheblich. Versuche,<br />
Eltern und Kindern zu helfen, entsprechende<br />
Kompetenzen an anderer Stelle, etwa in den Schulen,<br />
zu entwickeln, werden dann wenig fruchten,<br />
wenn die Handlungs- und Gestaltungsspielråume<br />
in der Familie durch Belastungen zu stark eingeengt<br />
werden, vorhandenes Potenzial somit erdrçckt<br />
wird. 13<br />
Unter Bedingungen, unter denen die Familie in<br />
der Lage ist, ihren Alltag konstruktiv zu gestalten,<br />
kann sie von der Bewusstmachung und Reflexion<br />
der Alltagsgestaltung profitieren, lernen, wie man<br />
den Alltag kompetent gestaltet. Dann gewinnt<br />
nicht nur die Familie, sondern auch die Schule.<br />
Wenn ± umgekehrt ± das gemeinsame Leben nicht<br />
gut funktioniert, dann werden die Forderungen<br />
der Schule bald zu Belastungen des Haushalts.<br />
Gelingt jedoch gutes Leben, dann sind auch Energien<br />
fçr das Lernen in der Schule und fçr bçrgerliches<br />
Engagement da bzw. kænnen aktiviert werden.<br />
Die Schlussfolgerung daraus kann nur lauten,<br />
den Ort, an dem Menschen miteinander leben, den<br />
Haushalt, zu unterstçtzen: durch die Vermittlung<br />
von Kompetenzen, denn diese Einheit gemeinsam<br />
wirtschaftender Menschen ist ein entscheidender<br />
Schnittpunkt unserer Sozialwelt.<br />
13 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat fçr Familienfragen, Die<br />
bildungspolitische Bedeutung der Familie ± Folgerungen aus<br />
der PISA-Studie, hrsg. vom Bundesministerium fçr Familie,<br />
Senioren, Frauen und Jugend, Stuttgart 2002.<br />
19 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2002
Edda Mçller /Hildegard Mackert<br />
Bildung fçr Haushalt und Konsum<br />
als vorsorgender Verbraucherschutz<br />
¹Kluge Verbraucherpolitik sucht die Balance zwischen<br />
staatlichen Regulierungen zum Schutz der<br />
Verbraucher und der Aktivierung der Konsumenten.<br />
In einer Wirtschaftsordnung, die neben eigener<br />
Wachstumsdynamik auch den Zwången gemeinsamer<br />
Standards im Binnenmarkt sowie eines Welthandelsabkommens<br />
ausgesetzt ist, haben staatliche<br />
Allmachtsvorstellungen keinen Platz.ª 1 Dieses<br />
Zitat der Bundesverbraucherministerin bringt den<br />
Zusammenhang zwischen Verbraucherpolitik und<br />
Verbraucherbildung auf den Punkt, ohne Bildung<br />
auch nur erwåhnen zu mçssen.<br />
Wåhrend Verbraucherpolitik es sich u. a. durch die<br />
Instrumente der Gesetzgebung, durch behærdliche<br />
Kontrolle und Ûberwachung zur Aufgabe machen<br />
muss, fçr den Schutz der Verbraucherinnen und<br />
Verbraucher 2 zu sorgen, zielt Verbraucherbildung<br />
auf deren Aktivierung zu eigenverantwortlichem<br />
Handeln. Die Aktivitåt der Verbraucher und<br />
damit das Ziel der Verbraucherbildung besteht vor<br />
allem in der Ûbernahme von Verantwortung fçr<br />
Konsumentscheidungen und in der Ausbildung<br />
der Fåhigkeit zur Gegenwehr, d. h. der Entwicklung<br />
von psychischem Widerstand gegen Beeinflussungsversuche,<br />
um auf Marketingstrategien<br />
angemessen reagieren zu kænnen.<br />
In einer Gesellschaft, die zunehmend von Marktprozessen<br />
gesteuert wird und in der sich technologischer<br />
und soziologischer Wandel beschleunigen,<br />
ist das Management des privaten Haushalts und<br />
des tåglichen Lebens keineswegs so einfach und<br />
banal, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.<br />
Verbraucher sind durch die vielen Facetten der<br />
Alltagsgestaltung sowie des allmåhlichen Rçckzugs<br />
des Staates aus der Daseinsfçrsorge mit den<br />
unterschiedlichsten Anforderungen konfrontiert.<br />
Fçr deren Bewåltigung vermittelt ihnen heute die<br />
Schule bei weitem nicht alle erforderlichen Fåhigkeiten<br />
und Kompetenzen. 3 Darunter fallen insbe-<br />
1 Renate Kçnast, Die Chance in der Krise: Qualitåt verlangen,<br />
in: Jçrgen Lackmann (Hrsg.), Verbraucherpolitik und<br />
Verbraucherbildung: Beitråge fçr einen nachhaltigen Verbraucherschutz,<br />
Weingarten 2002, S. 61.<br />
2 Aus Grçnden der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden<br />
nur die maskuline grammatische Form verwendet. Selbstverståndlich<br />
ist die feminine Form immer mitgemeint.<br />
3 ¹Sehr einfach gesprochen, ist mit alltåglicher Lebensfçhrung<br />
das gemeint, was Menschen den ganzen Tag und jeden<br />
Tag aufs neue alles tun. Dabei . . . geht (es) um die Art<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
sondere Konsumkompetenzen. Sie wollen gelernt<br />
und eingeçbt sein. Ziel der Bildung ist die Befåhigung<br />
zum mçndigen Konsumenten, der in der Lage<br />
ist, auf der Basis von Werten und Sachinformationen<br />
seine Entscheidungen zu treffen. Auftrag der<br />
Schule sollte es sein, ethische Werthaltungen wie<br />
soziale und ækologische Verantwortung auch in<br />
Bezug zu setzen zu dem Handeln als Konsument.<br />
Darçber hinaus muss die Fåhigkeit entwickelt werden,<br />
Sachinformationen einzuordnen, zu bewerten,<br />
zu gewichten und in Alltagshandeln umzusetzen.<br />
Hier setzt Bildung fçr Verbraucher an.<br />
Viele Regelungen, wie zum Beispiel das im Bundesrat<br />
abgewiesene Verbraucherinformationsgesetz<br />
(das allerdings wieder auf den Weg gebracht<br />
werden soll), das Bio-Siegel oder die Rentenreform,<br />
die so genannte ¹Riester-Renteª, kænnen<br />
nicht richtig greifen, wenn sie nicht genutzt werden.<br />
Nur der gebildete, entscheidungs- und handlungsbereite<br />
Verbraucher ist dazu in der Lage. Darçber<br />
hinaus ist Bildung die Voraussetzung fçr einen vorsorgenden<br />
Verbraucherschutz. Nur der informierte<br />
Verbraucher ist fåhig, seine Konsumentenrolle<br />
aktiv und verantwortlich wahrzunehmen und somit<br />
sich selbst und die Gesellschaft vor den negativen<br />
Auswirkungen des Konsums zu schçtzen.<br />
In den folgenden Kapiteln werden wir Ûberlegungen<br />
anstellen, wie Bildung fçr Verbraucher<br />
verknçpft ist mit dem Ziel eines vorsorgenden Verbraucherschutzes<br />
und dem Konzept des Nachhaltigen<br />
Konsums und welche Vorstellungen çber Bildungspolitik<br />
und Curriculumentwicklung daraus<br />
abzuleiten sind.<br />
und Weise, wie man die vielfåltigen Dinge des Alltags praktisch<br />
regelt und miteinander vereinbart.ª Karin Jurczyk, ¹Die<br />
<strong>Arbeit</strong> des Alltagsª ± Unterschiedliche Anforderungen in der<br />
alltåglichen Lebensfçhrung von Frauen und Månnern, in:<br />
Stiftung Verbraucherinstitut, Deutsches Institut fçr Erwachsenenbildung<br />
(Hrsg.), Focus Alltag, Frankfurt/M. 1995.<br />
Damit wird in den Blick gerçckt, dass die alltågliche Lebensfçhrung<br />
keineswegs aus automatisierten Ablåufen besteht,<br />
sondern sie ist ein mit <strong>Arbeit</strong> und Zeitaufwand verbundener<br />
aktiver Prozess, die einzelnen Bereiche des Alltags, die jeweils<br />
einer eigenen Logik folgen, miteinander in Einklang zu<br />
bringen. Um Aktivitåt und Gestaltungsmæglichkeit stårker zu<br />
betonen, wird auch von Alltagsgestaltung gesprochen. Vgl.<br />
Claudia Empacher, Zielgruppenspezifische Potenziale und<br />
Barrieren fçr nachhaltigen Konsum, Vortrag bei der Tagung<br />
¹Nachhaltiger Konsum? Auf dem Wege zur gesellschaftlichen<br />
Verankerungª, 29./30. 11. 2001, zitiert nach www.isoe.<br />
de, ohne Seitennummerierung.<br />
20
I. Vorsorgender Verbraucherschutz<br />
Eines der Leitbilder moderner Verbraucherpolitik<br />
ist die Vorsorge, d. h. die Vermeidung von Nachteilen<br />
des Konsums fçr die Verbraucher und hinsichtlich<br />
der Erreichung akzeptierter kollektiver<br />
gesellschaftlicher Ziele. 4 Vorsorgender Verbraucherschutz<br />
setzt nicht erst bei Produkten und<br />
Dienstleistungen am Markt an, sondern umfasst<br />
die der Vermarktung vorgelagerten Produktionsprozesse.<br />
Beim vorsorgenden Verbraucherschutz<br />
geht es z. B. um die Vermeidung gesundheitlicher<br />
individueller Risiken ebenso wie um die Vermeidung<br />
von Kosten fçr das Solidarsystem des<br />
Gesundheitswesens. Es geht auch um die Verhçtung<br />
nachteiliger Auswirkungen der Warenproduktion<br />
auf die Umwelt und auf soziale Belange<br />
wie den <strong>Arbeit</strong>sschutz und den Erhalt von<br />
<strong>Arbeit</strong>splåtzen. Dies betrifft nicht nur den tåglichen<br />
Warenkonsum. Vorsorgender Verbraucherschutz<br />
umfasst auch Fragen der Verschuldungspråvention<br />
sowie z. B. Regelungen und Informationen<br />
zu den besten Mæglichkeiten der privaten<br />
Altersvorsorge.<br />
Der Auftrag zu einem vorsorgenden Verbraucherschutz<br />
richtet sich an alle beteiligten Akteure: die<br />
Politik, die anbietende Wirtschaft, die Verbraucherorganisationen<br />
und die einzelnen Verbraucher:<br />
± Die Politik muss die Rahmenbedingungen fçr<br />
einen vorsorgenden Verbraucherschutz gestalten.<br />
Zu den Rahmenbedingungen gehæren u. a.<br />
wirksame Instrumente zur Garantie eines fairen<br />
Wettbewerbs sowie zur Sicherung der<br />
Transparenz des Anbieterverhaltens etwa in<br />
Form eines Verbraucherinformationsgesetzes.<br />
Es gehært hierzu insbesondere die Gestaltung<br />
einer Bildungspolitik, die es den Verbrauchern<br />
ermæglicht, als mçndige Konsumenten im<br />
Marktprozess zu agieren.<br />
± Die Rolle der Wirtschaft ist es, Entscheidungen<br />
çber Investitionen, Produktwahl und Produktionsstandorte<br />
in einer langfristigen unternehmerischen<br />
Perspektive zu treffen, wirksame<br />
Eigenkontrollen durchzufçhren sowie die<br />
Glaubwçrdigkeit und Verlåsslichkeit von<br />
Kennzeichnungen und Informationen sowie die<br />
Wahrhaftigkeit in der Werbung sicherzustellen.<br />
± Verbraucherorganisationen haben eine doppelte<br />
Aufgabe: Sie wirken auf den politischen<br />
Prozess ein und kontrollieren die Wirtschafts-<br />
4 Vgl. Edda Mçller, Grundlinien einer modernen Verbraucherpolitik,<br />
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage<br />
zur Wochenzeitung Das Parlament, B 24/2001, S. 6±15.<br />
akteure z. B. durch die Wahrnehmung kollektiver<br />
Klagerechte. Sie helfen den Verbrauchern<br />
durch Beratung und die Vermittlung von Information,<br />
sich gegen unseriæse Anbieter zu<br />
wehren und als souveråne Marktteilnehmer<br />
aufzutreten.<br />
± Die Verbraucher schlieûlich mçssen erkennen,<br />
dass sich aus ihren Rechten auch Pflichten<br />
ergeben. Sie sind gefordert, die Folgen ihrer<br />
Konsumentscheidungen zu bedenken. Dies<br />
sind ± auf der Makroebene ± ækologische und<br />
soziale Folgen, die sich aus den Produktionsbedingungen<br />
von Gçtern ergeben, aber auch ±<br />
auf der Mikroebene ± Folgen fçr das private<br />
Budget und die eigene Gesundheit.<br />
Vorsorgender Verbraucherschutz bedeutet also fçr<br />
alle Akteure die Ûbernahme von Verantwortung<br />
fçr die Bewahrung bzw. Wiederherstellung einer<br />
intakten Um- und Mitwelt im unmittelbar privaten<br />
und im gesellschaftlichen Sinne. Dabei ist das<br />
Handeln der privaten Haushalte immer auch<br />
beeinflusst durch politische und wirtschaftliche<br />
Rahmenbedingungen, die færdernd oder einschrånkend<br />
wirken kænnen, umgekehrt kann das<br />
Verhalten der Verbraucher rçckwirken auf Politik<br />
und anbietende Wirtschaft.<br />
II. Nachhaltige Entwicklung und<br />
Nachhaltiger Konsum<br />
Bereits 1987 forderte der Brundtland-Bericht 5 der<br />
Weltkommission fçr Umwelt und Entwicklung:<br />
Wir benætigen ein Konzept globaler Entwicklung,<br />
¹das die Bedçrfnisse der Gegenwart befriedigt,<br />
ohne zu riskieren, dass kçnftige Generationen ihre<br />
eigenen Bedçrfnisse nicht befriedigen kænnenª.<br />
Auf diese Definition Nachhaltiger Entwicklung<br />
<strong>hat</strong> sich die UN-Konferenz ¹Umwelt und Entwicklungª<br />
1992 in Rio de Janeiro verståndigt. In der<br />
dort verabschiedeten Agenda 21 wird die Herbeifçhrung<br />
¹nachhaltiger Produktions- und Konsum-<br />
5 1983 grçndeten die Vereinten Nationen die Internationale<br />
Kommission fçr Umwelt und Entwicklung (WCED) als unabhångige<br />
Sachverståndigenkommission mit dem Auftrag,<br />
einen Perspektivbericht zur langfristigen, tragfåhigen und<br />
umweltschonenden Entwicklung im Weltmaûstab bis zum<br />
Jahre 2000 und darçber hinaus zu erarbeiten. Dieser Bericht<br />
wurde 1987 unter dem Titel ¹Our Common Futureª veræffentlicht<br />
und ist auch bekannt als ¹Brundtland-Berichtª,<br />
benannt nach der Vorsitzenden der Kommission, Gro Harlem<br />
Brundtland, der damaligen Ministerpråsidentin von Norwegen.<br />
Der Brundtland-Report und weitere Berichte lieferten<br />
die Grundlage fçr die weltweite Konferenz fçr Umwelt und<br />
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro.<br />
21 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
musterª als zentrales Handlungsfeld benannt, um<br />
eine Nachhaltige Entwicklung zu erreichen. 6<br />
Nachhaltige Entwicklung steht fçr eine Verbindung<br />
von ækonomischer Beståndigkeit, dem Erhalt<br />
der Funktionsfåhigkeit des Naturhaushalts und der<br />
Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit. Diese drei<br />
Aspekte kænnen nicht voneinander getrennt oder<br />
gar gegeneinander ausgespielt werden. 7 Es geht<br />
also darum, tragfåhige Entwicklungsszenarien zu<br />
entwickeln, die den Wechselwirkungen zwischen<br />
Sozialem, Úkologie und Úkonomie Rechnung<br />
tragen.<br />
Die Úkonomie muss sich z. B. durch die Entwicklung<br />
und den Einsatz neuer Technologien und<br />
effizienterer Produktionsverfahren dem Globalisierungs-<br />
und internationalen Konkurrenzdruck<br />
stellen und Alternativen entwickeln, die ækologisch<br />
und sozial vertråglich sind. Im Interesse des<br />
Erhalts der natçrlichen Lebensgrundlagen mçssen<br />
Schadstoffeintråge und Ressourcenverbrauch so<br />
reduziert werden, dass weder die ækonomische<br />
Handlungsfåhigkeit leidet noch soziale Hårten<br />
± z. B. mehr <strong>Arbeit</strong>slosigkeit ± entstehen. Bei dem<br />
sozialen Auftrag geht es um die Bewahrung der<br />
gesellschaftlichen und politischen Stabilitåt in den<br />
Industrielåndern und darum, eine globale soziale<br />
Gerechtigkeit so zu erreichen, dass auch bei<br />
zunehmender Weltbevælkerung und Verstådterung<br />
die Umweltbelastungen sinken und sich die Lånder<br />
der ¹Dritten Weltª entwickeln kænnen.<br />
Diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit<br />
sichern zugleich die Grundlagen fçr eine gedeihliche<br />
Volkswirtschaft. Sie sichern den langfristigen<br />
Erhalt der Basis fçr jede Produktion und jeden<br />
Konsum. Sie sorgen fçr gesellschaftliche Stabilitåt,<br />
etwa durch gerechte Læhne und humane <strong>Arbeit</strong>splåtze,<br />
fçr Gerechtigkeit zwischen den Generationen<br />
und zwischen Industrie- und Entwicklungslåndern.<br />
Sie regen Innovationen in der<br />
Produktentwicklung und beim Angebot neuer<br />
Dienstleistungen an und ermæglichen damit Vorteile<br />
im internationalen Wettbewerb. Sie erhalten<br />
die Umwelt und schonen die natçrlichen Ressourcen.<br />
8<br />
Die Verantwortung, das Konzept Nachhaltiger<br />
Entwicklung mit zu tragen und mit zu gestalten,<br />
darf nicht allein an Politik und Wirtschaft adressiert<br />
werden. Vielmehr ist dies ein Leitbild, welches<br />
das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen<br />
6 Der gesamte Text der Agenda 21 im Internet unter: http://<br />
www.oneworldweb.de/agenda21/welcome.html, zu bestellen<br />
bei: Bundesministerium fçr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,<br />
Postfach 12 06 29, 53048 Bonn.<br />
7 Siehe auch: Inforundgang bei: www.blk21.de<br />
8 Vgl. Edda Mçller, Der Nachhaltige Warenkorb, in: Unternehmen<br />
und Umwelt, 15 (2002) 2, S. 12.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
Akteure erfordert, um mit Erfolg realisiert werden<br />
zu kænnen. Mithin sind auch die Verbraucher in<br />
der Pflicht, ihr Konsumverhalten an Nachhaltigkeitskriterien<br />
auszurichten. Konsum ist nicht nur<br />
individuelle Bedçrfnisbefriedigung, sondern <strong>hat</strong><br />
vielfåltige ækologische und soziale Folgewirkungen.<br />
Damit kommt allen Konsumenten hinsichtlich<br />
ihres Nachfrageverhaltens und Lebensstils eine<br />
zentrale Rolle fçr die Nachhaltige Entwicklung zu.<br />
III. Anforderungen an<br />
die Alltagsgestaltung<br />
Die angemessene Bewåltigung und Gestaltung des<br />
Alltags in Haushalt und Familie erfordert eine<br />
Fçlle unterschiedlichster Kompetenzen, die aktiv<br />
eingesetzt werden mçssen und eng mit den verånderten<br />
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen<br />
Gegebenheiten verknçpft sind:<br />
± Die Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen<br />
erfordert ein hohes Maû an Flexibilitåt<br />
und Bereitschaft, sich immer wieder neu in<br />
Haushalt und Beruf zu positionieren.<br />
± Die Verånderung der Familienstrukturen <strong>hat</strong><br />
Auswirkungen auf grundlegende Fragen der<br />
Existenzsicherung wie die Art der Ernåhrung<br />
und die Sorge fçr die Gesundheit.<br />
± Die Wandlung der Mårkte durch Globalisierung,<br />
Virtualisierung und Deregulierung sowie<br />
der Rçckzug des Sozialstaats haben ebenfalls<br />
erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte.<br />
Nicht nur ist Mobilitåt am und fçr den <strong>Arbeit</strong>splatz<br />
erforderlich, sondern auch die Beherrschung<br />
des Internets, sei es um einzukaufen,<br />
Reisen zu buchen oder zur Informationsbeschaffung.<br />
± Privates Finanzmanagement ist ebenso notwendig<br />
wie kompliziert, ob es um die beste Anlageform<br />
der Ersparnisse geht oder um die private<br />
Altersvorsorge.<br />
± Normenkonflikte und damit verånderte Verhaltensforderungen<br />
erwachsen aus sich çberlagernden<br />
Werten. So kann etwa der Wunsch<br />
nach Individualitåt und Selbstverwirklichung<br />
mit sozial-ethischen und ækologischen Werten<br />
bei Produktion und Konsum kollidieren. Eine<br />
Fernreise z. B. dient mæglicherweise der Persænlichkeitsentwicklung,<br />
kann jedoch den<br />
Erfordernissen eines sozial und ækologisch vertråglichen<br />
Tourismus zuwiderlaufen. Wichtig<br />
bei solchen Wertekonflikten ist, dass der einzelne<br />
Verbraucher sie zu seiner Sache macht.<br />
22
Er kann die Bejahung von Werten, die kollektiven<br />
Zielen dienen, nicht anderen Akteuren<br />
çberlassen. Vielmehr kann er çber seinen Beitrag<br />
durch Reflexion seines individuellen<br />
Lebensstils, seiner ækonomischen Ressourcen<br />
und der Gestaltung des Alltags selbst entscheiden.<br />
± Schlieûlich generieren die neuen Informationsund<br />
Kommunikationstechnologien neue Verhaltensweisen<br />
bei der Beschaffung von Informationen,<br />
aber auch im Sozialverhalten und in<br />
der Kontaktaufnahme. Der Trend ± wenn auch<br />
im Moment ein wenig verlangsamt ± geht hin<br />
zur verstårkten Nutzung des Internets, ob bei<br />
E-Commerce und Onlinebanking, bei der<br />
Beschaffung von Gçtern oder bei den neuen<br />
Formen von virtueller Kommunikation. Hier<br />
muss durch die Vermittlung entsprechenden<br />
Grundwissens çber Handhabung, Chancen und<br />
Risiken die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen<br />
gesichert werden.<br />
Kurz ± und mit Ernst Bloch gesprochen ±: ¹Das<br />
Leben ist interdisziplinårª, und damit natçrlich<br />
auch der Alltag.<br />
Haushalte mçssen in der Lage sein, auf die Verånderungen<br />
und Anforderungen ihrer Lebenswelt<br />
selbstbestimmt zu reagieren, und sollten durch Bildungsangebote<br />
dabei unterstçtzt werden. Das Verhaltens-<br />
und Kenntnisrepertoire zur Bewåltigung<br />
der Alltagsanforderungen hinsichtlich des persænlichen<br />
Haushalts- und Finanzmanagements ist<br />
defizitår: Viele Menschen sind z. B. nicht in der<br />
Lage, fundiert die Haushaltseinnahmen und -ausgaben<br />
aufeinander abzustimmen oder Versicherungsvertråge<br />
zu durchschauen und sich angemessen<br />
zu versichern. Die Anzahl der verschuldeten<br />
Haushalte nimmt zu. Die Zahl der zurzeit çberschuldeten<br />
Haushalte wird auf ca. 2,7 Millionen<br />
geschåtzt. 9 Ernåhrungsverantwortung wird håufig<br />
nicht mehr selbst wahrgenommen, sondern an<br />
Fast-Food-Ketten oder an die Hersteller von Convenience-Produkten<br />
delegiert. Die Zahl der Menschen<br />
mit krankhaften Essstærungen und Fehlernåhrung<br />
steigt. So sind z. B. 51 Prozent der<br />
Erwachsenen und 23 Prozent der Kinder çbergewichtig.<br />
Insgesamt verursachen ernåhrungsbedingte<br />
Krankheiten dem Gesundheitswesen in<br />
Deutschland derzeit jåhrlich ca. 75 Milliarden<br />
Euro an Kosten, das ist ein Drittel der Gesamtkosten<br />
des Gesundheitswesens. 10<br />
9 Vgl. Gutachten der GP-Forschungsgruppe ¹Ûberschuldung<br />
in Deutschland zwischen 1988 und 1999ª, Mçnchen<br />
2000 (zitiert nach www.iff-hamburg.de).<br />
10 Vgl. Gerhard Rechtkemmer, Bundesforschungs-Anstalt<br />
fçr Ernåhrung, Karlsruhe (zitiert nach http://rcswww.urz.tudresden.de/~ak180634/4_2.html).<br />
Hinsichtlich einer wirksamen Problemlæsung<br />
bewegen wir uns in einer Art gesellschaftlichen<br />
Vakuums: Der Umgang mit Geld, Haushaltsfçhrung<br />
und Konsumverhalten sind keine Themen,<br />
çber die ¹manª als zentrale Handlungsansåtze<br />
spricht, und auch in der schulischen Allgemeinbildung<br />
stehen sie nicht im Mittelpunkt des Bildungsauftrags.<br />
Es ist ein erklårtes Ziel des Bildungssystems, nicht<br />
nur den bekannten Fåcherkanon zu bearbeiten,<br />
sondern ebenso Fåhigkeiten wie Informationsbeschaffung<br />
und -bewertung, Lernbereitschaft und<br />
Flexibilitåt zu vermitteln, die ihrerseits wieder die<br />
Alltagsbewåltigung erleichtern. Diese im Kontext<br />
allgemeiner Bildungsbemçhungen stehenden Ziele<br />
gilt es aufzunehmen und mit verbraucherrelevanten<br />
Inhalten zu fçllen. Dazu sollte die Leitidee<br />
der aktuellen bildungswissenschaftlichen und bildungspolitischen<br />
Diskussion, das Konzept der<br />
¹fåcherçbergreifenden Problemlæsekompetenzenª,<br />
aufgegriffen werden. Zielfçhrend ist hier die Definition<br />
der PISA-Studie von Problemlæsen als ¹zielorientiertes<br />
Denken und Handeln in Situationen,<br />
fçr deren Bewåltigung keine Routinen verfçgbar<br />
sindª. 11<br />
IV. Bildung fçr Haushalt<br />
und Konsum<br />
Im Folgenden werden wir nåher erlåutern, was<br />
unter Bildung fçr Haushalt und Konsum zu verstehen<br />
und mit welchen Zielen sie zu verknçpfen ist.<br />
Spåtestens seit Herbert Spencer, dem englischen<br />
Philosophen und Sozialwissenschaftler, wissen wir:<br />
¹Das groûe Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern<br />
Handeln.ª Wie jede Form von Bildung ist<br />
auch Verbraucherbildung zum Teil Reflex auf<br />
gesellschaftliche Verånderungen und verånderte<br />
gesellschaftliche Werte. So stellte z. B. der zunehmende<br />
Stellenwert der Úkologie in der æffentlichen<br />
Diskussion in den siebziger und achtziger<br />
Jahren einen tief greifenden Paradigmenwechsel<br />
in der Verbraucherbildung dar und verschob ihren<br />
Schwerpunkt von ækonomischen Fragestellungen<br />
hin zu mehr ækologischer und sozialer Verantwortlichkeit.<br />
Dem ging in den siebziger Jahren eine<br />
intensiv gefçhrte verbraucherpolitische Diskussion<br />
voraus, deren Ergebnis eine politisch und rechtlich<br />
gestårkte Position der Verbraucher und der Ver-<br />
11 Vgl. Erfassung fåcherçbergreifender Problemlæsekompetenzen<br />
in PISA, OECD/PISA Deutschland, S. 3, siehe auch<br />
S. 13 (OECD, Lernen fçr das Leben: Erste Ergebnisse der<br />
internationalen Schçlerstudie PISA 2000, Paris 2001).<br />
23 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
aucherorganisationen war und die ihrerseits<br />
positiv auf die Bildungsbemçhungen fçr Konsumenten<br />
zurçckwirkte. Als ein Ergebnis dieser<br />
Debatte veræffentlichten die Stiftung Verbraucherinstitut<br />
und die Verbraucherzentrale Nordrhein-<br />
Westfalen bereits 1984 einen Lernzielkatalog zur<br />
schulischen Verbraucherbildung, der die generellen<br />
Lernziele ¹kritisches Bewusstsein, soziale Verantwortlichkeit,<br />
ækologische Verantwortlichkeitª<br />
verbunden mit der ¹Bereitschaft zum Handelnª<br />
formulierte. Ein an diesen Kriterien ausgerichtetes<br />
Konsumverhalten wurde als ¹qualitativer Konsumª<br />
bezeichnet und deckt sich in vielen Punkten<br />
mit dem heute so genannten Nachhaltigen Konsum.<br />
12 Damit æffnete sich erstmals der Blick fçr<br />
die Vermittlung von Zielen und Werten in der Verbraucherbildung,<br />
die çber die alleinige Nutzenmaximierung<br />
hinaus weisen.<br />
Durch die abnehmende Handlungsautonomie des<br />
Staates und seine begrenzte Fåhigkeit, fçr die Verfolgung<br />
kollektiver Ziele und Werte zu sorgen,<br />
durch die Auswirkungen der Globalisierung auf<br />
den individuellen Konsum, die vermehrte Wahlfreiheit<br />
der Konsumenten aufgrund der Deregulierung<br />
der Mårkte und durch die Notwendigkeit zu<br />
mehr Eigenverantwortung z. B. in der Alters- und<br />
Gesundheitsvorsorge erhålt die Konsumentensouverånitåt<br />
heute einen noch hæheren Stellenwert,<br />
als dies in der Vergangenheit der Fall war. Aber<br />
diese Verånderungen mit ihren vielfåltigen Auswirkungen<br />
auf das persænliche Leben bleiben fçr<br />
den Einzelnen eher abstrakt, und der eigene<br />
Beitrag bleibt unklar. Die Folge ist nicht selten ein<br />
subjektives Unsicherheits- und Ohnmachtgefçhl.<br />
Um von der Unsicherheit und Ohnmacht zur<br />
¹Bereitschaft zum Handelnª zu kommen, ist Bildung<br />
notwendig. Sie muss helfen, eine Brçcke<br />
zu schlagen zwischen globalen Herausforderungen,<br />
gesellschaftlichen Aufgaben im eigenen Land<br />
und der persænlichen Lebenssituation der Einzelnen.<br />
Bildungsangebote sollten nicht nur gesellschaftliche<br />
Verånderungen verståndlich machen, sie mçssen<br />
auch Erkenntnisse çber den eigenen Beitrag<br />
an solchen Prozessen vermitteln. Schçler mçssen<br />
darçber hinaus darauf vorbereitet werden, mit<br />
plætzlich auftauchenden Risiken umzugehen, um<br />
diese mæglichst eigenverantwortlich bewåltigen zu<br />
kænnen. Als Leitbild steht hier der ethisch verantwortlich<br />
handelnde Verbraucher, der zwar als<br />
Einzelner ein Recht auf Schutz <strong>hat</strong> und die Mæglichkeit<br />
zur Gegenwehr haben muss, sich aber<br />
der Konsequenzen seiner Konsumentscheidungen<br />
12 Vgl. Verbraucherzentrale NRW/Stiftung Verbraucherinstitut<br />
(Hrsg.), Verbrauchererziehung in der Schule. Ein<br />
Zielkatalog, Dçsseldorf ± Berlin 1984.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
bewusst ist und damit auch Mitverantwortung<br />
çbernimmt fçr kçnftige soziale und ækologische<br />
Entwicklungen, ob sie nun globaler oder lokaler<br />
Natur sind. 13<br />
Daraus ergeben sich Verånderungen im Konsumverhalten<br />
und in der Alltagsgestaltung, die alte<br />
Gewohnheiten der Beschaffung, Nutzung, des Verbrauchs<br />
und der Entsorgung von Waren auûer<br />
Kraft setzen; diese mçssen durch neue, nachhaltige<br />
Verhaltensweisen ersetzt werden. 14 Gleiches gilt<br />
fçr den Bereich der Dienstleistungen, insbesondere<br />
die persænliche Finanzplanung, fçr einen<br />
reflektierten Umgang mit den Medien und fçr die<br />
Entwicklung einer eigenen Familien- bzw. Haushaltskultur.<br />
Es ist ein hoher Anspruch, der hier an die Verbraucher<br />
gerichtet wird. Er zeichnet ± wie alle<br />
Leitbilder ± das ideale Ergebnis eines Lernprozesses,<br />
das nicht eben realitåtsnah erscheint, genauso<br />
wenig wie ehemals das Leitbild des ¹homo oeconomicusª,<br />
der seine Konsumhandlungen allein<br />
nach der individuellen Nutzenmaximierung ausrichten<br />
sollte. Bei der Gestaltung des Lernprozesses,<br />
der zu einer Annåherung an das Leitbild fçhren<br />
soll, ist zu berçcksichtigen, dass Konsum- und<br />
andere Alltagsentscheidungen immer auch soziale<br />
und psychische Implikationen haben. Håufig sind<br />
es nicht reflektierte Routinen oder auch Verhaltensweisen<br />
aufgrund von Familientraditionen.<br />
Dieser persænliche Hintergrund muss in der Bildung<br />
fçr Verbraucher berçcksichtigt werden, um<br />
den Schritten in Richtung Verantwortlichkeit eine<br />
solide Basis zu geben.<br />
Die in der Verbraucherbildung zu vermittelnden<br />
Voraussetzungen fçr verantwortliche Konsumentscheidungen<br />
lassen sich in vier Punkten zusammenfassen:<br />
± Konsumenten verfçgen çber problembezogenes<br />
Wissen und kennen mægliche Verhaltensalternativen;<br />
sie sind in der Lage, sich<br />
Informationen zu beschaffen und diese auszuwerten.<br />
± Sie haben entsprechende Werte, Einstellungen<br />
und Haltungen fçr sich akzeptiert.<br />
± Sie reagieren angemessen auf materielle oder<br />
immaterielle Verhaltensanreize, d. h., sie sind<br />
sich des individuellen Zusatznutzens einer Entscheidung<br />
bewusst.<br />
± Schlieûlich haben sie die Mæglichkeit, Auswirkungen<br />
ihres neuen Verhaltens zu erproben<br />
und wahrzunehmen.<br />
13 Vgl. E. Mçller (Anm. 4).<br />
14 Vgl. auch C. Empacher (Anm. 3).<br />
24
V. Der Beitrag der Schulen<br />
Es muss im Interesse einer Gesellschaft liegen, die<br />
Menschen zur individuell und gesellschaftlich verantwortlichen<br />
Gestaltung des Alltags zu befåhigen,<br />
und damit ist es Sache der Schulen, dies zu unterstçtzen.<br />
Bildungsangebote fçr Haushalt und Konsum<br />
sind in den Bundeslåndern und dort wieder in<br />
den verschiedenen Schultypen unterschiedlich<br />
verortet und repråsentiert. Sie finden sich z. B.<br />
wieder in den Fåchern <strong>Arbeit</strong>slehre, Sozialkunde,<br />
Hauswirtschaft. Diese wiederum variieren nach<br />
Stundenzahl und in ihren Curricula.<br />
Ebenso wie Verbraucherpolitik eine Querschnittsaufgabe<br />
ist, umfasst die Bildung fçr Verbraucher<br />
ein breites Themenspektrum. Deshalb låge es<br />
nahe, diese in die Curricula der bereits etablierten<br />
Schulfåcher zu integrieren. Fçr diese Læsung sprechen<br />
gewichtige Argumente: Der Fåcherkanon<br />
bliebe unveråndert, jedes Schulfach kænnte aus<br />
der Verbraucherperspektive betrachtet werden,<br />
und eine interdisziplinåre Bearbeitung trçge der<br />
Tatsache Rechnung, dass das Thema Konsum<br />
nicht eindimensional betrachtet werden kann, sondern<br />
Auswirkungen auf viele Bereiche <strong>hat</strong>.<br />
Obwohl Verbraucherthemen in den Curricula der<br />
oben genannten Fåcher enthalten sind, ist in der<br />
Praxis ihre ausreichende Bearbeitung håufig nicht<br />
gewåhrleistet. Verbraucherthemen werden bei der<br />
Integration in verschiedene Fåcher nicht selten<br />
zugunsten von fçr wichtiger gehaltenen Inhalten<br />
beim Lernpensum vernachlåssigt.<br />
Der andere Weg ist die Schaffung eines eigenen<br />
Schulfachs oder Lernfeldes. Von verschiedenen<br />
Seiten wird derzeit vorgeschlagen, ein Fach ¹Wirtschaftª<br />
an den Schulen einzufçhren. 15 Lehr- und<br />
Lernziele dieses Fachs werden begrçndet mit der<br />
Notwendigkeit, junge Menschen besser auf die<br />
Erfordernisse der <strong>Arbeit</strong>s- und Konsumgçtermårkte<br />
und die Wahrnehmung von Aufgaben in<br />
Unternehmen und der Unternehmensfçhrung vorzubereiten.<br />
Ihnen sollen Kenntnisse çber die Rolle<br />
des Staates im Verhåltnis zur Selbstregulierung des<br />
Marktsystems sowie die Mechanismen der internationalen<br />
Wirtschaftspolitik vermittelt werden.<br />
15 Vgl. z. B. das gemeinsame Projekt der Bertelsmann Stiftung,<br />
der Heinz Nixdorf Stiftung, der Ludwig-Erhard-Stiftung<br />
und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft ¹Wirtschaft in die<br />
Schule!ª, das in Zusammenarbeit mit den Bundeslåndern<br />
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Wçrttemberg<br />
u. a. çber den Weg der Lehrerfortbildung den Wirtschaftsunterricht<br />
stårken will (siehe auch www.bertelsmann-stiftung.de).<br />
Eine weitere Initiative kommt von der BDA und<br />
dem DGB in Zusammenarbeit mit Lehrerverbånden und<br />
dem Bundeselternrat, siehe auch: www.sowi-online.de<br />
Eine entsprechende Initiative der Bertelsmann<br />
Stiftung wendet sich z. B. als Weiterbildungsangebot<br />
an Lehrende der Sekundarstufe II und wird<br />
auf einer Lernplattform im Internet bereitgestellt.<br />
16<br />
Zu kurz kommen bei diesen Initiativen Inhalte,<br />
die sich auf die Anforderungen an die Alltagsbewåltigung<br />
sowie die Beschreibung der Rolle privater<br />
Haushalte und ihrer Leistungen fçr die Gestaltung<br />
von Wirtschaft und Gesellschaft beziehen.<br />
Dies gilt neben den Anforderungen an das Konsumverhalten<br />
beispielsweise fçr Fragen der Kindererziehung<br />
oder des Engagements in Vereinen<br />
und Verbånden. Zu wenig im Blick der Bildung ist<br />
hier generell der private Haushalt als Produzent<br />
von Humankapital und kollektiven Gçtern.<br />
Wir wollen hier ebenfalls fçr die Einfçhrung eines<br />
Schulfaches ¹Wirtschaftª plådieren, dabei jedoch<br />
Lehrinhalte, welche die Fåhigkeit zur Alltagsbewåltigung<br />
betreffen, stårker berçcksichtigt wissen.<br />
Generell deckt ein solches Fach ¹Wirtschaftª ein<br />
breites Themenspektrum ab. Es muss interdisziplinår<br />
angelegt sein und Themen aus Wirtschaft und<br />
Gesellschaft primår aus einer Haushalts- und Verbraucherperspektive<br />
bearbeiten. Neben den oben<br />
erwåhnten Inhalten sollte ein Fach ¹Wirtschaftª<br />
folgende Schwerpunktthemen behandeln:<br />
± Rolle und Bedeutung der Haushalte und Familien<br />
als verantwortliche Akteure in Wirtschaft<br />
und Gesellschaft; 17<br />
± Fragen der ækonomischen, ækologischen und<br />
sozialen Dimensionen des tåglichen Konsums<br />
von Gçtern und Dienstleistungen;<br />
± Grundlagen çber die Funktionsweisen globaler<br />
Finanz- und Konsumgçtermårkte;<br />
± Wissen çber das Verhåltnis von Kosten und<br />
Preisen, d. h. çber das Problem der Externalisierung<br />
sozialer und ækologischer Kosten des<br />
Konsums;<br />
± finanzielle Allgemeinbildung, die çber Finanzdienstleistungen<br />
informiert, an der eigenen<br />
Lebenswelt ansetzt und situationsbezogen vorgeht;<br />
18<br />
16 Vgl. www.oekonomische-bildung-online.de<br />
17 Vgl. auch Michael-Burkhard Piorkowsky, Wirtschaftliche<br />
Allgemeinbildung in den Schulen, in: Dieter Korczak<br />
(Hrsg): Bildungs- und Erziehungskatastrophe? Was unsere<br />
Kinder von uns lernen sollen, Interdisziplinåre Schriftenreihe,<br />
Bd. 25, Opladen 2003 (i. E.). Anmerkung der Redaktion:<br />
Siehe auch den Beitrag des Autors in dieser Ausgabe.<br />
18 Vgl. Udo Reifner, Der lernende Kapitalismus. Finanzielle<br />
Allgemeinbildung als Schuldenpråvention, Institut<br />
fçr Finanzdienstleistungen e. V. Hamburg, Website: www.iffhamburg.de;<br />
Version vom 24. Juli 2002.<br />
25 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
± Bildung fçr eine Nachhaltige Entwicklung als<br />
çbergreifende regulative Idee, die eine Klammer<br />
darstellt, um die Notwendigkeit und den<br />
Beitrag individueller Konsumentscheidungen<br />
zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in<br />
einer langfristigen Perspektive zu verdeutlichen.<br />
Ein solches Fach ¹Wirtschaftª sollte in allen Schultypen<br />
der Sekundarstufen I und II eingefçhrt werden.<br />
In der Grundschule wåren im Rahmen des<br />
Sachunterrichts erste Grundkenntnisse zu vermitteln.<br />
Um zu verhindern, dass das Fach ¹Wirtschaftª<br />
zu einem wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Propådeutikum ohne konkreten Bezug zum tåglichen<br />
Leben wird, sollten die Inhalte sich immer an<br />
den Erfahrungen und an der Lebenswirklichkeit<br />
der Schçler orientieren.<br />
Gerhard de Haan <strong>hat</strong> in seinem Aufsatz ¹Die<br />
Kernthemen der Bildung fçr eine nachhaltige Entwicklungª<br />
19 den Begriff der ¹Gestaltungskompetenzª<br />
geprågt. Dabei geht es ihm nicht allein um<br />
Wissenserwerb, vielmehr soll die Bereitschaft zu<br />
aktiven Verånderungen gefærdert werden. Gestaltungskompetenz<br />
umfasst neben den oben dargestellten<br />
Inhalten eine Reihe von Teilkompetenzen<br />
wie u. a. vorausschauendes Denken, weltoffene<br />
Wahrnehmung, interdisziplinåres <strong>Arbeit</strong>en, Partizipationskompetenz,<br />
Planungs- und Umsetzungskompetenz<br />
und die Fåhigkeit zur distanzierten<br />
Reflexion çber individuelle und kulturelle Leitbilder.<br />
So wie wir junge Menschen im Rahmen der politischen<br />
Bildung zu Staatsbçrgern erziehen wollen,<br />
19 Vgl. Gerhard de Haan, in: Zeitschrift fçr Entwicklungspådagogik,<br />
(2002) 1.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
mçssen wir sie heute auch schulen, damit sie in<br />
einem von der Politik nur noch eingeschrånkt zu<br />
steuernden Markt zu verantwortlich handelnden<br />
Marktteilnehmern werden. Sie mçssen durch Bildung<br />
befåhigt werden, sowohl ihren eigenen Alltag<br />
selbstbestimmt und ihrer spezifischen Situation<br />
angepasst zu gestalten als auch sich produktiv und<br />
konstruktiv in gesellschaftliche Verånderungsprozesse<br />
einzubringen.<br />
VI. Fazit<br />
Um vorsorgenden Verbraucherschutz zu verwirklichen,<br />
der ohne verantwortliche Konsumenten<br />
nicht erreichbar sein wird, brauchen wir ein Schulfach<br />
¹Wirtschaftª. Es sollte die Leistungen aller<br />
am Marktprozess beteiligten Akteure sowie die<br />
weltweiten Zusammenhånge erklåren. Ausgangsund<br />
Mittelpunkt eines Curriculums und Bildungskanons<br />
sollte der private Haushalt und das Individuum<br />
im Sinne von Verbraucherbildung sein. Notwendig<br />
ist hierfçr eine pådagogische Konzeption,<br />
die es ermæglicht, Wissensvermittlung mit der<br />
Erfahrungswelt der Schçler und ihren kçnftigen<br />
Aufgaben als Konsumenten, Grçnder von Familien<br />
und Verantwortliche fçr das Management<br />
eines privaten Haushalts und die Gestaltung ihres<br />
Lebensalltags zu verknçpfen.<br />
Internetverweise der Autorinnen:<br />
www.vzbv.de<br />
http://lernerfolg.vzbv.de<br />
www.nachhaltigkeitsrat.de<br />
www.neuehauswirtschaft.de<br />
26
Dieter Korczak<br />
Was sollen unsere Kinder von uns lernen<br />
Die veræffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie<br />
haben ein publizistisches Erdbeben in den Medien<br />
ausgelæst. Zum allgemeinen Schrecken befinden<br />
sich Deutschlands Schçlerinnen und Schçler<br />
bestenfalls im Mittelfeld. Selbst die Kulturtechnik<br />
des Lesens wird von zahlreichen Schçlern im Alter<br />
von 15, 16 Jahren schlecht beherrscht. Eifrig werden<br />
in Feuilletons und Leserbriefen Ursachenanalysen<br />
betrieben und Læsungsvorschlåge unterbreitet.<br />
Die Schwåchen unseres Bildungssystems sind<br />
jedoch schon långer bekannt. Strapazierte Lehrerinnen<br />
und Lehrer, çberfçllte Klassen, vollgestopfte<br />
Lehrplåne, hyperaktive, motivations- und<br />
lernschwache Schçler, schlechte Integration auslåndischer<br />
Schçler und leistungsorientierte, çberforderte<br />
Eltern sind seit einigen Jahren Alarmsignale.<br />
Klagen çber Bildungssysteme sind nicht neu. Im<br />
16. Jahrhundert rçgte der franzæsische Philosoph<br />
und Essayist Michel Eyquem de Montaigne bereits,<br />
dass Sorge und Aufwand der Eltern und<br />
Erzieher auf nichts anderes abzielen, ¹als uns den<br />
Kopf mit Wissen anzufçllen; von Urteil und Charakter<br />
ist nicht viel die Rede . . . Wir mçhen uns<br />
nur, das Gedåchtnis vollzupfropfen und lassen Verstand<br />
und Gewissen leerª 1 .<br />
Selbst von einem vollgestopften Gedåchtnis kann<br />
bei deutschen Schçlern im von UNESCO, Europåischer<br />
Union und deutscher Politik und Wissenschaft<br />
unisono verkçndeten neuen Zeitalter des<br />
¹lebenslangen Lernensª nicht die Rede sein. Die<br />
¹Informations- und Wissensgesellschaftª baut auf<br />
dieses Konzept. Betrachtet man jedoch die Leistungen<br />
der Schçlerinnen und Schçler von heute,<br />
kann man fçr die Gesellschaft von morgen, jedenfalls<br />
was Deutschland angeht, nur skeptisch sein.<br />
Auf der Suche nach Verantwortlichen fçr diese<br />
Misere bieten sich ¹die çblichen Verdåchtigenª an:<br />
die Eltern, Erzieher und Lehrer in Kindergarten<br />
und Schule, die Institution Schule als solche, die<br />
Bildungspolitik im Speziellen, die Medien und die<br />
Der Beitrag stçtzt sich auf Dieter Korczak (Hrsg.), Bildungsund<br />
Erziehungskatastrophe? Was unsere Kinder von uns lernen<br />
sollten, Wiesbaden 2003 (i. E.)<br />
1 Michel de Montaigne, Essais, Stuttgart 1953.<br />
Neusser Thesen zur Bildungspolitik<br />
Wirtschaft im Besonderen und die Modernisierung<br />
der Gesellschaft im Allgemeinen.<br />
Fçr die einen ist es die Krise der Våter, die als Identifikationsfiguren<br />
in der Erziehung der Jungen fast<br />
vællig ausfallen. Fçr die anderen bleibt echte Erziehung<br />
im Elternhaus auf der Strecke, da der Nachwuchs<br />
vor dem Fernseher oder dem Computer<br />
geparkt wird. In Deutschland sitzen beispielsweise<br />
Kinder zwischen vier und vierzehn Jahren tåglich<br />
eine Stunde und 41 Minuten vor dem Fernseher,<br />
miteinander geredet wird in den Familien jedoch<br />
nur fçr 25 Minuten am Tag. 2 Schlieûlich wird als<br />
Argument ins Feld gefçhrt, dass Mçtter und Våter<br />
in ihrer verbissenen Juvenilitåt keine Reibungsflåche<br />
mehr fçr die Kinder bæten, den Eltern fehle es<br />
an Erfahrens- und Wissensvorsprung.<br />
Nach den Erkenntnissen der Hirnforschung ist<br />
unbestritten, dass das Gehirn in der Jugendphase<br />
durch die Art seiner Nutzung gewissermaûen<br />
¹programmiertª wird. Emotionale Zuwendung<br />
und Bindung liefern danach die Grundvoraussetzung<br />
fçr Sicherheit und Selbstwertgefçhl im<br />
gesamten spåteren Leben. ¹Das Ausmaû und die<br />
Art der Vernetzung neuronaler Verschaltungen,<br />
insbesondere im frontalen Kortex, hångt also ganz<br />
entscheidend davon ab, womit sich Kinder und<br />
Jugendliche besonders intensiv beschåftigen, zu<br />
welcher Art der Benutzung ihres Gehirn sie im<br />
Verlauf des Erziehungs- und Sozialisationsprozesses<br />
angeregt werden.ª 3<br />
Eine Richtschnur fçr das eigene Lernen, um sich<br />
anzustrengen, mæglichst viel Wissen, Fåhigkeiten<br />
und Fertigkeiten zu erwerben, muss vorhanden<br />
sein. Sie wird entweder durch das elterliche Vorbild<br />
oder durch die schulische Erziehung geliefert.<br />
In der Anwendung von und im Umgang mit dem<br />
Wissen unterscheidet sich der gebildete Mensch<br />
vom halb- und ungebildeten. Bildung ist Formung<br />
der Existenz, ist der leichte Umgang mit Wissen,<br />
ist die an Kenntnis vieler Dinge reiche Seele, ist<br />
kultivierter Geschmack und am Objekt geschulte<br />
Urteilskraft. Jçrgen Oelkers weist mit Recht darauf<br />
hin, dass Bildung aber auch mit der Akzep-<br />
2 Die Ergebnisse der Studie der European Psychoanalytic<br />
and Psychodynamic Association sind zitiert nach einer Pressemeldung<br />
von dpa vom 4. 9. 2002.<br />
3 Gerald Hçther in seinem Vortrag auf dem Bildungskongress<br />
in Ulm am 29. 4. 2002.<br />
27 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
tanz von Schwierigkeiten, mit Erfahrungen des<br />
Nichtkænnens und mit herausfordernden Krånkungen<br />
des eigenen Ungençgens zu tun <strong>hat</strong>. 4<br />
Wenn John Irving seine Protagonistin in dem<br />
Roman ¹Witwe fçr ein Jahrª erklåren låsst: ¹Zwar<br />
håtte sie sich mehr Bildung fçr einen græûeren<br />
Teil der Bevælkerung gewçnscht, aber zugleich<br />
war sie davon çberzeugt, dass Bildung etwas war,<br />
womit die wenigsten Menschen, die ihr begegneten,<br />
etwas anfangen konntenª, 5 wird uns bewusst,<br />
worin die eigentliche Bildungskatastrophe liegt.<br />
Eltern wie Schule mçssen deshalb fçr sich selbst<br />
verbindliche Antworten dafçr finden, wie sie ihre<br />
Erziehungsziele eingebettet sehen wollen. Geschichte,<br />
Philosophie und Literatur liefern fçr<br />
diese notwendige Orientierung Wegweiser, denn<br />
keiner bricht als vællig leere Hçlse in die <strong>Zukunft</strong><br />
auf. Die kulturellen Traditionen der Antike und<br />
Europas, die gemeinsame Geschichte sind Fundamente,<br />
auf die Gegenwart und <strong>Zukunft</strong> aufbauen.<br />
Zeichen wie ¹Tschernobylª, ¹BSEª, ¹Klimaerwårmungª,<br />
¹Prestigeª 6 oder ¹11. Septemberª stehen<br />
nicht im luftleeren Raum, sondern kænnen durch<br />
die Rçckbesinnung auf vorausgegangene wirtschaftliche<br />
und politische Entwicklungen in ihrer<br />
Bedeutung erfasst und eingeordnet werden. Offensichtlich<br />
haben die Erwachsenen die Welt nicht<br />
mehr im Griff. Ungeachtet dessen erwarten die<br />
Heranwachsenden aber Antworten auf Fragen:<br />
Wie kommt man ohne Sicherheit zurecht und<br />
çbernimmt gleichwohl Verantwortung? Wie kann<br />
man in einer sich veråndernden Welt Prinzipien<br />
treu bleiben? Wie entwickelt man eigenståndige<br />
Ansichten und Auffassungen, durch welche die<br />
Informationsflut hinterfragt werden kann?<br />
Wenn wir die Kinder unserer Gesellschaft<br />
zukunftsfåhig erziehen und unterrichten wollen,<br />
dann mçssten wir uns das 21. Jahrhundert vorstellen<br />
kænnen, die Lebensspanne von çber drei<br />
Generationen. Das Problematische an der <strong>Zukunft</strong><br />
ist jedoch, dass sie einerseits ungewiss, aber dennoch<br />
nicht gånzlich offen, andererseits von uns vor<br />
den nachfolgenden Generationen zu verantworten<br />
ist. 7 Wir wissen jedoch ± trotz aller wissenschaftlichen<br />
und wirtschaftlichen Vorhersagen und Prognosen<br />
± nicht einmal, wie die ersten Jahrzehnte<br />
des 21. Jahrhunderts aussehen werden. Die Ungewissheit<br />
darçber reduziert sich insofern, als wir<br />
4 Vgl. Jçrgen Oelkers, Und wo, bitte, bleibt Humboldt?, in:<br />
Die Zeit vom 27. 6. 2002.<br />
5 John Irving, Witwe fçr ein Jahr, Zçrich 1999, S. 319.<br />
6 ¹Prestigeª ist der Name eines unter bahamaischer Flagge<br />
fahrenden Tankers, der mit 60 000 Tonnen Rohæl vor der<br />
Kçste Galiziens im November 2002 auseinanderbrach.<br />
7 Darauf weist eindringlich Hartmut von Hentig hin: Ach,<br />
die Werte! Ûber eine Erziehung fçr das 21. Jahrhundert,<br />
Mçnchen ± Wien 1999.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
nach wie vor die Vorstellungen çber Menschenwçrde<br />
und Demokratie, çber Gewaltenteilung<br />
und den contrat social teilen. Die Mechanik der<br />
Machtpolitik und die Natur bleiben weitgehend<br />
gleich, die elektronische Revolution <strong>hat</strong> gerade<br />
erst begonnen, zumindest die nahe <strong>Zukunft</strong> wird<br />
deshalb deutliche Zçge der Gegenwart tragen. Fçr<br />
alles Weitere tragen die gegenwårtigen Akteure in<br />
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik die Verantwortung.<br />
Sie haben sich weltweit 1992 in Rio de<br />
Janeiro dazu verpflichtet, dem Prinzip der sustainable<br />
development zu folgen. Wie die Nachfolgekonferenz<br />
in Johannesburg 2002 gezeigt <strong>hat</strong>, ist<br />
das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung jedoch<br />
(leider) immer noch mehr ein Schlagwort als<br />
Anleitung zum praktischen Handeln. Kinder und<br />
Schçler zukunftsfåhig zu erziehen und zu unterrichten,<br />
erfordert deshalb ein gesellschaftlich formuliertes<br />
Wollen und eine gemeinsame Anstrengung<br />
von Staat, Gesellschaft, Eltern und Schulen.<br />
Der Auftrag der Schulen ist in Abhångigkeit von<br />
den Schçlerzahlen, dem Leistungsniveau, den<br />
Lerngeschwindigkeiten, dem zu vermittelnden<br />
Stoff und der dafçr zur Verfçgung stehenden<br />
Zeit zwangslåufig begrenzt. Aber: Ein Wandel der<br />
Schulen und der Lernkultur ist nicht erst seit PISA<br />
dringend notwendig. Es wird seit Jahrzehnten an<br />
Schulen weitgehend frontal unterrichtet; Expression,<br />
Stil, Selbstdarstellung und die Verarbeitung<br />
des Wissens spielen kaum eine Rolle, das heiût,<br />
sowohl Kreativitåt wie Verstehen, Umsetzen,<br />
Bewerten und Anwenden kommen zu kurz. Es<br />
geht aber auch um die Art und Weise, wie alle<br />
Beteiligten dem Phånomen des Lernens begegnen.<br />
Wie håufig ist Schule primår eine Pflichtveranstaltung<br />
fçr Lehrer und Schçler, in der reglementiert<br />
Zeit totgeschlagen wird? Wie viele Lehrerinnen<br />
und Lehrer, Schçlerinnen und Schçler gehen mit<br />
Lust in die Schule, weil sie dort sinnvolles Wissen<br />
vermitteln bzw. fçr das Leben lernen kænnen? Wir<br />
wissen es nicht. Fest steht: Das Interesse am<br />
Potenzial des einzelnen Lehrers und des einzelnen<br />
Schçlers muss wachsen, so dass individuelle Færderungen<br />
bei beiden mæglich sind. Fçr Schçler ist<br />
dies in kleinen Klassen leichter gegeben als in<br />
groûen. Unverståndlicherweise sind in allen Bundeslåndern<br />
die Klassen zu Beginn der ¹Lern- und<br />
Schulkarriereª am græûten. Kindern, die mit sechs<br />
Jahren in die Schule eintreten und hoch motiviert<br />
sind zu lernen, ist håufig nach den Zåhmungs- und<br />
Båndigungsritualen der ersten beiden Jahre die<br />
Lust am Lernen vergangen. Nicht nur William<br />
Philipps, sondern auch Douglas Osherhoff ± beide<br />
selbst Nobelpreistråger 8 ± sind der Ansicht, dass<br />
8 Aussagen auf dem Nobelpreistrågertreffen in Lindau laut<br />
Die Woche vom 7. 9. 2001.<br />
28
der kindliche Kern, der Kreativitåt speist, die<br />
Neugier, den Kindern systematisch ¹ausgetriebenª<br />
wird. Klassengræûen von 15 bis 20 Schçlern sollten<br />
daher von der ersten Klasse an in <strong>Zukunft</strong> die<br />
Norm sein. Dies ist eine Investition in die <strong>Zukunft</strong><br />
der deutschen Gesellschaft, fçr die das notwendige<br />
Geld zur Verfçgung gestellt werden muss. Es<br />
reicht keineswegs, hier auf ¹public-private-partnershipª<br />
zu hoffen und zu vertrauen. ¹Wenn Fastfood-Ketten,<br />
Sportartikelhersteller und Computerkonzerne<br />
einspringen, um Finanzlçcken zu<br />
schlieûen, bringen sie ihr eigenes Bildungsprogramm<br />
mit . . . Sie kåmpfen darum, dass ihre Marken<br />
nicht mehr Zusatz, sondern Gegenstand der<br />
Ausbildung werden, nicht mehr Wahlfach, sondern<br />
Kernfach.ª 9<br />
9 Naomi Klein, NO LOGO !, Mçnchen 2001, S. 105 f.<br />
Neusser Thesen zur Bildungspolitik<br />
Auf der 59. Jahrestagung der Interdisziplinåren<br />
Studiengesellschaft e. V. in Neuss 2002 wurde versucht,<br />
eine Brçcke zwischen Elternhaus, Schule<br />
und Gesellschaft zu schlagen mit dem Ziel, einen<br />
sachgerechten Katalog fçr Bildungs- und Erziehungsziele<br />
sowie adåquate Unterrichtsformen zu<br />
erarbeiten. 10 Die Bewertung, ob wir uns in einer<br />
Bildungs- und Erziehungskatastrophe befinden<br />
oder nur in einer kritischen Mangelbewirtschaftung,<br />
hångt sicher vom Standpunkt des Betrachters<br />
ab. Es wåre jedoch zu wçnschen, dass die in Neuss<br />
formulierten Thesen zur Bildungspolitik nicht nur<br />
Gehær finden, sondern auch umsetzungsorientiert<br />
in der Bildungspolitik aufgegriffen werden.<br />
10 Vortråge und Empfehlungen dieser Tagung vgl. Dieter<br />
Korczak (Hrsg.), Bildungs- und Erziehungskatastrophe? Was<br />
unsere Kinder von uns lernen sollten, Wiesbaden 2003 (i. E.).<br />
1. Fçr eine zukunftsfåhige Gesellschaft benætigen wir die Erziehung zu Toleranz, Verantwortungsbereitschaft,<br />
Soziabilitåt und historischem Bewusstsein, die Færderung der Kreativitåt und der Fåhigkeit, vernetzt<br />
zu denken. Bildung ist die immaterielle Ausstattung, die uns befåhigt, uns und unsere Welt zu verstehen,<br />
die notwendigen Fertigkeiten zur Daseinsbewåltigung und -gestaltung zu erwerben, Chancen zu<br />
nutzen und Gefahren abzuwehren.<br />
2. Die Bildung und Stårkung unserer Persænlichkeit geschieht zuerst innerhalb frçhkindlicher Bindungsbeziehungen,<br />
die wiederum die Bçhne bereiten fçr unverzichtbare Erfahrungen in der Gleichaltrigenwelt.<br />
Das Recht des Kindes auf Achtung existiert von der ersten Minute seines Lebens an und muss<br />
sowohl von Eltern wie Lehrern respektiert werden. Denn: Erziehungskompetenz ist vor allem Beziehungskompetenz.<br />
3. Die Vorbildfunktion auf allen gesellschaftlichen Ebenen muss wieder Wirklichkeit werden: Eltern, Lehrer,<br />
Politiker, Unternehmer sollten die Werte vorbildhaft vorleben, die sie predigen. Gerade die elterliche<br />
Erziehungskompetenz und Vorbildfunktion sollte unbedingt gestårkt werden (z. B. durch frçhe Hilfen,<br />
Beratung, Begleitung, Entlastung).<br />
4. Kindergarten und Grundschule mçssen gleichwertige Systeme sein und eine hæhere gesellschaftliche<br />
Akzeptanz erfahren.<br />
5. Viele Kinder wollen mehr lernen, als dies gegenwårtig in Kindertageseinrichtungen der Fall ist. Die Ausbildung<br />
der Erzieher/innen muss deshalb verbessert werden, es mçssen stårker vorschulische Lernangebote<br />
eingefçhrt werden und Lern- und Erfahrungswelten fçr Kinder aller Milieus zur Verfçgung stehen.<br />
Die (Mutter-)Sprache sollte gefærdert, die Wahrnehmung sozialer Konfliktsituationen trainiert, motorisch-sensorische<br />
Fåhigkeiten unterstçtzt werden.<br />
6. Schulbildung ist mehr denn je Faktor des gesellschaftlichen Wandels und sollte die verånderte gesellschaftliche<br />
Wirklichkeit reflektieren. Interkulturelles Denken und Handeln ist ein Bestandteil des alltåglichen<br />
Lebens. Die Lebens- und Berufslaufbahnen sind entstandardisiert worden. Im Prozess des Wissenserwerbs<br />
mçssen deshalb eigene Erfahrungen und Kompetenzen eingebracht werden kænnen.<br />
7. Die Ausbildung der Lehrer muss professionalisiert werden. Pådagogisch-psychologische Kenntnisse<br />
sowie Kenntnisse çber Lernstærungen, Ûbungen zur Selbstreflexion und der didaktische Umgang mit<br />
Gruppen mçssen ebenso Bestandteile der Ausbildung werden wie Berufserfahrungen in Form von<br />
Praktika in unterschiedlichen Berufen.<br />
29 Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003
8. Die Schule muss wieder ihre Mitte zwischen Ideal und Realitåt finden.<br />
a) Vor allem in der Primarstufe sollten die Schçlerzahlen klein sein (max. 15 Schçler), die Schulzeit<br />
sollte maximal 12 Jahre betragen.<br />
b) Die Lernarbeit der Kinder muss im gesellschaftlichen Bewusstsein gleichwertig zur Berufsarbeit der<br />
Erwachsenen werden.<br />
c) Lesen, Erzåhlen und das freie Sprechen mçssen vom ersten Schuljahr an geçbt werden.<br />
d) Mæglichst viele Lehrinhalte sollten mit einer Anwendungsmæglichkeit verbunden, Projektarbeit<br />
sollte Bestandteil jeder schulischen <strong>Arbeit</strong> werden.<br />
e) Das pådagogische Gespråch çber die Schçler (und mit ihnen) muss institutionalisiert werden: Lehrer<br />
brauchen grundsåtzlich Supervision und Raum fçr die Selbstreflexion.<br />
f) Die festen, verbindlichen Lernfelder sollten sein: Deutsch, Mathematik, Geschichte/Erdkunde,<br />
Fremdsprachen, Naturwissenschaft, Sport, Kunst/Musik, Philosophie.<br />
g) Es sollte eine umfassende ¹Allgemeine Wirtschaftslehreª fçr den Schulunterricht entwickelt und an<br />
allen Schulformen und -stufen eingefçhrt werden.<br />
h) Es sollten Foren fçr jçngere, mittlere und åltere Schçler geschaffen werden, in denen sie ihre Fertigkeit<br />
pråsentieren kænnen. Deshalb sollten gezielt Talente çber die Grundfertigkeiten hinaus gefærdert<br />
werden.<br />
i) Regelmåûige Leistungsvergleiche zwischen Lehrern, zwischen Schulen gehæren zukçnftig zum Standard.<br />
Die selbstståndige Schule soll im Wettbewerb eine Chance zum Vergleich und zur Entwicklung<br />
eines eigenståndigen Profils bekommen.<br />
j) Bei der Entwicklung der Schulkonzepte mçssen die verschiedenen Ressourcen und sozialstrukturellen<br />
Bedingungen vor Ort unbedingt berçcksichtigt werden.<br />
10. Neue Institutionen der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Elternhaus, zwischen Gesundheitswesen,<br />
Jugendåmtern, Schulpsychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Schulen sind notwendig.<br />
11. Kein Schulsystem kann mehr leisten, als es der Gesellschaft wert ist.<br />
12. Die Schule muss sich vom Niederlagensystem zum Erfolgssystem wandeln, um die Humanressource<br />
Bildung entfalten zu kænnen und fçr Schçler wie Lehrer motivierend und stimulierend zu sein.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte B 9/2003<br />
30
Maria Thiele-Wittig<br />
Dr. sc. agr., M. Sc., geb. 1938; Professorin fçr Hauswirtschaft<br />
an der Universitåt Mçnster; Vorsitzende der Deutschen<br />
Gesellschaft fçr Hauswirtschaft e.V.<br />
Anschrift: Institut fçr Haushaltswissenschaft und Didaktik der<br />
Haushaltslehre, Westfålische Wilhelms-Universitåt Mçnster,<br />
Philippistraûe 2, 48149 Mçnster.<br />
E-Mail: thielwit@uni-muenster.de<br />
Veræffentlichungen u. a.: Zur Frage der innovativen Kraft<br />
neuer Haushalts- und Lebensformen, in: Hauswirtschaft<br />
und Wissenschaft, 40 1992) 1; Schnittstellen der privaten<br />
Haushalte zu Institutionen. Zunehmende Auûenbeziehungen<br />
der Haushalte im Wandel der Daseinsbewåltigung, in:<br />
Sylvia Gråbe Hrsg.), Der private Haushalt im wissenschaftlichen<br />
Diskurs, Frankfurt am Main ± New York 1993; Hrsg.)<br />
Internationale Perspektiven in Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaft,<br />
Baltmannsweiler 1999.<br />
Michael-Burkhard Piorkowsky<br />
Dr. rer. pol., geb. 1947; Professor fçr Haushalts- und Konsumækonomik<br />
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-<br />
Universitåt Bonn; Mitglied des Wissenschaftlichen Gutachtergremiums<br />
fçr die Erstellung des Armuts- und Reichtumsberichts<br />
der Bundesregierung.<br />
Anschrift: Universitåt Bonn, Meckenheimer Allee 174,<br />
53115 Bonn.<br />
E-Mail: piorkowsky@uni-bonn.de<br />
Veræffentlichungen u. a.: Hrsg. zus. mit Irmhild Kettschau/<br />
Barbara Methfessel) Familie 2000. Bildung fçr Familien und<br />
Haushalte zwischen Alltagskompetenz und Professionalitåt.<br />
Europåische Perspektiven, Baltmannsweiler 2000; zus. mit<br />
Stefanie Mçndner) Kursbuch zur Armutspråvention und<br />
Milderung defizitårer Lebenslagen durch Stårkung von<br />
Haushalts- und Familienkompetenzen, Deutsche Gesellschaft<br />
fçr Hauswirtschaft, Aachen±Bonn 2002.<br />
Lothar Krappmann<br />
Dr. phil., geb. 1936; bis 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
des Max-Planck-Instituts fçr Bildungsforschung, Berlin;<br />
Honorarprofessor fçr Soziologie der Erziehung an der Freien<br />
Universitåt Berlin.<br />
Anschrift: Lçtzelsteiner Weg 43, 14195 Berlin.<br />
E-Mail: krappmann@mpib-berlin.mpg.de.<br />
Veræffentlichungen u. a.: Untersuchungen zum sozialen<br />
Lernen, in: Hanns Petillon Hrsg.), Individuelles und soziales<br />
Lernen in der Grundschule, Opladen 2002; Bildung als Ressource<br />
der Lebensbewåltigung, in: Richard Mçnchmeier<br />
u. a. Hrsg.), Bildung und Lebenskompetenz, Opladen 2002.<br />
Edda Mçller<br />
Dr. rer. publ., geb. 1942; Vorstand des Verbraucherzentrale<br />
Bundesverbandes e. V. vzbv); Honorarprofessorin an der<br />
Hochschule fçr Verwaltungswissenschaften in Speyer; Stellvertretende<br />
Vorsitzende des von Bundeskanzler Schræder<br />
einberufenen Rats fçr nachhaltige Entwicklung; Vizepråsidentin<br />
von EUROSOLAR Deutschland; Mitglied im Verwal-<br />
tungsrat der Stiftung Warentest; seit November 2002<br />
Mitglied der Kommission fçr die Nachhaltigkeit in der Finanzierung<br />
der Sozialen Sicherungssysteme Rçrup-Kommission).<br />
Anschrift: vzbv, Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin.<br />
Veræffentlichungen vor allem zu Fragen der Umweltpolitik<br />
und zum politischen Interessenausgleich in modernen<br />
Demokratien sowie zu Fragen des Verbraucherschutzes.<br />
Hildegard Mackert<br />
Germanistin/Slawistin, geb. 1953; Referentin fçr Fortbildung<br />
beim vzbv Berlin.<br />
Anschrift: vzbv, Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin.<br />
E-Mail: mackert@vzbv.de<br />
Veræffentlichungen u. a.: Haushaltsbezogene Verbraucherbildung,<br />
in: Hauswirtschaftliche Bildung, 1998) 2 und 3;<br />
How can the internet be used constructively for consumer<br />
education?, in: NICEmail, 2001) 1.<br />
Dieter Korczak<br />
Dr. rer. pol., Diplomvolkswirt, geb. 1948; Leiter des Instituts<br />
fçr Grundlagen- und Programmforschung in Mçnchen.<br />
Anschrift: Institut fçr Grundlagen- und Programmforschung,<br />
Goethestr. 40, 80336 Mçnchen.<br />
E-Mail: info@gp-f.com; www.gp-f.com<br />
Veræffentlichungen u. a.: zus. Mit Joachim Hecker) Gehirn<br />
± Geist ± Gefçhl, Hagen 2000; Wissenschaftspolitik im<br />
Medienzeitalter, in: Theo Hug Hrsg.), Einfçhrung in die Wissenschaftstheorie<br />
und Wissenschaftsforschung, Hohengehren<br />
2001; Das schæne, neue Leben, Hagen 2001; Illegal<br />
drug use in Europe. In search of a hidden population, in:<br />
Research World, 11 Januar 2003) 1.<br />
Nåchste Ausgabe<br />
Holm Sundhaussen<br />
Staatsbildung und ethnisch-nationale Gegensåtze<br />
in Sçdosteuropa<br />
Anton Sterbling<br />
Eliten in Sçdosteuropa<br />
Rolle, Kontinuitåten, Brçche<br />
Heinz-Jçrgen Axt<br />
Vom Wiederaufbauhelfer zum Modernisierungsagenten<br />
Die EU auf dem Balkan<br />
Franz-Lothar Altmann<br />
Regionale Kooperation in Sçdosteuropa<br />
Wim van Meurs<br />
Den Balkan integrieren<br />
Die europåische Perspektive der Region nach 2004<br />
Andrea K. Riemer<br />
Die Tçrkei und die Europåische Union<br />
Eine unendliche Geschichte?<br />
n
Maria Thiele-Wittig<br />
Kompetent im Alltag: Bildung fçr Haushalt<br />
und Familie<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/2003, S. 3±6<br />
n Familien und Haushalte sind in immerkomplexerwerdende<br />
gesellschaftliche Zusammenhånge<br />
eingebunden. Die ihren Mitgliedern zunehmend<br />
abgeforderten Lebens- und Alltagsentscheidungen<br />
haben Rçckwirkungen auf die Gesellschaft.<br />
Aus dieser Perspektive ist eine Stårkung der Alltags-<br />
bzw. Daseinskompetenzen, ist Bildung fçr<br />
Haushalt und Familie ein Bereich aktivierender<br />
Gesellschaftspolitik.<br />
Michael-Burkhard Piorkowsky<br />
Neue Hauswirtschaft fçr die postmoderne<br />
Gesellschaft<br />
Zum Wandel der Úkonomie des Alltags<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/2003, S. 7±13<br />
n Dergesellschaftliche Modernisierungsprozess<br />
geht mit einem radikalen Wandel der Úkonomie<br />
des Alltags einher. Die Entscheidungen der Privathaushalte<br />
bzw. Individuen gewinnen an Bedeutung<br />
fçrdie sozioækonomische Makrostruktureinschlieûlich<br />
derBildung von Humanvermægen.<br />
Strukturgebend sind insbesondere Entscheidungen<br />
fçrbzw. gegen bestimmte Lebensstile und<br />
Lebensformen, Bildungswege und Erwerbsbeteiligungen,<br />
Konsummusterund Freizeitaktivitåten<br />
sowie Vermægensdispositionen. Eine erfolgreiche<br />
Haushaltsfçhrung setzt voraus, dass kçnftig entsprechende<br />
Grundlagen im allgemein bildenden<br />
Schulwesen vermittelt werden.<br />
Lothar Krappmann<br />
Kompetenzfærderung im Kindesalter<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/2003, S. 14±19<br />
n Um gemeinsam gutes Leben gestalten zu kænnen,<br />
benætigen Menschen Kompetenzen, die<br />
ihnen helfen, mit knappen Mitteln und unterZeitdruck<br />
Ziele auszuhandeln und zu verfolgen. Diese<br />
¹Daseinskompetenzenª erwerben Kinder durch<br />
Beteiligung an Kooperation und ± wenn sie ålter<br />
werden ± durch Reflexion und kritische Auseinandersetzung<br />
in schulischen Lernprozessen. Der<br />
wichtigste Ort, an dem Kinder diese Kompetenzen<br />
herausbilden und fçr Mitwirkung im Haushalt, fçr<br />
Lernen und andere soziale Tåtigkeiten nutzen<br />
kænnen, ist jedoch die Familie. Das Familienleben<br />
profitiert auch von der Færderung dieser Kompetenzen<br />
in anderen Bildungsbereichen.<br />
Edda Mçller/Hildegard Mackert<br />
Bildung fçr Haushalt und Konsum als<br />
vorsorgender Verbraucherschutz<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/2003, S. 20±26<br />
n Vor dem Hintergrund der in jçngster Zeit verstårkt<br />
gefçhrten Diskussion um vorsorgenden Verbraucherschutz<br />
und Nachhaltige Entwicklung auf<br />
dereinen und derPISA-Debatte auf deranderen<br />
Seite wird die Position des Verbraucherzentrale<br />
Bundesverbandes vorgestellt in Bezug auf Bildung<br />
fçr Verbraucherinnen und Verbraucher. Es wird<br />
dargelegt, dass es grundlegend neuer Kompetenzen<br />
bedarf, um die individuelle Alltagsgestaltung<br />
mit den Herausforderungen eines globalen Marktes<br />
sowie gesellschaftlicherZiele wie Umwelterhaltung<br />
und soziale Gerechtigkeit zu verbinden. Vor<br />
diesem Hintergrund wird fçr die Einfçhrung eines<br />
Faches ¹Wirtschaftª in den Sekundarstufen I und<br />
II an den allgemein bildenden Schulen plådiert.<br />
Neben derVermittlung entsprechenden Fachwissens<br />
sollte das Fach die Lebens- und Erfahrungswelt<br />
derSchçlerinnen und Schçlerim Blick haben<br />
und hieraus eine entsprechende pådagogische<br />
Konzeption entwickeln.<br />
Dieter Korczak<br />
Was sollen unsere Kinder von uns lernen<br />
Neusser Thesen zur Bildungspolitik<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/2003, S. 27±30<br />
n Kinderund Schçlerzukunftsfåhig zu erziehen<br />
und zu unterrichten erfordert ein gesellschaftlich<br />
formuliertes Wollen und eine gemeinsame Anstrengung<br />
von Staat, Gesellschaft, Eltern und<br />
Schulen. Die NeusserThesen stellen einen Versuch<br />
dar, eine Brçcke zwischen Elternhaus, Schule und<br />
Gesellschaft zu schlagen mit dem Ziel, einen sachgerechten<br />
Katalog fçr Bildungs- und Erziehungsziele<br />
sowie adåquate Unterrichtsformen zu erarbeiten.<br />
n