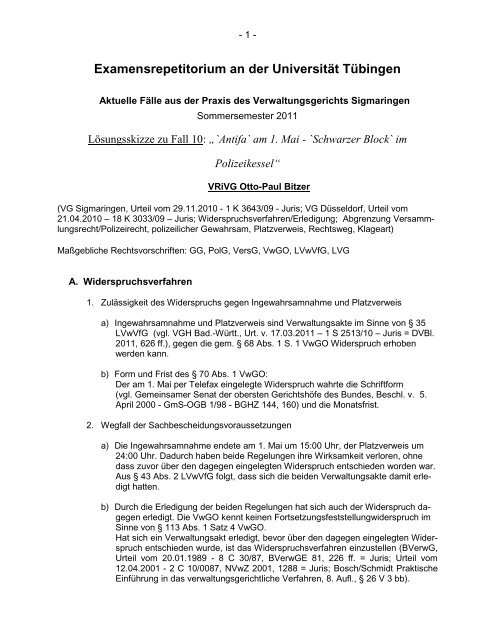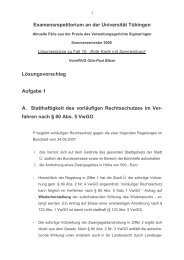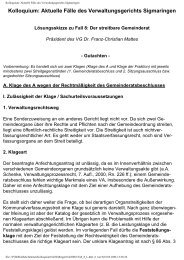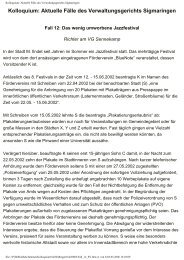Lösungsskizze - Verwaltungsgericht Sigmaringen
Lösungsskizze - Verwaltungsgericht Sigmaringen
Lösungsskizze - Verwaltungsgericht Sigmaringen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 1 -<br />
Examensrepetitorium an der Universität Tübingen<br />
Aktuelle Fälle aus der Praxis des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s <strong>Sigmaringen</strong><br />
Sommersemester 2011<br />
<strong>Lösungsskizze</strong> zu Fall 10: „`Antifa` am 1. Mai - `Schwarzer Block` im<br />
Polizeikessel“<br />
VRiVG Otto-Paul Bitzer<br />
(VG <strong>Sigmaringen</strong>, Urteil vom 29.11.2010 - 1 K 3643/09 - Juris; VG Düsseldorf, Urteil vom<br />
21.04.2010 – 18 K 3033/09 – Juris; Widerspruchsverfahren/Erledigung; Abgrenzung Versammlungsrecht/Polizeirecht,<br />
polizeilicher Gewahrsam, Platzverweis, Rechtsweg, Klageart)<br />
Maßgebliche Rechtsvorschriften: GG, PolG, VersG, VwGO, LVwVfG, LVG<br />
A. Widerspruchsverfahren<br />
1. Zulässigkeit des Widerspruchs gegen Ingewahrsamnahme und Platzverweis<br />
a) Ingewahrsamnahme und Platzverweis sind Verwaltungsakte im Sinne von § 35<br />
LVwVfG (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 17.03.2011 – 1 S 2513/10 – Juris = DVBl.<br />
2011, 626 ff.), gegen die gem. § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO Widerspruch erhoben<br />
werden kann.<br />
b) Form und Frist des § 70 Abs. 1 VwGO:<br />
Der am 1. Mai per Telefax eingelegte Widerspruch wahrte die Schriftform<br />
(vgl. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschl. v. 5.<br />
April 2000 - GmS-OGB 1/98 - BGHZ 144, 160) und die Monatsfrist.<br />
2. Wegfall der Sachbescheidungsvoraussetzungen<br />
a) Die Ingewahrsamnahme endete am 1. Mai um 15:00 Uhr, der Platzverweis um<br />
24:00 Uhr. Dadurch haben beide Regelungen ihre Wirksamkeit verloren, ohne<br />
dass zuvor über den dagegen eingelegten Widerspruch entschieden worden war.<br />
Aus § 43 Abs. 2 LVwVfG folgt, dass sich die beiden Verwaltungsakte damit erledigt<br />
hatten.<br />
b) Durch die Erledigung der beiden Regelungen hat sich auch der Widerspruch dagegen<br />
erledigt. Die VwGO kennt keinen Fortsetzungsfeststellungwiderspruch im<br />
Sinne von § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO.<br />
Hat sich ein Verwaltungsakt erledigt, bevor über den dagegen eingelegten Widerspruch<br />
entschieden wurde, ist das Widerspruchsverfahren einzustellen (BVerwG,<br />
Urteil vom 20.01.1989 - 8 C 30/87, BVerwGE 81, 226 ff. = Juris; Urteil vom<br />
12.04.2001 - 2 C 10/0087, NVwZ 2001, 1288 = Juris; Bosch/Schmidt Praktische<br />
Einführung in das verwaltungsgerichtliche Verfahren, 8. Aufl., § 26 V 3 bb).
- 2 -<br />
Nach § 80 Abs. 1 Satz 5 LVwVfG ist allerdings über die Kosten des Widerspruchs<br />
nach billigem Ermessen entschieden; der bisherige Sachstand ist zu berücksichtigen.<br />
B. Klageverfahren gegen die Ingewahrsamnahme<br />
I. Zulässigkeit der Klage<br />
1. Verwaltungsrechtsweg:<br />
Es müsste eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art ohne<br />
abdrängende Sonderzuweisung i. S. v. § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO vorliegen. Von einer<br />
öffentlich-rechtlichen Streitigkeit ist auszugehen, da sich D gegen polizeiliche<br />
Maßnahmen des Polizeivollzugsdienstes wendet.<br />
Der Verwaltungsrechtsweg könnte aber durch § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO in Verbindung<br />
mit § 28 Abs. 4 PolG ausgeschlossen sein.<br />
Rechtsgrundlage für die von D beanstandete Maßnahme ist § 28 Abs. 1 Nr. 1 PolG.<br />
Nach § 28 Abs. 4 Satz 6 PolG ist die (verwaltungsgerichtliche) Anfechtungsklage<br />
ausgeschlossen, wenn eine den Gewahrsam anordnende Entscheidung des Amtsgerichts<br />
ergangen ist. Eine den Gewahrsam anordnende Entscheidung des Amtsgerichts<br />
bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntgabe an den Betroffenen (§ 28<br />
Abs. 4 Satz 3 PolG). Im Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts kann sie auch mündlich<br />
ergehen (§ 28 Abs. 4 Satz 4 PolG). Dann ist sie unverzüglich schriftlich niederzulegen<br />
und zu begründen.<br />
Eine den Gewahrsam anordnende Entscheidung des Amtsgerichts ist nicht ergangen.<br />
Sie liegt noch nicht in der Anordnung des richterlichen Bereitschaftsdienstes,<br />
jede einzelne Person zur Überprüfung der Ingewahrsamnahme vorzuführen. Diese<br />
richterliche Entscheidung setzt zwar voraus, dass diese Personen festgehalten werden,<br />
bis die Einzelvorführung erfolgen kann. Darin liegt aber noch keine richterliche<br />
Entscheidung über den Gewahrsam im Sinne des § 28 Abs. 3 Satz 2 PolG. Die Entscheidung<br />
wird vielmehr für einen Zeitpunkt nach der Anhörung des Betroffenen vorbehalten.<br />
D wurde weder einem Richter vorgeführt noch ist eine richterliche Entscheidung<br />
getroffen worden.<br />
Der Verwaltungsrechtsweg ist gegeben.<br />
2. Statthafte Klageart:<br />
Welche Klageart statthaft ist, richtet sich danach, mit welchem Begehren sich der<br />
Kläger an das Gericht wendet. D möchte seine Ingewahrsamnahme nachträglich gerichtlich<br />
überprüfen lassen. Fraglich ist, wie er dieses Ziel erreichen kann.<br />
a) Fortsetzungsfeststellungsklage<br />
Nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO spricht das Gericht, hat sich der Verwaltungsakt<br />
vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, auf Antrag durch Urteil aus,<br />
dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes<br />
Interesse an dieser Feststellung hat. Diese Regelung bezieht sich Fälle, in<br />
denen sich der Verwaltungsakt nach Klagerhebung erledigt hat.
- 3 -<br />
Nach st. Rspr. des BVerwG ist § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO jedoch entsprechend<br />
auf Fälle anzuwenden, in denen sich ein Verwaltungsakt vor Klagerhebung erledigt<br />
hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.07.1999 - BVerwG 6 C 7/98 - BVerwGE 109,<br />
203 ff. = Juris Rn 20; Bosch/Schmidt a.a.O. § 45 II 2).<br />
- Eine solche Klage ist an keine Fristen gebunden (vgl. BVerwG, Urteil<br />
vom 14.07.1999, a.a.O.). Verliert ein Verwaltungsakt seine Regelungsfunktion<br />
ex nunc, ist es nach der Rspr. des BVerwG nicht gerechtfertigt,<br />
ungeachtet der durch diese Erledigung beendeten Verbindlichkeit der<br />
Regelung, ihm eine im Hinblick auf den Lauf von Klagefristen fortdauernde<br />
Wirkung beizumessen.<br />
Die Verwaltung werde, so das BVerwG, vor einer Klage noch Jahre<br />
nach Erledigung des Verwaltungsakts hinreichend durch das Erfordernis<br />
eines berechtigten Interesses an der begehrten Feststellung sowie<br />
durch das Institut der Verwirkung geschützt. Das entspreche der vom<br />
Gesetzgeber vorgenommenen Bewertung der Interessenlage bei der<br />
allgemeinen Feststellungsklage (§ 43 VwGO), mit der er sich dafür entschieden<br />
habe, die gerichtliche Durchsetzung solcher Feststellungsbegehren<br />
nicht an Fristen zu binden. Das BVerwG bezweifelt, ob bei einer<br />
nicht von vornherein als Anfechtungs- und Verpflichtungsklage erhobenen<br />
Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts<br />
überhaupt auf eine entsprechende Anwendung des § 113 Abs. 1 Satz 4<br />
VwGO zurückzugreifen ist. Die Voraussetzungen einer solchen speziellen<br />
Feststellungsklage, bei der es um die Feststellung der Rechtswidrigkeit<br />
eines Verwaltungsakts geht, der sich vor Eintritt der Bestandskraft<br />
durch Aufhebung vorprozessual erledigt hat, seien „letztlich dem § 43<br />
VwGO zu entnehmen“ (vgl. hierzu insges. BVerwG Urteil vom<br />
14.07.1999, a.a.O.). Da einer solchen speziellen Feststellungsklage<br />
stets ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, Anfechtungsklage<br />
(Gestaltungsklage i.S.v. § 43 Abs. 2 VwGO) wegen Erledigung<br />
des Verwaltungsakts nicht erhoben werden konnte und das „berechtigte<br />
Interesse“ als besondere Sachurteilsvoraussetzung nach heutigem<br />
Verständnis (anders noch BVerwG, Urteil vom 20.01.1989 - 8 C<br />
30/87, a.a.O.) in beiden Vorschriften den gleichen Anforderungen (vgl.<br />
Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 43 Rdnr. 23) unterliegt, dürfte ein Zurückgreifen<br />
auf § 43 VwGO nur zur Begründung der vom BVerwG vertretenen<br />
Nichteinhaltung einer Klagefrist notwendig sein.<br />
- Ein Vorverfahren ist nicht erforderlich, da dieses seine Aufgabe, u.a. der<br />
Selbstkontrolle der Verwaltung, nicht mehr erfüllen kann (vgl.<br />
Bosch/Schmidt, a.a.O., § 45 III 2.).<br />
aa) Berechtigtes Interesse als besondere Sachurteilsvoraussetzung:<br />
Ein berechtigtes Interesse dürfte unter dem Gesichtspunkt des Rehabilitationsinteresses<br />
des D vorliegen. Der Eingriff in den grundrechtlich geschützten<br />
Bereich der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und der Freiheit<br />
der Person nach Art. 2 Abs. 1 sowie Abs. 2 Satz 2 GG, verbunden mit<br />
dem verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf effektiven Rechtsschutz,<br />
erfordert es, das Feststellungsinteresse anzuerkennen und gilt<br />
insbesondere bei einem Feststellungsbegehren, das eine polizeiliche
- 4 -<br />
Maßnahmen zum Gegenstand hat (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil<br />
vom 22.07.2004 - 1 S 2801/03 - juris unter Hinweis auf BVerwG, Beschluss<br />
vom 30.4.1999 - 1 B 36.99 -, Buchholz 310 § 113 Abs. 1 VwGO<br />
Nr. 6 m.w.N.). Da die Ingewahrsamnahme auf einen kurzen Zeitraum<br />
beschränkt war, wäre D andernfalls eine gerichtliche Überprüfung der<br />
polizeilichen Maßnahme verwehrt. Dies wäre mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht<br />
zu vereinbaren (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom<br />
22.07.2004 a.a.O.). Nach der Rechtsprechung des BVerfG (vgl. Kammerbeschluss<br />
vom 07.12.1998 - 1 BvR 831/98 - juris Rdnr. 25) gebietet<br />
es das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, dass der Betroffene Gelegenheit<br />
erhält, in Fällen tiefgreifender, tatsächlich jedoch nicht mehr<br />
fortwirkender Grundrechtseingriffe auch dann die Rechtmäßigkeit des<br />
Eingriffs gerichtlich klären zu lassen, wenn die direkte Belastung durch<br />
den angegriffenen Hoheitsakt sich nach dem typischen Verfahrensablauf<br />
auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene die gerichtliche<br />
Entscheidung kaum erlangen kann.<br />
3. Zuständigkeit des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s <strong>Sigmaringen</strong><br />
Die sachliche Zuständigkeit folgt aus § 45 VwGO, die örtliche aus § 52 Nr. 1 VwGO<br />
(ortsgebundenes Rechtsverhältnis) i.V.m. § 1 Abs. 2 AGVwGO, §§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 4<br />
LVG.<br />
II. Begründetheit der Klage<br />
1. Passivlegitimation:<br />
Nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist die Klage gegen den Bund, das Land oder die Körperschaft,<br />
deren Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen oder den beantragten<br />
Verwaltungsakt unterlassen hat, zu richten. Diese Vorschrift gilt entsprechend<br />
bei einer Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines bereits erledigten<br />
Verwaltungsakts.<br />
Hier ist die Ingewahrsamnahme mittels Einkesselung durch Polizeivollzugsbeamte<br />
und anschließende Lautsprecherdurchsage der „Polizei“, mithin durch den Polizeivollzugsdienst<br />
erfolgt. Der Polizeivollzugsdienst wird nach § 70 Abs. 1 PolG vom<br />
Land (Baden-Württemberg) unterhalten und ist in Polizeidienststellen untergliedert.<br />
Diese sind mithin Behörden des Landes. Da deren Beamte gehandelt haben, ist die<br />
Klage ist gegen das Land zu richten.<br />
2. Gesetzliche Grundlage der Ingewahrsamnahme<br />
a) Als Rechtsgrundlage der Ingewahrsamnahme des D kommt § 28 Abs. 1 Nr. 1<br />
PolG in Betracht. Danach kann die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen,<br />
wenn auf andere Weise eine unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung<br />
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht verhindert oder eine bereits eingetretene<br />
erhebliche Störung nicht beseitigt werden kann.<br />
aa) Formelle Voraussetzungen der Ingewahrsamnahme:<br />
- Die Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes folgt aus § 60 Abs. 3 PolG<br />
(originäre Zuständigkeit).
- 5 -<br />
- Eine Anhörung des D war nach § 28 Abs. 2 Nr.1 LVwVfG entbehrlich.<br />
- Weil der Verwaltungsakt mündlich erlassen wurde, war auch keine Begründung<br />
erforderlich (vgl. § 39 Abs. 1 LVwVfG)<br />
bb) Tatbestandliche Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Nr. 1 PolG<br />
Von D müsste eine nicht auf andere Weise als durch die Ingewahrsamnahme zu<br />
verhindernde unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit<br />
oder Ordnung ausgegangen sein. Dabei ist die Gefahrenlage zu beurteilen,<br />
wie sie sich den Polizeivollzugsbeamten bei fehlerfreier ex ante-Prognose<br />
darstellte (vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil v. 17.03.2011 – 1 S 2513/10 – DVBl. 2011,<br />
626 ff. = Juris).<br />
D könnte im Hinblick auf seine Bekleidung, die jener der Personen des „Schwarzen<br />
Blocks“ stark ähnelte, und den Ort seines Antreffens als Anscheinsstörer angesehen<br />
werden. Anscheinsstörer ist, wer ex post betrachtet nicht wirklich eine<br />
Gefahr verursacht, aber ex ante betrachtet bei einem fähigen, besonnenen und<br />
sachkundigen Polizeibeamten den Eindruck der Gefahrverursachung erweckt.<br />
Hierfür genügt es, dass ein Verhalten objektiv geeignet ist, bei Dritten den Eindruck<br />
zu erwecken, es drohe ein Schaden für ein polizeilich geschütztes Rechtsgut<br />
(Irreführungsrisiko). Selbst wer nicht weiß, dass er von der Polizei beobachtet<br />
wird, übernimmt das Risiko dafür, dass aus seinem Verhalten in der Öffentlichkeit<br />
auf seine Störereigenschaft geschlossen wird (vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil v.<br />
17.03.2011 – 1 S 2513/10 – a.a.O.).<br />
b) Die Einkesselung und Ingewahrsamnahme des D könnte ungeachtet der Beantwortung<br />
der Frage der Störereigenschaft des D einen Eingriff in seine grundrechtlich<br />
geschützte Versammlungsfreiheit darstellen. Er müsste dann durch eine gesetzliche<br />
Ermächtigungsnorm gedeckt sein (Art. 8 Abs. 2 GG).<br />
aa) D wollte an der Versammlung des DGB bzw. an dessen Aufzug teilnehmen.<br />
Sein Verhalten fiel in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG.<br />
Versammlung i.S. des Art. 8 Abs. 1 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer<br />
Personen zur gemeinschaftlichen, auf Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung<br />
gerichteten Erörterung oder Kundgebung (vgl. BVerfG, Beschluss vom<br />
26. Oktober 2004 - 1 BvR 1726/01 -, NVwZ 2005, 80 f.). Die Veranstaltung des<br />
DGB genoss den Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG. Sie verlor diesen Schutz nicht dadurch,<br />
dass möglicherweise einzelne Teilnehmer des so genannten „Schwarzen<br />
Blocks“ ein Verhalten an den Tag legten, das sie von vornherein aus dem<br />
Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG, der nur das Recht, sich friedlich und ohne<br />
Waffen zu versammeln, schützt, ausschloss.<br />
Dass dem D ein solches Verhalten vorgeworfen werden konnte, kann nicht festgestellt<br />
werden. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich auf den einzelnen Teilnehmer<br />
abzustellen, nicht auf die Versammlung insgesamt. Würde unfriedliches Verhalten<br />
Einzelner für die gesamte Versammlung und nicht nur für die Täter zum<br />
Fortfall des Grundrechtsschutzes führen, hätten diese es in der Hand, die Demonstration<br />
"umzufunktionieren" und gegen den Willen der anderen Teilnehmer<br />
rechtswidrig werden zu lassen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 -<br />
1 BvR 233/81, 1 BvR 341/81 - (Brokdorf), BVerfGE 69, 315 ff. (361).
- 6 -<br />
Grundsätzlich muss daher gegen die störende Minderheit vorgegangen werden.<br />
Nur wenn dies keinen Erfolg verspricht, kann unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit<br />
gegen die Versammlung als solche eingeschritten und durch Auflösung<br />
nach § 15 VersG auch den friedlichen Teilnehmern der Schutz des Art. 8 Abs. 1<br />
GG genommen werden. Ferner darf die Demonstrationsfreiheit nicht dadurch unterlaufen<br />
werden, dass an die Bejahung der Teilnahme an Gewaltakten zu geringe<br />
Anforderungen gestellt werden. Deshalb reicht es für die Annahme einer Mittäterschaft<br />
oder Beihilfe an solchen Ausschreitungen nicht schon aus, dass der an<br />
ihnen nicht aktiv beteiligte Demonstrant an Ort und Stelle verharrt, auch wenn er,<br />
wie es die Regel sein wird, von vornherein mit Gewalttätigkeiten einzelner oder<br />
ganzer Gruppen rechnet und weiß, dass er allein schon mit seiner Anwesenheit<br />
den Gewalttätern mindestens durch Gewährung von Anonymität Förderung und<br />
Schutz geben kann. Für eine Teilnahme ist mehr erforderlich, nämlich die Feststellung,<br />
dass Gewährung von Anonymität und Äußerung von Sympathie darauf<br />
ausgerichtet und geeignet sind, Gewalttäter in ihren Entschlüssen und Taten zu<br />
fördern und zu bestärken, etwa durch Anfeuerung oder ostentatives Zugesellen<br />
zu einer Gruppe, aus der heraus Gewalt geübt wird. Eine Ausdehnung der Strafbarkeit<br />
auf "passiv" bleibende Sympathisanten wäre verfassungswidrig, weil sie<br />
das Gebrauchmachen von der Versammlungsfreiheit mit einem unkalkulierbaren<br />
Risiko verbinden und so das Grundrecht faktisch unzulässig beschränken würde<br />
(vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 21.04.2010 – 18 K 3033/09 – Juris unter Hinweis<br />
auf BGH, Urt. v. 24.01.1984 – VI ZR 37/82, BGHZ 89, 383 ff. zur zivilrechtlichen<br />
Haftung für Demonstrationsschäden).<br />
D war, als er in der Sattlergasse, in unmittelbarer Nähe zum Ort des Beginns des<br />
DGB-Demonstrationszugses und in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Beginn der<br />
Veranstaltung durch Bildung einer polizeilichen Absperrung in der Sattlergasse in<br />
Gewahrsam genommen wurde, Teil der Versammlung des DGB und als Teilnehmer<br />
durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützt. Dass er sich unfriedlich verhalten oder<br />
solche Handlungen unterstützt hat, ist nicht ersichtlich.<br />
bb) Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG müsste gerechtfertigt<br />
sein.<br />
- Gemäß § 15 Abs. 3 VersG kann eine Versammlung unter bestimmten Voraussetzungen<br />
aufgelöst werden. Eine solche gegen die gesamte Versammlung - also<br />
auch die friedlichen Teilnehmer - gerichtete Maßnahme wurde jedoch nicht<br />
getroffen.<br />
- D wurde auch nicht nach § 17a Abs. 4 VersG von der Demonstration ausge<br />
schlossen. Nach dieser Vorschrift kann die zuständige Behörde (nach § 1 Abs. 1<br />
Nr. 2 der Verordnung des Innenministeriums über Zuständigkeiten nach dem<br />
Versammlungsgesetz - VersGZuVO - die Kreispolizeibehörde, also die Stadt Ulm<br />
[§§ 62 Abs. 3 PolG , 15 Abs. 1 Nr. 2, 12 Abs. 4 LVG]) u.a. Personen in einer<br />
Aufmachung, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die<br />
Feststellung der Identität zu verhindern (§ 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG), also Teilnehmer,<br />
die gegen das Vermummungsverbot verstoßen, von der Veranstaltung<br />
ausschließen.<br />
- Ein solcher Ausschluss wegen Vermummung wurde jedoch nur angedroht, er<br />
wurde jedoch nicht ausgesprochen.
- 7 -<br />
- Nach der Rspr. des BVerfG (Kammerbeschluss vom 30.04.2007- 1 BvR<br />
1090/06 - Juris) sind Maßnahmen, die die Teilnahme an einer Versammlung<br />
beenden - wie eine Ingewahrsamnahme oder ein Platzverweis - rechtswidrig, solange<br />
die Versammlung nicht gem. § 15 Abs. 3 VersammlG aufgelöst oder der<br />
Teilnehmer auf versammlungsrechtlicher Grundlage von der Versammlung ausgeschlossen<br />
wurde (Juris Rdnr. 40). Art. 8 GG gebiete diese für den Schutz des<br />
Grundrechtsträgers wesentlichen Förmlichkeiten. Denn es handele sich um Anforderungen<br />
der Erkennbarkeit und damit der Rechtssicherheit, deren Beachtung<br />
für die Möglichkeit einer Nutzung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit<br />
wesentlich sei. In Versammlungen entstünden häufig Situationen rechtlicher und<br />
tatsächlicher Unklarheit. Versammlungsteilnehmer müssten wissen, wann der<br />
Schutz der Versammlungsfreiheit ende, denn Unsicherheiten könnten sie einschüchtern<br />
und von der Ausübung des Grundrechts abhalten (Juris Rdnr. 41).<br />
Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen Versammlungen richteten sich nach<br />
dem Versammlungsgesetz. Dieses Gesetz gehe in seinem Anwendungsbereich<br />
als Spezialgesetz dem allgemeinen Polizeirecht vor. Eine auf allgemeines Polizeirecht<br />
gegründete Maßnahme, durch welche das Recht zur Teilnahme an der<br />
Versammlung beschränkt werde, scheide aufgrund der Sperrwirkung der versammlungsrechtlichen<br />
Regelungen aus (Juris Rdnr. 43).<br />
- Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG ist daher nicht gerechtfertigt.<br />
Ergebnis: Die Klage gegen die Ingewahrsamnahme ist zulässig und begründet.<br />
C. Klageverfahren gegen den Platzverweis<br />
I. Zulässigkeit der Klage gegen den Platzverweis<br />
1. Statthafte Klageart:<br />
Gegen den ebenfalls mit Ablauf des 1.Mai erledigten Platzverweis ist die Fortsetzungsfeststellungsklage<br />
entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO statthaft.<br />
- Auch der Platzverweis hat sich mit Ablauf des 01. Mai und damit vor Klageerhebung<br />
erledigt, sodass seine Rechtmäßigkeit durch die Fortsetzungsfeststellungsklage nach<br />
§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO in entsprechender Anwendung überprüft werden kann (vgl.<br />
auch VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 14.04.2005 - 1 S 2362/04 - juris).<br />
Die oben zu B I 2. gemachten Ausführungen gelten entsprechend<br />
2. Zuständigkeit des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s <strong>Sigmaringen</strong><br />
Die sachliche Zuständigkeit folgt auch hier aus § 45 VwGO, die örtliche aus § 52 Nr. 1<br />
VwGO (ortsgebundenes Rechtsverhältnis) i.V.m. § 1 Abs. 2 AGVwGO, §§ 11 Abs. 1, 12<br />
Abs. 4 LVG.<br />
II. Begründetheit der Klage<br />
1. Passivlegitimation:
- 8 -<br />
Die Klage ist ebenfalls nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO gegen das Land zu richten, da<br />
auch der Platzverweis von den Polizeivollzugsbeamten erlassen worden ist.<br />
2. Gesetzliche Grundlage des Platzverweises<br />
a) Nach § 27a Abs. 1 PolG kann die Polizei zur Abwehr einer Gefahr oder zur<br />
Beseitigung einer Störung eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen<br />
oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die Gefahr<br />
bzw. die Störung muss hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit bestehen (vgl.<br />
LT-Drs. 14/3165 Seite 66: „Er [der Platzverweis] wird zur Abwehr von Gefahren<br />
für die öffentliche Sicherheit zugelassen“).<br />
aa) Formelle Voraussetzungen des Platzverweises:<br />
- Die Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes könnte sich aus § 60 Abs.<br />
2 PolG (Eilkompetenz) ergeben, wenn die Herbeiführung einer Entscheidung<br />
der hier zuständigen besonderen Polizeibehörde (Kreispolizeibehörde<br />
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 VersGZuVO, also Stadt Ulm nach §§<br />
62 Abs. 3 PolG , 15 Abs. 1 Nr. 2, 12 Abs. 4 LVG) zu einer nicht vertretbaren<br />
Verzögerung geführt hätte. Das ist aber nach einer mehr als vierstündigen<br />
Ingewahrsamnahme fraglich, zumal die Stadt Ulm vor Ort vertreten<br />
war.<br />
- Eine Anhörung des D war nach § 28 Abs. 2 Nr.1 LVwVfG entbehrlich.<br />
bb) Tatbestandliche Voraussetzungen des § 27a Abs. 1 PolG<br />
Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 27a Abs. 1 PolG erfüllt sind,<br />
insbesondere, ob D von einem „Ort“, worunter die Gesetzesbegründung einen<br />
„eng umgrenzten Ort“, der unter Umständen auch aus mehreren Straßenzügen<br />
bestehen kann (vgl. LT-Drs. 14/3165 Seite 66), verwiesen wurde, ist fraglich,<br />
weil sich der Platzverweis auf das gesamte Innenstadtgebiet bezog und<br />
dessen zu dessen Ausdehnung nähere Angaben fehlen. Diese Frage kann<br />
jedoch offen bleiben.<br />
b) Denn auch hier liegt ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG<br />
vor, der nicht gerechtfertigt ist, da keine Auflösung der Versammlung und kein<br />
Ausschluss des D verfügt worden ist – s.o.<br />
Ergebnis: Die Klage gegen den Platzverweis ist ebenfalls zulässig und begründet.<br />
D. Objektive Klagehäufung<br />
Die Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Platzverweises kann mit<br />
der Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Ingewahrsamnahme<br />
nach § 44 VwGO in einem Klageverfahren zusammen verfolgt werden, weil<br />
sich beide Klagen gegen denselben Beklagten richten und dasselbe Gericht<br />
zuständig ist.