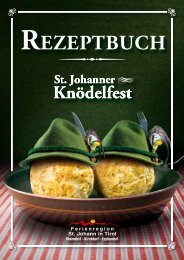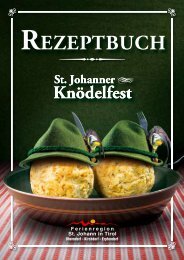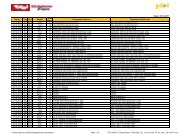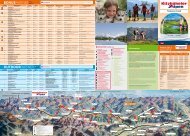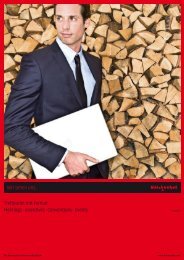PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform
PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform
PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aus der <strong>Geschichte</strong> <strong>Kitzbühels</strong><br />
Kitzbühel nach e<strong>in</strong>er Ansicht von Andreas Faistenberger aus dem Jahre 1620<br />
E<strong>in</strong> Teil unseres Heimatlandes war schon vor ungefähr 3.000 Jahren bewohnt. Das bestätigen<br />
Ausgrabungen auf der Kelchalm <strong>in</strong> Aurach und die Urnengräber vom Lebenberg. Die ersten<br />
Ansiedler waren Illyrer, die bei uns nach Kupfererz suchten.<br />
Um Christi Geburt unterwarfen die Römer unter Kaiser Augustus die Alpengebiete. Im östlichen<br />
Teil errichteten sie die Prov<strong>in</strong>zen Rätien und Noricum. Unser Gebiet, das Brixen- und Leukental,<br />
lag <strong>in</strong> der Prov<strong>in</strong>z Noricum, deren größte Stadt Juvavum, das heutige Salzburg, war. Römische<br />
Kaufleute zogen vom Felbertauern über den Pass Thurn kommend auch durch unser Tal<br />
(römerzeitliche Gebäudereste <strong>in</strong> Kirchdorf und Kössen).<br />
Um 500 nach Christi Geburt kamen die Bajuwaren <strong>in</strong> unser Tal. Sie rodeten die Wälder und<br />
ließen sich hier nieder.<br />
Woher Kitzbühel se<strong>in</strong>en Namen bekam<br />
Vor vielen hundert Jahren war der Talboden, wo heute Kitzbühel<br />
liegt, noch unbewohnt. Er war sumpfig. Die Ache hatte noch ke<strong>in</strong><br />
festes Flussbett und änderte immer wieder ihren Lauf. In den<br />
dichten Wäldern lebten Bären und Wölfe.<br />
Die Sage erzählt, dass die ersten bajuwarischen Siedler, als sie <strong>in</strong><br />
unser Tal kamen, Gemsen mit ihren Kitzen auf e<strong>in</strong>em Bühel äsen<br />
sahen. Die Siedler rodeten die Wälder und legten die Sümpfe<br />
trocken. Dem neuen Ort gaben sie den Namen Kitzbühel.<br />
In Wirklichkeit stammt der Name Kitzbühel wahrsche<strong>in</strong>lich vom<br />
Personennamen Chizzo. Bei der Landnahme durch die Bajuwaren baute der edelfreie Chizzo auf<br />
dem Hügel, wo heute die Stadt steht, e<strong>in</strong>e Burg. Der Südwest-Turm (angeblich e<strong>in</strong> Rest dieser<br />
Burg) ist heute der älteste Teil der Stadt.<br />
Als man den Grund für das Restaurant "Chizzo" aushob, fand man Reste des alten Stadtgrabens<br />
mit Knochenresten und anderem Abfall. In der Nähe des Stadtgrabens war nämlich die<br />
"Fleischbank", die Metzgerei der Stadt.
1271<br />
Kitzbühel erhält das Stadtrecht<br />
Das Gebiet von Kitzbühel gehörte <strong>in</strong> alter Zeit zu Bayern. Auf dem Hügel, wo heute die Stadt<br />
steht, entstand e<strong>in</strong>e Siedlung. Im Jahre 1271 verlieh der Bayerische Herzog Ludwig II. der<br />
Strenge den Kitzbühelern das Stadtrecht.<br />
Die Bürger e<strong>in</strong>er Stadt hatten viele Rechte:<br />
Marktrecht:<br />
Alle Bauern und Händler durften nur <strong>in</strong> der Stadt ihre Waren verkaufen. Die Stadt hob dafür<br />
Abgaben e<strong>in</strong>.<br />
Eigene Gerichtsbarkeit:<br />
Es gab e<strong>in</strong>en eigenen Stadtrichter.<br />
Selbstverwaltung:<br />
Im Geme<strong>in</strong>wesen wurde alles selbst geregelt.<br />
Steuer:<br />
An den Landesfürsten musste ke<strong>in</strong>e Steuer abgeliefert werden, dafür gab es e<strong>in</strong>e eigene<br />
Stadtsteuer, die aber viel günstiger war.<br />
Die Stadt war durch e<strong>in</strong>e Stadtmauer, e<strong>in</strong>en Stadtgraben und zwei Stadttore vor Fe<strong>in</strong>den<br />
geschützt. Das Stadtwappen zeigt e<strong>in</strong>e Gemse, die auf drei Hügeln steht.<br />
1297 schenkte der bayrische Herzog Rudolf (Sohn Herzog Ludwigs II.) den Bürgern der Stadt die<br />
Güter am Schattberg und die Weiden am Ehrenbach. Dieser Grundbesitz gehört noch heute der<br />
Stadtgeme<strong>in</strong>de Kitzbühel.<br />
Das Leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alten Stadt<br />
Die Stadt war von e<strong>in</strong>er hohen, starken Stadtmauer umgeben. In dieser Mauer waren Tore<br />
(Jochberger Tor, St. Johanner Tor) mit Zugbrücken und an den Ecken Türme. Um die Stadt<br />
führte e<strong>in</strong> tiefer Wassergraben. In der Mitte der Stadt war der Marktplatz. Dort war auch der<br />
Stadtbrunnen, von dem die Frauen das Wasser holten und bei dem sie die Wäsche wuschen. Die<br />
Straßen waren nicht oder nur teilweise gepflastert, eng und oft schmutzig, denn viele Abfälle<br />
wurden e<strong>in</strong>fach auf die Straße geworfen. In der Nacht gab es ke<strong>in</strong>e Beleuchtung. Am Abend<br />
wurden die Stadttore verriegelt. Der Nachtwächter auf dem Turm der Kathar<strong>in</strong>enkirche rief die<br />
Stunden aus und mahnte die Leute, auf Licht und Feuer achtzugeben.<br />
Der historische Stadtbrunnen<br />
(Geschichtlicher H<strong>in</strong>tergrund)<br />
Der vom Kitzbüheler Bildhauer Sepp Dangl anlässlich des 700-Jahr-Jubiläums der<br />
Stadterhebung geschaffene Stadtbrunnen zeigt die Büsten folgender Persönlichkeiten:<br />
Ludwig II. der Strenge:<br />
Der Bayernherzog verlieh im Jahre 1271 den Kitzbühelern das Stadtrecht.<br />
Margarethe Maultasch:<br />
Erbfürst<strong>in</strong> von Tirol<br />
Kaiser Maximilian I.:<br />
Er hat als Schlichter <strong>in</strong> die Erbstreitigkeiten im Herzogtum Bayern e<strong>in</strong>gegriffen. Als Lohn kamen<br />
1506 die drei Gerichte Kitzbühel, Kufste<strong>in</strong> und Rattenberg wieder zu Tirol bzw. zu Österreich.<br />
Kitzbühel gehörte früher zu Bayern. Die Grenze zur Gefürsteten Grafschaft Tirol bildete der Ziller<br />
(heute noch Diözesangrenze zwischen Innsbruck und Salzburg). Zur Römerzeit war der Ziller<br />
auch die Grenze zwischen den römischen Prov<strong>in</strong>zen Noricum (wozu auch unser Gebiet gehörte)<br />
und Rätien.<br />
Margarethe Maultasch war die Tochter von König He<strong>in</strong>rich und die Enkel<strong>in</strong> von Me<strong>in</strong>hard II., dem<br />
"Schmied des Landes Tirol". Mit 12 Jahren bereits wurde sie mit König Johann von Böhmen<br />
verheiratet. Die Ehe wurde später für ungültig erklärt, was der Papst jedoch nicht anerkannte.<br />
Margarethe heiratete schließlich Ludwig den Brandenburger (Sohn des bayrischen Kaisers
Ludwig).<br />
Ludwig schenkte Margarethe als "Morgengabe" (Hochzeitsgeschenk) die drei Gerichte Kitzbühel,<br />
Kufste<strong>in</strong> und Rattenberg (um 1350).<br />
Im Jahre 1361 starb Ludwig, der Brandenburger und zwei Jahre später der Sohn und Erbe<br />
Me<strong>in</strong>hard III., e<strong>in</strong> furchtbarer Schlag für se<strong>in</strong>e Mutter, die nun wieder alle<strong>in</strong> dastand.<br />
Herzog Rudolf von Österreich hatte die Ereignisse <strong>in</strong> Tirol aufmerksam verfolgt und eilte mitten<br />
im W<strong>in</strong>ter nach Tirol. Er bewog Margarethe, das Land mit Österreich zu vere<strong>in</strong>en. Im Herbst 1363<br />
übergibt Margarethe ihrem Vetter Rudolf die Regierung und dankt ab. Sie zieht nach Wien, wo<br />
heute noch der Stadtteil Margarethen an sie er<strong>in</strong>nert. Vorerst aber kam Kitzbühel doch wieder zu<br />
Bayern!<br />
Bergbau <strong>in</strong> und um Kitzbühel<br />
Im Gebiet von und um Kitzbühel wurde schon <strong>in</strong> der Bronzezeit vor ungefähr 3000 Jahren<br />
Kupferbergbau betrieben. Diese Stollen ("Alter Mann" genannt) befanden sich im Revier<br />
Schattberg-S<strong>in</strong>well am Fuß des Hahnenkamms, auf der Kelchalm (Geme<strong>in</strong>de Aurach) und <strong>in</strong> den<br />
Revieren Kupferplatte, Kuhkaser und Wurzhöhe (alle Geme<strong>in</strong>de Jochberg). Siedlungsreste<br />
wurden ke<strong>in</strong>e gefunden, allerd<strong>in</strong>gs entdeckte man am Lebenberg Urnengräber aus dieser Zeit.<br />
Später kam dieser Bergbau zum Erliegen und wurde erst Jahrhunderte später wieder<br />
aufgenommen:<br />
Auf der Kelchalm und am Schattberg wurde Kupferkies abgebaut. Die Schattbergsiedlung steht<br />
auf e<strong>in</strong>er riesigen Schutthalde.<br />
Am Rerobichl <strong>in</strong> Oberndorf wurde von 1540 - 1774 Kupfer und Silber gewonnen. Der sogenannte<br />
"Heiliggeistschacht" erreichte 1618 e<strong>in</strong>e Tiefe von 504 Klaftern<br />
(= 886m) und war somit der tiefste Schacht der Welt (140 m unter dem Meeresspiegel!).<br />
In Jochberg wurde Kupfer gefördert. Der Ortsteil "Hütte" und das Schaubergwerk "Kupferplatte"<br />
er<strong>in</strong>nern heute noch daran.<br />
Am Gebra wurde Eisenerz abgebaut. Es wurde <strong>in</strong> der Schmelzhütte <strong>in</strong> Fieberbrunn verarbeitet.<br />
Das Bergamt war <strong>in</strong> Kitzbühel (heute Gebäude der Bezirkshauptmannschaft). Die Erzstufen über<br />
dem E<strong>in</strong>gangstor er<strong>in</strong>nert heute noch daran. Die Knappen erhielten dort als Bezahlung Geld und<br />
Lebensmittel (Schmalz, Getreide,...). Dieses Getreide wurde im sogenannten "Troadkasten“<br />
(heute Heimatmuseum) gelagert.<br />
Durch den Bergbau wurde Kitzbühel e<strong>in</strong>e reiche Stadt. Viele Kunstwerke er<strong>in</strong>nern heute noch an<br />
diese Zeit, z.B. die Statuen des hl. Daniel und der hl. Barbara am Knappenaltar der Pfarrkirche.<br />
Die Arbeit der Bergknappen war schwer und gefährlich (im Revier Rerobichl <strong>in</strong> Oberndorf<br />
verunglückten <strong>in</strong> 26 Jahren über 700 Bergleute tödlich!). Ihr Gruß war daher: "Glück auf!"<br />
E<strong>in</strong>ige im Bergbau verwendete Maße und Gewichte:<br />
Längenmaße: Gewichtsmaße: Hohlmaß:<br />
1 Kitzb. Bergklafter ca. 1,75 m 1 Wiener Mark 280,64 g 1 Star ca. 1 Zentner Erz<br />
1 Lehen 12,25 m 1 Loth 17,54 g<br />
1 Lehen 7 Klafter 1 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong> 4,38 g<br />
1 Pfennig 1,09 g<br />
1 Mark Silber wird geteilt <strong>in</strong> 16 Loth, 1 Loth <strong>in</strong> 4 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong>, 1 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong> <strong>in</strong> 4 Pfennig
Auf den Spuren des Bergbaues<br />
Über den Schattberg:<br />
Wenn wir von der Schule weg zur Josef-Herold-Straße wandern, gehen wir über die Gründe, wo<br />
vor ungefähr 200 Jahren die Kitzbüheler Bürger ihre Krautgärten hatten. Von der<br />
Hahnenkammstraße gelangen wir über den Bergwerksweg auf den Schattberg (Im Jahre 1297<br />
schenkte der Bayernherzog Rudolf den Bürger <strong>Kitzbühels</strong> Güter und Almen am Schattberg bis<br />
h<strong>in</strong>auf zum Jufen am Hahnekamm, damit sie die Stadtmauer und den Stadtgraben bauten!). Das<br />
Gelände, auf dem heute die Schattbergsiedlung steht, besteht aus taubem Geste<strong>in</strong> aus dem<br />
Bergbau. Die Bergleute benötigten für ihre Arbeit auch e<strong>in</strong>e Menge Werkzeug (Hämmer,<br />
Berghauen), weshalb bei jedem Bergbau e<strong>in</strong> Bergschmied war. Diese Bergschmiede war h<strong>in</strong>ter<br />
dem Haus Mall. Das Eisen wurde <strong>in</strong> der Esse mit Holzkohle (Kohle wurde erst später bekannt)<br />
zur Rotglut gebracht und geschmiedet. Diese Holzkohle wurde von den Köhlern aus Holz<br />
erzeugt.<br />
Auch das Berghaus er<strong>in</strong>nert an den Bergbau: hier waren Büros für die Verwaltung untergebracht.<br />
L<strong>in</strong>ks neben dem Berghaus etwas zurückversetzt sieht man noch den Stollene<strong>in</strong>gang. Im Jahre<br />
1909 wurde der Bergbau wegen mangelnder Rentabilität aufgelassen und die Stollen verfielen.<br />
Im Heimatmuseum ist noch die große Glocke, mit der die Schicht e<strong>in</strong>geläutet wurde: 8 Stunden<br />
dauerte e<strong>in</strong>e Schicht, Tag und Nacht wurde gearbeitet. Die Arbeit war schwer und gefährlich:<br />
Stollen brachen e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> den Schächten und Stollen bildeten sich oft Gase, die sich entzündeten<br />
(„Schlagende Wetter“), wobei die Bergleute verbrannten oder erstickten. Deshalb mußte auch mit<br />
großen Blasebälgen Frischluft e<strong>in</strong>geblasen werden. Wegen der E<strong>in</strong>sturzgefahr mussten die<br />
Stollen teilweise ausgezimmert werden. Hunderte von Metern g<strong>in</strong>g der Stollen <strong>in</strong> den Berg h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>,<br />
es bestand sogar e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung mit dem Bergbau S<strong>in</strong>well. Auch Schächte (senkrecht) wurden<br />
angelegt, durch die mit Förderkörben das Erz aus der Tiefe heraufbefördert wurde, mit Hunten<br />
(kle<strong>in</strong>e Erzwaggons) wurde es dann aus dem Stollen transportiert. In der Scheidehütte wurde<br />
dann das erzhältige vom tauben Geste<strong>in</strong> getrennt. 13- bis 14-jährige Buben, Haldenkutter<br />
genannt, durchsuchten anschließend noch die Scheidehalden nach erzhältigem Geste<strong>in</strong>. Auch<br />
Wasser gab es im Bergwerk, weshalb man an der tiefsten Stelle e<strong>in</strong>en Stollen baute, durch den<br />
das Wasser abfließen konnte. Dieser mündete h<strong>in</strong>ter der ehemaligen Stadtsäge <strong>in</strong> die Ache. Im<br />
Erzhaus war früher die Erzquetsche, auch Pochwerk genannt, wo das Geste<strong>in</strong> zerkle<strong>in</strong>ert wurde.<br />
Durch die Schutthalden wurde das ehemals steile Gelände eben, h<strong>in</strong>ter der ersten auf dieser<br />
Halde gebauten Häuserreihe geht es steil h<strong>in</strong>unter. Wenn wir weitergehen, kommen wir zum<br />
Erzbach. Er hat <strong>in</strong> früheren Jahren oft großes Unheil angerichtet und oft zu Überschwemmungen<br />
geführt, weshalb die Geme<strong>in</strong>de ihn mit Sperrmauern verbauen ließ. Das Wasser dieses Baches<br />
wurde zum Antrieb des Pochwerkes und zum Betreiben der Hämmer gebraucht (gegenüber Haus<br />
Klaißner).<br />
In der Stadt:<br />
Auch <strong>in</strong> der Stadt stoßen wir auf Schritt und Tritt auf Spuren des ehemaligen Bergbaues. Ganz <strong>in</strong><br />
der Nähe der Schule, im Hof der Bezirkshauptmannschaft, ist an der l<strong>in</strong>ken Wand e<strong>in</strong> Sgraffito,<br />
mit Bezügen zum Bergbau: oben sehen wir die beiden wichtigsten Werkzeuge der Bergleute: Mit<br />
der sogenannten Klopfe schlug der Knappe auf das spitze Bergeisen und pickelte so das Geste<strong>in</strong><br />
heraus. Darunter die Wappen Österreichs, Tirols und Salzburgs (die meisten Gewerken<br />
stammten aus Salzburg) sowie die Wappen der wichtigsten Gewerken: Rosenberger, Thenn und<br />
Katzbeck. Darunter der Spruch:<br />
Dahs Haus erpauet hat<br />
Edler Gewerckhen Fleihs<br />
Derzue auch gleicher Weihs<br />
der Pergleuth Schweihs.<br />
Auch <strong>in</strong> der Bezirkshauptmannschaft selber gibt es e<strong>in</strong> Gemälde mit Bezug zum Bergbau: Jockel<br />
Montenbruck hat es im Jahre 1942 gemalt (neu gemalt 1989 von Hermann Mayr): Es stellt e<strong>in</strong>en<br />
Bergrichter und zwei Bergknappen (Perkhpuebe) mit dem typischen „Arschleder“ dar, dazu die<br />
Inschrift:<br />
Vil Kupfer, Silber, Salz auch Eysen<br />
Das können unsere Püecher weysen.<br />
Kitzbühel 1580<br />
Über dem E<strong>in</strong>gang zur Bezirkshauptmannschaft sowie der ehemaligen Bergverwaltung (1561 im<br />
Besitz der Kössenthalerischen Gewerken, 1718 Sitz der Berwerksverwesung, 1929<br />
Forstverwaltung, jetzt Teil der BH) sehen wir Erzstufen (=Handste<strong>in</strong>e von bestem Kupfererz).<br />
Zwischen den beiden Gebäuden ist das Heimatmuseum, früher „Troadkasten“. Dieser diente als<br />
Lager für die Vorräte an Lebensmittel, die man zur Verpflegung der ca. 6.000 Bergknappen<br />
benötigte - die Knappen bekamen nämlich als Lohn neben Bezahlung auch Getreide und<br />
Schmalz.<br />
Berggericht (heute F<strong>in</strong>anzamt): Rechte und Pflichten der Bergknappen sowie der Gewerken
waren genau geregelt. Zuständig war der Bergrichter, nicht der Stadtrichter!<br />
Schutzheilige der Bergleute: Hl. Barbara (Erker der BH) und Hl. Daniel<br />
Knappenaltar <strong>in</strong> der Pfarrkirche (rechter Seitenaltar) mit den Schutzheiligen Hl. Daniel, Hl.<br />
Barbara u.a.<br />
Kupferschmid Epitaph: Matthias Kupferschmid war zur Hochblüte des Bergbaues e<strong>in</strong>er der<br />
angesehensten Männer <strong>in</strong> Kitzbühel (Bürgermeister, besaß e<strong>in</strong>e Reihe von Bauernhöfen).<br />
Schlimme Zeiten<br />
Die Pest<br />
Die Pest, der „Schwarze Tod“, war e<strong>in</strong>e furchtbare Krankheit. Sie wurde von den Ratten auf den<br />
Menschen übertragen. Die Pest war ansteckend und führte meist zum Tod. Zu hunderten raffte<br />
diese entsetzliche Seuche die Menschen dah<strong>in</strong>. Ganze Landstriche wurden durch sie entvölkert.<br />
Das erstemal trat diese gefährliche Krankheit <strong>in</strong> Tirol im Jahre 1348 auf. In manchen Gegenden<br />
blieb nur e<strong>in</strong> Sechstel der Bevölkerung am Leben. Vor vielen Jahren (1564 und 1634) wütete die<br />
Pest auch <strong>in</strong> Kitzbühel. Besonders arg war es im Jahre 1564. Die Obrigkeiten der Stadt erließen<br />
daher folgende Vorsichtsmaßregeln:<br />
1) Alle Versammlungen und Zusammenkünfte (Hochzeiten, Kegelspiele usw.) werden<br />
verboten.<br />
2) Das Siechenhaus <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse wird den Pestkranken zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
3) Für die Pflege der Pestkranken werden Wärter und e<strong>in</strong> „Aderlasser“ (Arzt)<br />
angestellt.<br />
4) Die Stadttore werden streng bewacht. Leute, die aus e<strong>in</strong>er Gegend kamen, <strong>in</strong> der<br />
die Pest herrschte, durften nicht <strong>in</strong> die Stadt.<br />
5) In Gasthäusern darf nach 8 Uhr abends niemand mehr sitzen.<br />
6) Die Bürger der Stadt werden aufgerufen, besonders streng auf Sauberkeit zu<br />
achten. Schwe<strong>in</strong>e dürfen nicht mehr frei herumlaufen.<br />
7) Die Schule wird wegen Ansteckungsgefahr geschlossen.<br />
Trotz der Vorkehrungen starben damals von den 800 E<strong>in</strong>wohner <strong>Kitzbühels</strong> etwa 500 an der<br />
Pest. Die Toten wurden <strong>in</strong> Massengräbern ausserhalb der Stadt beerdigt. Die Pestkapelle <strong>in</strong> der<br />
Hammerschiedstraße er<strong>in</strong>nert noch heute an diese schreckliche Zeit:<br />
„Hier ruhen die im Jahre 1564<br />
an der Pest Verstorbenen.“<br />
Zum letztenmal trat die Pest im Jahre 1634 auf. Die Toten<br />
wurden auf dem Pestfriedhof <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse beerdigt.<br />
Auch dort sehen wir heute noch e<strong>in</strong>e Pestkapelle.<br />
Im Mittelalter und bis <strong>in</strong> den Beg<strong>in</strong>n des 19. Jahrhunderts war die Lepra e<strong>in</strong>e Krankheit, die auch<br />
bei uns häufig auftrat. Die Aussätzigen, wie die Leute, die an dieser Krankheit litten, genannt<br />
wurden, mussten bis zu ihrem Tod <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em abgesonderten Haus, dem Sondersiechenhaus <strong>in</strong><br />
der Ehrenbachgasse leben, um andere Leute nicht anzustecken.<br />
Der große Brand im Jahre 1565<br />
Ende Juli des Jahres 1565 brach <strong>in</strong> der „Hadergasse“ (heute Ehrenbachgasse) e<strong>in</strong> furchtbares<br />
Großfeuer aus. 61 Häuser brannten völlig nieder. Viele Familien wurden obdachlos. Vor allem<br />
Bergknappen waren von diesem Unglück betroffen, da viele hier ihr Haus hatten.
Der letzte Großbrand <strong>in</strong> Kitzbühel war im Jahre 1959. In der Vorderstadt brannten drei Häuser<br />
(Werner, Straßhofer, Messner). Hätte die Feuerwehr nicht sofort e<strong>in</strong>gegriffen, wäre die ganze<br />
Stadt e<strong>in</strong> Raub der Flammen geworden.<br />
Hochwasser<br />
Teile unseres Heimatortes wurden schon oft durch Hochwasser bedroht. Die alten Hause<strong>in</strong>gänge<br />
<strong>in</strong> der Gänsbachgasse und <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse zeigen uns heute noch, wie tief e<strong>in</strong>st der<br />
Boden lag. Beim Eggerwirt ist das e<strong>in</strong>stige Erdgeschoß jetzt so tief wie normalerweise der Keller.<br />
Auch bei anderen Häusern ist es ähnlich.<br />
Besonders gefährliche Wildbäche s<strong>in</strong>d:<br />
Ehrenbach<br />
Gänsbach mit Pfarraubach<br />
Walsenbach (1955 Zugsentgleisung)<br />
Köglerbach<br />
Heute s<strong>in</strong>d diese Wildbäche weitgehend verbaut (Sperrmauern, Uferbauten usw.), trotzdem<br />
stellen sie noch immer e<strong>in</strong>e große Gefahr dar. Der beste Schutz vor Muren und Hochwasser ist<br />
e<strong>in</strong> gesunder Wald. Der Waldboden kann viel Wasser aufnehmen und gibt es nur langsam wieder<br />
ab.<br />
Auf der Brücke <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse ist e<strong>in</strong>e Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, <strong>in</strong> der<br />
Kirchgasse ist ihm e<strong>in</strong>e wunderschöne Kapelle geweiht:<br />
"Heiliger Johannes von Nepomuk<br />
schütze und vor Wassergefahr!"<br />
Die Künstlerfamilie Faistenberger<br />
Der Stammvater dieser Familie, Andreas Faistenberger, kam aus Hall <strong>in</strong> Tirol nach Kitzbühel. Im<br />
Jahre 1620 schuf er als Auftragswerk der Stadt e<strong>in</strong>e genaue Vogelschauansicht von Kitzbühel:<br />
Stadtansicht von Andreas Faistenberger aus dem Jahre 1620<br />
Stadtkern von Osten (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien)<br />
Zu diesem Bild gibt es e<strong>in</strong>ige <strong>in</strong>teressante <strong>Geschichte</strong>n: Es wurde Ende der Dreissigerjahre vom<br />
damaligen Kustos des Heimatmuseums, Gidi Moser, im Haus-, Hof- und Staatsarchiv <strong>in</strong> Wien<br />
entdeckt. Moser ließ drei Kopien anfertigen, u.zw. e<strong>in</strong>e für das Heimatmuseum, e<strong>in</strong>e weitere für<br />
die Volksschule und e<strong>in</strong>e dritte für den Deutschen Alpenvere<strong>in</strong> <strong>in</strong> München. Als diese das Werk<br />
zugeschickt erhielten, glaubten sie erschrocken, man habe ihnen versehentlich das Orig<strong>in</strong>al
gesandt, so gut war die Kopie gelungen.<br />
Der Mittelteil, der Stadtkern, ist auswechselbar und zwar zeigt er e<strong>in</strong>mal die Stadt vom<br />
Hahnenkamm aus und das zweite Mal vom Kitzbüheler Horn. Wie genau diese Ansicht war,<br />
merkte man erst, als man auf dem Bild Arkadenbögen im Hof der Bezirkshauptmannschaft<br />
entdeckte, die es <strong>in</strong> Wirklichkeit aber nicht gab. Als man jedoch genauer nachschaute, waren<br />
diese Bögen nur zugemauert worden. Man entfernte das Mauerwerk und heute s<strong>in</strong>d diese<br />
Arkaden wieder sichtbar.<br />
Der Sohn Andreas Faistenbergers, Benedikt Faistenberger, war Bildhauer. Er schuf den<br />
prächtigen Hochaltar <strong>in</strong> unserer Pfarrkirche (1663).<br />
Alle neun Söhne Benedikts waren ebenfalls Künstler. E<strong>in</strong>er von ihnen, Ignaz, ist der Vater des<br />
berühmten Barockmalers ....<br />
Simon Benedikt Faistenberger<br />
(1695 - 1759)<br />
Se<strong>in</strong>e herrlichen Fresken und Ölbilder schmücken die Kirchen von Kitzbühel, Jochberg,<br />
Oberndorf, Reith, St. Johann, Kirchdorf, Kössen, St. Ulrich und Rattenberg.<br />
<strong>Kitzbühels</strong> Kirchen<br />
Die Pfarrkirche<br />
Sie ist dem Hl. Andreas geweiht. Schon um das Jahr 800 n. Chr. stand auf diesem Platz e<strong>in</strong><br />
Gotteshaus. Die heutige Pfarrkirche stammt aus der Zeit um 1500. 71 Jahre wurde an ihr gebaut<br />
(1435 - 1506). Den gotischen Bau hat Baumeister Stefan Krumenauer aufgeführt, 1785 wurde<br />
die Kirche dann durch Andre Hueber barockisiert. Die Kirche ist dreischiffig. Der prachtvolle<br />
Hochaltar stammt vom Kitzbüheler Bildhauer Benedikt Faistenberger und dem Maler Veit Rabl.<br />
Die Beichtstühle und die "Wangen" der Kirchenstühle schuf Josef Mart<strong>in</strong> Lengauer, ebenso den<br />
Tabernakel und die Figuren der Kanzel. Das Deckengemälde <strong>in</strong> der Taufkapelle und das Ölbild<br />
der Hl. Dreikönige malte der berühmte Kitzbüheler Barockmaler Simon Benedikt Faistenberger.<br />
Das lebensgroße Kruzifix an der l<strong>in</strong>ken Wand stammt vom Kitzbüheler Bildhauer Franz Christoph<br />
Erler.<br />
Die Kirche wurde mehrmals renoviert, sodass sie heute sowohl romanische (Turm), als auch<br />
gotische und barocke Bauelemente aufweist.
Pfarrkirche zum Hl. Andreas und Liebfrauenkirche<br />
Die Liebfrauenkirche<br />
Sie ist der Gottesmutter Maria geweiht. Der Bau stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das Altarbild<br />
ist e<strong>in</strong>e Kopie des berühmten Gnadenbildes "Maria-Hilf" von Lucas Cranach aus dem Dom zu<br />
Innsbruck. Simon Benedikt Faistenberger schuf die Wand- und Deckengemälde.<br />
Unter der Kirche ist e<strong>in</strong>e Totengruft (Krypta).<br />
Der mächtige Turm wurde vor ca. 400 Jahren als Glockenturm gebaut und trägt jetzt die "Große-<br />
Glocke" und die "Andreas-Glocke" sowie das "Zügnglöggei" - die Sterbeglocke.<br />
Unsere "Große Glocke"<br />
Sie war ursprünglich für die Stadtpfarrkirche zu St. Jakob <strong>in</strong> Innsbruck bestimmt. Wegen e<strong>in</strong>es<br />
Gussfehlers (e<strong>in</strong> Ziegelste<strong>in</strong> der Form war während des Gusses h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gefallen und h<strong>in</strong>terließ e<strong>in</strong><br />
faustgroßes Loch <strong>in</strong> der Krone) nahmen die Innsbrucker die Glocke nicht an. Der Kitzbüheler<br />
Baumeister Sebastian Schwe<strong>in</strong>ester hörte davon und <strong>in</strong>itiierte e<strong>in</strong>e Spendenaktion.<br />
Bürgermeister Josef Traunste<strong>in</strong>er selbst g<strong>in</strong>g von Haus zu Haus sammeln und so konnte man<br />
diese Glocke mit dem wunderbaren Klang zum Materialpreis erwerben (ihr Gewicht beträgt 6500<br />
kg).<br />
1847 läutete sie zum erstenmal vom Frauenturm. In den beiden Weltkriegen wurden alle Glocken<br />
zur Herstellung von Waffen e<strong>in</strong>geschmolzen, nur die "Große Glocke" durfte auf besondere<br />
Fürbitte h<strong>in</strong> auf dem Turm bleiben.<br />
Die Kathar<strong>in</strong>enkirche<br />
Sie ist die Kirche <strong>in</strong>nerhalb der ehemaligen Stadtmauern. In Kriegs- und Seuchenzeiten ließ man<br />
niemanden <strong>in</strong> die Stadt h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> bzw. aus der Stadt h<strong>in</strong>aus. Man brauchte daher e<strong>in</strong> Gotteshaus <strong>in</strong><br />
der Stadt. Sie ist im gotischen Stil erbaut und besitzt auch e<strong>in</strong>en schönen gotischen Flügelaltar.<br />
Seit dem Jahre 1950 ist auf dem Turm e<strong>in</strong> Glockenspiel zum Gedächtnis an die Gefallenen<br />
beider Weltkriege untergebracht.<br />
Vom 14. Jahrhundert bis zum 31. Dezember 1875 versahen die Nachtwächter im Turm der<br />
Kathar<strong>in</strong>enkirche getreulich ihren Dienst.
Die Feuerwachstube auf dem Turm der Kathar<strong>in</strong>enkirche<br />
Die Spitalkirche<br />
An ihrer Stelle stand ehemals e<strong>in</strong>e große gotische Kirche, die aber beim Bau der Straße 1836<br />
abgetragen wurde. Das Altarbild stammt von S. B. Faistenberger. Rechts vom E<strong>in</strong>gang steht die<br />
lebensgroße Figurengruppe "Unser Herr auf der Stiege".<br />
Das Kapuz<strong>in</strong>erkloster<br />
Das Kloster wurde 1697 von Johann Raymund Graf Lamberg d.Ä. gestiftet. Im Jahre 1702<br />
konnte se<strong>in</strong> Sohn Johann Raymund d.J., Weihbischof von Passau, die Klosterkirche, die als<br />
schlichter Barockbau <strong>in</strong> der typischen Art e<strong>in</strong>es Bettelordenshauses errichtet wurde, weihen. Seit<br />
dem Jahre 2002 wird das Kloster von Franziskanern betreut.<br />
Die Evangelische Christuskirche<br />
Sie stammt von Prof. Clemens Holzmeister und wurde 1962 geweiht.<br />
Die Nepomukkapelle<br />
Sie wurde im Jahre 1727 als Bittkapelle gegen die Überschwemmungen des Pfarrau- und<br />
Gänsbaches gebaut. Innen schmücken sie herrliche Fresken von Simon Benedikt Faistenberger.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus besitzt Kitzbühel über die ganze Stadt verteilt noch e<strong>in</strong>e ganze Reihe schöner<br />
Kapellen und Bildstöcke.<br />
Kitzbüheler Persönlichkeiten
Josef Herold<br />
(1872 - 1938)<br />
Er gehörte mit Franz Reisch zu den ersten<br />
Schifahrern <strong>in</strong> Kitzbühel. Als Fotograf machte er<br />
mit se<strong>in</strong>en Bildern Kitzbühel <strong>in</strong> aller Welt<br />
bekannt. Se<strong>in</strong> größter Wunsch war der Bau e<strong>in</strong>er<br />
Seilbahn auf den Hahnenkamm. Im Jahre 1927<br />
war es dann soweit - die Hahnenkammbahn<br />
wurde gebaut. Damit war Kitzbühel e<strong>in</strong>er der<br />
modernsten W<strong>in</strong>tersportorte der Welt.<br />
An me<strong>in</strong> Kitzbühel<br />
Du schöne Stadt im Kranz der Berge,<br />
Du bist uns lieb und wohlvertraut,<br />
Wir wissen nicht, wer De<strong>in</strong>e Häuser<br />
Und De<strong>in</strong>e Straßen e<strong>in</strong>st erbaut.<br />
Wir wissen nur, der Herrgott selber<br />
Hat diesen Meister e<strong>in</strong>st gesandt,<br />
Damit er hier e<strong>in</strong> Schmuckstück schaffe,<br />
Wie ke<strong>in</strong>s besteht im ganzen Land. -<br />
In diesem Land der schönen Berge<br />
Bist Du die schönste weit und breit:<br />
Gott schütze Dich, Du liebe Heimat<br />
In guter und <strong>in</strong> schlechter Zeit.<br />
Dieses Lied schrieb Josef Herold als e<strong>in</strong>e Liebeserklärung an se<strong>in</strong>e Vaterstadt.<br />
Josef Pirchl<br />
(1822 - 1906)<br />
Er war von Beruf Uhrmacher und e<strong>in</strong> gesuchter<br />
Mechaniker. Se<strong>in</strong>e ganze Kraft stellte er<br />
uneigennützig se<strong>in</strong>er Heimatstadt zur Verfügung:<br />
30 Jahre lang arbeitete er im Geme<strong>in</strong>derat und<br />
war 8 Jahre davon Bürgermeister der Stadt.<br />
Im Jahre 1872 gründete er die Freiwillige<br />
Feuerwehr. Er war auch Gründer des<br />
Turnvere<strong>in</strong>s.<br />
Josef Pirchl haben wir es auch zu verdanken,<br />
dass im Jahre 1875 die Eisenbahn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Schleife um Kitzbühel gebaut wurde und die<br />
Stadt e<strong>in</strong>en Bahnhof erhielt. Ursprünglich war<br />
nämlich vorgesehen, die L<strong>in</strong>ie von St. Johann<br />
nach Wörgl zu führen.<br />
Hochgeachtet starb Josef Pirchl im Jahre 1906.<br />
E<strong>in</strong>e Er<strong>in</strong>nerungstafel an se<strong>in</strong>em Wohnhaus und<br />
e<strong>in</strong>e nach ihm benannte Straße er<strong>in</strong>nern uns an<br />
ihn.
Franz Reisch<br />
(1863 - 1920)<br />
Er war Gastwirt und Konditor <strong>in</strong> Kitzbühel.<br />
Nachdem er e<strong>in</strong> Buch über den Schilauf <strong>in</strong><br />
Norwegen gelesen hatte, ließ er sich aus<br />
Norwegen "Scheeschuhe", wie die Schi damals<br />
genannt wurden, schicken. Am 5. März 1893 fuhr<br />
er erstmals mit Schiern vom Kitzbüheler Horn <strong>in</strong>s<br />
Tal. Als im Jahre 1902 die<br />
W<strong>in</strong>tersportvere<strong>in</strong>igung Kitzbühel gegründet<br />
wurde, fasste man auch den Beschluss, durch<br />
Sportbilder für das Schneeschuhlaufen und den<br />
Besuch <strong>Kitzbühels</strong> zu werben. Seit dieser Zeit<br />
war Josef Herold mit se<strong>in</strong>em "Guckkasten"<br />
(Fotoapparat) immer dabei, wenn Schitouren auf<br />
die umliegenden Berge gemacht wurden. Bei<br />
dieser Sitzung beschloss man ausserdem noch,<br />
bei den e<strong>in</strong>heimischen Wagnermeistern 30 Paar<br />
Schi für die Kitzbüheler Schuljugend anfertigen<br />
zu lassen und Franz Reisch übernahm es selbst<br />
"se<strong>in</strong>e Buben" auf der H<strong>in</strong>terbräuleiten im<br />
Schilauf zu unterrichten.<br />
Franz Reisch war auch <strong>in</strong> den Jahren 1903 -<br />
1913 Bürgermeister der Stadt und machte <strong>in</strong><br />
dieser Zeit Kitzbühel zum 1. W<strong>in</strong>tersportort Tirols.<br />
Er starb 1920 bei e<strong>in</strong>er Schiabfahrt vom Hahnenkamm im 59. Lebensjahr an Herzversagen.<br />
Das Kitzbüheler Ski-Wunderteam<br />
Von li. n. re.:<br />
Ernst H<strong>in</strong>terseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber d.J., Anderl Molterer, Toni Sailer
Alfons Petzold<br />
(1882 -1923)<br />
Der „Arbeiterdichter“ Alfons Petzold wurde 1882 <strong>in</strong><br />
Wien geboren. Schon als K<strong>in</strong>d kränkelte er immer<br />
wieder. Da se<strong>in</strong>e Eltern immer mehr verarmten,<br />
konnte er ke<strong>in</strong>e höhere Schule besuchen und<br />
musste sich, da er auch ke<strong>in</strong>e Lehrstelle fand, schon<br />
mit 14 Jahren als Hilfsarbeiter durchschlagen. In<br />
dieser Zeit starb se<strong>in</strong> Vater und wenig später auch<br />
se<strong>in</strong>e Mutter. Hunger und Delogierung waren se<strong>in</strong><br />
weiteres Los. Er musste <strong>in</strong> Massenquartieren<br />
übernachten und - <strong>in</strong> der schlimmsten Zeit se<strong>in</strong>es<br />
Lebens zeitweilig mit anderen Arbeitslosen - im<br />
Abflusskanal des Wienflusses. Die Obdachlosen<br />
ernährten sich von Abfällen und - als Aufbesserung<br />
ihrer Kost - sogar von Ratten.<br />
Trotzdem verlor Petzold nie den Glauben an das<br />
Gute, er las viel und begann selbst zu schreiben.<br />
Se<strong>in</strong> Schaffensgebiet war die Welt der Arbeiter.<br />
Nach zwölf Jahren als Hilfsarbeiter brach Petzold im<br />
Jahre 1908 unter e<strong>in</strong>em Blutsturz zusammen. Er war<br />
dem Tode nahe. Freunde ermöglichten ihm die<br />
E<strong>in</strong>weisung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Lungenheilstätte, wodurch sich<br />
se<strong>in</strong> Gesundheitszustand zusehends besserte. So<br />
kam er 1917 nach Kitzbühel. Das Klima hier tat ihm<br />
gut, aber der Zusammenbruch des Krieges brachte<br />
wieder Entbehrung und Not. Alfons Petzold starb,<br />
erst 41-jährig, am 26. Jänner 1923 <strong>in</strong> Kitzbühel. Er ruht auf dem hiesigen Bergfriedhof.<br />
Das bedeutendste Werk Alfons Petzolds ist se<strong>in</strong> Roman „Das rauhe Leben“, <strong>in</strong> dem er se<strong>in</strong><br />
eigenes Leben beschrieb.<br />
Immer ist es der Schweigende,<br />
der das Wort sät <strong>in</strong> die Welt,<br />
immer ist es der sich Neigende,<br />
der zuletzt als Sieger E<strong>in</strong>zug hält.<br />
Allen laut und hastig Strebenden<br />
baut e<strong>in</strong> tiefes Grab die Zeit,<br />
nur den still und e<strong>in</strong>sam Lebenden<br />
blüht die holde Ewigkeit.<br />
(Alfons Petzold)
Franz Christoph Erler<br />
(1829 - 1911)<br />
Erler war e<strong>in</strong> bedeutender Bildhauer unserer Stadt.<br />
Er schuf das Freiheitskämpferdenkmal beim alten<br />
Stadtspital und das große Kreuz <strong>in</strong> der Pfarrkirche.<br />
Die meiste Zeit se<strong>in</strong>es Schaffens verbrachte er <strong>in</strong><br />
Wien, wo auch die größte Zahl se<strong>in</strong>er Kunstwerke zu<br />
bewundern ist (Votivkirche, Alt-Lerchenfelder Kirche,<br />
Stephansdom).<br />
Erler wurde 1829 <strong>in</strong> der "Hanslmühle" (heute<br />
abgerissen - Parkplatz!) geboren und starb 1911 <strong>in</strong><br />
Wien. E<strong>in</strong> Gedenkste<strong>in</strong> im Kurpark er<strong>in</strong>nert an den<br />
großen Kitzbüheler Künstler.<br />
Alfons Walde<br />
(1891 - 1958)<br />
Walde kam 1891 als Sohn e<strong>in</strong>er Lehrerfamilie <strong>in</strong><br />
Oberndorf zur Welt. Im folgenden Jahr übersiedelte<br />
die Familie nach Kitzbühel, wo se<strong>in</strong> Vater Leiter der<br />
Volksschule wurde. Alfons Walde studierte<br />
anfänglich an der Technischen Hochschule, wandte<br />
sich später aber der Malerei zu. Bekannt wurde er<br />
durch se<strong>in</strong>e Bilder der Tiroler Landschaft und ihrer<br />
Menschen. Im Kitzbüheler Heimatmuseum s<strong>in</strong>d viele<br />
se<strong>in</strong>er Werke zu sehen (auch die Volksschule besitzt<br />
e<strong>in</strong> Bild von ihm, e<strong>in</strong> Geschenk se<strong>in</strong>er Schwester<br />
Berta Walde). Auch an Plakatwettbewerben für die<br />
Fremdenverkehrswerbung beteiligte er sich mit<br />
großem Erfolg. Walde war aber auch als Architekt<br />
tätig und plante u.a. die Stationsgebäude der alten<br />
Hahnenkammbahn, Schulen, Hotels und<br />
Privathäuser.
Quelle:<br />
http://www.v<br />
skitzbuehel.ts<br />
n.at/kitzb%C<br />
3%BChel/kit<br />
zbuehel.htm