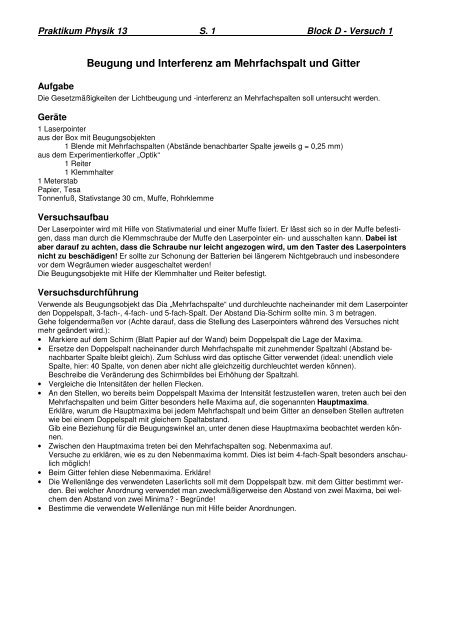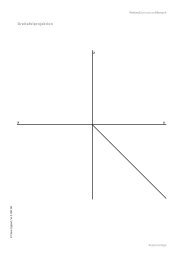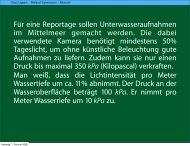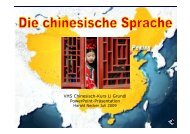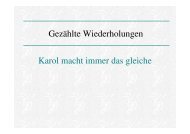Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...
Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...
Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praktikum Physik 13 S. 1 Block D - Versuch 1<br />
Aufgabe<br />
<strong>Beugung</strong> <strong>und</strong> <strong>Interferenz</strong> <strong>am</strong> <strong>Mehrfachspalt</strong> <strong>und</strong> <strong>Gitter</strong><br />
Die Gesetzmäßigkeiten der Lichtbeugung <strong>und</strong> -interferenz an <strong>Mehrfachspalt</strong>en soll untersucht werden.<br />
Geräte<br />
1 Laserpointer<br />
aus der Box mit <strong>Beugung</strong>sobjekten<br />
1 Blende mit <strong>Mehrfachspalt</strong>en (Abstände benachbarter Spalte jeweils g = 0,25 mm)<br />
aus dem Experimentierkoffer „Optik“<br />
1 Reiter<br />
1 Klemmhalter<br />
1 Meterstab<br />
Papier, Tesa<br />
Tonnenfuß, Stativstange 30 cm, Muffe, Rohrklemme<br />
Versuchsaufbau<br />
Der Laserpointer wird mit Hilfe von Stativmaterial <strong>und</strong> einer Muffe fixiert. Er lässt sich so in der Muffe befestigen,<br />
dass man durch die Klemmschraube der Muffe den Laserpointer ein- <strong>und</strong> ausschalten kann. Dabei ist<br />
aber darauf zu achten, dass die Schraube nur leicht angezogen wird, um den Taster des Laserpointers<br />
nicht zu beschädigen! Er sollte zur Schonung der Batterien bei längerem Nichtgebrauch <strong>und</strong> insbesondere<br />
vor dem Wegräumen wieder ausgeschaltet werden!<br />
Die <strong>Beugung</strong>sobjekte mit Hilfe der Klemmhalter <strong>und</strong> Reiter befestigt.<br />
Versuchsdurchführung<br />
Verwende als <strong>Beugung</strong>sobjekt das Dia „<strong>Mehrfachspalt</strong>e“ <strong>und</strong> durchleuchte nacheinander mit dem Laserpointer<br />
den Doppelspalt, 3-fach-, 4-fach- <strong>und</strong> 5-fach-Spalt. Der Abstand Dia-Schirm sollte min. 3 m betragen.<br />
Gehe folgendermaßen vor (Achte darauf, dass die Stellung des Laserpointers während des Versuches nicht<br />
mehr geändert wird.):<br />
• Markiere auf dem Schirm (Blatt Papier auf der Wand) beim Doppelspalt die Lage der Maxima.<br />
• Ersetze den Doppelspalt nacheinander durch <strong>Mehrfachspalt</strong>e mit zunehmender Spaltzahl (Abstand benachbarter<br />
Spalte bleibt gleich). Zum Schluss wird das optische <strong>Gitter</strong> verwendet (ideal: unendlich viele<br />
Spalte, hier: 40 Spalte, von denen aber nicht alle gleichzeitig durchleuchtet werden können).<br />
Beschreibe die Veränderung des Schirmbildes bei Erhöhung der Spaltzahl.<br />
• Vergleiche die Intensitäten der hellen Flecken.<br />
• An den Stellen, wo bereits beim Doppelspalt Maxima der Intensität festzustellen waren, treten auch bei den<br />
<strong>Mehrfachspalt</strong>en <strong>und</strong> beim <strong>Gitter</strong> besonders helle Maxima auf, die sogenannten Hauptmaxima.<br />
Erkläre, warum die Hauptmaxima bei jedem <strong>Mehrfachspalt</strong> <strong>und</strong> beim <strong>Gitter</strong> an denselben Stellen auftreten<br />
wie bei einem Doppelspalt mit gleichem Spaltabstand.<br />
Gib eine Beziehung für die <strong>Beugung</strong>swinkel an, unter denen diese Hauptmaxima beobachtet werden können.<br />
• Zwischen den Hauptmaxima treten bei den <strong>Mehrfachspalt</strong>en sog. Nebenmaxima auf.<br />
Versuche zu erklären, wie es zu den Nebenmaxima kommt. Dies ist beim 4-fach-Spalt besonders anschaulich<br />
möglich!<br />
• Beim <strong>Gitter</strong> fehlen diese Nebenmaxima. Erkläre!<br />
• Die Wellenlänge des verwendeten Laserlichts soll mit dem Doppelspalt bzw. mit dem <strong>Gitter</strong> bestimmt werden.<br />
Bei welcher Anordnung verwendet man zweckmäßigerweise den Abstand von zwei Maxima, bei welchem<br />
den Abstand von zwei Minima? - Begründe!<br />
• Bestimme die verwendete Wellenlänge nun mit Hilfe beider Anordnungen.
Praktikum Physik 13 S. 2 Block D - Versuch 1<br />
Strukturaufklärung<br />
Kennt man umgekehrt die Wellenlänge des Lasers, so kann man sehr kleine Abstände bestimmen (Strukturaufklärung).<br />
1. Bestimmung der <strong>Gitter</strong>konstanten eines <strong>Gitter</strong>s:<br />
Verwende als <strong>Beugung</strong>sobjekt das <strong>Gitter</strong> „250“ oder ein ähnliches <strong>Gitter</strong>. Bestimme dessen <strong>Gitter</strong>konstante<br />
mit Hilfe seines <strong>Beugung</strong>sbildes.<br />
Vergleiche dein Ergebnis mit der Firmenangabe: „250“ steht hier für 250 Spalte je cm.<br />
2. Bestimmung der Dicke eines Haares:<br />
Laser ausschalten!! Legt ein Haar eines Mitschülers über<br />
die Strahlaustrittsöffnung des Lasers <strong>und</strong> fixiert es seitlich<br />
mit Tesafilm. Auf einer mindestens 3 m entfernten Wand<br />
beobachtet ihr ein typisches <strong>Beugung</strong>sbild. Dieses hat<br />
Ähnlichkeit mit dem <strong>Beugung</strong>sbild eines Doppelspaltes,<br />
insbesondere ist in der Mitte (Schattenraum des Haares)<br />
ein heller Strich.<br />
Erkläre dieses Phänomen (vgl. Abb. 2). Bestimme die<br />
Haardicke.<br />
Abb. 2: Zur Entstehung der <strong>Interferenz</strong>figur eines<br />
Drahtes oder Haares. Als was fungieren die Randpunkte<br />
R1 <strong>und</strong> R2 des Haares?