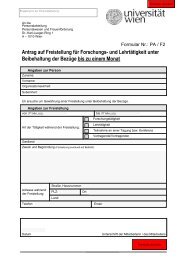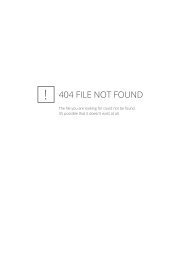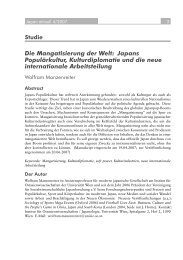Wolfram Manzenreiter Sport im Konsumkapitalismus: Spuren der ...
Wolfram Manzenreiter Sport im Konsumkapitalismus: Spuren der ...
Wolfram Manzenreiter Sport im Konsumkapitalismus: Spuren der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfram</strong> <strong>Manzenreiter</strong><br />
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
<strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong>: <strong>Spuren</strong> <strong>der</strong> Entwicklung zur globalen Ökonomisierung<br />
des <strong>Sport</strong>s<br />
<strong>Sport</strong> und Wirtschaft schöpfen ihre Kraft aus denselben Werten: Teamgeist, Fairness und das Streben<br />
nach Leistung sind in beiden Bereichen unabdingbar für den Erfolg.<br />
Josef Ackermann; Vorstandsvorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Deutsche Bank AG<br />
Einleitung: <strong>Sport</strong>, Business und Konsumgesellschaft<br />
<strong>Sport</strong> ist am Ende des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts zweifellos ein beeindrucken<strong>der</strong> Wirtschaftsfaktor von<br />
globaler D<strong>im</strong>ension geworden. Vor allem in den hoch entwickelten Gesellschaften des Nordens<br />
hat sich um den <strong>Sport</strong> herum ein gigantischer Markt gebildet, an dem die unterschiedlichsten<br />
Industriezweige beteiligt sind und Millionen von ArbeitnehmerInnen Beschäftigung<br />
finden. 2006 betrug <strong>der</strong> weltweite Markt für <strong>Sport</strong>dienstleistungen 96 Milliarden Dollar (PriceWaterhouseCoopers<br />
2007, S. 673). Dieser Betrag, <strong>der</strong> in etwa <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Nationalökonomien<br />
von Peru o<strong>der</strong> Neuseeland entspricht, bezieht sich allerdings lediglich auf die Erlöse<br />
aus Kartenverkäufen bei <strong>Sport</strong>veranstaltungen, den Verkauf von Übertragungsrechten und die<br />
Umsätze in Merchandising und Sponsoring. Zieht man noch die Umsätze <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>artikelindustrie<br />
(2002: 58,4 Milliarden Dollar; CCC 2004), sonstige <strong>Sport</strong>ausgaben <strong>der</strong> Privathaushalte<br />
und die <strong>Sport</strong>investitionen <strong>der</strong> öffentlichen Hand hinzu, wächst <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> globalen<br />
<strong>Sport</strong>ökonomie auf ein Vielfaches an. Genaue Angaben sind aufgrund <strong>der</strong> Komplexität des<br />
Marktes unmöglich, Schätzungen gehen aber von mehr als 600 Milliarden Dollar aus. In den<br />
USA (Schaaf 2004, S. 325), Großbritannien (<strong>Sport</strong> England 2003, S. 3) und Deutschland<br />
(Heinemann 1998, S. 33) betrug die Bruttowertschöpfung des <strong>Sport</strong>s zu Beginn des Jahrzehnts<br />
zwischen 1 und 1,5% des Bruttoinlandsprodukts. Mit einer Größenordnung von 194<br />
Milliarden Dollar überragte die US-amerikanische <strong>Sport</strong>wirtschaft 2001 einhe<strong>im</strong>ische Industriesektoren<br />
wie Chemikalien, Elektronik o<strong>der</strong> Lebensmittel und stellte damit die Gesamtwirtschaftsleistung<br />
von Län<strong>der</strong>n wie Österreich, Polen o<strong>der</strong> Norwegen in den Schatten.<br />
Eher noch als solche makroökonomischen Kennzahlen haben Sensationsmeldungen über millionenschwere<br />
Transfererlöse von Spitzensportlern, die fünfstellige Dollarsummen in <strong>der</strong> Woche<br />
verdienen, o<strong>der</strong> die gigantischen Summen für Medienrechte und Exklusivpartnerschaften,<br />
die Weltunternehmen wie Coca Cola, Gillette o<strong>der</strong> JVC mit den Kontrollorganen des Weltsports<br />
(z.B. IOC, FIFA) zusammenbringen, nachhaltig zur Schaffung des allgegenwärtigen<br />
Bildes vom Big Business <strong>Sport</strong> beigetragen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass<br />
<strong>der</strong> hochgradig kommerzialisierte <strong>Sport</strong> kein „kultureller Universalismus“ ist, son<strong>der</strong>n ein<br />
„historisches Moment“ (Sage 1998, S. 131), das den momentanen Stand in dem Spannungsverhältnis<br />
zwischen zwei kontrastierenden Auffassungen vom <strong>Sport</strong> als Erziehung einerseits<br />
und Unterhaltung an<strong>der</strong>erseits markiert. Auch wenn die Verflechtung von <strong>Sport</strong> und Kapital<br />
auf eine lange Tradition zurückblicken kann, so ist die <strong>der</strong>art geradlinige Gleichung von <strong>Sport</strong><br />
und Kommerz doch ein eher rezentes Phänomen, das <strong>im</strong> Kontext ökonomischer, politischer<br />
und kultureller Transformationen <strong>der</strong> Spätmo<strong>der</strong>ne verstanden werden muss (Andrews/Ritzer<br />
2007). Deshalb gilt auch, dass die symbiotische Partnerschaft von <strong>Sport</strong> und Wirtschaft nicht<br />
von ewiger Dauer sein muss. Die Grenzen <strong>der</strong> Belastbarkeit dieser Interessengemeinschaft<br />
zeichnen sich in den Krisen des <strong>Sport</strong>s ab, zuletzt etwa <strong>im</strong> Rückzug <strong>der</strong> Sponsoren aus dem<br />
von Doping-Skandalen geplagten Radrennsport.<br />
79
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
Als Bestandteil <strong>der</strong> Unterhaltungsindustrie ist <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> in vielerlei Hinsicht ein unorthodoxes<br />
ökonomisches Produkt. Zum einen unterwerfen sich seine ProduzentInnen freiwillig Beschränkungen,<br />
die den Wettbewerb eindämmen. Dazu zwingt sie <strong>der</strong> Umstand, dass <strong>der</strong> Zuschauersport<br />
seinen Wert durch die Gemeinschaftsproduktion unabhängiger Wirtschaftssubjekte<br />
erhält, die gleichzeitig in die Leistungsopt<strong>im</strong>ierung <strong>der</strong> Einzel- und <strong>der</strong> Gesamtproduktion<br />
investieren müssen. Exzessiver Wettbewerb schadet aber, weil die dauerhafte Dominanz<br />
eines Teilnehmers die Spannung aus dem Liga- o<strong>der</strong> Turnierbetrieb herausnehmen würde.<br />
Daher sorgen marktexterne Faktoren wie ein Relegationssystem o<strong>der</strong> das Draft-System für<br />
eine relativ ausgeglichene Spielstärke zwischen den Teams und stabilisieren damit die Nachfrage.<br />
Zum an<strong>der</strong>en verweigern sich die KonsumentInnen <strong>im</strong> Zuschauersport <strong>der</strong> Marktrationalität,<br />
da ihr Konsum sich nicht pr<strong>im</strong>är an <strong>der</strong> Qualität des Produkts, Effizienzgewinnen o<strong>der</strong><br />
Leistungen orientiert. Selbst das langfristige Ausbleiben von Titelerfolgen bedeutet nicht,<br />
dass diese Klubs weniger Eintrittskarten o<strong>der</strong> Fanartikel absetzen können. Zur konzeptionellen<br />
Unorthodoxie trägt auch <strong>der</strong> Freizeitsport bei, <strong>der</strong> in seiner Organisation und Bedeutung<br />
zwar einer eigenen Logik folgt, in Wirklichkeit jedoch bis zur gegenseitigen Abhängigkeit<br />
eng mit dem Spitzensport verbunden ist. Ein institutionelles Arrangement von <strong>Sport</strong>organisationen<br />
und öffentlichen Regulatoren ist für die gemeinsame Administration und Kontrolle<br />
zuständig; beide Bereiche stehen bei den gleichen öffentlichen und privaten Quellen um Ressourcen<br />
materieller und <strong>im</strong>materieller Art an, und die Bil<strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>medien und des Mediensports<br />
bilden den Stoff für die Träume, Wahlentscheidungen und Motivationen, die Fans<br />
und den sportlichen Nachwuchs in ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht mit diversen Akteuren<br />
wie den Produzenten, Anbietern und Kontrollorganen des <strong>Sport</strong>s einbinden.<br />
Ein Schlüssel zur Erklärung <strong>der</strong> umfassenden Ökonomisierung des <strong>Sport</strong>s findet sich in seiner<br />
Einbettung in einen Prozess, in dem die Praxis <strong>der</strong> Warenaneignung das dominante Mittel <strong>der</strong><br />
gesellschaftlichen Teilhabe geworden ist. Der Konkurrenzkampf um den Mehrwert <strong>der</strong> Arbeit<br />
ist zwar nach wie vor ein bedeuten<strong>der</strong> Motor <strong>der</strong> Entwicklung <strong>im</strong> Konsum-Kapitalismus. Der<br />
Konsum gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung für individuelle und kollektive Formen <strong>der</strong><br />
Identitätskonstruktion und damit für die Markierung von Trennlinien in <strong>der</strong> gesellschaftlichen<br />
Ordnung. Bereits 1899 hat Veblens The Theory of the Leisure Class (1986) demonstriert, dass<br />
das demonstrative verschwen<strong>der</strong>ische Konsumverhalten <strong>der</strong> Oberschicht dem Zweck <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Inszenierung von Status, Prestige und ökonomischer Macht dient. Bourdieu hat in<br />
seiner Arbeit Die feinen Unterschiede (1987) deutlich gemacht, wie die Praxis des Konsums<br />
von sozialer Differenzierung betroffen ist und diese bewirkt. Konsum ist also mehr als nur <strong>der</strong><br />
Endzweck jeden wirtschaftlichen Handelns, wie es die klassische Ökonomie postuliert. Eine<br />
soziologische Diskussion des <strong>Sport</strong>konsums lässt sich nicht auf die technische Definition des<br />
aggregierten Erwerbs und Verbrauchs von sportspezifischen Gütern und Dienstleistungen<br />
reduzieren, wenn sie <strong>der</strong> Subjektivität <strong>der</strong> Konsumierenden Rechnung tragen will. Sie wird<br />
den Prozess <strong>der</strong> Auswahl, Informationsbeschaffung und Kaufentscheidung ebenso einbeziehen<br />
müssen wie die vielfältigen Formen des Gebrauchs, <strong>der</strong> Neuinterpretation o<strong>der</strong> Weitergabe,<br />
die sich <strong>der</strong> strengen Marktrationalität von Angebot und Nachfrage entziehen (Campbell<br />
1995, S. 102).<br />
Das ökonomische Bindeglied zwischen <strong>Sport</strong> und Konsumkultur bildet das gemeinsame Interesse<br />
am Körper als expressives Mittel sowie die Fähigkeit, diesen für die Repräsentation von<br />
Status, Lifestyles und Identitäten zu mobilisieren (Hargreaves 1986, S. 134). Turner (1996, S.<br />
23) bemerkte, dass Konsum und Mode heute anstelle von Religion und Moral die regulierende<br />
Kontrolle des Körpers übernommen haben. Schon Walter Benjamin hat in seiner Analyse<br />
80
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
„Kapitalismus als Religion“ festgestellt, dass <strong>der</strong> Konsumismus zunehmend die Züge einer<br />
Weltreligion angenommen hat. Tatsächlich strukturieren <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> wie auch <strong>im</strong> Konsum die<br />
Macht des Begehrens und die generelle Norm <strong>der</strong> unerfüllten Befriedigung das Handeln des<br />
Einzelnen. Die Transformation des mo<strong>der</strong>nen <strong>Sport</strong>s in ein Feld <strong>der</strong> gesellschaftlichen Praxis<br />
des Konsums verläuft daher parallel zur Geschichte <strong>der</strong> Konsumgesellschaft, in <strong>der</strong> wachsen<strong>der</strong><br />
Wohlstand und sinkende Arbeitszeiten, Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Nachfrage nach Freizeitangeboten<br />
und die Ästhetisierung des Alltags das Arrangement von ProduzentInnen und KonsumentInnen<br />
<strong>im</strong> <strong>Sport</strong> verän<strong>der</strong>t haben. Dieser Prozess verlief in drei großen Phasen, die das gegenseitige<br />
Interesse von <strong>Sport</strong> und Wirtschaft und damit auch die soziale Bedeutung des <strong>Sport</strong>konsums<br />
distinktiv geprägt haben. Anhand <strong>der</strong> Rekonstruktion <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Kommodifizierung<br />
des <strong>Sport</strong>s wird <strong>im</strong> Folgenden <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> als Gegenstand gesellschaftlicher Machtinteressen<br />
diskutiert werden. Konkret interessiert uns dabei, welche Kräfte die Macht haben,<br />
den Konsum <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> und mit dem <strong>Sport</strong> zu beeinflussen und wie sich diese Interessenlagen<br />
und Machthierarchien auf Formen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Inklusion und Exklusion auswirken.<br />
Step 1: <strong>Sport</strong> in <strong>der</strong> Embryonalphase <strong>der</strong> Konsumgesellschaft<br />
Das Naheverhältnis zwischen <strong>Sport</strong> und Wirtschaft lässt sich aus <strong>der</strong> gemeinsamen Entwicklungsgeschichte<br />
ableiten. Etwa zeitgleich mit <strong>der</strong> Formalisierung von kompetitiven Bewegungsspielen<br />
bildeten sich <strong>im</strong> England des 18. und 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts die Fundamente heraus,<br />
auf denen mit Nationalstaat, Bürgergesellschaft und Industrialisierung die Grundprinzipien<br />
<strong>der</strong> gesellschaftlichen Organisation in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne aufbauten. Das Bindeglied zwischen diesen<br />
Institutionen lieferten mit dem Leistungsethos <strong>der</strong> protestantischen Ethik und einer funktional-rationalistischen<br />
Weltauffassung die Werte und Einstellungen <strong>der</strong> neuen bürgerlichen<br />
Eliten (Guttmann 1979). Ökonomische Erwartungen an den <strong>Sport</strong> spielten insofern eine wichtige<br />
Rolle, als die Wettleidenschaft <strong>der</strong> Oberschicht ein hervorragendes Betätigungsfeld <strong>im</strong><br />
ergebnisoffenen <strong>Sport</strong> vorfand. Gerade die Ökonomie des Glücksspiels benötigte neben dem<br />
Ethos des Fair Play <strong>der</strong> Beteiligten auch eine verbindliche Klärung <strong>der</strong> Wettkampfbedingungen,<br />
die zunächst auf Fallbasis ausgehandelt, später aber zunehmend abstrahiert wurden. Im<br />
Verlauf des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts fand ihre Standardisierung in Form von Spielregeln statt; für<br />
Einhaltung und Überwachung wurden unabhängige Organisationen eingerichtet. Waren es<br />
zunächst die Schulen <strong>der</strong> neuen Bildungseliten, an denen <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> seine institutionelle He<strong>im</strong>at<br />
fand, so organisierten sich die Arbeiter und Angehörigen <strong>der</strong> unteren Mittelschichten in<br />
jeweils ihren eigenen, autonomen Vereinen. Später formierten sich diese auch unter <strong>der</strong> Patronage<br />
von politischen Parteien und Kirchenverbänden, die mit dem Angebot an die Körper<br />
<strong>der</strong> Jugend um ihre Köpfe konkurrierten. Der Staat tolerierte diese Formen <strong>der</strong> Selbstorganisation<br />
weitgehend, zumal er sich selbst mit <strong>der</strong> Einrichtung des Schulsportfachs an den<br />
Pflichtschulen zu den erzieherischen Werten des apolitischen <strong>Sport</strong>s bekannte.<br />
Ansonsten wurde die Rolle des Geldes mit Argwohn betrachtet. Nicht zu Unrecht befürchtete<br />
man, dass Geld <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> zu Verzerrungen des Wettbewerbs und zu verschiedenen Formen<br />
von Exzessen führen würde, die den ideellen Werten seiner Patronage wi<strong>der</strong>sprachen. Das<br />
Ideal des unabhängigen o<strong>der</strong> ökonomisch desinteressierten Gentleman-Athleten wurde mit <strong>der</strong><br />
Amateurklausel festgeschrieben, die den Teilnehmern am <strong>Sport</strong>wettkampf verbot, Geld o<strong>der</strong><br />
geldwerte Preise in Empfang zu nehmen. Zusätzlich trug <strong>der</strong> soziale Ausschlusscharakter <strong>der</strong><br />
Regelung dazu bei, dass die arbeitende Bevölkerung von den oberen Schichten getrennt wurde;<br />
man blieb also „<strong>im</strong> Klub“ unter sich. Offiziell hielten die Olympische Bewegung und<br />
zahlreiche nationale <strong>Sport</strong>verbände bis in die 1980er-Jahre am Amateurparagraphen fest. Fak-<br />
81
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
tisch aber war er von Anbeginn an starkem Druck ausgesetzt, als die ersten Unternehmer das<br />
ökonomische Potenzial <strong>im</strong> Unterhaltungswert des <strong>Sport</strong>s erkannten. Da schließlich auch die<br />
nationalen Verbände und Fachorganisationen <strong>im</strong> IOC versuchten, ihren Spielraum so weit wie<br />
möglich auszureizen, verkam die Regelung während <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
zum Anachronismus, <strong>der</strong> in krassem Gegensatz zur allgemeinen Praxis stand.<br />
Die erste Phase <strong>der</strong> Kommerzialisierung des <strong>Sport</strong>s, die etwa von 1860 bis in die 1920er-Jahre<br />
reicht, wurde von <strong>der</strong> Entwicklung mo<strong>der</strong>ner Konsumpraktiken und Massenmärkte begleitet.<br />
Industrialisierung und Verstädterung bewirkten die Neuordnung <strong>der</strong> gesellschaftlichen Strukturen.<br />
Bislang unbekannte Arbeitsfel<strong>der</strong> und Berufszweige entstanden <strong>im</strong> Zuge <strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />
Expansion und för<strong>der</strong>ten die Chancen zur sozialen Mobilität. Mit <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong><br />
Arbeiterschaft stiegen nicht nur die Einkommen auf Pro-Kopf-Basis, son<strong>der</strong>n auch die arbeitsfreie<br />
Zeit (Glennie 1995, S. 165). Der Werbebranche kam die entscheidende Aufgabe zu,<br />
die Stadtbevölkerung zu überzeugen, besser in <strong>der</strong> Gegenwart zu konsumieren anstatt in die<br />
Zukunft zu investieren. Vor diesem Hintergrund rückte <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> als Investitionsobjekt und<br />
Werbeträger in das Blickfeld <strong>der</strong> Unternehmerklasse. Deren wirtschaftliches Engagement<br />
hatte in England zunächst eher aus philanthropischen Beweggründen in <strong>der</strong> Form von Zuwendungen<br />
für den lokalen <strong>Sport</strong>klub begonnen. Kompensationszahlungen für Verdienstausfälle<br />
<strong>der</strong> an den Turnieren für ihre Vereine spielenden Industrie- und Bergbauarbeiter setzten<br />
aber eine schleichende Professionalisierung in Gang. Als die Football Association Mitte <strong>der</strong><br />
1880er-Jahre offiziell auf die Amateurregelung verzichtete, folgte eine an<strong>der</strong>e Generation an<br />
Unternehmern mit neuen Geschäftsmodellen nach. Ihr Kapital begründete Fußballklubs als<br />
GmbHs, auf <strong>der</strong>en Ausgabenseite neben dem Bau und Unterhalt von Stadien die Gehälter für<br />
die Spieler standen. Auf <strong>der</strong> Einnahmenseite verzeichneten die Gesellschaften die Erlöse aus<br />
dem Verkauf von Eintrittskarten und Preisgel<strong>der</strong>. Allerdings wurden max<strong>im</strong>al fünf Prozent<br />
<strong>der</strong> Gewinne an Dividenden ausgezahlt, und <strong>der</strong> Vorstand selber betrachtete seine Arbeit als<br />
ehrenamtliche Tätigkeit (Horne 2006, S. 20).<br />
Die Kommerzialisierung <strong>im</strong> europäischen Fußball war jedoch eine Ausnahmeerscheinung, die<br />
zudem nur in wenigen Län<strong>der</strong>n gebilligt und nachgeahmt wurde. Professionalisierungstendenzen<br />
zeigten sich außerdem am Ende dieser Phase in <strong>Sport</strong>arten wie Boxen, Radrennen und<br />
Pfer<strong>der</strong>ennen, die wie <strong>der</strong> Fußball große Zuschauermassen mobilisieren konnten. Jedoch überwog<br />
in Europa bis weit über die Embryonalphase <strong>der</strong> Konsumgesellschaft hinaus die moralpädagogische<br />
Vorstellung, dass dem <strong>Sport</strong> eine beson<strong>der</strong>e erzieherische Bedeutung zukommt,<br />
während <strong>der</strong> unternehmerische Zugang, <strong>der</strong> <strong>im</strong> Showsport die Antwort auf die aufkommende<br />
Massennachfrage an Unterhaltung und Spektakeln sah, nur geringe Wertschätzung<br />
erfuhr. Hier zeichnet sich also ab, dass die Verbindungen zwischen Kommerzialisierung und<br />
<strong>Sport</strong> zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Län<strong>der</strong>n und für unterschiedliche<br />
<strong>Sport</strong>arten jeweils eigene Formen angenommen haben. Entscheidenden Einfluss auf den Balanceakt<br />
zwischen Unterhaltungs- und Erziehungswert hatten lokale Institutionen, Kontrollinstanzen<br />
und Regulationssysteme, die auf die Entwicklung regionalspezifischer Finanzierungsmodelle<br />
für den <strong>Sport</strong> einwirkten. Weil in Europa die Auffassung dominierte, dass mit<br />
dem <strong>Sport</strong> die Entwicklung von charakterlichen Eigenschaften wie auch körperlichen Fähigkeiten<br />
verbunden sein sollte, orientierte sich das europäische Finanzierungsmodell an einem<br />
auf Leistung und Erfolg basierenden offenen Ligasystem. Wichtigstes Zulassungskriterium<br />
wurde das spielerische Gesamtergebnis, das am Ende <strong>der</strong> Saison über Auf- und Abstieg zwischen<br />
verschiedenen Spielklassen entschied.<br />
82
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
In den USA dagegen wurde zeitgleich mit dem professionellen Athleten auch <strong>der</strong> hauptberufliche<br />
<strong>Sport</strong>entrepreneur geboren, <strong>der</strong> seinen Klub wie ein Unternehmen nach strikt profitorientierten<br />
Grundsätzen führte. Die Gründung des Nordamerikanischen Verbands professioneller<br />
Baseballklubs demonstrierte bereits in den 1870er-Jahren, dass die Verbindung von <strong>Sport</strong><br />
und Kommerz durchaus dem American Way of doing things entsprach. Die wenig später formierte<br />
National League setzte ein Geschäftsmodell durch, das in <strong>der</strong> Schaffung von Monopolrenten<br />
die Profitmax<strong>im</strong>ierung auszureizen suchte. Der feste Glauben an Marktwirtschaft und<br />
freies Unternehmertum stand zusammen mit den Grundprinzipien <strong>der</strong> Unterhaltungsindustrie<br />
Pate bei <strong>der</strong> Schaffung geschlossener Ligen. Diese kartellartig organisierten Zusammenschlüsse<br />
lassen lediglich eine l<strong>im</strong>itierte Anzahl von Franchise-Nehmern zu. Mitgliedschaft ist<br />
also die wichtigste formale Bedingung, um in <strong>der</strong> Liga mitspielen zu können; informell dagegen<br />
müssen die Klubs in <strong>der</strong> Lage sein, ausreichend für Unterstützung aus ihren He<strong>im</strong>atstädten<br />
zu sorgen und damit den Ligen ein gesichertes Einkommen zu garantieren (Horne 2006, S.<br />
28). Der Erfolg des Baseballmodells sollte für Nachahmer sorgen, wenn auch mit großer zeitlicher<br />
Verzögerung, die dem Baseball seine Vorrangstellung sicherte. Die quas<strong>im</strong>onopolistische<br />
Position auf dem <strong>Sport</strong>unterhaltungsmarkt blieb <strong>der</strong> Liga <strong>der</strong> Baseballklubs<br />
bis zum Ende dieser Phase erhalten. Erst in den 1930er-Jahren konnten sich auch <strong>im</strong> American<br />
Football und Eishockey halbwegs stabile Ligen bilden; <strong>der</strong> vierte große amerikanische<br />
Zuschauersport, Basketball, musste noch bis in die Nachkriegszeit hinein warten (Danielson<br />
1997, S. 6).<br />
Step 2: <strong>Sport</strong> unter dem Fordismus<br />
Der Fordismus als dominantes Produktionssystem und gesellschaftliches Wachstumsprinzip<br />
best<strong>im</strong>mte die nächste Phase in <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Konsumgesellschaft, die von den 1930er-<br />
Jahren bis in die späten 1960er-Jahre reichte. In <strong>der</strong> industriellen Arbeitsorganisation bedeutete<br />
<strong>der</strong> Fordismus, dass mit <strong>der</strong> standardisierten Massenproduktion in Fließbandarbeit die Effizienz<br />
des Arbeitsprodukts gesteigert wurde. Um die Ausbildungskosten zu amortisieren und<br />
die Arbeiter zu halten, boten die Unternehmer ihnen höhere Löhne und Sozialleistungen. Die<br />
paternalistische Unternehmenspolitik drückte sich in langfristigen Beschäftigungsgarantien<br />
und <strong>der</strong> zunehmenden Kontrolle über die Freizeit <strong>der</strong> Arbeiter aus. Als gesellschaftliches<br />
Wachstumsmodell bestand <strong>der</strong> Fordismus aus einem New Deal zwischen Arbeit und Kapital,<br />
in dem die Arbeiter massenhaft am Wohlstand beteiligt wurden. Mit <strong>der</strong> zunehmenden Massenkaufkraft<br />
nahm einerseits <strong>der</strong> Absatz zu, an<strong>der</strong>erseits kam es zu einer Verbürgerlichung<br />
des Lebensstils <strong>der</strong> Arbeiterklasse. Der Staat spielte <strong>im</strong> Fordismus eine zentrale Rolle als Garant<br />
<strong>der</strong> institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit. Hohe Staatsquoten<br />
zeigen, dass <strong>der</strong> Staat als Wirtschaftsakteur (sowohl als Konsument <strong>der</strong> industriellen Leistungen<br />
wie auch als Bereitsteller sozialer Sicherheitssysteme) an Bedeutung gewann. Nationalstaatliche<br />
Interessen wurden durch eine protektionistische Außenwirtschaftspolitik zu wahren<br />
gesucht.<br />
Im <strong>Sport</strong>konsum machte sich <strong>der</strong> Fordismus in erster Linie durch die Verbreitung <strong>der</strong> Massenpartizipation<br />
<strong>im</strong> <strong>Sport</strong> bemerkbar. Län<strong>der</strong> wie England, Frankreich und Kanada schufen in<br />
<strong>der</strong> Vorkriegszeit die gesetzlichen Grundlagen, um <strong>der</strong> Bevölkerung Gelegenheit zum <strong>Sport</strong><br />
zu bieten. Der Sozialstaat trat verstärkt als Anbieter o<strong>der</strong> För<strong>der</strong>er auf. Sowohl <strong>der</strong> Arbeiter-<br />
als auch <strong>der</strong> bürgerliche <strong>Sport</strong>, die sich in zunächst deutlich voneinan<strong>der</strong> getrennten Vereinsstrukturen<br />
organisiert hatten, fanden sich <strong>im</strong> Europa <strong>der</strong> Nachkriegsjahre unter <strong>der</strong> Patronage<br />
des sozialen Wohlfahrtstaats wie<strong>der</strong>. Mit Subventionen und Son<strong>der</strong>behandlungen för<strong>der</strong>te <strong>der</strong><br />
83
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
Staat die Reorganisationen <strong>der</strong> in ihrer Entstehungsgeschichte politisch motivierten Dualstruktur<br />
unter einem sich als apolitisch deklarierenden nationalen Dachverband und nutzte<br />
diese Struktur für die Durchsetzung seiner Freizeit- und Gesundheitspolitik. Über die <strong>Sport</strong>verbände<br />
lancierte <strong>der</strong> Staat nach den Wie<strong>der</strong>aufbaujahren nationale Fitness-Programme wie<br />
den „Goldenen Plan“, <strong>der</strong> in den 1960er-Jahren in Deutschland die Verfügbarkeit von <strong>Sport</strong>anlagen<br />
verbesserte, o<strong>der</strong> die Tr<strong>im</strong>m-Dich-Bewegung, um den Arbeitern und Angestellten<br />
sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für die wachsende arbeitsfreie Zeit zu bieten. Großunternehmen<br />
engagierten sich mit dem Aufbau von firmeninternen <strong>Sport</strong>klubs und Programmen<br />
für die Angestellten; Werkklubs mit semi-professionellen Spielern beteiligten sich an regionalen<br />
o<strong>der</strong> nationalen Ligen und bildeten damit in vielen Län<strong>der</strong>n und <strong>Sport</strong>arten die Grundlage<br />
für die später einsetzende Professionalisierung.<br />
Unter dem Fordismus erweiterte sich nicht nur das Angebot zum Konsum <strong>im</strong> <strong>Sport</strong>, son<strong>der</strong>n<br />
auch die Reichweite, die das <strong>Sport</strong>produkt auf dem Markt erzielen sollte. Die Embryonalphase<br />
<strong>der</strong> Kommodifizierung des <strong>Sport</strong>s war von einer starken räumlichen Bindung von Produktion<br />
und Konsum charakterisiert. Das Investitionskapital war lokaler Herkunft, wie auch die<br />
meisten <strong>der</strong> Spieler. Auch die Einnahmen kamen aus dem unmittelbaren sozialräumlichen<br />
Umfeld <strong>der</strong> Region, in dem die Anhänger als pr<strong>im</strong>äre Konsumenten des Angebots zu Hause<br />
waren: man konsumierte lokal. Nun rückten überregionale und nationale Märkte in den Fokus<br />
<strong>der</strong> Anbieter. Den größten Beitrag zur räumlichen Expansion lieferten mit Radio und Fernsehen<br />
die Massenmedien des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts, wenngleich die Formierung des Medien-<strong>Sport</strong>-<br />
Komplexes nicht bis zur Erfindung des Rundfunks auf sich hatte warten lassen. Cricket und<br />
Pfer<strong>der</strong>ennen hatten schon vor dem 19. Jahrhun<strong>der</strong>t Einzug in die Seiten <strong>der</strong> Londoner Zeitungen<br />
gefunden, und <strong>der</strong> Bedarf an Informationen für <strong>Sport</strong>wetten leistete seinen Beitrag zur<br />
Etablierung einer <strong>Sport</strong>berichterstattung (Boyle/Haynes 2000, S. 24-26). Für zahlreiche Verlage,<br />
die <strong>im</strong> Zuge <strong>der</strong> Pressefreiheit und <strong>der</strong> Konsolidierung des Zeitungsmarkts entstanden,<br />
bot <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> nicht nur einen kostengünstigen und Reichweite erzielenden Inhalt, son<strong>der</strong>n<br />
auch Potenziale, Leserschaften zu binden und ein vorwiegend männlich definiertes Massenpublikum<br />
an ihre Werbekunden auszuliefern (Rowe 1999, S. 30). Weil <strong>Sport</strong> Auflagen zu<br />
verkaufen half, begannen Zeitungen auch <strong>Sport</strong> zu verkaufen. Verlagsbesitzer traten als Sponsoren<br />
und Veranstalter von <strong>Sport</strong>bewerben in Erscheinung. Sie gründeten Teams, bauten Stadien<br />
und investierten in Werbung. In Län<strong>der</strong>n wie Italien und Frankreich konkurrierten <strong>im</strong><br />
frühen 20. Jahrhun<strong>der</strong>t bereits reine <strong>Sport</strong>zeitungen mit <strong>der</strong> Boulevardpresse um die Gunst <strong>der</strong><br />
Leserschaft.<br />
Ab den 1920er-Jahren übernahm <strong>der</strong> Rundfunk die Aufgabe, die Möglichkeit zur Teilnahme<br />
an den <strong>Sport</strong>ereignissen über den eng begrenzten Kreis <strong>der</strong> ZuschauerInnen hinaus auszudehnen.<br />
Schon allein <strong>der</strong> Live-Charakter von Radio und Fernsehen prädestinierte diese für die<br />
Aufgabe, überregional virtuelle Gemeinschaften zu bilden, die sich durch gemeinsame popularkulturelle<br />
Praxen und Interessen definierten. Mit <strong>der</strong> Aufnahme in die <strong>Sport</strong>berichterstattung<br />
definierten die Medien nicht nur, was <strong>Sport</strong> ist, son<strong>der</strong>n zunehmend auch, was als „guter“,<br />
„richtiger“ und „nationaler“ <strong>Sport</strong> galt. Massenreichweite und -nachfrage verän<strong>der</strong>ten die<br />
Geldflüsse <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> nachhaltig. Zum einen zogen sie das Interesse <strong>der</strong> Sponsoren an, die wie<br />
Gillette zum Beispiel als Exklusivsponsor <strong>der</strong> Baseballliga diese zur landesweiten Bewerbung<br />
ihrer Produkte nutzte. Zum an<strong>der</strong>en handelten die Klubs und später auf kollektiver Ebene die<br />
Ligen Exklusivverträge mit den Sen<strong>der</strong>n aus. Von <strong>der</strong> Kommerzialisierung profitierten auch<br />
die Einkommen <strong>der</strong> professionellen <strong>Sport</strong>ler, die zunächst nur wenig mehr als ihre KollegInnen<br />
in <strong>der</strong> Industrie verdienten und in quasi-feudaler Abhängigkeit von ihren Klubs gehalten<br />
84
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
wurden. Die Faszination vom <strong>Sport</strong>spektakel und <strong>der</strong> Vermischung von Geld, Glamour und<br />
Klatsch, <strong>der</strong> sich die Medien auch außerhalb <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>seiten <strong>im</strong> engeren Sinne annahmen,<br />
bedeutete auch die Kreation von <strong>Sport</strong>stars, die weit über die Grenzen ihres Arbeitsplatzes<br />
und des <strong>Sport</strong>felds hinaus Bekanntschaft errungen. Die zunehmend häufiger stattfindenden<br />
internationalen Turniere, allen voran die seit 1986 in ständig größerem Ausmaß abgehaltenen<br />
Olympischen Spiele, boten den <strong>Sport</strong>lern Gelegenheit, sich international einen Namen zu machen.<br />
Viele nutzten ihre Popularität, um den Sprung vom Amateursport in das kommerzielle<br />
Feld des Showsports zu wagen o<strong>der</strong> in die Filmindustrie zu wechseln. Die amerikanische<br />
Baseballikone Babe Ruth verdiente 1927 mit 70.000 Dollar zehn mal mehr als <strong>der</strong> durchschnittliche<br />
Profispieler. Als ihm 1928 mitgeteilt wurde, dass sein Jahresgehalt das Doppelte<br />
<strong>der</strong> 40.000 Dollar für den US-Präsidenten Hoover ausmachen würde, veranlasste ihn dies zum<br />
Kommentar, „Ich hatte wohl ein besseres Jahr als er“ (Cashmore 2000, S. 244).<br />
Auch die <strong>Sport</strong>artikelindustrie organisierte sich an den Möglichkeiten, die sich aus <strong>der</strong> Expansion<br />
von Massenproduktion und Massennachfrage ergaben. Der <strong>Sport</strong>artikelhersteller Spalding<br />
öffnete seinen ersten Shop bereits 1876 in Chicago; 1909 waren Spalding-Stores in dreißig<br />
amerikanischen Städten und sechs Übersee-Locations zu finden. Durch geschickte Akquisitionen<br />
konnte Spalding sich vor allem <strong>im</strong> Baseball als führende Marke etablieren; zudem<br />
reagierte das Unternehmen mit <strong>der</strong> ständigen Ausweitung <strong>der</strong> Produktpalette auf die steigende<br />
Popularität des <strong>Sport</strong>s in den USA. In Europa entstanden mit Slazenger (1881) und Dunlop<br />
(1900) auch schon vor <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>twende Firmen, die zunächst den lokalen Markt belieferten,<br />
sich über das britische Empire aber auch schon vor dem Zeitalter des Fordismus internationalisierten<br />
und heute führend auf dem globalen Markt für Tennis, Squash und Golf vertreten<br />
sind. Die Gründungswelle <strong>der</strong> heute auch <strong>im</strong> Lifestylesegment als globale Brands bekannten<br />
Firmen wie Converse (1910), Wilson (1931), Adidas, Puma (beide 1948) und später<br />
auch Reebok (1958) und Nike (1964) vollzog sich jedoch vor dem Hintergrund <strong>der</strong> zunehmenden<br />
Verschränkung von <strong>Sport</strong>, Medien und Konsumkultur. Die Gebrü<strong>der</strong> Dassler, die seit<br />
den 1920er-Jahren gemeinsam <strong>Sport</strong>schuhe entwickelten, waren unter den ersten, die systematisch<br />
<strong>Sport</strong>stars (wie Jesse Owens) und <strong>Sport</strong>veranstaltungen (wie die Olympischen Spiele)<br />
verwendeten, um für ihre Produkte zu werben. Die nach internen Zerwürfnissen entstandenen<br />
Firmen Adidas und Puma haben sich ebenso wie Nike o<strong>der</strong> Reebok von Kleinbetrieben, die<br />
hoch spezialisierte Produkte für einen Nischenmarkt herstellten, zu globalen Marken mit einer<br />
breiten Palette an <strong>Sport</strong>artikeln, Mode und Lifestyleaccessoires entwickelt (Smart 2007, S.<br />
119-121). Der zunehmend auf globaler Ebene ausgetragene Kampf um Marktanteile hat vor<br />
allem bei den technologieintensiveren Produkten wie <strong>Sport</strong>schuhen zu einem sehr hohen<br />
Konzentrationsgrad geführt.<br />
Auf <strong>der</strong> Produktionsseite finden sich neben dieser Tendenz zur Oligopolbildung und <strong>der</strong> Konsolidierung<br />
integrierter Geschäftsbereiche bereits in <strong>der</strong> fordistischen Phase Anzeichen einer<br />
„Neuen Internationalen Arbeitsteilung“, die in Grundzügen die <strong>im</strong>perialistischen Ausbeutungsstrukturen<br />
des Kolonialzeitalters nachmodelliert. Der <strong>Sport</strong>artikelhersteller Rawlings<br />
<strong>Sport</strong>ing Goods hatte sich seit <strong>der</strong> Gründung 1887 in St. Louis als Hersteller für <strong>Sport</strong>artikel<br />
und -kleidung, vor allem für Baseball, Basketball und American Football, aber auch für Fußball<br />
und Volleyball etabliert. Die Wan<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Produktionsstandorte begann 1953, zunächst<br />
innerhalb des Bundesstaats Missouri, um mit dem Standortwechsel auch die Gewerkschaft<br />
loszuwerden. 1964 bewogen Steueranreize den erneuten Umzug nach Puerto Rico; fünf Jahre<br />
später erreichte das Unternehmen die Küsten von Haiti, wo nicht nur die ärmste Bevölkerung<br />
<strong>der</strong> westlichen Hemisphäre bereit war zu Niedrigstlöhnen zu arbeiten, son<strong>der</strong>n auch Streiks<br />
85
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
gesetzlich verboten waren (Sage 2000, S. 272). Später bewegten die instabilen politischen<br />
Verhältnisse eine weitere Verlagerung nach Costa Rica. Die mittlerweile in <strong>der</strong> gesamten<br />
<strong>Sport</strong>artikelbranche etablierte Strategie, durch die Umgehung gesetzlich festgelegter Arbeitsrechte,<br />
Sicherheitsstandards und Umweltschutzauflagen Kosten zu min<strong>im</strong>ieren, hat eine Abwärtsspirale<br />
(„race to the bottom“) in Gang gesetzt, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt.<br />
Step 3: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> postfordistischen Akkumulationsreg<strong>im</strong>e<br />
Die Neue Internationale Arbeitsteilung ist nur ein Beispiel für die zunehmend global orientierte<br />
Ökonomie des <strong>Sport</strong>s. Zwar lässt sich mit Recht behaupten, dass <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> aufgrund<br />
seiner engen Beziehung zu Kapital und Empire <strong>im</strong>mer schon global gewesen ist. Dafür sorgte<br />
schon die institutionelle Architektur internationaler <strong>Sport</strong>organisationen wie IOC, FIFA o<strong>der</strong><br />
IAAF, die seit <strong>der</strong> Embryonalphase den Rahmen definierten, in dem sich nationale Organisationen<br />
einordnen mussten, wenn sie in <strong>der</strong> internationalen Gemeinschaft <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>nationen<br />
vertreten sein wollten. Allerdings haben technologische Innovationen, neue Wirtschaftsmodelle<br />
und umfassende Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Sozialorganisation dazu geführt, dass nun globale<br />
D<strong>im</strong>ensionen sowohl die Produktion wie auch den Konsum des <strong>Sport</strong>s bedingen. Die Verwaltungsorgane<br />
des Weltsports bilden zusammen mit <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>industrie und den Medien ein Triumvirat,<br />
das ich wegen ihrer verzerrenden Auswirkungen auf den <strong>Sport</strong> in Alltags- und Popularkultur<br />
in Anlehnung an den Military-Industrial Complex <strong>der</strong> USA als <strong>Sport</strong> Industrial<br />
Complex bezeichnet habe (<strong>Manzenreiter</strong> 2007, S. 1). So sind es weniger neue Akteure o<strong>der</strong><br />
Waren auf dem Markt, die <strong>der</strong> ökonomischen Globalisierung des <strong>Sport</strong>s Vorschub geleistet<br />
haben, son<strong>der</strong>n vielmehr die gleichen Akteure, die getrennt und gemeinsam um die Ausweitung<br />
ihrer Marktreichweiten kämpfen.<br />
Den Hintergrund für diese Transformationen lieferten sinkende Unternehmensgewinne und<br />
Steuereinnahmen in den USA <strong>der</strong> späten 1960er-Jahre, die das fordistische Modell diskreditierten<br />
und das Kapital veranlassten, nach neuen, lukrativeren Formen <strong>der</strong> Anlagemöglichkeit<br />
zu suchen. Fündig wurde man vor allem auf den internationalen Finanzmärkten, <strong>im</strong> Dienstleistungsbereich<br />
und in bislang weitgehend ökonomisch unterentwickelten Sektoren, die <strong>der</strong><br />
öffentlichen Hand zugeordnet waren. Im Postfordismus traten Flexibilisierung und Produktdifferenzierung<br />
an die Stellen von Massenproduktion und Standardisierung. Dem Konsum<br />
kam wie<strong>der</strong> eine gesteigerte Bedeutung zu, ebenso wie den Medien und <strong>der</strong> Werbung, die mit<br />
<strong>im</strong>mer diffizileren Methoden psycho-demografische Profile <strong>der</strong> KonsumentInnen erstellten.<br />
Ohne die Unterstützung o<strong>der</strong> zumindest Billigung <strong>der</strong> Politik wären diese Verän<strong>der</strong>ungen am<br />
Staat vorbei unmöglich gewesen. Die monetaristische Wirtschaftspolitik unter Thatcher und<br />
Reagan gab den Ton vor, mit dem ab den 1980er-Jahren die Privatisierung öffentlicher<br />
Dienstleistungen, <strong>der</strong> Abbau von Sozialleistungen und die Kommodifizierung bislang nicht<br />
als Ware zu behandeln<strong>der</strong> Güter vorangetrieben wurde. Regulationsinstanzen <strong>der</strong> internationalen<br />
Wirtschaft wie WTO, Weltbank o<strong>der</strong> Europäische Zentralbank trugen ebenfalls ihren<br />
Teil zur „Normalisierung“ des neoliberalen Projekts bei, so dass faktisch kein Ort und kein<br />
Mensch von <strong>der</strong> Entfesselung des globalen „Blade-Runner-Kapitalismus“ unberührt bleiben<br />
konnte. In dieser Phase <strong>der</strong> „Durchökonomisierung des Kulturellen“ wurde <strong>Sport</strong> zur postfordistischen<br />
Schlüsselindustrie; aufgrund seiner allmählich alle Zeit- und Raumgrenzen überschreitenden<br />
Verfügbarkeit wurde <strong>Sport</strong> gar zum wohl „universalsten Aspekt <strong>der</strong> Populärkultur“<br />
erklärt (Miller et al. 2001, S. 1). Neben <strong>der</strong> fortschreitenden Enträumlichung von Produktion,<br />
Konsum und Distribution <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> sind Korporatisierung, Spektakularisierung und die<br />
wachsende Amalgamierung von Mode- Freizeit- und Unterhaltungsindustrien die wichtigsten<br />
86
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
Faktoren, die <strong>der</strong> Kommodifizierung des <strong>Sport</strong>s Vorschub geleistet haben. Praktisch alle globalen<br />
<strong>Sport</strong>institutionen, zu denen Andrews und Ritzer (2007, S. 140) <strong>Sport</strong>organisationen,<br />
Ligen, <strong>Sport</strong>events und die <strong>Sport</strong>lerInnen auch zählen, haben sich unbewusst o<strong>der</strong> bewusst <strong>im</strong><br />
Kontext dieser Einflussfaktoren redefiniert und weisen mit profitorientierten Managementstrukturen<br />
und Marketingtechniken einen hohen Grad an Uniformität auf. Im extremen Sinn<br />
gilt dies auch für die an Alterung, Fettleibigkeit und Zivilisationskrankheiten laborierende<br />
Gesamtgesellschaft, in <strong>der</strong> Fitness und Gesundheit als Assets, Krankheit und Pflegebedürftigkeit<br />
jedoch als Kosten verbucht werden. Das korporatisierte Subjekt wird <strong>im</strong> postfordistischen<br />
Akkumulationsreg<strong>im</strong>e zur Ich-AG, die durch den Konsum <strong>der</strong> zunehmend vom Markt bereitgestellten<br />
<strong>Sport</strong>-, Wellness- und Gesundheitsgüter Investitionen in die zukünftige Gesundheit<br />
tätigt. Die Korporatisierung des Individuums hat sich zumindest an den Körpern <strong>der</strong> ProfisportlerInnen<br />
längst vollzogen, <strong>der</strong>en max<strong>im</strong>ale Renditemöglichkeiten von korporatisierten<br />
Intermediären wie Spieleragenturen in Verhandlungen mit <strong>Sport</strong>klubs, Eventfirmen und<br />
Sponsoren ausgehandelt werden.<br />
Der Korporatisierungsprozess hat in hohem Maße die Verwaltungsorgane des Weltsports verän<strong>der</strong>t,<br />
die bis über die 1970er-Jahre hinaus noch am ehesten als Klub von Frühstücksdirektoren<br />
zu charakterisieren waren. Seither haben sie sich als komplexe Unternehmungen reorganisiert,<br />
die an <strong>der</strong> Oberfläche weiterhin unter dem NGO-Etikett <strong>der</strong> Gemeinnützlichkeit agieren<br />
können; ihre kommerziellen Tochterunternehmen aber, die sich <strong>der</strong> Vermarktung von Medien-<br />
und Werberechten annehmen, haben <strong>im</strong> Interesse <strong>der</strong> Profitmax<strong>im</strong>ierung ein Gewand<br />
angelegt, das dem institutionellen Vehikel <strong>der</strong> Globalisierung <strong>im</strong> Spätkapitalismus nachgeschnei<strong>der</strong>t<br />
ist. Korporatisierung hat außerdem die Organisation des <strong>Sport</strong>betriebs auf nationaler<br />
Ebene erfasst, wie ein Blick auf die kommerziellen Fußballligen in Europa zeigt, und erstreckt<br />
sich auch auf die Versuche von bislang marginalisierten <strong>Sport</strong>arten, an die Werbe- und<br />
Sponsorentöpfen heranzukommen.<br />
Die vertikale Integration unterschiedlicher Produktions- und Handlungsstufen ist vor allem<br />
von den internationalen Medienunternehmen vorangetrieben worden, die wie Disneys ESPN,<br />
T<strong>im</strong>e Warner o<strong>der</strong> News Corporation auch als <strong>Sport</strong>unternehmer auftreten und das Management<br />
von <strong>Sport</strong>klubs, Ligen und Turnieren übernehmen. Der Medienmogul Rupert Murdoch<br />
hat diesem Prozess <strong>der</strong> Konzentration von Kapital und Kontrolle in <strong>der</strong> Literatur sogar seinen<br />
Namen überlassen müssen. Wie das Beispiel von Silvio Berlusconi, Besitzer zahlreicher Fernsehkanäle<br />
und des AC Milan zeigt, beschränkt sich „Murdochization“ nicht auf den amerikanischen<br />
Kontinent allein. Doch in <strong>der</strong> D<strong>im</strong>ension – mit Star TV, Fox Networks und BSkyB ist<br />
Murdochs News Corporation auf den drei größten Kontinenten vertreten – und <strong>der</strong> Aggressivität,<br />
mit <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> gezielt als Rammbock in neue Märkte verwendet wurde, steht die News-<br />
Gruppe konkurrenzlos da (Cashmore 2000, S. 292-295). Neue Technologien wie Satellitenübertragung,<br />
Breitband und Digitales Fernsehen ermöglichten nicht nur die quantitative Expansion<br />
des Angebots und die parallele Erschließung räumlich getrennter Märkte, son<strong>der</strong>n<br />
auch die Bereitstellung von kundenorientierten Diversifikationsprogrammen, die maßgeschnei<strong>der</strong>t<br />
den speziellen Bedürfnissen von ZuschauerInnen angepasst wurden. Trotz <strong>der</strong> zunehmenden<br />
technologischen Sophistisierung <strong>der</strong> Medienberichterstattung bildet <strong>Sport</strong> nach<br />
wie vor einen billig zu produzierenden Programmpunkt, von dem das Publikum trotz des <strong>im</strong>mens<br />
gewachsenen Angebots nicht genug bekommen kann: Vom Randplatz am Wochenende<br />
ist <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> in das nahezu tägliche Hauptabendprogramm vorgerückt, und eigene Spartensen<strong>der</strong><br />
übertragen rund um die Uhr Bil<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Welt des <strong>Sport</strong>s.<br />
87
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
Zu Recht ist das Fernsehen als die wichtigste einzelne Kraft hinter <strong>der</strong> ökonomischen Globalisierung<br />
des <strong>Sport</strong>s identifiziert worden. Weil <strong>der</strong> <strong>Sport</strong> durch dieses Medium ein großes<br />
weltweites Publikum erreichen kann, ist er ein lohnendes Werbefeld für multinationale Unternehmen,<br />
die gleiche o<strong>der</strong> doch sehr ähnliche Produkte auf zahlreichen nationalen Konsumentenmärkten<br />
parallel absetzen wollen. Die Vergabe <strong>der</strong> Flaggschiffveranstaltungen des Weltsports<br />
an Staaten <strong>der</strong> dynamischsten Wirtschaftsregion Asiens auf dem bevölkerungsstärksten<br />
Kontinent sind in diesem Kontext gigantische Markterschließungskampagnen für den <strong>Sport</strong><br />
wie auch die mit ihm assoziierten Produkte, Werte und Ideologien (<strong>Manzenreiter</strong>/Horne<br />
2007). Olympische Spiele o<strong>der</strong> Fußball-Weltmeisterschaften haben aufgrund ihrer sportlichen<br />
Signifikanz, des Alleinstellungsmerkmals und <strong>der</strong> relativen Seltenheit einen beson<strong>der</strong>s hohen<br />
Werbewert, den sich die Veranstalter teuer bezahlen lassen: zum einen von den Sen<strong>der</strong>n, die<br />
die Übertragungsrechte erwerben, zum an<strong>der</strong>en von ihren Exklusivpartnern, die <strong>im</strong> Gegenzug<br />
dafür max<strong>im</strong>ale Medienrepräsentanz erhalten. Anfang <strong>der</strong> 1970er-Jahre wurde das gesamte<br />
Sponsorgeschäft <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> auf 5 Millionen Dollar geschätzt; dreißig Jahre später war dieses<br />
um den Faktor 4000 auf über 20 Milliarden Dollar angewachsen und sollte 2006 noch einmal<br />
auf das Doppelte ansteigen (Smart 2007, S. 127). Der Sponsoringbereich zeigt die größte<br />
Wachstumsdynamik <strong>im</strong> gegenwärtigen <strong>Sport</strong>business. 1982 entstand <strong>im</strong> Kontext <strong>der</strong> Fußball-<br />
WM in Spanien das erste organisierte Sponsoring-Programm, das dem Verband 19 Millionen<br />
Dollar von insgesamt neun Partnern einbrachte. 2006 in Deutschland zahlten 15 Unternehmen<br />
jeweils etwa 35 Millionen Dollar für quasi das gleiche Produkt. Nur das olympische Partner<br />
Programm (TOP) vermag höhere Einnahmen zu erzielen. Vor seiner Einführung und den sozialistischen<br />
Rumpfspielen von Moskau bescherten 1976 in Montreal 628 Sponsoren dem<br />
IOC etwa sieben Millionen Dollar. Das erste offizielle TOP Programm Mitte <strong>der</strong> 1980er-Jahre<br />
beschränkte den Sponsorkreis auf eine exklusive Gruppe von neun Partnern und brachte bereits<br />
95 Millionen Dollar. Für die gegenwärtige und 2008 in Beijing endende Olympiade zahlten<br />
11 Partner insgesamt 866 Millionen Dollar an das IOC.<br />
Die Gewinne aus dem Verkauf von Medienrechten stellen aber noch die wichtigste einzelne<br />
Einnahmequelle für den multinational organisierten Mediensport dar. Der Verkauf <strong>der</strong> Fernsehrechte<br />
für die Olympischen Spiele von 1964, die wegen des erstmaligen Einsatzes <strong>der</strong> Satellitenübertragung<br />
als Medienspiele in die Geschichte eingingen, bescherte dem Olympischen<br />
Komitee 1,6 Millionen Dollar; zehn Olympiaden später war diese Einkommensquelle<br />
nahezu um das Tausendfache auf 1, 4 Milliarden Dollar angestiegen. Einen ähnlichen Höhenflug<br />
verzeichnete <strong>der</strong> Weltfußballverband FIFA. 1987 generierte die FIFA Jahreseinnahmen<br />
von 6,4 Millionen Dollar; 12 Jahre später waren es 23 Millionen, ein Jahr später, nach dem<br />
Auslaufen eines noch in den 1980er-Jahren abgeschlossenen Fernsehvertrags waren es 282<br />
Millionen. Für die folgende Vierjahresperiode konnte die FIFA ihre Einnahmen auf 1,8 Milliarden<br />
Dollar anschnellen sehen. Wie die Entwicklung <strong>der</strong> Champions League o<strong>der</strong> <strong>der</strong> englischen<br />
Premier League und <strong>der</strong> deutschen Bundesliga zeigt, hat sich die Explosion auf dem<br />
Rechtemarkt auch auf nationaler und überregionaler Ebene nachhaltig auf die Organisation<br />
des Ligenbetriebs ausgewirkt.<br />
Vor allem die Topvereine, die um die lukrativen Antrittsgel<strong>der</strong> und Titelpreise antreten, konkurrieren<br />
um die besten Spieler. In den USA wurde 1976 <strong>der</strong> Status des free agent eingeführt,<br />
<strong>der</strong> den Profi-Spieler aus <strong>der</strong> feudalen Anhängigkeit <strong>der</strong> Klubs befreite. Im Zuge dieser Lockerung<br />
explodierten die Spielergehälter. Zuvor hatte ein Basketballspieler durchschnittlich<br />
20.000 Dollar <strong>im</strong> Jahr verdient; 2003 war das durchschnittliche Einkommen in <strong>der</strong> NBA um<br />
16.205 Prozent auf 3,2 Millionen Dollar gestiegen (das 31fache <strong>der</strong> Inflationsrate). In <strong>der</strong> A-<br />
88
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
merican Football League (NFL), die aufgrund ihrer umfassenden Vermarktungsstrategie als<br />
reichste Liga <strong>der</strong> Welt gilt, stiegen die Gehälter von 47.500 (1976) auf 1,1 Millionen Dollar,<br />
und <strong>der</strong> durchschnittliche Major League-Profi verdiente mit 2,1 Millionen Dollar fast 300 mal<br />
soviel wie seine Vätergeneration (1977: 76,000; Seattle Post Intelligence 2002). In Europa<br />
setzte zwanzig Jahre später das Bosman-Urteil eine ähnlich aufwärts steigende Gehaltspirale<br />
in Gang. In <strong>der</strong> zweiten Hälfte <strong>der</strong> 1990er-Jahre wuchsen die Gehaltszahlungen <strong>der</strong> Klubs in<br />
Englands oberster Liga jährlich um 20 Prozent. 2003 verdienten über zehn Spieler mehr als 10<br />
Millionen Dollar an Gehaltszahlungen von ihren Klubs. Auch aus diesen Gründen versuchen<br />
die Vereine über Ausdifferenzierung neue Partnerschaften, Geschäftsmodelle, Einkommensquellen,<br />
Märkte und Kundenkreise zu erschließen. Für Aufsehen sorgten neben den Versuchen,<br />
Kapital an <strong>der</strong> Börse zu generieren, die Übernahme <strong>der</strong> Besitzmehrheiten von Premier-<br />
League-Klubs durch ausländische Großmagnaten wie Abramowitsch (Chelsea), Glazer (Manchester<br />
United) o<strong>der</strong> Magnusson (West Ham): Zu Beginn des Jahres 2007 stand je<strong>der</strong> dritte<br />
Klub <strong>der</strong> Premiership unter ausländischer Kontrolle.<br />
Den Superstars des <strong>Sport</strong>s aber winkt das große Geld zweifach: Die reichen Klubs buhlen um<br />
ihr Talent, und ihre Medienpräsenz verleiht ihnen den Bekanntheitsgrad, den ihre Ausrüster<br />
o<strong>der</strong> Werbepartner benötigen. 1972 zahlte Nike dem Tennisprofi Ilie Nastase 3.000 Dollar<br />
dafür, dass er den Nike-Cortez-Schuh verwendete. Geschichte machte <strong>der</strong> Basketballspieler<br />
Michael „Air“ Jordan, dem Nike nicht nur ein Schuhmodell widmete, son<strong>der</strong>n auch noch 20<br />
Millionen Dollar <strong>im</strong> Jahr dafür zahlte – mehr als die 300.000 Arbeiter in Nikes indonesischen<br />
Subunternehmen zusammen verdienten (Horne 2006, S. 81). Ein Jahrzehnt später kolportierten<br />
die Medien Verhandlungen zwischen Adidas und David Beckham über einen lebenslangen<br />
Deal, <strong>der</strong> dem Popstar des britischen Fußballs 160 Millionen Dollar gebracht hätte. Einen<br />
<strong>der</strong> lukrativsten Verträge hat <strong>der</strong> Golfspieler Tiger Woods mit Nike abgeschlossen: 112 Millionen<br />
Dollar über eine Laufzeit von gerade einmal acht Jahren.<br />
<strong>Sport</strong>berühmtheiten und Medienstars wie Jordan, Beckham o<strong>der</strong> Woods sind die perfekte<br />
Verkörperung einer Spektakularisierung des <strong>Sport</strong>s, in <strong>der</strong> Star, Produkt und Image für die<br />
Verbreitung und Vermarktung <strong>der</strong> Waren, Werte und Institutionen <strong>der</strong> Konsumgesellschaft<br />
eingesetzt werden (Kellner 2001, S. 38). Am offensichtlichsten äußert sich die Transformation<br />
des <strong>Sport</strong>s zum Spektakel in <strong>der</strong> dramaturgischen Inszenierung von <strong>Sport</strong>veranstaltungen,<br />
die maßgeblich von Präsentationsstil, assoziativer Erzähltechnik und den technologischen<br />
Möglichkeiten des allgegenwärtigen Fernsehmediums vorgegeben wird. Das Publikum selber<br />
erfährt sich vor dem voyeuristischen Auge <strong>der</strong> Kamera und <strong>der</strong> Reflektion über die Großbildschirme<br />
<strong>der</strong> Stadien als Akteur, auch wenn es dabei einem größeren Fernsehpublikum als Objekt<br />
des Spektakels vorgeführt wird. In <strong>der</strong> Spektakularisierung treffen sich also die Bedürfnisse<br />
des Mediums, die Bedeutung des Ereignisses durch Authentizität, Emotionen und Masse<br />
zu unterstreichen, mit den Begierden des Einzelnen, in <strong>der</strong> Masse von Gleichgesinnten eine<br />
vorübergehende He<strong>im</strong>at zu finden, in den Sekunden des medialen Ruhms aus ihr heraustreten<br />
zu können und Aufregung zu erleben (<strong>Manzenreiter</strong> 2006). Aufgrund <strong>der</strong> Dominanz <strong>der</strong> visuellen<br />
Sinne in <strong>der</strong> Ästhetik des Konsums drückt <strong>der</strong> Drang zum Spektakulären in wesentlicher<br />
subtilerer Form aber auch dem alltäglichen <strong>Sport</strong>konsum seinen Stempel auf. Die Erweiterung<br />
des <strong>Sport</strong>angebots durch körperbetonte und -betonende Praktiken <strong>der</strong> Fitnessindustrien, die<br />
Ausdehnung des sportlichen Feldes durch akrobatische Elemente und die extrem angestiegene<br />
Popularität von Extremsportarten, die Grenzerfahrungen versprechen, stehen beispielhaft für<br />
eine Verän<strong>der</strong>ung, in <strong>der</strong> das Spektakuläre zum spürbaren und demonstrativen Beweis für<br />
Echtheit geworden ist.<br />
89
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
<strong>Sport</strong>partizipation findet zunehmend weniger in den sozialen D<strong>im</strong>ensionen des Vereinslebens<br />
statt, son<strong>der</strong>n in neuen Settings, die dem Hang nach Flexibilität und Unverbindlichkeit entgegenkommen.<br />
Die Angebote <strong>der</strong> Fitness- und Wellnessindustrie binden die aktiven <strong>Sport</strong>lerInnen<br />
über den Markt in die <strong>Sport</strong>kultur ein, <strong>der</strong> den Zugang zu den notwendigen Kenntnissen,<br />
Ausrüstung und Trainingseinrichtungen eröffnet. Dieser Aspekt <strong>der</strong> Kommodifizierung kann<br />
eine Ursache für die in vielen Gesellschaften <strong>der</strong> Gegenwart zu beobachtende gegenläufige<br />
Tendenz zu Versportlichung und Entsportlichung sein: Während die Partizipationshäufigkeit<br />
für einen Teil <strong>der</strong> Bevölkerung zun<strong>im</strong>mt, wächst <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> unsportlichen Bevölkerung,<br />
<strong>der</strong> entwe<strong>der</strong> die Voraussetzungen zur Teilnahme am <strong>Sport</strong>konsum fehlt o<strong>der</strong> sich aber von<br />
an<strong>der</strong>en Angeboten <strong>der</strong> Konsumkultur stärker angesprochen fühlt.<br />
Schlussbemerkung: Wi<strong>der</strong>stand zwecklos?<br />
Die Geschichte <strong>der</strong> Kommodifizierung des <strong>Sport</strong>s ist mit Machtkonzentration und Expansion<br />
von <strong>im</strong>perialistischen Strukturen gekennzeichnet. Der expansionistische Drang des Kapitals<br />
<strong>im</strong> <strong>Sport</strong> wurde in <strong>der</strong> vorhergegangenen Diskussion deutlich anhand <strong>der</strong> räumlichen Ausweitung,<br />
<strong>der</strong> Erweiterung des Angebots, <strong>der</strong> Prostitution des <strong>Sport</strong>s für die ihm eigentlich fremden<br />
Anliegen seiner Sponsoren und <strong>der</strong> Integration des <strong>Sport</strong>s in die unterschiedlichsten Bereiche<br />
<strong>der</strong> Konsum- und Medienkultur. Die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilnahme<br />
am <strong>Sport</strong> haben sich insofern erweitert, als <strong>der</strong> Staat <strong>im</strong> Fordismus diesen wie ein öffentliches<br />
Gut behandelte; gleichzeitig hat <strong>der</strong> Staat aber auch die Rahmenbedingungen für eine Ökonomisierung<br />
geschaffen, <strong>der</strong>en Auswirkungen die soziale Segregation zwischen verschiedenen<br />
Gruppen <strong>der</strong> Gesellschaft und damit die auf Besitzunterschieden basierte Politik <strong>der</strong> Exklusion<br />
und Inklusion <strong>im</strong> <strong>Sport</strong> för<strong>der</strong>t.<br />
Vieles am heutigen <strong>Sport</strong> ist Produkt eines entfremdeten Produktionssystems, von dem die<br />
Gesellschaft abhängig ist, und gleichzeitig spielt er den Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Gesellschaft Ressourcen<br />
in die Hand, mit <strong>der</strong>en Hilfe sie ihre Identität konstruieren (Silverstone 1999). Nach Jahren<br />
des globalen Wachstums scheint <strong>der</strong> Konsum eine wichtigere Rolle als die Produktion<br />
(Arbeit) in <strong>der</strong> Erfahrung und Gestaltung von subjektiven und kollektiven Identitäten gewonnen<br />
zu haben. Gerade <strong>im</strong> flexiblen Akkumulationsreg<strong>im</strong>e, das sich durch häufigen Wohn- und<br />
Arbeitsplatzwechsel, die Pluralisierung von Familienformen und weiterer gesellschaftlicher<br />
Institutionen charakterisiert, bleiben affektive Loyalitäten, kulturelle Vorlieben und Lifestyle-<br />
Profile oftmals die einzigen Konstanten des sozialen Lebens. Die gerade in postmo<strong>der</strong>nen<br />
Untersuchungen stilbildende Zelebrierung des Konsums als Praxisfeld <strong>der</strong> Identitätskonstruktion<br />
befreit das Individuum aus den Fängen einer übermächtigen Kulturindustrie – allerdings<br />
etwas zu voreilig. Zwar bieten solche akteurszentrierten Analysen ein wichtiges Korrektiv zu<br />
den kulturpess<strong>im</strong>istischen Strömungen einer älteren Forschungsgeneration, die <strong>im</strong> Konsum<br />
nicht mehr als die Befriedigung von durch Werbung und Industrie künstlich produzierten,<br />
„falschen“ Bedürfnissen gesehen haben. Das kreative Potenzial <strong>der</strong> Aneignung, Verwendung<br />
und Umdeutung <strong>im</strong> Konsum soll auch nicht in Frage gestellt werden. Doch den damit verbundenen<br />
Erwartungen an den Konsum als Praxis des politischen Wi<strong>der</strong>stands sind gerade in <strong>der</strong><br />
Konsumkultur enge Grenzen gesetzt, wenn Marktmechanismen die Angebotsstrukturen und<br />
Zugangsmöglichkeiten definieren.<br />
Reaktionen traditioneller Fangruppen gegen die Anpassung <strong>der</strong> Spielzeiten an den Programmrhythmus<br />
des Fernsehens o<strong>der</strong> gegen „feindliche“ Übernahmen „ihres“ Klubs durch internationale<br />
Investoren verdeutlichen, dass die in <strong>der</strong> Ökonomie des <strong>Sport</strong>s zum Ausdruck kommen-<br />
90
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
den gesellschaftlichen Machtdifferenzen ein ziemlich maßstabgetreues Abbild <strong>der</strong> strukturellen<br />
Gewalt des Kapitalismus darstellen, das allerdings nicht über nackte Gewalt, son<strong>der</strong>n eher<br />
über Begehren, die subtile Grundtechnik des <strong>Konsumkapitalismus</strong>, Wi<strong>der</strong>stand bricht. Beispiele,<br />
wie sich lokaler Protest gegen die Kommerzialisierung des <strong>Sport</strong>s mobilisieren lässt,<br />
hat es in <strong>der</strong> Vergangenheit häufig gegeben – aber eben ohne anhaltenden Erfolg. Ohnmächtig<br />
mussten Fußballfans in vielen Län<strong>der</strong>n Europas die Gentrifizierung ihres <strong>Sport</strong>s über sich<br />
ergehen lassen. Über den Marktmechanismus exorbitant gestiegener Eintrittspreise verän<strong>der</strong>te<br />
sich die soziale Zusammensetzung <strong>der</strong> Klientel in den Stadien, während ein Konglomerat diverser<br />
Disziplinierungsstrategien, die zum größten Teil über Marktmechanismen verliefen, die<br />
Praxis des Fantums neu definierte. Wie die geteilten Reaktionen auf die Übernahme von<br />
Manchester United durch den Tycoon Glazer o<strong>der</strong> die Transformation von Austria Salzburg<br />
in ein Aushängeschild von Red Bull zeigt, ist die Fanszene selber gespalten, wo die Grenzen<br />
zwischen Ausverkauf und Anpassung zu ziehen sind. Exper<strong>im</strong>ente mit fanfinanzierten und<br />
basisdemokratisch organisierten Klubs sind für mache Fans ein Versuch, aus <strong>der</strong> Klammer<br />
des <strong>Konsumkapitalismus</strong> auszubrechen (Brown 2007). Aber kann diese Flucht „auf einem<br />
Markt unter einem Gott“, wo alles kommodifizierbar ist, erfolgreich sein?<br />
Tatsächlich ist das <strong>Sport</strong>feld alles an<strong>der</strong>e als homogen, nicht zuletzt wegen doch sehr unterschiedlicher<br />
Profitchancen. Nicht wenige <strong>Sport</strong>arten sind von den lukrativeren Verwertungsmöglichkeiten<br />
ausgeschlossen, manche entziehen sich ihnen und bieten damit Nischen für<br />
alternative Formen <strong>der</strong> Praxis und Sinnzuschreibung. Aber auch in solchen Fällen ist es<br />
schwer möglich, gegen Marx’ Beobachtung zu argumentieren, dass Menschen ihr (sportspezifisches)<br />
Leben selber gestalten, nur nicht unter den Bedingungen ihrer eigenen Wahl (Andrews/Ritzer<br />
2007, S. 145).<br />
Literatur<br />
Andrews, Dave/Ritzer, George: The Grobal in the <strong>Sport</strong>ing Global. In: Global Networks 7/2<br />
(2007). S.135-153.<br />
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik <strong>der</strong> gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt:<br />
Suhrkamp Verlag 1987.<br />
Boyle, Raymond/Haynes, Richard: Power Play. <strong>Sport</strong>, the Media and Popular Culture. Harlow:<br />
Longman 2000.<br />
Brown, Adam: ‘Not for Sale’? The Destruction and Reformation of Football Communities in<br />
the Glazer Takeover of Manchester United. In: Soccer and Society 8/4 (2007). S. 614-<br />
635.<br />
Campbell, Colin: The Sociology of Consumption. In: Acknowledging Consumption. A Review<br />
of New Studies. Hg. v. Daniel Miller. London: Routledge 1995. S. 96-126.<br />
Cashmore, Ellis: <strong>Sport</strong>s Culture. An A–Z Guide. London: Routledge 2000.<br />
CCC [Clean Clothes Campaign]: <strong>Sport</strong>swear Industry Data and Company Profiles. Background<br />
information for the Play Fair at the Olympics Campaign. 2004,<br />
http://www.fairolympics.org/en/index.htm, 3.12.2007.<br />
Danielson, Michael N.: Home Team. Professional <strong>Sport</strong>s and the American Metropolis.<br />
Princeton: Princeton University Press 1997.<br />
Glennie, Paul: Consumption within History Studies. In: Acknowledging Consumption. A Review<br />
of New Studies. Hg. v. Daniel Miller. London: Routledge 1995. S. 164-203.<br />
Guttmann, Allen: Vom Ritual zum Rekord. Das Wesen des mo<strong>der</strong>nen <strong>Sport</strong>s. Schorndorf:<br />
Hofmann 1979.<br />
91
<strong>Manzenreiter</strong>: <strong>Sport</strong> <strong>im</strong> <strong>Konsumkapitalismus</strong><br />
Hargreaves, John: <strong>Sport</strong>, Power and Culture. Cambridge: Polity Press 1986.<br />
Heinemann, Klaus: Entwicklung, gegenwärtige Lage und ausgewählte Forschungsthemen<br />
einer Ökonomie des <strong>Sport</strong>s. In: Spektrum 1 (1998). S. 24-49.<br />
Horne, John: <strong>Sport</strong> in Consumer Culture. Houndmills: Palgrave Macmillan 2006.<br />
Kellner, Douglas: The <strong>Sport</strong>s Spectacle, Michael Jordan and Nike: Unholy Alliance?. In Michael<br />
Jordan, Inc. Corporate <strong>Sport</strong>, Media Culture, and Late Mo<strong>der</strong>n America. Hg. v.<br />
David Andrews. Albany: SUNY Press 2001. S. 37-64.<br />
<strong>Manzenreiter</strong>, <strong>Wolfram</strong>: <strong>Sport</strong> Spectacles, Uniformities and the Search for Identity in Late<br />
Mo<strong>der</strong>n Japan. In Sociological Review 54/s2 (2006). S. 144-159.<br />
<strong>Manzenreiter</strong>, <strong>Wolfram</strong>: The Business of <strong>Sport</strong>s and the Manufacturing of Global Social Inequality.<br />
In: Esporte & Sociedade 6 (2007), http://www.esportesociedade.com/, 3.12.2007.<br />
<strong>Manzenreiter</strong>, <strong>Wolfram</strong>/Horne, John: Playing the Post-Fordist Game in/to the Far East: Football<br />
cultures and soccer nations in China, Japan and South Korea. In: Soccer and Society<br />
8/4 (2007). S. 561-577.<br />
Miller, Toby et al.: Globalization and <strong>Sport</strong>. Playing the World. London: Sage 2001.<br />
PriceWaterhouseCoopers: Global Entertainment and Media Outlook: 2007-2011. New York:<br />
PriceWaterhouseCoopers 2007.<br />
Rowe, David: <strong>Sport</strong>, Culture and the Media. The Unruly Trinity. Buckingham: Open University<br />
Press 1999.<br />
Sage, George: Power and Ideology in American <strong>Sport</strong>. Champaign, Ill.: Human Kinetics<br />
1998.<br />
Sage, George: Political Economy and <strong>Sport</strong>. In: Handbook of <strong>Sport</strong>s Studies. Hg. v. Jay<br />
Coakley/Eric Dunning. London: Sage 2000. S. 260-276.<br />
Schaaf, Phil: <strong>Sport</strong>s, Inc: 100 Years of <strong>Sport</strong>s Business. Amherst, NY: Prometheus 2004.<br />
Seattle Post Intelligence: Innocence Lost. How Money Changed <strong>Sport</strong>s. 2002,<br />
http://seattlepi.nwsource.com/specials/moneyinsports/, 3.12.2007.<br />
Silverstone, Robert: Why Study the Media?. London: Sage 1999.<br />
Smart. Barry: Not Playing Around: Global Capitalism, Mo<strong>der</strong>n <strong>Sport</strong> and Consumer Culture.<br />
In: Global Networks 7/2 (2007). S. 113-134.<br />
<strong>Sport</strong> England: The Value of the <strong>Sport</strong>s Economy in England. A Study on Behalf of <strong>Sport</strong><br />
England by Cambridge Econometrics. London: <strong>Sport</strong> England 2003.<br />
Turner, Brian S.: The Body and Society. London: Sage 1996.<br />
Veblen, Thorstein Bunde: Die Theorie <strong>der</strong> feinen Leute. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag<br />
1986.<br />
92