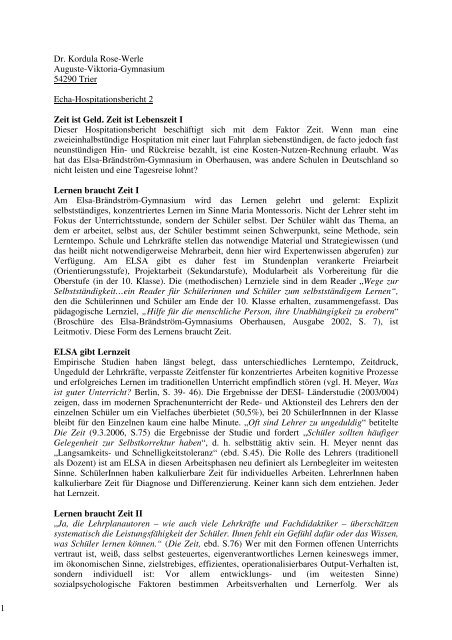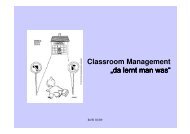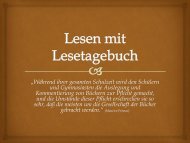Echa-Hospitationsbericht Elsa - Learning Rose Garden
Echa-Hospitationsbericht Elsa - Learning Rose Garden
Echa-Hospitationsbericht Elsa - Learning Rose Garden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Dr. Kordula <strong>Rose</strong>-Werle<br />
Auguste-Viktoria-Gymnasium<br />
54290 Trier<br />
<strong>Echa</strong>-<strong>Hospitationsbericht</strong> 2<br />
Zeit ist Geld. Zeit ist Lebenszeit I<br />
Dieser <strong>Hospitationsbericht</strong> beschäftigt sich mit dem Faktor Zeit. Wenn man eine<br />
zweieinhalbstündige Hospitation mit einer laut Fahrplan siebenstündigen, de facto jedoch fast<br />
neunstündigen Hin- und Rückreise bezahlt, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung erlaubt. Was<br />
hat das <strong>Elsa</strong>-Brändström-Gymnasium in Oberhausen, was andere Schulen in Deutschland so<br />
nicht leisten und eine Tagesreise lohnt?<br />
Lernen braucht Zeit I<br />
Am <strong>Elsa</strong>-Brändström-Gymnasium wird das Lernen gelehrt und gelernt: Explizit<br />
selbstständiges, konzentriertes Lernen im Sinne Maria Montessoris. Nicht der Lehrer steht im<br />
Fokus der Unterrichtsstunde, sondern der Schüler selbst. Der Schüler wählt das Thema, an<br />
dem er arbeitet, selbst aus, der Schüler bestimmt seinen Schwerpunkt, seine Methode, sein<br />
Lerntempo. Schule und Lehrkräfte stellen das notwendige Material und Strategiewissen (und<br />
das heißt nicht notwendigerweise Mehrarbeit, denn hier wird Expertenwissen abgerufen) zur<br />
Verfügung. Am ELSA gibt es daher fest im Stundenplan verankerte Freiarbeit<br />
(Orientierungsstufe), Projektarbeit (Sekundarstufe), Modularbeit als Vorbereitung für die<br />
Oberstufe (in der 10. Klasse). Die (methodischen) Lernziele sind in dem Reader „Wege zur<br />
Selbstständigkeit…ein Reader für Schülerinnen und Schüler zum selbstständigem Lernen“,<br />
den die Schülerinnen und Schüler am Ende der 10. Klasse erhalten, zusammengefasst. Das<br />
pädagogische Lernziel, „Hilfe für die menschliche Person, ihre Unabhängigkeit zu erobern“<br />
(Broschüre des <strong>Elsa</strong>-Brändström-Gymnasiums Oberhausen, Ausgabe 2002, S. 7), ist<br />
Leitmotiv. Diese Form des Lernens braucht Zeit.<br />
ELSA gibt Lernzeit<br />
Empirische Studien haben längst belegt, dass unterschiedliches Lerntempo, Zeitdruck,<br />
Ungeduld der Lehrkräfte, verpasste Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten kognitive Prozesse<br />
und erfolgreiches Lernen im traditionellen Unterricht empfindlich stören (vgl. H. Meyer, Was<br />
ist guter Unterricht? Berlin, S. 39- 46). Die Ergebnisse der DESI- Länderstudie (2003/004)<br />
zeigen, dass im modernen Sprachenunterricht der Rede- und Aktionsteil des Lehrers den der<br />
einzelnen Schüler um ein Vielfaches überbietet (50,5%), bei 20 SchülerInnnen in der Klasse<br />
bleibt für den Einzelnen kaum eine halbe Minute. „Oft sind Lehrer zu ungeduldig“ betitelte<br />
Die Zeit (9.3.2006, S.75) die Ergebnisse der Studie und fordert „Schüler sollten häufiger<br />
Gelegenheit zur Selbstkorrektur haben“, d. h. selbsttätig aktiv sein. H. Meyer nennt das<br />
„Langsamkeits- und Schnelligkeitstoleranz“ (ebd. S.45). Die Rolle des Lehrers (traditionell<br />
als Dozent) ist am ELSA in diesen Arbeitsphasen neu definiert als Lernbegleiter im weitesten<br />
Sinne. SchülerInnen haben kalkulierbare Zeit für individuelles Arbeiten. LehrerInnen haben<br />
kalkulierbare Zeit für Diagnose und Differenzierung. Keiner kann sich dem entziehen. Jeder<br />
hat Lernzeit.<br />
Lernen braucht Zeit II<br />
„Ja, die Lehrplanautoren – wie auch viele Lehrkräfte und Fachdidaktiker – überschätzen<br />
systematisch die Leistungsfähigkeit der Schüler. Ihnen fehlt ein Gefühl dafür oder das Wissen,<br />
was Schüler lernen können.“ (Die Zeit, ebd. S.76) Wer mit den Formen offenen Unterrichts<br />
vertraut ist, weiß, dass selbst gesteuertes, eigenverantwortliches Lernen keineswegs immer,<br />
im ökonomischen Sinne, zielstrebiges, effizientes, operationalisierbares Output-Verhalten ist,<br />
sondern individuell ist: Vor allem entwicklungs- und (im weitesten Sinne)<br />
sozialpsychologische Faktoren bestimmen Arbeitsverhalten und Lernerfolg. Wer als
2<br />
Lernender und Lehrender z.B. nichts über die jugendliche „Gehirnbaustelle“ (B. Strauch:<br />
„Warum wir so seltsam sind.“ Gehirnentwicklung bei Teenagern. Aus dem Amerikanischen<br />
von Sebastian Vogel. Berlin 2003) weiß oder die Alltagsrelevanz bzw. den Überlebenswert<br />
des Lernstoffs vernachlässigt (V.F. Birkenbihl: Stroh im Kopf. Vom Gehirn-Besitzer zum<br />
Gehirn-Benutzer. Frankfurt a.M. 2005) wird viel eher Opfer der Spirale von Enttäuschung<br />
und Frustration. Offene Unterrichtsformen erlauben dem Schüler, das einzubringen, wozu er<br />
gerade in der Lage ist. Dies hat mir der Besuch in den verschiedenen Klassen des ELSA<br />
gezeigt. Alle Schülerinnen waren in Bewegung und aktiv, in den Klassenräumen, auf den<br />
Fluren, ob in Einzel-, Partner-, Teamarbeit, bei Stillarbeit oder im Gespräch mit<br />
Mitschülerinnen, den Lehrkräften oder Gästen. Dass die Ergebnisse quantitativ und qualitativ<br />
unterschiedlich sind, liegt auf der Hand. „Man muss abwarten, bis es „klick“ macht.“ (B.<br />
Strauch, ebd.). Lernen braucht Zeit.<br />
Zeit ist Geld. Zeit ist Lebenszeit II<br />
Die tragenden pädagogischen Säulen des ELSA sind plakativ kondensiert in dem Akrostichon<br />
Erlebnis, Lernen, Spaß, Anspruch. In ihrem Artikel zum 50. Todestag von Maria Montessori<br />
fasst die Schulleiterin Erika Risse die in zahlreichen Studien bestätigten Chancen und Vorteile<br />
der offenen Arbeitsformen zusammen: selbstständiges Arbeiten, positives Sozialverhalten,<br />
intensive Konzentrationsfähigkeit, gesteigerte Lerneffizienz, Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Man muss kein bedingungsloser Anhänger Maria Montessoris sein und man kann auch den<br />
Ergebnissen der verschiedenen Evaluationen, an denen das ELSA erfolgreich teilgenommen<br />
hat, kritisch gegenüber stehen, das zugrunde liegende Bildungskonzept, ob man es jetzt<br />
klassisch antiquiert oder modern progressiv nennt, zielt ab auf die Freisetzung des<br />
Individuums, das sich seiner verantwortungsvollen Rolle als soziales Wesen bewusst ist.<br />
„Unser Eingriff in diesen wunderbaren Vorgang ist mittelbar: wir haben diesem Leben, das<br />
von selbst in die Welt kam, die zu seiner Entwicklung erforderlichen Mittel zu bieten, und<br />
haben wir dies getan, so müssen wir achtungsvoll seine Entwicklung abwarten.“(M.M., zit.<br />
nach H. Heiland: Maria Montessori. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b.<br />
Hamburg 2003, 9. Aufl., S.8)<br />
Wenn wir als Gesellschaft und Schule – endlich, jenseits aller Ideologie – akzeptieren lernen,<br />
dass Kinder (Menschen) unterschiedlich sind und Heterogenität nicht ein lästiges<br />
(Verwaltungs-)Problem ist, wenn wir Kompetenzgefälle und Unterschiede in der<br />
Lerngeschwindigkeit nicht als Problem der Auslese auf verschiedene Schulformen begreifen,<br />
sondern die Chancen individueller Kreativität sehen, wenn wir eine Lernumgebung schaffen<br />
können, in der „Leistungsunterschiede auf hohem Niveau“ (E. Stern, in: Die Zeit, 15.<br />
Dezember 2005, S.87) entstehen können, werden die (Vor-)Urteile bzgl. Kuschelpädagogik,<br />
Beliebigkeit, Ineffektivität etc. der offenen Arbeitsformen ihrer Basis beraubt und die<br />
Erkenntnis, dass Lernen immer individuell ist und immer individuelle Lernzeit braucht, wird<br />
selbstverständlich im Schulalltag sein. Für uns LehrerInnen bedeutet dies konkret, einen<br />
Lernalltag zu gestalten, der echte Lernzeit und ein größeres Maß an Zufriedenheit für alle<br />
Beteiligten gewährleistet. Die Gespräche mit SchülerInnen und KollegInnen am ELSA haben<br />
dies bestätigt.<br />
„Es gehört, glaube mir, ein großer und über menschliches Irrsal erhabener Mann dazu, nichts<br />
von seiner Zeit umkommen zu lassen, und sein Leben ist aus dem Grund das längste, weil es<br />
in seiner ganzen Ausdehnung ihm selbst zur Verfügung stand. Nichts davon hat brach und<br />
unbenutzt gelegen, nichts hing von der Verfügung eines anderen ab; hat er doch nichts<br />
gefunden, was wert gewesen wäre, es mit seiner Zeit zu vertauschen, deren sparsamster Hüter<br />
er war.“ (Seneca, zit. nach J. M. Werle (Hrsg.): Seneca für Zeitgenossen. Ein Lesebuch zur<br />
philosophischen Lebensweisheit. München: Goldmann 2000, S. 17)<br />
Ein Besuch am ELSA macht Mut. In diesem Sinne hat die Reise nach Oberhausen reiche<br />
Frucht getragen.<br />
Trier, den 6.6.2006