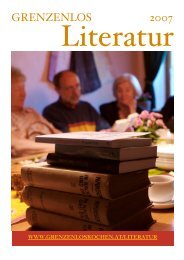DAS PROBLEM DES URSPRUNGES VON PRINZIPIEN ...
DAS PROBLEM DES URSPRUNGES VON PRINZIPIEN ...
DAS PROBLEM DES URSPRUNGES VON PRINZIPIEN ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Siebter Abschnitt<br />
<strong>DAS</strong> <strong>PROBLEM</strong> <strong>DES</strong> <strong>URSPRUNGES</strong> <strong>VON</strong> <strong>PRINZIPIEN</strong><br />
(VERNUNFT) UND INHALT (MATERIE):<br />
ALLHEIT UND ALLGEMEINHEIT ALS VORBILD<br />
(IDEAL DER REINEN VERNUNFT), OMNITUDO<br />
REALITATIS UND PROTOTYPON<br />
TRANSCENDENTALE ALS URBILD<br />
(TRANSZENDENTALES IDEAL).
— 1092 —
— 1093 —<br />
A. DER URSPRUNG DER THEOLOGISCHEN IDEE UND DIE<br />
WIDERLEGUNG DER GOTTESBEWEISE<br />
Die Diskussion der Auflösung der vierten Antinomie und der<br />
theologischen Idee im Anhang zur transzendentalen Dialektik wurde<br />
schließlich von Kant auf die heuristischen Momente beschränkt, was ich<br />
im der transzendetalen Methodenlehre vorangehenden Abschnitt gegen<br />
Ende nur stärker herausgearbeitet habe. Die theologische Idee selbst<br />
scheint bei dieser Beschränkung auf heuristische und zweckmäßige<br />
Gesichtspunkte auf einen historischen, vielleicht individuell zu<br />
wiederholenden Entwicklungsabschnitt der Vernunft beschnitten, der<br />
durch die Idee der systematischen und zweckmäßigen Einheit ersetzt<br />
werden kann. Im dritten Abschnitt der theologischen Idee: »Von den<br />
Beweisgründen der spekulativen Vernunft, auf das Dasein eines höchsten<br />
Wesens zu schließen« wird dann doch deutlich, weshalb die dritte<br />
transzendentale Vernunftidee eine theologische Idee sein muß: Die<br />
Vorstellung der Totalität der Reihe der Bedingungen führt<br />
notwendigerweise zur Vorstellung einer letzten bzw. höchsten Ursache,<br />
die keiner weiteren Ursache mehr bedarf. Zwar ist es richtig, daß diese<br />
Idee eine notwendige Vernunftidee ist, doch wird dabei auf die ebenso<br />
notwendige Alternative der bereits diskutierten endlosen Reihe von<br />
Bedingten und Bedingungen, die selbst wieder bedingt sind, vergessen.<br />
Für den ersten Schritt auf dem Weg zu den verfolgten Ziele reicht aber die<br />
Einsicht, daß zumindest die Idee einer im Regressus letzten, also ersten<br />
und obersten Idee eine notwendige Vernunftidee ist, auch wenn noch nicht<br />
verstanden worden ist, welche Verbindung zwischen dem Regressus von<br />
der niedrigeren zur höheren Idee einerseits und dem Regressus des<br />
Bedingten zum Unbedingten und dem Regressus der Reihe der Ursachen<br />
bis zur letzten und obersten Ursachen andererseits herzustellen ist, um auf<br />
die notwendige Einzigkeit einer transzendentalen Argumentation zu<br />
kommen. Es bleibt zu fragen, welches Motiv hier die Auswahl zwischen<br />
den beiden zunächst gleich notwendigen Vernunftideen beeinflußt hat.<br />
Man darf etwa näher auch fragen, weshalb die endlose oder wirklich ins<br />
Unendliche gehende Reihe unterbrochen werden muß. Das braucht nicht<br />
allein ein metaphysischer Grund (Seinsgrund) sein, sondern es ist auch zu<br />
berücksichtigen, daß die Erörterung in der Spannung zwischen einem<br />
radikalen transzendentalen Idealismus und dem sich mit dem<br />
synthetischen Urteil a priori einstellenden, nicht völlig resubjektivierbaren
— 1094 —<br />
Begriff einer Relation als eigentliches Charakteristikum der objektiven<br />
Realität steht, welcher — zumal nach der dritten dynamischen Kategorie<br />
des Commerciums — eine metaphysische Analogie auch im Rahmen der<br />
kosmologischen Idee im Gegensatz zum strengen transzendentalen<br />
Idealismus nicht zu verbieten, vielmehr zu fordern scheint, wenngleich<br />
Kant mit der Differenz des Dinges an sich und des Dinges an sich selbst<br />
aus anderen Gründen scheitert. Die endlose Reihe möglicher Analyse aber<br />
wird schon dadurch unterbrochen, als daß zum Verständnis einer<br />
Situation, in Abhängigkeit von der Horizontziehung, der Rückgang auf ein<br />
Unbedingtes, bzw. die Gesamtheit der Bedingungen, auch von Kant<br />
während der Aufstellung der Tafel der kosmologischen Ideen für den<br />
logischen Gebrauch der Begriffe als nicht notwendig erachtet wird. Dort<br />
markiert der Übergang zur Totalität der Reihe der Bedingungen vielmehr<br />
den Beginn der Dialektik in der kosmologischen Ideen.<br />
1) Transzendentaler Idealismus und Realismus als Grenzbestimmung<br />
zwischen kosmologischer und theologischer Idee.<br />
Erste Charakeristika höherstufiger Prädikate<br />
Hier stehen aber mit der Entscheidung über die Möglichkeit, sich über<br />
objektive Realität ein Urteil zu bilden, zwei grundsätzliche Fragen an, die<br />
auch für die Untersuchung der Geltungsmöglichkeit von Aussagen zur<br />
theologischen Idee methodisch von Wichtigkeit sind. Wie weit trägt das<br />
synthetisches Urteil a priori: (a) als modales Urteil, (b) als relationales<br />
Urteil?<br />
Diese Fragen können beide jeweils auf eine weitere Frage zurückgeführt<br />
werden: Überschreitet das synthetische Urteil a priori die Grenzen des<br />
strengen transzendentalen Idealismus? Nur so weit, als der strenge<br />
transzendentale Idealismus selbst schon nur auf ein reines intelligibles<br />
Subjekt als synthetisch-metaphysische Vorstellung beruhen soll und nicht<br />
auf den Horizont der Erfahrung, womit die transzendentale Analytik<br />
beginnt. Damit ist eine Bedingungen zur Beantwortung dieser einfachen<br />
grundlegenden Fragen (für jede der obigen Frage für sich oder als<br />
genetisch grundlegendere Frage) genannt worden, die einen strengen<br />
Widerspruch in sich selbst darstellt. Der strenge transzendentale<br />
Idealismus kennzeichnet genau die Position, von wo aus sowohl die<br />
transzendentale Ästhetik wie die transzendentale Analytik der
— 1095 —<br />
Verstandesbegriffe und Grundsätze des empirischen<br />
Verstandesgebrauches ausgeht. Wie kann zu verstehen zugemutet werden,<br />
daß diese Position auf das intelligible Subjekt aufruht? Das wurde sowohl<br />
in der Deduktion des transzendentalen Prinzips der Kausalität im Rahmen<br />
logifizierter Zeitbedingungen streng umrissener transzendentaler<br />
Erfahrungsbedingungen, wie in der dritten Antinomie und deren<br />
Auflösung anhand des nur teilweise aufgelösten Problems der<br />
Zurückhaltung Kantens in der Beurteilung der fundamentalen<br />
Ursprünglichkeit der transzendentalen Idee der Freiheit und deren<br />
Konsequenzen für die Frage nach der Natur der Kausalität der<br />
Intelligibilität allerdings schon klar gestellt, als daß diese Frage von der<br />
Naturkausalität distinkt getrennt wird (Kausalität durch, Kausalität aus<br />
Freiheit). Die in der Auflösung der dritten und vierten Antionomie der<br />
kosmologischen Ideen starke Trennung der Zeichenhaftigkeit des<br />
Bewußtseins von der Naturkausalität verleiht noch der methodischkritischen<br />
Haltung der transzendentalphilosophischen Propädeutik einen<br />
synthetisch-metaphysisch erzeugten Inhalt als »Grund« des<br />
transzendentalen Idealismus.<br />
Hier jedoch scheint die Sachlage eine andere zu sein, denn es geht nicht<br />
um das transzendentale Ideal der Freiheit, sondern um den Horizont der<br />
Erfahrung, womit die transzendentale Analytik beginnt. Freilich ist der<br />
transzendentalen Analytik die transzendentale Idee der Freiheit genetisch<br />
vorauszusetzen, doch aber ist die transzendentale Analytik eine<br />
Einklammerung einer Handlungsform (wie früher schon ausgeführt), die<br />
der transzendentalen Idee der Freiheit vielleicht schon ansichtig geworden<br />
ist, vielleicht aber auch noch nicht als transzendentale Idee. Die<br />
transzendentale Idee der Freiheit ist also nicht nur ausgeklammert,<br />
sondern im Ausgeklammerten (der pragmatischen Vernunfttätigkeit) nicht<br />
notwendigerweise schon explizite enthalten. Wohl muß eine Idee der<br />
Freiheit im Zusammenhang mit Schuld und Ursache pragmatisch und<br />
genetisch schon vorausliegen, doch aber nicht als transzendentales Ideal<br />
der reinen praktischen Vernunft. Keineswegs leugne ich die grundlegende<br />
Möglichkeit (vgl. die Entwicklung der Evidenzlehre der Megariker und<br />
Epikuräer), allerdings die unbedingte Notwendigkeit, um mit der<br />
philosophischen Untersuchung beginnen zu können. — Dazu<br />
komplementär: Die Idee der Freiheit ist im Urteilen wie im Schematismus<br />
implizite Voraussetzung, da die Verstandestätigkeit ein Akt unserer<br />
intelligiblen Spontaneität ist, und so von Anbeginn dieser Untersuchung
— 1096 —<br />
als transzendentale Idee vorausgesetzt zu betrachten sein muß. Unter der<br />
Voraussetzung der transzendentalen Analytik, das heißt neben der<br />
Berücksichtigung des transzendentalen Problems der Einschränkung des<br />
Erfahrungsraumes, eben auch unter der Voraussetzung der logischen<br />
Form des Urteils als für den Syllogismus zurechtgemachte Prädikatenlogik<br />
und unter halbherziger Beiziehung der Konsequenzlogik, die zwischen<br />
Verstandes- und Vernunftschluß unentschieden bleibt, ist diese implizite<br />
vorausgesetzte Idee der Freiheit als unbedingt notwendig zu denken. Die<br />
transzendentale Idee der Freiheit hat ihren systematischen Platz in der<br />
dritten Antinomie und deren Auflösung.<br />
Es findet gewissermaßen eine Einschränkung der Potentialität des<br />
ursprünglichen Verbindens, wie aus § 16 bekannt, statt; im dortigen<br />
transzendentalpsychologischem Sinne ist die ursprüngliche Handlung des<br />
Denkens das Verbinden. Die Ausarbeitung dieses Gedankens erlaubt die<br />
Fassungen A und B der Deduktion ins Verhältnis zu setzen und findet sich<br />
hier im ersten Abschnitt (Grund und Ganzes). Die Definition der<br />
intelligiblen Spontaneität, die sich im »Ich denke« ausdrückt, beinhaltet<br />
meiner bis jetzt aufrecht erhaltenen Auffassung nach nicht von selbst ein<br />
als grundlegend zu bezeichnendes Set von logischen Regeln, die in der in<br />
§ 16 der transzendentalen Deduktion verwendeten Bestimmung des<br />
Denkens erlauben würde, von einer vollständig, oder auch nur kategorial<br />
auf relevante Weise methodisch vollständig bestimmten<br />
Verstandestätigkeit zu sprechen. Vielmehr ist diese Erörterung bereits ein<br />
Produkt der radikalen transzendentalen Einklammerung des<br />
cartesianischen Erkenntnissubjekts, und bedarf weiterer<br />
Bestimmungsstücke, die nicht alle in der dortselbst gegebenen Definition<br />
auch schon analytisch enthalten sind, sondern das Ideal der reinen<br />
Vernunft (Begriff vom einzelnen Gegenstand) und nicht das Problem der<br />
transzendentalen Rechtfertigung der Mathematik insbesondere und den<br />
Formalwissenschaften im allgemeinen voraussetzen. Die transzendentale<br />
Logik muß nicht als Organon, vielmehr als Kanon verstanden werden<br />
können, 1 ähnlich wie die intelligible Spontaneität zur Verstandestätigkeit<br />
allererst bestimmt werden kann. Die transzendentale Logik wird<br />
hinsichtlich der Kriterien von objektiver Realität auf die relationale Seite<br />
der Frage nach der Bestimmbarkeit einer qualitativen oder quantitativen<br />
Bestimmung eingewiesen. Diese Bestimmbarkeit der Bestimmung ist aber<br />
1 Michael Benedikt, Philosphischer Empirismus, II. Praxis, Turia und Kant Wien 1998,<br />
V. Kap., p. 131
— 1097 —<br />
nicht einfach eine Aufstufung höherklassiger Prädikate im Sinne der<br />
Typenlehre von Russell, sondern vielmehr als eine eigenständige<br />
höherstufige Prädikatisierung von Vorstellungen mit Wahrheit anzusehen.<br />
Rein logisch ausgedrückt, gibt es eine allgemeine Wahrheit auch ohne<br />
konkret-allgemeine (weniger allgemeinen) Wahrheiten. Die hinsichtlich<br />
der Bezeichnung des Ursprunges eines Existenzbegriffes in Rede<br />
stehenden Prädikate sind hingegen modale Prädikate von Relationen<br />
(Prädikatsverhältnisse und Verhältnisprädikate) und eben nicht weitere<br />
Prädikationen von Prädikaten.<br />
2. Modalität und objektive Realität: Das Evidenzproblem des<br />
synthetischen Urteils a priori im Horizont des strikten transzendentalen<br />
Idealismus und das Problem des Existenzialsatzes<br />
Inwiefern kann nun ein modales Urteil ohne fundierende Bezugnahme auf<br />
ein Relational überhaupt gedacht werden? Ist ein modales Urteil als<br />
kriterienlose, womöglich transzendentalsubjektivistisch auch für<br />
Erkenntnisgründe als ursprünglich nur mißverstandene Evidenz<br />
überhaupt möglich, selbst wenn die Orientierung an der Bestimmbarkeit<br />
entlang der von der primären Intentionalität vorgegebenen Direktion des<br />
Interesses von objektiver Gültigkeit und objektiver Realität aufgehoben<br />
werden könnte? Diese Frage wurde ebenfalls in vorangegangenen<br />
Abschnitten anhand der Unterscheidung von Grundurteil, Existentialurteil<br />
und kategorisches Urteil dahingehend erörtert, daß Objektivität für<br />
subjektive und empirische Evidenz von Bestimmungen ohne<br />
Relationsbestimmung überhaupt unmöglich sei (aber deshalb nicht<br />
grundsätzlich unmöglich für alle qualitativen und nicht zugleich<br />
quantitative Prädikate). Damit ist in jedem Fall davon auszugehen, daß es<br />
kein modales Urteil ohne Relation gibt; mit einer einzigen Ausnahme: Der<br />
selbst bereits analytischen Feststellung des bloßen Daseins als inhärentes<br />
Momentum des Bewußtseins, die genetisch-analytisch zwar noch vor der<br />
Bestimmung der numerischen (A) und identischen (B) Einheit des<br />
Bewußtseins gedacht werden kann, dieser aber nicht anzusehen ist, ob<br />
dergleichen auch nur selbst als ursprüngliche und fundamentale Evidenz<br />
notwendigerweise zu denken ist, oder ob diese idealistische Vorstellung<br />
von Bewußtseinsimmanenz zwar eine analytisch herausgehobene<br />
Möglichkeit, aber damit auch schon nichts als ein Produkt der geregelten<br />
Spekulation über die Grenzen von Bedingungen der Möglichkeit der
— 1098 —<br />
Erfahrung hinaus ist, und die nur vermeintlich »ursprüngliche« Evidenz<br />
eines reinen Selbsbewußtseins fingiert.<br />
Es ist eben von dieser Stelle der systematischen Reflexion über das<br />
Bewußtsein selbst als Phänomen ausgehend noch nicht zu entscheiden<br />
möglich, was mit der vermuteten Unmittelbarkeit dieser und ähnlicher<br />
Evidenzen auf sich hat; ich neige zur Auffassung, daß das besagte<br />
Momentum selbst einen Mindesthorizont von Gleichursprünglichkeit mit<br />
anderen Momenten des Bewußtseins besitzt und insofern im strengen Sinn<br />
weder an sich unmittelbar ist noch für sich ohne Relationsbegriffe<br />
auskommen kann. Das »Weitere« ist eben nicht gleich der »logische<br />
Gegenstand« der Intentionalität eines Urteils, die mit einem Satzsubjekt<br />
oder einem Satzgegenstand primär bestimmt wird. Die Untersuchung geht<br />
selbst zwar urteilend vor, untersucht aber im primären Modus gerade<br />
keine Intention auf ein Objekt, vielmehr ein qualitativ-modales Urteil<br />
(Quaeitas) ohne Relation, das sich aber möglicherweise selbst als Moment<br />
eines Intentionengeflechts vorstellen läßt. Eben diese Vorstellungsart<br />
findet ihre Grenze darin, als daß die Beziehungen im Horizont einer<br />
vermutlich anzusetzenden Gleichursprünglichkeit selbst (ohne<br />
transzendentalanalytische Untersuchung) sowenig intentional sein können<br />
wie viele andere Beziehungen zwischen Elemente einer Vorstellung von<br />
intentional zusammengesetzten Akteinheiten auch. Ähnliches wurde im<br />
vierten Abschnitt anfangs im Zusammenhang des Problems einer<br />
eigenständigen Intentionalität von Gefühlen als methodische Schwierigkeit<br />
bereits festgestellt. Die Intentionalität auf den Horizont einer solchen<br />
Gleichursprünglichkeit ist, wie schon wie weiter oben auch im<br />
Zusammenhang zum Problem der »genetischen« Auffassung einer<br />
Reihenfolge von Argumenten ersichtlich, eine Folge der Analyse und<br />
insofern rein abstrakt betrachtet, nichts als ein Artefakt der Methode. Der<br />
Horizont der hier vermuteten Gleichursprünglichkeit ist auch nicht sofort<br />
der eines Satzes als grammatikalische und logische Form des<br />
Verstandesurteils, der allerdings als Urteil ideal oder normativ selbst als<br />
ausgebildetes Intentionengeflecht (eben auch in der Reflexion auf<br />
grammatikalische und logische Bestimmungen im Rahmen der<br />
Bestimmung des syntaktischen Kriteriums) darstellbar sein muß.<br />
Es ist aber von einem einfachen Bewußtseinsphänomen der<br />
Aufmerksamkeit durchaus die Rede, das erst in der Analyse selbst als<br />
Produkt eines vorgängigen Prozesses erscheint, doch kann klarerweise<br />
dieses einfache Bewußtseinsphänomen nicht selbst als modales Urteil
— 1099 —<br />
aufgefaßt werden; vielmehr ist erst die Reflexion auf das Inhaltliche des so<br />
genannten einfachen Bewußtseinsphänomen die Bedingung, um eine<br />
Relation zu entwickeln, die diese Reflexion ihrerseits der bestimmenden<br />
Urteilskraft und ihrem Ideal vom Urteil zu unterwerfen vermag. Dieses<br />
Ideal bleibt zunächst im Rahmen der Forderung nach formaler<br />
Vollständigkeit der grammatikalischen und logischen Bedingungen einer<br />
Aussage im Sinne von bestimmenden Urteilen, und ist nicht mit einem<br />
Vernunftideal der Organisation der Erkenntnisse zu verwechseln,<br />
wenngleich in dieser Hinsicht Verstandesideal und Vernunftideal singulär<br />
im Regressus des Erfahrungmachens zusammenfallen. — Um zur<br />
Ausgangsfrage zurückzukehren: Inwieweit kann im Rahmen des<br />
Subjektivismus des strengen transzendentalen Idealismus ein<br />
synthetisches Urteil a priori überhaupt behalten werden? Da auch in einem<br />
modalen Urteil nur dann im Sinne des Verstandesideals geurteilt wird,<br />
wenn die Reflexion der Reflexionen oder des Inbeziehungsetzens der<br />
Elemente des Horizonts der Gleichursprünglichkeit als ein Formbegriff der<br />
bestimmenden Urteilskraft nochmals vorgestellt werden kann, was nichts<br />
anderes heißt als die Ersetzung der Reflexion auf Wahrnehmungen selbst<br />
durch abstrahierende Symbole, findet wohl eine gegenüber der<br />
empirischen Erfahrung intellektuelle Synthesis statt, die man nicht anders<br />
als synthesis intellectualis bezeichnen kann. Daß eine solche Synthesis a<br />
priori stattfinden muß, darf als ausgemacht gelten, das aber macht ein<br />
synthetisches Urteil a priori selbst nicht aus. Das entscheidende Kriterium<br />
ist darin zu suchen, wie der Formbegriff zustande kommt. Nun konnte<br />
gezeigt werden, daß solche Formbegriffe notwendigerweise nur<br />
nachfolgend sein können. Synthetische Urteile a priori aber machen einen<br />
Formbegriff als Ausdruck einer Relation allererst möglich. Die Singularität<br />
der »formalen« Argumentation vermag nicht das transzendentale Prinzip<br />
zu ersetzen, daß das synthetische Urteile a priori im Rahmen der<br />
vollständigen transzendentalen Deduktion (Analyse und Synthesis)<br />
vorausgesetzt sein muß. Dennoch kann über den fraglichen Formbegriff<br />
nicht einfach auf eine Weise des Auffindens gesprochen werden. Die<br />
Metapher der Produktion, die Kant in der dritten Kritik selbst<br />
verschiedentlich verwendet, verfügt zwischen Naturtechnik und<br />
Naturzweck selbst nicht über ein eigentliches Urteil a priori im hier<br />
verlangten strengen Sinn. Es kann analytisch (aus der Unmöglichkeit des<br />
Gegenteils — apagogisch) wegen der Singularität des Arguments gefordert<br />
werden, daß es einen solchen Formbegriff gibt, aber es kann nicht einmal<br />
behauptet werden, daß es eine Relation gibt, bevor sie nicht durch die
— 1100 —<br />
Reflexion hergestellt und durch eine grammatikalisch mögliche Relation<br />
formal charakterisiert worden ist. Für hier ist diese Einspielung gerade<br />
noch dazu geeignet, die Konventionalität der fraglichen Relation zu<br />
beleuchten, deren Substrat für uns als analytisch Nachdenkende schon<br />
auch ohne die Beschränkung durch die transzendentale Kritik<br />
methodischer Artefakte nicht abermals als einfache Relation zu denken<br />
möglich scheint.<br />
Im Sinn der Ausgangsfrage weiter gefragt ist in Folge zu konstatieren, daß<br />
es kein synthetisches Urteil a priori im Rahmen der selbst im übertragenen<br />
Sinne als »ausgedehnt« zu bezeichnenden Grenze des strikten<br />
transzendentalen Idealismus der transzendentalen Ästhetik gibt. Doch<br />
aber »gibt« es diese Grenze; und man darf nach all dem wohl sagen,<br />
aufgrund einer Synthesis, die a priori geschehen muß. Das bedeutet eben<br />
aber nicht komplementär oder gar nach dem einfachen Grundsatz vom<br />
Gegenteil des Unmöglichen, daß mit der Vorstellung dieser fraglichen<br />
Synthesis a priori, die — ursprünglich wie auch immer — nur im Zuge der<br />
transzendentalen Analytik gewonnen werden konnte, auch die »formale«<br />
Synthesis eines Horizontes der Gleichursprünglichkeit selbst und deren<br />
Gesetzmäßigkeiten implizite schon gegeben wären. Wahr ist vielmehr, daß<br />
die Notwendigkeit einer solchen Synthesis transzendentalanalytisch<br />
dargetan werden kann, doch bleibt solches notgedrungen modallogisch.<br />
Wahr ist aber ebenso, daß die Forderung nach einer vorgängigen Synthesis<br />
nicht überhaupt und als solche bloß ein Artefakt der Methode sein kann,<br />
auch wenn ein synthetisches Urteil a priori im engen Sinn des Wortes als<br />
rein modales Urteil (und »logisch« ursprüngliche Evidenz) hier am Beginn<br />
der Analyse des transzendentalen Subjekts als intelligibles Subjekt nicht als<br />
solche nachgewiesen werden kann. Der bloße Umstand, daß auch der<br />
strikte transzendentale Idealismus seine ihm ins Antlitz eingeschriebene<br />
Einseitigkeit nicht innerhalb einer einseitig festschreibbaren Grenze<br />
uneingeschränkt behaupten kann, vermag also ein synthetisches Urteil a<br />
priori nur aus methodischen Gründen, die in den Grenzen der logischen<br />
und grammatikalischen Bestimmbarkeit des Intentionensgeflechtes liegen,<br />
nicht zu verweigern, sondern nunmehr schon aus Gründen eben dieser<br />
ursprünglichen Überschreitung der Einfachheit selbst. Diese<br />
Überschreitung gehört zur Spontaneität, die in dieser Einfachheit allein<br />
darin besteht, die formal als ursprünglich gesetzte Einfachheit zu<br />
überschreiten, ansonsten die Spontaneität selbst nur zu einer<br />
Gesetzmäßigkeit, die in dieser Einfachheit ihre Erschöpfung fände, führen
— 1101 —<br />
würde. Jedoch wäre das nichts anderes als die Spontaneität als bloße<br />
Subreption von Formbegriff und Kraftbegriff gedacht. Spontaneität ist<br />
zwar selbst als Ursache zu denken, aber keineswegs auf den Kraftbegriff<br />
zu reduzieren. Zur Spontaneität selbst gehört somit (wenn man hier schon<br />
aus dem Gegenteil schließen möchte) gerade nicht die gesetzmäßige<br />
Vorhersagbarkeit, wohl aber als intelligible Spontaeität das Vermögen der<br />
Selbstgesetzgebung der Vernunft.<br />
Es stellt sich jedoch schon für den Verstandesgebrauch die Frage,<br />
inwieweit das Vertrauen gerechtfertigt ist, das in den Gesetzesbegriff<br />
selbst hinsichtlich seiner Leistungen hinsichtlich der Bestimmung von<br />
objektiver Gültigkeit investiert worden ist; und zwar eben nicht nur, wenn<br />
es um den konkreten Einzelfall geht, der als solcher immer auch<br />
assertorisch verstanden werden können muß; und zwar auch schon bevor<br />
eine transzendentale Zeitbedingung aus transzendentalästhetischen,<br />
transzendentalpsychologischen und aus aussagenlogischen Gründen<br />
eingerichtet werden konnte, die erst eine vollständige kategoriale<br />
Definition erlaubt. Letztenendes hängt das Ungenügen gegenüber den<br />
konkreten Einzelfall als Individuum zuvor mit dem Ungenügen gegenüber<br />
der Totalität der Reflexion zusammen; und zwar bezeichnenderweise<br />
bevor der Horizont der Frage nach einer weiteren Eingeschränktheit oder<br />
Entschränktheit des Totums dieser ursprünglich transzendentalen<br />
Reflexion und den damit möglichen Folgen allgemeiner und konkreter<br />
Bestimmbarkeit von Einzellfall und mögliches Ganzes überhaupt fixiert<br />
werden kann. Weiters kann mit dem Gesetzesbegriff allein objektive<br />
Realität nicht ausreichend charakterisiert werden; das zeigt schon die<br />
Beurteilung der inneren Zweckmäßigkeit von Geometrie und Algebra<br />
Kantens, die allein nur zur objektiven Gültigkeit zureicht. — Spontaneität<br />
kann jedenfalls weder mathematisch noch dynamisch zureichend mit dem<br />
Gesetzesbegriff charakterisiert werden.<br />
Selbst in der Frage nach dem einfachen Phänomen des Bewußtseins stößt<br />
man auf die Idee der Freiheit; und zwar eben noch bevor der Horizont der<br />
Wahlmöglichkeit oder der Haltung im Falle der Alternativlosigkeit<br />
diskutiert werden kann. Die Behandlung der Spontaneität selbst kann nun<br />
unter keinen anderen Bedingungen erfolgen, wie das einfache Phänomen<br />
des Bewußtseins, was eine Rückbesinnung auf das Verstandesideal und<br />
dessen Schema des Urteils zwischen Grammatik und Logik notwendig<br />
macht, um daraus nunmehr im Rückblick die Differenz zwischen<br />
Spontaneität und Verstandesvermögen nochmals zu verstehen. Ob im
— 1102 —<br />
Schema des Urteils nicht bloß transzendentale Reflexion stattfindet,<br />
sondern dazu noch ein transzendentales Prinzip Platz greift, was ein<br />
synthetisches Urteil a priori als Grundlage der Aussagenkönnens die<br />
diskursive Form der Logik im Sinne des Behaupten- und<br />
Verwerfenkönnens allererst möglich machen könnte, ist von den<br />
Erwartungen Kants her zu beurteilen: Seine Weigerung, der Logik<br />
Leibnizens in seinem Sprachmolekularismus nachzufolgen, kann wohl<br />
nicht dem Existenzialsatz gelten, welcher der Form nach der Endfassung<br />
des Leibnizschen Logikkalküls zugrunde liegt. Doch schon die<br />
grundlegende Aufspaltung des einfachsten formalen logischen Elementes<br />
in Intuition und Diskursivität zeigt meiner Auffassung nach an, daß Kant<br />
einer prästabilierten Konvergenz von Metaphysik der Mathematik und<br />
Metaphysik der Natur (Kontingenz) systematisch mißtraut hat. Zweierlei<br />
ist als Ergebnis einer solcher Untersuchung zu erwarten: 1.<br />
Transzendentale Prinzipien beziehen sich immer schon auf<br />
Außersprachliches. Eine eigene Transzendentalität der Sprache gibt es<br />
nicht, oder nur in radikal transzendentalsubjektivistischer Hinsicht: das<br />
transzendentales Ich als sich monologisch artikulierende freie Person. 2.<br />
Kants transzendentalanalytischer Ansatz wird für die Probleme der<br />
analytischen Sprachphilosophie (etwa Searle, Apel im Umgang mit dem<br />
Zusammenhang von Wahrheit und Existenz) wie für die moderne<br />
mathematische Logik, insbesondere für deren weiterführende Probleme,<br />
die sich anhand einer bloß formalen extensionalen Betrachtungweise<br />
höherstufiger Prädikate zwischen Gödel und Russell zeigen, bald ebenso<br />
von Bedeutung sein, wie Leibniz.<br />
Der strikte transzendentale Idealismus der transzendentalen Ästhetik muß<br />
also überschritten werden, um zu einem transzendentalen Prinzip des<br />
synthetischen Urteil a priori zu gelangen, welches diesen Überschritt erst<br />
zu rechtfertigen vermag. Das bedingt die Formulierung von Beziehungen<br />
als Relationsform, wobei eben die Beziehung des Erkenntnissubjekt zum<br />
Erkenntnisobjekt nicht einheitlich formalisiert werden kann<br />
(Affinitätsproblem), aber gerade das, was im Erkenntnisinteresse liegt,<br />
nämlich die Relation zwischen den daseienden Dingen, schon analytischmetaphysisch<br />
als naiver transzendentaler Realist aus der bloßen Vielheit<br />
und der Eigenschaft unseres Verstandes, den Erscheinungen Dinge zu<br />
unterlegen, gedacht wird. Der aufgeklärte transzendentale Realist weiß<br />
aber, daß sich seine Vorstellungen nur auf Erscheinungen beziehen, und<br />
muß nach dem transzendentalen Prinzip suchen, welches ein synthetisches
— 1103 —<br />
Urteil a priori als Grundlage für konkret bestimmbare und aktuell<br />
assertorische Erfahrungsurteile erst möglich macht. Das kategorische<br />
Urteil ist nun ein Urteil, das Washeit und Modalität anhand der logischen<br />
Relationsform zwischen den Bestimmungen der Washeit, die sprachlich<br />
betrachtet, aussagenlogisch gegeben werden (z. B. als Konjunktion oder als<br />
Disjunktion, aber auch als Implikation), gemäß des syntaktischen<br />
Kriteriums zu bestimmen sucht. Das Schema eines kategorischen Urteils<br />
verlangt nach Allgemeingültigkeit — hier ist der Ort der Reflexion, ein<br />
synthetisches Urteil a priori zu verlangen, um die Möglichkeit solcher<br />
Urteile im Sinne von Propositionen, die über das Sosein von Existierenden<br />
bestimmend aussagen, zu beweisen. Im Sinne des Descartschen Diktums,<br />
Ideen seien Sätze, nicht Begriffe, kann man auch sagen, das synthetische<br />
Urteil a priori sei das Prinzip, und erweise epistemologisch im Nachweis<br />
wie mit der Bestimmung der Bedeutung der Frage nach der Identität von<br />
Wahrheit und Existenz in einem seine Transzendentalität. Mit dieser<br />
Gegenüberstellung ist komplementär nicht mehr oder weniger als eine<br />
Formbestimmung von Existentialsätzen gewonnen, die nicht allein auf<br />
logische oder grammatikalische Elemente beruht; vielmehr die Formen des<br />
Gegebenseins, zuerst in Hinblick auf sinnlich gegebene Erfahrung, als<br />
davon verschiedene (unabhängige) Voraussetzung in ihrer Rechtfertigung<br />
heranzieht. Gerade weil damit jede weitere Wesenserörterung im Sinne<br />
der Koordinationen von Eidos und Genus abgeschnitten worden ist,<br />
welche zu einer nicht bewältigbaren regionalontologischen Fassung zu<br />
führen hätte, kann das synthetische Urteil a priori auch nicht selbst als<br />
Existentialsatz aufgefaßt werden: Kant schließt jede Auffassung von<br />
Existentialsätzen, die auf sprachmolekularen Vorstellungen beruhen,<br />
welche zumindest der Realmöglichkeit nach die Elemente empirischer<br />
Wahrheit beinhalten, kategorisch aus. Das unterscheidet auch die hier<br />
verfolgte Auffassung von den Überlegungen von Bertrand Russell zur<br />
entscheidbaren Proposition, die zwar nicht vom Sprachpartikularismus,<br />
jedoch von einem möglichst einfachen Existentialsatz ausgehen, der einem<br />
System höherstufiger Prädikate zugrunde liegen soll. Der transzendentale<br />
synthetische Grundsatz der Deduktion des transzendentalen Prinzips der<br />
Kausalität ist hingegen nicht ein Existenzialsatz, sondern selbst das<br />
transzendentale Prinzip von Propositionen als »Tatsachenaussagen«,<br />
denen Russell prekär die subjektiv verbleibenden »Namen der Dinge«<br />
gegenüberstellt. 2<br />
2 Willard Van Orman Quine, Theorie und Dinge, Übersetzung J. Schulte,
— 1104 —<br />
Der transzendentale Idealismus ist notwendig, um dem Erkenntnisgrund<br />
radikal ein ursprüngliches Fundament zu verleihen, denn es ist gerade<br />
nicht so, daß wir über das Bewußtsein unseres Daseins hinaus uns selbst<br />
mit Gewißheit bekannt sind. So gibt es auch einen metaphysischen und<br />
ontologischen Grund des transzendentalen Idealismus weiterhin zu<br />
vermuten, obgleich dessen daraus erst nochmals nach Seinsgründen zu<br />
rechtfertigenden transzendentalen Subjektivismus selbst erst das<br />
Fundament des wissenschaftlichen Denkens aus der bloßen Spekulation<br />
befreit: Die ursprüngliche Relation zwischen Subjekt und Objektwelt im<br />
Affinitätsproblem muß vervollständigt werden; durch die mangelnde<br />
Bestimmung der Position des Erkenntnissubjektes nach der<br />
Einklammerung ist das auf das Erkenntnissubjekt reduzierte intelligible<br />
Wesen in seiner Beziehung zur Gottähnlichkeit und der damit in Verlust<br />
geratenen ontologischen Gewißheit, die zuvor in Rückbezug auf die<br />
adamitische Ursprache noch möglich schien, fraglich geworden. — Diese<br />
Perspektive könnte helfen, das Schwanken Kants zwischen<br />
transzendentalem Idealismus und transzendentalem Realismus im<br />
Übergang von kosmologischer zu theologischer Idee verständlich zu<br />
machen.<br />
3. Die reinen Prinzipien der Ideenlehre sind selbst weder transzendental<br />
noch ontotheologisch. Eine schwache formalontologische Rechtfertigung<br />
der theologischen Idee<br />
Die Entscheidung über die Transzendentalität von Prinzipien findet ihren<br />
eigentlichen Grund letztlich in der Eigenart der Architektonik der reinen<br />
Vernunft, gewissermaßen alternative Zimmerfluchten transzendenter<br />
Ideen doch zu Flügeln eines Gebäudeabschnitts von Idden regulativer<br />
Funktion zusammenzufügen; im positiven Falle handelt es sich um die<br />
Bezugnahme auf die Auflösung der dritten Antinomie, die insofern<br />
angebracht ist, weil noch in der »Endabsicht« Kant eine Fassung der<br />
theologischen Idee vorlegt, in welcher der »archetypus intellectus« der<br />
menschlichen Vernunft das Urwesen und das höchste Wesen bereits<br />
ersetzt hat. Man könnte diese Fassung für zu radikal empfinden, steht<br />
Frankfurt/Main, Suhrkamp 1 1991, S. 108. (Theories and Things, Harvard College<br />
1981)
— 1105 —<br />
doch die Möglichkeit der intelligiblen Ursächlichkeit für die in der<br />
sinnlichen Erfahrung gegebenen Welt für den Menschen (und a fortiori für<br />
Intelligenzen mit sinnlicher Anschauung überhaupt) auf dem Spiel. Fände<br />
man einen zureichenden Grund, sich gegen die starke Fassung der<br />
theologischen Idee zu entscheiden, bliebe sie immerhin eine notwendige<br />
Vernunftidee, aber von nur subjektiver Gültigkeit. Insofern bleibt eine<br />
gewisse Verbindung zur Entwicklungspsychologie und historischen<br />
Ausformung transzendentalobjektiv verstandener Genetik aufrecht.<br />
Ich behaupte also, daß die Gefahr der architektonischen Schwächung der<br />
Position der intelligiblen Ursächlichkeit, und damit auch der<br />
Einschränkung der transzendentalen Freiheit gleich von vorneherein auf<br />
die Intellection stösst, und zum architektonischen Argument wird,<br />
weshalb die theologische Idee als solche (als Urbild und höchstes Wesen)<br />
der als Vernunftidee subjektiv gleichnotwendigen Idee des endlosen oder<br />
wirklich ins Unendliche gehenden Regressus (gemeinsam mit der Idee der<br />
systematischen und zweckmäßigen Einheit der Natur als Prinzip deren<br />
Betrachtung) vorgezogen wird. Und zwar erstens, weil mit dem<br />
entgegengesetzten Schluß die in Stellung gehaltene Hypostasierung der<br />
Intelligibilität überhaupt in Gefahr kommen würde, sodaß das<br />
transzendentale Subjekt samt dessen nicht nur im ontotheologischen<br />
Analogieschluß unumgänglichen Problem der Leiblichkeit sich dann nicht<br />
mehr als Ideal der normierenden Vernunft vorstellen ließe, weil die<br />
Intelligibilität überhaupt schon mit dem Ausschluß der reinen<br />
Intelligibilität als Abtrennbares grundsätzlich bedroht scheint. Zweitens<br />
gäbe es keine Stelle in der Kantschen Architektonik, die, gewissermaßen in<br />
Vorarbeit einer List der Vernunft, am Boden der Erkenntniskritik noch<br />
einen Grund für die Intelligibilität unserer Spontaneität als Intelligenz<br />
notwendig machen könnte, außer der transzendentalen Idee der Freiheit.<br />
Die eigentliche Entscheidung über die formalen Gründe, die starke<br />
Version der theologischen Fassung anzunehmen, könnte also nur vom<br />
Eigendünkel geprägt sein, einerseits der eigenen konkreten und<br />
empirischen Ursprünglichkeit auszuweichen und andererseits damit nicht<br />
nur eine Garantie für die individuelle Freiheit in der Kontingenz dieser<br />
Welt, sondern auch noch für die Möglichkeit, selbst schöpferisch tätig zu<br />
sein, in Anspruch nehmen zu können. — Da nun die Erörterung aller<br />
Ideen der Vernunft von Interesse ist, ist nun unabhängig von jeder<br />
Entscheidung über den Vorrang der einen oder der anderen Fassung (die<br />
andere Fassung wrd spinozistisch), eben auch diese zu behandeln, auch
— 1106 —<br />
wenn von vorneherein klar ist, daß im Rahmen der Vernunft, die ihre<br />
Grenze mit der Selbstkritik in der transzendentalen Analytik der Dialektik<br />
der reinen Vernunft selbst umfaßt, trotz oder gerade wegen ihrer Strebung<br />
nach Transzendenz in Immanenz der Erfahrung (Vernunft inmitten der<br />
Erfahrung) niemals auch nur die Grenze von subjektiver Gültigkeit zur<br />
objektiven Gültigkeit allein mit Argumente der transzendentalen Analytik<br />
der Vernunftdialektik verschieben geschweige denn die Modalidät der<br />
»objektiven Realität« ableiten wird können.<br />
Der einzige Grund zur Einschränkung der ganzen Untersuchung auf die<br />
theologische Idee in der Fassung der Einheit vom Urwesen und vom<br />
höchsten Wesen ist also, gleichgültig aus welchen sonstigen näheren<br />
Gründen, zuerst architektonisch notwendig. Erst dann kann die Frage<br />
gestellt werden, inwieweit es einen Grund für die Annahme der Realität<br />
von Intelligibilität geben kann, wenn der ontotheologische<br />
Argumentationsgang abgeschnitten wird. Kant präsentiert die stärkste<br />
Fassung der Begründung dieser immanenten Notwendigkeit von<br />
Intelligibilität und Existenz in folgendem Absatz:<br />
»Wenn etwas, was es auch sei, existiert, so muß auch eingeräumt werden,<br />
daß irgend etwas notwendigerweise existiere. Denn das Zufällige existiert<br />
nur unter der Bedingung einens anderen, als seiner Ursache, und von<br />
dieser gilt der [derselbe] Schluß fernerhin, bis zu einer Ursache, die nicht<br />
zufällig und eben darum ohne Bedingung notwendigerweise da ist. Das ist<br />
das Argument, worauf die Vernunft ihren Fortschritt zum Urwesen<br />
gründet.« (B 612/A 584)<br />
Die Einzigkeit des letzten Arguments gerade hinsichtlich der subjektiven<br />
Notwendigkeit als Vernunftidee ist bereits widerlegt worden; insofern fällt<br />
aber nur ein formales Argument der Transzendentalität weg, und dazu<br />
noch das schwächste. Ich bin darüber hinaus dennnoch der Auffassung,<br />
daß das gegebene Zitat zwei Argumente und nicht eins enthält. Die<br />
Erklärung: »Denn das Zufällige existiert nur unter der Bedingung einens<br />
anderen, als seiner Ursache, und von dieser gilt der [derselbe] Schluß<br />
fernerhin, bis zu einer Ursache, die nicht zufällig und eben darum ohne<br />
Bedingung notwendigerweise da ist« ist offensichtlich als Erläuterung des<br />
ersten Satzes gedacht. Das mag sie immerhin unter näher bestimmten<br />
Umständen auch sein können, keinesfalls aber ist es eine Begründung der<br />
Aussage im ersten Satz des Zitats: »Wenn etwas, was es auch sei, existiert,<br />
so muß auch eingeräumt werden, daß irgend etwas notwendigerweise<br />
existiere«. Die gegebene Erklärung ist vielmehr erst aus dem Gegensatz
— 1107 —<br />
zum Zufälligen als Ableitungsgrund (Schluss) des Satzes über etwas<br />
notwendigerweise Existerendes zu denken. Aber: Der Schluß von bloßer<br />
Existenz schlechthin auf etwas schlechthin notwendigerweise<br />
Existierendes geht ursprünglich auch nicht auf die Determination einer<br />
Reihe von Naturursachen schlechthin; vielmehr auf denjenigen Grund von<br />
Existenz, der uns in einem Vernunftschluß auf Existenz schließen läßt. Das<br />
kann von der transzendentalen Position aus entlang der primären<br />
Intentionalität anhand der Sinnlichkeit und deren metaphysischen<br />
Pendant, der transzendentalen Ästhetik, geschehen; ob dies ähnlich in<br />
ontotheologischer Intentionalität denkmöglich ist (ob also Gott jeweils<br />
unmittelbar das Soseins ins Sein hält) oder ob ein solcher Gedanke anders<br />
als nur spekulativ nicht gefaßt werden könnte und sich von der<br />
Vorstellung eines Zentauren nicht unterscheiden ließe, daß gehört zentral<br />
zum verfolgten Fragekreis. Die bloße Negation der Determination als<br />
Umkehrung hätte allerdings nur zwei denkmögliche Negate: Chaos oder<br />
den obersten Grund, der die quantitative Unendlichkeit der Zeit aussperrt.<br />
Auch letzteres liefert aber, so behaupte ich, nicht die erfüllende<br />
Interpretation des diskutierten Satzes, weil er auf die Vorstellung einer<br />
Ursachenkette zurückgreift, die dem Übergang vom Bedingten zum<br />
Unbedingten nicht analytisch wesentlich ist. Es ist also der zweite Satz<br />
nicht als Erläuterung des ersten Satzes zu verstehen, sondern als reines<br />
synthetisches Urteil. M. a. W., die transzendentale Deduktion der<br />
Kategorien ist auch metaphysisch notwendig, so wie Thomas und auch<br />
Anselm von der empirischen Wirklichkeit im ontologischen Gottesbeweis<br />
ausgegangen sind.<br />
Der Satz: »Wenn etwas, was es auch sei, existiert, so muß auch eingeräumt<br />
werden, daß irgend etwas notwendigerweise existiere« sollte ursprünglich<br />
als einfache Evidenz verstanden werden und nicht als Ableitung. Daß es<br />
sich nicht mehr um die kritische Rekonstruktion einer Subreption in<br />
Gestalt einer schlichten Tautologie handelt, wie es für die Vorstellung des<br />
Beginns der transzendentalen Analyse noch gereicht hat, die Bedingungen<br />
des Anfangen-Könnens der Philosophie mit den Anfängen der<br />
Transzendentalphilosophie kurzzuschließen, darf nunmehr vorausgesetzt<br />
werden. Vom Standpunkt der transzendentalen Logik gesehen handelt es<br />
sich um die Verwechslung von Existenz mit einer existierenden<br />
Vorstellung oder der als fälschlicherweise als ursprüngliche und<br />
eigentümliche Relationsform vorgestellten Verknüpfung von Existenz mit<br />
inhaltlichen (gegenstandsbezogenen) Merkmalen der Vorstellung eines
— 1108 —<br />
realmöglichen Gegenstandes; insofern eigentlich ein Paralogismus. Diese<br />
nur vermeintlich als Relation gedachte Beziehung ist nicht selbst der<br />
Erkenntnisgrund, weshalb die Merkmale, die in den Prädikaten vorgestellt<br />
werden, auf wirkliche Dinge transzendental bezogen werden können,<br />
gerade weil dieser Bezug nur in Hinblick auf die Erscheinungen der Dinge<br />
in unserer Erfahrung reell vollzogen werden kann. Diese Vorstellung einer<br />
unmittelbaren Beziehung ist als Produkt eines unzureichenden<br />
Konkretisierungsversuches der Affinität von Subjekt und Objekt zu<br />
werten, das bestenfalls einen gewissen heuristischen Wert besitzt: Der<br />
zureichende Grund aller Logik nach Leibniz ist jener, wie Prädikate oder<br />
Aussagen auf wirkliche Gegenstände bezogen werden können. Dieser<br />
zureichende Grund ist eine transzendentale Hypothese zu nennen, die<br />
hierin ähnlich wie die transzendentale Ästhetik ihre Transzendentalität,<br />
ihre Geltung erst mit der hinreichenden transzendentalen Analyse aller<br />
Bedingungen der Möglichkeit des wahren Aussagens erwiesen bekommen<br />
kann.<br />
Die rein modallogische Fragestellung nach Notwendigkeit reicht nach der<br />
Einsicht in die alternative Verfasstheit der subjektiv notwendigen<br />
Vernunftideen zwischen Unbedingtheit, oberster Ursache und endloser<br />
Reihe der Determination als das Unbedingte der series rerum selbst, nicht<br />
mehr aus. Zumindest ist eine Charakteristik über das inhaltliche<br />
(empirisch konkrete) Merkmal hinausgehend notwendig, die mit den<br />
Kategorien des für den Verstand in der Anschauung Gegeben auch<br />
gegeben worden ist, deren Notwendigkeit hier aber offenbar nicht eigens<br />
erfragt werden soll. Es geht allerdings um Bedingungen des wahren<br />
Aussagens über wirkliche Dinge (und deren Beziehungen im Dasein), die<br />
nicht im Verstand, nicht in der Sinnlichkeit und nicht in den Dingen<br />
selbst liegt. Es muß allgemein mit der Frage nach der Notwendigkeit die<br />
Frage gestellt werden können, notwendig im Vergleich zu welchem<br />
Vorgang oder zu welcher konkretisierbaren Existenz? Dann ergibt sich<br />
folgende Frage in spekulativer Erweiterung des Fragehorizontes durch<br />
Abstraktion nahezu von selbst: Gibt es eine Notwendigkeit, die über die<br />
relative, weil per definitionem vorläufige, aber bedingende Notwendigkeit<br />
der Bedingungen, eine Idee von absoluter Notwendigkeit vorzustellen, an<br />
Notwendigkeit hinausgeht? Die spekulative, also versuchsweise bejahende<br />
Vernunft ist der Dämon, der die Idee von absoluter Notwendigkeit<br />
vorstellt, und mit der Frage nach der über die Bedingungen der<br />
Vorstellbarkeit hinausgehenden Notwendigkeit noch vermeint, absolute
— 1109 —<br />
Notwendigkeit bereits selbst zu denken. Absolute Notwendigkeit aber<br />
führe zur Existenz, gewissermaßen implizite, und weil absolut, auch<br />
eminent, also ohne weitere Rechtfertigung gegenüber dem Einzelnen und<br />
Individuellen. Aus der simplen Tatsache, daß die eine Determination von<br />
Reihen von Ursache und Wirkung, seien diese nun natürlich<br />
vorkommende Determinationen oder menschlich gewirkte, stärker sein<br />
kann als andere Determinationen, seien diese von uns in Gang gesetzt oder<br />
nur begrüßt, mag unschwer als eine psychologische Wurzel der über die<br />
Erfahrung hinaus gehende Strebung unserer Vernunft zu erkennen sein;<br />
aber gerade die letzte Behauptung kann unbeschadet der Notwendigkeit<br />
der Vorstellung absoluter Notwendigkeit kritisiert und auch ohne inneren<br />
Widerspruch aufgehoben werden. Grundsätzlich ist dazu zu sagen: Die<br />
bloße Vorstellung verschiedener »Stärken« von Determinationen verläuft<br />
nur in den Bahnen der Reihe von Bedingungen und Bedingten, die<br />
wiederum Bedingungen sind, und geht somit nur den schon bekannten<br />
Weg, eine unbedingte Bedingung überhaupt nur als Abstraktion<br />
überhaupt vorzustellen zu können. Gleichgültig, was dieser unbedingten<br />
Bedingung unterstellt wird, es bleibt für sich bloße Formalontologie, und<br />
somit bestenfalls einigermaßen geregelte Spekulation.<br />
Die modallogische Lesart des Satzes: »Wenn etwas, was es auch sei,<br />
existiert, so muß auch eingeräumt werden, daß irgend etwas<br />
notwendigerweise existiere« gründet nicht auf die verschiedentlich (nicht<br />
nur psychologisch) konstatierte Strebung der subjektiven Vernunft, auch<br />
nicht auf die Auffassung des Diodorus, wonach, das was existiere, selbst<br />
sei es zuvor nur als zufällige Möglichkeit erschienen, von dann an auch<br />
unumstösslich und notwendig sei. Sie zieht ihre Rechtfertigung daraus,<br />
daß Kant diesen Satz vermutlich als ontologische Interpretation einer<br />
gestürzt gelesenen logischen Wahrheit ansieht. Diese lautet ungefähr:<br />
Wenn es eine Wahrheit gibt, dann gibt es auch andere Wahrheiten; und ein<br />
ganzes System von Wahrheiten. Umgekehrt ergibt das eben: Wenn es<br />
mehrere Wahrheiten gibt, dann gibt es auch eine oberste Wahrheit. Was<br />
zunächst aber nur formal auf Satzsysteme und deren Mannigfaltigkeit<br />
axiomatischer Ordnung bezogen sein konnte, wird in der gewaltsam<br />
ontologischen Interpretation zum logischen Gerüst der Verdinglichung<br />
eines Zusammenhanges und zum Popanz eines intelligiblen Gegenstandes.<br />
— Da nun bei Kant definitionsgemäß überhaupt nur intelligible<br />
Gegenstände notwendigerweise existieren können, muß das, was Kant als<br />
notwendigerweise existierend beschreibt, ein intelligibler Gegenstand sein.
— 1110 —<br />
Damit wird nur die von mir behauptete Verknüpfung als bloße<br />
Denknotwendigkeit bestätigt, aber eben nicht die Notwendigkeit der<br />
Wirkung nach. Es ergibt sich daraus eine nunmehr naheliegende, jedoch<br />
verblüffende Variante: Das, was notwendigerweise existiert, existiert nicht<br />
wie empirisch gegeben Objekte der Erfahrung auch; das war nunmehr<br />
schon klar; aber, nur weil etwas als Intelligibeles existiert, existiert es noch<br />
nicht als absolut Notwendiges. Erst wenn das Intelligible in der Form eines<br />
absolut Notwendigen gedacht wird, zieht es die Forderung notwendiger<br />
Determination nach sich.<br />
Liest man den in Rede stehenden Satz in der Interpretation der mit der<br />
sinnlichen Anschauung gegebenen Erfahrungsgrundsätze, dann fällt auf,<br />
daß dies eine Übersetzung der reinen Kategorie sein könnte, welche<br />
Ursache und Wirkung nicht unterscheiden kann und nur mehr disjunktiv<br />
als komplementäre Notwendigkeit zu verzeichnen imstand ist. Doch<br />
genau das ist eben im untersuchten Zitat nicht ausgedrückt und kann für<br />
die theologische Idee verworfen werden. Das aber, was mit Notwendigkeit<br />
existiert, kann selbst analytisch mit Intelligibilität nicht eindeutig<br />
charakterisiert und nicht synthetisch zur absoluten Notwendigkeit erklärt<br />
werden. Eine Untersuchung der Widerlegung der Gottesbeweise wird also<br />
nicht nur nach der Art der Beweise (ontologischer, kosmologischer,<br />
physikotheologischer Gottesbeweis) vorgehen müssen (wie Kant sagt, in<br />
der entgegengesetzten Reihenfolge, wie diese Beweise in unser Bewußtsein<br />
treten), sondern auch nach der Art der aus der jeweiligen Totalität<br />
erschlossenen Eigenschaft. So ist das Urbild nicht von selbst das<br />
allerrealste Wesen, oder die Vorstellung der ersten nicht selbst wieder<br />
verursachten Ursache ist nicht mit Sicherheit aus der selben Quelle<br />
geschöpft, wie die Vorstellung von einem höchsten Wesen. Deren Einheit<br />
ist für Kant erst zu erweisen.<br />
4. Das Wesen des Unbedingten und das Urbild (prototypon) im<br />
Verhältnis zu totum ideale und totum transcendentale<br />
Ich trete in die nähere Auseinandersetzung mit dem Kantschen Text dort<br />
ein, wo Kant selbst die Abstraktheit seiner modallogischen Formulierung,<br />
daß, wenn irgend etwas existiert auch etwas notwendigerweise existiert,<br />
zum Ausgangspunkt nimmt (Beweisgründe der spekulativen Vernunft):<br />
»Nun sieht sich die Vernunft nach dem Begriffe eines Wesens um, das sich<br />
zu einem solchen Vorzuge der Existenz, als die unbedingte
— 1111 —<br />
Notwendigkeit, schicke, nicht so wohl, um alsdenn von dem Begriffe<br />
desselben a priori auf sein Dasein zu schließen, (denn, getrauete sie sich<br />
dieses, so dürfte sie überhaupt nur unter bloßen Begriffen forschen, und<br />
hätte nicht nötig, ein gegebenes Dasein zum Grunde zu legen,) sondern<br />
nur um unter allen Begriffen möglicher Dinge denjenigen zu finden, der<br />
nichts der absoluten Notwendigkeit Widerstreitendes an sich hat. Denn,<br />
daß doch irgend etwas schlechthin notwendig existieren müsse, hält sie<br />
nach dem ersteren Schlusse schon für ausgemacht. Wenn sie nun alles<br />
wegschaffen kann, was sich mit dieser Notwendigkeit nicht verträgt, außer<br />
einem; so ist dieses das schlechthinnotwendige Wesen, man mag nun die<br />
Notwendigkeit desselben begreifen, d. i. aus seinem Begriffe allein ableiten<br />
können, oder nicht.« (B 613/A 585)<br />
Kant gesteht also gleich zu Beginn zu, daß die behandelten<br />
modallogischen Formulierungen der Totalität der Reihe des Bedingten<br />
zum Unbedingten, implizite damit aber auch, daß Reihen der Bedingten<br />
und deren selbst wieder bedingten Bedingungen im Sinne kausaler<br />
Determination, keine modale Aussagekraft besitzen, um der Idee von<br />
unbedingter Notwendigkeit in concreto objektive Gültigkeit oder gleich<br />
objektive Realität zu erweisen. Vom gesuchten Begriff wird nur verlangt,<br />
daß er nichts der Vorstellung von der absoluten Notwendigkeit<br />
Widerstreitendes enthält. Inwiefern genau das eine Zumutung ist, kann<br />
näher anhand der Tafel des Nichts (ens rationis, nihil privativum, ens<br />
imaginarium, nihil negativum, B 348/A 292) aus der Amphibolie der<br />
Reflexionsbegriffe entschlüsselt werden: ein logisch möglicher<br />
(widerspruchsfreier) Begriff wird doch vom nihil negativum<br />
unterschieden, auch wenn er deshalb ein leerer Begriff sein kann. Kant<br />
stellt auch hier selbst wieder den Schluß auf etwas schlechthin notwendig<br />
Existierendes als etwas Fragwürdiges hin: Durch die Wendung, daß<br />
dergleichen die Vernunft »nach dem ersteren Schlusse schon für<br />
ausgemacht« hält, wie auch anhand der Formulierung: »Wenn sie nun<br />
alles wegschaffen kann, was sich mit dieser Notwendigkeit nicht verträgt,<br />
außer einem«, beginnt Kant diesen ersten Schluß von der formalen Würde<br />
der Einzigkeit der Argumentation (die erste formale Bedingung eines<br />
transzendentalen Beweises) zu entfernen, indem Kant nunmehr auch einen<br />
anderen Schluß oder überhaupt eine andere Schlußform für möglich hält,<br />
als den einen, der eben die Vorstellung eines schlechthin notwendigen<br />
Wesens als Schluß einer Vorstellungsreihe beinhaltet (übriglässt). Der<br />
»erstere« der Schlüsse, wie Kant anzeigt, ist der, der von jenen Dingen
— 1112 —<br />
ausgeht, die der Idee von einer absoluten Notwendigkeit nicht<br />
widerstreiten. Das Ergebnis genau dieser Operation ist nun der Begriff<br />
vom »schlechthinnotwendigen Wesen, mag man nun die Notwendigkeit<br />
desselben begreifen, d. i. aus seinem Begriffe allein ableiten können, oder<br />
nicht«. Das mag man nun so verstehen, daß eben, wie vermutet, ein<br />
solcher Begriff nur durch seine architektonische Stellung (topos) bestimmt<br />
wird, als solcher aber ein leerer Begriff ist. Immerhin besteht noch die<br />
Möglichkeit, auf den von mir noch stärker vorgetragenen Zweifel an der<br />
Einzigkeit der Argumentation zurückzukommen, und einen anderen<br />
Schluß (eine andere Schlußform) zu fordern.<br />
Kants Untersuchung bleibt hier unvollständig; nicht nur weil die Achse<br />
vom prototypon transcendentale zum existierendem Urbild (ens<br />
originarium) als Interpretation der Beziehung von Substanzkategorie und<br />
Antizipationskategorie bislang nur wenig berücksichtigt wurde. Die<br />
verschiedenen Momente der Spekulation über ein die Totalität des<br />
Kontingenten im Urbild resolutiv abschließenden unendlichen Wesens<br />
wären also aufeinander zu beziehen, womöglich nicht nur in einer<br />
hölzernen Liste von Anforderungen, sondern architektonisch in ihren<br />
verschiedenen argumentativen Wechselbeziehungen darzustellen. Kant<br />
stellt nun die Erörterung auf die Möglichkeit der Einteilung der<br />
Beweisgründe der spekulativen Vernunft ab, auf das Dasein eines<br />
höchsten Wesens zu schließen. Das ist zwar nur einer der offenbar auf die<br />
eine oder andere Weise unvermeidbaren, aber zuerst nur als bedingt<br />
notwendig zu verstehenden Fassungen der theologischen Idee als<br />
Vernunftbegriff, erlaubt aber die Komplexität der vorhin aufgeworfenen<br />
Frage zu reduzieren auf eine Einteilung der Beweisarten vom Dasein<br />
Gottes aus spekulativer Vernunft. Nach dieser nicht wirklich<br />
überraschenden Reduktion des Untersuchungsfeldes stehen also der<br />
physikotheologische, der kosmologische und der ontologische<br />
Gottesbeweis zur Diskussion an. Insofern will ich Kants Überlegungen in<br />
der Hoffnung auf weitere Hinweise weiter verfolgen:<br />
»Ich werde dartun: daß die Vernunft, auf dem einen Wege (dem<br />
empirischen) so wenig, als auf dem anderen (dem transzendentalen),<br />
etwas ausrichte, und daß sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über die<br />
Sinnenwelt durch die bloße Macht der Spekulation hinaus zu kommen.<br />
Was aber die Ordnung betrifft, in welcher die Beweisarten der Prüfung<br />
vorgelegt werden müssen, so wird sie gerade die umgekehrte von<br />
derjenigen sein, welche die sich nach und nach erweiternde Vernunft
— 1113 —<br />
nimmt, und in der wir sie auch zuerst gestellt haben. Denn es wird sich<br />
zeigen: daß, obgleich Erfahrung den ersten Anlaß dazu gibt, dennoch bloß<br />
der transzendentale Begriff die Vernunft in dieser ihrer Bestrebung leite<br />
und in allen solchenVersuchen das Ziel ausstecke, das sie sich vorgesetzt<br />
hat. Ich werde also von der Prüfung des transzendentalen Beweises<br />
anfangen, und nachher sehen, was der Zusatz des Empirischen zur<br />
Vergrößerung seiner Beweiskraft tun kann.« (B 619/A 591)<br />
Es liegt auf der Hand, daß es sich in diesem Zusammenhang nur um einen<br />
transzendentalen Beweis der theologischen Idee handeln kann, und nicht<br />
etwa um den transzendentalen Beweis überhaupt. Die Vermutung, daß ein<br />
»empirischer Zusatz« in dieser Frage nichts Entscheidendes beitragen<br />
könne, liegt auf der Hand; darauf läuft auch die Untersuchung des<br />
physikotheologischen und des kosmologischen Gottesbeweises hinaus.<br />
Das Empirische des lebendigen Geistes reichte selbst nicht aus, um diese<br />
Vorstellung von Totalität zu befriedigen (ihr ein Ende zu setzen), denn hier<br />
bezeichnet der Ausdruck »empirisch« zwar mindestens zweierlei, bleibt<br />
aber doch schon im intelligiblen Dasein auf Natur bezogen, wofür, wie<br />
berichtet, eigentlich schon die Idee von der systematischen und<br />
zweckmäßigen Einheit der Natur zureichen würde. In der theologischen<br />
Idee bleibt für Kant jedoch allein der ontologische Gottesbeweis in seiner<br />
vermeintlichen Unabhängigkeit von Hilfshypothesen der Kern der<br />
Argumentation. Bemerkenswert ist vorneweg, daß hier wie in den<br />
verschiedenen Fassungen des absolut notwendigen Wesens, welches die<br />
Unendlichkeit verschließt, nicht alle Fassungen gleichermaßen als<br />
verschieden Arten der Darstellung des Intelligibelen fungieren.<br />
»Man sieht aus dem bisherigen leicht: daß der Begriff eines<br />
absolutnotwendigen Wesens ein reiner Vernunftbegriff; d. i. eine bloße<br />
Idee sei, deren objektive Realität, dadurch, daß die Vernunft ihrer bedarf,<br />
noch lange nicht bewiesen ist, welche auch nur auf eine gewisse obzwar<br />
unerreichbare Vollständigkeit Anweisung gibt, und eigentlich mehr dazu<br />
dient, den Verstand zu begrenzen, als ihn auf neue Gegenstände zu<br />
erweitern.« (B 620/A 592) Kant läßt geflissentlich die Frage nach der<br />
objektiven Gültigkeit dieser Idee abermals beiseite; man könnte aber<br />
ansonsten in einer sowohl kritischen wie auch methodisch strengen<br />
Lesung diese Passage zulassen, wenn man das metaphysische Bedürfnis<br />
bloß als Grund, sich deshalb mit den dialektischen Produkten der<br />
spekulativen Vernunft kritisch beschäftigen zu müssen, gelten lassen will.<br />
»Man hat zu aller Zeit von dem absolutnotwendigen Wesen geredet, und
— 1114 —<br />
sich nicht so wohl die Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie man sich<br />
ein Ding dieser Art auch nur denken könne, als vielmehr sein Dasein zu<br />
beweisen.« (l. c.) Das ist ein trefflicher Vorwurf, zumal Kant nicht nur mit<br />
den verschiedenen Versionen des Überganges von Totalität auf Existenz,<br />
und von verschiedenen Versionen des selbst unendlichen, die extensive<br />
Unendlichkeit aber zugleich verschließenden Wesens, sich dem Versuch<br />
dieser Mühen mehrmals unterzogen hat, sondern insbesondere mit der<br />
Untersuchung zum prototypon transcendentale als dem Herzstück der<br />
theologischen Idee im Versuch der Identifizierung von omnitudo realitatis<br />
mit ens realissimum in methodischer Hinsicht einen zwar unvollständigen,<br />
aber in systematischer Hinsicht entscheidenden Umriß des Problems<br />
liefert. Nur dort ist die theologische Idee nicht nur als eine architektonisch<br />
ausgezeichnete Stelle, oder als eine zwar aus der Subjektivität des oberen<br />
Begehrungsvermögens geborene Vorstellung, aber selbst in der Gestalt der<br />
reinen Vernunft nicht zu leugnenden Strebung zur Transzendenz der<br />
Immanenz der reinen Vernunftidee zu rechtfertigen. Obgleich diese<br />
Übergänge auch in der theologischen Idee als Dialektik und als<br />
transzendentallogisches Problem skizziert werden, handelt es nicht um<br />
einen Gotttesbeweis; vielmehr besteht der Gehalt dieser Untersuchungen<br />
Kants in diesem Zusammenhang vor allem im Versuch, den Nachweis der<br />
architektonischen Notwendigkeit der theologischen Idee zu führen. Es ist<br />
eine Besonderheit der Einfachheit der transzendentalen Argumentation,<br />
daß nicht alle Begriffe gleichermaßen reelle Begriffe sein müßten, wenn<br />
zumindest Einzigkeit garantiert wäre. Auch wenn nicht über alle Stationen<br />
der Darstellung des Weges zur Vorstellung des prototypon<br />
transzendentale Einzigkeit garantiert werden kann, hat Kant, methodisch<br />
von der Idee von der systematischen und zweckmäßigen Einheit der Natur<br />
unabhängig, entlang der Auswickelung der von der Vielheit<br />
eingeschränkten Allheit zur Allgemeinheit des Besondern im Begriff vom<br />
einzelnen Gegenstand (Ideal der reinen Vernunft) bis zum existierenden<br />
Wesensbegriff im durch die bereits entschränkte Allheit selbst<br />
durchgängig bestimmten transzendentalen Ideal, zwei Strategien,<br />
notwendigerweise auf Existenz zu schließen, verknüpft: Die letztendlich<br />
wesenslogische Deutung des Teilbegriffes, der den Gegenstand als Ganzes<br />
unter dem Aspekt des gegebenen Merkmals vorzustellen erlaubt (in der<br />
ersten Kritik mittels der transzendentalen Einbildungskraft), und den aus<br />
der transzendentalidealistischen Argumentation der Angleichung oder<br />
Identifikation von ens realissimum und omnitudo realitatis stammende<br />
Schluß, aus der Totalität der Allheit möglicher Prädikate auf Existenz zu
— 1115 —<br />
schließen. Das transzendentale Ideal ist der Ausgangspunkt einer<br />
radikalen Erweiterung der Spekulation, deren näheren kritischen<br />
Darstellung im Anschluß an diesem Teil dieses Abschnittes erfolgt; es ist<br />
aber in Hinblick auf die theologische Idee nur der erste Schritt. Im<br />
nächsten Schritt wird dialektisch im Untersatz omnitudo realitatis zum<br />
Interpretament des disjunktiv vorgestellten transzendentalen Obersatzes,<br />
was zu weiteren Verwechslungen von omnitudo realitatis und ens<br />
realissimum führt; desweiteren zu gröberen Unklarheiten des damit zu<br />
bildenden Syllogismus hinsichtlich der durchgehenden Unterscheidbarkeit<br />
zwischen »logischen Vergleich« und »transzendentalen Vergleich« des<br />
Dinges mit dem ens originarium als prototypon transcendentale.<br />
Die Einführung des prototypon transcendentale ist selbst ein weiterer<br />
Schritt, der nicht so deutlich als in sich folgerichtige Erweiterung des<br />
Spekulationskreises von Kategorie (Allheit), Ideal der reinen Vernunft<br />
(Allgemeinheit) und transzendentales Ideal (existierender Wesensbegriff)<br />
dargestellt werden kann. Obgleich der mit dem transzendentalen Obersatz<br />
angedeutete »transzendentale«, aber dialektische Syllogismus nur zur<br />
Darstellung des transzendentalen Vergleichs sowohl in wesenslogischer<br />
(intensionaler) wie in ontotheologisch-attributieller (extensionaler)<br />
Hinsicht gedacht worden ist, womit die unscharfe Unterscheidung<br />
zwischen Merkmalslehre (durchgängige Bestimmung eines Dinges mittels<br />
Prädikate) und Wesensbegriff (intensionaler Allgemeinbegriff der<br />
Gattungslogik) gleich zwischen der Schwierigkeit, zwischen intensionaler<br />
und extensionaler Logik überhaupt zu unterscheiden, versteckt wird, wird<br />
nunmehr ein Urbild ans Ende der Untersuchung gestellt, als wäre damit<br />
der Wesensbegriff zu Ende gedacht. Damit soll wohl auch die oberste Idee<br />
die oberste materiale Bedingung enthalten, was als Endpunkt der<br />
Annäherung von ens realissimum und omnitudo realitatis aufgefaßt<br />
werden kann. Das prototypon transcendentale ist nicht nur die nächste<br />
Erweiterung des Spekulationskreises, die von der herausgestellten<br />
Unbestimmtheit des Verhältnisses zwischen omnitudo realitatis und ens<br />
realissimum zumindest einmal als motiviert gedacht werden kann, mit<br />
dem prototypon transcendentale wird eine neue Metaphorik eingeführt: Es<br />
ist ein Urbild, nicht mehr Vernunftidee; und es ist existierendes Urbild,<br />
nicht mehr oberste Idee als reine Intelligibilität, vielmehr (auch) oberste<br />
materielle Bedingung (als transzendentale Materie) in einem, wie in den<br />
Definitionen des transzendentalen Ideals gefordert wird.
— 1116 —<br />
Insofern erscheint mir das wie eine Aufforderung zur »Abvergottung«,<br />
wenn ich mir diese sprachliche Variation gestatten darf, welche nicht nur<br />
die Abtrennbarkeit der reinen Intelligibilität von Wirklichkeit verhindert,<br />
sondern auch die Unterscheidbarkeit der reinen Intelligibilität von der<br />
materiellen Bedingung ohne jeden eigentlichen Grund, allein aus<br />
Spekulation, untergräbt. Gerade eben auch, um solchen Schwierigkeiten<br />
gegenüber besser gewappnet zu sein, habe ich neben anderen Gründen,<br />
die ich an Ort und Stelle noch nicht geordnet anführen kann, die<br />
Untersuchung der Kantschen Widerlegung der Gottesbeweise der<br />
Untersuchung des transzendentalen Ideals als prototypon transcendentale<br />
vorangestellt.<br />
Damit behält diese Variation der theologischen Idee des unendlichen<br />
Wesens ihren transzendentalen Charakter aus einem nicht wirklich<br />
gelungenen Versuch, denn Kant läßt auch dort keinen Zweifel, daß<br />
objektive Gültigkeit und objektive Realität keineswegs in einem<br />
übertragbaren Sinn neu zu bestimmende Modalbegriffe wären. Mit dem<br />
transzendentalen Ideal, als eigentlicher Wesensbegriff des Individuell-<br />
Konkreten gedacht, und mit dem transzendentalen Obersatz, entweder als<br />
Wahres und Falsches beinhaltend, oder als das bloß Realmögliche,<br />
vielleicht auch leibnizianisch die verschiedenen möglichen series rerum,<br />
vielleicht auch spinozistisch die verschiedenen Kombinationen der<br />
Dimensionen der ersten Attribute der ersten Substanz, die Natur und Gott<br />
zugleich ist (ens realissimum), enthaltend, verläßt die Überlegung<br />
allmählich, aber endgültig das Feld, auf welchem Modalbegriffe wie<br />
objektive Gültigkeit oder objektive Realität irgendeine geregelte<br />
Anwendung finden könnten.<br />
Spätestens ab der Wendung zum Urbild und prototypon transcendentale<br />
gilt dies nicht nur für die weiten Interpretationen des transzendentalen<br />
Obersatzes, die immerhin denkmöglich sind. Die Einzigkeit dieser selbst<br />
notwendigerweise unvollständigen Argumentation erweist sich aber nicht<br />
nur architektonisch präzise in der Entwicklung von Allheit zu<br />
Allgemeinheit zum Wesensbegriff, der zuletzt nur deshalb transzendental<br />
wird, weil er entgegen der Anlage zur Totalität im logischen Vergleich<br />
disjunktiv auf die entgegengesetzte Argumentation abzielt, die intensional<br />
aus der Verknüpfung von Einzelnem und Individuellen im<br />
transzendentalen Ideal als Begriff vom einzelnen Wesen auf Existenz<br />
schließt. So ist die Darstellung des transzendentalen Ideals als protypon<br />
transcendentale bei Kant schon deshalb einmalig, weil eben der Entwurf
— 1117 —<br />
eines transzendentalen Obersatzes, gerade auch wegen seiner mangelnden<br />
Strenge, zuletzt wieder von der zielgerichteten Selektion der Komplexität,<br />
die im logischen Vergleich gefordert wäre, um ein ein Ding auch im<br />
transzendentalen Vergleich zu bestimmen, absehen muß. Derart sind<br />
Regressi beizubringen, die Kant nicht, oder nicht ausführlich genug<br />
behandelt hat; oder sich schlichtweg einer gründlichen Behandlung aus<br />
transzendentalidealistischen Gründen, die anderswo schon behandelt<br />
worden sind, entzogen hat. Diese von Kant mehr oder weniger deutlich<br />
auch angeregten Ergänzungen rechtfertigen ein zweites Mal die<br />
Sonderstellung der theologischen Idee, aber nicht selbst den Titel der<br />
Transzendentalität. Ein solcher im Rahmen der theologischen Idee<br />
erhobene Anspruch ist dialektisch.<br />
Die Rechtfertigung aus dem Titel der einzig möglichen Argumentation<br />
wird so gemäß den Regel der abstrakten Ideenlehre um den Titel des<br />
größtmöglichen Umfanges an alternativen Interpretationen erweitert;<br />
damit wird das erste formale Kriterium der Transzendentalität einer<br />
Argumentation selbst umgekehrt, obgleich weiterhin die Einzigartigkeit<br />
jener Argumentation, die diese komplementäre Erweiterung und<br />
Entschränkung eröffnet, wie die Forderung nach Distinktheit der<br />
Alternativen bestehen bleibt. Diese Ermöglichung einer systematischen<br />
Erweiterung des Umkreises alternativer Interpretationen bleibt, ebenfalls<br />
unabhängig von der intellektuellen Verknüpfung beider<br />
entgegengesetzten Prinzipien, ein gegenüber dem ersten Abschnitt von<br />
Allheit und Allgemeinheit bis zum Wesensbegriff eigener Grund der<br />
Auszeichnung. Der erste Abschnitt gibt dem »formalen« Argument der<br />
Einzigkeit darin noch einen weiteren verläßlichen Grund, indem zwischen<br />
Allheit und Allgemeinheit zwei entgegengesetzte Definitionen eines<br />
Prinzips der durchgängigen Bestimmung verwendet werden, die im<br />
Wesensbegriff der Fassung des transzendentalen Ideals vereint werden<br />
sollen. Dabei ist die Verknüpfung der Kategorie der Allheit (erstes<br />
kategoriales Quantum) und der logischen Allgemeinheit (erstes logisches<br />
Quantum) durch einen Gegensatz von Totalität aller möglichen Prädikate,<br />
worin Existenz enthalten sein muß, und Teilbegriff, worin der Gegenstand<br />
als ganze Vorstellung gedacht werden können soll, nicht länger als völlig<br />
reines Verstandesurteil anzusehen, indem sich darin, wenn auch nur<br />
unbestimmt-konkret, die Zusammenhänge der Deduktion der<br />
»Wahrheitsfähigkeit« der Kategorien von Erfahrungsbegriffen und der
— 1118 —<br />
Deduktion der »Wahrheitsfähigkeit« der logischen Formen des<br />
syntaktischen Kriteriums ausdrücken.<br />
Die folgenden Abschnitte besitzen nicht vergleichbare formale Dignität,<br />
doch kann man etwas verknappt und forciert behaupten, daß die erfolgte<br />
Entwicklung, welche zuerst das transzendentale Ideal, dann der<br />
transzendentale Obersatz in Richtung prototypon transcendentale nimmt,<br />
nicht einfach völlig unbestimmbar und unmittelbar auf einer »eigentlichen<br />
Komplexität« des untersuchten Feldes aufruht, sondern noch einer inneren<br />
Unbestimmtheit des Verhältnisses der Transzendentalphilosophie zur<br />
Metaphysik zu verdanken ist, die selbst nur teilweise sichtbar gemacht<br />
werden kann: Ideal der reinen Vernunft als Wesensbegriff;<br />
transzendentales Ideal als bloß analytisch herausgehobener Wesensbegriff<br />
— wäre da nicht die Bindung an die vom Ideal in concreto und in<br />
individuo bestimmte Idee. Die Uneinheitlichkeit des Verhältnisses von<br />
Transzendentalphilosophie und Metaphysik hat sich Kant aber auf<br />
mehreren Seiten zugleich und zielgerichtet eingehandelt, was abermals in<br />
einer architektonischen Analogie die Wichtigkeit (also nicht selbst als<br />
konkretisierte Einzigkeit) des transzendentalen Obersatzes indirekt (eben<br />
nicht selbst transzendental) in Bezug auf die Frage nach der Möglichkeit<br />
der Einheit von Vernunft und Existenz aufweist oder anzeigt. — Der<br />
theologischen Idee ist also nicht nur eine Stelle architektonisch angewiesen<br />
worden, sondern erweist auf zwei verschiedene Arten eigene Dignität: In<br />
der logischen und in der kritischen dialektischen Verwendung. Nicht aber<br />
ist damit auch ein unendliches oder unbedingt notwendiges Wesen als<br />
Ende der kontingenten Unendlichkeit bewiesen worden.<br />
5. Die Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises anhand der<br />
Zurückführung der Argumente auf die Dialektik bloßer<br />
Erkenntnisgründe, die als Seinsgründe genommen werden<br />
Ich setze also mit der Kantschen Untersuchung des ontologischen<br />
Gottesbeweises fort, der, wie erinnerlich, bereits eine systematische<br />
Einschränkung des Feldes möglicher methodischer Untersuchungen der<br />
theologischen Idee ist:<br />
»Noch mehr: diesen auf das Geratewohl gewagten und endlich ganz<br />
geläufig gewordenen Begriff hat man noch dazu durch eine Menge
— 1119 —<br />
Beispiele zu erklären geglaubt, so, daß alle weiter Nachfrage wegen seiner<br />
Verständlichkeit ganz unnötig geschienen.« (B 621/A 593)<br />
Die Rede ist vom Begriff der Vorstellung eines absolutnotwendigen<br />
Wesens, der obgleich leer, allein deshalb noch kein nihil negativum sein<br />
muß, nur weil bloß unsere Vorstellungskraft nicht ausreichen könnte.<br />
Doch scheint Kant über die Vergeblichkeit der Untersuchung hinsichtlich<br />
des eigentlichen Zwecks, nämlich der Beweis des die Unendlichkeit der<br />
Kontingenz beendenden absolut notwendigen Wesens, keine Illusionen zu<br />
besitzen:<br />
»Alle vorgegebenen Beispiele sind ohne Ausnahme nur von Urteilen, aber<br />
nicht von Dingen und deren Dasein hergenommen. [1] Die unbedingte<br />
Notwendigkeit der Urteile aber ist nicht eine absolute Notwendigkeit der<br />
Sachen. [2] Denn die absolute Notwendigkeit des Urteils ist nur eine<br />
bedingte Notwendigkeit der Sache, oder des Prädikats im Urteile. [3] Der<br />
vorige Satz sagte nicht, daß drei Winkel schlechterdings notwendig seien,<br />
sondern, unter der Bedingung, daß ein Triangel da ist, (gegeben ist) sind<br />
auch drei Winkel (in ihm) notwendigerweise da.[4]« (B 621 f./A 593 f.)<br />
(ad 1) Das sollte nicht überraschen, denn das ist die Voraussetzung der<br />
transzendentalen Erörterung. Diese Voraussetzung hat sich allerdings von<br />
der transzendentalanalytischen Hypostasierung der Intelligibilität<br />
argumentativ entfernt, obgleich weiterhin um die Möglichkeit der<br />
Selbstständigkeit der Intelligibilität anhand der theologischen Idee<br />
gestritten wird. Sicherlich sind die Beispiele nicht »von Dingen und deren<br />
Dasein hergenommen«, doch sie sollen notwendig mögliche Positionen der<br />
Reflexion in der transzendentalen Dialektik der reinen Vernunft,<br />
insbesondere in der theologischen Idee, sein.<br />
(ad 2) Kant erkennt den hier entscheidenden Unterschied: die<br />
Notwendigkeit des Urteils dem Inhalt oder Gegenstand des Urteils nach ist<br />
abhängig von der bedingten Notwendigkeit der Sache. Nun aber ist hier<br />
die »Sache« nicht ein Objekt der Erfahrung oder gar ein Ding an sich<br />
selbst, und auch nicht für sich schon ein Verhältnis zwischen Dinge an sich<br />
selbst im Sinne einer tatsächlichen Relation, deren korrespondierendes<br />
Dasein nicht allein unserem Denken entspringt. Offenbar meint Kant mit<br />
den Ausdruck »Sache« zuvor aber den kategorial bestimmbaren<br />
Gegenstand, sodaß nunmehr im behandelten Umfeld allein der Ursprung<br />
der Einheit im Urteil selbst in Frage steht.<br />
(ad 3) Der Satz: »Die absolute Notwendigkeit des Urteils ist nur eine<br />
bedingte Notwendigkeit der Sache, oder des Prädikats im Urteile« gibt
— 1120 —<br />
nochmals die zweite Quelle der Notwendigkeit eines Urteils an: die des<br />
Prädikats im Urteil (Aussage). Derart erhält die sprachliche und<br />
schriftliche Form einen formalwissenschaftlichen Leitfaden zur formalen<br />
oder allgemeinen Logik; aber noch mehr: den Anschein, allein auf Grund<br />
grammatikalischer oder logischer Gründe die Notwendigkeit eines Urteils<br />
ausmachen zu können. Die Ersetzung der Notwendigkeit von der Sache<br />
her durch die formale Notwendigkeit (formale Implikation) wäre aber<br />
gerade nur da möglich, wo die Sache (Inhalt, Gegenstand) des Urteils nicht<br />
als etwas behandelt wird, welcher der Intelligibiltät gegenübersteht.<br />
(ad 4) Kant zieht wie üblich auch die Geometrie heran: Selbst deren Sätze a<br />
priori sind bedingt durch die Möglichkeit reiner Anschauung. Erst wenn<br />
ein Triangel gegeben ist, so Kant, dann erst gelte auch der Winkelsatz.<br />
Einwände von Seiten nicht-euklidischer Geometrie sind in diesem<br />
Zusammenhang trivial und gegenstandslos, andere Einwände sind zu<br />
beachten. So ist allererst zu überlegen, was denn an Stelle der reinen<br />
Anschauung in der Geometrie im Falle des Begriffes vom unbedingt<br />
notwendigen Wesen in Frage kommen könnte.<br />
Kant demonstriert sein Argument gegen den ontologischen Gottesbeweis<br />
anhand eines logischen und eines geometrischen Beispiels: »Wenn ich das<br />
Prädikat in einem identischen Urteil aufhebe und behalte das Subjekt, so<br />
entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem<br />
notwendigerweise zu. Hebe ich aber das Subjekt zusamt dem Prädikate<br />
auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, welchem<br />
widerspochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei<br />
Winkel desselben aufheben, ist widersprüchlich; aber den Triangel samt<br />
seinen drei Winkeln aufheben, ist kein Widerspruch. Gerade ebenso ist mit<br />
dem Begriffe eines absolutnotwendigen Wesens bewandt.«<br />
(B 622 f./A 594)<br />
Was könnte, der reinen Anschauung in der Geometrie vergleichbar, zur<br />
Demonstration für die Möglichkeit eines absolutnotwendigen Wesens<br />
dienen, die auch nur zur objektiven Geltung der vorgestellten Idee<br />
zureicht? Und hebt die Aufhebung des Triangels nicht die euklidische<br />
Verfaßtheit der Geometrie in reiner Anschauung mit auf? Kants ganze<br />
Vorgangsweise stellt diese Fragen eher zum kosmologischen Gottesbeweis,<br />
doch hat Kant schon anhand der Intelligibilität entschieden, später auch<br />
erkannt, daß Bezüge zur Empirie bei der Untersuchung der Bedingung der<br />
Möglichkeit eines unendlichen Wesens selbst nichts nützen, auch wenn<br />
wie beim ontologischen Gottesbeweis des Thomas von Aquin die
— 1121 —<br />
empirische Erfahrung der Ausgangspunkt der theologischen Spekulation<br />
ist. 3 Daraus ist aber nur mehr der Schluß zu ziehen, daß diese zur<br />
Geometrie analog streng gefaßten Bedingungen der formalen und<br />
wirklichen Möglichkeit in der theologischen Idee weder empirisch noch in<br />
reiner Anschauung gegeben werden kann.<br />
»Äußerlich ist nichts, dem widersprochen würde, denn das Ding [des<br />
Begriffs vom absolutnotwendigen Wesen] soll nicht äußerlich notwendig<br />
sein; innerlich ist nichts, denn ihr habt, durch Aufhebung des Dinges<br />
selbst, alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig; das ist ein<br />
notwendiges Urteil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden, wenn<br />
ihr eine Gottheit, d. i. ein unendliches Wesen, setzt, mit dessen Begriff<br />
jener identisch ist. Wenn ihr aber sagt: Gott ist nicht, so ist weder die<br />
Allmacht, noch irgend ein anderes seiner Prädikate gegeben; denn sie sind<br />
alle zusamt dem Subjekte aufgehoben, und es zeigt sich in diesem<br />
Gedanken nicht der mindeste Widerspruch« (B 623/A 595)<br />
Die Aufhebung eines Urteils (Subjekt und Prädikat) ohne logischen<br />
Widerspruch (B 623) ist dann möglich, wenn die Bedingungen der<br />
assertorischen Geltung des »ist« von der kategorialen Geltung als Kopula<br />
unterschieden werden kann. Unter dieser Voraussetzung wird mit der<br />
Aufhebung der Setzung des Subjektes die Geltung der ganzen Aussage,<br />
also auch das (analytische) Prädikat aufgehoben; allerdings ohne die<br />
Richtigkeit der syntaktischen Relation zwischen Subjektbegriff und<br />
Prädikatsbegriff aufzuheben. In der Geometrie ist das der Fall, wenn gar<br />
kein Triangel in reiner Anschauung gesetzt worden ist (kein euklidisches<br />
Dreieck), in Urteilen über objektive Realität dann, wenn jetzt keine<br />
Assertion möglich ist, aber an anderer Stelle oder zu einer anderen Zeit<br />
erwartet werden kann. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß<br />
Kant womöglich im Falle des geometrischen Beispiels (und nur dieses<br />
verwendet er in diesem Zusammenhang) an die Besonderheit des Dreiecks<br />
gedacht hat, die das Dreieck durch seine Rolle in der Diskussion um die<br />
Notwendigkeit und Einzigkeit der euklidischen Geometrie gegenüber der,<br />
traditionell nur als bloße Denkmöglichkeit behandelten nicht-euklidischen<br />
Geometrie gespielt hat. In dieser durch Lambert auch Kant bekannte<br />
Diskussion spielt unter anderem die Winkelsumme eine entscheidende<br />
Rolle; da nun Kant nur von Winkeln, nicht von einer Winkelsumme<br />
3 Thomas von Aquin, Die Gottesbeweise in der »Summe gegen die Heiden« und der<br />
»Summe der Theologie, hersg,. Eingeleitet und kommentiert von Horst Seidl, Felix<br />
Meiner Verlag, Hamburg 2 1986
— 1122 —<br />
spricht, kann hier von einer Invarianz dieser Behauptung bezüglich der<br />
näheren Verfäßtheit reiner Geometrie in reiner Anschauung gesprochen<br />
werden. Damit ist ein Argumentationsgang eröffnet, der von Kant für die<br />
reine Geometrie grundsätzlich ausgeschlossen wird, aber dazu führt, daß<br />
desweiteren in aller Reinheit und innerer Notwendigkeit die Aufhebung<br />
des Begriffs eines Dreiecks auch zur Falsifikation dieses Begriffes führen<br />
könnte, weil eine andere für sich ebenso reine Geometrie dem<br />
Denkentwurf des Konzepts des Dreiecks vorausliegt, ohne das eine dieser<br />
Geomtrien als grundsätzlich unmöglich erwiesen werden könnte.<br />
Während diese disjunktive Entwicklung in ihrer Verzweigtheit völlig rein<br />
und a priori geltend als qualitative Mannigfaltigkeit der Geometrie<br />
weiterhin als in reiner Anschauung konstruierbar gedacht werden kann,<br />
ist es im Rahmen der Kontingenz nunmehr nach Kants Bestimmung des<br />
Horizonts empirischer Erfahrung anhand den Bedingungen der<br />
Sinnlichkeit unserer Erfahrung möglich, daß Konzepte empirischer<br />
Begriffe, seien sie analytische oder synthetische Sätze, als falsch gelten<br />
können, nicht weil sie jetzt nicht gelten, sondern weil sie Unmögliches<br />
behaupten, hielte man sie für wahr.<br />
Der allerrealste Begriff (Inbegriff) aber ist in keiner dieser Hinsichten<br />
aufhebbar. Was bedeutet dieser Wechsel vom Urteil zum Begriff (Inbegriff)<br />
in logischer Hinsicht für das Merkmal, was für die Distribution des<br />
Merkmals? Der Wechsel zum Konzept des Begriffes bedeutet der<br />
Übergang vom Verstandesgebrauch zu Vernunfturteilen, indem nunmehr<br />
nicht ein Satz, sondern ein System von Sätzen gedacht wird; und zwar als<br />
bloß mögliche Urteile, die ihrer Washeit nach als zureichend bestimmt<br />
oder bestimmbar gedacht werden, aber, obgleich eben nicht nur<br />
denkmöglich, nicht alle über eine gemeinsam aktuelle Assertion verfügen<br />
können. Nun kommt eben eine durchgängig bestimmte und bestimmende<br />
Assertion für eine Vernunftidee selbst nicht in Frage, doch aber bleibt auch<br />
die Idee vom Allerrealsten in einem zumindest denkbaren System von<br />
Sätzen im Sinne möglicher Vernunftbegriffe, die durch Vernunftschlüsse<br />
verbunden sind, wie zuvor anhand der Frage nach der Einheit von<br />
Unbedingtem und Bedingtem, oberster und nachfolgender Ursachen,<br />
oberer und niederer Idee bereits nahegelegt worden ist.<br />
Entscheidend für die Richtigkeit des Verfahrens ist jeweils das gegebene<br />
Beispiel: Die Aufhebung des ganzen Urteils zieht keinen Widerspruch<br />
nach sich. Das heißt im Falle des logischen Urteils oder des Triangels<br />
immer, daß die Geltung jetzt, im Anwesen, an einem bestimmten Ort zu
— 1123 —<br />
einer bestimmten Zeit (oder in einem bestimmten Zeitraum), keine<br />
Existenzbehauptung (Geltungsbehauptung im Falle der Geometrie)<br />
explizite enthält, obgleich angenommen werden kann, daß andernorts<br />
oder zu einer anderen Zeit (in der Geometrie: unter einem anderen Zweck<br />
der Konstruktion) das besagte Urteil auch als assertorische<br />
Existenzbehauptung bzw. aktuelle Geltungsbehauptung gelten können<br />
muß. Die Geltung des Urteils in Bezug auf das Verhältnis von Subjekt und<br />
Prädikat im Satz der Aussage steht bei den wechselnden Umständen der<br />
aktuellen Geltung im Sinn der empirischen Postulate aber bei Kant niemals<br />
selbst in Frage, zumal das Prädikat als analytisches Prädikat des<br />
Subjektbegriffes vorgestellt worden ist. Insofern wird mit der Aufhebung<br />
des Urteils, so wie Kant diese Aufhebung anstellt, nicht die innere<br />
Möglichkeit des Begriffs aufgehoben. Das würde die Aufhebung des<br />
Urteils aus Gründen innerer Widersprüchlichkeit oder eines anderen<br />
Grundes, der die Unmöglichkeit der Wahrheit dieses Satzes angibt,<br />
verlangen. — Das Ding des Begriffes vom absolutnotwendigen Wesens ist<br />
aber weder ein empirischer noch geometrischer Gegenstand, und die<br />
Umstände seiner objektiven Geltung können eben weder unter eine<br />
Zeitbedingung noch unter einen Konstruktionszweck in reiner<br />
Anschauung fallen. Insofern wird hier aus rein formalen Gründen der<br />
logischen Form eine logische Operation ohne kategoriale Bedeutung<br />
durchgeführt, was Sinnlosigkeit ergibt, weil jede Beziehung auf einen<br />
möglichen Gegenstand verloren geht. Es ist zwar nicht denkunmöglich,<br />
aber sinnlos, eine Aussage über Gott gemäß einer Formel, die für lokale<br />
Geltung oder Nichtgeltung konzipiert war, aufzuheben. — Zu einer<br />
ähnlichen Überlegung kommt Kant im nächsten Absatz: »Wider alle diese<br />
allgemeinen Schlüsse (deren sich kein Mensch weigern kann) fordert ihr<br />
mich durch einen Fall auf, den ihr, als einen Beweis durch die Tat,<br />
aufstellet: daß es doch einen und zwar nur diesen Einen Begriff gebe, da<br />
das Nichtsein oder Aufheben seines Gegenstandes in sich selbst<br />
widersprechend sei, und dieses ist der Begriff des allerrealsten Wesens. Es<br />
hat, sagt ihr, alle Realität, und ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als<br />
möglich anzunehmen, (welches ich vorjetzt einwillige, obgleich der sich<br />
nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des<br />
Gegenstandes beweist). Nun ist unter aller Realität auch das Dasein mit<br />
begriffen; Also liegt das Dasein in dem Begriffe von einem Möglichen.<br />
Wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des<br />
Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist.« (B 624/A 596)
— 1124 —<br />
Das scheint mir nicht sehr klar ausgedrückt zu sein. Grundsätzlich geht es<br />
darum, daß im Begriff vom allerrealsten Wesen notwendigerweise<br />
Existenz enthalten sein muß; wird also dieser Begriff aufgehoben, müßte<br />
auch die Existenz als dessen analytisches Prädikat aufgehoben worden<br />
sein. Nun wurde in den möglichen Beispielen niemals der Begriff<br />
aufgehoben, was in der Tat die innere Möglichkeit des Begriffes betreffen<br />
würde, sondern eben nur seine aktuelle Geltung, aber nicht seine<br />
subjektive, bloß der Idee von einer absoluten Notwendigkeit nicht<br />
widersprechende Geltung schlechthin. Seine innere Möglichkeit wird also<br />
gar nicht betroffen. Hier jedoch müßte, wenn der Begriff vom allerrealsten<br />
Wesen aufgehoben würde, es seiner inneren Möglichkeit widersprechen;<br />
und zwar weil das allerrealste Wesen auch die Existenz zum analytisch<br />
notwendigen Prädikat besäße, was erst die Aufhebung logisch im<br />
Gegensatz zu Begriffen kontingenter Wesenheiten zu einem Widerspruch<br />
machen würde. Das ist nun ausdrücklich nicht der Fall, denn das<br />
Existenzprädikat bezieht sich immer nur auf Vorstellungen, insofern auch<br />
auf die analytischen Merkmale des Begriffs vom absolutnotwendigen<br />
Wesen oder auf die Vorstellung vom absolutnotwendigen Wesen selbst als<br />
Teilbegriff. Kant hält die Denkmöglichkeit der Existenz eines absolut<br />
notwendigen Wesens zu sehr zurück, um das Argument der<br />
transzendentalen Kritik vollständig zustande zu bringen: Dieses hätte<br />
erstens die Frage zu beantworten, von wo diese Merkmale und<br />
Vorstellungen vom Wesen Gottes herkommen, und inwieweit diese reine<br />
Vernunftideen genannt werden können. Zweitens inwieweit ein solches<br />
Wesen in einer zusammenhängenden Erfahrung vorkommen könne.<br />
Drittens kann das Existenzprädikat transzendentallogisch eben auch im<br />
Rahmen der theologischen Idee nicht wie eine Qualität der inhaltlichen<br />
Bestimmung eines Begriffs im Urteil betrachtet werden. — Die Antwort<br />
Kants ist deutlicher als der oben exponierte Entwurf:<br />
»Ich antworte: Ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn ihr in<br />
den Begriff eines Dinges, welches ihr lediglich seiner Möglichkeit nach<br />
denken wolltet, es sei unter welchem versteckten Namen, schon den<br />
Begriff seiner Existenz hineinbrachtet. Räumet man euch das ein, so habt<br />
ihr dem Scheine nach gewonnen Spiel, in der Tat aber nichts gesagt; denn<br />
ihr habt eine bloße Tautologie begangen. Ich frage euch, ist der Satz: dieses<br />
oder jenes Ding (welches ich euch als möglich einräume, es mag sein,<br />
welches es wolle,) existiert, ist, sage ich, dieser Satz ein analytischer oder<br />
synthetischer Satz? [...] Wenn er das erstere ist, so tut ihr durch das Dasein
— 1125 —<br />
des Dinges zu eurem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu, aber alsdenn<br />
müßte entweder der Gedanke, der in euch ist, das Ding selber sein, oder<br />
ihr habt ein Dasein, als zur Möglichkeit gehörig, vorausgesetzt, und<br />
alsdenn das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit<br />
geschlossen, was nichts als eine elende Tautologie ist.« (B 625/A 597)<br />
Das Für-wahr-halten eines Satzes oder Begriffes schließt die kategoriale<br />
Möglichkeit von assertorisch zugänglicher Wirklichkeit oder sonstiger<br />
Geltungsbedingungen mit ein, auch wenn er gerade nicht gilt oder nicht<br />
angewendet werden kann. Die Merkmale von Allgemeinbegriffen gelten<br />
hingegen empirisch oder aus einem Konzept oder Theorie über Teile der<br />
Natur oder der Mathematik notwendig oder mit dem hypothetischen<br />
Anspruch auf Notwendigkeit. Hier wird ebenfalls mit einem Begriff von<br />
etwas eine mögliche Wirklichkeit oder aktuelle Geltung gesetzt. Allerdings<br />
sind diese Verhältnisse sowohl hinsichtlich der universiellen kategorialen<br />
Bestimmbarkeit von objektiver Realität wie der besonderen und auf den<br />
Einzelfall konkretisierbaren Allgemeinbegriffe auf empirische, d. h. hier<br />
sinnliche Erfahrung bezogen, während diese Verhandlung über den<br />
Begriff vom absolutnotwendigen Wesen geführt wird, dessen einzige<br />
Assertion schon in der bloßen Denkmöglichkeit selbst liegen können muß.<br />
Jedoch lädt Kant zu diesem Mißverstand durch die Vermengung ein, die<br />
geschehen muß, wenn man seiner Aufforderung folge leistet: »Ich frage<br />
euch, ist der Satz: dieses oder jenes Ding (welches ich euch als möglich<br />
einräume, es mag sein, welches es wolle,) existiert, ist, sage ich, dieser Satz<br />
ein analytischer oder synthetischer Satz?« Es interessiert zunächst nur der<br />
Klammerausdruck: Ist diese Einräumung willkürlich und Grund für die<br />
Vermengung von empirischen, reinen und nur gedachten Gegenständen?<br />
»Dieses oder jenes Ding« läßt an Beliebigkeit nichts zu wünschen übrig.<br />
Kant sucht hier mit abstrakt bleibender Totalität die Behauptung der<br />
Gegenposition zu unterlaufen, der Begriff von einem allerrealsten Wesen<br />
sei eben nicht wie ein Konzept von einem Ding, dessen Erscheinungen<br />
kontinuierlich in Zeit und Raum gegeben werden können, zu behandeln.<br />
Da nun jedoch ein Satz, auch wenn er vom allerrealsten Wesen handelt,<br />
nach logischen Gesichtspunkten behandelt werden kann, spricht von<br />
dieser Seite nichts gegen die Aufheblichkeit. Der Anspruch, die<br />
widerspruchsfreie Aufheblichkeit der aktuellen assertorischen Geltung<br />
eines jeden Satzes, mit dessen Behauptung eine Existenzbehauptung<br />
verbunden ist, auf den Begriff vom allerrealsten Wesen auszudehnen, ist<br />
vielleicht neu zu bewerten, wenn die Überlegung herangezogen wird, daß
— 1126 —<br />
erst die dialektische Überbeanspruchung des disjunktiven Urteils zur<br />
konjunktiven Totalität der entschränkten Allheit möglicher Prädikate eines<br />
Dinges außer jeder Zeit geführt hat. Das aber ist die Folie für eine Folge<br />
von Übersteigerungen, die ab dem expliziten Wesensbegriff des<br />
transzendentalen Ideals notwendig dialektisch werden, und nach dem<br />
transzendentalen Obersatz als disjunktive und vollständige<br />
Durchbestimmung des ens realissimum im prototypon transcendentale als<br />
existierendes Urbild einen ästhetischen Neuansatz des Wesensbegriffes<br />
bringt und zur Vorstellung des ens necessearium führt, worin dann die<br />
Vorstellung vom ens originarium, entium und summum als die stärkste<br />
Fassung der theologischen Idee fundiert sein soll. Das aber bestätigt<br />
strukturell die theologische Idee, ohne einen transzendentalen<br />
Gottesbeweis zuzulassen, sodaß die Aufheblichkeit nicht nur mehr<br />
Angelegenheit eines Gottesbeweises ist, sondern (wenngleich spekulativ)<br />
die reinen Vernunftideen in ihrer Notwendigkeit überhaupt betrifft. Die<br />
Eigentümlichkeit der dritten Vernunftidee liegt darin, daß nicht einmal<br />
ihre objektive Gültigkeit als heuristisches Prinzip im entscheidenden<br />
Abschnitt bewiesen werden kann, aber, unzureichend begründet, die<br />
absolutnotwendige Existenz des allerrealsten Wesens behauptet wird,<br />
obwohl Kant andernorts bereits angezeigt hat, daß der Inbegriff vom<br />
Allerrealsten gar nicht zur Charakteristik des absolutnotwendigen Wesen<br />
tauglich ist.<br />
6. Das allerrealste Wesen und das absolut notwendige Wesen.<br />
Das Existenzprädikat als analytisches und als synthetisches Prädikat in<br />
Hinblick auf rationale Metaphysik und Naturwissenschaft<br />
Die Eigentümlichkeit des Begriffs vom allerrealsten Wesen, das<br />
Existenzprädikat analytisch im Begriff zu enthalten, sodaß die Aufhebung<br />
der Existenz der inneren Möglichkeit des Begriffes widerspricht, würde<br />
dem Kriterium der Einzigkeit entsprechen, doch Kant besteht darauf, diese<br />
Eigenschaft den Begriffen aller möglichen beliebigen Dinge als mögliche<br />
Position des Existenzprädikates zuzuschreiben, von welchen grundsätzlich<br />
durchgängige Bestimmbarkeit mittels Prädikate behauptet werden kann.<br />
Diese Totalität der Versammlung aller möglichen Prädikate soll für jedes<br />
Ding das Existenzprädikat der Position nach analytisch enthalten, und<br />
durch die Opposition von Wahrheit und Falschheit entgegengesetzter<br />
Prädikate im transzendentalen Vergleich zum besonderen und
— 1127 —<br />
existierenden Ding weiterbestimmt werden können. Durch den<br />
transzendentalen Vergleich wird die Unterscheidung, ob es so ist, und ob<br />
es jetzt so ist, hinfällig, und real mögliche Begriffe werden als Urteile über<br />
das Sosein von Existenz behandelt, gleich, ob eine aktuelle Assertion<br />
vorliegt oder nicht. Dann aber ist auch die Unterscheidung hinfällig, die<br />
zwischen dem analytischen Existenzprädikat der Position der Möglichkeit<br />
nach und dem aktuell assertorisch geltenden Existenzprädikat gemacht<br />
wurde.<br />
Trotzdem stellt sich nochmals die Frage, inwieweit diese Begriffe noch als<br />
aufheblich bezeichnet werden können, wenn die durchgängige<br />
Bestimmung eines Dinges anhand der transzendentalen Vergleichung mit<br />
allen möglichen Prädikaten eines Dinges überhaupt das Existenzprädikat<br />
bereits analytisch enthalten soll. Nun wurde nicht nur die Aufheblichkeit<br />
der Begriffe der inneren Möglichkeit nach behauptet, sondern in einer<br />
Variante der Diskussion nur, daß sie hier und jetzt nicht gelten. Was aber<br />
unterscheidet dann den Begriff vom allerrealsten Wesen vom Begriff eines<br />
jeden anderen Dinges? Daß letzterer in einem Schema von Raum und Zeit<br />
gilt oder nicht gilt, ersterer kann aber nur entweder wahr oder falsch sein.<br />
Das Ding des Begriffes vom allerrealsten Wesen ist weder empirisch noch<br />
geometrisch noch algebraisch, und genau das unterscheidet die Operation<br />
der gedanklichen Aufhebung der Existenz oder Geltung von einem jeden<br />
anderen Ding: Dieses Wesen ist nicht in Zeit noch im Raum gedacht,<br />
sondern begrenzt deren kontingente Unendlichkeit oder Endlosigkeit.<br />
Dessen Aufheblichkeit soll nicht nur aus logischen Gründen unmöglich<br />
sein.<br />
Ist der Begriff vom allerrealsten Wesen nun gerade dadurch gegenüber<br />
anderen bloß wegen der Widerspruchsfreiheit denkmöglicher Begriffe<br />
ausgezeichnet, weil seine Aufheblichkeit einen inneren Widerspruch<br />
herruft? Da aber die Frage der objektiven Geltung des Begriffes vom<br />
allerrealsten Wesen nicht entschieden werden kann, weil weder die Art<br />
und Weisen des Gegebenseins noch ein Zusammenhang der Erfahrung<br />
postuliert werden kann, müßte der Begriff wieder aufheblich sein. Könnte<br />
die Existenz des selbst unendlichen und deshalb absolutnotwendigen<br />
Wesens anhand des allerrealsten Wesen (oder wie Thomas meint, aus der<br />
empirischen Erfahrung) bewiesen werden, dann freilich wäre die Geltung<br />
seines Begriffs wie die Existenz seines Dinges unaufheblich, obgleich ohne<br />
Erscheinungen dessen transzendentaler Beweis nicht möglich ist, während<br />
die analytische Notwendigkeit, das Existenzprädikat zu enthalten, für die
— 1128 —<br />
Begriffe aller anderen Dinge zwar das gleiche tut, aber das was die<br />
analytische Notwendigkeit, das Existenzprädikat zu enthalten, auch zu<br />
leisten vorgibt, einfach nicht ausreicht, die Stellung des Dinges in Zeit und<br />
Raum zu bestimmen. So bleibt der durchgängig an der Sphäre der<br />
Möglichkeit bestimmte Begriff vom einzelnen Ding dem Anspruch nach<br />
analytisch mit Existenz verbunden, aber vermag den Ort in Raum und Zeit<br />
nicht anzugeben, sodaß eben ein solcher Begriff streng genommen auch<br />
nur der Möglichkeit nach das Existenzprädikat enthält. Für die Vorstellung<br />
von Existenz des Dinges des Begriffs vom allerrealsten Wesen wird aber<br />
diese Bestimmung nicht verlangt, da ein solches Ding nicht in Zeit und<br />
Raum existieren würde. Es spricht nichts dagegen, das<br />
Gedankenexperiment zu machen, und den fraglichen Beweis als geglückt<br />
voraussetzen: Außer an Beobachtungen wie strenge Determiniertheit und<br />
dergleichen wäre nichts zu bemerken; keineswegs wäre man der<br />
Beantwortung der Frage, wie und nach welchen Gründen das unendliche<br />
Wesen dieses oder jenes bewirkt oder schon von Anbeginn an in Gang<br />
gesetzt hat, auch nur näher gekommen, denn eben weil das Ding dieses<br />
Wesens außerhalb von Raum und Zeit ist, müßte es auch außerhalb jeder<br />
Möglichkeit der Erfahrung liegen. Hätte sich aus den Untersuchungen der<br />
Naturwissenschaften strenge Determiniertheit der Natur zumindest als<br />
Grundprinzip durchgezeichnet, hätten wir zwar ein Indiz als Grund<br />
gehabt, auf ein unendliches Wesen zu schließen, aber wir hätten daraus<br />
keine weiteren bestimmten Eigenschaften ableiten können. Nichts als<br />
strenge Determiniertheit aber hätte uns ohne Freiheit und Urteilskraft<br />
zurückgelassen.<br />
Ich gebe die Stelle wieder, in welcher Kant eine entgegengesetzte Haltung<br />
zu der oben behandelten Vorgangsweise einnimmt, und zwischen den<br />
Positionen des Existenzprädikates in kontingenten Dingen und im<br />
allerrealsten Wesen keinen modallogischen Unterschied feststellen will.<br />
Schließlich kommt es wieder zu der entscheidenden Frage nach der<br />
analytischen oder synthetischen Verknüpfung des Prädikats mit dem<br />
Subjekt anhand grammatikalischer Merkmale:<br />
»Das Wort: Realität, welches im Begriffe des Dinges anders klingt, als<br />
Existenz im Begriffe des Prädikats, macht es nicht aus. Denn, wenn ihr<br />
auch alles Setzen (unbestimmt was ihr setzt) Realität nennt, so habt ihr das<br />
Ding schon mit allen seinen Prädikaten im Begriffe des Subjekts gesetzt<br />
und als wirklich angenommen, und im Prädikate wiederholt ihr es nur.<br />
Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen
— 1129 —<br />
muß, daß ein jeder Existenzialsatz synthetisch sei, wie wollet ihr denn<br />
behaupten, daß das Prädikat der Existenz sich ohne Widerspruch nicht<br />
aufheben lasse? Da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren<br />
Charakter eben darauf beruht, eigentümlich zukommt.« (B 625 f./A 597 f.)<br />
Zuerst wird nicht eigentlich die Setzung eines Dinges mit allen seinen<br />
Prädikaten kritisiert, sondern die Verwechslung auf Grund des<br />
transzendentalen Scheins, diese Setzung sei schon mit einem existierenden<br />
Ding an sich selbst ident. In der praktischen oder technischwissenschaftlichen<br />
Einstellung stört das zumeist nicht weiter. Näher wird<br />
übersehen, daß das analytische Enthaltensein des Existenzprädikates nicht<br />
transzendentalen Ursprungs ist, sondern daß die Begriffe der Dinge, die<br />
als aufheblich nur gedacht werden können, weil sie als ectypa in Raum<br />
und Zeit existieren, in ihrer konkreten Bestimmbarkeit empirischen<br />
Charakter besitzen. Mit der analytischen Darstellung des<br />
Existenzprädikates in Begriffen, deren Gegenstände auch unabhängig vom<br />
aktuellen Gegebensein als reale Gegenstände gedacht und vorgestellt<br />
werden können (transzendentale Einbildungskraft) wird die<br />
Notwendigkeit nur aus formalen logischen Gründen erschwindelt; im<br />
Grunde hängt die Gültigkeit solcher Begriffe (nicht immer sofort deren<br />
Prinzipien) von den affirmativ bewährenden Erfahrungen a posteriori ab.<br />
Insofern sind solche Begriffe möglicherweise aufheblich auch aus Gründen<br />
innerer Widersprüchlichkeit, die erst anhand der Erfahrung erkennbar<br />
wird, dann aber haben sie ihren Gegenstand in dieser Hinsicht auch vorher<br />
nicht wirklich betroffen, denn in der Tat haben diese Begriffe den<br />
Anspruch zu erheben, daß, wenn sie für wahr gehalten werden, mit ihnen<br />
nicht nur unbestimmt mögliche Existenz, sondern irgendwo und<br />
irgendwann notwendige Existenz ausgedrückt wird. Wenn dieser von<br />
jeder Erkenntnis zu erhebende Anspruch verwechselt wird mit der<br />
Gewißheit a priori und die Herkunft der empirischen Erkenntnis mit der<br />
Herkunft logischer Regelerkenntnis, dann hat das jenen falschen Schein<br />
ontologischer Wahrheit an sich, die Kant kritisiert.<br />
Kant bezweifelt also, weil das Existenzprädikat nunmehr synthetisch<br />
gedacht werden muß, sich dasselbe ohne Widerspruch nicht aufheben<br />
ließe. Wenn das Existenzprädikat synthetisch gedacht werden muß (a<br />
priori), hätte das starke Folgen: Jederzeit würde es einen Widerspruch zum<br />
erwarteten Fortgang ergeben, ein existierendes und wirkliches Ding<br />
aufheben zu wollen; und gleich einen zweiten Widerspruch, weil damit<br />
das Prinzip der Konstanz des Quantums an Materie verletzt werden
— 1130 —<br />
würde. Worauf ist dann die Möglichkeit der Aufhebung der Existenz eines<br />
Dinges bzw. der Geltung sowohl von Subjekt und Prädikat »bloß in<br />
Gedanken« noch sinnvoll zu beziehen? Die Denkmöglichkeit der<br />
Aufheblichkeit kontingenter Verhältnisse, die eben nicht streng<br />
determiniert sind, entstammt dem Vergleich mit deren Gegenvorstellung<br />
einer allmächtigen ersten, selbst nicht verursachten Ursache. Das<br />
Unternehmen, deren Begriff (genauer: einen — vermutlich —<br />
äquipollenten Begriff) als auf gleiche Weise aufheblich zu denken<br />
aufzugeben, scheitert aus zwei völlig verschiedenen Gründen:<br />
Erstens verliert das Verfahren der »Aufheblichkeit« in Gedanken, der<br />
Möglichkeit nach, ihren Gegenstand der Aussage, wenn die Aufheblichkeit<br />
von kontingenten Gegenständen zwar nach der inneren Möglichkeit nach,<br />
also gemäß den Bestimmungen intrinseci, keinen Widerspruch erzeugt,<br />
aber im Commercium; und damit noch ein grundlegendes Naturgesetz<br />
(Konstanz des Quantums der Materie) verletzt.<br />
Zweitens: Wohl kann ein Gegenstand mit dem Ende der funktionalen<br />
Form des Substrats auch als solcher ein Ende finden, und in diesem Sinn<br />
ist die Nichtexistenz eines bestimmten Gegenstandes, bezogen auf den<br />
Horizont des Anwesens, eine realmögliche Vorstellung. Die Aufheblichkeit<br />
als realmögliche Vorstellung umfaßt die Möglichkeit der Zerstörung. Das<br />
alles aber würde nur nochmals alle anderen Dinge vom für uns nur<br />
denkmöglichen Ding (Substanz) des unendlichen Wesens unterscheiden,<br />
sodaß die zugestandene Denkmöglichkeit in der Tat mehr beinhaltet als<br />
bloße logische Widerspruchsfreiheit und insofern einen<br />
transzendentallogischen Gehalt in transzendentalsubjektiver Hinsicht zur<br />
Bestimmung der Dingwelt, die wir in den Erscheinungen begründet<br />
vermuten, erhalten hat. Ein komplementär aus dem Gegenteil bestimmter<br />
Gehalt der insofern mit aufgestellten Vernunfthypothese ist noch<br />
undeutlich: allerrealstes, absolutnotwendiges, höchstes oder unendliches<br />
Wesen sind Attribute, deren Verhältnisse untereinander noch gar nicht<br />
geklärt sind, sodaß im Grunde nicht einmal die innere logische<br />
Widerspruchsfreiheit des obersten Inbegriffes sicher gegeben ist. Ob diese<br />
Bestimmungen also analytische und synthetische Beziehungen<br />
untereinander besitzen oder nur synthetische Beziehungen, wie es<br />
zunächst entgegen der Einführung Kantens den Anschein hat, kann so<br />
nach wie vor nicht entschieden werden.<br />
Kant findet den Grund der Illusion in der Verwechslung der logischen mit<br />
der realen Verwendung eines Prädikats. Die sogenannte »reale«
— 1131 —<br />
Verwendung, oder das »reale« Prädikat, wie Kant sich ausdrückt, besteht<br />
darin, daß das Merkmal als Bestimmung nicht unserer Vorstellung vom<br />
Gegenstand (Erscheinung der Erscheinung) sondern des Gegenstandes als<br />
Ding an sich selbst (Erscheinung) aufgefaßt wird. Letztere Bestimmung<br />
aber »ist ein Prädikat, welches über den Begriff des Subjekts hinzukommt<br />
und ihn vergrößert. Sie muß also nicht in ihm schon enthalten sein«. (l. c.)<br />
Hier sind zwei Argumentationsstränge zu beachten: Einerseits gibt es die<br />
logische und die reale Verwendung von Prädikaten, andererseits gibt es<br />
die analytische und die synthetische Verwendung von Prädikaten. Das<br />
synthetische Prädikat kommt logisch betrachtet zum Begriff des Subjektes<br />
hinzu, und es muß das synthetische Prädikat als reales Merkmal am<br />
Gegenstand gedacht werden können. Ebenso muß natürlich auch ein<br />
analytisches Merkmal des Begriffes (logisches Prädikat) als Merkmal des<br />
Gegenstandes gedacht werden können, da aber Kant klar gemacht hat, daß<br />
Existenzialaussagen (Aussagen mit Existenzbehauptung) schon wegen der<br />
Zusammenfügung der Beurteilung von ganzem Urteilsinhalt und der<br />
Beurteilung, ob dieser Urteilsinhalt jetzt und hier zutrifft, synthetischen<br />
Charakter besitzen müssen, fließen die Gründe bei Kant ineinander. Es<br />
muß aber klar sein, daß hier von zwei verschiedene Arten von Synthesis<br />
die Rede ist, obwohl beide die Synthesis der ursprünglich-synthetischen<br />
Einheit der Apperzeption vorausgesetzt haben; so sind auch das Prädikat<br />
als Merkmalsaussageteil des Satzes und das bislang nur hypostasierte<br />
Existenzprädikat voneinander in der Logik und in der Grammatik deutlich<br />
formal zu unterscheiden: Ersteres ist als Abschnitt der Proposition<br />
darzustellen, letzteres als Negationszeichen bzw. Symbol für Falschheit<br />
oder als Symbol für Wahrheit einer ganzen Aussage.<br />
7. Reales und logisches (modales) Prädikat im Syllogismus der<br />
empirischen Postulate. Übergang von der Assertorik zur Architektonik<br />
Davon ist die Bedeutung des Wortes »ist« nochmals gesondert zu<br />
überlegen, deren grammatikalische Funktion als Kopula mit der eben<br />
behandelten spekulativen Aufhebung eines existierenden Dinges oder der<br />
In-Existenz-Setzung aus dem Begriff nichts zu tun gehabt hat.<br />
»Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas,<br />
was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könnte. Es ist bloß die<br />
Position eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst. Im
— 1132 —<br />
logischen Gebrauche ist es lediglich die Kopula eines Urteils. Der Satz:<br />
Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objekte haben: Gott und<br />
Allmacht; das Wörtchen: ist, ist nicht noch ein Prädikat oben ein, sondern<br />
nur das, was das Prädikat beziehungsweise aufs Subjekt setzt. Nehme ich<br />
nun das Subjekt (Gott) mit allen seinen Prädikaten (worunter auch die<br />
Allmacht gehöret) zusammen, und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so<br />
setze ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das<br />
Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und zwar den<br />
Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei<br />
enthalten, und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit<br />
ausdrückt, darum, daß ich dessen Gegenstand als schlechthin gegeben<br />
(durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzukommen.«<br />
(B 626 f./A 598 f.)<br />
Die besondere Schwierigkeit der theologischen Idee ist die, daß, wenn ein<br />
Begriff des unendlichen Wesens einmal gesetzt ist, es den Anschein hat, als<br />
sei dieser unaufheblich, was in der vortranszendentalphilosophischen<br />
Erörterung der rationalen Metaphysik das prototypon transcendentale von<br />
den ectypa auch verläßlich unterschieden hat. Nunmehr hat Kant in seiner<br />
Untersuchung des transzendentalen Ideals und des prototypon<br />
transcendentales die metaphysische Darstellung dortselbst bereits auf die<br />
ersten Erkenntnisse der Transzendentalphilosophie, wie sie mit der<br />
Analytik des Verstandesgebrauches und der Kritik der Vernunftideen<br />
einhergehen, entsprechend eingerichtet: Das, was in der rationalen<br />
Metaphysik nur im Rahmen der theologischen Idee, aber nicht für<br />
Kontingenz gegolten hat, gilt nunmehr — freilich eben nur der<br />
Möglichkeit nach — für den Dingbegriff als solchen, während der Inbegriff<br />
der theologischen Idee, sowohl was die Auffindung eines Attributes<br />
überhaupt, der möglichen Verknüpfung der Attribute überhaupt, wie<br />
letztlich, was die Assertion (Art des Gegebenseins) angeht, nach dieser<br />
Depotenzierung zu verfallen beginnt.<br />
Es muß getrachtet werden, in die Position vor der Setzung zu gelangen,<br />
dann ist leicht einzusehen, wie der Schein entsteht, und weshalb er, aus<br />
subjektiven Gründen der Vernunft abgeleitet, nur von einer Seite besehen<br />
so zwingend sein kann, obwohl er falscher Schein sein muß. Da nun das<br />
Sein kein reales Prädikat sein kann, also kein eigenes Merkmal besitzt,<br />
kann sich das Existenzprädikat, von dem nur mehr eine logische<br />
Verwendung möglich ist, nicht auf Dinge an sich selbst beziehen, sondern<br />
hat Vorstellungen von diesen Dingen zum einzig möglichen Gegenstand.
— 1133 —<br />
Die Setzung außer dem Begriff kann sich nun nur auf Merkmale beziehen,<br />
die als Prädikate auch real, d. i. nunmehr nur in der zusammenhängenden<br />
Erfahrung verwendet werden können und hat auch selbst immer nur<br />
hypothetische Notwendigkeit, selbst wenn der Begriff selbst a priori<br />
bestimmt sein sollte. Die bloße Hinzufügung logischer Prädikate, die als<br />
Prädikate von Verhältnisrelationen zwischen Merkmalen des selben oder<br />
eines anderen Gegenstandes oder schließlich als Prädikate der Prädikate<br />
deren objektive Geltung als Merkmale an einem wirklichen Gegenstand<br />
behaupten respektive implizite voraussetzen, ohne daß der reale Gebrauch<br />
der Prädikate auch wirklich aktuell möglich ist, das ist der Irrtum, der<br />
immerhin möglich ist. Wenn aber die reale Verwendung von Prädikaten<br />
gar nicht möglich ist, nicht weil es sich um ein reines Existenzprädikat<br />
handelte, das nur auf Vorstellungen, nicht auf die Dinge an sich selbst<br />
bezogen werden kann, sondern weil das Ding eines unendlichen Wesens<br />
nicht in Zeit und Raum existiert, dann handelt es sich nicht um einen Pfad<br />
der Wissenschaft, auf welchen man vor und nach einer ausgebildeten<br />
Theorie auch irren kann, wenn man die Umstände des jeweiligen<br />
Einzelfalles nicht berücksichtigt, sondern um ein Unternehmen, dessen<br />
scheitern gewiß sein müßte.<br />
Kant geht noch einen Schritt weiter, indem er überlegt, wie die<br />
Verhältnisse aussehen müßten, wenn die logischen Prädikate auch als<br />
reale Prädikate gerbraucht werden könnten:<br />
»Denke ich mir auch sogar in einem Dinge alle Realität außer einer, so<br />
kommt dadurch, daß ich sage, ein solches mangelhaftes Ding existiert, die<br />
fehlende Realität nicht hinzu, sondern es existiert gerade mit demselben<br />
Mangel behaftet, als ich es gedacht habe, sonst würde etwas anderes, als<br />
ich dachte, existieren. Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität<br />
(ohne Mangel), so bleibt noch immer die Frage, ob es existiere, oder nicht.<br />
Denn, obgleich an meinen Begriffe, von dem möglichen realen Dinge<br />
überhaupt, nichts fehlt, so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu<br />
meinem ganzen Zustande des Denkens, nämlich daß die Erkenntnis jenes<br />
Objekts auch a posteriori möglich sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache<br />
der hierbei obwaltenden Schwierigkeit. Wäre von einem Gegenstand der<br />
Sinne die Rede, so würde ich die Existenz des Dinges mit dem bloßen<br />
Begriff des Dinges nicht verwechseln können. [1] Denn durch den Begriff<br />
wird nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empirischen<br />
Erkenntnis überhaupt als einstimmig, durch die Existenz aber als in dem<br />
Kontext der gesamten Erfahrung enthalten gedacht; da denn durch die
— 1134 —<br />
Verknüpfung mit dem Inhalte der gesamten Erfahrung der Begriff vom<br />
Gegenstande nicht im mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch<br />
denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. [2] Wollen wir<br />
dagegen die Existenz durch die reine Kategorie denken, so ist kein<br />
Wunder, daß wir kein Merkmal angeben können, sie von der bloßen<br />
Möglichkeit zu unterscheiden. [3]«<br />
Der erste Punkt ist nach dem vorhin ausgeführten durchaus klar und<br />
deutlich. Der dritte Punkt argumentiert in die richtige Richtung; nur<br />
handelt es sich hier um die transzendentale Untersuchung einer<br />
Vernunftidee, sodaß die Anwendung auch der reinen Kategorie eben ein<br />
Kategorienfehler darstellen würde. Allenfalls kann von einer reinen (nicht<br />
transzendentalen) Analogie zur reinen Kategorie die Rede sein. Aus einer<br />
Vernunftidee überhaupt einen Beweis für Existenz ziehen zu wollen, ist<br />
eben schon der transzendentallogische Irrtum. Erst die Erläuterung, die ich<br />
als zweiten Punkt zusammengenommen habe, führt auf einige<br />
Schwierigkeiten. Kant kommt hier wieder auf das Problem zu sprechen,<br />
das ihm die Einschätzung der Sphäre möglicher Prädikate eines Dinges<br />
überhaupt, was Allheit ergibt, bereitet, die einerseits aus dem Vergleich<br />
des unechten logischen Kontinuums der Vielheit möglicher Merkmale<br />
überhaupt mit der Idee der nur möglichen Totalität der Prädikate von<br />
Erfahrung eines besonderen Dinges (der selben Art von Ding),<br />
andererseits aus dem transzendentalen Vergleich der möglichen Prädikate<br />
desselben Dinges als Totalität möglicher Erfahrung mit dem ens<br />
realissimum oder omnitudo realitatis erst näher bestimmt wird. Zunächst<br />
wird ihm das Außer dem Begriff setzen zum Problem, obwohl Kant doch<br />
mit der Definition einer wesentlichen Funktion der transzendentalen<br />
Einbildungskraft außer Streit gestellt zu haben scheint, daß mit Hilfe der<br />
transzendentalen Einbildungskraft der Begriff den Erscheinungen ihren<br />
transzendentalen Gegenstand erst gibt; die Vorstellbarkeit eines<br />
Gegenstandes der Erfahrung ohne seine Anwesenheit gibt Kant teils als<br />
analytisch deduktiven Beweis aus der transzendentalen Psychologie, teils<br />
als empirisch für jedermann nachvollziehbare innere Handlung unserer<br />
intellektuellen Gemüt, schließlich aus der regulativen Vernunfteinheit der<br />
Betrachtung der Natur formaliter und materialiter spectata. Das Problem<br />
dürfte darin bestehen, daß Kant hier nicht deutlich genug die<br />
systematische Beziehung zu erkennen gibt, in welcher seine Kritik an den<br />
scholastisch-vernünftelnden Kollegen steht, welche dieses »Außer-den-<br />
Begriff-Setzen« eigentlich für Abstraktionen komparativer
— 1135 —<br />
Allgemeinbegriffe der empirischen Bestimmbarkeit gebrauchen, und dabei<br />
glaubten, ontologische Urteile a priori zu fällen: Es handelt sich um die<br />
Verknüpfungsform einerseits der transzendentalen Einbildungskraft in der<br />
Vorstellung eines nicht anwesenden Gegenstandes als wirklich<br />
(transzendentale synthesis speciosa), andererseits mit dem ersten Prinzip<br />
der durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels Prädikate als<br />
heuristisches Prinzip (synthesis intellectualis). Weiter oben konnte gezeigt<br />
werden, daß ein analytisch enthaltenes Existenzprädikat nur eine<br />
intellektuelle Stelle für mögliche Existenz offen halten kann; ob diese<br />
Erkenntnis bedingende Möglichkeit mittels naturwissenschaftlichen Sätzen<br />
oder mittels transzendentalen Bedingungen des Gegebenseins und der<br />
Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis überhaupt hergestellt wird, war<br />
zunächst hier noch gar nicht entscheidend. Für die transzendentale<br />
Analytik wie für die Naturwissenschaft ist aber für ihre Argumentation<br />
entscheidend zu wissen, woher jeweils ihre Argumente kommen. Diese<br />
Unterscheidung ist aber vor (oder unabhängig von) dieser Spezialisierung<br />
und Gegenüberstellung noch die der Einheit in der Komplementarität<br />
möglicher Auflösungen des analytisch gedachten Existenzprädikats. Kants<br />
Leistung liegt hier in der Verschränkung der Unterscheidung von<br />
analytischen und synthetischen Urteilen und der Unterscheidung in<br />
logische und reale Verwendung eines Prädikats mit der Unterscheidung<br />
von logischem Vergleich der Prädikate und transzendentalem Vergleich<br />
des Allgemein- oder logischen Wesensbegriffes. Bemerkenswert die<br />
Aufnahme eines vergleichbar naiven Ausdrucks wie »reales Prädikat«; das<br />
wird wohl eine gewisse Ambivalenz zwischen dem Gegenstand unserer<br />
Erscheinungen der Sinnlichkeit (aufgeklärter Realist in transzendentaler<br />
Hinsicht) und der metaphysischen Analogien zum Ding an sich selbst<br />
andeuten, die völlig hinter sich zu lassen eine weitere Untersuchung der<br />
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis zugleich<br />
verunmöglichen würde, und mit dem strikten transzendentalen<br />
Idealismus das auslangen finden müßte.<br />
Das ist in etwa der Hintergrund der Schwierigkeit in der Behauptung:<br />
»Denn durch den Begriff nur mit den allgemeinen Bedingungen einer<br />
möglichen empirischen Erkenntnis überhaupt als einstimmig, durch die<br />
Existenz aber als in dem Kontext der gesamten Erfahrung enthalten<br />
gedacht; da denn durch die Verknüpfung mit dem Inhalte der gesamten<br />
Erfahrung der Begriff vom Gegenstande nicht im mindesten vermehrt<br />
wird, unser Denken aber durch denselben eine mögliche Wahrnehmung
— 1136 —<br />
mehr bekommt.« Kant beginnt mit dem Schema der Argumentation aus<br />
den empirischen Postulaten: Die Einstimmigkeit wird vom ersten Postulat<br />
ausgedrückt, die durch die Existenz (in primärer Intentionalität die<br />
Sinnlichkeit — zweites Postulat) in dem Kontext der gesamten Erfahrung<br />
enthalten gedacht wird, was das dritte Postulat ergibt. Dazu ist zu<br />
bemerken, daß die »gesamte Erfahrung« nach der Kritik am Anspruch der<br />
Totalität der vergangen gesetzten Zeit nur eine regulative Idee ist, und<br />
selbst nichts mit der Kontinuitätshypothese der sinnlichen Erfahrung in<br />
den dynamischen Kategorien zu tun hat.<br />
Dann verheddert sich Kant im syllogistischen Aufbau der Argumentation<br />
und setzt damit den Anspruch auf Totalität wieder in Kraft. Der Satz: »Der<br />
Begriff vom Gegenstand werde dadurch nicht im mindesten vermehrt«<br />
stattet das erste empirische Postulat mit einer formalen Perfektibilität aus,<br />
die es nicht besitzen kann, was umgehend mit dem zweiten empirischen<br />
Postulat bestätigt zu werden scheint: »unser Denken aber durch denselben<br />
eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt«. Diese Erweiterung der<br />
Wahrnehmung (zweifellos ein gegebener, nicht im Begriff enthaltener<br />
Inhalt) betrifft aber nicht den Begriff vom Gegenstand? Nach dieser<br />
analytischen Kurzdarstellung der empirischen Postulate scheint ein<br />
synthetisches Urteil überhaupt von der syllogistischen Aufstellung<br />
unterdrückt zu werden, also noch weniger ein synthetisches Urteil a priori<br />
zur Bestimmung einer Relation daseiender Dinge benötigt zu werden;<br />
allein zur Rechtfertigung des reinen Existenzprädikates mittels der<br />
Assertion im zweiten empirischen Postulat wird hier wieder ein<br />
synthetisches Urteil benötigt. Ich halte das im allgemeinen für eine<br />
Demonstration Kants, wie metaphysische Sätze von der<br />
Transzendentalphilosophie, anhand der synthetischen Urteile a priori im<br />
empirischen und im geometrischen Verstandesgebrauch gerechtfertigt, als<br />
deren Konsequenz interpretiert werden können, um die Vollständigkeit<br />
der transzendentalen Analyse an eben diesen nach architektonischen<br />
Gesichtspunkten ausgewählten metaphysischen Sätze zu zeigen. Nunmehr<br />
scheint Kant dem transzendentalen Schein dieses Moments aufzusitzen<br />
und die Transzendentalphilosophie selbst dogmatisch nehmen zu wollen,<br />
während der dogmatische Gebrauch der Verstandesbegriffe nur<br />
gegenüber der Sinnlichkeit gilt. Die Kategorien sind Titel deren<br />
synthetischer Grundsätze a priori, nicht der empirische Begriff eines<br />
Gegenstandes der Erscheinung in komparativer Allgemeinheit, und auch<br />
nicht Prinzipien a parte priori der einzelnen Erfahrungswissenschaften. —
— 1137 —<br />
Die Wendung, daß dadurch unser Denken eine mögliche Wahrnehmung<br />
mehr bekommt, könnte also bedeuten,<br />
(a) daß unsere sinnliche Wahrnehmung den Allgemeinbegriff zum<br />
Einzelfall auch qualitativ ergänzt<br />
(b) daß Kant sich an dieser Stelle an die allgemeine Ähnlichkeit von<br />
Kategorie und Vernunftbegriff hinsichtlich ihrer heuristischen Funktion<br />
erinnert hat und die selbst affirmative Bewährung die Aussage ist<br />
(c) daß die Erfahrung mit Empirie, also Erfahrung im Umgang mit<br />
Verstandesprinzipien und Vernunftprinzipien wie mit Prinzipien a parte<br />
priori in der Organisation sinnlicher Erfahrungsbegriffe die weitere<br />
mögliche »Wahrnehmung« ist.<br />
Letzteres klingt im vorhergehenden Textverlauf kurz an, scheint mir aber<br />
hier wenig wahrscheinlich zu sein (auch spricht der Ausdruck<br />
»Wahrnehmung« nicht dafür), zweiteres ist wegen der mangelnen<br />
Unterscheidung in Quantität, Qualität, Relation und »logisch« reiner<br />
Modalität für die Konfusion mit verantwortlich, und ersteres ist direkt<br />
ausgeschlossen worden: »Da denn durch die Verknüpfung mit dem<br />
Inhalte der gesamten Erfahrung der Begriff vom Gegenstande nicht im<br />
mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch denselben eine<br />
mögliche Wahrnehmung mehr bekommt«(B 628 f./A 600 f.). Das aber ist<br />
zu wenig, denn Erfahrungserkenntnis kann nunmehr — neben der<br />
Vermehrung der Allgemeinbegrifffe und auch ohne der Vermehrung des<br />
Merkmalumfangs der Allgemeinbegriffe — nur mehr mit der Ausbildung<br />
von Relationsbegriffe möglich sein. Das verschiebt auch die Adresse, an<br />
welche Modalbegriffe zugestellt werden können. Kant hat in diesem<br />
Zusammenhang in der Tat immer wieder Schwierigkeiten, die<br />
Konsequenzen seiner Untersuchungen in jedem Fall klar und deutlich<br />
auseinanderzuhalten.<br />
Im letzten Satz »Wollen wir dagegen die Existenz durch die reine<br />
Kategorie denken, so ist kein Wunder, daß wir kein Merkmal angeben<br />
können, sie von der bloßen Möglichkeit zu unterscheiden« könnte man<br />
noch versuchen, die als empirische Postulate identifizierte Argumentation<br />
als reine Modalitätskategorien zu verstehen, was bekanntlich aber nicht<br />
alle Probleme lösen, vielmehr wegen der Abwesenheit eines qualitativen<br />
Merkmals noch mehr Probleme in der Frage der Weiterbildung der<br />
Koordination zur Wechselwirkung und zum Relationsbegriff schaffen<br />
würde. Man nähert sich hier dem Zentrum der Erörterung der<br />
ursprünglichen Quaeitas (Quantum und Modalität), und dem limitierten
— 1138 —<br />
Urteil. Hier ist die Assertion formal-unbestimmt als Beziehung der<br />
Qualität (Inhalt) einerseits zum Quantum, andererseits zur Modalität zu<br />
denken; reine modale (»logische«) Prädikate hingegen beinhalten als<br />
Begriff selbst betrachtet, nur eine reine inhaltslose Existenzbehauptung, die<br />
als »höherstufige« Prädikate nur auf Vorstellungen von Merkmale des<br />
Begriffs oder einer damit verbundenen Vorstellung eines wirklichen<br />
Objekts bezogen werden können. Die erste Formulierung der Beziehung<br />
zwischen Qualität, Quantum und Modalität im Rahmen des Konzepts der<br />
Quaeitas bedarf keines Begriffes von einem wirklichen Objekt (besitzt<br />
demnach auch keinen Teilbegriff); in der zweiten Formulierung fallen die<br />
Bedeutungen von Qualität, Quantum und Modalität wegen der Totalität<br />
der Abstraktion auf die oberste und unbedingte Ursache (reine Existenz:<br />
existificans) in eins zusammen, sodaß das Problem der empirischen<br />
Limitation erst gar nicht auftritt.<br />
Kant hält den Begriff eines höchsten Wesens »für eine in mancher Hinsicht<br />
sehr nützliche Idee«, und er dürfte recht behalten, denn trotz der<br />
Auflösung des Geltungsproblems durch den Nachweis der zureichenden<br />
Indifferenz möglicher Argumentationen auch nur für ihre objektive<br />
Geltung, erfährt man hier einiges über die architektonische Systematik.<br />
Kant schreibt zwar: »Sie [die Idee eines höchsten Wesens] ist eben darum,<br />
weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig, um vermittelst ihrer allein unsere<br />
Erkenntnis in Ansehung dessen, was existiert, zu erweitern. Sie vermag<br />
nicht einmal soviel, daß sie uns in Ansehung der Möglichkeit eines<br />
Mehreren belehrte« (B 629 f/A 601 f). Doch gesteht er zu, daß »das<br />
analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, daß bloße<br />
Positionen (Realitäten) keinen Widerspruch erzeugt« zwar zur<br />
Vermehrung der Wahrnehmungen führt, aber keine Vermehrung der<br />
Erkenntnisse gegebener Gegenstände mit sich bringt (B 628 f./A 600 f.).<br />
Dies ist deutlich als Affirmation, oder auch als Bewährung zu verstehen<br />
möglich, ohne auf neue Qualitäten oder Relationen kommen zu müssen.<br />
Jedoch sollen auch noch die Erkenntnisse über die Prinzipienlehre<br />
methodischer Naturerkenntnisse vermehrt werden können. Hier vermengt<br />
Kant noch den Begriff Realität im empirischen Sinne thomistischer<br />
Wirklichkeit, von wo der ontologische Gottesbeweis seinen Ausgang auch<br />
bei Anselm seinen Ausgang nimmt, mit der immer noch denkmöglichen<br />
rein intelligiblen Seinweise des Dings des Begriffes vom allerrealsten<br />
Wesen, was aber unter der einfachen und ursprünglichen Unterscheidung<br />
(aber nicht Trennung) in subjektive und objektive Realität unseres Daseins
— 1139 —<br />
auch die Definition des transzendentalen Ideals als »Idee und oberste<br />
materiale Bedingung« (hier eben im Sinne der anselmschen Entscheidung<br />
im disjunktiven Obersatzes seines ontologischen Gottesbeweises zu<br />
verstehen möglich) schwach erfüllen kann. So bliebe der starken<br />
Interpretation der theologischen Idee selbst kein eigener Seinsgrund und<br />
kein eigener Erkenntnisgrund als Vernunftgrund a priori übrig, doch aber<br />
einen Grund für deren architektonische Stellung: Insofern scheint<br />
zumindest die Einteilung der Ideenlehre des transzendentalen<br />
Subjektivismus in psychologische, kosmologische und theologische Idee<br />
als rein von sinnlicher Erfahrung und von a priori Geltung zu sein. So zeigt<br />
die genaue Beobachtung, daß noch andere als theologische Gründe für die<br />
dritte reine Vernunftidee aufzufinden sein müssen, die selbst mit der<br />
ursprünglichen ontotheologischen Fragestellung gar nichts mehr zu tun<br />
haben dürften: Vor allem ist hier der genetische Aspekt zu bedenken, der<br />
darin zu sehen ist, als daß in der theologischen Idee mit (a) dem Ideal der<br />
Durchbestimmung eines Dinges mittels dem logischen Vergleich der<br />
Prädikate mit der Allheit möglicher Prädikate eines Dinges, (b) dem Ideal<br />
der reinen Vernunft als Allgemeinheit eines Begriffes vom einzelnen<br />
Gegenstand, (c) dem transzendentalen Ideal als expliziter und für ein sich<br />
selbst und die Welt verstehendes Wesen notwendig (nicht unbedingt als<br />
absolutnotwendig) existierender Wesensbegriff und (d) dem prototypon<br />
transcendentale als Neuansatz und ästhetische Vereinfachung zum absolut<br />
notwendig existerenden Urbild und ens originarium Vernunftideen<br />
angemessen werden, die sich auf Gegenstände beziehen, obgleich nicht<br />
alle Vernunftideen gleichermaßen (unter pragmatischen Umständen:<br />
regulativer Gebrauch, unter idealen Umständen: spekulativer Gebrauch)<br />
als dialektisch kritisiert werden können. Dergleichen Beziehbarkeit von<br />
Ideen auf Gegenstände findet sich auch in den »vorkritischen« Schriften<br />
Kants zu rein modallogischen Untersuchungen aus der rationalen<br />
Metaphysik (Verstandesmetaphysik), vorwiegend im Rahmen der<br />
Überlegungen zur Totalität (das Ganze) des Sinnlichen und des Denkens,<br />
die erst gemeinsam, gleichsam syllogistisch erzwungen, zu einem<br />
apodiktischen Urteil über objektive Realität befähigen können sollten.<br />
Damit ist auch die vorgängige Vernunft, die einer kritischen<br />
transzendentalanalytischen oder überhaupt philosophischen<br />
Untersuchung der Metaphysik, der Naturwissenschaften und der<br />
Erkenntnisvermögen des Menschen voran gehen muß, charakterisierbar<br />
geworden: Erst die reinen Vernunftideen in transzendentaler Analogie zu<br />
den deduzierten Kategorien des empirischen Verstandesgebrauches
— 1140 —<br />
beziehen sich nicht mittels Begriffe auf Dinge, sondern mittels Ideen auf<br />
die systematische Einheit der empirischen Verstandeserkenntnisse. Dies ist<br />
zweifellos ein entscheidender Betrag zur Befestigung der systematischen<br />
Stellung der theologischen Idee in der Architektonik der reinen Vernunft,<br />
auch wenn damit ein Moment der Selbstauflösung und Überschreitung<br />
unabwendbar wird.<br />
8. Die Vorstellungsweisen von Notwendigkeit: Totalität der Prädikate,<br />
Totalität der Reihe der Bedingungen zum Unbedingten und die<br />
Unmöglichkeit des Gegenteils<br />
a) Wesensbegriff und Existenzprädikat<br />
Ich habe vorhin schon angedeutet, daß die Eigentümlichkeit der<br />
transzendentalen Analytik der reinen Verstandesbegriffe, nicht von einem<br />
synthetisch-metaphysischen Begriff des intelligiblen Erkenntnissubjekts,<br />
sondern von der Erfahrung, und den daraus sich ergebenden<br />
Erfordernissen eines transzendentalen Subjekts (transzendentale<br />
Psychologie) auszugehen, mehr mit dem kosmologischen als mit dem<br />
ontologischen Gottesbeweis zu tun hat. Der Erkenntnisgrund dafür liegt<br />
darin, daß die Elemente des Erfahrungsraum, von welchem in der<br />
primären Intentionalität zumindest ausgegangen werden muß, nicht nur<br />
den Verbindungsregeln der sinnlichen Anschauung, vielmehr den<br />
Verbindungsregeln der anhand der sinnlichen Anschaungen gegebenen<br />
Erkenntnisse gehorchen können müssen. Kants erste Untersuchungen<br />
gehen (auch in der Einleitung der ersten Kritik) auf grammatikalische<br />
Verhältnisse, wobei einerseits die sinnliche Bedingung die aptitudo der<br />
gegebenen Mannigfaltigkeit vertritt, andererseits nach Prinzipien der<br />
Erfahrung (Vernunftprinzipien a parte priori) und nach<br />
grammatikalischen Kriterien von Analyzität und Synthetizität der Urteile<br />
(der grammatikalische »Exponent«) ein Urteil überhaupt erst gefällt<br />
werden könnte. Diese grammatikalischen Kriterien sollen die unfruchtbare<br />
Diskussion um die Bedeutung der attributiven und prädikativen Stellung<br />
eines Merkmals eines Gattungsbegriffes für die Unterscheidung in<br />
synthetische Urteile (mit Zeitbedingung) und analytische (klassenlogische)<br />
Urteile bereits in Hinblick auf die nunmehr selbst gegenüber der<br />
Intentionalität formal betrachteten diskursiven (sprachlichen)<br />
Bedingungen entscheiden können. Wir wissen allerdings, daß die
— 1141 —<br />
Variationen der Aufspannbarkeit intentionaler Gerüste nach apitudo,<br />
Exponent und Prinzip gerade nicht eindeutig entschieden werden kann:<br />
hat doch schon Michael Benedikt gezeigt, daß sich der nämliche<br />
Erfahrungsraum eben nicht, wie gefordert, nur mit einer physikalistischen<br />
Interpretation erfüllen läßt. (Michael Benedikt, Phil. Empirismus, Theorie,<br />
1977)<br />
So hat Kant trotz dieser unverzichtbaren Komplementarität des<br />
kosmologischen und des anthropologischen Aspekts im transzendentalen<br />
Idealismus die Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises als die<br />
entscheidende Handlung angesehen, erstens, weil seiner Auffassung nach<br />
alle weiteren möglichen Gottesbeweise davon abhängen, und zweitens,<br />
weil der ontologische Gottesbeweis angeblich frei ist von allen<br />
Zusatzannahmen. Deshalb soll der fünfte Abschnitt des dritten<br />
Hauptstückes »Vom Ideal der reinen Vernunft«, also von der Widerlegung<br />
des kosmologischen Gottesbeweises, noch einer Lesung unterzogen<br />
werden. Zu erwarten ist ein Fortschritt in der Bestimmung der<br />
Eigenschaften des unendlichen Wesens und hinsichtlich der<br />
Erzeugungsart der rein intrisecischen Evidenz von dessen Vorstellungen<br />
als<br />
1. allerrealstes Wesen (ens realissimum),<br />
1. Urbild (ens originarium),<br />
3. unbedingt notwendiges Wesen (als für Kant dialektische<br />
Vorstellung der Gesetzmäßigkeit eines series rerum oder als<br />
Vorstellung eines rein intelligiblen Wesens als ens necessarium),<br />
1. erste, selbst nicht verursachte Ursache (ens entium),<br />
1. allseiendes umfassendes Wesen (ens summum)<br />
1. und höchstes Wesen.<br />
Kant erklärt nochmals die innere Notwendigkeit der Vernunft, die Idee<br />
eines unendlichen Wesens zu denken, die nicht nur nicht zureicht,<br />
objektive Realität zu beweisen, sondern, wie in diesem Kommentar<br />
ausgeführt, auch nicht als stichhaltiges Argument für die objektive und<br />
einzige Geltung eines der Inhaltsbestimmungen (oder deren<br />
gleichursprüngliche Zueinanderstellung) der Idee angesehen werden darf.<br />
Da aber, wie bereits weiter oben in der Auflösung der vierten Antinomie<br />
der kosmologischen Idee zur rein regulativen Idee der systematischen und<br />
zweckmäßigen Einheit der Natur, die Stellung der theologischen Idee für<br />
überflüssig dargestellt wird, hat sich die Frage gestellt, ob die theologische<br />
Idee für die ganze Architektonik der Vernunft noch einen Zweck hat, der
— 1142 —<br />
über die bloße Symmetriebedürfnisse der Vernunft hinausgeht. Während<br />
der Zusammenhang des Regressus des kontinuierlichen<br />
Erfahrungmachens in der Gegenwart des Dinges der Erscheinungen mit<br />
dem Zusammenhang der Erfahrungen im Begriff vom Gegenstand den<br />
logischen Gebrauch der kosmologischen Ideen ausmacht, überschreitet die<br />
Untersuchung der Anwendungsbedingungen im Zuge der Ausbildung<br />
verschiedener Methoden (verschiedener Formen des Regressus des<br />
Erfahrungmachens nicht nur entlang der sinnlich garantierten<br />
Kontinuitätsbedingung) die Grenze des strikten transzendentalen<br />
Idealismus. Kant kann das Problem dieser dialektischen Überschreitung in<br />
den Auflösungen der Antinomien in entscheidenden Punkten zumindest<br />
entsprechend den Bestimmung des transzendentalen Idealismus<br />
bezeichnen: Ein Regressus, etwa in der Vorstellung eines series rerum,<br />
überschreitet zwar die Grenze des strikten transzendentalen Idealismus,<br />
führt aber gerade erst im dialektischen Gebrauch auf das Prinzip der<br />
ersten unbedingten Ursache, sodaß es noch einen explizierbaren<br />
architektonischen Grund gibt, der Idee vom unendlichen oder vom absolut<br />
notwendigen (rein modal ausgedrückt: unbedingten) Wesen als solche,<br />
wenn eben auch nur widerleglich, in Stellung zu halten. Es schien zwar, als<br />
wäre die ursprüngliche theologische Idee erledigt und man müßte sich auf<br />
die Suche ihrer systematischen Funktion in der Ideenlehre der reinen<br />
Vernunft nach einen angemesseneren Titel begeben, doch bleibt die<br />
Beschränktheit der Untersuchung auf die Erkenntnisvermögen zu<br />
bedenken, sodaß die theologische Idee als Titel nicht nur aus<br />
architektonischen Gründen, oder aus Gründen der Ausbeutbarkeit<br />
hinsichtlich der Gewinnung weiterer brauchbarer regulativer Ideen, ihre<br />
Stellung in der Architektonik der Lehre von den obersten Ideen zu<br />
behalten hat. Und zwar weil eben es sich bei der dritten Vernunftidee nicht<br />
um bloß logische Denkmöglichkeit qua logischer Widerspruchsfreiheit,<br />
aber auch nicht um Realmöglichkeit handelt (was hier überhaupt<br />
apodiktisch ausgeschlossen werden muß), vielmehr die freilich<br />
dialektische Totalität der Vernunft im Rahmen der Darstellung des<br />
transzendentalen Scheins nicht nur als Nichts (als unmittelbare Aufhebung<br />
des transzendentalen Scheins) gedacht werden kann, und deshalb in der<br />
dritten Vernunftidee als reine, also nunmehr nicht selbst als<br />
transzendentale Idee, aber als systematische und logisch gerechtfertigte<br />
Vernunftmöglichkeit denkbarer Totalität erst exponiert werden muß,<br />
bevor deren Ungenügen gegenüber der regulativen Funktion von<br />
Vernunftbegriffen in den kosmologischen Ideen diskutiert werden kann –
— 1143 —<br />
und im Zusammenhang mit der Einschränkung auf Erkenntnisvermögen<br />
(die immerhin die ästhetische Urteilskraft beinhaltet) woher das<br />
Ungenügen derselben gegenüber der philosophischen (transzendentalen)<br />
Anthropologie kommt. Es ist also auch hier nach dem Ursprung des<br />
gedachten Inhaltes wie nach dem Motiv und der Methode der<br />
Totalisierung oder Verallgemeinerung bzw. Abstraktion von Inhalten<br />
eigens zu fragen.<br />
Wie schon bei Gelegenheit angeführt, gibt es drei Arten Notwendigkeit<br />
aus der Totalität zu denken: (1) Das erste Prinzip der durchgängigen<br />
Bestimmung (aus der Vielheit eingeschränkte Allheit möglicher Prädikate<br />
eines Dinges) enthält analytisch das Existenzprädikat; (2) Die<br />
Notwendigkeit, der Reihe von Bedingten, die jeweils wieder selbst<br />
Bedingung sind, entweder selbst ein Naturgesetz der series rerum zu<br />
geben, ohne damit ein unbedingtes erstes Glied innerhalb der<br />
Erscheinungswelt oder am Anfang der Erscheinungswelt zu setzen, oder<br />
(3) der Reihe von Bedingten, die selbst wieder Bedingung sind, in welchem<br />
der Regressus der Steigerung der Modalität zur Notwendigkeit, mit der<br />
selbst unbedingten Bedingung ein absolutes Ende gesetzt wird. Es gibt<br />
aber noch einen anderen Grund für Notwendigkeit, den Kant ab den Nova<br />
Dilucidatio kennt, aber eben nicht für die objektive Gültigkeit (logischen<br />
Gebrauch) der theologischen Idee verwenden kann: Wenn etwas<br />
notwendigerweise da ist, dann ist es nicht wegen eines Grundes da,<br />
sondern weil das Gegenteil gar nicht möglich ist. (6. Proposition, Nova<br />
dilucidatio; Beweis aus der Unmöglichkeit des Gegenteils).<br />
Für den ersten Punkt wurde eben festgestellt, daß das Existenzprädikat<br />
wie die Qualitäten aussagenden Prädikate auch nur als Möglichkeit und<br />
und Ort der assertorischen Bedingung analytisch im Begriff eines Dinges<br />
enthalten sein kann. Die Schwierigkeit dieses Verfahrens liegt<br />
hauptsächlich darin, daß idealiter die Merkmale eines gedachten<br />
Gegenstandes mit den Merkmalen eines wirklichen Dinges qualitativ nicht<br />
unterscheidbar sind, sodaß das im logischen Vergleich zwischen den<br />
Dingen angesetzte Kalkül, wonach alle notwendigen Merkmale einer<br />
besonderen Art dann, und nur dann ein Existenzprädikat zur Folge haben,<br />
wenn diese notwendigen Prädikate assertorisch gegeben sind, durch die<br />
analytisch mitgebrachte Überzeugung als bereits grundsätzlich<br />
vorausgesetzt und erledigt betrachtet werden kann. Dies entspricht den<br />
empirischen Postulaten und ist eine geübte naturwissenschaftliche Praxis,<br />
aber nicht für die transzendentale Kritik der dritten Idee geeignet, welche
— 1144 —<br />
dialektisch das Existenzprädikat aus der Vollständigkeit der bloß<br />
gedachten Merkmale dem Ding transzendent zuschreibt. 4 — Der zweite<br />
Punkt entspricht in etwa dem, was die theoretische Vernunft in Hinblick<br />
auf die mögliche Totalität der Verstandeserkenntnis gebietet, und der<br />
dritte Punkt umreißt unter dem Titel des unendlichen oder unbedingt<br />
notwendigen Wesens eigentlich ein rein modallogisches Thema, welches<br />
eine dialektische wie eine logische Seite besitzt. Der logische Gebrauch<br />
wäre nun diejenige Erkenntnis, die aus der Erscheinung, oder zumindest<br />
aus dem gegenwärtigen Regressus im Erfahrungmachen entstammt, ohne<br />
den dialektischen Regressus auf eine erste und notwendige Ursache<br />
anzuwenden. Es gibt zwei Kritikpunkte am strikten transzendentalen<br />
Idealismus, die ärgerlicherweise besonders die Qualität der Auflösungen<br />
der Antinomien der kosmologischen Idee bei Kant beeinträchtigen. Erstens<br />
die unreine Unterscheidung zwischen der Modalität des Verdikts gegen<br />
die dialektische Vorstellung eines series rerum und der Modalität des<br />
Verdikts gegen die dialektische Vorstellung eines unbedingt notwendigen<br />
Wesens hinsichtlich der angeblichen Notwendigkeit für die spekulative<br />
reine Vernunft: Notwendigkeit kann nicht gesteigert werden, nur die<br />
Quelle, woher es notwendig ist, kann erörtert werden. Zweitens die<br />
Unfähigkeit Kantens, der naturgeschichtlichen Zeit, die den gegenwärtigen<br />
Regressus des Erfahrungmachens überschreiten, selbst gerecht zu werden,<br />
und sei es als universielle Situierung einer eigenen Anschauungsform,<br />
ohne dies von der Entscheidung zwischen series rerum und unbedingt<br />
notwendigen Wesen abhängig zu machen. Was Kant in den M. A. d. N.<br />
mit der Formel »als vergangen gesetzte Zeit« notdürftig gelungen ist,<br />
bleibt in der Dialektik der reinen Vernunft auf Andeutungen beschränkt.<br />
b) Die Qualifiziertheit des Unmöglichen<br />
Die vierte und offenbar radikalste Schlußform auf Notwendigkeit scheint<br />
die Beziehung auf die Idee einer extensionalen Totalität nicht zu benötigen,<br />
ist hier aber selbst Ausdruck der dialektischen modalen Totalität: der<br />
Beweis aus der Unmöglichkeit des Gegenteils. Wie anhand der<br />
Überlegungen zum Satz vom Widerspruch zu erwarten, verlangt auch der<br />
Beweis aus der Unmöglichkeit des Gegenteils jeweils in seiner<br />
4 Hier wird von der Schwierigkeit abgesehen, daß weder alle notwendigen Merkmale<br />
fortwährend in den Erscheinungen gegeben werden, noch daß alle als Erscheinung<br />
gegebenen Merkmale dem gedachten Objekt, das als wirkliches Ding gedachtwerden<br />
soll, notwendig sind.
— 1145 —<br />
Anwendung nach einem Horizont von Bedingungen, dessen Erörterung<br />
erstens wieder nur unter der Voraussetzung neuerlich nur qualitativ<br />
aufzufassender Merkmale möglich ist. Der Grund solcher Annahmen kann<br />
allein darin liegen, daß selbst die Behauptung der Unmöglichkeit<br />
qualifiziert sein muß dahingehend, was unmöglich sein soll. Die daraus<br />
erschlossene Notwendigkeit gibt diese Gründe weder explizit zu erkennen,<br />
noch enthält es diese implizit; zunächst scheint es nicht einmal einen<br />
Grund zu geben, warum zu der qualifiziert gesetzten Unmöglichkeit ein<br />
bestimmtes Gegenteil gedacht werden muß, das in modaler<br />
Entgegensetzung der charakterisierten Unmöglichkeit notwendig<br />
existieren können soll. Derart kann mit dem Argument für die<br />
Notwendigkeit der Existenz von etwas nur von Seiten der Existenz<br />
überhaupt begonnen werden; und die Unmöglichkeit, von der<br />
Unmöglichkeit auszugehen ist eben nicht aus dem<br />
transzendentalsubjektivistischen Argument abgeleitet, sondern weil aus<br />
einer qualifiziert behaupteten Unmöglichkeit kein definitives einzelnes<br />
Gegenteil ohne weiteres gegeben werden kann. So wäre noch zu beachten,<br />
wie die Modalität des Unmöglichen, das eben notwendig sein soll, auf das<br />
Gegenteil, die Existenz, übergeht.<br />
Ein erster Aufriß könnte folgendermaßen aussehen: Zuerst gibt es den<br />
ursprünglichen Horizont des gesetzten Teiles, dann den eines anderen<br />
Teiles, Gleichrangigkeit ist durch den Horizont der Zusammensetzung<br />
zuerst vorausgesetzt und nicht länger Angelegenheit eines besonderen<br />
und als ideal konstruierten formalen Zugleichseins oder einer besonderen<br />
Genetik. In dieser formalontologischen Redeweise kann es bald keinen<br />
Gegensatz mehr geben, der nicht komplementär mittels Negation der<br />
Negation eingeholt werden könnte. Ähnlich ist das, was unmöglich ist,<br />
zwar durch Negation darstellbar, aber eben nicht selbst nichts als eine<br />
Negation. Doch aber ist das Unmögliche wieder verschieden vom<br />
Horizont verschiedener gleichursprünglicher Teile, deren<br />
Komplementarität durch grenzüberschreitende Negation der Negation in<br />
der Unterscheidung eingeholt werden kann, denn die Negation der<br />
Negation des Unmöglichen ergibt nichts qualitativ bloß nicht<br />
bestimmbares Mögliches, sondern über Möglichkeit wie bei Aristoteles<br />
Notwendigkeit. Das Besondere daran ist der Umstand, daß dieses Nicht-<br />
Mögliche sich doch qualitativ bestimmen können lassen muß, ohne je<br />
möglich zu sein. Das ist daraus zu erklären, daß das Unmögliche in einer<br />
Verknüpfung von bereits bestimmbaren Bestimmungsstücken besteht, die
— 1146 —<br />
von anderswo her und aus anderen Verbindungen bereits bekannt sind.<br />
Ein innerer Widerspruch mag der Grund für die Unmöglichkeit der<br />
Erfüllbarkeit einer Vorstellung sein, ihr adequater Ausdruck bedeutet<br />
nicht ein folgenloses Nichts, sondern gehört zu den Bestimmungen des<br />
Daseins (Vergleiche Bolzanos widersprüchliche Vorstellungen, die<br />
gegenstandslos sind).<br />
Der Beweis aus dem Gegenteil des Unmöglichen setzt das Mögliche bzw.<br />
dessen Kenntnis bereits voraus; letztendlich schon allein um das<br />
Unmögliche bestimmen zu können. Ist man soweit gefolgt, stellt sich<br />
immer noch die Frage: Was aber soll dann das Gegenteil des Unmöglichen<br />
anderes sein als wieder nur das Mögliche? Dann kann gleich auch gefragt<br />
werden, inwiefern ich glauben kann, umgekehrt das Mögliche aufheben zu<br />
können, was aber ein bloßes Mißverständnis wäre, denn die Operation der<br />
Negation des Möglichen zum Unmöglichen hebt nicht das Mögliche auf,<br />
sondern setzt dem Möglichen eine Grenze; oder man kann auch sagen: der<br />
Horizont der Möglichkeit wird von der Unmöglichkeit bestimmt. — Sofern<br />
also ein positiv qualifizierter Schluß auf das abstrakte Gegenteil des<br />
Unmöglichen denkbar wäre, dann müßte wohl das Gegenteil nicht in einer<br />
positiv konkreten Bestimmung faßbar sein dürfen, sondern, wenn also<br />
überhaupt, als ausgedehnter Horizont mehrerer, nicht der Herkunft nach,<br />
aber in den Folgen zusammenhängenden Bestimmungen. Als eben solches<br />
ließe sich das eben begrenzte Mögliche dann durchaus darstellen. Das aber<br />
ist dann insgesamt zugleich ein Beispiel für einen Horizont der<br />
Gleichursprünglichkeit, denn das Mögliche mag je nach Grenzziehung<br />
auch das Wirkliche umfassen, insgesamt gibt es jedoch keine eindeutige<br />
Redeweise über Existenz von Möglichem und auch keine Orientierung im<br />
Raum-Zeit-Kontinuum, sondern nur Tendenzen zur Verwirklichung in<br />
Hinblick auf das Raum-Zeit-Kontinuum.<br />
Das Unmögliche als Grund des Schlusses auf das Geltende (Existierende),<br />
und dieses als das Gegenteil des Unmöglichen muß qualitativ bestimmbar<br />
sein, weil schon das Gegenteil des Geltenden (Existierenden) nicht anders<br />
als nur das in Frage kommende andere gedacht werden kann, und<br />
empirisch nicht zum Unmöglichen fortgegangen werden braucht. Das<br />
Gegenteil des Unmöglichen kann aber eben auch nur immer das ganze<br />
Mögliche sein, bis eine Zeitbedingung und eine räumliche Orientierung<br />
gefordert wird, was erst wieder zu transzendentalästhetischen<br />
Bedingungen der Erscheinung der einzelnen kontingenten Existenz<br />
zurückführt. Schlußendlich behauptet Unmöglichkeit notwendige
— 1147 —<br />
Geltung; inwiefern kann aber Notwendigkeit aus der Negation des<br />
Möglichen, und deren abermals erweiternden Negation zur<br />
Notwendigkeit überhaupt positiv herausspringen? Das nur in endlichem<br />
Horizont, wenn man keine Ausnahme von der Regel macht, alle<br />
Unterscheidungen auch als logische Gegensätze darstellen zu können.<br />
Dann muß der Unterschied zwischen konkret qualifizierten Möglichen<br />
und konkret qualifizierten Unmöglichen (jeweils bereits als<br />
Verbindungsbegriff) ebenfalls als kontradiktorischer Gegensatz<br />
ausgedrückt werden können. Insofern scheint dem Schluß auf das<br />
Gegenteil des Unmöglichen formal eine gewisse Berechtigung zuteil<br />
werden, ohne aber überzeugend daraus die Notwendigkeit eines<br />
bestimmten daseienden Dinges, wohl aber überhaupt die Notwendigkeit<br />
irgend eines bestimmten, in der Idee aber dem Begriff nach unbestimmt<br />
welchen, Gegenstandes dartun zu können. Dieser Gegenstand ist dann<br />
schon immer als einzelner, und deshalb auch als bestimmter Gegenstand<br />
zu denken. Es ist demnach der Schluß auf das Gegenteil des Unmöglichen<br />
als Notwendiges immerhin möglich, dann aber bezieht sich die<br />
Argumentation in der Tat nicht auf die Totalität oder die Wechselwirkung,<br />
sondern allein auf die reale Möglichkeit eines einzelnen bestimmbaren<br />
Gegenstandes überhaupt. Das aber ist letztlich eine Tautologie, deren<br />
Rundgang zwar nicht trivial ist, indem die Kenntnisse über die logischen<br />
Verhältnisse zwischen Idee und Begriff vermehrt werden, aber in der<br />
Sache selbst genau dort ankommt, von wo man ausgegangen ist. Der<br />
Schluss auf das Gegenteil des Unmöglichen unterhält demnach sowohl<br />
eine Beziehung zur Totalität des Möglichen wie auf die Möglichkeit eines<br />
einzelnen, bestimmbaren Gegenstandes. Man könnte hier durchaus von<br />
einem Verfahren der Instantialisierung sprechen.<br />
c) Der Schluß auf das Gegenteil des Unmöglichen bei Leibniz<br />
Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, eine Bedingung zu denken, unter<br />
welcher der Schluß auf das Gegenteil des Unmöglichen denkbar wäre: Wir<br />
müßten nur ein an sich selbst (nicht aus dem Zusammenhang der<br />
Kontingenz) notwendiges Ding finden, um der Unmöglichkeit ein noch<br />
entfernteres Gegenteil entgegenzusetzen. Das kann das transzendentale<br />
Subjekt sein, oder das unendliche Wesen. Genau das Letztere hat Kant<br />
aber bekanntlich vermieden: die Notwendigkeit von Dingen in der<br />
Kontingenz ist nunmehr zuerst Ergebnis der Kantschen Depotenzierung<br />
des ontologischen Gottesbeweises. Leibniz bietet aber die fehlende
— 1148 —<br />
Vorstufe dazu: Der Grund, warum eher das existiert als etwas anderes,<br />
muß in irgend einem realen Seienden oder in einer Ursache liegen. Die<br />
Wahrheiten der Möglichkeiten haben keine Folgen (bewirken nichts),<br />
wenn sie nicht aktuell in einem wirklichen Zustand fundiert sind. Hier ist<br />
auch ein Ansatz zu finden, diejenigen Wahrheiten, die für alle bzw. vor<br />
alle möglichen Welten gelten (Notwendigkeiten als Gegenteil negierter<br />
Möglichkeiten), von den Möglichkeiten zu unterscheiden, die die<br />
Anwendung des Satzes vom Widerspruch erst in einer möglichen Welt<br />
(series rerum) erlauben. Aber alle Wahrheiten zeichnen sich dadurch aus,<br />
daß sie anscheinend nicht aus sich selbst zu wirken vermögen (keine Kraft<br />
haben und nichts selbst zur Existenz bringen können) und weiters, daß sie<br />
nicht aktuell, d.h. nicht selbst aufeinander einflußnehmend sind. Hier ist<br />
bei Leibniz ein Motiv zu finden, weshalb Kant der Überlegung einer<br />
eigenen Notwendigkeit des series rerum nicht Gleichrangigkeit gegenüber<br />
der zusammengestutzten aristotelisch-thomistischen Vorstellung des<br />
Zusammenfallens des Regressus der Ursachen zur causa prima mit dem<br />
Regressus der Reihe der Bedingten zum Unbedingten und mit dem<br />
Regressus empirischer Ursächlichkeit im Rahmen eines series rerum<br />
eingeräumt hat: »Denn nicht nur kann in keinem einzelnen, sondern<br />
ebensowenig im ganzen Zusammengesetzten und in der Reihe der<br />
Tatsachen ein zureichender Existenzgrund gefunden werden« (Gerhardt,<br />
VII, p. 302).<br />
Dieser Vorrang erscheint verständlich, doch vergißt Kant, daß er mit der<br />
Deduktion der Kategorien des Verstandesgebrauches ein transzendentales<br />
Prinzip der Naturphilosophie im synthetischen Grundsatz der Kausalität<br />
bestimmt hat. Dieses synthetische Urteil a priori übersetzt, wie von<br />
Leibnizens System des vinculum substantiales auch verlangt, Modalität in<br />
rationale Vermittlung. 5 Das ist bei aller Beschränktheit unseres Verstandes<br />
und des logischen Gebrauchs der Vernunftbegriffe in Hinblick auf die<br />
Totalität der spekulativen Vernunft selbst vor und nach der<br />
transzendentalen Analogie zu den Kategorien entschieden mehr, als Kant<br />
in den Auflösungen der Antinomien zu diskutieren bereit oder fähig ist.<br />
Die Striktheit des transzendentalen Idealismus wird zur Bedrohung der<br />
Stringenz der transzendentalen Analogie der reinen Vernunftbegriffe zu<br />
den Kategorien, was ein Abrutschen in rein formalontologische<br />
Spekulationen an Stelle von Naturwissenschaft fördert.<br />
5 Michael Benedikt, Wissen und Glauben. Zur Analyse der Analogien in historischkritischer<br />
Sicht, Herder. Wien 1975, § 77
— 1149 —<br />
Leibnizens zieht hingegen im elften Satz der »Vierundzwanzig Sätze« das<br />
Prinzip des Maximums mit dem Prinzip, das Regelmäßige vorzuziehen,<br />
zusammen, obgleich es gegenüber dem Prinzip des Maximums womöglich<br />
defiziente Formen des Prinzips, das Regelmäßige vorzuziehen, bereits mit<br />
beinhalten muß: »Es verwirklicht sich also das Vollkommenste, da<br />
Vollkommenheit nichts anderes ist als die Fülle (Quantität) der<br />
Wirklichkeit (Realität)«. Diese Verhinderung einer mit Notwendigkeit sich<br />
einstellenden Tautologie garantiert die qualifizierte Möglichkeit der Idee<br />
eines unbedingt notwendigen Wesens aus architektonischen Gründen auf<br />
ähnlich formale Weise wie die bloße Widerspruchsfreiheit<br />
(Unwiderleglichkeit der Denkmöglichkeit) die Exposition dieser Idee unter<br />
logischen Bedingungen allererst ermöglicht hat. Kant stellt nun (bei mir<br />
hier im fünften Abschnitt) die nun nochmals requalifizierte Idee des<br />
unbedingt notwendigen Wesens aus dem dritten Punkt mit der<br />
Notwendigkeit, aus der Totalität der prädikativen Bestimmbarkeit auf<br />
Existenz schlußfolgern zu können aus dem ersten Punkt zusammen.<br />
Zuerst argumentiert Kant wie schon bekannt mit der subjektiven<br />
Notwendigkeit des Strebens der Vernunft nach der Transzendenz einer<br />
reinen Immanenz der qualifiziert Totalität, um die Idee des unbedingt<br />
notwendigen Wesens zu exponieren. Da aber die Vernunft offenbar noch<br />
ein weiters Streben a priori besitzt, nämlich das Streben nach Gewißheit a<br />
priori und unbedingter Notwendigkeit und nicht nur nach Totalität ihrer<br />
Ideen, sucht sie sich einen Begriff, der den Forderungen eines solchen<br />
Wesens genüge tun könnte.<br />
»Diesen glaubte man nun in der Idee eines allerrealsten Wesens zu finden,<br />
und so wurde diese nur zur bestimmteren Kenntnis desjenigen, wovon<br />
man schon anderweitig überzeugt oder überredet war, es müsse existieren,<br />
nämlich des notwendigen Wesens, gebraucht. Indes verhehlte man diesen<br />
natürlichen Gang der Vernunft, und, anstatt bei diesem Begriffe zu<br />
endigen, versuchte man von ihm anzufangen, um die Notwendigkeit des<br />
Dasein aus ihm abzuleiten, die er doch nur zu ergänzen bestimmt war.<br />
Daraus entsprang der ontologische Beweis, der weder für den natürlich<br />
und gesunden Verstand, noch für die schulgerechte Prüfung etwas<br />
Genugtuendes bei sich führet.« (B 631 f./A 603)<br />
Kant experimentiert mit den verschiedenen Titeln der Erzeugung eines<br />
Begriffs vom notwendigen Wesen. Unmittelbar im Anschluß mutiert das<br />
allerrealste Wesen zum Wesen höchster Realität, und obwohl Kant diese<br />
Verwechselbarkeit zwischen allerrealstem Wesen und Wesen höchster
— 1150 —<br />
Realität auch anderswo pflegt, ist doch die Aufmerksamkeit darauf zu<br />
lenken, daß im Attribut ein entscheidender Wechsel stattfindet. Der<br />
Ausdruck »höchste Realität« unterscheidet sich vom Ausdruck<br />
»allerrealst« durch die Eindeutigkeit, mit welcher klar gemacht wird, daß<br />
hier eine Bewertung erfolgt und nicht der maximale Umfang von etwas<br />
bestimmt wird. Diese Eindeutigkeit läßt der Begriff vom allerrealsten<br />
Wesen vermissen: einerseits hat dieser Begriff seinen Ursprung in der<br />
Vorstellung von quantitativ darstellbarer Totalität, andererseits bereitet<br />
sich schon auf dem Boden der prädikativen Durchbestimmung der<br />
Übergang zur Intensität aus der Antizipationskategorie vor, indem die<br />
Versammlung aller Prädikate ja antizipativ das Existenzprädikat nach sich<br />
ziehen soll. Schon der ontologische Gottesbeweis argumentiert mit<br />
Abstraktionen realer Prädikate; insofern wird der Sache nach schon mit<br />
Gegenständen der Empirie operiert, was die Unterscheidung zum<br />
kosmologischen Gottesbeweis nochmals fragwürdig macht. Allerdings<br />
kommt damit auch eine Erwartung oder der Wunsch nach der Wahrheit<br />
des Satzes mit dem Wechsel zum »höchstrealen Wesen« zum Ausdruck. —<br />
Derart läßt sich diese Ungenauigkeit im Ausdruck Kants unschwer<br />
aufklären.<br />
d) Die Schwierigkeit des weder analytisch noch synthetisch<br />
begründbaren Zueinanders der Attribute der theologischen Idee. Die<br />
Idee vom höchsten Wesen und die jeder Ursache vorausgesetzte Materie<br />
ihrer Wirkung<br />
Eine der weiteren Schwierigkeiten dieser Vorstellung könnte darin liegen,<br />
daß die Vorstellung vom höchsten Wesen der Vorstellung von Materie<br />
entgegengesetzt werden kann.<br />
Die Idee vom höchsten Wesen ist nicht ursprünglich die Idee der ersten<br />
selbst nicht verursachten Ursache, und diese sind nicht ursprünglich ident<br />
mit der Idee von der unbedingten Notwendigkeit. Das allerrealste Wesen<br />
wurde von Kant selbst vor seinen kritischen Schriften überzeugend als<br />
ungeeignet abgelehnt, eine Vorstellung des höchsten oder des<br />
notwendigen Wesens zu sein: das ens realissimi hätte dergestalt alle<br />
Realität in sich zu vereinigen, was widersinnig ist, will man vom höchsten<br />
Wesen sprechen. Dieses Argument hat oberflächlich Ähnlichkeit mit der<br />
Konstitution der Allheit durch die Einschränkung der Vielheit gemäß<br />
einem Besonderen, nur wird hier logisch ausschließlich intensional und
— 1151 —<br />
nicht auch extensional vorgegangen. Wegen der Schwierigkeit mit der Idee<br />
vom allerrealsten Wesen geht Kant zuletzt auch dazu über, den Ausruck<br />
»allerrealst« durch den Ausdruck »höchste Realität« zu ersetzen.<br />
Wie kann man sich die Verknüpfung der ursprünglich getrennt gedachten<br />
Konzepte des höchsten, etc., Wesens denken? Zuerst analytisch, indem alle<br />
diese Ideen als Konzepte der theologischen Idee weiterhin als notwendiges<br />
Ergebnis der Spekulation betrachtet werden können, auch wenn damit das<br />
Argument der Einzigkeit verloren geht, und die Einheit der Gottesidee<br />
wegen der Grundlosigkeit der Zusammenstellung in Gefahr scheint.<br />
Insoferns scheint zumindest gleiche Modalität gesichert zu sein, doch<br />
handelt es sich damit eben nicht um die unbedingte Notwendigkeit, die<br />
über die einer bloßen Idee, die immerhin als ein notwendiges Ergebnis der<br />
spekulativen Erörterung der theologischen Idee gedacht werden kann,<br />
hinausreicht. Auch ist in Ansehung der relativen Selbstständigkeit der<br />
verschiedenen Konzepte allein in genetischer Hinsicht ein immerhin<br />
immer denkmöglicher Horizont der Gleichursprünglichkeit nicht selbst in<br />
aller Eigentlichkeit ursprünglich im Sinne des völlig Unhintergehbaren.<br />
Für Leibniz liegt die Existenz Gottes darin begründet, daß in den series<br />
rerum der Grund ihrer Realität nicht gefunden werden kann (die<br />
Unterscheidung von: warum überhaupt etwas ist, und: warum dieses und<br />
nicht etwas anderes). Demnach müßte die erste Idee die der ersten Ursache<br />
sein. Über deren Notwendigkeit kann nun auch dann ontologisch nichts<br />
weiter ausgesagt werden, wenn man den transzendentalen Subjektivismus<br />
verläßt, also nicht mehr allein aus Erkenntnisgründen urteilt.<br />
Doch unzweifelhaft wäre diese erste Ursache für uns noch als Teil der<br />
series rerum unbedingt notwendig, gerade wenn, genau besehen, nicht<br />
einmal nur mit irgendeinem Indiz behauptet werden kann, die erste<br />
Ursache hätte selbst keine weiteren Seinsgründe. Selbst wenn wir also die<br />
Position des transzendentalen Subjekts und seiner Welthaftigkeit<br />
verlassen, geraten wir naturphilosophisch nur in die Perspektive, die uns<br />
die Natur schon immer auferlegt hat. Was aber sollen wir unter den Begriff<br />
vom höchsten Wesen verstehen? Hat dieses göttliche Attribut nur zu<br />
besagen, daß es der höchste Begriff ist, der alle anderen unter sich, oder als<br />
Inbegriff in sich befaßt? Im Falle der letzten formalistischen Interpretation<br />
würde für diesen Begriff das selbe gelten wie für die Idee vom allerrealsten<br />
Wesen oder vom Raum als Idee eines idealen compositums. So bleibt als<br />
einzig noch mögliche Bedeutung übrig, wie man auch den Ausdruck<br />
»Wesen allerhöchster Realität« nur verstehen kann: nämlich als besondere
— 1152 —<br />
und einzige Qualität, deren Wahrnehmung durch die Erhabenheit<br />
geschieht. Allerdings könnte dieses Gefühl der Erhabenheit auch der Idee<br />
gelten und nicht einer Wahrnehmung darüber hinaus. Diese eigentlich<br />
göttlichen Attribute müssen demnach, allein aus dem Ablauf der<br />
Spekulation betrachtet, zuerst weder das Attribut, erste Ursache zu sein,<br />
besitzen, noch an und für sich unbedingt notwendig sein. Ebenso muß, wie<br />
bereits erwähnt, die Betrachtung der Notwendigkeit der Existenz, wie die<br />
nähere Erörterung der Seinsweise selbst, außerhalb auch nur unserer<br />
Spekulation bleiben. Nur für uns wäre die erste Ursache unbedingt<br />
notwendig; jedoch kann darüber nachgedacht werden, inwieweit die<br />
verschiedenen Vorstellungen als Interpretationen der theologischen Idee<br />
zueinander ein notwendiges Verhältnis besitzen. Gesucht ist nunmehr<br />
wiederum ein formales und transzendentales Prinzip für das hier<br />
anstehende synthetische Urteil a priori, ähnlich wie es ein Prinzip für das<br />
synthetische Urteil a priori in der reinen Geometrie gibt und noch ein<br />
transzendentales. Alle Untersuchungen haben aber bislang ergeben, daß es<br />
eben ein solches Prinzip nicht gibt; vermutlich, weil wir die Erhabenheit<br />
der Idee von der Erhabenheit als Erscheinungsform des<br />
zusammengesetzten höchsten Wesens selbst nicht unterscheiden können.<br />
Die Seinsweise betrachtend, ließe sich noch sagen (dies aber analytisch),<br />
daß sie überzeitlich sei, die Antizipation und die Wahrnehmung eins sind,<br />
während völlig dunkel bleibt, inwieweit Gott außerhalb der Naturgesetze<br />
dieser (oder auch nur irgend einer) series rerum etwas schaffen kann.<br />
Ebenso bleibt die Allmacht den Spekulationen verborgen. Anzunehmen<br />
ist, das auch diese erhabene Seinsweise gewisse Einschränkungen besitzt,<br />
allein, weil nichts völlig unbestimmt existieren oder auch nur sein kann.<br />
Eines kann noch über den Punkt, welcher von der ersten Ursache markiert<br />
wird, hinausgehend gesagt werden: Noch bevor es zur Schöpfung kommt,<br />
muß es einen Prozess der Klärung des Unvordenklichen geben, worin<br />
wohl auch die cusanische Lichtmetapher ihren Ausgang nimmt, was uns<br />
nur resolutiv zugänglich ist. Die für uns aus der Perspektive der Welt als<br />
wirkliche series rerum (also nicht transzendentalsubjektivistisch) gesehen<br />
erste Ursache steht also dem Endpunkt eines innergöttlichen Prozesses<br />
gegenüber oder selbst im Unvordenklichen. Inwieweit es nach der<br />
Schöpfung sinnvoll ist, Gott mit »innen«, die Schöpfung mit »außen«, oder<br />
umgekehrt, miteinander mit dieser räumlichen Metapher oder mit der<br />
Frage nach Teil und Ganzem in Beziehung zu setzen, lasse ich hier<br />
dahingestellt; noch aussichtsloser scheint die Erörterung der Frage, ob sich
— 1153 —<br />
die Mannigfaltigkeit der unvollkommenen Indifferenz des<br />
Unvordenklichen innerhalb oder außerhalb des göttlichen Verstandes sich<br />
befindet, obgleich die einen Spekulationen eher das eine, andere eher das<br />
andere nahezulegen scheinen. Inwieweit sich die vorgeschöpfliche<br />
Lichtmetapher der göttlichen Aufmerksamkeit in der Identität von<br />
Antizipation und Wahrnehmung erschöpft, ob der Grund des göttlichen<br />
Handelns in der Schöpfung bereits in der Antizipation mit beschlossen ist<br />
und was dies mit dem Streben nach Verwirklichung der Ideen, als bloße<br />
Möglichkeiten betrachtet, zu tun hat; wie dieses schließlich mit der<br />
transzendentalen Zusammenfügung von Metaphysik der Mathematik und<br />
der Metaphysik der Natur aus Freiheit; und zu guter Letzt wie diese<br />
ontotheologische Naturphilosophie mit der Anwesenheit Christi als<br />
Kosmotheoros in der Schöpfung, also mit dem ordo naturalis,<br />
zusammenhängt, sind Fragen, die auf ein reiches Feld der<br />
wissenschaftlich-philosophischen Spekulation schließen lassen, sobald<br />
man die transzendentalsubjektivistische Einschränkung aufzuheben<br />
gewillt ist. Kants Spekulation eines intelligiblen und notwendigen Wesens<br />
gehen in der dritten Antinomie nicht nur auf die erste Ursache eines<br />
entfernten Anfangs wie in der vierten Antinomie, sondern sollen ein<br />
anwesendes Wesen vorzustellen erlauben, dessen Form des Anwesens in<br />
dieser Version anders sein wird, weil es nicht sinnlich affiziert werden<br />
kann. –<br />
Genau das aber hat Kant nicht vor. Es verhält sich so, daß sich zwar einige<br />
intentionale Verschränkungen ergeben, die geregelte Alternativen zu<br />
denken erlauben, aber gerade die Überzeitlichkeit der Quelle erlaubte,<br />
gesetzt dem Falle, keine formalen und allgemeinen Bedingungen zu<br />
bestimmen, nach welchen Verstandesbegriffe auf eine Weise angewandt<br />
werden könnten, alsdaß von verständiger Erfahrung in diesen Fragen in<br />
einem vergleichbaren Sinn wie bei der Erfahrung anhand und im Umkreis<br />
der Sinnlichkeit die Rede sein kann. Bemerkenswerterweise reicht diese<br />
Selbstbeschränkung Kants gegenüber der Versuchung eines zumindest<br />
denkmöglichen transzendentalen Prinzips nicht aus, um zu verhindern,<br />
daß Kant denn doch Gründe anführt und zu erkennen gibt, weshalb er die<br />
theologische Idee für eine Vernunftidee hält. Daß Vernunftideen keinen<br />
eigenen Gegenstand finden außer die bereits gemachten<br />
Verstandeserkenntnisse und deren strategisch zweckmäßigste<br />
Systematisierung und Erweiterung des Gesichtsfeldes gilt für alle<br />
Vernunftbegriffe, also auch für die theologische Idee, woran die
— 1154 —<br />
Extraordinarität der Idealität der Idee oder des zumindest denkmöglichen<br />
Gegenstandes offenbar auch für Thomas und Anselm nichts zu ändern<br />
vermag. Diese Gründe sind allein aus der transzendentalen Analyse der<br />
Dialektik der theologischen Idee gewonnen; die Folgerichtigkeit der<br />
Analyse erweist sich zuerst mit der Aufstellung des spezifischen Problems<br />
eines synthetischen Urteils a priori und dann mit der Angabe der<br />
methodischen und systematischen Gründe, weshalb das notwendige<br />
transzendentales Prinzip nicht gefunden werden kann. Darüber<br />
hinausgehend mag immerhin spekuliert werden; sofern Metaphysik<br />
Wissenschaft werden soll, kann die Transzendentalphilosophie aber nur<br />
auf ihre kritische Funktion sehen. Die Schwierigkeiten aller möglichen<br />
Spekulationen, mögen sie auch in sich konsequent durchdacht sein und<br />
den einen oder anderen Grund des philosophischen Glaubens bei sich<br />
führen, liegen wohl darin, daß sie neben der immanenten Folgerichtigkeit<br />
nur die subjektive Steigerung des Gefühls der Erhabenheit erreichen oder<br />
letztlich von einer anderen in Wirklichkeit nicht reden können. Insofern<br />
beginnt jede philosophische Behandlung solcher Fragen bereits mit der<br />
entscheidenden Depotenzierung des zumindest denkmöglichen<br />
Gegenstandes.<br />
Der untersuchte Zusammenhang, wonach dem ens realissimum erspart<br />
bleibt, alle realmöglichen Prädikate in sich zur Wesensbestimmung<br />
einzuschließen, es aber zunächst nicht deutlich genug war, was damit<br />
gemeint sein könnte, kann demnach anhand des amphibolischen<br />
Verhältnisses des intelligiblen Substrats zwischen unbewegten Beweger,<br />
dem Subjekt im Schnittpunkt von Regressus auf uns zu und Progressus<br />
von uns weg, und dem möglichen Endpunkt der Geschichte 6 in der dritten<br />
und vierten Antinomie nach architektonischen Gründen entschieden<br />
werden. Das ließe dem omnitudo realitatis eine Bedeutung im Zuge<br />
weiterer Überlegungen, ohne dem nivellierenden Zwang der Identifikation<br />
mit dem ens realissimum. Noch deutlicher wird Kant im dritten Abschnitt<br />
des Ideals der reinen Vernunft, »Von den Beweisgründen der spekulativen<br />
Vernunft, auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen«, wenn er<br />
die nämliche Frage nach der Beziehung des prototypon transzendentale als<br />
6 »Kant wendet sich dagegen — und im Kontrast zu den drei Betrachtungsformen von<br />
Abderitismus der Ewigen Wiederkehr, dem Terrorismus der nahenden Katastrophe<br />
und dem Eudaimonismus als versöhnliches Ende — nunmehr kritisch jener<br />
Evolution im Zeichen der Eidaimonie der je anderen zu. Seine spezifische Ansicht ist<br />
der Ablauf von Kultur-Zivilisation zu ethischem Gemeinwesen, und er trachtet,<br />
kritisch die Bedingungen der letzteren anzugeben. (Kant, Refl. 5008)« (dazu: Michael<br />
Benedikt, Phil. Emp., II. Praxis, Wien 1998, S. 40)
— 1155 —<br />
existierendes Urbild zum ens realissimum aus dem Abschnitt über das<br />
prototypon transcendentale wieder aufnimmt: »Der Begriff eines Wesens<br />
von der höchsten Realität würde sich also unter allen Begriffen möglicher<br />
Dinge zu dem Begriffe eines unbedingtnotwendigen Wesens am besten<br />
schicken, und, wenn er diesem auch nicht völlig genug tut, so haben wir<br />
doch keine Wahl [...]«. 7 Zur Frage nach den Verhältnissen zwischen ens<br />
realissimum und ens originarium (Urbild) hat sich als Spielart des<br />
Allerrealsten ein Wesen höchster Realität hinzugesellt, das hier von Kant<br />
aber hinsichtlich der möglichen Beziehung auf ein durch die Idee des<br />
vollständigen Regressus rechtfertigbares unbedingtnotwendiges Wesen<br />
behandelt wird. Kant läßt uns durchaus eine Wahl, zuerst müsse aber die<br />
Vereinigung beider vorgestellt werden: »Das All aber ohne Schranken ist<br />
absolute Einheit, und führt den Begriff eines einigen, nämlich des höchsten<br />
Wesens bei sich, und so schließt sie, daß das höchste Wesen, als Urgrund<br />
aller Dinge, schlechthin notwendiger Weise dasei.« 8 Dieser Schluß ist für<br />
die Vernunft selbst aber nicht verbindlich: »Diesem Begriffe kann eine<br />
gewisse Gründlichkeit nicht gestritten werden, wenn von Entschließung<br />
die Rede ist [...]« 9 Es bedarf also mangels Bedingungen, die zur Assertorik<br />
führen könnten, eines eigentlichen Willensaktes, der Idee aus reinen<br />
Begriffen a priori auch als Realität glauben zu schenken. Erst im Glauben<br />
sei ein solches Wesen unbedingtnotwendig und nur dann hätte man auch<br />
keine Wahl mehr, diesen Willensakt des Glaubens anerkennend zu setzen.<br />
Denn »wenn es bloß um Beurteilung zu tun ist, wie viel wir von dieser<br />
Aufgabe wissen, und was wir uns nur zu wissen schmeicheln; dann<br />
erscheint obiger Schluß bei weitem nicht in so vorteilhafter Gestalt, und<br />
bedarf Gunst, um den Mangel seiner Rechtsansprüche zu ersetzen.« 10 —<br />
Eine Beurteilung der Rechtsansprüche dieses oder eines anderen Beweises<br />
kann aber ohne dem Subjekt der Freiheit der praktischen Philosophie nicht<br />
mehr diskutiert werden, auch wenn dem intelligiblen Subjekt des<br />
transzendentalen Subjekts beinahe entgegen dem Verlauf der<br />
Untersuchungen der bestimmenden Urteilskraft eine eigene Freiheit des<br />
verstandesgemäßen Handelns zugestanden werden muß. Denn es muß<br />
auch eine theoretische Vernunft geben, die deskriptiv beginnt und dann<br />
erst die selbst analytische Verstandestätigkeit zur Systematik gemäß Ideen<br />
7 B 614/A 583<br />
8 B 615/A 587; das »Bei-sich-führen« des Begriffs vom höchsten Wesens kann, muß<br />
aber nicht ein vom Teilbegriff des omnitudo realitatis verschiedener Begriff sein.<br />
9 l. c.<br />
10 l. c.
— 1156 —<br />
in der heuristischen Spekulation anleiten kann. Genau diese<br />
wissenschaftliche Methodik versagt in der theologischen Idee; es bleibt die<br />
Freiheit, reine Schematen spekulativer Ideen, deren historische<br />
Abhängigkeiten, und deren Zusammenstimmbarkeit auch durch die Zeit<br />
zu beurteilen.<br />
Der formalwissenschaftliche kritische Ertrag liegt erstens in der Einsicht in<br />
die Grundlosigkeit des Zueinander der verschiedenen Vorstellung eines<br />
unbedingt notwendigen Wesens oder eines allerhöchsten Wesens.<br />
Zweitens, daß nicht alle Vorstellungen gleich weit voneinander entfernt<br />
abstehen: So haben das Unbedingte und die nicht selbst verursachte erste<br />
Ursache einiges gemeinsam und lassen sich ineinander überführen; doch<br />
kann das im Zuge dieser Untersuchung nicht sofort Notwendigkeit aus<br />
Totalität bedeuten, da die Unbedingtheit der ersten Ursache zuerst nur<br />
relativ zu uns (und dem series rerum) bestünde. Diese modale<br />
Unterbestimmtheit der ersten Ursache, für sich selbst betrachtet, besitzt<br />
auch die bloße Vorstellung eines allerhöchsten Wesens. Drittens ist die<br />
Gleichürsprünglichkeit der Momente der theologischen Idee im engeren<br />
Sinn keineswegs als gewährleistet zu betrachten. Damit wird<br />
komplementär die Grenze der philosophischen Spekulation<br />
nachgezeichnet, die im Umfeld des philosophischen Gottesbegriffes der<br />
drei großen monotheistischen Weltreligionen historisch-ideengeschichtlich<br />
noch möglich sein könnte.<br />
Kant zieht sich hier sowohl vom Problem innergöttlicher Relationen wie<br />
vom Vorstellungskreis des series rerum zurück, ähnlich wie sich später<br />
Hegel einerseits von der eigentlichen Erörterung der innergöttlichen<br />
Trinität anhand logischer dialektischer Vorstellungen mit der<br />
Selbstbewegung des Geistes im Begriff, schon weil eben nur formal<br />
bedacht, verabschiedet, aber diese Bewegung durch das Dasein des<br />
Menschen als Teil der inneren Ökonomie der Welthaltigkeit Gottes wieder<br />
einzuholen versucht. 11 Damit wird allerdings die Stellung des Menschen<br />
im Kosmos, vor allem aber im Schopfungsprozess gegenüber Gott<br />
vermutlich systematisch überbewertet.<br />
11 Karl Josef Wallner, Gott als Eschaton. Trinitarische Dramatik als Voraussetzung<br />
göttlicher Universalität bei Hans Urs von Balthasar, Heiligenkreuzer Studienreihe,<br />
Bd. 7 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz, hrsg. vom Verein<br />
der Heiligenkreuzer Hochschulfreunde, Heiligenkreuz/Wien 1992
— 1157 —<br />
B. OMNITUDO REALITATIS UND TRANSZENDENTALES<br />
IDEAL, PROTOTYPON TRANSCENDENTALE UND ECTYPA<br />
1. Zur Stellung des transzendentalen Ideals in der Deduktion<br />
und in der Ideenlehre<br />
Aus welchen Motiven kam der Vergleich der Fassung des<br />
transzendentalen Ideals in § 12 der Deduktion mit der Fassung aus dem<br />
Kapitel über das prototypon transcendentale in der Ideenlehre der<br />
Dialektik, der den Fortgang der Untersuchung weiter bestimmt hat,<br />
zustande?<br />
a) Von § 16 wird man zu § 15, und von dort zu § 12 geführt. Von da aus<br />
wurde zunächst als Referenzstück die Fassung des transzendentalen Ideals<br />
aus der Dialektik (Ideenlehre) herangezogen. Die daraus<br />
hervorgegangenen Untersuchungen zur »Einheit des Begriffs vom Objekt«<br />
(§ 12) und vom »Begriff vom einzelnen Gegenstand« (Ideal der reinen<br />
Vernunft) konzentrieren sich auf die Frage: Was ist ein Begriff und was soll<br />
ein Begriff aussagen können?<br />
b) Methodisch interessiert daran primär das Zusammentreffen von darin<br />
enthaltenen Definitionen des Begriffs einerseits mit der Bezeichnung des<br />
Problems als eines des »transzendentalen Ideals«. In beiden geht es um die<br />
Bestimmung der Einheit des Begriffes; in gewisser Hinsicht könnte man<br />
sagen, es geht in beiden Fällen auch um die qualitative Bestimmung der<br />
Einheit des Begriffes.<br />
c) Gemäß der Vorgangsweise interessiert zunächst sekundär die<br />
architektonisch freilich selbst zentrale Frage nach dem Verhältnis von<br />
Verstandesbegriffe, Vernunftbegriffe einerseits und von Ideen und Ideale<br />
andererseits.<br />
Der hier vorgelegte Untersuchungsgang stößt also auf Überlegungen, die<br />
zweifelsfrei für die Ausbildung von Regeln für den verstandesgemäßen<br />
Gebrauch von Vorstellungen (Ideen, notiones) im Rahmen empirischer<br />
Erkenntnis und insbesondere für die transzendentale Überlegung über die<br />
Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnissen überhaupt von<br />
systematischer Bedeutung sind, aber offenbar selbst schon Anlass zu<br />
Untersuchungen der reinen Vernunft werden. Das hat sich deutlich<br />
anhand der Untersuchung des Satzes vom Widerspruch im »Obersten<br />
Grundsatz aller analytischer Urteile« vor dem Hintergrund<br />
wesenslogischer Äußerungen noch des späten Kants (Schrift gegen
— 1158 —<br />
Eberhardt) zeigen lassen. Deshalb habe ich auch daran festgehalten, vor<br />
der eigentlichen Untersuchung des Schematismus, der Verstand und<br />
Sinnlichkeit verbinden soll, die Definitionen der zentralen Begriffe von<br />
Objekt und Gegenstand aufzusuchen; offenbar gehen derlei Definitionen<br />
aber auf die eine oder andere Weise schon auf Vernunftbegriffe zurück<br />
oder greifen auf solche vor, weil sie sich auf die Funktionsweise des<br />
Verstandes nicht nur im Gebrauch desselben gegenüber der Sinnlichkeit<br />
beziehen und insofern deren Funktion nicht ausschließlich formal im Sinne<br />
der transzendentalen Ästhetik, der Konstruktion in reiner Anschauung<br />
oder der Algebra verstanden werden kann, sondern bereits zuvor oder<br />
unabhängig davon die Idee der Systematik und Axiomatik voraussetzt.<br />
Daß hier nunmehr zwei Fassungen des transzendentalen Ideals diskutiert<br />
wurden, hat also zunächst nur den Grund, daß nach der transzendentalen<br />
Ästhetik und der metaphysischen Deduktion in Gestalt der Analogie<br />
zwischen logischer Tafel und kategorialer Tafel des Urteilens gegen Ende<br />
der Darstellung derselben in § 12 das transzendentale Ideal als Quelle der<br />
Einheit des Begriffs vom Objekt (somit nur seiner Realmöglichkeit nach)<br />
hervortritt; und zwar gleichberechtigt neben dem § 13, welcher die<br />
Unterscheidung der pragmatischen Aneignung von Kenntnissen (quid<br />
facti) von der Rechtfertigung derselben zur Erkenntnis (quid juris)<br />
behandelt, und in die praktische Vernunft führt. Der § 14, der gemeinhin<br />
als Abschluß der metaphysischen Deduktion in der zweiten Fassung der<br />
ersten Kritik gilt, ist der Abschluß der Behandlung des logischen<br />
Leitfadens, als welcher die logische Tafel der kategorialen Tafel<br />
vorangestellt worden ist, und zugleich die Überleitung zum<br />
Schematismusproblem zwischen Verstand und Sinnlichkeit. — In §§ 12-13<br />
werden demnach die Bedinungen genannt, die nicht selbst zum<br />
Schematismus zwischen Verstand und Sinnlichkeit gehören:<br />
transzendentales Ideal in qualitativer Hinsicht der Begriffsbestimmung<br />
und die Frage nach dem Besitz von Kenntnissen und deren<br />
Rechtmäßigkeit in praktischer Hinsicht. Ich werde nun gemäß den<br />
Präliminarien der transzendentalen Analytik des empirischen<br />
Verstandesgebrauches die Frage nach der Einheit von theoretischer und<br />
praktischer Vernunft (sei diese nun analytisch oder synthetisch zu<br />
erreichen) wieder hintanstellen, und den § 12 in der Deduktion als<br />
denjenigen Teil der Transzendentalphilosophie vorstellen, der neben der<br />
Logik (logische Tafel und logischer Leitfaden), der Mathematik und<br />
Geometrie in den konstitutiven Kategorien, und den mathematischen
— 1159 —<br />
Naturwissenschaften (vgl. die Bedeutung der M. A. d. N. in den<br />
Erläuterungen zum synthetischen Grundsatz der Kausalität) als<br />
ideengeschichtliche Bedingung im engeren Sinn hinzukommt: das logische<br />
Kernstück der platonisch geprägten scholastischen Ontologie, also des<br />
ontologischen Gottesbeweises, der erstmals von Anselm von Canterbury<br />
formuliert worden ist. Kant aber formuliert in § 12 das transzendentale<br />
Ideal induktionslogisch um, während er das transzendentale Ideal in der<br />
Dialektik, insbesondere im Abschnitt zum prototypon transcendentale, zur<br />
intellektuellen Totalität von Quidditas, Quaetas und Existenz zu<br />
bestimmen vorgibt. Nebenbei sollte damit noch auch eine erste Definition<br />
von Individualität anhand des Zusammentreffens von Singularität,<br />
Totalität und Existenz vor jeder philosophischen Anthropologie<br />
notwendig geworden sein, was diesen ersten Rundgang freilich endgültig<br />
überfordert.<br />
Unbestreitbar bleibt, daß die Stellung des transzendentalen Ideals und der<br />
Idee vom prototypon transcendentale im Gedankengang Kants nicht allein<br />
anhand der Diskussion der Verhältnisse zwischen § 12 und den ersten<br />
zwei Abschnitten (Allheit, Allgemeinheit) des Kapitels über das<br />
prototypon transcendentale selbst aufgeklärt werden kann, wie es gemäß<br />
meines bisherigen Gedankengangs zum Ideal der reinen Vernunft im<br />
dritten Abschnitt scheinen könnte. Das anhand der strukturellen<br />
Ähnlichkeit zwischen den Kriterien aus § 12 einerseits und den ersten<br />
beiden Stadien der Bestimmung des Ideals als Prinzip der durchgängigen<br />
Bestimmung eines Dinges im »Das transzendentale Ideal. prototypon<br />
transcendentale« genannten Kapitel angestrengte Verhältnis andererseits<br />
gipfelte nun in einer Interpretation der Kriterien des Ideals der reinen<br />
Vernunft (der Begriff von einem einzelnen Gegenstand) durch die kritische<br />
Darstellung der Wesenslogik, wie sie im ersten Teil des zweiten Abschnitts<br />
in der Untersuchung des obersten Grundsatzes aller analytischen Urteile<br />
gegeben worden ist. Damit ist ein Unterschied in der Auffassung vom<br />
transzendentalen Ideal in der metaphysischen Deduktion (§ 12) und in der<br />
Ideenlehre der Dialektik deutlich geworden, den ich anhand der<br />
Unterscheidung in Induktion und Deduktion kenntlich zu machen<br />
versucht habe. Bemerkenwert daran ist zweifellos insbesondere<br />
hinsichtlich der Untersuchung des § 16, daß die Kriterien der Umbildung<br />
des scholastischen transzendentalen Ideals in § 12 den Nachweis der<br />
synthetischen Einheit nur a posteriori und analytisch erlauben;<br />
selbstverständlich ist es jedoch, wenn in der Dialektik gezeigt wird, daß
— 1160 —<br />
der Begriff vom einzelnen Gegenstand ein Produkt der Vernunftidee ist.<br />
Daß die Darstellung des transzendentalen Ideals zum Ende der<br />
metaphysischen Deduktion der Verstandesbegriffe hin verschieden ist von<br />
der Darstellung des transzendentalen Ideals in der Ideenlehre der reinen<br />
Vernunft überrascht also nicht, ohne das deshalb schon alle Verhältnisse<br />
verstanden worden wären.<br />
Die Behandlung des transzendentalen Ideals als prototypon<br />
transcendentale geht über die bloße qualitative Bestimmungsproblematik<br />
der Washeit in den ersten beiden Stadien der Allheit und der<br />
Allgemeinheit als Ideal oder Prinzip der durchgängigen Bestimmbarkeit<br />
eines Dinges wie auch über die modallogische Interpretation im<br />
spezifischen Zusammenhang mit der zum Existenzprädikat des<br />
Individuellen zugerichteten Essenz des Wesensbegriffes im<br />
transzendentalen Ideal als Idee des Singulären hinaus, und vollführt die in<br />
der ersten Fassung des Paralogismus erkenntlich gewordene Subreption<br />
im Begriff von der Substanz des Daseins 12 noch zweimal: Zuerst im<br />
transzendentalen Ideal als Wesensbegriff, der in concreto und in individuo<br />
bestimmt ist, und dann im prototypon transcendentale in der Steigerung<br />
von ens realissimum, ens necessarium und ens originarium.<br />
Um einen ersten Überblick zu gewinnen, ist am besten das Kapitel über<br />
das Ideal überhaupt in der ersten Kritik heranzuziehen<br />
(B 595 ff./A 567 ff.), da dort die wichtigsten Aspekte vorgestellt werden.<br />
Der erste Schwerpunkt betrifft die Stellung des Ideals als transzendentale<br />
Vernunftidee in der Kritik der reinen Vernunft, und verweist mit seinem<br />
zentralen Problem (das Ideal als in concreto und in individuo bestimmte<br />
Idee) auf das nächste Kapitel (prototypon transcendentale) [1]. Der nächste<br />
Schwerpunkt betrifft die Vollkommenheit der ganzen Menschheit [2],<br />
schließlich — nach dem Hinweis, daß sich das Ideal von der platonischen<br />
Idee als Gedanke im göttlichen Verstand durch die rein praktische<br />
Bedeutung unterscheide [3] —, zieht Kant noch das Begehrungsvermögen<br />
als eines Ideals fähig heran, obwohl: »Moralische Begriffe sind nicht<br />
gänzlich reine Vernunftbegriffe, weil ihnen etwas Empirisches (Lust oder<br />
Unlust) zum Grund liegt« (B 597/A 569), [4]. Schließlich verhandelt Kant<br />
die Darstellungregeln eines wirklich existierenden Ideals in Gestalt eines<br />
stoischen Weisen, womit man schon mitten im Begründungsgang des<br />
Ideals als Ideal des Schönen wäre [5].<br />
12 Hier im zweiten Abschnitt, beginnend im zweiten Teil, Substanz und Beharrlichkeit
— 1161 —<br />
Zwar erlaubt Kant einem empirisch konkretisierbaren Wesen als<br />
individuiertes Ideal gleich das ganze Gattungswesen zu vertreten (und<br />
zwar eben im Beispiel des stoischen Weisen); doch aber verbietet er, sich<br />
davon Regeln der Darstellung zu machen. — Das erinnert analog an die<br />
Normalidee in § 17 der K.d.U., die nur zur »schulgerechten« Darstellung<br />
zureicht, während das Kunstschöne — teils ohne deshalb gleich zum Ideal<br />
des Schönen zu werden, teils mit dem Ausdruck der inneren Gestimmtheit<br />
des betrachtenden Individuums das Auslangen findend — die bloß<br />
»schulgerechte« Darstellung hinter sich läßt (Kant gibt Beispiele völlig<br />
symmetrischer Gesichtsdarstellungen etc.), und so einerseits das<br />
Individuelle im Abbilden durch die Bereitschaft zur Abweichung in der<br />
reflexiven Beobachtung nicht nur der sinnlichen Form, sondern auch der<br />
inneren Haltung so passiv wie absichtlich zuläßt, andererseits aber die<br />
Abweichung in der Darstellung der äußeren sinnlichen Form und Gestalt<br />
im Einzelfall auch geplant (wenn auch nicht unbedingt als Regel lehrbar)<br />
benützt, um die innere Gestimmtheit zur Darstellung zu bringen. Nur<br />
insofern vermag bildende Kunst oder auch Literatur zur Kunst werden, als<br />
daß ein Genie die für seine Zwecke nötigen Regel zureichend beherrscht,<br />
und dazu noch ohne jede weitere Regel durch die Gunst der<br />
Zusammenstimmung seiner erworbenen Möglichkeiten und Talente weiß,<br />
wo er über die Regeln der bloß richtigen Darstellung hinausgehen muß,<br />
um auch die innere Zweckmäßigkeit (Literatur) des sinnlich Darstellbaren<br />
(bildende Kunst) z.B. in der bildenden Kunst oder z.B. in der Literatur<br />
selbst ausdrücken zu können. Diese Schwierigkeit der Darstellung eines<br />
Ideals in einer Anschauung drückt Kant im Kapitel über das Ideal<br />
überhaupt derart aus:<br />
»So wie die Idee die Regel gibt, so dient das Ideal als U r b i l d e der<br />
durchgängigen Bestimmung des Nachbildes und wir haben kein anderes<br />
Richtmaß unserer Handlungen, als das Verhalten dieses göttlichen<br />
Menschen in uns, womit wir uns vergleichen, beurteilen und dadurch uns<br />
verbessern, obgleich niemals erreichen können. Diese Ideale, ob man ihnen<br />
gleich nicht objektive Realität (Existenz) zugestehen möchte, sind doch um<br />
deswillen nicht für Hirngespinste anzusehen, sondern geben ein<br />
unentbehrliches Richtmaß der Vernunft ab, die des Begriffs von dem, was<br />
in seiner Art ganz vollständig ist, bedarf, um darnach den Grad und die<br />
Mängel des Unvollständigen zu schätzen und abzumessen.« (B 597/A 569)
— 1162 —<br />
Die Analogisierung und Metaphorisierung des Gebrauches des Begriffes<br />
vom »Bild« im Rahmen des Vergleiches von Urbild und Nachbild muß<br />
klar geworden sein. Damit gibt Kant eine Erklärung ab, die weder<br />
verlangt, daß das transzendentale Ideal (welches inhaltlich als<br />
Vernunftidee nur durch transzendente Begriffe bestimmbar ist: in<br />
individuo und in concreto bestimmt) als solche eine empirische Regel der<br />
Erfahrung zu sein habe, noch daß dieses gar keine Beziehung mehr zur<br />
empirischen Erfahrungswelt zu haben brauche: Im Gegensatz zum Ideal<br />
der Regelhaftigkeit naturwissenschaftlicher Prinzipien, die als Normen<br />
unbedingt gelten sollen (was als Anspruch jeweils unabhängig vom<br />
Wissenschaftsfortschritt aufrecht zu halten ist), wird hier ein Ideal<br />
postuliert, das nur mehr für den Menschen tauglich ist, wenn dieser die<br />
Idee einer transzendentalen und philosophischen Anthropologie<br />
auszuhalten vermag, die nicht ontologisch fundiert ist: eine Norm, die<br />
auch nicht unbedingt für alle Individuen einer Gattung gleichermaßen gilt,<br />
sondern zur Veränderung der Gattung wie deren Individuen selbst einen<br />
Maßstab abgibt, und so nicht länger vom aristotelischen Axiom der<br />
Konstanz der Arten, sondern von möglichen Prinzipien der Veränderung<br />
der Arten ausgeht. Sofern nun der Mensch das ist, was Natur<br />
und Geschichte aus ihm gemacht hat, so ist für uns Zeitgenossen jeweils zu<br />
fragen, wie wir miteinander in der gegenwärtigen geschichtlichen Epoche<br />
umgehen. Zur Anleitung der Beantwortung der Frage, wie wir mit uns<br />
und miteinander umgehen sollten, soll schließlich das Ideal dienen. —<br />
Zuvor ist aber dessen Funktion in der Architektonik von<br />
Verstandesgebrauch und (dialektischer) Ideenlehre im Rahmen der ersten<br />
Kritik näher zu verfolgen, worauf gemäß in dieser Arbeit waltendem<br />
Erkenntnisinteresse zuletzt nochmals das Hauptaugenmerk gelegt wird.<br />
2. Teilbegriff und ganzer (möglicher) Begriff: Das wesentliche<br />
Prädikat und die Idee der qualitativen Durchbestimmung<br />
Im Dritten Abschnitt wurde der Begriff vom einzelnen Gegenstand (das<br />
Ideal der reinen Vernunft) gegenüber dem Begriff vom Objekt (die<br />
qualitative Einheit des Begriffes in § 12) als aus dem Wesensbegriff<br />
abgeleitet, bzw. selbst als »wesentliches Prädikat« vorgestellt, dessen<br />
Qualifikation zur Allgemeinheit der Geltung allerdings einer Definition<br />
bedarf. Ich habe meine Auffassung der Kantschen Wesenslogik (vgl. 2.<br />
Abschnitt, Die wesenslogische Erörterung) dazu benutzt, im dritten
— 1163 —<br />
Abschnitt das erste Kriterium des Begriffs vom einzelnen Gegenstand (das<br />
kein Prädikat des Begriffes aus anderen Prädikaten abgeleitet sein darf)<br />
gemäß der Unterscheidung in Prädikate ut constitutiva und Prädikate ut<br />
rationata (die meiner Auffassung nach eben nicht ausschließlich die<br />
extraessentiellen Attribute betrifft) dahingehend zu interpretieren, daß der<br />
Begriff vom einzelnen Gegenstand ein Begriff des durch die wesentlichen<br />
Prädikate ut constitutiva gerechtfertigte Intuitionen (Anschauungen oder<br />
Ideen) aus dem Satzsubjekt in rechtfertigbare Prädikate ut rationata<br />
verwandelt werden. Insofern ist der Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
nicht selbst der ursprüngliche Begriff des Wesens. Kant hat also<br />
verschiedene gute Gründe, das Ideal der reinen Vernunft vom<br />
transzendentalen Ideal zu unterscheiden.<br />
Ein Grund kann immanent genannt werden: Es handelt sich um den<br />
Teilbegriff, der als Gegenpol zur bloß qualitativen Menge der für sich<br />
mittels Rückführbarkeit der Folgen rechtfertigbarer Merkmale (Quaetas)<br />
gemäß der Untersuchungen im ersten Abschnitt für die »ganze<br />
Vorstellung« eines Gegenstandes verantwortlich sein sollte. Diese Fassung<br />
des Teilbegriffes hatte immer schon die Schwierigkeit, zwischen conceptus<br />
singularis (worin das Konzeptuelle in der einzelnen Anschauung<br />
schlußendlich aufgelöst wird) und der aristotelischen Definition der<br />
Washeit zu stehen, worin die kategorialen Merkmale eines Objektes der<br />
Erfahrung zu einer inneren Organisationsform als zusammengefügt zu<br />
denken sind (Quidditas). Kant erklärt dies bekanntlich für ein<br />
Mißverständnis der aristotelischen Kategorienlehre; Definitionen von der<br />
Art des principiums individuationis können von der transzendentalen<br />
Kategorienlehre gar nicht geleistet werden. Es hat bei Kant, allerdings aus<br />
verschiedenen Gründen, auch den Anschein, das Merkmal des<br />
Teilbegriffes der ganzen Vorstellung eines Gegenstandes wäre nicht selbst<br />
einfach ein Teil der qualitativen Einheit des Begriffes vom Objekt, obgleich<br />
der Teilbegriff zumindest einen Teil der qualitativen Merkmale des<br />
Begriffs vom Objekt organisieren können sollte. Zweifellos ist diese<br />
monadologisch anmutende Differenz in der Unterscheidung der zwei<br />
logischen Prinzipien der durchgängigen Bestimmung eines Dinges (Allheit<br />
der möglichen Prädikate und Allgemeinheit oder Notwendigkeit des<br />
wesentlichen Prädikates) unmittelbar von Bedeutung. Meine Interpretation<br />
der behandelten Fragen ergibt also<br />
1. aus der Unterscheidung der qualitativen Einheit der Merkmale eines<br />
Begriffes und den Teilbegriffen, die im allgemeinen (Jäsche: generellen)
— 1164 —<br />
Merkmal die »ganze Vorstellung« des Gegenstandes (Subjekt) möglich<br />
machen soll (Erster Abschnitt)<br />
2. aus der Darstellung der wesenslogischen Möglichkeiten der Kantschen<br />
Auffassung in der Antwort auf Eberhard, daß in der Unterscheidung in<br />
Pradikate ut constitutiva und Prädikate ut rationata die letzteren nicht als<br />
bloße attributa extraessentiale aufzufassen sein können (Zweiter<br />
Abschnitt)<br />
3. aus der Interpretation des ersten Kriteriums des Begriffs vom einzelnen<br />
Gegenstand (Ideal der reinen Vernunft) als wesenslogisches Kriterium,<br />
welche die Notwendigkeit der nicht-komparativen Allgemeinheit erklären<br />
soll (Dritter Abschnitt)<br />
zusammen den Versuch einer wesenslogischen Definition eines Begriffes<br />
eines einzelnen Gegenstandes, der selbst gegenüber dem Wesensbegriff<br />
ein Teilbegriff bleiben muß. Die hier vertreten Auffassung, daß die<br />
Unterscheidung in Prädikate ut constitutiva und ut rationata einen<br />
synthetischen Aspekt besitzt, wird durch folgender Überlegung Kantens<br />
unterstützt: »Die theilbegriffe meines wirklichen Begrifs (die ich darin<br />
denke) sind analytisch; die des bloß moglichen gantzen Begrifs sind<br />
synthetische Merkmale.« (Refl. 2290, XVI, S. 301; nach 1776)<br />
Zwar wird hier der erhobene Anspruch der Teilbegriffe, eine »ganze<br />
Vorstellung« des Gegenstandes repräsentieren zu können, gegenüber dem<br />
»wirklichen Begriff« relativiert, doch bleibt zweierlei festzuhalten: Erstens<br />
eben dieser Übergang von »ganzer Vorstellung« zum »wirklichen Begriff«<br />
und den darauf folgenden Übergang vom »wirklichen Begriff« zum<br />
»gantzen Begriff«, was hier gleich noch von Wichtigkeit sein wird.<br />
Zweitens die Kennzeichnung des »bloß möglichen gantzen Begrifs« durch<br />
synthetische Merkmale, die zu den analytisch (aus dem intuitum des<br />
conpetus singularis — Anschaung — oder aus der Quidditas gewonnen<br />
Merkmale) hinzukommen müssen, um einen ganzen Begriff möglich zu<br />
machen. Dieser ganze Begriff ist offenbar nicht der der Vorstellung der<br />
Vollständigkeit der qualitativen Einheit der Merkmale des Begriffs vom<br />
Objekt oder der der Allheit der möglichen Prädikate eines Dinges, und<br />
unterstreicht die den Kantschen Überlegungen immanente Möglichkeit, im<br />
Rahmen der Wesenslogik wie damit gemäß meines Vorschlages auch im<br />
Rahmen des ersten Kriteriums des Begriffs vom einzelnen Gegenstand mit<br />
dieser Möglichkeit auch ein synthetisches Urteil a priori, oder doch dessen<br />
»Urbild«, voraussetzen zu müssen.
— 1165 —<br />
Nachdem in diesem Zusammenhang im dritten Abschnitt außer Streit<br />
gestellt worden ist, daß auch die transzendentale Beurteilung der<br />
Verhältnisse der Prädikate im wesenslogisch fundiertem Allgemeinbegriff<br />
logische und nicht selbst transzendentale Verhältnisprädikate ergeben,<br />
versteht sich schon von selbst, daß noch ein weiterer Schritt der<br />
Überlegung aussteht. So folgt denn auch im Kapitel über das<br />
transzendentale Ideal (prototypon transcendentale) im Abschnitt von der<br />
theologischen Idee nach einem Exkurs zur logischen und zur<br />
transzendentalen Negation der Übergang vom Ideal der reinen Vernunft<br />
zum transzendentalen Ideal. Das Ideal, so Kant im Kapitel über das Ideal<br />
überhaupt, sei der durch eine bloße Idee durchbestimmte Begriff eines<br />
Dinges: »Aber noch weiter, als die Idee, scheint dasjenige von der<br />
objektiven Realität entfernt zu sein, was ich das Ideal nenne, und worunter<br />
ich die Idee, nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein<br />
einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares, oder gar bestimmtes Ding,<br />
verstehe« (B 596/A 568). Wenn auch noch offen bleiben muß, was genau<br />
unter »in individuo« (als unteilbares) bestimmbares Ding zu verstehen<br />
sein kann, so könnte diese Aussage als mit dem Ideal der reinen Vernunft<br />
für erfüllt angesehen werden. Was nun ist das transzendentale Ideal? Ich<br />
gebe zuerst die zentrale Stelle wieder:<br />
»Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein<br />
transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam<br />
den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädikate der Dinge<br />
genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders,<br />
als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahre<br />
Verneinungen sind alsdenn nichts als Schranken, welche sie nicht genannt<br />
werden könnten, wenn nicht das Unbeschränkte (das All) zum Grunde<br />
läge. [I]« (B 603 f./A 575 f.)<br />
»Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines<br />
Dinges an sich selbst, als durchgängig bestimmt, vorgestellt, und der<br />
Begriff eines entis realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil<br />
von allen möglichen entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was<br />
zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird.[II]<br />
Also ist es ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen<br />
Bestimmung, die notwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird,<br />
zum Grunde liegt, und die oberste und vollständige materiale Bedingung<br />
seiner Möglichkeit ausmacht, auf welche alles Denken der Gegenstände<br />
überhaupt ihrem Inhalte nach zurückgeführt werden muß. [III] Es ist aber
— 1166 —<br />
auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig<br />
ist; weil nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von<br />
einem Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt, und als Vorstellung<br />
von einem Individuum erkannt wird.[IV]« (B 604/A 576)<br />
Punkt (I) wird im Anschluß ausführlich im Rahmen der Untersuchungen<br />
zur Problematik der Umfangsbestimmung des omnitudo realitatis, des ens<br />
realissimum und des transzendentalen Obersatzes behandelt. Die<br />
Behandlung von Punkt (II) geht von der Vorstellung aus, daß unser<br />
Verstand uns nur Teilbegriffe vom nur möglichen ganzen Begriff eines<br />
Dinges geben kann; auch weil in der aktuellen sinnlichen Erfahrung nicht<br />
alle möglichen Prädikate der Erfahrung gegeben werden können. Von hier<br />
ausgehend wird objektive Realität oder gleich die Wirklichkeit eines<br />
Dinges durch die Idee vollständiger Vorstellbarkeit des Dinges in allen<br />
seinen möglichen Prädikaten gedacht. Insofern bleibt die Rückkehr zum<br />
ersten logischen Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines Dinges<br />
(Allheit) wohl motiviert, auch wenn es zu einem Vereinbarungsversuch<br />
zweier widerstreitender Methoden führt: Abgesehen von der besonderen<br />
Problematik, die mit dem omnitudo realitatis verbunden ist, sieht man sich<br />
im transzendentalen Ideal vor der Schwierigkeit, einen Begriff zu denken,<br />
der sowohl gemäß der kategorialem Quantum der Allheit wie gemäß dem<br />
logischen Quantum der Allgemeinheit als durchbestimmt gedacht zu<br />
werden verlangte. — Gegenläufig ist die strategische Notwendigkeit der<br />
Reduktion der Allheit der möglichen Prädikate durch den<br />
Allgemeinbegriff, um auf die reinen Verstandesbegriffe zu kommen, aus<br />
logischer und transzendetalästhetischer Hinsicht zu bedenken.<br />
Die Kerndefinition des transzendentalen Ideals in Punkt (III) erlaubt die<br />
Möglichkeit einer rein modallogisch auf Existenz gehende Untersuchung<br />
gemäß des Verstandesvermögens. Die genannte transzendentale<br />
Beziehung erfolgt aber nicht auf das Ding, sondern auf den Inhalt der<br />
Vorstellungen, was nur der Beziehung des Existenzprädikates auf<br />
Vorstellung bei Kant entspricht. Das aber zeigt, daß doch ein Unterschied<br />
zwischen der modallogischen und der transzendentallogischen<br />
Betrachtungsweise liegt, und es sich nicht nur um zwei verschiedene<br />
Ansatzpunkte des selben Problems handelt. Hiezu gehört auch ein Exurs<br />
zur doppelten Verwendung des Begriffes »Stoff« bei Kant im<br />
Zusammenhang des Überganges vom transzendentalen Ideal zum<br />
Prototypon transcendentale, woher da der transzendentale Inhalt<br />
genommen wird (vom Begriff des einzelnen Gegenstandes als ein von
— 1167 —<br />
einer Idee durchbestimmten Allgemeinbegriff, oder das wesentliche<br />
Prädikat), und im Zusammenhang des Übergangs vom Inbegriff aller<br />
Möglichkeit zum Inbegriff aller Prädikate überhaupt (also als Vielheit vor<br />
der Heraushebung der Beziehung von Merkmalen auf Dinge), wo die<br />
Merkmale von der mit dem Inbegriff aller Möglichkeit bezeichneten Stelle<br />
der transzendentalen Reflexion in den »Inbegriff aller möglichen Prädikate<br />
überhaupt« (Vielheit, ohne expliziten Bezug auf Dinge) übernommen<br />
werden. Das heißt gemäß der Textlage aber nichts anderes, als daß die<br />
transzendentalen Inhalte in der Vorbereitung zur Bestimmung der Allheit<br />
von der »transzendentalen Materie« genommen worden sind, während<br />
der transzendentale Inhalt des Ideals als prototypon transcendentale und<br />
Urbild aller ectypa im wesentlichen Prädikat des Allgemeinbegriffes<br />
anhand des Kriteriums des Ausschlusses aller aus anderen Prädikaten<br />
abgeleiteten Prädikate gewonnen worden ist.<br />
Hier tritt in aller Schärfe die Sonderstellung des ersten Kriteriums des<br />
Ideals der reinen Vernunft in wesenslogischer Interpretation hervor. Zwar<br />
ist schon mit der Einschränkung der als ursprünglich angesetzten Vielheit<br />
der Merkmalsaussagen (mögliche Prädikate überhaupt) auf die Allheit<br />
möglicher Prädikate eines Dinges durch die explizit gemachte Bedingung,<br />
auf ein Ding beziehbar zu sein, auch die wahrhaft<br />
transzendentalphilosophische, weil kritische Frage aufgegeben worden,<br />
inwieweit hier nicht vergeblich abstrakt-unbestimmte Positionen der<br />
transzendentalen Reflexion erörtert werden, deren Artefakt diese<br />
Beziehbarkeit auf Dinge dann bloß sein müßte; oder ob nicht besser gleich<br />
von einer unbestimmt-allgemeinen Besonderheit die Rede sein soll, die<br />
allererst eine solche Einschränkung zustande bringt. Diese aufzubringen<br />
brächte aber eine ganz andere Schwierigigkeit mit sich, die in der<br />
Identsetzung der Differenz zweier bloßer grammatikalischer Positionen<br />
(von der Subjektstelle zum Satzgegenstand) der Charakteristik der<br />
Einzelheit, die mit dem Konzeptuellen an und für sich verbunden ist, mit<br />
dem Konzeptuellen selbst liegt. Ursprünglich liegt jeder Urteilslehre in<br />
psychologischer Hinsicht eine Intentionalitätslehre zu Grunde, deren<br />
Grundriss hier im vierten Abschnitt über die Funktionen der<br />
Einbildungskraft gegeben wurde.<br />
Die Verfaßtheit der Intentionalität, die als Fombestimmung vor der<br />
Beschreibung der Akteinheit als geregelten prozessualen und sukzessiven<br />
Ablauf in einer Urteilslehre des Verstandesgebrauches grob in modo in<br />
recto und modo obliquo unterschieden werden kann, besitzt neben der
— 1168 —<br />
Forderung klar und distinkt von anderen Orientierungen der<br />
Aufmerksamkeit unterscheidbar zu sein, die Eigentümlichkeit oder<br />
Besonderheit, spätestens in der reflektierenden analytischen<br />
Rückwendung vom Bedeuteten zur Form des Zeichenhaften dieser<br />
Bedeutung (Vico’s kontextueller Zusammenhang von Symbolen und<br />
einfachen Zeichnungen) die nämliche Differenz wie die Einzelheit als ein<br />
Charakteristikum des Konzeptuellen selbst aufzuweisen, indem in der<br />
Unterscheidung der Charakteristik der Intentionalität, auf Vorstellungen<br />
oder Begriffe gerichtet zu sein, keinen Unterschied machen muß im<br />
Gegenstand, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Diese<br />
Orthogonalität der Intention (die selbst keineswegs schon objektive<br />
Realität behaupten kann, vgl. Höffle ◊) hat nun an sich, daß unabhängig<br />
vom Gegenstand, worauf die Aufmersamkeit gerichtet ist (also sei er auch<br />
gar kein Ding, das im Ideal der reinen Vernunft als einzelner Gegenstand<br />
gedacht werden könnte) im Begriff ein logischer Gegenstand gedacht wird,<br />
worauf sich die Vorstellung beziehen kann, auch dann, wenn die<br />
Bestimmungstücke eines (wirklich möglichen) Dinges außerhalb der<br />
Merkmale des Ausgangsbegriffes liegen (Bolzano WL I, Einheit, Ganzheit,<br />
Ding sind logisch gesehen idente Bedeutungen). Davon zu unterscheiden<br />
ist die auch von Bolzano und Brentano benutzte »Modalität« des logischen<br />
Gegenstandes, gewissermaßen im Zuge eines ursprünglich<br />
philosophischen »Physikalismus« in der Sprachphilosophie, die sich darin<br />
eröffnet, daß jede vernünftige und entscheidbare Aussage letztlich auf<br />
einen Existenzialsatz, der die Existenz von A aussagt, rückführbar sein<br />
muß. Diese Überlegung hat Schelling am gründlichsten durchgeführt<br />
(transzendentale Freiheitsschrift), ◊ indem er den Anschein von bloß<br />
formallogischer Identsetzung von A = B als transzendentale Operation im<br />
Rahmen der topoi des »inesse« entlarvt hat, und so für die formale Logik<br />
eine transzendentale Logik einfordert, die die Beziehung der formalen<br />
Logik auf das für diese Identsetzung logisch vorausgesetzte<br />
transzendentale Objekt einzuholen imstande ist. Bloß logische<br />
Gegenstände erfordern hingegen keine transzendentale Operation zur<br />
Identsetzung von Wesensbegriff (Satzsubjekt) und Satzaussage: Entweder,<br />
weil sie nur über einfache Qualitäten aussagen (Grundurteile), ohne daß<br />
deshalb wirklich über deren Einfachheit im Sinne von Ursprünglichkeit<br />
etwas entschieden worden wäre, denn diese »Einfachheit« gründet allein<br />
darin, daß Aussagen über »einfache« Qualitäten einfach sind. Diese<br />
Einfachheit gründet sich aber, wie schon früher gezeigt, nicht auf<br />
Unterscheidungen im Sinne primärer und sekundärer Sinnesqualitäten
— 1169 —<br />
Lockes; vielmehr heißen diese Qualitäten einfach, weil sie<br />
Einklammerungen darstellen, derart, daß sie zwar Konzepte besitzen, aber<br />
selbst keine Vorstellung einer Quidditas; m. a. W. einen logischen<br />
Gegenstand, aber kein Ding an sich besitzen. — Oder aber es handelt sich<br />
um Elemente einer rein logischen Untersuchung über<br />
formalwissenschaftlich relevante Verhältnisse der Logik und Grammatik.<br />
Dann besteht eine andere Art von Differenz als die transzendentale<br />
zwischen Idee (als Urbild der Wesensbegriff) und Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand. Immer noch ist der gemeinte Gegenstand als getrennt von<br />
den Formalismen seiner Darstellung (Konstruktion) zu denken, doch<br />
besitzt dieser weder garantiert ein mit dem Konzept deckungsgleiches<br />
Ding an sich noch weist er von selbst in gleicher Intentionsrichtung auf<br />
eine selbstständige, vom eigenen Dasein auch als getrennt denkbare<br />
Existenz wie die Aussagen über die sogenannten »einfachen« Qualitäten.<br />
— Schließlich erzeugt die Analyse der Intentionalität den bloß logischen<br />
Gegenstand rein ohne jede Differenz zwischen Idee und Begriff.<br />
3) Zum reinen Inhalt des Denkens: Intellektualität und<br />
Spontaneität.<br />
a) Franz Brentanos subjektive Grundlegung der Intentionalität eines<br />
empirischen Verstandesurteils und die Formalontologie<br />
Die hier erfolgte Abhebung des logischen Gegenstandes aus der reinen<br />
Intentionslehre, frei von jeder transzendentallogischen Anmutung, soll<br />
also modallogisch neutral sein, in modo recto denkmöglich sein, und allein<br />
wegen der Analyzität ihrer Reflektiertheit auf die begriffliche Verfaßtheit<br />
der untersuchten Intentionsklasse als formalisierendes höherstufiges<br />
Prädikat überhaupt möglich sein. — Es »gibt« also ein Merkmal, freilich<br />
nur formalwissenschaftlich fixierbar, das zum »Inhalt« einer reinen<br />
gebundenen (geregelten) Spekulation und als solcher als eine nicht aus der<br />
Erfahrung stammenden Besonderheit bezeichnet werden kann, obgleich<br />
niemand bezweifeln wird, daß dergleichen nur von jemand gedacht<br />
werden kann, der nicht nur auch geregelte Erfahrung zu machen, sondern<br />
auch anzustellen imstand ist. Als solches will ich es auch nur im Voraus als<br />
ein Zeichen der Vernünftigkeit ansehen, insofern schon die Idee einer<br />
möglichen Systematik nichts anderes als vernünftig genannt werden kann,<br />
und als solche in Gestalt der logischen Tafel (als systematische Behandlung
— 1170 —<br />
der Formen logischen Urteilens und Schließens bereits in Bezug auf das<br />
transzendantallogische Problem) der Deduktion der Tafel der Kategorien,<br />
freilich eher als logischer Leitfaden denn als Fundament (vgl. Klaus Reich,<br />
Vollständigkeit der Kantschen Urteilstafel, S. 10 f.), vorausliegt. Die reinen<br />
Verstandesbegriffe entspringen nicht einfach der Formalität der logischen<br />
Systematik. Der formalwissenschaftlich fixierbare »Inhalt« reiner<br />
Spekulation liegt sowohl der Deduktion der Kategorien wie der davon zu<br />
unterscheidenden Deduktion der Vernunftbegriffe (die aber ohne erfolgter<br />
Deduktion der Kategorien gar nicht als Analogie in der<br />
Vernunftspekulation nach logischen und dialektischen Gebrauch<br />
untersucht werden könnte) voraus. Einen solchen eigenen »Inhalt« des<br />
Denkens hat Brentano andauernd wegen des Problems der Idealität der<br />
Mathematik geleugnet, obwohl er etwa anhand der Unterscheidung des<br />
Satzes »Der Baum ist grün« vom Satz »Der Baum ist nicht grün« feststellt,<br />
daß im ersten Satz der Baum wie das Grün in recto gedacht werden, im<br />
zweiten Satz wegen des verneinten Prädikats (als nicht-P) zum in recto<br />
gedachten Baum auch der Baum, von dem das Grün-sein geleugnet wird,<br />
in obliquo gedacht wird, was letztlich so viel besagt, als daß wir einen<br />
prädikativ Urteilenden denken müssen:<br />
Im Aufsatz »Von der attributiven Vorstellungsverbindung in recto und in<br />
obliquo« (Psychologie II, Anhang 4) 13 beginnt Brentano mit einer Analyse<br />
der Vorstellungsinhalte. 14 Bei der Vorstellung eines nichtgrünen Baumes<br />
wird (gemäß Bolzanos Interpretation der Kopula mit hat, hier m.E. nach zu<br />
recht) geleugnet, daß wir der Vorstellung eines Baumes die Vorstellung<br />
»nicht-grün« als Eigenschaft zusprechen könnten. Vgl. Kastil: Lotze, S. 207<br />
»Stelle ich mir einen grünen Baum vor, so denke ich den Baum in recto<br />
und wohl auch das Grüne in recto und identifiziere dabei Vorstellungen.<br />
Stelle ich dagegen, wie man sagt, einen nicht grünen Baum vor, so scheint<br />
das Verfahren ein viel komplizierteres; denn Aristoteles wenigstens<br />
leugnete, daß ein Negatives Objekt sein könnte. Und wenn dies, wie ich<br />
nicht bezweifle, wirklich möglich ist, so bleibt wohl nichts übrig, als<br />
anzunehmen, daß wir einen Baum vorstellen, von welchem man mit recht<br />
leugne, daß er grün sei, sodaß es sich um eine Identifikation in obliquo<br />
handelt.« O. Kraus dazu in Anmk. 3: » Wenn wir einen Baum vorstellen,<br />
13 Der Anhang wurde der zweiten Auflage aus dem Jahre 1911 von Brentano selbst<br />
beigefügt; die erste Auflage erschien 1874.<br />
14 Und zwar ähnlich wie die von Bolzanos zur imaginären Vorstellung<br />
vorgenommenen Untersuchungen. WL I, § 70
— 1171 —<br />
von welchem man mit Recht leugnet, daß er grün sei, so leugnen wir nicht<br />
etwas von etwas, fällen nicht selbst ein prädikatives Urteil, d.h. negativabsprechendes<br />
Urteil, sondern wir stellen einen Baum in modo recto vor<br />
und stellen einen synthetisch Urteilenden vor, der einem als den Subjekte<br />
der vorgestellten Leugnung indirekt vorgestellten (,) Baume das Grün<br />
richtig abspricht und identifizieren beide (direkt bzw. indirekt)<br />
vorgestellten Bäume. Um den Baum [in obliquo GWC] als „Subjekt eines<br />
absprechenden Urteils“ vorzustellen, müssen wir einen in dieser Weise<br />
prädikativ Urteilenden vorstellen.«<br />
Brentano nennt das bekanntlich paradoxerweise eine Vorstellung »sine<br />
fundamentum in re«, offenbar ohne zu bedenken, das Descartes eben res<br />
cogitans und res extensa unterschieden hat. Die von mir insinuierte<br />
Formalität der reinen Spekulation, die auch intensional auf Totalität geht,<br />
würde aber nicht zureichen, um einen prädikativ oder sonst Urteilenden<br />
befriedigend vorzustellen, es sei denn in seinen allgemeinen intelligiblen<br />
Aspekten, die aber mit den im Beispiel verlangten kategorialen und<br />
grammatikalischen Bestimmungen nichts mehr oder noch nichts zu tun<br />
haben. Keineswegs soll damit einer Formalontologie eine eigene<br />
Seinsweise angedichtet werden, doch gehört es zur Tendenz zur Totalität,<br />
daß sich formalontologische Fragen in rein modallogische Fragen<br />
verwandeln, was Brentano in seiner Logik in der ersten Psychologie auch<br />
präzise beherzigt hat. Im reflektierenden Rückblick, bei aller Vermengung<br />
der logischen Untersuchung schon bei Leibniz, sind die<br />
formalontologischen Aspekte reiner Vernunftspekulation und deren<br />
verschiedenen Quellen aber zum Thema zu erheben. — Die Beschränkung<br />
scheint schon im Begriff Formalontologie zu liegen: Das Formale ist im<br />
allgemeinen Subjektivismus des transzendentalen Idealismus nicht länger<br />
Gegenstand einer Idee von Wissenschaft, welche die Bestimmungsstücke<br />
der kontingenten Existenz als »Materie« der Realität und Wirklichkeit in<br />
ihrem Wesen über ihrer sinnlichen Erscheinung hinaus als eigentlicher<br />
Seinsgrund ausmacht, und insofern selbst wohl weder platonisch noch<br />
aristotelisch zu verstehen. Nur in dieser die Form der Intelligibiltät der die<br />
spinozistischen Substanzphilosophie zerbrechenden Weise, welcher den<br />
Determinismus der Natur nicht mit dem Determinismus der Intelligibilität<br />
kurzschließt, ist es möglich, ein »es gibt« für die Bestimmbarkeit formaler<br />
Momente der reinen Vernunftspekulation vor oder unabhängig der<br />
Untersuchung der Analogien der Kategorien des Verstandesgebrauches in<br />
der reinen Vernunft (was die transzendentalen Ideen erst ergibt)
— 1172 —<br />
auszumachen. Daß es die Mühe nicht lohne, weil offenbar die<br />
formalontologische Spekulation im Zuge der Tendenz zur Totalität sich<br />
gewissermaßen von selbst in eine rein modallogische Erörterung rettet, die<br />
in zu fordernder Allgemeinheit betrachtet selbst allerdings erst recht frei<br />
von jedem transzendentalen Inhalt zu sein scheint, kann nunmehr trotz<br />
der Kritik hinsichtlich der Natur der heranzuziehenden Prämissen wie in<br />
architektonischer Hinsicht nicht mehr behauptet werden.<br />
Nunmehr geht es im Ideal der reinen Vernunft (dann immer schon<br />
wiederum nur als Ideal vom Allgemeinbegriff einzelner Gegenstände)<br />
offenbar um eine andere Art von Idee als eben um die bloße Wiederholung<br />
der Positionsbestimmung als Besonderes, welches in der transzendentalen<br />
Beziehbarkeit auf Dinge als zureichendes Prinzip (Leibniz) schon aus der<br />
bereits untersuchten selbst intelligiblen Natur des Verstandes das<br />
Besondere auch als bloßes Artefakt erscheinen lassen mag. Der<br />
transzendentalanalytische Ursprung bleibt hingegen<br />
transzendentalsubjektivistisch auf Erkenntnisgründe bezogen; die<br />
transzendentalanalyisch und kritisch geprüfte (also wissenschaftliche)<br />
Metaphysik soll in ihrer Depotenzierung aus der Idee (oder Ideen) ein<br />
wesentliches Prädikat entlassen (vgl. 2. Abschnitt, 1. Kapitel), was von<br />
dieser Abstraktheit aus zunächst neuerlich nur als hinreichender Grund<br />
zur Annahme (Hypostasierung) eines auch qualitativ besonderen<br />
transzendentalen Inhalts außer des modalen Prädikats der Existenz und<br />
außer dem formalwissenschaftlich fixierbaren Prädikat der reinen<br />
Spekulation und der ihr unweigerlich innewohnenden Tendenz zur<br />
Formalontologie angesehen werden kann.<br />
b) Die Grundlosigkeit der transzendentalen Analytik und der Anschein<br />
genetischer Ursprünglichkeit.<br />
Meine Auffassung in dieser Frage ist seit dem zweiten Abschnitt bekannt:<br />
Die Erörterung des »Obersten Grundsatzes aller analytischen Urteile« habe<br />
hinreichend den synthetischen Charakter der dem Satz vom Widerspruch<br />
zugrunde liegenden Ableitung aus dem »logischen Wesensbegriff« und<br />
dessen Unabhängigkeit von einer transzendentalen Zeitbedingung gezeigt.<br />
Deshalb muß notwendigerweise das wesentliche Prädikat schon vor jeder<br />
abstrakten Bestimmung in der rein modallogischen Erörterung, die Essenz<br />
mit Existenz gleichsetzt (modales Prädikat in Totalität), durch einen<br />
(bestimmbaren) transzendentalen Inhalt unterschieden sein. Der noch<br />
mögliche Anschein von logischer Analyzität dieses Satzes kommt aber nur
— 1173 —<br />
daher, daß eben bereits immer eine Synthesis vorausgesetzt worden ist.<br />
Ohne die vollständige Analyse unserer geschichtlichen und<br />
gesellschaftlichen Position zwischen ideengeschichtlichen Ansätzen und<br />
den Formenkreis von Lebensmächte kann die kritische Würdigung unserer<br />
notwendigen Verklammerung mit der primären Intenionalität nicht<br />
erfolgen. Da diese Vorgangsweise der Kofundamentierung, wenn auch auf<br />
verschiedenen, erst wieder zusammenzuführenden Gebieten, nur abermals<br />
in bloße Empirie führen müßte, kann sie auch nicht für eine streng<br />
transzendentalidealistische Argumentation tauglich sein. Der genetische<br />
Anschein der Analyzität im Voraussetzen der Bedingungen als Idee vom<br />
Ursprung steht jedoch unwidersprechbar grundsätzlich im Verdacht, das<br />
Artefakt der Methode der transzendentalanalytischen Untersuchung des<br />
Verstandesgebrauches zu sein, welcher eben von den<br />
Rahmenbedingungen der primären Intentionalität und ihrer<br />
transzendentalen Gegenwendigkeit ausgeht. Ohne Entscheid über die<br />
offenen Fragen zur Umfangsbestimmung der verschiedenen Fassungen<br />
des Prinzips der durchgängigen Bestimmung (ohne Bestimmung des<br />
Exponenten von aptitudo und Prinzip) kann aber auch in der<br />
restringierten Fassung der Metaphysik letztlich keine andere Antwort<br />
gegeben werden, als daß das wesentliche Prädikat, welches nach dem<br />
ersten Kriterium des Allgemeinbegriffes des Ideals der reinen Vernunft<br />
(Begriff vom einzelnen Gegenstand als durch eine Idee durchgängig<br />
bestimmt) nicht nur von der Vielheit der möglichen Merkmale überhaupt,<br />
sondern auch von der Allheit möglicher Prädikate eines Dinges überhaupt<br />
per definitionem unterschieden sein muß, was letztlich in abstraktformaler<br />
Hinsicht trotz der Steigerung ins Ideale (Totum und Totalität der<br />
Bestimmbarkeit) über die Schwierigkeit einer nicht-transistorischen<br />
Bestimmung des Teilbegriffes gegenüber der Einheit einer Anschauung<br />
oder Ganzheit einer Vorstellung nicht hinausgekommen ist.<br />
Es ist damit klar, daß im Ideal der reinen Vernunft von der Version der<br />
bloß modallogischen Gleichsetzung von Essenz und Existenz Abstand<br />
genommen werden muß, aber es ist auch vom ersten Prinzip der<br />
durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels Merkmalsprädikaten<br />
gemäß der Definition des kategorialen Quantums der Allheit Abstand zu<br />
nehmen wegen des ersten Kriteriums des wesentlichen Prädikates, das<br />
nicht von anderen Prädikaten abgeleitet werden soll (Allgemeinheit des<br />
Begriffs vom einzelnen Gegenstand). Diese Verschiedenheit bleibt<br />
grundlegend und kann auch nicht auf logischem oder
— 1174 —<br />
transzendentallogischem Wege völlig in die Quidditas zurückgebogen,<br />
oder als ursprüngliche Weise des Gegebenseins aufgefaßt werden,<br />
vielmehr werden verschiedene Konstitution- und Reflexionsstufen<br />
aufeinanderbezogen. Nur in formaler Betrachtung schließt sich das<br />
wesentliche Prädikat im Ideal der reinen Vernunft dem Problemkreis des<br />
Teilbegriffes an, das wesentliche Prädikat ist das Produkt der<br />
wesenslogischen Interpretation der Regel des ersten Kriteriums des Ideals<br />
der reinen Vernunft: nicht aus anderen Prädikaten abgeleitet zu sein, und<br />
sollte zunächst nur erlauben können, abstrakt-unbestimmt den<br />
transzendentalen Inhalt gegenüber der Tendenz zur reinen<br />
formalontologischen und modallogischen Spekulation festzuhalten. Der<br />
Teilbegriff soll gegenüber der Ganzheit des möglichen Begriffs und<br />
gegenüber der möglichen Anschauung des konkreten und individuellen<br />
empirischen Gegenstandes — freilich nur selbst als Objekt der Erfahrung<br />
— habhaft werden können, insofern der Teilbegriff ausreicht, den<br />
(empirischen, oder der bloß fraglichen) Gegenstand, und nicht nur seine<br />
Merkmale in Prädikate zu denken. Dies steht bekanntlich im Kontrast zur<br />
Auffassung aus dem § 12 der Deduktion, daß im Begriff des Objektes nur<br />
Begriffsmerkmale versammelt wären und ein solcher Begriff nur eine<br />
Raphsodie empirischer Merkmale sein könne. Das wesentliche Prädikat als<br />
Grund der Notwendigkeit der Allgemeinheit des Begriffes vom einzelnen<br />
Gegenstand findet einen ausgezeichneten (besonderen) Teilbegriff, der in<br />
der Steigerung des formalen Idealismus zum Ideal der reinen Vernunft,<br />
d. i. der Begriff vom einzelnen Gegenstand selbst, wird.<br />
Punkt IV (»Es ist aber auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die<br />
menschliche Vernunft fähig ist; weil nur in diesem einzigen Falle ein an<br />
sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst durchgängig<br />
bestimmt, und als Vorstellung von einem Individuum erkannt wird«): Der<br />
Übergang von der Bestimmung des Begriffs durch eine Idee (Ideal der<br />
reinen Vernunft) zur Bestimmung eines Begriffs durch einen allgemeinen<br />
Begriff (transzendentale Idee) gelingt also nicht entlang der einfachen<br />
modallogischen Gleichsetzung von Essenz und Existenz durch völlige<br />
Abstraktion. Die andere Möglichkeit, zwischen Ideal der reinen Vernunft<br />
und transzendentalem Ideal zumindest hinsichtlich der verlangten<br />
Einzelheit Äquipollenz herzustellen, ist die Herstellung der Beziehbarkeit<br />
aller Merkmale (entschränkt als Vielheit des Inbegriffs aller möglichen<br />
Prädikate überhaupt) auf ein Ding mittels des transzendentalsubjektiven<br />
Zuschreibungsurteiles aller Vorstellungen als die meinen. Diese zum
— 1175 —<br />
ersten Kriterium des Begriffes vom einzelnen Gegenstand nur scheinbar<br />
gegenläufige Erweiterung des Gebrauchs vom Existenzialsatz vermag<br />
spekulativ ohne paralogistisch zu werden zu einem anderen universalen<br />
und wesentlichen Prädikat des transzendentalen Idealismus und<br />
transzendentalen Subjektivismus zu führen als das rein abstraktive<br />
modallogische Argument: Eingedenk, daß die Idee der Welt verschieden<br />
von der bloßen Konstruktion und Addition ihrer Elemente ist, daß aber<br />
beide Vorstellungen als notiones in transzendentalsubjektiver Hinsicht als<br />
gleichursprünglich zugeschrieben werden müssen, ist die erste und<br />
einzige noch verbleibende Voraussetzung der qualitativen und totalen<br />
Erfüllung eines Teilbegriffes zur Ganzheit des möglichen Begriffes die<br />
Möglichkeit, dem dann schon selbst wieder qualitativ besonderen<br />
Teilbegriff ein Substrat zu unterschieben, worauf sich ursprünglich<br />
unabhängig von jeder Qualität, dann zunächst modallogisch, schließlich<br />
auch transzendentallogisch unterschiedslos Merkmale beziehen lassen.<br />
Dieses Substrat könnte abstrakt-unbestimmt auch die perzepierende und<br />
apperzipierende Monade oder deren innerer Sinn sein. — Derart kann der<br />
Übergang von der Bestimmung eines Begriffes durch eine Idee (Ideal der<br />
reinen Vernunft) zur bloßen Bestimmung eines Begriffs durch einen Begriff<br />
(transzendentales Ideal) schon geleistet sein, wenn die fragliche Existenz<br />
des Fragenden diesen Übergang bereits transzendental voraussetzt. Das<br />
damit erreichte Verständis für die selbst wiederum allgemeinunbestimmte,<br />
und deshalb rein formale Bestimmung des Bewußtseins<br />
durch sich selbst ist eben wegen der innerhalb dieser Formalität als<br />
erreichbar vorgestellten Identität von Essenz und Existenz schon selbst nur<br />
ideal zu denken möglich, dennoch wird damit eine eigene Qualität<br />
konstituiert, was das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zur rein<br />
modallogischen Betrachtung ausmacht. Die Dialektik der<br />
transzendentallogischen Untersuchung führt derart zu einer<br />
modallogischen wie zu einer transzendentalsubjektivistischen Lösung;<br />
letztere führt unterschiedslos alle höherstufigen Prädikate auf einen schon<br />
ursprünglich bekannten Existenzialsatz zurück: cogito ergo sum. Das<br />
ergibt aber zumindest ein Kriterium, woran das transzendentale Ideal<br />
gemessen werden kann: Der Begriff vom einzelnen Wesen soll ein<br />
Individuum bestimmen. Daß alle der in innerer Erfahrung gegebenen<br />
Merkmale bereits als Vorstellungen dieses nur allgemein-unbestimmt<br />
gedachten Individuums anzusehen sind, führt zum ursprünglichen<br />
Kriterium des transzendentalen Ideals, daß das eines jeden Ideal ist: Das<br />
Individuum soll konkret, also durchgängig bestimmbar sein.
— 1176 —<br />
Das ist im entwickelten Umkreis der primären Intentionalität bekanntlich<br />
auch genau entgegengesetzt formulierbar: Das (der formalen Möglichkeit<br />
nach) vollständig konkret Bestimmbare muß als Einzelnes in Raum und<br />
Zeit bestimmbar sein. Die Verlagerung und Umorientierung des<br />
intentionalen Gefüges auf einen anderen Zielpunkt verliert aber die<br />
explizite Beziehung zum transzendentalästhetischen Fundament der<br />
Erkenntnisgründe. Damit müßte man sich mit abstrakt-unbestimmt<br />
bleibenden Seinsgründen zufrieden geben, die außerhalb der Systematik<br />
der Erkenntnisgründe des transzendentalen Subjektivismus des<br />
transzendentalen Idealismus liegen. — Vollständig und konkret im Sinne<br />
des transzendentalen Ideals aber ist der Begriff vom Wesen aber nur dann<br />
bestimmt, wenn es ideal als Begriff eines Einzelnen und ideal gegenüber<br />
der Mannigfaltigkeiten aller diesem Einzelnen möglichen Merkmale<br />
bestimmt werden kann. Das aber ist eben auch nur ideal denkbar, wenn<br />
das unbestimmt denkmögliche Mannigfaltige der Totalität<br />
notwendigerweise durch Beziehbarkeit aller Mannigfaltigkeit<br />
untereinander und jeweils zum abstrakt Einzelnen, also auf zwei Wegen<br />
zum abstrakten Einzelnen führt, und das abstrakt denknotwendige<br />
Einzelne notwendigerweise zur unbestimmten Mannigfaltigkeit der<br />
Totalität. — Offenbar macht die logische Unterscheidung in einen Begriff<br />
eines Dinges aus der Totalität der prädikativen Durchbestimmung und aus<br />
dem Teilbegriff, der das Objekt als Ganzes vorzustellen erlaubt, den<br />
Wechsel der Intentionsrichtung mit.<br />
c) Zum epistemologischen Verhältnis von Allgemeinheit und Wesenheit<br />
im transzendentalen Ideal. Die Bestimmung des Teilbegriffes durch die<br />
Idee oder durch den Begriff<br />
Die im transzendentalen Ideal erkannte Vorstellung eines Individuums<br />
soll die Einheit von Existenzprädikat und transzendentalem Inhalt<br />
garantieren, wie zuvor schon die Einheit der Einen Anschauung durch die<br />
Einheit der Anschauung in der Beziehung auf einen bestimmten und<br />
einzelnen Gegenstand garantiert worden ist. — Einerseits das Scheitern<br />
der Bemühungen zwischen formaler Anschauung, reiner Anschauung und<br />
Verstandesbegriff, ein vollständiges Schema der Erzeugung eines<br />
einzelnen und konkret zum Individuum bestimmten Gegenstandes<br />
zustande zu bringen; andererseits die technisch-praktische Erzeugbarkeit<br />
einer Reihe von Arten von Gegenständen, die dem ersten Befund des<br />
Ergebnisses des transzendentalen Schematismus zu widersprechen
— 1177 —<br />
scheinen: Zwar kann die Eigenschaft, ein einzelner und konkret<br />
bestimmter Gegenstand sein zu sollen, auch als bloßer heuristischer<br />
Vernunftbegriff gedacht werden, und als solcher für verschiedene (viele,<br />
alle) Arten von Dasein gelten, doch wird das Substrat des jeweiligen<br />
Daseins nicht in jedem Falle mit der Strenge des Anspruches als<br />
Individuum zu gelten bedacht werden — das Individuum ist in diesem<br />
Rahmen eigentlich immer noch das Dasein des Erkenntnissubjekts in der<br />
Gewärtigung des transzendentalen Subjekts als Einklammerung der<br />
praktischen Vernunft als oberes Begehrungsvermögen, was zum topos der<br />
theoretischen Vernunft führt, wo der Verstand die Sinnlichkeit als Medium<br />
des sinnlich Gegebenen und die Vernunft die Sinnlichkeit als unteres<br />
Begehrungsvermögen dominiert. Kant schreibt dazu: »Es ist aber auch das<br />
einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig ist; weil<br />
nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von einem<br />
Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt, und als die Vorstellung<br />
von einem Individuum erkannt wird« (B 604/A 576). Zweimal wird hier<br />
das Ideal der reinen Vernunft als Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
angesprochen. Zuerst ersehe ich das aus der Formulierung »allgemeiner<br />
Begriff von einem Dinge« insbesondere wegen der geforderten<br />
Allgemeinheit des Begriffs, zum Zweiten sagt die Formel des Begriffs<br />
»durch sich selbst durchgängig bestimmt« deutlich das gleiche über den<br />
Begriff vom einzelnen Wesen (transzendentales Ideal) wie über den Begriff<br />
vom einzelnen Gegenstand, »der durch die bloße Idee durchgängig<br />
bestimmt ist« 15 In der gleichen Formel wird »Wesen« mit »Gegenstand«<br />
und einmal »Begriff« mit »Idee« getauscht.<br />
Offenbar hat dieser Tausch damit zu tun, daß nunmehr der Begriff letztlich<br />
sich selbst bestimmt, während im Ideal der reinen Vernunft der Begriff von<br />
der Idee bestimmt wird. Nun läuft die Idee in Gefahr als bloßes Produkt<br />
der Abstraktion zur leeren Gedankenform zu werden, so wie die einzelne<br />
Anschauung ohne intuitus auf ein Objekt jede Einheit zu verlieren droht,<br />
wenn man hier nicht die immanente logische Gegenständlichkeit einer<br />
zureichend ausgerichteten Intention (Aufmerksamkeit) in Betracht zieht.<br />
Der Begriff vom einzelnen Gegenstand, wird er durch eine bloße Idee<br />
bestimmt, ist ohne die wesenslogische Erörterung allein in der logischen<br />
Gegenständlichkeit der ortogonalen Intentionalität fundiert (diese ist für<br />
Objektivität — allein — nicht geeignet). Das entsprechende logische<br />
Charakteristikum des transzendentalen Ideals ist nun, daß ein Begriff den<br />
15 B 602/A 574
— 1178 —<br />
Begriff vom einzelnen Wesen durchgängig bestimmen soll. Das soll<br />
offensichtlich mit dem Unterschied des Begriffs vom einzelnen<br />
Gegenstand und des Begriffs vom einzelnen Wesen zu tun haben. Kants<br />
Abhebung des transzendentalen Ideals vom Ideal der reinen Vernunft ist<br />
nicht eine rein logische, und kann nicht allein aus der Unterscheidung<br />
anhand der Bestimmbarkeit des Begriffes durch eine Idee oder durch einen<br />
Begriff formal begründet werden. Es gibt zwar einen Grund aus der<br />
logischen Spekulation, der erfüllt aber nur Kriterien gemäß objektiver<br />
Gültigkeit, nicht aber Kriterien objektiver Realität. Kant zieht hier einen<br />
außerlogischen Grund heran: Die Bestimmung des Begriffs des logischen<br />
Wesens zum ganzen möglichen Begriff durch den Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand ist gemäß den hier gegebenen Untersuchungen gar nicht<br />
möglich gewesen (hatte nur hypothetischen oder normativen Charakter);<br />
erst die Prädikate ut rationata machen sicherlich den Satzgegenstand aus.<br />
Es ist die Wahl der Art des Gegenständlichen (des Konzeptes), die nun im<br />
Fortgang der Bestimmung zum transzendentalen Ideal einer rein logischen<br />
Bestimmung vorhergehen muß: Es muß die Vorstellung eines<br />
Individuums der Gegenstand sein, daß es überhaupt möglich ist, einen<br />
Begriff als durch einen Begriff auch transzendentallogisch für bestimmbar<br />
zu halten, ansonsten nichts als die reine Formalität, aber kein<br />
transzendentales Ideal herausspringen müßte.<br />
Bevor ich auf diese Auswahl näher eingehe, die konsequent den Verlust<br />
des transzendentalen Inhalts einer rein formalontologischen Spekulation<br />
hintertreibt, die in der Reinheit der Modallogik (im empirischen<br />
Verstandesbegriff noch mit dem Zeitinhalt verknüpft) ihren Schlußpunkt<br />
vor sich zu sehen scheint, möchte ich die Aufmerksamkeit nochmals auf<br />
die Frage lenken, um welche Begriffe es sich hier handelt. Es geht hier um<br />
die Bestimmbarkeit eines Wesensbegriffes (transzendentales Ideal) durch<br />
einen Allgemeinbegriff (Ideal der reinen Vernunft). Durch diese<br />
Bestimmbarkeit soll allererst der Begriff des Wesens zu einem Begriff vom<br />
einzelnen Wesen werden, dessen Vorstellung (Merkmalsumfang) das<br />
Existenzprädikat heraushebbar (explizit) der selbst nur allgemeinsten<br />
Möglichkeit nach als bloße mögliche Position umfaßt. Das setzt allerdings<br />
die Bestimmbarkeit eines Dinges durch die Allheit möglicher Prädikate<br />
und deren Weiterbestimmung durch die logische Teilung der Menge<br />
dieser Prädikate als Entgegensetzung von wahren und falschen möglichen<br />
Prädikaten voraus. Die Frage ist, in welchem Sinne ist das im<br />
transzendentalen Ideal überhaupt möglich, wenn Kant von Beginn an den
— 1179 —<br />
logischen Vergleich der Prädikate vom transzendentalen Vergleichs eines<br />
Dings unterscheidet? Nur als formale Voraussetzung, daß das<br />
Existenzprädikat zumindest in dieser das Wahre wie das Falsche<br />
umfassenden Sphäre immer schon analytisch als enthalten gedacht sein<br />
muß? Das wäre trivial, ließe sich diese Vorausgesetztheit als nur implizite,<br />
also nicht bestimmte Heraushebbarkeit des Existenzpräikates bezeichnen.<br />
Im Begriff vom einzelnen Wesen soll durch den Allgemeinbegriff, der ein<br />
wesentliches Prädikat ist, das Existenzprädikat bereits explizite, also<br />
bestimmt, und als solches heraushebbar enthalten sein. Damit wäre der<br />
Grund für die Vorausgesetztheit der Allheit als Bestimmungsstück des<br />
transzendentalen Ideals im Begriff vom einzelnen Wesen für die<br />
aufgeworfene Frage hinreichend als auch für das dem zweiten logischen<br />
Prinzip der Durchbestimmung vorausgesetzte Mannigfaltigkeit geklärt. Im<br />
Begriff vom einzelnen Wesen soll aber nicht nur das Existenzprädikat mit<br />
dem bloßen Begriff vom Wesen als letzter abstrakter transzendentaler<br />
Inhalt verbunden werden, indem der im Satzgegenstand (und nicht mehr<br />
ihm Satzsubjekt gesuchte) zugängliche Begriff vom Wesen ein<br />
Allgemeinbegriff sein muß. Im Begriff vom einzelnen Wesen ist nicht nur<br />
eine sowohl durch den Allgemeinbegriff von der Allheit verschiedene<br />
Bestimmungsart des Konkreten (das Besondere) wie zugleich die<br />
Bestimmbarkeit des Konkreten durch die Allheit der möglichen Prädikate<br />
angezeigt, sondern es soll noch die Vorstellung eines Individuellen<br />
notwendig machen. Es ist zu beachten, daß es ausgerechnet der<br />
Allgemeinbegriff ist, der den Wesensbegriff überhaupt zu einem Begriff<br />
vom einzelnen Wesen zu machen verspricht. Das Einzelnsein gehört<br />
demnach nicht von selbst zum Wesen; ob deshalb nicht, weil das<br />
Einzelnsein erst synthetisch zum Wesensein hinzukommen muß, oder ob<br />
einfach deshalb nicht, weil das Einzelnsein wie das Existenzprädikat<br />
abstrakt und formal in der logischen Entgegensetzung nur implizite, also<br />
bloß unbestimmt und nicht heraushebbar in der Vorstellung vom Wesen<br />
überhaupt enthalten ist, muß gar nicht entschieden sein.<br />
Mein Interpretationsgang nach Allheit und Allgemeinheit stellt darüber<br />
hinaus einen Wechsel in den Kriterien von objektiver Realität fest: Zuerst<br />
ist die Totalität der möglichen Prädikate eines Dinges der Nachweis des<br />
Überganges von subjektiver zur objektiven Realität, dann die<br />
Notwendigkeit (Allgemeinheit) der als wesentlich zu qualifizierenden<br />
Prädikate des selbst nicht durchbestimmbaren und sich entziehenden<br />
»logischen« Wesensbegriffes.
— 1180 —<br />
Im transzendentalen Ideal wird zur Beanspruchung des Überganges zur<br />
objektiven Realität von Kant immer noch das Kriterium der Totalität der<br />
Prädikate herangezogen, während der Begriff von einem einzelnen<br />
Gegenstand entweder der komparativen Allgemeinheit oder im Rahmen<br />
der transzendentalen Idee eben der Allgemeinheit qua Notwendigkeit<br />
intrinseci bedarf, um überhaupt ein Konzept allgemein behaupten zu<br />
können, das den Anspruch auf Identifikation eines gegebenen Objekts<br />
leisten könnte. Im transzendentalen Ideal erscheint die Lage aber derart,<br />
als ob die Einzelheit des Gegebenen als Charakateristikum des<br />
Gegenständlichen bereits vorausgesetzt wird. Inwiefern kann dergleichen<br />
vorausgesetzt werden? Ist diese transzendentale Erkenntnis als Produkt<br />
unseres Erkenntnisvermögens oder als dessen Voraussetzung anzusehen?<br />
Diese Frage hat nun mit der Vorstellung von »Individuum« zu tun, und<br />
führt in den hermeneutischen Zirkel. Darauf muß diese Untersuchung<br />
aber gar nicht weiter eingehen; letztenendes weil auch im Paralogismus<br />
die Person nicht (für A: nicht zureichend) Gegenstand der Behandlung<br />
wird. Das Individuum wird in diesem Zusammenhang nicht als Begriff<br />
der Psychologie, Anthropologie, Willensphilosophie oder<br />
Rechtsphilosophie eingeführt, auch nicht als Quelle der (transzendentalen)<br />
Einbildungskraft oder einfach der vis repräsentatio, sondern im<br />
transzendentalen Wesensbegriff als Begriff einer primär rationalen<br />
Bewußtseinsphilosophie.<br />
Stellt dieser Begriff des Individuums dieses bereits mit Perzeption und<br />
Apperzeption begabt vor, dann ist eine Idee der numerischen Einheit zwar<br />
nicht ohne gegebene Mannigfaltigkeit, diese aber doch nicht selbst als<br />
numerische Einheit der Mannigfaltigkeit zugleich gegeben, und somit ist<br />
zweifelsfrei die numerische Einheit die des perzepierenden Indivdiuums<br />
— und eben weil als solche erkannt, zugleich die des apperzipierenden<br />
Individuums. Damit kann, so meint wohl Kant, zumindest die Einzelheit<br />
unseres subjektiven Daseins im Individuum als gesichert angesehen<br />
werden, was eine einigermaßen zufriedenstellende Erklärung des Formel<br />
wäre, daß im Begriff vom einzelnen Wesen derselbe Begriff durch einen<br />
allgemeinen Begriff bestimmt werden könnte und nicht nur durch eine<br />
Idee: weil wir uns als urteilende und denkende Wesen dieser unser<br />
Einzelheit im Selbstdenken ursprünglich bewußt werden können. Insofern<br />
wäre das transzendentale Ideal sowohl als in concreto und in individuo<br />
bestimmt wie auch als Allgemeinbegriff vorstellbar.
— 1181 —<br />
d) Die Position der Möglichkeit des Existenzprädikats einer Vorstellung<br />
und die intellektualistische Auflösung des Paralogismus der<br />
substanzialisierenden Selbstzuschreibung meiner Vorstellungen in der<br />
Entschränkung der Allheit eines Dinges zum omnitudo realitatis<br />
Das Existenzprädikat in transzendentallogischer Betrachtung steht, so<br />
könnte man es kurz skizzieren, als Prädikat höherer Ordnung<br />
gewissermaßen senkrecht zur Typenlehre Russells, und ist bis zum Ideal<br />
der reinen Vernunft (der Allgemeinbegriff als Wesensbegriff und explizite<br />
als Begriff vom einzelnen Gegenstand) nur analytisch im Begriff enthalten,<br />
da es im Allgemeinbegriff als Teilbegriff vorrangig um die Bestimmung<br />
der Quidditas geht; das bedeutet demnach, das Existenzprädikat ist nur<br />
der Möglichkeit nach im Begriff enthalten, was soviel heißt, es hat eine<br />
systematische Stelle im Begriff bestimmt bekommen. Im Übergang zum<br />
transzendentalen Ideal wird nun das Besondere als Einzelnes analytisch<br />
herausgehoben; der Mangel, daß das Existenzprädikat nur der Möglichkeit<br />
nach im Begriff enthalten ist, soll aber dadurch behoben werden können,<br />
daß nun eine entschränkte Allheit dem Prinzip der Durchbestimmung<br />
zugrundegelegt worden ist. Damit wird dem transzendentalen Ideal mehr<br />
angeboten als der sinnlichen Anschauung selbst ohne den ausdrücklichen<br />
Bezug Einer Anschauung auf ein gegebenes Etwas, nämlich durch eine<br />
unlimitierbare Prädikation das absolute Individuum oder das Individuum<br />
absolut zu setzen. {vgl. Leibniz Übergang zur unendlichen modalen<br />
Analyse sowohl für notwendige wie für kontingente Wahrheiten}. Dem<br />
Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels Prädikate<br />
widerstreitet die Entschränkung der Allheit, die ja nicht einfach zur<br />
Ausgangsposition der uneingeschränkten Vielheit zurückspringt, sondern<br />
eben, komplementär konsequent weitergedacht, nur ins völlig<br />
Unbestimmt-abstrakte (ens imaginarium oder nihil negativum,<br />
B 348/A 292 ◊ƒ) gedacht wird, nicht selbst. Allerdings öffnet dieser<br />
Kunstgriff die Spekulation dem Sinnlosigkeitsverdacht und der Willkür<br />
der uneingeschränkten (primärnarzistischen) transzendentalen Freiheit,<br />
deren notwendige Idee aus der bloßen Intelligibilität unseres Daseins<br />
entspringt ebenso, wie damit auch vorgezeigt wird, daß die Freiheit der<br />
Wahl, letztendlich der Wahl der Haltung, das Individuum zur<br />
apperzipierende Monade auszeichnet, und nicht das Prinzip der<br />
durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels Prädikate. Im Rückblick<br />
auf das eben Gedachte erscheint es aber zugleich, als hätte sich das Prinzip<br />
der durchgängigen Bestimmung nur in die geschichtliche
— 1182 —<br />
Dimensionsmannigfaltigkeit der Zeit vom Lebenslauf bis zur<br />
Naturgeschichte zu verlagern, um dem Sinnlosigkeitsverdacht (von hier<br />
aus zumindest bis auf weiteres) zu entgehen. Es ist ersichtlich, daß im<br />
ontologisierenden und reontologisierenden Diskurs ausgehend von der<br />
reinen Vernunftidee ein Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines<br />
Dinges, — sei es nun mittels Prädikate, durch wesentliche Prädikate einer<br />
Idee in der Konsequenz des logischen Konzeptes vom Teilbegriff als<br />
Vorläuferschaft der transzendentalen Logik, oder sei es eine Vorahnung<br />
der formalen Grundlagen einer allgemeinen historischen Vernunft —, das<br />
Individuelle gerade wie im ontologisch gefaßten transzendentales Ideal<br />
verlangten Ausmaß nicht zu erreichen vermag. In Folge bricht die<br />
Anwendbarkeit des Prinzips der durchgängigen Bestimmung nicht wegen<br />
dem unbestimmt-abstrakten Negat der entschränkten Allheit in der<br />
Zurüstung zum transzendentalen Ideal in formalontologischer Fassung<br />
weg, sondern wegen der grundsätzlichen Unfähigkeit, einen Exponenten<br />
zu finden, der dieses Prinzip auf die Entdeckung der transzendentalen<br />
Idee der Freiheit anwenden lassen könnte. Wenn also das transzendentale<br />
Ideal, wie verlangt, in concreto wie in individuo bestimmend sein soll, so<br />
ist (zuerst noch ohne Berücksichtigung des Schwindels mit dem implizite<br />
nach wie vor analytisch gesetzten Existenzprädikat) zu verlangen, daß dies<br />
in zwei verschiedenen, relativ unabhängigen Verfahren stattfinde, weil<br />
dergleichen offenbar in einem Zuge nicht zu erreichen sei.<br />
Ebenso offensichtlich ist nun aber, daß erstens die entschränkte Allheit die<br />
prädikative Bestimmbarkeit eines Dinges überhaupt wegen der<br />
Unbestimmtheit der Umstände der Distribution ohne zuvor die Sphäre<br />
aller möglichen Prädikate einschränkenden Teilbegriff (was Besonderheit<br />
verlangt) von vorneherein verhindert; was aber geschieht, wenn der<br />
Teilbegriff sich nicht mehr auf ein Ding überhaupt in abstrakter<br />
Redeweise, vielmehr auf das ens realissimum beziehen soll, ist vom strikt<br />
formalwissenschaftlichen Standpunkt wohl ähnlich unerklärlich wie das<br />
transzendentale Prinzip der Kausalität. Der Teilbegriff löst sich offenbar<br />
nicht in allen Versionen wohlgefällig rechtzeitig auf, um diese<br />
paralogistische Verwechslung zu verhindern, sondern wird zum<br />
Fundament dessen, was imaginiert wird, um sich ein »transzendentales«<br />
Substrat vorzustellen, worauf das, was zunächst daraus entnommen<br />
schien, einfach wieder darauf zurück zu beziehen ist, und derart,<br />
eigentlich von einem Artefakt nicht mehr unterscheidbar, selbst zu einer<br />
Art von allumfassenden Ding wird. — Andererseits kann das einzige
— 1183 —<br />
Individuum, dessen Existenzprädikat nicht nur analytisch der Möglichkeit<br />
nach im Begriff enthalten sein soll, eben nur das intelligible Subjekt der<br />
intellektuellen Spontaneität und der transzendentalen Idee der Freiheit<br />
selbst sein, sodaß dieses gerade als solches nicht auch nur in irgend einer<br />
Hinsicht dem Prinzip der durchgängigen Bestimmung unterworfen sein<br />
kann. Insofern stellt sich nach diesem Schritt im transzendentalen<br />
Reflexionsgang heraus, daß an dieser Stelle über das intelligible Subjekt<br />
und dessen eventuelle Ursächlichkeit nichts weiter gesagt werden kann,<br />
als daß die theologische Idee in der transzendentalen Reflexion der<br />
Spekulation zum intelligiblen Subjekt ihre architektonischen Stellung<br />
erwiesen bekommt.<br />
Die Kritik an der reinen Intelligibilität und Depotenzierung der<br />
theologischen Idee zum archetypus intellectus in der Auflösung der<br />
vierten Antinomie vermag also sowenig wie der Mangel eines<br />
transzendentalen Prinzips in den Erörterungen der theologischen Idee<br />
selbst die Vorstellung vom intelligiblen Subjekt der Spontaneität als<br />
unmöglich zu erklären. Das Hinzutreten des apperzipierenden<br />
Individuums zur von Anbeginn verkurzten formalontologischen (insofern<br />
bereits einmal restringierten) Fassung des transzendentalen Ideals ist<br />
wegen des fehlenden Echos des letzlich wiederum nur spekulativ und<br />
formal der Möglichkeit nach analytisch im Begriff enthaltenen<br />
Existenzprädikats als der entscheidende synthetischer<br />
Verknüpfungsvorgang vor jeder Entscheidung zwischen ens realissimum<br />
und apperzipierender Monade zu verstehen. Die transzendentalsubjektive<br />
Orientierung der Analyse läßt auch hier, wie schon die Paralogismen der<br />
psychologischen Idee erwarten lassen, kein transzendentales Prinzip zu,<br />
was synthetische Urteile a priori allererst möglich machen würde.<br />
Daß nun das existierende Individuum, wenn schon nicht abgeleitet oder<br />
produziert, aber als transzendentales Ideal erkannt wird, mag ein Motiv<br />
für Kant gewesen sein, das ens realissimum als Begriff zu bezeichnen,<br />
zumal im Anschluß in der Gegenüberstellung von »Inbegriff der Realität«<br />
(transzendentaler Obersatz) und »All der Realität« (transzendentaler<br />
Untersatz) zum transzendentalen Syllogismus unter dem Inbegriff nichts<br />
anderes als eben das ens realissimum aus dem transzendentalen Ideal<br />
(aber eben auch später das allerrealste Wesen im prototypon<br />
transcendentale, B 606) zu verstehen ist. Mit Ausnahme einer streng<br />
intensionalen modallogischen Darstellung ohne jeden Bezug auf Quaeitas<br />
und Quidditas erlaubt nur dieser totale Rückbezug auf das existierende
— 1184 —<br />
Individuum, welches ja unzweifelhaft das materiale Apriori des Beginns<br />
einer jeden Philosophie ist, das ens realissmum (das allerrealste Wesen) als<br />
sinnvollen Begriff mit wenigstens realmöglicher Bedeutung zu denken.<br />
Indem jede Erscheinung, in Folge jedes gedachte Ding der Erscheinung, in<br />
Folge jeder Begriff vom Erfahrungsobjekt, etc. (in grober und vorläufiger<br />
Aufstufung der Reflexion) als eine Schichtung von aufsteigenden<br />
Prädikaten, hierin ähnlich wie in der Typentheorie Russells, aufgefaßt<br />
werden kann, wird in der nachcartesianischen Transzendentalphilosophie<br />
das transzendentale Subjekt zum selbstgewissen Gegenstand des<br />
Existenzialsatz, auf welche sich, dann wieder formal gemäß der<br />
Beschreibungstheorie (oder eben Typentheorie der höherstufigen<br />
Prädikate) Russells, alle höherstufige Prädikate beziehen lassen müßten<br />
(Ideal der Affinität). Nur insofern läßt sich die im ursprünglichen Sinn für<br />
jeden perzipierenden Verstand richtige Kritik an der Vorstellung eines<br />
allerrealsten Wesens aufheben: indem das transzendentale Subjekt im total<br />
durchgeführten Zuschreibungsurteil (meine Vorstellung, mein Ding,<br />
meine Welt) nochmals paralogistisch zum Substrat aller Erscheinungen<br />
depotenziert wird. Insofern wird in transzendentalsubjektiver Analogie<br />
(nicht analogia entis) spekulativ auch die Idee vom allerrealsten Wesen als<br />
Attribut des höchsten Wesens komplementär vorstellbar, geht man nur<br />
von der bereits anhand anderer Problemaufstellungen nachgewiesenen<br />
Möglichkeit einer kritisch-transzendental restringierten Metaphysik aus.<br />
Zweifellos reicht eine synthetisch gewordene Metaphysik nicht durchwegs<br />
aus, ihrer Mannigfaltigkeit immanent notwendigen Sätze alle als<br />
synthetische Urteile a priori zu rechtfertigen; immerhin vermag auch der<br />
restringierten Spekulation zur Weiterbestimmung der theologischen Idee<br />
einige Regel und ein Plan alternativer Rundgänge, deren näherer<br />
Zusammenhang bei aller Gelegenheit zu Einblicken und Ausblicken<br />
allerdings gerade weitgehend ungeregelt bleiben muß, anhhand der<br />
Charakterisierung der Neigung der reinen Vernunft zur immanenten<br />
Transzendenz zur Verfügung gestellt werden. Derart scheint es doch<br />
möglich zu sein, der als zur bloßen Spekulation Hinzutretendes<br />
apostrophierte Immanenz der Intelligibilität der reinen Vernunft auch<br />
ohne synthetisches Urteil a priori in der transzendentallogischen<br />
Überlegung einen reellen Inhalt über die rein modallogische Erörterung<br />
hinausgehend zu geben, und zwar, wenn auch spekulativ fortgehend,<br />
formal ganz richtig gemäß der ursprünglichen Bestimmung der formalen<br />
Logik zwischen Intuitivität und Diskursivität.
— 1185 —<br />
Wird aber vor der Einschränkung auf die unrein transzendentale Analogie<br />
zur Deduktion der Kategorien des empirischen Verstandesgebrauches von<br />
der Willkür unseres von jeder Erfahrung entbundenen Verstandes und<br />
deren Totalität als Zerrbild der reinen Vernunft ausgegangen, steht dieser<br />
Art von Regression der intelligiblen Antizipation nach der<br />
transzendentalen Kritik der Dialektik der Vernunftideen, die selbst nur<br />
nach der Einschränkung auf Analogien zu den Verstandeskategorien<br />
möglich geworden ist, nunmehr ein Instrumentarium zur Verfügung, um<br />
die reell ausgedehnte Grenze innerhalb der theologischen Idee sowohl<br />
gegenüber ein sinnloses Ausmaß an Kritik wie gegenüber theosophischen<br />
Ansprüchen zu verteidtigen, welche die Erhabenheit ihrer nahezu<br />
schrankenlos weiterentwickelten Idee mit der Erhabenheit ihres immerhin,<br />
wenn auch nur schwach qualifiziert denkmöglichen Gegenstandes nicht zu<br />
unterscheiden vermögen. Insofern darf meines Erachtens sogar von einer<br />
positiven Auswickelung des transzendentalen Ideals entlang zweier<br />
Achsen; erstens: der wiederum zusammengesetzten allgemeinen<br />
Bedingung der bloß formalen Bedingung der nur als Medium gesetzten<br />
Einbildungskraft des ästhetischen Urteils (der qualitative Pol der Symbolik<br />
gegenüber reiner Algebra) bis hin zu zweitens: der Unterscheidung von<br />
allgemein-konkreten, insofern auch historisch gewordenen Normbildern<br />
vom Ideal des Schönen, gesprochen werden, die a fortiori dazu führt, daß<br />
die Vorstellung der Menschheit in uns den Ausdruck innerer<br />
Gestimmtheit, welche das sinnlich Angenehme erst ins ästhetisch Schöne<br />
eingliedert, zu regieren beginnt. {Benedikt, Phil. Emp. II, ◊} Der Vorzug<br />
dieser Alternative zur formalontologischen Fassung des transzendentalen<br />
Ideals liegt allein in der gesicherten Aussparung des Verfahrens der<br />
mathematischen und dynamischen Erhabenheit, als daß im Ideal des<br />
Schönen keine vorgängige Demütigung der natürlichen Ordnung der<br />
Erkenntnisvermögen (nach wie vor Verstand und Sinnlichkeit, wenn auch<br />
in ein anderes transzendentales Subsumtionsverhältnis eingespannt)<br />
vorauszusetzen ist. — Hier geht es mit der Spurensuche nach der<br />
synthetischen Metaphysik im Rahmen einer bereits ein erstes Mal kritisch<br />
restringierten Formalontologie weiter.
— 1186 —<br />
4. Prinzipien der Wissenschaft und der reinen Ideenlehre.<br />
Metaphysische Grundlagen der Formalwissenschaften?<br />
a) Den Prinzipien von Geometrie, Algebra und Grammatik liegt nicht<br />
die transzendentale Ästhetik zugrunde<br />
Omnitudo realitatis versammelt alle möglichen Prädikate entweder eines<br />
existierenden Dinges oder aller möglichen Dinge (ectypa ), worauf die<br />
Menge aller möglichen Prädikate überhaupt (Vielheit) zu beziehen<br />
genügen würde, eine kategoriale Definition der Allheit zu erhalten. Der<br />
Begriff von einem einzelnen Gegenstand im Ideal der reinen Vernunft setzt<br />
als Wesenslogik hingegen die R e a l m ö g l i c h k e i t nur abstrakt als<br />
Möglichkeit der Vereinbarung von Formalmöglichkeit und<br />
Realmöglichkeit voraus; erst die Vereinigung von Wesenslogik und<br />
Modallogik im Existenzprädikat gibt die Notwendigkeit, für einen<br />
quidditativ eingegrenzten Seinsbezirk die Einzelheit notwendig als<br />
individuell und konkret (prädikativ durchbestimmt) zu denken. Kant hält<br />
damit auch die Transzendentalität als Eigenschaft fest, daß hier nicht nur<br />
über die logische Form, sondern über den Inhalt eine transzendentale<br />
Reflexion angestellt wird. 16 Das ist sein Unterscheidungskriterium von der<br />
modalen Logik, die rein intellektuell ohne weiteres Merkmal Wahrheit =<br />
Allgemeinheit = Existenz (Notwendigkeit) eine abstrakte Ontologie gerade<br />
nicht vermeiden kann. Zur Einsicht, daß und wie diese Notwendigkeit für<br />
sich inhaltlich immer eine bedingte, an sich transzendentallogisch<br />
unbestimmt-allgemein wiederum eine unbedingte Notwendigkeit ist,<br />
kommt man damit nicht. Es geht also um den transzendentalen Inhalt in<br />
den Begriffen, nicht nur um das Existenzprädikat, obgleich dieses<br />
modallogisch entscheidend ist.<br />
Kants redlicher Versuch, mittels des transzendentallogischen Ansatzes<br />
Formallogik wie Modallogik in der Transzendentalphilosophie eine<br />
systematische Beziehung und Stellung zueinander zu geben, zeitigt<br />
letztendlich schon in den Abschnitten der Definition des transzendentalen<br />
Ideals, die nicht schon im Individuum die Einheit von Existenz und<br />
transzendentalen Inhalt vorneweg garantieren, den schmalen Grat<br />
zwischen transzendentaler Logik und Modallogik: »Entis realissimi ist der<br />
Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen<br />
entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was zum Sein<br />
16 B 600/A 573, B 604/A576
— 1187 —<br />
schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird.« 17 Das, »was<br />
zum Sein schlechthin gehört«: das lädt in diesem Zusammenhang ein,<br />
analytisch aus Sein reale Existenz von Seienden überhaupt zu folgern,<br />
doch aber an sich betrachtet ohne Entscheid, ob subjektive oder objektive<br />
Realität. — Zwar hat sich schon längst gezeigt, daß erstens die Existenz des<br />
Daseins als objektive Realität solange fraglich ist, bis Relationsbegriffe die<br />
Erscheinungen als Relationen wirklicher Objekte im Dasein im Rahmen<br />
der Regeln der reinen Anschauungsform zu verbinden vermögen, {1.<br />
Commercium, 2. phaenomenis constitutivis und phaenomenis resultantibus im<br />
30. Brief an Des Bosses als mögliches Unterpfand gegen einen trügerischen Gott,<br />
der bei gleichbleibenden Phänomenen die Ursachen vertauschen könnte} ◊ und<br />
daß zweitens die transzendentalanalytische kritische Untersuchung der<br />
analytischen Metaphysik (Verstandesmetaphysik) zu erkennen gibt, daß<br />
das Existenzprädikat nur der Möglichkeit nach in einem bloß gedachten<br />
Totum enthalten ist. In der Dialektik der reinen Vernunft befindlich hängt<br />
die Entscheidung schließlich nur mehr vom Existenzprädikat ab, wozu das<br />
principium contradictionis als formaler Einteilungsgrund vom Verstand<br />
vorausgesetzt, aber selbst nicht der zureichende Grund ist. Das<br />
Existenzprädikat (nunmehr sowohl als Bedingung für die Bestimmung der<br />
kategorialen Allheit wie für das transzendentale Ideal von Bedeutung)<br />
hängt im Rahmen der Vernunftmetaphysik aber in beiden Darstellungen<br />
nur von der Sinnlichkeit als Quelle der »transzendentalen Materie« ab<br />
(primäre Intentionalität), und hat für sich weder mit der Bestimmung<br />
transzendentaler Verhältnisprädikate noch mit dem Argument des<br />
Anselmschen ontologischen Gottesbeweises aus der Totalität, die größer<br />
nicht sein könnte, zu tun, obgleich Kant trachtet, zwischen den<br />
Argumentationen mittels dem Ganzen des Denkens und dem Ganzen der<br />
Sinnlichkeit etwa im Duisburger Nachlass und in der ersten Kritik<br />
(empirische Postulate) Wirklichkeit in der Konsequenz zu erreichen. Aus<br />
den Logiken (Metaphysiken) her gesehen ist auch für hier gültig zu sagen,<br />
daß die Stellung des principium contradictionis garantieren soll, daß der<br />
zureichende Grund über alle Analogien hinweg immer in der disjunktiven<br />
Einteilung des gegebenen Mannigfaltigen erkennbar bleibt; und das<br />
Existenzprädikat ist eine notwendige Folge des zureichenden Grundes.<br />
Mit diesen logisch-metaphysischen Vorbedingungen verwehrt Kant schon<br />
von seiner transzendentalanalytischen und kritischen Umgestaltung der<br />
rationalen Metaphysik her der Logizität und Mathematizität jeden<br />
17 B 604/A 576
— 1188 —<br />
ontologischen Vorrang vor der Sinnlichkeit: Sowohl die Erörterung des<br />
Existenzprädikates (obwohl selbst nicht auf Objekte der Erscheinungen<br />
sondern auf Vorstellungen als Dinge derselben zu beziehen) wie auch die<br />
vollständige Deduktion der Kategorien zu synthetischen Grundsätzen<br />
(führt zu daseinskonstituierenden Relationsbegriffe außer der<br />
Anschauungsform) können im Schematismusproblem auf die Sinnlichkeit<br />
nicht verzichten. Ohne Sinnlichkeit ist für Kant auch ein System der<br />
Rechtfertigung von innerer Erfahrung als Immanenz schlichtweg<br />
unmöglich. Trotzdem bewahrt für Kant das principium contradictionis<br />
unabhängige Formalität, gerade weil hier zuvor der wesenslogische<br />
Allgemeinbegriff als Begriff vom einzelnen Gegenstand überhaupt als<br />
durch eine Idee bestimmt eben dem nämlichen intensionalen Kriterium<br />
unterworfen ist, das damit bloß transzendentale Subjektivität, also<br />
subjektive Realität erreicht, und eben das Dasein von Gegenständen noch<br />
nicht aus dem objektiv gültig deduzierten transzendentalen<br />
Kausalitätsprinzip gerechtfertigt worden ist. M a. W., hier geht Kant<br />
wieder von der analytischen Fassung des Satzes vom Widerspruch aus, die<br />
auf derjenigen Fassung des Kompossibilitätsprinzips beruht, die<br />
formalontologisch vom Zugleichsein ausgeht, und nicht von der<br />
Leibnizianischen Fassung des principium contradictionis, die das<br />
Zugleichsein selbst, und damit erst auch das principium contradictionis,<br />
innerhalb der series rerum in Bezug auf die jeweils zukünftige<br />
Entwicklungsmöglichkeit setzt. Aus einem ähnlichen, nunmehr wieder<br />
formalontologischen Grund reicht auch die transzendentalästhetische<br />
Grundlegung nicht nur der Geometrie, sondern insbesondere der<br />
Mathematik insgesamt nicht wirklich aus, sondern zeigt schon im Rahmen<br />
der Axiome der Anschauung, daß hier nur die Anwendungsproblematik<br />
(aptitudo, Exponent, aber nicht durchwegs das Prinzip in der reinen<br />
Anschauung der Geometrie und in diesem Zusammenhang gar nicht in<br />
der Arithmetik und Grammatik) behandelt wird, und<br />
Konstruktionsprinzipien in Geometrie und Algebra die eigentliche<br />
Grundlegung dieser Wissenschaften als Formalwissenschaften ausmachen.<br />
Insofern bleibt die Frage nach der Metaphysik oder nach metaphysischen<br />
Anfangsgründen der Mathematik eingangs des § 3 der transzendentalen<br />
Ästhetik aktuell. Zum Ende der Erläuterungen Kants zur tranzendentalen<br />
Ästhetik gibt Kant auch einen weiteren Grund an, weshalb er auf die<br />
metaphysische Grundlegung der Mathematik zu verzichten müssen<br />
glaubt:
— 1189 —<br />
»Es ist auch nicht nötig, daß wir die Anschauungsart in Raum und Zeit auf<br />
die Sinnlichkeit des Menschen einschränken; es mag sein, daß alles endlich<br />
denkende Wesen hierin mit dem Menschen notwendig übereinkommen<br />
müsse, (wie wohl wir dieses nicht entscheiden können,) so hört sie um<br />
dieser Allgemeingültigkeit willen doch nicht auf Sinnlichkeit zu sein, eben<br />
darum, weil sie abgeleitet (intuitus derivatus), nicht ursprünglich (intuitus<br />
originarius), mithin nicht intellektuelle Anschauung ist, als welche aus<br />
dem eben angegebenen Grunde allein das Urwesen, niemals aber einem,<br />
seinem Dasein sowohl als seiner Anschauung nach (die sein Dasein in<br />
Beziehung auf gegebene Objekte bestimmt), abhängigen Wesen<br />
zuzukommen scheint; wiewohl die letzteren Bemerkungen zu unserer<br />
ästhetischen Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweisgrund gezählt<br />
werden muß.« (B 72)<br />
Kant legt, hierin Leibniz (und letztlich auch Bolzano) nicht unähnlich, die<br />
Wahrheit der Mathematik in den göttlichen Verstand, deren Ursprung<br />
aber in das Unvordenkliche des göttlichen Verstandes. Doch hat diese<br />
Quelle zwar nicht die Würdigkeit, doch aber die Grundlage, selbst als<br />
Erkenntnisgrund dienen zu können, nach der transzendentalen Kritik<br />
verloren, womit aber das Anwendungsproblem mathematischer Ideen auf<br />
die Natur aufgeworfen wird. Die transzendentale Ästhetik, die<br />
transzendental ist, weil sie unabhängig von der empirischen<br />
Organisationsform unserer Sinnlichkeit gedacht wird, depotenziert die<br />
Beziehung des menschlichen zum göttlichen Verstand bei Descartes zum<br />
transzendentalen Konstruktionsprinzip von Intelligenzen, die<br />
notwendigerweise über empirische Sinnlichkeit verfügen. — Nun gibt<br />
Kant zwei Gründe an, weshalb uns ein intuitus originarius nicht möglich<br />
sein sollte: Erstens, weil wir dem Dasein nach abhängig sind, und<br />
zweitens, weil unser Dasein (und allen Intelligenzen mit sinnlicher<br />
Anschauung) durch die Anschauung »in Beziehung auf gegebene Objekte<br />
bestimmt« sind. Zwar ist gar nicht von selbst einleuchtend, weshalb mit<br />
der Abhängigkeit des Daseins nach selbst Wesen wie uns jeder intuitus<br />
originarius abgesprochen werden muß, denn es ist allem Anschein nach<br />
nicht ausreichend, das Problem der Bestimmtheit unseres Daseins nur<br />
durch die Abhängigkeit von der Anschauung, die unser Dasein in<br />
Beziehung auf gegebene Objekte unzweifelhaft hinsichtlich der<br />
Erkenntnisgründe bestimmt (intuitus derivatus), zu behandeln. Eine<br />
derartige das Dasein bestimmende Beziehung könnte zunächst auch ein<br />
intuitus originarius sein, denn nur daß das jeweilige subjektive Dasein
— 1190 —<br />
durch anderes oder äußeres bestimmt wird, ist in einer solchen<br />
Untersuchung entscheidend, nicht, ob durch einen intuitus derivatus oder<br />
einen intuitus originarius. In Frage steht dabei freilich von Anbeginn, ob<br />
ein intuitus originarius als durch etwas anderes oder äußeres überhaupt<br />
bestimmt gedacht werden kann.<br />
Wir sind durch unser intelligibles Dasein auch durch reine Ideen und<br />
ursprüngliche Ideen bestimmt, nicht nur durch gegebene Objekte. Die<br />
Metaphysik (als Gegenstandsbereich eines möglichen intuitus originarius)<br />
ist als intuitus derivatus subjektive Metaphysik oder als Ideenlehre auch<br />
Psychologie. Gerade in Hinblick auf das Erkenntnisinteresse, die<br />
unbefriedigende Situation etwaiger metaphysischer Anfangsgründe der<br />
Mathematik näher aufklären zu wollen, scheint mit der Einschränkung auf<br />
ein abstraktes intensionales quantum originarium ein intuitus originarius,<br />
oder doch eine Depotenzierung der ursprünglichen Auffassung als ein<br />
Begriff der Psychologie des göttlichen Verstandes, in den Bereich der<br />
Hypothesenbildung vernünftiger, d. h., kritisch begleiteter Spekulation zu<br />
rücken. Den nämlichen Anspruch habe ich gleich zu Beginn des ersten<br />
Abschnittes dieser Arbeit für die reine Anschauung erhoben, zumal Kant<br />
eine Unklarheit zwischen intellektueller und intelligibler Anschauung<br />
zuläßt.<br />
Nun ist die formale Logik nach Kant bekanntlich ebenfalls intuitiv, aber<br />
zugleich auch diskursiv. So stellt sich die Frage, welcher intuitus ist hier<br />
gemeint? Dieser intuitus geht dann doch auf »primituive« Merkmale,<br />
sodaß hier das Grundurteil oder empirische Merkmale in Frage kommen;<br />
das formale Element wird offenbar doch dem diskursiven Moment<br />
zugerechnet. Kant scheint hier ebenso wie im Umkreis der symbolischen<br />
Vernunft zwar nicht zu übersehen, daß der formale Aspekt des<br />
diskursiven Momentes die Grammatik ist, und nicht ursprünglich und<br />
allein die Formenkreise des wiederum über sich informiert gedachten<br />
quantum originarium (Idee der Mathesis und als Ideal), jedoch wohl auch<br />
aus architektonischen Gründen wird der Umkreis der symbolischen<br />
Vernunft, der in diesem Aufriß von ästhetischer, teleologischer, also<br />
reflektierender, Urteilskraft bis zur Spekulation der reinen Vernunft unter<br />
dem Verstande (Algebra) reicht, nicht weiter ausgebaut.
— 1191 —<br />
b) Formalwissenschaftliche Untersuchung der transzendentalen Logik in<br />
Hinblick auf die Möglichkeit eines spezifisch eingeschränkten intuitus<br />
originarius<br />
In der Einleitung zur transzendentalen Logik stellt Kant gegen Ende des<br />
zweiten Teiles (Von der transzendentalen Logik) die allgemeine Logik<br />
schlußendlich in eine vergleichbare Spannung:<br />
»In Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori<br />
auf Gegenstände beziehen mögen, nicht als reine oder sinnliche<br />
Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen Denkens, die<br />
mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs<br />
sind, so machen wir uns zum voraus die Idee von einer Wissenschaft des<br />
reinen Verstandes und Vernunfterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände<br />
völlig a priori denken. [I] Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung,<br />
den Umfang und die objektive Gültigkeit bestimmete, würde<br />
transzendentale Logik heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesetzen<br />
des Verstandes und der Vernunft zu tun hat, aber lediglich, so fern sie auf<br />
Gegenstände a priori bezogen wird, [II] und nicht, wie die allgemeine<br />
Logik, auf die empirischen so wohl, als reinen Vernunfterkenntnisse ohne<br />
Unterschied.[III]« (B 81 f./A 57)<br />
Nur in Pkt. (III) wird auf den primitiuiven intuitus der formalen Logik<br />
Bezug genommen, worauf die allgemeine Logik allererst beruht, und<br />
gegenüber der Formalität des diskursiven Moments mit dem intuitus<br />
derivatus in Koinzidenz gerät. Diese angepeilte Abhebung der Formalität<br />
des diskursiven Moments vom intuitus der formalen Logik und dessen<br />
Abhebung vom intuitus derivatus der (sinnlichen) Anschauung geht aber<br />
nicht in die Konstruktivität der Grammatik und Algebra auf. — Wie nun<br />
auch immer eine allfällige Depotenzierung oder Ableitung eines intuitus<br />
originiarius als eine mögliche Version intellektueller Anschauung in dieser<br />
Hinsicht ausfallen könnte, keinesfalls kann eine solche Überlegung mit<br />
dem Anspruch Schritt halten, der mit den ersten beiden Punkten des<br />
gegebenen Zitates vorgegeben worden ist. Hier geht es um Begriffe des<br />
reinen Denkens, die zuerst negativ nach ihrem Ursprung von ästhetischen<br />
und empirischen Begriffen unterschieden werden, sich als solche aber<br />
bereits auf Gegenstände a priori beziehen sollen. Die Intelligibilität unseres<br />
Daseins — hier eben anders als in § 16; und auch anders als im »Ich denke«<br />
aus dem Übergang der Paralogismen zu den kosmologischen Ideen —<br />
wird bereits als das reine Denken der Idee von einer Wissenschaft des<br />
reinen Verstandes- und Vernunfterkenntnisses, also als regulative Idee
— 1192 —<br />
behandelt. Das macht von vornerherein deutlich, daß die<br />
transzendentalanalytische Untersuchung des empirischen<br />
Verstandesgebrauches als tranzendentalphänomenologische<br />
Einklammerung nur dann aufgefaßt werden kann, wenn zuvor die<br />
Vernunfterkenntnis aus Prinzipien zumindest partiell und beispielhaft<br />
bekannt ist. Es ist also nicht der Verstandesgebrauch allein, der uns ein<br />
Objekt zu unserer Erfahrung denken läßt, sondern es bedarf eines<br />
Vernunftbegriffes aus der Konsequenzlogik, um einen Gegenstand völlig a<br />
priori zu denken (I). Diese Apriorität gerät aber unversehens abermals in<br />
den Verdacht, bloße Formalontologie zu sein.<br />
Nun kommt Kant zu einer ersten Bestimmung (Exposition) der<br />
transzendentalen Logik: »Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung,<br />
den Umfang und die objektive Gültigkeit bestimmete, würde<br />
transzendentale Logik heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesetzen<br />
des Verstandes und der Vernunft zu tun hat« (hier als Punkt II<br />
ausgezeichnet). Eine solche Wissenschaft müßte also bereits eine<br />
Vernunftwissenschaft sein, die aber nicht empirische<br />
Verstandeserkenntnisse, sondern die topoi der reinen Verstandesbegriffe<br />
organisiert, und insofern transzendentale Logik heißen müßte. Kant nennt<br />
drei Bedingungen: Ursprung, Umfang und objektive Gültigkeit. Gerade<br />
weil in der Form des ostensiven Beweises formuliert sind diese<br />
Bedingungen in ihrem idealen architektonischen Anspruch nicht<br />
durchgängig einlösbar; sie sind jedoch, so meine These, von Horizonten<br />
von transzendentalsubjekiver Gleichursprünglichkeit ausgehende<br />
Direktionen (theoretische Intenionen), die als formalontologisches Ideal<br />
eine abstrakt-bestimmte Konkretisierung hinsichtlich ihrer Stellung im<br />
Reflexionsgang jeweils, und teilweise zueinander, zulassen. Streng<br />
genommen ist die erste Frage des Ursprunges in die Frage nach der<br />
Möglichkeit des Anfangenkönnens mit der Philosophie (oder: was ist<br />
Philosophie?) verschoben worden. Die Frage nach dem Umfang kann<br />
allerdings einigermaßen befriedigend beantwortet werden: Das<br />
Anwendungsgebiet ist eben dasjenige, auf welchen Boden oder wohin die<br />
Frage nach dem eigentlichen Ursprung, dessen Ursprünglichkeit nicht<br />
transzendentalsubjektivistisch einlösbar ist, als nicht schlüssig<br />
beantwortbar verschoben worden ist. Offenbar eröffnet die<br />
Umformulierung der ersten Frage nach dem Ursprung in die Frage nach<br />
dem Umfang wenigstens einen ersten Beantwortungsversuch: Zuerst ist<br />
die Frage nach dem Umfang in diesem Zusammenhang zweifellos eine
— 1193 —<br />
Frage nach dem transzendentalen Inhalt, und als solche logisch intensional<br />
verfaßt. Von logisch intensionaler Verfaßtheit war allerdings die als<br />
(vorläufig) unbeantwortbar aufgeschobene Frage nach dem Ursprung des<br />
Philosophierens oder der transzendentalen Logik zwischen reinen<br />
Verstand und reiner Vernunft auch. Nunmehr soll eine nähere<br />
Charakterisierung möglich sein dadurch, daß nach einem<br />
transzendentalen Inhalt gefragt worden ist. Es sollte nicht mehr<br />
überraschen, daß in Hinblick auf eine mögliche reine transzendentale<br />
Logik der transzendentale Inhalt nicht eine Position eines empirischen<br />
Merkmals oder Merkmalskomplexion beschreibt, vielmehr der<br />
transzendentale Inhalt (gewissermaßen in transzendentaler Rekognition)<br />
eben im Verhältnis zwischen Verstand und Vernunft besteht, welches in<br />
sich in der Tat als dialektisch beschrieben werden kann, indem<br />
Subsumtionsverhältnisse mit den wechselseitigen<br />
Abhängigkeitsverhältnissen von Verstand und Vernunft wechseln. Der<br />
transzendentallogische Umfang hinsichtlich seines Totum von<br />
Inhaltlichkeit, das als transzendentaler Inhalt in Frage kommen kann, ist<br />
nicht äquipollent mit dem rein modallogischen Problemhorizont, sondern<br />
bezieht sich erst in Folge der Entwicklung sowohl abwechselnd auf die<br />
Position primitiver empirische Qualitäten, deren einfachen realmöglichen<br />
Relationen (vergleiche noch Russell: Tatsachenaussagen oder<br />
Propositionen), und auf die modallogische Fragestellung nach dem<br />
Gegenstand, wie auch auf eventuell mögliche Versionen der Reihenfolge<br />
der teilweisen Verknüpfbarkeit der Elemente des Konzeptes, die schon von<br />
der Potentialität der der Reflexion von heuristischen Überlegungen<br />
vorgezeichneten Argumentationsstruktur eine daraufhin wahrscheinlich<br />
oder unwahrscheinlich werdende mittelbare Verknüpfbarkeit immanent<br />
erwarten lassen. Die wissenschaftliche Behandlung nach Prinzipien ist die<br />
gesuchte Vernunftwissenschaft, die der Möglichkeit nach bekannt sein<br />
muß, um überhaupt beginnen zu können; erst die<br />
transzendentalidealistische Einschränkung der Vernunft auf den Rahmen<br />
des Transzendentalsubjektivismus verlangt nach einer rationalen<br />
Psychologie, deren Umfang wiederum erst im Verhältnis der<br />
transzendentalen Analytik des empirischen Verstandesgebrauches und der<br />
transzendentalen Analytik der Dialektik der reinen Vernunft, die bei Kant<br />
allemal Intelligibilität und Leiblichkeit voraussetzt, klärer werden kann.<br />
Die in Aussicht gestellte Erhellung wird von vorneherein dadurch<br />
eingeschränkt, indem eben die reine Vernunft selbst ihre zentralen<br />
Vernunftideen (psychologische, kosmologische und theologische Idee) der
— 1194 —<br />
Einschränkung gemäß der Deduktion der Kategorien des empirischen<br />
Gebrauches der reinen Verstandesbegriffe verdankt, diese aber bereits<br />
ihrerseits eine Selektion, gemäß der eigens dazu vorläufig eingerichteten<br />
logischen Tafeln, hinter sich haben. Dieses als dialektisch nur beschriebene<br />
Wechselverhältnis zwischen Verstandesanalytik und Vernunftkritik wird<br />
also allein dadurch schon aufgehalten, weil die Deduktion der Kategorien<br />
selbst nicht ohne die Aufstellung der logischen Tafeln möglich wäre. Dem<br />
logischen Leitfaden, dem alleweil zu folgen ist, würde aber mit der<br />
Aufstellung irgendwelcher logischen Tafeln nicht genüge getan. Vielmehr<br />
zeigt sich nun allmählich die Tragekraft der formalen Logik (mitsamt dem<br />
unaufgelösten Problem des formal depotenzierten intuitus originarius<br />
zwischen primituiver Intuition und diskursivem Formalismus) aus dem<br />
Punkt III angesichts der Verwicklungen quasi-genetischer<br />
Vorausgesetztheiten zwischen transzendentaler Analytik des<br />
Verstandesgebrauches und der transzendentalen Analytik des<br />
Vernunftgebrauches. — Daß damit gleich eine Reihe denkbarer Formen<br />
der Depotenzierung eines eigentlich ursprünglichen intuitus originarius<br />
eröffnet worden ist, dürfte nicht entgangen sein: Soweit bekannt, gibt es<br />
sowohl zwischen formaler, reiner, intellektueller und intelligibler<br />
Anschauung wie zwischen reinen intellektuellen Operationen des<br />
begrifflichen Denkens in der Algebra und in der Grammatik (in<br />
Formalwissenschaften überhaupt) jeweils einen Intuitus, den allerdings<br />
immer als Depotenzierung eines spezifischen intuitus originarius<br />
vorzustellen selbst schon als eine Form der Depotenzierung und als<br />
intuitus derivatus (ansonsten die sinnlich gegebene Anschauung in<br />
transzendentalästhetischer Auffassung) zu denken vor sich hat.<br />
c) Die genetische Struktur in der logischen Argumentation der Diallele<br />
Die Dialektik ist aber gar nicht nur Teil der transzendentalen Logik, die ja<br />
die Anwendung von Verstandesgrundsätzen und Venunftprinzipien auf<br />
die Totalität der Erfahrung sein soll, sondern Kant teilt im dritten Teil der<br />
Einleitung zur transzendentalen Logik die allgemeine Logik in einen<br />
analytischen und in einen dialektischen Abschnitt. Kant kennzeichnet die<br />
Position des bloßen Logikers im weiten sprachphilosophischen Sinn, von<br />
wo aus die Logik abermals nur als besondere Technik der Sprache,<br />
insofern als Spezialdisziplin der Rethorik, angesehen werden könnte: Die<br />
Logiker hätte man zu allen Zeiten mit der Frage: Was ist Wahrheit? zu
— 1195 —<br />
einer Dialexe oder Diallele gezwungen, was zunächst nichts anderes<br />
besagt, als eine sich im Kreise bewegende Art des Schließens. Diese Art zu<br />
Schließen wird für gewöhnlich nichts erwarten lassen, weil auf diese Weise<br />
bestenfalls eine Umgruppierung der möglichen Aussagen erreicht wird,<br />
was nur in Fragen der Reihenfolge der Argumente, zumeist womöglich<br />
nur was Wohlformungsregeln betrifft, Relevanz besitzen kann. Ob aber<br />
eine Diallele schon den Beweis beinhaltet, der erst zu beweisen gewesen<br />
wäre, wie die Identifizierung mit dem circulus vitiosus behauptet, bleibt<br />
selbst ohne Beweis. Der etymologische Ursprung des Begriffs vom Beweis<br />
selbst steht im Mittelhochdeutschen zwischen Zeigen und Urteilen, sodaß<br />
auch die nur hermeneutisch-reflektierende Denkbewegung bereits<br />
mehrseitig den Zweifel bei sich führt, ob die lateinische Festlegung, die<br />
offenbar Kant nunmehr vorhat, tatsächlich die Verlegenheit treffend genug<br />
charakterisiert.<br />
Kant kritisiert die Allgemeinheit des logischen Kriteriums der Wahrheit:<br />
Übereinstimmung von Erkenntnis mit ihrem Gegenstande, und setzt dem<br />
nur entgegen, daß nunmehr verlangt sei, »das allgemeine und sichere<br />
Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis« zu wissen. Wie Leibniz,<br />
Bolzano und Brentano zu zeigen verstehen, kann auf das Adequanzprinzip<br />
(oder abstrakt-allgemein: dem intensionalen Prinzip des Sich-Deckens) in<br />
der Grundlegung nicht vollständig verzichtet werden, und auch Kant<br />
vermag hier nicht auf dieses Kriterium in der komparativen (insofern auch<br />
besonderen) Allgemeinheit der Distribution zu verzichten. Die<br />
Unterscheidung, die Kant trefffen möchte, bezieht sich einerseits auf die<br />
Sicherheit und andererseits darauf, daß jede Erkenntnis sicher sein solle,<br />
was offenbar mit dem bloßen logischen Kriterium der Wahrheit nicht<br />
erfüllbar ist. Im Sinne einer wissenschaftlichen und physikalistischen<br />
Sprache kann das Projekt Kantens in der transzendentalen Analytik des<br />
empirischen Verstandesgebrauches als transzendental kritisiertes<br />
Fundament wissenschaftlicher Sprachphilosophie verstanden werden; es<br />
darf aber nicht erwartet werden, daß damit der intensionale Umfang des<br />
Ausdruckes »jede Erkenntnis« bereits vollständig ausgelegt worden ist.<br />
Zwar beginnt sich Kant hinter dem Formalismus der allgemeinen Logik,<br />
die sowohl für empirische (kontingente) wie für Vernunfterkenntnisse<br />
objektiv gültig ist, zurückzuziehen, doch wurde zuvor der fragliche<br />
Umfang in den Umrissen schon festgelegt. So bezieht sich die allgemeine<br />
Logik nur auf »das Erkenntnis der bloßen Form nach« (B 83/A 60), was<br />
zurückübersetzt für den von Kant nur vorläufig und ungefähr situierten
— 1196 —<br />
Logiker auch soviel heißen mag, daß sich die allgemeine Logik auf die<br />
Wahrheit nur der Form nach beziehe. So kann eine der logischen Form<br />
gemäße Erkenntnis ihren Gegenstand auch widersprechen. Das aber ist<br />
zwar eine selbst transzendentallogische Erkenntnis, aber doch nicht auf die<br />
physikalistische Sprache, also auf die Deduktion der Kategorien des<br />
empirischen Verstandesgebrauches beschränkt. Kant bestätigt dies<br />
zumindest indirekt: »Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit,<br />
nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit dem allgemeinen und<br />
formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zwar die conditio<br />
sine qua non, mithin die negative Bestimmung aller Wahrheit: weiter aber<br />
kann die Logik nicht gehen, und den Irrtum, der nicht der Form, sondern<br />
den Inhalt [die Prämissen, GWC] trifft, kann die Logik durch keinen<br />
Probierstein entdecken.« (B 84/A 60)<br />
So beziehen sich die allgemeinen und formalen Gesetze des Verstandes<br />
gerade auch dann primär auf die Deduktion der Kategorien, wenn<br />
Wahrheit ausgesagt werden soll, die eben ohne Vernunft weder zu denken<br />
begonnen noch vervollständigt werden kann, weil die primäre<br />
Intentionalität, die auf Sinnlichkeit ausgerichtet ist, konstituierend ist für<br />
die ganze Architektonik, die allen entscheidbaren Sätzen, also nicht nur<br />
der Naturerkenntnisse, vorausliegt, auch wenn Kant sich auf die<br />
Potentialität der Formalisierung der inhaltlichen Beziehungen mittels der<br />
allgemeinen Logik zurückzieht. Insofern ist die allgemeine Logik als Kunst<br />
des Verstandes bloß ein Kanon zur Beurteilung, die dann dialektisch wird,<br />
wenn sie als Organon zur wirklichen Hervorbringung objektiv gültiger<br />
Behauptungen mißbraucht wird.<br />
Die systematische formale Betrachtung der allgemeinen Logik hat die<br />
Allgemeinheit hingegen wegen der formalen Implikation axiomatischer<br />
Satzsysteme; nicht aus Gründen weiterer wesensnotwendiger Prädikate<br />
und nicht aus Gründen komparativer Allgemeinheit. Der aus der Dialektik<br />
der Form der Wahrheit (hier dann wieder doch nur Urteile, Sätze,<br />
Propositionen) hervorspringende Schein der Wahrheit ist jedoch ein<br />
formalontologischer Schein. So unternimmt Kant im vierten Teil der<br />
Einleitung der transzendentalen Logik eine Einteilung der<br />
transzendentalen Logik in die »transzendentale Analytik und Dialektik«.<br />
Diese setzt zwar in der Spannung zwischen Verstand und Sinnlichkeit an,<br />
verlegt aber den Ursprung einer transzendentalen Logik wieder in eine<br />
Formalontologie.
— 1197 —<br />
»In einer transzendentalen Logik isolieren wir den Verstand, (so wie oben<br />
in der transzendentalen Ästhetik die Sinnlichkeit) und heben bloß den Teil<br />
des Denkens aus unserem Erkenntnisse heraus, der lediglich seinen<br />
Ursprung in dem Verstande hat.« (B 86/A 62)<br />
Damit sagt Kant, daß der Ausgang der wissenschaftlichen Betrachtung<br />
unseres Erkenntnisvermögens seinen Ursprung im Verstand hat, was eine<br />
genetische Aussage ist, und nicht etwa nichts anderes ist als eine<br />
Behauptung darüber, aus welchen Elementen unser Denken in der<br />
transzendentalen Logik zu bestehen hat. Das wird aus der nachfolgenden<br />
Einschränkung klar: »Der Gebrauch dieser reinen Erkenntnis aber beruhet<br />
darauf, als ihrer Bedingung: daß uns Gegenstände in der Anschauung<br />
gegeben seien, worauf jene angewandt werden könne. Denn ohne<br />
Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntnis an Objekten, und sie bleibt<br />
alsdenn völlig leer.« (l. c.)<br />
Auch diese Aussage kann genetisch gelesen werden, obwohl offensichtlich<br />
ist, daß Kant hier vorhat, die Aufgabe der transzendentalen Logik allein<br />
auf den Umkreis der Deduktion der Kategorien des konstituierenden<br />
Verstandesgebrauches in der Erfahrung zu beschränken, auch wenn der<br />
Sprachgebrauch es zulassen würde, die Arten von Anschauung und die<br />
Arten des Gegebenseins von verschiedenen Arten von »Objekten«<br />
(allgemein-unbestimmt: Gegenstände) nach den verschiedenen Arten des<br />
»Ist-Sagens« zu behandeln. So kündigt Kant den zweiten Teil der<br />
transzendentalen Logik nur negativ als Kritik des dialektischen Scheines<br />
der allgemeinen Logik an, der eben in allen möglichen Fällen dann<br />
entsteht, wenn der Kanon der allgemeinen Logik materialiter als Organon<br />
der Erzeugung der Wahrheit mißbraucht wird. Nach der immanenten<br />
genetischen Rechtfertigung wird dann doch die Dialektik der reinen<br />
Vernunftideen von der transzendentalen Kritik auf eine regulative<br />
Funktion beschränkt, was schlußendlich nicht nur die Erörterung der<br />
reinen Vernunft und des ihr innewohnenden Bezuges zum Totum,<br />
sondern noch die Differenzierung in Prinzipien der Konstruktion und<br />
Zusammenfügung von Konstruktionen in der reinen, abstraktunbestimmten<br />
Ideenlehre, in der Formalontologie und in der<br />
Formalwissenschaft als weitere Aufgabe zurückläßt.
— 1198 —<br />
d) Der reine Inhalt des Denkens hat selbst kein transzendentales Prinzip<br />
Die genetische Rechtfertigung der Darstellung und das nachvollziehbare<br />
Erkenntnisinteresse Kants an der zweiten Aufgabe der Kritik der reinen<br />
Vernunft fordert in diesem Rahmen von der ganzen Erkenntnis immer<br />
schon ein transzendentales Prinzip, dessen synthetisches Urteil a priori das<br />
modale Prädikat der objektiven Realität zu erfüllen vermag. Keineswegs<br />
ist damit aber mit Notwendigkeit ausgeschlossen, daß über die Reihe von<br />
formaler, reiner und empirischer Anschauung hinausgehend ein<br />
besonderer Intuitus für das reine begriffliche Denken anzusetzen ist. Der<br />
erste Teil des Programms der transzendentalen Logik hat die Aufgabe der<br />
Vereinbarung von Verstand und Sinnlichkeit; diese Ausrichtung ist im<br />
analytisch-konstruktiven (rekonstruktiven) Rückgang schon anhand des<br />
Moments des primituiven Intuitus gegenüber dem diskursiven Moment in<br />
der formalen Logik ersichtlich.<br />
Auch wenn weder hier am Aufgangspunkt der transzendentalen und<br />
allgemeinen Logik noch in der rein symbolischen Logik der Algebra, die<br />
ohne primituives empirisches Merkmal auskommt, ein transzendentales<br />
Prinzip möglich ist, so ist doch aus der abstrakt-unbestimmten Immanenz<br />
reiner Einteilung und rekombinierender Konstruktion (als formale ars<br />
invenviendi) nach jeweiligen allgemein-unbestimmt formalen und<br />
abstrakt-konkreten allgemeinen Bedingungen ein reelles Ergebnis zu<br />
erwarten, wie das synthetische Urteil a priori in der reinen Geometrie<br />
gezeigt hat, dessen Prinzip selbst nur der Geometrie, nicht aber der<br />
Erkenntnis der Gegenstände der sinnlichen Erscheinungen wegen<br />
transzendental genannt werden könnte, obgleich seit Descartes die<br />
Mathematisierung der Naturwissenschaft zur Methode geworden ist, die<br />
Gesetze der Wirklichkeit intellektuell der Natur vorzuschreiben.<br />
Insbesondere für die Grammatik und die Algebra ist, der reinen<br />
Anschauung in der Geometrie vergleichbar, ein immanenter Intuitus<br />
anzusetzen, welcher dem modalen Prädikat der objektiven Gültigkeit auch<br />
ohne transzendentales Prinzip ein reelles Fundament zu geben imstand ist.<br />
Dieser Intuitus muß ähnlich zusammengesetzt sein wie der der formalen<br />
Logik, da hier nicht wie in der konstruierenden Geometrie reiner<br />
Anschauung oder in der Arithmetik ein Bezug zu einer allgemein-abstrakt<br />
charakterisierbaren Ausdehnung oder Größe als Einschränkungsgrund<br />
vorliegt. Darin liegt auch deren eigentliche transzendentale<br />
Rechtfertigbarkeit, während weder die Mathematik noch die<br />
Formalwissenschaften eine eigene transzendentale
— 1199 —<br />
Rechtfertigungsproblematik außerhalb des Anwendungsproblems besitzt.<br />
Die transzendentale Rechtfertigung von Formalwissenschaften bezieht sich<br />
auf unser Verstandesvermögen, nicht auf die formalwissenschaftliche<br />
Selbstbegründung.<br />
Doch Kant geht insgesamt betrachtet noch einen Schritt weiter: Obgleich<br />
die Algebra eine Verbindung zur ästhetischen Symbolreflexion unterhält,<br />
und Kant in den Axiomen der Anschauung unternimmt, die natürliche<br />
Zahlenreihe auf grammatikalischen Wege zu bestimmen, die in Folge<br />
Albert Grote dazu veranlaßt hat, die hinreichende Vollständigkeit der<br />
Definition der Division anzuzweifeln, scheint Kant in den Reflexionen zur<br />
Algebra (◊) von der grundsätzlichen (ursprünglichen) Verknüpfung von<br />
Form und Inhalt abzugehen, welche eben bereits an den einfachen<br />
Elementen der formalen Logik als die Momente des primituiven Merkmals<br />
und des dikursiven Merkmals zu finden war. Kant verzichtet in der<br />
Algebra deshalb auf jeden weiteren Inhalt, weil die semantische Position<br />
aller algebraischen Zeichen sich zunächst völlig abstrakt-unbestimmt auf<br />
die Formen des Quantums beziehen, und erst dann komplexere<br />
Operationen gebildet werden. Insofern ist ein eigener immanenter und<br />
reeller Intuitus für Formalwissenschaften anzusetzen, auch wenn in der<br />
Einleitung der transzendentalen Logik nur manchmal und vor allem im<br />
zweiten Teil der Einleitung von dieser Erweiterung des Gebrauches des<br />
Intuitus eine Ahnung mit gegeben wird. Keinesfalls kann ein Intuitus, sei<br />
er auch transzendentalidealistisch und subjektivistisch, somit nur<br />
transzendentalpsychologisch exponierbar, aber mit der transzendentalen<br />
Logik darstellbar, als intuitus originarius im ursprünglichen Sinn<br />
intelligibler Anschauung gedacht werden. Dazu müßte die reelle<br />
Immanenz objektive Gültigkeit und objektive Realität ohne jedes zeitlich<br />
eindeutig orientierte Schema der Idee besitzen.<br />
Es ist also im Rahmen der Kantschen Transzendentalphilosophie ohne<br />
transzendentales Prinzip der Kausalität von einem eigenen intuitus<br />
derivatus mit dem Anspruch auf Apriorität begründet zu Reden möglich;<br />
diese Direktion der Entwicklung der Bedeutung von intuitus derivatus<br />
beinhaltet aber nichts mehr Ästhetisches oder Empirisches und insofern<br />
auch nichts Anschauliches. Im formalontologischen »Urbild« der<br />
transzendentalen Logik zeigt der inhaltlich abstrakt-unbestimmte, nach<br />
der Bestimmung der Position im Reflexionsgang aber formal allgemein<br />
bestimmbare intuitus derivatus auf den Begriff des reinen Gegenstand a<br />
priori; auch in der reinen Geometrie. Der gesuchte Intuitus ist demnach
— 1200 —<br />
sicherlich keine bislang vermißte Form des intuitus derivatus im<br />
ürsprünglichen und eigentlichen Sinne, sondern gehört schon zu den<br />
Erörterungen des Prinzips des »idea es conceptus archetypus«, was<br />
allerdings wieder den erhobenen Anspruch auf eine formal eingeschränkte<br />
Form des intuitus originarius befestigt. Dergleichen wird aber auch für das<br />
primituive Merkmal einfacher Elemente der formalen Logik gelten<br />
müssen, indem dieses Merkmal erst transzendentalanalytisch aus der nur<br />
sprachphilosophisch, hermeneutisch und semantisch weiter analysierbaren<br />
Einheit rekonstruktiv, und nur in Hinblick auf diese projektierten<br />
Untersuchungen, idealtypisch konstituiert worden ist, und so zu Unrecht<br />
als eine ursprüngliche Gleichursprünglichkeit (In-sich-Vermitteltheit) oder<br />
gar als der spontan unvermittelte Akt der gerichteten Aufmerksamkeit<br />
angesehen worden ist. Vielmehr ist bei spontanen (intelligiblen und freien)<br />
Intelligenzen mit sinnlicher Anschauung jeder Intuitus entweder vermittelt<br />
oder zumindest durch innere oder äußere Affektation verursacht worden,<br />
und somit ein eigentlicher intuitus originarius im Sinne intelligibler<br />
Anschauung erwartungsgemäß völlig unmöglich, was aber einen<br />
besonderen intuitus für Prinzipien a parte priori gar nicht ausschließt.<br />
Dieser hätte allerdings ebenfalls zusammengesetzt zu sein, und zwar<br />
systematisch nach Vernunftideen geordnet (analog zur Formalität der<br />
Diskursivität) und inhaltlich an komparativen Allgemeinbegriffen und<br />
deren mögliche Zweckmäßigkeit zueinander orientiert (analog zum<br />
intuitus auf primituive Merkmale).<br />
Die metaphysischen Anfangsgründe der Formalwissenschaften sind somit<br />
an der Grenze von Transzendentalpsychologie (als Einheit von rationaler<br />
Psychologie und rationaler Physiologie) und synthetischer Metaphysik zu<br />
finden. Diese Verwendung des Begriffs der »synthetischen Metaphysik«<br />
umfaßt nunmehr nicht mehr einen intuitus derivatus, welcher nur<br />
implizite die transzendentale Freiheit des über die immanenten<br />
Verhältnisse von Verstand und Vernunft Urteilenden demonstriert,<br />
sondern schließt bereits die Vorstellung des Überganges der reinen<br />
(theoretischen) Vernunft zur praktischen Vernunft mit ein. Daß bedeutet<br />
aber zusammengenommen nichts weniger, als daß die Vorstellung der<br />
transzendentalen Idee der Freiheit diesmal »wirklich« (mit objektiver<br />
Giltigkeit) selbst zugleich die Konsequenz ihres transzendentalen und<br />
ideal gedachten Inhalts ist. Erst da ist die Totalität der reinen Idee zugleich<br />
der Nachweis ihrer wirklichen Intelligibilität. Insofern kann nunmehr auch<br />
von einem abstrakt-unbestimmten, aber anhand der Stellung in der
— 1201 —<br />
transzendentalen Reflexion formal bestimmbaren intuitus originarius<br />
gesprochen werden. Was, allerdings eben nur in diesem hergestellten und<br />
herausgehobenen Zusammenhang (Wittgenstein: Ohne alle zugeordneten<br />
und geordneten Argumentationsschritte ist der Beweis nur ein<br />
behauptender Satz), den Anschein nicht-empirisch subjektiver und<br />
kriterienloser Evidenz mit sich führt, wie Brentano über die Bedeutung des<br />
Existenzialsatzes im Leibnizianischen Kalkül der analytischen<br />
Urteilstheorie hinaus übersieht, daß das Ungenügen der Kantschen<br />
Unterscheidung in analytische und synthetische Urteile in<br />
allgemeinlogischer Hinsicht zwar zur Heraushebung der bloß<br />
notwendigen Zuschreibung eines Merkmals führt, das weder analytisch<br />
noch synthetisch, sondern nur anhand relativer Gleichursprünglichkeit<br />
aller in Frage kommender Elemente der transzendentalen Untersuchung<br />
(nämlich transzendentale Zeitbedingung und reiner Verstandesbegriff)<br />
gerechtfertigt, daraus aber gerade nicht die ursprüngliche<br />
Unvermittteltheit einer kriterienlosen Evidenz gefordert oder auch nur<br />
erwartet werden kann. Selbst wenn dieser Horizont der Evidenz nun noch<br />
empirisch-psychologisch oder phänomenologisch-logisch als spezifische<br />
Denkmöglichkeit rekonstruierbar ist, so werden solche Rekombinationen<br />
aus letztlich architektonischen Gründen verworfen werden müssen, wenn<br />
der daraus resultierende Entwurf der Zuordnung und Ordnung der<br />
Argumente der transzendentalen Untersuchungsgänge des Verstandesund<br />
Vernunftgebrauches sich als ungenügend herausstellt.<br />
5. Der transzendentale Obersatz und die omnitudo realitatis<br />
a) Inbegriff und Allheit und die Einteilung einer Sphäre<br />
Kant beginnt den Abschnitt mit einer logischen Begriffsbestimmung und<br />
stellt dieser ihren Unterschied zur metaphysisch rationalen Bestimmung<br />
des Dinges gegenüber, auf die ich später nochmals zurückkommen werde:<br />
Die logische Bestimmbarkeit besteht nur darin, daß von zwei<br />
kontradiktorisch entgegengesetzten Prädikate nur eines dem Begriff<br />
zukommen könne. Hingegen hat die rationale Metaphysik die Aufgabe zu<br />
zeigen, daß die Bestimmung eines Dinges noch ontologisch unter dem<br />
Grundsatz der durchgängigen Bestimmung stehe, was zur Folge hat, daß<br />
»ihm [dem Ding] von allen möglichen Prädikaten der Dinge, so fern sie<br />
mit ihren Gegenteilen verglichen werden, eines zukommen muß. Dieses
— 1202 —<br />
beruht nicht bloß auf dem Satze des Widerspruchs; denn es betrachtet,<br />
außer dem Verhältnis zweier widerstreitenden Prädikate, jedes Ding noch<br />
im Verhältnis auf die gesamte Möglichkeit, als den Inbegriff aller Prädikate<br />
der Dinge überhaupt, und, indem es solche als Bedingung a priori<br />
voraussetzt, so stellt es ein jedes Ding so vor, wie es von dem Anteil, den<br />
es an jener gesamten Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit ableite.«<br />
(B 599 f,/A 571 f)<br />
Nachdem die ersten beiden Prinzipien der Durchbestimmung eines Dinges<br />
(einmal mittels Prädikate: Allheit; einmal mittels einer Idee: Allgemeinheit)<br />
vorgestellt worden sind, behandelt Kant das leitende Prinzip der ganzen<br />
Ideenlehre, das disjunktive Urteil, weiter. Ich behaupte aber entgegen des<br />
Verlaufes der Argumentation Kantens an dieser Stelle, daß das ens<br />
realissimum eben gerade nicht das All des Seienden umfaßt (das wäre<br />
auch nach Kants verkürzter Darstellung in diesem Zusammenhang bereits<br />
eine entschränkte Fassung des omnitudo realitatis, B 603). Der logischen<br />
Struktur der Antinomien wie des Ideals liegt zwar das disjunktive Urteil<br />
zu Grunde, doch in den Antinomien ist das nicht-ausschließende »oder«<br />
(was dann eben erst zur Antinomie führt), und im transzendentalen Ideal<br />
ist das ausschließende »oder« entscheidend:<br />
»Der allgemeine Begriff einer Realität überhaupt kann a priori nicht<br />
eingeteilt werden, weil man ohne Erfahrung keine bestimmte Arten von<br />
Realität kennt, die unter jener Gattung enthalten wären. Also ist der<br />
transzendentale Obersatz der durchgängigen Bestimmung aller Dinge<br />
nichts anderes, als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität, nicht<br />
bloß ein Begriff, der alle Prädikate ihrem transzendentalen Inhalte nach<br />
unter sich, sondern der sie in sich begreift, und die durchgängige<br />
Bestimmung eines Dinges beruht auf der Einschränkung dieses All<br />
der Realität, indem Einiges derselben dem Ding beigelegt, das übrige<br />
aber ausgeschlossen wird, welches mit dem Entweder und Oder des<br />
disjunktiven Obersatzes und der Bestimmung des Gegenstandes, durch<br />
eins der Glieder dieser Teilung im Untersatze, übereinkommt.« 18<br />
Der Inbegriff aller Prädikate wird als »All der Realität« bezeichnet, das<br />
eigentlich kategorial Vielheit heißen sollte, weil erst aus der<br />
Einschränkung dieses »All der Realität« der kategoriale Begriff der Allheit<br />
entspringt. Das »All der Realität« eines wirklichen Dinges soll nun nicht<br />
nur mit der Sphäre der möglichen Prädikate überhaupt verglichen und mit<br />
18 B 605/A 577, Hervh. vom Autor
— 1203 —<br />
dem ersten logischen Prinzip (principium contradictionis) eingeteilt<br />
werden, sondern gemäß der logischen Einteilung der Vernunftideen auch<br />
mit der ganzen möglichen Realität als mehrteiliges disjunktives Urteil im<br />
transzendentalen Obersatz verglichen werden. So schreibt Kant weiter<br />
unten im gleichen Absatz: »Demnach ist der Gebrauch der Vernunft, durch<br />
den sie das transzendentale Ideal zum Grunde ihrer Bestimmung aller<br />
möglichen Dinge legt, demjenigen analogisch, nach welchem sie in<br />
disjunktiven Vernunftschlüssen verfährt«. Diese Analogie wird als eine<br />
Analogie von Inbegriff und Gattungsbegriff dargestellt. Der Gebrauch<br />
dieser Analogie ist allerdings problematisch, weil sie sich über den Bereich<br />
von »Inbegriff aller Prädikate«, »All der Realität« und »Inbegriff aller<br />
Realität« erstreckt, dessen logische Identität zumindest im Rahmen des<br />
transzendentalen Obersatzes naheliegt, oder doch Äquipollenz begründet<br />
vermutet werden kann. Handelt es sich aber um Wechselbegriffe dieser<br />
Art, dann führte ein analogisches Verfahren jedoch in eine<br />
Unterbestimmung.<br />
Die starke ausschließende Interpretation der Disjunktion nach Entweder<br />
und Oder im Sinne der logischen Bestimmung aus § 11 der Deduktion<br />
verbietet freilich jede weitere Spekulation, die bloße Denkmöglichkeit<br />
(d. h. hier aber dann schon wieder: jede als Realmöglichkeit bloß gedachte<br />
Möglichkeit) ohne der spezifischen Möglichkeit einer ursprünglich<br />
kontingenten Assertion apodiktisch zu behaupten. Die Schwierigkeit<br />
dieser Erklärung zum »transzendentalen Obersatz« liegt zuerst aber<br />
zwischen den Formulierungen »All der Realität« und »Inbegriff aller<br />
Realität«: diese Formulierungen schweben zwischen der extensionalen<br />
Interpretation der Totalität (omnitudo realitatis) und der intensionalen<br />
Interpretation der Totalität (ens realissimum) der Logik. Beide Fassungen<br />
stehen unter begründetem Verdacht, nicht zwingend der logischen<br />
Definition aus § 11 zu entsprechen, wonach das disjunktive Urteil<br />
gleichermaßen das Wahre und das Falsche wie das Existierende und das<br />
Nicht-existierende umfassen soll. Das »All der Realität« (omnitudo<br />
realitatis), äquipollent gesetzt mit der Sphäre aller möglichen Prädikate<br />
eines Dinges, soll aber das zwischen transzendentaler Materie und<br />
intelligiblen Subjekt gesuchte transzendentale Substrat in absoluter<br />
Totalität gemäß des ersten Prinzips der Allheit im logischen Vergleich<br />
durchgängig bestimmen können, obgleich noch im transzendentalen Ideal<br />
der Begriff vom einzigen Wesen im transzendentalen Vergleich mit dem
— 1204 —<br />
Allgemeinbegriff vom einzelnen Gegenstand (Bestimmung durch einen<br />
Begriff) bestimmt wird (ens realissimum als Teilbegriff).<br />
Eigentlich ist unter omnitudo realitatis sowohl im Kapitel<br />
»Transzendentales Ideal (prototypon transcendentale)« gemäß der<br />
dortigen durchschnittlichen Ausdrucksweise wie in den vorkritischen<br />
Reflexionen zum totum syntheticum ausdrücklich die Summe aller<br />
»selbstständigen Teile« und nicht eine Totalität im absoluten Sinne des<br />
kontinuierlichen totum ideale zu verstehen. Vgl. entsprechend: Allheit ist<br />
erst nach einer Einschränkung des Totums (Vielheit) sagbar (K.r.V. § 11,<br />
B 111); vgl. den Gebrauch von »omnitudo synthetica« in der Refl. 5840<br />
(AA. XVIII, p. 366 f.), wonach selbständige (also insofern auch trennbare)<br />
Teile ein Ganzes nur soweit ausmachen, inwieweit die Synthesis in der<br />
Zusammenfassung gerade gekommen ist, und vom Totum eben zu<br />
unterscheiden ist. 19 Nunmehr verleitet die schlampige Formulierung<br />
Kantens in B 603 in der Tat dazu, die omnitudo realitatis als dasjenige<br />
vorzustellen, woraus durch Teilung (Beilegung und Ausschließung — also<br />
nicht durch Einschränkung eines Regressus oder Progressus) sowohl das<br />
Ding wie womöglich noch auch das ens realissimum (das Allerrealste) zu<br />
folgern wäre. Aber weder sind allein aus dem omnitudo realitatis als<br />
eventuelles Kriterium des Urbilds schon die ectypa abzuleiten, noch<br />
weniger kann dieses als das ens realissimum selbst oder dessen einzige<br />
Charakteristik bezeichnet werden, ansonsten das wesentliche Prädikat aus<br />
dem Ideal der reinen Vernunft (der Begriff vom einzelnen Gegenstand)<br />
nicht Bestimmungsstück des Wesensbegriffs im transzendentalen Ideals<br />
sein könnte, was es doch auch sein muß, wenn das logische<br />
Charakeristikum des Begriffs vom einzelnen Wesen die Bestimmung des<br />
Begriffes durch den Begriff und nicht wieder nur durch eine Idee wie eben<br />
im Begriff vom einzelnen Gegenstand sein soll.<br />
b) Die Informiertheit des ens realissimum und das Problem der<br />
Beziehbarkeit<br />
Der allgemeine Begriff einer Realität hingegen kann zwar nicht weiter<br />
eingeteilt werden, erscheint aber doch nicht leer von jedem inhaltlichen<br />
Merkmal, sondern als vollständig überfüllt, weil es kein Schema der<br />
Beziehbarkeit gibt. Der allgemeine Begriff ist nun nicht ident mit dem<br />
19 Es ist hier auf die Unterscheidung von Grenze und Einschränkung<br />
zurückzukommen, wie sie Richard Heinrich dargestellt hat.Vgl. ersten Abschnitt, II..
— 1205 —<br />
transzendentalen Obersatz, denn dieser ist die Vorstellung desselben als<br />
eine solche informierte Sphäre, für die nun gelten soll, was für den<br />
allgemeinen Begriff einer Realität nur für eine Gattung (eine Realität) als<br />
reale Denkmöglichkeit gedacht worden ist. Diese auf alle Gattungen<br />
erweiterte Vorstellung ist nun der Inbegriff aller Realität, der alle Prädikate<br />
in sich begreift. Eben derselbe wird im Untersatz als »All der Realität«<br />
angesprochen und wieder der Einschränkung der Vielheit unterworfen,<br />
um gemäß der logischen Entgegensetzungen der Prädikate diese<br />
zuzusprechen und abzusprechen. Desgleichen gilt in einer dergleichen<br />
informierten Sphäre erstens, daß jede Realmöglichkeit auch immer schon<br />
Existenz besitzt, besessen hat, besitzen wird, und vor allem in dieser<br />
radikalen Totalisierung der Möglichkeit als oberster Inbegriff überhaupt<br />
immer schon besessen haben wird. Zweitens, daß deren Begriffe alle<br />
bereits aus dem transzendentalen Vergleich als realmöglich erwiesen<br />
worden sind, sodaß die Aufhebung eines Dinges die Aufhebung aller<br />
Dinge nach sich ziehen würde, und eine Verneinung eines Prädikats<br />
würde nicht transzendentale Negation, vielmehr die Existenz in anderer<br />
Kombination und in einer anderen Gattung bedeuten. Der Inbegriff aller<br />
Realität aber verhält sich zum »All der Realität« als informierte Sphäre wie<br />
der Teilbegriff zu den Prädikaten eines durchgängig bestimmten Dinges<br />
(Kategorie der Allheit) und ist hier in dieser transzendentallogischen<br />
Verklammerung logischer Subsumtion und resolutiver inhaltlicher<br />
Bestimmung selbst nicht einteilbar ohne ihn zugleich aufzuheben.<br />
Es kann hier Äquipollenz zwischen den beiden Ausdrucken behauptet<br />
werden, als daß auch hier der Inbegriff vom omnitudo realitatis informiert<br />
worden sei, und es, was die in ihrer Überfüllung nicht heraushebbaren<br />
Merkmale angeht, um einen vergleichbaren, einfach gesagt womöglich um<br />
den gleichen transzendentalen Inhalt handelt, sollte die intensionale<br />
Formulierung durch eine extensionale Formulierung in intensionslogischer<br />
Hinsicht klaglos ersetzt werden können. Die hier extensional zu nennende<br />
Formulierung ist nun nicht im Sinne der Betrachtung von Mengen darin<br />
zusammengefaßter Gegenstände zu verstehen, sondern selbst eigentlich<br />
noch intensional zu nennen, da es sich hier bei dem Ausdruck »All der<br />
Realität« höchstwahrscheinlich nur um die Menge aller möglichen<br />
Prädikate handelt, ohne daß explizite ein gemeinsames Substrat,<br />
gewissermaßen ein Ding der Dinge, in Betracht genommen werden würde.<br />
Das kann immerhin vom Gebrauch des Inbegriffes aller Prädikate auf<br />
Grund der unklaren Konstellation zwischen ens realissimum und
— 1206 —<br />
omnitudo realitatis nicht mit entsprechender Deutlichkeit gesagt werden,<br />
vielmehr besteht Anlass, das Gegenteil zu vermuten. Diese Unklarheit<br />
entsteht, weil ens realissimum als möglicher Teilbegriff des omnitudo<br />
realitatis behandelt wird. Derart kann also zumindest von der<br />
intensionalen Seite der Überlegung her gesagt werden, daß zwischen den<br />
beiden Ausdrucken »Inbegriff aller Realität« und »All der Realität« über<br />
den Ausdruck »Inbegriff aller Prädikate« formal eine auch logisch<br />
analytische Beziehung der Identität bestehen kann, wenn man die<br />
Möglichkeiten dieser Unklarheit entsprechend ausnützt. Nicht aber besteht<br />
in diesem Zusammenhang auch eine logische Identität oder Äquipollenz<br />
dieser Ausdrucke mit dem Ausdruck »Inbegriff aller Möglichkeit«. —<br />
Dazu eine notwendig erscheinende Ergänzung: Natürlich muß die<br />
Möglichkeit bedacht werden, daß der Inbegriff aller Prädikate auch mit<br />
dem Inbegriff aller Möglichkeit deckungsgleich gedacht werden können<br />
muß, da aber Kant hier nahelegt, den Inbegriff aller Prädikate mit dem All<br />
der Realität gleichzusetzen, oder anderes ausgedrückt, sich keine leere<br />
Menge eines Distributionsumfanges in seinen extensionalistisch<br />
verstehbaren Ausdrucken vorstellen kann (wohl auch wegen der<br />
intensionalistischen Komponente seiner Herangehensweise), so ist an<br />
dieser Stelle eben gerade diese Entscheidung zu treffen, zumal die<br />
Existenzweise von Möglichkeiten als solche noch ungeklärt ist.<br />
Die bekannte Schwierigkeit, ob die Allheit der Prädikate die<br />
Einschränkung der Vielheit der Merkmale, oder doch die Entschränkung<br />
vom Besonderen des Allgemeinen vorausliegen hat, ist damit auch hier<br />
relevant: Ist der Umfang der nicht-heraushebbaren und der<br />
heraushebbaren Prädikate, sei er nun endlich, endlos oder unendlich, in<br />
transzendentallogischer Hinsicht nun nicht nur deckungsgleich mit dem<br />
Umfang des allgemeinen Begriffs einer Realität, sondern auch als<br />
deckungsgleich mit dem Umfang des Inbegriffs aller Realität zu denken<br />
überhaupt möglich? Die transzendentalidealistische Identität von<br />
allgemeinem Begriff einer ganz besonderen Realität und Inbegriff aller<br />
Realität im Sinne einer apperzipierenden Monade einmal beiseite gelassen,<br />
kann die gleiche Frage auch anders gestellt werden: Ist der Umfang des<br />
Inbegriffs aller Realität nun vergleichbar mit dem der Allheit, worauf die<br />
Vielheit wegen des Dinges schon eingeschränkt worden ist, mit der<br />
Vielheit selbst, oder mit dem Umfang der entschränkten Allheit, die mittels<br />
Negation der Allheit die Vielheit nochmals, zunächst unbestimmt-abstrakt,
— 1207 —<br />
überschreitet? Nur letzteres vermag den Vergleich mit dem ens<br />
realissimum auszuhalten.<br />
Aber auch »Dieses All der Realität«, wie sich Kant ausdrückt, spricht er an<br />
dieser Stelle im »transzendentalen Untersatz« nicht vom Inbegriff, aber als<br />
mit diesem gleichbedeutend, kann nur dann als omnitudo realitatis<br />
aufgefaßt werden, wenn letzteres nicht sowohl Wirkliches wie<br />
Realmögliches umfaßt, wie er zuvor (B 603) noch behauptet hat; der<br />
transzendentale Obersatz hingegen umfaßt insofern als Inbegriff aller<br />
Prädikate nicht nur unbedingt die Realität und nichts anderes, sondern<br />
auch in gewisser Weise wieder die Realmöglichkeit, da von der Sphäre des<br />
transzendentalen Obersatzes ausgehend das Wirkliche und Reale durch<br />
Einschränkung und Teilung jeweils erst als Soseiendes hergestellt<br />
betrachtet werden können soll. Da aber die Vielheit in ihrer multiplen<br />
Bestimmbarkeit zwischen Merkmale, Arten von Dingen und Dingen in<br />
einem negativ bestimmbaren Sinn alles Existierende (also alle Weisen des<br />
»Ist«-sagens) umfassen sollte, als daß damit auf die Beziehbarkeit auf das<br />
Dinghafte als zureichender Grund (Leibniz) aller Merkmale, also auch als<br />
Grund von Transzendentalität eines jeden qualitativen Inhalts wegen<br />
seiner Beziehbarkeit auf ein selbst nur mögliches, dem Denken gegenüber<br />
aber selbständiges Ding verzichtet worden ist, wird fraglich, ob es allein<br />
wegen der Erweiterung des qualitativen Umfanges der Idee von der<br />
Vielheit in streng transzendentallogischer Hinsicht notwendig war, die<br />
»entschränkte« Allheit der möglichen Prädikate als Grundlage des Begriffs<br />
von einzelnem Wesen (transzendentales Ideal) auf die erfolgte Art in den<br />
Fortgang der Überlegung einzuführen, wenn formalontologisch in<br />
Aussicht gestellt wird, das leidige Affinitätsproblem von der<br />
vorausgesetzten Affinität her aufzulösen. —<br />
c) Die raumzeitliche Dimension von omnitudo realitatis<br />
Im transzendentalen Ideal ging es eindeutig um die Überschreitung aller<br />
Methoden der Bestimmbarkeit von Realität allein durch Merkmale, im<br />
transzendentalen Obersatz handelt es sich jedoch wieder um eine<br />
Vorstellung der Einteilbarkeit des Inbegriffs aller Realität, welche der<br />
Einschränkung des Alls der Realität vorhergeht. Die Einschränkung kann<br />
nun erst dann erfolgen, wenn erstens die Analyzität der beiden Ausdrucke<br />
erwiesen ist (was zuvor geschehen ist), und zweitens der erste Ausdruck<br />
mit dem logisch identen (äquipollenten) zweiten Ausdruck vom »All der
— 1208 —<br />
Realität« ersetzt worden ist, was im Untersatz geschieht. Die<br />
Einschränkung selbst kann wegen der analytischen Beziehung erst nach<br />
der Ersetzung des Inbegriffs durch das All der Realität erfolgen; und zwar,<br />
weil erst damit die Informiertheit der Sphäre des Inbegriffs gegenüber<br />
seiner offengebliebenen Stellvertreterfunktion für das ens realissimum<br />
(dieses aber eben nicht länger ein Kandidat eines Teilbegriffs des omnitudo<br />
realitatis selbst ist) herausgehoben worden ist. Daraus folgt dann freilich<br />
abermals, selbst wiederum analytisch, die prinzipielle (mögliche)<br />
Einteilbarkeit nach Art und Gattung, gleich von welcher Formalität, von<br />
selbst.<br />
Nun ist die Vielheit gerade von einer Struktur, die erwiesenermaßen<br />
einteilbar ist, ansonsten eine Einschränkung auf die Allheit im Sinne der<br />
Prädizierbarkeit von Dingen gar nicht möglich gewesen wäre. Die<br />
Vorstellung von omnitudo realitatis ist demnach damit formal zunächst<br />
deckungsgleich. Doch kommt schon von der vorkritischen, rationalen Seite<br />
der analytischen Metaphysik die Einschränkung, wie denn das<br />
synthetische Moment im Terminus »omnitudo« zu verstehen sei, und wie<br />
diese Frage anhand des Ausdruckes »omnitudo synthetica« im ersten<br />
Abschnitt beantwortet werden kann. So ließe sich zumindest soviel sagen,<br />
als daß die Vielheit als reine Kategorie über die äquipollent gesetzte Idee<br />
der omnitudo realitatis ihrerseits, gewissermaßen resolutiv, die formale<br />
Eigenschaft erhält, nur soweit einteilbar zu sein, wie weit eben die<br />
Produktion von Realität zum Zeitpunkt der Frage auch immer<br />
fortgeschritten sein mag. Doch ist diese Auskunft aus zwei Gründen nicht<br />
ausreichend: Erstens wurde hier weiter oben vom transzendentallogischen<br />
Umfang der omnitudo realitatis bereits verlangt, er hätte auch das<br />
Realmögliche im Sinne der aristotelischen Indifferenz einer jeden<br />
Begriffslogik von wirklich und möglich zu umfassen. Ein solches<br />
Unterfangen muß also schon deshalb scheitern, weil die Vorstellung eines<br />
omnitudo realitatis als solche dialektisch ist. Zweitens wird die zeitliche<br />
Anordnung auch beziehungsloser Prädikate zu einem Problem, welches<br />
nicht nur mit den Schwierigkeiten eines auf lineare Performance<br />
eingeschränkten Mediums zu tun hat. —<br />
Die Zeit verschwindet niemals wirklich; selbst in der fortgesetzten reinen<br />
intellektuellen Operation entsteht in der gegliederten Erörterung des<br />
Horizonts der Gleichursprünglichkeit des Daseins der als solche zuerst<br />
unhintergehbare Anschein einer genetischen Anordnung, ohne dieser<br />
freilich auch kein reelles Schlußfolgern möglich wäre. Hier verrät schon
— 1209 —<br />
der Zusatz »realitatis«, es kann sich nicht um die virtuelle Gleichzeitigkeit<br />
der operativen Ebene des Bewußtseins als Denken, wie es mit dem<br />
Ausdruck »synthesis intellectualis« vorgestellt werden kann, handeln.<br />
Deshalb werden die Grenzen der Zeit auch mit der Übertragung der<br />
Eigenschaft der omnitudo synthetica, als Progressus mittels eines<br />
Regressus auch einteilbar zu sein, auf die omnitudo realitatis als zeitlich<br />
ungeordnete Vielheit nicht an Eindeutigkeit gewinnen. Ein zeitlich<br />
entwickelter »Inbegriff aller Realität« könnte nun aber ebensowenig wie<br />
das »All der Realität« in seiner raum-zeitlichen Ausdehnung das ens<br />
realissimum selbst sein, denn dieses enthält als Allerrealstes eben nicht alle<br />
mögliche Realität, wie aus dem Zitat aus dem Beweisgrund Gottes (A 34 f.)<br />
zu ersehen ist, was aber nötig wäre, um nach dem Vorbild des<br />
disjunktiven Urteils den »transzendentalen Obersatz« abzugeben.<br />
Es ist die Frage zu stellen, ob eine mögliche weitere Fassung des<br />
Allereralsten (ens realissimum) dieses in der Lage versetzen würde, als<br />
Inbegriff aller Realität zu fungieren; ich habe diese Anmutung bislang<br />
abgelehnt und bleibe weiters dabei. Unabhängig von dieser Einschätzung<br />
soll nach weiteren Gründen dieser offenbar unhintergehbaren Unklarheit<br />
gesucht werden. So ist die naheliegende Alternative zu bedenken, die in<br />
der Frage liegt, was der Schlußsatz des transzendentalen Syllogismus denn<br />
eigentlich aussagen soll; was kann er uns insgesamt sagen? Ist nicht im<br />
Fortgang zum Ideal als wirkliches Urbild (prototypon transcendentale)<br />
geradezu schon besiegelt, daß das ens realissimum auch in diesen<br />
Zusammenhang als prototypon gegenüber den möglichen ectypa die<br />
entscheidende Charakteristik aus dem Beweisgrund Gottes behält, und<br />
eben selbst nicht den transzendentalen Obersatz bedeuten kann?<br />
d) Der Inbegriff als nicht-einteilbarer Allgemeinbegriff eines Alls der<br />
Realität (logische Monadologie). Der Inbegriff der Möglichkeit<br />
Zunächst stellt sich im Zuge der Überlegungen des transzendentalen<br />
Ideals das Problem, ob der Begriff vom All der Realität wirklich als<br />
Gattungsbegriff (Allgemeinbegriff) behandelt werden kann. Immerhin<br />
bezeichnet Kant den fraglichen Begriff vom All der Realität zunächst selbst<br />
als Allgemeinbegriff, der aber nicht (nicht ohne Erfahrung) weiter<br />
eingeteilt werden kann. Er zieht hinsichtlich des logischen Enthaltenseins<br />
bekanntlich daraus eine ähnliche Schlußfolgerung wie in der vierten<br />
metaphysischen Erörterung des Raumes oder der ersten Fußnote in § 17
— 1210 —<br />
der transzendentalen Deduktion: »Also ist der transzendentale Obersatz<br />
der durchgängigen Bestimmung aller Dinge nichts anderes, als die<br />
Vorstellung des Inbegriffs aller Realität, nicht bloß ein Begriff, der alle<br />
Prädikate ihren transzendentalen Inhalte nach unter sich, sondern der sie in<br />
sich begreift«. Dazu wurden im dritten Abschnitt zum Problemkreis der<br />
Affinität zwischen räumlicher Anschauung und dialektischem<br />
Existenzprädikat bereits die wichtigsten Festsetzungen getroffen. Die<br />
Charakterisierung eines Inbegriffs aber ist logisch nicht eindeutig; es ist<br />
zuerst die Frage, ob die gegebene Charakterisierung als Prinzip der<br />
durchgängigen Bestimmung eines einzelnen Dinges überhaupt<br />
verwendbar ist, nicht: ob damit ein einzelnes Ding von anderen<br />
diskriminiert wird. Für letzteres reicht der Inbegriff wohl zu: Ein Inbegriff<br />
unterscheidet sowohl Individuen verschiedener Arten wie auch<br />
Individuen der gleichen Art, wenn ein Individuum die charakteristischen<br />
Eigenschaften der Art stärker ausgeprägt besitzt als andere in der<br />
unmittelbaren Umgebung. Schließlich vermag ein Inbegriff auch<br />
verschiedene Typen von Ensembles zu unterscheiden.<br />
Es bleibt aber zweifelhaft, daß ein Inbegriff überhaupt geeignet ist, ein<br />
Allgemeinbegriff im Sinne der aristotelischen Syllogistik zu sein, daß<br />
allgemein über Allgemeines ausgesagt wird. — Im gegebenen Zitat Kants<br />
drückt sich diese Schwierigkeit darin aus, als daß Kant schreibt: »der<br />
transzendentale Obersatz der durchgängigen Bestimmung aller Dinge [sei]<br />
nichts anderes, als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität«. In diesem<br />
Satz wird schon fraglich, ob ein Prinzip der Durchbestimmung »aller<br />
Dinge« überhaupt logisch äquipollent möglich sein kann mit einem<br />
Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines jeden einzelnen Dinges.<br />
Immerhin ist es für einen Allgemeinbegriff notwendig, daß ein Merkmal<br />
eines Dinges sinnvoll denkbar ist, das komparativ-allgemein auszumachen<br />
ist, was sowohl für einen komparativen Allgemeinbegriff eines jeden<br />
Dings wie für einen Begriff der notwendigen Allgemeinheit der Idee<br />
desselben Dinges im (wesenslogischen) Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
zu gelten hat Dem Allgemeinbegriff zeichnet eine bestimmte<br />
Merkmalskompexion oder ein wesentliches Merkmal aus; ob komparative<br />
oder wesenslogische Notwendigkeit bleibt zunächst unausgemacht: Doch<br />
ist der Allgemeinbegriff anders als der logische Wesensbegriff logisch<br />
geeignet, ein bestimmbares einzelnes Ding zu bedeuten und auch fähig,<br />
der Art und deren allgemeinen Besonderung nach eindeutig zu<br />
bezeichnen.
— 1211 —<br />
Die logische Charakteristik der Begriffe macht einstweilen gerade soviel<br />
kenntlich, daß weder für den Allgemeinbegriff noch für den Inbegriff in<br />
Hinblick auf ein einzelnes Ding (Individuum) von einer durchgängigen<br />
Bestimmbarkeit im Sinne der Menge aller möglichen Prädikate eines jeden<br />
Dinges (erstes Prinzip der Durchbestimmung eines Dinges: Allheit) die<br />
Rede sein kann. So hat der logische Allgemeinbegriff abstrakt im Rahmen<br />
des Ideals der reinen Vernunft doch nur die Eigenschaft, eine zureichende<br />
Bestimmung des Begriffs von einem einzelnen Gegenstand in einer<br />
Vernunftidee denken zu lassen, aber Allgemeinbegriffe als solche<br />
(komparativ oder wesenslogisch), Wesensbegriffe wie Inbegriffe sind per<br />
definitionem für eine prädikativ durchgängige Bestimmbarkeit des<br />
konkret und individuell Gemeinten ungeeignet. Insofern stellt sich hier die<br />
Frage nach der Einteilbarkeit völlig anders: Im Fall eines Allgemeinbegriffs<br />
wird nicht der Begriffsinhalt sondern die Menge aller Gegenstände der<br />
selben Art eingeteilt, im Fall des Inbegriffs werden innerhalb der Art<br />
Individuuen zum Teil auch mit sehr unscharfen und fragwürdigen<br />
Kriterien unterschieden, oder außerhalb der Arten ein Typ von Ensemble<br />
beschrieben, der von anderen Typen eindeutig genug zu unterscheiden ist.<br />
Es ist nicht der Aspekt des Inbegriffs allein, wie er sich im Vergleich zum<br />
»Intuitum« der Anschauung zumindest denken läßt, welcher die Analogie<br />
zum Wesensbegriff im Allgemeinbegriff zu rechtfertigen vermag; das<br />
Problem liegt darin, daß auch ein Allgemeinbegriff (wie auch immer<br />
gerechtfertigt) auf eine Menge von Dingen zu beziehen sein muß. Der<br />
Inbegriff bezieht sich nur außergewöhnlicherweise auf die<br />
Bestimmungsfrage von Individuen, doch in der Hauptsache auf<br />
Eigenschaften eines Kollektivs von Dingen. Beide haben sich als nicht<br />
geeignet herausgestellt, selbst das erste logische Prinzip der<br />
durchgängigen Bestimmung eines Dinges zu erfüllen; es bleibt jedoch die<br />
Durchbestimmbarkeit der Methode von komparativem und<br />
wesenslogischem Verfahren einerseits, und einer Methode der Herstellung<br />
eines Inbegriffs andererseits zu unterscheiden.<br />
Zwischen dem Anspruch der durchgängigen Bestimmbarkeit eines<br />
Begriffs einerseits (transzendentales Ideal) und der durchgängigen<br />
Bestimmbarkeit eines Dinges andererseits (kategoriale Allheit) eröffnet<br />
sich ein Durchblick: Nun soll gerade das wesenslogische Argument für die<br />
Notwendigkeit der Geltung eines Begriffes einen eigenen Grund für die<br />
Allgemeinheit gegenüber der bloß komparativen Allgemeinheit besitzen;<br />
so schreibt Kant im Abschnitt über das Ideal der reinen Vernunft: »Ob nun
— 1212 —<br />
zwar diese Idee von dem Inbegriffe aller Möglichkeit, sofern er als<br />
Bedingung der durchgängigen Bestimmung eines jeden Dinges zum<br />
Grunde liegt, in Ansehung der Prädikate, die denselben ausmachen<br />
mögen, selbst noch unbestimmt ist, und wir dadurch nichts weiter als<br />
einen Inbegriff aller möglichen Prädikate überhaupt denken, so finden wir<br />
doch bei näherer Untersuchung, daß diese Idee, als Urbegriff, eine Menge<br />
von Prädikate ausstoße [...].« 20 Diese weiter oben schon ausgiebig<br />
behandelte Stelle sollte erlauben, näheres über die Auffassung Kantens<br />
über den Inbegriff ausmachen zu können. Zunächst hält Kant mit einer<br />
Verdopplung des Arguments fest, daß — zumindest dieser Inbegriff —<br />
dem Inhalt nach völlig unbestimmt ist. Daraus entspringt einerseits die<br />
Frage, ob das für alle Arten vom Inbegriff so sein müsse, andererseits die<br />
Gewißheit, daß der Inbegriff aller Realität, der den transzendentalen<br />
Obersatz ausmachen soll, nicht von der gleichen Art ist, denn dieser ist<br />
eindeutig nicht ein Allgemeinbegriff einer Realität, aber eben der Inbegriff<br />
aller Realität.<br />
Die zweite Bestimmung, die Kant nennt, lautet: zumindest diese Art von<br />
Inbegriff fungiert im Rahmen des Ideals der reinen Vernunft (dem Begriff<br />
vom einzelnen Gegenstand) als Urbegriff. Man erfährt also nicht wirklich<br />
näheres über den Inbegriff überhaupt, sondern bestenfalls etwas über<br />
diese Art von Inbegriff. Dieser ist also erstens dem Inhalt (den Prädikaten)<br />
nach völlig unbestimmt, und fungiert zweitens als Urbegriff. Letzterer<br />
wird durch die Einschaltung der Idee vermittelt. Das hilft zur logischen<br />
Weiterbestimmung des Inbegriffs aber nicht wirklich weiter, insofern alle<br />
notiones Ideen sind. Immerhin gibt die Darstellung des Inbegriffs als<br />
Urbegriff die Gewißheit, daß Kant an dieser Stelle ernsthaft die Absicht<br />
hatte, die Eigenschaft des Inbegriffs, eine verschiedene Arten (vielleicht<br />
sogar auch disparate Gattungen) umfassende Menge kollektiv zu erfassen,<br />
mit der wesenslogischen, also nicht-komparativen Allgemeinheit eines<br />
Begriffes analogisch zu vereinbaren. 21 Davon unberührt bleibt der<br />
komparative Allgemeinbegriff zunächst nur deshalb, weil seinem Merkmal<br />
als solchem am Ding nur eine Eigenschaft unter anderen zukommt, ohne<br />
aus sich selbst (analytisch) nachweisen zu können, daß es sich bei diesem<br />
Merkmal um die wesensnotwendige Eigenschaft dieses einzelnen<br />
Gegenstandes handelt. Diesen Nachweis zu erbringen, ist nun deshalb so<br />
20 B 601/A 573<br />
21 Vgl. in diesem Zusammenhang die Deskriptionen der qualitativen Einheit eines<br />
Begriffes vom Objekt in § 12: Thema, Fabel
— 1213 —<br />
schwierig, weil es eben nicht mehr nur allein darum geht, den logischen<br />
Allgemeinbegriff wesenslogisch als notwendigen Teilbegriff nachzuweisen,<br />
sondern zugleich (logisch: äquipollent) darum, den Nachweis zu<br />
erbringen, daß es sich dabei um den Wesensbegriff eines einzelnen<br />
Gegenstandes handelt. Offenbar ist auf eine strukturelle Ähnlichkeit<br />
zwischen Inbegriff und wesenslogischer Allgemeinheit aufmerksam zu<br />
machen, die nicht anhand eines selbst logischen Kriteriums der<br />
Allgemeinheit ausgemacht werden kann, sondern erst in der gemeinsamen<br />
Gegenüberstellung zum logischen Kriterium der Allheit deutlich wird:<br />
Zwar besteht eine Verwandtschaft zwischen Inbegriff und komparativen<br />
Allgemeinbegriff, da auch die kollektive Einheit des Inbegriffs durch<br />
Vergleichen zustandekommt, jedoch vermögen i. a die einzelnen<br />
Eigenschaftender Elemente der Kollektivität selbst keine generelle<br />
Bedeutung mehr zu erlangen Vgl. die verschiedenen Aufassungen zur<br />
aristotelischen Theorie der mixtis und wie aus verschiedenen Merkmalen<br />
der verschiedenen Ausgangsstoffe gemeinsame Merkmale des neuen<br />
Stoffes werden. Eine allgemeine Wesensdefinition entspringt aber nicht<br />
aus dem Vergleich der Merkmale, sondern ursprünglich aus der<br />
Charakteristik des Conatus des Wesens der ästhetischen Erscheinung. 22<br />
22 Zimmermann versteht die Dynamik zwischen einmal mißlungenen und einmal<br />
gelungenen Ausgleich als Grund der Bewegung des Geistes. Die beiden hier in Folge<br />
gegebenen Zitate zeigen nochmals, wie Zimmermann zwischen Geistmetaphysik<br />
und rationaler Psychologie im Sinne Kants unentschieden hin und herschwankt:<br />
»Das System der harmonischen Ausgleichung räumt nicht nur innerhalb des<br />
gesammten ästhetischen Vorstellens alle bloss scheinbaren Harmonien aus dem<br />
Weg, sondern rundet dasselbe zu einem mehr als befriedigenden, zu einem<br />
wohlthuenden Abschluss ab. Dasselbe erscheint nicht nur bewegt, sondern beseelt,<br />
nicht nur beseelt, sondern durchgeistigt, nicht nur durchgeistigt, sondern vom Geist<br />
des Harmonischen erfüllt. Das Bild scheint zu athmen [...] als wenn es von Innen<br />
heraus von dem Hauche des Wohlgefälligen belebt und regiert würde, d.h. sich<br />
selbst regierte. Dem Subjekt tritt es als Objekt, dem Ich wie ein zweites Ich, dem<br />
Beseelten als Beseeltes, dem Bewußten als Bewußtsein gegenüber, keiner Hilfe<br />
bedürftig und keine beanspruchend, eine Welt, getragen und sich selbst tragend, ein<br />
geschlossenes lebendiges, sich selbst bauendes Ganzes.« [Ästhetik, § 181]<br />
»Zwar ist wie die Beseelung des Bildes überhaupt, so auch seine Geistbeseelung nur<br />
Schein [...] Aber dieser Schein ist unwillkürlich und nothwendig, er entspringt [...]<br />
aus dem Umstande, dass der Geist für die Veränderung, die mit dem Bilde vor sich<br />
geht, indem an die Stelle des Scheinbildes das wahre Bild tritt, eine Ursache sucht,<br />
und diese, da er sich genöthigt findet, das Scheinbild zurückzunehmen, in das<br />
Nöthigende, d.h. in das Bild selbst verlegt. Die Erhöhung des Eindruckes ist nur die<br />
Folge des voraus-gegangenen Scheines des Gegentheiles; da aber die Ursache der<br />
Aufhebung des Scheines einmal in das Bild verlegt worden ist, so wird nun auch<br />
diesen die Folge als beabsichtigter Erfolg, d.i. als Zweck unter-geschoben, zu dessen<br />
Erreichung der Schein des Gegentheiles hervorgebracht wurde, es wird nicht nur<br />
Ursache, sondern zwecksetzende, bewußte Ursache, Geist in das Bild gelegt.«<br />
[Anthroposophie, § 292]
— 1214 —<br />
Untergründig macht sich hier die Schwierigkeit der Anschaung, daß von<br />
Kant immer schon »Eine Anschauung« auf einen einzelnen Gegenstand<br />
hingeordnet wird, und somit der »Räumlichkeit« gegenüber der<br />
»Räumigkeit« (Descartes) Kant nicht anders als über die reine Sinnlichkeit<br />
gerecht werden kann, nochmals bemerkbar.<br />
e) Der in logischer Hinsicht erweiterte Inbegriff und die möglichen<br />
Formen des transzendentalen Syllogismus<br />
Die Möglichkeit, den transzendentalen Obersatz (formal als disjunktiver<br />
Vernunftschluß eingeführt) grammatikalisch zu rekonstruieren, bedeutet<br />
auch, daß das Verhältnis von »Inbegriff aller Realität« und »All der<br />
Realität« den Ursprung des Problems in der Analogie des<br />
transzendentalen Syllogismus zum System der Vernunftschlüsse darstellt,<br />
worauf Kant sein System der Vernunftideen (jeweils als psychologische,<br />
kosmologische, theologische Idee) aufgebaut hat. — Zur inneren Kohärenz<br />
der Aussagen Kants über das System der Vernunftschlüsse habe ich früher<br />
näheres gesagt. Hier steht die behauptete logische Analogie von<br />
Allgemeinbegriff (Gattungsbegriff) und Inbegriff überhaupt zur<br />
Diskussion, deren Fazit nur sein kann, das aus einer solchen Analogie<br />
ohne Erfahrung nicht weiter aufs Allgemeine geschlossen werden sollte,<br />
da mit ihr nicht bloß verschiedene sondern disparate Verhältnisse zu<br />
umfassen versucht werden könnte (Leibniz).<br />
Wohl aber kann zwischen verschiedenen Inbegriffen, als Mannigfaltigkeit<br />
von Typikalität verstanden (Max Weber), jeweils ein allgemeines<br />
Besondere hergestellt und unterschieden werden; so etwa die typische<br />
süddeutsche Kleinstadt mit mittelalterlichen Kern, oder das typische<br />
Erscheinungsbild einer von der Stahl/Kohle-Industrie geprägten urbanen<br />
Landschaft, oder das typische Bild einer europäischen Großstadt in der<br />
Zwischenkriegszeit, etc.. Hier läßt sich intensional durchaus von<br />
Einteilung oder Einschränkung des Einbildungs- bzw. Vorstellungsraumes<br />
sprechen. In der eidetischen Reduktion ergibt sich für Husserl ein ganz<br />
ähnliches Problem, die Allgemeinheit und die Individualität des logischen<br />
Wesens in einer gemeinsamen und zugleich vereinzelbaren Evidenzform<br />
darzustellen (Vgl. Carnaps und Poppers Auffassungsunterschied in der<br />
Frage des individuellen und allgemeinen Gebrauchs von Begriffen).<br />
Schließlich muß Husserl alle transzendentalphänomenologischen Ansätze<br />
resubjektivieren, was aber eben schon abstrakt die Beziehbarkeit der
— 1215 —<br />
Vorstellungen auf Verhältnissen zwischen Individuuen und Objekte, somit<br />
auch allgemein-unbestimmt auf Verhältnisse zwischen Objekte, impliziert;<br />
auch wenn sich nach der transzendentalen Kritik daraus keine<br />
ontologischen Wahrheiten herausheben lassen. Vielmehr bedeutet das, wie<br />
gezeigt, die Erweiterung der Arten von Interpretationen des<br />
Wesensbegriffes bis hin zum durchschnittlichen Idealbegriff Max Webers,<br />
der nicht bloß kollektiv zusammenfaßt, sondern die Verschiedenheiten<br />
(auch Disparatheiten) zum durchschnittlich zu erwartenden Ensemble<br />
zusammenstellt, und darin erst ihr Substrat fingiert. — Ich halte das für<br />
einen Nachweis, daß die logischen Definitionen des Wesensbegriffes —<br />
gemäß der Umrisse der Darstellung im Ideal der reinen Vernunft und zum<br />
obersten Grundsatz aller analytischer Urteile — doch zu einer erkennbaren<br />
Ähnlichkeit mit dem Inbegriff, der kollektiv zusammenfaßt, fähig sind,<br />
indem das wesentliche Prädikat einfach konventionalistisch als Titel einer<br />
vereinbarten Zusammenstellung oder Liste von Merkmalen behandelt<br />
werden kann. So beschreibt Kant schon in § 12 der Deduktion unter dem<br />
Titel des transzendentalen Ideals die qualitative Einheit eines Begriffes<br />
vom Objekt als Thema einer Fabel oder als raphsodische<br />
Zusammenfassung. Insofern muß von Kant zwar letztlich doch (und<br />
vermutlich entgegen seinen eigenen Erwartungen einer dialektischen<br />
Überlegung) die Möglichkeit eingeräumt werden, von einer Analogie des<br />
disjunktiven Vernunftschlusses zum transzendentalen Syllogismus (der<br />
Inbegriff aller Realität — als entis realissimi — im transzendentalen<br />
Obersatz und das All der Realität — Inbegriff aller Prädikate überhaupt —<br />
im Untersatz) zu sprechen; ein eigener Nachweis für allfällige weitere<br />
Schlußfolgerungen kann damit ebensowenig wie bei der Erörterung<br />
anderer Kombinationsmöglichkeiten erfolgen: Es bleibt doppeldeutig, wie<br />
der Ausdruck »All der Realität« (auch die selbst doppeldeutige omnitudo<br />
realitatis) zu verstehen sei; und es bleibt wegen der Doppeldeutigkeit der<br />
omnitudo realitatis weiterhin doppeldeutig, wie, abgesehen von formalen<br />
und rein logischen Fragen das »All der Realität« den Inbegriff aller Realität<br />
zwecks Einteilung der logischen Sphäre gemäß der logischen Regel des<br />
disjunktiven Vernunftschlusses im transzendentalen Obersatz so einfach<br />
ersetzen kann: Ob das »All der Realität« nun als omnitudo realitatis oder<br />
nur als »Inbegriff aller Prädikate der Dinge überhaupt« bezeichnet werden<br />
kann, bleibt ebenso völlig offen, wie die Frage, ob der »Inbegriff aller<br />
Prädikate« oder doch das »All der Realität« die bessere Übersetzung des<br />
ens realissimum sei, oder, weil letzteres wesentlich kein Teilbegriff von
— 1216 —<br />
omnitudo realitatis sein kann, All der Realität und Inbegriff aller Prädikate<br />
etwas vom ens realissimum verschiedenes bedeuten muß.<br />
Zieht man aber im Dunkel der Unklarheiten an Stelle der omnitudo<br />
realitatis zuerst die Umformulierung des All der Realität zum Inbegriff<br />
aller Prädikate der Dinge überhaupt heran, ergeben sich zwei<br />
Möglichkeiten, wovon die erste und logisch stärkere gleich die Bildung des<br />
transzendentalen Syllogismus verhindert: Wird behauptet, ein Inbegriff<br />
läßt sich nicht einteilen, so bleibt diese Überlegung gleich zu Beginn<br />
stecken. Hat man sich aber überzeugen lassen, daß sich ein Inbegriff<br />
prinzipiell sehr wohl einteilen läßt, doch aber nicht nach einer allgemeinen<br />
und für alle Fälle voraussetzbaren Regel, dann kann man daran gehen, den<br />
Inbegriff aller Realität und den Inbegriff aller Prädikate der Dinge<br />
überhaupt nach ihrer möglichen Äquipollenz zu untersuchen. Man sieht<br />
sich aber sofort einem schon bekannten Problem gegenüber: Es ist nicht<br />
mit völliger Sicherheit zu entscheiden, ob nicht ursprünglich schlechthin<br />
von einem Inbegriff aller Prädikate überhaupt die Rede sein sollte, und der<br />
Inbegriff aller Prädikate der Dinge überhaupt nicht schon die bekannte<br />
Einschränkung der Vielheit auf Allheit hinter sich hat. Einerseits ist es aber<br />
zweifellos doch so, daß, soll von der »Allheit der Realität« ausgegangen<br />
werden, nur die Vielheit in Frage zu kommen scheint, setzt man voraus,<br />
daß »Allheit der Prädikate« eben bereits kategorial die logische<br />
Einschränkung der Vielheit zur Allheit bedeutet. Damit wäre aber die<br />
Operation der Ersetzung auch schon gescheitert. Jedoch ist es andererseits<br />
auch wieder so, daß diese Einschränkung der Vielheit auf Allheit nur<br />
durch die selbst abstrakt-unbestimmte Möglichkeit von Prädikaten, eine<br />
deictische (intentionale) Beziehung auf gedachte oder wirkliche Dinge zu<br />
unterhalten, geschehen konnte, sodaß eigentlich nicht notwendigerweise<br />
eine neue Qualität hinzu kommen müßte, ohne daß deshalb schon ein<br />
weiteres qualitatives Prädikat mit der nämlichen analytisch<br />
heraushebbaren Zuordenbarkeit grundsätzlich ausgeschlossen wäre. So<br />
gesehen, müßte unter der Einschränkung der Vielheit zur Allheit nicht<br />
auch notwendigerweise eine Änderung des Bedeutungsumfanges im Sinne<br />
des transzendentalen Inhalts verstanden werden, wenn die Beziehbarkeit<br />
auf Dinge nur analytisch herausgehoben worden wäre. Also nur unter der<br />
angezogenen Voraussetzung, es gäbe keine Änderung im<br />
Bedeutungsumfang, und der Unterschied der beiden Fassungen des<br />
Inbegriffs (aller Realität, aller Prädikate) ausschließlich in der formalen<br />
Einteilbarkeit liegt, die in der Version des Inbegriffs aller Prädikate der
— 1217 —<br />
Dinge überhaupt als Idee der Distribution eines Merkmals gegeben ist,<br />
dann muß dieser nur mögliche qualitative Unterschied in der Totalisierung<br />
der Abstraktion zunächst gerade für den Inbegriff aller Realität<br />
verschwinden oder einfach irrelevant sein, da es dann nur mehr um die<br />
Totalität der Realität gerade allein in Hinblick auf den transzendentalen<br />
Inhalt geht (Begriff vom existierenden einzelnen Wesen — principium<br />
individuationis). Insofern dürfte in dieser allgemein logischen<br />
Entschränktheit der Termini behauptet werden, daß der Inbegriff aller<br />
Realität mit dem Inbegriff aller Prädikate (gleich welcher Fassung)<br />
transzendentallogisch ident ist. Damit wären die beiden Inbegriffe auch<br />
zum Mittelbegriff eines Syllogismus tauglich. Genau diese Voraussetzung<br />
ist aber in der reinen Spekulation auf mögliche Totalität bereits immer<br />
schon gegeben. Allerdings ist dann das ens realissimum im Sinne des<br />
einzigen Beweisgrund Gottes oder im Sinne der nachfolgenden<br />
Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises kein Teilbegriff des<br />
omnitudo realitatis.<br />
Mit dem gleichen Recht kann auch behauptet werden, daß der Inbegriff<br />
aller Realität, gerade weil er sich ausschließlich auf die Totalität des<br />
Umfanges des möglichen transzendentalen Inhalts als Position bezieht,<br />
sicherlich abstrakter sein muß als der Inbegriff aller Prädikate, der schon in<br />
dieser auf Vielheit bezogenen Version die qualitative In-sich-<br />
Verschiedenheit aller möglichen transzendentaler Inhalte (nach Position<br />
und nach Qualität: quaeitas) analytisch mit der expliziten Beziehbarkeit<br />
auf Dinge in der Kategorie der Allheit hinter sich hat. Vollends wird dieser<br />
Unterschied an Abstraktheit des Umfanges deutlich, wenn man den<br />
Inbegriff aller Prädikate der Dinge überhaupt selbst in Betracht zieht: da ist<br />
dann schon die Idee der methodischen Zuschreibbarkeit ausdrücklich<br />
geworden. Mit diesem einwandfrei feststellbaren Unterschied der<br />
Abstraktheit der Inbegriffe kann nun, freilich völlig unbestimmt-abstrakt<br />
und rein formal, auch ein analoger Unterschied von Umfängen an<br />
Allgemeinheitsgraden nach dem Vorbild von Art und Gattung konstruiert<br />
werden. Damit könnte aber mit Sicherheit ein allgemeiner Syllogismus<br />
nach Barbara konstruiert werden, während zuvor anhand der Bestimmung<br />
der Inbegriffe als transzendentallogisch ident und als mögliche<br />
Mittelbegriffe sowohl Barbara wie auch der partikuläre Syllogismus in<br />
Frage kämen. — Mit diesem abstrakt konstruierten Syllogismus können<br />
weitere inhaltliche Fassungen des transzendentalen Syllogismus<br />
hergestellt werden: Z. B., würde der Inbegriff aller Realität im
— 1218 —<br />
transzendentalen Obersatz als Unvordenkliches interpretiert werden, das<br />
All der Realität im Untersatz als ens realissimum im transzendentalen und<br />
logischen Vergleich mit dem Ding stehen (hier wiederum die Unklarheit<br />
zwischen wesentlichen Prädikaten und Merkmalsprädikaten), sollte im<br />
Schlußsatz das einzelne Ding (ectypa) entspringen.<br />
Im Vierzigster Brief von Spinoza an N. N. vom 10. April 1666 ist zu lesen:<br />
»Ein Wesen, das sein Dasein notwendig in sich enthält, muß folgende<br />
Eigenschaften haben: 1. Ewigkeit, 2. Einfachkeit, 3. Unendlich, nicht<br />
begrenzt, 4. Unteilbar, 5. Vollkommenheit, 6. Dieses Wesen muß einzig sein,<br />
und kann Gott genannt werden.« (S. 137) Wie die Einfachheit und<br />
Unteilbarkeit zu verstehen sei, wird gerade von Kant kritisch diskutiert;<br />
hier ist die Unendlichkeit und Unbegrenztheit Gottes von Bedeutung, die<br />
auf den quantitativen Aspekt der Spekulation auf Totalität aufmerksam<br />
macht, was Kant an dieser Stelle vernachläßigt. Es ist in dieser Hinsicht die<br />
Frage zu stellen, ob gilt:<br />
Ens realissimum ist unendlich<br />
Omnitudo realitatis ist unendlich<br />
Oder gilt:<br />
Ens realissimum ist unendlich<br />
Omnitudo realitatis ist endlich<br />
Im ersten Fall ist noch nicht klar, ob damit auch schon die Fassung, die für<br />
den transzendentalen Syllogismus tauglich wäre, identifiziert werden<br />
kann, da nach Cantor Unendlichkeit und Unendlichkeit erst hinsichtlich<br />
ihrer Mächtigkeit verglichen werden müssen. Zunächst scheint klar, daß<br />
das ens realissimum von unendlich größerer Mächtigkeit sein muß als das<br />
omnitudo realitatis. Doch dieser Vergleich ist nicht einfach zu führen, da<br />
nicht klar ist, anhand welcher Merkmale die Mächtigkeiten verglichen<br />
werden sollen. So wäre es vielleicht möglich, daß an Mannigfaltigkeit das<br />
omnitudo realitatis das ens realissimum gemäß des Leibnizianischen<br />
Grundsatzes der sich immer mit sich selbst unähnlicher werdenden<br />
Materie, um das mögliche Maximum der Erfüllung zu gewährleisten,<br />
schließlich sogar übertrifft (z. B. gemäß der alten Auffassung Leibnizens,<br />
daß absolute Wahrheiten nur einer endlichen Analyse bedürften). — Auch<br />
hier zeigt sich die Dialektik des Totums als bloße Unentscheidbarkeit, die<br />
auch mit einer mehrwertigen Logik nicht behebbar ist.
— 1219 —<br />
Gerade der Abstraktheit und reinen Formalität der konstruierten Umfänge<br />
von Allgemeinheit anhand bloßer Inbegriffe aber kann auch hypothetisch<br />
keine weitere transzendentalanalytische Bedeutung mehr unterlegt<br />
werden, da dann doch offensichtlich wäre, daß ein logisches Merkmal, die<br />
Allgemeinheit des Begriffes, das eine klare Distributionsregel besitzt, mit<br />
einem anderen logischen Merkmal, die Kollektivität des Inbegriffes, das<br />
gerade keine genaue durchgängig für alle möglichen Fälle gleichlautende<br />
Regel der Distribution besitzen kann, allein wegen der Allgemeinheit der<br />
Regel der metasprachlichen Vereinbarungen, wie über die Beziehung von<br />
Inbegriffen auf Mannigfaltigkeit überhaupt logisch verlässlich die Rede<br />
sein kann, selbst ein eigenen formales Merkmal der Allgemeinheit im<br />
Sinne selbst allgemein definierbarer Distributionsregeln fälschlicherweise<br />
zugeschrieben bekommen hätte. Auf diese Weise wäre nur das logische<br />
Merkmal des Allgemeinen, die geregelte Distribuierbarkeit, durch die<br />
Hintertür dem Inbegriff selbst als logisches Merkmal zugeschrieben<br />
worden, während es doch nur so ist, daß wir allgemeine logische<br />
Merkmale besitzen, wie wir über Inbegriffe im Unterschied zu<br />
Allgemeinbegriffen reden können; diese Allgemeinheit reicht aber nicht<br />
einmal zu, rein formal eindeutig zwischen Inbegriffe im Sinne der<br />
Typikalität von Max Weber oder Inbegriffe im Sinne der Kantschen<br />
Transzendentalphilosophie zu unterscheiden; dazu wird allemal noch eine<br />
transzendentallogische Reflexion benötigt. Zu guter Letzt ist der<br />
Denkmöglichkeit dieser Bestimmung des Verhältnisses der beiden in Rede<br />
stehenden Inbegriffe nach dem Vorbild von Art und Gattung schon<br />
deshalb das Fortkommen verhindert, weil Inbegriffe zwar weiter eingeteilt<br />
werden können, sogar vereinzelt Subsumtionsverhältnisse bilden können,<br />
diese aber nicht imstande sind, eindeutig voneinander abgegrenzt zu<br />
werden. Zieht man noch die eben gegebene Kritik an der völligen<br />
Abstraktheit der rein formalen Konstruktion der allgemeinen<br />
Subsumtionsverhältnisse von an sich und für sich bloß verschiedenen<br />
Graden von Abstraktheit der in Rede stehenden Inbegriffe (Inbegriff aller<br />
Realität, Inbegriff aller Prädikate) heran (ein Inbegriff ist selbst kein<br />
Gattungsbegriff, mag es auch Gattungbegriffe in Sinne von logischen<br />
Klassen von Arten konkreter Inbegriffe geben), und vergewissert man sich<br />
nochmals, daß im Zusammenhang des transzendentalen Obersatzes mit<br />
dem Untersatz sinnvollerweise nach einem Mittelbegriff zu suchen ist,<br />
kann mit hinreichender Gewißheit entschieden werden, daß derjenige<br />
Vergleich der fraglichen Inbegriffe, welcher darauf hinausläuft, direkt ein<br />
Subsumtionsverhältnis zu konstruieren, letztlich die Sphäre der
— 1220 —<br />
Informiertheit, gleich welcher Fassung, und sei sie nun selbst wieder<br />
gegenüber dem ens realissimum die Erfüllung des ersten Prinzips der<br />
durchgängigen Bestimmung mittels Prädikate, mit eben dem ens<br />
realissimum in Verwechslung gerät, was zur Folge hat, daß das ens<br />
realissimum als Teilbegriff des omnitudo realitatis in Verdacht kommt. —<br />
Hier zeichnet sich die nämliche Struktur durch, die seit der<br />
Unterscheidung der qualitativen Einheit eines Begriffs vom Objekt (§ 12<br />
der Deduktion) als Allheit und dem Begriff vom einzelnen Gegenstand als<br />
Teilbegriff bekannt ist.<br />
6. Die logische Methode zur Bestimmung der existierenden<br />
Idee ist nicht nur analytisch oder synthetisch<br />
a) Die Einzelheit des Konzepts und der Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand<br />
Kant zieht bei der Entwicklung der Positionen von Allheit<br />
(Durchbestimmung eines Dinges mittels Prädikate), Allgemeinheit<br />
(Durchbestimmung des Begriffes mittels einer Idee), transzendentales<br />
Ideal (Durchbestimmung des Begriffes mittels eines Begriffes),<br />
transzendentaler Obersatz als omnitudo realitatis, als Sphäre der<br />
Möglichkeiten, ens realissimum und prototypon transcendentale als<br />
existierendes Urbild und ens originarium (summum, entis) verschiedene<br />
Methoden heran.<br />
Im ersten Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels<br />
Prädikate (Einschränkung der Menge aller möglichen Prädikate auf ein<br />
Ding überhaupt ergibt Allheit, Teilung der Sphäre der Prädikate nach dem<br />
prinzipium contradictionis im logischen Vergleich ergibt die prädikative<br />
Durchbestimmung, worin auch die Existenzbestimmung enthalten sein<br />
muß) wird sowohl der Horizont der Aussage eines einzelnen Satzes wie<br />
auch der Horizont einer aktuellen Anschauung überschritten:<br />
»Es ist der Grundsatz der Synthesis aller Prädikate, die den vollständigen<br />
Begriff von einem Dinge machen sollen, und nicht bloß der analytischen<br />
Vorstellung, durch eines zweier entgegengesetzter Prädikate, und enthält<br />
eine transzendentale Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller<br />
Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes<br />
Dinges enthalten soll.
— 1221 —<br />
Der Satz: alles Existierende ist durchgängig bestimmt, bedeutet nicht<br />
allein, daß von jedem Paare einander entgegengesetzter gegebenen,<br />
sondern auch von allen möglichen Prädikaten ihm immer eines zukomme;<br />
es werden durch diesen Satz nicht bloß Prädikate unter einander logisch,<br />
sondern das Ding selbst, mit dem Inbegriffe aller möglichen Prädikate,<br />
transzendental verglichen.« 23<br />
Zur Vorstellung eines Dinges überhaupt muß erstens der Horizont der<br />
logischen Struktur eines einzelnen einfach prädikatisierenden Satzes, der<br />
dem Ding mittelbar über das Satzsubjekt ein Prädikat zuschreibt, verlassen<br />
werden; es geht offenbar um den Begriff des Dinges, der zweitens<br />
ebenfalls die aktuell gegebenen Prädikate übersteigt, indem Kant die bloß<br />
möglichen Prädikate in die Selektion der Prädikate zum Begriff des Dinges<br />
im transzendentalen Vergleich des Dinges mit dem Inbegriff möglicher<br />
Prädikate und auch in den Auschließungskriterien zum Begriff vom<br />
einzelnen Gegenstand als Ideal der reinen Vernunft miteinbezieht. Damit<br />
muß ein Grund zur Existenzbehauptung der Möglichkeit nach schon vor<br />
dem transzendentalen Vergleich des Dinges mit dem Inbegriff aller<br />
möglichen Prädikate und vor jeder anderen Art der Teilung der Sphäre der<br />
Allheit der Prädikate mit dem principium contradictionis analytisch<br />
enthalten sein; unabhängig davon wird durch diese jeweilige Teilung der<br />
Menge der Prädikate eines Dinges in eine Doppelmenge entgegengesetzter<br />
Prädikate die Existenz dieses Dinges in der Apperzeption auf ein qualitativ<br />
näher bestimmbaren Begriff vom Ding (eines besonderen Dinges)<br />
spezifiziert.<br />
Im zweiten Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines Begriffes vom<br />
einzelnen Gegenstand durch die Idee kann es sich also nur um ein<br />
besonderes Ding handeln. Zweierlei ist hier verknüpft: Erstens in<br />
qualitativer Hinsicht eine weitere Einschränkung der Allheit nach einem<br />
strengeren Kriterium, die bekanntlich selbst erst aus der Einschränkung<br />
der Vielheit durch die Beziehbarkeit der Vorstellungen als Prädikate eines<br />
Dinges entstanden ist. Diese weitere Einschränkung soll nun nicht nach<br />
dem Besonderen des Allgemeinen geschehen, als daß das Besondere im<br />
Vergleich der Dinge untereinander nur eine Art von vielen konkreten<br />
Dingen zusammenfaßt, sondern in der Notwendigkeit eines oder gewisser<br />
Prädikate für je diese Art von Ding liegen. Allerdings benötigt schon die<br />
erste Einschränkung der Vielheit zur Allheit ein besonderes abstraktes<br />
23 K. r. V., B 600 f./A 572 f.
— 1222 —<br />
Merkmal, was man auch als eine Art von höherstufigem Prädikat<br />
bezeichnen könnte: nämlich auf ein Ding (einzelner Gegenstand oder<br />
Konzept) oder auf eine Klasse von Dingen (Mehrzahl oder Menge)<br />
beziehbar zu sein. Die Besonderheit liegt hier also bereits in der<br />
intendierten Einzelheit von Beginn an zu Grunde, und ist selbst nur eine<br />
analytisch herausgehobene Eigenschaft des Konzeptes. Allerdings<br />
beinhaltet diese Heraushebung zugleich eine Transferierung in einen<br />
anderen Topos: Was zuerst nur die abstrakte Bestimmtheit der Idee zur<br />
Identität als Konzept unabhängig von jedem Ding bedeutet hat, wird nun<br />
zur Eigenschaft eines Dinges im Begriff vom einzelnen Gegenstand. — Es<br />
wird also im Begriff vom einzelnen Gegenstand als Ideal der reinen<br />
Vernunft zum ersten Mal die Einzelheit eines Dinges im Gegenstand<br />
explizit gedacht.<br />
Es liegt aber auch das Antecedens der Allheit der Prädikate (inhaltlich:<br />
zuerst nur irgendein besonderes Merkmal) im nur formal allgemeinen<br />
Prinzip des zureichenden Grundes, daß Prädikate überhaupt auf Konzepte<br />
und auf Dinge bezogen werden können. Das Konzept des Prädikats ist<br />
nun, ein Merkmal auszusagen, daß auf etwas außer sich bezogen werden<br />
muß. Insofern vermag die Dinghaftigkeit, oder das Etwas-sein gar nicht<br />
vollständig im Prädikat-sein enthalten sein, sondern verflüchtigt sich zum<br />
logischen Gegenstand einer Intention des urteilenden Verstandes in die<br />
Allgemeinheit der rein formalen Definition, die offenbar nicht die<br />
kollektive konkrete Bestimmung einer Menge von Dingen sein kann. Die<br />
allgemeine Besonderheit des Konzeptes eines Prädikates liegt im<br />
Aussagen, und nicht im Sein des Merkmals oder dessen weiteren<br />
Eigenschaft, anhand der Art und Weise des Gegebenseins des Merkmals<br />
Rückschlüsse über die Seinsweise des Dinges als das etwas des vom<br />
Prädikat ausgesagten Merkmals zu machen. Hier nun aber liegt der<br />
zureichende Grund darin, daß Prädikate auf Konzepte und auf Dinge<br />
bezogen werden können. Damit erscheint das Ding in seiner Seinsweise<br />
insofern in aller Unbestimmtheit als bereits vorbestimmt, als daß das Ding<br />
damit von der bloß logischen Gegenständlichkeit einer Intention ein erstes<br />
Mal unterscheidbar wird. Genau dieser Unterschied soll, um das<br />
Allgemeine allgemein auszudrücken, vom zureichenden Grund einer<br />
jeden wahren (formal: entscheidbaren) Aussage begründet werden. Das<br />
verlangt die kontinuierliche Bestimmbarkeit der Art und Weise des<br />
Gegebenseins, aber ohne etwas über die konkrete Bestimmbarkeit des<br />
Gegebenen zu sagen. Derart »gibt es« eben dann auch einen zureichenden
— 1223 —<br />
Grund dafür, daß das Wesen des Prädikat-seins darin liegt, ein Merkmal<br />
auf etwas außer sich zu beziehen. Das ist auf zwei Wegen zu zeigen: (1)<br />
Ein Merkmal ist nicht selbst ein Konzept, sondern ein Element eines<br />
Konzeptes oder eine Eigenschaft eines Dinges, (2) Das Prädikat-sein ist<br />
nicht selbst ein Merkmal, sondern ein Konzept, ohne Eigenschaft eines<br />
Dinges oder Konzept eines Dinges zu sein, sein zu können. Derart »gibt<br />
es«, ohne über die Art und Weise des Gegebenseins etwas anderes als<br />
allgemeine, abstrakt bleibende, Bestimmungen auszusagen, bereits einen<br />
Ausgang aus der reinen Formalität der Spekulation. Das Prädikat-sein ist<br />
Konzept des Aussagens und selbst Element eines Konzepts des Aussagens.<br />
Am Konzept vom Prädikat wird ein etwas ohne Ding ersichtlich, am<br />
Konzept des Dinges sowohl die Einzelheit wie die Vielheit der Konzepte;<br />
und zwar unabhängig von der Vielheit der Dinge. Insofern hat sich auch<br />
die Gelegenheit ergeben, die Entwicklung des Gedankenganges als<br />
fortschreitende analytische Heraushebung der Verbindung von Konzept<br />
einerseits und von Einzelheit und Vielheit andererseits darzustellen.<br />
Im Begriff vom einzelnen Gegenstand geht es nun nicht um die<br />
Vollständigkeit der prädikativen Bestimmung eines Dinges, sondern um<br />
die wesentlichen Prädikate (womöglich um das wesentliche Prädikat)<br />
eines Dinges, das aktuell als einzelner Gegenstand gegeben sein kann.<br />
Dieses wesentliche Prädikat habe ich logisch-grammatikalisch mit dem<br />
Teilbegriff im ersten Abschnitt »Grund und Ganzes«, dessen Vorstellung<br />
den ganzen Gegenstand vorstellt, identifiziert. Damit wird einer der<br />
möglichen Teilbegriffe des möglichen ganzen Begriffes durch das erste<br />
Kriterium des Ideals der reinen Vernunft (der Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand), daß kein Prädikat aus einem anderen abgeleitet sein dürfe,<br />
ausgezeichnet, da ansonsten verschiedene Teilbegriffe des selben<br />
Gegenstandes äquipollent sein können (Wechselbegriffe). Diese Regel<br />
dürfte aber nur im Rahmen der Subsumtionslogik nach Gattung und Art<br />
stark gelten (ansonsten Überlappungen oder unzusammenhängende oder<br />
nicht regelmäßig einbeziehbare Charakteristika). Es ist also zwischen dem<br />
Gegebensein der Prädikate und der Art des Hervortretens der Dinge zum<br />
Gegenstand zu unterscheiden. Dieser schon in der Bestimmung der Allheit<br />
bemerklich werdende Unterschied wird im Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand analytisch herausgehoben, und abstrakt und allgemein zur<br />
Bestimmung dieses Begriffes durch eine Idee erklärt. Demnach muß eine<br />
Idee, zumindest aber diese Idee vom logischen Wesen, ursprünglich auf<br />
einen Gegenstand bezogen sein und zugleich das universale Konzept des
— 1224 —<br />
Gegenständlichen beinhalten. Es ist also mit Kant die Frage zu stellen, ob<br />
eine solche Idee nicht logische, sondern vielmehr dialektische Idee, also<br />
Idee von der Dialektik heißen müßte. Die Kritik dieser Dialektik wird aber<br />
nichts weiteres zu Tage bringen, als daß die transzendentalen Ideen der<br />
reinen Vernunftbegriffe zwar auf die Einschränkung der Vernunft nach<br />
den Analogien der Kategorien des empirischen Verstandesgebrauches<br />
beruhen, und es sich bei der Eigenschaft der Vernunftideen, sich nicht<br />
unmittelbar auf Gegenstände beziehen zu lassen, eine Folge dieser<br />
Einschränkung handeln wird (also nicht ursprünglich ist), es aber<br />
nunmehr auf die Form der Ideen der Vorläuferin der reinen Vernunft<br />
ankommt.<br />
b) Idea est conceptus archetypus: Die ganze und einzige Vorstellung<br />
vom Objekt.<br />
Demgegenüber ist die Diskussion weiterzuführen zwischen dem<br />
Beweisgrund Gottes und Refl. 2835:<br />
»Idea est conceptus archetypus, enthält den Grund der Möglichkeit des<br />
obiects. [I] Sie ist die Vorstellung des Gantzen, durch dessen<br />
Einschränkung andere werden. Sie ist eine eintzige (vom obiect), alles<br />
verschiedene ist bloß die limitation desselben; e.g. ens realissimum ist die<br />
transzendentale Idee. [II] Sie läßt sich niemals in concreto denken, sondern<br />
geht aller Beurtheilung in concreto zuvor. [III]« 24 (AA. XVI, p. 537)<br />
(I) »idea est conceptus archetypus« setzt die Ideenlehre in den Prius;<br />
demgegenüber behauptet das ens realissimum mit der Erfüllung der<br />
Totalität des conceptus archetypus die ganze Realität. Die Idee aber enthält<br />
den Grund der Möglichkeit des Objekts, ganz wie in § 12 der Deduktion,<br />
wo Kant das Substrat der qualitativen Einheit des Begriffs vom Objekt<br />
nicht im Objekt, sondern im Begriff sieht. Das entspricht konsequent der<br />
nämlichen transzendentalanalytischen Haltung, weshalb Kant<br />
üblicherweise das Existenzprädikat den Vorstellungen und nicht den<br />
Dingen zuschreibt. Insgesamt sieht man trotzdem auch hier, daß Kant vom<br />
Erkenntnisgrund ausgeht und derart auch seinen in den Kritiken forcierten<br />
transzendentalen Idealismus durchgängig durchhält. Die Möglichkeit des<br />
Objekts als Sinnesobjekt wird hier nun gar nicht behandelt; Kant behandelt<br />
allein den Grund der Möglichkeit des Objekts als Erkenntnisgrund und<br />
bleibt so erkenntnisidealistisch. Das Objekt ist also auch hier nichts als ein<br />
24 AA. XVI, p. 537
— 1225 —<br />
Gedankending des Verstandes, obgleich auch selbst in dynamischer<br />
Verknüpfung entstanden, und nicht bloß als Gefäß zu denken, worin die<br />
ganze Sinnlichkeit nur passiv Gestalt annimmt.<br />
(II) Die Idee wird als Vorstellung zweifach charakterisiert: als Vorstellung<br />
vom Ganzen und als »einzige« Vorstellung vom Objekt; letzteres heißt<br />
wohl soviel wie, daß sie eine universale Vorstellung des Objekthaften an<br />
sich sein soll. Insgesamt bleibt mit dieser zweifachen Charakterisierung<br />
aber offen, was genau damit vorgestellt wird, wenn man diese<br />
Bestimmungen zusammen denkt. Soll das einzelne Objekt als Ganzes<br />
vorgestellt oder gedacht werden (a), oder soll das Ganze als einzelnes<br />
Objekt hypostasiert werden (b)?<br />
(a) Die Idee ist als ungesättigter Satz (Descartes) zu betrachten wie auch als<br />
möglicher ganzer Begriff (Kant). Der nur der Möglichkeit nach ganze<br />
Begriff muß progressiv als vervollständigbar gedacht werden oder kann<br />
durch die Komplementierung von Wesensprädikate und<br />
Merkmalsprädikate, schließlich durch ein System von Teilbegriffen erst als<br />
mögliches Ganzes überhaupt gedacht werden. Insofern wird die<br />
Schwierigkeit zwischen Descartes (Idee ist ein Satz) und Kant (Idee ist ein<br />
Begriff) keine unüberwindliche sein, weil alle Entwicklungen, wie ein<br />
möglicher ganzer Begriff zu erreichen, letztlich überhaupt methodisch<br />
ausgewiesen zu denken möglich sei, mehr oder weniger deutlich auf die<br />
Entwicklung von Satzsystemen hinauslaufen. Der mögliche ganze Begriff<br />
kann als endloser Progressus oder Regressus, und auch als abschließbar<br />
gedacht werden, allerdings ohne selbst implizite einen Grund für die<br />
Aufhebung der Möglichkeit weiterer Anreicherung mitzubringen. Die<br />
relative Abschließbarkeit ergibt sich jeweils dann, wenn letztlich alles<br />
Material der Erfahrung koordiniert (widerspruchsfrei) unter den Begriff<br />
subsummiert werden kann; demnach ist der Grund eines Abschlusses ein<br />
doppelter: empirisch und formal. Die Idee als ungesättigter Satz, oder<br />
gleich wie in Bolzano’s Vorstellung, als System von Sätzen mit einen oder<br />
mehreren ungesättigten Sätzen betrachtet, kann dann als prinzipiell<br />
abschließbar betrachtet werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:<br />
Erstens muß das Satzsystem inhaltlich wie relational begrenzbar sein, ohne<br />
Widersprüche zu erzeugen, zweitens muß das Verhältnis von Satzsubjekt<br />
und Satzprädikat eindeutig grammatikalisch definierbar sein, sodaß die<br />
semantische Auswirkung des Inhalts des Satzsubjekts auf den Inhalt des<br />
Prädikates ausgeschlossen, oder als vernachlässigbar betrachtet werden<br />
kann. Unter diesen Voraussetzungen kann der ungesättigte Satz als eine
— 1226 —<br />
bereits spezifisch auf allgemeine Grammatik eingeschränkte Sphäre der<br />
Möglichkeit (formal eingeschränkte Art von reinem Inbegriff der<br />
Möglichkeit) angesehen werden, die durch die Einsetzung in die Variable<br />
(Bolzano: Variablen) konkret als entscheidbar angesehen werden kann;<br />
insofern auf eine konkret bestimmbar gewordene, also eindeutig<br />
realisierbare Möglichkeit eingeschränkt worden ist, auch wenn formal nur<br />
die Entscheidbarkeit feststellbar geblieben ist.<br />
(b) Soll das Ganze als Objekt hypostasiert werden, dann kann dies<br />
zunächst in formaler Hinsicht nach dem Vorbild der ganzen Vorstellung<br />
des Objekts durch einen Teilbegriff (Konzept) untersucht werden.<br />
Gegenüber dem ersten Untersuchungsgang liegt also bereits eine als erfüllt<br />
oder erfüllbar zu denkende Totatlität voraus; im Vergleich zum<br />
ungesättigten Satz, der nach formal bestimmbarer Ergänzung verlangt, ist<br />
hier von der normativen Vorstellung eines gesättigten Satzes oder<br />
Satzsystems auszugehen. Das zieht unter geregelten Umständen die<br />
Entscheidung zwischen wahr und falsch, unter weiteren spezielleren<br />
Umständen die Entscheidung zwischen existierend und nicht existierend<br />
nach sich. Genau das ist aber die behauptete modale Eigenschaft aller<br />
systematischer Totalisierungen, sobald nur überhaupt eine empirische<br />
Wahrheit als mögliches Element eines solchen Totums erwiesen werden<br />
kann.<br />
Wenn das Objekt als Ganzes gedacht wird, kann es als nur möglicher<br />
ganzer Begriff dem logischen Vergleich mit der Totalität der Sphäre der<br />
möglichen Prädikate unterworfen werden (a), wenn das Ganze als Objekt<br />
hypostasiert wird, kann es aber als Teilbegriff, welcher eine ganze<br />
Vorstellung vom Gegenstand erlaubt, nur mehr dem transzendentalen<br />
Vergleich mit der Totalität des Wesens unterworfen werden. — Erst in<br />
einem nächsten Schritt werden diese Operationen auf das ens realissimum<br />
bzw. im Rahmen der transzendentalen Einschränkung der Argumentation<br />
auf Erkenntnisgründe auf den conceptus archetypus übertragen, weshalb<br />
Kant dann auch gemäß (a) behaupten kann, daß alles Verschiedene bloß<br />
die Limitation davon sein muß.<br />
(III) Der conceptus archetypus (die reine Idee) »läßt sich niemals in<br />
concreto denken, sondern geht aller Beurtheilung in concreto zuvor«;<br />
daraus ist eben zu entnehmen, daß es sich hier eigentlich nicht um ein<br />
transzendentales Ideal handelt, das in concreto und in individuo bestimmt<br />
sein muß.
— 1227 —<br />
c) Die formalontologische und die wesenslogische Betrachtung des<br />
Übergangs von der Idee zum Ideal anhand des conceptus archetypus als<br />
Urbild der Ideenlehre und der Axiomatik<br />
Logisch gesehen kann die innere Struktur einer Idee also mit der Struktur<br />
eines ungesättigten Satzes verglichen werden, die Bolzano als logische<br />
Unterscheidung zu einem logischen Satz »Vorstellung« genannt hat. Auch<br />
Descartes sieht ja die Idee durch einen Satz und nicht durch einen Begriff<br />
repräsentiert. ◊ Gleichwohl vermag ich das eben auch als Begriff im Sinne<br />
des Titels eines Schemas der Idee zu verstehen, wogegen aus modaler Sicht<br />
nichts spricht: wahre Begriffe sind nur möglich, niemals wahr im Sinne<br />
von existierend wie entsprechende — gesättigte — Aussagen. Das Objekt<br />
der Vorstellung kann aber nicht nur nach dem Vorbild des ersten<br />
logischen Prinzips der durchgängigen Bestimmung mittels Prädikate<br />
gedacht werden, denn Kant schränkt hier bewußt die Untersuchung der<br />
Idee auf die Idee selbst ein. In diesem Versuch einer Vorstellung einer Idee<br />
selbst wird jedenfalls die allgemeinste Idee des Konzepts gedacht, als<br />
würde sie alle dadurch denkbar gewordenen Konzepte schon der<br />
Möglichkeit nach koordiniert enthalten können. Kant bestätigt im<br />
Anschluß, daß es sich hier nicht um die Sphäre der Prädikate handelt, die<br />
mit den Prädikaten des Dinges verglichen werden, wie im ersten Prinzip<br />
der Durchbestimmung (Allheit), sondern bereits um den transzendentalen<br />
Vergleich des Dinges mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikate, und das<br />
ist nun nicht ein anderer Begriff für die Sphäre aller möglichen Prädikate<br />
selbst (omnitudo realitatis), obgleich er als solcher in der äquipollenten<br />
Fassung von ens realissimum und All der Realität (omnitudo realitatis)<br />
diskutiert wird, sondern kann zuerst als Idee (idea est conceptus<br />
archetypus) nur das allgemeinste Konzept der Gegenständlichkeit sein:<br />
»Sie ist eine eintzige (vom obiect), alles verschiedene ist bloß die limitation<br />
desselben«. Die Möglichkeit der Informiertheit, als Vermögen ausgedrückt,<br />
besteht in der Entwickelbarkeit der Idee vom allgemeinsten Konzept, die<br />
den abstrakten Prinzipien einer formalen Ideenlehre oder Axiomatik<br />
gehorcht. Die Frage nach dem Ursprung eines transzendentalen Inhalts<br />
bleibt damit allerdings im Grunde ungeklärt, weil gar nicht gestellt.<br />
Folgerichtig besitzt die Erwähnung des ens realissimum als<br />
transzendentale Idee für diese abstrakte Behandlung nur Beispielcharakter.<br />
Es bleibt die Frage: Ist nun die Idee des Konzepts wegen ihrer<br />
Allgemeinheit nicht selbst konzeptuell? So ist die Welt eine Idee, weder
— 1228 —<br />
durch Konstruktion erfüllbar, noch selbst als konstruierbar denkbar, doch<br />
die allgemeine (oberste) Idee vom Dreieck als philosophischer Begriff der<br />
Geometrie beinhaltet zwar keinen konkret bestimmten<br />
Konstruktionsbegriff, aber Konstruierbarkeit (Spinoza‘s sämmtliche Werke,<br />
übersetzt vom J. H. v. Kirchmann und C. Schaarschmidt, Zweiter Band: René<br />
Descartes‘ Prinzipien der Philosophie, Verlag der Dürr‘schen Buchhandlung,<br />
Leipzig 2 1893, Einleitung, p. X, Begriff vom Dreieck enhält nicht die<br />
Konstruktionsregel eines bestimmten Dreiecks).<br />
Die abstrakte Definition jeder Idee im »idea est conceptus archetypus«<br />
definiert nun jede Idee als Konzept, und eine oberste oder allgemeinste<br />
Idee mag durch Abstraktion uns einsichtig geworden sein, doch soll die<br />
Idee selbst als Konzept verstanden werden, was auf Elemente der Idee<br />
schließen läßt. Ist deshalb auf Konstruierbarkeit im vergleichbaren Sinne<br />
zu schließen? Diese Elemente werden aber nicht als unabhängig von ihrer<br />
allgemeinen Idee zu betrachten sein, sondern durch ihren wechselseitigen<br />
notwendigen Bezug innerhalb eines Konzeptes ausgezeichnet sein, ohne<br />
das von den Beziehungen unter den Elementen selbst durchwegs<br />
Notwendigkeit behauptet werden muß, da doch das eine Element auch in<br />
einem andern Konzept eine für das jeweilige Konzept notwendige Stelle<br />
einnehmen kann. Erst durch diese Notwendigkeit für das Konzept werden<br />
auch die Beziehungen der Elemente untereinander notwendig. In der<br />
abstraktesten Idee ist nun nur diese allgemeinste Struktur von Ideen<br />
überhaupt mehr der Inhalt: conceptus archetypus. Dabei fällt der<br />
Bedeutungsumfang der Informiertheit des resolutiv entwickelten<br />
conceptus archetypus in dieser der Möglichkeit nach gedachten Totalität<br />
schließlich womöglich mit der Sphäre aller möglichen Prädikate eines<br />
Dinges überhaupt zusammen, aber nicht mit dem ganzen<br />
Bedeutungsumfang eines archetypus intellectus selbst, wie es auch hier<br />
den Anschein haben könnte. Insofern ist man wieder bei jener Variante<br />
herausgekommen, welche auch den transzendentalen Vergleich eben an<br />
der Sphäre aller möglichen Prädikate eines Dinges vornimmt (nunmehr als<br />
Elemente eines jeweiligen konkretisierbaren Konzepts), ohne an die<br />
Problematik der hier interessierenden Bestimmungsweise näher<br />
herangekommen zu sein als mit dem Übergang zur Vermögenslehre<br />
(Konstruierbarkeit), die bekanntlich nur zur einer Illustration geführt hat,<br />
deren Tragfähigkeit und Reichweite noch nicht vollends eingeschätzt<br />
werden konnte.
— 1229 —<br />
Sofern nicht eben von der Möglichkeit, im Inbegriff eines allgemeinen<br />
Dreieckes ein stumpfwinkeliges Dreieck zu denken, die Rede ist (was<br />
freilich ein Unding ist; es müßte heißen: die Möglichkeit mit diesem<br />
Inbegriff auch den Inbegriff eines stumpfwinkeligen Dreieckes<br />
widerspruchsfrei zu denken, diese Möglichkeit ist aber nicht bloß möglich,<br />
sondern notwendig), so ist Möglichkeit immer auf Wirkliches bezogen,<br />
zumindest aber auf die Möglichkeit von Wirklichen. Anders als im<br />
assymmetrischen Verhältnis zwischen Konstruktionsbegriff und Produkt<br />
(Bild) wird im Inbegriff stumpfwinkeliger Dreiecke der Inbegriff<br />
allgemeiner Dreiecke ebenso notwendig mitgedacht wie der Inbegriff<br />
stumpfwinkeliger Dreiecke im Inbegriff allgemeiner Dreiecke; der<br />
Unterschied besteht hier nur mehr im Grad der Heraushebbarkeit: Wohl<br />
kann durch Abstraktion vom Inbegriff stumpfwinkeliger Dreiecke<br />
sicherlich dem Inbegriff allgemeiner Dreiecke nähergekommen werden,<br />
doch kann der Inbegriff stumpfwinkliger Dreiecke im Inbegriff<br />
allgemeiner Dreiecke nicht ohne dem Versuch einer vollständigen<br />
Einteilung der Sphäre möglicher Dreiecke gefunden werden. Er kann nicht<br />
für sich gezielt herausgehoben werden, sondern muß seine Tauglichkeit<br />
als Inbegriff und Allgemeinbegriff einer Unterart an einem allgemeineren<br />
Prinzip der Einteilung erst erweisen (die Behandlung von Merkmalen muß<br />
hier nicht in jedem Falle unbedingt bis zum Konstruktionsbegriff<br />
fortgesetzt werden). Dieses allgemeinere Prinzip sorgt in diesem Falle für<br />
die Einteilung in stumpwinkelige, spitzwinkelige und gleichschenkelige<br />
Dreiecke zugleich, und nicht nur für die Heraushebbarkeit des Inbegriffs<br />
der stumpfwinkeligen Dreiecke, während der Inbegriff allgemeiner<br />
Dreiecke im Inbegriff z. B. stumpfwinkeliger Dreiecke allein durch<br />
Abstraktion, d. h. nicht mittels Vergleich, gefunden werden kann.<br />
Diese Verhältnisse wären nun auf die letzmögliche Abstraktionsstufe, die<br />
im conceptus archetypus erreicht ist, zu übertragen. Demnach wird ein<br />
inhaltliches Einteilungsprinzip der Idee benötigt, das die Einteilbarkeit und<br />
die Koordinierbarkeit des Eingeteilten garantiert; dieses wird mit der<br />
einzigen abstrakt-allgemeinen Charakteristik der Idee, Konzept zu sein, für<br />
diese oberste Idee auch schon selbstreferentiell gegeben, sodaß je nach<br />
interpretativer Entscheidung von Redundanz oder von resolutiver<br />
Informiertheit gesprochen werden kann. Auch ohne die möglichen<br />
Einteilungsarten der abstrakten Sphäre durchgängig bestimmen zu können<br />
(Satz von Bolzano-Weyerstrass), kann idealiter aber zumindest gesagt<br />
werden, daß alle Teile einer Einteilung wie auch alle Einteilungsarten
— 1230 —<br />
formal gleich notwendig sind. Ebenso kann vom abstrakt allgemeinsten<br />
Begriff eines Konzeptes (die abstrakte Definition der Idee) idealiter<br />
behauptet werden, er sei aus jedem der nur unbestimmt möglichen<br />
Unterarten des Konzepts durch Abstraktion wieder direkt abzuleiten.<br />
Das Stelle aus der Refl. 2835 über das ens realissimum drückt genau das<br />
aus, wohin der Versuch führt, das ens realissimum anhand der Definition<br />
der Menge möglicher Prädikate als omnitudo realitatis zu charakterisieren;<br />
dieses dann aber erst als »entschränkte Allheit« wieder auf das ens<br />
realissimum resolutiv beziehen zu können. Indem die Idee (das erste<br />
Prinzip) der durchgängigen Bestimmung eines Dinges mittels Prädikate<br />
zum Ideal gesteigert wird, wird ein Ding gedacht, dem alle Prädikate<br />
zugeschrieben werden müssen, um es in Totalität durchgängig bestimmt<br />
zu denken. Dieses Ding ist nicht mit den Dingen, die zu einzelnen<br />
Gegenständen werden können, zu vergleichen, und wird von Kant mit<br />
dem Begriff von den entis realissimi gleichgesetzt. Kant bedenkt die<br />
Ausgangssituation also nicht transzendental, er entwirft vielmehr anhand<br />
des Ideals des ersten Prinzips der Durchbestimmung eine rein spekulative,<br />
formalontologische Perspektive als Ding, dem gegenüber der Plural des<br />
ens realissimum denkbar wäre. Insofern ist die Definition des<br />
transzendentalen Ideals als ens realissimum letztlich als Versuch zu<br />
werten, das erste logische Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines<br />
Dinges mittels der Allheit der möglichen Prädikate mit dem zweiten<br />
logischen Prinzip der durchgängigen Bestimmung eines Begriffes vom<br />
einzelnen Gegenstand mittels einer Idee zu vereinbaren. Das Ideal der<br />
reinen Verunft, also der Begriff vom einzelnen Gegenstand, der durch eine<br />
Idee bestimmt wird, setzt nun am logischen Wesen an, das sowohl von<br />
einem intuitus derivatus und der Form der Diskursivität ausgeht, und<br />
stellt dem »Idea est conceptus archetypus« der analytischen<br />
Verstandesmetaphysik, die von der rein formalen Untersuchung der<br />
Ideenlehre ausgeht, die wesenslogische Unterscheidung von inhaltlicher<br />
Ableitung (Merkmale ut constitutiva) und Rechtfertigung (Merkmale ut<br />
rationata) gegenüber.<br />
Doch stellt Kant mit dem »Idea es conceptus archetypus« die resolutive<br />
Informiertheit nicht als notwendig verbunden vor; so läßt sich die<br />
Identifikation der reinen Idee mit dem conceptus archetypus in der Refl.<br />
2835 (III) niemals in concreto denken, sondern geht jeder Beurteilung in<br />
concreto zuvor. Es geht einer Idee also eine Synthesis vorher, die nicht<br />
abstrakt ist, oder nichts mit der Abstraktion a posteriori zu tun hat,
— 1231 —<br />
sondern konkret genannt werden kann, obgleich die oberste, abstrakte und<br />
reine Idee als conceptus archetypus niemals in concreto gedacht werden<br />
kann. Allem Anschein nach ist diese, als konkret nur unbestimmt zu<br />
denken mögliche Synthesis dem conceptus archetypus als transzendentale<br />
Bedingung der Möglichkeit vorgängig zu denken; dieser selbst ist aber nur<br />
abstrakt zu denken möglich, weder aber dieser und auch nicht die<br />
vorgängige Synthesis vermag in concreto gedacht zu werden. Die Quelle<br />
der Informiertheit bleibt demnach jeder weiteren Einsicht verschlossen,<br />
muß aber — transzendental — immer vorausgesetzt sein, weshalb im Zuge<br />
der Totalisierung des Möglichen die Informiertheit als verdeckte<br />
Konsequenz herausspringt. Damit wird Indifferenz erzeugt zwischen den<br />
beiden Ansätzen im Kapitel über das transzendentale Ideal (prototypon<br />
transcendentale), die vollständige materiale Bedingung näher zu<br />
bestimmen; es entstand ja das Problem zweier Quellen, die zur<br />
Bestimmung des transzendentalen Inhalts gleich notwendig herangezogen<br />
werden konnten: entweder die »transzendentale Materie« als Quell aller<br />
möglichen Prädikate, oder der logische Wesensbegriff als Quell des<br />
wesentlichen Prädikats (der wesentlichen Prädikate). Dieser Aspekt<br />
verdeckt aber nur das Problem, daß letztlich darin begründet ist, daß sich<br />
Merkmalslehren nicht vollständig in Urteilslehren überführen lassen. Trotz<br />
dieser absehbaren Schwierigkeiten bleibt auch nur die Denkmöglichkeit<br />
der Abhebung der bloßen Informiertheit von den Fragen materialer oder<br />
inhaltlicher Herkunft bei Kant die Voraussetzung für weitere<br />
Untersuchungen, auch wenn von einer transzendentalen Subsumtion<br />
keinesfalls die Rede sein kann, da hier eine transzendentale Ästhetik oder<br />
ein Unternehmen mit vergleichbaren Funktionen hinsichtlich der<br />
transzendentalpsychologischen Eingrenzung der Möglichkeit der<br />
intelligiblen Spontaneität wie gegenüber der Sinnlichkeit naturgemäß<br />
fehlen muß.<br />
Die Identifikation von ens realissimum und transzendentaler Idee in der<br />
Refl. 2835 (II) soll sich aber in concreto denken lassen; so soll das<br />
transzendentale Ideal in der spezifischen Definition des zweiten<br />
Abschnitts des Ideals der reinen Verunft auch noch die Definition des<br />
Individuums sein können und überhaupt seit der Untersuchung des Ideals<br />
überhaupt das transzendentale Prinzip der durchgängigen Bestimmung<br />
einer Idee in concreto (Allheit) und in individo (Wesenheit) sein.
— 1232 —<br />
7. Modallogik; Realmöglichkeit und Formalmöglichkeit in der<br />
Welt der Dinge<br />
a) Die Erweiterung des omnitudo realitatis in Raum und Zeit und die<br />
spinozistischen Folgen der Einschränkung des Ideals auf<br />
Realmöglichkeit und Formalmöglichkeit<br />
Es vermag sowohl die Überlegung, daß das für dieses anwesende bzw. als<br />
konkret Einzelnes fragliche Ding nicht geltende, aber mögliche Prädikat<br />
zugeich im Raum anderswo für einen existierenden Umstand gelten<br />
könnte, wie auch die Überlegung, daß das, was nicht zugleich, wohl aber<br />
nach einander existieren könne, einen Zeitumfang situiert, der zwar über<br />
den Zeithorizont unserer konkreten Wahrnehmung und Erfahrung (als<br />
Natur unter einer Regel) hinausgehen kann, aber, obgleich zuerst nur als<br />
kontinuierliche Fortsetzung der Umstände der sinnlichen Wahrnehmung<br />
gedanklich verlängert, als series rerum das Totum des Seienden bereits<br />
gedanklich als Konkretum, d. h. als mögliche, von anderen möglichen<br />
Welten unterscheidbare Welt bestimmbar geworden ist. Diese aus den<br />
kosmologischen Ideen nur als abgeleitet zu betrachtende Vorstellung<br />
übersteht aber insofern zu recht nicht die transzendentalanalytische Kritik,<br />
als diese Vorstellung noch stärker wäre als das von Kant in den<br />
dynamischen Kategorien angesetzte synthetische Urteil a priori, was genau<br />
genommen schon die strengen Grenzen des transzendentalen Idealismus<br />
überschreitet.<br />
Das hätte Konsequenzen nicht nur für das transzendentale Ideal, wenn<br />
gerade in der Fassung der theologischen Idee in der Kritik der<br />
theoretischen Vernunft eine dieserart zugerichtete Totalität als<br />
Interpretament der omnitudo realitatis zu Ehren kommt: das Substrat (das<br />
einzelne Wesen als Teilbegriff dieser Totalität) müßte dann entweder als<br />
der erfüllte Raum oder als das series rerum gedacht werden. Das vermag<br />
mit der Definition des Begriffes vom einzelnen Wesen, die mit dem Begriff<br />
des wesentlichen und allgemeinen Prädikats geleistet wird, und der den<br />
Begriff des Wesen in concreto und in individuo zur Existenz zu bestimmen<br />
imstande sein soll, nicht erfüllt zu werden. Soll diese Überlegung aber<br />
weiter geführt werden, dann unterliegt auch sie der formalen Idealisierung<br />
in Richtung Formalontologie, führte aber unter der angegebenen<br />
Voraussetzung von der kosmologischen Idee aus zur spinozistischen<br />
Auffassung einer göttlichen Ursubstanz mit räumlichen und zeitlichen<br />
Attributen zurück
— 1233 —<br />
Wohl aber scheint die Forderung des transzendentalen Ideals, nach der<br />
Vereinigung beider Prinzipien der Durchbestimmung (Allheit und<br />
Allgemeinheit, qualitative Einheit des Begriffs vom Objekt und<br />
wesentliches Prädikat des Begriffs vom einzelnen Gegenstand) ihr Substrat<br />
in concreto und in individuo als durchbestimmt zu denken mit der<br />
ontotheologischen Interpretation des transzendentalen Ideals zum<br />
prototypon transcendentale zumindest spekulativ vereinbar zu sein:<br />
Allgegenwart und Allmächtigkeit sollten die Superiorität eines nunmehr<br />
wieder bloß spekulativ (hypothetisch) gedachten Gottes sowohl für die<br />
Individualität (ens originarium) wie für die Idee des Raumes (ens<br />
summum) und der Zeit (ens entium) als vereinbar denken lassen. Doch<br />
erweist sich das als eine unzulässige Vermengung von Eigenschaften<br />
Gottes und Eigenschaften der Schöpfung, wonach die Schöpfung als zwar<br />
mittelbar, aber notwendigerweise mit der Selbstschöpfung Gottes<br />
verbunden aufgefaßt werden könnte. — Dies kann aber nicht mehr<br />
Ergebnis einer analytischen Methode der Heraushebung sein und bedarf<br />
einer anderen (nicht formalontologischen) spekulativen Methode.<br />
Aus den möglichen Interpretationen des omnitudo realitatis geht zwar<br />
eindeutig hervor, daß im Rahmen der Entwicklung vom transzendentalen<br />
Ideal als ens realissimum zum prototypon transcendentale der Übersprung<br />
zum existierenden und selbst schöpferischen Urbild und zur theologischen<br />
Idee durch die Synthesis der selbst nur spekulativ aus den Variationen der<br />
Interpretationen des vom omnitudo realitatis bestimmten Begriffs<br />
gewonnenen Substratsvorstellungen (Ding, Raum und Zeit als Strebung)<br />
vorstellbar wird, wobei abermals wie im Problem der qualitativen Einheit<br />
des Begriffs vom Objekt (§ 12) von der Erkenntlichkeit eines gemeinsamen<br />
wesentlichen Prädikats (was dessen Allgemeinheit intensional aus der<br />
Notwendigkeit herausspringen läßt, nicht umgekehrt extensional die<br />
logische Notwendigkeit aus der Allgemeinheit) nicht die Rede sein kann.<br />
Zur Vervollständigung bedarf es also eines Schemas des Ideals der reinen<br />
Vernunft. Daß das ens entium zwar als Strebung zur Schöpfung und des<br />
Werdens (existiturire und — noch nicht oder nicht mehr — existifcans) der<br />
Wechselwirkung wie zu der der aktuellen Aggregation vorausliegenden<br />
Ursache aus der Diskussion von totum analyticum, totum syntheticum<br />
und totum reale nochmals vorausliegt, aber weder mit der endlichen<br />
Totalität des series rerum Leibnizens noch mit dem Problem der<br />
Antinomien der kosmologischen Ideen konfrontiert wird, ist ein weiterer<br />
Makel dieser Dialektik im Ideal, der die von Kant angeführten
— 1234 —<br />
Widerlegung der Argumentation zumindest ab den kosmologischen Ideen<br />
zu präzisieren nur noch schwieriger macht: Die Definition des ens<br />
realissimum als Substrat des transzendentalen Ideals bleibt schon wegen<br />
der Darstellung desselben als Teilbegriff gleichbedeutend mit einem durch<br />
ein entschränktes All durchgängig bestimmtes Seiendes ohne eigenen<br />
Wesensbegriff erst recht immer unterbestimmt. Von der entschränkten<br />
Allheit als durchgängige Bestimmung im transzendentalen Ideal wird von<br />
mir behauptet, daß das Negat (die Entschränkung) nicht wieder einfach<br />
die Vielheit der Merkmale und Dinge ergibt. Dennoch soll sowohl diese<br />
Sphäre aller möglichen Prädikate eines Dinges im logischen Vergleich mit<br />
den Prädikaten eines Dinges überhaupt wie auch der Inbegriff aller<br />
Möglichkeit in der bereits restringierten Gestalt des Inbegriffs aller<br />
möglichen Prädikate im transzendentalen Vergleich mit dem Ding selbst<br />
(dem transzendentalen Begriff des Dinges) durch die einfache logische<br />
Bedingung der Entgegensetzung (principium contradictionis) weiterhin<br />
bestimmbar bleiben. Aber wenn das Negat mit der Entschränkung der<br />
Allheit wieder Vielheit ergeben würde, dann wäre die logische<br />
Entgegensetzung als Einteilungsprinzip der Prädikation<br />
transzendentallogisch ohne Zusatzannahmen wieder kohärent auf einen<br />
charakterisierbaren Seinsbezirk einschränkbar. Dies ist nun eben nur dann<br />
tranzendentallogisch vollständig denkbar, wenn die Vielheit bereits den<br />
nämlichen qualitativen Umfang besitzt wie die Allheit. Dann aber kann<br />
der Existenzialsatz, worauf alle höherstufigen Prädikate nach der<br />
Beschreibungstheorie von Bertrand Russell beziehbar sein sollten, nicht ein<br />
beliebiger Existenzalsatz sein, sondern muß transzendentalsubjektivistisch,<br />
wie auch Brentano vorsieht, das individuelle Dasein als Satzaussage des<br />
transzendentalidealistisch ursprünglichen Existenzialsatzes sein.<br />
Allerdings ist dann das Mannigfaltige der Vielheit nur mit dem Hinweis<br />
auf die antizipatorische Grundlage unseres intentional verfaßten<br />
Bewußtseins zu verstehen: denn dann wäre unter Individuum immer ein<br />
Wesen mit entsprechendem Bewußtsein seiner Vorstellung von sich selbst<br />
und von seinen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar auf sich selbst<br />
beziehen, bloß der Möglichkeit nach vorzustellen.<br />
Unabhängig von der Überlegung bezüglich des Ungenügens der<br />
Durchbestimmung des Begriffes vom einzelnen Wesen mittels des<br />
omnitudo realitatis im transzendentalen Ideal mangels eindeutiger<br />
Durchführungsbestimmungen der behaupteten Äquipollenz von ens<br />
realissimum und omnitudo realitatis bleibt wohl die Annahme bestehen,
— 1235 —<br />
daß auch das aktuell nicht Existierende (das Nicht-Anwesende,<br />
unbestimmt ob in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht) immerhin ein<br />
Realmögliches sei, ohne daß sich dessen objektive, d. h. wirkliche Existenz<br />
hier und jetzt demonstrieren ließe. Diese, dem resolutiven Vorgehen<br />
entgegengesetzte, bestimmende Informiertheit, die mit der formalen Idee<br />
der Distribuierbarkeit von Prädikaten auf Dinge zusammenhängt, könnte<br />
auf das Motiv hinweisen, weshalb Kant sich unterzogen hat, das ens<br />
realissimum wider besseres Wissen als Teilbegriff des omnitudo realitatis<br />
mit der Sphäre aller möglichen Prädikate für durchbestimmbar zu halten,<br />
zumal er zuvor den logischen Vergleich vom transzendentalen Vergleich,<br />
wenngleich deutlich, aber doch nicht klar unterschieden hat.<br />
So findet sich im transzendentalen Ideal eine gleichrangige<br />
formalontologische Definition, die im Individuum die Existenz als Folge<br />
der Übereinstimmung von Realmöglichkeit und Formalmöglichkeit<br />
behauptet, was aber gemäß den Überlegungen anfangs und gegen Ende in<br />
Grund und Ganzes eben nur für ein absolut notwendiges Wesen zureichen<br />
würde, von welchem noch gar nicht entschieden wäre, ob es als Teilbegriff<br />
des omnitudo realitatis, der den Gegenstand als Ganzes vorzustellen<br />
erlaubt, zu denken ist, oder als ens realissimum im Sinne der<br />
Überlegungen aus dem einzigen Beweisgrund Gottes oder in der<br />
anschließenden Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises, das eben<br />
weder alles Realmögliche noch die ganze Existenz umfaßt. Will man hier<br />
jede apperzipierende Monade einsetzen, sieht man sich nicht nur der<br />
prästabilierten Harmonie als analytisch geforderte Voraussetzung eines<br />
universal gesetzten Nexus gegenüber: In der modalen Betrachtung wäre<br />
die Konsequenz die gleiche wie im Spinozismus, der alles der gleichen<br />
Gesetzmäßigkeit überliefert, was formalidealistisch entsprechend Spinozas<br />
radikalen Substanzmonismus zu vollständiger Determiniertheit führt.<br />
Dann wäre die formalontologische Spekulation als Kette formaler<br />
Implikationen aufzufassen, was die Aufheblichkeit kontingenter Dinge<br />
nicht mehr erlauben würde. Allerdings widerpricht die Auffassung, daß<br />
Intelligibilität und Materie zusammen im Nexus existieren können, formal<br />
bemerkenswerterweise nicht Kants Haltung im transzendentalen Ideal<br />
(eine Idee und oberste materiale Bedingung) und in der Auflösung der<br />
dritten und vierten Antinomie, was einen Ausblick darauf gibt, daß die<br />
modale Schwierigkeit, die sich aus der Tendenz der formalontologischen<br />
Spekulation zum jeweils möglichst abstrakten Totum unweigerlich ergibt,<br />
mit der spinozistischen Schwierigkeit in einem überführt werden kann in
— 1236 —<br />
die Dialektik der unbezweifelbaren Intelligibilität der Freiheit, insofern sie<br />
selbst wieder eine unmittelbare Entgegensetzung zum spinozistischen<br />
Determinismus beinhaltet, die nach Kant (Religion in den Grenzen der<br />
Vernunft) im deutschen Idealismus offenbar nur Schelling zu einer<br />
transzendentalphilosophischen Grundlegung der Opposition von Gut und<br />
Böse zu entwickeln imstande war.<br />
Kant vermag also mit der behandelten Darstellung des transzendentalen<br />
Ideals im zweiten Abschnitt der theologischen Idee das Problem der<br />
Informiertheit mehrfach anzusprechen; das Ergebnis der Untersuchungen<br />
konnte neben dem Verlust des transzendentalen Inhalts in der reinen<br />
modallogischen Fassung, auch die hierarchische und resolutive<br />
Entwicklungsmöglichkeit des Prinzips »idea est conceptus archetypus« als<br />
ein Motiv der Äquipollentsetzung der Umfänge von ens realissimum und<br />
omnitudo realitatis im Rahmen einer Theorie der Informiertheit, und nicht<br />
als Identsetzung herausgearbeitet werden. Ergänzt man das Ergebnis<br />
dieser Subreption mit der gegenüber der formalontologischen Totalität der<br />
modalen Spekulation zu erwartenden Einschränkung, kann, wie schon<br />
weiter oben behauptet, auch nicht mehr das absolut notwendige Wesen als<br />
ens realissimum und einziges Wesen im transzendentalen Ideal gedacht<br />
werden. Der Übergang zu einer auf die Distributionsbedingungen der<br />
Dinge, die zu einzelnen Gegenständen werden können, restringierten<br />
Fassung des transzendentalen Ideals vermochte aber der entschränkten<br />
Allheit als Bestimmungsgrund der Begriffe des Dinges an sich selbst und<br />
des ens realissimum über die Vielheit der Prädikate hinweg bei Fichte<br />
noch eine Position zu entringen, die zweierlei in aller Allgemeinheit nach<br />
sich zieht: Einmal die Idee als bloße Stelle eines wesentlichen Prädikates zu<br />
bedenken, was mit der reinen Gegenständlichkeit jeder logischen Intention<br />
und Idee zu tun hat, und einmal nach der Möglichkeit vieler verschiedener<br />
wesentlicher Prädikate, auch die Möglichkeit vieler Dinge, und daraus<br />
unter der Voraussetzung der Entscheidung Kantens in der Auflösung der<br />
dritten und vierten Antinomie schließlich die Möglichkeit der Vielheit<br />
apperzipierender Monaden deduzieren läßt.<br />
b) Die Figuren des transzendentalen Syllogismus<br />
Der transzendentale Vergleich eines Dinges mit dem Inbegriff aller<br />
möglicher Prädikate, der zugleich als Inbegriff aller Möglichkeit<br />
aufzufassen sein soll, und eben nicht mittels logischer Vergleichung der<br />
Merkmalsprädikate geschieht, hat aber, wenn zwar zu
— 1237 —<br />
formalontologischen und modalen Bestimmungen (auch eine Art von<br />
»Prädikate höherer Ordnung«), nicht zu »transzendentalen Inhalten«, die<br />
allein der Objektwelt entstammen, geführt, zumal die konkrete (Durch)-<br />
Bestimmbarkeit eines Dinges oder Individuums als Einschränkung wie als<br />
Einteilung nichts als negative Prädikate beinhaltet, ohne daß deshalb<br />
Nicht-Seiendes ausgesagt würde. Andererseits ist das Gegenüber der<br />
»entschränkten Allheit« nicht die ursprünglich quantitativ und qualitativ<br />
gedachte Vielheit als aktuell gebbares Wirkliches, sondern (eben auch nach<br />
Raum und Zeit entschränkt) das Mögliche, so muß der Ausdruck<br />
»mögliche Realität« keineswegs immer entweder aktuelle und anwesende<br />
oder im kategorialem Sinne nur denkmögliche Realität bedeuten, und<br />
kann nicht das selbe besagen wie die transzendentale Negation einer<br />
Realmöglichkeit. — Die transzendentale Negation hätte auch nicht<br />
modallogisch Unmöglichkeit zu bedeuten, ohne das im kategorial<br />
bestimmenden Sinne (also nicht als bloße Vermutung) von realmöglich ein<br />
möglich existierendes Seiendes in seiner Abwesenheit gedacht worden ist.<br />
— Hier kann abermals nach dem Vorbild Aristoteles zwischen<br />
Notwendigkeit und Unmöglichkeit die Möglichkeit als spezifischen<br />
Bereich von Wirklichkeit und Realität vorgestellt werden: Das Mögliche im<br />
Einzelnen (was der Fall ist) konnte zuvor, bevor es war, sein oder auch<br />
nicht sein; das Notwendige muß, das Unmögliche kann nicht sein. Das<br />
Unmögliche aber ist kein Ergebnis der transzendentalen Negation. Das<br />
Realmögliche umschließt aristotelisch sowohl aktuell Existierendes wie<br />
aktuell nicht Existierendes; allerdings ohne damit einen Horizont für das<br />
Seiende schlechthin zu bestimmen, da damit keine Horizontbestimmungen<br />
a priori in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht verbunden sind. Die<br />
transzendentale Negation hätte, zumindest in der Fassung des zweiten<br />
Abschnittes der theologischen Idee, den Horizont des Seienden schlechthin<br />
aufzuheben.<br />
Insofern stellt sich die Sachlage so dar, daß hier bislang, weit entfernt vom<br />
spinozistischen Determinismus oder von der transzendentalen Negation,<br />
jeweils von einem abstrakt-unbestimmten Existenzialsatz die Rede war;<br />
unbestimmt auch in der Hinsicht, ob die Überlegung letztlich ein Ding als<br />
Objekt der sinnlichen Erfahrung betrifft, oder ob es eine apperzipierende<br />
Monade als selbst daseiendes Individuum betrifft. Im Versuch der<br />
Weiterbestimmung in den von der transzendentalen Kritik aufgewiesenen<br />
Grenzen wurde schon im Rahmen der Untersuchung der kosmologischen<br />
Ideen zwischen einem logischen und einem dialektischen Gebrauch von
— 1238 —<br />
Vernunftbegriffen unterschieden; es gilt also herauszufinden, auf welche<br />
Weise und für welchen Bereich auch hier ein logischer Gebrauch der<br />
Vernunftidee möglich gemacht werden könnte. Es trifft sich glücklich, daß<br />
damit implizite auch die nur unbefriedigend beantwortete Frage nach dem<br />
Ursprung der Informiertheit trotz des gleichzeitigen Verlustes des<br />
transzendentalen Inhalts weiterbehandelt werden kann.<br />
Nun wird von Kant der transzendentale Obersatz unmißverständlich als<br />
disjunktives Urteil nach dem Vorbild der ganzen Ideenlehre der reinen<br />
Vernunft vorgestellt: »Die logische Bestimmung eines Begriffs durch die<br />
Vernunft beruht auf einem disjunktiven Vernunftschlusse, in welchem der<br />
Obersatz eine logische Einteilung (die Teilung der Sphäre eines<br />
allgemeinen Begriffs) enthält, der Untersatz diese Sphäre bis auf einen Teil<br />
einschränkt und der Schlußsatz den Begriff durch diesen bestimmt<br />
(B 604 f./A 576 f.).« Gerade der Übergang von der Einteilung der Sphäre<br />
eines allgemeinen Gattungsbegriffes »einer Realität« zum Inbegriff »aller<br />
Realität« in der Folge droht aber die Anwendung logischer Regeln beinahe<br />
unmöglich zu machen. Bekanntlich geben die Untersuchungen zum<br />
Inbegriff aller Realität zwar Anlaß, an die Idee des disjunktiven Urteils zu<br />
denken, aber gerade keinen Ansatzpunkt für eine formal durchgebildete<br />
logische Gestalt des Urteils als Verstandesurteil, als daß das Prinzip der<br />
Subsumtion überhaupt in Frage gestellt wird, welches mit der Subsumtion<br />
auch die logische Bedingung der Einteilbarkeit der subsummierten<br />
Mannigfaltigkeit fordert: Das Prinzip von Subsumtion und Koordination<br />
ist bereits in § 15 normativ und als subjektive regulative Idee zu verstehen.<br />
Zugleich ist die logische Analyzität aber entlang verschiedener<br />
Distributionsweisen herstellbar, sodaß zumindest irgendeine weitere<br />
Einteilbarkeit auch auf Grund raphsodisch gemachter Erfahrungen<br />
möglich scheint, sodaß dieses Prinzip nicht völlig verletzt werden müßte.<br />
Jedoch nützt dieses Argument in transzendentaler Einfachheit wenig.<br />
Wegen der Einzigkeit und Besonderheit der fraglichen Begriffe bei aller<br />
ihrer abstrakten Unbestimmtheit oder unbestimmten Allgemeinheit<br />
können nicht alle Figuren des Syllogismus gleichermaßen erfüllt werden,<br />
da nicht alle möglichen Begründungen der Regeln, die einen Syllogismus<br />
aufstellen lassen, anwendbar sind. Wenn auch Kant in der Bezeichnung<br />
zwischen Vernunftschluß und Verstandesschluß weder in der ersten Kritik<br />
noch in den Vorlesungen zur Logik befriedigend eindeutig wird, kann<br />
doch angenommen werden, daß diese Undeutlichkeit darin zu suchen ist,<br />
daß Schlüsse, gleich ob dreigliedrige »Schlüsse« oder zweigliedrige
— 1239 —<br />
Schlüsse, jeweils Verstandesgründe besitzen müssen; und zwar aus zwei<br />
Gründen: erstens in Bezug auf den transzendentalen Inhalt im Sinn der<br />
radikalen Auffassung Kants von Erkenntnis, und zweitens in Bezug auf das<br />
Interesse an der logischen Regelhaftigkeit des empirisch-subjektiven<br />
psychischen Denkvorganges. So fallen Vernunftschlüsse aus Prinzipien a<br />
parte priori in transzendentallogischer Hinsicht nur deshalb nicht unter<br />
Verstandesschlüsse, weil sie nicht selbst als empirische Prinzipien, sondern<br />
vielmehr als spekulative Sätze reiner Vernunft, die von der empirischen<br />
Erfahrung, gewissermaßen nach deren aptitudo (Antizipation!) von der<br />
praktischen Klugheit erst ausgewählt werden, behandelt werden. Kant tut<br />
dies vermutlich aus architektonischen Gründen, doch betreffen diese auch<br />
den Umstand, daß Prinzipien a parte priori selbst eben nicht imstand sind,<br />
im Rahmen kontinuierlicher oder kontinuierbarer, also sinnlicher<br />
Erfahrung Erfahrungsbegriffe zu bilden, sondern immer nur diese, und die<br />
Methoden zu ihrer Gewinnung, zu systematisieren vermögen. Im Rahmen<br />
einer solchen Erörterung kann kaum erwartet werden, daß auf die<br />
Selbstverständlichkeit eingegangen wird, daß man sich alleweil nach<br />
logischen Regeln im Ausdruck zu halten hat, was dann doch wieder<br />
Angelegenheit des Verstandes sein muß.<br />
So befindet Kant in den »Logischen Spitzfindigkeiten«, daß das Schließen<br />
im Syllogismus nicht selbst als Schluß angesehen werden kann, und nur<br />
eine nachträgliche Zusammenstellung von Urteilen ist, doch wendet er<br />
sich dort nicht an die Vernunft, sondern folgert daraus, »daß die obere<br />
Erkenntniskraft schlechterdings nur auf dem Vermögen zu Urteilen<br />
beruhe« (Falsche Spitzf., A 30). Es wird also, wie noch im Übergang der<br />
Paralogismen zu den kosmologischen Ideen auch, das Denken nicht über<br />
die Vernunft, sondern als urteilender Verstand bestimmt (vgl. Zeidler 97,<br />
S. 73). Man darf annehmen, daß Kant in den Spitzfindigkeiten wie in den<br />
Vorlesungen zur Logik eher den regellogischen Aspekt, in der Kritik der<br />
Dialektik der reinen Vernunft eher den transzendentallogischen Aspekt<br />
betrachtet hat. Erst letzterer macht die Vernunft von Beginn der<br />
transzendentallogischen Untersuchung an unabdingbar, auch wenn es<br />
methodisch in der Analytik der Verstandesbegriffe und den Grundsätzen<br />
der Kategorien zuerst darum geht, die thematische Einklammerung des<br />
transzendentalen Subjekts in seiner Verklammerung mit der primären<br />
Intentionalität aufzuarbeiten.<br />
Derart kann im Rahmen der beklagten Unklarheiten zwischen den<br />
verwendeten Begriffen von Totalität von einer formalen »Konkordanz«
— 1240 —<br />
zwischen — intensionalem — Inbegriff und von — extensionalen —<br />
Sphäre gesprochen werden, da zu den Einschränkungen aus der Kritik an<br />
der bloßen Verstandesmetaphysik parallel eine resolutive Argumentation<br />
über den transzendentalen Vergleich eines Dinges mit dem Inbegriff aller<br />
Realität verläuft, um dem informierten Ding vorneweg eine Stelle in der<br />
Entwicklung der Ideenlehre gemäß dem Prinzip von »idea est conceptus<br />
archetypus« geben zu können. Das aber nur, um schon in den<br />
vorkritischen Überlegungen, die noch rationale Metaphysik bleiben, die<br />
Einteilbarkeit der Mannigfaltigkeit im Gegensatz dazu nur als rein<br />
logisches Prinzip und reinen Erkenntnisgrund behandeln zu können. Kant<br />
setzt sich durchwegs von resolutiven Lösungen des Problems der<br />
Informiertheit einer Sphäre von Realmöglichkeiten ab, und ersetzt dies<br />
durch die, allerdings bis zuletzt schwierige, Ausarbeitung des Begriffs von<br />
Erfahrung. Insofern kann man Kant epistemologisches Vorgehen<br />
bescheinigen.<br />
Das aber verhindert nicht die Lösbarkeit der Aufgabe (oder der Erklärung<br />
ihrer Unmöglichkeit), positive Bestimmungen der Dinge als Negationen<br />
einer sowohl intelligiblen wie die vollständige materiale Bedingung<br />
beinhaltenden Idee zu behandeln (wie im transzendentalen Ideal und in<br />
den Antinomien gefordert), solange das Problem der transzendentalen<br />
Umfangsbestimmung, was transzendentalanalytisch Materie und was<br />
semantischer Inhalt sei, als letzte transzendentale Inhaltsbestimmung als<br />
gelöst oder lösbar gedacht werden kann; es verhindert vermutlich aber, die<br />
dritte Figur des Aristotelischen Syllogismus eindeutig als logische<br />
Charakteristik dieser Überlegung zu bezeichnen.<br />
c) Zum modallogischen Aufbau des transzendentalen Syllogismus<br />
Der »transzendentalen Obersatz« gibt allein nicht eindeutig zu erkennen,<br />
wie er eigentlich gemeint sein könnte, obwohl Kant zweifellos im<br />
Anschluß so verfährt, daß mit dem gegebenen Syllogismus nur die<br />
Ableitung der ectypa aus dem Urbild gemeint sein kann. Er setzt nämlich<br />
unmittelbar nach dem weiter oben eingangs gegebenen Zitat fort:<br />
»Demnach ist der Gebrauch der Vernunft, durch den sie das<br />
transzendentale Ideal zum Grunde ihrer Bestimmung aller möglichen<br />
Dinge legt, demjenigen analogisch, nach welchem sie in disjunktiven<br />
Vernunftschlüssen verfährt; welches der Satz war, den ich oben zum<br />
Grunde der systematischen Einteilung aller transzendentalen Ideen legte,
— 1241 —<br />
nach welchem sie den drei Arten von Vernunftschlüssen parallel und<br />
korrespondierend erzeugt werden«. 25 Insofern wäre mit dem<br />
transzendentalen Syllogismus gerade der Übergang vom durch das<br />
omnitudo realitatis durchgängig bestimmten ens realissimum zum<br />
einzelnen Ding oder Horizont des Anwesens als Ausschnitt des Ganzen<br />
des Seins als Seiendheit geleistet worden.<br />
Deutlich identifiziert Kant hier das transzendentale Ideal anhand des<br />
disjunktiven Urteils mit dem »transzendentalen Obersatz«. — Wenn nun<br />
Kant schreibt: »So wird denn alle Möglichkeit der Dinge (der Synthesis des<br />
Mannigfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet und nur allein die<br />
desjenigen, was alle Realität in sich schließt, als ursprünglich<br />
angesehen.«, 26 so fällt er zwar spät, aber deutlich, nur eine der anstehenden<br />
Entscheidungen: ens realissimus umfaßt nicht das Ganze des nur<br />
Realmöglichen. Hier macht Kant konsequenterweise einen Schritt aus der<br />
aristotelischen Indifferenz zwischen möglich und real heraus, die zuvor<br />
für das omnitudo realitatis immerhin noch möglich gehalten worden ist.<br />
Das aber kontrastiert eben unangenehm mit den logischen Bedingungen<br />
und deren Kombinationsmöglichkeiten im Formenkreis des disjunktiven<br />
Urteils, die insbesondere in § 11 der »metaphysischen« Deduktion<br />
Wahrheit und Falschheit zum Ganzen eines disjunktiven Urteils zählen.<br />
Dies mit der Dialektik der Vernunftbegriffe und Vernunftschlüsse zu<br />
erklären versuchen, würde erstens übersehen, daß es sich doch um die<br />
Erörterung der Idee des Ideals handelt, und zweitens übersehen, daß dann<br />
das Realmögliche, nunmehr außerhalb der aristotelischen Indifferenz<br />
stehend, als Mögliches, aber nicht Existierendes zum omnitido realitatis<br />
gezählt werden müßte. Wie schon festgestellt, handelt es sich hier aber<br />
nicht mehr um eine rein analytische Metaphysik (Verstandesmetaphysik)<br />
sondern um spekulative Philosophie zwischen Formalontologie und<br />
ontotheologischer Spekulation. Die Frage nach dem<br />
transzendentallogischen Umfang des Inbegriffes, also nach Umfang nicht<br />
nur an qualitativen Merkmalen (transzendentaler Inhalt), sondern auch an<br />
Arten der Einteilung und Verknüpfung¨(transzendentallogische<br />
Reflexion), wird ohne eine für die spekulative Vernunft selbst unbekannte<br />
Bedingung der Möglichkeit zusammenhängender Erfahrung nicht<br />
beantwortet: Umfaßt das ens realissimum das All der Realität in dieser<br />
strikten Fassung und nichts anderes, oder gilt für das ens realissimum<br />
25 K. r. V., B 605/A 577<br />
26 B 606/A 578
— 1242 —<br />
nach wie vor die noch strengere Einsicht aus dem Beweisgrund Gottes: das<br />
Allerrealste umfaßt weder die ganze Realmöglichkeit (bei Aristoteles mit<br />
Notwendigkeit auch immer schon das Wirkliche) noch ausschließlich alles<br />
wirklich Reale (die zwei ursprünglich möglichen Fassungen des omnitudo<br />
realitatis). Darauf kommt Kant in diesem Zusammenhang später noch<br />
zurück; so will ich es auch halten und nur mehr hinzufügen, daß das ens<br />
realissimum als Allerrealstes schon in der Idee der unhintergehbaren und<br />
unbedingten Ursache nicht die ganze Realität umfassen kann, geschweige<br />
denn, wenn offenkundig wird, daß die Spekulation um das Allerrealste<br />
nur dann fortgesetzt werden kann, wenn das allerrealste Wesens zum<br />
Wesen allerhöchster Realität weitergebildet wird.<br />
Man sieht sich also einer widersprüchlichen Darstellung gegenüber:<br />
Einerseits ist zu behaupten, der Inbegriff aller Realität und das All der<br />
Realität können hinsichtlich ihres Umfanges äquipollent gesetzt werden,<br />
sodaß es dazu kommt, daß erstens der Inbegriff nicht als ganzer Obersatz<br />
in grammatikalischer Gestalt anzusehen ist, sondern nichts als die Aussage<br />
im Sinne vom Prädikat oder Satzgegenstand des Satzes oder Urteiles ist,<br />
und zweitens, daß die intellektuelle Vorstellung vom All der Realität nur<br />
als Satzsubjekt verstanden werden kann, das im Untersatz eingeschränkt<br />
wird, um das einzelne Ding im »transzendentalen Vergleich« im<br />
Schlußsatz vorstellen zu können. Damit ist ein partikulärer Syllogismus<br />
gebildet worden, dessen Satzsubjekte entweder jeweils als das<br />
transzendentale Objekt = X angesprochen werden könnten, aber<br />
formalontologisch diffus doch noch am Besten als transzendentallogische<br />
Identität zu verstehen sein wird, wenn es spekulativ und abstraktiv um<br />
den transzendentalen Inhaltsumfang des Begriffes überhaupt geht. Diesem<br />
transzendentalen Inhalt ist und bleibt aber unbestimmt selbst schon die<br />
Verbindung von Intuitivität und Diskursivität vorausgesetzt, wobei Kant<br />
durchaus den rein diskursiven (konventionalistischen) Gebrauch von<br />
Begriffen kennt, sodaß der Bildung des Syllogismus nichts im Wege zu<br />
stehen scheint. Andererseits wurde eben dargetan, daß der intensionale<br />
Bedeutungsumfang des Inbegriffs aller Realität — allein schon als<br />
Teilbegriff des Alls der Realität — und des Alls der Realität nicht<br />
deckungsgleich sein können. Es könnte aber dann aus Inbegriff und dem<br />
All der Realität kein Syllogismus im Sinn einer Urteilslogik oder<br />
Begriffslogik gebildet werden, wenn jeder der diskutierten Ausdrucke eine<br />
eigene intentionale Direktion in der transzendentalen Analyse besitzt<br />
(disparat sind).
— 1243 —<br />
d) Die logisch schwache, transzendentalphilosophisch starke<br />
modallogische Fassung verhindert die Rekonstruktion des<br />
transzendentalen Syllogismus<br />
Um mit diesem Untersuchungsabschnitt den transzendentalen<br />
Syllogismus abzuschließen, ist nun noch die Alternative zur strikten<br />
modallogischen Fassung zu überlegen, die transzendentalphilosophisch<br />
eigentlich die stärkeren Argumente besitzt. Es kann auf eine weitere<br />
Erörterung des ens realissimum in diesen Zusammenhang verzichtet<br />
werden, da bereits außer Streit gestellt werden konnte, daß der Inbegriff<br />
aller Realität nur dann äquipollent mit der Vorstellung des ens<br />
realissimum gesetzt werden darf, wenn letzteres in der intensionalextensiven<br />
Fassung als nichts als das All der Realität bedeutend verwendet<br />
wird, und nicht in der restringierten Fassung aus dem Beweisgrund<br />
Gottes, wonach schlußendlich auch hier von Kant das allerrealste Wesen<br />
vom Wesen allerhöchster Realität nochmals unterschieden wird. Der<br />
ganzen Überlegung liegt folgende Gegenüberstellung der Umfänge<br />
zugrunde:<br />
1. Allheit der Prädikate eines Dinges überhaupt als Einschränkung der<br />
Vielheit, woraus transzendentallogisch, trotz verschiedener Merkmale des<br />
Begriffes, Identität anhand der Äquipollenz hinsichtlich des Bezeichneten<br />
mit dem Inbegriff aller Prädikate eines Dinges überhaupt folgt.<br />
2. Entschränkte Allheit als Negation dieser Einschränkung. Dieses Negat<br />
der Allheit wird logisch nicht als geordnete (ordenbare) Vielheit betrachtet.<br />
3. Die logisch starke Darstellung des transzendentalen Obersatzes<br />
(insofern auch des omnitudo realitatis als Bestimmungsgrund) schließt das<br />
Wahre wie das Falsche mit ein. Das kann hier nur bedeuten, daß auch das<br />
bloß Realmögliche ohne aktuelle Möglichkeit zur Assertion zum Umfang<br />
des fraglichen Obersatzes, dann aber auch zum Umfang des Inbegriffes<br />
aller Realität gehören müßte. Genau das entspricht den angebotetenen<br />
Alternativen der Interpretation des Inbegriffs aller Realität: ens<br />
realissimum ist entweder genau das All der Realität oder eine Art von<br />
höher qualifizierter Realität, welche die Kategorialität des entscheidbaren<br />
Aussagens im Sinne eines allerhöchsten Wesens einerseits überschreitet,<br />
andererseits alle Realität gerade nicht umfaßt. Oder: wenn ens realissimum<br />
ein Teilbegriff des omnitudo realitatis ist, dann mit dem nämlichen<br />
modallogischen Problem, ob das Wahre und das Falsche tatsächlich mit<br />
inbegriffen wird.
— 1244 —<br />
4. Wenn ens realissimum transzendentalphilosophisch stark interpretiert<br />
wird (also als allerhöchste Realität, die nicht alles Reale umfaßt), dann gibt<br />
es unter der Voraussetzung sowohl der empirischen Auffassung von<br />
»Wirklichkeit« in den ontologischen Gottesbeweisen von Thomas und<br />
auch von Anselm, wie der (reinen?) Intelligibilität des Daseins Gottes,<br />
keine transzendentallogische Identität im Zuge der spekulativen Analogie<br />
von ens realissimum, Inbegriff aller Realität und Allheit der Realität<br />
anhand durch Abstraktion totalisierten Äquipollenzen. Wenn omnitudo<br />
realitatis oder das All der Realität logisch stark (also modallogisch<br />
schwach), und ens realissimum als Inbegriff modallogisch stark<br />
interpretiert wird, dann gibt es keine Gelegenheit, logische Identität gemäß<br />
dem abstrakt totalisierten transzendentalen Inhalt zu behaupten. Nur<br />
wenn ens realissimum modallogisch stark interpretiert wird (nichts als das<br />
All der Realität), dann gibt es überhaupt die Möglichkeit zur formal<br />
verlangten Deckungsgleichheit. Um diese zu erreichen, muß eine weitere<br />
Bedingung erfüllt sein: omnitudo realitatis, das All der Realität, kurzum<br />
der Umfang des transzendentalen Obersatzes muß logisch schwach, aber<br />
modallogisch stark interpretiert werden, also es muß gelten, daß nur das<br />
gilt, was existiert, sodaß nicht auch die bloß gedachte Realmöglichkeit in<br />
den Umfang fällt.<br />
5. Auch wenn omnitudo realitatis oder das All der Realität logisch stark<br />
(also modallogisch schwach), und ens realissimum als Inbegriff<br />
transzendentalphilosophisch stark interpretiert wird, dann wird die<br />
geforderte Gleichsetzbarkeit der Bedeutungsumfänge in dieser Art von<br />
mittelbarer Analogie nicht erfüllt.<br />
6. Die noch zu diskutierende Problemstellung kann deshalb im<br />
Wesentlichen nur mehr mit der logisch schwachen, modallogisch starken<br />
Fassung (nichts als das All der Realität) des omnitudo realitatis (a), welche<br />
die eine Bedingung der durch Analogien ermittelten Identität ist, und mit<br />
der logisch starken, modallogisch schwachen Fassung der Bestimmung der<br />
logischen Gestalt des transzendentalen Obersatzes aus dem § 11, wonach<br />
das Ganze des disjunktiven Urteils auch das Wahre und das Falsche<br />
umfasse (b), verbunden sein, solange das All der Realität im Untersatz<br />
nichts als das Seiende behauptet. Entscheidend wird die logische Form des<br />
Obersatzes, und vor allem die Form der Einschränkung des Alls der<br />
Realität. Die Besonderheit, aus den Negationen des Inbgriffs aller<br />
Prädikate dem abzuleitenden Dinges (ectypa) das positiv intendierte<br />
Prädikat zu konstruieren, um durch Einteilung des Alls der Realität die
— 1245 —<br />
Positivität des Dinges, der Dinge, zu erweisen, zeigt nur abermals, daß das<br />
Gelingen des transzendentalen Syllogismus nur durch spekulativ<br />
vorgehende Erörterung beurteilt werden kann; und offenbar ist<br />
unabhängig von den vorangehenden Überlegungen mit der logischen<br />
Form des Untersatzes, der doch den transzendentalen Vergleich des<br />
Dinges mit dem Inbegriff aller Prädikate eines Dinges überhaupt<br />
durchführen soll und gerade die allgemeine Verwendbarkeit der<br />
allgemeinen Logik zu garantieren hätte, eine Umständlichkeit im<br />
Schwange, die nichts mehr mit den beiden Quellen des transzendentalen<br />
Inhalts, der transzendentalen Materie und den wesentlichen Prädikaten<br />
(als eigene Problemstellung zwischen Merkmalslehre und Urteilslehre) zu<br />
tun hat. Man wird im Anschluß auf Folgendes im Rahmen weiterer<br />
Untersuchungen zur transzendentalen Negation in Verbindung mit der<br />
Überlegung der noch nicht völlig aufgeklärten Bedingung derjenigen<br />
formalontologischen Spekulation, welche die Aufheblichkeit kontingenter<br />
Dinge behauptet, erfahren, ob Kant verabsäumt hat, die Merkmale auch<br />
aufheblich zu denken, oder ob mit der Behandlung der transzendentalen<br />
Negation bereits einem Programm kritischer Einschränkung spekulativer<br />
Verstandesmetaphysik folgt. Insbesondere für die Verständlichmachung<br />
des Grundes, welche die Spekulation auf Totalität zwischen Resolution<br />
und Abstraktion zur theologischen Idee führt, werden dort die Einflüsse<br />
von Cusanus, Anselm und Thomas, und das Zurücktreten spinozistischer<br />
Hinweise konstatiert.<br />
e) Die theologische Idee innerhalb und außerhalb des Umkreises des<br />
Seienden. Spinoza, Leibniz und Kant<br />
Nunmehr ist der transzendentale Obersatz in dieser Argumentation vom<br />
transzendentalen Ideal darin verschieden, daß er nicht, um<br />
widerspruchfrei allgemein unbestimmt in verschiedenen Versionen<br />
möglicher Syllogismen gedacht zu werden, als Bestimmungsganzes eines<br />
daseienden, im Sinne einer apperzipierenden Monade vernunftbegabten<br />
Individuums gedacht werden muß. Die hier sich ergebenden<br />
Verzweigungen der Überlegung wurden eingehend anhand des Umfanges<br />
der Bestimmungen von ens realissimum, Inbegriff aller Realität, omnitudo<br />
realitatis und Inbegriff aller Prädikate behandelt, sodaß hier zu der sich<br />
daraus ergebenden Möglichkeit fortgegangen werden kann:<br />
1. Die Mannigfaltigkeit ist als Mannigfaltigkeit des gegebenen Seins<br />
aufzufassen (also noch in der transzendentalsubjektivistischen Position)
— 1246 —<br />
2. Die Mannigfaltigkeit ist formalontologisch als das immanent Gegebene<br />
und das daraus Mögliche aufzufassen (also sowohl als<br />
transzendentalsubjektivistisches wie auch als formalontologisches<br />
Regelwerk interpretierbar).<br />
3. Die Mannigfaltigkeit ist als Bestimmungsganzes des prototypon<br />
transcendentale, d. i. nunmehr das existierende Urbild nicht als<br />
transzendentales Ideal eines einzelnen Wesens, sondern bereits ens<br />
realissimum als ens originarium, also des einzigen allerrealsten Wesens zu<br />
denken.<br />
4. Die Mannigfaltigkeit ist als das Unvordenkliche (transzendentale<br />
Materie) eben des ens realissimum und nicht als archetypus intellectus vor<br />
jeder Informiertheit, das ens realissimum als allerrealstes und höchst<br />
reales Wesen aber bereits als informiert und gemeinsam mit Wirklichkeit<br />
im Sinne empirischer Erfahrbarkeit der Welt der Dinge zu denken (ens<br />
originarium, entium, summum). Mit dieser Totalisierung durch<br />
Abstraktion und transzendentallogisch einseitige Setzung von<br />
Gleichursprünglichkeit wird zugleich die Frage nach der Abfolge der<br />
Ursächlichkeit der ersten Ursache vermieden. Oder die Mannigfaltigkeit<br />
liegt in einer Position vor der Realmöglichkeit und vor der<br />
Formalmöglichkeit in unvollkommener Indifferenz als das<br />
Unvordenkliche dem ens realissimum gegenüber (wie die Abweichung im<br />
Beweisgrund Gottes und die Widerlegung im Zweiten Abschnitt<br />
nahelegen würden), woraus sich der göttliche Verstand erst frei bestimmt<br />
und informiert.<br />
Der erste und der zweite Punkt erlaubt zusammen transzendentallogisch<br />
eine Zusammenfassung, deren Horizontbestimmung ebenfalls<br />
ungenügend ist, aber eben weiter ist als die aus § 11 der metaphysischen<br />
Deduktion, wonach das disjunktive Urteil das Wahre wie das Falsche (hier<br />
also das Existierende wie das Mögliche) enthalte. Im transzendentalen<br />
Obersatz wie im Untersatz kommt noch die wesensgemäße<br />
Interpretierbarkeit des Realmöglichen nach Raum und Zeit als Problem<br />
hinzu, da mit dem möglichen Wegfall der ausgezeichneten Position des<br />
Individuums nur vermeintlich auch das Problem der Aktualität und der<br />
Anwesenheit verschwindet: Schon die Untersuchung der Antinomien der<br />
kosmologischen Idee haben gezeigt, daß weder das Problem des<br />
Horizontes der Aktualität und Anwesenheit schwindet, noch daß das<br />
Problem der Metaphysik von Raum und Zeit mit der strengeren
— 1247 —<br />
Durchführung des Transzendentalsubjektivismus einfach wegfällt. 27 Kant<br />
beobachtet in diesen Zusammenhang eindeutig die Dimensionierung der<br />
Auslegbarkeit des tranzendentalen Obersatzes zu wenig; offenbar will er<br />
sich den Aufwand der Kritik zwischen transzendentalem Idealismus und<br />
den verschiedenen Positionen des transzendentalen Realismus, die mit der<br />
Entdeckung des transzendentalen Prinzips des synthetischen Urteils a<br />
priori und deren Analogien zu den transzendentalen Ideen der reinen<br />
Vernunft eröffnet worden sind, nun aber die Reinheit des transzendentalen<br />
Idealismus selbst bedrohen, oder sich gleich eine Entscheidung in dieser<br />
Angelegenheit überhaupt ersparen. Die Sphäre der Mannigfaltigkeit kann<br />
hier räumlich wie zeitlich in verschiedenen Kombinationen ausgelegt<br />
werden; ich denke, daß metaphysische Anfangsgründe der<br />
transzendentalen Ästhetik als Kritik an der Verstandesmetaphysik<br />
Spinozas aufgefaßt werden müssen, nach welcher die göttliche Substanz in<br />
Übereinstimmung mit den Attributen Allgegenwart, Allwissen und<br />
Allmacht in Raum und Zeit sei, womöglich aber in einem auch anders sei.<br />
Der Herausdrehung dieser Vorstellung von Raum und Zeit aus der<br />
Position des absolut notwendigen Wesen, das alles determiniert, in die<br />
Position des durch die primäre (sinnlich-empirisch ausgerichtete)<br />
Intentionalität bestimmten transzendentalen Subjektes der<br />
transzendentalen Analytik des empirischen Verstandesgebrauches, das<br />
Totalität nur als Produkt von Teilung, Einschränkung und Grenze im<br />
Regressus empirischer Erfahrung verstandesgemäß denken kann, legt<br />
Kant noch in den Kapiteln der transzendentalen Ästhetik mit<br />
metaphysischen Erörterungen des Raumes die Grundlage.<br />
Wie schon öfter in diesem Zusammenhang ist wieder auf die Leibnizsche<br />
Fassung des Kompossibilitätsprinzipes zu verweisen, das bereits das<br />
Zugleichsein dynamisch, wenngleich unbestimmt-allgemein, mit<br />
zukünftigen Zuständen verbindet. Die Übertragbarkeit ist dadurch<br />
eingeschränkt, als daß Leibniz von series rerum in eigener, gewissermaßen<br />
am Ende der Zeit objektiv zeitlicher Ausdehnung ausgeht, entlang der wir<br />
von der Gegenwart nur mitgenommen werden; Kant zeigt hier anders als<br />
in den M. A. d. N. hingegen auch in der Behandlung des Regressus und<br />
Progressus den transzendentalidealistischen Standpunkt, indem er<br />
dasjenige intelligible Subjekt, daß er in »Überlappung« mit der Objektwelt<br />
durch Sinnlichkeit und Leiblichkeit vorstellt (Auflösung der dritten<br />
Antinomie), zum Ausgangspunkt sowohl der Orientierung in die<br />
27 Vgl. im selben Abschnitt: Fünftes Kapitel, Intellection und Einbildungskraft
— 1248 —<br />
Vergangenheit, letztlich auf die erste und oberste Ursache, wie der<br />
Orientierung auf die Zukunft, auf das Noch-nicht-Seiende, aber auch auf<br />
das Nicht-Absehbare, nimmt. Kant stellt also die Orientierung gemäß der<br />
Zeitreihe A, d. i. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft als aneinander nicht<br />
anliegende Zeitteile, auf ein transzendentalästhetisches Fundament, ohne<br />
deshalb der Zeitreihe A selbst eine transzendentalästhetische<br />
Anschauungsform anzumessen. Ist hierin ein Widerspruch zu Leibniz zu<br />
erkennen? Es ist davon auszugehen, da Kant den logischen Gebrauch der<br />
Vernunftbegriffe nur mit einer Deduktion ihrer objektiver Gültigkeit<br />
versehen hat, daß auch hier der Anspruch auf objektive Gültigkeit der<br />
Prinzipien geht. M. a. W., Kant geht in seinem Versuch einer<br />
Frontbegradigung der Metaphysik durch ihre Kritik und Verwandlung<br />
derselben in eine Wissenschaft, und hierin enger an Descartes<br />
Grundlegung angelehnt als Leibniz, transzendentalidealistisch so strikt<br />
wie möglich von Erkenntnisgründen aus. Leibniz denkt aber als<br />
Alternative zu einer radikal transzendentalsubjektivistischen Position des<br />
frühen Descartes alles andere als an eine Formalontologie; auch handelt es<br />
sich weder bei seinen Entwürfen zu einer zusammenhängenden<br />
Monadologie noch in seinem nur verstreut skizzierten System der<br />
vinculum substantiales um ein System der Regionalontologien. Obgleich<br />
regionalontologische Gesichtspunkte bei der Gliederung von Teilen der in<br />
der gleichnamigen Schrift zusammengefaßten Monadologie hilfreich sein<br />
können, entsprechen sie nicht dem Gang der Überlegungen: so sind die<br />
zum Teil nicht einheitlichen Versuche, mechanische und biologische<br />
Prinzipien konstruktivistisch nach dem Unterscheidungskriterium von<br />
nicht endlos teilbaren und endlos teilbaren Maschinen letztlich doch zu<br />
vereinbaren, keinesfalls regionalontologisch aufzulösen. Das System des<br />
vinculum substantiale superadditivum, daß allererst der wahrhaft<br />
apperzipierenden Monade einsichtig sein soll, bestimmt zwar die<br />
Vernunft, und zwar an anderer Stelle als Kant, der eben schon den<br />
urteilenden Verstand als entscheidenden Grund ansieht, von<br />
(transzendentaler) Apperzeption zu sprechen. Während die Darstellung<br />
der Monadologie eine immanente genetische Linie besitzt, wird das<br />
System des vinculum substantiales insgesamt zur ontotheologischen<br />
Bedingung der Möglichkeit der Verwirklichung eines Systems der<br />
praktischen Vernunft in technisch-praktischer wie in ästhetisch-praktischer<br />
Hinsicht.
— 1249 —<br />
Leibniz Überlegungen zum series rerum stehen nun mit dem<br />
evolutionären wie mit dem mechanischen Aspekt der Schöpfung in<br />
Verbindung, auch wenn, wie etwa in den 24 Sätzen, die abstraktunbestimmte<br />
Form der Spekulation auf Totalität durch Abstraktion eine<br />
eigene Dignität in ontologischer Hinsicht gewinnt, die allemal nicht restlos<br />
als formalontologisch denunzierbar ist. Kant ist aber offenbar nicht gewillt,<br />
die Zeitform der verfließenden, kontinuierlich abzählbaren Zeit weiter zu<br />
abstrahieren und etwa auf eine auf die Antizipation fundierende<br />
transzendentalästhetische Position formaler (d. i. im Bewußtsein der Zeit<br />
und des Zeitinhalts kontinuierlichen) Subjektivität von Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft anzuwenden, die bis in die<br />
Grundlegungsproblematik der Finalursachen gegenüber der Kritik der<br />
metaphysischen Voraussetzung eines Organisationsprinzips in der Natur<br />
in der Kritik der teleologischen Urteilskraft Relevanz haben könnte.<br />
Leibniz hat, wenn auch nicht den Raum, dann doch die Zeit objektiv<br />
genommen, und sich damit deutlich über die Grenzen des<br />
transzendentalen Idealismus hinaus bewegt. Leibniz ist insofern<br />
Hyperrealist oder eben rationaler Metaphysiker, aber weder betreibt er nur<br />
Verstandesmetaphysik noch wird Leibniz zum bloßen transzendentalen<br />
Realisten, was die Einschränkung der Apperzeption auf Vernunft<br />
nachweist.<br />
In Hinblick auf die Interpretation der grundlegenden logischen Struktur<br />
des Aussagens zwischen auschließendem und nicht-ausschließendem<br />
»oder«, was immerhin dem »Inbegriff aller Realität« wie dem »All der<br />
Realität« die verschiedensten Fassungen zur Darstellung verhilft, ist<br />
demnach auch eine zeitliche Dimension zu berücksichtigen. Dies zuerst<br />
nur analytisch, da der immanent genetische Moment gewisser Aspekte<br />
dieser Untersuchung dies spekulativ, aber reell in Stellung zu bringen<br />
erlaubt. Sobald aber das Denken die Grenze des transzendentalen<br />
Idealismus überschreitet, wird auch der inhaltliche Horizont der<br />
Überlegung subjektiv verzeitlicht, sei sie eine der Spekulation, der<br />
Reflexion des Vergleichens und Verknüpfens, oder des Bejahens und<br />
Verneinens, oder des Einräumens und des Ausschließens. Das führt in eine<br />
Phänomenologie der Arten von Regressi in den Antinomien der<br />
kosmologischen Ideen, wobei spätestens ab der Auflösung der zweiten<br />
Antinomie (zuvor schon im synthetischen Grundsatz der<br />
Wechselwirkung) bereits der strikte transzendentale Idealismus von Fall<br />
zu Fall allein mit Hilfe einer metaphysischen Analogie verlassen worden
— 1250 —<br />
ist. Die metaphysische Analogie als solche sollte einerseits gerade anhand<br />
des synthetischen Urteils a priori, das in der transzendentalen Deduktion<br />
der Begriffe und der Schematen gegen die strikte Auslegung des<br />
Transzendentalsubjektivismus das modale Prädikat der »objektiven<br />
Realität« hergestellt hat, wenn auch restringiert, immerhin möglich<br />
geworden sein. Andererseits bedarf es erst der Qualifikation einer jeden<br />
nur spekulativ aufgefundenen Analogie zur metaphysischen Analogie, die<br />
eben im Falle absoluter und besonderer Einzelbegriffe nicht wie<br />
komparative Allgemeinbegriffe allein aus der zusammenhängenden<br />
Erfahrung qualifiziert werden können.<br />
Grundsätzlich spricht nach all dem nichts dagegen, daß die Vorstellung<br />
des series rerum in seiner allgemein-unbestimmten Fassung in dem eben<br />
eröffneten Bereich der reellen Spekulation der reinen Vernunft verbracht<br />
wird. Was aber für Leibniz in eben dieser allgemeinen Unbestimmtheit,<br />
und auch im Moment ohne Bezug auf einen allgemeinen und umfassenden<br />
Conatus stehend festgehalten, noch kein Problem sein muß, führt im<br />
Rahmen der Kantschen Transzendentalphilosophie unvermeidlich in eine<br />
bislang vermiedene Schwierigkeit: Beschränkt man sich auf die<br />
Erkenntnisgründe, so führt die Verzeitlichung zur Frage nach der<br />
Bestimmbarkeit der Vergangenheit und, was hier nun entscheidend ist, zur<br />
Frage nach der Bestimmbarkeit der Zukunft, die nicht auf ein letztlich<br />
innersubjektives Schema zwischen dem Conatus pathologischer Begierden<br />
und dem Willensvermögen als die Vernunft als Oberes<br />
Begehrungsvermögen hinausläuft. Trotzdem bleibt die Subjektivität<br />
erkenntniskritisch (im theoretischen Erkenntnisinteresse) in Stellung. Diese<br />
Frage ist aber in einem gänzlich anderen Sinne der unmittelbaren Kenntnis<br />
entzogen, wie im Regressus des Erfahrungmachens, wo erst jeweils am<br />
vorläufigen Ende der Methodenanwendung (der Beantwortung der damit<br />
gestellten Frage) sowohl der Denk- wie der Forschungsbewegung zu<br />
einem wie immer vorläufigen Ergebnis kommt; oder wie eben in der Frage<br />
nach der (empirischen) Bestimmbarkeit der Vergangenheit, die zumindest<br />
teilweise Urteile über Spuren und Quellen erlaubt. Die Zukunft ist<br />
grundsätzlich nicht nur wegen der Unbekanntheit bekannter oder selbst<br />
unbekannter Faktoren ungewiß, sondern weil sie schlichtweg nicht völlig<br />
im strengen Sinn determiniert ist. — Da es sich nun um eine<br />
transzendentale Untersuchung handelt, vermag daraus auch kein<br />
Argument für eine Darstellung gemäß der Unbedingtheit des
— 1251 —<br />
transzendentalen Obersatzes (des transzendentalen Syllogismus) gezogen<br />
werden; es bleibt jedoch das transzendentale Kategoriengerüst in Stellung.<br />
Darüberhinaus gehende Versionen setzen sich also nicht nur über die<br />
Grenze des strengen transzendentalen Idealismus hinweg, sondern<br />
verlangen vom allgemein-unbestimmten Begriff des series rerum bei aller<br />
inhaltlichen Indifferenz gerade im Rahmen der Spekulation verschiedener<br />
möglicher Welten doch schon die Entscheidung, daß es ein Ende gäbe, von<br />
wo aus die Determinationen in der Zeit des series rerum, die Leibniz eben<br />
nicht so streng wie hier Kant in den Grenzen des transzendentalen<br />
Idealismus auf die Zeitlichkeit des sinnlichen Erfahrungsmachens und<br />
deren Kausalität einschränkt, überblickbar werden könnten. Nun geht aber<br />
Kant in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaften<br />
von eben einer solchen Idee der vergangen gesetzten Zeit aus, die zwar als<br />
regulative Idee jeweils vom gerade zugänglichen Stand des Wissens<br />
auszugehen hat, aber a fortiori rein spekulativ bis zu dieser Absolutheit<br />
gesteigert werden kann, das das ganze series rerum darin Platz findet.<br />
Insofern mag es als Desiderat gelten, den transzendentalen Obersatz mit<br />
den Ergebnissen der anhand der Untersuchung des transzendentalen<br />
Obersatzes eröffneten Kreis reeller Spekulation als metaphysische<br />
Anfangsgründe zu reinterpretieren. Allerdings wird hier von der<br />
Spekulation eben mehr verlangt als die Auslegung des transzendentalen<br />
Existenzialsatzes, von welchem aus die Bewegung des Begriffes beginnt,<br />
und im Rahmen des transzendentalen Idealismus auch in einer kritisch<br />
restringierten Fassung des transzendentalen Ideals zu einem Ende<br />
gebracht werden kann. Das reicht aus, um in der Immanenz des<br />
ontologischen Gottesbeweises dessen formale und objektive Gültigkeit für<br />
den Begriff jedes einzelnen Dinges zu behaupten, aber nicht die<br />
notwendige Existenz von bestimmten einzelnen Dingen in einem<br />
möglichen Erfahrungszusammenhang und nicht die absolute<br />
Notwendigkeit eines obersten und höchsten realen Wesens. Das würde<br />
nach einem transzendentalen Prinzip und einem synthetischen Urteil a<br />
priori verlangen, was für die eine wie für die andere Frage allein aus<br />
Begriffen erschlossen, als unmöglich für erweisbar entschieden worden ist.<br />
Die absolute Notwendigkeit ist schon für den vorkritischen Kant nur aus<br />
Begriffen zu beweisen möglich, sofern als daß nur Urteile einander<br />
widersprechen, nicht die wirklichen Dinge (Erste Hälfte der sechziger<br />
Jahre, Refl. 3813: »[...] Die Absolute Nothwendigkeit eines Dinges muß aus<br />
Begriffen hergeleitet werden und nicht aus dem Verhältnis mit anderem<br />
existierenden. Kein Gegentheil des Daseyns wiederspricht sich; nur die
— 1252 —<br />
Sätze.« AA. XVII, p. 301). Gegenüber der rein logischen Auffassung konnte<br />
auch in den Grenzen des strikten transzendentalen Idealismus ein reeller<br />
Gehalt für die spekulativen Überlegungen der theologischen Idee für<br />
allgemeine Überlegungen einer allgemeinen Prinzipienlehre m. E. bereits<br />
nachgewiesen werden. Nunmehr aber soll im Umkreis des unbrauchbar<br />
gewordenen transzendentalen Obersatzes die Spekulation ohne Geleit die<br />
göttlichen Attribute bis in die Unvordenklichkeit des ontotheologischen<br />
Ur- und Ungrundes hinein fundieren. Hier kann die Metaphysik der<br />
transzendentalen Ästhetik mittels Spinozas Substanzbegriff die<br />
Formalontologie zwar noch einmal spekulativ übersteigen, verliert dabei<br />
aber den Bezug zur transzendentalen Idee der Freiheit, die im<br />
transzendentalen Ideal immerhin möglich geworden ist, wie den Bezug zu<br />
jedem transzendentalen Inhalt, gleichgültig, ob dieser als von der<br />
transzendentalen Materie oder vom wesentlichen Prädikat abgeleitet<br />
gedacht wird.<br />
8. Die Konzepte des Begriffes und das »Einzige« als Ausdruck<br />
letzter intensionaler Totalität. Das Problem einer eindeutigen<br />
Ordnung höherstufiger Prädikate<br />
a) Die Grenze der transzendentalen Dialektik zwischen Idee und Ideal<br />
in der rationalen Metaphysik<br />
Es geht um die Differenz von Idee und Ideal: Ideal der reinen Vernunft,<br />
transzendentales Ideal gehen auf den Gegenstand. Genetisch betrachtet<br />
muß die der transzendentalen Analytik vorgängige Vernunft einerseits<br />
pragmatische, andererseits ideale Vernunft sein. Daraus ergeben sich in<br />
dieser Frage zwei Argumentationsmöglichkeiten: (1) Die vorkritische<br />
Vernunft besitzt weder in ihren pragmatischen, noch in ihren idealen<br />
Aspekten die Eigenschaft, auf Gegenstände direkt beziehbar zu sein.<br />
Pragmatisch nicht, weil die Gegenständlichkeit der Objekte nicht das<br />
eigentliche Erkenntnisinteresse ausmacht, sondern nur die beschränkte<br />
Verwendbarkeit dieser Objekte; idealistisch nicht, weil die Idealität selbst<br />
abstrakt bleibt und an der Wirklichkeit scheitern muß. Die Beziehbarkeit<br />
von Ideen auf Gegenstände ist demnach ein Artefakt der Dialektik im Ideal<br />
der reinen, bereits kritisierten Vernunft. (2) Die vorkritische Vernunft<br />
bezieht sich sowohl in ihrem pragmatischen wie in ihrem idealen Aspekt<br />
immer schon auf Gegenständliches, wenn auch nicht explizit und zu reiner
— 1253 —<br />
Theorie gebracht. Die Mittelbarkeit dieser Beziehung drückt sich in den<br />
Vernunftideen der reinen Vernunft weiterhin aus, im Ideal der reinen<br />
Vernunft drückt sich hingegen die Bezüglichkeit aufs Gegenständliche<br />
aus.Die jeweiligen präzisierenden Formulierungen zeigen auf, daß diese<br />
Alternativen voneinander abhängig sind und auch aufeinander verweisen.<br />
Die dazugehörige Ideenlehre (idea est conceptus archetypus) wurde weiter<br />
oben bereits dargestellt, und besagt grundsätzlich, daß sich Oberste Ideen<br />
zwar auf Gegenstände beziehen lassen, aber eben auch nur mittelbar über<br />
allgemeinste Merkmale, und ohne das Objekt näher zu bestimmen, zu<br />
konstruieren oder zu produzieren. Es scheint sich also hier um eine<br />
weitere Variation des nämlichen Verhältnisses von Idee und Gegenstand<br />
versus Ideal und Gegenstand; die Frage, ob der explizite Bezug einer Idee<br />
auf einen Gegenstand dialektisch sei, und somit auch der<br />
Gegenstandsbezug des ontologischen Ideals, ist aber immer die gleiche.<br />
Grundsätzlich bedarf es einer nachträglich erst verständlichen Ergänzung,<br />
die eigentlich von Beginn dieser transzendentallogischen Erörterung an in<br />
Geltung gewesen ist. Entsprechend der Auffassung, daß die logischen<br />
Tafeln (§ 9) nicht die allgemeine Logik repräsentieren sollen, sondern die<br />
logischen Regeln entsprechend unserer Urteile zusammenstellt, um einen<br />
Leitfaden zur Deduktion der Kategorien zu gewinnen, ist zu sehen, daß<br />
die zwei zentralen Begriffsdefinitionen der Analytik wie der Dialektik, die<br />
qualitative Einheit des Begriffes vom Objekt (§ 12, als ontologisch-induktiv<br />
depotenziertes transzendentales Ideal) und der Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand (Ideal der reinen Vernunft) nicht selbst die logischen<br />
Definitionen des Begriffs ausmachen können, als daß sie bereits gemäß der<br />
transzendentalsubjektivistischen Verschärfung in Kants Programm, die<br />
mit der Kritik der reinen Vernunft als Propädeutik erfolgt ist, zugerichtet<br />
worden sind. Das eine wird mit der logischen Kontinuität des Prinzips der<br />
durchgängigen Bestimmbarkeit eines Dinges mittels Prädikate als<br />
Merkmale, unabhängig vom Raumbegriff der transzendentalen Ästhetik<br />
und unabhängig von Voraussetzungen der rationalen Physiologie, formal<br />
voraussetzbar, das andere nur als Transformation des wesentlichen<br />
Prädikats aus dem Ideal der reinen Vernunft, logisch gemäß dem<br />
Teilbegriff, der eine ganze Vorstellung des Gegenstandes erlaubt, zu einer<br />
Relation aus der Erfahrung (Erfahrung haben, machen, anstellen) denkbar.<br />
Dabei ist die Anwendung der Kategorie der Allheit auf den Inbegriff aller<br />
Prädikate eines Dinges überhaupt ohne weiters zu einem Satzsystem<br />
entwickelbar, gerade bedenkt man die Unklarheit des Prinzips der
— 1254 —<br />
durchgängigen Bestimmung mittels Prädikate zwischen<br />
Merkmalsprädikate und wesentlichen Prädikaten, während das Ideal der<br />
reinen Vernunft spekulativ zwar zum transzendentalen Ideal als Begriff<br />
vom einzelnen (einzigen) Wesen gesteigert werden kann, damit einzelne<br />
Dinge der transzendentalen Materie aber nur mehr auf dem Umweg der<br />
Existenz eines Substrates des erkennenden transzendentalen Subjekts<br />
anerkannt werden können. Und es gibt eine synthetisch-metaphysische<br />
und transzenzendentale Analogie, die im Rahmen der bloßen Ideenlehre<br />
als formale Implikation ausdrückbar ist, und einerseits zur<br />
Unaufhebbarkeit der res, seien sie cogitans oder extensa, führt,<br />
andererseits in die Unaufheblichkeit eines Dinges im Zusammenhang der<br />
Erfahrung mündet. Transzendentallogisch bleibt dies sowohl mit der<br />
Wesenslogik (d. h. hier bereits von je her der Erfahrung zugewandt) wie<br />
mit der transzendentalen und logifizierbaren Zeitbedingung verbunden<br />
(vgl. zweiten Abschnitt) und wird vernunftgemäß und kritisch betrachtet<br />
zu einer Idee von naturwissenschaftlicher Theorie und deren allgemeinen<br />
Erfahrungsbedingungen. Kant sieht im Zuge der transzendentalen<br />
Analytik des empirischen Verstandesgebrauches also ein, daß, um das<br />
modale Problem (die Behauptung objektiver Realität) nach<br />
Erkenntnisgründen aufzulösen, ein aussagenlogischer Ansatz nötig ist,<br />
was aber keineswegs davon enthebt, ein syntaktisches Kriterium zu<br />
finden.<br />
b) Das logische Konzept des Begriffes innerhalb und außerhalb des<br />
einfachen Satzes mit Subjekt und Prädikat. Das »Einzige« in der<br />
transzendentalpsychologischen Urteilslehre. Verschiedene höherstufige<br />
Prädikate und Gödels Auffassung zu Russells Typenlehre<br />
Das Konzept des Begriffes ist für sich selbst schon nicht eindeutig, sondern<br />
scheint gleichursprünglich in mehrere Direktionen zu entwickeln zu sein:<br />
Erstens ist der Begriff ein satzinternes Konzept, daß erst je verschieden aus<br />
der grammatikalischen Stellung im durchgebildeten Satz, der immer schon<br />
erst die diskursive Entscheidungsfähigkeit als eines der modal<br />
entscheidenden Kriterien besitzt, formale Merkmale erhält. 28 Insofern<br />
28 Leibniz: syntaktische Kriterien, § 195, § 184, 22, 271 f., 22, 274 f., C 325 in: Generales<br />
Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum 1686, , Hrsg. von Franz Schupp, in:<br />
Meiner Phil. Bibl. Bd. 338, Hamburg 1982). John R.. Searle, Sprechakte. Ein<br />
sprachphilosophischer Essay. Übersetzt von R. und R. Wiggershaus, Suhrkamp,<br />
Frankfurt am Main 1971 (Originalausgabe: Speech Acts, Cambridge University Press
— 1255 —<br />
bleibt der Begriff als Konzept innerhalb des Konzeptes eines Satzes der<br />
Struktur S - P.<br />
Zweitens ist der Begriff ein Konzept, daß sowohl vertikal entlang nach<br />
Gattung und Art, wie jeweils horizontal nach Attribute logisch einteilbar<br />
sind. M. a. W. ist dieses Konzept des Begriffes auch im intensionalen<br />
Konzept der Durchbestimmung eines Dinges mittels Prädikaten bereits<br />
eine System von ganzen S - P - Sätzen. Diese Einteilung folgt den<br />
Vorläufern des logischen Prinzips der Negation, den formalisierbaren<br />
Prinzipien der Einteilung und Zuteilung (Zuschreibung) von Merkmalen,<br />
die von Anbeginn der Platonischen Diairesis von inhaltlichen Prinzipien<br />
begleitet waren, welche aber ihrerseits mittelbar mit der Methode des<br />
Erwerbs oder Habhaftwerdung in verschiedensten Abwandlungen je nach<br />
Gegenstand oder praktisch-pragmatisch relevanten Verhältnis zum<br />
Gegenstand in Zusammenhang gestanden sind. Diese Verhältnisse lassen<br />
sich anhand des Satzes der Identität, des Satzes vom Widerspruch und des<br />
Satzes vom ausgeschlossenen Dritten weitgehend formalisieren; jedenfalls<br />
ist zwischen Plato und Aristoteles eine durchgehend extensionale<br />
Interpretation im Sinn mengentheoretischer Grundlegung aufgrund von<br />
Distributionsverhältnisse auf Gegenstände ebenso wenig zu erwarten, wie<br />
eine formalontologische Ausarbeitung eines Dingbegriffes zum<br />
Gegenstand unter transzendentalsubjektivistischen Bedingungen.<br />
Nunmehr hat die Frage nach den inhaltlichen Prinzipien längst eine<br />
platonisch-mathematische und eine naturphilosophisch-ontologische<br />
Dimension bekommen, seit über den Horizont der an sich und für sich<br />
relativen Gleichursprünglichkeit regressiv hinausgehenden Vermutungen<br />
angestellt wurden, ob es sich bei der Vorstellung eines sogenannten<br />
»eigentlich« Ursprünglichen, bloß um willkürliche<br />
Rekonstruktionsversuche im Rahmen einer analytischen Methode handelt,<br />
ohne sicher entscheiden zu können, wann es sich um ein bloßes Artefakt<br />
handelt, oder ob es zumindest zu einer Auslegung der ersten Alternativen<br />
des »Einzigen« kommt, auch wenn eine hinreichend zuverlässige<br />
Entscheidung nicht, oder nicht regelmäßig, zustande kommt. Der oder das<br />
»Einzige« tritt selbst sowenig auf wie die Menschheit in uns, das<br />
transzendentale Ich oder die abstrakte Vorstellung vom unbeteiligten<br />
Dritten, und ist ein reines Vernunftideal, das, obwohl doch deutlich aus<br />
der psychologischen Idee abgeleitet, wegen seiner Unterscheidbarkeit vom<br />
1969), 5. Kap. Prädikation; insbesondere 5.4 Die Termtheorie der Sätze (p. 173 f.), wo<br />
die »syntaktischen Kriterien« von Frege, Strawson und Russell diskutiert werden.
— 1256 —<br />
Seelenbegriff nicht einmal vom Paralogismus bedroht ist, sondern von der<br />
praktischen Vernunft eigens eingeschränkt werden muß. Vgl. in A die<br />
numerische Einheit der selbst empirischen Apperzeption, die mit dem<br />
Gewahrwerden der fortwährend gleichbleibenden Konsequenz (die<br />
»stehende« Vorstellung ohne anschauliche und sonstige Merkmale) aus<br />
der transzendentalsubjektivistisch ursprünglichen und primordialen<br />
numerischen Einheit des empirischen Bewußtseins im Fluß der<br />
Erscheinungen der sogenannten empirischen Apperzeption zum ersten<br />
und einfachen Bewußtseinsakt der transzendentalen Apperzeption im<br />
Sich-Zuschreiben der synthetischen Einheit des »Ich denke« sich<br />
verwandelt. Obgleich der Leib zum materialen Apriori wie schon zu den<br />
Grundlagen einer jeden Orientierung im Raum gehört, gehört zu dieser<br />
Operation bereits die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung gegenüber den<br />
Objekten und gegenüber den anderen handelnden Individuen, und was<br />
hier entscheidend ist, gerade die Unterscheidung des eigenen Selbst von<br />
der einfachen Leiblichkeit. Das ist auch der tiefere<br />
(fundamentalontologische) Grund für die Einzigkeit als erste<br />
Charakteristik einer transzendentalen Argumentation und betrifft<br />
resolutiv in einem schon das Syndrom (die Vorstellungskomplexion) der<br />
»Menscheit in uns« als Gegenstand der philosophischen Anthropologie ein<br />
erstes Mal wesentlich.<br />
Drittens ist der Begriff das Konzept einer Reihe von horizontal<br />
(Konjunktion oder Disjunktion) und vertikal (subordinierend anstatt<br />
subsummierend) orientierbaren Prädikate, die mittelbar nicht unabhängig<br />
von den Schwierigkeiten in der mengentheoretisch und klassenlogisch<br />
fundierten und somit dem extensionalen Formenkreis im eigentlichen<br />
Sinne, schlußendlich auch nicht unabhängig von der zugehörigen<br />
Typentheorie und Beschreibungslehre von Bertrand Russell bleiben<br />
werden. Eine andere Art von Prädikate höherer Ordnung können nach den<br />
hier angestrengten Untersuchungen die Aufstufung von Attributen der<br />
göttlichen Substanz zu deren Modis bei Spinoza sein. Oder es können<br />
quantitative Bestimmungen qualitativer Prädikate transzendentale<br />
Verhältnisprädikate und modallogische Prädikate niedrigerer Ordnung<br />
voraussetzen. Insgesamt betrachtet gibt es überhaupt verschiedene<br />
denkmögliche Arten formaler Aufstufung der Reflexionsschritte, die a<br />
posteriori in der Analyse der Aussage als Formbegriffe prädiziert werden<br />
können, die sich vermutlich nicht alle zu einer einzigen<br />
zusammenhängenden Methode qualifizieren lassen, obwohl abstrakt
— 1257 —<br />
formale Analogien zu systematischen Zusammenhängen<br />
zusammengestellt werden können müssen.<br />
Viertens ist das Konzept vom Begriff schließlich der merkmalsfreie<br />
Abstraktionsbegriff, welcher der Russellschen Beschreibungstheorie mit<br />
der Überstülpung einer Typenlehre höherstufiger Prädikate die bekannte<br />
Antinomie beschert, die allein in der extensionalen Behandlung der Logik<br />
ihre Wurzel hat, wie Kurt Gödel in seinem Aufsatz zu Russells und<br />
Witheheads »Principia Mathematica« mit der Widerlegung oder<br />
Umgehung der Russellschen Antinomie auf intensionalem Wege anhand<br />
verschiedener Beispiele sich selbst enthaltener »Imprädikative« zu<br />
erkennen gibt. 29 Bereits kurz nach der Erscheinung der ersten Auflage (?)<br />
1918 hat Weyl die Sinnhaftigkeit der rein formalen und beliebig<br />
scheinende Aufstufbarkeit für logische Probleme sprachlicher Aussagen<br />
überhaupt bezweifelt. 30 Die Sinnhaftigkeit der Konstruktion einer solchen<br />
höherstufigen Typenlehre in der Principia Mathematica, zumal wenn<br />
gerade in der zweiten Auflage fast ausschließlich von einstufigen<br />
Prädikaten gehandelt wird, bezweifelt auch Gödel. 31 Insofern darf im Zuge<br />
einer Theorie höherstufiger, bloß subordinierender Prädikate von einem<br />
merkmalsfreien Abstraktionsbegriff, der allein aus seiner selbst abstrakten<br />
vertikalen und horizontalen Stellenordnung noch eine Bestimmung<br />
bezieht, wohl die Rede sein. Insofern wird ein gemeinsamer systematischer<br />
Kern von sprachlogischen und mathematischen Systemen (oder eine<br />
gleiche Abstraktionslehre) sichtbbar, obgleich Godel im genannten Aufsatz<br />
davon ausgeht, daß für sprachliche, nicht rein mathematische Ausdrücke<br />
ein unendliches Kalkül nicht notig sei. — An besser geigneter Stelle wird<br />
weiter unten der logische Ursprung der Begriffe und die Formen des<br />
Vergleichs aneinander wie der transzendentale Bezug der Begriffe auf die<br />
numerische Einheit des Bewußtseins als erste Bedingung Kants, von<br />
transzendentaler Apperzeption zu sprechen, behandelt werden. Dies an<br />
Stelle eines fünften Punktes.<br />
29 Russell, Bertram (und A. N. Withehead), Principia Mathematica, Vorwort von Kurt<br />
Gödel und Einleitungen, Übersetzt von Hans Mokre, Suhrkamp 593, Frankfurt a. M.<br />
1986, p. XVI f. zu Imprädikative<br />
30 Hermann Weyl., Über eine neue Grundlagenkrise der Mathematik, Math. Zeitschrift<br />
10 (1921)<br />
31 Gödel, w.o., p XI zu Zermelos Axiomatischer Mengentheorie, Endnote 16: »Die<br />
intensionalen Paradoxien können bewältigt werden, z. B. durch die Theorie der<br />
einfachen Typen oder der verzweigten Hierachie, die keinerlei unerwünschte<br />
Einschränkungen involvieren, wenn sie nut auf Konzepte angewandt werden und<br />
nicht auf Mengen.«
— 1258 —<br />
c) Der transzendentale Schein eines sprachmolekularen Existenzsatzes<br />
und das Problem der Rückführbarkeit höherstufiger Prädikate.<br />
Die Erforschung der Strukturen der logischen, modallogischen und<br />
transzendentallogischen Untersuchungen vor jeder Aussicht auf ein<br />
transzendentales Prinzip, daß zu einem synthetischen Urteil a priori<br />
befähigen könnte, besitzt ein vorläufiges Ergebnis:<br />
1. Es gibt für Formalwissenschaften kein universielles Prinzip für<br />
synthetische Urteile a priori analog der Schlußfolgerung aus reiner<br />
Anschauung nach dem Vorbild der Geometrie.<br />
2. Die Elemente einer transzendentalen logischen Untersuchung sind<br />
selbst nicht transzendental oder rein logisch.<br />
3. Es gibt mehrere Direktionen, nach welchen höherstufige Prädikate<br />
entwickelt werden können.<br />
4. Es müssen verschiedene Arten von Direktionen bei der Entwicklung<br />
einer umfassenden Theorie höherstufiger Prädikate beteiligt sein.<br />
5. Es gibt mehr als einen Horizont von Evidenzkriterien für die Geltung<br />
von Existenzialsätzen, völlig unabhängig von der Frage nach einer<br />
Systematik von Regionalontologien.<br />
6. Alle Horizonte von Evidenzkriterien sind transzendental<br />
resubjektivierbar oder mit der transzendentalsubjektivistischen Position<br />
widerspruchsfrei in Zusammenhang zu bringen.<br />
Im Grunde setzt sich hier noch die Unklarheit zwischen<br />
Merkmalsprädikaten fort, die aus der transzendentalen Materie stammen,<br />
und wesentlichen Prädikaten, die Teilbegriffe, die den ganzen Gegenstand<br />
vorstellen lassen, da die transzendentale Analyse den Horizont der<br />
Betrachtung des gegebenen Gegenstandes nicht nur auf den Regressus im<br />
Erfahrungmachen erweitert, vielmehr auch transzendentale Reflexion und<br />
die transzendentallogischen Untersuchungen der Wahrheitsbedingungen<br />
mit dem Fortschreiten der Spekulation zunehmend in die Stellung des in<br />
der Kritik zu betrachtenden Materials einrückt. Das Hauptargument für<br />
die logisch starke, modallogisch schwache Variante der Bestimmung des<br />
Umfangs des omnitudo realitatis, die gemäß § 11 der Deduktion das<br />
Wahre (Existierende) und das Falsche (Nicht-Existierende) beinhaltet, liegt<br />
erstens in der damit eindeutigen Positionierung des Existenzialsatzes, was<br />
allein mit der aristotelischen Fassung des Realmöglichen ein Problem<br />
geblieben ist, und ist zweitens der Bewältigung des Anspruches, den<br />
abstrakt auch die Typentheorie von Russell stellt: nämlich daß alle höheren<br />
Typen von Prädikate sich umstandslos auf Existenzialsätze beziehen
— 1259 —<br />
lassen. Es ist aber unbestreitbar eine Inhomogeneität unter den bislang<br />
bekannt gewordenen Arten von höherstufigen Prädikaten (modale<br />
Prädikate, transzendentale Verhältnisprädikate) zu erkennen, die es<br />
zweifelhaft erscheinen läßt, daß ein abstraktiv vorgehender Entwurf wie<br />
der von Russell alle, oder auch nur alle relevanten Problemstellungen in<br />
diesem Zusammenhang einheitlich aufzunehmen imstande sein kann. Vgl.<br />
Poppers Aufspaltung von Subsumtionsverhältnissen und<br />
Falsifikationsverhältnissen zwischen Sätzen32 anhand eines Beispiels des<br />
vorlogischen Syllogismus aus der analytica a posteriori, in welchem an<br />
Stelle einer logischen Beziehung die grammatikalische (satzinterne)<br />
Beziehung des Relativsatzes tritt (E. Kapp, Der Ursprung der Logik bei den<br />
Griechen, Göttingen 1965, vgl. auch Zeidler K. W. Zeidler, Grundriß der<br />
transzendentalen Logik, Junghans, Cuxhaven & Dartford 2<br />
1997). Das hat<br />
zur Folge, daß es sich nicht eigentlich um einen Syllogismus handelt,<br />
sondern um eine rethorische Form, der erst gemeinsam mit ausdrücklich<br />
semantischen Elementen (empirischen Begriffen) zu einem Schluß<br />
zusammengestellt werden kann. Das nennt Kant je nach dem<br />
unvollständige Schlüsse oder eine besondere Logik im Gegensatz zur<br />
allgemeinen (rein formalen) Logik, wenn nicht empirische und<br />
transzendentale Begriffe in der Untersuchung vermengt worden sind, ist<br />
aber nicht geeignet, Grundlage einer transzendentalen Grammatik zu sein.<br />
Die allgemeine Logik ist zunächst ein Regelwerk richtigen logischen<br />
Schließens ohne jede Wahrheit außer die des principium contradictionis,<br />
erst die modallogische Analyse ist im Rahmen des Assertionsproblems mit<br />
Wahrheit und Existenzprädikat befaßt. Die transzendentale Logik wird<br />
deshalb angestrengt, um das grundlegende modallogische Problem zu<br />
lösen. Die transzendentallogische Analyse gibt nicht selbst die Antwort auf<br />
die Frage, wie denn die Semantik oder der empirische Begriff in die<br />
Sprache oder in den wissenschaftlichen Formalismus hineinkommt (das ist<br />
für Kant ein Problem der empirischen Deduktion der Begriffe, »welche die<br />
Art anzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und Reflexion über dieselbe<br />
erworben worden, und daher nicht die Rechtmäßigkeit, sondern daß<br />
Faktum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen«, B 117/A 85); sie gibt<br />
vielmehr die Antwort auf die Frage, wie die Relation beschaffen sein muß,<br />
die qualitative Bestimmungen (oder deren, in quantitative Begriffe<br />
konkretisierbaren Verhältnisse) modal als »objektive Realität« zu<br />
32 Karl R. Popper, Logik der Forschung,, J. C. B. Mohr, Tübingen 5 1973., VI. Kapitel
— 1260 —<br />
bezeichnen erlaubt, und auch darauf, wo die Grenzen des sinnvollen<br />
Aussagens im Rahmen der reinen spekulativen Vernunft liegen. So haben<br />
sich in dieser Arbeit die modallogischen Reflexionen Kants bei bestimmten<br />
Gelegenheiten auch als Umgestaltungen aufgrund der Überlegungen im<br />
Duisburger Nachlaß, die zur Notwendigkeit eines transzendentalen<br />
Schematismus erst geführt haben, und nicht bloß als Ableitungen daraus<br />
herausgestellt. Insofern gehören modallogische Prädikate wie das<br />
Existenzprädikat zu einer der transzendentallogischen Arten der<br />
höherstufigen Prädikate.<br />
Kant hat gegenüber Leibniz transzendentalphilosophisch zwei Vorzüge:<br />
erstens daß er die relevanten Fragen des nachcartesianischen<br />
transzendentalen Idealismus in der Kritik der reinen Vernunft schärfer<br />
gesehen hat und zweitens daß er konsequenterweise die englische<br />
Tradition des Empirismus im kritischen Abschnitt seiner<br />
Transzendentalphilosophie eingebaut hat, nachdem er gesehen hat (so die<br />
hier vertretene These), daß ein primär sprachphilosophischer Ansatz, so<br />
wie etwa im Duisburger Nachlaß zwischen aptitudo, Exponent und<br />
Prinzip vertreten, vergeblich versucht, dem Problem des »Ist-Sagens« seit<br />
Aristoteles, und auf welche Arten sinnvoll »es gibt« behauptet werden<br />
kann, endgültig beizukommen. — Der gesuchte Grund der Beendigung<br />
der endlosen Analyse kann bei Kant also nicht ein formal-immanenter<br />
Grund sein, gleichgültig, was nun »formal« jeweils bedeuten könnte. Das<br />
heißt aber auch, daß es eben von uns aus gesehen keinen universiellen und<br />
identen Grund zum Abruch gibt, gleichgültig, was die Untersuchung der<br />
spekulativen Vernunft in der theologischen Idee auch ergibt.<br />
Brentanos grammatikalische Analysen besitzen hingegen, weil innerhalb<br />
des des einfachen Satzhorizontes verbleibend, entgegen Brentanos eigener<br />
Darstellung 33 einen Grund des Abbruches der aufgestuften Metareflexion:<br />
Das ursprüngliche A ist wegen der Verdopplung der Bedeutung von »es<br />
gibt« durch die Unterscheidung »Es gibt eine Vorstellung von A« und »Es<br />
gibt A« nicht weiter in einer endlosen Reihe von Sätzen »Es gibt eine<br />
Vorstellung der Vorstellung von A« etc. zu denken; bzw. wäre diese Reihe<br />
gerade keine Metareflexion logischer Evidenzkriterien. So ist im obersten<br />
Satz einer Reihe der Reflexionen über die logischen Bedingungen ein<br />
bestimmtes A nicht mehr enthalten; vielmehr muß eine oberste Formel nur<br />
33 Im Anhang zu Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, 2. Bd.:<br />
Von der Klassifikation der psychischen Phänomene, Hrsg. Oskar Kraus,<br />
Hamburg 1959 (Nachdruck von 1925), Vom ens rationis
— 1261 —<br />
mehr behaupten können, daß es wahr sei, wahre Sätze als wahre Sätze und<br />
falsche Sätze als falsch zu behaupten. Nur insofern ist es wahr, daß die<br />
oberste oder grundlegende logische Evidenz im Rahmen des<br />
Metakonzeptes der Gleichursprünglichkeit mit der subjektiven (immer<br />
empirischen) Evidenz, die nach Brentano kriterienlos sein soll, in<br />
abstrakter Unbestimmtheit doch noch, wenn auch mit formal nicht mehr<br />
angebbbaren Gründen, übereinstimmbar sein soll. — Um es nochmals<br />
auch mit Brentano festzuhalten: Der ursprüngliche Existenzialsatz ist das<br />
cartesianische cogito ergo sum; der nunmehr gesuchte Existentialsatz, der<br />
uns aus dem Gefängnis des strikten transzendentalen Idealismus befreien<br />
soll, wird von Kant in den synthetischen Grundsätzen in den<br />
Satzgegenstand verlegt. Von da an ist der transzendentalanalytische<br />
Zweifel prinzipiell (wenn es um Prinzipien geht) angebracht. Man kann<br />
darin auch den Übergang vom Existenzialsatz Brentanos, der trotz Teleoise<br />
im urteilenden Subjekt liegt, zum Existenzialsatz von Russell ersehen<br />
(Propositionen sagen Tatsachen aus). Die noch zu lösende Schwierigkeit<br />
liegt zuerst darin, die verschiedenen Stränge der methodischen<br />
Überlegung der transzendentalen Logik einmal systematisch darzustellen,<br />
und dann in weiterer Folge dies sowohl mit den wissenschaftshistorisch<br />
sich ergebenden Schwierigkeiten zwischen Plato und Aristoteles (oder<br />
überhaupt zwischen den frühen Stoikern und Megarikern einerseits und<br />
der Akademie andererseits bis hinauf zu Epikur), wie mit dem<br />
grundlegenden Problem zwischen Russell und Gödel (extensionaler versus<br />
intensionaler Ansatz der Logik) vor dem Hintergrund der auch von<br />
Russell in seiner Beschreibungstheorie behaupteten grundsätzlichen<br />
Rückführbarkeit aller relevanten Prädikate auf einen ausgezeichneten<br />
Existenzialsatz, kritisch aufeinanderzubeziehen.<br />
d) Die anzeigende Funktion einer transzendentalen Grammatik<br />
Dabei ist auf zweierlei zu achten: Erstens, daß die Ansätze<br />
grammatikalischer Kategorienlehren bei Aristoteles oder Brentano zwar<br />
ebenfalls wie bei Plato auf die Möglichkeit eines Existenzialsatzes beruhen,<br />
aber dazu verschiedene Voraussetzungen machen. Brentano sagt dazu im<br />
Rahmen seiner Kategorielehren: »Plato hat alle Attribute eines Dinges<br />
derart gedacht, daß ihr Unterliegendes bei der Reihe von spezielleren zur<br />
allgemeineren Aussageweise für jedes Attribut auf das selbe Seiende führt.<br />
Aristoteles hat das bestritten (gesunder Körper, gesunde Speise, gesundes<br />
Klima) und hält deshalb eine Kategorienlehre für notwendig. Ähnlich wie
— 1262 —<br />
im Beispiel der Verwendungsweisen von »gesund« sei nun die Redeweise<br />
von eigentlich Seienden (Wesen oder Substanz) und uneigentlich Seienden<br />
(Akzidenz) zu unterscheiden.« 34 Brentano übersieht in dieser Begründung<br />
vermutlich, daß es verschiedene Weisen des uneigentlichen Prädizierens<br />
gibt, die nur in einseitiger Abstraktion formal instantialisierbar sind. Es<br />
wird damit aber deutlich, daß es verschiedene Weisen der Beziehbarkeit<br />
von Prädikate auf einen Existenzialsatz gibt, wobei die uneigentliche<br />
Verwendung von Prädikaten (oder Attributen) als höherstufiges<br />
semantisches Prädikat bezeichnet werden kann, das aber nicht aus der<br />
transzendentallogischen oder modallogischen Analyse entstammt. —<br />
Zweitens ist entscheidend, daß die transzendentale Analytik Kantens zwar<br />
auf Kategorien führt, die die nämliche Zielsetzung besitzt wie andere<br />
Ansätze, und zwar einen Existenzialsatz zu bestimmen, worauf alle<br />
Prädikate eindeutig bezogen werden können, aber nicht selbst auf einer<br />
grammatikalischen Analyse beruht wie bei Aristoteles, sondern auf eine<br />
Prinzipienlehre (den reinen Verstandesbegriffen) und den<br />
transzendentalen Zeitbedingungen der sogenannten dynamischen<br />
Kategorien, welche zusammen in den synthetischen Grundsätzen<br />
ausgedrückt werden, und wovon die Kategorien also nur Titel sein<br />
können. In der entscheidenden Kategorie der Kausalität führt die<br />
transzendentale Analyse allerdings auch bei Kant zu einer<br />
grammatikalischen Analyse: Nach der garmmatikalischen Definition der<br />
reinen Kategorie der Substanz (das der Begriff der Substanz nicht als<br />
Prädikat gebraucht werden könnte) und des ersten, wesenslogischen<br />
Kriteriums des Ideals der reinen Vernunft (Begriff vom einzelnen<br />
Gegenstand), nicht von anderen Prädikaten abgeleitet zu sein, ist es im<br />
synthetischen Grundsatz der Kausalität die aussagenlogische Form,<br />
welche die entscheidende und eigentlich transzendentale Bedingung der<br />
Möglichkeit der Erfahrung, mithin das transzendentale Prinzip der<br />
Kausalität, grammatikalisch charakterisiert. Kants Bedingungen, einen<br />
Existenzialsatz zu finden, besitzen einerseits außerlogische Gründe, die<br />
nicht in einer extern vorausgesetzten Naturontologie zu fundieren sind,<br />
sondern aus der intensional verfahrenden transzendentalen Analyse der<br />
subjektiven Erfahrungsbedingungen entstammen, andererseits sind diese<br />
Bedingungen grammatikalisch charakterisierbar, und zwar als Übergang<br />
zur Ausagenlogik, insofern nicht allein im reinen Verstandesbegriff eine<br />
34 Brentano, Kategorienlehre, Herausgegeben und eingeleitet von Alfred Kastil, Felix<br />
Meiner Verlag, Hamburg 1 1933, p. 102
— 1263 —<br />
»logische« Zeitbedingung aus der Semantik der Begriffe ausgedrückt wird,<br />
sondern die ganze Aussage sich insbesondere im Grundsatz der Kausalität<br />
bereits auf ein Geschehen bezieht, nicht nur auf die Verwechslung in der<br />
Vorstellung einer beharrenden Substanz und deren transzendentale<br />
Attributionsproblematik mit der bleibenden Erscheinung im Wechsel der<br />
Erscheinungen. Hierin ist ein Durchblick auf Aristoteles insofern gestattet,<br />
als noch Searle in der Schrift zur Sprechakttheorie die Universalien als aus<br />
Verben abgeleitet vorstellt; allerdings ist mit dem transzendentalen Prinzip<br />
der Kausalität außer Streit zu stellen, daß Kategorien im Sinne<br />
aristotelischer Traditionen als Universalien fungieren.<br />
Im Zuge der Überlegungen zu einer transzendentalen Grammatik ist der<br />
entscheidende Unterschied im Ansatz grammatikalischer Kategorienlehren<br />
und dem transzendentalanalytischem Ansatz Kantens in<br />
grammatikalischer Hinsicht der, daß Kant jeden Satz als Existenzialsatz<br />
qualifiziert sieht, der dem transzendentalen Prinzip der Kausalität<br />
gehorcht, worin die aussagenlogische Form als grammatikalische<br />
Charakteristik mit beschlossen ist, grammatikalische Kategorienlehren<br />
hingegen ein syntaktisches Kriterium für S - P - Sätze suchen. Dies gilt<br />
bemerkenswerterweise unvermindert auch für die analytische<br />
Sprachphilosophie, die zwar keine Kategorien kennt, aber Universalien zur<br />
Problemaufstellung gehören. Mit dieser formalen Unterscheidung sind<br />
auch verschiedene modallogische Konsequenzen verbunden: Nach Leibniz<br />
führt eine reine Begriffslogik im Falle, ein Begriff gilt als wahr, nur zur<br />
modalen Bestimmung der Möglichkeit, also nur möglicherweise auch<br />
Existenz behauptend; während in einer reinen Aussagenlogik, gilt ein Satz<br />
als wahr, modal zugleich auch Existenz behauptet wird. 35 Davon spricht<br />
letztendlich auch Russell, obzwar Logik und Ontologie nicht so sauber rein<br />
modallogisch verbindend wie Leibniz, wenn er mit den Propositionen eine<br />
»Ontologie der Tatsachen« behauptet. Bevor das daraus sich ergebende<br />
Ziel, die beiden Hauptprobleme der Logik (in Sprachanalytik und<br />
mathematischer Logik), die letztlich beide jeweils aus ihrem Verhältnis zur<br />
Grammatik des richtigen Urteilens entspringen, im Rahmen der<br />
transzendentalen Logik und als Teil der transzendentalen Logik,<br />
aufeinander bezogen zur Darstellung zu bringen, verfolgt werden kann,<br />
muß zuvor ein grundsätzlicher Einwand gegen die unendliche Aufstufung<br />
der Prädikate der logischen Überlegung überlegt werden, der den<br />
35 Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum 1686, , Hrsg. von Franz<br />
Schupp, in: Meiner Phil. Bibl. Bd. 338, Hamburg 1982).
— 1264 —<br />
Entschluß Leibnizens 1686, sowohl für absolute wie für kontingente<br />
Wahrheiten gleichermaßen eine unendliche Analyse anzusetzen, in einem<br />
neuen Licht erscheinen lassen wird.<br />
e) Totalität und Negation: Die absolute Notwendigkeit,<br />
ihre Einschränkung und ihre Ursprünglichkeit.<br />
Der Obersatz im Gottesbeweis von Anselm von Canterbury<br />
Auch in der Schrift zum Beweisgrund Gottes beginnt Kant die Erörterung<br />
des ens realissimum auf einer formalontologischen Ebene, welche von<br />
jedem transzendentalen Inhalt, gleichgültig, ob von transzendentaler<br />
Materie oder von einem wesentlichen Prädikat stammend, abstrahiert,<br />
und methodisch als modale Logik bezeichnet werden kann, obgleich gleich<br />
zu Beginn der Geltungsbereich der transzendentalen Negation<br />
eingeschränkt wird. Wenn etwas Aufhebliches existiert, dann muß ein<br />
Grund für das Aufhebliche existieren, der selbst nicht aufheblich ist:<br />
»Alle Möglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus, worin und wodurch alles<br />
Denkliche gegeben ist. Demnach ist eine gewisse Wirklichkeit, deren<br />
Aufhebung selbst alle inneren Möglichkeiten überhaupt aufheben würde.<br />
Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle Möglichkeit<br />
vertilgt, ist schlechterdings notwendig. Demnach existiert etwas absolut<br />
notwendiger Weise.« (A 29)<br />
Das gilt aber nur, nachdem schon das Faktum von Existenz<br />
unbezweifelbar ist, weil allein durch die Möglichkeit, dergleichen zu<br />
denken, irgendeine Existenz bereits vorausgesetzt ist. Dabei wird leicht<br />
übersehen, daß diese Möglichkeit nicht ursprünglich als Seinsgrund<br />
sondern nur transzendental als Erkenntnisgrund gedacht werden kann,<br />
und nur zweierlei Bedingungen einschließt: Einerseits ein gegebenes<br />
Faktum, andererseits das Faktum des Bewußtseins. Darin liegt die Affinität<br />
zwischen beliebigen Dingen und intelligibler Existenz allerdings bereits<br />
ursprünglich-synthetisch beschlossen. Nicht folgt daraus von selbst die<br />
Notwendigkeit Gottes oder die absolute Notwendigkeit. Kant fährt aber<br />
mit einer formalontologischen Spekulation fort, die auch aus dem ersten<br />
Prinzip der Durchbestimmung eines Dinges mittels Prädikate bekannt ist,<br />
schließt aber nicht aus der Totalität der prädikativen Durchbestimmtheit<br />
desselben auf das Allerrealste als Inbegriff aller Prädikate, auch nicht<br />
gleich auf eine erste Ursache einer Reihe sich regressiv bedingenden<br />
Ursachen, sondern auf das Unbedingte der Reihe des Bedingten:
— 1265 —<br />
»Weil ein solches Wesen also das realste unter allen möglichen ist, indem<br />
so gar alle anderen nur durch dasselbe möglich sein, so ist dieses nicht so<br />
zu verstehen, daß alle mögliche Realität zu seinen Bestimmungen gehöre.<br />
Dieses ist eine Vermengung der Begriffe, die bis dahin ungemein<br />
geherrscht hat.« (Beweisgrund Gottes, A 34 f.)<br />
»Es könnte auch beim ersten Anblick scheinen zu folgen: daß, weil das<br />
notwendige Wesen den letzten Realgrund aller anderen Möglichkeit<br />
enthält, in im auch der Grund der Mängel und Verneinungen derer Wesen<br />
der Dinge liegen müsse, welches, wenn es zugelassen würde, auch den<br />
Schluß veranlassen dürfte, daß es selbst Negationen unter seinen<br />
Prädikaten haben müsse, und nimmermehr nichts als Realität. Allein man<br />
richte nur seine Augen auf den einmal festgesetzten Begriff desselben. In<br />
seinem Dasein ist seine eigene Möglichkeit ursprünglich gegeben.<br />
Dadurch, daß es nun andere Möglichkeiten sein, wovon es den Realgrund<br />
enthält, folgt nach dem Satze vom Widerspruchs, daß es nicht die<br />
Möglichkeit des realsten Wesens selber, und daher solche Möglichkeiten,<br />
welche Verneinungen und Mängel enthalten, sein müssen. — Demnach<br />
beruht die Möglichkeit aller andern Dinge, in Ansehung dessen, was in<br />
ihnen real ist, auf dem notwendigen Wesen, als einem Realgrunde, die<br />
Mängel aber darauf, weil es andere Dinge und nicht das Urwesen selber<br />
sind, als einem logischen Grunde.« (Ebd., A 37 f.)<br />
Der logische Grund ist eben nicht der nämliche Grund im Satz, daß das<br />
unbedingt Notwendige nicht wegen eines Grundes, sondern wegen der<br />
Unmöglichkeit des Gegenteiles wahr ist, vielmehr handelt es sich hier um<br />
eine limitierte transzendentale Negation, die einen transzendentalen<br />
Mangel der Positivität des Dinges gegenüber dem ens realissimum<br />
ausdrücken soll, ohne deshalb das Ding in Gedanken oder gar wirklich<br />
aufheben zu wollen; die Aufheblichkeit bleibt als gedankliche Möglichkeit<br />
nur in der Funktion einer Charakteristik des Daseins der Dinge in der<br />
Welt, die zugleich von der Seinsweise des ens realissimum unterscheidet.<br />
Das, was in der Nova Dilucidatio in der Position des un-bedingt<br />
Notwendigen gestanden ist (die Unmöglichkeit des Gegenteils), wird im<br />
Beweisgrund Gottes zum Argument der ersten relativen Bestimmungen<br />
der Dinge, wovon unterschieden, zwar modal aus der nämlichen Position<br />
wie die unbedingte Notwendigkeit in der Nova Dilucidatio, nunmehr aber<br />
die absolute Notwendigkeit den einzigen Realgrund ausmacht (ens<br />
realissimum als ens entium), ohne damit den weiteren Bestimmungen der<br />
Dinge in ihrer Andersartigkeit zum Sein Gottes aus der Informiertheit des
— 1266 —<br />
ens realissimum oder zumindest als ens originarium weiters ontologisch<br />
rechtfertigen zu können. Man könnte über eine eigene Seinsweise Gottes,<br />
die von der Existenzweise der Dinge der Welt verschieden ist, vermuten,<br />
sie charakterisiere nichts als reine Intelligibilität, doch ist eben die Frage<br />
der Trennbarkeit und eigenständigen Seinsweise beider Seinsweisen<br />
umstritten und mit guten Gründen zu bezweifeln, daß die gedanklich<br />
spekulative Verfolgung der Trennbarkeit der Seinsweisen unsere<br />
Erkenntnisse zu vermehren imstande ist. Ganz anders als in der<br />
Behandlung der transzendentalen Negation im Zuge der Erörterung des<br />
transzendentalen Ideals, oder im besagten Prinzip in der Nova dilucidatio,<br />
ist hier das Gegenteil nicht unmöglich, was nicht nur Unbestimmbarkeit,<br />
vielmehr die völlige Indifferenz der Dinge untereinander zur Folge hätte,<br />
sondern es wird den Dingen der Welt gegenüber der Seinsweise des ens<br />
realissimum, das selbst als nicht alle Realmöglichkeit umfassend aus der<br />
modalen Bestimmung des empirischen Wirklichkeitsbegriff (letztlich seit<br />
Aristoteles) erst herausgehoben wurde, im Fortgang der methodischen<br />
Spekulation ihre Seinsweise durch Negation als Mangel bestimmt. Die<br />
Methode der Bestimmbarkeit der Dinge der Welt steht damit noch aus;<br />
und vor allem anderen: Der Seinsbegriff wird zunächst von der<br />
Wirklichkeit der Welt der Dinge entnommen; nunmehr wird durch eine<br />
vorgängige Herausdrehung des Existenzbegriffes aus dem Seinsbegriff der<br />
Seinsbegriff als das Ursprünglichere gesetzt, und die Seinsweise der Dinge<br />
als Existierendes als abhängig von von einem erst als ursprünglich<br />
gedachten Sein vorgestellt. Daß die Seinsweise der Dinge aber als Mangel<br />
gegenüber dem als ursprünglich gesetzten Sein aufgefaßt wird, ändert<br />
nichts an dem Problem, daß die Quelle des transzendentalen Inhalts von<br />
hier aus unbekannt bleibt. Diese Verschiebung des Seins in den nur<br />
gedachten Ursprung und die Verschiebung der qualitativen<br />
Bestimmbarkeit in »andere« Dinge führt nicht einmal zur deutlichen<br />
Unterscheidung von Merkmalsprädikaten (Allheit) und wesentlichen<br />
Prädikaten (Allgemeinheit). Derart hat man mit dieser Herausdrehung des<br />
als ursprünglich vermuteten ontotheologischen Grundes aus der absoluten<br />
Position in die Ontologie der Welt der Dinge zum logischen Grund von<br />
Notwendigeit aus der Unmöglichkeit des Gegenteils wieder ein Manöver<br />
der Verschließung der Möglichkeit der Einsicht in die Quelle des Inhalts<br />
vor sich.<br />
Ich verstehe diesen »logischen Grund« (andere Dinge als das in Existenz<br />
versetzende Urwesen — exisitificans) als Hinweis auf den
— 1267 —<br />
formalontologischen Aspekt der Spekulation um das erste Prinzip der<br />
vollständigen Durchbestimmung eines Dinges. Die Schwierigkeiten der<br />
Zuschreibung der Totalität der Sphäre aller möglichen Prädikate auf ein<br />
vom spekulativen Denken nur ausgedachtes, somit hypostasiertes Ding,<br />
die mit der Gleichsetzung des nur gedachten Dinges mit dem ens<br />
realissimum entstehen, fallen in der formalontologischen Perspektive<br />
wieder weg, weil konsequent die größtmögliche Abstraktionsstufe gesucht<br />
wird. Die formalontologische Reflexion ist gerade dadurch charakterisiert,<br />
keinen transzendentalen Inhalt im Sinne als von transzendentaler Materie<br />
hergenommen zu besitzen; ihr eigener Inhalt ist rein modallogisch die<br />
Unterscheidung in notwendig und möglich bzw. von unmöglich und<br />
möglich. In der rein formalen Steigerung der Totalität durch Abstraktion<br />
im Ideal fallen Existenz und Möglichkeit im unbedingt notwendigen<br />
Wesen zusammen, wie auch Richard Heinrich bereits festgestellt hat:<br />
»Man muß [...] den Inbegriff der Realität bilden, die durch das formale<br />
Prinzip aller Möglichkeit gedacht wird (das ist jener Schritt, mit dem fixiert<br />
wird, wovon das Gegenteil undenkbar ist). In dem so bezeichneten Wesen<br />
würde durch Aufhebung seiner Realität ein innerer Widerspruch<br />
entstehen. Aber seine Realität kann nicht aufgehoben werden, weil sie<br />
ganz und gar in Übereinstimmung mit dem formalen Prinzip aller<br />
Möglichkeit steht. Sie ist der Inbegriff aller mit diesem Prinzip<br />
übereinstimmenden Realität. Daher existiert dieses Wesen notwendig.«<br />
(R.Heinrich, p. 181)<br />
Allerdings ist über ein Wesen, in welchem Existenz und Möglichkeit<br />
zusammenfallen, in der formalen Betrachtung der reinen modallogischen<br />
Verhältnisse nicht entschieden, ob es nun das notwendige Wesen der<br />
Ontologie der Welt der Dinge ist, oder das einzige Wesen absoluter<br />
Notwendigkeit, demgegenüber es das Wesen der Ontologie der Welt der<br />
Dinge es ist, transzendentaler Mangel zu sein.<br />
Thomas ist in dieser Frage eindeutig: die induktive Vorgehensweise des<br />
ontologischen Gottesbeweises geht von der Wirklichkeit aus, die wir aus<br />
der Welt der Dinge kennen. Zwar kann gesagt werden, dieser<br />
Wirklichkeitsbegriff sei nicht selbst die Ontologie der Welt der Dinge<br />
sondern transzendentalanalytisch zuerst und zunächst subjektive Realität,<br />
doch steht unzweifelhaft eine eingrenzbares Verständnis von<br />
»Wirklichkeit« wegen der das Bewußtsein orientierenden primären<br />
Intentionalität zur Debatte, das insofern über methodische Grenzen<br />
hinweg eine vergleichbare Direktion besitzt wie der ontologische
— 1268 —<br />
Realismus von Thomas. Ähnliches gilt für den ersten Blick auch für<br />
Anselm. Anselms Gottesbeweis besitzt formal Ähnlichkeit mit dem<br />
syllogistischen Aufbau der empirischen Postulate. Allein der<br />
Einschränkungsgrund wird entscheidend anders formuliert: Assertion und<br />
Wirklichkeit führt selbst nicht zu einem Beweis des Dasein Gottes. Der<br />
transzendentale Obersatz im Kapitel zum transzendentalen Ideal<br />
(prototypon transcendentale) besitzt die nämliche Ähnlichkeit, als<br />
disjunktives Urteil formal dargestellt werden zu können, abermals wird<br />
der Einschränkungsgrund anders formuliert: Diesmal nicht als Assertion,<br />
sondern als versammeltes Gegenteil dessen, was aus dem All der Realität<br />
herausgeschnitten werden soll, um die wahrhaft metaphysische Ableitung<br />
des jeweils einzelnen Dinges (oder auch nur als Essenz einer Gattung)<br />
herausspringen zu lassen. Anselm selbst reicht im Untersatz die<br />
Behauptung von Wirklichkeit aus, um zumindest die für sich selbst<br />
unabhängig von der Schöpfung oder bloß von der Welt der existierenden<br />
Dinge unabhängig seiende reine Intelligibilität (oder doch nur die rein<br />
intellektuale Vorstellung von Gott), also das erste Glied des Obersatzes<br />
von Anselm, auszuschließen. Zweifellos steht das in Widerstreit mit der<br />
Vorstellung, die Seinsweise des ens realissimum, zumindest als ens entium<br />
betrachtet, würde die Dinge als erste Ursache auch zuerst in Existenz<br />
versetzen, denn nunmehr wird bereits im zweiten Glied des Obersatzes<br />
eine Gegenabhängigkeit zwischen den beiden spekulativ als verschieden<br />
und unterschieden, allerdings nicht als trennbar erörterten Seinsweisen<br />
des ens realissimum in eminenter Bedeutung und der Seinsweise der<br />
Dinge der Welt insinuiert.<br />
Daß nun im Untersatz, wo die Existenz Gottes bewiesen werden soll,<br />
einfach die reine Intelligibilität gegenüber der reinen Intellektualität schon<br />
als Wirklichkeit gelten könnte, verhindert das zweite zusammengesetze<br />
Glied des disjunktiven Obersatzes (Vernunft und Wirklichkeit), dessen<br />
Wahrheit von Anselm mit dem bekannten (von Kant schließlich zweiseitig<br />
widerlegten) Argument behauptet wird, daß eine Vorstellung, die alle<br />
Bestimmungen umfasse, nur dann größer nicht mehr sein könne, wenn<br />
auch Existenz unaufheblich behauptet werden kann. Dieser einzige und<br />
einheitliche Wirklichkeitsbegriff droht eigentlich die Unterscheidung in<br />
eine Seinsweise Gottes und in eine Seinsweise der Welt der Dinge durch<br />
eine schleichende Okkupation des Wirklichkeitsbegriffes im Sinne der<br />
Seinsweise der Dinge der Welt zu verhindern, was schließlich zur Folge<br />
hat, daß die Vorstellung, das ens realissimum fungiere gegenüber den
— 1269 —<br />
Dingen der Welt als ens entium, wiederum in Zweifel gezogen werden<br />
kann, und man zur Auffassung gelangen könnte, das diese Tendenzen<br />
wiederum versuchsweise den Schluß nahelegen ließen, es sollte das ens<br />
realissimum dann vielleicht doch besser als Teilbegriff des omnitudo<br />
realitatis, mit Leibniz als Entwurf der Ganzheit des series rerum, mit Kant<br />
in den Auflösungen der Antinomien aber als regulative Idee gedacht<br />
werden. Die Geschicklichkeit Anselms von Canterbury besteht nun darin,<br />
die behauptete allergrößte Totalität, die für Anselm mit der bloßen<br />
Behauptung von Wirklichkeit im Sinne der Seinsweise der Dinge der Welt<br />
zuerst schon erreicht zu sein scheint, mit der modalen Frage nach<br />
absoluter Notwendigkeit zu verbinden, indem er »Existenz«, schließlich<br />
wieder in einem unbestimmten, aber abstrakt gesichert scheinenden<br />
Zusammenhang mit der für sich selbst offenbar immer noch reinen<br />
Intelligibilität verbringt. Für diesen Zusammenhang scheint sich aber kein<br />
gemeinsamer mittlerer Existenzbegriff ableiten zu lassen, wenn einerseits<br />
die Charakterisierung der Wirklichkeit der Seinsweise der Dinge der Welt<br />
Ausgangspunkt der Untersuchung ist, andererseits als Zielpunkt eine<br />
Seinsweise hypostasiert wird, die eben durch ihre Unaufheblichkeit<br />
zugleich in Gegensatz zur Aufheblichkeit der Seinsweise der Dinge der<br />
Welt gerät. Die entscheidende Frage ist nur ins zweite Glied der logisch<br />
eben nicht vollständig formulierten Disjunktion verschoben worden. —<br />
Für hier ist noch herauszuheben, daß die eben genannten drei Syllogismen<br />
ihre einschränkende Bedingung im Untersatz verschieden formulieren.<br />
Inwiefern kann dann das absolut notwendige Wesen noch als Ursache des<br />
bloßen Faktum der In-Existenz-Versetztheit verstanden werden, wenn es<br />
im Ideal in der über das ursprüngliche »idea est conceptus archetypus«<br />
hinausgehende Spekulation nur hypostasiert worden ist? Nur dann, wenn<br />
das ens realissimum nicht als durch die formalontologische Spekulation<br />
erzeugt oder als abgeleitet gedacht wird, sondern eine andere, nicht<br />
transzendentalidealistische Quelle besitzt. Eben dies wird von Kant mit<br />
der Abweichung von der Umfangsbestimmung des ens realissimum in den<br />
gegebenen Zitaten aus dem Beweisgrund Gottes zu den im Abschnitt über<br />
das transzendentale Ideal gemachten Voraussetzungen der<br />
transzendentallogischen Konstruktion von Identität angezeigt. Die anhand<br />
von Äquipollenzbehauptungen entlang der verschiedenen Termini des ens<br />
realissimum als Teilbegriff des omnitudo realitatis (Inbegriff aller Realität),<br />
und dieses noch im Inbegriff aller Prädikate zur Totalität der Sphäre aller<br />
möglichen Prädikate eines Dinges instantialisiert, sollte zu einer auch
— 1270 —<br />
komplementär und aus absoluter Position betrachtet unvollständigen<br />
Analogie eines Syllogismus aufgeschlichtet werden, hat dabei aber nur das<br />
Unvordenkliche in das logisch nur schwankend und in Alternativen<br />
vorstellbare disjunktive Urteil des transzendentalen Obersatzes<br />
eingelassen.<br />
9. Negation, Einschränkung, Teilung:<br />
Die Bestimmung der Dinge aus der absoluten Position<br />
Die transzendentale Vergleichung soll, zum Unterschied zur logischen<br />
Entgegensetzung von wahren und falschen Prädikaten in einem Satz oder<br />
in einer geregelten Folge von Sätzen, zwischen dem Ding und der Sphäre<br />
des Inbegriffs aller Prädikate (als der ganzen Möglichkeit) stattfinden. Um<br />
diesen geforderten Vergleich wenigstens teilweise unternehmen zu<br />
können, ist aus mehreren Gründen ein Übergang von der Totalität als<br />
Allheit der Prädikate zur Notwendigkeit des wesentlichen Prädikates<br />
vorauszusetzen: Es ist bislang weder geklärt, inwieweit (1) Prädikate, die<br />
Merkmale eines Dinges aussagen, selbst einen transzendentalen Inhalt<br />
besitzen, oder ob doch ein Inhalt einer Vorstellung oder eines Begriffs auf<br />
ein Ding oder Dinge bezogen werden muß, um eine transzendentale<br />
Bedeutung zu besitzen, also (2) in Folge auch, ob die transzendentale<br />
Vergleichung vom ganzen Ding ausgeht, noch, ob (3) die transzendentale<br />
Vergleichung auch mit der Ersetzung des Begriffs vom Ding durch die<br />
Menge aller diesem Ding gegebener Prädikate, die dann mit der Sphäre<br />
aller möglichen Prädikate eines Dinges überhaupt verglichen wird,<br />
gedacht werden kann, oder ob (4) der Inbegriff aller Prädikate nicht schon<br />
beginnt, auf das ens realissimum zu deuten. Dieses wäre dann nochmals<br />
(5) entweder als Teilbegriff des omnitudo realitatis oder als ens<br />
originarium und ens necessarium zu denken; wobei (6) letztere<br />
Vorstellung des ens realissimum schlußendlich durch ersteren in<br />
fortschreitender Totalisierung der Spekulation resolutiv als informiert<br />
vorgestellt werden könnte. Von dieser Beweglichkeit des Gedankengangs<br />
in diesen Fragen ist natürlich auch das Verständnis des transzendentalen<br />
Inhalts abhängig, dessen Verlust durch die formalistische Einschränkung<br />
auf die modale Frage droht. Allerdings erweist sich im Fortgang der<br />
Überlegung, daß eben noch diese Einschränkung auf Existenz auf eine<br />
universale und fortdauernde Wirkung Gottes als ens entium auf die Wesen
— 1271 —<br />
der Dinge (Essenz) verweist, als welche die einzelne Existenz der Dinge<br />
nunmehr angesehen werden müsse. Diese Wendung bringt auch die Frage<br />
nach dem transzendentalen Inhalt in eine neue Position.<br />
Obgleich der reale Grund der Existenz der Dinge im ens realissimum als<br />
ens originarium liegen soll, bleibt als einziger Grund für die<br />
Verschiedenheit der Prädikate des ens realissimum von den Prädikaten<br />
eines besonderen Dinges die Andersheit ihrer Prädikate. Diese Andersheit<br />
wird im Beweisgrund Gottes gegenüber dem einzigen notwendigen<br />
Realgrund (ens realissimum als ens necessarium) zum transzendentalen<br />
Mangel: »Es könnte auch beim ersten Anblick scheinen zu folgen: daß,<br />
weil das notwendige Wesen den letzten Realgrund aller anderen<br />
Möglichkeit enthält, in ihm auch der Grund der Mängel und<br />
Verneinungen derer Wesen der Dinge liegen müsse, welches, wenn es<br />
zugelassen würde, auch den Schluß veranlassen dürfte, daß es selbst<br />
Negationen unter seinen Prädikaten haben müsse, und nimmermehr<br />
nichts als Realität. Allein man richte nur seine Augen auf den einmal<br />
festgesetzten Begriff desselben. In seinem Dasein ist seine eigene<br />
Möglichkeit ursprünglich gegeben. Dadurch, daß es nun andere<br />
Möglichkeiten sein, wovon es den Realgrund enthält, folgt nach dem Satze<br />
vom Widerspruchs, daß es nicht die Möglichkeit des realsten Wesens<br />
selber, und daher solche Möglichkeiten, welche Verneinungen und Mängel<br />
enthalten, sein müssen. — Demnach beruht die Möglichkeit aller andern<br />
Dinge, in Ansehung dessen, was in ihnen real ist, auf dem notwendigen<br />
Wesen, als einem Realgrunde, die Mängel aber darauf, weil es andere<br />
Dinge und nicht das Urwesen selber sind, als einem logischen Grunde.«<br />
(Beweisgrund Gottes, A 37 f.)<br />
Diese Negation wird aus der Position der absolut notwendigen Realität als<br />
solche ausgesprochen; also nicht transzendental, wonach die absolute<br />
Position durch die Sinnlichkeit der primären Intentionalität ausgedrückt,<br />
dort aber auch nicht als aufheblich gedacht wird. Es ist keineswegs klar,<br />
wie dieser Mangel im Rahmen der transzendentalen Subjektivität der<br />
primären Intentionalität oder auch nur im Rahmen des formalen Problems<br />
der Bedeutungshorizonte des Ist-Sagens ausgedrückt werden sollte. Ich<br />
ziehe nun den Abschnitt über das transzendentale Ideal als prototypon<br />
transcendentale heran, um zuerst die dortige Darstellung des Problems<br />
weiter zu verfolgen.
— 1272 —<br />
a) Formalontologische und modallogische Reflexion im<br />
transzendentalen Ideal als prototypon transcendentale<br />
»Wenn wir alle mögliche Prädikate nicht bloß logisch, sondern<br />
transzendental, d. i. nach ihrem Inhalte, der an ihnen a priori gedacht<br />
werden kann, erwägen, [I] so finden wir, daß durch einige derselben ein<br />
Sein, durch andere ein bloßes Nichtsein vorgestellet wird [II]. Die logische<br />
Verneinung, die lediglich durch das Wörtchen: Nicht, angezeigt wird,<br />
hängt eigentlich niemals einem Begriffe, sondern nur dem Verhältnisse<br />
desselben zu einem anderen in einem Urteile an, und kann also dazu bei<br />
weitem nicht hinreichend sein, einen Begriff in Ansehung seines Inhalts zu<br />
bezeichnen. Der Ausdruck: Nichtsterblich, kann gar nicht zu erkennen<br />
geben, daß dadurch ein bloßes Nichtsein am Gegenstande vorgestellet<br />
werde, sondern läßt allen Inhalt unberührt [III]. Eine transzendentale<br />
Verneinung bedeutet dagegen das Nichtsein an sich selbst, dem die<br />
transzendentale Bejahung entgegengesetzt wird, welche ein Etwas ist,<br />
dessen Begriff an sich selbst schon ein Sein ausdrückt, und daher Realität<br />
(Sachheit) genannt wird, [IV] weil durch sie allein, und so weit sie reichet,<br />
Gegenstände Etwas (Dinge) sind, [V] die entgegenstehenden Negationen<br />
hingegen einen bloßen Mangel bedeutet, und, wo diese allein gedacht<br />
wird, die Aufhebung alles Dinges vorgestellt wird.[VI]« (B 602 f./A 574 f.)<br />
(I) Hier irritiert in der transzendentalanalytischen Perspektive die<br />
Einschränkung der Sphäre möglicher Prädikate auf transzendentale<br />
Inhalte, die dazu noch an diesen Prädikaten a priori gedacht werden<br />
können (Hervorhebung von mir). Die transzendentale Einschränkung geht<br />
hier nicht auf mögliche empirische Inhalte oder auf transzendentale<br />
Bedingungen ihres Gegebensein als mögliche höherstufige Prädikate,<br />
sondern sie geht auf Inhalte, die an den möglichen Prädikaten selbst<br />
gedacht werden können; und zwar a priori gedacht werden können<br />
müssen. Es handelt sich also um ausgezeichnete Prädikate »höherer<br />
Ordnung«, die gegenüber den transzendentalen Inhalten, die etwa aus der<br />
»transzendentalen Materie« (Allheit) oder dem »wesentlichen« Prädikat<br />
(Allgemeinheit) ihre Legitimation beziehen, als verschieden zu denken<br />
sein müßten. — Diese Eröffnung bezieht sich auf den Umstand, daß der<br />
Inhalt, der an allen Prädikaten gedacht werden kann, mit dieser<br />
Abstraktheit der damit gegebenen universiellen Charakterisierung eben<br />
nichts anderes mehr als die Beziehbarkeit auf Dinge selbst ausdrückt, die a<br />
priori als Merkmal an Prädikaten zu finden ist. Das ist der zureichende<br />
Grund für Erkenntnis bei Leibniz.
— 1273 —<br />
(II) Der Inhalt, der a priori an Prädikaten gedacht werden können soll,<br />
stellt sich hier aber auch als das reine modale Prädikat selbst heraus, das<br />
Vorstellungen oder Prädikate als wahr oder falsch kennzeichnet. Damit<br />
würde mehr verlangt als mit der allgemeinen Vorbedingung, daß<br />
Prädikate sich als solche bestimmen lassen, indem sie als auf Dinge<br />
beziehbar erwiesen werden. Es würde auch mehr verlangt als mit der<br />
transzendentallogischen Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung,<br />
welche dem ersten zureichenden Grund Leibnizens allererst eine objektive<br />
und reale Grundlage zu geben vermag. Es sind weitere Fragen zu stellen:<br />
Sind hier bereits weitere Beziehungen zwischen Prädikate »höherer<br />
Ordnung«, also z. B. quantitative Prädikate eines bestimmten qualitativen<br />
Prädikats in radikaler Opposition wie »Absoluter Nullpunkt ist völlige<br />
Abwesenheit von freier Energie« oder »Schwärze ist völlige Abwesenheit<br />
von Licht« mitbedeutet? Eine transzendentale Negation kann es nicht sein,<br />
an die Kant hier denkt, denn eine solche würde definitionsgemäß das Sein<br />
schlechthin aufheben. Dann handelte die transzendentale Erwägung von<br />
nichts anderem als von Inhalten, die an den Prädikaten a priori gedacht<br />
werden, deren Negation transzendental in dem Sinne wäre, als daß jedes<br />
Sein von Dingen in der Welt schlechthin aufgehoben wäre, oder kritisch<br />
formuliert, daß jede Aussagemöglichkeit über Dinge der Welt aufgehoben<br />
wäre. Kant bedenkt nun in der Tat etwas Widersprüchliches, oder scheint<br />
nur etwas Widersprüchliches zu bedenken, da es meine Hervorhebung des<br />
»an« war und meine Interpretation des »an« als im Gegensatz stehend zu<br />
demjenigen, was in den Prädikaten gedacht werden könnte. Es bleibt aber<br />
unabhängig von dieser Frage nunmehr die Aufmerksamkeit darauf zu<br />
richten, daß die transzendentale Erwägung von a priori geltenden Inhalten<br />
nicht auf notwendige Existenz schließen läßt, deren Aufheblichkeit zur<br />
transzendentalen Negation führen müßte, sondern mit den einen Inhalten<br />
a priori ein Sein, mit den anderen ein Nichtsein vorgestellt wird. Dies wäre<br />
in Totalität sinnvoll nur mehr unter der Voraussetzung denkbar, wenn das<br />
Sein notwendige Existenz, und das Nichtsein Unmöglichkeit bedeutet, was<br />
eben nicht die Aufhebung des zureichenden Grundes der analytisch<br />
darstellbaren Prädizierbarkeit von Prädikaten nach sich zieht, sondern im<br />
Gegenteil diesen noch für die Unterscheidung in notwendige Existenz und<br />
Unmöglichkeit als notwendige Bedingung voraussetzt. Jedoch spricht auch<br />
der von Kant gewählte Ausgangspunkt, nämlich die Sphäre »aller<br />
möglichen Prädikate« gegen diese Auffassung. Der Schwierigkeit der<br />
untersuchten Formulierung Kantens liegt die schon bekannte<br />
Schwierigkeit, zwischen transzendentalem Vergleich eines Dinges und
— 1274 —<br />
dem logischen Vergleich anhand von Merkmalsbegriffen eine klare und<br />
deutliche Unterscheidung treffen zu können, zugrunde. Die Wurzel dieser<br />
notorischen Unklarheit in der Begriffsunterscheidung liegt schlußendlich<br />
aber schon auf architektonischer Ebene, und zwar in der speziell<br />
transzendentallogisch problematischen Nivellierung des selbst nicht<br />
durchgängig eindeutigen Unterschiedes von Verstandesurteilen und<br />
Vernunftschlüssen, die damit geschieht, daß Kant schon unabhängig von<br />
eventueller konventionalistischer Aspekte, die mit der diskursiven Form<br />
der formalen Logik einhergehen, die allgemeine Logik für<br />
Verstandesbegriffe wie für Vernunftbegriffe gleichermaßen für tauglich<br />
erklärt.<br />
(III) Im zweiten Satz des gegebenen Zitats behandelt Kant seine<br />
Auffassung der logischen Negation: das »nicht« gehört zur Kopula, nicht<br />
zu einem Begriff. Das heißt soviel wie, nicht nur, daß die logische<br />
Verneinung selbst keinesfalls eine Existenzbehauptung aufhebt (obgleich<br />
in Folge einer logischen Verneinung dergleichen zusammen mit der<br />
transzendentalen Bedingung im Rahmen einer empirischen Theorie die<br />
Konsequenz sein kann), auch ist es sinnlos, ein Prädikat zuzusprechen, in<br />
welchem ein negierter Begriff steht, weil damit unsere Kenntnis vom damit<br />
letztlich prädizierten Ding nicht vermehrt wird. Die Formulierung »Der<br />
Ausdruck: Nichtsterblich, kann gar nicht zu erkennen geben, daß dadurch<br />
ein bloßes Nichtsein am Gegenstande vorgestellet werde« bleibt aber<br />
unterbestimmt: Um eine transzendentale Negation, die alles Sein, auch das<br />
des Gegenstandes, aufheben würde, handelt es sich auch hier nicht;<br />
warum aber dann nicht ein im Sinne des vom verwendeten Wörtchen »am«<br />
intendierte Art von Sein (sei als eine Weise des Ist-Sagens von Merkmalen,<br />
sei es als eine Weise des Geltungsaussagens höherstufiger Prädikate) im<br />
Zuge der Intentionsanalyse hypostasiert wird, welches im Anschluß daran<br />
selbstverständlich genau in diesem Sinne auch ein Nichtsein, etwa in der<br />
Wendung »es gibt« in der Aussage »Es gibt keine euklidischen Dreiecke,<br />
die eine andere Winkelsumme als 180 Grad besitzen«, im Unterschied zur<br />
Aufhebung des Sein eines seienden Dinges bedeuten könnte, ohne deshalb<br />
die Abhängigkeit dieser Redeweise von einem der möglichen<br />
Existenzialsätze leugnen zu müssen, die aus der<br />
transzendentalsubjektivistischen Verfasstheit und der Ausgerichtetheit<br />
unseres Bewußtseins auf die primäre Intentionalität entspringen, wird mir<br />
von hier aus nicht klar.
— 1275 —<br />
(IV) »Die transzendentale Verneinung bedeutet dagegen das Nichtsein an<br />
sich selbst« besagt nicht mehr und nicht weniger als<br />
transzendentalidealistisch die Aufhebung des Daseins schlechthin,<br />
analytisch-metaphysisch die Aufhebung des Seins schlechthin. Die<br />
transzendentale Bejahung wird aber nicht etwa als notwendige Handlung<br />
(zwar als Reaktion auf Etwas, nicht als einfache Folge dieses etwas)<br />
vorgestellt, wobei die Ausdrucksweise von der Realität als Sachheit die<br />
primäre Intentionalität bereits als Objektivität und mögliche Realität eines<br />
Dinges intendierend zu charakterisieren erlaubte, sondern direkt mit der<br />
Sachheit identifiziert. Ich schließe daraus, daß Kant hier unmittelbar auf<br />
die cartesianische Unterscheidung von res cogitans und res extensa und<br />
deren einfacheren intentionalen Evidenzverhältnisse Bezug nimmt.<br />
Insofern scheint Kant hier die Bedeutung der transzendentalen Bejahung<br />
auf die Weise (die Weisen) des Ist-Sagens, die für den Seinsbereich der res<br />
extensa tauglich gemacht werden können, gegenüber dem<br />
Bedeutungsumfang der transzendentalen Negation einzuschränken, der<br />
bei der Einführung das ganze Sein zu umfassen schien. —<br />
Damit wird eine Schicht der Vernunftideen angerissen, die vor den<br />
Analogien zu den Kategorien, welche allererst die Ideenlehre der reinen<br />
Vernunft möglich macht, anzusetzen ist. Ähnlich wie die Kategorien und<br />
die obersten Vernunftideen hat diese Idee ihre Unabhängigkeit gegenüber<br />
den empirischen Bestimmungen nach Genus und Eidos zwischen<br />
Phronesis und Empeireia, wie auch gegenüber den darauf beruhenden<br />
logischen Formalisierungen der Apophantik. Unterschieden ist die<br />
cartesianische Vorstellung vom Ding als analytischer Begriff, der<br />
gleichwohl Vernunftbegriff sein können soll, von der Kategorie durch die<br />
Voraussetzungen in der transzendentalen Ästhetik, den logischen<br />
(historisch: semantischen) Zeitbedingungen in den Verstandesbegriffen<br />
und den transzendentalen Zeitbedingungen der Kategorien; vom »reinen«<br />
Vernunftbegriff durch die getrennte Aufstellung und Auflösung der<br />
Dialektik der transzendentalen Ideen (psychologische, kosmologische,<br />
theologische Idee). Es scheint, als könne diese unbeachtete Dialektik der<br />
Vernunftbegriffe, die mit diesen Rückgriff in den Blick kommt, für den<br />
vorläufig und auf genetische Motive hin angenommenen vorgängigen<br />
Vernunftbegriff des Dinges (res zwischen res extensa und res cogitans)<br />
hintangehalten werden. Den Vorläufer des Vernunftbegriffs in dieser<br />
»genetischen« Hinsicht vermute ich, wie an anderer Stelle ausgeführt in<br />
der letztlich bewußtseinspsychologisch verfaßten Intentionalitätslehre und
— 1276 —<br />
dem im Rahmen einer jeden Urteilslehre herausspringenden logischen<br />
Gegenstand der Intentionalität. Damit ist die Einschränkung des<br />
Bewußtseins auf die primäre Intentionalität nicht von vorneherein mit<br />
Notwendigkeit verbunden, nur in genetischer Betrachtung und in<br />
strategischer Hinsicht für uns als Teil der Welt der Dinge von Bedeutung;<br />
vom nur vorgestellten, aber nicht denkbaren Standpunkt des absolut<br />
notwendigen Seins muß diese Beschränkung auf das Feld der res extensa<br />
allerdings willkürlich erscheinen. Deshalb kann aber der logische<br />
Gegenstand der Intentionalität im Rahmen eines Urteils auch niemals mit<br />
dem Ding an sich selbst oder dem transzendentalen Objekt verwechselt<br />
werden.<br />
(V) Kant fährt nun mit seiner Erläuterung fort: »weil durch sie allein, und<br />
so weit sie reichet, Gegenstände Etwas (Dinge) sind«. Keineswegs ist klar,<br />
worauf dieses »sie« sich beziehen lassen soll; zur Auswahl stehen ab der<br />
transzendentalen Bejahung (und nur diese kommt in Frage):<br />
1. Der Begriff vom Etwas, »dessen Begriff an sich selbst schon ein Sein<br />
ausdrückt«. Kant macht die eben beobachtete Einschränkung auf einen<br />
Begriff von einem einzelnen oder besonderen Gegenstand nochmals durch<br />
das von mir hervorgehobene »ein« deutlich; das allgemein gehaltene Sein<br />
erlaubt eine Verbindung zum »einzigen Realgrund« aus dem Beweisgrund<br />
Gottes herzustellen, sodaß der einzige Seinsgrund, im ens realissimum als<br />
ens originarium wurzelnd, auch für die noch von der absoluten Position<br />
ausgehend als »anders« bestimmten Dinge des Seinsmöglichen der einzige<br />
Realgrund bleiben soll. Auch wenn diese einen transzendentalen Mangel<br />
gegenüber Gott als Grund für ihre Andersartigkeit besitzen, der zwar<br />
hypothetisch zumindest abstrakt-unbestimmt als von jeder empirischen<br />
Bestimmbarkeit und Besonderheit unabhängigen eigener Inhalt a priori<br />
gedacht werden kann, bleibt letztlich der einzige Realgrund für uns nur<br />
rein modal zu denken übrig. Allein spekulativ kann die Herkunft des<br />
transzendentalen Inhalts der Bestimmungen der Welt der Dinge weiter<br />
verfolgt werden, deren Ursprung liegt noch verborgen in der Indifferenz<br />
des Unvordenklichen; einstweilen ist nur klar, daß der transzendentale<br />
Mangel der Seinsweise der Dingwelt gegenüber dem ens realissimum als<br />
ens originarium, entium (insofern als ens necessarium), summum (als<br />
allerhöchstes Wesen), sollte er über die rein modale Bedeutung als einziger<br />
Realgrund der Dinge einer weiteren Bestimmung zugänglich sein, nichts<br />
mit dem transzendentalen Inhalt der bisher untersuchten transzendentalen<br />
Logik in der Kritik des empirischen Verstandesgebrauches und nichts
— 1277 —<br />
mehr mit der ebenfalls transzendentallogischen Kritik an der<br />
Formalontologie der sich in rein modale Begriffe verflüchtigenden reinen<br />
Vernunftspekulation zu tun hat. — Doch allein, man weiß hier nicht<br />
welchen Mangel, oder ob beide: entweder einen Mangel gegenüber der<br />
Totalität des wie im Detail auch immer bereits eingeschränkten Inbegriffs<br />
aller möglichen Prädikate, oder doch einen Mangel gegenüber dem Sein<br />
des Allerhöchsten im Sinne vom Allerrealsten und, ob nun als ens<br />
originarium oder ob als in der Totalität der Antizipation resolutiv<br />
informiert, auch im Sinne von Allwissendheit.<br />
2. Das Etwas als Realität und Sachheit könnte nun gleich selbst als einzige<br />
uns ursprünglich zugängliche Quelle des Ist-Sagens im Bereich der res<br />
extensa genau gegenüber dem Bereich der res cogitans und dem damit<br />
verbundenen, als ursprünglich-rein (analytisch) angesehenen<br />
Evidenzproblem exponiert worden sein, dem die Verbindung zum<br />
»einzigen Realgrund« im Sinne des modalen Beweisgrundes Gottes aus<br />
der Existenz wie der nexus von Leib und Seele allerdings völlig im Rücken<br />
liegt. — Beide Versionen (ein Sein in Abhängigkeit vom einzigen<br />
Realgrund, Realität als Sachheit) erfüllen verschieden die formulierte<br />
Bedingung: »weil durch sie allein, und so weit sie reichet, Gegenstände<br />
Etwas (Dinge) sind«.<br />
(VI) Erst im Schlußsatz bezieht Kant die Darstellung aus dem Beweisgrund<br />
Gottes ausdrücklich auf die selbst analytisch-metaphysisch vorgehende<br />
Exponation der res extensa: Die »entgegenstehenden Negationen« können<br />
einerseits der transzendentalen Bejahung entgegenstehen, sind also die<br />
untersuchten transzendentalen Negationen; dies aber plötzlich gleich in<br />
der Mehrzahl, was auf dem ersten Blick dem nur zwischenzeitlichen<br />
Ausfall der ontologischen Reflexion auf die Einheit der Vielheit in der die<br />
Ontologie übersteigende Reflexion auf die theologische Idee zu verdanken<br />
wäre. Die Mehrzahl kann aber eben so gut gerade als aus dem Versuch des<br />
Wechsel von der Position der Welt der Dinge (res extensa) zur Welt der<br />
reinen Intelligibilität des ens realissimum entspringend angesehen werden,<br />
als daß die Allheit der möglichen Prädikate eines Dinges samt der Vielheit<br />
der Arten von Dingen nur mehr als Totalität der Sphäre göttlicher<br />
Informiertheit eine logische, hingegen die Vielheit der Merkmale und<br />
Dinge als omnitudo realitatis gedacht wird, die, obwohl nochmals<br />
hypostasiert in zeitloser Totalität vorstellbar, bereits eine, freilich abstraktunbestimmte<br />
Beziehung zu räumlichen und zeitlichen Ordnungen besitzt.<br />
Diese Beziehung zu Raum und Zeit gehört nicht selbst zur Einheit der
— 1278 —<br />
(reinen?) Intelligibilität, insofern also von selbst und ursprünglich (vor der<br />
Setzung von Räumlichkeit und Zeitlichkeit möglicher Dinge) zur Vielheit<br />
der Dinge, obgleich eben wiederum die Ordnung der Dinge in Raum und<br />
Zeit erst durch die In-Existenz-Setzung ihrer Wesen enstanden gedacht<br />
werden muß. Vgl. dazu die rein logische Ableitung von Raum und Zeit<br />
durch Kant im Opus postumum und deren Referenzen zu Spinoza und<br />
Fichte in Gegenüberstellung zur transzendentalphilosophischen Wende<br />
zur Erfahrung.<br />
Die in (V) noch nicht entscheidbare Frage, welche Fassung der Bedingung,<br />
daß »durch sie allein, und so weit sie reichet, Gegenstände Etwas (Dinge)<br />
sind« nun als die Zutreffende erachtet wird, die intensional vollständige<br />
(ein Sein in Abhängigkeit vom einzigen Realgrund) oder die auf selbst<br />
intensionale Weise extensional vollständige Fassung als Totalität oder<br />
Inbegriff aller möglichen Prädikate im Konzept (wesentliches Prädikat),<br />
läßt sich nun komplementär zusammenfassen und insofern auch<br />
beantworten: In der Welt existierende Dinge besitzen sowohl einen Mangel<br />
gegenüber dem ens realissimum als ens originarium, entium, summum<br />
(letztlich als allerhöchste Realität dem Zugriff jeder ontologischen<br />
Untersuchung entzogen) wie auch den Mangel gegenüber der Totalität<br />
aller möglichen Prädikate eines Dinges überhaupt — und dies anhand der<br />
Informiertheit Gottes in einem Zuge. Die erste Fassung der<br />
transzendentalen Negation eingangs dieser Untersuchung hat nun den<br />
»einzigen Realgrund« zumindest als Wirkung für die Welt der »anderen«<br />
Dinge aufgehoben, die Formulierung »ein Sein in Abhängigkeit vom<br />
einzigen Realgrund« hebt damit auch dieses eine betrachtete Sein (Dasein<br />
als Sein eines Seienden) für sich als einzelnes existierendes Wesen auf, das<br />
nur in der Welt der Vielheit der Dinge und nur in diesem Sinne existierend<br />
wirklich und an sich und für sich Einzelnes sein kann, ohne zugleich selbst<br />
Totalität sein zu müssen. Eine transzendentale Negation in der Mehrzahl<br />
sollte nunmehr zwar immer nur ein einzelnes oder besonderes Dasein<br />
eines Dinges aufzuheben imstand sein, ohne deshalb das Dasein anderer<br />
gleichermaßen bestimmter oder auch nur bestimmbarer Dinge<br />
aufzuheben, aber hat in Folge im Durchgang durch alle Dinge ebenso zur<br />
Aufhebung »alles Dinges« zu führen wie die vollständige formale<br />
Reflexion in reiner Modalität — allerdings ohne den »einzigen Realgrund«<br />
selbst, der in Gott liegt, mit aufzuheben, da es sich bei der Erörterung der<br />
transzendentalen Bejahung und Verneinung um eine ontologische<br />
Untersuchung gehandelt hat.
— 1279 —<br />
Kann vielleicht in Erinnerung an verschiedene Konzepte für<br />
Subjektbegriffe und Prädikatsbegriffe vor der Verwischung der<br />
Unterschiede im Zuge der Untersuchung des Ideals zunächst verwundern,<br />
daß Kant die transzendentale Fassung einer logischen Negation<br />
ausgeschlossen hat, die nur Prädikate derjenigen Seinsweisen<br />
berücksichtigt, die am Ding vorkommen können, so ist einsichtig<br />
geworden, weshalb die Fassung der Darstellung des transzendentalen<br />
Mangels als Ergebnis des transzendentalen Vergleichs des einzelnen<br />
Dinges gegenüber dem ens realissimum die stärkere Version gegenüber<br />
allen Versuchen einer Neudefinitionen der transzendentalen Negation sein<br />
muß. Der Grund, weshalb Kant dieser, von den logischen Untersuchungen<br />
des syntaktischen Kriteriums sogar geforderten alternativen<br />
Denkmöglichkeit nicht nachgeht, liegt nochmals darin: Durch die<br />
Festlegung des Ist-Sagens auf die Seinsweise der res extensa ist nun das<br />
Sein und Dasein eines jeden einzelnen Dinges einseitig mit der Seinweise<br />
der Seiendheit überhaupt bestimmt worden, und so analytisch im als<br />
einzelnes Ding gedachten Ding abstrakt-unbestimmt bereits als sein<br />
gedachtes Konzept mitzudenken. Der in der abstrakten Totalität des Ideals<br />
der reinen Vernunft zu denkende Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
drückt genau diese Formel aus, wenn nichts anderes mehr als die Idee<br />
(idea est conceptus archetypus) diesen Begriff bestimmt. Die angedachte<br />
transzendentale Aufhebung der Seinsweise eines Prädikats als Aufhebung<br />
eines Merkmals an einem jedem einzelnen oder besonderen Ding soll<br />
offenbar auch deshalb nicht transzendentale Negation genannt werden,<br />
weil die Seinsweise des nur am Ding Vorkommen-Könnens nicht<br />
unmittelbar vom »einzigen Realgrund« abhängig ist, sondern seinerseits<br />
völlig von der Seinsweise des Dinges, hier als zugehörig zum Bereich der<br />
res extensa charakterisiert, abhängig gemacht worden ist, deren<br />
transzendentale Inhaltlichkeit aber bekanntlich in qualitativer Hinsicht<br />
nicht der göttlichen Willkür untersteht, auch eher nicht aus der Indifferenz<br />
des Unvordenklichen, sondern aus der Eigenschaft der Materie entstammt,<br />
durch immer größere Unähnlichkeit ihrer Teile untereinander die<br />
Mannigfaltigkeit der Erscheinungsweisen der Materie zu vergrößern. 36<br />
Aber in konsquenter transzendentalsubjektivistischer Perspektive ist an<br />
dieser rationalen Konstruktion zu kritisieren, daß mit ähnlicher<br />
spekulativer Methode auch an Merkmale herangegangen werden kann, die<br />
als wesensnotwendig aus der inneren Kraft einer realen Substanz<br />
36 G. W. Leibniz, Gerhardt, Bd. VII, p. 289, Kap. VIII, Vierundzwanzig Sätze
— 1280 —<br />
entstanden gedacht werden können, aber ohne daß hier die Spekulation<br />
eingeschränkt werden könnte wie etwa im gegenwendigen<br />
transzendentalen System innerer und äußerer Zwecke. Kant verhindert<br />
mit seiner Beschränkung der Denkmöglichkeiten auf die strikte<br />
Konsequenz der transzendentalen Negation von vorneherein alle<br />
Schwierigkeiten der Art, hinsichtlich der Aufheblichkeit »alles Dinges«<br />
Vermutungen über die determinierende Kraft der ersten Ursache oder<br />
über den inneren Zusammenhang eines series rerum, über ein nach<br />
inneren und äußeren Zwecken organsisiertes Wesen, oder über den<br />
Zusammenhang empirischer Begriffe in der Erfahrung anstellen zu<br />
müssen.<br />
b) Der Übergang vom Inbegriff der Möglichkeit zur Vermögenslehre<br />
und die vierfache Bestimmungsweise des transzendentalen Inhalts zum<br />
transzendentalen Mangel.<br />
Kant gibt zum transzendentalen Mangel der Dinge gegenüber der<br />
Seinsweise des ens realissimum einige anschauliche Beispiele: »Nun kann<br />
sich niemand eine Verneinung bestimmt denken, ohne daß er die<br />
entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe. Der Blindgeborene<br />
kann sich nicht die mindeste Vorstellung von Finsternis machen, weil er<br />
keine vom Lichte hat; der Wilde nicht von der Armut, weil er den<br />
Wohlstand nicht kennt. Der Unwissende hat keinen Begriff von seiner<br />
Unwissenheit, weil er keinen von der Wissenschaft hat, usw.«<br />
(B 603/A 575)<br />
Diese Beispiele verwenden nun doch Prädikate, die Merkmale von<br />
Daseindem aussagen, aber eben nicht als Merkmal von Dingen, vielmehr<br />
als Merkmal und Einteilungsgrund eines selbst empirschen Vermögens<br />
der Wahrnehmung und des Verstandes. Es hat offenbar ein<br />
Stellungswechsel stattgefunden: nicht länger von den für den Bereich der<br />
res extensa tauglichen Weisen des Ist-Sagen ist hier mehr die Rede,<br />
sondern von der selbst daseienden Seinsweise des Daseins, dessen völlige<br />
Abtrennung und Eingrenzung auf die reine Intelligibilität des res cogitans<br />
Kant in der Auflösung der dritten und vierten Antinomie bekanntlich<br />
einen unüberwindlichen Riegel vorschiebt. Nur das Beispiel der zweiten<br />
Art (selbst verschuldete Unmündigkeit, Unwissenheit) kann auch ohne<br />
vollständige Aufhebbarkeit des Mangels eingesehen und auch teilweise<br />
behoben werden. Es ist demnach zu untersuchen, ob diese Beispiele für
— 1281 —<br />
das hier anstehende Problem der näheren Entwicklung individueller<br />
transzendentaler Negationen oder auch nur für die Möglichkeit einer<br />
Erklärung, weshalb überhaupt plötzlich von einer Vielzahl von<br />
transzendentaler Negationen die Rede ist, um zur Bestimmung des<br />
bewußten transzendentalen Mangels einen Hinweis erhalten zu können,<br />
oder warum solche Beispiele grundsätzliche Hinweise dieser Art nicht<br />
geben können. — Kant fährt fort:<br />
»Es sind also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet, und die<br />
Realitäten enthalten die Data und so zu sagen, die Materie, oder den<br />
transzendentalen Inhalt, zu der Möglichkeit und durchgängigen<br />
Bestimmung aller Dinge.« (B 603/A 575) Hier wird der transzendentale<br />
Inhalt nunmehr wieder auf ein gegebenes Datum bezogen, das der<br />
»Realität« entstammt, und nicht wie oben bereits entweder auf die<br />
Vermögen zur Erfassung dieser Realität im Modus des »quid facti« oder<br />
auf die Fähigkeit, diese Kenntnisse auch zu rechtfertigen; auch nicht auf<br />
die Eigenschaft der Materie, in sich mit sich selbst immer unähnlicher zu<br />
werden, um so das Maximum des Raumes zu erfüllen und das Maximum<br />
an möglichen Arten zu schaffen. Mit der Verknüpfung von Materie und<br />
transzendentalem Inhalt wird nunmehr dem Begriff von »Materie« die<br />
gleiche Bedeutung unterstellt, wie der Ausdruck »transzendentaler<br />
Materie« sowohl anfangs des Kapitels »Das transzendentale Ideal<br />
(prototypon transcendentale)« wie anfangs der M. A. d. N. nahelegt.<br />
Einerseits wird mit der transzendentalidealistischen Wendung zur reinen<br />
Intelligibilität des Subjektes der rationalen Psychologie im Gegenzug der<br />
Ausdruck »transzendentale Materie« allererst möglich, andererseits wird<br />
von den Beispielen gerade demonstriert, daß diese Negationen jeweils für<br />
jedes Vermögen eine völlige Beraubung darstellt, welche eine Ableitungen<br />
eines in der Welt der Dinge positiv bestimmten Inhaltes unmöglich macht.<br />
Diese unbefriedigende Gegenüberstellung von »transzendentalem<br />
Mangel« und »Realität« als Seinsweise der Dingwelt, die in einem Zuge<br />
eine positive Identifizierung beider in einer Seinsweise fordert, während<br />
die transzendentallogische Untersuchung doch zuerst auf den Ursprung<br />
der transzendentalen Inhalte zu gehen hätte, führt das Fragen zurück zum<br />
transzendentalen Vergleich des Dinges mit dem Inbegriff aller möglichen<br />
Prädikate, der nur wegen der Informiertheit Gottes äquipollent mit dem<br />
Bedeutungsumfang des omnitudo realitatis sein soll. Nun ist der<br />
Ausschluß des logischen Vergleichs der Prädikate für den<br />
transzendentalen Vergleich ab der Erörterung des »transzendentalen
— 1282 —<br />
Mangels« der Welt der Dinge gegenüber Gott unumstösslich, doch aber<br />
bleibt die Schwierigkeit zurück, wie denn nun der bewußte Mangel im<br />
transzendentalen Vergleich mit dem als intelligibel und derart als<br />
informiert zu denkenden ens realissimum als Definition der<br />
transzendentalen Negation darstellbar wäre, da doch der sich mit der<br />
transzendentalen Negation erst zeigende besondere und einzelne Mangel<br />
eines jedes Dinges gegenüber der Intelligibilität des ens realissimum mit<br />
der bloßen Vermehrung zu transzendentalen Negationen allein noch nicht<br />
zu seiner Darstellung gekommen ist, wenn die Konsequenz unversehens<br />
doch nichts anderes als die Aufhebung alles Seienden im Sinne von res<br />
extensa zur Folge hat. So soll an einem Begriff, der bereits ein Ding und<br />
nicht nur eine Eigenschaft eines Dinges zu bezeichnen vermag, der<br />
Zusammenhang von logischen und transzendentalen Vergleich nochmals<br />
vorgestellt werden.<br />
Um weitere Vorbedingungen über die Natur eines solchen Begriffes nicht<br />
eigens vorausschicken zu müssen, auch um anzuzeigen, daß es eben nicht<br />
unbedingt nur um eine ganz bestimmte Art von Begriff oder Ding geht,<br />
möchte ich als Beispiel einen Namen nehmen, der eine bestimmte Person<br />
bezeichnet. Was nun eine Person überhaupt ist, und wer genau diese<br />
Person, ich nenne sie Paul, sein mag, braucht nur ungefähr in<br />
Abgrenzungen zu anderen Erfahrungsgegenständen und anderen<br />
Personen bekannt sein; es bedarf also zur Exposition keiner vollständigen<br />
Definition. Die hier zuerst wichtigen Aspekte hängen auch nicht sosehr<br />
davon ab, daß dieser Name im gewählten Beispiel eine Person bezeichnet.<br />
Die Vorgehensweise im gewählten Beispiel prädiziert nicht selbst eine<br />
bestimmte Qualität, die am »Ding« der Intention vorkommen kann; und<br />
wäre nun das direkte Zutreffen des gesuchten Prädikats noch fraglich,<br />
gerade das Zutreffen einzelner äußerlicher Eigenschaften macht erst einen<br />
Vergleich von Ähnlichkeiten, wie hier angestrebt, möglich, um das<br />
gesuchte Prädikat, das eben kein äußerliches Merkmal mehr aussagt,<br />
aufzufinden. Das Beispiel besteht nun darin, daß A und B etwa auf der<br />
einen Seite eines kleinen Platzes stehen, und eine Person aus einem<br />
öffentlichen Gebäude auf der anderen Seite herauskommt. Beide fragen<br />
sich nun, ob es sich bei dieser Person um Paul handeln könnte. Es geht im<br />
ersten Schritt um diese Ähnlichkeit vor der Gewißheit, ob es sich hier um<br />
Paul handelt oder nicht, im zweiten um die verschiedenen<br />
Wahrnehmungssituationen, wonach etwa ein bekannter Doppelgänger,<br />
die Ähnlichkeit eines Umrisses eines Gebüsches im Dunkeln oder
— 1283 —<br />
dergleichen die Liste der möglichen Alternativen enger oder weiter faßt.<br />
Hier sind, ähnlich wie im Kronenkorkenbeispiel Husserls, einige<br />
hervorstechende Eigenschaften in der Wahrnehmung gegeben, aber eben<br />
die Identität des Dinges fraglich. Die hier interessierende Merkwürdigkeit<br />
ist folgende: Der Bereich der möglichen Alternativen zur Verneinung einer<br />
der quidditativen Möglichkeiten umfaßt nicht die logische Totalität aller<br />
anderen Möglichkeiten wie die logische Negation, sondern ist die<br />
Negation einer besonderen Logik, wobei aber die Liste der Negate nicht<br />
einfach abschließbar ist.<br />
Der Unterschied zwischen allgemeiner Logik einerseits und besonderer<br />
Logik andererseits ist insofern klar und deutlich; nunmehr aber ist in der<br />
transzendentalen Logik auf andere Weise als in der allgemeinen und<br />
formalen Logik ein allgemeiner Anspruch zu erheben, da die<br />
transzendentale Logik, hierin der besonderen Logik ähnlich, auf den Inhalt<br />
überhaupt geht. Die transzendentale Logik handelt nun nicht von<br />
Wesensbestimmungen von Gattungsbegriffen, sondern, wenn man schon<br />
von einer Wesenshaftigkeit sprechen will, von der Einheitlichkeit des<br />
Wesens des Gegebenseins überhaupt. Kant sieht offenbar durchaus, daß<br />
die Universalisierung der transzendentaler Inhalte auch für die<br />
transzendentale Negation analoge Folgen haben muß wie für den<br />
Übergang von der Negation einer besondern Logik zur Negation der rein<br />
formalen Totalität der allgemeinen Logik. Doch hat die Negation in der<br />
besonderen Logik gewisse äußerliche Eigenschaften, die an eine<br />
Anforderung der Darstellung des hier weiter verfolgten besonderen<br />
transzendentalen Mangels denken läßt, nämlich etwas zu suchen, daß<br />
weder durch Prädikate, die nur Merkmale eines Dinges aussagen, noch<br />
durch Prädikate, die über das Wesen oder die Besonderheit dieses Dinges<br />
oder dieser Art von Ding aussagen, allein dargestellt werden kann, und<br />
zwar ohne selbst als Negat unmittelbar die ganze mögliche Totalität der<br />
Bestimmbarkeit zu bedeuten. Doch dürfte unabhängig von der weiteren<br />
Spezifikation des Horizontes von Weisen des Gegebenseins (Weisen des<br />
Ist-sagens) als allgemein oder universiell umfaßbar oder nicht, mit der<br />
Spezifikation des Horizontes des Bewußtseins in Hinblick auf die<br />
Bedeutung der primären Intentionalität und der Ausbildung einer<br />
physikalistischen Sprache für die formale und allgemeine Logik nunmehr<br />
entschieden sein, daß weder von reiner Formalwissenschaft noch von<br />
abstraktiven Phänomenologien eine Lösung für das entscheidende<br />
Grenzproblem des transzendentalen Ideals erwartet wird. Die
— 1284 —<br />
transzendentale Logik hat ihren transzendentalen Inhalt, wenn nicht als<br />
modales Prädikat oder ein anderes höherstufiges Merkmal von Relationen<br />
im Rahmen der fortschreitend totalisierenden Abstraktionslehre, primär in<br />
der Wesensbestimmung des Gegebenseins von Objekten der Sinnlichkeit,<br />
nicht in der Informiertheit der Intelligibilität über diese Objekte, und auch<br />
nicht im transzendentalen Mangel gegenüber Gott, dessen Position zur<br />
Ontologie anhand der Vermögenslehre immerhin zur Sprache kommen<br />
konnte.<br />
Mit der Vermögenslehre ist aber bislang die einzige Darstellungsweise<br />
dieses transzendentalen Mangels gegeben worden, der nicht im<br />
transzendentalen Vergleich des Dinges mit der intelligiblen Informiertheit<br />
des ens realissimum gefunden werden kann, auch wenn sie nur als<br />
Illustration auftritt: Den Mangel als Beraubung eines ursprünglichen<br />
Vermögens. Den hier behandelten besonderen Mangel der Dinge<br />
gegenüber Gott jenseits des transzendentalen Inhalts ist demnach nur<br />
mittels einer Darstellungsweise der Potenz zu einer ersten Vorstellung zu<br />
bringen. Eine Potenzlehre dieser Art ist eine besondere Möglichkeitslehre,<br />
deren Möglichkeiten als Vermögen oder Fähigkeit darstellbar werden<br />
können, wenn eine Strebung oder zumindest eine strukturelle Tendenz<br />
(Yorck) angesetzt werden kann. Anscheinend gibt es zwei Arten von<br />
Beraubung: Die radikale, die selbst nicht artikuliert, sondern durch<br />
außenstehende verständige Wesen nur bemerkt werden kann; und eine<br />
Beraubung, die zumindest von verständigen Wesen selbst eingesehen<br />
werden kann (z. B. die selbst verschuldete Unmündigkeit in einer<br />
arbeitsteiligen Gesellschaft). Offenbar ändert auch eine formale<br />
Exponierung der Potenz- oder Vermögenslehre, die selbst nicht<br />
ausdrücklich eine Lehre von den Seelenvermögen impliziert, nichts daran,<br />
daß nunmehr erstens verständige Wesen explizit vorauszusetzen sind, und<br />
zweitens, daß eine komplexe Organisationsform dieser verständigen<br />
Wesen mit vorauszusetzen ist.<br />
Wenn es sich herausstellen sollte, daß rein substanzontologisch kein<br />
Entscheid gefunden werden kann darüber, ob in einem letzten Sinn von<br />
Ursprünglichkeit von einer oder von einer Vielzahl von Substanzen<br />
auszugehen sei, so ist die gleiche Frage nach der Transformation von<br />
Möglichkeit zu Vermögen und von Substanz zu Subjekt, welche die<br />
Notwendigkeit verständiger Wesen zur Formulierung einer<br />
Vermögenslehre als notwendige Voraussetzung in die Argumentation<br />
übernimmt, bereits entschieden. Für die gestellte Ausgangsfrage ist dieser
— 1285 —<br />
Übergang bislang die einzige Möglichkeit, vom Mangel in der hier<br />
verlangten Weise zu sprechen. Doch bleibt die Einzigkeit des ens<br />
realissimum als ens originarium und ens entium und ens summum das<br />
Problem, insofern die Einzigkeit des ens realissimum dem Implikat der<br />
eben herausgestellten Transformation von Substanzmetaphysik zu<br />
Subjektmetaphysik, eben die Vielheit der Subjekte der Vermögenslehre,<br />
direkt widerspricht. Auch deshalb muß die Vermögenslehre in diesem<br />
Zusammenhang einstweilen weiterhin als nur illustrative Redeweise<br />
betrachtet werden. Allerdings ist damit weder etwas über die erste<br />
Voraussetzung dieser Transformation, ein verständiges Wesen zu sein,<br />
noch etwas über den instrumentiellen oder heuristischen Wert dieser<br />
illustrierenden Redeweise entschieden, da es sich letztlich insofern um eine<br />
rein formale Spekulation handelt, indem deren Ergebnis als ursprünglich<br />
vorausgesetzt nur vorgestellt wird. Doch kann diese Transformation durch<br />
die auch in anderen Fällen übliche Charakterisierung eines grundlegenden<br />
Unterschiedes anhand der Gebrauches einer logischen Entgegensetzung,<br />
hier der wohl letztursprüngliche zwischen ens realissimum als informierte<br />
Intelligibilität und der Totalität der Sphäre möglicher Prädikate von<br />
Bestimmungen der Dinge, aus dem Versuch eines ontologischen<br />
Vergleichs der Seinsbezirke untereinander motiviert sein. Man steht aber<br />
noch vor mehreren Widersprüchen darüber hinaus: Nur insofern im<br />
Beweisgrund Gottes die zu bestimmenden Dinge der Welt in ihrem<br />
Anderssein zu Gott noch einen anderen Bestimmungsgrund als den<br />
einzigen und ersten Realgrund beanspruchen, kann dort im Prinzip mittels<br />
Zusprechen und Absprechen sowohl der transzendentale Vergleich des<br />
wesentlichen Prädikats als Teilbegriff mit der informierten Intelligibilität,<br />
wie mit allen möglichen Prädikaten eines Dinges überhaupt stattfinden.<br />
Schließlich wird der transzendentale Vergleich gesteigert, bis nur mehr der<br />
Mangel gegenüber dem ens realissimum selbst geeignet erscheint, den<br />
transzendentalen Vergleich gedanklich zu vollenden. Damit findet eine<br />
Vermengung statt<br />
1. von »anderem« Bestimmungsgrund, der offenbar im Zusammenhang<br />
mit dem Bestimmungsgrund der Sphäre aller möglichen Prädikate steht<br />
(»transzendentale Materie«), zugleich nochmals »anders«, diesmal aber als<br />
logischer Vergleich der Prädikate der jeweiligen Dinges aneinander;<br />
2. dem wesentlichen Prädikat zwischen Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
(Ideal der reinen Vernunft) und Begriff vom einzelnen Wesen<br />
(transzendentales Ideal); und
— 1286 —<br />
3. dem einzigen Realgrund, wenn der transzendentale Vergleich in der<br />
Perspektive des Mangels am Sein des Dinges gegenüber dem ens<br />
realissimum ausgedrückt wird.<br />
Diese »Andersheit« des Logischen grenzt für sich betrachtet aber keinen<br />
eigenen ontologischen Bezirk der Wahrheit ab, worin die bisherigen<br />
Unterscheidungen als Merkmal eines größeren Ganzen wie in der<br />
Substanzmetaphysik oder Geschichtsmetaphysik ihre Einheit finden<br />
könnten. Weshalb der einzige Realgrund außer der Existenzsetzung selbst<br />
auch noch einen eigenen Beitrag zur qualitativen (inhaltlichen)<br />
Bestimmung der »anderen« Seinsweise des zu bestimmenden Dinges<br />
leisten können soll, liegt keineswegs auf der Hand. Die Negation bezieht<br />
sich auf einen Teil der Charakteristik der Sphäre des ens realissimum, die<br />
diesem erst als angehörig unterstellt werden muß, bevor dieses neue,<br />
selbst transzendentale Merkmal als Mangel an den (anderen) Dingen, der<br />
im transzendentalen Vergleich mit dem ens realissimum festgestellt<br />
werden kann, diesen auch als spezifizierbarer Mangel wieder<br />
zugeschrieben werden kann. Dem Akt eben dieser Zuschreibung liegt<br />
wieder die Intelligibilität des verständigen Wesens zu Grunde, wie es<br />
vorher zur Situierung der illustierenden Redeweise vom Mangel schon der<br />
Fall war: Diese Zuschreibung ist dann nicht mehr nur abstrakt und rein<br />
modallogisch auf bloße Existenz (Daßheit) bezogen, sondern drückt<br />
abstrakt selbst schon im Vollzug die Wesensverschiedenheit der reinen<br />
Intelligibilität in der Differenz von (Teil-) Symbol und Symbolisierten<br />
radikal aus. Im Rahmen der Erörterung des Intelligiblen und des<br />
Zeichenhaften des Bewußtseins ist damit nunmehr jede Art von<br />
unmittelbarer Anteilhabe zwischen Gegenstandswelt und Sprachwelt<br />
ausgeschlossen.<br />
Doch abermals ist das Ergebnis unbefriedigend und nur vorläufig zu<br />
verstehen, denn der Mangel, der sich abstrakt und doch verschieden von<br />
der bloßen Existenz, der in jedem Einzelfall der einzige Realgrund zu<br />
Grunde liegt, allenfalls am Ding nach dem transzendentalen Vergleich mit<br />
dem ens realissimum erkennen läßt, ist dann immer nur der selbe: nämlich<br />
der wesentliche und letztursprüngliche Unterschied von ens realissimum<br />
und der Sphäre aller möglichen Prädikate eines Dinges. Das erfüllt aber<br />
nicht die von Kant nur zwischendurch gegebene Beschreibung des<br />
Mangels, die nicht nur in der Illustration, sondern auch schon im<br />
Beweisgrund Gottes anheischig macht, daß gewissermaßen jede Art von<br />
Ding (jedes Ding?) seinen privaten Mangel gegenüber Gott habe, der sich
— 1287 —<br />
vom Mangel einer andern Art von Dingen (anderem Ding?) unterscheide.<br />
Nur so ließe sich auch das Kunststück vollführen, einerseits die zwei<br />
verschiedenen Arten der Vergleichung (logisch, transzendental) mit der<br />
rein logischen Entgegensetzung von ens realissimum und der Sphäre aller<br />
möglicher Prädikate zu unterscheiden, und andererseits beide<br />
Vergleichungsarten in der Vielheit noch auf den selben (!)<br />
transzendentalen Inhalt in der Dingwelt zu beziehen. Was aber ist in<br />
diesem Zusammenhang mit dem Ausdruck »transzendentaler Inhalt«<br />
jeweils bedeutet? Wie man gesehen hat, gibt es dazu mindestens drei<br />
Auffassungen: die erste bezieht den Inhalt der Prädikate aus der<br />
transzendentalen Materie (Allheit), die zweite aus dem wesentlichen<br />
Prädikat des Begriffes vom einzelnen Gegenstand (Allgemeinheit), und die<br />
dritte eben weiter oben als auf die Reflexionsform des Begriffs vom Ding<br />
selbst bezogener Inhalt als Beziehbarkeit eines Merkmals auf etwas. Die<br />
Erörterung des Anspruches des so weit behandelten Mangels, der nicht<br />
einem Vergleich der Dinge untereinander entspringt, sondern dem hier<br />
deshalb (also nicht aus logischen Gründen) transzendental genannten<br />
Vergleiches mit der Seinsweise des ens realissimum, fügt dieser Liste<br />
indirekt eine weitere Bedeutung hinzu. Die Besonderheit des<br />
transzendentalen Inhalts, wie er hier abermals anhand eines wesentlichen<br />
Prädikats oder Teilbegriffs vorgestellt wird, ist aber seine doppelte<br />
Bestimmbarkeit: einmal als vom Anderssein der Dinge ausgehend<br />
bestimmbar, einmal vom Mangel der Dinge und eines jeden Dinges<br />
gegenüber dem ens realissimum, also bereits von der absoluten Position<br />
ausgehend, bestimmbar. Damit wird der selbe Inhalt zwei<br />
Bestimmungsweisen unterworfen.<br />
c) Die transzendentale Analogie zwischen Einheit des Bewußtseins in<br />
der Untersuchung des logischen Ursprungs der Begriffe und der<br />
zerbrochenen Einheit der Seinsweisen im Obersatz des Anselmschen<br />
Gottesbeweises<br />
Dies entspricht in einer formalen, äußerlichen Analogie der Reflexion über<br />
die logischen Regeln, welche die Spontaneität zum Verstand bestimmen.<br />
K. W. Zeidler analysiert in seiner Arbeit »Grundriss der transzendentalen<br />
Logik« 37 den logischen Ursprung der Begriffe. Auch hier wird von der<br />
Einheit der Apperzeption und deren Erklärung als »Einheit der Handlung,<br />
37 Kurt Walter Zeidler, Grundriß der transzendentalen Logik., Traude Junghans Verlag<br />
Cuxhaven & Dartford 2 1997 als Bd. 3 der Reihe »Transzendentalphilosophie heute«.
— 1288 —<br />
verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen« [...]<br />
also als Handlung der »Spontaneität des Denkens« (B 93/A 68)<br />
ausgegangen, die Prinzipien dieser Subsumtion und Koordination werden<br />
aber nicht selbst in der Spontaneität des Verstandes, was Intelligibilität<br />
bedeutet, gesucht. Zeidler: »So hat Kant doch an anderer Stelle, und zwar<br />
im Anschluß an die Abstraktionstheorie der Wolff-Schule, versucht diese<br />
„Spontaneität des Denkens“ (des Verstandes) zu analysieren, indem er<br />
dem „Logischen Ursprung der Begriffe“ durch Komparation, Reflexion und<br />
Abstraktion nachspürt« (S. 126). Mit den Wendungen »Logischer Ursprung<br />
der Begriffe« (Refl. 2876) oder »Logische actus im Begriffe« (Refl. 2854) läßt<br />
sich belegen, daß meine Entscheidungen in den Vorbemerkungen im<br />
ersten Abschnitt »Grund und Ganzes«, (a) eine Vorstellung zu einer<br />
anderen hinzusetzen (§ 16, Text) sei streng zu unterscheiden davon,<br />
Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen (§16, Fußnote),<br />
und (b) das Prinzip der Subsumtion (Leibniz: Enthaltensein) habe selbst<br />
bei Kant keine eigentliche erkenntnispsychologische (Zeidler) oder<br />
transzendentalpsychologische (Cernoch) Grundlegung, vielmehr eine<br />
restringierte Verstandesmetaphysik in § 15 und § 12 zur Grundlage, seine<br />
Berechtigung gehabt hat. Die Verstandeshandlung, als solche betrachtet,<br />
besitzt zweifellos erkenntnispsychologische oder<br />
transzendentalpsychologische Aspekte, doch die Regel, wonach gehandelt<br />
wird, entspringt nicht selbst ihrem Inhalt nach dem Ich als Urbild aller<br />
Regeln (indem, um als stehende und bleibende Vorstellung im Fluß der<br />
Erscheinungen und sich deshalb zugleich als numerische Einheit zu<br />
begreifen, die Vorstellungen mit dem »Ich denke« begleitet werden<br />
müssen). Die logische Regel der Subsumtion ist aber auch nicht einfach ein<br />
Produkt der Abstraktionstheorie, vielmehr hat sie in § 12 die »qualitative<br />
Einheit des Begriffs vom Objekt« als depotenzierte Interpretation des<br />
scholastischen (thomistischen) transzendentalen Ideals zum Grunde, und<br />
in transzendentallogischer Hinsicht kritisch als Vernunftidee betrachtet,<br />
liegt der logischen Regel als Urbild das Ideal der reinen Vernunft als der<br />
Begriff vom einzelnen Gegenstand zum Grunde.<br />
Zeidler kommt nach einer Überlegung zum Außersprachlichen an der<br />
diskursiven Form des Begriffes und der Schwierigkeit der Vermittlung des<br />
Außersprachlichen an die konstruktivistischen und konventionalistischen<br />
Elemente einer jeden diskursiven Form zum entscheidenden Punkt:<br />
»Näherhin gefragt: was ist unter der ersten dieser Handlungen, der<br />
Komparation, zu verstehen? Die Jäsche-Logik nennt sie „die Vergleichung
— 1289 —<br />
der Vorstellungen untereinander im Verhältnisse zur Einheit des<br />
Bewußtseins“, Reflexion 2854 „die Vorstellung einer nota als communis“<br />
und Reflexion 2876 sieht den logischen Ursprung der Begriffe durch<br />
Komparation in deren“Vergleichung unter einander“ bzw. „wie sie sich zu<br />
einander, in einem Bewußtsein verhalten“. Kant bringt damit zum<br />
Ausdruck, daß die Vergleichung (comparatio) eine Vergleichsbasis<br />
voraussetzt, wie denn auch die „Vorstellung einer nota communis“ nach<br />
einem Einheitsgrund der notae singulares verlangt. Folglich ist die<br />
Komparation in transzendentaler Bedeutung nichts anderes als die<br />
notwendige Beziehung der notae auf die numerische Einheit des<br />
Bewußtseins.« (S. 127) — Ich halte hier inne, weil ich beeinspruchen<br />
möchte, die ursprünglich-synthetische Einheit der transzendentalen<br />
Apperzeption eventuell auf die numerische Einheit der transzendentalen<br />
Apperzeption zu reduzieren, die aus der rein intellektuellen Vorstellung<br />
eines stehenden und bleibenden Selbst im Fluß der Erscheinungen auf die<br />
numerische Einheit des Bewußtseins schließt, oder die ursprünglichsynthetische<br />
Einheit als spontanen Actus des Denkens aus der<br />
notwendigen Beziehung der notae auf die Einheit des Bewußtseins<br />
überhaupt auszuschließen beginnt. Außerdem widerspricht sich Zeidler<br />
mit der Behauptung, daß die Komparation schließlich nichts anderes als<br />
die Beziehung auf die numerische Einheit sei, schon darin, als er doch<br />
gerade zuvor den Vergleich aneinander und untereinander als die<br />
Definition des logischen Vergleiches (comparatio) herausgestellt hat. Die<br />
notwendige Beziehung auf die Einheit des Bewußtsein ist transzendental<br />
deshalb, weil eine Voraussetzung für diesen Vergleich, aber nicht selbst<br />
der Vergleich, auch nicht als transzendentaler Vergleich; das wäre ein<br />
absolutes Mißverständnis. — Zeidler verweist im unmittelbaren Anschluß<br />
auf einen von Kant vorgesehenen zweiten Schritt: »Sie in dieser Beziehung<br />
zu erhalten bedarf es aber zweitens der „reflexion (mit dem selben<br />
Bewußtseyn): wie verschiedene in einem Bewußtseyn begriffen seyn<br />
können“ (Refl. 2876), d. h. die verschiedenen Vorstellungen (notae) müssen<br />
in die synthetische Einheit des Bewußtseins aufgenommen, mithin als<br />
verschieden aneinander reflektiert werden, woraus „3. durch abstraction:<br />
Da man das wegläßt, worin sie sich unterscheiden“ (ibid.) der conceptus<br />
communis als ihre begriffene Aneinandervermitteltheit entsteht.« (S. 127)<br />
Das ist, um mit Kant ab der Kritik zu sprechen, eine empirische<br />
Untersuchung des logischen Ursprungs der Begriffe, die angibt, woher wir<br />
unsere logischen Begriffe herhaben, oder, wie wir ihrer habhaft werden
— 1290 —<br />
können. Daß Begriffe Handlungen des Verstandes zur Voraussetzung<br />
haben, und nicht selbst als selbstständige Entitäten anzusehen sind, ist<br />
kein Grund, die Einheit des numerischen Bewußtseins oder die<br />
ursprünglich-synthetische Einheit allein transzendentalpsychologisch<br />
auszulegen, sondern die Darlegung der Bedeutung der rationalen<br />
Psychologie in § 16 der Deduktion hat die Grundregel des Hinzusetzens<br />
einer Vorstellung zu einer anderen als transzendentalpsychologisches<br />
Urbild des Verbindens und Verknüpfens, und davon ausgehend abstraktiv<br />
auch gleich des Ersetzens, vorzustellen. Derart soll aus der rationalen und<br />
transzendentalen Psychologie, und deren, zunächst nur intellektuell<br />
aufgefaßten Spontaneität Logik und Verstand werden. Dies kann als<br />
transzendentale Abstraktionslehre im Rahmen einer ersten Vorführung<br />
des synthetischen Momentes der Idee skizziert werden, wird aber<br />
Kriterien voraussetzen, die nicht allein dem Verhältnis von rationaler<br />
Psychologie des Verstandes und rationaler Physiologie des inneren Sinnes<br />
im transzendentalen Subjekt (deshalb transzendentale Psychologie)<br />
entstammen könnten. Diese Darstellung hat durchaus den Vorzug, mit den<br />
notae communis sowohl das selbe Bewußtsein, wie die mögliche<br />
Gemeinschaft im diskursiven Gebrauch in weiterer, durch Abstraktion<br />
erlaubten, metaphorischer Verwendung zu bedeuten, weil die Selbigkeit<br />
des Bewußtseins in genau bestimmter Hinsicht nach Regeln dargetan<br />
werden kann, und dann im Anschluß nicht notwendigerweise auf die<br />
transzendentale Psychologie rekkurrieren muß.<br />
Daß die Selbigkeit, oder auch logische Identität des Bewußtseins begriffen<br />
werden kann, bedarf aber immer noch des Nexus von Intelligibilität und<br />
Leiblichkeit. M. a. W., auch diese, letztlich spekulative,<br />
Erweiterungsmöglichkeit ist in einem existierenden Individuum zu<br />
fundieren: »Sie in dieser Beziehung zu erhalten bedarf es aber zweitens der<br />
„reflexion (mit dem selben Bewußtseyn): wie verschiedene in einem<br />
Bewußtseyn begriffen seyn können“ (Refl. 2876)«. Mit dem selben<br />
Bewußtsein, mit dem im ersten Schritt die numerische Einheit des<br />
Bewußtseins hergestellt worden ist, wird im zweiten Schritt nicht eine<br />
Vorstellung zu einer anderen hinzugesetzt, wie in § 16, sondern es wird hier<br />
gefragt, wie verschiedene Vorstellungen oder notae in einem Bewußtsein<br />
sein können. Die Quelle dieser Verschiedenheit ist in § 16 zweifellos das im<br />
(möglichen) Bewußtsein gegebene Mannigfaltige; der gesuchte<br />
Einheitsgrund ist jedoch zunächst nur in der qua Bewußtsein<br />
mitgebrachten Einheit zu erkennen, die durch die nämliche Handlung des
— 1291 —<br />
Hinzusetzens erst hergestellt worden ist. Nun steht die qualifiziertere<br />
Forderung an, das als Verschiedenes bereits Bekannte als Einheit zu<br />
denken. Diese höher qualifizierende Definition von transzendentaler<br />
Apperzeption könnte auf auf Überlegungen Leibnizens im 30. Brief an Des<br />
Bosses zurückgehen.◊ Da nun im Umkreis der behandelten Reflexionen<br />
der logische Ursprung der Begriffe gesucht wird, ist davon auszugehen,<br />
daß hier ebenso weitere Voraussetzungen außerhalb der rein<br />
transzendentalpsychologischen Überlegung von numerischer Einheit und<br />
logischer Identität des selben Bewußtseins zu finden und zu untersuchen<br />
sind, wie es für die Kategorien sinnlicher Mannigfaltigkeit oder der reinen<br />
Algebra und Mathematik der Fall ist.<br />
Ich halte hier die Logik für ein Organon des reinen Verstandes, das nicht<br />
aus der rationalen Psychologie abgeleitet wird, sondern daß die Idee einer<br />
rationalen Psychologie mitsamt der Intellektualität ihrer Spontaneität erst<br />
mit dem Verstand analysierbar wird; dieser aber qualifiziert sich zu einem<br />
solchen durch zweierlei: erstens durch die doppelte Einheit der<br />
transzendentalen Apperzeption, und zweitens mit der Bestimmbarkeit der<br />
intellektuellen Spontaneität durch logische Regeln. Deren Gebrauch kann<br />
im Sinne von Anwendungsbedingungen in einigen Fällen<br />
transzendentalpsychologisch in transzendentaler Analyse gerechtfertigt<br />
werden, aber ebenso wichtig sind weitere Schritte, welche das Umfeld der<br />
psychologischen Idee verlassen: Die Untersuchungen zur kosmologischen<br />
und theologischen Idee können keinesfalls als aus der psychologischen<br />
Idee oder aus der numerischen (analytischen) oder synthetischursprünglichen<br />
Einheit der transzendentalen Apperzeption analytisch<br />
abgeleitet betrachtet werden.<br />
Daß nun gerade an einer Stelle der Erörterung, wo im Zusammenhang mit<br />
dem so genannten »transzendentalen Mangel« die von Anselm behauptete<br />
Einheit des die reine Intelligibilität und Wirkliches im Sinne der Dinge der<br />
Welt umfassenden Seinsbegriff zerbrochen ist (was bei Kant unmittelbar<br />
mit der dritten und vierten Antinomie der kosmologischen Idee zu tun<br />
hat), und in der Frage der Bestimmbarkeit der Seinsweise der Dinge der<br />
Welt, über die selbst fraglich gewordene Abhängigkeit der Dinge der Welt<br />
von der von der Seinsweise der Dinge der Welt verschiedenen Seinsweise<br />
des In-Existenz-versetzenden Gottes hinweg, noch zu einer doppelten<br />
Bestimmung des transzendentalen Inhalts gelangt, 38 der sich zuletzt in der<br />
38 Eben als transzendentaler Mangel aus der absoluten Position und als<br />
transzendentaler und logischer Vergleich aus der Position der Dinge der Welt
— 1292 —<br />
Suche nach seinem Ursprung doch wieder auf die Dinge der Welt<br />
zurückwendet, macht den zweiten Schritt aus der Reflexion 2876 so<br />
bemerkenswert, wenn man ihn mitsamt seiner in sich Verschiedenheit<br />
nicht auf die Einheit des Bewußtseins hin interpretiert, sondern auf die<br />
fraglich bleibende Auflösung der dritten Antinomie, oder gleich auf den<br />
Obersatz des Anselmschen Gottesbeweises. Die Bestimmungen der<br />
Vorstellungen oder notae geschehen sowohl in den Überlegungen zum<br />
logischen Ursprung der Begriffe wie auch hier in der ontotheologischen<br />
Spekulation durch einen Vergleich (comparatio) sowohl aneinander bzw.<br />
untereinander wie auch in Beziehung auf ein als unbedingt<br />
vorausgesetztes Drittes, sei dieses nun die Einheit des Bewußtseins oder<br />
die fraglich gewordene Einheit der Seinsweisen, das offenbar mittels der<br />
Fähigkeit der Bestimmung bzw. der Eigenschaft, bestimmbar zu sein, die<br />
sich aufgetane Kluft wieder überbrücken soll. Dies wäre allerdings<br />
einerseits als Idee einer Ursache oder Kraft, andererseits als mit der<br />
zeichenhaften Verfaßtheit unseres Bewußtseins verbundene kognitive<br />
Fähigkeit des selbst von Kant als intelligibles Subjekt des reinen<br />
Verstandeswesens der rationalen Psychologie vorgestellten Wesens erst<br />
weiter auszuwickeln.<br />
Nunmehr geht es an der Grenze der ontotheologischen Spekulation um die<br />
Bestimmung des Mangels jeden Dinges der individuellen Seinsweise nach<br />
gegenüber der Seinsweise des ens realissimum. Nach den eben<br />
behandelten Voraussetzungen des Zeichengebrauchs dürfte die<br />
Vorstellung von einer reinen und von der Körperwelt getrennten<br />
Intelligibilität als methodisches Vorbild zur Erörterung dieser Frage nicht<br />
in Frage kommen. Offenbar kann die reine Intelligibilität auch nicht die<br />
Seinsweise des ens realissimum ausmachen, selbst wenn man Kants<br />
strenge Auffassung vom ens realissimum voraussetzt, das als allerhöchstes<br />
Wesen eben nicht alle mögliche Realität umfaßt. Es wird von Kants<br />
Darstellung des transzendentalen Ideals als oberste und vollständige<br />
materiale Bedingung jedoch gerade nicht verhindert, in der Frage, ob unter<br />
ens realissimum doch nichts anderes als ein Teilbegriff des omnitudo<br />
realitatis zu verstehen sein sollte, frei von jedem Zweifel sein zu können.<br />
Dieser im Begriff vom einzelnen Wesen erzeugten obersten Idee liegt nach<br />
Kant auch selbst das transzendentales Subtratum zugrunde, das als All der<br />
Realität (omnitudo realitatis) die transzendentale Materie vorstellt, woraus<br />
die Prädikate ihren Inhalt nehmen. Die Informiertheit des ens realissimum<br />
steht allerdings zwischen der unvollkommenen Indifferenz des
— 1293 —<br />
Unvordenklichen und der vollständigen materialen Bedingung, die, um<br />
vollständig zu sein, wohl sowohl Allheit (Sphäre aller möglichen Prädikate<br />
eines Dinges überhaupt) wie Allgemeinheit (wesentliches Prädikat, das<br />
nicht aus anderen Prädikaten abgeleitet sein kann), also qualitative Einheit<br />
des Begriffes des Objekts (§ 12) und Teilbegriff, der den ganzen<br />
Gegenstand vorstellen läßt — zumindest gemäß der doppelten Struktur<br />
der Darstellung des transzendentalen Ideals durch Kant — vereinbaren<br />
können muß. Die Quellen der inhaltlichen Bestimmung sind verschieden:<br />
Der logische Vergleich der Prädikate, die von der transzendentalen<br />
Materie genommen sind, geschieht zuerst unter den Dingen<br />
untereinander, erst das wesentliche Prädikat erlaubt den allgemeinen<br />
Begriff von einem einzelnen Gegenstand und den transzendentalen<br />
Vergleich. Soll unter dem transzendentalen Vergleich des Dinges nun nach<br />
wie vor nur der Vergleich mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikate<br />
eines Dinges überhaupt als univok mit dem All der Realität (omnitudo<br />
realitatis), also der Vergleich der Prädikate des besonderen Dinges mit der<br />
Sphäre aller möglichen Prädikate eines Dinges überhaupt (B 601/A 573)<br />
verstanden werden, oder ist die Umwandlung zum Inbegriff doch schon<br />
bedeutsam für diejenige Auffassung, unter dem transzendentalen<br />
Vergleich wäre eben der Wesensbegriff (Allgemeinbegriff) eines Dinges<br />
mit dem ens realissimum als Teilbegriff des omnitudo realitatis zu<br />
vergleichen, was im Schutz der Unklarheit des Überganges von omnitudo<br />
realitatis zum Inbegriff aller möglichen Prädikate bereits vorbereitet<br />
worden wäre?<br />
Weiters: Was also bedeutet die Informiertheit des ens realissimum in<br />
strenger Fassung als allerhöchstes Wesen näher, umfaßt sie nur die<br />
allgemeinen und konkreten Wesenheiten der Dinge, oder auch die<br />
Prädikate, die aus dem Vergleich der Dinge untereinander oder aus der<br />
transzendentalen Materie als All der Realität (omnitudo realitatis)<br />
genommen werden? Und ist damit die bodenlose Negativität des<br />
transzendentalen Mangels der Dinge gegenüber dem ens realissimum in<br />
der strengen Fassung als allerhöchstes Wesen kraft dessen auch nur<br />
erdachten Fähigkeit, die Dinge zur Existenz zu bestimmen, auch schon als<br />
erledigt zu betrachten, oder beginnt da erst die Erörterung des<br />
transzendentalen Mangels als ein davon verschiedenes Problem, wenn<br />
man die grundlegende Verschiedenheit der Naturen des ens realissimum<br />
als ens originarium, entium, summum und die Natur der Welt der Dinge<br />
(res extensa) bedenkt, die nicht geeignet zu sein scheint, durch eine
— 1294 —<br />
logische Entgegensetzung ausgedrückt zu werden (Anselms Obersatz,<br />
Logik von Port Royal: Gott schuf die sichtbare und unsichtbare Welt)?<br />
Schließlich bleibt noch die Frage nach der Aufheblichkeit der res als<br />
solcher und als Konzept gemäß des »idea est conceptus archetypus«, und<br />
inwieweit die transzendentale Negation, wird sie einmal an das »idea est<br />
conceptus archetypus« gebunden, letztendes nicht nur die Schöpfung,<br />
sondern auch den Schöpfer zumindest als Schöpfer mit aufheben würde.<br />
d) Die Reichweite der transzendentalen Negation und des Conceptus,<br />
nochmals der transzendentale Mangel aller Dinge bei Cusanus und Kant<br />
Auch zieht man die Aussage Leibniz aus der Monadologie heran: Gott<br />
allein ist von jedem Körper frei (§ 72, vgl. auch Theozidee, §§ 90, 124), so<br />
erlaubt das keineswegs schon allein, von einem ens rationis sine<br />
fundamentum in re zu sprechen, wie Brentano für die Seinsweise des<br />
Vorstellens selbst der Deutlichkeit der Unterscheidungen willen in<br />
Anspruch genommen hat, denn Descartes bezeichnet auch das selbst<br />
körperlose Erkenntnisvermögen als res cogitans. So ist zwar die Sphäre der<br />
Dinge dem Umfang nach gegenüber dem »idea est conceptus archetypus«<br />
ganz wie gegenüber dem ens realissimus bestimmt, doch fallen die<br />
Bedeutungsumfänge des conceptus archetypus und ens realissimum auch<br />
dann nicht gleichmäßig in eins zusammen, wenn man annimmt, daß mit<br />
dem conceptus archetypus auch eine Eigenschaft des ens realissimum als<br />
ens originarium beschrieben wäre, denn das conceptus archetypus wird<br />
offenbar auch auf intelligible und leibliche Wesen zur Anwendung<br />
gebracht, was ein Unterschied im Umfang der Distribution des Begriffes<br />
auf Dinge ausmacht.<br />
Dabei wird von der resolutiven Informiertheit aus der pyramidalen<br />
Entwickelung des conceptus archetypus als verzweigte Hierarchie sich<br />
weiter und weiter konkretisierender Zwecke ausgegangen, sodaß eine<br />
einfache Ausschließung des Bestimmungskreises der Möglichkeiten eines<br />
besonderen Dinges (ob deshalb schon individuell ist nicht entschieden) aus<br />
dem Bestimmungskreis der Möglichkeiten des Konzepts des Konzept als<br />
Kennzeichen der obersten Idee zur Unterscheidung zureichen soll, damit<br />
die allgemeine Besonderheit des bestimmten Dinges in der Hierarchie der<br />
Entwicklung des conceptus archetypus ihre Stelle erhält.<br />
Das Wesen selbst mag aus der Indifferenz des Unvordenklichen stammen<br />
und nicht selbst vollständig der Willkür Gottes unterliegen, es wird auch
— 1295 —<br />
bei Leibniz erst durch den göttlichen Verstand klar und distinkt gedacht.<br />
Doch wird auch mit der wesenslogischen Darstellung des<br />
transzendentalen Vergleichs der wesentliche Unterschied zwischen Gott<br />
und der Welt der Dinge nicht ausgedrückt, und so konnte auch der bereits<br />
im Übergang zur Vermögenslehre ins Auge gefaßte transzendentale<br />
Mangel noch nicht näher behandelt werden. Als Bestimmung des<br />
Unterschiedes bleibt so der Versuch, diesen als den von reiner<br />
Intelligibilität gegenüber der Welt der Dinge vorzustellen. Genau diese<br />
reine Intelligibilität aber wird bekanntlich zum Problem: Kant bestimmt<br />
die oberste Idee als eine mit der vollständigen materialen Bestimmung.<br />
Wobei eben die Frage offen bleibt, worauf Kant hier den Schwerpunkt legt,<br />
und inwieweit mit der materialen Bestimmung auch eine eindeutige<br />
regionale Bestimmung von Realität und Wirklichkeit gefunden werden<br />
kann, die gegenüber der Seinsweise Gottes unabhängig bleibt. Insofern<br />
wäre im Gegenzug die schon aus dem Beweisgrund Gottes bekannte<br />
Möglichkeit zur Weiterbestimmung des in der transzendentalen Negation<br />
und im Untersatz des transzendentalen Syllogismus wieder erkenntlich<br />
gewordenen transzendentalen Mangels von Belang.<br />
Die ausgearbeitete Figur des Mangels als Freiraum in der sich<br />
schließenden Vernunftspekulation für den Überstieg vom quantitativen<br />
Unendlichkeitsproblem zu einem übervernünftigen<br />
Unendlichkeitsproblem findet sich als erstes bei Cusanus. Gemäß des<br />
Prinzips der Koinzidenz der Gegensätze wäre auch der Gegensatz von der<br />
Seinsweise des ens realissimum und der Seinsweise der (anderen) Dinge<br />
noch einer Weiterbehandlung zugänglich, die im Zuge der Suche nach<br />
Wegen der fortgehenden Totalisierung nach oben und nach unten zu<br />
einem System von Konkordanzen werden könnte, und wegen der Idee<br />
dieser Möglichkeit in diesem forcierten Spekulationsgang der<br />
fortlaufenden Totalisierung damit auch schon geworden ist und im Reich<br />
reiner Intelligibilität (reiner intensionaler dialektischer Spekulation) immer<br />
schon gewesen ist.<br />
Kant mutet zuerst, obgleich wissentlich den dialektischen Gebrauch der<br />
theologischen Idee betreibend, mit dem Anspruch der Bestimmbarkeit<br />
eines besonderen Mangels einen jeden Dinges (vielleicht sogar eines jeden<br />
Individuums) gegenüber dem ens realissimum diesen und uns mehr zu als<br />
Cusanus, nur um in der Konsquenz es nur zu einer universalen<br />
transzendentalen Negation nach dem Vorbild der allgemeinen Logik zu<br />
bringen. Doch aber ist auch mit dieser regional allgemeinen Auslegung
— 1296 —<br />
gemäß der res extensa allein gar nicht getan, da damit noch gar nicht<br />
entschieden ist, ob diese Zumutung deshalb selbst mit aufgehoben wird,<br />
oder ob der Sachverhalt nicht eher so liegt, daß damit über die jeweilige<br />
Besonderheit des Mangels nicht mehr gesagt worden ist, als daß eben seine<br />
besondere Bestimmung als besondere Bestimmung der transzendentalen<br />
Negation nicht a priori möglich ist, aber nicht, daß solches schlechthin<br />
unmöglich oder der Anspruch als solcher als unerheblich anzusehen wäre.<br />
Damit hat sich der Schwerpunkt der Untersuchung verschoben: Bislang<br />
wurde versucht, eine qualitative und inhaltliche Bestimmung des besagten<br />
Mangels zu erreichen, der über die abstrakte Unterscheidung von<br />
quantitativer Unendlichkeit und Unendlichkeit der qualitativen, aber<br />
selbst immer weiter abstrahierenden Totalität hinausgeht, die sich aber<br />
letztlich rein modal in der Auffassung, Gott sei für jedes Ding der einzige<br />
Realgrund erschöpft. Nunmehr geht es nicht mehr um die Rechtfertigung<br />
dieses Anspruches selbst, sondern wie im ästhetischen Urteil, um die<br />
Rechtfertigung, diesen Anspruch überhaupt erheben zu können, auch<br />
wenn keine Aussicht darauf besteht, eine allgemeine Rechtfertigung des<br />
mit dem Anspruch verbundenen Inhalts erreichen zu können. Überhaupt<br />
ist das ästhetische Urteil ähnlich wie die Vermögenslehre als Illustration<br />
der fraglichen Verhältnisse geeignet, die bei den Erörterungen des nicht<br />
mehr als transzendentalen Inhalt der Dinge der Welt bestimmbaren<br />
transzendentalen Mangels auftreten, indem dem als schön beurteilten<br />
Objekt etwas zugeschrieben wird, was es aus sich selbst nicht ist, sondern<br />
letztlich eine Eigenschaft ausdrückt, die sich unmittelbar nur auf innere<br />
Verhältnisse der Seelen-, näher der Erkenntnisvermögen beziehen läßt,<br />
wenn auch mathematische Verhältnisse in der Erscheinung des Objekts die<br />
äußere Bedingung dafür hergibt. Die von der Position des ens realissimum<br />
ausgehenden Zuschreibung des transzendentalen Mangels auf jedes Ding<br />
bietet hier eine formale Analogie dieser distributiven Schwierigkeit, auf die<br />
auch zurückgekommen werden muß, geht es um den Ausdruck innerer<br />
Gestimmtheit und dessen Funktion zur Identifikation dieser Gestimmtheit<br />
(M. Benedikt, Phil. Emp. II: Das Ideal des Schönen ist nur im Verhältnis<br />
zur Vernunft als oberes Begehrungsvermögen zu denken möglich).<br />
Cusanus hat an der nämlichen Grenze der Erörterung die uns zugängliche<br />
Seite der »resolutiven« Methode, also der Rückgang von einer<br />
extenstionalen Totalität auf die im Rückgang sich selbst informierenden<br />
Idee des Können-selbst als intensionale Totalität darin aufgehen lassen,<br />
daß es nicht allein unser Unvermögen ist, den transzendentalen Mangel
— 1297 —<br />
näher zu bestimmen, sondern es eine Eigenschaft des sich Zeigenden ist,<br />
sich nicht als sich selbst, sondern nur vermittels des anderen auf sich selbst<br />
beziehen zu können. Darin wird gewissermaßen auch ein Aspekt der<br />
Abhängigkeit des Intelligiblen von Leiblichen aufgezeigt, wie es auch der<br />
Darstellung der inneren Gestimmtheit durch den immer äußerlichen<br />
Ausdruck eigen ist. Damit wird dem zum archetypus intellectus<br />
weiterbestimmten ens realissimum eine Strebung zum Ausdruck<br />
unterstellt, der der gattungsmäßig unterstellten Strebung, den<br />
transzendentalen individuellen Mangel zuerst zu bestimmen und dann<br />
das Mindeste zu versuchen, um ihn aufzuheben, glücklich gegenübersteht.<br />
Das entspricht dem Übergang zur Vermögenslehre in der Illustration der<br />
transzendentalen Negation Kants im zweiten Abschnitt über das Ideal der<br />
reinen Vernunft (Vom transzendentalen Ideale). Kant läßt offenbar in<br />
dieser Illustration der der transzendentalen Negation vorausliegenden<br />
Vorstellung des besagten Mangels mehr zu, als dies Cusanus anhand<br />
seiner Auslegung der Lichtmetapher vorzusehen scheint. Bei Cusanus<br />
kann letztlich das göttliche Wesen gar nicht selbst in Erscheinung treten.<br />
Das kann zwar als Absage an die Metapher der Anschaulichkeit<br />
verstanden werden, doch hat Cusanus das nämliche mit der Vergeblichkeit<br />
der Darstellung der Person eines Autors durch sein Buch versucht<br />
darzustellen. Schließlich geht es auch hier um das Vernehmen im<br />
Schweigen, womit der transzendentale Mangel womöglich sogar als<br />
individuell, bei aller Negativität in der Perspektive des äußeren<br />
Darstellens, immerhin bedeutet werden könnte.<br />
Kant hält sich demnach hier nur im Rahmen der Metaphorik des<br />
Anschaulichen und deren Distributionsweisen auf, weshalb eben die<br />
Darstellung des transzendentalen Mangels im Zusammenhang mit der<br />
transzendentalen Negation auch nur vorläufig bleiben muß. Die<br />
Darstellung des transzendentalen Ideals aber besitzt keinerlei Anzeichen,<br />
die erlauben könnten, anhand der allgemeinen Zeichenhaftigkeit des<br />
Bewußtseins zur Metaphorik des Vernehmens vorzustoßen, worin noch<br />
eine Möglichkeit vermutet werden kann, den Versprechungen aus der<br />
illustrativen Vermögenslehre ein Fundament (cum vel sine fundamentum<br />
in re) zu suchen, auf welchem Wege der transzendentale Mangel sein<br />
aptitudo äußern und sich so unversehens mitteilen könne ohne selbst als<br />
sein Gegenteil, was dann schon wieder nur seine Positivität für uns wäre,<br />
erscheinen zu müssen.
— 1298 —<br />
d) Die Bestimmung des transzendentalen Ideals durch die<br />
Hereindrehung des Distributionsproblems des transzendentalen<br />
Mangels in den transzendentalen Subjektivismus (Das Problem der<br />
Umstülpbarkeit des Arguments Kantens). Das nicht-paralogistische<br />
Zuschreibungsproblem höherstufiger Prädikate im transzendentalen<br />
Subjektivismus. Die Unbestimmtheit der Herausdrehung des<br />
transzendentalen Mangels aus dem transzendentalen Subjektivismus<br />
(Das Problem der Umstülpbarkeit des Arguments Anselms)<br />
Obgleich die Untersuchung der transzendentalen Negation im zweiten<br />
Abschnitt des dritten Hauptstückes »Vom Ideal der reinen Vernunft«<br />
(Vom transzendentalen Ideal) im transzendentalen Syllogismus zu einer<br />
Entwicklung geführt hat, die unabhängig von der radikalen Konsequenz<br />
der transzendentalen Negation in die Schwierigkeiten des Obersatzes des<br />
Anselmschen Gottesbeweises hinsichtlich der Uneinheitlichkeit des<br />
Seinsbegriffs geraten ist, bleibt die anschließende Darstellung des<br />
transzendentalen Ideals davon inhaltlich und vor allem argumentativ<br />
unberührt. Offenbar soll im transzendentalen Ideal noch nicht der<br />
transzendentale Mangel gegenüber dem ens realissimum, sondern der<br />
Mangel bloß prädikativer Durchbestimmtheit (Allheit) gegenüber der<br />
Definition aus wesentlichen Prädikaten (Allgemeinheit) thematisiert<br />
werden, was aber nur zu einer unklaren Fassung des transzendentalen<br />
Vergleichs von Umfängen von Wesensbegriffen (Vergleich des Ding selbst<br />
mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikate) gelangt ist.<br />
Die Zuschreibung der Totalität ist nur entlang der Interpretation der<br />
Affinität möglich, die Merkmale als Prädikate und Prädikate als<br />
Vorstellungen auffaßt, sodaß ein Prädikat als Merkmal einem Ding, als<br />
Vorstellung aber dem Vorstellenden zuzuschreiben ist. Ich behaupte also,<br />
Totalität aller möglichen Prädikate ist nur im zweiten Falle zumindest<br />
denkmöglich. Insofern kann vom zweiten Prinzip der durchgängigen<br />
Bestimmung eines Begriffes durch eine Idee (Allgemeinheit) ausgehend<br />
das Substrat des transzendentalen Ideals kein Ding oder bloß die<br />
transzendentale Materie als omnitudo realitatis mehr sein, sondern muß<br />
zumindest perzepierende Monade; und um diese Totalität als Idee zu<br />
fassen (Allgemeinheit), apperzepierende Monade sein. Damit ist die<br />
Vorstellung des informierten archetypus intellectualis idealiter auch schon<br />
wieder als erfüllt zu betrachten, aber gerade nicht die des ens realissimum,<br />
was doch zuvor dem Problem des besonderen (womöglich auch<br />
individuellen) transzendentalen Mangels zugrunde gelegt worden ist. Die
— 1299 —<br />
genaue Untersuchung der transzendentalen Negation ergibt also keine<br />
direkten Hinweise für den Aufbau der Argumentation des<br />
transzendentalen Ideals, bleibt jedoch für die Diskussion möglicher<br />
logischer Formen im Rahmen des transzendentalen Untersatzes in<br />
Stellung. Die Brauchbarkeit und Relevanz der Auffassung von der<br />
Kantschen Darstellung des transzendentalen Ideals als Idee von einer<br />
apperzepierenden Monade läßt sich auch damit argumentieren, daß Kant<br />
dortselbst zwar zuerst vom Begriff von einem entis realissimi<br />
(B 604/A 576) spricht; die Vereinzelung aber erst mit der Bestimmung des<br />
Begriffes des Wesens durch den Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
ausdrücklich wird.<br />
Es dürfte sich um eine Ineinanderspiegelung einer gewissen Analogie<br />
zwischen menschlichem und göttlichem Verstand handeln, auf die auch<br />
Hegel mehrfach anspielt. Vergleiche auch die Aussage über das<br />
transzendentalen Ideal: »Das transzendentale Ideal scheint nur am<br />
weitesten von der objektiven Realität entfernt zu sein« mit der christlichen<br />
Lehre, daß Gott meinem Selbst näher steht (unendlich nah) als mein Ich<br />
selbst: In dieser Umstülpung der Spekulationsrichtung würde das<br />
transzendentale Ideal die semantische Funktion Gottes übernehmen. Doch<br />
ist das transzendentale Ideal der »Begriff eines entis realissimi« und der<br />
»Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen<br />
entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was zum Sein<br />
schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird.« (B 604/A 576)<br />
Ich verstehe das hier nun so, daß das »Sein schlechthin« der »einzige<br />
Realgrund«, also die ursprüngliche göttliche Schöpferkraft (Cusanus:<br />
possest est, Können-sein) in jedem einzelnen Ding ist. Dann aber verläßt<br />
Kant den Gang der Argumentation, wie man ihn aus dem Beweisgrund<br />
Gottes kennen gelernt hat: »Also ist es ein ein transzendentales Ideal,<br />
welches der durchgängigen Bestimmung, die notwendig bei allem, was<br />
existiert, angetroffen wird, zum Grunde liegt, und die oberste und<br />
vollständige materiale Bedingung seiner Möglichkeit ausmacht, auf<br />
welche[r] alles Denken der Gegenstand überhaupt ihrem Inhalte nach<br />
zurückgeführt werden muß.« (l. c.)<br />
Die oberste und materiale Bedingung ist als rein spekulativ aus der<br />
Analytik gesetzte Vorausetzung zu verstehen, die nur deshalb im Denken<br />
der Gegenstände überhaupt allen Inhalt auf diese Voraussetzung<br />
zurückführen muß, weil das Denken nach einer obersten Idee sucht, und<br />
diese spekulativ setzt. Diese oberste Idee ist inhaltlich offenbar nicht rein
— 1300 —<br />
intelligibel. Jedenfalls ist diese oberste Idee nicht die von einem ens<br />
realissimum, das im Rahmen der Spekulation der reinen Intelligibilität<br />
Gottes als allerrealstes, schließlich als allerhöchst reales Wesen zu denken<br />
aufgegeben werden kann, da sie auch die vollständige und oberste<br />
materiale Bedingung beinhalten soll. Das unterscheidet diese Darstellung<br />
auch von derjenigen, wonach Gott auf Grund seiner reinen Intelligibilität<br />
und deren Zeichenhaftigkeit von den Dingen getrennt ist, die durch ihr<br />
Anderssein zwar nur negativ zu Gott bestimmt worden sind, aber doch<br />
einen eigenen Bestimmungsgrund von wo anders mit sich zu bringen<br />
hätten. Dessen Doppeltheit der Bestimmung der Andersheit der Dingwelt<br />
gegenüber der Seinsweise Gottes hat sich in diesem Zusammenhang<br />
bereits zwischen Allheit (transzendentalen Materie) und Allgemeinheit<br />
(wesentliches Prädikat) gezeigt.<br />
Diese spekulative Bestimmbarkeit der Seinsweisen muß eben nicht in der<br />
Substanzvorstellung Spinozas enden: Anselm setzt im ontologischen<br />
Gottesbeweis die Idee des größtmöglichen Seins (des je als größer<br />
denkmöglichen Seins) als Disjunktion von Vernunft zu Vernunft und<br />
Wirklichkeit an. Es wird hier der Begriff »Wirklichkeit« als einheitlicher<br />
Begriff der Existenzweisen gebraucht, der von unserer physischen<br />
Existenzweise und unserer Sinnlichkeit her bestimmbar gedacht wird,<br />
wenngleich nicht als vollständig bestimmbar. Die Möglichkeit der<br />
Gegenübersetzung reiner Intelligibilität als eigenständige Seinsweise wird<br />
im zweiten Satz ausgeklammert; damit gerät allerdings die christliche<br />
Vorstellung, Existenz hätte eine Voraussetzung, die nicht in der Existenz<br />
der Dinge der Welt selbst liege, in Diskussion. Das Argument, daß<br />
Vernunft und Wirklichkeit »mehr« sei als bloße Vernunft, betrachtet<br />
deshalb, weil Gott als dasjenige zu denken sei, was größer nicht sein<br />
könne, allein aus dieser Regel der Totalisierung auch die Existenz Gottes<br />
als bewiesen. Damit wird nicht nur von der reinen Vernunft verlangt,<br />
wozu sie allein als reine Intelligibilität (im Rahmen des Zeichenhaften) gar<br />
nicht fähig ist, sondern es wird noch in einer sonderbaren Redeweise vom<br />
Mehr-sein des Seins als des Seienden gesprochen, während Kant im<br />
Beweisgrund Gottes das ens realissimum vom All der Realität<br />
freigesprochen hat. Dieses »Mehr-sein« des Seins gegenüber dem Seienden<br />
kann nun als Umfangsbestimmung von Möglichkeit entlang der<br />
fortlaufenden Abstraktion zum totalen Totum aufgefaßt werden, indem<br />
das Seiende ist, was es ist, und insofern einen Bereich von Möglichkeit<br />
anhand möglicher Verbindbarkeit mit anderem Seienden bestimmt, der
— 1301 —<br />
aus analogen Gründen kleiner sein muß als die des Seins, wie auch die<br />
gedachte Sphäre der Möglichkeiten der individuellen Erfüllbarkeit des<br />
Artbegriffes kleiner sein muß als die des Gattungsbegriffes. Schließlich<br />
verschließt das Seiende die Möglichkeiten anderer Seiender, die an Stelle<br />
des jeweiligen Seienden treten könnten. Doch aber kann ein mehr an<br />
Möglichkeiten nicht Grund sein, von »Mehr-sein« von Sein als univoker<br />
Ausdruck von Existenz zu sprechen, sondern nur von einem größeren<br />
Vermögen (Potenz), was zweifelsohne Existenz des Vermögens und die<br />
Kraft, es einzusetzen, voraussetzt. So wird auch von Thomas die Existenz<br />
induktiv als Wirkung Gottes erschlossen, während Anselms Argument die<br />
Existenz Gottes bereits deduktiv, oder als positiv gegeben vorauszusetzen<br />
scheint. Dieses Argument gegen Anselm hat aber die Schwierigkeit, daß<br />
Anselm die Existenz eben nicht schlechthin, auch nicht einfach als bloße<br />
Realmöglichkeit setzt, die wiederum ihre Wirklichkeit sowohl dem Wesen<br />
wie der Existenz nach von wo anders her beziehen müßte, sondern, indem<br />
er disjunktiv Vernunft (als Denkmöglichkeit) und Vernunft und<br />
Wirklichkeit (als Realmöglichkeit) setzt, schließlich die Vernunft, bereits<br />
auf Realmöglichkeit beschränkt, und Wirklichkeit zusammen gegen die<br />
bloße Denkmöglichkeit setzt. Die Umfangsbestimmung und der<br />
Umfangsvergleich ist nun nicht einfach, vielmehr stehen sich neuerdings<br />
zwei alternative Fassungen gegenüber. Denkmöglichkeit ist größer, weil<br />
reichhaltiger an Varianten, oder Realmöglichkeit und Wirklichkeit ist<br />
größer, weil die formale Spekulation endlicher Vernunft die unendliche<br />
Potenz des Seins auch nicht formal überbieten kann, und schließlich, weil<br />
ein unendlich mannigfaltiger abstrakter Ideenkosmos der Sphäre des bloß<br />
Denkmöglichen für sich allein soviel wie nichts wäre, macht eben die<br />
Wirklichkeit erst dieses entscheidende »mehr« aus. Unabhängig vom<br />
Entscheid dieser offenbar nicht mehr rein modal behandelbaren Frage ist<br />
zumindest sicher, daß auch der Versuch eines spekulativen Vergleichs der<br />
Thesen zum Variantenreichtum immer nur dann stattfinden kann, wenn<br />
bereits für »Vernunft und Wirklichkeit« (Realmöglichkeit) entschieden<br />
worden ist. Jedenfalls kreuzen sich hier zwei Stränge der Bedeutung von<br />
»mehr« oder »weniger« Sein und mehr oder weniger Varianten in formaler<br />
Betrachtung, weil einerseits die Existenz Gottes »mehr« real ist (allerrealst)<br />
als die Existenz der Dinge, die ihre Existenz Gott verdanken, sodaß Gott<br />
insofern als ihre Ursache anzusehen ist, andererseits im nächsten Schritt<br />
der abstrahierenden Totalisierung das Sein, als Inbegriff aller Möglichkeit<br />
gesetzt, seine und die Existenzweise der Dinge unabhängig vom Ursprung<br />
der Wesen als quidditative Bestimmbarkeit analytisch mitbringt, was die
— 1302 —<br />
Einsicht nach sich zieht, daß spekulative Vernunft als reine<br />
Denkmöglichkeit gar nicht möglich ist. Das heißt, die Entscheidung zur<br />
Existenz, die mit der Entscheidung für »Vernunft und Wirklichkeit« (als<br />
Realmöglichkeit) ohne uns und für uns gefallen ist, um überhaupt mit dem<br />
Fragen beginnen zu können, ist näher qualifiziert worden durch Vernunft,<br />
was hier wohl nicht mehr besagen kann als eine systematische Beziehung<br />
von Ideen aufeinander inmitten der Wirklichkeit.<br />
Weshalb Kant in der Dialektik der reinen Vernunft auch in der Erörterung<br />
der theologischen Idee auf die Analogien der Kategorien in den<br />
psychologischen und kosmologischen Ideen zurückgreifen kann, wurde<br />
schon gezeigt; also ist der regulative Gebrauch der Vernunftidee auch in<br />
der Dialektik der Grund für die Möglichkeit sytematischer Beziehungen<br />
von Ideen überhaupt, der regulative Gebrauch aber nicht ohne die<br />
Einschränkung der Vernunftspekulation durch die Analogien zu den<br />
Kategorien, also zu den Bedingung objektiver Realität für die Geltung von<br />
Aussagen, möglich. Das könnte auch die oberste Idee als vollständige<br />
materiale Bedingung (oder diese enthaltend) in der hier entscheidenden<br />
Definition des transzendentalen Ideals, allerdings aus der Perspektive der<br />
absoluten Position — besagen. Wie aber Anselm die Vernunft und deren<br />
Spekulation als bloße Denkmöglichkeit noch mit Notwendigkeit mit<br />
Wirklichkeit außer durch die Zusammenstellung im »Vernunft und<br />
Wirklichkeit« (dann eben aber bereits als Realmöglichkeit) verbinden will,<br />
und hier nun vor allem, wie dann die spekulatiive Vernunft als bloße<br />
Denkmöglichkeit ohne Analogien zu Kategorien (das hieße bei Cusanus<br />
invers: ohne lux intelligibilis) als systematische Beziehung von Ideen<br />
gedacht werden soll, ist bei Anselm nicht mehr nachvollziehbar. Es<br />
handelt sich demnach bei Anselm um eine unechte Disjunktion, aber<br />
deshalb noch nicht um eine Setzung der Existenz Gottes im Term<br />
Wirklichkeit im Ausdruck »Vernunft und Wirklichkeit«. Die Setzung<br />
Gottes soll durch oder mittels dem ganzen Ausdruck »Vernunft und<br />
Wirklichkeit« erfolgen, sodaß auch bei Anselm an dieser Stelle weder<br />
unbedingt schon von dem »mehr« an Sein im »Allerrealsten« durch die<br />
Schöpfung noch von reiner Vernunftspekulation die Rede sein muß.<br />
Unabhängig davon, daß zwar das Argument gegen Anselm entkräftet<br />
werden konnte, welches von der einfachen Voraussetzung der Existenz<br />
Gottes im Sinne des (eventuell nur vermeintlichen) Schlußsatzes ausgeht,<br />
bleibt das Problem der deduktiven Ableitung von Existenz gegenüber dem<br />
induktiven Vorgehen bei Thomas dann aufrecht, wenn die Einheit von
— 1303 —<br />
Vernunft und Existenz sofort als Gottesidee gesetzt wird. — Kant greift die<br />
bereits als unentscheidbar bestimmte Rede des »Mehr-seins« nicht nur mit<br />
dem Ausdruck »ens realissimum« wieder auf (später als allerhöchste<br />
Realität apostrophiert), sondern bestimmt sowohl im Duisburger Nachlaß<br />
wie noch in der ersten Kritik Existenz aus der Totalität. Allerdings nicht<br />
allein aus der Totalität des Denkens sondern auch aus der Totalität der<br />
Sinnlichkeit, sodaß Zeit als Erfahrungsraum und die idealiter als<br />
durchgängig subsummierbar und koordinierbare Idee vom Ganzen der<br />
systematischen Bezüge zwischen Ideen mit der Totalität des Denkens zwar<br />
verbunden bleibt, aber selbst nicht allein die data und den Grund von<br />
Existenz (hier aber schon transzendentalanalytisch als Grund des<br />
Existenzprädikates) enthält. Das soll in der Untersuchung zum<br />
transzendentalen Ideal (prototypon transcendentale) durch die<br />
konstitutionelle Unterscheidung in kategoriales Quantum (Allheit) und<br />
logischen Quantum (Allgemeinheit) ausgedrückt werden: Die Prädikate<br />
werden im Rahmen der kategorialen Allheit hier abstrakt von der<br />
transzendentalen Materie genommen; ein Ausdruck, der auch in den M. A.<br />
d. N. als Repräsentant der Sinnlichkeit ohne Bezug auf Ding oder<br />
Gegenstand vorkommt. Hingegen wird in der Erörterung des logischen<br />
Quantums das wesentliche Prädikat als Teilbegriff des Wesens, das selbst<br />
nur als möglicher Begriff gedacht werden kann, behandelt. Das hat<br />
einerseits mit dem nicht ganz geglückten Übergang vom logischen<br />
Vergleich der Prädikate zum transzendentalen Vergleich des Dinges selbst<br />
(!) mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikate zu tun, sodaß das<br />
Verständnis, was die Forderung nach einer Bestimmung in concreto<br />
eigentlich bedeutet, nicht leicht eingegrenzt werden kann. Andererseits<br />
wird mit der Durchbestimmung des Begriffes eines einzelnen Wesens<br />
durch einen Begriff (dem wesentlichen Prädikat), die komplementär zur<br />
entschränkten (nicht-kategorialen) Allheit geschieht, die individuelle<br />
Definition des Wesens als Individuelles grundsätzlich ermöglicht; letztlich<br />
aber ohne das logische Verhältnis der beiden Bestimmungsweisen des<br />
transzendentalen Ideals befriedigend bestimmt zu haben.<br />
Bei Kant wird demnach die Existenz der Dinge durch die Totalität der<br />
gegebenen Merkmale eines Dinges in der Erfahrung, die in der Idee der<br />
Totalität der möglichen Prädikate eines Dinges überhaupt nur als<br />
Möglichkeit (hypothetisch) gedacht wird, unterschieden von der<br />
Vorstellung einer Art zu existieren, in welcher von der nur gedachten Idee<br />
der Totalität der in der Erfahrung gegebenen Prädikate eines Dinges aus
— 1304 —<br />
der nur gedachten Idee der Totalität möglicher Merkmale überhaupt ein<br />
Teil ausgeschnitten wird. Dieses nur über den Umweg des Inbegriffes<br />
gedachte Substratum der »vollständigen materialen Bedingung« soll also<br />
insofern mit der Vernunft als Sphäre der Realmöglichkeit zusammen in<br />
der obersten Idee ausgedrückt werden können, doch besteht nunmehr die<br />
Realmöglichkeit nicht allein gegenüber wirklich möglichen Merkmalen<br />
(geltenden, weil in möglichen Assertionen bereits geprüften, womöglich<br />
weil gesetzmäßig geforderten Prädikaten), sondern gegenüber jenem Sein,<br />
gegenüber der transzendentale Vergleich die Wesen der Dinge mit dem<br />
Wesen der Ursache der Existenz vergleicht — sodaß weder die Existenz<br />
Gottes noch die der Dingwelt für den ganzen transzendentalen Inhalt der<br />
angedachten gemeinsamen Form der Seinsweise der Dinge der Welt und<br />
des Wesens Gottes gehalten werden kann. Die von Anselm im zweiten<br />
Glied seines Obersatzes in Zusammenhang gebrachte Differenz der<br />
Seinsweisen Gottes und der Dinge der Welt sucht im Widerspruch eine<br />
neu sich eröffnende Sicht- und Seinsweise. Das damit gesuchte Wesen hat<br />
kein Ding mehr, das allgemein zum Gegenstand bestimmt werden könnte,<br />
und es ist weder ens realissimum als Teilbegriff von omnitudo realitatis<br />
noch ens realissimum als ens originarium, ens entium und ens summum,<br />
sodaß auch hier der Paralogismus der Substanz als Grenzbestimmung rein<br />
logisch seine kritische Funktion besitzt. Die Doppeltheit im Begriff von<br />
Existenz, in welchem die eine Existenz die Ursache (forma) der anderen ist,<br />
wird im Anselmschen Argument nicht berücksichtigt, sodaß wohl<br />
diejenige Auffassung näher an der richtigen Auffassung liegt, daß es sich<br />
beim Anselmschen Argument nicht um einen Syllogismus, sondern um<br />
eine Tautologie handelt, die weder zur Deduktion noch zur Induktion<br />
tauglich sei. Der Wechsel in den Positionen, was wessen Ursache ist, die<br />
einer denkmöglichen Konkordanz zwischen Intellibilität und Materie<br />
voraus liegen müßte, läßt allein aber nicht auf eine einfache Tautologie<br />
schließen; dergleichen ist nur für den Versuch, Intelligibilität und Substanz<br />
vertikal zu subsummieren eine Gefahr. Eine Abschließung der<br />
fortlaufenden Abstraktion und Totalisierung in der Vernunftspekulation<br />
durch die Abfassung eines Substanzbegriffes steht also nicht mehr an.<br />
Kant erweitert bekanntlich die Überlegungen einer »transzendentalen<br />
Psychologie« des transzendentalen Subjektes auf den intelligiblen<br />
Charakter unseres Gattungswesens und erreicht damit die Formulierung<br />
des Freiheitsproblems. »Also ist „Freiheit ... nur, wo causalitas<br />
intellectualis ist, d. i. an Intelligenzen, die durch Vernunft Ursache sind
— 1305 —<br />
(Refl. 5979)“. Nach diesen Bestimmungen der Kategorienlehre impliziert<br />
also der Begriff der Substanz den der Freiheit und der Intelligenz, der<br />
Begriff der Freiheit den der Substanz und der Intelligenz. Aus der<br />
Intelligenz jedoch ist nicht der Schluß auf Substanz und Freiheit möglich«<br />
(D. Henrich, Über die Einheit der Subjektivität, cit. op., p. 41). Dennoch<br />
bleibt diese Idee eine ohne weitere Wesenbestimmung Gottes, und wenn<br />
es auch wenn es so ausgesehen hat, als würde die Existenz die Essenz<br />
Gottes ausmachen, deshalb unzureichend und gerade nicht die erfüllte<br />
Totalität, die bislang im »mehr sein« über die (von Kant widerlegte) rein<br />
modale Bedeutung hinausgehend zu denken nur vorgegeben worden ist.<br />
Gott bestimmt jedes Ding zur Existenz, bestimmt aber in diesem Schritt<br />
nicht die Andersheit der Dinge, oder deren wesensbestimmenden formae<br />
weiter (vgl. Cusanus Unterscheidung des lux intelligibilis vom Licht des<br />
göttlichen Verstandes selbst, vgl. Leibniz Auffassung in der Theodizee,<br />
daß Gott nicht die Ursache oder Quelle der Wesensbestimmungen in<br />
unvordenklicher Mannigfaltigkeit sei, sondern Ursache der Wahl, welche<br />
Dinge — welche besondere Art oder Wesen von Dingen — existieren).<br />
Nun wurde aber mit der Untersuchung des transzendentalen Mangels<br />
gegenüber eben dem selben ens realissimum der Auffassung, nach welcher<br />
die göttliche Substanz völlig verschieden von der anders bestimmten<br />
Natur der Dinge sei, eine Darstellungsweise eingeführt, die über diese<br />
oberste Idee, die die vollständige materiale Bedingung enthalten soll,<br />
nochmals hinausgeht: Sie kann ihren Gegenstand eingestandenerweise<br />
nicht zum Vorschein bringen, und, in Folge der Singularität des<br />
Überganges zwischen der Welt der Erscheinungen und der Intelligibilität,<br />
gerade die Einsicht in die Unmöglichkeit dieser Überschreitung<br />
(Cusanus:Erblindung) als Beweis für das göttliche Licht der Wahrheit, die<br />
den Dingen Existenz verleiht, ansehen. Dies zweimal: Erstens klassisch<br />
durch die Existenzverleihung, zweitens durch die Informiertheit des<br />
göttlichen Verstandes im Licht der Wahrheit, die im Versuch der<br />
Vorstellung des geordneten Ganzen, zunächst entlang einer Ideenlehre, an<br />
der Grenze der Vorstellungskraft und des menschlichen Verstandes (so<br />
Cusanus zum Infininitesimalproblem in der Mathematik), aufblitzt als<br />
Ahnung eines Ausdruckes von etwas, was man geradezu nicht mehr<br />
erblickt, wobei dieses etwas die Vorstellung der ganzen Ideenkette in alle<br />
Glieder hinein (Kant, logisch: subsummiert und koordiniert, Cusanus,<br />
resolutiv: ein System der Konkordanz der Gegensätze) ist, und eben noch<br />
nicht das göttliche Licht selbst. (vgl. den Übergang der Raumvorstellung<br />
als Anschauungsform in der transzendentalen Ästhetik zum Gefühl der
— 1306 —<br />
Allgegenwart in der Antizipation bei Kant). Die Verbindung zur<br />
Informiertheit für uns liegt demnach bloß im Gewahrwerden des<br />
Ausdrucks und der Gestimmtheit des Ganzen des Daseins in der Welt und<br />
in der Zeit. Dieser transzendentale Mangel einer apperzipierenden<br />
Monade gegenüber Gott läßt sich demnach auch anhand des Grenzbegriffs<br />
der Allwissenheit aufzeigen. Doch bleibt ein solcher Ansatz zur<br />
Weiterbestimmung des transzendentalen Mangels gegenüber Gott erstens<br />
in diesem Rahmen naturgemäß wiederum nur eine allgemeine und keine<br />
individuelle Bestimmung, und beschränkt sich zweitens auf eine<br />
bestimmte Art von Dingen, den apperzipierenden Monaden. Genau diese<br />
Einschränkung scheint aber die Darstellung des transzendentalen Ideals<br />
im zweiten Abschnitt (Vom transzendentalen Ideal) aus anderen Gründen<br />
auch zu forden.<br />
Zwei Problemkreise sind noch zu behandeln: (1) Die Bestimmung der<br />
transzendentalen Materie im ersten Prinzip der durchgängigen<br />
Bestimmung gemäß der Allheit aller möglichen Prädikate eines Dinges ist<br />
verschieden vom zweiten Prinzip der durchgängigen Bestimmung gemäß<br />
der Allgemeinheit des wesentlichen Prädikats als Bestimmung des<br />
Begriffes eines einzelnen Gegenstandes durch eine Idee. — Damit könnte<br />
die oberste Idee in der hier besprochenen Fassung als vollständige<br />
Bedingung der Materie im dem Sinne angesprochen werden, daß sie,<br />
ähnlich wie weiter oben im Zusammenhang mit dem conceptus<br />
archetypus, nichts weiter als die Informiertheit im Inbegriff der<br />
Möglichkeiten bedeutet. Die Lesart, anhand der Bestimmung des Begriffs<br />
eines einzelnen Wesens durch einen Begriff (zum Unterschied vom Begriff<br />
vom einzelnen Gegenstandes, der durch eine Idee bestimmt wird) nicht<br />
von der Totalität der Sphäre aller möglichen Prädikate (Inbegriff der<br />
Möglichkeiten) auszugehen, sondern den Begriff, der den Begriff eines<br />
einzelnen Wesens bestimmt, als den Begriff vom einzelnen Gegenstand<br />
(Allgemeinheit, Ideal der reinen Vernunft) und wesentliches Prädikat zu<br />
identifizieren, entschärft die Schwierigkeit, die oberste materiale<br />
Bedingung als vollständige materiale Bedingung anzusehen zu müssen, da<br />
von der Seite der Argumentation des zweiten (logischen) Prinzips der<br />
Durchbestimmung des Begriffs durch eine Idee das als erste angeführte<br />
Kriterium die Vollständigkeit der Prädikate selektioniert, und das<br />
wesentliche Prädikat, das nicht aus anderen Prädikaten abgeleitet wird,<br />
der Grund für die Allgemeinheit eines solchen Prädikats ist. Derart wird<br />
sicher gestellt, daß unter dieser Einschränkung und logischen
— 1307 —<br />
Qualifizierung der inhaltlichen Bestimmung prinzipiell die besondere Art<br />
des Dinges oder des Einzelnen oder des Individuellen fällt. In der<br />
Allgemeinheit der Untersuchung bleibt dies in logischer Hinsicht eine<br />
empirische Untersuchung über die besondere Art eines Dinges (besondere<br />
Logik).<br />
(2) Dieser Befund widerspricht aber der vorausgesetzten Anwendung des<br />
ersten Prinzips der Durchbestimmung mittels Prädikate, welches, grob<br />
gesagt, vom Vergleich mit der Totalität der Sphäre aller möglichen<br />
Prädikate eines Dinges ausgeht, ohne das allerdings die Stellung dieses<br />
Verfahrens zwischen logischen und transzendentalen Vergleich volllends<br />
bestimmt worden wäre. Kant setzt offenbar die Verklammerung durch<br />
Gegensätze als Darstellungsmittel auf allen Ebenen ein: Die Identifizierung<br />
des transzendentalen Ideals als Produkt zweier formal getrennter<br />
Methoden führt aber in die schon bekannte Schwierigkeit, die<br />
Gleichsetzungen der Umfänge des Inbegriffs aller möglichen Prädikate mit<br />
dem des omnitudo realitatis, mit dem des Inbegriff aller Realität, sogar mit<br />
dem des Inbegriffs allerrealster Existenz (ens realissimum) nicht<br />
verhindern zu können, was eben obige Einschränkung auf das Besondere<br />
wieder aufzuheben droht. Grundsätzlich ist von der vollständigen<br />
Informiertheit des archetypus intellectus auszugehen. Insofern gilt das<br />
gleiche für die starke Fassung des ens realissimum als Kandidat für das<br />
allerhöchste Wesen, auch wenn angenommen wird, daß Gott nicht selbst<br />
als Ursache der Wesenheiten oder Ideen auftritt. Diese vollständige<br />
Informiertheit hat gerade auch dann zu gelten, wenn der<br />
Bedeutungsumfang einer möglichen Bestimmbarkeit des ens realissimum<br />
als solches nicht mit dem Bedeutungsumfang der Totalität der Sphäre aller<br />
möglichen Prädikate eines Dinges überhapt (omnitudo realitatis)<br />
zusammenfällt. Das logische Problem besteht darin: Wie kann eine<br />
Totalität der Mannigfaltigkeit, die mehr unterscheidbare Qualitäten<br />
umfaßt (die Tendenz der Materie zu immer größerer Unähnlichkeit mit<br />
sich selbst, Leibniz, Zwölfter Satz) als eine (von uns aus gesehen, weil von<br />
uns aus spekulativ erschlossene) zweite Totalität, von der zweiten Totalität<br />
als enthalten gedacht werden? Die möglichen Antworten sind in den<br />
Grundzügen schon bekannt: Entweder mit dem Übergang von einer<br />
Sphäre der Möglichkeiten zu einer Sphäre der Vermögen oder mit dem<br />
Übergang von der Richtung der Zuschreibung der Vorstellungen als<br />
Prädikate, die Merkmale einem Ding zuschreiben, zur Richtung der<br />
Zuschreibung der Vorstellung als die meinen, bis schließlich selbst die
— 1308 —<br />
Vorstellung des Dinges mir selbst zugeschrieben werden muß. Diese<br />
Ansätze, die vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um den<br />
Existenzialsatz bei Leibniz, Kant (transzendentales Prinzip der Kausalität)<br />
und Russell einerseits oder bei Kant (Transzendentalsubjektivismus von<br />
Descartes) und Brentano andererseits Interesse verlangen dürfen, sind aber<br />
für die ontotheologische Ausgangslage, wonach die reine Intelligibilität<br />
des ens realissimum vom Andersein der Dinge der Natur nach<br />
verschieden ist, und der transzendentale Mangel gegenüber dem ens<br />
realissimum (also nicht gegenüber der Totalität der Prädikate der Dinge)<br />
die Dinge nicht untereinander, sondern nur gegenüber dem ens<br />
realissimum transzendental zu bestimmen vermag, gleichermaßen gültig<br />
wie für die transzendentalanalytischen Überlegungen zum logischen<br />
Ursprung der Begriffe, welche die notae oder Vorstellungen aneinander<br />
und untereinander vergleichen und an der (numerischen) Einheit des<br />
Bewußtseins als transzendentale Bedingung dieser Vergleichung in der<br />
Rekognition vergleichen. 39 Ich schreibe diese, freilich nicht ungestörte,<br />
Analogie oberster Prinzipien einer formalen Ideenlehre zu. Kants zu<br />
strikter transzendentaler Idealismus in den Antinomien scheint diese<br />
Störung, die mit dem transzendentalen Prinzip der Kausalität die<br />
Einfachheit der apperzipiernden Monade in ein System von<br />
Wechselbezügen zwingt, wieder ausgleichen zu wollen. Dank Zeidlers<br />
Untersuchung zum Logischen Ursprung der Begriffe bei Kant war es mir<br />
möglich, eine mindest ebenso wichtige, aber formale Analogie zwischen<br />
erstens den Voraussetzungen der transzendentalen Logik in der rationalen<br />
Psychologie und den logischen Handlungen von Komparation, Reflexion,<br />
Abstraktion (die notae aneinander, untereinander, an der Bedingung des<br />
Vergleichs, der numerischen Einheit des Bewußtseins, vergleichen) und<br />
zweitens der, wenn auch schon bei der Unterscheidung mit vielen<br />
Unklarheiten behafteten, Verklammerung von logischem und<br />
transzendentalem Vergleich eines Dinges und seiner Prädikate in der<br />
Untersuchung des transzendentalen Ideals, des Ideals der reinen Vernunft,<br />
und des (ersten) logischen Prinzips der durchgängigen Bestimmbarkeit<br />
eines Dinges festzuhalten. Trotz der komplexeren und zugleich weniger<br />
bestimmten Ausgangslage zwischen transzendentalem Ideal und<br />
ontotheologischer Spekulation, läßt sich hier anhand der bei aller<br />
sonstiger, andernorts bereits aufgeklärten Problematik hinsichtlich des<br />
Mangels an eindeutiger Bestimmbarkeit, zumindestens deutlichen<br />
39 Vgl. w. o. zu Zeidler
— 1309 —<br />
Unterscheidbarkeit von logischem Vergleich und transzendentalem<br />
Vergleich eindeutig die gleichen logischen Handlungen des Vergleichens<br />
(aneinander, untereinander, an der als vorausgesetzt gedachten Einheit)<br />
feststellen wie aus der Kantschen Untersuchung zum Logischen Ursprung<br />
der Begriffe bekannt.<br />
Die Verfaßtheit der Intentionalität, die auf Dinge gerichtet ist, und auf der<br />
primären Intentionalität der Sinnlichkeit aufruht, läßt sich auf einem<br />
streng transzendentalsubjektivistischen Tableau nur durch<br />
Distributionsweisen der Merkmale auf Dinge hin charakterisieren, weshalb<br />
ich auch an anderer Stelle von der Beziehung zwischen<br />
1. dem logischen Gegenstand aus der Verfaßtheit der Intentionalität im<br />
Rahmen verstandesgemäßen Urteilens,<br />
2. der Ideen als Konzepte von besonderen Dingen, deren Merkmale<br />
bekannt sind oder bekannt gemacht werden können, und<br />
3. der davon zu unterscheidenden Reflexion des Dings an sich als<br />
transzendentales Objekt gesprochen habe. Formal: Die kritische und<br />
analytische Umkehrung der Intentionsrichtung verliert in ihrem<br />
Untersuchungsgang die geregelten Beziehungen zwischen logischem<br />
Gegenstand und dem Ding an sich. Inhaltlich: Die Bestimmung der Dinge<br />
anhand des transzendentalen Mangels gegenüber dem ens realissimum<br />
sind keine Prädikate dieses Dinges, erstens weil Negationen von Begriffe<br />
keine Prädikate sind, die die Erkenntnisse vermehren, und zweitens auch<br />
dann nicht, wenn eine Qualität als mangelhafte Kopie eines umfassend<br />
positiven und konkreten Attributes angesehen werden könnte, da dann<br />
die quantitativen Verhältnisse von selbst wieder von uns aus gesehen für<br />
ein relativ zu Gott größtmöglichen Unterschied sorgen. Bestimmungen der<br />
Art sind trotz der ihnen innewohnenden Dialektik, die zum<br />
Existenzsetzungsversuch aus reiner Vernunft führen, werden sie nicht<br />
kritisch als spekulative Vermögenslehre betrachtet, in logischer Hinsicht<br />
Verhältnisprädikaten (dialektisch) oder reinen Direktionen (kritisch)<br />
vergleichbar und sind nicht einfache Merkmale. Die Unterscheidung in<br />
logischem und dialektischem Gebrauch ist in einer Erörterung des Ideals<br />
ansonsten schwierig anzuwenden.
— 1310 —<br />
f) Die Informationstheorie nach Leibniz und das Unvordenkliche.<br />
Der Übersprung der Spekulation von der ontotheologischen zur<br />
theologischen Diskussion<br />
Die Vermutungen über die Ausdrucksmöglichkeiten des besonderen<br />
Mangels im Rahmen einer Vermögenslehre, insbesondere im Übergang<br />
von der Metaphorik der Anschaulichkeit zur Metaphorik der<br />
Vernehmbarkeit, liegen in einer anderen Richtung. Der logische Vergleich<br />
der Prädikate eines Dinges mit der Sphäre aller möglichen Prädikate eines<br />
Dinges überhaupt ist von dem transzendentalen Vergleich eines Dinges<br />
mit dem ens realissimum auch darin verschieden, als daß die<br />
Informiertheit des ens realisssimum nicht in der einfachen Auflistung aller<br />
möglichen Prädikate besteht. Insofern wäre die Totalität der Sphäre aller<br />
möglichen Begriffe zwar in der Totalität der Bestimmungen des<br />
informierten ens realissimum dennoch aufgehoben, ohne das dieses<br />
deshalb selbst widersprüchlich und unmöglich sein müßte, aber die<br />
Prädikate sind aus dem transzendentalen Mangel gegenüber Gott nicht<br />
ableitbar: die Prädikate aus der transzendentalen Materie nicht, weil sie<br />
aus der Tendenz zur immer größerer werdenden Unähnlichkeit der<br />
Materie mit sich selbst entstanden sind; und die Wesensbegriffe der Dinge<br />
nicht, weil sie von Gott zwar allererst klar und distinkt als Möglichkeiten<br />
(neben den notwendigen Wahrheiten, die allein nach dem Prinzip der<br />
Regelmäßigkeit herausgehoben werden) gedacht werden, aber der<br />
unvollkommenen Indifferenz der unvordenklichen Mannigfaltigkeit<br />
entstammen. Wollte man diesen Sprung bedenken, der in der<br />
Zusammenfügung dieses Gegensatzes bestünde, so müßte man erst die<br />
Position des ens realissimum von einer dritten Position außerhalb des<br />
klassisch-ursprünglichen Verhältnisses von ens realissimum als die<br />
Gottheit bezeichnend und der Andersartigkeit der Dinge bedenken<br />
können. Im nächsten Schritt wird die Unverfügbarkeit der oberen<br />
Wesensbestimmungen der Dinge für Gott selbst, der diese nicht geschaffen<br />
hat, nach Leibniz letztlich nur davon übertroffen, daß Gott eine Auswahl<br />
aus der unvollkommenen Indifferenz des Unvordenklichen zum Besten<br />
und zur größtmöglichen Harmonie trifft und getroffen hat.<br />
Dieses abermals aufzuheben und das Verhältnis von der reinen<br />
Intelligibilität Gottes zu den anderen Dingen zu überbieten mit der<br />
Spekulation einer vorgängigen Schöpfung, in welcher Gott nicht bloß<br />
vollständig informiert ist, sondern die Materie der unvollkommenen<br />
Indifferenz des Mannigfaltigen des Unvordenklichen überhaupt erst
— 1311 —<br />
schafft, woraus Gott nach Leibniz (und Bayle) dann nachgeordnet die<br />
Wesenheiten der formae der Dinge entnimmt. — Im Rahmen dieser<br />
Fortsetzung der Spekulation werden die Möglichkeiten im göttlichen<br />
Verstand nicht nur erst klar und distinkt gedacht, Gott schafft vielmehr<br />
selbst die Vorausetzungen seiner Informiertheit, die ihm als Indifferenz<br />
des Unvordenklichen im Zuge der In-Existenz-Setzung (nunmehr als<br />
zweite Schöpfung zu betrachten), wieder entgegentreten, noch bevor diese<br />
Entgegensetzung in der Andersheit der Dinge der Welt in Bezug auf das<br />
ens realissimum als ernstgenommene, nicht nur innergöttliche Andersheit<br />
der Dinge zum Vorschein kommen konnte. Neben allen Schwierigkeiten,<br />
die naturgemäß mit Spekulationen dieser Art grundsätzlich verbunden<br />
sind, treten mit der Darstellung einer zur In-Existenz-Setzung gemäß der<br />
Wahl zum Besten und zur größtmöglichen Harmonie vorgängigen<br />
Schöpfungschritt weitere Problemstellungen grundsätzlicher Art auf: So ist<br />
auch in diesem Zusammenhang weiterhin mit Bayle zu fragen, ob Gott<br />
diese erste und nicht weiter hintergehbare Schöpfung in Freiheit und<br />
willentlich mit Absicht vollbracht hat, oder ob dieser dann wirklich<br />
ursprüngliche Akt nicht zufällig oder notwendigerweise geschehen ist,<br />
weil dieser womöglich gar nicht ein Akt der Freiheit Gottes gewesen ist,<br />
sowenig die Existenz Gottes selbst in seiner Macht steht. Das nun<br />
hinzukommende Problem besteht darin, wie es noch zu denken möglich<br />
gemacht werden könnte, daß Gott zumindest die Voraussetzungen seiner<br />
Informiertheit selbst schafft, selbst wenn dieser Akt nicht zu seiner Freiheit<br />
gehören sollte. Dieses neue Problem ist eben unabhängig von der Antwort<br />
auf die Frage nach der Freiheit Gottes im Zuge der zweiten Schöpfung in<br />
der Spekulation über eine vorgängige Schöpfung zu behandeln, da das<br />
Problem der selbst geschaffenen Voraussetzungen der Informiertheit,<br />
selbst in dieser Totalität aufgestellt, nicht nur die spekulative Totalisierung<br />
der formalen Bedingungen eines Vermögens bedeuten kann, das einmal<br />
mehr und einmal weniger als erfüllt vorgestellt werden könnte, sondern<br />
auch die inhaltliche Seite der Informiertheit im zweiten Akt mit dem noch<br />
ursprünglicheren ersten Akt grundlegen sollte. Derart wäre nunmehr ab<br />
dieser Stelle des Fortganges der Spekulation auszuschließen, daß im Falle<br />
einer Determination Gottes zum Anfang der Schöpfung diese<br />
Determination zur Fingierung einer außergöttlichen Quelle der<br />
Information herangezogen wird, was nur die Perpetuierung der<br />
Diskussion nach dem Ursprung des Ursprungs nach sich ziehen würde. —<br />
Soweit eine erste äußerliche Verknüpfung der ontotheologischen<br />
Diskussion mit der theologischen Diskussion innergöttlicher Dynamik;
— 1312 —<br />
äußerlich bleibt die Verknüpfung, weil sie nur durch systematisch<br />
abarbeitende spekulative Überschreitung denkmöglich gemacht worden<br />
ist. Die innergöttliche Dynamik kann kaum anders als im Rahmen<br />
christlicher Trinität und deren platonischen Bestimmungsversuchen<br />
gedacht werden; 40 genau das kann nicht Thema einer philosophischen<br />
Erörterung des philosophischen Gottesbegriffes sein, auch nicht einer<br />
kritischen Fassung einer solchen. Urs von Balthasar hat auf eine<br />
Verbindung innergöttlicher trinitarischer Dramatik mit der Gestaltung und<br />
der Zukunft der Welt der Dinge hingewiesen, die Hegel trotz seiner<br />
Reduzierung der Dynamik des Geistes auf die logische Bewegung des<br />
Begriffes, etwa in der Phänomenologie des Geistes als eine Auswirkung<br />
des Geistesgeschehens in der Natur und deren Entwicklung zu<br />
beschreiben imstand war. 41<br />
g) Die unvollständige Formalität der reinen Spekulation und die<br />
Zeichenhaftigkeit des Bewußtseins. Die Dialektik von Bedeutung und<br />
Sinnhorizont eines Bedeutungszusammenhangs.<br />
Allgemein ist nach dem Übertritt von der rein modalen Erörterung zur<br />
Frage nach der Bestimmbarkeit des transzendentalen Mangels, und des<br />
damit verbundenen (erzwungenen) Übergangs von der Sphäre der<br />
Möglichkeit zur Sphäre der Vermögen nunmehr zu beobachten, inwieweit<br />
nicht eine Tendenz zur Abschließung der Spekulation der Totalität<br />
festgestellt werden kann, welche die Vorstufen der Spekulation<br />
gewissermaßen vernichtet oder einklammert, und aus dem Kreis der<br />
nächsten Totalität ausschließt und nicht affimiert. Dabei geschieht die<br />
Abschließung unabhängig von der Unterscheidung in reine Intelligibilität<br />
und Welt der Dinge, die die ursprüngliche Unterscheidung zwischen Gott<br />
und der Welt mit dem logischen Gegensatz entgegen Anselms<br />
Bemühungen um einen einheitlichen Seinsbegriff festschreibt. Diese<br />
Tendenz zur letztendlichen Abschließung der die Totalität suchende<br />
40 Karl Josef Wallner, Gott als Eschaton. Trinitarische Dramatik als Voraussetzung<br />
göttlicher Universalität bei Hans Urs von Balthasar, Heiligenkreuzer Studienreihe,<br />
Bd. 7 der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz, hrsg. vom Verein<br />
der Heiligenkreuzer Hochschulfreunde, Heiligenkreuz/Wien 1992. Zu Richard von<br />
St. Victor: Michael Benedikt, Philosophischer Empirismus III, Spekulation, Teil 1:<br />
Eine Passage zwischen Cyberspace und Anthropo-Narzißmus, Turia und Kant, Wien<br />
2001, Kap. III: Seinsbestand und Attribute, Personen und Relationen, III.1.1. Die<br />
Differenz zwischen Seinsbestand und mehrerlei Bedeutung des Personalen bei<br />
Richard von Sanct Victor, p. 36 ff..<br />
41 Wallner, cit. op., 2. Hauptteil: Trinitarische Fülle zur Welt, Viertes Kapitel: Im Ringen<br />
mit Hegel: Gottes Weltverhältnis im „Überblick“?, p. 224 ff.
— 1313 —<br />
Spekulation von ihren Voraussetzungen ist verschiedentlich zu<br />
beobachten, hat offenbar aber auch nicht von selbst die vollständige<br />
Abtrennung von der materialen Bedingung notwendigerweise zur Folge.<br />
Insofern zeigt sich, daß die Lichtmetapher nicht nur als Ausdruck der<br />
reinen Intelligibilität im Versuch der Vorstellung des Ganzen des Seins<br />
eine Stellung besitzt: vielmehr erscheint die Intelligibilität nunmehr als der<br />
eigentliche Grund der Geordnetheit, und notwendigerweise gemeinsam<br />
mit dem eigentlichen Grund von Existenz. Die nämliche Doppeltheit<br />
charakterisiert zwar die Problemstellung der Informiertheit, wenn die<br />
oberste Bedingung des Denkens von Dingen oder von omnitudo realitatis<br />
im transzendentalen Ideal zugleich die vollständige materiale Bedingung<br />
enthält, doch nunmehr ist das keine dialektische Spekulation über die<br />
Grenzen des transzendentalen Idealismus, die Überlegung ist zu einer<br />
analytisch-metaphysischen Spekulation über die Bedingungen eines jeden<br />
Inhalts geworden. Diese nur versuchte reine, und nunmehr trotzdem<br />
immanente, weil eben rein und in Totalität gedachte formale Grundlegung<br />
der Informiertheit ist offensichtlich nicht selbst schon die Informiertheit; es<br />
ist aber die vollständige formale Bedingung der Informiertheit hier gerade<br />
in in Bezug auf Totalität und auf die jeweiligen Begrenzung der<br />
Totalisierung durch bloße Abstraktion zu denken. Die reine und<br />
vollständige Bedingung der Informiertheit ist dann die formale<br />
Möglichkeit des Inhalts, also seine Darstellbarkeit oder Mitteilbarkeit,<br />
unabhängig von seiner Position als Merkmal am Ding, als Prädikat des<br />
Dinges, als formales oder modales Prädikat von Prädikaten oder<br />
Prädikatsverhältnissen. Zu den möglichen Erörterungsweisen zählt die<br />
formale Betrachtung der Information im Rahmen der Idee eines Kalküls<br />
oder Algorithmus oder als Bedeutung im Rahmen der Idee einer Semantik<br />
in Beziehung zum selbst wieder doppelten Problem der Konstitution eines<br />
Sinnhorizontes und dessen gleichzeitige Vorausgesetztheit, um überhaupt<br />
von Bedeutungen sprechen zu können. Da letzteres ähnlich charakterisiert<br />
ist wie das Ausgangsproblem, scheint es erfolgversprechend, auch dort<br />
anzusetzen.<br />
Insofern erfährt zumindest die Zeichenhaftigkeit des Bewußtseins ein rein<br />
formales Fundament im Kontrast von schwankender Bedeutung und den<br />
spezifischen Mannigfaltigkeiten von Sinnhorizonten einerseits und der<br />
Bestimmbarkeit des Umfanges von möglichen Bedeutungen im Vergleich<br />
aneinander und untereinander gemäß eines fixierten Sinnhorizontes<br />
andererseits. In der hier angezogenen Fragestellung sollte der Sinnhorizont
— 1314 —<br />
bereits als fixiert gedacht werden können; gerade, weil die Position des ens<br />
realissimum allein aus der Gegenüberstellung zur Andersartigkeit der<br />
Dinge in der Welt (Leibniz: l’universe) noch nicht bestimmt werden<br />
konnte, muß dies die Freiheit der Spekulation je erst bestimmen. Doch darf<br />
vermutet werden, daß auch nur eine teilweise Bestimmung des<br />
Sinnhorizontes bereits eine Selektion oder Rangreihung der möglichen<br />
Bedeutungen nach sich zieht, was zumindest durchschnittlich die Aussicht<br />
erhöht, im nächsten Schritt auch die Fixierung des Sinnhorizontes der Lage<br />
und der Konsistenz nach zu verbessern. Da es sich hier nicht um das<br />
Problem der Auffindung eines transzendentalen Prinzips handelt, das die<br />
Grundlage eines synthetischen Urteils a priori abgeben müßte, reicht diese<br />
Aussicht zunächst aus, die Möglichkeit zu behaupten, a fortiori<br />
irgendwann einmal diese Fixierung des Sinnhorizontes zu erreichen. Also<br />
kann man in Totalität gedacht hier davon ausgehen, daß es ein Kalkül der<br />
Optimierung zwischen dem Umfang möglicher Bedeutungen und<br />
möglicher Sinnhorizonte gibt und daß deshalb der Sinnhorizont in der<br />
Ausgangsfrage idealiter als bereits fixiert zu betrachten ist. Zwei Fragen<br />
stellen sich an dieser Stelle: Garantiert das schon klare und distinkte<br />
Bedeutungen? Garantiert das schon die logische Einheit der Bedeutungen<br />
gemäß Subsumtion und Koordination? — Es stellen sich komplementär<br />
noch einige Fragen, die aber die eben erreichte Formalität des Horizontes<br />
der Darstellung wieder sprengen: Was geschieht mit den offenbar zuvor<br />
aussortierten Bedeutungen, die nach der Reduktion zur Fixierung des<br />
Sinnhorizontes nicht in Frage gekommen sind; und wiederum: Mit der<br />
Frage, wie sind dergleichen offenbar unwesentlich gewordenen<br />
Bedeutungen überhaupt entstanden, eröffnet sich zugleich ein Grund<br />
neuerlich zu Fragen, wie Bedeutungen überhaupt entstehen, da von der<br />
Sphäre möglicher Bedeutungen ausgehend der jeweilige Sinnhorizont<br />
nicht konstituierend sondern als Selektionsprinzip auftritt. Die<br />
konstituierende Bedeutung des Sinnhorizontes für die Sphäre der<br />
Bedeutungen scheint nachdem schon wieder nur mehr auf die Hinsichten<br />
der klaren und distinkten Unterscheidung von Merkmalen eingeschränkt<br />
worden zu sein, obgleich nirgends von Bedeutung ohne vorausgesetzten<br />
Sinnhorizont die Rede sein kann. Diese Schwierigkeit kann insofern<br />
behoben werden, wenn mit in Betracht gezogen wird, daß der<br />
Sinnhorizont nicht selbst im konkreten Repräsentationszusammenhang<br />
der Bedeutung mit gegeben sein muß. Es erscheint zuerst die Bedeutung<br />
auf vorläufige Weise, bevor im vorgängig, aber nur unbestimmt<br />
vorausgesetzten Sinnhorizont dieser selbst vorläufig erschließbar wird.
— 1315 —<br />
Daß heißt aber auch, es erscheint niemals nur eine Bedeutung;<br />
Erscheinung kann hier nur so viel heißen, daß für Gegebenes bereits ein<br />
Bedeutungszusammenhang hergestellt werden kann. Dieser<br />
Bedeutungszusammenhang ist seinerseits zwar als die vorläufige<br />
Erscheinungsform des Sinnhorizontes anzusehen, ist aber eben nicht der<br />
für die Erscheinung der Bedeutungen und ihres Zusammenhanges<br />
vorauszusetzende Sinnhorizont selbst, noch weniger gleich der<br />
Sinnhorizont zukünftiger Möglichkeiten.<br />
Wie in der Unklarheit der Unterscheidung von logischer und<br />
transzendentaler Vergleichung der Begriff vom einzelnen Wesen rein<br />
intelligibel und zugleich als oberste materiale Bedingung angesetzt werden<br />
kann, das läßt sich zwar bereits anhand der resolutiven Informiertheit<br />
einer jeden weiter ausgebildeten Ideenlehre vorzeigen, führt aber im<br />
Rahmen von Bedeutung und Sinnhorizont zu einer zeitlichen (genetischen)<br />
Charakteristik; aber nicht mehr zum Anschein eines transzendental<br />
gerechtfertigten Prius der theologischen Idee innerhalb der reinen<br />
Vernunft. Eine genetische Charakteristik konnte auch in anderen<br />
Zusammenhängen der Letztbegründungsproblematik und der abstraktformalen<br />
Erörterung der Horizonte von Gleichursprünglichkeit festgestellt<br />
werden; in der hier behandelten Fragestellung zeigt sich der Grundzug der<br />
transzendentalen Analytik in der spekulativen Philosophie nochmals: Der<br />
ursprünglich vorauszusetzende Sinnhorizont zeigt sich nicht selbst im<br />
formal notwendig gemachten Bedeutungszusammenhang, sondern in<br />
dieser nur als reine und abstrakte Vorläuferschaft des erst in seiner<br />
Vollständigkeit zu erschließenden Sinnhorizontes, der aber seinerseits<br />
gerade in diesem ganz besonderen Falle eben als immer schon implizit<br />
vorausgesetzt betrachtet werden kann, weil eben selbst im Anspruch der<br />
Spekulation auf Totalität bereits abstrakt eingeschrieben. — Die<br />
Schwierigkeit liegt nun darin, daß in Totalität betrachtet, hier einerseits<br />
schlußendlich alles bereits als gleichmäßig gegeben zu betrachten ist,<br />
sodaß für Vorläufigkeit oder dem Anschein von Zeitlichkeit auf Grund der<br />
systematischen Abfolge der Argumentation nach dem Abschluß der<br />
Argumentation, die bis zum immer noch ausständigen Schritt zur<br />
Totalität, aber eben niemals zu dieser selbst führt, eigentlich kein Platz<br />
mehr sein sollte. Andererseits hat es sich für jeden Versuch der<br />
Durchführung einer strengen Argumentation erwiesen, daß diese Figur<br />
der Vorgängigkeit unabweislich für jedes transzendentalanalytisches und<br />
für jedes kritisches Unternehmen wird. Dieser Gegensatz ist einerseits als
— 1316 —<br />
Kritik an den formalontologischen Aspekten einer jeden solchen<br />
Spekulation zu verstehen, und kann deshalb nicht selbst weiter kritisiert<br />
werden. Andererseits kann die sich notgedrungen einstellende<br />
Unabweislichkeit dieses Gegensatzes auch als selbst formalontologische<br />
Ermöglichung von Vorgängigkeit angesehen werden, womit einer<br />
genetischen Charakteristik der Zeitlichkeit ein transztendentales<br />
Fundament gegeben sein könnte, aber jedenfalls auch unter den<br />
Umständen einer abermaligen Abstraktion um der Totalität spekulativ<br />
näher zu kommen, die letzte Möglichkeit anzeigt, mit der problematischen<br />
Exposition einer selbst reinen, aber der Spekulation immanenten und<br />
somit artifiziellen Formalontologie noch das Gegebensein einer<br />
immanenten Mannigfaltigkeit als Bestandstück des Horizontes reiner<br />
Intelligibilität vorzustellen.<br />
Der Verdacht, daß damit nicht nur der Beantwortung der Frage nach dem<br />
Nexus von Leib und Seele, wie sie von Kant in der Auflösung der dritten<br />
Antinomie der kosmologischen Idee vorgestellt wurde, der Boden<br />
entzogen wird, sondern die Sorge um die Superiorität und Reinheit des<br />
Bewußtseinsphänomens selbst schon im unmittelbaren Umkreis der<br />
Spekulation dazu führt, daß die Gottesspekulation allein nach den näheren<br />
Bedingungen der Allwissenheit und der Allgegenwart ausgerichtet<br />
worden ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Insofern hat die Metaphorik<br />
der Anschaulichkeit wegen ihrer Ermöglichung zur nachprüfbaren<br />
Entfernung und Abstraktion unversehens an Bedeutung gewonnen, sodaß<br />
auch von hier aus auf eine gewisse Einseitigkeit, und daraus resultierend,<br />
auf die Unvollständigkeit der eingeleiteten Untersuchung der Totalität<br />
reiner Intelligibilität geschlossen werden kann. So bleibt die Kritik an der<br />
formalontologischen Charakteristik der reinen dialektischen<br />
Vernunftspekulation aufrecht, wie in aller Unabgeschlossenheit gerade die<br />
Besonderheit dieser Spekulation, daß ihre Alternativen aufeinander<br />
zurückführen, verhindert, daß diese Kritik zur absoluten Beendigung der<br />
Spekulation führt. Diese einzige letzte Flucht von Horizonten der Totalität<br />
nach dem vermeintlichen Abschluß in der rein modalen Spekulation<br />
absoluter Notwendigkeit ins Personale, von eben dieser Kritik selbst als<br />
Artefakt verdächtigt, sprengt immerhin auch selbst den<br />
formalontologischen Aspekt der Elemente dieser Spekulation, indem den<br />
Artefakten und Fakten gedanklich noch die Spontaneität der reinen<br />
Intelligibilität gegenübergestellt wird.
— 1317 —<br />
Dabei ergibt sich abermals ein Hinweis auf eine mögliche, in Hinblick auf<br />
die systematische Erörterung sogar wiederum mit Notwendigkeit<br />
behaftete Erweiterung der Spekulation, indem mit den Übergängen von<br />
der Möglichkeit zum Vermögen, und vom Vermögen zum Personalen,<br />
nunmehr im Übergang von der kosmologischen zur theologischen Idee,<br />
auch inmitten einer von der ontotheologischen Erörterung ausgehenden<br />
Spekulation dasjenige wieder zum Vorschein kommt, was der<br />
kosmologischen Idee im Rücken liegt: die psychologische Idee. Insofern<br />
zeichnet sich eine Bewegung ab, die gewissermaßen im Grundriss eine<br />
geschlossene Figur zu bilden scheint: Die psychologische Idee entäußert<br />
sich zur kosmologischen Idee, diese findet in ihrer Dialektik (insbesondere<br />
die dritte und vierte Antinomie) problematisch, das aber offenbar mit<br />
Notwendigkeit, die theologische Idee, welche im Zuge der<br />
fortschreitenden Abstraktion und Totalisierung in einen ihrer alternativen<br />
Möglichkeiten der Spekulation wieder in den Formenkreis der<br />
psychologischen Idee gerät. Dieses nicht Zuende-Kommen-Können der<br />
Spekulation entsteht entweder (a) durch das In-Einheit-setzen von<br />
Gegensätzen (was möglich sein muß: Gegensätze gibt es nur in Begriffen,<br />
nicht im Dasein der Dinge), oder (b) durch das doppelte Enthalten-sein<br />
eines Begriffes, sodaß er einmal als Bedingung und einmal als Teil der<br />
Konsequenz erscheint, oder (c) wenn ein solcher Begriff sowohl Teilbegriff<br />
eines möglichen ganzen Begriffs ist, und zugleich dieser mögliche ganze<br />
Begriff bereits abstrakt-unbestimmt Teil dieses Begriffes ist. Letzteres wird<br />
z. B. in der Untersuchungen zur Substanzkategorie bemerklich, wo zuerst<br />
der Wechsel als Charakteristik der transzendentalen Zeitbedingung<br />
gebraucht wird, dann aber Teil des reinen Verstandesbegriffes der<br />
transzendentalen Kategorie wird, der nichts als den wechselseitigen<br />
analytischen Gegensatz von Wechsel und Beharrlichkeit enthält. Doch<br />
wird auch klar, inwiefern mit dem Wechsel der Position der Begriff<br />
»Wechsel« einen Bedeutungswandel mitmacht, sodaß von logischer<br />
Identität der durchgängigen Charakteristik der transzenentalen<br />
Zeitbedingung mit der logischen Zeitbedingung, welche im reinen<br />
Verstandesbegriff ausgedrückt wird, gerade nicht mehr die Rede sein<br />
kann. Eben dieser Unterschied kann als konstituierend für die vollständige<br />
transzendentale Deduktion der Kategorien, die Kant bekanntlich nur<br />
angerissen hat, angesehen werden.<br />
Diese Bewegung soll dann schon in sich selbst Ausdruck der intelligiblen<br />
Kausalität sein, bevor der systematische Abschluß und die vollständige
— 1318 —<br />
Konstitution des Sinnhorizontes in der Totalität reiner Spekulation<br />
idealiter in eins gesetzt werden kann. — Das reine Gegebensein kann also<br />
spekulativ auch schon wieder rückblickend als reines und immanentes<br />
Phänomen betrachtet werden, was aber den Verlust des Anscheins reiner<br />
Zeitlosigkeit, die jedem formalontologisch faßbaren (beschreibbaren)<br />
Spekulationsschritt eigen ist, auch inhaltlich (wenn auch nur als<br />
Verschobenheit der Bedeutung) nach sich zieht. So beginnt bei Kant die<br />
reine Intelligibilität letztlich aus sich selbst und durch ihre Bewegung in<br />
der reinen Vernunftspekulation in sich selbst vorbereitet, bereits in die<br />
Zeitlichkeit zu fallen, während das rein intellektuell Gegebene als selbst<br />
geschaffenes Artefakt der Bewegung der Spekulation gegenüberzustehen<br />
beginnt.
— 1319 —<br />
C. ZUM BEWEIS DER THEOLOGISCHEN IDEE ALS<br />
VERNUNFTBEGRIFF A PRIORI<br />
1. Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der<br />
menschlichen Vernunft. Die vernunftimmanente<br />
Notwendigkeit der Ideen vom Urwesen und der Welt und der<br />
Mangel der Darstellung ersterer als regulative Vernunftidee<br />
I. Die Differenz von logischer Möglichkeit und einer Möglichkeit, die<br />
Vernunft und Erfahrung nicht zuwider ist<br />
»Man kann sich eines Begriffes a priori mit keiner Sicherheit bedienen,<br />
ohne seine transzendentale Deduktion zu Stande gebracht zu haben. Die<br />
Ideen der reinen Vernunft verstatten zwar keine Deduktion von der Art,<br />
als die Kategorien; sollen sie aber im mindesten einige, wenn auch nur<br />
unbestimmte, objektive Gültigkeit haben, und nicht nur bloß leere<br />
Gedankendinge (entia rationis ratiocinatis) vorstellen. So muß durchaus<br />
eine Deduktion desselben möglich sein, gesetzt, daß sie auch von<br />
derjenigen weit abwiche, die man mit den Kategorien vornehmen kann.<br />
[...] Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein<br />
Gegenstand schlechthin, oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben<br />
wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand<br />
zu bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein<br />
Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, sondern<br />
welches nur dazu dient, um andere Gegenstände, vermittelst der<br />
Beziehung auf diese Idee, nach ihrer systematischen Einheit, mithin<br />
indirekt uns vorzustellen. So sage ich, der Begriff einer höchsten<br />
Intelligenz ist eine bloße Idee, d. i., seine objektive Realität soll nicht darin<br />
bestehen, daß er sich geradezu auf einen Gegenstand bezieht (denn in<br />
einer solchen Bedeutung würden wir seine objektive Gültigkeit nicht<br />
rechtfertigen können), sondern er ist nur ein nach Bedingungen der<br />
größten Vernunfteinheit geordnetes Schema [...].« (B 697 f./A 669 f.)<br />
»Alsdenn heißt es z. B. die Dinge der Welt müssen so betrachtet werden,<br />
als ob sie von einer höchsten Intelligenz ihr Dasein hätten. Auf solche<br />
Weise ist die Idee eigentlich nur ein heuristischer und nicht ostensiver<br />
Begriff, und zeigt an, nicht wie ein Gegenstand beschaffen ist, sondern, wie<br />
wir, unter der Leitung desselben, die Beschaffenheit und Verknüpfung der<br />
Gegenstände der Erfahrung überhaupt suchen sollen. Wenn man nun
— 1320 —<br />
zeigen kann, daß, ogbleich die dreierlei transzendentalen Ideen<br />
(psychologische, kosmologische und theologische,) direkt auf keinen ihnen<br />
korrespondierenden Gegenstand und dessen Bestimmung bezogen<br />
werden, dennoch alle Regeln des empirischen Gebrauchs der Vernunft<br />
unter Voraussetzung eines solchen Gegenstands in der Idee auf<br />
systematische Einheit führen und die Erfahrungserkenntnis jederzeit<br />
erweitern, niemals aber derselben zuwider sein können; so ist es eine<br />
notwendige Maxime der Vernunft nach dergleichen Ideen zu verfahren.<br />
Und dieses ist die transzendentale Deduktion aller Ideen der spekulativen<br />
Vernunft, nicht als konstitutive Prinzipien der Erweiterung unserer<br />
Erkenntnis über mehr Gegenstände, als Erfahrung geben kann, sondern als<br />
regulativer Prinzipien der systematischen Einheit des Mannigfaltigen der<br />
empirischen Erkenntnis überhaupt, welche dadurch in ihren eigenen<br />
Grenzen mehr angebauet und berichtigt wird, als es ohne solche Ideen,<br />
durch den bloßen Gebrauch von Verstandesgrundsätze, geschehen<br />
konnte.« (B 698 f./A 670 f.)<br />
Ich möchte diese Darstellung Kantens ergänzen: Erstens, weil es offenbar<br />
interpretationsbedürftig geblieben ist, wie die Differenz von logischer<br />
Möglichkeit aus Widerspruchsfreiheit, und derjenigen Möglichkeit, die<br />
darin liegt, daß sie den Bedingungen empirischer Erfahrung und der<br />
Vernunft nicht »zuwider« sind, aus ihrer Negativität zu heben sei.<br />
Zweitens, um festzustellen, daß der transzendentale Beweis, der gerade im<br />
Fall der Vernunftbegriffe als regulative Prinzipien nach meinen<br />
vorhergehenden Untersuchungen erst ostensiv erfolgen müßte, um mit der<br />
Beweiskraft der Deduktion der Kategorien des Verstandesgebrauches<br />
verglichen werden zu können, immerhin gleichsinnig verläuft mit der<br />
ebendort vertretenen Auffassung, zumindest die obersten Ideen der<br />
regulativen Prinzipien wären als Sätze a priori beweisbar. In meiner<br />
strengen Version der Lesung wird für die Behauptung objektiver Realität<br />
die Kontinuität der Zeitbedingung eingefordert, die für sich aber nicht von<br />
vorneherein nur von der Sinnlichkeit gegeben werden müßte; das wird<br />
erst im Zusammenhang mit den »psychologischen« Bedingungen des<br />
transzendentalen Subjekts notwendig. Insofern kann ich Kant nur<br />
dahingehend verstehen, daß er, so wie etwa in der Skizze der zeitlichen<br />
Dimensionierungshorizonte des Regressus auch, den Nachweis der<br />
Transzendentalität der Deduktion selbst substituieren kann, indem der<br />
einzige weiter verfolgte Argumentationsstrang bei der Formulierung<br />
seiner zentralen modalen Forderung nicht objektive Realität, sondern nur
— 1321 —<br />
objektive Gültigkeit verlangt. Dies ist für das Prinzip selbst,<br />
Vernunftbegriffe als regulative Prinzipien aufzufassen, noch möglich, nicht<br />
aber für die Prinzipien a parte priori. Die Vernunftprinzipien a parte priori<br />
sind eben nicht von a priori Geltung. Das aber ist unabhängig von der<br />
Frage, ob man von einer endlosen Reihe der Ursachen ausgeht oder von<br />
einer ersten Ursache. Jedoch gibt es auch inhaltlich weiter bestimmte<br />
regulative Vernunftprinzipien wie das transzendental genannte Prinzip<br />
der Spezifikation, die selbst als Prinzipien a priori zu gelten haben, deren<br />
Anwendung auf Erfahrungserkenntnisse zumindest transzendental<br />
genannt werden kann. Diese regulativen Vernunftprinzipien a priori<br />
gelten ebenfalls unabhängig von der Entscheidung in der Frage, ob eine<br />
erste, selbst nicht verursachte Ursache gibt oder eine endlose Reihe von<br />
Ursachen. Vergleichbares sollte man auch durch die »reelle Immanenz«<br />
reiner Spekulation in der theologischen Idee als erfüllbar vorstellen<br />
können, wenn man von der theologischen Idee Begriffe objektiver<br />
Gültigkeit erwartet und dieser selbst eine heuristische und dazu noch für<br />
die Architektonik der ganzen Vernunft regulative Funktion zuschreibt.<br />
Letzteres hat sich als definitiv falsch erweisen lassen.<br />
Drittens, weil die Einzigkeit der Argumentation nun das formale Indiz für<br />
die Transzendentalität aller reinen Vernunftbegriffe wäre, auch wenn sie<br />
nur in ihrem regulativem Gebrauch betrachtet werden. Daß dies für die<br />
ganze theologische Idee, also nicht nur die Untersuchungen zum<br />
transzendentalen Ideal gelten soll, muß über den Zweifel an der<br />
heuristischen Funktion in Hinblick auf das sich abzeichnende<br />
Doppelsystem vom psychologischer und kosmologischer Idee hinaus,<br />
bezweifelt werden, obgleich der Anspruch auf objektive Gültigkeit einiger<br />
Argumente erwiesen werden konnte.<br />
Viertens hat sich die Einschränkung der reinen Vernunftbegriffe auf die<br />
heuristische Funktion gegenüber der empirischen Erkenntnis des<br />
kategorialen Verstandesgebrauches als das inhaltliche Indiz für die<br />
Transzendentalität deren Deduktion erwiesen; doch ist eben letzteres nur<br />
auf Grund der transzendentalen Deduktion der Kategorien der reinen<br />
Verstandesbegriffe möglich und die transzendentale Differenz ist von der<br />
Doktrin der bestimmenden Urteilskraft geborgt. Insofern ist es nur eine<br />
mittelbare Verwendung einer transzendentalen Rechtfertigung, und<br />
eigentlich selbst kein vollständiger transzendentaler Beweis. Ich verstehe<br />
diese Schwierigkeit mit dem Anspruch auf eine transzendentale Deduktion<br />
bei strenger Lesung eben als Indiz, daß Kant auch Gründe gegen die<br />
dogmatische Durchführung des strikten transzendentalen Idealismus
— 1322 —<br />
gesucht hat, der ihn bei der Auflösungen der Antinomien der<br />
kosmologischen Ideen verleitet hat, Zugeständnisse zu machen, die den<br />
transzendentalidealistischen Voraussetzungen entgegenstehen.<br />
Fünftens, um daran zu erinnern, daß damit von den<br />
Beantwortungsversuchen der Frage nach der Natur der Wirkung der<br />
intelligiblen Kausalität letzlich nur der Imperativ in der Auflösung der<br />
dritten Antinomie weiter behandelt worden ist, indem — wie in den<br />
Kategorien die Voraussetzung zur Rechtfertigung der reinen<br />
Verstandesbegriffe die Sinnlichkeit war — die Deduktion des Prinzips des<br />
regulativen Gebrauchs der Vernunftideen auf der Vorausetzung des<br />
bedingten Imperativs beruht; und zwar wegen der Charakterisierbarkeit<br />
oder Übersetzbarkeit regulativer Prinzipien als Maxime. Weder die<br />
intelligible Spontaneität gegenüber dem inneren Sinn und dem Gemüt als<br />
Einbildungskraft, noch die intersubjektive Entstehung und Wirkungsweise<br />
der Zeichenhaftigkeit unseres intentionalen Bewußtseins werden von<br />
diesen Definitionen unmittelbar berührt. Die eigentliche Frage nach der<br />
Kausalität durch Freiheit, wie es wirklich geschieht, daß wir die<br />
Naturursachen für unsere Zwecke zu neuen Naturdetermination<br />
zusammenfügen vermögen, konnte mit dem Verweis auf die Leiblichkeit<br />
nicht zur völligen Zufriedenheit beantwortet werden, und führt zurück<br />
zur Frage nach dem Ursprung und dem Umfang der Einbildungskraft, die<br />
im Rahmen der Begründungsproblematik sowohl von objektiver<br />
Gültigkeit wie von objektiver Realität bereits als notwendige<br />
Hilfsannahme der transzendentalen Psychologie gekennzeichnet worden<br />
ist. Die Hypothesen zu diskutieren, die intelligible Spontaneität sei<br />
gegenüber dem inneren Sinn (in Folge auch gegenüber dem Gemüt) als<br />
Einbildungskraft tätig, oder die intelligible Spontaneität verbleibt in der<br />
intellektuellen Synthesis und die Einbildungskraft folgt dieser nur nach,<br />
wie es in dieser Arbeit im dritten und im ersten Teil dieses Abschnittes<br />
erfolgt ist, scheint so nicht für alle Abschnitte der Untersuchung von<br />
gleicher Bedeutung zu sein, doch bleibt der Zusammenhang dieser<br />
»psychologischen« Fragestellungen mit dem Argumentationsstrang zum<br />
Problem der Kausalität durch Freiheit in den Kritiken wie ausgeblendet.<br />
Kant hat in der Tat hier Größeres vor: Er will, nachdem er die regulativen<br />
Prinzipien der Vernunft als Maximen charakterisieren konnte, zum<br />
Endweck der Vernunft vorstoßen. Dazu wird mit einem Aufriß der<br />
transzendentalen Vernunftideen begonnen, aus dem offenkundig wird,<br />
daß diese bereits auf die Analogien zum kategorialen Verstandesgebrauch
— 1323 —<br />
eingeschränkt worden sind, ohne daß diese Umständlichkeit eigens noch<br />
Erwähnung findet. Kant will die oben gegebene Darstellung deutlicher<br />
machen. Es ist zu beobachten, ob die größere Deutlichkeit den Beweis a<br />
priori, der von der reinen Vernunft gefordert wird, betrifft, oder ob es die<br />
Transzendentalität der Deduktion der regulativen Prinzipien betrifft. Oder<br />
aber, ob das gesuchte reine synthetische Urteil a priori der reinen Vernunft<br />
(anders als in der Deduktion der Kategorien) nicht schon einen Grundsatz<br />
der reinen praktischen Vernunft ergeben muß, oder doch mit der<br />
Erörterung der Dialektik der ästhetischen und teleologischen Urteilskraft<br />
das höhere Begehrungsvermögen in der Kritik der Urteilskraft bereits<br />
gefunden ist. Die letzte Fragestellung wird wohl hier nicht mehr mit<br />
gebührender Klarheit beantwortet werden können; entscheidend für die<br />
kritische Betrachtung bleibt, daß damit die Überlegung zum ersten Mal<br />
die Beschränkung auf die Verhältnisse der Erkenntnisvermögen<br />
überwunden hat. Diese systematische Ausweitung ist schon in der Kritik<br />
der reinen Vernunft vorgezeichnet.<br />
»Ich will dieses deutlicher machen. Wir wollen den genannten Ideen als<br />
Prinzipien zu Folge erstlich (in der Psychologie) alle Erscheinungen,<br />
Handlungen und Empfänglichkeit unseres Gemüts an dem Leitfaden der<br />
inneren Erfahrung so verknüpfen, als ob dasselbe eine einfache Substanz<br />
wäre, die, mit persönlicher Identität, beharrlich (wenigstens im Leben)<br />
existiert, indessen, daß ihre Zustände, [zu welchen] die des Körpers nur als<br />
äußere Bedingungen gehören, kontinuierlich wechseln. Wir müssen<br />
zweitens (in der Kosmologie) die Bedingungen, der inneren sowohl als der<br />
äußeren Naturerscheinungen, in einer solchen nirgend zu vollendeten<br />
Untersuchungen verfolgen, als ob dieselbe an sich unendlich und ohne ein<br />
erstes oder oberstes Glied sei, obgleich wir darum, außerhalb aller<br />
Erscheinungen, die bloß intelligiblen ersten Gründe derselben nicht<br />
leugnen, aber sie doch niemals in den Zusammenhang der<br />
Naturerklärungen bringen dürfen, weil wir sie gar nicht kennen. Endlich<br />
und drittens müssen wir (in Ansehung der Theologie) alles, was nur immer<br />
in den Zusammenhang möglicher Erfahrung gehören mag, so betrachten,<br />
als ob diese eine absolute, aber durch und durch abhängige und noch<br />
immer noch innerhalb der Sinnenwelt bedingte Einheit ausmache, doch<br />
aber zugleich, als ob der Inbegriff aller Erscheinungen (die Sinnenwelt<br />
selbst) einen einzigen obersten und allgenugsamen Grund außer ihrem<br />
Umfange habe, nämlich eine gleichsam selbständige, ursprüngliche und<br />
schöpferische Vernunft, in Beziehung auf welche wir allen empirischen
— 1324 —<br />
Gebrauch unserer Vernunft in seiner größten Erweiterung so richten, als ob<br />
die Gegenstände selbst aus jenem Urbilde aller Vernunft entsprungen<br />
wären, das heißt: nicht von einer einer einfachen, denkenden Substanz die<br />
inneren Erscheinungen der Seele, sondern nach der Idee eines einfachen<br />
Wesens jene von einander ableiten; nicht von einer höchsten Intelligenz die<br />
Weltordnung und systematische Einheit derselben ableiten, sondern von<br />
der Idee einer höchstweisen Ursache die Regel hernehmen, nach welcher<br />
die Vernunft bei der Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen in der<br />
Welt zu ihrer eigenen Befriedigung am besten zu gebrauchen sei.«<br />
(B 700 f./A 672 f.)<br />
II. Das Problem der Einzigkeit und die notorische Unklarheit der<br />
Verbindbarkeit oberster dialektischer Ideen.<br />
Die einfache Idee von Etwas<br />
Dies ist eben, summarisch gesprochen, eine architektonische Begründung,<br />
der noch aufzuzeigen wäre, daß sie wirklich die einzige mögliche<br />
Argumentation ist, um das erste formale Argument für die<br />
Transzendentalität des Beweises der Prinzipien des regulativen Gebrauchs<br />
für alle Vernunftbegriffe auszumachen. Kant gibt offenbar zuerst die<br />
allgemeine Empfehlung, den transzendentalen Schein aus heuristischen<br />
Gründen zu folgen, ohne die in den Ideen nur gedachten Gegenstände als<br />
objektiv real anzuerkennen. Nur in der theologischen Idee ist die Situation<br />
offenbar nicht so übersichtlich: Das erste Paar des »als ob« ist leicht<br />
verständlich und beinhaltet nichts als die wie vorläufig auch immer zu<br />
verstehende Berechtigung, weiterhin an eine prästabilierte Harmonie zu<br />
glauben. Ich will vom zweiten »als ob« an die Komplizierung in der<br />
theologischen Idee näher verfolgen.<br />
(i)<br />
»als ob der Inbegriff aller Erscheinungen (die Sinnenwelt selbst) einen<br />
einzigen obersten und allgenugsamen Grund außer ihrem Umfange habe,<br />
nämlich eine gleichsam selbständige, ursprüngliche und schöpferische<br />
Vernunft« — Diese Forderung nach einer personalen ersten oder obersten<br />
Ursache schließt wohl die Verknüpfung der obersten oder ersten Ursache<br />
mit der höchsten Intelligenz bereits mit ein. Gerade die Notwendigkeit<br />
außer der unserer von Totalität zu Totalität fortschreitenden spekulativen<br />
Vernunft selbst bleibt Kant jedoch schuldig.
— 1325 —<br />
(ii)<br />
»in Beziehung auf welche wir allen empirischen Gebrauch unserer<br />
Vernunft in seiner größten Erweiterung so richten, als ob die Gegenstände<br />
selbst aus jenem Urbilde aller Vernunft entsprungen wären, das heißt:<br />
nicht von einer einfachen, denkenden Substanz die inneren Erscheinungen<br />
der Seele, sondern nach der Idee eines einfachen Wesens jene von einander<br />
ableiten« — Die hier als Spezifizierung präsentierte Beziehung unserer<br />
Vernunft auf den »obersten und allgenugsamen Grund« schränkt diesen<br />
zum Urbild ein. Aber nicht als synthetische Metaphysik sollen wir die<br />
notwendigen Vorstellungen (Ideen) aus einer gegebenen einfachen,<br />
denkenden Substanz gemäß Kategorien, sondern, insofern bereits kritisch,<br />
die Gegenstände aus der Idee eines einfachen Wesens gemäß des<br />
transzendentalen Prinzips der Spezifikation ableiten. Dann aber sollen wir<br />
den strikten transzendentalen Idealismus abermals entlang Prinzipien des<br />
regulativen Gebrauch der reinen Vernunftbegriffe verlassen, und uns<br />
dabei an den selbst metaphysischen Schein als Leitfaden halten. Damit<br />
wird der zum Urbild der Vernunft degradierte »oberste und allgenugsame<br />
Grund«, der als solches als archetypus intellectus das Auslangen finden<br />
würde, nur wieder zum prototypon transcendentale erhöht, woraus alle<br />
Gegenstände nur ectypa sind. Dies deshalb, weil regulative<br />
Vernunftprinzipien insofern transzendental genannt werden können,<br />
wenn sie sich mittelbar auf empirische Verstandeserkenntnisse beziehen<br />
lassen, womit in modo obliquo ein wirklicher Gegenstand mitgedacht<br />
werden könnte. Das aber reicht im Rahmen der spekulativen Überlegung<br />
der theologischen Idee zur transzendentalenVerwechslung bereits zu. Was<br />
Kant kaum jemals beachtet, ist der Umstand, daß die Erörterung der<br />
theologischen Idee, methodisch gesehen, in wesentlichen Zügen nicht die<br />
Untersuchung einer transzendentalen Idee, sondern die Untersuchung<br />
eines Ideals ist.<br />
(iii)<br />
»nicht von einer höchsten Intelligenz die Weltordnung und systematische<br />
Einheit derselben ableiten, sondern von der Idee einer höchstweisen<br />
Ursache die Regel hernehmen, nach welcher die Vernunft bei der<br />
Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen in der Welt zu ihrer eigenen<br />
Befriedigung am besten zu gebrauchen sei« — Allerdings erhält der<br />
»oberste und allgenugsame Grund« nicht alle vermuteten Würden; gerade<br />
die Vorstellung einer höchsten Intelligenz entspringt zwar notwendig der<br />
spekulativen reinen Vernunft, aber eben nicht notwendig als einzige
— 1326 —<br />
Vorstellung, und wird von der »Idee einer höchstweisen Ursache« ersetzt,<br />
was aber nur der Wechsel von einem transzendenten Scheingrund zu<br />
einen anderen ist. Das »Als ob« hat den Zweck, die regulative Funktion<br />
der theologischen Idee für die prästabilierte Harmonie zwischen res<br />
cogitans und res extensa an Stelle der sich der Diskussion entziehenden<br />
Problematik des nexus von Leib und Seele zu benutzen, da der Beweis der<br />
Kausalität durch Freiheit eigentlich nicht vollständig gelungen ist. Es gibt<br />
einen moralischen Grund und einen heuristischen Grund für diese<br />
optimistische Hypothese. Letzterer liegt im Wissenschaftsfortschritt,<br />
ersterer im Optimismus, der in der Gunst unsererer Existenz seinen ersten<br />
Grund findet.<br />
Allerdings findet Kant selbst, daß auf diesem Wege von Transzendentalität<br />
nur mehr die Rede sein kann, wenn die kosmologische mit der<br />
theologischen Idee zusammenfällt; die grundsätzliche Leugnung der<br />
Möglichkeit, spekulativ auf Aussagen objektiver Gültigkeit zu gelangen,<br />
kann ich nur mehr im Zusammenhang mit dem ungelösten Problem der<br />
Einzigkeit, die als erstes formales Kriterium transzendentaler Beweise zu<br />
fordern ist, verstehen: »So ist der transzendentale und einzige bestimmte<br />
Begriff, den uns die spekulative Vernunft von Gott gibt, im genauesten<br />
Verstande deistisch, d. i. die Vernunft gibt nicht einmal objektive<br />
Gültigkeit eines solchen Begriffs, sondern nur die Idee von Etwas an die<br />
Hand, worauf alle empirische Realität ihre höchste und notwendige<br />
Einheit gründet, und welches wir uns nicht anders, als nach der Analogie<br />
einer wirklichen Substanz, welche nach Vernunftgesetzen die Ursache aller<br />
Dinge sei, denken können, wofern wir es ja unternehmen, es überall als<br />
einen besonderen Gegenstand zu denken, und nicht lieber, mit der bloßen<br />
Idee des regulativen Prinzips der Vernunft zufrieden, die Vollendung aller<br />
Bedingungen des Denkens, als überschwenglich für den menschlichen<br />
Verstand, bei Seite setzen wollen [...].« (B 703/A 675)<br />
Noch genauer überlegt, ist die »Idee von Etwas [...], worauf alle empirische<br />
Realität ihre höchste und notwendige Einheit gründet« keineswegs auch<br />
nur ein deistischer Begriff von Gott; und zwar eben so wenig, wie die Idee<br />
der Welt als einfache Ableitung aus dieser einfachsten Idee von Etwas<br />
gedacht werden kann: »Die Begriffe der Realität, der Substanz, der<br />
Kausalität, selbst die der Notwendigkeit im Dasein, haben, außer dem<br />
Gebrauche, da sie die empirische Erkenntnis eines Gegenstandes möglich<br />
machen, gar keine Bedeutung, die irgend ein Objekt bestimmete. Sie<br />
können also zwar zu Erklärung der Möglichkeit der Dinge in der
— 1327 —<br />
Sinnenwelt, aber nicht der Möglichkeit eines Weltganzen selbst gebraucht<br />
werden, weil dieser Erklärungsgrund außerhalb der Welt und mithin kein<br />
Gegenstand einer möglichen Erfahrung sein müßte. Nun kann ich<br />
gleichwohl ein solches unbegreifliches Wesen, den Gegenstand einer<br />
bloßen Idee, relativ auf die Sinnenwelt, obgleich nicht an sich selbst,<br />
annehmen.« (B 705/A 677) Doch ist erstens die Erklärung des Weltganzen<br />
aus einem selbst unbegreiflichen Wesen verschieden von dem Grund,<br />
weshalb allein aus der bloßen Idee von Etwas weder ein deistischer Begriff<br />
Gottes noch die Idee vom Weltganzen abgeleitet werden kann; und<br />
zweitens ist die Idee eines dem Weltganzen zugrunde liegendes<br />
unbegreifliches Wesens zwar zweifelos eine notwendige Idee insofern, als<br />
daß eine solche Idee spekulativ zu erörtern sein wird, doch aber eben nicht<br />
in dem Sinne, daß sie die einzige, und deshalb notwendige Idee ist, welche<br />
spekulativ dem Weltganzen oder auch nur der Vorstellung vom<br />
Weltganzen als Grund genommen werden könnte. Der eigentliche Grund<br />
der Auszeichnung dieser Idee liegt in der Eigenschaft der spekulativen<br />
Totalität, sich selbst überschreitend zu sein, und weil die intensionale<br />
Logik das formale Gerüst hergibt, ist ein einzelnes, außerhalb der<br />
Sinnenwelt liegendes Wesen als der Grund dieser Sinnenwelt das Ergebnis<br />
der Spekulation, die allerdings noch einige Male überschritten werden<br />
kann.<br />
Dann aber geht Kant sogar noch über den einfachen deistischen Begriff<br />
hinaus, indem er nicht nur die »Realitäten der Welt« zusammen zur<br />
Totalität, sondern zuerst diese nochmals zur höchsten Vollkommenheit<br />
steigert: »Ich werde mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt,<br />
der Substanzen, der Kausalität und der Notwendigkeit, ein Wesen denken,<br />
das alles dieses in der höchsten Vollkommenheit besitzt, und indem diese<br />
Idee bloß auf meiner Vernunft beruht, dieses Wesen als selbstständige<br />
Vernunft, was durch Ideen der größten Harmonie und Einheit, Ursache<br />
vom Weltganzen ist, denken können.« (B 706/A 678) Dieses Wesen hätte,<br />
wenn es nicht bloß ein Produkt unserer überschwänglichen Vernunft wäre,<br />
zweifellos aus seiner höchsten Vollkommenheit heraus selbstständige<br />
Vernunft, und wäre dann auch der Grund des Weltganzen. Kant enthüllt<br />
damit wieder ein Moment der Willkür in der Einrichtung der ganzen<br />
Ideenlehre, die jedoch ohne Darstellung des Überschwanges gegenüber<br />
unserem Verstand, im Versuch, mit Vernunftbegriffe unmittelbar<br />
Wirklichkeit als objektive Realität zu denken, selbst nicht zu denken ist.<br />
Wenn wir demnach, obzwar nur aus subjektiver Notwendigkeit unserer
— 1328 —<br />
Vernunft, gezwungen sind, am transzendentalen Schein anzubauen, auch<br />
wenn die Deduktion diesen Schein immer wieder auf den regulativen<br />
Gebrauch einschränkt, dann stellen wir den »obersten allgenugsamen<br />
Grund« selbst nicht als Urbild oder prototypon transcendentale und<br />
Ursubstanz in außerweltliche Analogie zur Sinnenwelt vor, sondern wir<br />
personifizieren die Idee einer höchstweisen Ursache zur höchsten<br />
Intelligenz.<br />
In Frage steht also auch, ob und wie weit aus Gründen eines möglichen<br />
regulativen Gebrauches des reinen Vernunftbegriffs der Überschwang der<br />
spekulativen Vernunft in die eine wie in die andere Richtung im<br />
Nachhinein gerechtfertigt werden kann: »Werfen wir unseren Blick nun<br />
auf den transzendentalen Gegenstand unserer Idee, so sehen wir, daß wir<br />
eine Wirklichkeit nach den Begriffen von Realität, Substanz, Kausalität etc.<br />
an sich selbst nicht voraussetzen können, weil diese Begriffe auf etwas, das<br />
von der Sinnenwelt ganz unterschieden ist, nicht die mindeste<br />
Anwendung haben. Also ist die Supposition der Vernunft von einem<br />
höchsten Wesen, als oberster Ursache, bloß relativ, zum Behuf der<br />
systematischen Einheit der Sinnenwelt gedacht, und ein bloßes Etwas in<br />
der Idee, wovon wir, was es an sich sei, keinen Begriff haben. Hierdurch<br />
erklärt sich auch, woher wir zwar in Beziehung auf das, was existierend in<br />
den Sinnen gegeben ist, der Idee eines an sich notwendigen Urwesens<br />
bedürfen, niemals aber von diesem und seiner Notwendigkeit den<br />
mindesten Begriff haben können.« (B 707/A 679) Hier ist unbedingt<br />
mehrfach Einspruch zu erheben: Bislang konnte Kant durchaus nicht<br />
erweisen, daß die Idee eines höchsten Wesens zum regulativen Gebrauch<br />
kosmologischer Ideen etwas beiträgt; er hat vielmehr das Gegenteil<br />
bewiesen. Die Idee vom höchsten Wesen mit der Idee von einem bloßen<br />
Etwas zu erläutern, ihr damit sogar bereits eine notwendige Stelle zu<br />
geben, darin vermag ich nur reine Spekulation zu entdecken; und<br />
schlußendlich kann gerade von der Bedürftigkeit unserer Vernunft, ein<br />
Urwesen in Beziehung auf das, »was existierend in den Sinnen gegeben<br />
worden ist« unmittelbar notwendigerweise zu denken, nicht die Rede sein.<br />
Letzteres sogar dann nicht, wenn nicht nur der logische Gebrauch von<br />
Vernunftideen, sondern auch der dialektische Gebrauch bedacht wird. —<br />
Wie ich in diesem Abschnitt zeigen konnte, geht es aber doch um die Frage<br />
der Vereinbarkeit von Intelligibilität und Materialität, die im Rahmen der<br />
ontotheologischen Spekulation unweigerlich mit dem Gottesbeweis von<br />
Anselm von Canterbury und der scholastischen Vorstellung zu tun
— 1329 —<br />
bekommt, daß Gott die Dinge in Existenz versetze. Vor diesem<br />
Hintergrund wird die Darstellung Kants als historisch verständlich, zumal<br />
ich aufweisen konnte, daß hierin ein letztmöglicher Horizont der<br />
spekulativen Erörterung der Gründe eines einheitlichen Begriffs vom Sein<br />
vorliegt — allerdings eben auf eine Weise, wie ein solcher letzmöglicher<br />
Horizont der Spekulation um die Einheit des Seinsbegriffs für gerade<br />
diesen Strang der spekulativer Totalisierung gebildet werden kann,<br />
welches ein Urwesen überhaupt für notwendig erachtet.<br />
Die aufgeworfene Frage geht über die modale Frage hinaus, obgleich es<br />
bemerkenswert ist, das diese Rechtfertigung weniger leistet als die<br />
bisherigen Deduktionsversuche des Prinzips des regulativen Gebrauches<br />
der Vernunftbegriffe. Daß Kant im Rahmen der theologischen Idee so<br />
starke Entwürfe vorlegt, liegt meines Erachtens nicht nur an der<br />
Erhabenheit des Themas, sondern um nichts weniger wieder daran, daß<br />
Kant die prästabilierte Harmonie benötigt, um die ungelöste Schwierigkeit<br />
der Verbindung zwischen res cogitans und res extensa bei der Deduktion<br />
der Kausalität durch Freiheit auf höherer Ebene architektonisch wieder<br />
wettzumachen. 42<br />
III. Der Weltbegriff und dessen Mißbrauch in der einfachen<br />
obersten Idee. Das nur mittelbar transzendentale Prinzip der<br />
Spezifikation und die platonische Diaresis<br />
Im Anschluß zeigt Kant, wie die in den Paralogismen aufgeworfenen<br />
Schwierigkeiten, der Seele eine einfache Substanz zu Grunde zu legen, sich<br />
auflösen, wenn die Konzepte einer einfachen Substanz und einer<br />
Grundkraft nur in dieser regulativen Funktion, nach empirischer<br />
Möglichkeit den systematischen Zusammenhang zu befördern, betrachtet<br />
werden. Die psychologische Idee ist meines Erachtens die klarste, sodaß<br />
die schon erfolgten Erörterungen im zweiten Abschnitt ausreichen sollte.<br />
Ich gehe also gleich über zur zweiten regulativen Idee:<br />
»Die zweite regulative Idee der bloß spekulativen Vernunft ist der<br />
Weltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur das einzige gegebene<br />
Objekt, in Ansehung dessen die Vernunft regulative Prinzipien bedarf.<br />
42 Benedikt, Philosophischer Empirismus. Theorie. Herder, Wien, Freiburg, Basel 1977,<br />
VIII. Abschnitt: Der Ansatz zu einem dritten Deduktionsverfahren und das Problem<br />
der Kategorialdeduktion praktischer Vernunft bei Kant, 2. Kants<br />
Deduktionsversuche nach dem distibutiven Prinzip der Vollständigkeit, p. 382
— 1330 —<br />
Diese Natur ist zwiefach, entweder die denkende, oder die körperliche<br />
Natur. Allein zu der letzteren, um sie ihrer inneren Möglichkeit nach zu<br />
denken, d. i. die Anwendung der Kategorien auf dieselbe zu bestimmen,<br />
bedürfen wir keiner Idee, d. i. einer die Erfahrung übersteigenden<br />
Vorstellung, es ist auch keine in Ansehung derselben möglich, weil wir<br />
darin bloß durch sinnliche Anschauungen geleitet werden, und nicht wie<br />
im psychologischen Grundbegriffe (Ich), welcher eine gewisse Form des<br />
Denkens, nämlich die Einheit desselben, a priori enthält. Also bleibt uns<br />
für die reine Vernunft nichts übrig, als Natur überhaupt, und die<br />
Vollständigkeit der Bedingungen in derselben nach irgend einem Prinzip.«<br />
(B 712 f./A 684 f.)<br />
Ich verweise auch hier wieder auf ein Moment der Willkür. Die Natur<br />
überhaupt, bereits als Idee, wird bereits in den Antinomien der<br />
kosmologischen Ideen hinsichtlich der Vollständigkeit der Bedingungen<br />
für den logischen und der Unvollständigkeit der Bedingungen des<br />
dialektischen Gebrauchs untersucht. Die Aufstellung der kosmologischen<br />
Ideen selbst gehen klar und deutlich von der Unterscheidung des<br />
logischen und des transzendenten (dialektischen) Gebrauches von<br />
Vernunftideen aus. Nur der dialektische Gebrauch der kosmologischen<br />
Ideen führt in diese Verwicklungen, die erst am Boden einer kritischen<br />
Untersuchung des Ideals weiter aufgeklärt werden können.<br />
Insofern ist der Verdacht des Mißbrauchs nicht gänzlich von der Hand zu<br />
weisen, auch wenn die Ideen von einem bloßen Etwas angeblich keinen<br />
Inhalt besitzen, der sie überhaupt mißbräuchlich verwenden ließe, wie<br />
Kant als ob zur vorauseilenden Verteidigung anführt? Doch sind diese<br />
Ideen nicht völlig unbestimmbare Ideen von Etwas, sondern durch die<br />
Stellung in der Reihe von psychologischer, kosmologischer und<br />
theologischer Idee charakterisierbar und in jeder Idee nochmals<br />
weiterbestimmbar. Der Moment, an welchen dieser Verdacht erste Gründe<br />
gefunden hat, ist genau angebbar: die Ausweitung des Geltungsbereiches<br />
des regulativen Prinzips auf die theologischen Idee zur Rechtfertigung des<br />
transzendentalen Scheines, weil diese der einzig möglicher und<br />
notwendiger Schlußstein der Archtitektonik der reinen Vernunft sein soll,<br />
was zu erweisen allerdings so eindeutig gar nicht möglich scheint, und so<br />
der anzuführende Grund, nämlich die maximale Übersteigerung von<br />
intensionalen Totaltäten, selbst schon zum transzendenten Schein verfällt.<br />
Letzteres erfüllt nun keinesfalls die Erfordernisse einer transzendentalen<br />
Deduktion, nur den notwendigen Bezug auf Totalität und Ganzheit der
— 1331 —<br />
Intellection; und auch die Bedingungen der Konstitution von Maximen<br />
setzen nicht selbst die transzendentale Differenz voraus, welche die<br />
transzendentale Deduktion der Kategorien notwendig, aber auch allererst<br />
sinnvoll möglich macht. So ist die Transzendentalität der Vernunftideen<br />
wiederum nur eine geborgte. Schließlich ist auch das formale Kriterium<br />
der Einzigkeit für die Transzendentalität des Beweises in Zweifel gezogen:<br />
keineswegs ist abschließend deutlich geworden, daß die Entwicklung<br />
zwischen vierter Antinomie und theologischer Idee ebenso wie dargestellt<br />
verlaufen muß und hat eben zuvor mit der Unterscheidung in »die<br />
weltweise Ursache« und der »höchsten Intelligenz« von Kant selbst zuletzt<br />
noch eine Alternative vorgestellt bekommen. Doch verletzen sie<br />
anscheinend auch keine weitere Regel, und sind für sich, obwohl<br />
spekulativ, eben nicht notwendigerweise zugleich auch schon<br />
transzendent im Sinne von existenzbehauptend.<br />
Insofern steht die Wirklichkeit der Idee der Welt bei aller Unbestimmtheit<br />
ihrer Zusammensetzung außer Zweifel, während die Idee von Etwas der<br />
Wirklichkeit erst habhaft werden muß. Wird nun die nämliche Idee von<br />
Etwas an die absolute Position verbracht, dann wird nur die Idee von<br />
Etwas, die als Gedankenform eines jeden Inhalte der Idee der Welt<br />
konzipiert war, aus dem Raum möglicher zusammenhängender Erfahrung<br />
von Wirklichkeit herausgedreht. Über die schon genannten<br />
Schwierigkeiten der Spekulation hinaus, wäre auch noch zu bedenken, daß<br />
die Idee von Etwas der Idee der Welt eindeutig zugeordnet ist, und zwar<br />
ursprünglich und in der Welt seiend. Soll nun diese einfachste Idee<br />
zugleich die oberste sein, dann steht sie, wie sie auch immer zur Welt<br />
steht, nicht in einem vergleichbaren Sinn in der Welt: sie steht außerhalb<br />
der zusammenhängenden Wirklichkeit, deren Erfahrungsraum wir<br />
gemeinhin mit der Idee der Welt verbinden. Es ist die Frage, ob die<br />
weitergehende Abstraktion des Dinges zum Etwas den entstehenden<br />
Widerspruch verhindert, indem die Idee von Etwas als oberste Idee<br />
abstrakt bestimmt, und so aus dem Erfahrungszusammenhang der<br />
Abstraktion entfernt wird. — Der Widerspruch kann von der absoluten<br />
Position aus erkannt werden, wenn man (entgegen den ontologischen<br />
Gottesbeweisen) dieser gedanklichen Operation vorwirft, daß die Idee von<br />
Etwas als Abstraktion der Erfahrung in der Welt zur Grundlage der<br />
obersten Idee genommen worden ist. Von dieser Position aus könnte man<br />
in den ontologischen Gottesbeweisen auch von einem Mißbrauch der Idee<br />
der Welt sprechen.
— 1332 —<br />
Diese Problemstellung tritt dann auf, wenn die Idee von Etwas als oberste<br />
Idee von der Wirklichkeit der Welt ausgehend gedacht wird; wird aber die<br />
Idee der Welt und deren Wirklichkeit von der Wirklichkeit der obersten<br />
Idee aus gedacht, dann entsteht ein Widerspruch, weil das Etwas der<br />
obersten Idee (nichts Denkbares, aber auch nicht Nichts — nihil) als<br />
Vorbild eines jeden Vorkommnisses in der Welt zu gelten hätte. Das aber<br />
stimmt nicht mit unserer Erfahrung aus der ersten Perspektive überein,<br />
was an unserer Beschränktheit liegen könnte, oder eher daran, daß die<br />
reine In-Beziehung-Setzung von einfacher oberster Idee und der Idee von<br />
einem Etwas eine beide Positionen umfassende Perspektive benötigen<br />
würde, um dazu nochmals eine Vorstellung von Totalität und möglicher<br />
Ganzheit zu denken. — Zwingt man noch diese auseinanderstrebenden<br />
Alternativen in einer Aufstufung des Intensionalen in diese Engführung,<br />
wäre eine Weise der Anwesendheit Gottes in der Welt gefordert, die diese<br />
Verwechslung der Positionen der Idee von Etwas beendet: naheliegend ist<br />
die Verknüpfung von Wahrheit und Existenz. Eben die Existenz von Etwas<br />
in der Welt wäre so das göttliche Wirken wie die Existenz der Welt selbst.<br />
Existenz in diesem Sinne möglicher zusammenhängender Erfahrung ist<br />
nicht als Folge zu denken, dessen Progressus eingeschränkt werden kann,<br />
kann aber weder aus sich heraus weiter eingeteilt, noch könnte aus dieser<br />
Idee von Existenz die Idee der Welt abgeleitet werden.<br />
Daneben besteht das Problem der Transzendentalität des Prinzips der<br />
Spezifikation, was als Thema zur Bestimmung der Formen des Regressus<br />
gehört. Meiner Beurteilung nach ist das Prinzip selbst von a priori Geltung,<br />
und soweit selbst auch als rein zu bezeichnen, jedoch auch hier vermag der<br />
Nachweis der Transzendentalität des Beweises selbst nicht zu gelingen, da<br />
auch er transzendental nur in Hinsicht auf den Rückgriff der Doktrin der<br />
bestimmenden Urteilskraft genannt werden kann. Im Vergleich zu deren<br />
Deduktion bleibt die Deduktion des Prinzips der Spezifikation darin<br />
zurück, daß erstere die transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit<br />
von empirischer Erfahrungserkenntnis betroffen hat, während die Regeln<br />
der Spezifikation als Prinzipien a parte priori behandelt werden müssen,<br />
die als heuristische und bereits inhaltlich bestimmt zu denkende<br />
Prinzipien gemäß der aptitudo der Mannigfaltigkeit, die in der sinnlichen<br />
Erfahrung gegeben wird, ausgewählt werden, und offenbar indirekt auch<br />
»falsifiziert«, zumindest als nicht erfolgversprechend a posteriori<br />
verworfen werden können, wie das ursprünglich für die Deduktion des<br />
Prinzips des regulativen Gebrauches der Vernunftbegriffe überhaupt
— 1333 —<br />
vorgestellt worden ist. Andererseits setzt das Prinzip der empirischen<br />
Spezifikation das logische Prinzip des Genus aus der diairesis selbst<br />
doppelt voraus: einmal bereits formal rekonstruiert als oberstes, formales<br />
Prinzip der Teilung, Zuteilung und Ausschließung von Namen für Klassen<br />
von Dingen oder Erscheinungen, und einmal konkret als diskursiv<br />
inhaltlich zu bestimmendes Prinzip, um das formale Prinzip entsprechend<br />
des Eidos, näher spezifiziert (operationalisiert) durch die Methode der<br />
Habhaftwerdung der Erscheinung, im Regressus des Erfahrungmachens<br />
erst konkret weiterzubestimmen.<br />
Doch bleibt die transzendentale Differenz die der Doktrin der<br />
bestimmenden Urteilskraft, die uns erklärt, inwieweit wir berechtigt sind,<br />
mit den Gegenständen der Erscheinungen wirkliche Dinge an sich selbst<br />
zu denken. Insofern kann gesagt werden, Kant setze nur eine<br />
Fragestellung auf radikal andere Weise fort, die Plato mit der Apophantik<br />
zu beantworten sucht. Das Wesen der Kategorien des<br />
Verstandesgebrauches liegt zum Aufriß der platonischen Diarese<br />
gewissermaßen quer; es darf gesagt werden, der historische Ursprung der<br />
Logik liegt nicht in der Absicht der Deduktion der Kategorien des<br />
empirischen Verstandesgebrauches. Thema der Deduktion der Kategorien<br />
ist die Erörterung sowohl der Bedingungen der Erscheinungen wie der<br />
Bedingungen von Erfahrung, die Kant, bevor diese Bedingungen mit der<br />
Bedingung der Möglichkeit eines Objektes der Erfahrung selbst<br />
identifiziert werden, aus zwei Gründen mit der Sinnlichkeit verknüpft<br />
(transzendentale Ästhetik und primäre Intentionalität). Die Logik nach<br />
dem Vorbild der diairesis stellt solche Fragen nicht, und hat nach dem<br />
Ineinander-Enthaltensein von Zuteilungen nach Ausschließungen die nicht<br />
nur rein formallogisch darstellbare Differenz von Allgemeinen und<br />
Besonderen zum Thema; selbst noch der einzelnen Gegenstand kann als<br />
intendierte Aufgabe vorgestellt werden. Insofern könnte hier von einer<br />
möglichen Analogie eines Ansatzpunktes zu einer transzendentalen<br />
Argumentation gesprochen werden, wenn damit auch die Bestimmung<br />
des Einzeldinges im Begriff zur Anerkenntnis als Gegenstand gefordert<br />
wird.<br />
Die Kategorien formulieren nun transzendentale Bedingungen der<br />
Möglichkeit der Erfahrung, die so gedacht werden müssen, als seien sie die<br />
Bedingung der Möglichkeit der Dinge an sich selbst, was sich insofern von<br />
selbst bewahrheitet, weil doch nur Erscheinungen Gegenstände unserer<br />
(hier: sinnlichen) Erfahrung sein können. Die Kategorien formulieren nicht
— 1334 —<br />
Prinzipien der inhaltlichen Bestimmung einer möglichen Washeit, weder<br />
in konkret-allgemeiner, also immer im Vergleich zu einem möglichen,<br />
abstrakteren Begriff besonderen Hinsicht, noch in konkret-individueller<br />
Hinsicht. Sie rekurrieren erstens auf den logischen Gegenstand als<br />
abstrakte Idee einer jeden konzentrierten und gerichteten Aufmerksamkeit<br />
(Intentionalität) als leeres Etwas (das ist die einfachste oberste Idee), und<br />
beschränken diese Idee mittels der Kontinuitätsbedingung der Sinnlichkeit<br />
methodisch auf den Umkreis der primären Intentionalität. Das geschieht<br />
zweitens mit der Anpassung der mit der transzendentalen Ästhetik<br />
mitgegebenen metaphysischen Bedingungen des Raumes an die<br />
Bedingungen der »transzendentalen« Psychologie zwischen rationaler<br />
Psychologie und rationaler Physiologie. Drittens wird in den Kategorien<br />
anhand der Angleichung transzendentaler Zeitbedingungen an die<br />
logischen Zeitbedingungen, die von den reinen Verstandesbegriffen der<br />
Kategorie ausgedrückt werden, die synthetischen Grundsätze gebildet,<br />
welche für uns die deshalb transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit<br />
der Erfahrung sinnlich gegebener Gegenstände ausdrücken. Damit wird<br />
aber die Frage nach der Rechtfertigbarkeit der Kenntnis der Beschaffenheit<br />
der Dinge grundsätzlich und unabhängig von der Frage nach der<br />
Quidditas gestellt.<br />
IV. Übergang von der vierten Antinomie zur theologischen Idee.<br />
Deren indirekte heuristische Funktion ist nicht selbst transzendental.<br />
Die Selbstständigkeit der regulativen Idee<br />
Ohne den Verdacht der spekulativen Willkür selbst auszuräumen, der ja<br />
noch damit beschwert wird, daß gar nicht alle möglichen Ansätze zur<br />
Beantwortung der Frage, wie denn die eine Wirkung der intelligiblen<br />
Ursache aussehen könne, weiter verfolgt worden sind, nimmt Kant eine<br />
Wendung, die zu einem Argument für seine Auffassung vom<br />
heuristischen Wert der theologischen Idee wird:<br />
»Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen beruht,<br />
ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das spekulative Interesse der<br />
Vernunft macht es notwendig, alle Anordnungen in der Welt so<br />
anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft<br />
entsprossen wäre. Ein solches Prinzip eröffnet nämlich unserer auf das<br />
Feld der Erfahrungen angewandten Vernunft ganz neue Aussichten, nach<br />
teleologischen Gesetzen die Dinge der Welt zu verknüpfen, und dadurch
— 1335 —<br />
zu der größten systematischen Einheit derselben zu gelangen. Die<br />
Voraussetzung einer obersten Intelligenz, als der alleinigen Ursache des<br />
Weltganzen, aber freilich bloß in der Idee, kann also jederzeit der Vernunft<br />
nutzen und dabei doch niemals schaden.« (B 714/A 686)<br />
Die komplementäre Frage ist: kann man ein System teleologischer<br />
Beziehungen, also von einem System wechselseitiger Zweckmäßigkeit<br />
sprechen, ohne eine verursachende Intelligenz zu denken? Ich denke<br />
durchaus; es ist bloß nicht möglich, ein solches System ohne Intelligenz zu<br />
denken. Aber ganz unabhängig von dieser Frage kann ein heuristischer<br />
Wert auch dann nicht abgesprochen werden, wenn eine spätere<br />
Überlegung zur Einsicht kommt, es könne auf diese oberste Idee als<br />
heuristisches Prinzip auch verzichtet werden, ohne für die<br />
Zweckmäßigkeit innerhalb und zwischen Systemen jeden Grund zu<br />
verlieren. Dann wäre aber eine transzendentale Deduktion teleologischer<br />
Prinzipien in der Natur fällig: Kant unternimmt in der Kritik der<br />
teleologischen Urteilskraft die Rechtfertigung des teleologischen<br />
Beurteilungsprinzips neben dem Prinzip der bestimmenden Urteilskraft<br />
und setzt ein Organisationsprinzip der Natur selbst nur ähnlich<br />
unbestimmt an, wie neben allen Einwänden und diesen zum Trotz, der<br />
theologischen Idee immer wieder ein womöglich transzendental<br />
rechtfertigbarer Begriff a priori unterstellt wird. So verweist Kant bei aller<br />
Unbestimmtheit die Überlegung doch auf den physikotheologischen<br />
Beweis. — Zweifelos muß dem transzendentalen Schein dieser Idee das<br />
Verdienst zugesprochen werden, die Überlegung zur Totalisierung der<br />
Prinzipien der teleologischen Urteilskraft eröffnet zu haben.<br />
»Bleiben wir nur bei dieser Voraussetzung, als einem bloß regulativen<br />
Prinzip, so kann selbst der Irrtum uns nicht schaden. Denn es kann<br />
allenfalls daraus nichts weiter folgen, als daß, wo wir einen teleologischen<br />
Zusammenhang (nexus finalis) erwarteten, ein bloß mechanischer oder<br />
physischer (nexus effectivus) angetroffen werde, wodurch wir, in einem<br />
solchen Falle, nur eine Einheit mehr vermissen, aber nicht die<br />
Vernunfteinheit in ihrem empirischen Gebrauche verderben.«<br />
(B 715 f./A 687 f.)<br />
Kant hat damit in der Tat die theologische Idee als zumindest mittelbarer<br />
Ursprung möglicher teleologischer Prinzipien in der Natur installiert,<br />
sodaß deren heuristischer Wert, wenn vielleicht nur historisch, doch<br />
gerade im Aufbau des Systems der Vernunft an zentraler Stelle zu stehen<br />
kommt. Eben das bleibt auch Grund weiteren Fragens, so etwa, ob
— 1336 —<br />
unbestritten des heuristischen Wertes der theologischen Idee, an dieser<br />
Stelle nach der historischen Würdigung nicht auch ein anderes Prinzip an<br />
dieser Stelle stehen müßte. — M. a. W., im Rückblick wird die theologische<br />
Idee, als Ursprung der Idee einer systematischen und für sich selbst<br />
zweckmäßigen Einheit genommen, im Lichte ontotheologischer<br />
Überlegungen als unterbewertet oder bereits depotenziert erscheinen, und<br />
zwar vor allem, weil damit keine In-Existenz-Setzung mehr verbunden ist.<br />
Dieser Ursprung kann vielleicht als depotenziertes ens necessarium, aber<br />
nicht als höchstes Wesen gedacht werden.<br />
Ohne die sich mehrenden Fragen, die auch verschieden zu bewertende<br />
mögliche Einwände beinhalten, auf befriedigende Weise zu<br />
berücksichtigen, gelangt Kant einige Seiten weiter zu einer Darstellung,<br />
welche die Steigerung der notwendigen Idee einer einfachen Substanz und<br />
ersten Ursache in der theologischen Idee, die spätestens ab der<br />
Verbindung von Urbild, prototypon transcendentale und Urwesen als ens<br />
necessarium gemeinsam mit der Vorstellung des höchsten Wesens den<br />
eigentlichen Gegenstand der theologischen Idee ausmacht, wieder<br />
weitgehend zurücknimmt, und so meinem gemäßigt kritischen Kurs,<br />
insbesondere was eben diese Entwicklung in der theologische Idee angeht,<br />
zu widerlegen scheint.<br />
V. Die Idee der Naturheinheit folgt aus dem Wesen der Dinge.<br />
Die »verkehrte Vernunft« in der bloßen Vorstellung einer<br />
existierenden obersten Intelligenz als Grund der Vorstellung eines<br />
Zirkels<br />
Nachdem anhand der teleologischen Verfaßtheit der praktischen Vernunft<br />
demonstriert worden ist, daß auch für teleologische Urteile empirische<br />
Erfahrung und deren systematische Erweiterung vorausgesetzt wird, und<br />
nochmals zumindest ein Indiz für meine Auffassung über die<br />
Deduktionen des Prinzips des regulativen Vernunftgebrauchs und des<br />
Prinzips der empirischen Spezifikation liefert (Kant: erster Fehler), kommt<br />
Kant zu einer starken Einschränkung der theologischen Idee, die einige<br />
Seiten zuvor, selbst schon in einer schwachen Fassung, als reines<br />
heuristisch notweniges Prinzip vorstellig gemacht worden ist: »Der zweite<br />
Fehler, der aus der Mißdeutung des gedachten Prinzips der<br />
systematischen Einheit entspringt, ist der der verkehrten Vernunft<br />
(perverso ratio,[...]). Die Idee der systematischen Einheit sollte nur dazu
— 1337 —<br />
dienen, um als regulatives Prinzip sie in der Verbindung der Dinge nach<br />
allgemeinen Naturgesetzen zu suchen, und, so weit sich etwas davon auf<br />
dem empirischen Wege antreffen läßt, um soviel auch zu glauben, daß<br />
man sich der Vollständigkeit angenähert habe, ob man sie freilich niemals<br />
erreichen wird. [1] Anstatt dessen kehrt man die Sache um, und fängt<br />
davon an, daß man die Wirklichkeit eines Prinzips der zweckmäßigen<br />
Einheit als hypostatisch zum Grunde legt, den Begriff einer solchen<br />
Intelligenz, weil er an sich gänzlich unerforschlich ist,<br />
anthropomorphistisch bestimmt, und denn der Natur Zwecke, gewaltsam<br />
und diktatorisch, aufdringt, anstatt sie, wie billig, auf dem Wege der<br />
physischen Nachforschung zu suchen, [2] so daß nicht allein Teleologie,<br />
die bloß dazu dienen sollte, um die Natureinheit nach allgemeinen<br />
Gesetzen zu ergänzen, nun vielmehr dahin wirkt, sie aufzuheben, sondern<br />
die Vernunft sich noch dazu selbst um ihren Zweck bringt, nämlich das<br />
Dasein einer solchen intelligenten obersten Ursache, nach diesem, aus der<br />
Natur zu beweisen.[3]« (B 720 f./A 692 f.)<br />
Punkt (1) entspricht meiner Kritik an der Darstellung der theologischen<br />
Idee als heuristisches Prinzip insofern, als daß damit erkenntlich wird, daß<br />
damit vielleicht nur für uns, aber nicht für die Transzendentalphilosophie,<br />
ein höchstes Wesen als Ursprung der systematischen und zweckmäßigen<br />
Einheit zu denken nötig ist, obwohl ganz unzweifelhaft gelten muß, daß,<br />
gäbe es ein solches Wesen, es auch der oberste Grund für die Geordnetheit<br />
und Zweckmäßigkeit der Natur für sich selbst sein müßte. In Punkt (2)<br />
wird nicht nur die »hypostatische« In-Existenz-Setzung der theologischen<br />
Idee durch die menschliche Vernunft kritisiert, es wird hier auch die<br />
Verknüpfung eines solchen, immerhin denkmöglichen, aus der Stelle der<br />
theologischen Idee heraus entwickelbaren obersten (allerdings<br />
definitionsgemäß dialektischen) Vernunftbegriffes einer ersten Ursache<br />
mit dem Begriff der höchsten Intelligenz, wenngleich auch nur nebenher,<br />
dem Zweifel ausgesetzt. Punkt (3) enthält nicht mehr und nicht weniger in<br />
wenigen Worten das Programm der Kritik der teleologischen Urteilskraft,<br />
und verweist in der ersten Kritik auf den physikotheologischen<br />
Gottesbeweis.<br />
Kant geht mit seiner Kritik so rigoros vor, daß er in der Tat neue<br />
Argumente zu Abgrenzung des transzendentalen Scheines als reelle<br />
Immanenz vom transzendenten Schein als zwar nicht reine, aber dennoch<br />
nicht reelle Immanenz auffindet:
— 1338 —<br />
»Denn, wenn man nicht die höchste Zweckmäßigkeit in der Natur a priori,<br />
d. i. als zum Wesen derselben gehörig, voraussetzen kann, wie will man<br />
denn angewiesen sein, sie zu suchen und auf der Stufenleiter derselben<br />
sich der höchsten Vollkommenheit eines Urhebers, als einer<br />
schlechterdingsnotwendigen, mithin a priori erkennbaren<br />
Vollkommenheit, zu nähern? [1] Das regulative Prinzip verlangt, die<br />
systematische Einheit als Natureinheit, welche nicht bloß empirisch<br />
erkannt, sondern a priori, obzwar noch unbestimmt, vorausgesetzt wird [;]<br />
schlechterdings, mithin als aus dem Wesen der Dinge folgend,<br />
vorauszusetzen.[2] Lege ich aber zuvor ein höchstes ordnendes Wesen<br />
zum Grunde, so wird die Natureinheit in der Tat aufgehoben. Denn sie ist<br />
der Natur der Dinge ganz fremd und zufällig, und kann auch nicht aus<br />
allgemeinen Gesetzen derselben erkannt werden.[3] Daher entspringt ein<br />
fehlerhafter Zirkel im Beweisen, da man das voraussetzt, was eigentlich<br />
hat bewiesen werden sollen.[4]« (B 721/A 693)<br />
(ad 1) Zuerst beharrt Kant auf der Vorstellung der höchsten<br />
Zweckmäßigkeit, als »der Natur a priori als zum Wesen derselben<br />
gehörig« und fragt, wie man sonst angewiesen sein könnte, sie zu suchen.<br />
Dann geht Kant in unmittelbaren Anschluß dazu über, die Idee einer<br />
»schlechterdingsnotwendigen, mithin a priori erkennbaren<br />
Vollkommenheit« mit der Idee der höchsten Vollkommenheit eines<br />
(ersten) Urhebers zu verknüpfen, wobei die Notwendigkeit zuvor aber<br />
darin liegt, daß die spekulative Vernunft dem transzendentalen Schein<br />
soweit nachgibt, daß sie selbst vom transzendenten Schein der In-Existenz-<br />
Setzung aus dem bloßen Begriff bedroht wird. Kant anerkennt nur diese<br />
subjektive Strebung in der transzendentalen Dialektik der reinen Vernunft;<br />
das beinhaltet aber mitnichten irgend eine Art von Deduktion.<br />
(ad 2) Zwar stellt das regulative Prinzip die Idee der Natureinheit als<br />
systematische Einheit a priori, aber als ein oberstes Prinzip empirisch<br />
unbestimmt vor, doch wird nunmehr keine Deduktion verlangt, vielmehr<br />
eine Induktion durch Abstraktion und Reflexion gegeben: Mit dieser<br />
systematischen Einheit sei »schlechterdings«, als aus dem Wesen der<br />
Dinge folgend, die Idee der Natureinheit denkbar geworden. Das läßt<br />
allerdings offen, ob überhaupt, und gegebenenfalls wie aus einer solchen<br />
universiellen und formalen Wesensbestimmung selbst eine weitere<br />
Spezifikation erwachsen könnte. Damit wird eine Frage aufgeworfen, die<br />
Kant nicht vollständig beantworten kann, und so, hierin ähnlich wie in der<br />
Indifferenz zwischen einer natürlich determinierten und einer intelligibel
— 1339 —<br />
zusammengefügten Konstellationen der Reihen von Naturursachen in der<br />
dritten Antinomie, in der strikten transzendentalphillosophischen<br />
Erörterung womöglich gar nicht als transzendentales Argument<br />
zugelassen ist.<br />
(ad 3) Erst mit der Verknüpfung mit einem gesetzten »höchsten ordnenden<br />
Wesens« wird der transzendentale Schein der Natureinheit zum<br />
transzendenten Schein, und unabhängig von den Gründen der regulativen<br />
Prinzipien a priori aufgehoben. Hier geht Kant in der Tat weiter als meine<br />
bislang geäußerte Kritik: Gerade aus der Mittelbarkeit und<br />
Uneigentlichkeit der Transzendentalität der bislang angeführten Beweise<br />
des regulativen Prinzips (und des Prinzips der Spezifikation) schließt Kant<br />
allem Anschein nach auf die Verschiedenheit dieser Prinzipien gegenüber<br />
den Organisationsprinzipien der Natur, die noch in der Dialektik der<br />
teleologischen Urteilskraft mit der starken Fassung der Idee vom<br />
»höchsten ordnenden Wesen« zu tun haben. Diejenige Vorstellung, für<br />
welche ich die Transzendentalität der Beweise in einem strikten Sinne<br />
nicht gelten lassen wollte, aber »kann nicht aus allgemeinen Gesetzen<br />
derselben [der Natur]« erkannt werden. Insofern wird der metaphysische<br />
Einschub des Wesens der Dinge verständlich, denn offenbar kann die Idee<br />
von der systematischen und zweckmäßigen Natureinheit selbst weder<br />
unmittelbar von der Vorstellung eines »höchsten ordnenden Wesens«,<br />
noch einfach von der empirischen, also sinnlichen Erfahrung genommen<br />
werden. Dieser Idee wird ein synthetisch-metaphysischer Wesensbegriff<br />
zugrunde liegen müssen.<br />
(ad 4) In Frage steht, ob der »Zirkel im Beweisen«, wie es kritisch durchaus<br />
Sinn macht, schon auf den metaphysischen Einschub eines Wesens der<br />
Dinge in Anwendung gebracht werden soll, oder ob dieser Zirkel erst<br />
durch die Verknüpfung mit dem »höchsten ordnenden Wesen« entstanden<br />
ist. Die erste Vermutung dürfte mit der kritischen Darstellung der<br />
wesenslogischen Aspekte des principium contradictionis wie des Ideals<br />
der reinen Vernunft, ihre Idee (das wesentliche Prädikat) nicht aus<br />
Prädikaten abzuleiten, hinfällig geworden sein, da dieser eigentlich bereits<br />
»synthetisch-metaphysisch« zu nennende Einschub des Wesens meiner<br />
Auffassung nach zugleich die Idee einer Rechtfertigungsmethode<br />
spekulativer Prädikate an der Erfahrung beinhaltet, die zunächst<br />
inhaltlich, dann allgemein und abstrakt das Ideal der reinen Vernunft zum<br />
Begriff vom einzelnen Gegenstand, schließlich transzendentallogisch das<br />
transzendentale Ideal zum Begriff vom einzelnen Wesen bestimmt. — Der<br />
nur ungefähr und versuchsweise, meiner Ansicht nach also nicht wirklich
— 1340 —<br />
erfolgreichversprechende Ansatz, im transzendentalen Ideal auch das ens<br />
realissimum zugleich als ens originarium, ens entium und ens summum<br />
zu denken, spricht für die zweite Vermutung, der Zirkel entstünde erst<br />
durch die Einführung eines »höchsten ordnenden Wesens«. Meines<br />
Erachtens handelt es sich auch da nicht um einen Zirkel, sondern eher um<br />
das, was Bolzano eine überfüllte Vorstellung genannt hat. Kant schreibt<br />
dem höchsten Wesen höchst unüberlegt das Vermögen, zu ordnen, zu: Die<br />
Ordnung ist bislang als eine Folge des göttlichen Handelns, nicht selbst<br />
aber als unmittelbares oder mittelbares Produkt Gottes, und das<br />
Geschehen nicht als unmittelbar oder mittelbar von Gott verursacht zu<br />
denken aufgegeben, als ob die göttliche Natur selbst ein Teil der Reihe der<br />
Naturdeterminationen wäre. Einiges spricht dafür, den Vorwurf des<br />
Zirkels an die Spinozisten zu adressieren. Zwar kein Zirkel, aber der<br />
Umstand, daß die Vorstellung eines »höchsten ordnenden Wesens« weder<br />
aus der Erfahrung noch rational metaphysisch bewiesen werden kann, ist<br />
der Grund der Grundlosigkeit einer solchen Vorstellung. Ein immerhin<br />
konstruierbarer logischer Zirkel gehörte selbst zum transzendenten Schein.<br />
VI. Die Unklarheit in der spekulativen Verbindung von<br />
»vollkommenen Urwesen« und »höchsten Wesen«.<br />
Depotenzierung zum »archetypus intellectus«oder Abweg zu<br />
Spinoza?<br />
Wie zu erwarten, unternimmt Kant den Versuch, der spekulativen<br />
Strebung oder Neigung der Vernunft, die sich schon in verschiedenen<br />
Subreptionen gezeigt hat, gerade im Fall eines »schlechthin vollkommenen<br />
Urwesens« noch einen Sinn abzugewinnen. Die Unterscheidung von<br />
einem »höchsten Wesen« und eine aufschlußreiche Variation des<br />
Wesensbegriffes der Dinge zwischen metaphysischem und empirischem<br />
Ansatz sind Grund genug, noch einen Schritt die Kantsche Argumentation<br />
im Detail zu verfolgen.<br />
»Vollständige zweckmäßige Einheit ist Vollkommenheit (schlechthin<br />
betrachtet).[1] Wenn wir diese nicht in dem Wesen der Dinge, welche den<br />
ganzen Gegenstand der Erfahrung, d. i. aller unserer objektivgültigen<br />
Erkenntnis, ausmachen, mithin in allgemeinen und notwendigen<br />
Naturgesetzen finden; wie wollen wir daraus gerade auf die Idee einer<br />
höchsten und schlechthin notwendigigen Vollkommenheit eines Urwesens<br />
schließen, welches der Ursprung aller Ursache ist? [2] Die größte
— 1341 —<br />
systematische, folglich auch die zweckmäßige Einheit ist die Schule und<br />
selbst die Grundlage der Möglichkeit des größten Gebrauchs der<br />
Menschenvernunft. Die Idee derselben ist also für uns gesetzgebend, und<br />
so ist es sehr natürlich, eine ihr korrespondiernde gesetzgebende Vernunft<br />
(intellectus archetypus) anzunehmen, von der alle systematische Einheit<br />
der Natur, als dem Gegenstande unserer Vernunft abzuleiten sei. [3]«<br />
(B 722 f./A 694 f)<br />
(ad 1) Kant unterscheidet Arten von Vollkommenheiten: gegenüber der<br />
Betrachtung der Idee vom Schlechthinnotwendigen des höchsten Urhebers<br />
ergibt auch die Idee der vollständigen zweckmäßigen Einheit noch<br />
Vollkommenheit, aber eben nur »schlechthin«. Das erste ist dialektisch und<br />
transzendent; das zweite als regulatives Prinzip a priori rechtfertigbar, und<br />
transzendental, weil mittelbar auf empirische Verstandeserkenntnisse<br />
beziehbar.<br />
(ad 2) Das Wesen der Dinge wird zwischen logischem Gegenstand der im<br />
Urteil ausgerichteten Intentionalität und der empirischen Erfahrung in der<br />
Naturwissenschaft ausgemacht, und dann als Bedingung der bloßen<br />
Denkmöglichkeit der selbst als nur spekulativ gekennzeichneten »Idee<br />
einer höchsten und schlechthin notwendigigen Vollkommenheit eines<br />
Urwesens« vorgestellt. Das ist zweifellos eine bedeutende Wende in der<br />
Argumentation: Nicht in reiner, letztlich auch ohne ernsthafte In-Existenz-<br />
Setzung aus bloßen Begriffen transzendenter Immanenz der reinen<br />
Vernunft (bereits als Dialektik des notwendigen transzendentalen Scheins),<br />
auch nicht in reeller Immanenz formalwissenschaftlicher Grundlagen<br />
(Prinzipien der Spezifikation, Mathematik), sondern in reeller und realer<br />
Immanenz der wirklichen Möglichkeit von Naturwissenschaft in der<br />
empirischen Erfahrung (Wissenschaftsfortschritt) liegt nunmehr wieder<br />
die Idee eines vollkommenen Urwesens begründet. Dieses wäre aber nicht<br />
als höchstes Wesen, vermutlich nicht einmal als Teilbegriff eines<br />
möglichen ganzen Begriffes eines solchen, zu denken möglich. Kant<br />
schließt hier offenbar eher an die Überlegung von Descartes an, für den die<br />
Möglichkeit mathematischer Physik ein Beweis für die Gutheit Gottes,<br />
insofern mathematische Physik ein natürlicher Gottesdienst gewesen sein<br />
könnte. Das hätte Kant sachlich gar nicht nötig: Der<br />
Massenerhaltungsgrundsatz im synthetischen Grundsatz der<br />
Substanzkategorie hat, im Grunde schon vor Descartes, begonnen, diese<br />
Spekulation zu ersetzen. Genetisch ist diese Querverbindung aber<br />
zweifellos von Bedeutung.
— 1342 —<br />
(ad 3) Die Idee der systematischen und zweckmäßigen Einheit ist für uns<br />
gesetzgebend; doch nunmehr nimmt Kant nicht ein höchstes Wesen zum<br />
Grund dieser Idee, natürlich auch nicht die bloße Abstraktion aus der<br />
empirischen Erkenntnis, da ohne der Idee von der systematischen Einheit<br />
die Mannigfaltigkeit der weiter spezifierbaren Natur gar nicht<br />
entsprechend zusammengefaßt werden könnte, sondern der Grund für die<br />
Annahme der Idee von der systematischen Einheit der Natur liegt in die<br />
Vernunft, welche als gesetzgebend zum Ursprung der Idee von der<br />
systematischen und zweckmäßigen Einheit gemacht wird. Der »intellectus<br />
archetypus« als subjektive Vernunft tritt an die Stelle des Urwesens oder<br />
des höchsten Wesens.<br />
Kants Schwanken zwischen der angeblichen Notwendigkeit, einen<br />
»einigen weisen und allgewaltigen Welturheber« im transzendentalen<br />
Schein vorzustellen, was als Anerkennung der Strebung der spekulativen<br />
Vernunft von der Notwendigkeit objektiver Gültigkeit der Idee selbst zu<br />
unterscheiden ist, und der Notwendigkeit der Idee der systematischen und<br />
zweckmäßigen Einheit in heuristischer Hinsicht allein auf Grund der<br />
Ordnung (des Wesens) der Dinge und nichts als dessen Wesensausdruck<br />
sonst zu denken, setzt sich erwartungsgemäß fort. Es scheint, als wäre für<br />
Kant die Unterscheidung in Anerkennung der allgemein-subjektiven<br />
Strebung der spekulativen Vernunft zur immanenten Transzendenz und in<br />
Anerkennung der objektiven Gültigkeit von heurististischen Prinzipien<br />
doch nicht klar genug, um hier eine fällige Entscheidung herbeizuführen.<br />
Der »archetypus intellectus«, auf welchen auf Grund der Ideen und des<br />
Strebens nach Transzendenz der Immanenz geschlossen wird, steht im<br />
Begriff, das Urwesen und das höchste Wesen in der Transzendenz zu<br />
versenken und an deren Stelle zu treten. Der »archetypus intellectus« kann<br />
für sich selbst aber nichts als eine erworbene oder in der transzendentalen<br />
Analytik der Dialektik der Vernunft sichtbar zu machende Charakteristik<br />
der intelligiblen Ursächlichkeit der Spontaneität des »Ich denke« sein.<br />
Obgleich immer intelligibel, kann das »Ich denke« in § 16 der<br />
transzendentalen Deduktion, in den Paralogismen im Übergang zu den<br />
kosmologischen Ideen, und im archetypus intellectus das Denken nicht im<br />
gleichen Sinn bestimmt haben, sondern findet in sich das vom im Dasein<br />
gegebene Mannigfaltige verschiedene Bewußtsein zwar vernünftig<br />
bestimmt, aber neben der pathologischen Affiziertheit des Strebens durch<br />
die unteren Begehrungsvermögen noch durch das Streben der<br />
spekulativen Vernunft nach Immanenz in der Transzendenz selbst
— 1343 —<br />
abgelenkt. Kant hält die Kritik an der Verwechslung der Anerkennung<br />
dieser Strebung nach Immanenz und der objektiven Gültigkeit der Idee<br />
offenbar für entscheidend.<br />
Jedoch gibt es ein mögliches, der Überlegung inhärentes Motiv, weshalb<br />
Kant die meines Erachtens schon mögliche Entscheidung noch<br />
hinauszögert. Offensichtlich versucht er die These der Selbstständigkeit<br />
des Intelligiblen als reine intelligible Substanz aus der vierten Antinomie<br />
so lange wie möglich zu verteidtigen, denn nach dem Umsturz, der vom<br />
Urwesen und höchstem Wesen zum archetypus intellectus geführt hat,<br />
kann nur mehr vom Substrat unseres Daseins, das intelligible Ursache und<br />
Naturursache zu vereinbaren hat, ausgegangen werden. Die These einer<br />
selbständigen intelligiblen Ursache und Substanz wäre damit endgültig<br />
gefallen. Das aber ist auch mit Berücksichtigung eines überblicksmäßigen<br />
Rückblickes auf die ontotheologische und theologische Diskussion zu<br />
stark: nur die Trennbarkeit der reinen Intelligibilität von der Wirklichkeit<br />
wird bezweifelt. Kant berücksichtigt durchwegs diese Thematik als<br />
Rahmen, was ein zusätzliches Motiv ist, den strikt durchgeführten<br />
transzendentalen Idealismus des Descartes, trotz manch bereits<br />
Entschiedenes wiederum in Frage zu stellen. Daß uns Kant mit dieser<br />
Umständlichkeit nur eine im Ursprung lauernde Aporie einer jeden<br />
systematisch durchgebildeten Ideenlehre der Vernunft verhehlen wollte,<br />
halte ich für ausgeschlossen. Kant bedient vielmehr unterschwellig die<br />
zeitgenössischen spinozistischen Strömungen im philosophischen<br />
Publikums, wenn er in der Komplementarität des »als ob« der Idee von<br />
der systematischen und zweckmäßigen Einheit der Natur und des »als ob«<br />
des Urwesens und höchsten Wesens keinen Unterschied mehr erkennen<br />
will:<br />
»Allein darf ich nun zweckähnliche Anordnungen als Absichten ansehen,<br />
indem ich sie vom göttlichen Willen, obzwar vermittelst besonderer dazu<br />
in der Welt darauf gestellten Anlagen, ableite? Ja, das könnt ihr auch tun,<br />
aber so, daß es euch gleich viel gelten muß, ob jemand sage, die göttliche<br />
Weisheit hat alles so zu seinen obersten Zwecken geordnet, oder die Idee<br />
der höchsten Weisheit ist ein Regulativ in der Nachforschung der Natur<br />
und ein Prinzip der systematischen und zweckmäßigen Einheit derselben<br />
nach Naturgesetzen, auch selbst da, wo wir jene nicht gewahr werden, d. i.<br />
es muß euch da, wo ihr sie wahrnehmt, völlig einerlei sein, zu sagen: Gott<br />
hat es es weislich so gewollt, oder die Natur hat es also weislich geordnet.«<br />
(B 726 f./A 698 f.)
— 1344 —<br />
Modal ist für die verschiedenen Fassungen der theologischen Idee der<br />
Unterschied zu oberste Prinzipien der Naturbetrachtung nicht<br />
festzustellen, doch bleibt im Rahmen der Reflexion oberster heuristischer<br />
Prinzipien die Frage, woher hat die eine und die andere Erklärung ihre<br />
Gründe? Und vor allem die von mir von Beginn an gestellte Frage:<br />
Weshalb werden die verschiedenen, spekulativ zunächst gleichrangigen<br />
Ausgänge totalisierender Spekulation auf das Syndrom des Urwesens als<br />
ens necessarium gebracht, wenn das regulative Prinzip der systematisch<br />
zusammenhängenden Zweckmäßigkeit bereits als abstraktive Ableitung<br />
aus dem »Wesen der Dinge« feststeht? Schließlich die Frage: Weshalb wird<br />
das Urwesen mit den höchsten Wesen einfach identifiziert? —<br />
Spinozistisch an der Indifferenz der zuletzt gegebenen Kantschen<br />
Darstellung ist die völlige Austauschbarkeit von oberster Naturursache<br />
und höchstem Wesen. Die Notwendigkeit der Gültigkeit der<br />
Vernunftideen, die bei Kant zur Entscheidung ansteht, ist die<br />
Notwendigkeit regulativer Prinzipien überhaupt. Mit Spinoza ist die Frage<br />
zu stellen, können Ideen vollständig aus einer einzig möglichen<br />
Argumentation entwickelt werden. Wenn ja, müßte gemäß der dann<br />
verwendeten formalen Implikation vollständige Determination die Folge<br />
sein. Die Notwendigkeit Spinozas ist die des aus der, zwischen Natur und<br />
Gott indifferente, erste und oberste Substanz entspringene vollkommene<br />
Determinismus; unsere einzige Freiheit bleibt die Betrachtung der<br />
Gesetzmäßigkeit, und unsere einzige Klugheit ist die Einsicht in diese<br />
Gesetzmäßigkeit. Fritz Mauthner beschreibt in seinem Spinoza-Büchlein<br />
Kant als Kenner des Spinoza-Streits um Lessing wie Goethe auch, den<br />
Jacobi und Mendelsohn, zwei mittlere Geistesgrößen, mutwillig<br />
aufgebracht in Szene gesetzt haben, und vermag sowohl die in der von mir<br />
eröffneten Diskussion angesprochene Stellen in Kants Kritiken zu<br />
identifizieren wie auch einige weitere Zitate beizubringen. Allerdings ist<br />
Kants Distanz zu Spinozas Rigorosität in jeder Hinsicht, nicht nur in<br />
denjenigen, anläßlich welcher ich auf den Spinozismus zu sprechen<br />
gekommen bin, unbestritten. Der spinozistische Hintergrund wird bei<br />
Kant, wenngleich im Kontrast, auch in der Diskussion der<br />
transzendentalen Ästhetik sichtbar, und paradoxerweise gerade, wenn ein<br />
Zeitbegriff, der nicht nur im irreversiblen Nacheinander besteht, die<br />
Überlegung von alternativen Möglichkeiten eröffnet, oder die Idee des<br />
Raumes formal auf andere Vorstellungsverhältnisse als die der sinnliche<br />
Anschauung enthaltene Vorstellungen übertragen wird. Raum und Zeit<br />
sind universielle Attribute der einfachen Ursubstanz; unsere
— 1345 —<br />
transzendentalen Anschaungsformen heißen transzendental nur weil wir<br />
vom cartesianischen Punkt der Gewißheit ausgehen, und deren<br />
mannigfaltige Perspektivik ist von den modi der materiellen Attribute<br />
bestimmt, welche die jeweilige Welt determinieren. Diese werden uns<br />
resolutiv, allerdings nur als allgemeine Prinzipien, zu erkennen gegeben.<br />
Diese Form der Evidenz wäre demnach ursprünglich in sich vermittelt zu<br />
denken. Weitere Fragen nach Relationen und deren modale Verhältnisse<br />
im logischen Sinn können aus dieser Spekulation nicht fundiert (das hieße<br />
hier bereits: nicht mit einem aus dem Vorigen angebbaren Grund<br />
erfunden) werden. Die leere Denkmöglichkeit, andere Modi der Materie zu<br />
denken, die andere Grenzen von Raum und Zeit ergeben, liefert eine<br />
allgemeinste Topologie für im ontologischen Sinne uneigentliche<br />
Verwendungen von Zeit- und Raumbegriffe. Daß Kant zumindest den<br />
logischen Raum der intensionalen Einteilung von Begriffen nach<br />
Merkmalen eine gemeinsame Wurzel mit den Einteilungsregeln des<br />
Raumes gemäß den metaphysischen Erörterungen gegeben hat, habe ich<br />
im ersten Abschnitt (Grund und Ganzes) gezeigt. Versuche, Raum und<br />
Zeit spekulativ aus dem Zusammenhang der transzendentalen Ästhetik<br />
herauszudrehen scheitern nur dann unweigerlich, wenn Aussagen über<br />
Konstrukte »es gibt« behaupten, ohne das eine deutliche Unterscheidung<br />
dieser Behauptung von der transzendentalen Behauptung des<br />
Zusammenhanges von Wahrheit und Existenz möglich ist, oder eine solche<br />
nicht erreicht werden konnte.<br />
Abschließend ist zu sagen, daß Kant die weitgehende Depotenzierung der<br />
theologischen Idee nicht verhindern hätte können; im Gegenteil: mit der<br />
für Kant nicht nur modalen Indifferenz zwischen der Idee von der<br />
systematischen und zweckmäßigen Einheit der Natur und der Idee vom<br />
Urwesen und vom höchsten Wesen wird die Depotenzierung<br />
ausdrücklich. Der theologischen Idee als Idee vom Urwesen und höchsten<br />
Wesen bleibt nicht erspart, vollständig als transzendenter Schein der<br />
Immanenz der spekulativen Vernunft kritisiert zu werden. Ob die<br />
angenommene Strebung der subjektiven und spekulativen Vernunft zur<br />
Transzendenz der Immanenz ausreicht, um in einer anderen<br />
Prinzipienlehre des regulativen Gebrauchs der Vernunftideen, die andere<br />
Fragen als die Organisation von empirischen Erkenntnissen zu regeln hat,<br />
als heuristisches Prinzip von Wert zu sein, kann letztlich nur mehr im<br />
Rahmen einer totalisierenden Spekulation entschieden werden, wenn die<br />
Erörterung der fortlaufenden Subreption und Erweiterung der Spekulation
— 1346 —<br />
und abermaliger Subreption usw. bereits auf ein formalontologisches<br />
Tableau gehoben wird. Inwieweit diese Überlegungen jemals die reine<br />
Immanenz der Vernunftspekulation wenigstens punktuell verlassen<br />
könnten, um der eingangs vorgestellten Differenz von logischer<br />
Möglichkeit und der Vorstellung einer als solchen nur unbestimmtabstrakten<br />
Möglichkeit, die weder der Vernunft noch der Erfahrung<br />
»zuwider« ist, die eine oder andere allgemeine Definition zu geben, wird<br />
im Anschluß nochmals zusammengefaßt. Unzweifelhaft hat Kant in<br />
Hinsicht auf die Organisation empirischer Erkenntnis nach dem Prinzip<br />
der systematischen und zweckmäßigen Einheit der Natur die Idee vom<br />
Urwesen und vom höchsten Wesen jeder Notwendigkeit von objektiver<br />
Geltung als heuristisches (regulatives) Prinzip beraubt.<br />
2. Die dreifache Rechtfertigung der architektonischen<br />
Stellung der theologischen Idee<br />
Die reinen logischen Analogien zwischen den Überlegungen zum<br />
logischen Ursprung der Begriffe, dem unklaren, aber deutlichen<br />
Unterschied zwischen logischem und transzendentalem Vergleich, und der<br />
Spekulation zum transzendentalen Mangels der Dinge der Welt gegenüber<br />
Gott zeichnen einen gemeinsamen Grundriß nach, der schon allein die<br />
Antwort gibt, weshalb die Untersuchung der Spekulation der reinen<br />
Vernunft auch die theologische Idee umfassen muß. Dieses<br />
architektonische Argument hat für die Überlegungen zur theologischen<br />
Idee selbst allerdings keinerlei Beweiskraft. Doch aber konnte gezeigt<br />
werden, daß die Überlegungen zur theologischen Idee eine Grenze der<br />
Spekulation erreichen, die sich einerseits noch als letzte Grenze<br />
vernünftigen Spekulierens aufzeigen läßt, indem die Grenze der Einsicht<br />
in der Erkundung des bloß Denkmöglichen der Ontotheologie mit dem<br />
»transzendentalen Mangel« formuliert werden konnte, auch wenn dieser<br />
Ausdruck an historisch näher bezeichenbaren, selbst rein spekulativen<br />
Verhältnissen der Ontotheologie erst gebildet worden ist (eine Verbindung<br />
sowohl von Anselm wie von Cusanus zu den Viktorianern verweist auf<br />
einen gemeinsamen historischen Grund, aus: Kommentar zu Cusanus, Der<br />
höchste Punkt der Theorie, hrsg. und kommentiert von H. G. Senger).<br />
Andererseits ist eben diese Spekulation schon eine, welche die<br />
Grenzüberschreitung vom Inbegriff der Möglichkeit zur Potenzenlehre als<br />
Vermögenslehre bereits hinter sich hat, und bei aller Unbeantwortbarkeit
— 1347 —<br />
der damit hinsichtlich eines einheitlichen oder zusammenfügbaren<br />
Seinsbegriffs aufgeworfenen Fragen eine nachvollziehbare Argumentation<br />
besitzt und schon mit der Aufdeckung der als ursprünglich nur gedachten<br />
Frage nach der Einheitlichkeit des Seins auch eine in dieser Formulierung<br />
relevante logische Frage hinsichtlich der Verbindung von Wahrheit und<br />
Existenz aufwirft. Das spricht für die Annahme, es handle sich hier noch<br />
um rationale Spekulation.<br />
Anhand des Indiz eines zumindest korrekten Verfahrens, das mit der<br />
Analogie zu den logischen Handlungen der Komparation, Reflexion und<br />
Abstraktion auch für die Darstellung des Verhältnisses von logischem und<br />
transzendentalem Vergleich im transzendentalen Ideal gegeben worden<br />
ist, ist gleiches für das Ideal der Vernunft zu erwarten, wenngleich die<br />
Unklarheiten zwischen logischem und transzendentalem Vergleich<br />
weiterhin das Substrat des transzendentalen Ideals unentschieden lassen.<br />
Hier ist der transzendentale Vergleich in der Reflexion auf Totalität, die in<br />
der transzendentalen Reflexion auf die Einheit des Bewußtseins möglich<br />
schien, von Beginn an durch die Frage behindert: Kann der<br />
transzendentale Vergleich vollständig in einen logischen Vergleich<br />
überführt werden? In der Frage nach der Zusammenfügung von reiner<br />
Intelligibilität und Materie, die ich anhand einer Forderung Kantens aus<br />
der transzendentalen Idee und des Obersatzes des Gottesbeweises von<br />
Anselm näher behandelt habe, scheitert diese letzte transzendentale<br />
Reflexion an der nahezu unmöglich scheinenden, aber behaupteten Einheit<br />
von Wesensungleichen und fällt zur Natureinheit zurück. Daß diese<br />
Grenze ontotheologischer Spekulation trotz der Vermehrung offener<br />
Fragen nochmals in der einen oder anderen Hinsicht überschreitbar bleibt,<br />
konnte ich in meiner Darlegung zur Widerlegung des ontologischen<br />
Gottesbeweises kritisch und auch zuletzt in Hinblick auf den Übergang<br />
zur innertrinitarischen Spekulation aufzeigen.<br />
Der Vorwurf gegen die theologischen Idee, diese wäre nur aus<br />
Symmetriegründen oder historischen Gründen in der Architektonik der<br />
reinen Vernunft den Auflösungen der dritten und vierten Antinomien der<br />
kosmologischen Ideen aufgesetzt worden, und deren Abschluß in ein<br />
System regulativer Ideen würde die Vernunft bereits zu einem System von<br />
psychologischer und kosmologischer Idee auslegen können, ohne die<br />
theologische Idee dazu zu benötigen, erfolgt sicherlich nicht ohne<br />
Berechtigung, weil es weitgehend den Anschein hat, als daß es zu einem<br />
systematischen Abschluß der Erörterung der reinen Vernunftbegriffe ohne
— 1348 —<br />
theologische Idee im engeren Sinn kommen könnte. Das einzige, aber<br />
entscheidende Gegenargument: Kant untersucht das Vernunftideal im<br />
Rahmen der theologischen Idee. Die Fragen: Welche Stellung besitzt das<br />
Ideal der reinen Vernunft und das transzendentale Ideal für die<br />
Methodenlehre der Vernunft? Aus welchen Gründen muß die Behandlung<br />
des Ideals in der theologischen Idee erfolgen? Die zweite Frage ist leicht<br />
beantwortet: weil die Spekulation der reinen Vernunft aus Gründen der<br />
konstatierten Neigung zur erfahrungsüberschreitenden Auslegung auf<br />
Totalität eben zur theologischen Idee kommt, kommt sie auch erst im Zuge<br />
dieser Überschreitungen zum Ideal. Wie es sich gezeigt hat, gibt es nicht<br />
nur verschiedene Aufgänge der Spekulation, sondern auch verschiedene<br />
Ausgänge der spekulativen Totalisierung. — Die erste Frage habe ich<br />
versucht, im ersten, dritten und im letzten Abschnitt zu beantworten: Das<br />
Vernunftideal ist die Zielvorstellung der unkritischen Vernunft, bevor die<br />
Untersuchung der transzendentalen Logik als Analytik des<br />
Verstandesgebrauches zu einem systematischen Unternehmen werden<br />
kann. Damit ist aber auch die Stellung der theologischen Idee in<br />
architektonischer Hinsicht ungeachtet ihres rein spekulativen Charakters<br />
unangreifbar geworden.<br />
Die theologische Idee im engeren Sinn erlaubt in kritischer Lesung<br />
insbesondere der Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises die<br />
Einnahme des Standpunktes, es handele sich um eine Untersuchung der<br />
Möglichkeit letzter Prinzipien, deren ausschließlich dialektischer Gebrauch<br />
unbestreitbar erscheint. Die Untersuchung der Verhältnisse oberster<br />
Prinzipien als Eigenschaften des philosophischen Gottesbegriffes kommt<br />
an logische und transzendentallogische Grenzen, zumal es sich als nicht<br />
möglich herausstellt, einen Horizont der Gleichursprünglichkeit für die<br />
obersten dialektischen Prinzipien zu situieren. Dieses, wenn auch negative,<br />
Egebnis verweist auf eine mögliche logische Alternative zu<br />
Wechselbegriffen, die nicht auch Teilbegriffe des Selben sind, und erlaubt<br />
eine Charakterisierung einer spezifischen Intentionalität als<br />
Aufmerksamkeit, deren Ausrichtung unvollständig bestimmbar bleibt,<br />
und zwischen Natureinheit und höchstem Wesen oszilliert. Ebenso<br />
unterbestimmt bleibt die Möglichkeit einer erfüllenden Intention. Diese<br />
Charakterisierung einer unvollständigen Prädikatisierung macht aber<br />
weder das spezifische dieser Art von Intentionalität noch die Einzigkeit<br />
deren Ausgerichtetheit aus, sondern beschreibt nur eine formale Art der<br />
Erweiterung als Folge der spekulativen Überschreitungen. Die
— 1349 —<br />
Ausgerichtetheit ist einzig, obwohl mehrere Alternativen möglich sind,<br />
weil sie Ergebnis einer wiederholten Grenzüberschreitung von Totalität ist,<br />
welche zuletzt die Natureinheit aus Zwecken und aus dem allgemeinen<br />
Wesen der Dinge (was Wechselbegriffe als Teilbegriffe sind) bereits invers<br />
in eine Vermögenslehre umgestülpt hat. Die Ablösung der einen<br />
Vorstellung von der anderen erzeugt zuerst das Doppelssystem von reiner<br />
Intelligibilität und der Welt der Dinge, was für uns zum Dreifachsystem<br />
von Natur als Ding der Welt, Natur als Objekt des Urwesens und Welt als<br />
Gegenstand des höchsten Wesens erweitert werden kann, jedoch das<br />
höchste Wesen mit dem Urwesen immer wieder in Verwechslung gerät,<br />
jedenfalls beide miteinander durch Natur und Welt verbunden bleiben.<br />
Die doppelte Natureinheit — einmal aus der Dialektik der Idee der<br />
Zweckmäßigkeit als Seinsprinzip, einmal aus der Dialektik der<br />
allgemeinen Logik als Wesen der Dinge — entsteht schon innerweltlich<br />
aus zwei Perspektiven, in welchen sich jeweils nochmals<br />
Erkenntnisprinzip und Seinsprinzip verschränken. Die Umstülpung des<br />
Inbegriffs der Möglichkeiten zur Vermögenslehre im Zuge der Aufstufung<br />
der Grenzüberschreitungen beginnt diese Verschränkung zu<br />
Vergegenständlichen, sodaß die absolute Position, obgleich nur spekulativ<br />
gedacht, gegenüber der Welt der Dinge darstellbar wird. Das ist eine Folge<br />
der Herausdrehung der transzendentalen Perspektive aus dem<br />
ontologischen Realismus und der Substanzmetaphysik in den<br />
transzendentalen Idealismus und der Subjektmetaphysik, obgleich der<br />
transzendentale Subjektivismus gegenläufig die nämliche Verschiebung<br />
als Herausdrehung der transzendentalen Perspektive aus der<br />
Subjektmetaphysik in die Ontologie begreift. Die weitere Erörterung der<br />
Modallogik bis zur Vorstellung der Existenz als Folge, und deren<br />
Steigerung bis zur unbedingten Bedingung, und von da zur nicht selbst<br />
verursachten Ursache (Spontaneität) läßt sich in beiden Fassungen<br />
vorstellen. Die Unterscheidung ist aber anhand der Erfahrung zu treffen<br />
möglich, was zumindest ein Motiv dafür ist, daß Kant die oberste<br />
materiale Bedingung in die oberste Idee (transzendentales Ideal) verlegt.<br />
Die Kriterien dieser Unterscheidung sind einseitig definitiv und a priori<br />
bestimmbar durch die transzendentale Analytik des Verstandesgebrauches<br />
und die Kritik bzw. Auflösung der Dialektik der reinen Vernunftbegriffe.<br />
Die intensionale Aufstufung der Totalitäten und deren Negationen (die<br />
nicht durchwegs affirmativ sind!) und die Übergänge anhand der Analogie<br />
zum Übergang von Subjekt als ursprünglicher Daseinsbegriff zum Objekt
— 1350 —<br />
(vom transzendentaler Idealismus zur synthetischen Metaphysik und vom<br />
Inbegriff der Möglichkeiten zurück zur Vermögenslehre) verweisen auf die<br />
der Dialektik der idealischen Vernunft eigentümliche Struktur der<br />
spekulativen Reflexion: Verdopplung und Unähnlichmachung. Die<br />
idealistische Beschränktheit totaler Selbstauslegung führt aber zur<br />
Selbstveräußerung, zur Entfremdung und zur verkehrten Vernunft, die<br />
deshalb verkehrt ist, weil sie empirische (psychologische)<br />
Denkmöglichkeit, logische Möglichkeit, Bedingungen der Möglichkeit der<br />
Erfahrung und Seinsmöglichkeiten bloß raphsodisch vermengt und in<br />
Folge der gesetzten Strebung der Vernunft nach Totatlität an der Grenze<br />
der Reflexion sich dissoziativ verdoppelt und anders anordnet. In diesem<br />
Abgrund gründet jenun die Vernunftspekulation, wenn sie sich als<br />
Spekulation nicht als sich selbst, sondern zugleich als das andere setzt.<br />
Aber: Setzt sie sich selbst, setzt sie damit auch anderes. Die Verkehrtheit<br />
des sich selbst als anderes Setzens spiegelt sich im nur analytisch<br />
mitgesetzten anderen ab; wird dies zum Prinzip der Spekulation erhoben,<br />
spiegelt sich die Sich-selbst-als-anderes-Setzung am nur spekulativ<br />
Mitgesetztem ab und wird in objektsprachlicher Perspektive tautologisch,<br />
in metasprachlicher Perspektive stellt sich hingegen der topologische<br />
Stellungswechsel nochmals abstrakt dar. Die Frage ist dann: Unter<br />
welchen Umständen berührt der angesprochene Positionswechsel im<br />
Kontext den fraglichen Inhalt nicht? Sicher ist, daß unter diesen kritischen<br />
Umständen der Positionswechsel den Inhalt sehr wohl berührt (und zwar<br />
auch dann, wenn diese Veränderung nicht gesetzmäßig darstellbar ist),<br />
und eine solche Veränderung die verschieden gewordenen Inhalte auch<br />
aufeinander bezieht. Offen bleibt, ob eine Platzhalterschaft (Topologie)<br />
eines Inhalts, dessen Veränderung allein aus der Struktur der spekulativen<br />
Bewegung des Denkens entstammt, überhaupt etwas außerhalb dieser<br />
Struktur bedeuten kann.<br />
Derart kann die architektonische Stellung der theologische Idee als<br />
mindestens dreifach gerechtfertigt angesehen werden: Historisch-genetisch<br />
als idealische Vernunft, im Ideal der reinen Vernunft als Begriff vom<br />
einzelnen Gegenstand, und das transzendentale Ideal als Ort der<br />
zweifachen Ausstülpung: prototypon transcendentale als transzendentale<br />
Anthropologie oder als Ontotheologie.<br />
❆