Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig ... - Krotoszyn
Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig ... - Krotoszyn
Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig ... - Krotoszyn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Heinrich</strong> <strong>Wuttke</strong>, <strong>Städtebuch</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>Posen</strong>, <strong>Leipzig</strong> 1877, s. 347-348<br />
Krotoschin, polnisch <strong>Krotoszyn</strong> (1458 Krothoschyn, auf alten Karten auch Krutoschin), wird<br />
uns erst spät 1 , erst in der Mitte <strong>des</strong> XVI. Jahrhunderts genannt, als ihm die Stellung von 2<br />
Kriegern (in der Veranlagung von 1458) auferlegt wurde. Im XVI. Jahrhunderte waren die<br />
Rozdrazewski Besitzer <strong>des</strong> Ortes. Einer von diesen Namens Johann hielt sich zu den<br />
böhmischen Brüdern und übergab daher diesen die katholische Kirche; jedoch nach einem<br />
Jahrzehnt schon war sie den böhmischen Brüdern wieder genommen. Im XVII. Jahrhunderte<br />
geschieht eines schönen herrschaftlichen Schlosses mit Gartenanlagen Erwähnung, welches<br />
nahe an der Stadt liegt. Der Ort kam zu 8 Jahrmärkten, die lange ansehnlich waren, jedoch im<br />
XVIII. Jahrh. unbedeutend wurden. In demselben Jahrhunderte war Krotoschins Gegend<br />
während <strong>des</strong> letzten Schwedenkrieges (1712) Schauplatz von Kämpfen, dann erscheint Ignaz<br />
Potocki als Besitzer, der eine Kirche und ein Kloster erbauen liess, die er 1731 den<br />
Trinitariermönchen übergab. Die zu Fraustadt am 23. August 1785 gehaltene grosspolnische<br />
Dissidentensynode genehmigte für Krotoschin den Bau einer evangelischen Kirche und die<br />
Berufung eines Predigers. Der Bau der lutherischen Kirche geschah darauf 1790. Die Stadt<br />
hatte ein Hospital, aber es wurde schlecht verwaltet. Die Bürger besassen Braugerechtigkeit,<br />
sie wurde ihnen jedoch entzogen und erst in der südpreussischen Zeit (1797) zurückgegeben.<br />
Das Geschlecht der Krotowski führt von diesem Ort den Namen. Nach der Theilung Polens<br />
kam Krotoschin an den preussischen Minister Goerne, als dieser abgesetzt und eingesperrt<br />
wurde, ward Krotoschin zu einem Domänenamt gemacht. Am Ausgange <strong>des</strong> XVIII. Jahrh.<br />
war Krotoschin eine offene Stadt, ohne Graben und Wall, mit 3 Thoren. Auf dem Markte lag<br />
das gemauert aufgeführte Rathhaus, Katholiken und Evangelische hatten ihre Kirche,<br />
ausserdem war ein Kloster mit 11 Geistlichen vorhanden. Die Zahl der Wohnhäuser betrug<br />
502, von denen ein einziges Ziegeldach hatte. In der südpreussischen Zeit wurden in<strong>des</strong>s noch<br />
auf dem zum Domänenamte gehörigen Grunde vor dem Kobiliner Thore massive Häuser und<br />
auch ein Salzmagazin erbaut. Zur Stadt gehörten 44 Mühlen. Die Kämmerei bezog jährlich<br />
1152 Thlr. Die Stadt hiell 3 Nachtwächter. Die Einwohnerzahl betrug 3427, von denen etwa<br />
ein Sechstel Polen, nahezu ein Drittel (1074) Juden waren. In der Stadt lebten 10<br />
Leinwandhändler, 5 Tuchhändler, 3 Eisenhändler, 63 Kürschner (zur Hälfte Juden), 2 Gerber,<br />
56 Schneider (davon 51 Juden), 40 Tuchmacher und Tuchscherer, 40 Schuster, 38 Leinweber,<br />
37 Bäcker, 31 Müller, 18 Fleischer, 15 Branntweinbrenner, l Weinhändler, 9 Hufschmiede, 8<br />
Töpfer, 7 Stellmacher, 7 Posamentirer (davon 5 Juden), 4 Böttcher, ferner l Honigküchler, 2<br />
Goldschmiede (Juden), l Bildhauer (Jude), 3 Buchbinder (Juden), 7 Musiker, l Apotheker;<br />
einen Bierbrauer gab es nicht. Im XIX. Jahrhundert wurde eine Tabakspfeifenfabrik angelegt.<br />
Kürschnerei, Gerberei, Tuchweberei, Cichorien- und Tabaksbereitung blieb im Schwünge<br />
oder kam nun in Aufnahme, auch der Wollhandel nahm zu. 1816 betrug die Einwohnerzahl<br />
4227 (n. a. 4406); im Kloster gab es nur noch 3 Mönche. 1837 lebten in Krotoschin 6337,<br />
1843: 6750, 1858: 7688, 1861: 8459 Menschen. Ein Stadt- und Landgericht bekam in<br />
preussischer Zeit hier seinen Sitz. Der König gab im Mai d. J. 1819 Krotoschin als “rechtes<br />
Erb-Thron-Mann-Lehn" zur Abfindung für die Posthalterei in Rheinpreussen dem Fürsten<br />
Karl Alexander von Thurn und Taxis in Besitz und vereinigte sämmtliche ihm in <strong>Posen</strong><br />
gegebene Herrschaften (die Städte Adelnau und Sulmerschütz, 48 Dörfer, eine Anzahl<br />
Vorwerke und Forsten) am 25. Mai 1819 zu einer Stan<strong>des</strong>herrschaft, am 29ten zu einem<br />
Fürstenthum Krotoschin. Die neue Herrschaft nahm <strong>des</strong> Ortes sich an. Die Juden legten eine<br />
hebräische Druckerei an, auch eine Buchhandlung entstand, später sogar eine Bücherei. Eine<br />
Sparkasse wurde gegründet. Die Stadtschule ward erweitert und die Bürgerschaft begehrte<br />
1 Ein Dorf Crothoszino, welches im XIV. Jahrhunderte den Cisterziensern zu Lekno gehörte<br />
und von diesen 1361 an Shiluth. Erbherrn von Domaborz, verkauft wurde (Cod. dipl. Pol., II,<br />
732), lag in districtu Paluccnsi, ist also das Dorf dieses namens in der Gegend von Schubin
schon 1833 ein Gymnasium; die Regierung fand jedoch, dass es dazu an Mitteln gebreche.<br />
In<strong>des</strong>sen wurde die Stadtschule 1836 zu einer Kreisschule erweitert, ihr das Klostergebäude<br />
eingeräumt und sie 1847 zu einer Realschule erhöht. Eine Mädchenschule ward daneben<br />
gegründet und endlich 1854 wirklich ein Gymnasium errichtet 2 . Die Städteordnung ward am<br />
29. November 1834 verliehen. Ein Brand, der 1841 (?) die Stadt grossentheils verzehrte, ward<br />
überwunden: besser wurde sie aufgebaut. Im Jahre 1848 ahmte der Landrath Bauer, der es mit<br />
der Polenpartei hielt, den Königsritt nach. Hoch zu Ross durchritt der schöne Mann die Stadt,<br />
die Verbrüderung der Deutschen und Polen verkündend, darauf veranstaltete er auf dem<br />
Markte eine Volksversammlung und hielt in ihr eine Rede, <strong>des</strong> Inhalts, dass eine neue Zeit<br />
angebrochen sei. Des zum Zeichen liess er vom Rathhaus den preussischen Adler abnehmen,<br />
den polnischen aufstellen. Die Beamten liefen davon, der Bürgermeister, ein guter, einfacher<br />
Mann, wusste nichts zu thun. Bauer setzte als neue Behörde einen Ausschuss auf dem<br />
Rathhause ein. Polnische Edelleute richteten sich auf ihm ein. Allein den Juden missfiel diese<br />
Veränderung. Sie waren es, die einschritten; sie entfernten den polnischen Adler, und ein<br />
begüterter Mann aus ihrer Mitte, L. Benas, begab sich aufs Rathhaus und fragte Bauer: “was<br />
alles das solle? wozu die Edelleute hier seien, da doch die Stadt ihren eigenen Rath habe?“.<br />
Bauer antwortete: “ob er denn nicht wisse, was vorgegangen sei in der Welt?“. Benas jedoch<br />
bedeutete ihm mit Nachdruck: er habe auf dem Rathhaus gar nichts zu suchen. Bauer musste<br />
das Rathhaus verlassen. Darauf zogen sich die Edelleute in den Gregorschen Saal und tagten<br />
dort weiter; sowie es ruchbar wurde, jagten Judenburschen sie auseinander und trieben sie aus<br />
der Stadt. Ein polnischer Reiter, der in die Stadt sprengte, wurde vom Pferde gerissen. Die<br />
Juden riefen: “wir wollen kein Polenthum, wir sind Preussen!“ Nunmehr schloss Krotoschin<br />
den Schritten, die Meseritz that, sich an, schickte (den 18. April) Bevollmächtigte nach <strong>Posen</strong>,<br />
um sich mit dem dortigen Hauptausschluss zu benehmen, ordnete eine Absendung nach Berlin<br />
ab und verlangte Willisen's Entfernung. Damals war Jüngling Marian Langiewicz, der hier am<br />
5. August 1827 als der Sohn eines Arztes geboren wurde, wahrscheinlich einer deutschen<br />
Familie Lange entsprossen, welcher nachmals der geschickte Anführer und Dictator der Polen<br />
in ihrem Erhebungsversuche im Winter 1863 war. Der Sinn für Geschichte scheint in<br />
Krotoschin sehr schwach, da von dieser beträchtlichen Stadt so geringe geschichtliche<br />
Nachrichten aufzubringen sind.<br />
Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski<br />
2 Schönborn’s Jahresbericht über das Gymnasium zu Krotoschin von Ostern 1854 bis Ostern<br />
1855.


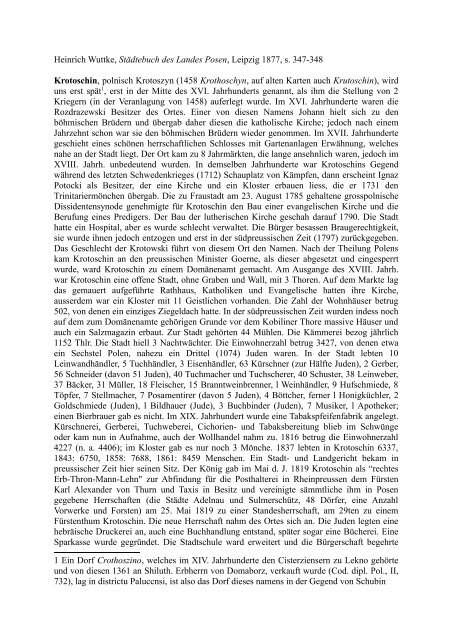











![Dr Stanisław Karwowski [rec.], Koźmin Wielki i Nowy. Monografia ...](https://img.yumpu.com/18093540/1/184x260/dr-stanislaw-karwowski-rec-kozmin-wielki-i-nowy-monografia-.jpg?quality=85)

