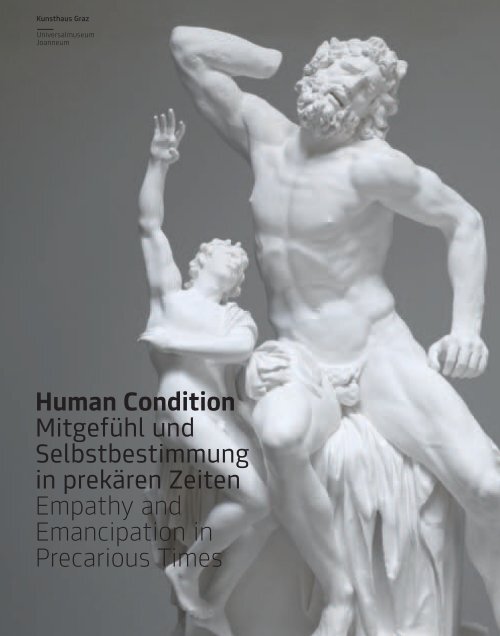Human Condition - Universalmuseum Joanneum
Human Condition - Universalmuseum Joanneum
Human Condition - Universalmuseum Joanneum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong><br />
<strong>Joanneum</strong><br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Empathy and<br />
Emancipation in<br />
Precarious Times
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Empathy and<br />
Emancipation in<br />
Precarious Times
2—3<br />
Susan Philipsz<br />
The River Cycle, 2009<br />
Lyrics: Radiohead,<br />
Pyramid Song, 2001
I jumped in the river and what did I see?<br />
Black-eyed angels swam with me<br />
A moon full of stars and astral cars<br />
And all the figures I used to see<br />
All my lovers were there with me<br />
All my past and futures<br />
And we all went to heaven in a little row boat<br />
There was nothing to fear and nothing to doubt<br />
I jumped into the river and what did I see?<br />
Black-eyed angels swam with me<br />
A moon full of stars and astral cars<br />
And all the figures I used to see<br />
All my lovers were there with me<br />
All my past and futures<br />
And we all went to heaven in a little row boat<br />
And there was nothing to fear and nothing to doubt<br />
There was nothing to fear and nothing to doubt<br />
There was nothing to fear and nothing to doubt
4—5<br />
Adrian Paci<br />
Per Speculum,<br />
2006
8—9<br />
Adrian Paci<br />
Turn on, 2004
10—11<br />
Adrian Paci<br />
Electric Blue, 2010
14—15<br />
Lida Abdul<br />
In Transit, 2008
18—19<br />
Lida Abdul<br />
White House, 2005
22—23<br />
Name des Künstlers<br />
Titel der Arbeit, 2005
24—25<br />
Lida Abdul<br />
Man in the Sea, 2010
26—27
28—29<br />
Marcel Dzama<br />
Pip, 2004
30—31<br />
Marcel Dzama<br />
Knowing precisely<br />
where to cut, 2008
32—33<br />
Marcel Dzama<br />
Ulysses, 2009
34—35<br />
Mark Manders<br />
Two Interconnected<br />
Houses, 2010
36—37
40—41<br />
Kris Martin<br />
Mandi VIII, 2006
42—43<br />
Mark Manders<br />
Small Unfired<br />
Clay Figure, 2006/07
44—45<br />
Kris Martin<br />
Bells, 2008
46—47<br />
Maria Lassnig<br />
Woman Laokoon, 1976
48—49<br />
Marcel Dzama<br />
Zürich redet<br />
mit Helvetia,<br />
2008<br />
Lits et ratures,<br />
2008
50—51<br />
Marcel Dzama<br />
Whose hell hoof<br />
resounds like<br />
heaven’s thunder,<br />
2008<br />
Presence is<br />
unsustainable or<br />
The circle of<br />
traitors, 2008
52—53<br />
Marcel Dzama<br />
Surrounded by<br />
his dark machines<br />
and the rage of<br />
the wild or An<br />
epic of humanity,<br />
2008<br />
Poor Bertrand<br />
de Born, 2009
54—55<br />
Renzo Martens<br />
Episode 3, 2009
58—59<br />
Renzo Martens<br />
Episode 1, 2000/03
62—63<br />
Maria Lassnig<br />
Stilleben mit rotem<br />
Selbstportrait, 1969
64—65
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Diese Publikation<br />
erscheint anlässlich<br />
der Ausstellung<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong><br />
<strong>Joanneum</strong><br />
12. Juni bis<br />
12. September 2010<br />
Kurator<br />
Adam Budak<br />
Herausgeber<br />
Peter Pakesch,<br />
Adam Budak<br />
Erschienen<br />
im Verlag der<br />
Buchhandlung<br />
Walther König,<br />
Köln
66 — 67<br />
Inhaltsverzeichnis
2<br />
Abbildungen<br />
176<br />
Vorwort<br />
Peter Pakesch<br />
178<br />
Die Zerbrechlichkeit<br />
der menschlichen<br />
Angelegenheiten<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>.<br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Adam Budak<br />
198<br />
Empathie und<br />
Emanzipation<br />
„Verstehendes Herz“,<br />
prekäre Zeit,<br />
erweitertes Urteilen –<br />
eine Annäherung<br />
mit Hannah Arendt<br />
Sophie Loidolt<br />
206<br />
Vita activa oder<br />
Vom tätigen Leben<br />
Hannah Arendt<br />
218<br />
Die empathische<br />
Zivilisation<br />
Wege zu einem<br />
globalen<br />
Bewusstsein<br />
Jeremy Rifkin<br />
238<br />
Gefährdetes Leben<br />
Politische Essays<br />
Judith Butler<br />
253<br />
Index<br />
254<br />
Biografien<br />
264<br />
Impressum
Vorwort<br />
Peter Pakesch
Der Gang der letzten Jahre hat uns vieler Gewissheiten beraubt. Eine in atemberaubendem<br />
Tempo wachsende Menschheit durchlebt eine Entwicklung höchst heterogener<br />
und widersprüchlicher Dynamik, die die Grundfesten unserer Existenz materiell wie<br />
ideell infrage stellt. Die Fragen, mit denen wir heute konfrontiert werden, vervielfachen<br />
sich nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken. Sie multiplizieren sich<br />
vor allem auch durch ein nie zuvor existentes Wissen vom Gang des Geschehens und<br />
der Umstände allerorts, in großen Zusammenhängen wie auch im Detail – und mit<br />
all den Unterschieden, die krasser nicht sein könnten. Das verursacht ein Bedürfnis,<br />
nach Gewissheiten zu suchen, ein Verlangen nach Strategien, diesen Wandel besser<br />
zu verstehen und ihm mit neuen Dimensionen des Handelns zu begegnen. So begeben<br />
wir uns gegenwärtig im <strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong> mit ganz unterschiedlichen<br />
Ausstellungen auf die Suche nach den Perspektiven dieser Aktualität. Im Zentrum<br />
davon steht das vorliegende Projekt <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten als ein Aspekt des Themenschwerpunktes Conditio humana.<br />
So lebt der Mensch.
Die Zerbrechlichkeit<br />
der menschlichen<br />
Angelegenheiten<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Adam Budak
1 Gilles Deleuze: Logik des Sinns.<br />
Frankfurt: Suhrkamp 1993, S. 100.<br />
2 Judith Butler: Gefährdetes<br />
Leben. Politische Essays.<br />
Frankfurt: Suhrkamp 2005, S. 68.<br />
3 The Invisible Committee, The<br />
Coming Insurrection, Semiotext(e)<br />
Intervention Series 1, Los Angeles:<br />
Semiotext(e) 2009, S. 16<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
4 Vgl. Hannah Arendt: Vita activa<br />
oder Vom tätigen Leben. München:<br />
Piper 1981.<br />
5 Vgl. Jeremy Rifkin: Die empathische<br />
Zivilisation. Wege zu einem<br />
globalen Bewusstsein. Frankfurt,<br />
New York: Campus 2009.<br />
6 Butler, Gefährdetes Leben, S. 67.<br />
7 Brian Holmes: Escape the<br />
Overcode. Activist Art in the Control<br />
Society. Van Abbemuseum/<br />
WHW 2009, S. 195<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
Was gibt es Bürokratisches in diesen phantastischen Maschinen, die die Völker und<br />
Gedichte sind? Es reicht, daß wir uns ein wenig zerstreuen, damit wir uns auf der<br />
Oberfläche wissen, daß wir unsere Haut wie eine Trommel spannen, damit die „große<br />
Politik“ beginnt. Ein leeres Feld, weder für den Menschen, noch für Gott; Singularitäten,<br />
die weder allgemein noch individuell, weder persönliche noch universelle sind,<br />
all dies durchquert von Zirkulationen, Echos, Ereignissen, die mehr Sinn und mehr<br />
Freiheit verschaffen, mehr Wirksamkeiten, als der Mensch je erträumt und Gott sich<br />
je vorgestellt hatte. Das leere Feld zirkulieren zu lassen und die prä-individuellen und<br />
unpersönlichen Singularitäten zum Sprechen zu bringen, kurz, den Sinn zu produzieren:<br />
Darin besteht heute die Aufgabe.1<br />
Denn wenn ich von dir verwirrt bin, da bist du bereits bei mir, und ich bin nirgendwo<br />
ohne dich. Ich kann das „Wir” nicht zusammenbringen, es sei denn, ich finde die Art<br />
und Weise, wie ich an das „Du” gebunden bin, indem ich zu übersetzen versuche, aber<br />
feststelle, daß meine eigene Sprache versagen und aufgeben muß, wenn ich dich<br />
kennen will. Du bist das, was ich durch diese Orientierungslosigkeit und diesen Verlust<br />
gewinne. So entsteht das Menschliche immer wieder als das, was wir erst noch<br />
kennenlernen müssen.2<br />
Wenn dann alles gesagt und getan ist, befinden wir uns mit einer gesamten Anthropologie<br />
im Krieg. Mit der Idee des Menschen an sich.3<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten bietet eine<br />
Reise in die menschliche Ethik, in der die Struktur des Einander-Ansprechens, der Veranwortung<br />
und des moralischen Handelns auf dem Spiel stehen. „Wer sind wir?“, fragt<br />
Hannah Arendt in Vita activa oder Vom tätigen Leben, wo sich die Verwirklichung eines<br />
„Wer“ auf Denk-, Willens- und Urteilsprozesse bezieht.4 „Woraus bestehen wir?“, fragt<br />
Jeremy Rifkin bei seiner Einführung des Homo empathicus, des Protagonisten seiner<br />
„neuen Sicht auf das Wesen des Menschen”.5 „Was gilt als menschlich? Was erlaubt<br />
uns einander zu begegnen?“6, untersucht Judith Butler am Ende ihrer Aufsätze über<br />
zeitgenössische Gewalt und Trauer. Diese Ausstellung ist das Porträt einer prekären<br />
Welt voller Instabilität und mit einer ungewissen Zukunft, in der die Verwundbarkeit der<br />
Gesellschaft hinterfragt und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Angelegenheiten<br />
zur Schau gestellt wird. In welchem Verhältnis stehen Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
zueinander? Auf welche Art und Weise wird durch diese Begriffe das menschliche<br />
Sein geformt? Im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Verzweiflung, Selbstermächtigung<br />
und einem rasant wachsenden Riss in der gesellschaftlichen Gestalt,<br />
zwischen kommunalem Begehren und einer Mentalität des Individualismus versammeln<br />
sich in dieser Ausstellung Modelle zeitgenössischer Wirklichkeiten und Konfliktherde.<br />
Im Angesicht der Unvorhersehbarkeit der Zukunft und konfrontiert mit der<br />
Aufhebung bislang verfügbarer Muster stellt sie sich die Frage, ob es noch Hoffnung<br />
gibt, und sucht nach Möglichkeiten von Heldentum im Zeitalter korrumpierter Werte<br />
und der Auslöschung des historischen Subjekts. „Wie kommt die Welt zusammen? Wie<br />
fällt eine Welt auseinander?“ Dies ist Brian Holmes’ Neuformulierung des ganz grundlegenden<br />
„Sein oder Nichtsein?“ unserer Zeit und sein Verweis auf Mittel und Wege<br />
für intellektuelles Handeln an der Basis im heutigen globalen System, als Prozesse der<br />
„Selbstverortung vor dem Horizont der Katastrophe und der anschließenden Ermittlung<br />
der Methoden und Maßstäbe konkreter Intervention in die gelebte Erfahrung“7. In den<br />
Worten dieses Gesellschaftstheoretikers „stehen wir an der Schwelle zu einem Gesellschaftsumbruch,<br />
herbeigeführt durch ein gescheitertes Wirtschaftsmodell, das auch<br />
zum Schmelzen der Polkappen und Aufflammen von Kriegen geführt hat”8.
72 — 73<br />
Adam Budak<br />
8 Holmes, Escape the Overcode,<br />
S. 401<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
9 Nicolas Bourriaud: Precarious<br />
Constructions. Answers to Jacques<br />
Ranciere on Art and Politics. In:<br />
Open. Cahier on Art and the Public<br />
Domain No. 17 (2009), S. 23<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
10 Bourriaud, Precarious<br />
Constructions, S. 32<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
11 Comité invisible,<br />
L’insurrection qui vient, S. 9<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
12 Ibid., S. 83<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
http://www.mecanopolis.org/<br />
wp-content/uploads/2008/11/<br />
pdf_insurrection.pdf<br />
13 Vgl. Ibid., S. 15<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
14 Ibid., S. 19.<br />
Mehr als je zuvor tauchen zahlreiche Fragen von alarmierender Dringlichkeit auf und<br />
es formen sich dann Aussagen von sowohl Verzweiflung als auch Klarheit, verschickten<br />
Manifesten, Äußerungen einer Gesellschaft, einer Menschlichkeit im Angesicht des<br />
Verlusts moralischer Autorität und eines Gefühls für Werte. Wer spricht heute für die<br />
Menschheit? Mit welcher Stimme und mit welchen Absichten? Was sind die vordringlichen<br />
Verpflichtungen in unserer Zeit? Was ist moralisch verbindlich? Wir warten. Wir<br />
hängen in der Luft. Es sind prekäre Zeiten, in denen wir leben – zerbrechliche und ephemere<br />
Augenblicke der Kurzlebigkeit. Beständigkeit ist zu einer Seltenheit geworden.<br />
In seiner Analyse des „Prekariats“ erinnert Nicolas Bourriaud an Zygmunt Baumans<br />
Definition unserer Zeit als einer der „flüssigen Moderne“ in Form einer Gesellschaft von<br />
allgemeiner Disponibilität, wo nichts verrufener ist als „die Standfestigkeit, Klebrigkeit<br />
und Zähflüssigkeit von belebten wie unbelebten Dingen“9. „Prekär“ bedeutet, wie Bourriaud<br />
erinnert, etymologisch „das, was nur dank einer jederzeit umkehrbaren Genehmigung<br />
existiert. Die precaria waren die Felder, die für einen festgesetzten Zeitraum<br />
dem Bauern vom Grundherrn zur Nutzung überlassen wurden, ganz unabhängig von<br />
den Gesetzen zur Regelung von Eigentumsfragen. Man sagt, ein Gegenstand sei prekär,<br />
wenn er weder einen eindeutigen Status noch eine sichere Zukunft oder endgültige<br />
Bestimmung hat: Er ist gefangen, in der Schwebe, wartend, umgeben von Unschlüssigkeit.<br />
Er besetzt ein transitorisches Territorium.“10<br />
Wir warten. Wir hängen in der Luft, in Erwartung. Das vom anonymen Kollektiv Comité<br />
invisible verfasste politische Pamphlet L’insurrection qui vient (Der kommende Aufstand)<br />
konstatiert knallhart: „Darüber ist sich jeder einig. Wir stehen unmittelbar vor<br />
dem großen Knall.”11 Wir warten weiter, während sie behaupten:<br />
Warten ist sinnlos – auf einen Durchbruch, auf die Revolution, die atomare Apokalypse<br />
oder eine soziale Bewegung. Weiter warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe wird nicht<br />
kommen, sie ist schon da. Wir befinden uns bereits mittendrin im Zusammenbruch der<br />
Zivilisation. Und in eben dieser Wirklichkeit müssen wir Position beziehen.12<br />
Die Rhetorik der Krise und die Rhetorik der Macht überschneiden sich hier; das Teilen<br />
von Empfindsamkeit und die weitere Ausarbeitung des Teilens ist ein Antrieb: die<br />
Enthüllung dessen, was uns gemein ist und der Aufbau einer Macht. Die Empathie fungiert<br />
als Mittel zur Messung der Intensität des Teilens.13 Und noch eine Frage, ebenso<br />
merkwürdig wie auf der Hand liegend und verwundbar, kommt hier zum Ausdruck: „Wie<br />
finden wir einander?”14 Inmitten der Aufstände in Griechenland und Frankreich, beim<br />
Gebet im Schatten eines Tempels, wird ein Ruf nach einem Aufstand geäußert.<br />
Die zur Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären<br />
Zeiten eingeladenen Künstler erschließen den kritischen Raum des menschlichen Seins<br />
und legen ihr Augenmerk ganz besonders auf Hannah Arendts Handeln, eine der ganz<br />
grundlegenden menschlichen Tätigkeiten, die zusammen mit Arbeiten und Herstellen<br />
die Vita activa bzw. das tätige Leben ausmachen und den elementaren Bedingungen<br />
entsprechen, unter denen dem Menschen in Hannah Arendts Worten das Leben auf<br />
Erden geschenkt wurde. Die menschliche Grundbedingung, unter der die Tätigkeit<br />
des Arbeitens steht, ist das Leben selbst, wogegen das Herstellen für eine „künstliche“<br />
Welt der Dinge sorgt, deutlich anders als jede natürliche Umgebung, und seine<br />
menschliche Grundbedingung ist die Weltlichkeit. Das Handeln ist, wie Arendt ausführt,<br />
die einzige Tätigkeit der Vita activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material<br />
und Dingen direkt zwischen Menschen abspielt. Die Grundbedingung, die ihr entspricht,<br />
ist das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, daß nicht ein Mensch, sondern<br />
viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern.15<br />
Das Handeln wird verknüpft mit dem Prinzip des Neuanfangs, „im ursprünglichsten<br />
und allgemeinsten Sinne ist Handeln und etwas Neues anfangen dasselbe; jede Aktion
15 Arendt, Vita activa, S. 17.<br />
16 Ibid., S. 215.<br />
17 Ibid., S. 217.<br />
18 Ibid., S. 220.<br />
19 Ibid., S. 224.<br />
20 Ibid., S. 234.<br />
21 Julia Kristeva: Hannah Arendt.<br />
New York: Columbia University<br />
Press 2001, S. 174<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
setzt vorerst etwas in Bewegung“.16 Das Handeln ist auch mit dem Sprechen verwandt,<br />
weil das Handeln der spezifisch menschlichen Lage, sich in einer Vielheit einzigartiger<br />
Wesen als unter seinesgleichen zu bewegen, nur entsprechen kann, wenn es seine Antwort<br />
auf die Frage bereithält, die unwillkürlich jedem Neuankömmling vorgelegt wird,<br />
auf die Frage: „Wer bist Du?“17 […] Diese Aufschluß-gebende Qualität des Sprechens<br />
und Handelns, durch die, über das Besprochene und Gehandelte hinaus, ein Sprecher<br />
und Täter mit in die Erscheinung tritt, kommt aber eigentlich nur da ins Spiel, wo Menschen<br />
miteinander, und weder für- noch gegeneinander, sprechen und agieren.18<br />
Ein Ruf nach dem „Wer“ und dem „Mit(einander)“ liegt Hannah Arendts Gewebe der<br />
menschlichen Beziehungen zugrunde; Dazwischen und Zusammengehörigkeit sind<br />
darin die grundlegendsten Einsatzplattformen:<br />
Handeln und Sprechen bewegen sich in dem Bereich, der zwischen Menschen qua<br />
Menschen liegt, sie richten sich unmittelbar an die Mitwelt, in der sie die jeweils<br />
Handelnden und Sprechenden auch dann zum Vorschein und ins Spiel bringen, wenn<br />
ihr eigentlicher Inhalt ganz und gar „objektiv“ ist, wenn es sich um Dinge handelt,<br />
welche die Welt angehen, also den Zwischenraum, in dem Menschen sich bewegen und<br />
ihren jeweiligen, objektiv-weltlichen Interessen nachgehen. Diese Interessen sind im<br />
ursprünglichen Wortsinne das, was „inter-est“, was dazwischen liegt und die Bezüge<br />
herstellt, die Menschen miteinander verbinden und gleichzeitig voneinander scheiden.<br />
Fast alles Handeln und Reden betrifft diesen Zwischenraum, der ein jeweils anderer für<br />
jede Menschengruppe ist, so daß wir zumeist miteinander über etwas sprechen und<br />
einander etwas weltlich-nachweisbar Gegebenes mitteilen, für das die Tatsache, daß<br />
wir unwillkürlich in solchem Sprechen-über auch noch Aufschluß darüber geben, wer<br />
wir, die Sprechenden, sind, von sekundärer Bedeutung scheint.19<br />
Das Handeln als Instrument der Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten ist<br />
eine gemeinschaftliche Angelegenheit – im Gegensatz zur Tätigkeit des Herstellens<br />
ist es in Isolierung niemals möglich. Für Arendt gilt: „[J]ede Isoliertheit […] beraubt der<br />
Fähigkeit zu handeln.“20<br />
Von Julia Kristeva wird Arendt für ihre Verwirklichung eines „Wer“ gewürdigt, in ihren<br />
philosophischen Ausführungen zu den Denk-, Willens- und Urteilsakten auf der Suche<br />
nach Antworten zu der Frage „Wer sind wir?“ im Gegensatz zu „Was sind wir?“. Nur<br />
offenbart in einer Handlung, an die es gekoppelt ist, erscheint das „Wer“ als dynamische<br />
Realität, als energeia, die ihr eigenes Tun und Handeln transzendiert und sich<br />
allen Versuchen der Verdinglichung oder Vergegenständlichung widersetzt. Somit ist<br />
es eine „Quelle“ der Kreativität, wenn auch, wie Kristeva anmerkt, „eine, die außerhalb<br />
des eigentlichen Schaffensprozesses bleibt“ und „unabhängig davon ist, was [von<br />
Künstlern] erreicht wird.“21 Kristeva diagnostiziert darüber hinaus auch ein schwieriges<br />
Verhältnis zwischen dem „Wer“ und dem Selbst : Das „Wer“ ist das eigenständige<br />
Wesen, der griechische daimon, der „anderen gegenüber so deutlich und unverwechselbar<br />
erscheint, aber „der Person selbst verborgen bleibt.“ Das „Wer“ ist ein verborgenes<br />
Selbst, doch es verbirgt sich mehr vor der Person als vor der Erinnerung anderer<br />
Menschen. Das „Wer“ erscheint somit essenziell zu sein, doch nur im engen Sinne des<br />
Wortes: „as an essence that is actualized within the time of the plurality specific to<br />
other people.“22<br />
Indem er Hannah Arendts „Wer sind wir?” durch ein „Woraus bestehen wir?“ ergänzt,<br />
verkündet der Ökonom und Aktivist Jeremy Rifkin einen epochalen Schwenk auf eine<br />
„Klimaxweltwirtschaft“ und eine fundamentale Neuausrichtung des menschlichen<br />
Lebens auf diesem Planeten. Seinen Ausführungen zufolge wird nun, im Lichte der<br />
dritten industriellen Revolution, in einer neuen Ära des distributed capitalism (verteilter<br />
Kapitalismus) und am Beginn eines Biosphärenbewusstseins, das Zeitalter der
74 — 75<br />
Adam Budak<br />
22 Kristeva, Hannah Arendt,<br />
S. 173.<br />
23 Rifkin, Die empathische<br />
Zivilisation, S. 14.<br />
24 Ibid., S. 45.<br />
25 Vgl. Ibid., S. 31.<br />
26 Vgl. Ibid., S. 31.<br />
27 Ibid., S. 33.<br />
28 Ibid., S. 159.<br />
29 Ibid., S. 113.<br />
30 Vgl. Ibid., S. 119.<br />
31 Jeremy Rifkin, The Empathic<br />
Civilization: The Race to Global<br />
Consciousness in a World in Crisis.<br />
New York: Tarcher 2009, S. 168.<br />
32 Ibid, S. 173.<br />
33 Ibid, S. 173.<br />
34 Rifkin, Die empathische<br />
Zivilisation, S. 14.<br />
35 http://www.republicart.net/<br />
disc/empire/buden02_de.htm<br />
Aufklärung vom Zeitalter der Empathie abgelöst. Rifkin beginnt sein Buch Die empathische<br />
Zivilisation mit einer beunruhigenden Frage: „Wird globale Empathie rechtzeitig<br />
erreicht sein, um den Zusammenbruch der Zivilisation abzuwenden und unseren<br />
Planeten zu retten?”23 Die Entdeckung des Homo empathicus ist von entscheidender<br />
Bedeutung für Rifkins radikale neue Sicht auf das Wesen des Menschen, die nun langsam<br />
an Boden gewinnt, mit revolutionären Implikationen, „wie wir in den kommenden<br />
Jahrhunderten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Weichen<br />
stellen.“24 Hervorgerufen durch das erwachende Selbstsein, fungiert die Empathie als<br />
Motor der Zivilisation, der sich als Enttribalisierung der verwandtschaftlichen Bande<br />
und Resozialisierung von verschiedenen Individuen auf der Grundlage von verbindenden<br />
Eigenschaften verstehen lässt.25 Rifkin schreibt der empathischen Erweiterung<br />
die Rolle eines psychologischen Mechanismus zu, der den Wandel und Übergang erst<br />
ermöglicht: Zivilisation geht einher mit wachsendem Einfühlungsvermögen.26 „Die Dialektik,<br />
die unserer Geschichte zugrunde liegt, ist die Endlosschleife der Rückkoppelung<br />
zwischen ausgreifender Empathie und zunehmender Entropie.“27 Eine solche Zivilisation<br />
ist auf einer Gesellschaft mit einer gemeinschaftlichen Identität, einem gemeinsamen<br />
Bewusstsein aufgebaut („Der Schlüssel zur Erleuchtung liegt darin, von der irregeleiteten<br />
Vorstellung abzugehen, dass es ein ‚Ich‘ gäbe, und zu erkennen, dass es nur<br />
viele einzigartige ‚Wir‘ gibt.“28), entwickelt als einzigartige Erfahrung mit unzähligen<br />
anderen – und im Hinblick auf die Empathie – im Zentrum der Menschheitsgeschichte,<br />
als Generator des gewaltigen Wandels von „Ich denke, also bin ich” zu einem „Ich<br />
nehme Anteil, also bin ich.“29 Gewebt aus Ehrfurcht, Vertrauen und Transzendenz ist<br />
das empathische Bewusstsein ein heikler Balanceakt, der sowohl enges persönliches<br />
Engagement als auch Abstand erfordert. Es ist die Seele der Demokratie30, wie Rifkin<br />
betont, eine Feier des Lebens31, ein zerbrechliches Konstrukt, das von uns abhängig ist,<br />
„eine poröse Grenze zwischen dem Ich und dem Du, die ermöglicht, dass zwei Wesen<br />
in einem gemeinsamen geistigen Raum aufeinander eingehen können.“32 Sie erscheint<br />
als allumfassende Erfahrung, mit der die großen Erzählungen der Menschheit ausverhandelt<br />
und in Einklang mit einem neuen, besseren und einheitsstiftenden Sinn des<br />
Lebens gebracht werden können:<br />
Indem wir uns Glauben und Vernunft als intime Aspekte des empathischen Bewusstseins<br />
vorstellen, erzeugen wir eine neue historische Synthese, die viele der eindringlichsten<br />
und überzeugendsten Eigenschaften des Zeitalters des Glaubens und des<br />
Zeitalters der Vernunft in sich vereinigt, während sie die vom Körper abgetrennten<br />
lebensverneinenden Erzählstränge hinter sich lässt.33<br />
Doch wie euphorisch diese Vision auch klingen mag, bleibt die einleitende alarmierende<br />
Frage nach wie vor offen: „Wird globale Empathie rechtzeitig erreicht sein, um den<br />
Zusammenbruch der Zivilisation abzuwenden und unseren Planeten zu retten?“34<br />
In einem Text über das post-emanzipatorische Emanzipationskonzept kritisiert Boris<br />
Buden die heutige Erfahrung des (politischen) Engagements und kartiert die gegenwärtige<br />
Unmöglichkeit von Identifikation mit aktivem Engagement:<br />
Wir engagieren uns zwar, wir erheben unsere Stimme dort, wo wir es für angebracht<br />
oder gerecht halten, wir artikulieren unsere Proteste und unsere Solidarität, aber wir<br />
tun es irgendwie halbherzig. Mit einem lästigen Unbehagen, das wir, wie es scheint, nie<br />
mehr los werden können. Warum eigentlich?35<br />
Nach Boris Buden können wir nicht mehr klar und deutlich zwischen unseren emanzipatorischen<br />
Interessen und allen anderen Interessen unterscheiden und uns von den<br />
politischen Positionen und Meinungen, die wir nicht teilen, klar abgrenzen. In seiner<br />
Erforschung der Logik der Emanzipation behauptet Ernesto Laclau, dass wir nicht mehr<br />
im Zeitalter der Emanzipation leben. Der Philosoph spekuliert:<br />
Wir kommen heute mit unserer eigenen Endlichkeit zu Rande, und mit den politischen
36 Ernesto Laclau: Jenseits von<br />
Emanzipation. In: Ernesto Laclau:<br />
Emanzipation und Differenz. Wien:<br />
Turia und Kant 2002, S. 44.<br />
37 Vgl. Ibid., S. 29.<br />
38 Ibid., S. 37 f.<br />
Möglichkeiten, die sie eröffnet. Dies ist der Punkt, von dem aus die potentiellen Befreiungsdiskurse<br />
unseres postmodernen Zeitalters beginnen müssen. Vielleicht können wir<br />
sagen, daß wir heute am Ende der Emanzipation stehen und am Beginn der Freiheit.36<br />
Das Ende des Kalten Krieges, die Explosion neuer ethnischer und nationaler Identitäten,<br />
die gesellschaftliche Zersplitterung im Zeichen des Spätkapitalismus und<br />
der Zusammenbruch universell gültiger Gewissheiten in der Philosophie wie in den<br />
Sozial- und Geschichtswissenschaften haben nach Laclau unsere Erwartungen an die<br />
Emanzipation verändert und auch deren Begriff, wie er in seiner Ausformulierung seit<br />
der Aufklärung besteht, modifiziert, was zum Scheitern oder vielmehr zum Verschwinden<br />
der Emanzipation aus dem politischen Horizont unserer Ära geführt hat. Laclau<br />
untersucht die inneren Widersprüche des Begriffes der „Emanzipation“, wie er aus dem<br />
Mainstream der Moderne aufgetaucht ist. Emanzipation bedeutet in ein und demselben<br />
Moment radikale Gründung und radikalen Ausschluss; das heißt, sie postuliert<br />
zugleich sowohl einen Grund des Sozialen als auch seine Unmöglichkeit.37 Die Herstellung<br />
eines Emazipationsdiskurses hängt darüber hinaus auch vom Verhältnis zwischen<br />
Universalismus und Partikularismus ab, das sich in ihm birgt. Laclau merkt dazu an:<br />
„Emanzipation ist direkt mit dem Schicksal des Universellen verbunden […] ohne das<br />
Auftreten des Universellen im historischen Terrain wäre Emanzipation unmöglich.“38<br />
Auf der Suche nach Möglichkeiten des politischen Handelns „jenseits der Emanzipation”<br />
unterscheidet Laclau zwischen zwei Dimensionen der Emanzipation: einer radikalen<br />
(in sich selbst gegründeten, die alles, was ihre Vollendung als radikale Andersheit<br />
behindert, ausschließt) und der anderen, nicht radikalen (gemeinsam mit ihrem anderen<br />
gegründeten, die auf alle Gesellschaftsbereiche Einfluss nimmt), und konstatiert<br />
dann das Scheitern von beiden, da beide voneinander ununterscheidbar geworden sind,<br />
angesichts der Tatsache, dass sich diese Gründung in dieser Gesellschaft nicht mehr<br />
vorstellen lässt, gefolgt vom Verschwinden des Universellen vom historischen Terrain.<br />
Buden diagnostiziert Laclau folgend die aktuelle Krise der Emanzipation, indem er sein<br />
Augenmerk auf das schwierige Verhältnis der Gesellschaft zu Engagement und Empathie<br />
und die Verwirrung rund um den mehrdeutigen Status der Gesellschaft legt:<br />
So können wir heute anstatt von der Emanzipation nur noch von einer Pluralität der<br />
Emanzipationen reden. Die Tatsache, dass wir sie nicht mehr klar voneinander unterscheiden<br />
bzw. abgrenzen können, kommt eben von ihrer grundlegenden Opazität. Wir<br />
können nämlich keinen einheitlichen Grund mehr finden, auf den sich alle emanzipatorischen<br />
Kämpfe reduzieren lassen. Ohne diese Gründung – ohne dass der Grund<br />
der Gesellschaft postuliert wird – gibt es auch keinen Ausschluss, kein Außen mehr.<br />
Die Gesellschaften, in denen wir leben, lassen sich nicht mehr als radikal gespalten<br />
vorstellen, und wir können keine klare Trennlinie ziehen, durch die unser emanzipatorisches<br />
Interesse etwas in der Gesellschaft abgrenzt, was aus ihr auszuschließen<br />
wäre. Und wir können uns auch nicht mit einem Subjekt identifizieren, das den Grund<br />
der Gesellschaft universal repräsentiert. Daher kommt dieses Unbehagen, das unser<br />
aktuelles emanzipatorisches Engagement ständig begleitet.39<br />
Doch Hannah Arendts Auffassung von Emanzipation als Fähigkeit (miteinander) zu<br />
denken, zu handeln und zu urteilen scheint in einem noch engeren Sinne einer weiteren<br />
Version der Definition von Emanzipation zu entsprechen, jener von Jacques Rancière. In<br />
seinem Buch Der emanzipierte Zuschauer betont Rancière:<br />
Die Emanzipation beginnt dann, wenn man den Gegensatz zwischen Sehen und Handeln<br />
in Frage stellt, wenn man versteht, dass die Offensichtlichkeiten, die so die Verhältnisse<br />
zwischen dem Sagen, dem Sehen und dem Machen strukturieren, selbst der<br />
Struktur der Herrschaft und der Unterwerfung angehören. Sie beginnt, wenn man versteht,<br />
dass Sehen auch eine Handlung ist, die diese Verteilung der Positionen bestätigt
76 — 77<br />
Adam Budak<br />
39 http://www.republicart.net/<br />
disc/empire/buden02_de.htm<br />
40 Jacques Rancière: Der<br />
emanzipierte Zuschauer. Wien:<br />
Passagen Verlag 2009, S. 23.<br />
41 Rancière: Democracy,<br />
Dissensus and the Aesthetics<br />
of Class Struggle. Historical<br />
Materialism 13:4 (2005), S. 292.<br />
42 Rancière, Der emanzipierte<br />
Zuschauer, S. 33.<br />
43 Butler, Gefährdetes Leben,<br />
S. 36.<br />
44 Ibid., S. 38 f.<br />
45 Ibid., S. 45.<br />
46 Ibid., S. 46.<br />
oder verändert. Auch der Zuschauer handelt, wie der Schüler oder der Gelehrte. Er<br />
beobachtet, er wählt aus, er vergleicht, er interpretiert.40 Rancière legitimiert seine<br />
eigene Interpretation der Emanzipation durch einen Rückgriff auf die ursprüngliche<br />
Bedeutung des Wortes „Emanzipation“: hervortreten aus dem Status einer Minderheit.<br />
Für den französischen Philosophen spielt die Emanzipation eine bedeutende gesellschaftliche<br />
Rolle mit einer ganz besonderen ethischen Aufgeladenheit, welche die<br />
Entwicklung der Gesellschaft beeinflusst und deren Fortschritt bedingt. Sie ist „vielmehr<br />
Prozess als Ziel, ein Bruch mit der Gegenwart statt ein in die Zukunft verlegtes<br />
Ideal.“41 Rancière distanziert sich von der Idee, dass Emanzipation nach einer Utopie<br />
strebe, die man erreichen könne, dass das (politische) Ringen um Anerkennung irgendwann<br />
ein Ende finde. Emanzipation wird als Ruf nach Gleichheit verstanden und wird<br />
somit immer und immer wieder weiterverhandelt; und nach jedem Sieg einer bestimmten<br />
Gruppe, wenn aus Dissens Konsens entstanden ist und eine neue „partage du sensible“<br />
(Aufteilung des Sinnlichen) erreicht wird, wird eine andere Gruppe ausgesondert,<br />
unsichtbar gemacht, zum Verstummen gebracht und als unbedeutend erachtet. In<br />
Rancières Grammatik der Zuschauerschaft bedeutet Emanzipation das Verwischen des<br />
Gegensatzes zwischen den Sehenden und den Handelnden, Einzelpersonen und Mitgliedern<br />
eines Kollektivkörpers. „Eine emanzipierte Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft<br />
von Erzählern und von Übersetzern“42, behauptet der Verfasser von Der emanzipierte<br />
Zuschauer, wo genau diese Emanzipation als der Prozess des Nachweises der Gleichstellung<br />
aller Intelligenzen wahrgenommen wird.<br />
Dringlichkeit des Handelns, die Herausforderung der Empathie sowie die Möglichkeit<br />
der Selbstbestimmung sind Kernthemen von Judith Butlers Politik des gefährdeten<br />
Lebens. Was sind die Dimensionen menschlicher Verletzbarkeit? Auf welche Art und<br />
Weise ist das menschliche Sein in seiner Gesamtheit von Verletzbarkeit geprägt? Die<br />
Philosophin reflektiert: „Mich beschäftigt in Anbetracht der jüngsten globalen Gewalt<br />
die Frage: Wer gilt als Mensch? Wessen Leben zählt als Leben? Und schließlich: Was<br />
macht ein betrauernswertes Leben aus?“43 Butlers Buch ist ein Kompendium dringlicher<br />
Fragen der Ethik, die von verletzbaren, der Gewalt ausgesetzten und Trauer,<br />
Schmerz und Verlust erfahrenden Wesen artikuliert werden:<br />
Etwas ergreift Besitz von dir: Woher kommt das? Welchen Sinn hat das? Was beansprucht<br />
uns in solchen Augenblicken, so daß wir nicht Herr unserer Selbst sind? An was<br />
sind wir gefesselt? Und von was werden wir ergriffen? […] Wer „bin“ ich ohne dich?44<br />
Das Bedürfnis, Gewalt zu verstehen, steht im Zentrum von Judith Butlers Aufsatzsammlung<br />
Gefährdetes Leben. Politische Essays. Inmitten all der Trauer, Besorgnis,<br />
Angst und Wut ist<br />
Gewalt […] eine Berührung der schlimmsten Art, mit ihr wird eine primäre Verletzbarkeit<br />
des Menschen durch andere Menschen in der erschreckendsten Weise sichtbar, sie ist<br />
ein Vorgang, in dem wir, ohne etwas tun zu können, dem Willen eines anderen ausgeliefert<br />
sind, ein Vorgang, in dem das Leben selbst durch die vorsätzliche Handlung<br />
eines anderen ausgelöscht werden kann.45<br />
Der Stoff, aus dem wir Menschen sind, ist verletzbar, schadensanfällig, bedroht und<br />
ungeschützt, gefährdet, verletzbar „gegenüber einer plötzlichen Attacke von irgendwoher,<br />
die wir nicht verhindern können.”46 Wie geht man damit um? Welche Optionen<br />
haben wir, welche langfristigen Strategien bieten sich an? „Es gibt die Möglichkeit,<br />
unverwundbar zu erscheinen, die Verwundbarkeit selbst zurückzuweisen“, spekuliert<br />
Butler und fährt fort:<br />
Wenn ich auf einer „gemeinsamen“ körperlichen Verletzbarkeit bestehe, mag es so aussehen,<br />
als postulierte ich eine neue Grundlage für den <strong>Human</strong>ismus. […] Eine Verletzbarkeit<br />
muß wahrgenommen und anerkannt werden, um in einer ethischen Begegnung<br />
eine Rolle zu spielen, und es gibt keine Garantie, daß dies geschehen wird. Es gibt
47 Ibid., S. 60 f.<br />
48 Ibid., S. 67.<br />
49 Ibid., S. 50.<br />
50 Ibid., S. 155.<br />
51 Ibid.<br />
52 Vgl. Ibid., S. 156 f.<br />
53 Ibid., S. 157.<br />
54 Ibid., S. 165.<br />
55 Ibid., S. 172.<br />
nicht nur stets die Möglichkeit, daß eine Verletzbarkeit nicht anerkannt wird und daß<br />
sie als „Nichtanerkennbare“ konstituiert wird, vielmehr hat, wenn eine Verletzbarkeit<br />
anerkannt ist, diese auch die Macht, Bedeutung und Struktur der Verletzbarkeit selbst<br />
zu ändern. Wenn die Verletzbarkeit eine Vorbedingung für die Vermenschlichung ist<br />
und die Vermenschlichung durch wechselnde Normen der Anerkennung unterschiedlich<br />
erfolgt, dann ergibt sich daraus in diesem Sinne, daß die Verletzbarkeit, soweit sie<br />
irgendeinem menschlichen Subjekt zugeschrieben werden soll, grundsätzlich von den<br />
existierenden Normen der Anerkennung abhängig ist.47<br />
Und es kommen noch weitere drängende Fragen auf, türmen sich vor uns auf, übernehmen<br />
das Kommando und drängen auf ihre verantwortungsvolle Beantwortung: Wie<br />
gehen wir mit unserer Verletzbarkeit um? Wie können wir uns im Zustand der Angst,<br />
der Not und des kollektiven Widerstands schützen? Butler fügt dazu hinzu: „Wollen wir<br />
sagen, daß es unser Status als ‚Subjekte‘ ist, der uns alle verbindet, obwohl das ‚Subjekt‘<br />
für viele von uns als in sich vielfältig und fragmentiert gilt? […] Was erlaubt uns, einander<br />
zu begegnen?“48 „Wessen Leben ist real? Wie ließe sich die Realität neu gestalten?”49<br />
Bei ihrer Ausführung der ethischen Anforderungen und ihrer Untersuchung der Kräfte<br />
der Trauer und der Gewalt fordert sie die Berücksichtigung der Struktur der Ansprache<br />
selbst. Dies ist für die Philosophin die wichtigste Verpflichtung in unserer Zeit – die<br />
Reaktionsweise, die auf ein Angesprochensein folgt, wahrgenommen als „ein Verhalten<br />
gegenüber dem Anderen, nachdem der Andere eine Forderung an mich gestellt<br />
hat, mich einer Schwäche bezichtigt oder mich zur Übernahme einer Verantwortung<br />
aufgefordert hat.“50 Darüber hinaus ist die Struktur der Ansprache wichtig, um zu verstehen,<br />
wie die moralische Autorität eingeführt und aufrechterhalten wird. Für Judith<br />
Butler heißt jemanden in einem Gespräch ansprechen auch eine Form von Koexistenz<br />
eingehen, folglich erweist sich irgendetwas an unserer Existenz als prekär, wenn diese<br />
Ansprache misslingt. Die Struktur der Ansprache ist unmittelbar damit verbunden, wie<br />
moralische Autorität eingeführt wird und funktioniert:<br />
Oder emphatischer ausgedrückt, was uns moralisch verpflichtet, hat damit zu tun, wie<br />
wir von anderen angesprochen werden, in Formen, die wir nicht verhindern oder vermeiden<br />
können. Dieser Einfluß, den die Ansprache des Anderen auf uns ausübt, konstituiert<br />
uns zuallererst gegen unseren Willen, oder vielleicht passender formuliert, noch vor<br />
der Ausbildung unseres Willens.51<br />
Butler geht auf das „Gesicht” ein, eine von Emmanuel Lévinas eingeführte Vorstellung,<br />
um zu erklären, wie es kommt, dass andere moralische Ansprüche an uns stellen,<br />
moralische Forderungen an uns richten, die wir nicht wollen und die wir nicht ohne<br />
weiteres ablehnen können.52 Für sie ist die Annäherung an das Gesicht die elementarste<br />
Form der Verantwortung. „Mich der Verletzlichkeit des Gesichts auszusetzen“53<br />
ist wohl die mutigste Herausforderung. Das Gesicht als die äußerste Gefährdetheit<br />
des anderen; das Gesicht als Diskursrahmen („Antlitz und Gespräch sind miteinander<br />
verbunden“); das Gesicht als Bedingung der Menschwerdung54; das Gesicht als<br />
Darstellung dessen, „womit keine Identifizierung möglich ist, eine Vollendung der<br />
Entmenschlichung und eine Bedingung für Gewalt“55: Genau hier, auf der Bühne des<br />
Gesichts entfalten sich (sanft) die Wesen der Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl<br />
und Selbstbestimmung in prekären Zeiten.<br />
Die für die Ausstellung zusammengestellten Kunstwerke bilden eine Sammlung<br />
von Allegorien auf die turbulenten Zeiten, die wir durchleben. In dieser Studie der<br />
menschlichen Porträtkunst tritt das Gesicht als eine Landschaft der Menschlichkeit<br />
auf; es ist die Spiegeloberfläche, auf der sich Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit der<br />
menschlichen Angelegenheiten spiegeln, ein Instrument einer verletzten Identität, die<br />
Vertreibung und Enteignung ausgesetzt ist.
78 — 79<br />
Adam Budak<br />
Griechen im Würgegriff,<br />
Titelseite der Frankfurter<br />
Rundschau, 2. März 2010<br />
56 Paci erinnerte sich, dass er als<br />
kleiner Junge mit Freunden ein<br />
ähnliches Spiel gespielt hatte – er<br />
erinnerte sich daran, als er in den<br />
Fernsehnachrichten Bilder von<br />
palästinensischen Kindern sah, die<br />
mit zerbrochenen Spiegeln Soldaten<br />
blendeten.<br />
Der Film Per Speculum (2006) des albanischen Künstlers Adrian Paci entlehnt seinen<br />
Titel vom Korintherbrief des Apostels Paulus: „Videmus nunc per speculum in aenigmate:<br />
tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam<br />
sicut et cognitus sum“ (Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte<br />
Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich<br />
unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch<br />
und durch erkannt worden bin; Erster Brief an die Korinther XIII, 12). In der Eröffnungseinstellung<br />
des Films sehen wir eine Kindergruppe in einer idyllischen, beinah<br />
biblischen Landschaft, die auf seltsam beunruhigende Art und Weise direkt in das Auge<br />
der Kamera blickt, quasi auf Konfrontation mit ihr geht. Dies entpuppt sich bald als<br />
bloße Reflexion in einem riesigen Spiegel, der vor ihr aufgestellt ist, um die perfekte<br />
Illusion eines anderen, heterotopischen Raumes zu erzeugen, der gleichzeitig Nähe<br />
und unheimliche Distanz suggeriert. Die Gesichter der Kinder zeigen keinerlei Emotion,<br />
wenn auch ihre Blicke vorwurfsvoll sind und tatsächlich einen Hauch von Bosheit und<br />
verlorener Unschuld vermitteln. Pacis Szene lässt sich als ein ikonischer Augenblick<br />
wahrnehmen, der im Einklang mit der Pauluspassage darauf hinweist, dass jede körperliche<br />
Darstellung oder Spiegelung immer ungenau und verzerrt ist; anders betrachtet<br />
kann sie den Zusammenbruch aller Signifikationsbemühungen bezeichnen, indem sie<br />
sich mehr oder weniger buchstäblich auf das Scheitern der Lacan’schen Spiegelphase<br />
bezieht, eines entscheidenden Augenblicks in der Identitätsbildung, in dem aus einem<br />
zersplitterten Bild eine erkennbare kohärente Einheit wird und der den Eintritt des<br />
Kindes in die Welt markiert. Die Story von Per Speculum schreitet langsam voran, doch<br />
in radikaler Manier, sobald der Spiegel in einem gewaltsamen, wenn auch spielerischen<br />
Akt zerbricht und sich das Spiegelbild in zahllose Fragmente aufsplittert. So<br />
verschwindet nun der Gemeinschaftsgeist und die Kinder sind jetzt auf den Ästen eines<br />
gewaltigen Baumes verstreut und in ein weiteres neues „Funny Game“ vertieft.56 Jedes<br />
hält eine Scherbe des zerbrochenen Spiegels und produziert strahlende Lichtkegel,<br />
indem es das Sonnenlicht zurück auf die Kameralinse abprallen lässt und den Betrachter<br />
so mit der unerträglich intensiven Reflexion grausam blendet. In diesem Film, den<br />
man als unheimliche Performance des Gesichts und Drama des Schauens betrachten<br />
kann, markiert Adrian Paci die Unmöglichkeit des Gesichts und das Scheitern der<br />
Ansprache. In der Schwebe in einer archetypischen Raum-Zeit-Dimension, ausgestattet<br />
mit der umwerfenden metaphorischen Dichte einer Geschichte über Leben und Tod, ist<br />
Per Speculum eine tiefgründige Studie der Täuschung, in der alle erhaltenen Wahrheiten,<br />
Wahrnehmungen und Bedeutungen kritisch unterwandert werden. Diese Videoarbeit<br />
drückt auch die Zerbrechlichkeit des menschlichen Seins aus, offen ausgestellten<br />
Zorn und die Aggression latenter Traumata, selbstzerstörerische Gesten und die Instabilität<br />
prekärer Zeiten eingefangen im Augenblick der Erwartung und des Erwachens.<br />
Schon Pacis Arbeit Turn on (2004) berührte ähnliche Themen, verwies jedoch inhaltlich<br />
auf das reale Leben – die politische Situation im Heimatland des Künstlers. Der Film<br />
ist beinahe ein Tableau vivant aus 18 beschäftigungslosen Arbeitern aus Pacis Heimatstadt<br />
Shkoder, die auf einem öffentlichen Platz in der Stadt auf einer Treppe sitzen und<br />
die simple Tätigkeit des Einschaltens der benzinbetriebenen Generatoren zur Aufführung<br />
bringen, welche die Glühbirnen, die sie gleich Trophäen aus einer verlorenen Zivilisation<br />
in Händen halten, mit Strom versorgen. Auch hier ist der Mensch eine Quelle<br />
des Lichts, ein Erzeuger des Lichts. In Nahaufnahmen konzentriert sich der Künstler<br />
auf die von der Sonne gegerbten faltigen Gesichter der Männer und komponiert aus<br />
ihnen eine gleichsam eingefrorene Landschaft der Verletzlichkeit, paralysiert im<br />
Ausdruck der Resignation, der Sinnlosigkeit und des Scheiterns. Mit dieser Reihe von<br />
in die Kameralinse starrenden Gesichtern wird der Betrachter angesprochen und sein<br />
Moralgefühl aktiviert. Der Film ist ein bewegendes Dokument des Überlebens und ein<br />
Zeugnis des Wandels: ein fast spirituelles erhellendes Spektakel, in dem der aggressive
80 — 81<br />
Adam Budak<br />
57 „Obwohl ich in erster Linie als<br />
Videokünstler bekannt bin, bin ich<br />
eigentlich Maler. Genauer gesagt,<br />
Porträtmaler. Im Alter von 10 bis<br />
22 Jahren malte ich zahlreiche<br />
Porträts und in der Schule hielten<br />
meine Freunde und ich häufig<br />
nach Personen Ausschau, die uns<br />
für unsere Zeichnungen Modell<br />
standen. Das waren immer Menschen<br />
von der Straße, alte Leute,<br />
die nur herumsaßen und warteten,<br />
dass die Zeit verging. Im Atelier<br />
saßen sie uns stundenlang Modell,<br />
ohne irgendeine besondere Pose<br />
einzunehmen. Sie machten einfach<br />
weiterhin das, was sie ohnehin<br />
gemacht hätten. Ich arbeitete<br />
mehrere Jahre an diesen Gesichtern,<br />
machte Studien mit Bleistift,<br />
Tempera- und Ölfarben, modellierte<br />
ihre Falten, dechiffrierte<br />
ihren Gesichtsausdruck und reproduzierte<br />
ihre Haut mit meinen<br />
Farben“. Adrian Paci im Gespräch<br />
mit Miriam Varadinis in: Adrian<br />
Paci. „Electric Blue“. Kunsthaus<br />
Zürich 2010, S. 6.<br />
58 Paci in Adrian Paci, S. 7.<br />
59 Lida Abdul, zitiert in: Els<br />
van der Plas: On Beauty and<br />
Other Unfinished Things. www.<br />
princeclausfund.org/.../lectureonbeautyandotherunfinishedthings-<br />
ElsvanderPlas.doc<br />
Lärm der Generatoren einen Widerspruch zur Zartheit des erzeugten Lichts und der<br />
Zerbrechlichkeit der müden und desillusionierten Gesichter der Arbeiter bildet, der<br />
Zeugen dramatischer politischer Umwälzungen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs,<br />
die im Ritual des sinnlosen stoischen Wartens auf eine strahlende bessere Zukunft<br />
hoffen. Pacis Szene hat die Qualität eines antiken Dramas: Wir sind die Zuschauer im<br />
Theater der quasi-heroischen Gesten, auf den Ruinen der Aufklärung, auf denen große<br />
Emotionen der Moralität mit Pathos und Grandeur in Szene gesetzt werden. Turn on<br />
und Per Speculum, Adrian Pacis Orchestrierungen von Vernunft, Glaube und Mitgefühl,<br />
sind Porträts in Nahaufnahme einer Menschheit in der Schwebe zwischen Hoffnung<br />
und Vergänglichkeit, eingetaucht in eine Trance der Erwartung und von einer besseren<br />
Zukunft tagträumend. Adrian Pacis neuester Film, Electric Blue (2010), erzählt eine<br />
weitere Überlebensgeschichte und stellt eine weitere Fallstudie von Menschenleben,<br />
die zwischen Moral, individueller Wahl und den Zumutungen eines Systems hin- und<br />
hergerissen werden: vom politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Albaniens<br />
in den 1990er Jahren. Beruhend auf Tatsachen ist der Film der Versuch eines Gesellschaftsporträts57,<br />
gewoben aus geplatzten Träumen, politischen Spannungen und der<br />
Komplexität des historischen Augenblicks des Wandels, der jegliche Moral und jedes<br />
persönliche ethische Gespür auf eine harte Probe stellt. Um der Armut zu entrinnen,<br />
eröffnet ein einst leidenschaftlicher Filmemacher ein Pornokino namens „Electric Blue”<br />
(als Erinnerung an eine erotische Sendung eines Fernsehkanals im alten Jugoslawien),<br />
obwohl er bald das anstößige Archivmaterial aus Sexszenen durch Aufnahmen aus<br />
Fernsehnachrichten ersetzt, die über den Krieg berichten und über die einsetzende<br />
Bombardierung Serbiens durch die NATO. Dies ist Pacis ironische Version von Sex,<br />
Kriege und Video, eine fesselnde und eindringliche Geschichte von Gewalt, Missbrauch<br />
und ethischen Fallstricken. Auch hier macht die Textur der Nahaufnahmen von menschlichen<br />
Gesichtern (und vor allem die von ihnen evozierte Nähe und Intimität) formal wie<br />
emotional die Hauptoberfläche der Handlung und Erfahrung aus, indem sie Mitgefühl<br />
erzeugt. Paci verwendet bewusst das Gesicht zur Darstellung des Konflikts und zur<br />
buchstäblichen Visualisierung des buchstäblichen Dramas eines Einzel- wie auch eines<br />
kollektiven Schicksals. „Mich interessiert der Augenblick der Spannung als Metapher<br />
für die Welt und ihren Zustand des permanenten Werdens“, behauptet der Künstler<br />
und meint weiter: „Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit sind meines Erachtens ganz<br />
grundlegende Bedingungen des Menschseins, die gleichzeitig Schönheit und Würde<br />
vermitteln können.“58<br />
Die Video- und Fotoarbeiten der afghanischen Künstlerin Lida Abdul sind ein Laboratorium<br />
der Empathie und der Emanzipation, Schauplätze des Handelns wie der<br />
Apokalypse. Als getreue Chronistin des Zusammenbruchs ihres Heimatlandes ist die<br />
Künstlerin eine Schreiberin des Desasters, eine Zeugin von Verbrechen gegen die<br />
Menschlichkeit. „Hier“, bekennt Lida Abdul, „sind die Ruinen meines Landes, meiner<br />
Geschichte und meiner Kultur. Ich akzeptiere das nicht, also schreie ich es mit einer<br />
Schönheit heraus, die weh tut.“59 Abduls White House (2005) präsentiert eine Ruinenarchitektur<br />
als Schauplatz eines berührenden Rituals der Trauer und der Klage über<br />
die Grausamkeiten des Krieges und die Absurdität des Konflikts, dargeboten von der<br />
Künstlerin höchstpersönlich. White House ist ein bewegendes Drama der Heimkehr:<br />
Durch Anmalen der Ruinen eines zerbombten Gebäudes in der Nähe von Kabul mit weißer<br />
Farbe manifestiert die Künstlerin verzweifelt die Notwendigkeit eines Neuanfangs<br />
wie auch die beinah utopische Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Normalität. Dem<br />
Arbeitsprozess der Künstlerin haftet eine unheimliche stoische Ruhe und Stille an, die<br />
jedoch einerseits von Resignation und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit erfüllt ist,<br />
andererseits aber vom Versprechen einer neuen Zeit, einer bald kommenden neuen<br />
Ära. Dies ist Abduls symbolischer Akt der Reinigung, der Löschung der Vergangenheit,
60 Lida Abdul auf: http://www.<br />
lidaabdul.com/statement.htm<br />
61 Ibid.<br />
62 Ibid.<br />
Neuschreibung der Geschichte auf dem weißen Blatt des Lebens, an einem Ort mit<br />
einer Potenzialität und einer Zukunft. Die Künstlerin meint dazu:<br />
Eine Kunst der Zukunft würde gleichzeitig Aufruf und Anklage sein. Ich habe versucht,<br />
die Katastrophe zu verstehen, von der mein Land nun seit über zwei Jahrzehnten verwüstet<br />
wird. Sprache, Begriffe vom häuslichen Leben und Wahrnehmungen der anderen<br />
– das ist alles so radikal transformiert, dass Überlebende/Flüchtlinge sich häufig<br />
weigern, über die Dinge, die sie durchgemacht haben, zu reden. Wir kennen alle die<br />
Geschichte dieses Schweigens. Es herrscht immer die Furcht davor, dass die Arbeiten<br />
dieser dissidenten Künstler, die einer sich entfaltenden „Politik“ zu nahe kommen, ihre<br />
künstlerischen Intentionen kompromittieren. In meiner Arbeit versuche ich, den Raum<br />
der Politik und den des Tagtraums nebeneinander zu stellen, den Raum der Zuflucht<br />
mit dem der Wüste; dabei versuche ich immer, die „Leerräume“ zur Aufführung zu bringen,<br />
die sich bilden, wenn den Menschen alles genommen wird.60<br />
Abduls Künstlerethos und Mission ist es, Belege für den Schrecken und die Ungerechtigkeit<br />
der gewalttätigen Zeiten, in denen wir leben, zu liefern:<br />
Künstler sind die wandernden Seelen der Welt, die sich von einem Ort zum anderen<br />
bewegen und Kunst schaffen, die Zeugnis ablegt, die herausfordert und auch andere<br />
Fragen stellt. Sie werden für ihre Weigerung, im Spiel „Sie gegen uns“ Partei zu ergreifen,<br />
gefeiert, ignoriert, verfolgt und bisweilen sogar umgebracht; sie sind im Ausland<br />
immer die Unschuldigen, die in vielen Fällen aus ihren Heimatländern vertrieben worden<br />
sind.61<br />
Der weiße Anstrich der Ruinen ist auch ein Zeichen des Protests, genauso wie die<br />
Erzählung von In Transit (2008), einem Werk, in dem Kinder gezeigt werden, die in<br />
gleichsam ritualistische Spiele rund um ein abgeschossenes russisches Flugzeug auf<br />
dem Spielfeld eines ehemaligen Fußballstadions vertieft sind – ein Akt der Anklage<br />
und Indiz der Schuld. Lida Abdul fertigt das Porträt einer verwundeten Landschaft des<br />
Selbst in Trümmern. Ihr Werk ist eine auf dem Trümmerhaufen der Zivilisation fast wie<br />
eine Therapie zur Aufführung gebrachte Choreografie menschlichen Schmerzes und<br />
Leids, eine ihrem Wesen nach kathartische Geste der Reinigung, denn für die Künstlerin<br />
ist „die Kunst immer eine Bitte um eine andere Welt, ein momentanes Zertrümmern<br />
dessen, was für uns angenehm ist, damit wir uns bei unserer Rückforderung der<br />
Gegenwart noch geschickter anstellen.“62 Lida Abduls neueste Zwei-Kanal-Videoarbeit<br />
Man in the Sea (2010) ist die poetische Studie des Gesichts eines Kriegers und eine<br />
heroische Geste, in diesem Fall inszeniert im nostalgischen und romantisierten Dekor<br />
der Selbstvernichtung und symbolischen Auslöschung. Als Abduls erneutes Ringen mit<br />
der Architektur der Hoffnung ist der Film ein ziemlich pessimistisches Zeugnis für eine<br />
ausweglose politische Situation und das Fehlen jeglicher Alternative der Rebellion. Das<br />
herangezoomte Gesicht füllt den Videobildschirm fast zur Gänze aus, so als würde es<br />
sich buchstäblich in die Projektionsfläche einer verstümmelten Identität verwandeln.<br />
Stumm und ohnmächtig verschwindet Abduls Protagonist im Meer.<br />
Streichung und Löschung, Negation und Absurdität – das ist die Ausverhandlung der<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong> in der Version des belgischen Künstlers Kris Martin. Von Grund auf<br />
subversiv oszillieren seine Bildhauerei und seine Konzeptkunst um die Themen Endlichkeit<br />
und plötzliches Erscheinen, wobei der Tod und die Möglichkeit eines Neuanfangs<br />
der Relativität der Zeit und der Zwecklosigkeit allen Widerstands gegenübergestellt<br />
werden. Somit ist Kris Martins Œuvre eingetaucht in einen philosophischen Diskurs, in<br />
dem die wichtigsten großen Erzählungen der Menschheit ausführlich angeschnitten<br />
werden. Die Präsenz der historischen Dimension verflochten mit der tiefen Reflexion der<br />
abstrakten Begriffe von Raum und Zeit ergeben ein Werk von erhellender allegorischer<br />
Kraft und einer metaphysischen Dimension. Martins herausragende wie unheimliche<br />
Skulptur Mandi VIII (2006) ist eine Mise-en-scène des Scheiterns und des unerfüllten
82 — 83<br />
Adam Budak<br />
Begehrens. Das Werk ist ein weiterer Beitrag zu einer Serie mit dem gemeinsamen Titel<br />
Mandi, ein Titel, der seinen Ursprung in einem Ausdruck hat, dem der Künstler in Italien<br />
begegnet ist, wo seine Ankunfts- und Abflugtafeln hergestellt werden, ein umgangssprachliches<br />
Wort für „Auf Wiedersehen“, dessen Etymologie darüber hinaus die Wörter<br />
„mano“ (Hand) und „dio“ (Gott) in sich birgt, was dann zur Bedeutung „in Gottes Hände“<br />
geben führt. Als eindrucksvoller Ausdruck der Wehklage darüber, dass die Menschheit<br />
alle Gewissheit und Klarheit verloren hat, artikuliert Mandi VIII den menschlichen<br />
Drang nach Selbstbestimmung und Erhabenheit. Beruhend auf der antiken griechischen<br />
Marmorskulptur Laokoon und seine Söhne (datiert auf das 1. Jahrhundert nach<br />
Christus, 1506 in Rom ausgegraben und von den Vatikanischen Sammlungen erworben,<br />
wo sie sich heute noch befindet), die den trojanischen Priester Laokoon und seine<br />
Zwillingssöhne Antiphas und Thymbraeus darstellt, die von einer furchterregenden<br />
Seeschlange angefallen werden – sie wurde ausgesandt, um ihn für seine Anfeindung<br />
des Willens des Gottes Apoll zu bestrafen –, ist Kris Martins Mandi VIII eine weitere<br />
Übung in der Lieblingsstrategie des Künstlers, nämlich der Aneignung verschiedenster<br />
Readymades, von antiken Kunstwerken und literarischen Meisterwerken bis hin zu Alltagsgegenständen<br />
und sogar noch flüchtigeren Naturphänomenen, in der Zusammenhänge<br />
verschoben werden, quasi mit der Bedeutung mitreisen und somit Ungewissheit,<br />
Zweifel und ein Bedürfnis nach weiteren Nachforschungen aufrufen. Laokoon und seine<br />
Söhne war schon immer kontroverses Studienobjekt und Gegenstand der Bewunderung<br />
zugleich, angefangen vom römischen Dichter Vergil mit seinem epischen Gedicht der<br />
Aeneis über die ausführlichen wissenschaftlichen Forschungen des Historikers Johann<br />
Joachim Winckelmann (1717-1768), der in der Skulptur „edle Einfalt und stille Größe“<br />
erkannte, und des Philosophen und Dichters Ephraim Lessing (1729-1781), der sie aus<br />
dem Blickwinkel einer Philosophie der Ästhetik betrachtete und sie als Fallstudie zur<br />
Definition des Unterschieds zwischen bildender Kunst und Literatur heranzog, bis hin<br />
zu Jacques Rancière, der die Skulptur in seinem Buch Das ästhetische Unbewußte für<br />
ihren Ausdruck des Sieges des klassischen Gleichmuts über die Emotion lobte, regte<br />
unsere Fantasie an und war Gegenstand einer Vielzahl von hyperuniversellen Lesarten.<br />
An sich fast eine originalgetreue Gipsnachbildung der ikonischen Skulptur, die Plinius<br />
der Ältere als größtes aller Kunstwerke bezeichnete, ist Kris Martins Version auch ein<br />
wenig bearbeitet. In einer ironischen, wenn nicht gar sarkastischen „Intervention“ lässt<br />
der Künstler die Schlange weg – die Gruppe kämpft also gegen eine unsichtbare Macht<br />
– und verändert somit den Sinn der skulpturalen Komposition beträchtlich, indem er<br />
unser Augenmerk nun viel stärker auf die idealisierte Schönheit der ringenden Männerkörper<br />
lenkt als auf die Darstellung von Schmerz und Leid sowie Gewalt, Verbrechen<br />
und Bestrafung, die großen Themen also, die seit Jahrhunderten mit der Interpretation<br />
dieser Skulptur verbunden werden. Der Künstler täuscht den Betrachter, der sich nun<br />
hinsichtlich der historischen Referenz mit einer beunruhigenden Leerstelle konfrontiert<br />
sieht, manipuliert seine Sinne und öffnet ganz unerwartet das Tor zum Nichts – hinter<br />
dem möglicherweise ein unbekannter Aggressor oder eine unsichtbare Quelle des Leids<br />
lauern – oder auch nur zu paranoiden Spekulationen. Wen bekämpfen wir eigentlich?<br />
Der Grund für den Kampf wird abstrakt und phantasmagorisch: In Krämpfen und Konvulsionen<br />
sind wir uns Auge in Auge selbst überlassen. Schicksal und Macht sind (vorübergehend?)<br />
vom Horizont unserer existenziellen Erfahrung entfernt. Mandi VIII ist eine<br />
eindrucksvolle, wenn auch stumme Hymne auf eine Menschheit in prekären Zeiten der<br />
Bedrängnis und der Angst. Der Anatom Sir Charles Bell (1774-1842), der Laokoon und<br />
seine Söhne in seinem Buch The Anatomy and Philosophy of Expression As Connected<br />
with the Fine Arts untersuchte, betonte die Stille von Laokoons Leiden:<br />
diese allerschrecklichste Stille im menschlichen Konflikt, wenn der Aufschrei der Angst<br />
oder des Schmerzes durch die Anstrengung erstickt wird; denn beim Ringen mit den<br />
Armen muss der Brustkorb ausgedehnt werden, oder im Akt des sich Erhebens; und
63 Charles Bell: The Anatomy<br />
and Philosophy of Expression<br />
As Connected with the Fine Arts.<br />
Zitiert in: William Schupbach:<br />
Laokoon and the Expression of<br />
Pain. http://www.wellcome.ac.uk/<br />
en/pain/microsite/culture3.html<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />
64 Radiohead:<br />
Pyramid Song. 2001.<br />
daher wird die Stimme, die sich bei der Expulsation von Atemluft beim Einfallen oder<br />
Zusammenpressen des Brustkorbs bildet, unterdrückt.63<br />
Diese beunruhigende Stille begleitet das Leid von Laokoon und seinen Söhnen,<br />
schmerzgequält, das Gesicht des Helden verzerrt und der Körper in Konvulsionen:<br />
Wir werden Zeugen eines Augenblicks des Erwachens, der Verkündigung einer noch<br />
kommenden stillen Apokalypse; wir befinden uns an der Schwelle von Mitgefühl und<br />
Selbstbestimmung. Diese unheimliche Stille und die Unmöglichkeit der klanglichen<br />
Äußerung sind charakteristische Eigenschaften von Kris Martins gesamtem Schaffen.<br />
Seine Skulptur Bells (2008) ist eine melancholische und zerbrechliche Metapher für<br />
eine Existenz in der Schwebe: zwei Bronzeglocken sind beinah wie Liebende im Liebesakt<br />
miteinander verbunden, was sie gleichzeitig völlig ihrer eigentlichen Funktion<br />
entledigt. Kein Glockenschlag ist möglich, keine Handlung kann ausgeführt werden, sie<br />
können weder von Lebensfreude, Trauer über den Tod oder Angst vor Gefahr künden. In<br />
diesem dramatischen Akt der Verweigerung und der Isolation repräsentieren sie eine<br />
weitere Studie der Löschung von Kris Martin, einen weiteren Ausdruck der Endlichkeit<br />
und Sterblichkeit. Verführerisch in der Einfachheit und verblüffenden Intimität gibt<br />
Bells einen Kommentar auf die Hoffnungslosigkeit und die Trägheit der entfremdeten<br />
Gesellschaften der Gegenwart ab. Die Stille dieses Werkes ist Zeugnis einer <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong>, die gefangen ist in ihrer Potenz und ihrem Eigensinn.<br />
Kris Martins Inszenierung der Stille wird ergänzt durch die Stimm-Performance der<br />
schottischen Künstlerin Susan Philipsz. „I jumped in the river and what did I see?<br />
Black-eyed angels swam with me” – so beginnt Susan Philipsz’ im Rahmen der Ausstellung<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten präsentiertes<br />
Werk The River Cycle (2005), ihre von ihr selbst a cappella vorgetragene bewegende<br />
Beschwörung unter Aneignung des psychedelischen Texts von Pyramid Song<br />
(2001) von Thom Yorke, dem Sänger der Band Radiohead. Ein Gefühl von Nostalgie und<br />
Dislozierung evozierend, lädt die Installation zu einer zugleich realen wie magischen<br />
poetischen Reise durch die universellen Themen des Begehrens, des Verlusts und der<br />
Trauer ein, immer wiederkehrende Themen im Schaffen der Künstlerin, die aus dem<br />
Stoff privater Erinnerung wie kollektiver Erfahrung gewebt sind. Die Reise führt über<br />
den mythischen Fluss Styx ins Jenseits, da wir offensichtlich mit dem Tod des Subjekts<br />
konfrontiert werden oder einem anderen wichtigen Übergangsritual. Susan Philipsz’<br />
Performance The River Cycle ist ein Tagtraum, der uns die Illusion einer Verlangsamung<br />
der Zeit und eines Raumes auf der anderen Seite von Cocteaus Spiegel liefert, dort wo<br />
Endlichkeit und Sterblichkeit sich mit einem Gefühl von Befreiung und Erfüllung verschwören:<br />
„there was nothing to fear and nothing to doubt; there was nothing to fear<br />
and nothing to doubt“.64 Die Künstlerin erschafft skulpturale Umgebungen von einem<br />
verblüffenden akustischen Volumen und einer unerhörten Intensität, was auf ihr gründliches<br />
Studium des psychologischen und skulpturalen Potenzials des Klangs und der<br />
Art und Weise, wie architektonischer Raum und öffentlicher Raum durch Klang definiert<br />
werden, zurückzuführen ist. Unter Einsatz verschiedenster (elektro-)akustischer und<br />
narrativer Techniken, die Einfluss auf Sinne und Wahrnehmung des Publikums nehmen<br />
(wie zum Beispiel Halleffekte, Echos, sich überlagernde Stimmen, Loops und tranceartige<br />
Wiederholungen), und unter Aneignung von musikalischen, literarischen und<br />
filmischen Verweisen von Will Oldham bis James Joyce und David Bowie sowie unter<br />
Verwendung von bekannten Volksliedern, Märchen, Balladen oder Wiegenliedern entwirft<br />
Susan Philipsz in gleichem Maße fesselnde wie kathartische Séancen kollektiver<br />
psychophysiologischer Audiohypnose. Mit ihren vorwiegend a cappella vorgetragenen<br />
Interpretationen erforscht die Künstlerin<br />
[e]motive Effekte des Gesangs; wie er Erinnerungen auslöst und einen Ort neu definiert<br />
[…] Mit meiner Arbeit versuche ich, ein Publikum wieder in seine Umgebung
84 — 85<br />
Adam Budak<br />
65 Susan Philipsz, zitiert in:<br />
Charlotte Higgins: Susan Philipsz:<br />
Lament for a Drowned Love.<br />
http://www.guardian.co.uk/<br />
artanddesign/2010/apr/04/susanphilipsz-glasgow-internationalinterview<br />
66 Peio Aguirre: When the Body<br />
Speaks. On the Work of Susan<br />
Philipsz. In: A Prior, Nr.16, zu<br />
finden unter:<br />
http://www.aprior.org/articles/33<br />
67 Marcel Dzama, zitiert in:<br />
M. J. Thompson: The Infinitude<br />
of Cool. Border Crossings 107<br />
(August 2008), S. 1000.<br />
zurückzuführen, nicht umgekehrt. Was ich bewirken möchte, ist [Ihnen] den Ort, an<br />
dem Sie sich befinden, bewusster zu machen und dabei gleichzeitig Ihr eigenes Selbstempfinden<br />
zu verstärken. Also ist die Verortung dieser Arbeit sehr wichtig, der Ort wird<br />
zum visuellen Element.65<br />
Oft an unerwarteten Orten im öffentlichen Raum in Szene gesetzt (unter einer Brücke,<br />
in einem Heiligtum, in einem Luftschutzraum, auf Friedhöfen oder über die Lautsprecher<br />
eines Tesco-Supermarkts geleitet), streben Susan Philipsz’ eindringliche Songs<br />
nach Zugehörigkeit und Akzeptanz. Songs als Hommage, Songs als Ehrenmale, in<br />
der Schwebe zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, obsessive Litaneien<br />
und Wehklagen, in denen das Verschwinden eines geliebten Menschen betrauert wird,<br />
Mordballaden und Hymnen auf unerfüllte Liebe und Sehnsucht oder sogar Radio-<br />
Pausenzeichen aus der ganzen Welt dargeboten auf dem Vibrafon (aufgenommen von<br />
der Künstlerin selbst für ihre aktuelle Installation You are not alone für das Radcliffe<br />
Observatorium der Universität Oxford, ein wunderschönes, auf dem antiken Turm der<br />
Winde in Athen basierendes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert) – das sind Susan Philipsz’<br />
aufrichtige Zeugnisse der Unheimlichkeit des menschlichen Schicksals. In der Tat,<br />
mit Susan Philipsz’ Arbeiten sind wir am Fundament menschlichen Seins angelangt, an<br />
dem Augenblick der Herausbildung der Subjektivität und der Erkennungsprozesse, an<br />
dem sich die empathischen Eigenschaften formen und emanzipatorische Triebe erzeugt<br />
werden. Peio Aquirre merkt dazu Folgendes an:<br />
Wiederholung – wieder und immer wieder singen, seine eigene Stimme hören und<br />
seiner eigenen Stimme zuhören – hat einen Effekt, der in der Psychoanalyse zur Erlangung<br />
von Subjektivität in Beziehung gesetzt wird. Mit der Wiederholung des Lieds<br />
identifizieren wir uns mit der Stimme und mit dem mit dieser Stimme verbundenen<br />
imaginären Körper. Erst durch diese Wiederholung verliert das Kind (bei Wiegenliedern<br />
und Märchen) seine Angst vor dem Draußen und wird zum autonomen Subjekt. Dies ist<br />
der wahre Zweck der Endlosschleife (Loop) in Philipsz’ Arbeit. Die Endlosschleife ist ein<br />
Mechanismus, der in seiner Unendlichkeit zum Sender einer ewigen Wiederkehr wird,<br />
der das Bewusstsein durch die gemütliche, zyklische und beruhigende Wirkung des<br />
Klangs durchdringt.66<br />
Von geisterhaften Stimmen bewohnt und zusammengesetzt aus Klängen aus der Vergangenheit<br />
und Erinnerungen, ist Susan Philipsz’ melancholisches und metaphysisches<br />
Werk sowohl Trauer über eine verlorene Zeit als auch Feier der Rückkehr und wiedererlangten<br />
Hoffnung.<br />
Für das performative und polyphone Œuvre (Grafiken, Collagen, Skulpturen, Dioramen,<br />
Videos) des kanadischen Künstlers Marcel Dzama, in dem sich kollektives Gedächtnis<br />
und Kulturerbe (Imaginäres und Texte aus alter Zeit, wie Mythen, Sagen, Volkslieder<br />
und Volksmärchen, die primären Quellen der kulturellen und zivilisatorischen Weisheit<br />
der Menschheit) mit der intimsten traumartigen Erfahrung wie auch dem Wirken anderer<br />
unkontrollierter Bewusstseinszustände verbinden, ist der Tagtraum ein Bereich,<br />
der einen verblüffenden kreativen Output ermöglicht. So errichtet Dzama seine eigene<br />
einzigartige und exklusive Privatmythologie, seinen hypersymbolischen Mikrokosmos,<br />
heimgesucht von psychophysiologischen Traumata: Wir befinden uns in einer (schönen<br />
neuen) Welt am Rand der zivilisatorischen Raserei, an den Grenzen der Zurechnungsfähigkeit,<br />
jenseits des Glaubens und jeder Vernunft, in einem geistesgestörten Theater<br />
des Exzesses. „Ich mag die Idee, eine Mythologie oder einen alten Volksglauben zu<br />
erfinden“, sagt der Schöpfer halb menschlicher, halb tierischer Kreaturen, Hybride aus<br />
außerirdischen Fantasien, Cyborgs der posttechnologischen Hysterie. „Ich zeichne<br />
am Tag doch meine Ideen entstehen in der Nacht“67, fügt der Künstler hinzu, dessen<br />
Fantasie die Schwellenbereiche zwischen Träumen und Wachen bewohnt, während er<br />
ein dunkles Vokabular der Psychose und des posthumanen Deliriums ersinnt. Durch
und durch grotesk und karnevalesk vereint sich in Marcel Dzamas Arbeit die vermeintliche<br />
Unschuld von Kindheitserinnerungen mit der Grausamkeit der Erwachsenenwelt.<br />
Gewalt zieht sich auf der Makro- wie auf der Mikroebene durch den rund um die Themen<br />
Erniedrigung, Zorn, Hass und Missbrauch kreisenden Plot. In seiner Serie Drawings<br />
for Dante (2002) erzählt er zeitgenössische Makaberheit in Form von Notizbuchzeichnungen<br />
eines Schulkinds. Seine scheinbar infantilisierte, beinah cartoonartige Version<br />
des menschlichen Infernos ist zu transgressiv, zu sehr gegen alle Regeln, um als bloße<br />
Karikatur oder Satire einer verrückt gewordenen Welt durchzugehen. Sie ist ein Manifest<br />
einer destruktiven und absurden Macht in der Morgendämmerung der Zivilisation,<br />
ein Drängen nach einem Erwachen. Dzamas monumentales Werk The Course of <strong>Human</strong><br />
History Personified (2005) markiert die eigene subjektive Geste der Neuschreibung der<br />
Geschichte als eine Fortsetzungsgeschichte aus barbarischen Eroberungen, Fremdherrschaft<br />
und Brutalität und bringt in kühner Art und Weise eine furchteinflößende Natur<br />
und die Anomalie einer Menschheit in den Ruinen der Moral und im Schatten des Todes<br />
zur Aufführung. Auch hier ist allgegenwärtige Gore-Gewalt eine ganz normale Sache,<br />
recht ornamental, fast freizeitmäßig, eine regelmäßige Alltagsaktivität, zulässig, ein<br />
unvermeidlicher Teil einer Wirklichkeit, in der alle Tabus ausgelöscht sind. The hidden,<br />
the unknowable, the unthinkable (Das Verborgene, das Unwissbare, das Undenkbare)<br />
– wie schon der Titel von Dzamas Grafik aus dem Jahr 2007 andeutet: Dies sind<br />
die Bereiche der menschlichen Psyche, deren Erforschung und Zurschaustellung den<br />
Künstler interessieren. Das Diorama Knowing precisely where to cut (2008) ist seine<br />
wahrlich verhexte, quälende und verwirrende Version eines anachronistischen Totentanzes<br />
mit Film-Noir-Figuren, grotesken Opfern, eingesperrt im Käfig des menschlichen<br />
Seins, umgeben von ausgestopften Mäusen und künstlichen Vögeln, mythologischen<br />
Boten einer verloren gegangenen Spiritualität. Inspiriert von mexikanischen Schreinen<br />
und Joseph Cornells Boxes und an die eingebauten Schaukästen in naturhistorischen<br />
Museen erinnernd, sind Dzamas Dioramen Displays für danteske und kafkaeske Rituale<br />
gesellschaftlicher Qualen. Dzamas Pip (2004) ist eine weitere Assemblage aus einer<br />
grotesken Figur eines (menschlichen) Tieres, das in einen eleganten, wenn nicht gar<br />
pedantischen Anzug aus Filz und falschem Fell, Drahtgeflecht, Papiermaché, Plastikschaum<br />
und Gummi gekleidet ist und von Zeichnungen und Aquarellen begleitet wird,<br />
die offenbar das (bürokratische) Credo des Protagonisten darstellen sollen (inklusive<br />
Botschaften wie „Wir werden verschwinden” oder „Verloren in der endlosen Zeit” sowie<br />
Pips Biografie). Wir befinden uns hier auch im Reich des Burlesken oder auf der Bühne<br />
eines Marionettentheaters, das die Erinnerung an Schultheater-Aufführungen evoziert,<br />
die auf dem Erlebnis eines Spukhauses aus einer beunruhigenden und traumatischen<br />
Kindheit beruhen. Zur gleichen Zeit fremd und vertraut repräsentiert Dzamas Bildsprache<br />
eine auf den Kopf gestellte Welt auf der permanenten verzweifelten Suche<br />
nach ihrer eigenen Erneuerung und Genesung. Ulysses (2009), seine hyperlange Grafik<br />
in drei Abschnitten, sowie seine Collagen-Serie (2008-2009) sind Tagebücher einer<br />
von niederträchtigen Gespenstern aus vergangenen Epochen und schattenhaften<br />
Figuren aus alten Stummfilmen bewohnten Zivilisation, die sich perversen Praktiken<br />
der Gewalt und Pornografie widmet. Diese neodadaistische Theatralik akuter Angst ist<br />
unsere entmenschlichte Welt von heute – geplagt von Kriegen und Terror und dem Leid<br />
des moralischen Verfalls und des ethischen Kollaps. Dzamas antiglamouröse Helden<br />
– männliche oder weibliche Krieger mit überbelichteten weißen Waffen oder selbstgemachten<br />
Schusswaffen, Commedia-dell’Arte-Opfer der Gräueltaten und Grausamkeiten<br />
mit ihren verstümmelten oder zerstückelten Körpern und verwundeten Psychen, hoffnungslose<br />
Terroristen und impotente Unterdrücker, die immer einen Zwischenbereich<br />
zwischen der Welt der Menschen und dem Tierreich bewohnen – sind lächerliche und<br />
bedauernswerte Akteure einer Machtausübung, die sich in ein Spektakel des Horrors<br />
verwandelt. In seinen vernichtenden und möglicherweise zu zynischen Untersuchungen
86 — 87<br />
Adam Budak<br />
68 Mark Manders in: The Absence<br />
of Mark Manders. Kunstverein<br />
Hannover, Bergen Kunsthall,<br />
S.M.A.K. Ghent, Kunsthaus Zürich.<br />
Ostfildern: Hatje Cantz 2007, S. 53.<br />
69 Ibid., S. 22.<br />
70 Ibid., S. 120.<br />
71 Andrea Wiarda: Mark Manders.<br />
In: Kaleidoscope (March-April<br />
2009).<br />
des zeitgenössischen Bösen inszeniert Dzama ein Storyboard der Unfähigkeit unserer<br />
Gesellschaft zur Empathie. Er präsentiert eine gefährdete Welt der unterbrochenen<br />
Intimität und der vergewaltigten Unschuld. Werte sind gestrichen, Tugenden haben<br />
ihre Gültigkeit verloren und das Heilige ist abwesend. Doch – keine Angst! Wir befinden<br />
uns im Vergnügungsbau einer Traumlandschaft für Erwachsene. Bitte aufwachen!<br />
Die Skulpturen und Installationen des niederländischen Künstlers Mark Manders sind<br />
eine Anatomie des Selbst und die Beschäftigung mit der Abwesenheit eines Künstlers,<br />
der sich selbst wie folgt definiert:<br />
Der Künstler Mark Manders ist eine fiktionale Person. Er ist eine Figur, die in einer nach<br />
den Prinzipien der Logik gestalteten und gebauten Welt lebt, einer Welt, die aus im<br />
Augenblick ihrer höchsten Intensität geronnenen Gedanken besteht. Er ist eine Figur,<br />
die hinter ihren Handlungen verschwindet. Sie lebt in einem Gebäude, das sie permanent<br />
verlässt; eigentlich ist das Gebäude unbewohnt.68<br />
Als poetisches Selbstporträt eines zwischen der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und<br />
einem Drang, den Fesseln gemeinschaftlicher Idiome und der Landschaft einer Innenwelt<br />
zu entfliehen, hin- und hergerissenen Individuums reflektiert Manders’ ergreifendes<br />
Œuvre eine Menschheit im Zustand hochgradiger Aufsplitterung, an der Schwelle<br />
zu einem möglichen und notwendigen Neuanfang. Als Séance einer psychotischen<br />
Katharsis birgt es das Versprechen eines verjüngten Subjekts in sich, das nun aus dem<br />
Kokon der gesellschaftlichen Routine befreit ist und seine körperliche und geistige<br />
Architektur als „Monument in Trümmern“ erbaut, und als Klage über den Zusammenbruch<br />
unserer Zivilisation. „Was bin ich im Grunde genommen? Ein menschliches<br />
Wesen, das sich mithilfe sehr präziser konzeptueller Konstruktionen in eine erschreckende<br />
Menge Sprache und Material entfaltet“69, bekennt der Schöpfer von Selfportrait<br />
as a Building, einem laufendem konzeptuellen Projekt, einer Art Manifest einer<br />
Lebenszeit, das Manders seit 1986 verfolgt und das ursprünglich als literarisches Werk<br />
geplant war, sich aber schließlich auf die räumliche Entfaltung des psychologischen<br />
Selbst des Künstlers konzentrierte. Obsessiv betrieben als Erforschung des Denkens<br />
und des Denkprozesses entwickelt es die Idee eines Selbstseins als Architektur und<br />
Komposition im Raum. Das Gebäude ist der Prototyp des in Bearbeitung befindlichen<br />
Selbst, ein lebender Organismus, ein Laboratorium der Identitätsproduktion:<br />
Das Gebäude ist wie eine in der Zeit erstarrte gigantische Anordnung mit vielen Räumen,<br />
die alle so aussehen, als wären sie gerade erst verlassen worden. […] Wie eine<br />
Enzyklopädie ist das Gebäude immer bereit, wenn es sich auch ständig verändert,<br />
wächst oder schrumpft.70<br />
Andrea Wiarda erkennt in Manders’ Self-portrait as a Building „den mythischen Container<br />
für seinen Versuch, seine Position in der Evolution der Welt des Menschen als<br />
eine paradigmatische Konstruktion zu verstehen“71. Der Künstler beschäftigt sich mit<br />
dem fundamentalen Prozess einer ganz besonderen Form der Mythenbildung, indem<br />
er die Semantik des Totemismus und der universellen Erzählungen der Menschheit mit<br />
dem Vokabular der heutigen Alltagserfahrung und des zeitgenössischen häuslichen<br />
Lebens kombiniert. Manders’ Skulptur Unfired Clay Figure (2005-2006) stellt eine<br />
Baustelle, oder vielmehr: Ausgrabungsstätte der Subjektivität im kritischen Augenblick<br />
des Ursprungs und der Verwandlung dar und rückt die Verletzbarkeit des menschlichen<br />
Seins selbst in den Vordergrund, indem sie ein (utopisches) psychologisches Szenario<br />
entwirft, das in äußerster Schwebe zwischen den Gefahren der Wirklichkeit und der<br />
traumartigen Imagination pendelt. Eine zweigeteilte Figur, gespalten und offenbar<br />
beschädigt, wenn auch monumental und erhaben in ihrem offensichtlichen Verweis auf<br />
den heroischen Stil der Antike oder auf einen kostbaren archäologischen Fund, roh und<br />
unvollendet, ist Manders’ geheimnisvoller Zeuge seiner selbst – ein Gegenstand der<br />
Kontemplation, gefangen in seinem eigenen Unvermögen, die Welt zu erzählen – doch
72 Ibid.<br />
73 Manders, The Absence of Mark<br />
Manders, S. 45.<br />
74 Luce Irigaray: Wie lässt sich<br />
weibliche Selbstaffektion zum<br />
Erscheinen bringen. In: Zwei oder<br />
Drei oder Etwas. Maria Lassnig, Liz<br />
Larner. Ausst.-Kat. Hrsg. v. Adam<br />
Budak, Peter Pakesch. Kunsthaus<br />
Graz 2006. S. 38 & 41.<br />
gleichzeitig auch ein Gegenstand einer brüchigen Menschlichkeit in der angehaltenen<br />
Bewegung ihrer eigenen begrenzten Macht und ethischen Verantwortung. Wir befinden<br />
uns inmitten Deleuze’scher Plateaus der Differenz und Wiederholung, der Ambiguität<br />
und der Schizophrenie, in einer Landschaft der Trennung. Die Gestalt des Ichs von<br />
Unfired Clay Figure ist buchstäblich gespalten, in dem Maße wie die Two Interconnected<br />
Houses (2010) vereint sind, zu einem Organismus werden, zur räumlichen Psyche<br />
des Künstlers. 80 Schwarz-Weiß-Dias laden zu einer unheimlichen Reise zwischen<br />
zwei Interieurs von mehrdeutiger Identität ein (ein Künstleratelier? Eine verlassene<br />
anonyme Wohnung? Ein Lagerraum? Ein Archiv? Ein verwunschener Bunker? ), die tatsächlich<br />
an Kafkas Bau erinnert, eine ganz besondere dunkle Passage durch die Tunnel<br />
der Psyche, eine Metamorphose. Two Interconnected Houses stellt tatsächlich eine<br />
Karte des menschlichen Gehirns dar; die Serie ist eine eindrucksvolle Äußerungsform<br />
von Manders’ Selbstporträt als Gebäude, das „tatsächlich zwischen zwei Weltsichten<br />
[oszilliert]: die aus atomartigen Halbwahrheiten gebaute Welt und jene, in der diese<br />
Wahrheiten als Tatsachen akzeptiert werden.“72 Clay Figure with Iron Chair (2009)<br />
stellt einen weiteren Versuch eines Selbstporträts dar: eine Hybride aus zerstückelter<br />
(Frauen-)Figur und Sessel, verlassen und stumm, in einer Geste der Hoffnungslosigkeit,<br />
eine Metapher für eine eingekerkerte und paralysierte Welt. Die Intimität der Szene ist<br />
verstörend; sie bringt den Betrachter in Verlegenheit und lässt ihn mit einem Gefühl<br />
der Scham und der Schuld zurück. Abstand und Nichtzugehörigkeit sind Begleiter des<br />
Andersseins. Manders’ auratisches Œuvre wird behaust von morbiden geisterhaften<br />
Kreaturen, die zwischen irdischem Alltag und Mythos hin und her schweben, nach ihrer<br />
eigenen Abwesenheit streben und nach ihrem Autor suchen, wie schon der Künstler<br />
selbst in einem Text aus dem Jahr 1994, The Absence of Mark Manders, geschrieben<br />
hat: „Die Erkenntnis, dass das Leben auch ohne dich seinen Lauf nimmt, ist eine intensive<br />
menschliche Erfahrung; sie zeigt die Endlichkeit der Persönlichkeit“.73<br />
Die selbstverstümmelten, erstarrten Figuren von Mark Manders’ Self-portrait as a Building<br />
spiegeln Maria Lassnigs lebenslange konsequente Entfaltung ihres eigenen beeindruckend<br />
kühnen Akts des Selbstporträts. Für die österreichische Künstlerin Maria<br />
Lassnig ist das Selbstporträt entweder Maskerade (Selbstporträt als ...) oder eine<br />
Gemeinschaft von Identitäten (Selbstporträt mit ...). Luce Irigaray bezeichnet diesen<br />
Aspekt von Lassnigs Œuvre als „unmögliches Porträtieren“ und verortet ihn innerhalb<br />
des Rahmens der Gender-Differenzierung:<br />
Wenn allgemein das Bild eines Mannes ein wenig erstarrt zu sein scheint, sieht das<br />
einer Frau eher bewegt aus. Ein Mann benötigt gewisse Anstrengungen, um Formen<br />
in Bewegung zu setzen, während sie für die Frau auf die eine oder andere Weise immer<br />
in Bewegung sind. Vielleicht versucht sie, etwas zu erfassen, was schwer fassbar,<br />
nicht erfassbar ist – ihr eigenes Fleisch. Um das anzudeuten, muss Maria Lassnig also<br />
eine andere Identität annehmen – bis hin zu einer Identität als Tier oder als Pflanze<br />
(siehe Selbstporträt als Tier, 1963, und auch Mutter und Tochter, 1966) – oder ihrem<br />
Fleisch etwas hinzufügen, das es um ein Objekt, ein Ding herum oder durch einen Akt<br />
unbeweglich macht, durch eine Rolle, eine Funktion, manchmal hinter einer Scheibe<br />
– warum nicht aus Plastik? (Siehe Ein Selbstporträt mit Stab, 1971; Selbstporträt mit<br />
Gurkenglas, 1971; […] Selbstporträt als Prophet, 1967; […]) Es handelt sich nicht länger<br />
um ein reines Selbstporträt. Dies zu realisieren scheint unmöglich. Das Fleisch strömt<br />
außerhalb jeder Nachbildung.74<br />
Maria Lassnigs Selbstporträts sind eine Theaterbühne, auf der das Drama des menschlichen<br />
Seins von Amateurschauspielern aufgeführt wird, die in eine ganze Reihe von<br />
Figuren schlüpfen, die für ein Zeitalter der Moral in der Krise stehen. Ganz ähnlich<br />
wie bei Mark Manders lässt sich jedes Gemälde als Selbstporträt betrachten – als<br />
ein Schutzraum, eine Flucht in Identitäten jenseits ihrer eigenen, eine Probe oder<br />
ein Vorsprechen für ein wahres Selbst, das noch in der Zukunft liegt. All ihre Sujets
88 — 89<br />
Adam Budak<br />
75 Maria Lassnig auf:<br />
http://www.artknowledgenews.<br />
com/Maria_Lassnig.html<br />
76 Silke Andrea Schummer, zitiert<br />
in Russell Ferguson: Eiserne Jungfrau<br />
und Fleischige Jungfrau. In:<br />
Zwei oder Drei oder Etwas, S. 88.<br />
77 Maria Lassnig in: „Inside Out“,<br />
Gespräch mit Jörg Heiser. Frieze<br />
103 (November – Dezember 2006).<br />
entstammen einem Prozess, den die Künstlerin selbst als „Körperbewusstsein“<br />
beschreibt, in dem die physische Erscheinung des Körpers in der Dimension der Empfindung<br />
ihre Erweiterung findet. Der Körper ist nicht so dargestellt, wie er von außen<br />
wahrgenommen wird. Stattdessen wird das Bild durch Introspektion erzeugt, durch<br />
eine Erfahrung aus dem Inneren. Maria Lassnigs Körper ist in ihren Gemälden häufig nur<br />
menschenähnlich und fremd, grotesk und verzerrt, sich in Krämpfen und Qualen windend,<br />
an existenziellem Schmerz leidend und von Hyper-Affektion und Gewalt gequält.<br />
Ihre Figuren weisen oft eine Behinderung auf oder dysmorphe oder von Folter gezeichnete<br />
Körperteile und stützen sich auf Krücken. Die Haut wird als Membran gesehen,<br />
die Empfindungen wie Hitze, Kälte, Spannung, Druck und Gewicht aufzeichnet, die<br />
dann von der Künstlerin mit Strichen und Klecksen in lebhaften Farben als Konturen<br />
des Körpers gemalt werden, die vor Energie übersprühen; Fleisch wird als „nackte“<br />
offene Materie dargestellt, als unverhülltes, exhibitionistisches, „drastisches“ Gewebe,<br />
anfällig für Verwundung, Verletzung oder einfach Alterung. Maria Lassnigs „physisches<br />
Ereignis der Körpererfahrung“ hinterlässt beim Betrachter ein Gefühl des psychischen<br />
Unbehagens: Hier, in dieser verstörenden Körperkulisse, befinden wir uns im Herzen der<br />
menschlichen Gebrechlichkeit, im Hause der physischen und psychischen Schlachterei<br />
der modernen Zivilisation, verwandelt in einen Schrein der elementaren Leidenschaften<br />
wie auch der ganz gewöhnlichen Gefühle, wie die Künstlerin selbst auf unglaublich<br />
unschuldige Art und Weise, wenn auch scheinbar provokant, ihre „drastischen“<br />
Gemälde kommentiert: „Ich ziele in meiner Arbeit nicht auf die großen Emotionen ab,<br />
sondern konzentriere mich auf kleine Gefühle: Empfindungen der Haut oder der Nerven,<br />
alles, was man fühlen kann.“75 Zur gleichen Zeit tragisch und humorvoll, gewalttätig<br />
und sanft beschwört ihr Schaffen dringliche moralische Imperative herauf, artikuliert<br />
ein menschliches Sein im Zustand der ethischen Alarmbereitschaft und verbleibt als<br />
solches innerhalb der Sphäre des Privaten und der überwältigenden Intimität, wie Silke<br />
Andrea Schummer ganz zurecht zu Maria Lassnigs Selbstporträts anmerkt – und dies<br />
gilt nichtsdestotrotz auch für Womanpower (1979):<br />
Sie hat die Zurschaustellung ihres Körpers nie in Verbindung zu einem gesellschaftlichen<br />
Thema gebracht. In ihrem Fall ist der Körper sowohl privates Wahrnehmungsinstrument<br />
als auch Forschungsthema, doch er ist weder Repositorium für Gesellschaftsfunktionen<br />
noch eine Metapher für die Gesellschaft.76<br />
Tatsächlich hat Maria Lassnig selbst ihre Abneigung gegen Womanpower zum Ausdruck<br />
gebracht, ein Bild, das einst als Symbol für die emanzipatorischen Tendenzen<br />
der Frauen betrachtet wurde, und es als eines ihrer dümmsten und am wenigsten<br />
favorisierten Gemälde rundweg abgelehnt („Es ist als Titel interessant, doch nicht als<br />
Bild.“77) Die Künstlerin hat jedoch nie ein Hehl aus ihrer unabhängigen Position und<br />
ihrem Streben nach Selbstbestimmung gemacht. Die Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>.<br />
Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten präsentiert zwei außergewöhnliche<br />
Studien aus Maria Lassnigs Selbstporträtschaffen: Woman Laokoon (1976) und<br />
Stilleben mit rotem Selbstportrait (1969). Angesichts des kontroversen Gemäldes<br />
Woman Laokoon, dieser erhabenen Studie der Hysterie, ist uns die Menschheit im<br />
aufrichtigsten und niederschmetterndsten Augenblick der persönlichen Angst und des<br />
Leids gewärtig. Die Unmittelbarkeit dieser Darstellung ist bemerkenswert gewagt und<br />
aggressiv und setzt sich über alle moralischen Standards hinweg, was die Intimität und<br />
ihre öffentliche Zurschaustellung betrifft. Wenn wir ins dieses unvergessliche Gesicht<br />
voller Schmerzen blicken, betrachten wir den Spiegel des menschlichen Seins mit all<br />
seiner Machtlosigkeit, Handlungsunmöglichkeit und Hoffnungslosigkeit.<br />
Judith Butlers „angesprochen werden“ und Hannah Arendts „Wille zum Verstehen”<br />
finden im filmischen Work-in-Progress des niederländischen Künstlers Renzo Martens<br />
mit den lakonischen Titeln Episode 1 (2000/2003) und Episode 3 (2009) ungewöhnlich
78 Renzo Martens auf: http://<br />
www.modernedition.com/artarticles/contemporary-dutch-art/<br />
dutch-contemporary-artists.html<br />
erschreckenden Ausdruck. Es sind dies tatsächlich Episoden, Geschichten aus der Welt<br />
im TV-Serien-Format, fesselnde Berichte über ein Leben im Ausnahmezustand durch<br />
den Filter der sehr intimen privaten Lebenserfahrung des Künstlers/Autors. Episode<br />
1 und Episode 3 sind in der Tat Selbstporträts von Renzo Martens, mit dem Künstler<br />
höchstpersönlich als Erzähler, der die Handlung infiltriert und in Brecht’scher Manier<br />
verfremdet und somit den dramatischen Kontrast zwischen Wirklichkeiten und Welten<br />
im Allgemeinen kritisch in den Vordergrund rückt. Für Episode 1 bereist der Künstler<br />
die Kriegszone Tschetscheniens und drückt die Videokamera dabei desillusionierten<br />
Flüchtlingen in die Hand, die ihn filmen sollen, während er ihnen die allereinfachste,<br />
wenn auch höchst unerwartete Frage stellt: „Was hältst du von mir?“ Die Perspektive<br />
ist jetzt umgedreht: Das (Medien-)Bild wird von einem Opfer produziert und auf den<br />
Westen gerichtet. „Was ist dein Thema? Warum bist du hier? Warum brauchst du<br />
jemand anderen, der dir sagt, wo dein Platz ist? Warum filmst du das?“ – solch vorwurfsvolle<br />
und feindselige Fragen prallen zurück, während die Kamera das Gesicht des<br />
Künstlers durchdringt und seinen schamlosen Exhibitionismus auf die Probe stellt.<br />
Die Szene ist beschämend und für alle Beteiligten entwürdigend, und das Gefühl von<br />
Unbehagen und Verzweiflung ist niederschmetternd: „Wer ist dafür verantwortlich?<br />
Wie können wir einander verstehen?“ In gleichem Maße verstörend wie zutiefst bewegend<br />
erforscht die Geste des Künstlers die Möglichkeit von Empathie und erforscht die<br />
Wahrnehmung des „anderen“:<br />
Ich produzierte Episode 1 als Delegierter der Öffentlichkeit der Fernsehzuschauer, eines<br />
Publikums, das sich in erster Linie für sich selbst interessiert. Deshalb fragte ich die<br />
Leute nicht, wie es ihnen jetzt geht, nachdem ihnen die Beine amputiert wurden, oder<br />
stellte andere Fragen dieser Art. Doch befragte ich sie zu ihrer Einschätzung dazu, wie<br />
ich mich fühlte. Ob sie dachten, ich sei attraktiv oder wie ich daheim in Brüssel meine<br />
Freundin verführen solle. […] Ich drehte den Spieß um, weil es in Wirklichkeit viel mehr<br />
darum geht, wie wir uns fühlen, als wie sie sich fühlen.78<br />
Obwohl Martens’ Filmmaterial offenbar auch die üblichen Kriegsbilder liefert (Bilder<br />
von Städten in Trümmern, Flüchtlingslagern mit endlosen Zeltreihen, bis auf die<br />
Zähne bewaffneten Soldaten auf Grenzpatrouille, leidender Zivilbevölkerung, Hunger,<br />
Lebensmittelknappheit, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen bei der Ausarbeitung<br />
von Hilfsprogrammen und Journalisten auf der Jagd nach Schreckens- und Katastrophenbildern),<br />
liegt das Augenmerk des Künstlers eher darauf, wie Moral und ethische<br />
Fähigkeiten in solchen Extremsituationen in Territorien unter Beschuss funktionieren.<br />
Martens deckt die Verlogenheit des globalen Mediensystems auf und den Zusammenbruch<br />
aller humanitären Hilfsmaßnahmen zur Linderung der Tragödie für die<br />
Bevölkerung der Kriegszone. In der Tat ist Episode 1 eine Studie des Missbrauchs und<br />
der Ausbeutung. „Ich will Tränen“, antwortet ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation,<br />
während er die Mechanismen der humanitären Hilfe aufdeckt, die von der Präsenz der<br />
Kameras und der Medienberichterstattung determiniert sind. Martens manipuliert das<br />
Gleichgewicht des moralischen Empfindens des Zuschauers noch weiter: Eingebettet<br />
in den quasi journalistischen Plot des Films und an das Genre des Tagebuchs oder<br />
des Liebesbriefs erinnernd, sind die persönlichen Gefühle, die der Künstler für seine<br />
Freundin Marie empfindet und die ihren Ausdruck in in den entscheidendsten und<br />
dramatischsten Augenblicken des Films direkt in die Kameralinse gerichteten Liebeserklärungen<br />
finden („Ich bin’s, Liebling. Es ist wirklich Zeit, dass du mich auch liebst“).<br />
Dies interpunktiert die Reise des Künstlers durch die Hölle und fungiert als klassischer<br />
Brecht’scher V-Effekt, durch den unser stereotyper Blickwinkel gebrochen wird und<br />
das Gefühl von Wahrheit und Aufrichtigkeit gestärkt wird. Als Balanceakt hart am<br />
Rand des ethisch Korrekten ist Renzo Martens’ provokanter Film sowohl künstlerische<br />
Selbstanalyse als auch seine politische, und zutiefst menschliche, Intervention in die<br />
Stofflichkeit des prekären Lebens, in dem Liebesgeschichte und die Schrecken des
90 — 91<br />
Adam Budak<br />
79 Vgl. Rancière, Der emanzipierte<br />
Zuschauer, S. 101-125.<br />
80 Susan Sontag: Das Leiden<br />
anderer betrachten. Frankfurt:<br />
Fischer 2005, S. 142.<br />
81 Sontag, Das Leiden anderer<br />
betrachten, S. 113.<br />
Krieges teilhaben am notwendigen und dringenden Akt gemeinschaftlicher wie individueller<br />
Katharsis.<br />
Episode 3 markiert einen weiteren Schritt des Künstlers bei seiner Erforschung des<br />
„Leids der anderen” vermittels einer Analyse der Mechanismen der globalen Politik<br />
und Ökonomie. Diesmal bricht Martens auf eine danteske Reise in das Innere des<br />
Kongos auf und erlebt eine von Krieg, extremem Elend und Ungerechtigkeit gequälte<br />
Gesellschaft. Auch in diesem Fall verläuft die Erzählung auf zwei Ebenen und birgt eine<br />
autoreflexive Komponente in sich, die sich mit der Politik der Bildproduktion befasst,<br />
und hier ganz besonders mit der Ethik und Ökonomie der Darstellung postkolonialen<br />
Leids. „Was macht ein Bild unerträglich?“, fragt Martens im Sinne von Jacques Rancière<br />
und rührt somit provokant an der Ordnung der sichtbaren Dinge und spürt einer Verlagerung<br />
vom Unerträglichen im Bild zur Unerträglichkeit des Bildes selbst nach, die<br />
sich laut Rancière im Zentrum der Spannungen verorten lässt, welche die politische<br />
Kunst berühren.79 Seine Kritik am westlichen Fotojournalismus verweist auf einen<br />
Missbrauch menschlichen Elends und menschlicher Armut als „abgepackte Ware“ für<br />
die Augen der westlichen Welt. Martens widmet sich kühn der erdrückenden Armut und<br />
dem überwältigenden Leid eines von Gewalt und Unheil heimgesuchten Landes, das<br />
von den Medien in eine Bilderfabrik und in ein faszinierendes Spektakel verwandelt<br />
worden ist, und lässt somit Susan Sontags Reflexion zur Psychologie der Bilder der<br />
Katastrophe und des Bösen anklingen. Susan Sontag fragte sich „Gibt es ein Mittel<br />
gegen die so nachhaltig verführerische Wirkung, die vom Krieg ausgeht?“80 und verweist<br />
auf das beinah obsessive Interesse an ihnen, das schon Edmund Burke in seinen<br />
Philosophischen Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und<br />
Schönen (1757) betont hat: „Kein Schauspiel verfolgen wir mit solchem Eifer wie das<br />
eines ungewöhnlichen, betrüblichen Unglücks.“81 Renzo Martens entlarvt die Masken<br />
der pseudohumanitären internationalen Hilfsorganisationen und ihrer schonungslosen<br />
Ausbeutung der menschlichen Tragödie und sucht, gegen den Strich, nach Alternativen:<br />
Der Vorschlag des Künstlers ist überraschend und verzweifelt, doch könnte man<br />
ihn auch als ironisch, ja als zynisch, auffassen – „Enjoy please the poverty” (Genießt<br />
doch bitte die Armut) ist das subversive Motto seines emanzipatorischen Kursus, den<br />
er für kongolesische Amateurfotografen ins Leben gerufen hat, eine Akademie des<br />
Überlebens und eine Schule der Bewältigung ihres eigenen Elends, eine kontroverse<br />
„Aufklärungsstunde“. „Ich bringe ihnen bei, wie sie mit dem Leben klarkommen“ – so der<br />
Kommentar des Künstlers zu seiner Idee, die Einheimischen mit einer Art lehrreichem<br />
Know-how-Paket auszustatten, mit dem sie ihr Unglück in eine Einkommensquelle verwandeln<br />
können. Unterwiesen von Renzo Martens, beginnen sie westliche Fotojournalisten<br />
nachzuahmen, indem sie Fotos vom Krieg, den Vergewaltigungen und der Armut<br />
schießen – all jenen Dingen, von denen sie heimgesucht und umgeben sind, anstatt<br />
der üblichen Fotos von den Volks- und Familienfesten, die zwar zu den Freuden ihres<br />
Lebens zählen, aber deren Marktwert unverhältnismäßig niedriger ist als die Einkünfte<br />
mit dem sensationsheischenden und drastischen Bildmaterial: Dokumenten des Leids,<br />
der Grausamkeit und des Bösen. Martens bewegt sich in einem ganz besonderen und<br />
einzigartigen Genre, einer mutigen Art Metasprache, die zwischen (performativem)<br />
Dokumentarfilm, Doku-Drama, Performance und emanzipiertem Reisetagebuch oszilliert<br />
und eine subjektive Erzählung mit einem kritischen Ansatz zum aufgezeichneten<br />
Material in sich vereint. Der Künstler/Erzähler praktiziert aber auch eine Art Travestie:<br />
In Episode 1 spielt er einen westlichen Amateurjournalisten, wogegen er in Episode 3<br />
vielmehr als Utopist agiert, als naiver und uneingeweihter Aktivist oder als zynischer<br />
Coach, der „Know-how“ in gefährdete Krisengebiete bringt. Irgendwo zwischen geistigem<br />
Abstand, Engagement, Anschuldigung und Protest ist der chamäleonhafte und<br />
heterotopische Charakter des Künstlers einer von vielen: Er ist kühler Beobachter und
82 Martens gesteht: „Episode 1<br />
und Episode 3 sind die Seitenflügel<br />
eines Triptychons, auf dem<br />
Bilder der Armut, des Krieges und<br />
der historischen Verwüstung als<br />
Produkte zu sehen sind. Sie zeigen<br />
ganz irdische Erzählungen, mit<br />
Rebellen, Priestern, Richtern, Gier<br />
und Kameras – und thematisieren<br />
die Repräsentation selbst als Teil<br />
der ganzen Verwirrung. Wie bei<br />
den mittelalterlichen Altarwerken<br />
wird Episode 2 eines Tages das<br />
alles transzendieren.“ Das hoffe<br />
ich und kann den Release von<br />
Episode 2 kaum erwarten!<br />
83 Sontag, Das Leiden<br />
anderer betrachten, S. 122.<br />
84 Ibid., S. 14 f.<br />
gnadenloser Eindringling, leidenschaftlicher Prediger und Messias, Zeuge und Märtyrer,<br />
narzisstischer Abenteurer und Fremder, und, zu guter Letzt, ein metteur en scène, der<br />
seine grandiose Herzog’sche „(Genießt-doch-bitte-die Armut-)Anti-Broadway-Show”<br />
auf die Leinwand bringt! Als Ich-Erzähler, der auch vor der Kamera auftritt, rückt Renzo<br />
Martens seine eigene Person und eine klare Aussage in den Vordergrund: „Der Künstler<br />
ist da.” In der Tat haben wir es hier mit dem Genre des extremen, ja radikalen Selbstporträts<br />
zu tun – einem künstlerischen Akt als höchster Form der Verantwortung und<br />
des ethischen Bewusstseins.<br />
Renzo Martens’ Episodes sind Studien der Hoffnung wie auch der Hoffnungslosigkeit.<br />
Ebenso tragen Verzweiflung und Resignation zur Verletzbarkeit und Gebrechlichkeit<br />
einer Menschheit im Ausnahmezustand bei. Das als Triptychon konzipierte Werk82 ist<br />
ein Essay über das Leid und birgt als solcher in seinem Herangehen an ethische Fragen<br />
eine beinah religiöse Qualität in sich, ganz besonders wenn es um das Wesen des<br />
Mitgefühls geht. Martens’ Kritik der globalen Mediengesellschaft führt dazu, unserer<br />
Gesellschaft Unfähigkeit zur Empathie zu diagnostizieren. Wieder einmal beschwört<br />
ein Künstler Susan Sontags Einschätzung der zeitgenössischen Politik der Bilder und<br />
der Medien herauf:<br />
Der zweiten Ansicht zufolge […] haben in einer mit Bildern gesättigten, nein, übersättigten<br />
Welt gerade jene Bilder, auf die es ankommen sollte, eine dämpfende Wirkung:<br />
wir stumpfen ab. Letztlich nehmen uns solche Bilder etwas von unserer Fähigkeit zu<br />
fühlen und die Signale, die von unserem Gewissen ausgehen, wahrzunehmen.83<br />
In ihrer Analyse von Virginia Woolfs Reflexionen zu Kriegsbildern bemerkt Susan Sonntag:<br />
Wem diese Bilder nicht wehtun, wer vor ihnen nicht zurückschreckt, wer sich bei ihrem<br />
Anblick nicht gedrängt fühlt, die Ursachen für diese Verwüstung, dieses Blutbads aus<br />
der Welt zu schaffen – der reagiert nach Woolfs Meinung wie ein moralisches Monstrum.<br />
Wir seien aber keine Monster, so gibt sie uns [zu] verstehen, sondern Angehörige<br />
der gebildeten Klasse. Versagt haben unsere Vorstellungskraft und unser Mitgefühl: wir<br />
sind dieser Realität geistig nicht gewachsen gewesen.84<br />
Empathie in der Krise ist offenbar das wichtigste und wertvollste Thema von Renzo<br />
Martens’ künstlerischem Schaffen, doch gleichzeitig scheint es auch, als sei das ehrgeizigste<br />
Motiv dieses im Schatten einer Neonleuchtreklame mit den Worten „enjoy<br />
please the poverty”(Genießt doch bitte die Armut) entstandenen Werks der Drang,<br />
menschliches Leid durch die Mobilisierung der wundersamen Kraft des Mitgefühls und<br />
der Sublimierung zu überwinden. Julia Kristeva formuliert dieses Motiv, diese Herausforderung,<br />
auf äußerst fesselnde Art und Weise und definiert es als eine wichtige<br />
Aufgabe künftiger Generationen. Ihr Manifest ist ein Aufruf zu gemeinsamem Handeln<br />
und Zusammengehörigkeitsgefühl:<br />
Diese Zivilisation – von Christus […] bis Mozart, auf der ganzen Welt bekannte Persönlichkeiten<br />
–, diese Zivilisation, unsere, die heute bedroht ist, von außen wie auch von<br />
unserer eigenen Unfähigkeit, sie zu interpretieren und zu erneuern, hinterlässt uns<br />
somit ihren subtilen Triumph über das menschliche Leid, verwandelt, ohne das Leiden<br />
bis zum Tod des Göttlichen selbst aus den Augen zu verlieren. Uns obliegt es nun,<br />
dieses Erbe wieder anzunehmen, ihm Bedeutung zu verleihen und es im Angesicht der<br />
aktuellen Explosionen des Todestriebes zur Entfaltung zu bringen.<br />
Totalitäre Regime und in einer unterschiedlichen, aber durchaus symmetrischen Art<br />
und Weise die moderne Automatisierung der Spezies behaupten von sich, dem Leid<br />
ein Ende zu machen, es zu beseitigen oder einfach links liegen zu lassen, nur um es<br />
uns dann noch besser als Instrument der Ausbeutung und Manipulation aufzwingen<br />
zu können. Die einzige Alternative zu diesen auf verschiedenen Formen der Leugnung<br />
der Malaise gegründeten Formen der Barbarei ist wohl, sich wieder und wieder durch
92 — 93<br />
Adam Budak<br />
85 Julia Kristeva: This Incredible<br />
Need to Believe. New York: Columbia<br />
University Press 2009, S. 97 f.<br />
[Übersetzung: Lichtenwörther]<br />
86 Alain Badiou: Das Jahrhundert.<br />
Zürich, Berlin: Diaphanes 2006,<br />
S. 145.<br />
87 Ibid., S. 180.<br />
88 Ibid., S. 172.<br />
den Schmerz und das Leid durchzuarbeiten: So, wie wir es versuchen, so, wie ihr es<br />
versucht. Auf unterschiedliche Art und Weise und sehr oft jeder für sich gegen die<br />
anderen. Gegen oder „zu Recht gegen“? Und dennoch sind Mitgefühl und Sublimierung<br />
keine große Hilfe, wenn die neuen Barbaren, die sogar die Fähigkeit zu leiden verloren<br />
haben, Leid und Tod um uns herum und in uns verstreuen; wenn die Armut in der<br />
globalisierten Welt sprunghaft ansteigt, Auge in Auge mit zügelloser Anhäufung von<br />
Reichtum, dem alles egal ist? Selbstverständlich. Was ich jedoch ganz bestimmt weiß,<br />
ist die Tatsache, dass kein politisches Handeln ihren Platz einnehmen könnte, wenn<br />
der <strong>Human</strong>ismus –selbst eine Form des Leids – sich nicht selbst die Instrumente in<br />
die Hand gäbe, diese „liebende Intelligenz“, die vom Schmerzensmann ausgeht und<br />
untrennbar mit ihm verbunden ist, und das Mitgefühl des Leids, das sich mit dem<br />
Göttlichen selbst verwechseln ließe, zu interpretieren und neu zu erfinden. Dies ist die<br />
Herausforderung an das Zeitalter der Globalisierung, die ich als aufregende und langfristige<br />
Berufung begrüße, der wir uns nicht stellen werden können, es sei denn, wir<br />
versuchen gemeinsam zu denken und zu handeln […]85<br />
Leben, Handeln, Zusammengehörigkeit und die Essenz des „Wir“, nicht als Vertrag oder<br />
als Fusion verstanden, sondern als „Aufrechterhaltung des Ungetrennten“86 – das<br />
sind die Prinzipien, die das menschliche Sein definieren und ein von der Erfahrung von<br />
Leid gesteuertes Gleichgewicht von Mitgefühl und Selbstbestimmung orchestrieren.<br />
Alain Badiou beendet sein Kapitel über die Grausamkeit mit einer Apotheose des Handelns<br />
– „Vor dem Hintergrund von Schmerz durch den stets unwahrscheinlichen Einschub<br />
einer Formel und eines Augenblicks eine unbekannte Intensität zu produzieren:<br />
Das ist der Wunsch des Jahrhunderts. Darum gelingt es ihm. Trotz seiner vielförmigen<br />
Grausamkeit, durch seine Künstler, seine Gelehrten, seine Kämpfer und seine Liebenden,<br />
die Aktion selbst zu sein.“87 – und zitiert André Bretons Loblied auf Schmerz und<br />
Leiden als untrennbar mit dem Leben verbundene bereichernde Erfahrungen:<br />
Genau in diesem quälenden Augenblick, da alles unter der Last der erduldeten Leiden<br />
verschlungen zu werden droht, bewirkt gerade der Exzeß der Prüfung eine Umkehrung<br />
der Vorzeichen , die darauf zielt, die menschliche Stumpfheit in Wachheit umschlagen<br />
zu lassen und dieser eine Größe zu verleihen, die ihr sonst nie hätte zuteil werden können<br />
[…] Man muß bis auf den Grund des menschlichen Schmerzes vorgedrungen sein,<br />
seine merkwürdigen Fähigkeiten entdeckt haben, um mit der gleichen grenzenlosen<br />
Hingabe seiner selbst begrüßen zu können, was wert ist, gelebt zu werden.88
Empathie und Emanzipation1<br />
„Verstehendes Herz“,<br />
prekäre Zeit, erweitertes<br />
Urteilen – eine Annäherung<br />
mit Hannah Arendt<br />
Sophie Loidolt
1 Der folgende Essay Empathie<br />
und Emanzipation stellt eine<br />
Reflexion über diese beiden<br />
Begriffe im Kontext von Hannah<br />
Arendts Werk dar. Damit orientiert<br />
er sich stärker am englischen Titel<br />
der Ausstellung Empathy and<br />
Emancipation in Precarious Times<br />
als am deutschen Titel Mitgefühl<br />
und Selbstbestimmung in prekären<br />
Zeiten. Da gerade die Begriffe der<br />
„Empathie“ und der „Emanzipation“<br />
im gegenwärtigen Diskurs zwar<br />
geläufig, ihre ursprüngliche Bedeutung<br />
aber trotzdem oft unklar ist,<br />
schien es mir interessanter, hier<br />
eine Klärungsarbeit mit Arendt zu<br />
versuchen und damit auch ein<br />
neues Verständnis dieser Termini<br />
vorzuschlagen. Im Gegensatz zur<br />
„Selbstbestimmung“ (die eher dem<br />
Begriff der „Autonomie“ entspricht)<br />
habe ich daher die „Selbstbefreiung“<br />
in den Vordergrund gestellt,<br />
die Bedeutung, die „Emanzipation“<br />
seit der Aufklärung im 17. und<br />
18. Jahrhundert erhielt (im Lateinischen<br />
bedeutete emancipare hingegen<br />
noch, einen Sohn oder einen<br />
Sklaven in die Selbstständigkeit<br />
zu entlassen, hatte also ein passives<br />
Moment). Zudem schien mir<br />
der dynamische Prozess, der in der<br />
„Selbstbefreiung“ steckt, ein spannendes<br />
Moment im Verhältnis zum<br />
„Gefühl“ darzustellen. Die „Empathie“,<br />
die man auch als „Einfühlung“<br />
oder „emotionale Kompetenz“<br />
übersetzen könnte, öffnet diesbezüglich<br />
ebenso ein weiteres<br />
begriffliches Feld über das „Mitgefühl“<br />
hinaus: Denn empathisch<br />
kann bzw. muss auch der Prozess<br />
des „Verstehens“ sein, wodurch<br />
Arendts Anliegen der „erweiterten<br />
Denkungsart“ in eine affektive,<br />
gefühlsmäßige Perspektive besser<br />
eingebunden werden kann.<br />
2 Arendt, Über die Revolution,<br />
S. 115.<br />
3 Ibid., S. 114. Arendt zitiert hier<br />
aus einer Petition einer der Pariser<br />
Sektionen während der Revolution:<br />
„Aus Mitleid, aus Liebe<br />
zur Menschheit, seid inhuman!“<br />
4 Ibid., S. 113.<br />
5 Ibid.<br />
6 Ibid., S. 112.<br />
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Empathie und Emanzipation? Oder, anders<br />
formuliert: Vermag uns unser Vermögen der Einfühlung bei dem Prozess der gesellschaftlichen<br />
und politischen Selbstbefreiung zu helfen? Oder trübt das Schwelgen im<br />
Mitleid, das heute medial so gezielt zur Gewinnmaximierung eingesetzt wird, nur unser<br />
Urteilsvermögen? Was überhaupt heißt Emanzipation in einer Welt, die von systematischen<br />
Ungerechtigkeiten beherrscht wird, wodurch eine kleine „ emanzipierte“ Schicht<br />
einer großen Masse von Menschen gegenübersteht, die kaum etwas zu verlieren<br />
haben? Und hat nicht an unserem eigenen privilegierten Platz der Welt die hehre Idee<br />
der Aufklärung nach den Katastrophen der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts<br />
einer breiten Emanzipationsmüdigkeit und konsumorientierten Indifferenz Platz<br />
gemacht? Es lohnt sich, diese Begriffe wieder neu zu denken und zu überdenken. Hannah<br />
Arendt, die mit dem Thema der „human condition“ eine Grundinspiration für diese<br />
Ausstellung gelie fert hat, kann auch hier einige Anstöße geben. Und wie immer denkt<br />
sie gegen den Strich.<br />
1 Empathie: „Ich will verstehen“<br />
Versteht man Empathie als einfühlendes und mitfühlendes „Mitleid“, so begibt sich<br />
Arendt sofort in deutliche Distanz zu einer ganzen Tradition von Revolutionären und<br />
Sozialreformern, die sich das Mitleid mit den notleidenden Massen zum Grundmotiv<br />
ihres Denkens und Handelns gemacht hatten. Mitleid kann kein politisches Prinzip sein,<br />
so Arendt. Darin liegt natürlich etwas Skandalöses. Worum es Arendt aber geht, ist<br />
zweierlei, und beides hat mit dem Gefühlscharakter des Mitleids zu tun. Der erste Punkt,<br />
den Arendt hauptsächlich in ihrer Analyse der Französischen Revolution herausarbeitet,<br />
betrifft den Überschlag des Mitleids mit den les miserables in eine „Politik der Tugend“,<br />
die sich allzu schnell als eine Politik des Terrors erweisen kann. Die von Rousseau<br />
inspirierten Führer der Französischen Revolution kompensierten ihre Überforderung mit<br />
der aufbrechenden sozialen Frage, den verelendeten Massen, durch die „Maßlosigkeit<br />
ihrer Emotionen, welche [alle] Revolutionäre so seltsam unempfindlich für das faktisch<br />
Reale und vor allem für die Wirklichkeit von Menschen machte, die sie immer bereit<br />
waren, für die Sache oder den Gang der Geschichte zu opfern“2: Par pitié, par amour pour<br />
l’humanité, soyez inhumains!3<br />
Der zweite Punkt, der uns hier näher beschäftigt, ist der Eigencharakter des Mitleids als<br />
eines Gefühls. Arendt unterscheidet zwischen „Gefühl“ und „Leidenschaft“. Eine Leidenschaft<br />
versteht sie, dem griechischen páthos gemäß, als ein Erleiden, etwas, dem ich<br />
radikal ausgesetzt bin. Sie hält es mit Rousseau für eine grundmenschliche Eigenschaft,<br />
im Angesicht des Leidens anderer von dieser Empfindung überwältigt zu sein. Das<br />
Gefühl hingegen birgt etwas Selbstreflexives in sich, ein SichselbstEmpfinden, und<br />
ist dadurch der Sentimentalität ausgesetzt (die Rousseau und ein ganzes Zeitalter<br />
nach ihm ebenfalls kultiviert haben). Das Mitleid, so Arendt, das sich „in gefühlsseliger<br />
Distanz zu seinem Objekt hält“4, tendiert daher dazu, in seinem eigenen SichFühlen<br />
zu schwelgen, und führe beinahe automatisch dazu, das Leiden der anderen zu glorifizieren.<br />
Diese „sentimentale Gefühlsseligkeit des Mitleids“ unterscheidet Arendt von<br />
der echten Leidenschaft des „MitLeidens, das leidenschaftlich seiner selbst vergisst“5.<br />
Beiden Varianten erteilt sie aber hinsichtlich des politischen und engagierten Handelns<br />
eine Absage zugunsten der Haltung der Solidarität. Diese fühlt sich nicht „zu den<br />
Schwachen hingezogen“6, sondern wägt in Freiheit zwischen den Leidenschaften ab und<br />
sinnt auf eine dauerhafte Interessensgemeinschaft mit den Unterdrückten und Aus gebeuteten,<br />
jenseits des Wechsels der Stimmungen und Empfindungen. Arendt geht es<br />
darum, dass mich ein Prinzip gleichsam „von außen“ inspiriert, da seine Idee konstant<br />
bleibt, während Gefühl und Leidenschaft „von innen“ motivieren, daher aber unzuverlässiger<br />
sind: Meine GefühlsMotive können sich ändern, Prinzipien ändern sich nicht.
96 — 97<br />
Sophie Loidolt<br />
Hannah Arendt<br />
(190675)<br />
7 Ibid., S. 113.<br />
8 Arendt, Fernsehgespräch mit<br />
Günter Gaus, S. 62.<br />
Man kann an diesen Passagen gut erkennen, aus welchen Gründen Arendt das Prinzip<br />
der Solidarität der Empfindung des Mitleidens vorzieht, die „Vernunft“ den „Emotionen“:<br />
weil diese wankelmütig, heteronom, eventuell selbstgefällig und vor allem – manipulierbar<br />
sind. Darin liegt, bei allem klassisch philosophischen Misstrauen dem Gefühl<br />
gegenüber, vor allem das Körnchen Wahrheit, dass die medial erzeugte Mitleidsmaschinerie<br />
bei humanitären oder anderen Katastrophen zwar auch viel Gutes bewirkt, indem<br />
sie die Spendengelder fließen lässt, die Aufmerksamkeit aber schnell weiterwandert<br />
und die Emotionen schon bald wieder mit Neuem gefüttert werden müssen. Mitleid<br />
führt in diesem Fall nicht zur Freiheit: Die Betroffenen werden nicht von ihrer drückenden<br />
Situation befreit (da dies nur eine dauerhafte Hilfeleistung bewirken könnte), und<br />
in den Helfenden auf Distanz bleibt das Unbehagen zurück, einer Bilderflut ausgesetzt<br />
zu sein, die einem letztlich nichts anderes zeigt, als dass man gegen das ungeheuerliche<br />
Leid auf der ganzen Welt machtlos ist. Solidarität, so Arendt, gründet sich auf<br />
Prinzipien der Größe, Ehre und Würde des Menschen und erscheint deshalb kälter und<br />
abstrakter als das konkrete Mitleid – genau aber diese Prinzipien sind es, die „das<br />
Handeln inspirieren und es leiten“7 –, das Mitleid hingegen verharrt in der (schlimmstmöglich:<br />
selbstgefälligen) Passivität oder gerät höchstens in einen Überschwang<br />
des Handelns, der auch schnell wieder verpuffen kann, also keinesfalls „geleitet“ wird.<br />
Führt uns also Empathie gar nicht auf den Weg der Befreiung?<br />
Arendt wählt einen anderen Ansatz. Die Verwerfung des Gefühls als politisches Movens<br />
ist nicht die ganze Geschichte und man würde einem Klischee verfallen, wenn man<br />
Arendt bloß in ihrer Nüchternheit als abstrakte Denkerin charakterisieren würde. Ein<br />
bekannt gewordener Satz dieser Denkerin lautet: „Ich will verstehen.“ Und dieser Prozess<br />
des Verstehens hat keineswegs etwas mit kühler Rationalität zu tun. Man kann vielmehr<br />
sagen, dass sich Arendt einen ganz eigenen Weg des Verstehens angeeignet hat,<br />
der vor allem von der Auseinandersetzung mit dem Holocaust geprägt ist, von dem<br />
Arendt ja direkt betroffen war: „Hier ist etwas geschehen, womit wir alle nicht fertig<br />
werden.“8<br />
Ihrer Betroffenheit setzt Arendt die aktive Arbeit des Verstehens entgegen. Und dieses<br />
Verstehen – dies haben Arbeiten von Seyla Benhabib und vor allem von Peter Trawny<br />
gezeigt – zeichnet sich durch den ethischen Gestus des „narrativen Handelns“ (Benhabib)<br />
und eine „Hermeneutik des verstehenden Herzens“ (Trawny) aus. Dazu sind zumindest<br />
zwei kurze Erläuterungen notwendig.<br />
(1) Das Verstehen schlägt bei Arendt immer sogleich in ein Erzählen um bzw. Verstehen<br />
ereignet sich bei ihr als Erzählen. Dieses Erzählen hat ethischen Charakter, weil es<br />
zutiefst der conditio humana entspricht: Menschen existieren in der Zeit, sie werden<br />
geboren, sie sterben. Da sie handeln und sprechen können, kann man über sie eine<br />
Geschichte erzählen. Das HandelnKönnen, das EinenAnfangmachenKönnen, Neues<br />
in die Welt bringen, verbindet Arendt mit der Bedingtheit des GeborenSeins: Sie nennt<br />
es Natalität. Der klassischen „conditio“ der Sterblichkeit und Endlichkeit stellt Arendt<br />
also die Natalität, die Geburtlichkeit, gegenüber. Wir sind Sterbliche, aber genauso sind<br />
wir Wesen, die einen Anfang machen können. Und nur weil wir Sterbliche und Anfangende<br />
sind, die auf der Bühne der Welt auftreten, die als Neuankömmlinge ihren Faden in<br />
das Gewebe des Bestehenden hineinschlagen, die leben, wohnen, Werke hinterlassen,<br />
handeln und schließlich wieder verschwinden, kann man eine Geschichte über jeden<br />
Einzelnen von uns erzählen.<br />
Im Handeln offenbart sich am deutlichsten, „wer einer ist“. Es gibt Aufschluss über<br />
die unverwechselbare und einzigartige Individualität jedes Einzelnen, die nie bloß<br />
im „Charakter“ gerinnt, sondern immer das unverfügbare Ereignis in sich birgt. Doch<br />
da das Handeln sich oft ins Selbstvergessene des Alltags auflöst, wird uns der Sinn
9 Arendt, Menschen in finsteren<br />
Zeiten, S. 30.<br />
10 Ibid., S. 31.<br />
11 Arendt, Das Urteilen, S. 16.<br />
12 Ibid., S. 16.<br />
unserer Praxis meist erst in der nachträglichen Erzählung deutlich. Odysseus, so<br />
schreibt Arendt in ihrem Denktagebuch, habe geweint, als ein Sänger bei den Phäaken<br />
die Geschichte von der Niederschlagung Trojas durch die List des hölzernen Pferdes<br />
erzählt. In diesem Weinen erkennt Odysseus das Geschehene als seinen bios, als sein<br />
Leben: „Der tragische Held wird wissend, indem er das Getane noch einmal in Form des<br />
Erleidens erfährt, und in diesem ‚Pathos‘, in dem Erleiden des Gehandelten, wird das<br />
Geflecht der Taten überhaupt erst zum Geschehen.“9 Durch das pathische Bewegtsein<br />
entsteht also erst „Geschehen“ als eine Möglichkeit des Sinns, durch die wir nicht<br />
nur handeln, sondern uns auch als Handelnde mit einer Geschichte verstehen können.<br />
Und dieses SinnAufnehmen und Weiterspinnen setzt sich fort und ermöglicht uns,<br />
dem Geschehen, dem Gehandelten begegnen zu können: Man bemerkt den Kummer<br />
des Fremden und fordert Odysseus auf zu sagen, wer er ist, und seine Geschichte zu<br />
erzählen – was dieser auch sogleich tut. Auf diese Weise, so Arendt, findet eine weitere<br />
„Verwandlung“ statt. Das Erzählen ist also einerseits die Möglichkeit, den Sinn unseres<br />
Handelns in einem Geflecht von menschlichen Bezügen überhaupt erst zu verstehen;<br />
andererseits ist es eine ethische Strategie, die im Leben und im Gespräch mit den<br />
anderen bleibt:<br />
Sofern es überhaupt ein „Bewältigen“ der Vergangenheit gibt, besteht es im Nacherzählen<br />
dessen, was sich ereignet hat; aber auch dies Nacherzählen, das Geschichte<br />
formt, löst keine Probleme und beschwichtigt kein Leiden, es bewältigt nichts endgültig.<br />
Vielmehr regt es, solange der Sinn des Geschehenen lebendig bleibt – und dies<br />
kann durch sehr lange Zeiträume der Fall sein – zu immer wiederholendem Erzählen<br />
an. Die Dichter in einem sehr allgemeinen, die Geschichtsschreiber in einem sehr<br />
speziellen Sinn haben die Aufgabe, dies Erzählen in Gang zu bringen und uns in ihm<br />
anzuleiten. Und wir, die wir gemeinhin weder Dichter noch Historiker sind, kennen das,<br />
was hier vorgeht, aus unserer eigenen Lebenserfahrung sehr gut, in der wir ja auch<br />
das Bedürfnis haben, uns das, was in unserem Leben eine Rolle spielte, in die Erinnerung<br />
zu rufen, indem wir es nach und uns vorerzählen.10<br />
(2) Erzählen ist vor allem auch das Erzählen der Geschichten und Taten von anderen –<br />
im Besonderen der Taten, die wir für erinnerungswürdig halten. Hier zeigt sich<br />
noch einmal ein charakteristisches Element der narrativen Ethik Arendts. Es richtet<br />
sich direkt gegen die Geschichte, die „Pseudogottheit der Neuzeit“11. Die Härte des<br />
Gedankens der „Sieger der Geschichte“ ist bekannt. Die Verlierer sind tot, vergessen,<br />
vernichtet – nicht nur physisch ausradiert, sondern auch dem Dunkel des Vergessens<br />
anheimgegeben, sodass oft nicht einmal mehr Namen bleiben von denen, die in den<br />
Lagern ermordet worden oder auf dem Schlachtfeld gefallen oder in purer Armut verendet<br />
sind. Durch das Erzählen und Urteilen können wir unsere menschliche Würde<br />
von dieser Pseudogottheit namens Geschichte zurückgewinnen, so Arendt, indem wir<br />
ihr das Recht verweigern, der letzte Richter zu sein. Arendt zitiert in diesem Zusammenhang<br />
gerne einen Satz des Römers Cato: Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni<br />
(„Die siegreiche Sache gefällt den Göttern, die besiegte aber gefällt Cato.“).12<br />
Auch wenn die gute, mutige, tapfere Tat dem Untergang geweiht war, auch wenn sie<br />
für den Ausgang einer Geschichte „sinnlos“ war – wir können sie als wert, erinnert und<br />
erzählt zu werden, beurteilen. Dies ist der Protest der <strong>Human</strong>ität gegen die Geschichte<br />
der Sieger: Die Kriterien unseres Urteilens müssen wir uns nicht dadurch vorgeben<br />
lassen, wer der Stärkere oder der Sieger war. Wir sind nicht dazu gezwungen, nur das<br />
für gut zu halten, was Erfolg hat.<br />
Auch im Angesicht der Kriege, der Unterdrückung und der drückenden Armut der<br />
Gegenwart in vielen Teilen dieser Welt ist das Erzählen eine wichtige Strategie gegen<br />
das Vergessen. Denn das Unglück der Armut liegt vor allem auch darin, dass „das
98 — 99<br />
Sophie Loidolt<br />
Immanuel Kant<br />
(17241804)<br />
13 Arendt, Über die Revolution,<br />
S. 86.<br />
14 Vgl. Trawny, Verstehen und<br />
Urteilen, S. 288.<br />
Leben keine Folgen in der Welt hat, keine Spur in ihr hinterlässt“13. Um es mit Brecht<br />
zu sagen:<br />
Denn die einen sind im Dunkeln<br />
Und die andern sind im Licht.<br />
Und man siehet die im Lichte,<br />
Die im Dunkeln sieht man nicht.<br />
Der Prozess des Verstehens bedeutet also zunächst einmal zu erzählen. Doch erzählen<br />
ist nie bloß abschildern. Es erfordert nicht nur immer ein Urteilen im Wie des Erzählens,<br />
mehr noch: Das ethische Element dieses gleichsam erzählenden Verstehens ist das<br />
Urteilen 14 – indem es sich über die bloßen Ereignisse der Geschichte erhebt und sie<br />
beurteilt. In diesem Sinn erinnert Arendt daran, dass das griechische Wort historein<br />
(„erkunden, um zu erzählen, wie es war“) ursprünglich bei Homer im Wort histor vorkommt,<br />
und dieser Historiker Homers ist der Richter. Es geht also darum, gleichsam vor<br />
dem großen Gemälde des Geschehens zurückzutreten, um es sehen zu können, um<br />
einen „Sinn“ zu erfassen und diesen urteilend für das Menschliche zurückzugewinnen.<br />
Dabei darf nie vergessen werden, dass dieser Urteils und Sinngewinnungsprozess für<br />
Arendt einer ist, der sich nur in der Pluralität vollziehen kann – und dass es Arendt mit<br />
dem „Sinn“ nicht um einen absoluten Wahrheitsanspruch geht, sondern darum, dass<br />
Menschen in einer Welt „zu Hause“ sein können, sich orientieren und sich mit dem<br />
Geschehenen versöhnen können, indem sie eben über es urteilen. Deshalb geht es um<br />
„selbst denken“ und „zu einem Urteil kommen“ genauso wie um den Austausch und den<br />
Diskurs mit anderen. Arendt spricht vor allem den Dichtern (man könnte im weiteren<br />
Sinne vielleicht auch sagen: den Künstlern) eine herausragende Fähigkeit zum ersten<br />
Erzählen zu. Sie vermögen den Sinn des Gehandelten am ehesten zu erfassen, weil sie<br />
(idealerweise) frei sind, d.h., weil sie unabhängig sowohl vom wissenschaftlichen als<br />
auch vom gesellschaftlichen Konsens sind.15 Doch das Vermögen des Urteilens kommt<br />
uns allen zu. Hier handelt es sich nicht nur um ein BetroffenSein, sondern um eine erste<br />
Emanzipation, eine Selbstbefreiung zum Urteilen hin. Die Empathie des Verstehens<br />
emanzipiert uns dahingehend, verschiedene Standpunkte in unserem Denken einnehmen<br />
zu können.<br />
2 Emanzipation: denken, handeln, urteilen<br />
„Urteilen“ bedeutet hier nicht „verurteilen“ oder gar „aburteilen“. Es bedeutet auch<br />
nicht, bloß eine Meinung zu haben, die man für seine eigene hält. Urteilen ist vielmehr<br />
ein aktiver Prozess, ein Durchgehen und Abwägen vieler verschiedener Standpunkte,<br />
ein Reflektieren der eigenen Perspektive und ein Einnehmen der der anderen. Eine<br />
Anstrengung des Denkens, der Einbildungskraft und der Reflexion sind erforderlich,<br />
bevor man zu seinem Urteil kommt, seinen angereicherten Standpunkt durchgedacht<br />
und sich eine Meinung gebildet hat (im Unterschied zu Meinungen, die einem bloß<br />
zufallen oder gleichsam aus einem hervorbrechen).<br />
Arendt entwickelt ihre Urteilstheorie am Leitfaden des ersten Teils von Kants Kritik der<br />
Urteilskraft, der das ästhetische Urteilen zum Thema hat – denn Kant ist sich bewusst,<br />
dass in „Geschmacksurteilen“ nicht nur einfach Kategorien auf „Fälle“ an gewendet<br />
werden, sondern dass das Urteilen hier eine ganz besondere, „reflektierende“ Aufgabe<br />
erfüllt. Deshalb nennt er diese Urteile, in denen keine allgemeinen Maßstäbe zur<br />
Beurteilung vorliegen, auch „reflektierende Urteile“ im Gegensatz zu „bestimmenden<br />
Urteilen“, die bloß subsumieren und insofern keine Herausforderung für die Urteilskraft<br />
darstellen. Arendt ist nun der Ansicht, dass im Grunde der gleiche Modus für<br />
das ästheti sche wie für das politische Urteilen, d.h. für das Urteilen über menschliche
15 Vgl. Trawny, Denkbarer<br />
Holocaust, S. 76.<br />
16 Vgl. Kant, Kritik der<br />
Urteilskraft, B 158.<br />
Angelegenheiten, gelten muss: Denn hier wie da geht es um Einzelfälle, es gibt keinen<br />
Anspruch auf absolute Wahrheit, viele streiten sich darum, aber obwohl es keine<br />
objektive Meinung geben kann, ist doch auch nicht alles rein subjektivzufällig und<br />
beliebig.<br />
Das reflektierende Urteilen ist nämlich nicht bloß Wiedergabe einer privaten Empfindung,<br />
sondern gerade die Emanzipation von meiner unmittelbaren Betroffenheit,<br />
um mir einen weiteren Blickwinkel, die erweiterte Denkungsart (Kant) zu verschaffen.<br />
Arendt hält sich hier eng an Kant, der zwischen „Sinnengeschmack“ und „Reflexionsgeschmack“<br />
unterscheidet: Der Sinnengeschmack ist bloß eine private Empfindung,<br />
die auf meine bzw. auf die je eigene Sinnlichkeit beschränkt ist und meine zufällige<br />
unmittelbare Reaktion auf das, was mich affiziert, ausdrückt (z.B.: Spinat schmeckt<br />
mir). Im strengen Sinne fälle ich aber hier kein Urteil, sondern gebe bloß meinen<br />
Zustand wieder, stelle ihn fest, sage ihn aus – ich distanziere mich in keiner Weise von<br />
dem, was mich unmittelbar anspricht oder abstößt. Der Reflexionsgeschmack hingegen<br />
verlangt mir etwas ganz anderes ab. Er gibt keinen unmittelbaren Reiz wieder, sondern<br />
bringt mich in einen Denkprozess, dessen Ergebnis ein Urteil ist, das auf intersubjektive<br />
Zustimmung (nicht absolute Wahrheit!) Anspruch erhebt. Nur hier urteile ich<br />
wirklich und – ich müsste schon im Plural sprechen – nur hier tut sich etwas Verhandlungs<br />
würdiges auf, das über unsere private Sinnlichkeit hinaus ein Gegenstand<br />
der Kommunikation sein kann. Denn kommuniziert wird nicht über bloß private Lustempfindungen<br />
(das wäre sehr schnell uninteressant: ich mag Blau, du magst Gelb),<br />
sondern über solche, die wir teilen können, weil oder indem wir uns alle dazu in Distanz<br />
gesetzt haben. Der Gegenstand, das Ereignis, zeigt sich nun von mehreren Seiten.<br />
Es geht hier nicht darum, eine objektive Wahrheit über den Gegenstand zu erreichen,<br />
sondern ihn in seinen pluralen Erscheinungsweisen sich vorzustellen und sich dann<br />
zu fragen: Wie würde ich nun urteilen?<br />
Diese Übung im Denken, verschiedene Standpunkte einzunehmen, nennt Kant<br />
„ Operation der Reflexion“, deren erster Schritt darin besteht, „seine Einbildungskraft<br />
zu lehren, Besuche zu machen“. Arendt bringt dies wieder in Zusammenhang mit der<br />
Figur des „blinden Dichters“ (Homer), der nicht unmittelbar von dem Geschehen affiziert<br />
wird, weil seine Augen geschlossen sind. Dieses Vermögen der Distanzierung, der<br />
Repräsentation (wofür die Einbildungskraft zuständig ist) bringt uns in einen angemessenen<br />
Abstand zum Gegenstand. Es schafft die Bedingungen für eine relative<br />
Unparteilichkeit, ohne dabei empfindungslos zu werden – denn das Repräsentierte,<br />
Reflektierte affiziert mich ja noch immer, weckt Lust oder Unlust, aber eben auf einer<br />
anderen, vermittelten und nicht unmittelbarunausweichlichen Ebene.<br />
In einem weiteren Schritt nimmt Operation der Reflexion Kants Maximen des aufgeklärten<br />
Denkens in Anspruch: 1. selbst zu denken (vorurteilsfreie Denkungsart), 2. an der<br />
Stelle jedes anderen zu denken (erweiterte Denkungsart) und 3. mit sich selbst in Übereinstimmung<br />
zu denken (sich nicht zu widersprechen: konsequente Denkungsart).16<br />
Was heißt nun „an der Stelle jedes anderen denken“? Es kann natürlich weder bedeuten,<br />
den anderen das Denken abzunehmen, noch genau zu wissen, was der/die andere fühlt,<br />
bzw. an seiner/ihrer Stelle zu fühlen, das zu fühlen, was er/sie fühlt. In diesem Sinn<br />
kommt die Empathie nicht zum Tragen, wie Arendt ganz deutlich betont.<br />
Vielmehr geht es darum, dass ich verstehe, wo der/die andere steht, dass dies ein<br />
anderer Platz der Welt ist als meiner, von wo aus sich die Dinge anders zeigen. Es geht<br />
darum, eine andere Perspektive auf die Welt einnehmen zu können. Im Anschluss<br />
daran ist aber noch immer das Selbstdenken gefragt. Wie würde ich an dieser Stelle<br />
denken und urteilen? Denn ohne diese Möglichkeit müsste ich jedes andere Urteil von<br />
jedem anderen für richtig, oder besser: für unbeurteilbar und deshalb richtig halten –<br />
die Konsequenz wäre, dass es im Grunde nichts Gemeinsames mehr gäbe, über das wir
100 — 101<br />
Sophie Loidolt<br />
Daniel Wiesenfeld,<br />
animal laborans: Putzfrau, 2006<br />
Öl auf Leinwand; 120 × 200 cm<br />
Daniel Wiesenfeld,<br />
animal laborans: Büro, 2006<br />
Öl auf Leinwand; 120 × 200 cm<br />
17 Scholem, Briefe, Brief 64<br />
(23. Juni 1963), S. 98.<br />
18 Arendt, Ich will verstehen,<br />
S. 35.<br />
19 Vgl. Arendt, Vom Leben<br />
des Geistes, S. 14 f.<br />
20 Arendt, Vita activa, S. 157.<br />
21 Kant, Kritik der Urteilskraft,<br />
B 28.<br />
22 Ibid., B 122. Das Urteilen<br />
bestünde also darin, sich ein<br />
Bild zu machen, das die unmittelbaren<br />
Instinkte der Masse<br />
nicht bedienen kann – und sich<br />
trotzdem nicht in einen elitären<br />
weltabgewandten Raum zurückzieht,<br />
sondern sich sehr wohl<br />
der öffentlichen Beurteilung und<br />
Zustimmungsfähigkeit aussetzt.<br />
23 Arendt, Was ist Politik?, S. 181.<br />
Arendt bezieht sich in diesem<br />
Fragmenttext auf Nietzsche.<br />
urteilen und uns trefflich streiten könnten: Es gäbe keinen sensus communis mehr,<br />
also keinen „gemeinschaftlichen Sinn“, das, worauf ich beim anderen Anspruch erhebe,<br />
wenn ich ihm mein Urteil „ansinne“ (so Kant) – wir hätten, so Arendt, keine gemeinsame<br />
Welt (im Sinne eines Bezugsgewebes) mehr, die ja nur im gemeinsamen Kommunizieren<br />
über diese Welt entsteht und immer neu entsteht und sich dynamisch verändert.<br />
Jeder würde stattdessen in seinem eigenen sensus privatus (Privatsinn oder: logischer<br />
Eigensinn) festsitzen, dessen schnelles Überhandnehmen zum ideologischen Eigensinn,<br />
der keinen anderen Standpunkt mehr einbeziehen kann, von Kant als ein Merkmal<br />
der Verrücktheit diagnostiziert wird.<br />
Deshalb ist es Arendt auch so wichtig zu betonen, dass dieses Urteilen, das zumindest<br />
versucht, an anderen Stellen zu denken, unentbehrlich ist, wenn wir gemeinsam, mit<br />
anderen, „Sorge für die Welt“ tragen wollen. In diesem Sinn antwortet sie auch an<br />
Gershom Scholem (der bezüglich der EichmannKontroverse gemeint hatte: „Ich maße<br />
mir kein Urteil an. Ich war nicht da.“17): „Und wenn Sie vielleicht recht haben, daß es<br />
ein ‚abgewogenes Urteil‘ noch nicht geben kann, obwohl ich es bezweifle, so glaube<br />
ich, daß wir mit dieser Vergangenheit nur fertig werden können, wenn wir anfangen zu<br />
urteilen, und zwar kräftig.“18 Es geht Arendt also weniger um eine Letztgültigkeit des<br />
Urteils oder um eine Angst vor dem falschen Urteilen, sondern darum, überhaupt im<br />
Urteilsprozess zu bleiben. Denn viel bedenklicher ist es für sie, gar nicht mehr zu urteilen.<br />
Und dies nicht nur, weil das Urteilen für eine Aussöhnung notwendig ist, damit gestraft<br />
oder verziehen werden kann. Arendt diagnostiziert gerade mit dem Aufkommen des<br />
Totalitarismus und dem gleichzeitigen Zusammenbruch des alten Wertesystems die<br />
(wahrscheinlich hier erst sichtbar werdende) Unfähigkeit, selbst zu denken und zu<br />
urteilen. Das Phänomen Eichmann, so Arendt, ist vor allem auch durch die Unfähigkeit<br />
oder durch die Ausschaltung (auf jeden Fall den NichtGebrauch) der eigenen Urteilskraft<br />
zu charakterisieren.19<br />
Die Emanzipation, die also im Verstehens und Urteilsprozess stattfindet, ist eine<br />
Emanzipation von der Befangenheit im bloß eigenen Standpunkt und eine Selbstbefreiung<br />
auf eine gemeinsame Welt hin. Dieses Gemeinsame ist kein Absolutes, Monolithisches,<br />
das auf eine Konsenspflicht hinausläuft, sondern ein „Zwischen“, das immer in<br />
Verhandlung bleibt und sinn und weltbildend fungiert, solange die Kommunikation und<br />
das lebendige Urteilen aufrechterhalten werden. Für diese Emanzipation brauchen wir<br />
die Empathie nicht im Sinne des Mitleids oder des MitdenanderenFühlens, sondern<br />
im Sinne des Verstehens und des Urteilens. Denn die verschiedenen Standpunkte sollen<br />
nicht auf einen zusammengeschmolzen werden, sondern einen Zwischen-Raum der<br />
Kommunikation eröffnen, in dem allein Lösungen gefunden werden können, von denen<br />
sich andere nicht vereinnahmt oder bevormundet fühlen. Dafür brauchen wir auch die<br />
erweiterte Denkungsart, die es einzuüben und an Erzählungen, Urteilen und Diskussionen<br />
zu erproben gilt: Denn ohne diese wird man nie eine andere Person erreichen, nie so<br />
sprechen können, dass sie einen versteht, letztlich selbst nie verstehen können, was<br />
gemeinsame Welt ist und sein kann – über einen geteilten Globus hinaus.<br />
Urteilen bedeutet also nicht, sich über die Leidenden als bloß gefühlloser Zuschauer<br />
hinwegzuemanzipieren, sondern es bedeutet, so Arendt, verantwortlich die Aufgabe zu<br />
übernehmen, Sinn zu verstehen, das Zwischen offen zu halten, und „Sorge um die Welt“<br />
zu tragen. Emanzipation muss daher noch eine weitere Dimension haben: die des<br />
Handelns. Und Handeln bedeutet bei Arendt immer miteinander handeln – also weder<br />
gegeneinander noch füreinander handeln. Die reine Absicht des „für“ – die gute Tat – ist<br />
nicht das, was Arendt als die höchste Form der Freiheit, die sie den „Sinn von Politik“<br />
nennt, betrachtet: vielmehr ist es das „acting in concert“, die Erfahrung des Miteinander<br />
etwasBewirkens, etwas Neues zu beginnen, die Welt zu verändern.
Literatur<br />
Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte<br />
zu Kants politischer Philosophie.<br />
Hrsg. und mit einem Essay von Ronald<br />
Beiner. München & Zürich: Piper 1998.<br />
Dies.: Denktagebuch 1950 – 1973. Hrsg.<br />
von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann.<br />
New York & München: Piper 2002.<br />
Dies.: Ich will verstehen. Selbstauskünfte<br />
zu Leben und Werk. Hrsg. von Ursula<br />
Ludz. München & Zürich: Piper 1996.<br />
Dies.: Menschen in finsteren Zeiten.<br />
Hrsg. von Ursula Ludz. München &<br />
Zürich: Piper 1989 (Orig. 1968).<br />
Dies.: Über die Revolution. München &<br />
Zürich: Piper 1994 (Orig. 1963).<br />
Dies.: Vita activa. Vom tätigen Leben.<br />
München & Zürich: Piper 1981<br />
(Orig. 1958).<br />
Dies.: Vom Leben des Geistes. Das<br />
Denken. Das Wollen. Hrsg. von Mary<br />
McCarthy. München & Zürich: Piper 1981.<br />
Dies.: Was ist Politik? Fragmente aus<br />
dem Nachlass. Hrsg. von Ursula Ludz,<br />
Vorwort von Kurt Sontheimer.<br />
München & Zürich: Piper 2003.<br />
Dies.: Fernsehgespräch mit Günter Gaus.<br />
In: Hannah Arendt: Ich will verstehen.<br />
Selbstauskünfte zu Leben und Werk.<br />
Hrsg. von Ursula Ludz. München &<br />
Zürich: Piper 1996, S. 46–72.<br />
Dies.: Kultur und Politik. In: Hannah<br />
Arendt: Zwischen Vergangenheit und<br />
Zukunft. Übungen im politischen<br />
Denken I. Hrsg. von Ursula Ludz. München<br />
& Zürich: Piper 1994, S. 277–304.<br />
Dies.: Verstehen und Politik. In: Hannah<br />
Arendt: Zwischen Vergangenheit<br />
und Zukunft. Übungen im politischen<br />
Denken I. Hrsg. von Ursula Ludz. München<br />
& Zürich: Piper 1994, S. 110–127.<br />
Benhabib, Seyla: Hannah Arendt.<br />
Die melancholische Denkerin der<br />
Moderne. Hamburg: Rotbuch 1998.<br />
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft.<br />
Hrsg. von Wilhelm Weischedel.<br />
Werkausgabe X. Frankfurt/Main:<br />
Suhrkamp 1974.<br />
Scholem, Gershom: Briefe. Band II,<br />
1948–70. Hrsg. von Itta Shedletzky.<br />
München: Beck 1995.<br />
Trawny, Peter: Denkbarer Holocaust.<br />
Die politische Ethik Hannah Arendts.<br />
Würzburg: Königshausen & Neumann<br />
2005.<br />
Ders.: Verstehen und Urteilen.<br />
Hannah Arendts Interpretation der<br />
Kantischen „Urteilskraft“ als politischethische<br />
Hermeneutik. In: Zeitschrift für<br />
philosophische Forschung 60/2 (2006),<br />
S. 269–289.<br />
3 „Sorge um die Welt“ in Zeiten der Globalisierung?<br />
Aber ist dies in einer globalisierten Welt noch möglich? Können wir überhaupt noch<br />
handeln, etwas verändern, oder laufen nicht vielmehr einfach Prozesse ab (ökonomische<br />
Prozesse, Naturprozesse etc.), auf die nur mehr reagiert werden kann? Arendt hat<br />
diese Warnung schon vor mehr als fünfzig Jahren ausgesprochen: Es muss nicht immer<br />
nur der Totalitarismus sein, der der Welt ein einziges, unerbittliches Gesicht aufzwingt.<br />
Die ÖkoNomie (das Gesetz des Haushalts, also des Lebens) zwingt uns heute – mittlerweile<br />
in globalisierten Dimensionen – ebenso mit einer Notwendigkeit in eine Perspektive,<br />
die die vielen Perspektiven obsolet macht und uns schließlich vergessen lässt, das wir<br />
tatsächlich immer „neu beginnen“ könnten.<br />
Emanzipation ist in diesem Sinne auch Befreiung von der Notwendigkeit, oder besser:<br />
Befreiung von der Perspektive, in der uns gewisse Dinge als unabänderliche Notwendigkeiten<br />
erscheinen. Diese Perspektive nennt Arendt die des „animal laborans“ (des<br />
„arbeitenden Tiers/Lebewesens“), das in allem einen schnelllebigen Konsumartikel sieht<br />
und voll in die Prozesshaftigkeit des Erzeugens und Verzehrens eingespannt ist. Das<br />
moderne Leben der westlichkapitalistischen Massengesellschaften ist nach Arendt<br />
durch die Sichtweise des „Jobholders“ charakterisiert, dessen einzige individuelle<br />
Entscheidung nur noch darin liegt, die eigene Identität aufzugeben, um im Strom des<br />
Lebens automatisch zu funktionieren und die eigenen Empfindungen zu betäuben.<br />
Die Freizeit, die wir auf Kosten anderer gewinnen, macht uns nicht frei für das „Höhere“<br />
(wie Marx es hoffte), sondern „wird niemals für etwas anderes verbraucht als das<br />
Konsumieren, und je mehr Zeit [dem animal laborans] gelassen wird, umso begehrlicher<br />
und bedrohlicher werden seine Wünsche und sein Appetit“20. In dieser Haltlosigkeit<br />
liegt letztlich auch die Banalität des Bösen, die Arendt an anderer Stelle so prominent<br />
kritisiert hat. Denn es gehen darin die Fähigkeiten, die auf die Grundbedingung der<br />
Pluralität antworten, verloren, Urteilsmüdigkeit mündet in Urteilsenthaltung, das<br />
Handeln wird gegen das bloße „Verhalten“ eingetauscht und die Multiperspektivität der<br />
Welt auf einen stromlinienförmigen Lebens und Konsumerhaltungsprozess hin normiert.<br />
Arendt spricht von einem „Erfahrungsschwund“.<br />
Es klingt einfacher, als es ist, sich aus diesem Klima des Erfahrungsschwunds und der<br />
(pseudotoleranten) Indifferenz zu emanzipieren. Die Welt, in der wir leben, „macht<br />
etwas mit uns“, sie nistet sich in unsere tiefste Psyche ein, strukturiert und formiert<br />
unser Empfinden – und selbst das AufgestörtWerden gehört schon zu einer gewissen<br />
Routine, die immer noch stärker am affektiven und emotionalen Lautstärkeregler<br />
drehen muss. Politik und Medien arbeiten deshalb in unseren lustlosen Demokratien<br />
verstärkt und vorrangig – um noch einmal mit Kant zu sprechen – mit „Reiz und Rüh<br />
rung“21 und bedienen den „schmelzenden Affekt“22: womit eher geistige „Wüsten“23<br />
(Arendt) als konkrete Handlungs und Diskussionsräume erzeugt werden. Gleichzeitig<br />
wächst das Misstrauen in den öffentlichen politischen Raum als Ort der Verhandlung<br />
von Angelegenheiten, die alle betreffen. Je mehr Kommunikationsmöglichkeiten wir<br />
haben, umso mehr scheint der Raum der qualifizierten öffentlichen Kommunikation zu<br />
schrumpfen – oder aber auch sich grundlegend zu verändern. Die Frage, wie sich diese<br />
Veränderungen letztlich auf das Politische als das koinon (das Gemeinsame) in unseren<br />
Gesellschaften und auf der gesamten Erde auswirken wird, muss hier natürlich offenbleiben.<br />
Auf jeden Fall aber kann gesagt werden, dass sich der „öffentliche Raum“,<br />
so wie Arendt ihn sich vorstellte, durch Blog, Twitter und YouTube gründlich gewandelt<br />
hat und nicht immer nur eine unheilvolle Vermischung von „Privatem“ und „Öffentlichem“<br />
(falls dies jemals so genau trennbar war) erzeugt. Wir müssen und können uns<br />
daher auch innerhalb dieser Unentscheidbarkeiten bemühen, einen Urteils und Handlungsraum<br />
offenzuhalten, der wirklich ein Zwischen pluraler Perspektiven als „Welt“
102 — 103<br />
Sophie Loidolt<br />
24 Arendt, Verstehen und Politik,<br />
S. 126.<br />
25 Vgl. Trawny, Verstehen und<br />
Urteilen, S. 286 f.<br />
ermöglicht und nicht bloß die Illusion eines vernetzten Globus in endloser virtueller<br />
Bilderflut über die Bildschirme flimmern lässt.<br />
Dafür gilt es auch – um noch einmal auf die Arendt’sche Variante der Empathie zu<br />
kommen –, um ein „verstehendes Herz“ zu bitten, wie es König Salomon getan hat,<br />
dessen Geschichte Arendt in dem Aufsatz Verstehen und Politik mit Nachdruck zitiert.<br />
Das „verstehende Herz“ ist das „größte Geschenk, das ein Mensch erhalten und sich<br />
wünschen kann“: „Allein das menschliche Herz – von Sentimentalität gleich weit entfernt<br />
wie von allem Papierenen – ist in der Welt bereit, die Last zu tragen, welche die göttliche<br />
Gabe des Handelns, des EinAnfangSeins und deshalb des Fähigseins, einen<br />
Anfang zu machen, uns auferlegt hat.“24 Wir brauchen – so Arendt – die Urteilskraft<br />
mithilfe des verstehenden Herzens als ein Vermögen jenseits des „Kopfes“ und<br />
des „Bauches“, als ein Vermögen, das sich zwischen dem bloß Intellektuellen und dem<br />
bloß Emotionalen aufhält und im Verstehen nicht die Stärke zu handeln verliert.<br />
Dieses Verstehen darf vielmehr praktische Konsequenzen beanspruchen 25, gerade in<br />
einer Welt, in der wir nicht mehr selbstverständlich heimisch sind, die in ihrer Globalität<br />
vielmehr „unheimlich“ und wüstenhaft werden kann; eine Welt, in der die gängigen<br />
Kategorien und Maßstäbe, die alten Traditionen und metaphysischen Welt und<br />
Geschichtsbilder weggebrochen sind und/oder zunehmend global aufgebrochen werden.<br />
Die reflektie rende Urteilskraft und das verstehende Herz sind gerade da gefragt, wo<br />
wir ohne Geländer sind.
Vita activa oder<br />
Vom tätigen Leben<br />
Hannah Arendt
Erstes Kapitel<br />
Die menschliche Bedingtheit<br />
1 Vita activa und <strong>Condition</strong> humaine (Auszug)<br />
Nun umfaßt aber die <strong>Condition</strong> humaine, die menschliche Bedingtheit im Ganzen, mehr<br />
als nur die Bedingungen, unter denen den Menschen das Leben auf der Erde gegeben<br />
ist. Menschen sind bedingte Wesen, weil ein jegliches, womit sie in Be rührung kommen,<br />
sich unmittelbar in eine Bedingung ihrer Existenz verwandelt. Die Welt, in der die Vita<br />
activa sich be wegt, besteht im wesentlichen aus Dingen, die Gebilde von Menschenhand<br />
sind; und diese Dinge, die ohne den Menschen nie entstanden wären, sind<br />
wiederum Bedingung menschlicher Existenz. Die Menschen leben also nicht nur unter<br />
den Be dingungen, die gleichsam die Mitgift ihrer irdischen Existenz überhaupt darstellen,<br />
sondern darüber hinaus unter selbstge schaffenen Bedingungen, die ungeachtet<br />
ihres menschlichen Ursprungs die gleiche bedingende Kraft besitzen wie die<br />
bedin genden Dinge der Natur. Was immer menschliches Leben be rührt, was immer<br />
in es eingeht, verwandelt sich sofort in eine Bedingung menschlicher Existenz. Darum<br />
sind Menschen, was auch immer sie tun oder lassen, stets bedingte Wesen. Was in<br />
ihrer Welt erscheint, wird sofort ein Bestandteil der mensch lichen Bedingtheit. Die<br />
Wirk lichkeit der Welt macht sich inner halb menschlicher Existenz als die diese Existenz<br />
bedingende Kraft geltend und wird von ihr als solche empfunden. Die Ob jektivität<br />
der Welt – ihr Objekt- und Ding-Charakter – und die menschliche Bedingtheit ergänzen<br />
einander und sind aufeinan der eingespielt; weil menschliche Existenz bedingt ist,<br />
bedarf sie der Dinge, und die Dinge wären ein Haufen zusammen hangloser Gegenstände,<br />
eine Nicht-Welt, wenn nicht jedes Ding für sich und alle zusammen mensch liche<br />
Existenz bedin gen würden.<br />
Um Mißverständnisse zu vermeiden: die Rede von der Bedingtheit der Menschen und<br />
Aussagen über die „Natur“ des Menschen sind nicht dasselbe. Auch die Gesamtsum me<br />
menschlicher Tätigkeiten und Fähigkeiten, insofern sie menschlichen Bedingtheiten<br />
entsprechen, stellt nicht so etwas wie eine Beschreibung der Menschennatur dar.<br />
Selbst wenn wir das, was wir hier ausdrücklich auslassen, die Tätigkeit des Den kens<br />
und die Fähigkeit der Vernunft, mit in unsere Erörterung hineinnehmen würden, ja<br />
selbst wenn es einem gelingen sollte, ein peinlich genaues Verzeichnis aller menschlichen<br />
Mög lichkeiten, wie sie uns heute vorliegen, anzufertigen, so wären damit die<br />
wesentlichen Charaktere menschlicher Existenz kei neswegs erschöpft, nicht einmal<br />
im negativen Verstande, als hätte man nun wenigstens gefunden, was menschliche<br />
Existenz schlechterdings nicht entbehren dürfe, ohne aufzuhören, menschlich zu sein.<br />
Die radikalste Veränderung in der mensch lichen Bedingtheit, die wir uns vorstellen<br />
können, wäre eine Abwanderung auf einen anderen Planeten, und diese Vorstel lung<br />
ist ja heute keineswegs mehr eine müßige Phantasie. Dies würde heißen, daß die<br />
Menschen ihr Leben den irdisch-gegebe nen Bedingungen ganz und gar entziehen und<br />
es gänzlich unter Bedingungen stellen, die sie selbst geschaffen haben. Der Erfahrungshorizont<br />
eines solchen Lebens wäre vermutlich so ra dikal geändert, daß das, was wir<br />
unter Arbeiten, Herstellen, Handeln, Denken verstehen, in ihm kaum noch einen Sinn<br />
ergäbe. Und doch kann man kaum leugnen, daß selbst diese hypothetischen planetaren<br />
Auswanderer noch Menschen blie ben; aber die einzige Aussage, die wir über ihre<br />
Menschennatur machen könnten, wäre, daß sie immer noch bedingte Wesen sind, wiewohl<br />
unter solchen Verhältnissen die mensch liche Bedingtheit nahezu ausschließlich<br />
das Produkt von Men schen selbst wäre.<br />
Im Gegensatz zur Bedingtheit des Menschen, über die wir, wenn auch noch so unzureichende,<br />
Aussagen machen können, scheint das Problem des Wesens des Menschen, das<br />
Augustini sche quaestio mihi factus sum – „ich bin mir selbst zu einer Frage geworden“ –,
106 — 107<br />
Autor<br />
2 Augustin, dem gewöhnlich<br />
zugeschrieben wird, die sog.<br />
anthropologische Frage in die<br />
Philosophie eingeführt zu haben,<br />
kannte diese Unterschiede und<br />
Schwierigkeiten sehr gut. Er unterschied<br />
zwischen den Fragen<br />
„Wer bin ich?“ und „Was bin ich?“;<br />
die erste richtete der Mensch an<br />
sich selbst – „Und ich wandte mich<br />
an mich selbst und sprach zu mir:<br />
Du, wer bist Du? (tu, quis es?)<br />
Und ich antwortete: Ein Mensch«<br />
(Confessiones, X, 6). Die zweite<br />
Frage aber richtet der Mensch<br />
an Gott: „Was also bin ich,<br />
mein Gott? Was ist mein Wesen?“<br />
(Quid ergo sum, Deus meus?<br />
Quae natura sum? ib. X, 17).<br />
Denn in dem grande profundum,<br />
das der Mensch ist (IV, 14), gibt<br />
es „etwas Menschliches (aliquid<br />
hominis), von dem der Geist des<br />
Menschen, der in ihm ist, nichts<br />
weiß. Nur Du, o Herr, der Du<br />
ihn geschaf fen hast, weißt alles<br />
von ihm (eius omnia)“ (X, 5).<br />
Dementsprechend ist der bekannteste<br />
dieser Aussprüche, den ich<br />
im Text zitiere, das quaestio mihi<br />
factus sum, eine in der Gegenwart<br />
Gottes erhobene und eigentlich<br />
an ihn gerichtete Frage (X, 33),<br />
die auch nur Gott beantworten<br />
kann. Was die Antworten anlangt,<br />
so kann man in Kürze sagen, daß<br />
das „Wer bin ich?“ mit dem: Ein<br />
Mensch, was immer das sein mag,<br />
zu beantworten ist, während die<br />
Frage „Was bin ich“ überhaupt nur<br />
von Gott zu beantworten ist, der<br />
den Menschen geschaffen hat.<br />
Mit anderen Worten, die Frage<br />
nach dem Wesen des Menschen<br />
ist genau so eine theolo gische<br />
Frage wie die Frage nach dem<br />
Wesen Gottes; beide können nur<br />
im Rahmen einer göttlichen Offenbarung<br />
beantwortet werden.<br />
unlösbar, wobei es sogar gleichgültig ist, ob man diese Frage individualpsychologisch<br />
oder allgemein philosophisch versteht. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß wir, die wir<br />
das Wesen der Dinge, die uns umgeben und die wir nicht sind, also das Wesen irdischer<br />
und vielleicht einiger Dinge in dem die Erde umgebenden Universum, erkennen, bestimmen<br />
und definieren können, auch das Gleiche für uns selbst zu leisten imstande sind –<br />
als könnten wir wirklich über unseren eigenen Schatten springen. Zudem berechtigt<br />
uns nichts zu der Annahme, daß der Mensch überhaupt ein Wesen oder eine Na tur im<br />
gleichen Sinne besitzt wie alle anderen Dinge. Sofern es aber wirklich so etwas wie<br />
ein Wesen des Menschen geben sollte, so ist zweifellos, daß nur ein Gott es erkennen<br />
und defi nieren könnte, weil nur ein Gott vielleicht imstande ist, über ein „Wer“ in dem<br />
gleichen Sinne Aussagen zu machen wie über ein „Was“.2 Die Formen menschlicher<br />
Erkenntnis sind an wendbar auf alles, was „natürliche“ Eigenschaften hat, und so mit<br />
auch auf uns selbst, insofern die Menschen Exemplare der höchst entwickelten Gattung<br />
organischen Lebens sind; aber diese gleichen Erkenntnisformen versagen, sobald wir<br />
nicht mehr fragen: Was sind wir, sondern: Wer sind wir. Dies Versa gen ist der eigentliche<br />
Grund, warum die Versuche, das Wesen des Menschen zu bestimmen, zumeist mit<br />
irgendwelchen Kon struktionen eines Göttlichen enden, eines Philosophengottes, der<br />
sich bei näherem Zusehen immer als eine Art Urmodell oder platonische Idee vom Menschen<br />
enthüllt. Selbstverständ lich ist die Demaskierung solch philosophischer Begriffe<br />
vom Göttlichen als eine Vergöttlichung menschlicher Fähigkeiten und Tätigkeiten kein<br />
Beweis, nicht einmal ein Argument, für die Nichtexistenz Gottes. Aber die Tatsache, daß<br />
Versuche, das Wesen des Menschen zu bestimmen, so leicht zu Vorstel lungen führen,<br />
die uns nur deshalb als ‚göttlich‘ anmuten, weil sie offenbar Übersteigerungen eines<br />
Menschlichen beinhalten, dürfte uns vielleicht doch argwöhnisch gegen den Versuch<br />
machen, das Wesen des Menschen begrifflich zu bestimmen.<br />
Andererseits können die Bedingungen menschlicher Exi stenz – das Leben selbst und<br />
die Erde, Natalität und Mortalität, Weltlichkeit und Pluralität – niemals „den Menschen“<br />
erklären oder Antwort auf die Frage geben, was und wer wir sind, und zwar aus dem<br />
einfachen Grunde, weil keine von ihnen absolut bedingt. Dies war immer die Ansicht der<br />
Philosophie im Unter schied zu den Wissenschaften, Anthropologie, Psychologie, Biologie<br />
usw., die sich auch mit dem Menschen befassen. Aber heute könnte man fast<br />
sagen, daß es wissenschaftlich erwiesen ist, daß die Menschen, wiewohl sie unter den<br />
Bedingungen der Erde leben und wahrscheinlich immer unter ihnen leben wer den, doch<br />
keineswegs im gleichen Sinne erdgebundene Kreatu ren sind wie alle anderen Lebewesen.<br />
Dankt doch die moderne Naturwissenschaft ihre außerordentlichen Triumphe dem,<br />
daß sie ihren Blickpunkt geändert hat und auf die erdgebundene Natur so blickt und sie<br />
so behandelt, als ob sie gar nicht mehr auf der Erde, sondern im Universum lokalisiert<br />
wäre, als ob es ihr gelungen wäre, den archimedischen Punkt nicht nur zu fin den, sondern<br />
sich auf ihn auch zu stellen und von ihm aus zu operieren.<br />
Fünftes Kapitel<br />
Das Handeln<br />
All sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them.<br />
lsak Dinesen<br />
Nam in omni actione principaliter intenditur ab agente, sive necessitate naturae<br />
sive voluntarie agat, propriam similitudinem explicare; unde fit quod omne agens, in<br />
quantum huiusmodi, delectatur, quia, cum omne quod est appetat suum esse, ac in<br />
agendo agentis esse modammodo amplietur, sequitur de ne cessitate delectation. ...<br />
Nihil igitur agit nisi tale exi stens quale patiens fieri debet.<br />
Dante
24 Die Enthüllung der Person im Handeln und Sprechen<br />
Das Faktum menschlicher Pluralität, die grundsätzliche Bedingung des Handelns wie<br />
des Sprechens, manifestiert sich auf zweierlei Art, als Gleichheit und als Verschiedenheit.<br />
Ohne Gleichartigkeit gäbe es keine Verständigung unter Lebenden, kein Verstehen<br />
der Toten und kein Planen für eine Welt, die nicht mehr von uns, aber doch immer noch<br />
von unseresgleichen bevölkert sein wird. Ohne Verschiedenheit, das absolute Unterschiedensein<br />
jeder Person von jeder anderen, die ist, war oder sein wird, bedürfte es<br />
weder der Sprache noch des Han delns für eine Verständigung; eine Zeichen- und Lautsprache<br />
wäre hinreichend, um einander im Notfall die allen gleichen, immer identisch<br />
bleibenden Bedürfnisse und Notdürfte anzu zeigen.<br />
Verschiedenheit und Besonderheit sind nicht dasselbe. Be sonderheit oder Andersheit,<br />
diese merkwürdige Eigenschaft der ‚alteritas‘, die allem Seienden als solchem eignet<br />
und die daher von der mittelalterlichen Philosophie zu den Universalien gezählt wurde,<br />
kennzeichnet zwar Pluralität überhaupt und ist der Grund dafür, daß wir nur definieren<br />
können, indem wir unterscheiden, daß jede Bestimmung eine Negation, ein Anders-als<br />
mitaussagt; aber diese allgemeinste Besonderheit, die anzeigt, daß wir Seiendes überhaupt<br />
nur im Plural erfahren, differenziert sich bereits in der Mannigfaltigkeit des organischen<br />
Lebens, dessen primitivste Formen Variationen und Verschiedenheiten aufweisen,<br />
die über das schiere Anderssein hinausgehen. Unter ihnen wiederum ist es nur dem<br />
Menschen eigen, diese Verschiedenheit aktiv zum Ausdruck zu bringen, sich selbst von<br />
Anderen zu unterscheiden und eventuell vor ih nen auszuzeichnen, und damit schließlich<br />
der Welt nicht nur etwas mitzuteilen – Hunger und Durst, Zuneigung oder Abnei gung<br />
oder Furcht –, sondern in all dem auch immer zugleich sich selbst. Im Menschen wird die<br />
Besonderheit, die er mit al lem Seienden teilt, und die Verschieden heit, die er mit allem<br />
Lebendigen teilt, zur Einzigartigkeit, und menschliche Plura lität ist eine Vielheit, die die<br />
paradoxe Eigenschaft hat, daß jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist.<br />
Sprechen und Handeln sind die Tätigkeiten, in denen diese Einzigartigkeit sich darstellt.<br />
Sprechend und handelnd unter scheiden Menschen sich aktiv voneinander, anstatt<br />
lediglich verschieden zu sein; sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst<br />
offenbart. Dies aktive In-Erscheinung-Tre ten eines grundsätzlich einzigartigen Wesens<br />
beruht, im Unterschied von dem Erscheinen des Menschen in der Welt durch Geburt,<br />
auf einer Initiative, die er selbst ergreift, aber nicht in dem Sinne, daß es dafür eines<br />
besonderen Entschlusses be dürfte; kein Mensch kann des Sprechens und des Handelns<br />
ganz und gar entraten, und dies wiederum trifft auf keine an dere Tätigkeit der Vita<br />
activa zu. Die Arbeit mag noch so cha rakteristisch für den menschlichen Stoffwechsel<br />
mit der Natur sein, das besagt nicht, daß jeder Mensch auch arbeiten müßte; er kann<br />
sehr gut andere zwingen, für ihn zu arbeiten, ohne daß seinem Menschsein darum<br />
Abbruch geschähe. Und genau das gleiche gilt für das Herstellen, sofern man sehr wohl<br />
die Welt der Dinge benutzen und genießen kann, ohne je selbst auch nur ein einziges<br />
nützliches Ding hergestellt und ihrem vielfältigen Reichtum hinzugefügt zu haben.<br />
Das Leben eines Sklavenhal ters, eines Ausbeuters, oder eines Parasiten mag moralisch<br />
an fechtbar sein, es ist immer noch eine spezifisch menschliche Weise zu existieren.<br />
Ein Leben ohne alles Sprechen und Han deln andererseits – und dies wäre im Ernst die<br />
einzige Lebens weise, die auf den Schein und die Eitelkeit der Welt im bibli schen Sinne<br />
des Wortes verzichtet hätte – wäre buchstäblich kein Leben mehr, sondern ein in<br />
die Länge eines Menschenle bens gezogenes Sterben; es würde nicht mehr in der Welt<br />
unter Menschen erscheinen, sondern nur als ein Dahinschwindendes sich überhaupt<br />
bemerkbar machen; wir wüßten von ihm nicht mehr als wir, die Lebenden, von denen<br />
wissen, die in den Tod schwinden, den wir nicht kennen.<br />
Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte,<br />
bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in
108 — 109<br />
Autor<br />
1 Daß es sich so verhält, scheint<br />
nun auch durch Forschungsergebnisse<br />
in der Biologie und<br />
Psychologie bestätigt zu werden,<br />
welche die innere Verwandtschaft<br />
von Handeln und Sprechen<br />
betonen sowie eine Spontaneität,<br />
die von praktischen Anlässen und<br />
Zwecken ganz unabhängig ist. Sehr<br />
interessant in dieser Hinsicht ist<br />
Arnold Gehlen, Der Mensch: Seine<br />
Natur und seine Stel lung in der<br />
Welt (1955), in dem man eine gute<br />
Zusammenfassung der neue ren<br />
Forschung findet. Daß Gehlens<br />
Interpretation mit den Biologen<br />
an nimmt, daß diese spezifisch<br />
menschlichen Fähigkeiten einer<br />
„biologischen Notwendigkeit“ entsprächen,<br />
nämlich der Tatsache,<br />
daß der menschliche Körper biologisch<br />
schlechter ausgestattet ist<br />
als der Körper der anderen Tiergattungen,<br />
ist natürlich eine „Theorie“,<br />
die uns hier nicht zu kümmern<br />
braucht und die auch den Wert<br />
einer Fülle wertvoller Einsichten<br />
bei Gehlen nicht beeinträchtigt.<br />
2 De Civitate Dei XII, 20.<br />
3 Diese beiden „Anfänge“, der<br />
Anfang der Welt und der Anfang<br />
des Men schen, waren für Augustin<br />
so wenig miteinander identisch,<br />
daß er zwei ganz verschiedene<br />
Worte brauchte, um sie zu<br />
bezeichnen und zu unterscheiden.<br />
Der Anfang, der der Mensch ist,<br />
heißt bei ihm initium, während<br />
er für den Anfang der Welt die<br />
lateinische Bibelübersetzung<br />
übernimmt, die das erste Wort der<br />
Bibel „Im Anfang“ mit principium<br />
übersetzt. Wie wir aus Civ. Dei XI,<br />
32, entnehmen können, hatte das<br />
Wort principium für Augustin eine<br />
sehr viel weniger radikale Bedeutung:<br />
er erläutert das „ln principio<br />
fecit Deus coelum et terram“ wie<br />
folgt: illud quod dictum est In<br />
principio, not ita dictum tamquam<br />
primum hoc factum sit, cum ante<br />
fecerit Angelos. Wäh rend es also<br />
vor der Erschaffung der Welt nicht<br />
etwa Nichts gab, gab es vor der<br />
Erschaffung des Jemand, der der<br />
Mensch ist, buchstäblich Niemand.<br />
der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung<br />
dafür auf uns nehmen. Aber wiewohl nie mand sich diesem Minimum an Initiative ganz<br />
und gar entzie hen kann, so wird sie doch nicht von irgendeiner Notwendig keit erzwungen<br />
wie das Arbeiten, und sie wird auch nicht aus uns gleichsam hervorgelockt durch den<br />
Antrieb der Leistung und die Aussicht auf Nutzen. Die Anwesenheit von Anderen,<br />
denen wir uns zugesellen wollen, mag in jedem Einzelfall als ein Stimulans wirken, aber<br />
die Initiative selbst ist davon nicht be dingt; der Antrieb scheint vielmehr in dem Anfang<br />
selbst zu liegen, der mit unserer Geburt in die Welt kam, und dem wir dadurch entsprechen,<br />
daß wir selbst aus eigener Initiative etwas Neues anfangen.1 In diesem ursprünglichsten<br />
und allge meinsten Sinne ist Handeln und etwas Neues Anfangen das selbe;<br />
jede Aktion setzt vorerst etwas in Bewegung, sie agiert im Sinne des lateinischen agere,<br />
und sie beginnt und führt etwas an im Sinne des griechischen ὰρχειν. Weil jeder<br />
Mensch auf Grund des Geborenseins ein initium, ein Anfang und Neuan kömmling in der<br />
Welt ist, können Menschen Initiative ergrei fen, Anfänger werden und Neues in Bewegung<br />
setzen. [In itium] ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit – „damit ein<br />
Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, vor dem es niemand gab“2 – in den Worten<br />
Augustins, der mit diesem einen Satz seiner politischen Philosophie in der ihm manchmal<br />
eigenen tiefsinnig-apodiktischen Weise den Grund der Lehre Jesu von Nazareth<br />
mit dem Erfahrungshintergrund römischer Geschichte und Politik schlagartig verbindet.<br />
Dieser Anfang, der der Mensch ist, insofern er Jemand ist, fällt keinesfalls mit der<br />
Erschaffung der Welt zusammen;3 das, was vor dem Men schen war, ist nicht Nichts,<br />
sondern Niemand; seine Erschaf fung ist nicht der Beginn von etwas, das, ist es erst<br />
einmal er schaffen, in seinem Wesen da ist, sich entwickelt, andauert oder auch vergeht,<br />
sondern das Anfangen eines Wesens, das selbst im Besitz der Fähigkeit ist anzufangen:<br />
es ist der Anfang des Anfangs oder des Anfangens selbst. Mit der Erschaffung des<br />
Menschen erschien das Prinzip des Anfangs, das bei der Schöpfung der Welt noch<br />
gleichsam in der Hand Gottes und damit außerhalb der Welt verblieb, in der Welt selbst<br />
und wird ihr immanent bleiben, solange es Menschen gibt; was natürlich letztlich<br />
nichts anderes sagen will, als daß die Erschaffung des Menschen als eines Jemands<br />
mit der Erschaffung der Freiheit zusammenfällt.<br />
Es liegt in der Natur eines jeden Anfangs, daß er, von dem Gewesenen und Geschehenen<br />
her gesehen, schlechterdings unerwartet und unerrechenbar in die Welt bricht.<br />
Die Unvorhersehbarkeit des Ereignisses ist allen Anfängen und allen Ur sprüngen inhärent.<br />
Die Entstehung der Erde, des organischen Lebens auf ihr, die Entwicklung des<br />
Menschengeschlechts aus den Evolutionen der Tiergattungen, also der gesamte Rahmen<br />
unserer realen Existenz, beruht auf „unendlichen Unwahr scheinlichkeiten“, wenn man<br />
die Urereignisse, die diesen Rah men einst gebildet haben, vom Standpunkt der Vorgänge<br />
im Universum oder der Ablaufprozesse des Anorganischen oder der Entwicklungsprozesse<br />
des organischen Lebens sieht, wel che durch jedes dieser Ereignisse jeweils<br />
entscheidend unterbrochen werden. Der Neuanfang steht stets im Widerspruch zu<br />
statis tisch erfaßbaren Wahrscheinlichkeiten, er ist immer das unendlich Unwahrscheinliche;<br />
er mutet uns daher, wo wir ihm in lebendiger Erfahrung begegnen – das heißt,<br />
in der Erfahrung des Lebens, die vorgeprägt ist von den Prozeßabläufen, die ein<br />
Neu anfang unterbricht –, immer wie ein Wunder an. Die Tat sache, daß der Mensch zum<br />
Handeln im Sinne des Neuanfan gens begabt ist, kann daher nur heißen, daß er sich<br />
aller Abseh barkeit und Berechenbarkeit entzieht, daß in diesem einen Fall das Unwahrscheinliche<br />
selbst noch eine gewisse Wahrschein lichkeit hat, und daß das, was „rational“,<br />
d.h. im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft<br />
werden darf. Und diese Begabung für das schlechthin Unvorhersehbare wiederum<br />
beruht ausschließlich auf der Ein zigartigkeit, durch die jeder von jedem, der war, ist<br />
oder sein wird, geschieden ist, wobei aber diese Einzigartigkeit nicht so sehr ein<br />
Tatbestand bestimmter Qualitäten ist oder der einzig artigen Zusammensetzung bereits
4 Da Sprechen und Enthüllen<br />
oder, wie Heidegger sagt, „Entbergen“,<br />
näher miteinander verwandt<br />
sind als Handeln und Enthüllen,<br />
meint Plato, daß die Rede – λέξις –<br />
mehr mit Wahrheit (in Heideggers<br />
Sinn der „Unverborgen heit“) zu tun<br />
habe als Handeln - πρᾶξις.<br />
bekannter Qualitäten in einem „Individuum“ entspricht, sondern vielmehr auf dem al les<br />
menschliche Zusammensein begründenden Faktum der Na talität beruht, der Gebürtlichkeit,<br />
kraft deren jeder Mensch einmal als ein einzigartig Neues in der Welt erschienen<br />
ist. We gen dieser Einzigartigkeit, die mit der Tatsache der Geburt ge geben ist, ist es,<br />
als würde in jedem Menschen noch einmal der Schöpfungsakt Gottes wiederholt und<br />
bestätigt; will man den Jemand, der einzigartig in jedem neuen Menschen in die Welt<br />
kommt, bestimmen, so kann man nur sagen, daß es in bezug auf ihn vor seiner Geburt<br />
„Niemand“ gab. Handeln als Neuanfan gen entspricht der Geburt des Jemand, es<br />
realisiert in jedem Einzelnen die Tatsache des Geborenseins; Sprechen wiederum entspricht<br />
der in dieser Geburt vorgegebenen absoluten Ver schiedenheit, es realisiert<br />
die spezifisch menschliche Pluralität, die darin besteht, daß Wesen von einzigartiger<br />
Verschieden heit sich von Anfang bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen<br />
befinden.<br />
Handeln und Sprechen sind so nahe miteinander verwandt, weil das Handeln der<br />
spezifisch menschlichen Lage, sich in einer Vielheit einzigartiger Wesen als unter seinesgleichen<br />
zu bewegen, nur entsprechen kann, wenn es eine Antwort auf die Frage<br />
bereithält, die unwillkürlich jedem Neuankömm ling vorgelegt wird, auf die Frage: Wer<br />
bist Du? Aufschluß darüber, wer jemand ist, geben implizite sowohl Worte wie Taten;<br />
aber so wie der Zusammenhang zwischen Handeln und Beginnen enger ist als der<br />
zwischen Sprechen und Beginnen, so sind Worte offenbar besser geeignet, Aufschluß<br />
über das Wer-einer-ist zu verschaffen, als Taten.4 Taten, die nicht von Reden begleitet<br />
sind, verlieren einen großen Teil ihres Offen barungscharakters, sie werden „unverständlich“,<br />
und ihr Zweck ist gemeinhin, durch Unverständlichkeit zu schockieren oder, wie<br />
wir sagen können, durch die Schaffung vollendeter Tatsachen alle Möglichkeiten<br />
einer Verständigung zu sabotie ren. Als solche sind sie natürlich verständlich, sie lehnen<br />
das Reden und Sprechen ab, und ihre Verständlichkeit ist der Ab lehnung geschuldet;<br />
was wir verstehen, ist gerade die zur Schau getragene Stummheit. Gäbe es darüber<br />
hinaus wirklich ein prinzipiell wortloses Handeln, so wäre es, als hätten die aus ihm<br />
resultierenden Taten auch das Subjekt des Handelns, den Han delnden selbst, verloren;<br />
nicht handelnde Menschen, sondern Roboter würden vollziehen, was für Menschen<br />
prinzipiell un verständlich bleiben müßte. Wortloses Handeln gibt es streng genommen<br />
überhaupt nicht, weil es ein Handeln ohne Han delnden wäre; „beides, beredt in Worten<br />
zu sein und rüstig in Taten“ gehört zusammen, weil es keinen eigentlichen Täter der<br />
Taten – πρηκτήρ τε ἔργων – gäbe, würde ihn nicht gleichzeitig der Sprecher der<br />
Worte – μύθων τε ῥητήρ – offenbar machen (Bias IX, 445). Erst durch das gesprochene<br />
Wort fügt sich die Tat in einen Bedeutungszusammenhang, wobei aber die<br />
Funk tion des Sprechens nicht etwa die ist, zu erklären, was getan wurde, sondern das<br />
Wort vielmehr den Täter identifiziert und verkündet, daß er es ist, der handelt, nämlich<br />
jemand, der sich auf andere Taten und Entschlüsse berufen kann und sagen, was er<br />
weiterhin zu tun beabsichtigt.<br />
Es gibt keine menschliche Verrichtung, welche des Wortes in dem gleichen Maße bedarf<br />
wie das Handeln. Für alle anderen Tätigkeiten spielen Worte eine untergeordnete Rolle;<br />
sie dienen lediglich der Information oder begleiten einen Leistungs vorgang, der auch<br />
schweigend vonstatten gehen könnte. Zwar ist die Sprache durchschnittlich ein durchaus<br />
adäquates Mittel für Informationszwecke, aber sie könnte als solche auch durch<br />
eine Zeichensprache ersetzt werden, die zweckentsprechender wäre; in der Mathematik<br />
und anderen Wissenschaften, aber auch bei bestimmten Kollektivarbeiten, werden<br />
solche Zeichensprachen dauernd verwandt, und zwar einfach, weil die natürliche Sprache<br />
sich als zu umständlich für ihre Zwecke er weist. Der Umstand, der sie so umständlich<br />
macht, ist die Per son, die in ihr mitspricht. Im gleichen Sinne könnte man sagen,<br />
daß die Fähigkeit des Handelns durchaus für Zwecke der Selbstverteidigung oder zum<br />
Verfolgen bestimmter Interessen adäquat ist; stände aber nicht mehr auf dem Spiel,
110 — 111<br />
Autor<br />
als durch Handeln bestimmte Zwecke zu erreichen, so könnten solche Zwecke offenbar<br />
noch erheblich besser und schneller mit Hilfe stummer Gewaltmittel erreicht werden.<br />
Vom Standpunkt des bloßen Nutzens ist Handeln nur Ersatz für die Anwendung von<br />
Gewalt, die sich immer als wirksamer erweist, so wie das Spre chen vom Standpunkt der<br />
bloßen Information eine Art von Notbehelf ist, mit dem man sich nur so lange abfindet,<br />
als eine Zeichensprache nicht erfunden ist.<br />
Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv<br />
die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt,<br />
auf der sie vorher so nicht sichtbar waren, solange nämlich, als ohne ihr eigenes Zutun<br />
nur die einmalige Gestalt ihres Körpers und der nicht weniger einmalige Klang der<br />
Stimme in Erscheinung tra ten. Im Unterschied zu dem, was einer ist, im Unterschied zu<br />
den Eigenschaften, Gaben, Talenten, Defekten, die wir besit zen und daher so weit zum<br />
mindesten in der Hand und unter Kontrolle haben, daß es uns freisteht, sie zu zeigen<br />
oder zu verbergen, ist das eigentlich personale Wer-jemand-jeweilig-ist unserer Kontrolle<br />
darum entzogen, weil es sich unwillkürlich in allem mitoffenbart, was wir sagen<br />
oder tun. Nur vollkommenes Schweigen und vollständige Passivität können dieses Wer<br />
viel leicht zudecken, den Ohren und Augen der Mitwelt entziehen, aber keine Absicht<br />
der Welt kann über es frei verfügen, ist es erst einmal in Erscheinung getreten. Es ist<br />
im Gegenteil sehr viel wahrscheinlicher, daß dies Wer, das für die Mitwelt so un miß verständlich<br />
und eindeutig sich zeigt, dem Zeigenden selbst gerade und immer verborgen<br />
bleibt, als sei es jener δαίμων der Griechen, der den Menschen zwar sein Leben lang<br />
begleitet, ihm aber immer nur von hinten über die Schulter blickt und daher nur denen<br />
sichtbar wird, denen der Betreffende begeg net, niemals ihm selbst.<br />
Diese Aufschluß-gebende Qualität des Sprechens und Han delns, durch die, über das<br />
Besprochene und Gehandelte hin aus, ein Sprecher und Täter mit in die Erscheinung<br />
tritt, kommt aber eigentlich nur da ins Spiel, wo Menschen miteinander, und weder<br />
für- noch gegeneinander, sprechen und agieren. Weder die tätige und zuweilen sehr<br />
tatkräftige Güte, vor deren Selbst losigkeit die Mitwelt nur im Modus eines Füreinander<br />
er scheint, in dem sich gleichsam jeder vor jedem versteckt, noch das Verbrechen, das<br />
sich gegen die anderen stellt und vor ihnen sich verbergen muß, können riskieren, den<br />
jeweiligen Jemand, das Subjekt des Handelns und Sprechens, zu enthüllen, und zwar<br />
unter anderem auch darum, weil niemand weiß, wen er eigentlich offenbart, wenn er<br />
im Sprechen und Handeln sich selbst unwillkürlich mitoffenbart. Dies Risiko, als ein<br />
Jemand im Miteinander in Erscheinung zu treten, kann nur auf sich nehmen, wer bereit<br />
ist, in diesem Miteinander auch künftig zu existieren, und das heißt bereit ist, im<br />
Miteinander unter sei nesgleichen sich zu bewegen, Aufschluß zu geben darüber, wer er<br />
ist, und auf die ursprüngliche Fremdheit dessen, der durch Geburt als Neuankömmling<br />
in die Welt gekommen ist, zu ver zichten. Diesen Verzicht aber kann sich weder das<br />
Für- noch das Gegeneinander leisten; die Tatkraft der Güte wie des Ver brechens entspringen<br />
einer Distanz, in der die ursprüngliche Fremdheit des durch Geburt in die Welt<br />
Gekommenseins fest gehalten wird, wobei es in unserem Zusammenhang gleichgül tig<br />
ist, daß diese Fremdheit in dem einen Fall sich im Selbstop fer und im anderen in einer<br />
absoluten Selbstsucht realisiert. Vom Standpunkt des Miteinander handelt es sich in<br />
beiden Fäl len um Phänomene der Verlassenheit, die gewissermaßen nur am Rande des<br />
Bereichs menschlicher Angelegenheiten er scheinen dürfen, soll dieser Bereich nicht<br />
zerstört werden, also um Randerscheinungen des Politischen, die in ihm geschicht lich<br />
wirksam nur in Zeiten des Untergangs, des Verfalls und der politischen Korruption werden.<br />
In solchen Zeiten verdunkelt sich der Bereich der menschlichen Angelegenheiten;<br />
er verliert die strahlende, Ruhm stiftende Helle, die nur dem Öffentlichen, das sich im<br />
Miteinander der Menschen konstituiert, eig net, und die unerläßlich ist, soll Handeln<br />
und Sprechen sich voll entfalten, d.h. über das Gehandelte und Besprochene hinaus die<br />
Handelnden und Sprechenden mit in Erscheinung treten lassen. In diesem Zwielicht,
5 William Faulkners Legende<br />
zeichnet sich nicht nur durch die<br />
Qualität vor der Nachkriegsliteratur<br />
des Ersten Weltkrieges aus,<br />
sondern auch dadurch, daß sie der<br />
erste Roman ist, dessen Verfasser<br />
offenbar verstanden hat, warum<br />
dieser Krieg so furchtbar war, und<br />
daher den Unbekannten Soldaten<br />
zum Helden des Geschehens<br />
machte.<br />
in dem niemand mehr weiß, wer einer ist, fühlen Menschen sich fremd, nicht nur in der<br />
Welt, sondern auch untereinander; und in der Stimmung der Fremd heit und Verlassenheit<br />
gewinnen die Gestalten der Fremdlinge unter den Menschen, die Heiligen und die<br />
Verbrecher, ihre Chance.<br />
Ohne diese Eigenschaft, über das Wer der Person mit Auf schluß zu geben, wird das<br />
Handeln zu einer Art Leistung wie andere gegenstandsgebundene Leistungen auch. Es<br />
kann dann in der Tat einfach Mittel zum Zweck werden, so wie Herstellen ein Mittel<br />
ist, einen Gegenstand hervorzubringen. Dies tritt im mer dann ein, wenn das eigentliche<br />
Miteinander zerstört ist oder auch zeitweilig zurücktritt und Menschen nur für- oder<br />
gegeneinander stehen und agieren, wie etwa im Kriegsfall, wenn Handeln nur besagt,<br />
bestimmte Gewaltmittel bereitzu stellen und zur Anwendung zu bringen, um gewisse,<br />
vorgefaßte Ziele für sich selbst und gegen den Feind zu erreichen. In sol chen Fällen,<br />
von denen die Geschichte der Menschheit so viel zu erzählen weiß, daß man sie lange<br />
Zeit für die eigentliche Substanz des Geschichtlichen überhaupt hielt, ist Sprechen in<br />
der Tat „bloßes Gerede“, nämlich ein Mittel unter anderen für die Erreichung des Zweckes,<br />
ob dies Mittel nun dazu dient, dem Feind Sand in die Augen zu streuen, oder dazu,<br />
sich selbst an der eigenen Propaganda zu berauschen. Das Reden ist hier bloßes Gerede,<br />
weil es überhaupt über nichts mehr Aufschluß gibt, also dem eigentlichen Sinn des<br />
Sprechens geradezu zuwi derläuft; aber auch das eigentliche Handeln mit Waffengewalt,<br />
bei der ja dann die Entscheidung liegt, vollzieht sich so, daß die einmalige Identität der<br />
Handelnden selbst in ihm keine Rolle mehr spielt; der Sieg oder die Niederlage sind,<br />
jedenfalls im modernen Krieg, Leistungen positiver oder negativer Art, und sie sagen über<br />
Sieger und Besiegte nicht mehr aus als andere Leistungen auch.<br />
Was dem Handeln in diesen Fällen verlorengegangen ist, ist gerade die Eigenschaft,<br />
durch welche es alle im eigentlichen Sinne produktiven und herstellenden Tätigkeiten<br />
übersteigt, die von der einfachsten Verfertigung von Gebrauchsgegenstän den bis zu<br />
dem transfigurierenden Erstellen von Kunstwerken nur so viel offenbaren, als sich in<br />
dem vollendeten Gegenstand zeigt, das heißt ihrem Wesen nach gar nicht intendieren,<br />
mehr zu zeigen, als nach Beendigung des Herstellungsprozesses für alle sichtbar<br />
vorliegt. Handeln, das in der Anonymität ver bleibt, eine Tat, für die kein Täter namhaft<br />
gemacht werden kann, ist sinnlos und verfällt der Vergessenheit; es ist niemand da,<br />
von dem man die Geschichte erzählen könnte. Ein Kunst werk hingegen behält seine<br />
volle Bedeutung, ob wir den Na men des Meisters kennen oder nicht. Nach dem Ersten<br />
Welt krieg legten die in allen Ländern errichteten Denkmäler für den „Unbekannten<br />
Soldaten“ noch ein beredtes Zeugnis von einem allseitigen Bedürfnis ab, ein Wer, einen<br />
Jemand zu fin den, den die vier Jahre des Massenmordes hätten offenbaren sollen.<br />
Das Denkmal für den „Unbekannten“ entstand aus einem wohlbegründeten Unwillen,<br />
sich damit abzufinden, daß ein so ungeheueres Geschehen im wahrsten Sinne des<br />
Wortes von Niemand gewollt und in Szene gesetzt worden war; die Denkmäler waren<br />
allen denen gesetzt, die der Krieg, trotz größten menschlichen Einsatzes, im Unbekannten<br />
gelassen hatte, was ihrer Leistung zwar keinen Abbruch tat, was sie aber als<br />
Handelnde ihrer Menschenwürde beraubte.5<br />
25 Das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten<br />
und die in ihm dargestellten Geschichten<br />
Das unverwechselbar einmalige des Wer-einer-ist, das sich so handgreiflich im Sprechen<br />
und Handeln manifestiert, entzieht sich jedem Versuch, es eindeutig in Worte zu<br />
fassen. Sobald wir versuchen zu sagen, wer jemand ist, beginnen wir Eigen schaften<br />
zu beschreiben, die dieser Jemand mit anderen teilt und die ihm gerade nicht in seiner<br />
Einmaligkeit zugehören. Es stellt sich heraus, daß die Sprache, wenn wir sie als ein<br />
Mittel der Beschreibung des Wer benutzen wollen, sich versagt und an dem Was hängen
112 — 113<br />
Autor<br />
6 Diels-Kranz, Fragmente der<br />
Vorsokratiker, B 93.<br />
7 Hiermit hängt zusammen,<br />
daß Sokrates sein δαιμόνιον<br />
ausdrücklich nur für die ἀδηλα in<br />
Anspruch nimmt, aber nicht für die<br />
ἀναγκαῑα, d.h. nur für Sachen, die<br />
direkt mit dem Zusammenleben<br />
der Menschen zusammenhängen,<br />
aber nicht für solche, bei denen<br />
Menschen mit der Dingwelt<br />
kon frontiert sind, sowie daß<br />
er offenbar die Ratschläge des<br />
δαιμόνιον mit den Orakelsprüchen<br />
des delphischen Apoll verglich. O.<br />
Gigon (Sokrates, 1947, S. 175) hat<br />
bereits darauf hingewiesen, daß<br />
Sokrates dabei für die Aussagen<br />
seines δαιμόνιον das gleiche Wort<br />
gebraucht, das wir bei Heraklit<br />
für die Aussagen des delphischen<br />
Orakels lesen: σημαίνειν. Entscheidend<br />
in unse rem Zusammenhang ist<br />
die ausdrückliche Beschränkung<br />
der Gültigkeit von Orakel und<br />
δαιμόνιον auf den Bereich<br />
des Handelns. Siehe Xenophon,<br />
Memorabilia I, 2–9.<br />
bleibt, so daß wir schließlich höchstens Cha raktertypen hingestellt haben, die alles<br />
andere sind als Perso nen, hinter denen vielmehr das eigentliche Personale sich mit<br />
einer solchen Entschiedenheit verbirgt, daß man versucht ist, die Charaktere für Masken<br />
zu halten, die wir annehmen, um das Risiko des Aufschlusses im Miteinander zu<br />
verringern – gleichsam als schalteten wir eine Schutzschicht ein, um die be stürzende<br />
Eindeutigkeit des Dieser-und-niemand-anders-Seins abzudämpfen.<br />
Dies Versagen der Sprache hängt aufs engste mit der der Philosophie nur zu bekannten<br />
Unmöglichkeit zusammen, das Wesen des Menschen zu definieren; alle solche Definitionen<br />
laufen immer auf Bestimmungen und Interpretationen dessen hinaus, was<br />
der Mensch ist, welche Eigenschaften ihm im Ver gleich mit anderen lebenden Wesen<br />
zukommen mögen; wäh rend die differentia specifica des Menschseins ja gerade darin<br />
liegt, daß der Mensch ein Jemand ist und daß wir dies Jemand- Sein nicht definieren<br />
können, weil wir es mit nichts in Vergleich setzen und qua Wer-Sein gegen keine<br />
andere Art des Wer -Seins absetzen können. Aber abgesehen von dieser Aporie im Philosophischen,<br />
ist dies Versagen der Sprache vor dem leben digen Wesen der Person, das<br />
sich im Verlauf des Sprechens und Handelns dauernd zeigt, von sehr großer Tragweite<br />
für den ge samten Bereich menschlicher Angelegenheiten, in dem wir ja primär als<br />
Handelnde und Sprechende uns bewegen. Es schließt nämlich prinzipiell die Möglichkeit<br />
aus, diese Angele genheiten je so zu handhaben wie Sachen, die uns wesentlich<br />
zur Verfügung stehen und über die wir dadurch verfügen, daß wir sie benennen. Leider<br />
hat die Art und Weise, in der das Wer- einer-ist sich manifestiert, eine vertrackte Ähnlichkeit<br />
mit den Aufschlüssen, welche die griechischen Orakelsprüche zu geben pflegten<br />
und deren Unzuverlässigkeit und Vieldeutigkeit ja notorisch war; es geht einem damit<br />
wie mit den Sprüchen des delphischen Apoll, der nach Heraklit οὔτε λέγει οὔτε<br />
κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει, „weder sagt noch verbirgt, aber zeigt“6. Daß das Wer sich<br />
in solch vieldeutiger und unnennbarer Ungewißheit zeigt, bedingt die Ungewißheit<br />
nicht nur aller Politik, sondern aller Angelegenheiten, die sich direkt im Miteinander der<br />
Men schen vollziehen, jenseits des vermittelnden, stabilisierenden und objektivierenden<br />
Mediums einer Dingwelt.7<br />
Dies Versagen ist nur eine von den vielen unlösbaren Apo rien, die dem Miteinander der<br />
Menschen anhaften und ihren Verkehr untereinander auf eigentümliche Weise zugleich<br />
erschweren und bereichern. Aber während andere Aporien, von denen wir noch zu sprechen<br />
haben werden, im wesentlichen durch Vergleiche mit den so viel verläßlicheren<br />
und produkti veren menschlichen Tätigkeiten des Herstellens, des Erken nens und selbst<br />
des Arbeitens entstehen, haben wir es hier mit einem Versagen zu tun, das direkt<br />
aus dem Handeln selbst ent steht und die ihm eigenen Intentionen und Erwartungen<br />
ent täuscht, die wir ohne alle Vergleiche aus der Natur der Sache an es stellen. Das<br />
Versagen betrifft gerade die Enthüllung der Per son, ohne die Handeln und Sprechen ihre<br />
spezifische Relevanz verlieren.<br />
Handeln und Sprechen bewegen sich in dem Bereich, der zwischen Menschen qua<br />
Menschen liegt, sie richten sich un mittelbar an die Mitwelt, in der sie die jeweils<br />
Handelnden und Sprechenden auch dann zum Vorschein und ins Spiel bringen, wenn<br />
ihr eigentlicher Inhalt ganz und gar „objektiv“ ist, wenn es sich um Dinge handelt,<br />
welche die Welt angehen, also den Zwischenraum, in dem Menschen sich bewegen<br />
und ihren jeweiligen, objektiv-weltlichen Interessen nachgehen. Diese Interessen sind<br />
im ursprünglichen Wortsinne das, was ‚inter-est‘, was dazwischen liegt und die Bezüge<br />
herstellt, die Menschen miteinander verbinden und zugleich voneinander scheiden.<br />
Fast alles Handeln und Reden betrifft diesen Zwi schenraum, der ein jeweils anderer für<br />
jede Menschengruppe ist, so daß wir zumeist miteinander über etwas sprechen und<br />
einander etwas weltlich-nachweisbar Gegebenes mitteilen, für das die Tatsache, daß<br />
wir unwillkürlich in solchem Sprechen -über auch noch Aufschluß darüber geben, wer<br />
wir, die Spre chenden, sind, von sekundärer Bedeutung scheint. Dennoch bildet diese
8 Politisch gesprochen, geht die<br />
Geschichte des Materialismus<br />
zumindest bis auf Plato und Aristoteles<br />
zurück, die annahmen, daß<br />
politische Gemein schaften, also<br />
die Polis im Unterschied zu dem<br />
Beisammen mehrerer Haus halte<br />
(οἰκίαι), durch die materiellen<br />
Bedürfnisse der Menschen entstanden<br />
sind. (Für Plato, siehe<br />
Staat 369: „Es entsteht also eine<br />
Polis, wie ich glaube, weil jeder<br />
Einzelne von uns sich selbst nicht<br />
genügt, sondern gar vieles bedarf.“<br />
Aber vgl. dagegen den 11. Brief<br />
359, wo die Gründung von Poleis<br />
auf „Zusammentreffen großer<br />
Ereignisse“ zurückgeführt wird;<br />
hier spricht Plato nicht theoretisch<br />
und dürfte lediglich die in der Polis<br />
selbst herrschende Meinung über<br />
diese Dinge wiedergegeben haben.<br />
– Für Ari stoteles, dessen politische<br />
Philosophie in dieser wie in anderer<br />
Hinsicht sich enger an die öffentliche<br />
Meinung hält, siehe „Politik“<br />
1252 b 29: „Die Polis entsteht um<br />
des Lebens willen und bleibt um<br />
des Gut-Lebens willen bestehen“).<br />
Der aristotelische Begriff<br />
des σύμφερον, den wir später<br />
in Ciceros utilitas wiederfinden,<br />
erklärt sich im Zusammenhang<br />
dieser durchaus „ma terialistischen“<br />
Theorien. Plato und Aristoteles<br />
sind in Wahrheit die Vor läufer der<br />
Interessentheorie, die im Prinzip<br />
bereits von Bodin formuliert ist:<br />
Wie die Könige die Völker regieren,<br />
so regiert das Interesse die<br />
Könige. So ist auch das, was Marx<br />
innerhalb der modernen Entwicklung<br />
auszeich net, nicht etwa sein<br />
„Materialismus“, sondern daß er<br />
der einzige politische Theoretiker<br />
in dieser Tradition ist, der den<br />
Materialismus der Überliefe rung<br />
auf die ihm adäquate Grundlage<br />
stellte, nämlich die die Geschichte<br />
beherrschenden materiellen<br />
Interessen auf eine nachweisbare<br />
materielle menschliche Tätigkeit<br />
zurückführte, die Arbeit und den<br />
Stoffwechsel des Menschen mit<br />
der „Materie“.<br />
unwillkürlich-zusätzliche Enthüllung des Wer des Handelns und Sprechens einen so<br />
integrierenden Bestandteil allen, auch des „objektivsten“, Miteinanderseins, daß es ist,<br />
als sei der objektive Zwischenraum in allem Miteinander, mitsamt der ihm inhärenten<br />
Interessen gleichsam, von einem ganz und gar verschiedenen Zwischen durchwachsen<br />
und überwu chert, dem Bezugssystem nämlich, das aus den Taten und Wor ten selbst,<br />
aus dem lebendig Handeln und Sprechen entsteht, in dem Menschen sich direkt, über<br />
die Sachen, welche den jewei ligen Gegenstand bilden, hinweg aneinander richten und<br />
sich gegenseitig ansprechen. Dieses zweite Zwischen, das sich im Zwischenraum der<br />
Welt bildet, ist ungreifbar, da es nicht aus Dinghaftem besteht und sich in keiner Weise<br />
verdinglichen oder objektivieren läßt; Handeln und Sprechen sind Vorgänge, die von<br />
sich aus keine greifbaren Resultate und Endprodukte hinterlassen. Aber dies Zwischen<br />
ist in seiner Ungreifbarkeit nicht weniger wirklich als die Dingwelt unserer sichtbaren<br />
Um gebung. Wir nennen diese Wirklichkeit das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten,<br />
wobei die Metapher des Ge webes versucht, der physischen Ungreifbarkeit des<br />
Phänomens gerecht zu werden.<br />
Nun ist dies Gewebe menschlicher Bezüge natürlich, trotz seiner materiellen Ungreifbarkeit,<br />
weltlich nachweisbar und genau so an eine objektiv-gegenständliche Dingwelt<br />
gebunden, wie etwa die Sprache an die physische Existenz eines lebendi gen Organismus<br />
gebunden ist; aber das Verhältnis zwischen dem Bezugsgewebe menschlicher<br />
Angelegenheiten und der objektiv-gegenständlichen Welt, die es durchdringt, gleicht<br />
nicht etwa dem Bezug, der zwischen einer Fassade und einem Gebäude oder, in marxistischer<br />
Terminologie, zwischen dem „Überbau“ und den ihn tragenden materiellen<br />
Strukturen ob waltet. Der Grundirrtum aller Versuche, den Bereich des Poli tischen<br />
materia listisch zu verstehen – und dieser Materialismus ist nicht eine Erfindung von<br />
Marx und noch nicht einmal spezi fisch modern, sondern im wesentlichen genau so alt<br />
wie die Ge schichte politischer Philosophie 8 –, liegt darin, daß der allem Handeln und<br />
Sprechen inhärente, die Person enthüllende Fak tor einfach übersehen wird, nämlich<br />
die einfache Tatsache, daß Menschen, auch wenn sie nur ihre Interessen verfolgen und<br />
be stimmte weltliche Ziele im Auge haben, gar nicht anders können, als sich selbst in<br />
ihrer personalen Einmaligkeit zum Vorschein und mit ins Spiel zu bringen. Diesen sogenannten<br />
„sub jektiven Faktor“ auszuschalten würde bedeuten, die Menschen in etwas<br />
zu verwandeln, was sie nicht sind; zu leugnen, daß die Enthüllung der Person allem, auch<br />
dem zielbewußtesten Han deln innewohnt und für den Ablauf der Handlung bestimmte<br />
Konsequenzen hat, die weder durch Motive noch durch Ziele vorbestimmt sind, heißt<br />
einfach, der Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht Rechnung tragen.<br />
Der Bereich, in dem die menschlichen Angelegenheiten vor sich gehen, besteht in einem<br />
Bezugssystem, das sich überall bildet, wo Menschen zusammenleben. Da Menschen<br />
nicht von ungefähr in die Welt geworfen werden, sondern von Men schen in eine schon<br />
bestehende Menschenwelt geboren wer den, geht das Bezugsgewebe menschlicher<br />
Angelegenheiten allem einzelnen Handeln und Sprechen voraus, so daß sowohl die<br />
Enthüllung des Neuankömmlings durch das Sprechen wie der Neuanfang, den das<br />
Handeln setzt, wie Fäden sind, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschlagen<br />
werden und das Gewebe so verändern, wie sie ihrerseits alle Lebensfäden, mit denen<br />
sie innerhalb des Gewebes in Berührung kommen, auf einmalige Weise affizieren.<br />
Sind die Fäden erst zu Ende ge sponnen, so ergeben sie wieder klar erkennbare Muster<br />
bzw. sind als Lebensgeschichten erzählbar.<br />
Weil dies Bezugsgewebe mit den zahllosen, einander wider strebenden Absichten und<br />
Zwecken, die in ihm zur Geltung kommen, immer schon da war, bevor das Handeln<br />
überhaupt zum Zug kommt, kann der Handelnde so gut wie niemals die Ziele, die ihm<br />
ursprünglich vorschwebten, in Reinheit verwirk lichen; aber nur weil Handeln darin<br />
besteht, den eigenen Fa den in ein Gewebe zu schlagen, das man nicht selbst gemacht<br />
hat, kann es mit der gleichen Selbstverständlichkeit Geschich ten hervorbringen, mit der
114 — 115<br />
Autor<br />
das Herstellen Dinge und Gegen stände produziert. Das ursprünglichste Produkt des<br />
Handelns ist nicht die Realisierung vorgefaßter Ziele und Zwecke, son dern die von ihm<br />
ursprünglich gar nicht intendierten Geschich ten, die sich ergeben, wenn bestimmte Ziele<br />
verfolgt werden, und die sich für den Handelnden selbst erst einmal wie neben sächliche<br />
Nebenprodukte seines Tuns darstellen mögen. Das, was von seinem Handeln schließlich<br />
in der Welt verbleibt, sind nicht die Impulse, die ihn selbst in Bewegung setzten, sondern<br />
die Geschichten, die er verursachte; nur diese können am Ende in Urkunden und Denkmälern<br />
verzeichnet werden, in Ge brauchsgegenständen und Kunstwerken sichtbar<br />
gemacht wer den, im Gedächtnis der Generationen wieder und wieder nach erzählt und<br />
in allen möglichen Materialien vergegenständlicht werden.<br />
Die Geschichten selbst aber, in ihrer lebendigen Wirklich keit, sind keine „Dinge“ und<br />
müssen erst verdinglicht, d.h. transformiert werden, bevor sie in den gegenständlichen<br />
Be stand der Welt eingehen können. Sie handeln von keinen Sachen oder Gegenständen,<br />
und der „Held“, um den die Geschichte sich bildet und von dem sie berichtet, ist uns<br />
schließlich vertrau ter, als es die Verfasser der berühmtesten und geschichtlich wirksamsten<br />
Werke je werden können, wenn wir nichts von ihnen kennen als das Werk ihrer<br />
Hände. Obwohl sie also in einem so unvergleichlich intimen Verhältnis zu der Person<br />
ste hen, die zugleich Held und Veranlasser der Geschichte ist, sind diese Geschichten<br />
nicht eigentlich Produkte eines Autors. Kein Mensch kann sein Leben „gestalten“ oder<br />
seine Lebensge schichte hervorbringen, obwohl ein jeder sie selbst begann, als er sprechend<br />
und handelnd sich in die Menschenwelt einschal tete. Obwohl also erzählbare<br />
Geschichten die eigentlichen „Produkte“ des Handelns und Sprechens sind, und wiewohl<br />
der Geschichtscharakter dieser „Produkte“ dem geschuldet ist, daß handelnd und<br />
sprechend die Menschen sich als Personen enthül len und so den „Helden“ konstituieren,<br />
von dem die Geschichte handeln wird, mangelt der Geschichte selbst gleichsam ihr<br />
Ver fasser. Jemand hat sie begonnen, hat sie handelnd dargestellt und erlitten, aber<br />
niemand hat sie ersonnen.<br />
Daß die Spanne menschlichen Lebens zwischen Geburt und Tod schließlich sich zu<br />
einer erzählbaren Geschichte formiert mit Anfang und Ende, ist die vorpolitische und<br />
prähistorische Bedingung dessen, daß es überhaupt so etwas wie Geschichte im<br />
Dasein der Menschheit gibt. Wenn wir von einer Geschichte der Menschheit oder überhaupt<br />
von der Geschichte einer Men schengruppe sprechen, deren Existenz im Ganzen<br />
nicht notwendigerweise von Geburt und Tod begrenzt ist, so gebrau chen wir eigentlich<br />
das Wort ‚Geschichte‘ im Sinne einer Meta pher; denn zum Wesen der „Geschichte“<br />
der Menschheit ge hört, daß sie selbst keinen von uns wißbaren Anfang und kein von<br />
uns erfahrbares Ende hat und so eigentlich nicht mehr ist als der Rahmen, innerhalb<br />
dessen die unendlichen, erzählba ren Geschichten der Menschen gesammelt und<br />
niedergelegt werden. Aber daß jedes Menschenleben eine nur ihm eigene Geschichte<br />
zu erzählen hat und daß Geschichte schließlich zu einem unendlich erweiterbaren<br />
Geschichtenbuch der Mensch heit werden kann, in dem es eine Unzahl von „Helden“<br />
gibt und das doch keiner je verfaßt hat, hat seinen Grund darin, daß beide gleichermaßen<br />
das Resultat des Handelns sind. Denn die große Unbekannte, die in keiner<br />
Gleichung der neuzeitlichen Geschichtsphilosophie je aufgegangen ist, tritt nicht erst<br />
auf, wenn man die Geschichte als Ganzes betrachtet und findet, daß ihr „Held“, die<br />
Menschheit, eine Abstraktion ist, die nicht han deln kann, weil man ihr unter keinen<br />
Umständen die zum Han deln notwendige Eigenschaft der Personalität zumuten kann.<br />
Die gleiche Aporie, welche durch die Geschichtsphilosophie geistert und sie mit<br />
den Gespenstern einer listig gewordenen Natur (Kant) oder Vernunft, mit Welt- und<br />
Zeitgeistern bevöl kert, die durch die Menschen hindurchhandeln, um sich selbst zu<br />
offenbaren, finden wir bereits in den Anfängen der politi schen Philosophie, nur mit<br />
dem allerdings entscheidenden Un terschied, daß die Philosophie vor der Entstehung<br />
des neu zeitlichen Geschichtsbewußtseins aus der Unmöglichkeit, den eigentlich
9 Gesetze 803 u. 644.<br />
Verantwort lichen für den Gesamtbereich der zwi schen den Menschen sich ergebenden<br />
Angelegenheiten zu er mitteln, den Schluß zog, daß diese Angelegenheiten unmöglich<br />
von allzu großem Belang sein könnten. Nicht nur bedurfte es nicht der modernen<br />
Geschichts philosophie, um diese dem menschlichen Handeln anhaftenden Verlegenheiten<br />
zu ent decken, man möchte umgekehrt meinen, daß die ursprünglich politischen<br />
Impulse der neuzeitlichen Philosophie in eine Geschichtsphilosophie geführt haben,<br />
weil es scheinen konnte, daß man durch die Einführung des Begriffs einer Menschheitsgeschichte<br />
dieser ursprünglich politischen Verlegenheit Herr werden könnte. Denn die<br />
Verlegenheit selbst ist so elementa rer Natur, daß sie sich bei dem Erzählen der<br />
unscheinbarsten, noch ganz und gar „unhistorischen“ Geschichte meldet; sie liegt einfach<br />
darin, daß jede Abfolge von Geschehnissen, wenn sie nur zeitlich verbunden ist<br />
und ganz gleich, wie zufällig und disparat die Veranlassungen jeweils gewesen sein<br />
mögen, im mer noch genug Zusammenhang aufweist, um erzählbar zu sein und in dem<br />
Erzähltwerden einen Sinnzusammenhang zu erge ben. Auf die Frage aber, wer diesen<br />
Sinn wohl ersonnen hat, wird die Antwort immer ‚Niemand‘ lauten, denn auch der Held<br />
der erzählten Geschichte – gesetzt, daß sie überhaupt einen eindeutig identifizierbaren<br />
Täter aufweist, der den Gescheh nisablauf erst einmal ins Rollen gebracht hat – kann<br />
unter kei nen Umständen in dem gleichen Sinn als Autor der Geschichte und ihres Sinns<br />
angesprochen werden wie etwa der Verfasser einer Novelle.<br />
So besteht Plato gerade in seiner politischen Philosophie dar auf, daß die aus dem<br />
Handeln (πράττειν) entstandenen Ange legenheiten zwischen den Menschen (τὰ τῶν<br />
ἀνθρώπων πράγματα) nicht wert seien, ernst genommen zu werden, daß das Tun<br />
und Treiben der Menschen untereinander vielmehr einem Puppenspiel gleiche, in dem<br />
die Drähte von unsichtbarer Hand gezogen werden, vielleicht von der Hand eines Gottes,<br />
der sich mit Menschen wie mit Marionetten die Zeit vertreibt.9 An die sen halb ironischen<br />
Reflektionen ist vor allem bemerkenswert, daß Plato, ohne sich im geringsten des<br />
spezifisch neuzeitlichen Geschichtsproblems bewußt zu sein, zu der gleichen Metapher<br />
eines hinter dem Rücken der Menschen handelnden Unbe kannten griff, welche die<br />
Geschichtsphilosophie in so mannig faltigen Abwandlungen – als göttliche Vorsehung,<br />
als Adam Smith’ „unsichtbare Hand“ im ökonomischen Handeln, als Natur, als Weltgeist<br />
und schließlich als das Marxsche Klasseninteresse – zur Lösung ihres zentralen Problems<br />
bereitstellte, das darin besteht, daß Geschichte, wiewohl offenbar durch menschliches<br />
Handeln entstanden, doch von Menschen nicht „gemacht“ wird. Schon Plato brauchte<br />
einen Drahtzieher hin ter dem Rücken der Menschen, hinter der Bühne des sichtba ren<br />
Geschehens, nicht um diese oder jene Handlung zu „erklären“, die man stets an Maßstäben<br />
messen und beurteilen kann, sondern um einen Jemand zu finden, der für die<br />
aus ihr sich ergebende Geschichte verantwortlich zeichnen könnte. Platos göttlicher<br />
Drahtzieher, der sich zu seinen menschlichen Mario netten verhält wie der Autor eines<br />
Bühnenstücks zu den in ihm auftretenden Personen, ist noch ironisch gemeint; und<br />
diese souveräne Ironie gegen das nur Menschliche und das aus ihm sich ergebende nur<br />
Geschichtliche äußert sich gelegentlich auch noch in der Neuzeit, wie wenn Kant von<br />
dem in der Ge schichte waltenden „trostlosen Ungefähr“ spricht oder Goethe alle<br />
Geschichte für einen „Mischmasch aus Irrtum und Gewalt“ erklärt. Gewiß ist hier die<br />
Rede von politischer Geschichte, und diejenigen, die glauben, in der Geschichte einen<br />
eindeuti gen Sinn erkennen zu können, berufen sich unwillkürlich auf Geistes- und<br />
Ideengeschichte. Aber Geschichte, sofern sie von Ereignissen und Geschehnissen<br />
handelt und als eine Ge schichte erzählbar ist, ist natürlich ihrem Wesen nach politisch,<br />
was heißt, daß sie nicht aus Ideen oder Tendenzen oder all gemeinen, gesellschaftlichen<br />
Kräften entsteht, sondern aus Handlungen und Taten, die als solche durchaus verifizierbar<br />
sind. Wie sehr auch die Geschichtsphilosophie sich an Geistes geschichte orientieren<br />
mag, um zu ihren spezifischen Deutun gen zu kommen, so bestätigt sie doch auf ihre<br />
Weise der Geschichte ihren primär politischen Charakter immer wieder dadurch, daß sie
116 — 117<br />
Autor<br />
ohne den großen, unbekannten Drahtzieher hinter dem Rücken der Menschen nicht auszukommen<br />
ver mag; denn dieser Drahtzieher würde sich sofort als überflüssig erweisen,<br />
wenn wir es in ihr wirklich mit nichts anderem zu tun hätten als mit einer Entwicklungsgeschichte<br />
des menschlichen Geistes. So beweist denn auch Adam Smith, wenn er eine<br />
„un sichtbare Hand“ für seine Analyse des Wirtschaftslebens und der Marktvorgänge<br />
braucht, nicht mehr und nicht weniger, als daß auch die Nationalökonomie es nicht nur<br />
mit wirtschaft lichem Kalkül und der Vertretung bestimmter Interessen zu tun hat, sondern<br />
eben mit zum Handeln begabten Menschen, die, wenn sie auf dem Warenmarkt<br />
erscheinen, aus eigener In itiative zu handeln beginnen, sich also keineswegs lediglich<br />
als Produzenten und als Warenbesitzer verhalten.<br />
Die Hypothese, daß ein den Menschen Unbekanntes sie lenkt und daß es dies Unbekannte<br />
ist, das dem von Menschen Gehandelten seinen erzählbaren Sinn verleiht, entspricht<br />
nicht so sehr den im Handeln selbst gemachten Erfahrungen als vielmehr den<br />
Ansprüchen, die ein Verstand und ein Denken, das an ganz anderen Erfahrungen<br />
ursprünglich orientiert und interessiert ist, an das Handeln stellt. Welcher Art diese<br />
An sprüche sind und woher sie erfahrungsmäßig stammen, ist un schwer daraus zu<br />
erkennen, daß die uralte Hypothese des Drahtziehers die durch das Handeln erzeugten<br />
Geschichten im Sinne von erfundenen und so oder anders verfaßten Geschich ten<br />
umdeutet, in denen nun wirklich ein Verfasser die Fäden in der Hand hält und das von<br />
ihm erfundene Spiel leitet. Die er fundene Geschichte weist auf einen Verfasser, so wie<br />
jedes Kunstwerk und überhaupt jeder verfertigte Gegenstand darauf hinweist, daß<br />
„hinter“ ihm sich ein Jemand befindet, der ihn hergestellt hat. In diesem Sinne aber<br />
gehört der Verfasser kei neswegs in die Geschichte, die er selbst erfand; die Geschichte<br />
selbst gibt keinerlei Auskunft über ihn, was immer sonst sie uns zu erzählen hat; nur<br />
ihre schiere Existenz als ein Erfundenes weist hin auf den Autor, der sie erfand. Der<br />
Unterschied zwi schen einer wirklich geschehenen und einer nur erfundenen Geschichte<br />
besteht gerade darin, daß nur die letztere erst aus gedacht und dann im Sinne des Ausgedachten<br />
verfaßt wurde, während die wirklich geschehene Geschichte weder durch ein<br />
Ausdenken noch ein Herstellen entstanden ist. Die wirkliche Geschichte, in die uns das<br />
Leben verstrickt und der wir nicht entkommen, solange wir am Leben sind, weist weder<br />
auf einen sichtbaren noch einen unsichtbaren Verfasser hin, weil sie überhaupt nicht<br />
verfaßt ist. Der einzige Jemand, den sie ent hüllt, ist und bleibt der Held der Geschichte,<br />
dessen Wer sich nur im Medium des Erzählbaren und daher ex post facto in einer Greifbarkeit<br />
und Bedeutungsfülle darstellt, die der un greifbar flüchtigen und doch unverwechselbar<br />
einzigartigen Manifestation entspricht, in der die Person durch Handeln und<br />
Sprechen einer Mitwelt gegenwärtig ist. Wer jemand ist oder war, können wir nur erfahren,<br />
wenn wir die Geschichte hören, deren Held er selbst ist, also seine Biographie; was<br />
immer wir sonst von ihm wissen mögen und von den Werken, deren Ver fasser er ist, kann<br />
uns höchstens darüber belehren, was er ist oder war. So kommt es, daß wir von der<br />
Person des Sokrates, der keine Zeile je geschrieben hat und über dessen Meinungen wir<br />
so viel schlechter unterrichtet sind als über die von Plato und Aristoteles, doch ein<br />
erheb lich besseres Bild haben als von der der meisten Philosophen vor und nach ihm. Wir<br />
wis sen, wer Sokrates war, in einem Sinne, in dem wir weder von Plato noch von Aristoteles<br />
wissen, wer sie waren, weil wir die Geschichte des Sokrates kennen.<br />
Der Held, um den sich eine Geschichte zentriert und dessen Person die Geschichte<br />
aufdeckt, bedarf keiner heroischen Ei genschaften. Der Heros ist ursprünglich bei Homer<br />
nur der freie Mann, der als solcher teilhat an dem Krieg um Troja und von dem daher<br />
eine Geschichte zu erzählen ist.10 Der Mut, den wir heute als unerläßlich für einen<br />
Helden empfinden, ge hört bereits, auch wenn er kein heroischer Mut in unserem Sinne<br />
ist, zum Handeln und Sprechen als solchen, nämlich zu der Initiative, die wir ergreifen<br />
müssen, um uns auf irgendeine Weise in die Welt einzuschalten und in ihr die uns eigene<br />
Ge schichte zu beginnen. Dieser Mut entspringt keineswegs not wendigerweise oder
10 Bei Homer schwingt in dem<br />
Wort ἥρως zweifellos die Bedeutung<br />
einer Vor trefflichkeit mit,<br />
aber diese Vortrefflichkeit kommt<br />
jedem freien Mann zu. Der homerische<br />
Heros ist noch kein Halbgott,<br />
und diese Bedeutung ent stand<br />
vermutlich, weil man die epischen<br />
Helden der Vorzeit später als<br />
„Halbgötter“ verehrte.<br />
11 Aristoteles sagt ausdrücklich,<br />
daß man „Drama“ sage, weil<br />
δρῶντες, Han delnde in dieser<br />
Kunstform nachgeahmt werden<br />
(Poetik 1448 a 28). Aus dem<br />
Zusammenhang wird deutlich,<br />
daß der aristotelische Begriff der<br />
„Nachahmung“ aus dem Drama<br />
gewonnen war und dann auf die<br />
anderen Kunstformen einfach<br />
angewandt wurde.<br />
12 Daher spricht auch Aristoteles<br />
zumeist nicht von einer<br />
Nachahmung des Handelns<br />
(πρᾱξις), sondern der Handelnden<br />
(πράττοντες) – vgl. Poetik 1448<br />
a 1 ff., 1448 b 25, 1449 24 ff. –,<br />
wobei sich aber gelegentlich auch<br />
Abwei chungen hiervon finden,<br />
so 1451 a 29 u. 1447 a 28. Entscheidend<br />
ist, daß es sich in der<br />
Tragödie nicht um die Eigenschaften<br />
des tragischen Helden handelt,<br />
um seine ποιότης, sondern<br />
darum, was ihm zustößt und was<br />
er tut, um sein Leben in Glück und<br />
Unglück (1450 a 15-18). Die griechische<br />
Tragödie ist keine Charaktertragödie;<br />
in ihrem Mittelpunkt<br />
steht immer die Hand lung.<br />
13 In den „Problemata“ wird<br />
gelegentlich darauf hingewiesen,<br />
daß der Chor „weniger nachahmt“<br />
(918 b 28).<br />
primär der Bereitschaft, für ein Getanes die Konsequenzen auf sich zu nehmen; des<br />
Mutes und sogar einer gewissen Kühnheit bedarf es bereits, wenn einer sich entschließt,<br />
die Schwelle seines Hauses, den Privatbereich der Verborgenheit, zu überschreiten,<br />
um zu zeigen, wer er eigent lich ist, also sich selbst zu exponieren. Das<br />
Ausmaß dieses an fänglichen Mutes, ohne den Handeln und Sprechen – und da mit,<br />
wenigstens für die Griechen, Freiheit – überhaupt nicht möglich sind, ist nicht weniger<br />
groß und vielleicht sogar grö ßer, wenn es sich zufällig ergeben sollte, daß der „Held“<br />
leider ein Feigling ist.<br />
In der Verdinglichung durch das Kunstwerk, das eine Tat oder eine Leistung verherr licht<br />
und vermittels der nur ihm ei genen Verdichtung und Transfiguration ein Außer ordent -<br />
liches in seiner vollen Bedeutsamkeit erstrahlen läßt, kann der Gehalt des Gesprochenen<br />
und Getanen sowie sein eigent licher konkreter Inhalt die verschiedensten Formen<br />
annehmen. Indessen ist die dem Handeln und Sprechen eigene Ent hüllung des Wer so<br />
unlösbar an den lebendigen Fluß des Vor ganges selbst gebunden, daß sie nur in einer<br />
Art Wiederholung des ursprünglichen Vorgangs dargestellt und „verdinglicht“ werden<br />
kann, in der Nachahmung oder μίμησις, von der Ari stoteles zwar annahm, daß sie eine<br />
Grundvoraussetzung aller Künste sei, die er aber selbst in der Tat nur im δρᾶμα vorfand,<br />
dessen Name (‚Drama‘, das Substantiv eines der vielen griechi schen Worte<br />
für Handeln, δρᾶν, entspricht genau der „Hand lung“, die auch wir vom Theater erwarten)<br />
bereits anzeigt, daß es die dem Handeln entsprechende Kunstgattung ist, und das<br />
für ihn stellvertretend für alle Kunstgattungen wurde.11 Die Bühne des Theaters ahmt<br />
in der Tat die Bühne der Welt nach, und die Schauspielkunst ist die Kunst „handelnder<br />
Personen“. Aber das Element des wiederholenden Nachahmens kommt nicht erst im<br />
Schauspieler zur Geltung, es ist bereits, wie Ari stoteles mit Recht behauptet, im Verfertigen<br />
und Niederschrei ben des Stückes am Werk, sofern ein Schauspiel ja nur sekun där<br />
als Lesestück rezipiert werden kann und, ähnlich dem Musikstück, der Aufführung<br />
bedarf, um sich in seiner vollen Bedeutung zur Geltung zu bringen. Was sich in der<br />
Aufführung zur Geltung bringt, ist dabei nicht so sehr der Gang der Hand lung, der sich<br />
auch im reinen Erzählen wiedergeben ließe, als das So-und-nicht-anders-Sein der<br />
handelnden Personen, die der Schauspieler unmittelbar in ihrem eigensten Medium darstellt.12<br />
Mit Bezug auf die griechische Tragödie besagt dies, daß der allgemeine Sinn<br />
der dargestellten Geschichte wie des Gan ges der Handlung durch den Chor ausgesagt<br />
wird, der nichts nachahmt 13 und dessen Aussagen die rein lyrisch-gesungenen Partien<br />
des Stückes bilden, während die ungreifbare Identität der die Handlung darstellenden<br />
Personen nur durch ein Nach ahmen des wirklichen Handelns vorgeführt werden kann,<br />
da sie gerade sich aller Verallgemeinerung und demzufolge auch aller Verdinglichung<br />
und Transfigurierung in ein anderes Me dium entzieht. So ist das Theater denn in der<br />
Tat die politische Kunst par excellence; nur auf ihm, im lebendigen Verlauf der Vorführung,<br />
kann die politische Sphäre menschlichen Lebens überhaupt so weit transfiguriert<br />
werden, daß sie sich der Kunst eignet. Zugleich ist das Schauspiel die einzige Kunstgattung,<br />
deren alleinigen Gegenstand der Mensch in seinem Bezug zur Mitwelt bildet.<br />
26 Die Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten<br />
Handeln, im Unterschied zum Herstellen, ist in Isolierung nie mals möglich; jede Isoliertheit,<br />
ob gewollt oder ungewollt, be raubt der Fähigkeit zu handeln. So wie das Herstellen<br />
der Umgebung der Natur bedarf, die es mit Material versorgt, und einer Umwelt, in<br />
der das Fertigfabrikat zur Geltung kommen kann, so bedarf das Handeln und Sprechen<br />
der Mitwelt, an die es sich richtet. Das Herstellen vollzieht sich in und für die Welt, mit<br />
deren dinglichem Bestand es in ständigem Kontakt bleibt; das Handeln und Sprechen<br />
vollzieht sich in dem Bezugsgewebe zwischen den Menschen, das seinerseits aus<br />
Gehandeltem und Gesprochenem entstanden ist, und muß mit ihm in ständigem Kontakt
118 — 119<br />
Autor<br />
14 Plato hat bereits dem Perikles<br />
vorgeworfen, daß er die Bürger<br />
nicht besser gemacht habe und<br />
daß die Athener bei seinem Tod<br />
eher schlechter gewesen seien als<br />
vorher. Siehe Gorgias 515.<br />
15 Daß es sich bei dem Ausdruck<br />
„Menschenmaterial“ um keine<br />
harmlose Metapher handelt, dürften<br />
wir inzwischen erfahren haben.<br />
Das gleiche trifft natürlich auf<br />
eine ganze Reihe wissenschaftlicher<br />
Experimente mit Menschen<br />
in den Sozialwissenschaften, der<br />
Biochemie, der Gehirnchirur gie<br />
usw. zu, die alle darauf hinauslaufen,<br />
den Menschen wie „Material“<br />
zu behandeln bzw. zu verändern<br />
und zu bearbeiten. Diese „mechanistischen“<br />
Einstellungen sind<br />
typisch für die Neuzeit; wenn die<br />
Antike ähnliche Ziele verfolgte,<br />
pflegte sie sich in Metaphern auszudrücken,<br />
die aus dem Tier reich<br />
genommen waren: die Menschen<br />
sollten aus wilden Tieren zu<br />
Haus tieren gemacht, sie sollten<br />
gezähmt werden.<br />
16 Für den griechischen Sprachgebrauch<br />
und die ursprüngliche<br />
Bedeutung der Verben, die Handeln<br />
bezeichnen, siehe vor allem<br />
C. Capelle, Wörterbuch des Homers<br />
und der Homeriden, 1889.<br />
bleiben. Die Vorstellung, daß der Starke am mächtig sten allein ist, beruht entweder<br />
auf dem Irrglauben, daß wir im Bereich der menschlichen Angelegenheiten etwas<br />
„machen“ können – z.B. Einrichtungen und Gesetze „schaffen“, wie wir Tische und<br />
Stühle fabrizieren, oder den Menschen besser oder schlechter „machen“14 –, oder aber<br />
sie entspringt der bewußten Verzweiflung an dem Sinn von Handeln überhaupt, des<br />
politi schen wie des unpolitischen, die sich dann leicht mit der utopi schen Hoffnung<br />
tröstet, man könne vielleicht die Menschen behandeln, wie man alles andere Material<br />
behandelt.15 Die Stärke geistiger oder physischer Art, die für alles Herstellen benötigt<br />
wird, erweist sich für das Handeln als ganz und gar wertlos. Wir kennen zahllose<br />
Beispiele aus der Geschichte von der Ohnmacht des Starken und geistig Überlegenen,<br />
der daran scheitert, daß er es nicht versteht, sich der Hilfe und des Mit handelns seiner<br />
Mitmenschen zu versichern. Dies Versagen er klärt man sich gemeinhin mit der heillosen<br />
Minderwertigkeit der Menge und dem Ressentiment, das jede hervorragende Persönlichkeit<br />
inmitten der gemeinen Mediokrität erweckt. So richtig diese Beobachtungen<br />
im Einzelfall sein mögen, sie tref fen nicht den Kern der Sache.<br />
Um sich diese Sache zu vergegenwärtigen, mag es gut sein, sich daran zu erinnern,<br />
daß, im Unterschied zu den neueren Sprachen, das Griechische wie das Lateinische<br />
zwei ganz verschiedene und doch in einem bestimmten Zusammenhang ste hende<br />
Worte besaßen, mit denen sie das bezeichneten, was wir handeln nennen. Den beiden<br />
griechischen Verben: ἄρχειν (anfangen, anführen und schließlich befehlen und herrschen)<br />
und πράττειν (mit etwas zu Ende kommen, etwas ausrichten, es vollenden)<br />
entsprechen die beiden lateinischen Verben agere (in Bewegung setzen und anführen)<br />
und gerere (dessen Grundbedeutung tragen dann, wie das πράττειν, die Bedeu tungen<br />
von ausführen, betreiben, vollziehen annimmt).16 In bei den Sprachen also teilt sich<br />
das Handeln in zwei klar voneinander geschiedene Teile bzw. Stadien: etwas wird<br />
begonnen oder in Bewegung gesetzt von einem einzelnen, der anführt, wor aufhin ihm<br />
viele gleichsam zu Hilfe eilen, um das Begonnene weiter zu betreiben und zu vollenden.<br />
Nicht nur ist der innere Zusammenhang der beiden Worte in beiden Sprachen nahezu<br />
identisch, ihre Wortgeschichte ähnelt sich auf auffallende Weise. Beide Male nämlich<br />
setzte sich das ursprünglich nur für das zweite Stadium der Handlung bestimmte<br />
Wort – πράττειν bzw. gerere – so sehr im Sprachgebrauch durch, daß es in späte rer Zeit<br />
für Handeln überhaupt verwendet wurde, während die Worte, die das Anfangen<br />
bezeichneten, zum mindesten in der politischen Sprache, mehr und mehr eine ganz<br />
spezialisierte Bedeutung annehmen. So wird ἄρχειν politisch ausschließlich zum Herrschen<br />
und agere wird weit öfter in der Bedeutung von ‚führen‘ als von ‚in Bewegung<br />
setzen‘ benutzt.<br />
Diese Wortgeschichte berichtet natürlich von wirklichen Verhältnissen; aus dem Anfänger<br />
und Anführer, der ein pri mus inter pares (und bei Homer ein König unter Königen)<br />
war, wird ein Herrscher; die dem Handeln eigentümliche Doppel seitigkeit des Vollzugs,<br />
daß es angefangen und vollendet wer den muß, daß daher der Anfänger und Führer von<br />
anderen ab hängt, die ihm mit der Durchführung helfen müssen, und daß andererseits<br />
diese anderen, die in seinem Gefolge auftreten, von ihm insofern abhängen, als sie<br />
ohne ihn nie etwas zu tun bekommen hätten, spaltet sich in zwei ganz und gar voneinan<br />
der geschiedene Funktionen auf – die Funktion des Befehlens, die zum Vorrecht des<br />
Herrschers, und die Funktion, Befehle zu vollstrecken, die zur Pflicht seiner Untertanen<br />
wird. In die ser Aufteilung in Funktionen verwischt sich die ursprünglich dem Handeln<br />
selbst eigene Artikulation, die zwischen den Sta dien des Beginnens und Vollbringens<br />
unterscheidet, und an die Stelle der dieser Artikulation adäquaten Bezüge zwischen<br />
dem Einen, der allein anfängt, und den Vielen, die gemeinsam vollbringen, tritt das Verhältnis<br />
zwischen Befehl und Vollstreckung, in dem der Befehlende und die vollstreckend<br />
Gehor chenden sich in keinem Moment des Handelns mehr miteinan der verbünden.
Der Herrscher und Befehlshaber bleibt allein und isoliert von den Anderen, als sei er<br />
für immer gleichsam festgefroren in der Position des Anfangenden und Anführen den,<br />
der er war, als er sich noch auf nichts verlassen konnte als auf die Kraft der eigenen<br />
Initiative, bevor er die Anderen ge funden hatte, mit denen zusammen er das Angefangene<br />
vollen den konnte. Aber die Kraft dessen, der die Initiative ergreift, welche in<br />
der Tat die Stärke des Starken ausmacht, kommt nur in dieser Initiative und dem in ihr<br />
übernommenen Risiko zur Geltung, nicht in der tatsächlichen Leistung. Zwar mag der<br />
er folgreiche Herrscher und Befehlshaber es sich leisten können, das für sich allein in<br />
Anspruch zu nehmen, was nur durch die Hilfe der Vielen hat vollbracht werden können,<br />
aber damit mo nopolisiert er für sich die zahllosen Kräfte, ohne deren Hilfe seine<br />
Stärke machtlos geblieben wäre. In dieser monopolisie renden Anmaßung, in der es<br />
ein eigentliches Handeln gar nicht mehr gibt, weil weder der Befehlende noch die<br />
Vollstrecken den je wirklich handeln, entsteht dann das Trugbild, daß der Starke am<br />
mächtigsten allein sei.<br />
Weil sich der Handelnde immer unter anderen, ebenfalls handelnden Menschen bewegt,<br />
ist er niemals nur ein Täter, sondern immer auch zugleich einer, der erduldet.<br />
Handeln und Dulden gehören zusammen, das Dulden ist die Kehrseite des Handelns;<br />
die Geschichte, die von einem Handeln in Bewe gung gebracht wird, ist immer eine<br />
Geschichte der Taten und Leiden derer, die von ihr affiziert werden. Die Zahl derer, die<br />
so affiziert werden, ist im Prinzip unbegrenzt, weil die Folgen einer Handlung, die als<br />
solche ihren Ursprung außerhalb des menschlichen Bezugssystems haben kann, in das<br />
Medium des unend lichen Gewebes der menschlichen Angelegenheiten hin einschlagen,<br />
wo jede Reaktion gleichsam automatisch zu einer Kettenreaktion wird und jeder<br />
Vorgang sofort andere Vor gänge veranlaßt. Da Handeln immer auf zum Handeln begabte<br />
Wesen trifft, löst es niemals nur Re-aktionen aus, sondern ruft eigenständiges<br />
Handeln hervor, das nun seinerseits andere Handelnde affiziert. Es gibt kein auf einen<br />
bestimmten Kreis zu begrenzendes Agieren und Re-agieren, und selbst im beschränktesten<br />
Kreis gibt es keine Möglichkeit, ein Getanes wirklich zuverlässig auf die<br />
unmittel bar Betroffenen oder Ge meinten zu beschränken, etwa auf ein Ich und ein Du.<br />
Schran kenlos aber wird das Handeln nun aber nicht erst dadurch, daß es sich im<br />
Medium der Vielen, also in dem im engeren Sinne politischen Bereich bewegt, als entstände<br />
die Unzahl möglicher mensch licher Bezüge lediglich dadurch, daß unabsehbar<br />
viele Menschen jeweils durch das Bezugsgewebe ihrer Angelegen heiten zusammengehalten<br />
und miteinander ins Spiel gebracht werden. Wäre die Unbegrenztheit des<br />
Handelns lediglich der schieren Mengenhaftigkeit menschlichen Daseins geschuldet,<br />
so könnte seine Maßlosigkeit geheilt werden, indem man das Zusammenleben der<br />
Menschen politisch auf kleine und klein ste Gruppen einschränkte in der Hoffnung,<br />
übersehbare Ver hältnisse geschaffen zu haben. Zweifellos hat diese Hoffnung in der<br />
Beschränkung der griechischen Stadt-Staaten auf eine be stimmte, nicht zu überschreitende<br />
Zahl von Einwohnern und Bürgern eine Rolle gespielt; aber wir wissen auch aus<br />
der Ge schichte dieser zahlenmäßig so beschränkten Gebilde, daß das Bezugsgewebe<br />
in ihnen dadurch sich eher noch turbulenter ge staltete, als wirke sich die dem Handeln<br />
eigene Maßlosigkeit desto intensiver aus, je mehr man versucht, seinen Spielraum<br />
einzuengen. Jedenfalls bleiben auch in den beschränktesten Umständen die Folgen<br />
einer jeden Handlung schon darum un absehbar, weil das gerade eben noch Absehbare,<br />
nämlich das Bezugsgewebe mit den ihm eigenen Konstellationen, oft durch ein einziges<br />
Wort oder eine einzige Geste radikal geändert wer den kann.<br />
Schrankenlosigkeit erwächst aus der dem Handeln eigen tümlichen Fähigkeit, Beziehungen<br />
zu stiften, und damit aus der ihm inhärenten Tendenz, vorgegebene Schranken<br />
zu sprengen und Grenzen zu überschreiten.17 Die Schranken und Grenzen, die von so<br />
großer Bedeutung in dem Bereich der menschlichen Angelegenheiten sind, stellen den<br />
niemals verläßlichen Rah men her, in dem Menschen sich bewegen, ohne den ein
120 — 121<br />
Autor<br />
17 So definiert noch Montesquieu,<br />
dessen zentrales Anliegen<br />
nicht so sehr die Gesetze als die<br />
Handlungen waren, die von ihnen<br />
inspiriert werden, das Wesen der<br />
Gesetze als ‚rapports‘ oder Bezüge<br />
(vgl. Esprit des Lois, I, 1 u. XXVI, 1).<br />
Diese Definition ist überraschend,<br />
weil Gesetze gemeinhin als<br />
Grenzen und Schranken bestimmt<br />
werden. Montesquieus Definition<br />
er klärt sich daraus, daß er primär<br />
nicht an dem interessiert war,<br />
was er „la nature du gouvernement“<br />
nannte, also an der Staatsform<br />
als solcher, son dern an dem<br />
„principe“, das das Handeln in<br />
ihr bestimmt und sie in Bewe gung<br />
bringt (ib. III, 1).<br />
Zusam menleben überhaupt nicht möglich wäre, und der doch oft noch nicht einmal stabil<br />
genug ist, um dem Ansturm zu widerstehen, mit dem jede neue Generation der<br />
Geborenen sich in ihn ein schaltet. Die Zerbrechlichkeit der Einrichtungen und Gesetze,<br />
mit denen wir immer wieder versuchen, den Bereich der menschlichen Angelegenheiten<br />
halbwegs zu stabilisieren, hat mit der Gebrechlichkeit oder Sündhaftigkeit der menschlichen<br />
Natur nichts<br />
zu tun; sie ist einzig dem geschuldet, daß immer neue Menschen in diesen Bereich<br />
fluten und in ihm ihren Neu anfang durch Tat und Wort zur Geltung bringen müssen.<br />
Alles, was diesen Bereich stabilisiert, von dem schützenden Zaun um Haus und Hof<br />
bis zu den Landesgrenzen, die die physische Identität, und den Gesetzen, die die politische<br />
Existenz der Völker bestimmen und einhegen, ist gleichsam von außen an diesen<br />
Bereich herangebracht, in dessen Inneren die Tätigkei ten des Handelns und Sprechens<br />
wirken, zu deren Wesen es gehört, Anfänge zu setzen und Bezüge zu stiften, aber nicht<br />
zu stabilisieren und zu begrenzen. Weil Handeln von sich aus gar nicht anders als maßlos<br />
sein kann, ist Maßhalten seit eh und je eine der klassischen politischen Tugenden<br />
und die Hybris seit eh und je die spezifische Versuchung des handelnden Men schen<br />
gewesen, wie die in diesen Dingen nur zu erfahrenen Griechen nicht müde wurden, sich<br />
selbst vorzuhalten. Der Wille zur Macht hingegen ist ein spezifisch modernes Phänomen,<br />
das nicht so sehr aus dem Handeln als aus der Ohnmacht moderner Menschen im<br />
Bereich des Politischen stammt; aber Hybris und Maßlosigkeit sind die Versuchungen,<br />
die allem Handeln als solchem eigen sind.<br />
Schrankenlosigkeit kann zwar durch die Grenzen und Gesetze, ohne welche politische<br />
Körper noch nicht einmal entste hen, geschweige denn überdauern würden, niemals<br />
mit unbe dingter Zuverlässigkeit aus dem Bereich menschlicher Angele genheiten ausgeschaltet<br />
werden, aber sie wird durch sie doch weitgehend eingedämmt. Dies nun<br />
gerade ist kaum noch mög lich mit der anderen, ihr eng verwandten Eigentümlichkeit<br />
des Handelns, nämlich mit dem Tatbestand, daß niemand die Fol gen der eigenen Tat<br />
je voll übersehen kann. Dies liegt nicht daran, daß kein menschliches Gehirn imstande<br />
ist, die poten tiellen Konsequenzen eines Tuns zu errechnen, als sei das Be zugsgewebe,<br />
in das dies Tun fällt, ein ungeheuer kompliziertes Schachbrett, wo die Folgen<br />
eines Zuges etwa von dem über menschlichen „Gehirn“ einer elektronisch betriebenen<br />
Rechen maschine zumindest so weit errechnet werden könnten, daß die Zukunft<br />
in Form von Alternativen voraussagbar wäre. Die Unabsehbarkeit der Folgen gehört<br />
vielmehr zum Gang der von einem Handeln unweigerlich erzeugten Geschichte; sie<br />
bil det die dieser Geschichte eigene Spannung, die ein Menschen leben spannt und in<br />
Atem hält und ohne die es vor Langeweile förmlich in sich zusammenfallen müßte.<br />
Es ist diese Spannung, mit der wir den Ausgang einer Geschichte erwarten, die mit<br />
dazu beiträgt, daß wir so unbeirrbar uns auf die Zukunft aus richten und an ihr uns<br />
orientieren, obgleich wir doch nur zu gut wissen, daß das allein sichere Ende dieses<br />
Zukünftigen der ei gene Tod ist. Daß wir es als Lebende überhaupt aushalten, mit<br />
dem Tod vor Augen zu existieren, daß wir uns nämlich keines wegs so verhalten, als<br />
warteten wir nur die schließliche Voll streckung des Todesurteils ab, das bei unserer<br />
Geburt über uns gesprochen wurde, mag damit zusammenhängen, daß wir je weils<br />
in eine uns spannende Geschichte verstrickt sind, deren Ausgang wir nicht kennen.<br />
Der Lebensüberdruß, das taedium vitae, ist vielleicht nichts anderes als ein Erlahmen<br />
dieses Ge spanntseins.<br />
Der Grund, warum die Spannung des Lebens, gleichsam der Elan des mit der Geburt<br />
gegebenen Anfangs, anhalten kann bis zum Tode, liegt darin, daß die Bedeutung einer<br />
jeden Ge schichte sich voll erst dann enthüllt, wenn die Geschichte an ihr Ende gekommen<br />
ist, daß wir also zeit unseres Lebens in eine Geschichte verstrickt sind, deren<br />
Ausgang wir nicht kennen. Im Gegensatz zu allen Herstellungsprozessen, deren Gang<br />
vor gezeichnet ist durch die Vorstellung oder das Modell, in deren Besitz der
Herstellende sein muß, bevor er sein Werk beginnt, erhellen sich Handlungsprozesse –<br />
gleich welchen Inhalt und Charakter sie haben, ob sie im Privaten oder im Öffentlichen<br />
sich abspielen, ob viele oder wenige an ihnen beteiligt sind – erst dann, wenn das Handeln<br />
selbst an seinen Abschluß ge kommen ist, oft wenn alle Beteiligten tot sind. Es<br />
gibt keine Ereignisse, die eindeutig in die Zukunft weisen, so sehr sie auch immer ihr<br />
Licht auf das Vergangene werfen mögen. Darum kennen die volle Bedeutung dessen,<br />
was sich handelnd jeweils ereignete, nicht diejenigen, die in das Handeln verstrickt<br />
waren und direkt von ihm betroffen, sondern derjenige, der schließ lich die Geschichte<br />
überblickt und sie erzählt. Die Rede von dem Historiker als dem rückwärts gewandten<br />
Propheten hat in der Tat so viel für sich, daß der Geschichtsschreiber es wirklich<br />
gemeinhin besser weiß als diejenigen, die ihm zu seinen Ge schichten verholfen haben.<br />
In der Hand des Historikers werden die von den Handelnden selbst erstatteten Berichte<br />
und Me moiren zum Quellenmaterial, das auf seine Relevanz und Glaubwürdigkeit im<br />
Ganzen erst geprüft werden muß, und dies selbst in den seltenen Fällen, in denen<br />
völlig wahrheitsgemäß über Absichten, Ziele und Motive Rechenschaft gegeben wurde,<br />
weil die eigentliche Signifikanz dieser Absichten, Ziele und Motive ja erst erscheint,<br />
wenn das Gesamtgewebe, in das sie schlugen, halbwegs bekannt ist. Daher können es<br />
die von den Handelnden selbst erstatteten Rechenschaftsberichte an Bedeutungsfülle<br />
kaum je mit der Geschichte aufnehmen, die sich dem rückwärts gekehrten Blick des<br />
Geschichtsschreibers und Geschichtenerzählers enthüllt. Was sich in der erzählten<br />
Geschichte darbietet, bleibt dem Handelnden qua Handelnden schon darum verborgen,<br />
weil die Motive seiner Tat ja keineswegs in der Bedeutung liegen, die sich in der aus ihr<br />
resultieren den Geschichte schließlich hergestellt hat. So sind erzählbare Geschichten<br />
zwar die einzigen eindeutig-handgreiflichen Re sultate menschlichen Handelns, aber es<br />
ist nicht der Han delnde, der die von ihm verursachte Geschichte als Geschichte erkennt<br />
und erzählt, sondern der am Handeln ganz unbeteiligte Erzähler.
Die empathische<br />
Zivilisation<br />
Wege zu einem<br />
globalen Bewusstsein<br />
Jeremy Rifkin
1 Freud 1997, S. 42<br />
2 Ebd., S. 60<br />
3 Ebd., S. 66<br />
Teil I<br />
Homo empathicus<br />
Kapitel 2<br />
Der neue Blick auf die menschliche Natur<br />
Woraus sind wir gemacht? In einer Zeit, die besessen ist von materiellen Interessen,<br />
verwundert es nicht, wenn Biologen – ganz zu schweigen von Che mikern und Physikern –<br />
auf der Suche nach dem Inbegriff des Lebens materielle Erklärungen herangezogen<br />
haben. Bis vor kurzem waren auch die meisten Philosophen überzeugt, dass wir von<br />
Grund auf materialistische Wesen sind. Und selbst die Psychologen der ersten Stunde –<br />
obwohl sie sich weniger mit philosophischen Betrachtungen über das Wesen des<br />
Menschen befassten als mit klinisch-wissenschaftlichen Beobachtungen dazu, wie die<br />
menschliche Psyche funktioniert – hielten an den alten Vorurteilen über die materielle<br />
Prägung der menschlichen Natur fest. Wie bereits Adam Smith gingen sie davon aus,<br />
dass jeder Mensch im Kern darauf aus sei, sein pures wirtschaftliches Eigeninteresse<br />
zu verfolgen. Und mit Darwin waren sie der Ansicht, dass die erste Sorge jedes Menschen<br />
dem eigenen physischen Überleben und der Fortpflanzung gelte.<br />
Freud: der letzte große Utilitarist<br />
Auch wenn Sigmund Freud als Vordenker gilt, der dem Blick auf die mensch liche<br />
Natur eine vollkommen neue Perspektive gegeben hat, folgt er in den wichtigsten<br />
und grundlegendsten Aspekten seiner theoretischen Überle gungen strikt dem<br />
materialistischen Drehbuch. Es ist ihm gelungen, eine weltliche Variante der mittelalterlichen<br />
These von der grundsätzlich verderbten Natur des Menschen mit dem<br />
materialistischen Narrativ der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zu verbinden. Sein<br />
erschreckendes Bild der menschlichen Natur war so eindrucksvoll und gewaltig, dass<br />
es unsere Wahrnehmung bis zum heutigen Tag geprägt hat und sich in allen Bereichen<br />
der Gesellschaft – ob in der Erziehung, dem Sozialverhalten, der Wirtschaft oder<br />
der Politik – niederschlägt.<br />
Freud hat uns als sein großes Erbe die Sexualisierung des materiellen Ei geninteresses<br />
hinterlassen. Und es dauerte nicht lange, bis sein sexualisier tes Menschenbild von<br />
John B. Watson, einem anderen Pionier der neuen Wissenschaft, der die eben gewonnenen<br />
Einsichten auf das Gebiet der Wer bepsychologie übertrug, aufgegriffen wurde.<br />
Man kann sicher mit Fug und Recht behaupten, dass der Siegeszug des Konsumkapitalismus<br />
zu einem nicht geringen Teil auf die Erotisierung der Sehnsüchte und<br />
Wünsche und die Sexualisierung des Konsums zurückzuführen ist. Werbebotschaften<br />
sind durchdrungen von erotischen Assoziationen.<br />
Freud stellt die Frage an den Anfang, was die Menschen „vom Leben for dern, in ihm<br />
erreichen wollen“, und übt den Schulterschluss mit den Utilita risten des 19. Jahrhunderts,<br />
wenn er über das menschliche Streben nach Glück sinniert: „Dies Streben<br />
hat zwei Seiten, ein positives und ein negatives Ziel, es will einerseits die Abwesenheit<br />
von Schmerz und Unlust, andererseits das Erleben starker Lustgefühle.“1 Und er geht<br />
noch einen Schritt weiter in seiner Argumentation: „Wenn wir ganz allgemein annehmen,<br />
die Triebfeder aller menschlichen Tätigkeiten sei das Streben nach den beiden zusammenfließenden<br />
Zielen, Nutzen und Lustgewinn, so müssen wir dasselbe auch für die<br />
hier angeführten kulturellen Äußerungen gelten lassen …“2<br />
Weil die „geschlechtlichen Beziehungen“ dem Menschen „die stärksten Befriedigungserlebnisse<br />
gewähren, ihm eigentlich das Vorbild für alles Glück geben“, sei es naheliegend<br />
für ihn, „die genitale Erotik in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen“.3 Der<br />
Wunsch nach sexueller Befriedigung sei so stark, dass die gesamte äußere Wirklichkeit
124 — 125<br />
Jeremy Rifkin<br />
4 Ebd., S. 75 f.<br />
5 Ebd., S. 76<br />
6 Ebd., S. 76 f.<br />
7 Ebd., S. 79<br />
8 Ebd., S. 82 f.<br />
lediglich als Instrument angesehen werde, diese zu erreichen. Der Mensch ist demnach<br />
ein von Natur aus aggres sives, bloß von seiner Libido getriebenes Ungeheuer:<br />
Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alldem ist, daß der Mensch nicht ein<br />
sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu<br />
verteidigen vermag, sondern daß er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen<br />
Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste<br />
nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine<br />
Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädi gung auszunützen,<br />
ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner<br />
Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu<br />
töten. Homo homini lupus.4<br />
Hier wird der Mensch entlarvt als „wilde Bestie, der die Schonung der eige nen Art<br />
fremd ist“.5<br />
Die Kultur ihrerseits ist nicht viel mehr als ein ausgeklügeltes psychosozi ales Gefängnis,<br />
geschaffen, um den aggressiven Sexualtrieb des Menschen zu bändigen, damit er nicht<br />
zum Krieg eines jeden gegen jeden und zur ge genseitigen Vernichtung führt. Freud<br />
geht so weit, die Liebe zu einer „zielge hemmten Methode“ zu erklären, mit deren Hilfe<br />
der primitivere und aggres sivere Sexualtrieb in Zaum gehalten werden soll. Von dem<br />
christlichen Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, behauptet Freud geringschätzig,<br />
„daß nichts anderes der menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft“.6 Kultur ist<br />
ihm zufolge lediglich ein zweckdienlicher Kompromiss, auf den die Men schen zähneknirschend<br />
eingegangen sind, um „für ein Stück Glücksmög lichkeit ein Stück Sicherheit“<br />
einzutauschen.7<br />
Wenn es, wie Freud behauptet, der Natur der Menschen entspricht, sich gegenseitig<br />
umzubringen, wie kommt es dann, dass das Leben selbst offen bar nach immer geordneteren<br />
und komplexeren Zuständen strebt? Wenn der Hang zur Zerstörung alles wäre,<br />
was die biologische Grundausstattung des Menschen bestimmt, so stünden wir damit<br />
einigermaßen im Gegensatz zur Darwinschen Evolutionstheorie, aber auch zu den<br />
Gesetzen der Thermo dynamik. Um diesen Widerspruch zu lösen, nahm Freud zu dem<br />
Zuflucht, was er den „Todestrieb“ nannte. Der Begriff sollte zum Angelpunkt seiner<br />
Sicht der menschlichen Psyche werden. Seiner eigenen Aussage nach kam ihm die Idee<br />
des „Todestriebes“, während er 1920 an Jenseits des Lustprinzips schrieb:<br />
Ausgehend von Spekulationen über den Anfang des Lebens und von biologischen<br />
Parallelen, zog ich den Schluß, es müsse außer dem Trieb, die lebende Substanz zu<br />
erhalten und zu immer größeren Einheiten zusammenzufassen, einen anderen, ihm<br />
gegensätzlichen geben, der diese Einheiten aufzulösen und in den uranfängli chen,<br />
anorganischen Zustand zurückzuführen strebe. Also außer dem Eros einen Todestrieb;<br />
aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken dieser beiden ließen sich die<br />
Phänomene des Lebens erklären … Der Trieb würde so selbst in den Dienst des Eros<br />
gezwängt, indem das Lebewesen anderes, Belebtes wie Unbelebtes, anstatt seines<br />
eigenen Seins vernichtete. Umgekehrt würde die Einschränkung dieser Ag gression<br />
nach außen die ohnehin immer vor sich gehende Selbstzerstörung stei gern müssen.8<br />
Ob Allmachts- und Dominanzgefühle oder Selbsterniedrigung und Selbst zerstörung,<br />
ob Sadismus oder Masochismus – für Freud stand letztendlich das gesamte Leben<br />
im Dienst des Todestriebes, und nicht wenige führende Denker seiner Zeit schlossen<br />
sich dieser pessimistischen Sicht der menschli chen Natur an.<br />
In Freuds Welt sind alle anderen menschlichen Gefühle bloße Symptome der Unterdrückung<br />
des Sexual- und des Todestriebes. Selbst Liebe und Zärt lichkeit sind
9 Ebd., S. 31<br />
unterdrückte oder abgeschwächte Ausdrucksformen des eroti schen Impulses. Kultur<br />
hat nur einen einzigen Sinn und Zweck: Sie soll uns als Vehikel dienen, um unsere<br />
libidinösen Wünsche und unser Dominanzbe dürfnis zu befriedigen und unsere materiellen<br />
Eigeninteressen zu verfolgen.<br />
Was in Freuds Denkgebäude seltsamerweise fehlt, ist eine gründlichere Analyse der<br />
Mutterliebe, dieser starken Kraft, die bei allen Säugetieren zu beobachten ist. Hier liegt<br />
einer der Schlüssel zu Freuds eigener psychischer oder gar pathologischer Befindlichkeit.<br />
In Das Unbehagen in der Kultur macht Freud eine Bemerkung, die Bände spricht. In<br />
Bezug auf das „Gefühl der un auflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit<br />
mit dem Ganzen der Außenwelt“, das sich dem ursprünglichen Einssein eines Säuglings<br />
mit sei ner Mutter verdankt, schreibt er: „Ich selbst kann dieses ‚ozeanische‘ Gefühl<br />
nicht in mir entdecken“9 – obwohl er einräumt, dass andere solche Empfin dungen<br />
haben könnten. Für ihn ist schon das Kleinkind das libidogetriebene Wesen, das es<br />
auch als Erwachsener einmal sein wird. Die Mutter ist nicht das Objekt seiner Liebe und<br />
Zuneigung, sondern ein Nutzobjekt, dessen einziger Zweck darin besteht, der eigenen<br />
Lustbefriedigung zu dienen. Bindung, Liebe, Zuneigung und Freundschaft sind bloße<br />
Illusion. Die Eltern-Kind-Be ziehung ist vom ersten Moment an zweckorientiert und nur<br />
dazu bestimmt, dem Kind maximale Lustbefriedigung zu verschaffen.<br />
Freud stellt die interessante Frage, ob sich das „ozeanische“ Gefühl, das in Bezug<br />
auf die Kindheit so oft beschrieben wird, möglicherweise beim Er wachsenen in dem<br />
Bedürfnis nach Religiosität und Nähe zu Gott äußert, ver wirft den Gedanken aber<br />
zumindest da, wo es um einen Ersatz für mütterliche Zuwendung geht. Er sieht die<br />
Quelle der Religiosität vielmehr in der „infantilen Hilflosigkeit und der durch sie<br />
geweckten Vatersehnsucht“. Reli giosität ist für Freud also rein zweckgebunden und<br />
der Sehnsucht nach einer schützenden Vaterfigur geschuldet. Mütterliche Liebe<br />
und Fürsorge und das Gefühl gegenseitiger Zuneigung sind Fantasiegebilde, hinter<br />
denen sich ein tiefer liegender narzisstischer Trieb verbirgt.<br />
Freud war der Letzte der alten Garde. Meisterhafter Geschichtenerzähler, der er war,<br />
lieferte er ein überzeugendes säkulares Plädoyer für das patriar chale Narrativ, das<br />
in den großen Ackerbaukulturen des Nahen und Fernen Ostens wurzelte und sich in<br />
den Abrahamitischen Religionen und im Konfu zianismus zu voller Blüte entwickelt<br />
hatte. In einem letzten großen Gefecht führte Freud die geballte Kraft des gerade neu<br />
entdeckten Unbewussten ins Feld, um seinem Argument der männlichen Dominanz<br />
als natürlicher Ord nung der Dinge zur Geltung zu verhelfen. Der Ödipuskomplex war ein<br />
gelun gener Plot, eigens zu dem Zweck erfunden, den männlichen Protagonisten als<br />
Hauptdarsteller auf der Bühne der Weltgeschichte festzuschreiben. Die Rolle der Frau<br />
hingegen blieb ihm, abgesehen davon, dass sie Kinder gebiert und sie mit ihrer Milch<br />
nährt, als Figur auf dieser Bühne ein ewiges Rätsel, wie er selbst eingestand. Für<br />
ihn waren alle anderen geistigen und emotionalen Anlagen, über die sie möglicherweise<br />
verfügen mochte, nur ein blasser Schatten des Männlichen. Kein Wunder also,<br />
dass Freud die weibliche Psyche vollkommen verleugnete, indem er behauptete,<br />
das Verhalten der Frau re flektiere in seiner Summe letztendlich den „Penisneid“, der<br />
ihr angeboren sei.<br />
Aber selbst Freuds beredtes Plädoyer für die männliche Überlegenheit konnte nicht<br />
verhindern, dass der Zahn der Zeit an den patriarchalen Grund festen zu nagen<br />
begann, die sich mehr als fünf Jahrtausende lang behauptet hatten. Die Entwicklungen<br />
im Kommunikations- und Energiesektor, die zur ersten und zweiten industriellen<br />
Revolution geführt hatten, befreiten die Frauen aus der Jahrhunderte währenden<br />
Leibeigenschaft und Sklaverei, in der das patriarchale System sie gehalten hatte. Mit<br />
dem automatisierten Buchdruck fanden Romane Verbreitung, in denen Frauen sich und<br />
ihre sozi alen Beziehungen gespiegelt fanden, was sie darin bestärkte, die mühsame<br />
Entdeckungsreise zu ihrem eigenen Ich anzutreten. Das Telefon wiederum bot Millionen
126 — 127<br />
Jeremy Rifkin<br />
Frauen die Möglichkeit, dem Gefängnis ihrer heimischen vier Wände zu entfliehen und<br />
ihre Alltagserfahrungen mit anderen auszutau schen. Während der Roman als Instrument<br />
der Selbstreflexion fungierte, trug das Telefon als Kommunikationsforum dazu bei,<br />
dass sich ein Gefühl weiblicher Solidarität entwickeln konnte.<br />
Beides hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Frauen sich der Aufsicht ihrer Männer<br />
entziehen sowie eine eigene Identität und Stimme finden konnten. Vor der allgemeinen<br />
Alphabetisierung, der Einführung der Rotati onsdruckmaschinen und der Erfindung<br />
des Telefons waren die Möglich keiten für Frauen, sich eine eigene Meinung zu bilden<br />
und über die Kaffeekränzchen im familiären Kreis hinaus mit Geschlechtsgenossinnen<br />
auszutauschen, ziemlich beschränkt. Die männliche Dominanz war allgegenwärtig und<br />
einschüchternd. Nun aber hatten Frauen die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern<br />
und ihre weibliche Identität zu finden. Später waren es dann Kino, Radio und Fernsehen,<br />
die zu dieser Identitätsfindung und -erwei terung beitrugen.<br />
Mit der Einführung eines staatlichen Schulsystems wurden Frauen all mählich die<br />
gleichen Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet wie Männern. Die Verbreitung<br />
des Automobils, die Elektrifizierung der Wohnhäuser und die Massenproduktion<br />
elektrischer Haushaltsgeräte sorgten zumindest teil weise dafür, dass die Frauen<br />
nicht mehr in täglicher Schinderei die Dinge fertigen mussten, die ihre Familien zum<br />
Leben brauchten. Dadurch, dass sich auch in der Produktion, der Logistik und in den<br />
Dienstleistungen der Schwerpunkt von der körperlichen zur geistigen und emotionalen<br />
Arbeit verschob, fanden immer mehr Frauen Eingang in die Fabriken und Büros der<br />
moder nen Wirtschaftsunternehmen. Auch wenn sie ihre Fähigkeiten und Talente nicht<br />
so uneingeschränkt einbringen konnten wie die Männer und für ihre Arbeit wesentlich<br />
schlechter bezahlt wurden als diese, spielte die semi-unabhängige Lohnempfängerin<br />
eine wesentliche Rolle in der Veränderung der Geschlechterbeziehungen.<br />
Freud entwickelte seine Theorien in den Jahrzehnten, in denen sich in Eu ropa und<br />
Nordamerika der Übergang von der ersten zur zweiten industriel len Revolution vollzog.<br />
Seine brillantesten Schriften hat er in den 1920er Jahren verfasst, just zu der Zeit,<br />
als die Fabrikmaschinen von Dampfkraft auf Strom umgestellt wurden, Frauen in Henry<br />
Fords T-Modell das Steuer übernahmen und Frauenrechte zu einem beherrschenden<br />
Thema wurden. Die neue Generation von Frauen, für die der Schriftsteller F. Scott<br />
Fitzgerald den Begriff „Flapper“ erfand, wurde mit ihrem Bild des trotzigen Aufbegehrens<br />
gegen die männliche Dominanz zum Inbegriff der Goldenen Zwanziger.<br />
Was Kinder wirklich wollen<br />
Diese Entwicklungen veranlassten eine jüngere Generation von Psychoana lytikern,<br />
zentrale Aspekte in Freuds Thesen zur menschlichen Natur infrage zu stellen. Passenderweise<br />
war es mit der Psychoanalytikerin Melanie Klein eine Frau, die, wenn auch eher<br />
unbeabsichtigt, als erste namhafte Vertreterin ihres Standes an den Grundfesten des<br />
Freudschen Gedankengebäudes rüttelte. Mit ihrer Objektbeziehungstheorie öffnete sie<br />
die Tür nur einen Spaltbreit, aber immerhin doch weit genug, dass andere die Mauern<br />
der Freud schen Festung überwinden und der Welt eine neue Geschichte vom Wesen<br />
der menschlichen Natur präsentieren konnten – eine Geschichte, die sich besser vertrug<br />
mit den technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Kräf ten, die nun die Gesellschaft<br />
zu prägen begannen. Anders als Freud, als des sen treue Anhängerin sie sich<br />
gleichwohl bis an ihr Lebensende verstand, schrieb Klein der Mutter eine zentrale Rolle<br />
in der menschlichen Entwick lung zu.<br />
Freud war der Erste, der im Zusammenhang mit der Sexualisierung früh kindlicher<br />
Beziehungen den Begriff des „Objekts“ eingeführt hatte. In seiner 1905 verfassten<br />
Schrift Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie nannte er „die Person, von welcher die<br />
geschlechtliche Anziehung ausgeht, das Sexualob jekt und die Handlung, nach welcher
10 Freud 2009, S. 37 f.<br />
11 Ebd., S. 117<br />
12 Vgl. Gerson 2004, S. 773;<br />
Buckley 1986, S. 2<br />
13 Fairbairn 2000, S. 62<br />
14 Ebd.<br />
15 Ebd., S. 63<br />
der Trieb drängt, das Sexualziel“.10 Freud zufolge wechselt ein Individuum, um seine<br />
sexuelle Lust zu befriedigen, ständig von einem Objekt zu nächsten, mit dem Ziel des<br />
„zeitweiligen Erlö schens der Libido“.11 Klein blieb mit ihrer Objektbeziehungstheorie<br />
der Freud schen Linie treu, mit zwei Ausnahmen. Zwar betrachtete sie wie Freud Libido<br />
und Aggression als primäre Triebe, aber sie legte das Schwergewicht auf letz teren.<br />
Ihr zufolge richtet sich die Aggression zuallererst gegen die Mutter brust. Der Säugling<br />
spaltet dieses primäre Objekt in die gute Brust, die seinen libidinösen Trieb befriedigt,<br />
und die böse Brust, die ihn frustriert und ihm die Triebbefriedigung versagt. Ferner<br />
behauptete sie, dass das Ich in einer primitiven Form von Geburt an eine Rolle spielt<br />
und es dem Kleinkind er möglicht, verinnerlichte Objektbeziehungen zu schaffen.<br />
Dieses schon dem Säugling eigene Bewusstsein, so die weitere Schlussfolgerung, führt<br />
dazu, dass nicht der Vater, sondern die Mutter das erste verinnerlichte Objekt des<br />
Kindes ist.<br />
Demnach ist es auch die Mutter, gegen die sich die naturgegebene Aggres sion im<br />
frühesten Stadium der Kindheit richtet. Da der Säugling die Mutter brust aber in eine gute<br />
und eine böse Brust aufspaltet, hegt er kontroverse Gefühle gegenüber diesem Objekt.<br />
Wenn das Kind älter wird und in der Mut ter nicht mehr nur die Brüste sieht, sondern eine<br />
eigenständige Person, die es umsorgt, führt dieser Zwiespalt zu der Befürchtung, seine<br />
Aggression könnte dem guten Objekt schaden. Daraus resultieren bei dem Kind Reue -<br />
und Schuldgefühle sowie das Bedürfnis nach Wiedergutmachung, um die Beziehung nicht<br />
zu zerstören, auf die es zur Befriedigung seiner Libido ange wiesen ist.<br />
Auch wenn Klein in der Freudschen Tradition überzeugt war, dass der pri märe Trieb<br />
eines Kindes libidinöser und aggressiver Natur sei, hielt sie es doch immerhin für<br />
möglich, dass menschliche Beziehungen durch Gemein sinn moduliert werden können.<br />
Weil sie jedoch wie Freud Destruktions- und Todestrieb als fest in der menschlichen<br />
Psyche verankert ansah, konnte sie den Gemeinsinn auch nicht als primären Trieb,<br />
sondern lediglich als einen sekundären Kompensationstrieb begreifen.12<br />
Andere hingegen griffen nach dem dünnen Strohhalm der Hoffnung, den Melanie Klein<br />
geliefert hatte, und nahmen Freuds These vom angeborenen Destruktionstrieb im<br />
Dienste der Libidobefriedigung des Kindes unter Beschuss. Es waren Psychoanalytiker<br />
wie William Fairbairn, Heinz Kohut, Do nald Winnicott und Ian Suttie, die das Bedürfnis<br />
nach Gemeinschaft zum Primärtrieb und destruktives und aggressives Verhalten zu<br />
einer kompen satorischen Reaktion auf die Unterdrückung dieses elementarsten aller<br />
menschlichen Bedürfnisse erklärten. Für sie waren Objektbeziehungen nicht zweckgerichtet<br />
und vom Bedürfnis nach Lustbefriedigung bestimmt, son dern von dem Wunsch<br />
nach Gemeinsamkeit, Liebe, Zuneigung und Freund schaft getragen.<br />
Fairbairn leitet den Angriff mit einer einfachen Frage ein: „Warum lutscht ein Baby<br />
am Daumen?“ Und er fährt fort: „Die Antwort auf diese einfache Frage entscheidet<br />
über die gesamte Validität der Konzeption erogener Zonen und der davon abgeleiteten<br />
Libidotheorie.“13 Freud wollte uns glauben ma chen, dass das Kind am Daumen lutscht,<br />
weil sein Mund eine erogene Zone sei und das Lutschen ihm erotischen Lustgewinn<br />
verschaffe. Das mag auf den ersten Blick überzeugend klingen, aber Fairbairn schließt<br />
eine zweite Frage an: „Warum an seinem Daumen?“, und hat auch die Antwort parat:<br />
„Weil keine Brust zum Saugen da ist.“ Er bezeichnet das Daumenlutschen als eine<br />
„Technik, um mit einer unbefriedigenden Objektbeziehung fertig zu werden“.14 Der<br />
Säugling sucht sich, mit anderen Worten, ein Ersatzobjekt zur Befriedigung seiner Lust,<br />
weil ihm das, was er sich eigentlich wünscht, näm lich eine Beziehung zur mütterlichen<br />
Brust und zur Mutter selbst, verwehrt wird. Hier weicht Fairbairn definitiv von Freud<br />
und Klein ab und legt den Grundstein für eine grundlegende Spaltung in der Psychoanalyse.<br />
Er schreibt: „Wir müssen uns jedoch immer vor Augen führen, daß nicht die<br />
libidinöse Haltung die Objektbeziehung bestimmt, sondern die Objektbeziehung die<br />
libidinöse Haltung.“15
128 — 129<br />
Jeremy Rifkin<br />
16 Ebd., S. 69<br />
17 Ebd., S. 90<br />
18 Kohut 1981<br />
Alle Formen frühkindlicher Sexualität, von der Freud so besessen war, sind Fairbairn<br />
zufolge Ersatzhandlungen, mit denen das Kind seine Sorge um das zu beschwichtigen<br />
sucht, was es sich wirklich wünscht und was ihm teilweise oder auch weitestgehend<br />
verweigert wird. Und was ist das, was sich jedes Kind vor allem anderen wünscht und<br />
nicht zu bekommen fürchtet? Auf diese Frage hat Fairbairn eine eindeutige Antwort:<br />
Die Frustration seines Bedürfnisses, als Person geliebt zu werden und zu sehen,<br />
daß seine Liebe angenommen wird, ist das schwerste Trauma, das einem Kind<br />
zu gefügt werden kann. Dieses Trauma ist die Hauptursache für die verschieden -<br />
arti gen Fixierungen der frühkindlichen Sexualität, in die sich das Kind flüchtet, wenn<br />
es versucht, das Scheitern seiner emotionalen Beziehungen zu seinen äußeren<br />
Ob jekten durch Ersatzbefriedigungen zu kompensieren.16<br />
Wenn ein Kind das Gefühl hat, dass es als Person nicht geliebt wird oder dass seine<br />
Liebe nicht angenommen wird, stagniert sein Reifeprozess, und es be ginnt, anomale<br />
Beziehungen und krankhafte Symptome wie aggressives, zwanghaftes, paranoides,<br />
hysterisches und phobisches Verhalten zu entwi ckeln. All diesen Verhaltensauffälligkeiten<br />
liegt ein tiefes Gefühl der Isola tion und Verlassenheit zugrunde.<br />
Fairbairn kommt zu dem Schluss, dass Freud mit seiner Sicht der mensch lichen Natur<br />
in zwei entscheidenden Punkten irrt, nämlich hinsichtlich der von ihm postulierten<br />
elementaren Bedeutung des libidinösen Triebes und dessen Befriedigung:<br />
Zu den folgenreichsten Schlüssen, die ich … dargelegt habe, zählen 1. meine Auffassung,<br />
daß libidinöse ‚Ziele‘ im Vergleich zu den Objektbeziehungen zweitrangig<br />
sind, und 2. meine Ansicht, daß das eigentliche Ziel der libidinösen Strebungen nicht<br />
in der Triebbefriedigung, sondern in einer Beziehung zum Objekt besteht.17<br />
Die Implikationen dieser Beobachtungen sind gewaltig, denn sie bringen die Fundamente<br />
der Freudschen Lehrmeinung über die Natur des Menschen ins Wanken. Freud,<br />
erinnern wir uns, sah in der Libido einen uns innewohnen den Primärtrieb. Das Kind<br />
sucht, dem „Lustprinzip“ entsprechend, von Ge burt an uneingeschränkte Lustbefriedigung<br />
in unterschiedlicher erotisierter Form. Bevor ein Ich existiert, gibt es schon das<br />
Es, eine Urkraft auf der Suche nach libidinöser Befriedigung. Aber mit der Zeit muss<br />
die Gesellschaft dem Lustprinzip Schranken setzen, weil sonst keine geregelte soziale<br />
Interaktion möglich ist. Dazu dient das von der Gesellschaft eingesetzte „Realitätsprin<br />
zip“ in Form elterlicher Verbote und Gebote, angefangen bei der Sauberkeitserziehung<br />
und anderen Methoden der Konditionierung. Solche Maßnahmen tragen dazu<br />
bei, das Ich zu formen, was nicht viel mehr ist als ein Mechanis mus, die libidinösen<br />
Triebe zugunsten der Sozialisation zu unterdrücken und zu beherrschen.<br />
Andere Psychoanalytiker schlossen sich Fairbairns Kritik an und formu lierten eine<br />
Gegentheorie, in deren Mittelpunkt die grundlegende Bedeu tung sozialer Beziehungen<br />
für die Entwicklung der Psyche und des Selbst stand. Heinz Kohut war ebenfalls<br />
der Auffassung, dass der Destruktionstrieb nicht in der Natur des Menschen angelegt<br />
ist, sondern nur dann auftritt, wenn keine verlässlichen Beziehungen hergestellt<br />
werden können. Er erwei terte Winnicotts Analyse um die Überlegung, welche wichtige<br />
Rolle Empa thie für die Entwicklung des reifen Selbst spielt und welche negativen<br />
Aus wirkungen es auf die Bildung des Ich hat, wenn sie fehlt.18 Kohut postuliert, dass<br />
Kinder von Geburt an über einen Selbstbehauptungstrieb verfügen, un terscheidet<br />
diesen aber von Wut, Aggression und destruktivem Verhalten. Ersteren betrachtet er<br />
als notwendige Voraussetzung für die Ich-Bildung und die Entwicklung eines reifen<br />
Selbst, letztere als Ausdruck einer misslunge nen Selbstobjektbeziehung infolge fehlender<br />
Empathie vonseiten des signi fikanten Anderen, eines Elternteils oder beider Eltern.
19 Kohut 1985, S. 166<br />
20 Ebd., S. 167<br />
21 Winnicott 1998, S. 188<br />
22 Ebd., S. 151, 153<br />
Aufgrund jahrelanger klinischer Beobachtungen gelangte Kohut zu der Überzeugung,<br />
dass die Bestätigung und Empathie, die ein Kind von seinen Eltern erfährt oder<br />
nicht, darüber entscheidet, was für eine Persönlichkeit es später werden wird: „Die<br />
Bedeutung eines empathischen Umfelds kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“19<br />
Dabei stellte Kohut fest, dass es kaum eine Rolle spielt, wer im frühen Kindesalter die<br />
Elternrolle übernimmt, solange die jeweilige Person das für eine gesunde Entwicklung<br />
des Kindes notwendige empathische Umfeld schafft. Um zu zeigen, dass es dazu<br />
nicht unbedingt der biologischen Mutter bedarf, führt er einen Fall an, über den Anna<br />
Freud und Sophie Dann berichtet hatten. Es ist die Geschichte von sechs Kindern, die<br />
während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager überlebten. Im Laufe<br />
der drei Jahre, die sie in dem Lager verbrachten, küm merte sich eine ständig wechselnde<br />
Gruppe von Müttern um sie. Wenn eine der Ersatzmütter ermordet wurde, übernahm<br />
eine andere ihren Platz und immer so weiter. Obwohl die Kinder durch diese Erfahrung<br />
verständlicher weise traumatisiert waren, verfügten sie doch über verhältnismäßig<br />
stabile Persönlichkeiten, was nur auf die empathische Zuwendung zurückgeführt werden<br />
kann, die sie von ihren zahlreichen Ersatzmüttern erfahren hatten.20<br />
Im Gegensatz zu Fairbairn und Kohut, die zum Frontalangriff gegen Freuds Sicht der<br />
menschlichen Natur bliesen, war ihr Zeitgenosse Donald Winnicott subtiler, wenn auch<br />
nicht weniger treffend in seiner Kritik, die sich auf seine jahrzehntelange Arbeit mit<br />
Säuglingen und Kleinkindern stützte. Seine Kri tik richtete sich gegen die Vorstellung<br />
vom mit sich selbst beschäftigten klei nen Individuum, für das die Welt nur dazu<br />
bestimmt sei, seinen unersättli chen Hunger zu stillen: „In diesem sehr frühen Stadium<br />
ist es auch nicht logisch, von einem Individuum zu sprechen …, weil es noch kein<br />
individuel les Selbst gibt.“21 Obwohl der Gedanke zu dieser Zeit eher ungewöhnlich<br />
schien, hat Winnicott hier, rückblickend gesehen, ein wichtiges Argument ins Feld<br />
geführt: nämlich dass sich zwar ein Kind im Mutterleib, ein Indivi duum hingegen in<br />
einer Beziehung bildet. Eine Gemeinschaft wird also nicht von Individuen geschaffen,<br />
vielmehr bringt die Gemeinschaft Individuen hervor – erst eine Beziehung, dann das<br />
Individuum, nicht umgekehrt. Diese einfache Beobachtung rüttelt an den Grundfesten<br />
der Moderne mit ihrer Be tonung des autonomen Einzelnen, der der Welt seinen Willen<br />
aufzwingt.<br />
Winnicott untermauert seine These, indem er das erste Aufschimmern der Bewusstwerdung<br />
eines Säuglings in seiner allerersten Handlung – der Suche nach der<br />
mütterlichen Brustwarze – beschreibt. Wenn die Mutter ihr Kind zum ersten Mal an<br />
die Brust legt, muss sie ihm erlauben, den Nippel selbst zu entdecken. Sie muss ein<br />
spielerisches Geschenk daraus machen und, wichtiger noch, dem Säugling das – wenn<br />
auch nur undeutlich wahrgenommene – Gefühl vermitteln, die Brust und damit „die<br />
Welt erschaffen“ zu haben. „Die Mutter“, so Winnicott, „wartet darauf, entdeckt zu<br />
werden.“22 Dies ist der Anfang der ersten Beziehung des Kindes und prägt die Entwicklung<br />
seines Selbst. Dieser erste Schöpfungsakt ist die Grundlage, auf der sich später<br />
das Gefühl für das Ich und das Du bilden kann. Die Bedeutung des ersten Stillens fasst<br />
Winnicott so zusammen:<br />
Auf der Grundlage zahlloser Sinneseindrücke, die mit der Aktivität des Stillens und<br />
der Entdeckung des Objekts einhergehen, werden Erinnerungen aufgebaut. So<br />
entwickelt sich im Laufe der Zeit ein Zustand, in dem der Säugling voll Vertrauen wird,<br />
das Objekt seines Begehrens finden zu können, und dies bedeutet, daß der Säugling<br />
die Abwesenheit des Objekts allmählich zu ertragen lernt. Auf diese Weise entwickelt<br />
sich seine Vorstellung von der äußeren Realität … Die Magie des Begeh rens vermittelt<br />
dem Baby gewissermaßen die Illusion, magische, schöpferische Kräfte zu besitzen;<br />
durch die einfühlsame Anpassung seiner Mutter wird die Omni potenz Wirklichkeit.<br />
Die allmähliche Erkenntnis, daß es die äußere Realität nicht magisch zu beherrschen
130 — 131<br />
Jeremy Rifkin<br />
23 Ebd., S. 157<br />
24 Ebd., S. 155<br />
25 Suttie 1952, S. 4, 6<br />
26 Ebd., S. 16<br />
27 Ebd., S. 22<br />
28 Ebd., S. 50<br />
vermag, gründet in der Omnipotenz der frühen Phase, die dank der Anpassungstechnik<br />
der Mutter Realität wird.23<br />
Wenn es die Mutter beispielsweise nicht zulässt, dass der Säugling die Brust warze<br />
spielerisch entdeckt und auf magische Weise erschafft, sondern sie ihm quasi in den<br />
Mund schiebt, dann nimmt sie ihm die Möglichkeit, das Sinnesgedächtnis aufzubauen,<br />
das er braucht, um sich später als Individuum wahrzunehmen, das mit von ihm<br />
getrennten anderen interagiert. Die Mutter hilft ihrem Kind also durch die Art, wie<br />
sie in diese erste Beziehung mit ihm eintritt, eine eigenständige Person zu werden.<br />
Winnicotts Fazit lautet: „Vielleicht ist die Tatsache, daß der Säugling das Bedürfnis<br />
hat, die Mutterbrust selbst zu erschaffen, die wichtigste Information, mit der der<br />
Psychologe, wenn sein Wissen von der Gesellschaft akzeptiert wird, zur psychischen<br />
Gesundheit ihrer Mitglieder beitragen kann.“24<br />
lan Suttie ging noch einen Schritt weiter und lieferte eine Erklärung der menschlichen<br />
Natur, die Freuds Theorie diametral entgegengesetzt ist. Seine These: „Die biologische<br />
Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme könnte psy chologisch im seelischen Empfinden<br />
des Säuglings gespiegelt sein, nicht als ein Bündel praktischer Notwendigkeiten<br />
und möglicher Entbehrungen, son dern als Lust an der gegenseitigen Gesellschaft<br />
und in der Entsprechung als Unbehagen an Einsamkeit und Isolation.“ Er sieht im<br />
„angeborenen Bedürf nis nach Gesellschaft“ das wichtigste Mittel der Selbsterhaltung<br />
eines Säug lings und den eigentlichen Wesenskern des Menschen – denn in Wahrheit<br />
sind wir, so Suttie, ausgesprochen gesellige Wesen.25 Er geht davon aus, dass alle<br />
späteren Interessen des Individuums – die Art, wie es spielt oder sich in Konkurrenzsituationen<br />
verhält, seine Kooperationsfähigkeit und seine kul turellen und politischen<br />
Prägungen – ein Ersatz für die allererste Beziehung, die Bindung zwischen dem<br />
Säugling und seiner Mutter, sind. „Mit diesem Ersatz“, bemerkt Suttie, „setzen wir das<br />
gesamte soziale Umfeld an die Stelle, die einmal von der Mutter besetzt war.“26<br />
Für ihn war das Spielen die wichtigste gesellschaftliche Aktivität, weil im Spiel Kameradschaften<br />
entstehen, Vertrauen gebildet wird und Fantasie und Kreativität zum Einsatz<br />
kommen. Im Spiel können wir die existenzielle Angst vor der Einsamkeit überwinden<br />
und das Gefühl der Gemeinsamkeit wieder herstellen, das wir bei unserer uranfänglichen<br />
Spielgefährtin, unserer Mut ter, erstmals entdeckt haben: „Die Zeitspanne<br />
zwischen Kindheit und Er wachsenenalter wird von einem fast unstillbaren Bedürfnis<br />
nach Geselligkeit bestimmt, das sich der formbaren Kraft menschlicher Interessen<br />
zur Befrie digung im Spiel bedient.“27<br />
Den Gedanken, dass alle menschlichen Beziehungen, selbst die eines Säuglings, von<br />
dem Wunsch bestimmt sind, Macht über andere zu gewinnen, lehnt Suttie ab. Für ihn<br />
kann es keinen vermeintlichen Urzustand kindlicher Allmachtsgefühle geben, weil es<br />
auch kein ursprüngliches Selbstbewusstsein gibt. Erst wenn sich die Mutter weigert,<br />
sich dem Säugling zuzuwenden, oder wenn sie seine Liebesbezeugungen zurückweist,<br />
entstehen „Angst, Hass und Aggressionen (die Freud irrtümlich für einen primären<br />
Trieb hält) und das Streben nach Macht“.28<br />
Zu Beginn seines Lebens verfügt ein Kind demnach über das instinktive, wenn auch<br />
noch unausgereifte Bedürfnis zu geben und zu nehmen – die Grundvoraussetzung für<br />
Liebe und soziales Verhalten. Die Beziehung zwi schen Mutter und Kind ist symbiotisch,<br />
und sie erfordert ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Austeilen und dem<br />
Empfangen von Liebesbe weisen. Soziales Verhalten beruht auf Gegenseitigkeit, sie<br />
ist die Grundlage aller Beziehungen. Wenn die Gegenseitigkeit nicht funktioniert, wird<br />
die Entwicklung des Selbst und des Sozialverhaltens gehemmt, und es entstehen<br />
seelische Störungen.
29 Levy 1937, S. 644<br />
30 Bender u.a. 1941, S. 1169<br />
Der Mensch, ein durch und durch soziales Wesen<br />
Andere Wissenschaftler kamen unabhängig voneinander zu ähnlichen Er gebnissen<br />
wie die Objektbeziehungstheoretiker Fairbairn, Kohut, Winnicott und Suttie. In einer<br />
Reihe kontrollierter Studien mit Kindern, die in Waisen häusern oder bei Adoptiv-<br />
beziehungsweise Pflegeeltern aufgewachsen wa ren, gewannen Psychologen einige<br />
bedrückende Erkenntnisse, die offen sichtlich die Theorie vom Menschen als sozialem<br />
Wesen untermauerten.<br />
Das ursprüngliche Interesse des Psychoanalytikers David Levy richtete sich auf Kinder<br />
überfürsorglicher Mütter. Seine Kontrollgruppe bestand aus Kindern, die als Säuglinge<br />
überhaupt keine mütterliche Fürsorge genossen hatten und in der Folge unfähig waren,<br />
eine Bindung zu ihren Adoptiveltern zu entwickeln. Die meisten dieser Kinder hatten<br />
ein paar Jahre lang in Wai senhäusern gelebt, bevor sie in Familien vermittelt wurden.<br />
Schon bald ent deckte Levy bei den Kindern der Kontrollgruppe ein beunruhigendes<br />
Muster, das ihn veranlasste, sein Augenmerk jetzt ganz auf sie zu richten. Obwohl die<br />
Kinder, denen eine frühe Mutterbindung gefehlt hatte, nach außen hin durchaus ein<br />
liebevolles Verhalten zeigten, waren sie unfähig zu echter emo tionaler Wärme. Sie<br />
erwiesen sich oft als sexuell aggressiv, neigten zu unso zialem Verhalten und hatten<br />
in vielen Fällen ein beträchtliches Geschick beim Lügen und Stehlen entwickelt.<br />
Praktisch keines der Kinder war fähig, echte Freundschaften zu schließen. Levy zufolge<br />
waren sie außerstande, das gesamte Spektrum der Gefühle auszudrücken, die aus<br />
einer gesunden Bezie hung zu einer Mutterfigur erwachsen, weil ihr primärer Affekt<br />
nicht befriedigt wurde: Sie litten unter „Affekthunger“. Levy stellte die ziemlich<br />
beängs tigende Frage, ob es möglich sei, „dass es im emotionalen Leben zu Man gelerkrankungen<br />
kommen könnte, vergleichbar den physischen Folgen einer Mangelernährung<br />
beim sich entwickelnden Organismus“.29<br />
Andere Wissenschaftler machten ähnliche Beobachtungen bei Kindern, die in Waisenhäusern<br />
aufwuchsen. Loretta Bender, die Leiterin der Kinder psychiatrie am New Yorker<br />
Bellevue-Krankenhaus, stellte fest, dass diese Kinder beängstigend menschenfeindliche<br />
Züge aufwiesen. Sie schrieb:<br />
Sie haben kein Spielmuster und können sich nicht in eine spielende Gruppe ein bringen,<br />
sondern sie provozieren und ärgern andere Kinder, klammern sich an die Erwachsenen<br />
und neigen zu Wutausbrüchen, wenn man kooperatives Verhalten von ihnen verlangt.<br />
Sie sind hyperaktiv und unkonzentriert; persönliche Beziehun gen können sie überhaupt<br />
nicht einordnen, und sie verlieren sich in destruktiven Fantasien, die sich sowohl<br />
gegen die Welt als auch gegen sie selbst richten.30<br />
Kinder, die als Säuglinge keine mütterliche Fürsorge erlebt hatten, entwickelten<br />
demnach psychische Störungen.<br />
Der Mangel an mütterlicher Fürsorge wurde noch verschlimmert durch die strengen<br />
Hygienevorschriften in den Heimen, die ironischerweise ei gentlich der Gesundheit der<br />
Kinder dienen sollten. Wie im ersten Kapitel be reits beschrieben, wurde in Waisenhäusern<br />
und Pflegeheimen geradezu zwanghaft auf ein steriles Umfeld geachtet, das<br />
vor der Verbreitung von Krankheitserregern schützen sollte. Aus dem gleichen Grund<br />
war es für das Pflegepersonal verpönt, die Kinder anzufassen oder gar in den Arm zu<br />
neh men und mit ihnen zu schmusen. Die meisten Kinder tranken allein aus der Flasche,<br />
sodass es auch beim Füttern zu keinem Körperkontakt kam. Die Folge war, dass die<br />
Kinder verkümmerten. In einigen Waisenhäusern lag die Kindersterblichkeit in den<br />
ersten beiden Lebensjahren bei erschütternden 32 bis 75 Prozent. Obwohl ausreichend<br />
ernährt und gut gepflegt, starben die Kleinen zuhauf. Oft wurde ihr Tod irrtümlicherweise<br />
auf Unterernährung zurückgeführt, oder bei den Kindern wurde „Hospitalismus“
132 — 133<br />
Jeremy Rifkin<br />
31 Karen 1998, S. 19<br />
32 Bakwin 1941, S. 31<br />
33 Vgl. Karen 1998, S. 21<br />
diagnostiziert, aber das alles verschleierte nur das eigentliche Problem.31 Ohne mütterliche<br />
Liebe und Zuwendung verloren die Kinder ihren Lebenswillen.<br />
Die strengen Hygienevorschriften für Waisenhäuser waren von der Zeit vor dem Ersten<br />
Weltkrieg bis in die 1930er Jahre gültig, obwohl sich die Anzeichen dafür mehrten,<br />
dass in der Führung dieser Einrichtungen etwas ganz und gar nicht stimmte. Erst 1931,<br />
als mit Harry Bakwin ein Kinderarzt die Leitung der Pädiatrie am Bellevue-Krankenhaus<br />
übernahm, begann sich auf der Säuglingsstation einiges zu ändern. Bakwin veröffentlichte<br />
einen Auf satz mit dem Titel „Einsamkeitsgefühle bei Säuglingen“, in dem er<br />
einen Be zug herstellte zwischen Säuglingssterblichkeit und emotionaler Verkümme rung.<br />
In einer Passage beschrieb er, welche absurden Formen die zwanghafte Beschäftigung<br />
mit dem keimfreien Umfeld für Säuglinge in dem Kranken haus angenommen hatte:<br />
„Es wurde ein Kasten mit Einlass- und Auslassven tilen eingeführt, der über mit Stulpen<br />
ausgestattete Eingriffe für das Pflege personal verfügt. In diesen Kasten wird der<br />
Säugling gelegt und kann versorgt werden, ohne dass er mit den Händen eines<br />
Menschen groß in Berührung kommt.“ Bakwin ließ in der Säuglingsstation Schilder<br />
aufhängen, auf denen stand: „Betreten Sie diese Station nie, ohne ein Baby in den Arm<br />
zu neh men.“32 Schon bald gingen die Ansteckungskrankheiten zurück, und die Kin der<br />
blühten auf.<br />
Etwa zur gleichen Zeit stellten Wissenschaftler einen Zusammenhang zwi schen Intelligenz,<br />
Sprachentwicklung und emotionaler Vernachlässigung fest. Bei Kindern, die<br />
in Waisenhäusern aufgewachsen waren, wurde oft ein so niedriger IQ-Wert gemessen,<br />
dass man sie als zurückgeblieben einstufte, während die Messergebnisse bei Kindern<br />
aus Pflegefamilien normal waren. Diese Studien warfen die Lehrmeinung vom ererbten<br />
IQ über den Haufen.<br />
Harold Skeel führte in einem staatlichen Pflegeheim eine bahnbrechende Studie mit<br />
13 Kindern unter zweieinhalb Jahren durch, die er jeweils der Obhut eines älteren<br />
geistig zurückgebliebenen Mädchens unterstellte. Inner halb von 19 Monaten war der<br />
durchschnittliche IQ dieser Kinder von 64 auf 92 gestiegen, womit bewiesen war,<br />
dass emotionale Bindungen bei der Entwicklung der Intelligenz eine viel wichtigere<br />
Rolle spielen, als bis dahin ange nommen.33 Die lange gültige Lehrmeinung, der<br />
zufolge die Intelligenz eines Menschen in seiner Biologie angelegt sei, schien nicht<br />
mehr ganz so über zeugend zu sein. War es möglich, dass die geistigen Fähigkeiten<br />
eines Kindes seinem angeborenen emotionalen Bedürfnis nach Zuwendung und Nähe<br />
entspringen?<br />
Unter dem Einfluss der zahlreichen Studien, die in den 1930er und 1940er Jahren auf<br />
dem Gebiet der Säuglingsforschung durchgeführt wurden, begann sich unter Psych ia tern<br />
das Bild von der Natur des Menschen zu verän dern. Aber es waren die emotional aufrüttelnden<br />
Bilder eines einzigen Films, die das gesamte Berufsfeld bis in die Grundfesten<br />
erschütterten und die überkommenen Vorstellungen von angemessener professioneller<br />
Kinder pflege, aber auch von der Beziehung zwischen Eltern und Kindern veränder ten.<br />
Im Jahr 1947 sah sich eine kleine Gruppe von Ärzten und Psychologen an der medizinischen<br />
Fakultät der New Yorker Universität einen kurzen Film mit dem Titel Trauer – eine<br />
Bedrohung im Säuglingsalter an, den der Psycho analytiker René Spitz gedreht hatte.<br />
Es war ein Stummfilm, in Schwarzweiß aufgenommen, und zu sehen waren darin Kleinkinder,<br />
die anfangs von ih ren Müttern versorgt worden waren, dann aber aufgrund aller<br />
möglichen Umstände in einem Pflegeheim untergebracht wurden, wo es nur eine aus gebildete<br />
Pflegerin und fünf Hilfsschwestern für 45 Babys gab.<br />
Das erste Baby sieht man, kurz nachdem es von seiner Mutter für einen dreimonatigen<br />
Aufenthalt im Heim abgegeben wurde. Das Mädchen lächelt, jauchzt und spielt mit<br />
einer erwachsenen Betreuungsperson. Schon eine Wo che später ist aus dem Kind eine<br />
andere Person geworden. Es wirkt verloren und reagiert kaum. Manchmal weint es<br />
ohne ersichtlichen Grund oder tritt nach der Betreuungsperson. In seiner Miene drückt
34 Ebd., S. 24<br />
35 Spitz 1996<br />
36 Bowlby 1967, S. V<br />
sich nackte Angst aus. Die Kamera schwenkt über andere Kleinkinder, die stumpf,<br />
traurig und leb los wirken. Viele der Kinder sind abgemagert und legen stereotype<br />
Verhal tensweisen wie Kauen an den Händen an den Tag. Einige der Kinder können<br />
weder sitzen noch stehen. Sie verharren reglos und ausdruckslos, ohne An trieb.<br />
Sie wirken wie leere Hüllen. Dann erscheint eine Schrift auf der Lein wand: „Das<br />
Heilmittel: Gebt dem Kind die Mutter wieder!“34<br />
Die Zuschauer waren erschüttert. Einige brachen in Tränen aus. In den fol genden<br />
Jahren sollten sich Tausende von Ärzten, Psychologen, Sozialarbei tern und<br />
Kinder schwestern den Film ansehen. Viele lasen später auch die Ergebnisse der<br />
beiden Studien, die Spitz 1945 und 1946 zu dem Thema durch geführt hatte,<br />
die aber erst knapp 20 Jahre später veröffentlicht wurden.35 Sie markierten einen<br />
Wendepunkt in den Grundlagen der Säuglingspflege, aber dennoch sollte es noch<br />
zwei Jahrzehnte dauern, bis eine signifikante Mehr heit der Kinderärzte und -psychologen<br />
die Erkenntnisse aus den Studien und dem Film von René Spitz in ihre Arbeit<br />
einfließen ließ.<br />
Der Mann, der die Dokumentationen von Spitz und anderen Forschern maßgeblich zu<br />
einer tragfähigen Theorie ausformulierte, war der britische Psychiater John Bowlby. Die<br />
wesentlichen Aspekte seiner Bindungstheorie veröffentlichte er zwischen 1958 und<br />
1960 in drei Aufsätzen, die die psycho analytische Gemeinde erschütterten. Ausgehend<br />
von der Objektbeziehungs theorie und insbesondere William Fairbairns Erkenntnissen,<br />
erklärt Bowlby, dass die erste Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter dessen geistige<br />
und emotionale Entwicklung entscheidend beeinflusst. Wie Fairbairn hält er das<br />
Bedürfnis des Kindes, Beziehungen zu anderen aufzubauen, für einen Pri märtrieb:<br />
Wenn ein Kind geboren wird, kann es eine Person nicht von der anderen unterscheiden,<br />
ja, es kann eine Person kaum von einem Gegenstand unterscheiden. Doch<br />
bis zu seinem ersten Geburtstag hat es sich im Allgemeinen zu einem wahren<br />
Men schenkenner gemausert. Es kann nicht nur mühelos zwischen Bekannten und<br />
Fremden unterscheiden, sondern sucht sich auch unter den Menschen, die es kennt,<br />
seine Lieblingspersonen heraus. Diese begrüßt es freudig, folgt ihnen, wenn sie<br />
ge hen, und sucht nach ihnen, wenn sie nicht da sind. Auf ihre Abwesenheit reagiert<br />
es mit Angst und Unruhe, ihre Rückkehr erleichtert es und vermittelt ihm ein Gefühl<br />
der Sicherheit. Auf diesem Fundament baut offenbar sein gesamtes Gefühlsleben<br />
auf – ohne dieses Fundament sind sein künftiges Glück und seine künftige Gesundheit<br />
gefährdet.36<br />
Bowlby teilt die Ablehnung der Freudschen Libidotheorie mit anderen Ob jektbeziehungstheoretikern,<br />
geht aber einen großen Schritt weiter, indem er die Objektbeziehungen<br />
in der Evolutionsbiologie verortet, und damit eine seriöse wissenschaftliche Basis<br />
für die Widerlegung der Freudschen Lehr meinung schafft. Seine Theorie ist stark von<br />
Konrad Lorenz’ verhaltensbiolo gischen Erkenntnissen beeinflusst. Lorenz hatte 1935<br />
im Journal für Ornithologie einen bedeutenden Beitrag über die Prägung bei Vögeln<br />
veröffentlicht. In seinem Aufsatz mit dem Titel „Der Kumpan in der Umwelt des Vogels“<br />
hatte Lorenz beschrieben, dass frisch geschlüpfte Jungtiere bei Vogelarten wie Enten<br />
und Gänsen sich dem ersten Erwachsenen anschließen, mit dem sie in Berührung<br />
kommen. Für Bowlby bestätigten diese Forschungsergeb nisse auf ethologischem Gebiet<br />
das, was er in Bezug auf die Entwicklung von Säuglingen beobachtet hatte.<br />
Seine eigenen Beobachtungen und die Erkenntnisse der Ethologen brach ten ihn zu der<br />
Vermutung, dass es bei fast allen Säugetierarten Bindungsverhalten gibt. Ein Jungtier<br />
sucht die Bindung an ein erwachsenes Tier, in den meisten Fällen die Mutter, weil<br />
es ihm Schutz bietet, und dieses Verhalten hat nichts mit dem Sexualtrieb oder dem<br />
Bedürfnis nach Nahrung zu tun. Doch Bowlby geht noch einen Schritt weiter als die
134 — 135<br />
Jeremy Rifkin<br />
37 Bowlby 2001, S. 164<br />
38 Ebd., S. 167 ff.<br />
39 Ebd., S. 174<br />
Ethologen, denn er sieht im Bindungsverhalten nur einen Teil der sich entwickelnden<br />
Beziehung zur Mutter. Eine ebenso wichtige Rolle spielt in seinen Augen das<br />
„ Erkundungsverhalten“, das er als dessen Gegenpol begreift:<br />
Es gibt nun viele Beweise für die Ansicht, daß das Erkundungsverhalten von gro ßer<br />
Bedeutung ist, indem es eine Person oder ein Tier in die Lage versetzt, ein kohä rentes<br />
Bild der Umweltmerkmale zu entwickeln, die zu irgendeinem Zeitpunkt für das Überleben<br />
wichtig werden können. Kinder und andere junge Lebewesen sind bekanntlich<br />
neugierig und wißbegierig, was sie veranlaßt, sich von ihren Bindungs figuren fortzubewegen.<br />
In diesem Sinne steht das Erkundungsverhalten im Wider spruch zum<br />
Bindungsverhalten. Bei gesunden Individuen wechseln sich diese bei den Verhaltensweisen<br />
normalerweise ab.37<br />
Vermitteln die Eltern dem Kind nicht das Gefühl, geborgen zu sein, umsorgt und<br />
geliebt zu werden, so kann es sich nicht zu einem offenen, selbststän digen Wesen<br />
entwickeln. Gleichzeitig müssen sie jedoch das angeborene Bedürfnis des Kindes,<br />
seine Welt zu erforschen, unterstützen. Das Gelingen oder Nichtgelingen dieses<br />
dialektischen Prozesses entscheidet über das spä tere Gefühlsleben und Sozialverhalten<br />
eines jeden Kindes.<br />
Erst spätere Untersuchungen der Eltern-Kind-Dynamik haben deutlich ge zeigt, dass<br />
eine Mutter oder ein Vater umso eher in der Lage sind, die Bedürf nisse und Wünsche<br />
ihres Kindes emotional und kognitiv zu erfassen, je em pathischer sie sind. Bowlby ging<br />
aufgrund seiner Studien davon aus, dass in den Vereinigten Staaten und Großbritannien<br />
mehr als die Hälfte der Kinder von ihren Eltern angemessen betreut und in ihrer Entwicklung<br />
gefördert wur den, mehr als ein Drittel hingegen nicht. Die Eltern dieser Kinder<br />
reagierten nicht auf deren Versuche, Fürsorgeverhalten auszulösen, behandelten<br />
sie ge ringschätzig oder wiesen sie offen zurück. Solches Verhalten kann dazu füh ren,<br />
dass das Kind aus Angst vor dem Verlust einer Bindungsperson in einem permanenten<br />
Zustand der Angst und Unsicherheit lebt – einer Angstbindung, wie Bowlby es nennt –<br />
und ein krankhaftes Verhalten an den Tag legt, das von neurotischen Symptomen bis<br />
zu Depressionen und Phobien reichen kann.38<br />
Für Bowlby liegt es auf der Hand, dass sich das einmal erworbene Bin dungsverhalten<br />
im späteren Leben kaum ändert. Ein Mensch geht, mit ande ren Worten, als Erwachsener<br />
nach dem gleichen Muster Bindungen – zu Freunden, einem Ehepartner, einem Arbeitgeber<br />
– ein, wie er es als Kind mit seiner ersten Bindungsperson erlebt hat.39<br />
Bowlbys Erkenntnisse muten heute vollkommen selbstverständlich an. Aber man<br />
muss sich klar machen, dass Kinderärzte in den Vereinigten Staa ten und Großbritannien<br />
erst in den 1960er Jahren anfingen, danach zu han deln und Eltern beim Umgang<br />
mit Säuglingen und Kleinkindern entspre chend zu beraten. Auf dem europäischen<br />
Kontinent dauerte es sogar bis in die späten 1970er Jahre, bis sich die Veränderungen<br />
in der Kinderpsychologie herumgesprochen hatten und auch durchsetzten. Bowlbys<br />
Theorien fanden nicht über Nacht Zustimmung. Im Gegenteil, anfangs stießen sie<br />
auf erbit terten Widerstand. So leicht gaben sich die Freudianer nicht geschlagen mit<br />
ihrer materialistischen und utilitaristischen Auffassung von der menschli chen Psyche.<br />
Auch die Behavioristen waren nicht davon zu überzeugen, dass Kinder von Geburt<br />
an auf der Suche nach sozialen Bindungen sind. Sie ver traten die Ansicht, ein Kind<br />
sei bei seiner Geburt ein unbeschriebenes Blatt, und weil es seine Lust zu befriedigen<br />
und Schmerzen zu vermeiden sucht, sei es durch die richtige Konditionierung uneingeschränkt<br />
formbar. Die Behavi oristen leisteten besonders heftigen Widerstand gegen<br />
Bowlbys Bindungs theorie, weil sie ihrer Überzeugung widersprach, der zufolge Babys,<br />
die zu viel Zuwendung und „Hätschelei“ erfahren, verzogen würden und später weniger<br />
formbar seien.
40 Watson 1930, S. 68 f.<br />
41 Interview mit Mary Ainsworth,<br />
in: Karen 1998, S. 147<br />
John B. Watson war der Erste, der diese Theorie in den 1920er Jahren ver treten hatte.<br />
Gehen Sie mit ihnen [den Kindern] um, als seien es erwachsene junge Menschen.<br />
Erledigen Sie das Anziehen, das Baden mit Sorgfalt und Umsicht. Seien Sie in Ihrem<br />
Benehmen immer sachlich und von freundlicher Bestimmtheit. Herzen und küssen<br />
Sie die Kinder nie; nehmen Sie sie nie auf den Schoß. Wenn es gar nicht anders geht,<br />
geben Sie ihnen beim Gutenachtsagen einen Kuß auf die Stirn. Geben Sie ihnen<br />
morgens die Hand. Streichen Sie ihnen über den Kopf, wenn sie eine schwierige Aufgabe<br />
besonders gut erledigt haben.40<br />
Selbst frühe Feministinnen übten Kritik an Bowlby, weil er in ihren Augen die Rolle der<br />
Frauen als allein für die Kindererziehung Zuständige in seiner Bindungstheorie festschrieb.<br />
Das allerdings war eine Fehlinterpretation. Bowlby betonte vielmehr, dass ein<br />
Kind zwar bis zum Alter von drei Jahren eine feste Bezugsperson brauche, dass diese<br />
Person aber ebenso gut der Va ter, eine Verwandte oder ein Verwandter oder sogar ein<br />
Kindermädchen sein könne.<br />
In einem Punkt stimmten Bowlbys Kritiker alle überein: Sie forderten ei nen empirischen<br />
Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie vom angeborenen Bindungsverhalten. Diesen<br />
lieferte Mary Ainsworth, eine kanadische Psy chologin und langjährige Mitarbeiterin<br />
Bowlbys. Sie führte in den 1960er Jahren an der Johns Hopkins Universität in Baltimore<br />
eine Reihe von Studien durch, deren Ergebnisse Bowlbys Theorie mit wissenschaftlichen<br />
Fakten un termauerten. Zu diesem Zweck entwickelte Ainsworth einen einfachen<br />
Test, den sie „die fremde Situation“ nannte. Dabei befanden sich eine Mutter und ihr<br />
etwa einjähriges Kind in einer ihnen nicht bekannten Umgebung, in der vorhandenes<br />
Spielzeug das Kind zum Erkunden animieren sollte. Nach eini ger Zeit kam eine fremde<br />
Person hinzu, woraufhin sich die Mutter entfernte und das Kind mit dieser allein ließ.<br />
Ainsworth und ihr Team beobachteten, wie das Kind auf das Weggehen und die Rückkehr<br />
der Mutter reagierte. An schließend wurde eine zweite Situation inszeniert, in<br />
der das Kind allein im Raum war, als die fremde Person den Raum betrat. Die Frage<br />
war, ob das Kind in deren Beisein weniger ängstlich auf die Abwesenheit der Mutter<br />
reagieren würde.41<br />
Die Ergebnisse der Studien stützten Bowlbys Thesen, dass ein sicher ge bundenes<br />
Kind in der Lage ist, selbstständig seine Umwelt zu erkunden, wäh rend dies einem<br />
unsicher gebundenen Kind Schwierigkeiten bereitet. Ains worth beobachtete drei<br />
deutlich voneinander abgegrenzte Verhaltensmuster bei den Kindern: Die sicher<br />
gebundenen sind zwar ängstlich und weinen auch, wenn die Mutter geht, begrüßen<br />
sie aber freudig bei ihrer Rückkehr und lassen sich durch ihre Umarmung trösten; die<br />
unsicher-vermeidend ge bundenen, die vordergründig distanziert wirken und gelegentlich<br />
Aggressio nen gegen die Mutter zeigen, sind auch ängstlich oder unruhig, wenn<br />
sie den Raum verlässt, ignorieren sie aber, wenn sie wiederkommt; die unsicher-<br />
am bivalent gebundenen wieder um, die zu Hause fordernd und übertrieben an hänglich<br />
sind, weinen in der Testsituation, wenn die Mutter aus dem Raum geht, lassen sich<br />
aber auch dann nicht trösten, wenn sie zurückkommt.<br />
Es wird kaum verwundern, dass die Mütter sicher gebundener Kinder viel aufmerksamer<br />
waren, stärker auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Babys eingingen und sie länger<br />
und liebevoller im Arm hielten. Sie waren beständi ger in ihrer emotionalen Zuwendung.<br />
Die Mütter der unsicher-ambivalent gebundenen Kinder waren sprunghafter und weniger<br />
verlässlich in ihren Re aktionen, während die Mütter der unsicher-vermeidenden Kinder<br />
ein eher abweisendes Verhalten an den Tag legten.<br />
Ainsworths Studien widerlegten die lange vorherrschende Meinung, man dürfe Babys<br />
nicht übermäßig hätscheln und in den Arm nehmen oder ihnen zu viel Aufmerksamkeit<br />
widmen, weil sie sonst keine Selbstständigkeit ent wickeln und allzu anhänglich werden.
136 — 137<br />
Jeremy Rifkin<br />
42 Ebd., S. 312<br />
Für die Entwicklung einer sicheren Bindung kommt es nicht darauf an, wie lange eine<br />
Mutter ihr Kind im Arm hält, sondern wie sie es hält. Die Mütter sicher gebundener<br />
Kinder gingen viel zärtlicher und liebevoller und niemals grob mit ihrem Baby um. Und,<br />
was mindestens ebenso wichtig ist, sie nahmen es dann in den Arm, wenn das Baby<br />
es wollte, und zeigten damit, dass sie es als ein eigenständiges We sen mit individuellen<br />
Wünschen und Bedürfnissen wahrnahmen.<br />
Trotz dieser Befunde wurde nach wie vor Kritik an der Bindungstheorie geübt. Nahrung<br />
lieferte den Kritikern die Verhaltensgenetik. Studien mit eineiigen Zwillingen, die gleich<br />
nach der Geburt getrennt worden und in ver schiedenen Familien aufgewachsen waren,<br />
schienen die Theorie zu unter mauern, dass bei der emotionalen Entwicklung eines<br />
Menschen die Gene eine wichtigere Rolle spielen als das soziale Umfeld. In sehr vielen<br />
Fällen wurde eine geradezu unheimliche Übereinstimmung in der Gemütsverfas sung<br />
und im Verhalten dieser Zwillinge festgestellt, was Bowlbys Theorie wi dersprach. Allerdings<br />
waren sich sowohl er als auch Ainsworth der Tatsache bewusst, dass jedes Kind<br />
von Natur aus einen eigenen Rhythmus hat und für ein bestimmtes Bindungsverhalten<br />
prädisponiert ist.<br />
Somit lautet die Frage: Wenn man zugrunde legt, dass sowohl Anlagen als auch äußere<br />
Faktoren das Entstehen von Bindungen beeinflussen, muss man dann annehmen,<br />
dass eines eine größere Rolle spielt als das andere? Der Psy chotherapeut Robert Karen<br />
fand darauf eine eindeutige Antwort. Ihm zu folge ist das Gehirn eines Säuglings bei<br />
der Geburt weitgehend unstruktu riert, organisiert sich aber innerhalb der ersten fünf<br />
Monate. Der Stromkreis wird durch die Interaktion des Kindes mit der Mutter, die seine<br />
erste äußere Welt ist, geschaltet. Daraus kann man, sagt Karen, einen begründeten<br />
Schluss ziehen: „Die Fähigkeit des Säuglings, sich vor allem in den Bereichen, die sich<br />
auf das Emotionale beziehen, einzustellen und anzupassen, hängt von der Einstellung<br />
und der Empathie der Eltern ab; und wenn die Mutter nicht fähig ist, sich emotional auf<br />
das Kind einzustellen, kann das Gehirn des Kindes bleibende Schäden davontragen.“42<br />
——<br />
Die Objektbeziehungstheorie hält der menschlichen Natur einen neuen Spiegel vor,<br />
und was wir darin von unserer Spezies sehen, ist ein liebevolles, fürsorgliches Lebewesen,<br />
das sich nach Gesellschaft sehnt und vor Einsam keit fürchtet und das biologisch<br />
prädisponiert ist, anderen Geschöpfen Em pathie entgegenzubringen.<br />
Sind wir aber die einzigen unter den sozialen Lebewesen, die fähig sind, untereinander<br />
und unseren Mitgeschöpfen gegenüber Empathie an den Tag zu legen? In den letzten<br />
zehn Jahren gewonnene wissenschaftliche Erkennt nisse haben uns gezwungen, unsere<br />
Sicht der biologischen Evolution neu zu überdenken. Die überkommene Vorstellung<br />
von der Evolution als Wettlauf und Kampf um Ressourcen und Sicherung der Fortpflanzung<br />
weicht, zumin dest auf die Welt der Säugetiere bezogen, allmählich der<br />
Erkenntnis, dass es beim Überleben der Stärksten ebenso sehr auf soziale Fähigkeiten<br />
und Ko operation ankommen könnte wie auf Muskelkraft und Konkurrenzverhal ten.<br />
Und wir sind offenkundig nicht allein mit unserer Fähigkeit zur Empa thie. Die neuen<br />
Erkenntnisse über die biologischen Wurzeln unseres Sozialverhaltens beginnen sich<br />
modellhaft darauf auszuwirken, wie wir die lebendige Welt und unsere eigene Rolle<br />
in der fortlaufenden Geschichte des Lebens auf der Erde betrachten.
Gefährdetes Leben<br />
Politische Essays<br />
Judith Butler
5<br />
Gefährdetes Leben<br />
… der Überschuß jeder Sozialität über jede Einsamkeit. Lévinas<br />
Unlängst nahm ich an einer Besprechung teil und hörte bei diesem Anlaß zu, wie der<br />
Direktor eines Universitätsverlags eine Ge schichte erzählte. Es war unklar, ob er sich<br />
mit dem Standpunkt identifizierte, von dem die Geschichte erzählt wurde, oder ob<br />
er die schlechten Nachrichten bloß widerwillig weitergab. Die Ge schichte handelte von<br />
einer anderen Besprechung, bei der er zu gehört hatte, und da hatte der Präsident<br />
einer Universität die Ansicht vertreten, daß niemand mehr geisteswissenschaftliche<br />
Bücher lese und daß die Geisteswissenschaften nichts mehr zu bieten hätten, oder<br />
besser gesagt, unserer Zeit nichts mehr zu bie ten hätten. Ich bin nicht ganz sicher, ob<br />
er sagte, daß der Univer sitätspräsident gesagt habe, die Geisteswissenschaften hätten<br />
ihre moralische Autorität verloren, aber es klang so, als sei dies tat sächlich jemandes<br />
Ansicht und als sei dies eine ernstzunehmende Ansicht. In derselben Besprechung<br />
folgten weitere Diskussionen, bei denen es nicht immer möglich war, eindeutig zu sagen,<br />
wer sich zu welcher Ansicht bekannte oder ob irgend jemand wirklich bereit war, sich<br />
zu einer Ansicht zu bekennen. Es war eine Dis kussion, die sich um die Frage drehte:<br />
Haben sich die Geisteswis senschaften mit all ihrem Relativismus, ihrem Infrage stellen<br />
und ihrer „Kritik“ selbst untergraben, oder wurden die Geisteswis senschaften von<br />
denjenigen untergraben, die gegen all diesen Re lativismus, dieses Infragestellen und<br />
diese „Kritik“ sind? Jemand – oder irgend eine Gruppe von Leuten – hat die Geisteswissen<br />
schaften untergraben, aber es war unklar wer, und es war unklar, wer glaubte,<br />
daß dies stimme. Ich fing an, mich zu fragen, ob ich nicht mitten drinsteckte im<br />
Dilemma der Geisteswissenschaften, in diesem Dilemma, in dem niemand weiß, wer<br />
spricht, wer mit welcher Stimme und mit welcher Absicht spricht. Steht irgend jemand<br />
zu den Worten, die von wem auch immer geäußert werden? Können wir diese Worte<br />
noch zu einem Sprecher oder vielleicht sogar zu einer Verfasserin zurückverfolgen?<br />
Und welche Bot schaft wurde eigentlich genau übermittelt?<br />
Natürlich wäre es paradox, wenn ich nun argumentieren würde, was wir wirklich<br />
bräuchten, wäre eine Anbindung des Diskurses an die Autoren, und so würden wir<br />
beides, Autoren wie Autorität, wiedergewinnen. Gemeinsam mit vielen anderen habe<br />
ich meinen Teil Arbeit dazu beigetragen, diese Anbindung mög lichst zu durchtrennen.<br />
Was allerdings meines Erachtens fehlt, und was ich gern zurückkehren sehen und<br />
hören würde, ist eine Berücksichtigung der Struktur der Ansprache selbst. Obwohl<br />
ich nicht wußte, in wessen Stimme diese Person sprach, ob es ihre ei gene Stimme<br />
war oder doch nicht, spürte ich, daß ich angespro chen war und daß etwas, das die<br />
Geisteswissenschaften hieß, aus der einen oder anderen Richtung mit Spott bedacht<br />
wurde. Auf eine solche Ansprache zu reagieren ist in diesen Zeiten anschei nend eine<br />
wichtige Pflicht. Diese Pflicht ist etwas anderes als die Rehabilitierung des Autor<br />
Subjekts an sich. Es geht um eine Reak tionsweise, die auf ein Angesprochensein folgt,<br />
um ein Verhalten gegenüber dem Anderen, nachdem der Andere eine Forderung<br />
an mich gestellt hat, mich einer Schwäche bezichtigt oder mich zur Übernahme einer<br />
Verantwortung aufgefordert hat. Das ist ein Austausch, der nicht in das Schema<br />
gepreßt werden kann, bei dem das Subjekt hier ist, als ein Thema, das reflexiv befragt<br />
werden muß, und der Andere dort ist, als ein Thema, das geliefert werden muß. Die<br />
Struktur der Ansprache ist wichtig, um zu verstehen, wie die moralische Autorität<br />
eingeführt und aufrechterhalten wird, wenn wir nicht bloß akzeptieren, daß wir andere<br />
anspre chen, sobald wir reden, sondern in dem Augenblick des Ange sprochenwerdens<br />
sozusagen in gewisser Hinsicht zu existieren beginnen und sich irgend etwas an<br />
u nserer Existenz als prekär er weist, wenn diese Ansprache mißlingt. Oder emphatischer
140 — 141<br />
Judith Butler<br />
* In den bisherigen Übersetzungen<br />
der Texte von Lévinas war es<br />
manchmal üblich, bei visage vom<br />
„Antlitz des Anderen“ zu sprechen.<br />
Wie der Übersetzer Thomas<br />
Wiemer deutlich macht, hat diese<br />
Übersetzung auch Nachteile: „Sie<br />
versieht, gewollt oder ungewollt,<br />
die Lévinassche Diktion mit einer –<br />
zusätzlichen – Aura der Erhabenheit,<br />
die ihr nur zum geringeren<br />
Teil gerecht wird, während sie<br />
wichtigere andere Teile verdeckt.<br />
[…] Gerade an der ‚Materialität‘<br />
des visage versucht Lévinas<br />
zu entziffern, was über sie hinausweist;<br />
[…] Die Übersetzung<br />
Antlitz steht dieser Profilierung<br />
des Terminus eher im Wege.“<br />
Ich schließe mich der Auffassung<br />
von Thomas Wiemer an, derzufolge<br />
Gesicht die adäquatere Übersetzung<br />
für visage bzw. face ist.<br />
Vgl. Emmanuel Lévinas, Jenseits<br />
des Seins oder anders als Sein<br />
geschieht, Freiburg/München<br />
1992, Fußnote I, S. 43. [Anm. der<br />
Übersetzerin]<br />
ausge drückt, was uns moralisch verpflichtet, hat damit zu tun, wie wir von anderen<br />
angesprochen werden, in Formen, die wir nicht ver hindern oder vermeiden können. Dieser<br />
Einfluß, den die Anspra che des Anderen auf uns ausübt, konstituiert uns zuallererst<br />
gegen unseren Willen, oder vielleicht passender formuliert, noch vor der Ausbildung<br />
unseres Willens. Wenn wir also glauben, bei der mo ralischen Autorität gehe es darum,<br />
seinen eigenen Willen heraus zufinden und zu ihm zu stehen, dem Willen seinen Namen<br />
aufzu prägen, ist es möglich, daß wir die Art verfehlen, wie moralische Forderungen<br />
vermittelt werden. Das heißt, wir verfehlen die Si tuation des Angesprochenseins, die<br />
Forderung, die von anderswo an uns herantritt, manchmal ein namenloses Anderswo,<br />
von dem unsere Pflichten ausgesprochen und uns zugemutet werden.<br />
In der Tat gebe ich mir die Vorstellung von dem, was moralisch bindend ist, nicht selbst;<br />
sie entspringt nicht meiner Autonomie oder meiner Reflexivität. Sie fällt mir von<br />
anderswo zu, unerbe ten, unerwartet und ungeplant. Tatsächlich stört sie eher meine<br />
Pläne, und wenn meine Pläne durchkreuzt sind, kann das durch aus ein Zeichen dafür<br />
sein, daß etwas moralisch verpflichtend für mich ist. Wir glauben, Präsidenten würden<br />
ihre Sprechakte vor sätzlich vollziehen, so daß wir dann, wenn der Direktor eines<br />
Universitätsverlags oder der Präsident einer Universität spricht, die Erwartung haben,<br />
zu wissen, wovon sie sprechen, zu wem sie sprechen und mit welcher Absicht sie<br />
sprechen. Wir erwarten von der Ansprache, daß sie mit Autorität vorgetragen wird und<br />
in die sem Sinne verbindlich ist. Aber die Rede von Präsidenten ist selt sam in diesen<br />
Zeiten, und es wäre eine bessere Rhetorikerin nötig, als ich es bin, um das Mysteriöse<br />
ihrer Methoden zu durch schauen. Warum sollte zum Beispiel der Irak eine Gefahr für<br />
die Sicherheit der „zivilisierten Welt“ genannt werden, während von Nordkorea Raketen<br />
abgeschossen werden und sogar der Versuch einer Geiselnahme von USBooten<br />
gemacht wird und dies als „Regionalkonflikt“ bezeichnet wird? Und wenn der Präsident<br />
der USA von der Mehrheit der Staaten aufgefordert wurde, seine Kriegsandrohung<br />
zurückzunehmen, warum fühlte er sich dieser Ansprache dann so wenig verpflichtet?<br />
Angesichts des heillosen Durcheinanders, das die Präsidentschaftsansprachen erfaßt<br />
hat, sollten wir vielleicht ernsthafter über das Verhältnis von Formen der Ansprache<br />
und moralischer Autorität nachdenken. Das könnte uns dabei helfen, zu erkennen,<br />
welche Werte die Geistes wissenschaften zu bieten haben und in welcher Situation des<br />
Dis kurses die moralische Autorität verbindlich wird.<br />
Ich möchte gern auf das „Gesicht“,* eine von Emmanuel Lévinas eingeführte Vorstellung,<br />
eingehen, um zu erklären, wie es kommt, daß andere moralische Ansprüche an uns<br />
stellen, morali sche Forderungen an uns richten, die wir nicht wollen und die wir nicht<br />
ohne weiteres ablehnen können. Vorläufig stellt Lévinas eine Forderung an mich, aber<br />
seine Forderung ist nicht die ein zige, der ich zur Zeit nachkommen muß. Ich werde das<br />
skizzie ren, was für mich den Grundriß einer möglichen jüdischen Ethik der Gewalt losig keit<br />
ausmacht. Dann werde ich diesen Entwurf auf einige drängende Fragen der Gewalt<br />
und Ethik beziehen, die sich uns jetzt stellen. Die Lévinassche Vorstellung des „Gesichts“<br />
ist lange Zeit mit kritischer Bestürzung aufgenommen worden. Denn es scheint so zu<br />
sein, daß das „Gesicht“ des von Lévinas so genannten „Anderen“ eine ethische Forderung<br />
an mich stellt, und dennoch wissen wir nicht, welche Forderung es eigentlich stellt.<br />
Das „Gesicht“ des anderen kann nicht auf einen geheimen Sinn hin entziffert werden,<br />
und der Imperativ, den es übermittelt, ist nicht unmittelbar in eine Vorschrift übersetzbar,<br />
die sprachlich formuliert und befolgt werden könnte.<br />
Lévinas schreibt: „Die Annäherung an das Gesicht ist die ele mentarste Form von<br />
Verantwortung. […] Das Gesicht ist nicht vor mir (en face de moi), sondern über mir;<br />
es ist der andere vor dem Tod, er durchschaut den Tod und enthüllt ihn. Zweitens ist das<br />
Gesicht der andere, der mich bittet, ihn nicht allein sterben zu lassen, so als ob man<br />
bei seinem Tod zum Komplizen werden würde, wenn man das täte. Das Gesicht sagt<br />
mir also: Du sollst nicht töten. In der Beziehung zu dem Gesicht stehe ich da als ei ner,
1 Emmanuel Lévinas und Richard<br />
Kearney, „Dialogue with Emmanuel<br />
Lévinas“, in: Face to Face with<br />
Lévinas, Albany: SUNY Press 1986,<br />
S. 23 f. [Bei der französischen<br />
Version des Gesprächs, die unter<br />
dem Titel „De la phéno ménologie<br />
à l’éthique. Entretien avec<br />
Emmanuel Lévinas“ in der Zeitschrift<br />
Esprit, Nr. 234, 1997,<br />
S. 121–140, erschienen ist, handelt<br />
es sich um eine von Lévinas<br />
nicht durchgesehene Übersetzung<br />
aus dem Englischen; daher wird<br />
hier nach der englischen Fassung<br />
zitiert; Anm. der Übersetzerin.]<br />
Lévinas entwickelt diese Vorstellung<br />
zuerst in Totalität und<br />
Unendlichkeit. Versuch über die<br />
Exteriorität (1961), übers. von<br />
W. N. Krewani, Freiburg/ München:<br />
Alber 1987, S. 267–318. Ich<br />
entnehme meine Zitate seiner<br />
späteren Arbeit, weil ich glaube,<br />
daß sie eine reifere und prägnantere<br />
Formulierung des Gesichts<br />
hergeben.<br />
2 Emmanuel Lévinas, Ethik<br />
und Unendliches, Gespräche<br />
mit Philippe Nemo, übers. von<br />
Dorothea Schmidt, Wien: Passagen<br />
1992, S. 66. Im Text wird hierauf<br />
mit EU verwiesen.<br />
3 Emmanuel Lévinas, „Paix et<br />
Proximité“, in: Emmanuel Lévinas,<br />
Altérité et Transcendance, Paris<br />
1995: Fata Morgana, S. 138–150.<br />
Verweise im Text mit dem Sigel PP.<br />
der sich den Platz des anderen widerrechtlich aneignet. Das gefeierte ‚Existenzrecht‘,<br />
das Spinoza conatus essendi nannte und als das Grundprinzip aller Intelligibilität<br />
definierte, wird durch die Beziehung zu dem Gesicht in Frage gestellt. Dementspre chend<br />
hebt meine Pflicht, auf den anderen einzugehen, mein na türliches Recht auf Überleben,<br />
le droit vital, auf. Meine ethische Beziehung der Liebe für den anderen verdankt sich<br />
der Tatsache, daß das Selbst für sich allein nicht überleben kann, in seinem eige nen<br />
InderWeltSein keinen Sinn finden kann. […] Mich der Verletzlichkeit des Gesichts<br />
auszusetzen heißt, mein ontologisches Existenzrecht in Frage zu stellen. In der Ethik<br />
hat das Existenzrecht des anderen Vorrang vor meinem eigenen, ein Vorrang, der in<br />
dem ethischen Edikt verkörpert wird: Du sollst nicht töten, du sollst das Leben des<br />
anderen nicht gefährden.“1<br />
Lévinas schreibt weiter: „Das Antlitz ist das, was man nicht töten kann oder dessen<br />
Sinn zumindest darin besteht, zu sagen: ‚Du darfst nicht töten‘. Es stimmt, der Mord<br />
ist ein banales Faktum: Man kann den Anderen töten; die ethische Forderung ist<br />
keine ontologische Notwendigkeit. […] Sie erscheint auch in der Hei ligen Schrift, der<br />
die Menschlichkeit des Menschen, solange sie in der Welt involviert ist, ausgesetzt<br />
bleibt. Aber eigentlich ist die Erscheinung dieser ‚ethischen Merkwürdigkeiten‘ – die<br />
Mensch lichkeit des Menschen – innerhalb des Seins ein Bruch des Seins. Er ist von<br />
Bedeutung, selbst wenn das Sein sich wieder erneuert und sich wieder in die Gewalt<br />
bekommt.“2<br />
Das Gesicht spricht also genaugenommen nicht, aber was das Gesicht bedeutet,<br />
wird dennoch durch das Gebot „Du sollst nicht töten“ vermittelt. Es vermittelt dieses<br />
Gebot, ohne es wirklich aus zusprechen. Wir können dieses biblische Gebot offenbar<br />
verwen den, um etwas von der Bedeutung des Gesichts zu verstehen. Aber etwas fehlt<br />
hier, da das „Gesicht“ nicht in dem Sinne spricht, wie es der Mund tut; das Gesicht<br />
ist nicht auf den Mund reduzierbar, schon gar nicht auf irgend etwas, das der Mund<br />
zu sagen hat. Ir gendeiner oder irgend etwas anderes spricht, wenn das Gesicht mit<br />
einer bestimmten Art des Sprechens verglichen wird; es ist ein Sprechen, das nicht<br />
aus einem Mund kommt oder, falls es das tut, dort nicht seinen letzten Ursprung oder<br />
Sinn hat. Tatsächlich hat Lévinas in einem Aufsatz mit dem Titel „Paix et Proximité“<br />
klar gestellt, daß „das Gesicht nicht ausschließlich ein menschliches Gesicht ist“.3 Um<br />
dies zu erläutern, bezieht er sich auf Wassilij Grossmanns Text Leben und Schicksal,<br />
wo es um eine Geschichte geht, in der „die Familien, die Ehefrauen und die Eltern von<br />
poli tischen Häftlingen zur Ljubjanka nach Moskau reisen, um etwas Neues zu erfahren.<br />
Eine Schlange bildet sich an den Schaltern, wo die einen nur die Rücken der anderen<br />
sehen. Eine Frau wartet dar auf, daß sie an der Reihe ist: [Sie] hatte niemals gedacht,<br />
daß der Rücken eines Menschen so ausdrucksvoll sein und Seelenzustände auf so<br />
eindringliche Weise vermitteln könnte. Die Personen, die sich dem Schalter näherten,<br />
hatten eine besondere Art, ihren Hals und ihren Rücken zu strecken, die hochgezogenen<br />
Schultern hatten wie mit Sprungfedern gespannte Schulterblätter und schienen zu<br />
schreien, zu weinen, zu schluchzen“ (PP, S. 146 f.).<br />
Hier verhält sich der Begriff „Gesicht“ wie eine Katachrese: „Gesicht“ beschreibt den<br />
menschlichen Rücken, das Strecken des Halses, das Hochziehen der Schulterblätter wie<br />
„mit Federn ge spannt“. Und von diesen Körperteilen wiederum heißt es, daß sie weinen,<br />
schluchzen und schreien, als seien sie ein Gesicht oder vielmehr ein Gesicht mit<br />
einem Mund, einer Kehle, oder vielleicht sogar bloß ein Mund und eine Kehle, aus denen<br />
Vokalisierungen hervorgehen, die sich nicht zu Worten fügen. Das „Gesicht“ be findet<br />
sich gleichsam am Rücken und am Hals, aber es entspricht nicht ganz einem Gesicht.<br />
Die Laute, die von dem Gesicht kom men, sind gequält, leidend. Wir können also bereits<br />
sehen, daß das „Gesicht“ aus einer Reihe von Ersetzungen zu bestehen scheint,<br />
so daß ein Gesicht die Gestalt eines Rückens erhält, der wiederum in einem figürlichen<br />
Sinn als ein Schauplatz gequälter Vokalisie rung erscheint. Und obwohl hier viele Namen
142 — 143<br />
Judith Butler<br />
4 Der theologische Hintergrund<br />
dafür läßt sich in Exodus ausmachen.<br />
Gott verdeutlicht Mose,<br />
daß Gottes Gesicht niemandem<br />
ansichtig sein kann, das heißt, das<br />
göttliche Gesicht ist dem Sehen<br />
entzogen und der Darstellung<br />
nicht zugänglich: „Du kannst<br />
mein Angesicht nicht sehen; denn<br />
kein Mensch kann mich sehen<br />
und am Leben bleiben“ (33, 20,<br />
Einheitsübersetzung). Daraufhin<br />
macht Gott deutlich, daß der<br />
Rücken das Gesicht erset zen kann<br />
und wird: „Dann ziehe ich meine<br />
Hand zurück und du wirst mei nen<br />
Rücken sehen. Mein Angesicht<br />
aber kann niemand sehen“ (33, 23).<br />
An späterer Stelle, als Mose<br />
Gottes Wort in Form der Gebote<br />
überbringt, steht geschrieben:<br />
„Als Aaron und alle Israeliten Mose<br />
sahen, strahlte die Haut seines<br />
Gesichtes Licht aus und sie<br />
fürchteten sich, in seine Nähe zu<br />
kom men“ (34, 30). Doch Moses<br />
Gesicht, das göttliche Wort<br />
tragend, ist ebenfalls nicht dafür<br />
bestimmt, dargestellt zu werden.<br />
Als Mose zu seinem menschlichen<br />
Ort zurückkehrt, kann er<br />
sein Gesicht zeigen: „Als Mose<br />
aufhörte, mit ihnen zu reden, legte<br />
er über sein Gesicht einen Schleier.<br />
Wenn Mose zum Herrn hineinging,<br />
um mit ihm zu reden, nahm er<br />
den Schleier ab, bis er wieder<br />
herauskam. Wenn er herauskam,<br />
trug er den Israeliten alles vor,<br />
was ihm aufgetragen worden war.<br />
Wenn die Israeliten das Gesicht<br />
des Mose sahen und merkten, daß<br />
die Haut seines Gesichtes Licht<br />
ausstrahlte, legte er den Schleier<br />
über sein Gesicht, bis er wieder<br />
hineinging, um mit dem Herrn zu<br />
reden“ (34, 33 – 34, 35). Ich danke<br />
Barbara Johnson für die Freundlichkeit,<br />
mich auf diese Textstellen<br />
aufmerksam zu machen.<br />
aneinandergereiht sind, endet die Reihung mit einer Figur für das, was nicht benannt<br />
werden kann, mit einer Äußerung, die strenggenommen nicht sprachlich ist. Daher übermitteln<br />
das Gesicht, der Name für das Gesicht und die Worte, durch die wir seine Bedeutung<br />
– „Du sollst nicht töten“ – verstehen sollen, die Bedeutung des Gesichts nicht ganz,<br />
da es am Ende der Reihe gerade die wortlose Vokali sierung des Leidens ist, die hier die<br />
Grenzen einer sprachlichen Übersetzung markiert. Das Gesicht, wenn wir seiner Bedeutung<br />
tatsächlich Worte beilegen wollen, wird eben das sein, für das Worte nicht wirklich<br />
funktionieren. Das Gesicht scheint eine Art Klang zu sein, der Klang von Sprache, die<br />
ihres Sinns entleert ist, das klangvolle Substrat der Vokalisierung, das der Übermittlung<br />
irgendeines semantischen Sinns vorausgeht und Grenzen setzt.<br />
Am Ende der Beschreibung fügt Lévinas die folgenden Zeilen an, welche die Satzform<br />
nicht ganz erreichen: „Das Gesicht als die äußerste Gefährdetheit des Anderen.<br />
Frieden als Erwachen für die Gefährdetheit des Anderen“ (PP, 147). Beide Aussagen<br />
sind Gleichnisse, und beide vermeiden sie das Verb, insbesondere die Kopula. Sie sagen<br />
nicht, daß das Gesicht die Gefährdetheit ist oder daß Frieden die Daseinsweise ist,<br />
die sich der Gefährdetheit des Anderen bewußt ist. Beide Phrasen sind Ersetzungen,<br />
die jede Verpflichtung auf die Ordnung des Seins verweigern. Tatsächlich sagt uns<br />
Lévinas, die „Menschlichkeit ist ein Bruch des Seins“, und in den vorangegangenen<br />
Bemerkungen zeigt er diese Außer kraftsetzung und den Bruch des Seins in einer<br />
Äußerung, die so wohl mehr als auch weniger als eine Satzform ist. Auf das Gesicht<br />
zu reagieren, seine Bedeutung zu verstehen heißt, wach zu sein für das, was an einem<br />
anderen Leben gefährdet ist, oder vielmehr wach zu sein für die Gefährdetheit des<br />
Lebens an sich. Dies kann, um sein Wort zu gebrauchen, kein Wachsein für mein eigenes<br />
Leben sein, woran sich eine Extrapolation anschließt, die von einem Verständnis<br />
meiner eigenen Gefährdetheit zu einem Verständnis des gefährdeten Lebens eines<br />
anderen reicht. Es muß ein Verständnis der Gefährdetheit des Anderen sein. Denn<br />
genau das führt dazu, daß das Gesicht zur Sphäre der Ethik gehört. Lévinas schreibt,<br />
daß „das Gesicht des anderen in seiner Gefährdetheit und Schutzlosigkeit für mich<br />
die Versuchung zu töten ist und zugleich der Aufruf zum Frieden, das ‚Du sollst nicht<br />
töten‘“ (PP, 147). Diese letzte Bemerkung deutet etwas an, das in mehreren Hinsichten<br />
entwaffnend ist. Warum sollte es so sein, daß die Gefährdetheit des Anderen eine<br />
Versuchung zu töten in mir hervorruft? Oder warum sollte sie die Versuchung zu töten<br />
zur gleichen Zeit hervorrufen, in der sie eine Forderung nach Frieden übermit telt?<br />
Liegt in meinem Erfassen der Gefährdetheit des Anderen irgend etwas, das in mir den<br />
Wunsch aufkommen läßt, den Anderen zu töten? Ist es einfach nur die Verletzbarkeit<br />
des Anderen, die für mich zu einer Versuchung des Mordes wird? Wenn mich der<br />
An dere, das Gesicht des Anderen, das schließlich die Bedeutung dieser Gefährdetheit<br />
trägt, zum Mord verlockt und mich gleichzeitig daran hindert, gemäß der Versuchung<br />
zu handeln, dann wirkt das Gesicht so, daß es einen Kampf in mir entfacht und diesen<br />
Kampf im Zentrum der Ethik etabliert. Es ist wohl Gottes Stimme, die von der menschlichen<br />
Stimme verkörpert wird, da es Gott ist, der durch Moses sagt: „Du sollst nicht<br />
töten.“ Das Gesicht, das mich einerseits mordlustig macht und mich andererseits daran<br />
hindert, zu morden, ist das Gesicht, das mit einer Stimme spricht, die ihm nicht gehört,<br />
das mit einer Stimme spricht, die keine menschliche Stimme ist.4 Das Gesicht gibt also<br />
verschiedene Äußerungen zu gleich von sich: Es zeugt von einer Qual, einer Verwundbarkeit,<br />
während es gleichzeitig ein göttliches Verbot gegen das Töten kundtut.5<br />
Zuvor geht Lévinas in „Paix et Proximité“ auf die Berufung Eu ropas ein und fragt sich,<br />
ob das „Du sollst nicht töten“ nicht genau das ist, was man aus der Bedeutung europäischer<br />
Kultur heraushören sollte. Es bleibt unklar, wo sein Europa anfängt oder aufhört,<br />
ob es überhaupt geographische Grenzen hat oder ob es jedes Mal erzeugt wird, wenn<br />
das Gebot ausgesprochen oder vermittelt wird. Das allein ist schon ein merkwürdiges<br />
Europa, dessen Bedeutung spekulativerweise in den Worten des Gottes der Hebräer
5 Lévinas schreibt: „Doch dieses<br />
Gesicht mir gegenüber, in seinem<br />
Ausdruck – in seiner Sterblichkeit<br />
– ruft mich auf, fordert mich<br />
auf, verlangt mich: so als ob der<br />
unsichtbare Tod, dem sich das<br />
Gesicht des anderen gegenübersieht<br />
[…] ‚meine Angelegenheit‘<br />
wäre. So als ob er mich, ohne<br />
daß der an dere es weiß, den es in<br />
der Nacktheit seines Angesichts<br />
bereits betrifft, ‚et was anginge‘,<br />
noch bevor ich damit konfrontiert<br />
bin, noch bevor es der Tod ist, der<br />
mir selbst ins Gesicht starrt. Der<br />
Tod des anderen Menschen stellt<br />
mich in Frage, so als ob ich durch<br />
meine mögliche Gleichgültigkeit<br />
zum Komplizen dieses Todes werden<br />
würde, des Todes des anderen,<br />
der ihm un sichtbar ist und dem<br />
er sich aussetzt; als ob ich diesen<br />
Tod des anderen zu verantworten<br />
hätte, noch bevor ich selbst dazu<br />
verurteilt bin, und den an deren in<br />
seiner Todeseinsamkeit nicht allein<br />
lassen dürfte.“ Emmanuel Lévinas,<br />
„Philosophie et Transcendance“, in:<br />
ders., Altérité et Transcendance,<br />
Paris: Fata Morgana 1995, S. 45 f.<br />
zu suchen sein soll, ein Europa, dessen zivilisatorischer Status sozusagen von der<br />
Übermittlung göttlicher Verbote aus der Bibel abhängt. Es ist Europa, wo das Hebräertum<br />
an die Stelle des Hellenismus getreten ist und der Islam unaussprechlich bleibt.<br />
Vielleicht will Lévinas uns sagen, daß das einzige Europa, das Europa genannt werden<br />
sollte, dasjenige ist, welches das Alte Testament über das Zivilrecht und weltliches<br />
Recht erhebt. Jedenfalls scheint er zum Primat des Verbots für die Bedeutung von<br />
Zi vilisation schlechthin zurückzukehren. Und obwohl wir versucht sein könnten, dies<br />
als einen schändlichen Eurozentrismus zu ver stehen, ist es wahrscheinlich auch wichtig,<br />
zu sehen, daß es kein erkennbares Europa gibt, das sich aus seiner Sicht ableiten<br />
ließe. Tatsächlich ist es nicht die Existenz des Mordverbots, was Europa zu Europa<br />
macht, sondern die Sorge und der Wunsch, die das Ver bot erzeugt. Bei seiner weiteren<br />
Erläuterung, wie dieses Gebot funktioniert, bezieht sich Lévinas auf Genesis, Kapitel<br />
32, in dem Jakob von dem bevorstehenden Herannahen seines Bruders und Rivalen<br />
Esau erfährt: „Jacob ist beunruhigt durch die Nachricht, daß ihm sein Bruder Esau –<br />
Freund oder Feind – entgegenmarschiert: ,An der Spitze von vierhundert Mann.‘ Vers<br />
8 sagt uns: ,Jakob erschrak sehr und bekam Angst.‘“ Lévinas wendet sich dann dem<br />
Kommentator Rashi zu, um „den Unterschied zwischen Furcht und Angst“ zu verstehen,<br />
und kommt zu dem Schluß: „[Jakob] ängstigte sich vor dem eigenen Tod, aber er fürchtete,<br />
töten zu müssen“ (PP, 142).<br />
Es bleibt natürlich nach wie vor unklar, warum Lévinas anneh men sollte, daß eine der<br />
ersten oder wesentlichen Reaktionen auf die Gefährdetheit eines anderen der Wunsch<br />
zu töten ist. Warum sollte es so sein, daß die Sprungfeder der Schulterblätter, das<br />
Strecken des Halses, die gequälte Vokalisierung, die das Leiden eines anderen vermitteln,<br />
in jemandem eine Lust auf Gewalt aus lösen? Es muß so sein, daß Esau, der mir<br />
mit seinen vierhundert Mann gegenübersteht, droht, mich zu töten, oder so aussieht,<br />
als ob er das vorhat, und daß ich mich im Hinblick auf diesen be drohlichen Anderen<br />
oder sogar den, dessen Gesicht eine Bedro hung darstellt, verteidigen muß, um mein<br />
Leben zu erhalten. Lévinas erklärt jedoch, daß Mord im Namen der Selbsterhaltung<br />
nicht gerechtfertigt ist, daß Selbsterhaltung nie eine hinreichende Bedingung für die<br />
ethische Rechtfertigung von Gewalt ist. Dies erscheint uns dann wie ein extremer<br />
Pazifismus, ein absoluter Pa zifismus, und das mag durchaus so sein. Wir können diese<br />
Folgen akzeptieren wollen oder auch nicht, aber wir sollten das von ih nen hervorgerufene<br />
Dilemma als konstitutiv für die ethische Sorge berücksichtigen: „Er ängstigte<br />
sich vor dem eigenen Tod, aber er fürchtete, töten zu müssen.“ Da ist Angst um das<br />
eigene Überleben, und da ist Furcht, den Anderen zu verletzen. Und diese beiden<br />
Impulse bekämpfen einander, wie Geschwister mit einander streiten. Aber sie bekämpfen<br />
einander, damit es nicht zu einem Kampf kommt, und das ist wohl der entscheidende<br />
Punkt. Denn die Gewaltlosigkeit, die Lévinas zu befürworten scheint, entspringt nicht<br />
einem friedlichen Ort, sondern einer andauern den Spannung zwischen der Angst,<br />
Gewalt zu erleiden, und der Angst, Gewalt zuzufügen. Ich könnte meiner Angst vor<br />
dem ei genen Tod ein Ende machen, indem ich den anderen vernichte, obwohl ich<br />
dann mit der Vernichtung weitermachen müßte, wenn es so ist, daß 400 Mann hinter<br />
ihm stehen und alle noch Fa milien und Freunde haben, sofern ihm nicht gar ein oder<br />
zwei Na tionen beistehen. Ich könnte meiner Besorgnis, ein Mörder zu werden, ein<br />
Ende bereiten, indem ich mich mit der ethischen Rechtfertigung abfinde, die unter<br />
solchen Voraussetzungen für das Begehen von Gewalthandlung und Tötung gilt. Ich<br />
könnte das utilitaristische Kalkül hervorholen oder an die intrinsischen Rechte von<br />
Individuen appellieren, ihre eigenen Rechte zu schüt zen und zu wahren. Wir können<br />
uns sowohl für die konsequen tialistische als auch für die deontologische Rechtfertigung<br />
Verwen dungsweisen vorstellen, die mir viele Möglichkeiten geben würden,<br />
selbstgerecht Gewalt zuzufügen. Ein Konsequentialist könnte argumentieren, es<br />
wäre zum Nutzen der vielen. Ein Deontologe könnte sich auf den intrinsischen Wert
144 — 145<br />
Judith Butler<br />
6 „Ist die Ontologie fundamental?“,<br />
in: Emmanuel Lévinas, Zwischen<br />
uns. Versuche über das Denken<br />
an den Anderen, übers. von Frank<br />
Mäthing, München: Hanser 1995,<br />
S. 21 f.<br />
des eigenen Lebens berufen. Die Rechtfertigungen könnten außerdem dazu benutzt<br />
werden, das Primat des Mordverbots anzufechten, ange sichts dessen ich meine<br />
Besorgnis ständig spüren würde.<br />
Obwohl sich Lévinas dahingehend ausspricht, daß Selbsterhal tung kein hinreichender<br />
Grund zum Töten ist, nimmt er doch auch an, daß der Wunsch zu töten für Menschen<br />
wesentlich ist. Ist der Wunsch zu töten der erste Impuls gegenüber der Verletzbar keit<br />
des anderen, so besteht die ethische Anweisung genau darin, gegen diesen ersten<br />
Impuls vorzugehen. Psychoanalytisch ausge drückt würde das bedeuten, den Wunsch<br />
zu töten umzudirigieren zugunsten des inneren Wunsches, die eigene Aggression<br />
und das Gefühl der Vorrangigkeit auszumerzen. Das Ergebnis würde wahrscheinlich<br />
neurotisch ausfallen, aber es ist möglich, daß die Psychoanalyse hier an ihre Grenzen<br />
stößt. Für Lévinas ist es das Ethische selbst, das einen aus dem Kreislauf des schlechten<br />
Ge wissens herausführt, aus der Logik, mit der das Aggressionsver bot zum inneren<br />
Kanal für die Aggression selbst wird. Die Ag gression wird dann in Form von Grausamkeit<br />
des ÜberIchs auf einen selbst zurückgewendet. Wenn uns das Ethische über<br />
das schlechte Gewissen hinausführt, dann deshalb, weil das schlechte Gewissen letztlich<br />
nur eine negative Version des Narzißmus ist und somit immerhin noch eine Form<br />
des Narzißmus. Das Ge sicht des Anderen erreicht mich von außerhalb und unterbricht<br />
diesen narzißtischen Zirkel. Das Gesicht des Anderen ruft mich aus dem Narzißmus<br />
heraus zu etwas, das letztlich wichtiger ist. Lévinas schreibt: „Der Nächste ist das<br />
einzige Wesen, das ich tö ten wollen kann. Ich kann wollen. Und doch ist dieses Können<br />
(pouvoir) das genaue Gegenteil der Macht (pouvoir). Der Tri umph dieses Könnens ist<br />
seine Niederlage als Macht. Im gleichen Moment, wo meine Fähigkeit zu töten in die<br />
Tat umgesetzt wird, ist mir der Nächste schon entwischt. […] Ich habe ihm nicht ins<br />
Gesicht gesehen, ich bin nicht seinem Antlitz begegnet. Die Ver suchung der totalen<br />
Negation, […] das ist die Gegenwart des Antlitzes. Dem Nächsten von Angesicht zu<br />
Angesicht gegen überstehen heißt, nicht töten können. Das ist auch die Situation des<br />
Diskurses.“6<br />
Es ist auch die Situation des Diskurses … Letzteres ist kein leerer Anspruch. Lévinas<br />
erklärt in einem Interview: „Antlitz und Ge spräch sind miteinander verbunden. Das<br />
Antlitz spricht. Es spricht, indem gerade durch es das Gespräch ermöglicht und be gonnen<br />
wird“ (EU, 66). Da das, was das Gesicht ‚sagt‘, „Du sollst nicht töten“ lautet, hat es<br />
den Anschein, als würde das Sprechen erst durch dieses wesentliche Gebot entstehen,<br />
so daß das Spre chen erst vor dem Hintergrund dieses möglichen Mordes ent steht.<br />
Allgemeiner gesagt, der Diskurs erhebt genau deshalb einen ethischen Anspruch an<br />
uns, weil noch vor dem Sprechen etwas zu uns gesagt wird. In einem einfachen Sinne,<br />
und vielleicht nicht ganz so wie von Lévinas beabsichtigt, werden wir von einem<br />
An deren angesprochen, der zu uns spricht, bevor wir selbst die Spra che erwerben.<br />
Und wir können weiter folgern, daß wir nur unter der Bedingung, daß wir angesprochen<br />
werden, fähig sind, von der Sprache Gebrauch zu machen. In diesem Sinne ist der<br />
Andere die Voraussetzung des Diskurses. Wenn der Andere ausgelöscht ist, ist es die<br />
Sprache ebenfalls, denn außerhalb der Bedingungen der Ansprache kann die Sprache<br />
nicht überleben.<br />
Doch wir sollten uns daran erinnern, daß uns Lévinas auch mit geteilt hat, daß das<br />
Gesicht – welches das Gesicht des Anderen ist und somit die vom Anderen gestellte<br />
ethische Forderung – die Vokalisierung der Qual ist, die noch nicht Sprache oder nicht<br />
mehr Sprache ist, das, von dem wir geweckt werden für die Ge fährdetheit des Lebens<br />
des Anderen, das, was die Versuchung zu morden und zugleich das Verbot dagegen<br />
hervorruft. Warum sollte es so sein, daß die Unfähigkeit zu töten die Situation des<br />
Diskurses ist? Ist es nicht vielmehr so, daß die Spannung zwi schen der Angst um das<br />
eigene Leben und der Sorge, zum Mörder zu werden, die Zweideutigkeit schafft, die<br />
die Situation des Dis kurses ist? Es ist eine Situation, in der wir angesprochen werden,
in welcher der Andere die Sprache an uns richtet. Diese Sprache teilt die Gefährdetheit<br />
des Lebens mit, welche die anhaltende Spannung einer gewaltfreien Ethik erzeugt.<br />
Die Situation des Diskurses ist nicht dasselbe wie das Gesagte oder sogar das Sag bare.<br />
Für Lévinas besteht die Situation des Diskurses in der Tat sache, daß die Sprache<br />
bei uns wie eine Ansprache ankommt, die wir nicht wollen und von der wir in einem<br />
ursprünglichen Sinne gefangen, wenn nicht gar, mit den Worten von Lévinas, als Geisel<br />
genommen werden. So liegt bereits darin, angesprochen zu werden, einen Namen zu<br />
erhalten, einer Reihe von Zumutungen un terworfen zu sein, auf eine fordernde Alterität<br />
reagieren zu müs sen, eine gewisse Gewalt. Niemand überprüft die Ausdrücke, mit<br />
denen man angesprochen wird, zumindest nicht in der grundsätz lichsten Weise. Angesprochen<br />
zu werden heißt, von Anfang an seines Willens beraubt zu werden, und diese<br />
Beraubung ist der Si tuation im Diskurs zugrunde gelegt.<br />
Im ethischen Gefüge der Lévinasschen Position beginnen wir mit der Postulierung<br />
einer Dyade. Doch die Sphäre der Politik ist, wie er sagt, ein Bereich, in dem stets mehr<br />
als zwei Subjekte im Spiel sind. Ich könnte in der Tat entscheiden, mich nicht auf<br />
mei nen Wunsch nach Selbsterhaltung zu berufen, um eine Rechtfer tigung für Gewalt<br />
zu haben, aber was ist, wenn Gewalt an jeman dem verübt wird, den ich liebe? Was<br />
ist, wenn da ein Anderer ist, der einem weiteren Anderen Gewalt antut? Auf welchen<br />
Anderen reagiere ich ethisch? Welchem Anderen gebe ich Vorrang vor mir selbst?<br />
Oder schaue ich dann nur zu? Derrida behauptet, wenn man versuche, auf jeden Anderen<br />
zu reagieren, könne das nur zu einer Situation völliger Unverantwortlichkeit führen.<br />
Und die Spinozisten, Nietzscheaner, Utilitaristen und Freudianer fragen alle: „Kann<br />
ich mich auf den Imperativ berufen, das Leben des An deren zu erhalten, auch wenn<br />
ich dieses Recht der Selbsterhaltung für mich selbst nicht anführen kann?“ Und ist<br />
es wirklich mög lich, der Selbsterhaltung in der Weise auszuweichen, wie Lévinas das<br />
impliziert? Spinoza schreibt in der Ethik, daß der Wunsch, das rechte Leben zu führen,<br />
den Wunsch zu leben erfordert, den Wunsch, im eigenen Sein zu beharren; wodurch<br />
angedeutet ist, daß die Ethik immer einige Lebenstriebe dirigieren muß, selbst wenn<br />
die Ethik als ein ÜberIchZustand droht, zu einer reinen Kultur des Todestriebs<br />
zu werden. Es ist möglich, ja, sogar ein fach, Lévinas als einen gehobenen Masochisten<br />
zu deuten, und es hilft uns nicht, diesen Schluß zu verhindern, wenn wir bedenken,<br />
daß er einmal – gefragt, was er über die Psychoanalyse denke – er widert haben soll:<br />
„Ist das nicht eine Form von Pornographie?“<br />
Doch gibt es zumindest einen zweifachen Grund dafür, im heuti gen Kontext auf Lévinas<br />
einzugehen. Erstens ermöglicht er es uns, über das Verhältnis zwischen Darstellung<br />
und Vermenschli chung nachzudenken, ein Verhältnis, das keineswegs so unkom pliziert<br />
ist, wie wir vielleicht glauben möchten. Wenn kritisches Denken zur gegenwärtigen<br />
Situation etwas zu sagen hat, dann sehr wahrscheinlich auf dem Gebiet der Darstellung,<br />
wo Ver menschlichung und Entmenschlichung unaufhörlich vor sich ge hen. Zweitens<br />
bietet Lévinas, in einer Tradition jüdischer Philo sophie stehend, einen Ansatz für das<br />
Verhältnis zwischen Gewalt und Ethik, der wichtige Implikationen für ein Nachdenken<br />
dar über hat, wie eine jüdische Ethik der Gewaltlosigkeit aussehen könnte. Ich habe den<br />
Eindruck, das ist für viele von uns eine zeit gemäße und dringliche Frage, und besonders<br />
für diejenigen unter uns, die das noch junge Moment des Postzionismus im Judentum<br />
unterstützen. Vorerst möchte ich die Problematik der Vermenschlichung noch einmal<br />
überdenken, indem wir uns ihr über die Figur des Gesichts nähern.<br />
Wenn wir uns überlegen, wie wir gewöhnlich über Vermensch lichung und Entmenschlichung<br />
denken, treffen wir auf die An nahme, daß diejenigen, die zur Darstellung,<br />
insbesondere zur Selbstdarstellung, gelangen, eine bessere Chance haben, vermenschlicht<br />
zu werden, und daß diejenigen, die keine Chance ha ben, sich selbst darzustellen,<br />
ein größeres Risiko tragen, als Un termenschen behandelt zu werden, als Untermenschen
146 — 147<br />
Judith Butler<br />
7 Lévinas unterscheidet manchmal<br />
zwischen dem „Gesichtsausdruck“<br />
[countenance], worunter das<br />
Gesicht im Wahrnehmungs erleben<br />
verstanden wird, und dem „Gesicht“,<br />
dessen Koordinaten das Wahrnehmungsfeld<br />
trans zen dieren.<br />
Gelegentlich spricht er auch von<br />
„plastischen“ Darstellungen des<br />
Gesichts, die das Gesicht tilgen.<br />
Damit sich das Gesicht wie ein<br />
Gesicht ver halten kann, muß es<br />
sich stimmhaft äußern oder als<br />
die Funktionsweise ei ner Stimme<br />
verstanden werden.<br />
8 Siehe Lila AbuLughod, „Do<br />
Muslim Women Really Need Saving?<br />
Anthropological Reflections on<br />
Cultural Relativism and Others“, in:<br />
American Anthropologist, 104/3,<br />
S. 783–790.<br />
betrachtet zu werden oder sogar überhaupt nicht beachtet zu werden. Damit stehen<br />
wir vor einem Paradox, weil Lévinas deutlich gemacht hat, daß das Gesicht nicht<br />
ausschließlich ein menschliches Gesicht ist und gleichwohl eine Bedingung für<br />
Vermenschlichung ist.7 Ande rerseits wird das Gesicht in den Medien verwendet, um<br />
eine Ent menschlichung zu bewirken. Die Personifizierung vermensch licht offenkundig<br />
nicht immer. Für Lévinas kann sie das Gesicht, das vermenschlicht, durchaus entleeren;<br />
und ich möchte zeigen, daß die Personifizierung zuweilen ihre eigene Entmenschlichung<br />
vollzieht. Wie können wir den Unterschied erkennen zwischen dem nichtmenschlichen,<br />
aber (für Lévinas) vermenschlichenden Gesicht und der Entmenschlichung, die ebenfalls<br />
durch das Gesicht erfolgen kann?<br />
Vielleicht müssen wir an die verschiedenen Formen denken, in denen Gewalt geschehen<br />
kann: eine Form ist genau die durch die Herstellung des Gesichts, des Gesichts von<br />
Osama Bin Laden, des Gesichts von Jasir Arafat, des Gesichts von Saddam Hussein.<br />
Was ist mit diesen Gesichtern in den Medien geschehen? Sie sind ins Bild gesetzt<br />
geworden, gewiß, aber sie produzieren sich auch für dieses Bild. Und das Ergebnis ist<br />
ausnahmslos tendenziös. Es handelt sich dabei um mediengerechte Porträts, die oft<br />
im Dienst des Kriegs arrangiert werden, so als ob Bin Ladens Gesicht das Gesicht des<br />
Terrors wäre, als ob Arafats Gesicht das Gesicht der Täuschung wäre, als ob Saddams<br />
Gesicht das Gesicht zeitgenös sischer Tyrannei wäre. Und dagegen dann das Gesicht<br />
von Colin Powell, so wie es ins Bild gesetzt und verbreitet wird: Powell sitzt vor der<br />
ihn umgebenden Leinwand von Picassos Guernica, ein Gesicht, daß vor einem Hintergrund<br />
der Auslöschung in den Vor dergrund tritt, könnten wir sagen. Außerdem gibt<br />
es die Gesich ter afghanischer Mädchen, die ihre Burkas abgelegt oder fallen ge lassen<br />
haben. Irgendwann im letzten Winter besuchte ich einen Politikwissenschaftler, der<br />
diese Gesichter stolz an seiner Kühl schranktür zur Schau stellte – direkt neben einigen<br />
anscheinend wertvollen Supermarktcoupons: Für ihn waren sie ein Zeichen erfolgreicher<br />
Demokratie. Ein paar Tage später besuchte ich eine Konferenz, auf der ich einen<br />
Vortrag über die wichtigen kulturel len Bedeutungen der Burka hörte, darüber, wie<br />
sie für die Zuge hörigkeit zu einer Gemeinschaft und Religion, zu einer Familie, einer<br />
umfangreichen Geschichte von Verwandtschaftsbeziehun gen steht, daß sie eine Übung<br />
in Bescheidenheit und Stolz, einen Schutz vor Scham symbolisiert und daß sie auch<br />
als Schleier dient, hinter dem und durch den die weibliche Handlungsfähigkeit wir ken<br />
kann.8 Die Sprecherin fürchtete, daß die Zerstörung der Burka, so als sei diese ein<br />
Zeichen der Unterdrückung, der Rück ständigkeit oder sogar des Widerstandes gegenüber<br />
der kultu rellen Moderne selbst, zu einer erheblichen Dezimierung isla mischer<br />
Kultur führen würde und zu einer Ausbreitung von USamerikanischen kulturellen<br />
Annahmen, wie Sexualität und Handlungsfähigkeit zu organisieren und darzustellen<br />
seien. Den triumphalen Fotos zufolge, die die Titelseite der New York Times beherrschten,<br />
entblößten diese jungen Frauen ihre Gesichter in einem Akt der Befreiung, aus Dankbarkeit<br />
für das USMilitär und als Ausdruck eines Vergnügens, das plötzlich und zum<br />
allergröß ten Entzücken nicht mehr verboten ist. Der amerikanische Zu schauer war<br />
sozusagen reif dafür, das Gesicht zu sehen, und schließlich wurde das Gesicht vor der<br />
Kamera und für die Kamera entblößt, wo es schlagartig zum Symbol für den kulturellen<br />
Fort schritt wurde, den man erfolgreich aus Amerika exportiert hatte. Das Gesicht<br />
wurde uns in diesem Augenblick entblößt, und wir waren gewissermaßen im Besitz des<br />
Gesichts; es wurde nicht nur von unseren Kameras eingefangen, sondern wir arrangierten<br />
es so, daß das Gesicht unseren Triumph einfängt und als Begrün dung für unsere<br />
Gewalt dient, für den Einbruch in die Souveräni tät, den Tod von Zivilisten. Wo ist der<br />
Verlust in diesem Gesicht? Und wo bleibt das Leiden wegen des Krieges? Tatsächlich<br />
scheint das fotografierte Gesicht das Gesicht im Lévinasschen Sinne zu verbergen oder<br />
zu ersetzen, denn wir sahen und hörten durch die ses Gesicht keine Vokalisierung von<br />
Trauer oder Qual, bemerkten kein Gefühl für die Gefährdetheit des Lebens.
Damit erfassen wir offenbar eine gewisse Ambivalenz. Eigenarti gerweise vermenschlichen<br />
all diese Gesichter die Ereignisse des letzten Jahres; sie geben den afghanischen<br />
Frauen ein menschli ches Gesicht; sie geben dem Terror ein Gesicht; sie geben dem<br />
Bö sen ein Gesicht. Aber wirkt das Gesicht in jedem einzelnen Fall vermenschlichend?<br />
Und wenn es in manchen Fällen vermensch lichend wirkt, in welcher Form erfolgt<br />
dann diese Vermenschli chung, und gibt es nicht auch eine Entmenschlichung, die im<br />
Ge sicht und durch das Gesicht vorgenommen wird? Begegnen wir diesen Gesichtern<br />
im Lévinasschen Sinne oder sind es in verschie denen Hinsichten Bilder, die durch<br />
ihre mediale Formatierung das paradigmatisch Menschliche erzeugen, die zu den<br />
kulturellen Mitteln werden, mit denen das paradigmatisch Menschliche eta bliert wird?<br />
Obwohl der Gedanke verführerisch ist, daß die Bil der selbst die visuelle Norm für das<br />
Menschliche setzen, eine Norm, die angestrebt oder verkörpert werden sollte, wäre<br />
es falsch, so zu denken. Denn im Falle von Bin Laden oder Saddam Hussein ist das<br />
paradigmatisch Menschliche als etwas zu verste hen, das außerhalb des formatierten<br />
Bildes zu verorten ist; es han delt sich bei ihnen um das menschliche Gesicht in seiner<br />
Deformiertheit und Extremheit, nicht um das Gesicht, mit dem man sich identifizieren<br />
soll. Mit der übertriebenen Aufnahme des Bö sen in das Gesicht, die Augen, wird die<br />
Ablehnung der Identifi zierung regelrecht provoziert. Und falls wir uns selbst in diesen<br />
Bildern irgendwo angerufen fühlen sollten, dann eben gerade als der nicht dargestellte<br />
Betrachter, als derjenige, der zuschaut, der von überhaupt keinem Bild eingefangen<br />
wird, der aber dafür zu ständig ist, das jeweilige Bild einzufangen, zu unterwerfen,<br />
wenn nicht gar auszuschlachten. Genauso werden wir vielleicht die plötzlich entblößten<br />
Gesichter der jungen afghanischen Frauen als die Feier des Menschlichen verfechten<br />
wollen, müssen uns aber fragen, in welcher narrativen Funktion diese Bilder mobili siert<br />
werden, ob der militärische Einfall in Afghanistan wirklich im Namen des Feminismus<br />
erfolgte und in welche Form sich die ser Feminismus nachträglich kleidete. Am<br />
wichtigs ten ist aller dings, daß wir fragen müssen, welche Szenen des Schmerzes<br />
und der Trauer diese Bilder übertünchen und derealisieren. Offenbar heben alle diese<br />
Bilder die Gefährdetheit des Lebens auf; sie stel len entweder Amerikas Triumph dar<br />
oder liefern einen Anreiz für zukünftige militärische Triumphe Amerikas. Sie sind die<br />
Kriegsbeute, oder sie sind die Kriegsziele. Und in diesem Sinne ist das Gesicht in jedem<br />
Fall verunstaltet, könnten wir sagen, und daß dies eine der repräsentationalen und<br />
philosophischen Konse quenzen des Krieges ist.<br />
Es ist wichtig, zwischen den Arten von Nichtdarstellbarkeit zu unterscheiden. Zunächst<br />
einmal gibt es die Lévinassche Auffas sung, derzufolge es ein „Gesicht“ gibt, welches<br />
kein Gesicht voll ständig erschöpfen kann: das Gesicht verstanden als menschliches<br />
Leiden, als der Schrei menschlichen Leidens, der keine direkte Darstellung zuläßt. Hier<br />
ist das „Gesicht“ stets eine Figur für et was, das buchstäblich genommen kein Gesicht<br />
ist. Andere menschliche Ausdrücke sind hingegen sinnbildlich als ein „Ge sicht“ darstellbar,<br />
obwohl sie keine Gesichter sind, sondern Laute oder Mitteilungen einer anderen<br />
Ordnung. Der Schrei, der durch die Figur des Gesichts dargestellt wird, ist so beschaffen,<br />
daß er die Sinne verwirrt und einen eindeutig unrichtigen Vergleich her vorruft: Das<br />
kann nicht richtig sein, denn das Gesicht ist kein Laut. Und dennoch kann das Gesicht<br />
für den Laut stehen, gerade weil es nicht der Laut ist. In diesem Sinn unterstreicht<br />
die Figur die Unvergleichbarkeit des Gesichts mit was immer es darstellt.<br />
Das Gesicht stellt also genaugenommen gar nichts dar, in dem Sinne, als es das,<br />
worauf es verweist, nicht einzufangen und zu übermitteln vermag.<br />
Für Lévinas wird das Menschliche also nicht vom Gesicht darge stellt. Das Menschliche<br />
wird vielmehr in genau der Disjunktion indirekt bejaht, welche die Darstellung unmöglich<br />
macht, und diese Disjunktion wird in der unmöglichen Darstellung vermit telt.<br />
Damit die Darstellung das Menschliche vermitteln kann, muß sie nicht nur scheitern,
148 — 149<br />
Judith Butler<br />
9 Zu einer ausführlichen<br />
Erörterung der Beziehung zwischen<br />
dem medialen Bild und dem<br />
menschlichen Leiden siehe den<br />
provokanten Text von Susan<br />
Sontag, Die Leiden anderer<br />
betrachten, übers. von Reinhard<br />
Kaiser, München: Hanser 2003.<br />
10 Zu einer Erörterung des<br />
„ Scheiterns“ als grundlegend für<br />
eine psychoana lytische Konzeption<br />
der Psyche siehe Jacqueline<br />
Rose, Sexuality in the Field<br />
of Vision, London: Verso 1986,<br />
S. 91 ff.; dt. Sexualität im Feld der<br />
Anschauung, Wien: Turia & Kant<br />
1996.<br />
sondern sie muß ihr Scheitern zudem noch zeigen. Es gibt etwas Nichtdarstellbares,<br />
das wir dennoch darzustellen versuchen, und dieses Paradox muß in der Darstel lung,<br />
die wir geben, beibehalten werden.<br />
In diesem Sinne wird das Menschliche nicht mit dem gleichge setzt, was dargestellt<br />
wird, es wird aber auch nicht dem Nichtdar stellbaren gleichgesetzt; es ist vielmehr<br />
das, was das Gelingen ei ner jeden darstellenden Praktik beschränkt. Das Gesicht wird<br />
bei diesem Scheitern der Darstellung nicht „ausgelöscht“, sondern wird eben in dieser<br />
Möglichkeit geschaffen. Etwas vollkommen anderes passiert allerdings dann, wenn<br />
das Gesicht im Dienst ei ner Personifizierung wirksam ist, die beansprucht, den fraglichen<br />
Menschen „einzufangen“. Für Lévinas läßt sich das Menschliche nicht durch<br />
die Darstellung einfangen, und wir können beobach ten, daß ein gewisser Verlust des<br />
Menschlichen stattfindet, wenn es von dem Bild „eingefangen“ wird.9<br />
Ein Beispiel für ein derartiges „Einfangen“ ist dann gegeben, wenn das Böse durch<br />
das Gesicht personifiziert wird. Da wird eine bestimmte Entsprechung zwischen<br />
dem angeblich Bösen und dem Gesicht behauptet. Dieses Gesicht ist böse, und das<br />
Böse, das das Gesicht ist, weitet sich aus zu dem Bösen, das den Menschen insgesamt<br />
zukommt – dem verallgemeinerten Bösen. Wir personifizieren das Böse oder<br />
den militärischen Triumph durch ein Gesicht, das die Idee, für die es steht, sein soll,<br />
ein fangen soll, enthalten soll. In diesem Fall können wir das Gesicht nicht durch das<br />
Gesicht hören. Das Gesicht maskiert hier die Laute des menschlichen Leidens und<br />
die Nähe, die wir zur Gefährdetheit des Lebens selbst einnehmen könnten.<br />
Das Gesicht dort drüben, dessen Bedeutung so hingestellt wird, als sei es vom Bösen<br />
ergriffen, ist jedoch genau das Gesicht, das nicht menschlich ist, nicht im Lévinasschen<br />
Sinne menschlich. Das „Ich“, das dieses Gesicht betrachtet, wird nicht damit identifiziert:<br />
Das Gesicht stellt das dar, womit keine Identifizierung möglich ist, eine Vollendung<br />
der Entmenschlichung und eine Be dingung für Gewalt.<br />
Eine vollständigere Ausarbeitung dieses Themas müßte natür lich die unterschiedlichen<br />
Mittel genauer analysieren, mit denen diese Darstellung im Hinblick auf Vermenschlichung<br />
und Ent menschlichung arbeitet. Manchmal gibt es triumphale Bilder, die uns<br />
eine Idee des Menschlichen vermitteln, mit dem wir uns iden tifizieren sollen, beispielsweise<br />
mit dem patriotischen Helden, der unsere eigenen IchGrenzen ekstatisch auf<br />
die der Nation ausweitet. Ohne Berücksichtigung der Bedingungen und Bedeu tungen<br />
von Identifikation und Gegenidentifikation kann das Ver hältnis zwischen Bild und<br />
Vermenschlichung nicht wirklich verstanden werden. Man muß allerdings beachten,<br />
daß die Iden tifizierung immer auf einer Differenz beruht, die sie überwinden will, und<br />
daß ihr Ziel nur erreicht wird, indem die Differenz wie dereingeführt wird, die überwunden<br />
zu haben sie beansprucht. Die Person, mit der ich mich identifiziere, bin nicht<br />
ich, und das „nicht ich sein“ ist die Voraussetzung für die Identifikation. An dernfalls,<br />
daran erinnert uns Jacqueline Rose, fällt die Identifika tion mit der Identität zusammen,<br />
und das bedeutet den Tod der Identifikation selbst.10 Diese interne Differenz in<br />
der Identifizie rung ist entscheidend und zeigt uns gewissermaßen, daß die Gegenidentifizierung<br />
Bestandteil des gewöhnlichen Identifizie rungsvorgangs ist. Das<br />
triumphale Bild kann dem Betrachter eine unmögliche Überwindung dieser Differenz<br />
vermitteln, einen Typ von Identifikation, der meint, daß er die Differenz überwunden<br />
hat, welche die Bedingung seiner Möglichkeit ist. Das kritische Bild, wenn wir so<br />
reden können, verarbeitet diese Differenz in derselben Weise wie das Lévinassche Bild;<br />
es muß nicht nur daran scheitern, seinen Referenten einzufangen, sondern dieses<br />
Schei tern auch zeigen.<br />
Die Forderung nach einem wahrhaftigeren Bild, nach mehr Bildern, nach Bildern,<br />
die den ganzen Schrecken und die Wirk lichkeit des Leidens übermitteln, ist wichtig<br />
und angebracht. Die Tilgung dieses Leidens durch das Verbot von Bildern und Darstellungen<br />
grenzt allgemeiner betrachtet die Sphäre des Erschei nens ein, den Bereich
11 „In diesem Sinn kann man<br />
sagen, daß das Antlitz nicht<br />
‚ gesehen‘ wird. Es ist das, was<br />
nicht ein Inhalt werden kann, den<br />
unser Denken umfassen könnte;<br />
es ist das Unenthaltbare, es führt<br />
uns darüber hinaus.“ Lévinas,<br />
Ethik und Unendliches, a.a.0.,<br />
S. 65.<br />
dessen, was wir sehen und was wir wissen können. Es wäre aber ein Fehler, zu glauben,<br />
wir müßten lediglich die richtigen und wahren Bilder finden, und dann werde eine<br />
be stimmte Wirklichkeit schon übermittelt. Die Wirklichkeit wird nicht von dem vermittelt,<br />
was im Bild dargestellt wird, sondern dadurch, daß die Darstellung, welche die<br />
Realität übermittelt, in Frage gestellt wird.11<br />
Die Entleerung des Menschlichen durch das Bild in den Me dien muß dennoch unter<br />
dem Gesichtspunkt des umfassenderen Problems verstanden werden, daß normative<br />
Schemata der Intel ligibilität die Etablierung dessen bewirken, was als menschlich<br />
gelten wird und was nicht, was ein lebenswertes Leben sein wird und was ein betrauernswerter<br />
Tod. Diese normativen Schemata wirken nicht bloß, indem sie Ideale des<br />
Menschlichen erzeugen, die einen Unterschied zwischen denjenigen machen, die mehr<br />
oder weniger menschlich sind. Zuweilen erzeugen sie Bilder von Untermenschen in der<br />
Verstellung als Menschen, um zu zeigen, wie sich das Untermenschentum verstellt und<br />
diejenigen von uns zu betrügen droht, die möglicherweise glauben, in jenem Gesicht<br />
einen anderen Menschen zu erkennen. Aber manchmal funktio nieren diese normativen<br />
Schemata gerade dadurch, daß sie kein Bild, keinen Namen, keine Erzählung liefern,<br />
so daß es niemals ein Leben und niemals einen Tod gegeben hat. Es handelt sich um<br />
zwei unterschiedliche Formen der normativen Macht: Die eine wirkt, indem sie eine<br />
symbolische Identifikation des Gesichts mit dem Unmenschlichen vornimmt und unser<br />
Verständnis für das Menschliche in der Szene vorab ausschließt; die andere funktioniert<br />
durch gründliche Auslöschung, so daß es niemals einen Menschen, nie ein Leben<br />
gegeben hat und daher auch nie ein Mord stattgefunden hat. Im ersten Fall muß<br />
etwas, das bereits im Bereich des Erscheinens aufgetaucht ist, als erkennbar menschlich<br />
bestritten werden; im zweiten Fall wird der öffentliche Bereich des Erscheinens an<br />
sich erst auf der Grundlage des Ausschlusses jenes Bildes konstituiert. Die anstehende<br />
Aufgabe ist die, in der Öffentlichkeit Formen des Sehens und Hörens zu etablieren,<br />
die auf den Schrei des Menschlichen in der Sphäre des Erscheinens durchaus reagieren<br />
können, eine Sphäre, in der die Spur des Schreis übertrieben gesteigert wurde, um<br />
einen unersättlichen Nationalismus zu rationalisieren, oder vollständig getilgt wurde,<br />
wobei beide Alternativen auf dasselbe hinauslaufen. Wir können dies als eine der<br />
philosophischen und repräsentationalen Implika tionen des Kriegs betrachten, weil die<br />
Politik – und die Macht – zum Teil so funktionieren, daß sie vorschreiben, was erscheinen<br />
darf und was gehört werden kann.<br />
Diese Schemata der Intelligibilität werden natürlich still schweigend und nachdrücklich<br />
von jenen Konzernen gedeckt, die die Kontrolle über die breitenwirksamen Medien<br />
monopolisie ren, welche ein starkes Interesse daran haben, die militärische Macht<br />
der USA aufrechtzuerhalten. Die Kriegsberichterstattung hat die Notwendigkeit einer<br />
umfassenden Entmonopolisierung der Medieninteressen in aller Deutlichkeit sichtbar<br />
werden lassen, während die diesbezügliche Gesetzgebung, wie abzusehen war, auf<br />
Capitol Hill höchst umstritten gewesen ist. Wir denken bei diesen Interessen an die<br />
Ausübung von Kontrolle als Eigentü merrecht, doch gleichzeitig entscheiden sie auch<br />
darüber, was öf fentlich als Realität erkennbar sein wird oder nicht. Sie zeigen zwar<br />
keine Gewalt, aber es liegt eine gewisse Gewalt in der me dialen Formatierung dessen,<br />
was gezeigt wird. Die letztgenannte Gewalt steckt in dem Mechanismus, durch den<br />
bestimmte Menschenleben und Tode entweder nicht darstellbar bleiben oder auf eine<br />
Art und Weise dargestellt werden, die (wieder einmal) ihre Vereinnahmung durch das<br />
Kriegsunternehmen bewirkt. Das er ste ist eine Auslöschung durch Blockierung, das<br />
zweite ist eine Auslöschung durch die Darstellung selbst.<br />
Welche Beziehung besteht zwischen der Gewalt, durch die diese nicht betrauernswerten<br />
Menschenleben verloren gingen, und dem Verbot ihrer öffentlichen Betrauerung?<br />
Ist das Verbot zu trauern die Fortsetzung der Gewalt selbst? Und verlangt das Ver bot<br />
zu trauern eine strenge Aufsicht über die Wiedergabe von Bildern und Worten? Wie
150 — 151<br />
Judith Butler<br />
taucht das Verbot zu trauern als eine Ein grenzung der Darstellbarkeit wieder auf, so<br />
daß unsere nationale Melancholie fest in den Rahmen eingefügt wird, der bestimmt,<br />
was gesagt werden kann, was gezeigt werden kann? Ist dies nicht der Ort, an dem wir –<br />
wenn wir das noch tun – ablesen können, wie diese Melancholie als die Begrenzung<br />
dessen, was gedacht werden kann, eingeschrieben wird? Die Derealisierung des Ver lusts –<br />
die Unempfänglichkeit für menschliches Leiden und Tod – wird zum Mechanismus, über<br />
den die Entmenschlichung erreicht wird. Diese Derealisierung findet weder im Bild noch<br />
außerhalb des Bildes statt, sondern durch die mediale Formatierung, mit der das Bild in<br />
Schach gehalten wird.<br />
In der ursprünglichen Kampagne des Kriegs gegen den Irak machte die USRegierung<br />
ihre militärischen Heldentaten als ein überwältigendes visuelles Phänomen publik.<br />
Daß die USRegie rung und das Militär dies als eine Strategie von „Schock und Ehr furcht“<br />
bezeichneten, deutet schon an, daß sie ein visuelles Spek takel veranstalteten, daß<br />
die Sinne betäubt und, wie das Erhabene selbst, die Denkfähigkeit ausschaltet. Diese<br />
Veranstaltung findet nicht bloß für die irakische Bevölkerung auf dem Boden statt,<br />
de ren Sinne mit diesem Spektakel fertiggemacht werden sollten, sondern auch für<br />
die Konsumenten des Kriegs, die auf CNN oder Fox angewiesen sind, das Sendenetz,<br />
das seine Kriegsberichter stattung im Fernsehen regelmäßig unterbrach, um sich<br />
mit der Behauptung einzuschalten, es sei die „zuverlässigste“ Informati onsquelle über<br />
den Krieg. Die „Schock und Ehrfurcht“Strategie zielt nicht nur darauf ab, dem Krieg<br />
eine ästhetische Dimension zu geben, sondern die visuelle Ästhetik als Bestandteil<br />
der eigent lichen Kriegsstrategie auszubeuten und zu instrumentalisieren. CNN hat<br />
viel zu dieser visuellen Ästhetik beigetragen. Und ob gleich sich die New York Times<br />
nachträglich gegen den Krieg wandte, schmückte auch sie ihre Titelseiten täglich<br />
mit romanti schen Bildern militärischer Geschütze vor der untergehenden Abendsonne<br />
im Irak oder mit „Bombendetonationen in der Luft“ über den Straßen und Häusern<br />
von Bagdad (die, keines wegs überraschend, dem Blick entzogen sind). Es war natürlich<br />
die spektakuläre Zerstörung des World Trade Center, die als erste einen Anspruch<br />
auf die Wirkung von „Schock und Ehrfurcht“ er hob, und die USA demonstrierten<br />
dann vor aller Welt, daß sie ge nauso zerstörerisch sein können und sein werden. Die<br />
Medien ließen sich von der Erhabenheit der Zerstörung völlig faszinieren, und die<br />
Stimmen Andersdenkender und der Opposition mußten sich erst einen Weg suchen,<br />
um diese empfindungslos machende Traumfabrik anzuhalten, in der die massive<br />
Zerstörung von Men schenleben und Behausungen, von Wasserversorgung, Strom und<br />
Wärme zu einem euphorischen Zeichen wiederbelebter militäri scher Stärke der USA<br />
verarbeitet wird.<br />
Tatsächlich wurden die drastischen Bilder toter und enthaupte ter USSoldaten im Irak<br />
und später die Fotos von Kindern, die amerikanische Bomben verstümmelt und getötet<br />
hatten, von den breitenwirksamen Medien abgelehnt und durch Filmmaterial er setzt,<br />
daß stets die Sicht von oben aus der Luft einnahm, eine Luftbildansicht, deren Perspektive<br />
von staatlicher Macht errich tet und aufrechterhalten wird. Dennoch schafften<br />
es die vom Sad damRegime hingerichteten Körper im Augenblick ihrer journa listischen<br />
Enthüllung, auf die Titelseite der New York Times zu gelangen, weil diese Körper<br />
betrauert werden mußten. Die Em pörung über ihren Tod motiviert die Kriegsanstrengung,<br />
wäh rend sich diese auf ihre Verwaltungsphase zu bewegt, die sich sehr wenig von dem<br />
unterscheidet, was man gemeinhin „eine Beset zung“ nennt.<br />
Tragischerweise sieht es so aus, als versuchten die USA, der ge gen sie gerichteten<br />
Gewalt zuvorzukommen, indem sie selbst als erste Gewalt anwenden, doch die<br />
Gewalt, die sie fürchten, ist die Gewalt, die sie erzeugen. Ich will damit nicht sagen,<br />
daß die USA in irgendeiner ursächlichen Weise für die Angriffe auf ihre Bürger verantwortlich<br />
sind. Und ungeachtet der furchtbaren Bedingun gen, die palästinensische<br />
Selbstmordattentäter zu ihren mörderi schen Taten animieren, entlaste ich diese
Sprengstoffattentäter keineswegs. Denn auch zwischen dem Leben unter furchtbaren<br />
Bedingungen, dem Leiden an schweren, schier unerträglichen Verletzungen und dem<br />
Entschluß zu mörderischen Handlungen muß eine gewisse Entfernung zurückgelegt<br />
werden. Präsident Bush hat diese Entfernung recht schnell zurückgelegt, indem er<br />
nach gerade einmal zehn Tagen pompösen Trauerns „ein Ende der Trauer“ forderte. Das<br />
Leiden kann zur Erfahrung der Demut, der Verletzbarkeit, der Manipulierbarkeit und<br />
Abhängigkeit führen, und diese Erfahrungen können zu Ressourcen werden, wenn wir<br />
sie nicht allzu schnell „auflösen“; sie können uns über die Beru fung zum paranoiden<br />
Opfer hinausführen, das die Rechtfertigungen für den Krieg endlos erneuert. Das ist<br />
ebensosehr eine Ange legenheit des ethischen Ringens mit den eigenen mörderischen<br />
Impulsen, mit Impulsen, die eine übermächtige Angst bezwingen wollen, wie eine<br />
Angelegenheit, die verlangt, das Leiden anderer zu begreifen und sich darüber klarzuwerden,<br />
welches Leiden man selbst zugefügt hat.<br />
Im Vietnamkrieg waren es die Bilder mit Napalm verbrannter und sterbender Kinder,<br />
die die amerikanische Öffentlichkeit schockierten, empörten, zu einem Gefühl der Reue<br />
und Trauer be wegten. Es waren gerade die Bilder, die wir nicht sehen sollten, und sie<br />
durchbrachen das Gesichtsfeld und das gesamte Gefühl für öffentliche Identität, das<br />
auf diesem Feld aufbaute. Die Bilder lie ferten zwar eine Realität, aber sie zeigten auch<br />
eine Realität, die das hegemoniale Feld der Darstellung selbst zerstörte. Trotz ihrer<br />
drastischen Wirksamkeit wiesen die Bilder auf etwas anderes hin, wiesen über sich<br />
selbst hinaus auf ein Leben und auf eine Gefähr detheit, die sie nicht zeigen konnten.<br />
Und aus dieser Erkenntnis der Gefährdetheit jener Menschenleben, die von uns zerstört<br />
wur den, entwickelten viele USBürger einen wichtigen und dauerhaf ten Konsens gegen<br />
den Krieg. Wenn wir aber die Worte, die uns diese Botschaft überbringen, weiterhin<br />
überhören, und wenn die Medien solche Bilder nicht zeigen werden, und wenn solche<br />
Men schenleben unbenannt und nicht betrauernswert bleiben, wenn sie nicht in ihrer<br />
Gefährdetheit und in ihrer Vernichtung erscheinen, werden wir nicht bewegt werden.<br />
Wir werden nicht zu einer ethi schen Empörung zurückkehren, die sich unverkennbar für<br />
einen Anderen, im Namen eines Anderen einsetzt. Unter den derzeiti gen Bedingungen<br />
der Darstellung können wir weder den gequäl ten Schrei hören noch durch das Gesicht<br />
gezwungen oder genötigt werden. Wir haben uns von dem Gesicht abgewandt, manchmal<br />
eben gerade durch das Bild des Gesichts, eines Gesichts, das dazu ausersehen<br />
ist, das Unmenschliche zu übermitteln, das bereits Tote, das nicht gefährdet ist und<br />
deshalb auch nicht getötet werden kann; dennoch ist es dieses Gesicht, das wir töten<br />
sollen, so als ob es uns zum Menschlichen zurückführen würde, anstatt unsere ei gene<br />
Unmenschlichkeit zu besiegeln, wenn die Welt von diesem Gesicht befreit wäre. Man<br />
müßte hören, wie das Gesicht anders als in einer Sprache spricht, um die Gefährdetheit<br />
des Lebens zu er kennen, um die es geht. Aber welche Medien werden uns diese<br />
Zerbrechlichkeit wissen und fühlen lassen und damit an die Grenzen der Darstellung<br />
gehen, so wie diese zur Zeit kultiviert und un terhalten wird? Falls die Geisteswissenschaften<br />
eine Zukunft als Kulturkritik haben, und die Kulturkritik zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt eine Aufgabe hat, dann ist es zweifellos die Aufgabe, uns zum Menschlichen<br />
zurückzuführen, wo wir nicht erwarten, es zu finden: in seiner Fragilität und an<br />
den Grenzen seiner Fähig keit, verständlich zu sein. Wir werden das Entstehen und<br />
Ver schwinden des Menschlichen an den Grenzen dessen, was wir wis sen können,<br />
hören können, sehen können, empfinden können, untersuchen müssen. Dies wird uns<br />
vielleicht auf affektivem Wege veranlassen, die intellektuellen Projekte der Kritik,<br />
des Infrage stellens, des Verstehens der Schwierigkeiten und Erfordernisse kultureller<br />
Übersetzung und Nichtübereinstimmung mit neuer Kraft zu beleben und ein Gefühl<br />
für die Öffentlichkeit zu schaf fen, in dem oppositionelle Stimmen nicht gefürchtet<br />
sind, heruntergemacht oder abgetan werden, sondern wegen der Anstiftung zu einer<br />
empfundenen Demokratie geschätzt werden, die sie gele gentlich zuwege bringen.
152 — 153<br />
Radiohead,<br />
Pyramid Song, 2001<br />
→ S. 3<br />
Ich sprang in den Fluss und was sah ich?<br />
Engel mit schwarzen Augen schwammen mit mir<br />
Ein Mond voller Sterne und Sternenwagen<br />
Und all die Gestalten, die ich sonst traf<br />
All meine Liebhaber waren mit mir dort<br />
All meine Vergangenheit und Zukünfte<br />
Und wir kamen alle in den Himmel<br />
in einem kleinen Ruderboot<br />
Es gab keine Angst und keine Zweifel<br />
Ich sprang in den Fluss und was sah ich?<br />
Engel mit schwarzen Augen schwammen mit mir<br />
Ein Mond voller Sterne und Sternenwagen<br />
Und all die Gestalten, die ich sonst traf<br />
All meine Liebhaber waren mit mir dort<br />
All meine Vergangenheit und Zukünfte<br />
Und wir kamen alle in den Himmel<br />
in einem kleinen Ruderboot<br />
Es gab keine Angst und keine Zweifel<br />
Es gab keine Angst und keine Zweifel<br />
Es gab keine Angst und keine Zweifel
Anhang
154 — 155<br />
Index
Lida Abdul<br />
White House, 2005<br />
16 mm-Film auf DVD, 4 min 58 s<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
und Giorgio Persano, Turin<br />
In Transit, 2008<br />
16 mm-Film auf DVD, 4 min 55 s<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
und Giorgio Persano, Turin<br />
Man in the Sea, 2010<br />
Zweikanal-Filminstallation,<br />
Film auf DVD, 3 min 44 s<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
und Giorgio Persano, Turin<br />
Marcel Dzama<br />
Pip, 2004<br />
Skulptur: Kleidung mit Filz und<br />
Kunstpelz, Drahtgeflecht, Papiermaché,<br />
Plastikschaum, Gummi,<br />
185 × 60 × 45 cm; begleitet von<br />
5 ungerahmten Zeichnungen<br />
und einem gerahmten Aquarell<br />
Privatsammlung, München<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Knowing precisely where to cut,<br />
2008<br />
Diorama: Holz, 2 Glasschiebeplatten,<br />
Gips, Karton, Acryl, Seil,<br />
Metall, präparierte Mäuse, künstliche<br />
Vögel, 91,4 × 76,8 × 45,7 cm<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Zürich redet mit Helvetia, 2008<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Lits et ratures, 2008<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Whose hell hoof resounds like<br />
heaven’s thunder, 2008<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Presence is unsustainable or<br />
The circle of traitors, 2008<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Surrounded by his dark machines<br />
and the rage of the wild or<br />
An epic of humanity, 2008<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Poor Bertrand de Born, 2009<br />
Collage auf Papier, 30,2 × 22,9 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Ulysses, 2009<br />
Graphit, Tinte, Wasserfarbe,<br />
Transparentpapier auf<br />
Klavier notenrolle, 3 Teile:<br />
28,5 × 234,5 cm, 28,5 × 222 cm,<br />
28,5 × 187,8 cm<br />
Sammlung Deutsche Bank<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf;<br />
David Zwirner, New York<br />
Maria Lassnig<br />
Stilleben<br />
mit rotem Selbstportrait, 1969<br />
Öl/Leinwand, 81 × 97 cm<br />
Neue Galerie Graz am<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Woman Laokoon, 1976<br />
Öl/Leinwand, 193 × 127 cm<br />
Neue Galerie Graz am<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Mark Manders<br />
Small Unfired Clay Figure,<br />
2006/07<br />
Eisen, bemaltes Epoxidharz,<br />
Holz, bemaltes Holz,<br />
Buch, 153,5 × 64 × 29 cm<br />
Sammlung Raf Simons, Belgien<br />
Courtesy Zeno X Gallery,<br />
Antwerpen<br />
Clay Figure with Iron Chair, 2009<br />
Bemalte Bronze, Eisen,<br />
81 × 177 × 59 cm<br />
Privatsammlung<br />
Courtesy Zeno X Gallery,<br />
Antwerpen<br />
Two Interconnected Houses,<br />
2010<br />
80 Schwarz-Weiß-Dias für<br />
einen Karussell-Projektor<br />
Courtesy Zeno X Gallery,<br />
Antwerpen<br />
Renzo Martens<br />
Episode 1, 2000/03<br />
Videoinstallation, Hi-8 auf HD,<br />
Sound, Farbe, 45 min<br />
Courtesy Galerie Fons Welters<br />
und Wilkinson Gallery<br />
Episode 2, 2010<br />
Episode 3, 2009<br />
Videoinstallation, PAL 16:9, HD,<br />
Sound, Farbe, 90 min; 2 Metallkoffer<br />
mit dem Master Tape,<br />
einige Neonleuchtzeichen, ein<br />
Bild entstanden in Zusammenarbeit<br />
mit Aphoka, Association<br />
des Photographes de<br />
Kanyabayonga, 84 × 47 × 35 cm<br />
und 65 × 30 × 24 cm<br />
Courtesy Galerie Fons Welters<br />
und Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
Renzo Martens, Child, 2007<br />
Fotografie, 62 × 40 cm<br />
Courtesy Galerie Fons Welters<br />
und Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in Zusammenarbeit mit Renzo<br />
Martens, Three Children, 2007<br />
Fotografie, 40 × 62 cm<br />
Courtesy Galerie Fons Welters<br />
und Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in Zusammenarbeit mit Renzo<br />
Martens, Mother and Child, 2007<br />
Fotografie, 62 × 40 cm<br />
Courtesy Galerie Fons Welters<br />
und Wilkinson Gallery<br />
Kris Martin<br />
Mandi VIII, 2006<br />
Gips, 221 × 150 × 100 cm<br />
Sammlung David Roberts, London<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf<br />
Bells, 2008<br />
Bronzeglocken,<br />
30 × 50 × 60 ○/ 30 cm<br />
Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf<br />
Adrian Paci<br />
Turn on, 2004<br />
Film auf DVD, 3 min 33 s<br />
Courtesy des Künstlers;<br />
Francesca Kaufmann, Mailand;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zürich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Per Speculum, 2006<br />
35 mm-Film, 6 min 53 s<br />
Courtesy des Künstlers;<br />
Francesca Kaufmann, Mailand;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zürich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Electric Blue, 2010<br />
HD-Video, ca. 15 min<br />
Courtesy des Künstlers;<br />
Francesca Kaufmann, Mailand;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zürich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Susan Philipsz<br />
The River Cycle, 2009<br />
Audioinstallation, 2 min 15 s<br />
Courtesy der Künstlerin
156 — 157<br />
Biografien<br />
Lida Abdul<br />
Geboren 1973 in Kabul (AF),<br />
lebt und arbeitet in Kabul (AF),<br />
Kalifornien (US) und Europa<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Fundação Calouste Gulbenkian,<br />
Lissabon<br />
Krannert Art Museum,<br />
University of Illinois, Champaign<br />
Ruins: Stories of Awakening,<br />
Anna Schwartz Gallery,<br />
Melbourne<br />
2008<br />
In Transit, Giorgio Persano, Turin;<br />
Le Print Temps Septembre,<br />
Toulouse Art Festival, Toulouse;<br />
OK Centrum für<br />
Gegenwartskunst, Linz<br />
Western Front Exhibitions &<br />
Centre A, Vancouver<br />
IDEA Space, Colorado College,<br />
Colorado Springs<br />
Indianapolis Museum of Art,<br />
Indianapolis<br />
Alessandra Bonomo, Rom<br />
GSK Royal Academy of Arts,<br />
London<br />
2007<br />
Modern Mondays, MoMA,<br />
New York<br />
Musée Chagall, Nizza<br />
Musée national Picasso, Vallauris<br />
ICA Prefix Institute of<br />
Contemporary Art, Toronto<br />
National Museum of Kabul, Kabul<br />
White House, Netwerk Centrum<br />
voor hedendaagse kunst, Aalst<br />
What We Saw Upon Awakening,<br />
Location One, New York<br />
2006<br />
Petition for Another World,<br />
Museum Voor Moderne Kunst,<br />
Arnhem<br />
Giorgio Persano, Turin<br />
After War Games, Musées<br />
Palais du Tau de Reims, Reims<br />
Pino Pascali Museo d’Arte<br />
Contemporanea,<br />
Polignano a Mare<br />
Now, Here, Over There.<br />
Lida Abdul/Tania Bruguera,<br />
FRAC Lorraine, Metz<br />
What We Saw Upon Awaking,<br />
CAC Brétigny, Brétigny<br />
2005<br />
Afghanischer Pavillon,<br />
La Biennale di Venezia, Venedig<br />
Video des Monats #6:<br />
Lida Abdul, Kunsthalle Wien,<br />
Ursula Blickle Videolounge, Wien<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
The individual and the war, AZKM<br />
Ausstellungshalle zeitgenössische<br />
Kunst Münster, Münster<br />
HomeLessHome, Museum on the<br />
Seam, Jerusalem<br />
CUE: Artist’ Videos, Vancouver<br />
Art Gallery, Vancouver<br />
Monument to Transformation,<br />
Galeria Miroslav Kraljevic, Zagreb<br />
Spatial City: An Architecture of<br />
Idealism, Institute of Visual Arts,<br />
Milwaukee; Hyde Park Art Center,<br />
Chicago; Museum of<br />
Contemporary Art, Detroit<br />
2009<br />
Anabasis: On Rituals of<br />
Home coming, Ludwik Grohman<br />
Villa, Lodz<br />
Futur, FRAC Aquitaine, Bordeaux<br />
Bilderschlachten, EMAF<br />
European Media Art Festival,<br />
Osnabrück<br />
Monument to Transformation,<br />
City Gallery Prague, Prag<br />
Stranded Positions, Ausstellungsraum<br />
Klingental, Basel<br />
History of Violence, Haifa Museum<br />
of Art, Haifa<br />
The End, The Andy Warhol<br />
Museum, Pittsburgh<br />
Dream and Reality. Contemporary<br />
Art from the Near<br />
East, Zentrum Paul Klee, Bern<br />
Moving Perspectives: Lida Abdul<br />
and Dinh Q Le, Smithsonian<br />
Freer Gallery of Art and Arthur<br />
M. Sackler Gallery, Washington<br />
Riwaq Biennial, Ramallah<br />
2008<br />
Eurasia. Geographic cross-overs<br />
in art, MART Museo di Arte<br />
Moderna e Contemporanea<br />
di Trento e Rovereto, Trento/<br />
Rovereto<br />
4. Triennale zeitgenössischer<br />
Kunst Oberschwaben, Zeppelin<br />
Museum, Friedrichshafen<br />
Biennale Cuvée, OK Centrum<br />
für Gegenwartskunst, Linz<br />
Yellow Cruise, Louis Vuitton<br />
Espace, Paris<br />
Artes Mundi 3rd Award<br />
Exhibition, National Museum<br />
of Cardiff, Cardiff<br />
Lida Abdul: In Transit,<br />
Videoformes Festival,<br />
Clermont-Ferrand<br />
Intimacies of Distant War,<br />
Samuel Dorsky Museum of Art,<br />
New York<br />
Open Sky, Kunstverein<br />
Medienturm, Graz<br />
2007<br />
Illuminations, Tate Modern,<br />
London<br />
2. Moscow Biennial of<br />
Contemporary Art, Moskau<br />
8. Sharjah Biennial, Sharjah<br />
Re-thinking Dissent, 4. Göteborg<br />
International Biennial for<br />
Contemporary Art, Göteborg<br />
3. Auckland Triennial, Auckland<br />
Thermocline of Art: New Asian<br />
Waves, ZKM, Karlsruhe<br />
Memorial to Iraq War, ICA,<br />
London<br />
Timeout: Art and Sustainability,<br />
Kunstmuseum Liechtenstein,<br />
Vaduz<br />
Global Feminisms, Brooklyn<br />
Museum, New York; Wanderausstellung<br />
Asian Attitude/Transient Forces,<br />
The National Museum, Poznan;<br />
Zendai Museum of Modern Art,<br />
Shanghai; Wanderausstellung<br />
2006<br />
27. Sao Paulo Biennial, Sao Paulo<br />
First Chapter_Trace Root,<br />
Gwangju Biennale, Gwangju<br />
The Doubtful Strait. A Visual Art<br />
Event, Museo de Arte y Diseño<br />
Contemporáneo, Costa Rica<br />
Mens, S.M.A.K, Gent; K.U.,<br />
Leuven<br />
Painting as a Way of Living,<br />
Istanbul Museum of Modern Art,<br />
Istanbul<br />
The UnQuiet World,<br />
The Australian Centre for<br />
Contemporary Art, Victoria<br />
Undercurrents06, Göteborg<br />
Konstmuseum, Göteborg<br />
Courants Alternatifs, Le Parvis<br />
Centre d’art contemporain,<br />
Ibos-Tarbes; CAPC Musée d’art<br />
contemporain, Bordeaux<br />
Painting Ruins, Foundation for<br />
Culture and Civil Society, Kabul<br />
Fast Futures: Asian Video Art,<br />
Mumbai<br />
ACAW Asian Contemporary Art<br />
Week, Brooklyn Art Museum,<br />
New York<br />
Nafas. Contemporary Art<br />
from the Islamic World, IFA,<br />
Berlin/Stuttgart<br />
Liberation, Tradition and<br />
Meaning/Women on the Edge<br />
of Culture, Milwaukee Institute<br />
of Art & Design, Milwaukee<br />
New territories, De Hallen,<br />
Brügge<br />
2005<br />
Between the Furniture and<br />
the Building (Between a Rock<br />
and a Hard Place), CAC Brétigny;<br />
FR66, Paris<br />
Wall to Destroyed, FRAC Lorraine,<br />
Metz<br />
Irreducible. Contemporary Short<br />
Form Video, Miami Central, Miami<br />
In the Shadow of Heroes,<br />
Central Asian Biennale,<br />
Kirgisische Republik<br />
Video Lounge, South London<br />
Gallery, London<br />
Vinyl, Redux Projects Gallery,<br />
London<br />
Taste of others, Apex Art,<br />
New York<br />
2004<br />
Contemporaneity, Academy of<br />
Fine Arts, Tashkent; National<br />
Museum of Arts, Bishkek;<br />
Foundation for Culture and Civil<br />
Society, Kabul<br />
On healing, D.U.M.B.O., Brooklyn<br />
Poetics of Proximity, Chapman<br />
University, Orange<br />
2003<br />
Shibuya UNESCO Association,<br />
Tokyo<br />
Colors of God, Layola Marymount<br />
University, Los Angeles<br />
Open Ticket, Guggenheim Gallery<br />
Chapman College, Orange<br />
Wide Awake, Highways,<br />
Los Angeles<br />
ENTERINTERCESSOR,<br />
Raid Projects, Los Angeles<br />
2002<br />
All Stars of LA Performance<br />
Art, City of Los Angeles Cultural<br />
Affairs Department, Hollywood<br />
Not in our Name, The Palace Art<br />
Speak, Hollywood<br />
Democracy When?, LACE<br />
Los Angeles Contemporary Art<br />
Exhibitions, Hollywood<br />
After the Ruins of Kabul,<br />
Highways, Santa Monica;<br />
Bumbershoot Festival, Seattle;<br />
The Palace Art Speak, Hollywood<br />
Project Enduring Look, Exhibition<br />
Studies Space, School of the<br />
Art Institute of Chicago, Chicago<br />
GENERATION WHY: ARTISTS<br />
OF CONSCIENCE SPEAK,<br />
Occidental College, Los Angeles<br />
2001<br />
Overflowing, Track-16,<br />
Santa Monica<br />
The Gathering, Highways,<br />
Santa Monica<br />
Slam, Highways, Santa Monica<br />
In Public, Art Center College<br />
of Art and Design, Pasadena<br />
CAPITAL ART, Track-16,<br />
Santa Monica<br />
All Star of LA, Knitting Factory,<br />
Los Angeles
Marcel Dzama<br />
Geboren 1974 in Winnipeg (CA),<br />
lebt und arbeitet in Brooklyn,<br />
New York (US)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Musée d’Art Contemporain de<br />
Montréal, Montreal<br />
Marcel Dzama: Delila’s Dance,<br />
Galeria Helga de Alvear, Madrid<br />
2009<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
2008<br />
Edition 46, Marcel Dzama, in<br />
Kooperation mit Süddeutsche<br />
Zeitung Magazin, Pinakothek<br />
der Moderne, München<br />
Even the Ghost of the Past,<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
2007<br />
Oficina para Proyectos de Arte<br />
(OPA), Guadalajara<br />
Celluloid Ceremony, Galleri<br />
Magnus Karlsson, Stockholm<br />
Moving Picture, Timothy Taylor,<br />
London<br />
2006<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Centre for Contemporary Arts,<br />
Glasgow<br />
IKON Gallery, Brimingham<br />
The Richard L. Nelson Gallery &<br />
The Fine Arts Collection,<br />
UC Davis, Davis<br />
2005<br />
David Zwirner, New York<br />
Centre d’arte Santa Monica,<br />
Barcelona<br />
2004<br />
Timothy Taylor Gallery, London<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Christophe Daviet-Thery,<br />
Livres et Editions d’Artistes, Paris<br />
Galleri Magnus Karlsson,<br />
Stockholm<br />
Olga Korper, Toronto<br />
2003<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Rizzero Arte, Pescara<br />
Art Gallery of Windsor, Windsor/<br />
Ontario<br />
Perugi Artecontemporanea,<br />
Padua<br />
2002<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Timothy Taylor Gallery, London<br />
2001<br />
Mendel Art Gallery, Saskatoon,<br />
Saskatchewan<br />
Galleri Magnus Karlsson,<br />
Stockholm<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Monica de Cardenas, Mailand<br />
2000<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
More Famous Drawings,<br />
Plug In Gallery, Winnipeg<br />
Zeichnungen + Video,<br />
Diehl Vorderwuelbecke, Berlin<br />
1999<br />
Greene Gallery, Genf<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
1998<br />
Espace Purplex, Rio de Janeiro<br />
Casa Triangulo, Sao Paulo<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
Art Pace Foundation,<br />
San Antonio<br />
Art Forum Berlin, Berlin<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2011<br />
Fairy Tales, Monsters and the<br />
Genetic Imagination, First Center<br />
for the Visual Arts, Nashville<br />
2010<br />
CUE: Artists’ Videos, Vancouver<br />
Art Gallery, Vancouver<br />
Monster, West Vancouver<br />
Museum, West Vancouver<br />
2009<br />
Wonderland, KAdE, Amersfoort<br />
Compass in Hand: Selections<br />
from The Judith Rothschild<br />
Foundation Contemporary<br />
Drawings Collection, The<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
Mi Vida. From Heaven to Hell:<br />
Life Experiences in Art from the<br />
MUSAC Collection, Mucsarnok<br />
Kunsthalle, Budapest<br />
Private Universes, Dallas<br />
Museum of Art, Dallas<br />
Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv<br />
2008<br />
The Other Mainstream II:<br />
Selections from the Collection<br />
of Mikki and Stanley Weithorn,<br />
Arizona State University Art<br />
Museum, Tempe<br />
The Gallery, David Zwirner,<br />
New York<br />
2007<br />
Running Around the Pool,<br />
Museum of Fine Arts, The College<br />
of Visual Arts, Theatre & Dance,<br />
Florida State University,<br />
Tallahassee<br />
Cult Fiction, The New Art Gallery,<br />
Walsall; Nottingham Castle,<br />
Nottingham; Leeds City Art<br />
Gallery, Leeds; Aberystwyth<br />
Art Gallery, Aberystwyth;<br />
Tullie House, Carlisle<br />
Hinter den Sieben Bergen,<br />
Patricia Low Contemporary,<br />
Gstaad<br />
Royal Art Lodge – Where is Here?,<br />
Winnipeg Art Lodge, Winnipeg<br />
2006<br />
Into Me/Out of Me, P.S.1<br />
Contemporary Art Center, New<br />
York; Kunst-Werke Berlin e.V. –<br />
Institute for Contemporary Art,<br />
Berlin; MACRO Museo d’Arte<br />
Contemporanea Roma, Rom<br />
Since 2000: Printmaking Now,<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
Parallel Visions II: “Outsider”<br />
and “Insider” Art Today, Gallerie<br />
St. Etienne, New York<br />
Faces of a Collection, Kunsthalle<br />
Mannheim, Mannheim<br />
New Prints 2006, International<br />
Print Center New York, New York<br />
The Compulsive Line: Etching<br />
1900 to Now, Museum of Modern<br />
Art, New York<br />
Down by Law, 2006 Whitney<br />
Biennial, Whitney Museum of<br />
American Art, New York<br />
2005<br />
Words,<br />
Andrea Rosen Gallery, New York<br />
Eccentric Modern,<br />
The Foundation To-Life, New York<br />
The Gallery,<br />
Magnus Karlsson, Stockholm<br />
Max Ernst and the Tradition<br />
of the Modern, Städtische Kunsthalle<br />
Mannheim, Mannheim<br />
New Work/New Acquisitions, The<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
La Melange des Genres, Musée<br />
des Beaux-Arts de Rouen, Rouen<br />
Pensieri dei serpenti by<br />
The Royal Art Lodge, Perugi<br />
artecontemporanea, Padua<br />
Surface, Lucas Schoormanns<br />
Gallery, New York<br />
Funny Cuts, Staatsgalerie<br />
Stuttgart, Stuttgart<br />
Emergencias, Museo de Arte<br />
Contemporaneo, León<br />
Strips & Characters – Kunst<br />
unter dem Einfluss von Comics,<br />
Kunstverein, Wolfsburg<br />
Central Station – The Harald<br />
Falckenberg Collection,<br />
La Maison Rouge, Paris<br />
Security Check. Painting after<br />
Romanticism, Arndt & Partner,<br />
Zürich<br />
2004<br />
Pride in Workmanship, The Royal<br />
Art Lounge, Houldsworth Gallery,<br />
London<br />
Galerie Anne de Villepoix, Paris<br />
2003<br />
Royal Art Lodge: Ask the Dust<br />
The Drawing Center, New York;<br />
The Power Plant, Contemporary<br />
Art Gallery, Toronto; De Vleeshal,<br />
Middelburg<br />
For the Record: Drawing<br />
Contemporary Life, Vancouver<br />
Art Gallery, Vancouver<br />
The Great Drawing Show 1550-<br />
2003, Michael Kohn Gallery,<br />
Los Angeles<br />
Odd Fellows, Pennsylvania<br />
Academy of Fine Arts,<br />
Philadelphia<br />
Sweet Tooth, Mixture<br />
Contemporary Art, Houston<br />
Zwischenbilanz, Kunstforum<br />
Baloise, Basel<br />
MosaiCanada: Sign and Sound,<br />
The Seoul Museum of Art, Seoul<br />
2002<br />
Fantasyland, Dámelio Terras<br />
New York, New York<br />
Fantasy Underfoot, Corcoran<br />
Biennal, Washigton D.C.<br />
2001<br />
I love NY, David Zwirner,<br />
New York<br />
The Royal Art Lodge, Perugi<br />
Artcontemporanea, Padua<br />
The Royal Art Lodge: Amounts<br />
of Blood, Atycore, Toronto<br />
IN FUMO, Galleria of Modern<br />
and Contemporary Art, Bergamo<br />
Amused: Humour in Contemporary<br />
Art, Carrie Secrist Gallery,<br />
Chicago<br />
2000<br />
Artcore Gallery, Toronto<br />
Dr. Wings, Galerie Air de Paris,<br />
Paris<br />
Babylon, Galerie Philomene<br />
Magers, München<br />
Selections from the Manilow<br />
Collection, MOCA, Chicago<br />
Double Whammy,<br />
Atelier Gallery, Vancouver<br />
Greetings from Winnipeg,<br />
MCAD, Minneapolis<br />
Drawing Show,<br />
Chicago Institute of Art, Chicago<br />
Drawings 2000,<br />
Barbara Gladstone, New York<br />
1999<br />
Draw, Ten in One Gallery,<br />
Chicago Castelli di Carte, Galeria<br />
Claudia Gian Ferrari, Mailand<br />
Sit(E)ings: Trajectories for<br />
a Future, Winnipeg Art Gallery,<br />
Winnipeg<br />
Greetings from Winnipeg,<br />
Minneapolis College of<br />
Art & Design, Minneapolis<br />
1998<br />
Selections Spring 98,<br />
The Drawing Center, New York<br />
Laughing, Plug In Gallery,<br />
Winnipeg
158 — 159<br />
Biografien<br />
Maria Lassnig<br />
Maria Lassnig<br />
Geboren 1919 in Kappel am<br />
Krappfeld, Kärnten (AT),<br />
lebt und arbeitet in Wien (AT)<br />
und Kärnten (AT)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Städtische Galerie im Lenbachhaus<br />
und Kunstbau, München<br />
2009<br />
Maria Lassnig. Im Möglichkeitsspiegel.<br />
Aquarelle und<br />
Zeichnungen von 1947 bis heute,<br />
Museum Ludwig, Köln<br />
Das neunte Jahrzehnt, Museum<br />
moderner Kunst Stiftung Ludwig,<br />
Wien<br />
2008<br />
Contemporary Arts Center,<br />
Cincinnati<br />
Serpentine Gallery, London<br />
2007<br />
Hauser & Wirth, Zürich<br />
2006<br />
Maria Lassnig: Körper und Seele<br />
malen, Museum für Gegenwartskunst<br />
Siegen, Siegen<br />
Maria Lassnig: Körperbilder,<br />
Museum Moderner Kunst Kärnten,<br />
Klagenfurt<br />
2005<br />
Maria Lassnig/Eiserner Vorhang,<br />
Museum in Progress, Wien<br />
Maria Lassnig – body. fiction.<br />
nature, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Wien<br />
Maria Lassnig. Animationsfilme –<br />
Retrospektive, culture2culture,<br />
Wien<br />
2004<br />
Maria Lassnig – Paintings,<br />
Hauser & Wirth, London<br />
2003<br />
Verschiedene Arten zu sein,<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich<br />
2002<br />
Friedrich Petzel Gallery, New York<br />
Maria Lassnig. Körperporträts,<br />
Museum für Gegenwartskunst,<br />
Siegen<br />
Maria Lassnig. Eine andere<br />
Dimension. Skulpturen. Galerie<br />
Ulysses, Wien<br />
2001<br />
Maria Lassnig. Bilder 1989 – 2001,<br />
kestnergesellschaft, Hannover<br />
1999<br />
FRAC des Pays de la Loire, Nantes<br />
1997<br />
Kunsthalle Bern, Bern<br />
Kunsthalle Mücsarnoc, Budapest<br />
1995/96<br />
Retrospektive der Zeichnungen<br />
und Aquarelle, Kunstmuseum<br />
Bern, Bern<br />
Musée national d’art moderne,<br />
Paris<br />
Kulturhaus der Stadt Graz, Graz<br />
1994<br />
Das Innere nach Außen,<br />
Stedelijk Museum, Amsterdam<br />
1992<br />
Galerie Klewan, München<br />
Galerie Ulysses, Wien<br />
1991<br />
Galerie Busche, Köln<br />
Raymond Bollag, Zürich<br />
1988-90<br />
Neue Galerie Graz, Graz<br />
Mit dem Kopf durch die Wand,<br />
Kunstmuseum Luzern, Luzern<br />
Kunstverein Hamburg, Hamburg<br />
Wiener Secession, Wien<br />
Galerie Barbara Gross, München<br />
Graphische Sammlung Albertina,<br />
Wien<br />
1987<br />
Galerie Thaddaeus Ropac,<br />
Salzburg<br />
Edition Hundertmark, Köln<br />
Galerie Onnasch, Berlin<br />
1985<br />
Museum moderner Kunst<br />
Stiftung Ludwig Wien, Wien<br />
Kunstmuseum Düsseldorf,<br />
Düsseldorf<br />
Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg<br />
Kärntner Landesgalerie,<br />
Klagenfurt<br />
1982-84<br />
Retrospektive der Zeichnungen<br />
und Aquarelle, Kunstverein<br />
Mannheim, Mannheim<br />
(Wanderausstellung)<br />
1981<br />
Galerie Heike Curtze, Wien<br />
1978<br />
Haus am Lütowplatz, Berlin<br />
1977<br />
Retrospektive des grafischen<br />
Werks, Graphische Sammlung<br />
Albertina, Wien<br />
Galerie Kalb, Wien<br />
1975<br />
Gallery Cortella, New York<br />
1974<br />
Green Mountains Gallery,<br />
New York<br />
1962/63<br />
Kärntner Landesmuseum,<br />
Klagenfurt<br />
1960<br />
Galerie nächst St. Stephan, Wien<br />
1956<br />
Galerie Würthle, Wien<br />
1954<br />
Zimmergalerie, Frankfurt<br />
1952<br />
Art-Club-Galerie, Wien<br />
1950<br />
Galerie Cosmos, Wien<br />
1948<br />
Galerie Kleinmayr, Klagenfurt<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Nur Papier, und doch die ganze<br />
Welt ... 200 Jahre Graphische<br />
Sammlung, Staatsgalerie<br />
Stuttgart, Stuttgart<br />
The Dissolve. SITE Santa Fe<br />
Biennial 2010, Santa Fe<br />
Vermeer. Die Malkunst,<br />
Kunst historisches Museum, Wien<br />
2009<br />
The Female Gaze: Women Look at<br />
Women, Cheim & Read, New York<br />
Die Gegenwart der Linie.<br />
Eine Bestandsauswahl neuerer<br />
Erwerbungen des 20. und<br />
21. Jahrhunderts, Pinakothek<br />
der Moderne, München<br />
Best of Austria – Eine Kunstsammlung,<br />
Lentos Kunstmuseum,<br />
Linz<br />
2008<br />
Life on Mars: 55th Carnegie<br />
International, Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh<br />
Drawing a Tension, Fundação<br />
Calouste Gulbenkian, Lissabon<br />
Baselitz bis Lassnig, Sammlung<br />
Essl, Klosterneuburg/Wien<br />
Mind Expanders. Performative<br />
Körper – Utopische Architekturen<br />
um ’68, MUMOK – Museum<br />
Moderner Kunst Stiftung Ludwig<br />
Wien, Wien<br />
2007<br />
Wien – Paris, Belvedere, Wien<br />
Critical Mass – Kritische<br />
Masse, Kunsthalle Bern, Bern<br />
WACK! Art and the Feminist<br />
Revolution, National Museum<br />
of Women in the Arts,<br />
Washington DC; MOCA – Museum<br />
of Contemporary Art, Los Angeles;<br />
P.S.1, Long Island City<br />
Kunst nach 1970. Aus der<br />
Sammlung der Albertina,<br />
Albertina, Wien<br />
2006<br />
Eye on Europe, MoMA, New York<br />
Zwei oder Drei oder Etwas.<br />
Maria Lassnig, Liz Larner,<br />
Kunsthaus Graz, Graz<br />
Österreich: 1900 – 2000,<br />
Konfrontationen und<br />
Kontinui täten, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Wien<br />
Into me/Out of me, P.S.1,<br />
Long Island City; MACRO – Museo<br />
d’Arte Contemporanea, Rom<br />
2005<br />
Ars Pingendi, Neue Galerie Graz,<br />
Graz<br />
Leporello, Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Zeitgenössische österreichische<br />
Kunst und Malerei der<br />
Nachkriegszeit aus der<br />
Sammlung Essl, Museo de Arte<br />
Moderno de México, Mexico City<br />
(Wanderausstellung)<br />
Das neue Österreich, Österreichische<br />
Galerie Belvedere, Wien<br />
2003<br />
Grotesk! 130 Jahre Kunst der<br />
Frechheit, Haus der Kunst,<br />
München<br />
La Biennale di Venezia, Dreams<br />
and Conflicts – The Viewer’s<br />
Dictatorship, Venedig<br />
Warum! Bilder Diesseits und<br />
Jenseits des Menschen,<br />
Gropius Bau, Berlin<br />
EXPRESSIV!, Fondation Beyeler,<br />
Basel<br />
2001<br />
Reisen ins Ich, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Wien<br />
Abbild, steirischer herbst,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>,<br />
Graz<br />
Österreichische Kunst, Shanghai<br />
Art Museum, Shanghai<br />
2000<br />
Die verletzte Diva,<br />
Kunstverein München, München;<br />
Kunsthalle Baden, Baden-Baden<br />
Das Bild des Körpers,<br />
Rupertinum, Salzburg<br />
1999<br />
Jahrhundert der Frauen,<br />
Kunstforum, Wien<br />
1997<br />
documenta X, Kassel<br />
1996<br />
Malerei in Österreich 1945 – 1995.<br />
Die Sammlung Essl,<br />
Künstlerhaus Wien, Wien<br />
Kunst aus Österreich 1896 – 1996,<br />
Kunsthalle Bonn, Bonn<br />
1995<br />
La Biennale di Venezia,<br />
Identità e Alternità. Formen des<br />
Körpers 1895 – 1995, Venedig<br />
Feminine-Masculine,<br />
Musée national d’art moderne,<br />
Centre George Pompidou, Paris<br />
1986<br />
Zeichen und Gesten. Informelle<br />
Tendenzen in Österreich,<br />
Wiener Secession, Wien<br />
1982<br />
documenta 7, Kassel<br />
1980<br />
La Biennale di Venezia,<br />
Öster reichischer Pavillon,<br />
Venedig
Mark Manders<br />
Geboren 1968 in Volkel (NL),<br />
lebt und arbeitet in Arnhem (NL)<br />
und Ronse (BE)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2011<br />
Walker Art Center, Minneapolis<br />
Douglas Hyde Gallery, Dublin<br />
Aspen Art Museum, Aspen<br />
Castello di Rivoli, Turin<br />
2010<br />
Hammer Museum, Los Angeles<br />
Carillo Gil Museum of Art,<br />
Mexico City<br />
Jarla Partilager, Stockholm<br />
Zeno X Gallery, Antwerpen<br />
2009<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
The Absence of Mark Manders,<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich;<br />
S.M.A.K., Gent; Kunsthall Bergen,<br />
Bergen; Kunstverein Hannover,<br />
Hannover<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
2006<br />
Mark Manders: Short Sad<br />
Thoughts, BALTIC Centre for<br />
Contemporary Art, Gateshead<br />
2005<br />
Parallel Occurance, IMMA – Irish<br />
Museum of Modern Art, Dublin<br />
Mark Manders: Fragments<br />
from Self Portrait as a Building,<br />
Solo Projects, Los Angeles<br />
MATRIX 214: The Absence<br />
of Mark Manders, Berkeley Art<br />
Museum, Berkeley<br />
2004<br />
Silent Studio, Zeno X Storage,<br />
Antwerpen – Borgerhout<br />
2003<br />
The Art Institute Chicago,<br />
Chicago<br />
The Renaissance Society, Chicago<br />
Pinakothek der Moderne,<br />
München<br />
Kaleidoscope Night,<br />
Kröller-Müller Museum, Otterlo<br />
Yellow Bathtub, Cobra Museum<br />
voor Moderne Kunst, Amstelveen<br />
Fragments from Self Portrait<br />
as a Building, Moore College<br />
of Art and Design, Philadelphia;<br />
Art Gallery of York University,<br />
Toronto<br />
Night Drawings from Self<br />
Portrait as a Building, Kabinet<br />
OverHolland/Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Reduced November Room,<br />
Greene Naftali Gallery, New York<br />
Room with Several Night Drawings<br />
and One Reduced Night Scene,<br />
The Drawing Center, New York<br />
1999<br />
Galerie Friedrich, Bern<br />
1998<br />
Self Portrait in a surrounding<br />
area, Biennale Sao Paolo,<br />
Sao Paolo<br />
14 Fragments from Self Portrait<br />
as a Building, Staatliche<br />
Kunsthalle, Baden-Baden<br />
1997<br />
The Douglas Hyde Gallery, Dublin<br />
Zeno X Gallery, Antwerpen<br />
De Appel, Amsterdam<br />
1995<br />
Galerie Erika + Otto Friedrich,<br />
Bern<br />
1994<br />
Mark Manders shows some<br />
fragments of his Self Portrait,<br />
MUHKA, Antwerpen<br />
Van Abbemuseum, Eindhoven<br />
Zeno X Gallery, Antwerpen<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2011<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections, DESTE<br />
Foundation, Athen; Magasin 3<br />
Stockholm Konsthall, Stockholm<br />
2010<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections,<br />
La maison rouge, Paris; Ellipse<br />
Foundation, Cascais<br />
Animism, Kunsthalle Bern, Bern<br />
Skin Fruit: Selection from the<br />
Dakis Joannou Collection,<br />
New Museum, New York<br />
Contemplating the Void:<br />
Interventions in the Guggenheim<br />
Museum, Guggenheim Museum,<br />
New York<br />
What happens next is a secret,<br />
The Irish Museum of Modern Art,<br />
Dublin<br />
2009<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections,<br />
Fondazione Sandretto Re<br />
Rebaudengo, Turin<br />
Works by Charles Long, Mark<br />
Manders, Thomas Schütte and<br />
Ian Kiaer with paintings by Luc<br />
Tuymans, Jarla Partilager, Berlin<br />
A Story of the Image: Old and<br />
New Masters from Antwerp,<br />
National Museum of Singapore,<br />
Singapur; Shanghai Art Museum,<br />
Shanghai<br />
Walking in my Mind, The Hayward,<br />
Soutbank Centre, London<br />
Le sang d’un poète, Biennale<br />
Estuaire Nantes – Saint Nazaire,<br />
Nantes<br />
The Eventual, Futura Center for<br />
Contemporary Art, Prag<br />
The Quick and the Dead, Walker<br />
Art Center, Minneapolis<br />
Ophelia. Sehnsucht, melancholie<br />
en doodsverlangen, Museum<br />
voor Moderne Kunst, Arnhem<br />
2008<br />
The Order of Things, MuHKA,<br />
Antwerpen<br />
Transformation AGO, The Art<br />
Gallery of Ontario, Ontario<br />
Foyer: language and space<br />
at the border, CAC, Contemporary<br />
Art Center, Vilnius<br />
Life on Mars, the 55th Carnegie<br />
International, Carnegie<br />
Museum of Art, Pittsburgh<br />
2007<br />
Destroy Athens, 1. Athens<br />
Biennial, Athen<br />
(I’m Always Touched) By Your<br />
Presence, Dear – New Acquisitions,<br />
IMMA The Irish Museum<br />
of Modern Art, Dublin<br />
Comfort/Discomfort, Stedelijk<br />
Museum, ’s-Hertogenbosch<br />
Works on paper, Zeno X Gallery<br />
& Zeno X Storage, Antwerpen<br />
2006<br />
The Secret Theory of Drawing:<br />
Dislocation & Indirection<br />
in Contemporary Drawing,<br />
The Drawing Room, London<br />
Ergens/Somewhere, MuHKA,<br />
Antwerpen<br />
Roma Publications, Culturgest,<br />
Lissabon<br />
Transforming Chronologies:<br />
An Atlas of Drawings, Part Two,<br />
MoMA, New York<br />
Of Mice and Men, Berlin Biennale,<br />
Berlin<br />
2005<br />
Recent Acquisitions, LA MOCA,<br />
Los Angeles<br />
2004<br />
Manifesta 5, European<br />
Biennale of Contemporary Art,<br />
San Sebastian<br />
Drafting Deceit, Apexart,<br />
New York<br />
Sculptural Sphere, Goetz<br />
Collection, München<br />
2003<br />
Gelijk het leven is, S.M.A.K., Gent<br />
Taktiken des EGO, Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum,<br />
Duisburg<br />
Post-Nature. Nove Artistas<br />
Holandeses, Instituto Tomie<br />
Ohtake, Sao Paulo<br />
2002<br />
On Paper 1, Galerie Friedrich,<br />
Basel<br />
Contemporary Drawing: Eight<br />
Propositions, Museum of Modern<br />
Art, New York<br />
EU2, Stephen Friedman Gallery,<br />
London<br />
documenta 11, Kassel<br />
2001<br />
Plateau of <strong>Human</strong>kind,<br />
italienischer Pavillon, La Biennale<br />
di Venezia, Venedig<br />
Free Sport, Greene Naftali,<br />
New York<br />
Squatters, Casa de Serralves,<br />
Porto<br />
Post-Nature: Nine Dutch Artists,<br />
Palazzo Ca’Zenobio, La Biennale<br />
di Venezia, Venedig<br />
2000<br />
Face to Face, Kabinet Overholland<br />
in het Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Territory, Tokyo Opera City Art<br />
Gallery, Tokyo<br />
Drawings 2000, Barbara<br />
Gladstone Gallery, New York<br />
1999<br />
Transmitter, Bonner Kunstverein,<br />
Bonn<br />
De Opening, S.M.A.K., Gent<br />
Collection, Van Abbemuseum,<br />
Eindhoven<br />
1998<br />
Shopping the Stars,<br />
Zeno X Gallery, Antwerpen<br />
Entr’Acte, Stedelijk Van<br />
Abbemuseum, Eindhoven<br />
Vertical Time, Barbara<br />
Gladstone Gallery, New York<br />
1997<br />
Premio Fondazione Sandretto<br />
Re Rebaudengo per l’Arte, Turin<br />
Belladonna, Firstsite at<br />
the Minories, ICA, London<br />
1996<br />
Making a Place, Snug Harbor<br />
Cultural Center, New York<br />
Accrochage, Zeno X Gallery,<br />
Antwerpen<br />
1995<br />
Orientasi/Oriëntatie, National<br />
Museum of Modern Art, Jakarta<br />
Country Cöde, Bravin Post Lee,<br />
New York<br />
1994<br />
This is the show and the show<br />
is many things, Museum<br />
van Hedendaagse Kunst, Gent<br />
Du Concept à l’Image. Art<br />
Pays-Bas XXe siècle, Musée d’Art<br />
Moderne de la ville de Paris, Paris<br />
1993<br />
La Biennale di Venezia, Scuola<br />
de San Pasquale, Venedig<br />
1992<br />
Prix Nl 1992. 7 kunstenaars,<br />
Galerie Nouvelles Images,<br />
Den Haag<br />
Prix de Rome, Museum Fodor,<br />
Amsterdam; Rijksakademie,<br />
Amsterdam; Beeldhouwkunst,<br />
Oude Kerk, Amsterdam
160 — 161<br />
Biografien<br />
Renzo Martens<br />
Geboren 1973 in Sluiskil (NL),<br />
lebt und arbeitet in<br />
Amsterdam (NL), Brüssel (BE)<br />
und Kinshasa (CD)<br />
Einzelausstellungen<br />
2009<br />
Episode 3, Wilkinson Gallery,<br />
London<br />
2008<br />
Episode 3, Stedelijk Museum<br />
Bureau, Amsterdam<br />
2005<br />
Episode 1, Vtape, Toronto<br />
2004<br />
Episode 1, Marres Centre<br />
for Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
2003<br />
Episode 1, Galerie Fons Welters,<br />
Amsterdam<br />
1999<br />
Rien ne va plus,<br />
De Merodestraat, Brüssel<br />
Gruppenausstellungen<br />
2010<br />
Monumentalism, Stedelijk<br />
Museum, Amsterdam<br />
Berlin Biennale, Berlin<br />
MyWar. Identity and<br />
Appropriation Under War<br />
<strong>Condition</strong>, FACT, Liverpool<br />
Self as disappearance,<br />
Centre d’art contemporain<br />
La synagogue de Delme, Delme<br />
Morality Act III. And the moral<br />
of the story is …, Witte de With,<br />
Rotterdam<br />
2009<br />
Recente Aanwinsten, De Hallen,<br />
Haarlem<br />
Rien ne va plus, Van Abbe<br />
Museum, Eindhoven<br />
Le Temps de la Fin, Espace<br />
d’art contemporain La Tolerie,<br />
Clermont-Ferrand<br />
Exploring the Age of Repression,<br />
Pavilion, Bukarest<br />
Endurance. Daring Feats of<br />
Risk, Survival and Perseverance,<br />
Abington Art Center, Philadelphia<br />
Images Recalled, Fotofestival,<br />
Ludwigshafen<br />
Until the End of the World,<br />
AMP Gallery, Athen<br />
Monumentalismus. One’s History<br />
is Another’s Misery, Autocenter,<br />
Berlin<br />
Muhka Media, Muhka, Antwerpen<br />
Hors Pistes (Filmvorführung<br />
Episode 3), Centre Pompidou,<br />
Paris<br />
Kunstenfestivaldesarts, Brüssel<br />
2008<br />
Matter of Fact; Aftermath<br />
(Capacete/A Gentil Carioca/<br />
Galeria Vermelho), Sao Paulo<br />
Brussels Biennial, Brüssel<br />
Manifesta 7. Matter of Fact<br />
(The European Biennial of<br />
Contemporary Art), Rovereto<br />
L’Art en Europe. Experience<br />
Pommery #5, Domaine Pommery,<br />
Reims<br />
Neither Either Nor Or, Württembergischer<br />
Kunstverein, Stuttgart<br />
To Burn Oneself with Oneself:<br />
the Romantic Damage Show,<br />
De Appel, Amsterdam<br />
2007<br />
Modern Solitude, Galerie Fons<br />
Welters, Amsterdam<br />
Brave New World, Cobra Museum,<br />
Amstelveen<br />
Nothing Else Matters, Museum<br />
de Hallen, Haarlem<br />
Speakers, Aeroplastics Gallery,<br />
Brüssel<br />
Magazine Project, documenta 12,<br />
Kassel<br />
2006<br />
A Picture of War is not War,<br />
Wilkinson Gallery, London<br />
Excess, Z’33, Hasselt<br />
An Evening with …,<br />
Platform Garanti, Istanbul<br />
Frieze Art Fair, Wilkinson Gallery,<br />
London<br />
2005<br />
I Love Video Art, Musée d’Art<br />
Contemporain, Strasbourg<br />
Undercurrents, Basis Actuele<br />
Kunst (BAK), Utrecht<br />
Reprise, Marres Centre<br />
for Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
Inner and Outer Worlds,<br />
Argos festival, Argos<br />
Soft Target, Basis Actuele Kunst,<br />
Utrecht<br />
2004<br />
Constructing Visions,<br />
TENT, Rotterdam<br />
Mediamatic Supersalon,<br />
Mediamatic, Amsterdam<br />
Plug-In, Futura, Prag<br />
Yugoslav Biennial, Vrsac<br />
Monitoring, Kunstverein<br />
Kassel, Kassel<br />
IDFA, Amsterdam<br />
2003<br />
Urban Dramas, De Singel,<br />
Antwerpen<br />
Etablissements d’en face<br />
projects, Brüssel<br />
Blick zum Nachbarn.<br />
Kunstfilmbiennale, Köln<br />
Art Cologne, Galerie Fons<br />
Welters, Amsterdam<br />
2002<br />
De Avonden, De Appel,<br />
Amsterdam
Kris Martin<br />
Geboren 1972 in Kortrijk (BE),<br />
lebt in Gent (BE)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
White Cube, London<br />
Almine Rech, Brüssel<br />
2009<br />
Aspen Art Museum, Aspen<br />
Sies + Höke, Düsseldorf<br />
Johann König, Berlin<br />
2008<br />
Wattis Institute for<br />
Contemporary Arts, San Francisco<br />
Museum Dhondt-Dhaenens,<br />
Deurle<br />
Eldorado. Kris Martin. Inter pares,<br />
Galleria d’Arte Moderna e<br />
Contemporanea GAMeC, Bergamo<br />
Marc Foxx, Los Angeles<br />
White Cube, London<br />
2007<br />
P.S.1 MoMA, Contemporary Art<br />
Center, New York<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
My Private #5, Piazza San Marco,<br />
Venedig<br />
Marc Foxx, Los Angeles<br />
2006<br />
Deus ex machina, Johann König,<br />
Berlin<br />
2005<br />
Neuer Aachener Kunstverein,<br />
Aachen<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
2004<br />
Beaulieu Gallery,<br />
Wortegem-Petegem<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Contemplating the Void,<br />
Guggenheim Museum, New York<br />
Triennale Kleinplastik, Fellbach<br />
Berlin – Paris, Johann König,<br />
Berlin; Galerie Philippe Jousse,<br />
Paris<br />
2009<br />
Beg Borrow and Steal, Rubell<br />
Family Collection, Miami<br />
A l’épreuve, Institute d’Art<br />
Contemporain, Villeurbanne<br />
Earth: Art of a changing world,<br />
GSK Contemporary, 2009,<br />
Royal Academy of Arts, London<br />
Silent, Hiroshima City Museum<br />
of Contemporary Art, Hiroshima<br />
Morality, Witte de With, Center<br />
for Contemporary Art, Rotterdam<br />
Das Gespinst. Die Sammlung<br />
Schürmann zu Gast im Museum<br />
Abteiberg, Mönchengladbach<br />
The Importance of the Zebra Fish,<br />
Pilar Parra & Romero, Madrid<br />
Moby Dick, Wattis Institute for<br />
Contemporary Arts, San Francisco<br />
cargo manifest, Bayrische<br />
Staatsoper, München<br />
The Site of Silence – Der Ort der<br />
Stille, Ausstellungshalle zeitgenössische<br />
Kunst, Münster<br />
Heaven, 2. Athens Biennale,<br />
Athen<br />
Beginnings, Middles, And Ends,<br />
Galerie Georg Kargl, Wien<br />
Magritte et la Lumière, Almine<br />
Rech Galerie, Brüssel<br />
The Quick and the Dead, Walker<br />
Art Center, Minneapolis<br />
On second readings, Galeria<br />
Estrany-de la Mota, Barcelona<br />
Born in the morning, dead<br />
by night, Leo König, New York<br />
2008<br />
Heavy Metal, Kunsthalle zu Kiel,<br />
Kiel<br />
Political/Minimal, KW – Institute<br />
for Contemporary Art, Berlin<br />
Ars in Cathedrali, Cathédrale<br />
Saints-Michel-et-Gudule, Brüssel<br />
Library, UOVO Open Office, Berlin<br />
The Krautcho Club/In and Out<br />
of Place, Forgotten Bar Project,<br />
Berlin & Project Space 176,<br />
London<br />
This is not a void, Galerie<br />
Luisa Strina, São Paulo<br />
When a clock is seen from<br />
the side it no longer tells the<br />
time, Johann König, Berlin<br />
FADE IN/FADE OUT,<br />
Bloomberg Space, London<br />
L’Argent, FRAC Ile-de-France,<br />
Paris<br />
Speicher fast voll – Sammeln und<br />
Ordnen in der Gegenwartskunst,<br />
Kunstmuseum, Solothurn<br />
The Eternal Flame,<br />
Kunsthaus Baselland, Basel<br />
Boros Collection, Berlin<br />
Past – Forward, Zabludowicz<br />
Collection 176, London<br />
Traces du sacré,<br />
Centre Georges Pompidou, Paris<br />
You Dig the Tunnel – I`ll Hide<br />
the Soil, White Cube, London<br />
God is design …, Galeria Fortes<br />
Vilaça, São Paulo<br />
Section des Miroirs, School<br />
of the Art Institute of Chicago,<br />
Chicago<br />
Der eigene Weg/Perspektiven<br />
belgischer Kunst, Museum<br />
Küppersmühle für Moderne<br />
Kunst, Duisburg<br />
Countdown, Center for<br />
Curatorial Studies, New York<br />
All-Inclusive. Die Welt des<br />
Tourismus, Schirn Kunsthalle,<br />
Frankfurt<br />
2007<br />
Gehen Bleiben,<br />
Kunstmuseum Bonn, Bonn<br />
Passengers, Wattis Institute<br />
for Contemporary Arts,<br />
San Francisco<br />
The Office, Tanya Bonakdar<br />
Gallery, New York<br />
The Long Goodbye,<br />
Vanmoerkerke collection,<br />
Oostende<br />
The skeleton in art,<br />
Cheim & Read,<br />
New York<br />
For Sale, Cristina Guerra<br />
Contemporary Art, Lisbon<br />
Learn to Read, Tate Modern,<br />
London<br />
Invisible, Max Wigram Gallery,<br />
London<br />
Absent Without Leave,<br />
Victoria Miro Gallery, London<br />
Some Time Waiting,<br />
Kadist Art Foundation, Paris<br />
Ci vediamo a casa,<br />
Perarolo di Cadore, Belluno<br />
Trobleyn/Laboratorium,<br />
Jan Fabre, Antwerpen<br />
2006<br />
My private escaped from Italy,<br />
International Center of Art and<br />
Landscape on the island of<br />
Vassivière, Beaumont du Lac<br />
Protections. Das ist keine<br />
Ausstellung, Kunsthaus Graz,<br />
Graz<br />
Faster! Bigger! Better!<br />
Signetwerke der Sammlungen,<br />
ZKM, Museum für neue Kunst,<br />
Karlsruhe<br />
Nichts weiter als ein Rendezvous,<br />
Künstlerhaus Bremen, Bremen<br />
Designing Truth, Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum,<br />
Duisburg<br />
Of Mice and Men, 4. Berlin<br />
Biennale für Zeitgenössische<br />
Kunst, Berlin<br />
Message personnel,<br />
Yvon Lambert, Paris<br />
2005<br />
SEE history 2005 – Der private<br />
Blick, Kunsthalle zu Kiel, Kiel<br />
Post Notes, Midway<br />
Contemporary Art, Minnesota<br />
2003<br />
Gelijk het leven is, SMAK<br />
Stedelijk Museum voor Actuele<br />
Kunst, Gent<br />
The distance between Me and<br />
You, Lisson Gallery, London<br />
2001<br />
Verklärte Nacht, Sonsbeek 9,<br />
Arnhem<br />
2000<br />
Wahnsinn, Garden of Museum<br />
Dhondt-Dhaenens, Deurle
162 — 163<br />
Biografien<br />
Adrian Paci<br />
Geboren 1969 in Shkodra (AL),<br />
lebt und arbeitet in Mailand (IT)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
Motion Picture(s),<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich<br />
francesca kaufmann, Mailand<br />
Gestures,<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
I mutanti, Villa Medici, Rom<br />
2009<br />
Centro di Permanenza<br />
temporanea, Outlet Project<br />
Room, Istanbul<br />
2008<br />
Subjects in Transit, CCA, Tel Aviv<br />
Kunstverein Stuk, Leuven<br />
Kunstverein Hannover, Hannover<br />
Bonniers Konsthall, Stockholm<br />
2007<br />
Pino Pascali Prize XI Edition,<br />
Museo Pino Pascali,<br />
Polignano a Mare<br />
Smith – Stewart Gallery, New York<br />
Museum am Ostwall, Dortmund<br />
Per Speculum, Milton Keynes<br />
Gallery, Milton Keynes<br />
2006<br />
Per Speculum,<br />
francesca kaufmann, Mailand<br />
Galleria Civica di Modena,<br />
Modena<br />
BAK, Utrecht<br />
Modern Times, MAN, Nuoro<br />
2005<br />
P.S.1, MoMA, New York<br />
Yale University, New Haven<br />
Perspectives 147: Adrian Paci,<br />
Contemporary Arts Museum,<br />
Houston<br />
MC projects, Los Angeles<br />
Galerie Peter Kilchmann, Zürich<br />
First at Moderna, Moderna<br />
Museet, Stockholm<br />
Exit Gallery, Pec, Kosovo<br />
2004<br />
Slowly, francesca kaufmann,<br />
Mailand<br />
Turn on, ViaFarini, Mailand<br />
2003<br />
A Toll on Rituals,<br />
BAC Baltic Art Center, Visby<br />
Galerie Peter Kilchmann, Zürich<br />
2002<br />
Sorella Morte,<br />
francesca kaufmann, Mailand<br />
Galleria Irida, Sofia<br />
Galleria d’Arte Moderna<br />
e Contemporanea, Bergamo<br />
Claudio Poleschi, Lucca<br />
2001<br />
BildMuseet, Umeå<br />
Fondazione Lanfranco Baldi,<br />
Florenz<br />
Home Sweet Home, Artropia,<br />
Milan<br />
1996<br />
National Gallery of Art, Tirana<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2010<br />
International Biennale<br />
of Contemporary Art, Poznan<br />
Languages and Experimentations,<br />
MART, Rovereto<br />
Les Mutants, Villa Medici, Rom<br />
Artes Mundi, National Museum<br />
Cardiff, Cardiff<br />
The Library of Babel/In and<br />
Out of Place,<br />
176 Zabludowicz Collection,<br />
London<br />
ATOPIA – Art and the City in the<br />
21st Century, Centro de Cultura<br />
Contemporania de Barcelona,<br />
Barcelona<br />
… on the eastern front,<br />
The Ludwig Museum, Budapest<br />
Suspended Spaces No 1 – from<br />
Famagusta, La Maison de la<br />
Culture d’Amiens, Amiens<br />
2009<br />
Los de arriba y los de abajo,<br />
Sala de Arte Publico Siqueiros,<br />
Mexico City<br />
The Symbolic Efficiency of the<br />
Frame, 4. T.I.C.A.B, Tirana<br />
International Contemporary<br />
Art Biennial, Tirana<br />
The World is Yours, Louisana<br />
Museum of Modern Art,<br />
Humlebaek<br />
The Spectacle of the Everyday,<br />
10. Biennale de Lyon, Lyon<br />
Heaven, 2. Athens Biennale,<br />
Athen<br />
Windows upon Oceans - 8. Baltic<br />
Biennial of Contemporary Art,<br />
National Museum, Szczecin<br />
Havana Biennial, Havana<br />
Panoramica, Museo Tamayo,<br />
Mexiko<br />
2008<br />
Ich will/I will, Kunsthalle<br />
Exnergasse, Wien<br />
Memories for Tomorrow: Works<br />
from The UBS Art Collection,<br />
Shanghai Art Museum, Shanghai<br />
Shifting Identities, Kunsthaus<br />
Zürich, Zürich; CAC, Vilnius<br />
Lost Paradise, Zentrum Paul Klee,<br />
Bern<br />
Peripheral look and collective<br />
body, Museion, Bozen<br />
Street & Studio, Tate Modern,<br />
London; Museum Folkwang,<br />
Essen<br />
2007<br />
Land of <strong>Human</strong> Rights, Rotor,<br />
Graz<br />
Transculture, Bunkier Sztuki,<br />
Krakau<br />
Borderland, Brussels Biennale I,<br />
BOZAR - Palais des Beaux-Arts,<br />
Brüssel<br />
Senso Unico, P.S.1, MoMA,<br />
New York<br />
2006<br />
Fremd bin ich eingezogen,<br />
Kunsthalle Fridericianum, Kassel<br />
Exposed Memory, Hungarian<br />
University of Fine Arts, Budapest<br />
Wherever we go, Spazio Oberdan,<br />
Mailand<br />
Busan Biennale 2006, Busan<br />
Equal and less equal, Museum<br />
of the Seam, Jerusalem<br />
The Grand Promenade, National<br />
Museum of Contempary Art,<br />
Athen<br />
Of the one and the many,<br />
Platform Garanti Contemporary<br />
Art Center, Istanbul<br />
Zone of Contact, 15. Biennale<br />
of Sydney, Sydney<br />
60 Seconds Well Spent, Frankfurter<br />
Kunstverein, Frankfurt<br />
Biennale Cuvée, O.K. Centrum<br />
für Gegenwartskunst, Linz<br />
Shoot the Family, Cranbrook<br />
Art Museum, Bloomfield Hills;<br />
Knoxville Museum of Art,<br />
Knoxville; Western Gallery,<br />
Bellingham; David and Sandra<br />
Bakalar Gallery, Boston;<br />
Contemporary Art Museum<br />
St. Louis, St. Louis; Columbus<br />
College of Art and Design,<br />
Columbus<br />
2005<br />
La Biennale di Venezia, Venedig<br />
Berlin Photography Festival,<br />
Martin-Gropius-Bau, Berlin<br />
More Than This! Negotiating<br />
Realities, Göteborg International<br />
Biennial for Contemporary Art,<br />
Göteborg<br />
KunstFilmBiennale,<br />
Museum Ludwig, Köln<br />
Projekt Migration,<br />
Kölnischer Kunstverein, Köln<br />
Arbeit – work/labour,<br />
Galerie im Taxipalais, Innsbruck<br />
2004<br />
Biennale di Sevilla, Sevilla<br />
New Video/New Europe, Museum<br />
of Contemporary Art, St. Louis<br />
Exiting Europe, Galerie für<br />
Zeitgenössische Kunst, Leipzig<br />
Se Bashku, Museum of<br />
Contemporary Art, Uppsala<br />
I Nuovi Mostri, Fondazione<br />
Trussardi, Mailand<br />
New Video, New Europe,<br />
The Renaissance Society, Chicago<br />
2003<br />
Looking Awry, Apex Art, New York<br />
Skin Deep, MART, Museo di<br />
arte moderna e contemporanea,<br />
Rovereto<br />
Gestures, Printemps de Septembre,<br />
Festival of Contemporary<br />
Images, Toulouse<br />
BALKAN – In den Schluchten,<br />
Kunsthalle Fridericianum, Kassel<br />
Blut & Honig, Zukunft ist<br />
am Balkan, Essl Museum,<br />
Klosterneuburg/Wien<br />
Multitudes – Solitudes, Museion,<br />
Bozen<br />
Isola (Art) Project Milano,<br />
MAMCO musée d’art moderne<br />
et contemporain, Genf<br />
Bitter/Sweet Harmony –<br />
Contemporary Albanian Art,<br />
Digital ArtLab, Holon<br />
Durchzug/Draft, Kunsthalle<br />
Zürich, Zürich<br />
2002<br />
In Search of Balkania,<br />
Neue Galerie Graz am <strong>Universalmuseum</strong><br />
<strong>Joanneum</strong>, Graz<br />
EXIT, Fondazione Sandretto<br />
Re Rebaudengo, Turin<br />
It’s ain’t much but it’s home,<br />
Binz 39 (mit Emmanuel Licha),<br />
Zürich<br />
Rain, Fotofest, Houston<br />
Home, Collegium Artisticum,<br />
Sarajevo<br />
2001<br />
Short Stories, Fabbrica del<br />
Vapore, Mailand<br />
I Biennale di Valencia, Valencia<br />
Biennale di Tirana, Tirana<br />
Generator, Claudio Poleschi,<br />
Lucca<br />
Le Mois de la Photo à Montréal,<br />
Montreal<br />
Beautiful Strangers, ifa-Galerie,<br />
Berlin<br />
Ostensiv, Kunstraum Leipzig,<br />
Leipzig<br />
Arteast Collection 2000+,<br />
Orangerie Congress, Innsbruck<br />
2000<br />
Oberhausen Short Film Festival,<br />
Oberhausen<br />
BAN Exhibition, International<br />
House, Brüssel<br />
Manifesta 3, Ljubljana<br />
Arteast Collection 2000,<br />
Museum of Modern Art, Ljubljana<br />
Kasseler Dokumentarfilm-<br />
und Videofest, Kassel<br />
In & Out, National Gallery of Art,<br />
Tirana<br />
1999<br />
La Biennale di Venezia, Venedig<br />
Lost & Found, Center for<br />
Electronic Media de Waag,<br />
Amsterdam<br />
1998<br />
Permanent Instability,<br />
National Gallery of Art, Tirana
Susan Philipsz<br />
Geboren 1965 in Glasgow (GB),<br />
lebt und arbeitet in Berlin (DE)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2011<br />
Ludwig Forum für internationale<br />
Kunst, Aachen<br />
2010<br />
When Day Closes, IHME Project<br />
2010, Pro Arte Foundation,<br />
Helsinki<br />
Lowlands, Glasgow International,<br />
Glasgow<br />
I See a Darkness, Tanya Bonakdar<br />
Gallery, New York<br />
Kunst Halle Sankt Gallen,<br />
St. Gallen<br />
Mizuma and One Gallery, Beijing<br />
Peabody Essex Museum, Salem<br />
We Shall Be All, Museum<br />
of Contemporary Art, Chicago<br />
2009/10<br />
Ellen De Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
The Shortest Shadow, Wexner<br />
Centre for the Arts, Ohio State<br />
University, Columbus<br />
2009<br />
Appear to Me, Silo Monastery,<br />
Burgos<br />
Lowlands, Museum Ludwig, Köln<br />
Long Gone, CoCA, Torun<br />
Carried by the Winds, Radcliffe<br />
Observatory, Modern Art Oxford,<br />
Oxford<br />
From a Distance, Imperial War<br />
Museum, Duxford<br />
2008/09<br />
I See a Darkness, Jarla Partilager,<br />
Stockholm<br />
2008<br />
Here Comes Everybody,<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin<br />
Alpine Architecture<br />
(mit Monica Sosnowska),<br />
Alte Fabrik, Rapperswil<br />
More Than This,<br />
Juan Miro Foundation Gardens,<br />
Palma de Mallorca<br />
Yale Art Gallery Commission,<br />
New Haven<br />
Imperial War Museum<br />
Commission, Duxford<br />
Out of Bounds: Susan Philipsz,<br />
ICA-Institute of Contemporary<br />
Art, London<br />
2007<br />
Did I Dream You Dreamed About<br />
Me, Mitzuma Gallery, Tokyo<br />
CGAC, Santiago de Compostela<br />
Art Statements Basel, Basel<br />
2006<br />
Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin<br />
ARCO Art Fair, Madrid<br />
Reception 3 (mit Robert Barry),<br />
Büro Friedrich, Berlin<br />
Stay With Me, Malmö Konsthall,<br />
Malmö<br />
Appendiks, Kopenhagen<br />
2004<br />
Kunstverein Arnsberg E.V.,<br />
Arnsberg<br />
Ellen de Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
Let Us Take You There (mit Paul<br />
Rooney), Site Gallery, Sheffield<br />
2003<br />
38 Langham Street, London<br />
2002<br />
Ellen de Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
Pledge, Temple Bar Gallery,<br />
Dublin<br />
2001<br />
Tomorrow Belongs To Me,<br />
Stadtlabor, Lüneburg<br />
2000<br />
I Remember You, The Old<br />
Museum Arts Centre, Belfast<br />
Some Place Else (mit Mary<br />
McIntyre), Consortium Gallery,<br />
Amsterdam<br />
1999<br />
Red Standard (mit Eoghan<br />
McTigue), The New Works Gallery,<br />
Chicago<br />
1998<br />
Strip Tease, The Annual<br />
Programme, Manchester<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl)<br />
2011<br />
Freeze, Wexner Center for the<br />
Arts, The Ohio State University,<br />
Columbus<br />
Estuaire, Nantes, Saint Nazaire<br />
2010<br />
Haunted, Solomon R.<br />
Guggenheim Museum, New York<br />
Contemplating the Void:<br />
Interventions in the Guggenheim<br />
Museum, Solomon R. Guggenheim<br />
Museum, New York<br />
29. Bienal de São Paulo,<br />
São Paulo<br />
RES PUBLICA, Calouste<br />
Gulbenkian Foundation, Lissabon<br />
ESPECTRAL (Spectral), CGAC<br />
Centro Galego de Arte Contemporánea,<br />
Santiago de Compostela<br />
Brondo Sculpture Park, Warschau<br />
2009/10<br />
Mirrors, MARCO Museo de Arte<br />
Contemporanea, Vigo<br />
2009<br />
The Quick and the Dead, Walker<br />
Arts Center, Minneapolis<br />
Le sang d’un poète, Estuaire<br />
Nantes Saint-Nazaire Biennale,<br />
Nantes<br />
The Past in the Present, LABoral<br />
Centro de Arte, Gijón<br />
The Collection, Siobhan Davies<br />
Dance & Victoria Miro Gallery,<br />
London<br />
PLOT/09: This World & Nearer<br />
Ones, öffentliches Projekt für<br />
Governor’s Island produziert<br />
in Kooperation mit Creative Time,<br />
New York<br />
Quizas me puedas contar orta<br />
historia …, Museo de Cáceres,<br />
Cáceres<br />
1989. Ende der Geschichte oder<br />
Beginn der Zukunft, Kunsthalle<br />
Wien, Wien<br />
2008<br />
Life on Mars: 55th Carnegie<br />
International, Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh<br />
Sound of Music, Marres Centre<br />
for Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
God and Goods, Villa Manin<br />
Centre for Contemporary Art,<br />
Passariano, Codroipo<br />
Tales of Time and Space,<br />
Folkstone Triennial, Folkstone<br />
Revolutions: Forms That Turn,<br />
Sydney Biennale, Sydney<br />
Unknown Pleasures, Aspen Art<br />
Museum, Aspen<br />
U Turn, Copenhagen Triennale,<br />
Kopenhagen<br />
2007<br />
Skulptur Projekte Münster 07,<br />
Münster<br />
for REE, Marc Foxx, Los Angeles<br />
Madrid Abierto, Madrid<br />
Unmonumental, New Museum<br />
for Contemporary Art, New York<br />
Busan Biennale, Busan<br />
2006<br />
Radio Waves Goodbye, Live<br />
Radio Project, Hidden Rythms,<br />
Nijmegen<br />
Ars 06, Museum of Contemporary<br />
Art KIASMA, Helsinki<br />
2005<br />
Guangzhou Triennale, Guangzhou<br />
Torino Triennale, Kirche von<br />
Santa Crux, Rivoli<br />
Argos Festival, Brüssel<br />
Leaps of Faith, Nikosia<br />
Our Surroundings, Dundee<br />
Contemporary Arts, Dundee<br />
2004<br />
The Stars Are So Big, The Earth<br />
is So Small … Stay As You Are,<br />
c/o Esther Schipper, Berlin<br />
I Feel Mysterious Today,<br />
Palm Beach Institute of<br />
Contemporary Art, Palm Beach<br />
Pass The Time of Day, Maryron<br />
Park, London<br />
Art Forum Berlin,<br />
Ellen De Bruijne Projects, Berlin<br />
Platform Garanti Contemporary<br />
Art Center, Istanbul<br />
Depicting Love, Künstlerhaus<br />
Bethanien, Berlin<br />
Space to Face, Westfälischer<br />
Kunstverein, Münster<br />
Berlin North,<br />
Hamburger Bahnhof, Berlin<br />
Beck’s Futures 2004,<br />
ICA Galleries, London<br />
2003<br />
Susan Philipsz, Paul Pfeiffer,<br />
Brian Fridge, Art Pace<br />
Foundation, San Antonio<br />
The Echo Show, Tramway,<br />
Glasgow<br />
Days Like These: The Triennial<br />
of British Art, Tate Britain, London<br />
The Moderns, Museo d’Arte<br />
Contemporanea, Castello di<br />
Rivoli, Turin<br />
2001<br />
The Glen Dimplex Awards, Irish<br />
Museum of Modern Art, Dublin<br />
The International Language,<br />
grassy knoll productions, Belfast<br />
Tirana Biennale, Tirana<br />
Sloan/Philipsz/McTigue,<br />
The Plug In Gallery, Winnipeg<br />
Total Object Complete with<br />
Missing Parts, Tramway, Glasgow<br />
Loop, Kunsthalle der<br />
Hypo-Kulturstiftung, München<br />
Islands and Aeroplanes,<br />
Sparwasser HQ, Berlin<br />
New York New Sounds, Musée<br />
d’art contemporain de Lyon, Lyon<br />
2000<br />
Manifesta 3, Ljubljana<br />
The Internationale, Kunst-Werke,<br />
Berlin<br />
1999<br />
Melbourne International Biennial,<br />
Melbourne
164 — 165<br />
Autoren
Hannah Arendt, gesellschafts-<br />
und politikwissenschaftliche<br />
Theoretikerin, geboren 1906 in<br />
Hannover, gestorben 1975 in<br />
New York, studierte Philosophie,<br />
Theologie und Griechisch unter<br />
anderem bei Martin Heidegger,<br />
Edmund Husserl und Karl Jaspers.<br />
Nach einer kurzen Inhaftierung<br />
durch die Gestapo 1933 Emigration<br />
nach Paris, Sozialarbeiterin<br />
bei jüdischen Einrichtungen,<br />
1940 Verschleppung in das<br />
Internierungslager Gurs,<br />
ab 1941 in New York, 1944-46<br />
Forschungsleiterin der<br />
Conference on Jewish Relations,<br />
1946-49 Cheflektorin im Salman<br />
Schocken Verlag, 1948-52<br />
Direktorin der Jewish Cultural<br />
Reconstruction Organization zur<br />
Rettung jüdischen Kulturguts,<br />
1953 nach mehreren Gastvorlesungen<br />
u.a. in Princeton und<br />
Harvard Professur am Brooklyn<br />
College in New York, 1959 als<br />
erste Frau Gastprofessur an der<br />
Princeton University, 1963<br />
Professorin an der Universität<br />
von Chicago, ab 1967 an der<br />
New School for Social Research<br />
in New York.<br />
Publikationen (Auswahl):<br />
Elemente und Ursprünge totaler<br />
Herrschaft (1955);<br />
Rahel Varn hagen. Lebensgeschichte<br />
einer deutschen<br />
Jüdin aus der Romantik (1958);<br />
Vita activa oder Vom tätigen<br />
Leben (1958);<br />
Eichmann in Jerusalem.<br />
Ein Bericht von der Banalität<br />
des Bösen (1963);<br />
Über die Revolution (1963);<br />
Macht und Gewalt (1970);<br />
Das Urteilen. Texte zu Kants<br />
politischer Philosophie (1982).<br />
Judith Butler, geboren 1956 in<br />
Cleveland, Ohio, ist Philosophin<br />
und Philologin. Sie erlangte ihren<br />
Doktortitel an der Yale University<br />
und erhielt 1991 eine Professur<br />
für <strong>Human</strong>wissenschaften an<br />
der Johns Hopkins University,<br />
Baltimore. Seit 1993 lehrt Butler<br />
an der University of California,<br />
Berkeley, wo sie 1998 den<br />
Maxine-Elliot-Lehrstuhl für<br />
Rhetorik und Vergleichende<br />
Literaturwissenschaft annahm.<br />
Butlers Hauptforschungsgebiete<br />
sind Feministische Theorie,<br />
Philosophie und Literatur,<br />
Politische Theorie, mit einem<br />
ausgewiesenen Schwerpunkt auf<br />
Gender und Sexualität. Zu ihren<br />
wichtigsten Publikationen zählen:<br />
Das Unbehagen der Geschlechter<br />
(1991); Körper von Gewicht.<br />
Die diskursiven Grenzen des<br />
Geschlechts (1995); Haß spricht.<br />
Zur Politik des Performativen<br />
(1998); Antigones Verlangen.<br />
Verwandtschaft zwischen Leben<br />
und Tod (2001); Psyche der<br />
Macht. Das Subjekt der Unterwerfung<br />
(2002); Kritik der ethischen<br />
Gewalt. Adorno-Vorlesungen<br />
2002 (2003); Gefährdetes<br />
Leben. Politische Essays (2005);<br />
Sprache, Politik, Zugehörigkeit<br />
(zusammen mit Gayatri Spivak,<br />
2007); Krieg und Affekt (2009);<br />
Die Macht der Geschlechternormen<br />
und die Grenzen des<br />
Menschlichen (2009).<br />
Sophie Loidolt ist Lehrbeauftragte<br />
am Institut für Philosophie<br />
der Universität Wien und arbeitet<br />
zurzeit an einem Projekt zu<br />
Hannah Arendt mit dem Titel<br />
Arendt und Kant. Transformation<br />
der Aufklärung mit Unterstützung<br />
eines APART-Stipendiums<br />
der Österreichischen Akademie<br />
der Wissenschaften. Forschungsaufenthalte<br />
in New York,<br />
Paris und Leuven (Belgien).<br />
Buchpublikationen: Anspruch<br />
und Rechtfertigung. Eine Theorie<br />
des rechtlichen Denkens im<br />
Anschluss an die Phänomenologie<br />
Edmund Husserls (2009);<br />
Das Fremde im Selbst. Das<br />
Andere im Selben. Transformationen<br />
der Phänomenologie<br />
(Mitherausgeber<br />
Matthias Flatscher, 2010).<br />
Jeremy Rifkin, geboren 1943 in<br />
Denver, Colorado, ist Soziologe<br />
und Ökonom, Publizist sowie<br />
Gründer und Vorsitzender der<br />
Foundation on Economic Trends<br />
(FOET) in Washington D.C.<br />
Er unterrichtet an der Wharton<br />
School der Universität Pennsylvania,<br />
ist Berater für die Europäische<br />
Union und verschiedene<br />
Regierungen weltweit. Rifkin hat<br />
zahlreiche Bücher veröffentlicht,<br />
die sich mit großen Zukunftsthemen<br />
auseinandersetzen, mit<br />
den Auswirkungen des wissenschaftlichen<br />
und technischen<br />
Wandels auf Arbeitswelt, Wirtschaft,<br />
Gesellschaft und Umwelt,<br />
darunter: Das Ende der Arbeit<br />
und ihre Zukunft (1995),<br />
Das biotechnische Zeitalter. Die<br />
Geschäfte mit der Genetik (1998),<br />
Access (2000), Die H2-Revolution.<br />
Wenn es kein Öl mehr gibt …<br />
Mit neuer Energie für eine<br />
gerechte Weltwirtschaft (2002),<br />
Der Europäische Traum. Die<br />
Vision einer leisen Supermacht<br />
(2004, internationaler Buchpreis<br />
Corine) und Die empathische<br />
Zivilisation. Wege zu einem<br />
globalen Bewusstsein (2010).
166 — 167<br />
Impressum<br />
Diese Publikation erscheint<br />
anlässlich der Ausstellung<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
12. Juni – 12. September 2010<br />
Kurator<br />
Adam Budak<br />
Herausgeber<br />
Adam Budak,<br />
Peter Pakesch<br />
Redaktion<br />
Johanna Ortner<br />
Übersetzungen<br />
Paul Aston,<br />
Ulrike Bischoff,<br />
Waltraud Götting,<br />
Christof Huemer,<br />
Otmar Lichtenwörther,<br />
Xenia Osthelder,<br />
Karin Wördemann<br />
Lektorat<br />
Martha Davis Konrad,<br />
Bernd Eicher,<br />
Stefan Schwar<br />
Grafische Konzeption<br />
und Gestaltung<br />
Harald Niessner<br />
mit Katharina<br />
Untertrifaller<br />
Corporate Design<br />
Lichtwitz –<br />
Büro für visuelle<br />
Kommunikation<br />
Drucküberwachung<br />
Michael Neubacher<br />
Lithographie und Druck<br />
Medienfabrik Graz<br />
Papier<br />
Hello Silk 170g,<br />
Biotop3 100g,<br />
Cyclus 100g,<br />
Invercote 300g<br />
Schrift<br />
Tram <strong>Joanneum</strong><br />
Das Werk ist urheberrechtlich<br />
geschützt. Die dadurch<br />
begründeten Rechte, insbesondere<br />
die der Übersetzung,<br />
des Nachdruckes, der Entnahme<br />
von Abbildungen, der Rund -<br />
funksendung, der Wiedergabe<br />
auf fotomechanischem oder<br />
ähnlichem Weg oder der<br />
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen<br />
bleiben,<br />
auch bei nur auszugsweiser<br />
Verwertung, vorbehalten.<br />
2010 © Künstlerinnen und<br />
Künstler, Autorinnen und<br />
Autoren, Kunsthaus Graz<br />
und Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Köln<br />
Erschienen im<br />
Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Köln<br />
Ehrenstr. 4, 50672 Köln<br />
Tel +49-221/20596-53<br />
Fax +49-221/20596-60<br />
verlag@buchhandlung-<br />
walther-koenig.de<br />
Die deutsche Bibliothek<br />
verzeichnet diese Publikation<br />
in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische<br />
Daten sind über<br />
http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
Vertrieb<br />
Schweiz<br />
Buch 2000<br />
c/o AVA<br />
Verlagsauslieferungen AG<br />
Centralweg 16<br />
CH-8910 Affoltern a.A.<br />
Tel +41-44/762 42 00<br />
Fax +41-44/762 42 10<br />
a.koll@ava.ch<br />
UK & Eire<br />
Cornerhouse Publications<br />
70 Oxford Street<br />
GB-Manchester M1 5NH<br />
Tel +44-161/200 15 03<br />
Fax +44-161/200 15 04<br />
publications@cornerhouse.org<br />
Außerhalb Europas<br />
D.A.P./Distributed Art<br />
Publishers, Inc.<br />
155 6th Avenue, 2nd Floor<br />
New York, NY 10013<br />
Tel +1-212/627-1999<br />
Fax +1-212/627-9484<br />
www.artbook.com<br />
Gedruckt in Österreich<br />
ISBN 978-3-86560-845-1<br />
Copyrights<br />
© Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Köln<br />
und Kunsthaus Graz<br />
© für die abgebildeten<br />
Werke bei den Künstlerinnen<br />
und Künstlern oder deren<br />
Rechtsnachfolgern<br />
© für die gedruckten Texte bei<br />
den Autorinnen und Autoren,<br />
Übersetzerinnen und Übersetzern<br />
oder deren Rechtsnachfolgern<br />
© für die Fotografien bei den<br />
Fotografinnen und Fotografen<br />
oder deren Rechtsnachfolgern:<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
und Giorgio Persano, Turin:<br />
S. 15–17, 19–22, 25–27<br />
Achim Kukulies, Düsseldorf:<br />
S. 30/31, 40/41, 44/45, 48–53<br />
Martin Url/Sammlung Deutsche<br />
Bank: S. 32/33<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>/<br />
Nicolas Lackner: S. 47<br />
Courtesy Zeno X Gallery,<br />
Antwerpen: S. 34–39, 43<br />
Cover<br />
Kris Martin, Mandi VIII, 2006<br />
Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf<br />
Wir haben uns bemüht, sämtliche<br />
Rechtsinhaberinnen und -inhaber<br />
ausfindig zu machen.<br />
Sollte es uns in Einzelfällen nicht<br />
gelungen sein, so bitten wir<br />
diese sich beim Verlag zu melden.
Quellenverzeichnis<br />
und Übersetzungen<br />
Peter Pakesch<br />
Vorwort<br />
Adam Budak<br />
Die Zerbrechlichkeit der<br />
menschlichen Angelegenheiten:<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>.<br />
Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
(übersetzt von Otmar Lichtenwörther)<br />
Sophie Loidolt<br />
Empathie und Emanzipation.<br />
„Verstehendes Herz“, prekäre Zeit,<br />
erweitertes Urteilen – eine<br />
Annäherung mit Hannah Arendt<br />
Hannah Arendt<br />
Vita activa oder Vom tätigen Leben<br />
Erstes Kapitel: Die menschliche<br />
Bedingtheit (Auszug),<br />
Fünftes Kapitel: Das Handeln<br />
Wiederabdruck<br />
© 1967 Piper Verlag GmbH, München<br />
Jeremy Rifkin<br />
Die empathische Zivilisation. Wege<br />
zu einem globalen Bewusstsein<br />
Teil I: Homo empathicus, Kapitel 2:<br />
Der neue Blick auf die menschliche<br />
Natur<br />
Wiederabdruck aus: Jeremy Rifkin,<br />
Die empathische Zivilisation. Wege<br />
zu einem globalen Bewusstsein,<br />
Frankfurt/New York: Campus Verlag<br />
2010, S. 46-68.<br />
(übersetzt von Ulrike Bischoff,<br />
Waltraud Götting und Xenia Osthelder)<br />
Judith Butler<br />
Gefährdetes Leben. Politische Essays<br />
5: Gefährdetes Leben<br />
Wiederabdruck<br />
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp<br />
Verlag, Frankfurt am Main 2005.<br />
(übersetzt von Karin Wördemann)<br />
Kunsthaus Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Peter Pakesch, Intendant<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>,<br />
Leiter Kunsthaus Graz<br />
Gabriele Hofbauer,<br />
Assistentin Intendanz<br />
Katrin Bucher Trantow, Kuratorin<br />
Adam Budak, Kurator<br />
Katia Schurl, Johanna Ortner,<br />
Kuratorische Assistenz<br />
Elisabeth Ganser, Registrarin<br />
Werner Urdl, Assistenz<br />
Registratur<br />
Magdalena Reininger,<br />
Fachpraktikantin Registratur<br />
Paul-Bernhard Eipper,<br />
Restaurator<br />
Monika Holzer-Kernbichler,<br />
Astrid Bernhard, Kunst-<br />
und Architekturvermittlung<br />
Eva Ofner, Anke Leitner,<br />
Personalkoordination Aufsicht/<br />
Kunstvermittlung<br />
Markus Hall, Silvia Münzer,<br />
Maria Ogawa, Eva Strunz,<br />
Information<br />
Teresa Ruff, Office Management<br />
Andreas Schnitzler,<br />
Leiter Außenbeziehungen<br />
Sabine Bergmann,<br />
Christoph Pelzl, Presse<br />
Elisabeth Weixler,<br />
Marketing<br />
Astrid Rosmann,<br />
Bettina Kindermann,<br />
Marketing Assistenz,<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Barbara Ertl-Leitgeb,<br />
Web-Betreuung<br />
Jörg Eipper Kaiser,<br />
Texter und Lektor<br />
Gabriela Filzwieser,<br />
Veranstaltungsmanagement<br />
Sarah Spörk, Assistenz<br />
Veranstaltungsmanagement<br />
Helga Bauer,<br />
Tourismusbeauftragte<br />
Leo Kreisel-Strauß,<br />
Michael Posch, Chiara Pucher,<br />
Grafik<br />
Bernd Dörling, Leitung IT<br />
Andreas Graf,<br />
Norbert Körbler, Georg Pachler,<br />
Stefan Zugaj, IT<br />
Erik Ernst, Technischer Leiter<br />
Irmgard Knechtl, Assistenz<br />
Technische Leitung<br />
und Zentralwerkstatt<br />
Robert Bodlos,<br />
Leitung Zentralwerkstatt<br />
Erich Aellinger, Walter Ertl,<br />
Markus Ettinger, Bernd<br />
Klinger, Klaus Riegler, Peter<br />
Rumpf, Michael Saupper,<br />
Stefan Savič, Peter<br />
Semlitsch, Andreas Zerawa,<br />
Zentralwerkstatt und<br />
technische Abteilung
168 — 169<br />
Kunsthaus Graz dankt<br />
Sophie Loidolt<br />
Giorgio Persano, Turin:<br />
Celeste Meoli<br />
Sies + Höke, Düsseldorf:<br />
Nina Höke, Alexander Sies,<br />
Diana Hunnewinkel,<br />
Julia Köhler, Nuria Molina,<br />
Johanne Tonger-Erk<br />
Sammlung Deutsche Bank:<br />
Friedhelm Hütte,<br />
Claudia Schicktanz,<br />
Carmen Schäfer<br />
David Zwirner, New York<br />
Neue Galerie Graz am<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>:<br />
Christa Steinle,<br />
Monika Binder-Krieglstein,<br />
Gudrun Danzer,<br />
Günther Holler-Schuster<br />
Raf Simons<br />
Raf Simons Studio:<br />
Bianca Luzi<br />
Zeno X Gallery, Antwerpen:<br />
Frank Demaegd,<br />
Hanneke Skerath<br />
The David Roberts Art<br />
Foundation: Vincent Honoré,<br />
Sandra Pusterhofer<br />
Ilse Joliet<br />
Galerie Fons Welters:<br />
Fons Welters,<br />
Rosa Juno Streekstra<br />
Wilkinson Gallery:<br />
Amanda Wilkinson,<br />
Dan Coopey, Chris Jacob<br />
Stedelijk Museum:<br />
Jelle Bouwhuis<br />
Francesca Kaufmann,<br />
Mailand: Francesca Kaufmann,<br />
Julia Koropoulos,<br />
Lucia Mannella<br />
Peter Kilchmann Galerie,<br />
Zürich<br />
Peter Blum Gallery,<br />
New York<br />
Kunsthaus Zürich:<br />
Franziska Lentzsch,<br />
Mirjam Varadinis<br />
KIZ RoyalKino:<br />
Nikos Grigoriadis<br />
Österreichisches Filmmuseum:<br />
Andrea Glawogger,<br />
Franz Kaser-Kayer<br />
Frank Bode, Eoghan McTigue<br />
Isabella Bortolozzi Galerie,<br />
Berlin<br />
Witte de With, Rotterdam:<br />
Anne-Claire Schmitz,<br />
Paul van Gennip<br />
Grazer Kunstverein:<br />
Søren Grammel<br />
Mondriaan Foundation,<br />
Amsterdam:<br />
Gitte Luiten, Coby Reitsma,<br />
Marijn Veenhuijzen<br />
Unser besonderer Dank<br />
gilt den Künstlerinnen<br />
und Künstlern der<br />
Ausstellung sowie allen<br />
privaten Leihgeberinnen<br />
und Leihgebern, die<br />
namentlich nicht genannt<br />
werden möchten.
170 — 171<br />
Mit Unterstützung von<br />
Stadt Graz, Land Steiermark, A1
172 — 172<br />
Kunsthaus Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Peter Pakesch, Intendant<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>,<br />
Leiter Kunsthaus Graz<br />
Gabriele Hofbauer,<br />
Assistentin Intendanz<br />
Katrin Bucher Trantow, Kuratorin<br />
Adam Budak, Kurator<br />
Katia Schurl, Johanna Ortner,<br />
Kuratorische Assistenz<br />
Elisabeth Ganser, Registrarin<br />
Werner Urdl, Assistenz<br />
Registratur<br />
Magdalena Reininger,<br />
Fachpraktikantin Registratur<br />
Paul-Bernhard Eipper,<br />
Restaurator<br />
Monika Holzer-Kernbichler,<br />
Astrid Bernhard, Kunst-<br />
und Architekturvermittlung<br />
Eva Ofner, Anke Leitner,<br />
Personalkoordination Aufsicht/<br />
Kunstvermittlung<br />
Markus Hall, Silvia Münzer,<br />
Maria Ogawa, Eva Strunz,<br />
Information<br />
Teresa Ruff, Office Management<br />
Andreas Schnitzler,<br />
Leiter Außenbeziehungen<br />
Sabine Bergmann,<br />
Christoph Pelzl, Presse<br />
Elisabeth Weixler,<br />
Marketing<br />
Astrid Rosmann,<br />
Bettina Kindermann,<br />
Marketing Assistenz,<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Barbara Ertl-Leitgeb,<br />
Web-Betreuung<br />
Jörg Eipper Kaiser,<br />
Texter und Lektor<br />
Gabriela Filzwieser,<br />
Veranstaltungsmanagement<br />
Sarah Spörk, Assistenz<br />
Veranstaltungsmanagement<br />
Helga Bauer,<br />
Tourismusbeauftragte<br />
Leo Kreisel-Strauß,<br />
Michael Posch, Chiara Pucher,<br />
Grafik<br />
Bernd Dörling, Leitung IT<br />
Andreas Graf,<br />
Norbert Körbler, Georg Pachler,<br />
Stefan Zugaj, IT<br />
Erik Ernst, Technischer Leiter<br />
Irmgard Knechtl, Assistenz<br />
Technische Leitung<br />
und Zentralwerkstatt<br />
Robert Bodlos,<br />
Leitung Zentralwerkstatt<br />
Erich Aellinger, Walter Ertl,<br />
Markus Ettinger, Bernd<br />
Klinger, Klaus Riegler, Peter<br />
Rumpf, Michael Saupper,<br />
Stefan Savič, Peter<br />
Semlitsch, Andreas Zerawa,<br />
Zentralwerkstatt und<br />
technische Abteilung
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Empathy and<br />
Emancipation in<br />
Precarious Times<br />
This catalogue is<br />
published on<br />
the occasion of<br />
the exhibition<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Empathy and<br />
Emancipation in<br />
Precarious Times<br />
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong><br />
<strong>Joanneum</strong><br />
June 12 –<br />
September 12, 2010<br />
Curator<br />
Adam Budak<br />
Editors<br />
Peter Pakesch,<br />
Adam Budak<br />
Published by<br />
Verlag der<br />
Buchhandlung<br />
Walther König,<br />
Cologne
174 — 175<br />
Contents
2<br />
Illustrations<br />
176<br />
Foreword<br />
Peter Pakesch<br />
178<br />
The Frailty of<br />
<strong>Human</strong> Affairs<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>,<br />
or on Empathy<br />
and Emancipation<br />
in Precarious Times<br />
Adam Budak<br />
198<br />
Empathy and<br />
Emancipation in<br />
Precarious Times<br />
The understanding<br />
heart and expanded<br />
judgment, in the eyes<br />
of Hannah Arendt<br />
Sophie Loidolt<br />
206<br />
The <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong><br />
Hannah Arendt<br />
218<br />
The Empathic<br />
Civilization<br />
The Race to Global<br />
Consciousness<br />
in a World in Crisis<br />
Jeremy Rifkin<br />
238<br />
Precarious Life<br />
The Powers<br />
of Mourning<br />
and Violence<br />
Judith Butler<br />
253<br />
Index<br />
254<br />
Biographies<br />
264<br />
Imprint
Foreword<br />
Peter Pakesch
The course of events in recent years has robbed us of many certainties. The global<br />
population is growing at breakneck speed, developing a highly heterogeneous and<br />
contradictory dynamic that tests the very foundations of our existence both materially<br />
and intellectually. The issues we are confronted with today proliferate not just because<br />
of differing dynamics. They multiply above all because of an unheard-of global<br />
awareness of the course of events and circumstances, on a scale that has never<br />
existed before, in terms of both general context and detail – and with all the differences<br />
that could hardly be more glaring. That gives rise to a need for certainties, a<br />
demand for strategies to help us understand the changes better and respond to them<br />
with new dimensions of action. That is why, at the <strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>, we<br />
have embarked on a series of very different exhibitions in a search for perspectives on<br />
this current state of affairs. The heart of these is the present project on the <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong>. Empathy and Emancipation in Precarious Times, as an aspect of the core<br />
theme Conditio <strong>Human</strong>a. The Way We Live.
The Frailty of<br />
<strong>Human</strong> Affairs<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>,<br />
or on Empathy<br />
and Emancipation<br />
in Precarious Times<br />
Adam Budak
1 Gilles Deleuze, The Logic of<br />
Sense, New York: Columbia University<br />
Press, 1990, p. 73.<br />
2 Judith Butler, Precarious Life.<br />
The Powers of Mourning and<br />
Violence, London, New York: Verso,<br />
2004, p. 49.<br />
3 The Invisible Committee, The<br />
Coming Insurrection, Semiotext(e)<br />
Intervention Series 1, Los Angeles:<br />
Semiotext(e) 2009, p. 16.<br />
4 Hannah Arendt, The <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong>, Chicago: University of<br />
Chicago Press, 1998.<br />
5 Jeremy Rifkin, The Empathic<br />
Civilization: The Race to Global<br />
Consciousness in a World in Crisis,<br />
New York: Tarcher 2009.<br />
6 Butler, Precarious Life, p. 49.<br />
7 Brian Holmes, Escape the Overcode.<br />
Activist Art in the Control<br />
Society, Van Abbemuseum / WHW<br />
2009, p. 195.<br />
8 Ibid., p. 401.<br />
what is bureaucratic in these fantastic machines which are peoples and poems? it<br />
suffices that we dissipate ourselves a little, that we be able to be at the surface,<br />
that we stretch our skin like a drum, in order that the ‘great politics’ begin. an empty<br />
square for neither man nor god; singularities which are neither general nor individual,<br />
neither personal nor universal. all of this is traversed by circulations, echoes, and<br />
events which produce more sense, more freedom, and more strength than man has<br />
ever dreamed of, or God ever conceived. today’s task is to make the empty square<br />
circulate and to make pre-individual and nonpersonal singularities speak - in short,<br />
to produce sense.1<br />
For if I am confounded by you, then you are already of me, and I am nowhere without<br />
you. I cannot muster the ‘we’ except by finding the way in which I am tied to ‘you,’ by<br />
trying to translate but finding that my own language must break up and yield if I am<br />
to know you. You are what I gain through this disorientation and loss. This is how the<br />
human comes into being, again and again, as that which we have yet to know.2<br />
When all is said and done, it’s with an entire anthropology that we are at war.<br />
With the very idea of man.3<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Empathy and Emancipation in Precarious Times offers a journey into<br />
human ethics where the structure of address, responsibility and moral agency are at<br />
stake. “Who are we?” asks Hannah Arendt in her <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong> where the actualization<br />
of “who” refers to processes of thinking, willing and judging.4 “What are we made<br />
of?” asks Jeremy Rifkin while introducing Homo Empathicus, the main protagonist of<br />
his “new view of human nature.”5 “What counts as human? What allows us to encounter<br />
one another?” investigates Judith Butler, concluding her essay on contemporary<br />
violence, grief and mourning.6 This exhibition is the portrait of a precarious world of<br />
instability and an uncertain future, where social vulnerability is challenged and the<br />
frailty of human affairs is exposed. What is the relationship between emancipation<br />
and empathy? How do they shape the human condition? Between emancipation and<br />
despair, self-empowerment and a rapidly growing rupture of social Gestalt, between<br />
communal desire and individualistic mentality, this exhibition collects models of contemporary<br />
realities and sites of conflict. Faced by the unpredictability of the future<br />
and confronted by the suspension of previously available patterns, it asks for a chance<br />
of hope and searches for the possibilities of the heroic in an age of corrupted values<br />
devoid of a historical reference. “How does the world come together? How does a<br />
world fall apart?” thus Brian Holmes rephrases the essential “to be or not to be?” of<br />
our times and indicates the pathways for grassroots intellectual action in the contemporary<br />
world-system as processes of “locating yourself against the horizon of disaster,<br />
then finding the modes and scales of concrete intervention into lived experience.”7<br />
According to a social theorist, “we are at the threshold of social change, brought on by<br />
a failed economic model, which has also led to melting icecaps and blazing war.”8<br />
More than ever before, multiple questions of alarming urgency appear and then statements<br />
of both despair and clarity are formed, manifestos in dispatch, articulations<br />
of a society and humanities, facing the loss of moral authority and a sense of value.<br />
Who speaks for humanities now? In what voice and with what intention? What are the<br />
important obligations during our times? What is morally binding? We are waiting. We<br />
are pending. The precarious times we inhabit are fragile and ephemeral moments of the<br />
transitory. Endurance has become a rare thing. Analyzing “precarity,” Nicholas Bourriaud<br />
recalls Zygmunt Bauman’s definition of our period as one of “liquid modernity,”
180 — 181<br />
Adam Budak<br />
9 Nicolas Bourriaud, “Precarious<br />
Constructions. Answers to Jacques<br />
Rancière on Art and Politics,” in<br />
open Cahier on Art and the Public<br />
Domain, NAi Publishers SKOR<br />
2009/No. 17, p. 23.<br />
10 Ibid., p. 32.<br />
11 The Invisible Committee, The<br />
Coming Insurrection, p. 9.<br />
12 Ibid., p. 96.<br />
13 Ibid., p. 15.<br />
14 Ibid., p. 19.<br />
15 Arendt, The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>,<br />
p. 7.<br />
16 Ibid., p. 178.<br />
17 Ibid., p. 180.<br />
18 Ibid., p. 182.<br />
which constitutes a society of generalized disponibility, driven “by the horror of expiry,”<br />
where nothing is more decried than “the steadfastness, stickiness, viscosity of things<br />
inanimate and animate alike.”9 “Precarious is etymologically,” as Bourriaud reminds us,<br />
“‘that which only exists thanks to a reversible authorization.’ The precaria was the field<br />
cultivated for a set period of time, independently of the laws that govern property. An<br />
object is said to be precarious if it has no definite status and an uncertain future or<br />
final destiny: it is held, in abeyance, waiting, surrounded by irresolution. It occupies a<br />
transitory territory.”10<br />
We are waiting. We are pending, in anticipation. A political pamphlet, “The Coming<br />
Insurrection,” authored by an anonymous collective, the Invisible Committee states<br />
harshly: “Everyone agrees. It’s about to explode.”11 We keep on waiting however as they<br />
claim: “It’s useless to wait – for a breakthrough, for the revolution, the nuclear apocalypse<br />
or a social movement. To go on waiting is madness. The catastrophe is not coming,<br />
it is there. We are already situated within the collapse of civilization. It is within<br />
this reality that we must choose sides.”12 The rhetoric of crisis and the rhetoric of power<br />
overlap; the sharing of sensibility and the elaboration of sharing is an urge: the uncovering<br />
of what is common and the building of a force. Empathy acts as a measure of the<br />
intensity of sharing.13 Still another question is being articulated, as odd as obvious<br />
and vulnerable: “How do we find each other?”14 In the heart of the riots in Greece and<br />
France, while praying in the shadow of a temple, a call for insurrection is uttered.<br />
The artists invited to the exhibition <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Empathy and Emancipation<br />
in Precarious Times map the critical space of the human condition, concentrating<br />
in particular on Hannah Arendt’s action, one of the fundamental human activities<br />
that, together with labor and work, compose vita activa and correspond to the basic<br />
conditions under which, according to Arendt, life on earth has been given to man.<br />
The human condition of labor is life itself whereas work provides an “artificial” world<br />
of things, distinctly different from all natural surroundings and its human condition<br />
is worldliness. Action, as Arendt indicates, “is the only activity that goes on directly<br />
between men without the intermediary of things or matter and as such, it corresponds<br />
to the human condition of plurality, to the fact that men, not Man, live on earth and<br />
inhabit the world.”15 Action is linked to the principle of beginning as “to act, in its most<br />
general sense, means to take an initiative, to begin (…), to set something in motion.”<br />
Action too relates to speech “because the primordial and specifically human act must<br />
at the same time contain the answer to the question asked for every newcomer: ‘who<br />
are you?’16 (…) This revelatory quality of speech and action comes to the fore where<br />
people are with others and neither for nor against them – that is, in sheer human<br />
togetherness.”17 A call for “who” and “with” lies at the foundation of Hannah Arendt’s<br />
web of human relationships; in-betweeness and togetherness are their most essential<br />
platforms of operation: “action and speech go on between men, as they are directed<br />
toward them, and they retain their agent-revealing capacity even if their content is<br />
exclusively ‘objective,’ concerned with the matters of the world of things in which men<br />
move, which physically lies between them and out of which arise their specific, objective,<br />
worldly interests. These interests constitute, in the word’s most literal significance,<br />
something which inter-est, which lies between people and therefore can relate<br />
and bind them together. Most action and speech is concerned with this in-between,<br />
which varies with each group of people, so that most words and deeds are about some<br />
worldly objective reality in addition to being a disclosure of the acting and speaking<br />
agent.”18 Action as an agent of the frailty of human affairs is a communal affair – as<br />
distinguished from fabrication, it is never possible in isolation. For Arendt, to be isolated<br />
is to be deprived of the capacity to act.19
19 Ibid., p. 188.<br />
20 Julia Kristeva,<br />
Hannah Arendt, New York:<br />
Columbia University Press,<br />
2001, p. 174.<br />
21 Ibid., p. 173.<br />
22 Rifkin, The Empathic<br />
Civilization, p. 3.<br />
23 Ibid., p. 43.<br />
24 Ibid., p. 24.<br />
25 Ibid., pp. 24-26.<br />
26 Ibid., p. 148.<br />
27 Ibid., p. 153.<br />
28 Ibid., p. 161.<br />
29 Ibid., p. 168.<br />
30 Ibid., p. 173.<br />
Julia Kristeva praises Arendt for the actualization of “who” while writing about the<br />
philosopher’s acts of thinking, willing and judging that guide her through the space of<br />
the question “who are we?” as opposed to “what are we?” Disclosed only in the action<br />
to which it is attached, the “who” appears as a dynamic actuality, an energeia that<br />
transcends its own doings and activities and that is opposed to any effort towards<br />
reification or objectification. As such, it is a “source” of creativity, though, as Kristeva<br />
observes, the “one that remains outside the actual work process and that is “independent<br />
of what (artists) may achieve.”20 Kristeva too diagnoses a troublesome relationship<br />
of the “who” towards it-self: “who” is the separate being, the Greek daimon,<br />
that “appears so clearly and unmistakably to others” but that “remins hidden from the<br />
person himself.”.The “who” is a hidden self, but it is hidden more from the person than<br />
from the memory of other people. The “who” as “someone’s life” thus appears to be<br />
essential, but only in the narrow sense of the word: as an essence that is actualized<br />
within the time of the plurality specific to other people.21<br />
Complementing Hannah Arendt’s “who are we?” with “what are we made of,” economist<br />
and activist, Jeremy Rifkin announces an epic shift into a “climax” global economy and<br />
a fundamental respositioning of human life on the planet. According to him, in the<br />
light of the Third Industrial Revolution, in a new era of “distributed capitalism” and at<br />
the beginning of biosphere consciousness, the Age of Reason is being eclipsed by the<br />
Age of Empathy. Rifkin opens his book, Empathic Civilization with a worrying question:<br />
“Can we reach global empathy in time to avoid the collapse of civilization and save the<br />
Earth?”22 The discovery of Homo empathicus is crucial for Rifkin’s radical new view<br />
of human nature that has been slowly emerging and gaining momentum, with revolutionary<br />
implications for the way we understand and organize our economic, social<br />
and environmental relations in the centuries to come.23 Brought on by the awakening<br />
sense of selfhood, empathy acts as an engine of civilization understood as “the detribalization<br />
of blood ties and the resocialization of distinct individuals based on associational<br />
ties.”24 Rifkin assigns the empathic extension the role of a psychological mechanism<br />
that makes the conversion and transition possible: “When we say to civilize, we<br />
mean to empathize (…) The underlying dialectic of human history is the continuous<br />
feedback loop between expanding empathy and increasing entropy.”25 Such civilization<br />
is built of a society of communal identity and consciousness (“there is no simple<br />
autonomous ‘I,’ but only a unique constellation of numerous ‘we’”26) developed as a<br />
unique experience with countless others, considering empathy – at the heart of the<br />
human story – as a generator of a great transformation from “I think, therefore I am” to<br />
“I participate, therefore I am.”27 Woven of awe, trust and transcendence, the empathic<br />
consciousness is a delicate balancing act, which requires both intimate engagement<br />
and a detachment. It is a soul of democracy28, as Rifkin emphasizes, a celebration of<br />
life29, a fragile construct, which depends upon “a porous boundary between I and thou<br />
that allows the identity of two beings to mingle in a shared mental space.”30 It appears<br />
as an all encompassing experience, capable of negotiating grand narratives of humanity<br />
towards a new and better, unifying sense of life: “By reimagining faith and reason<br />
as intimate aspects of empathic consciousness, we create a new historical synthesis<br />
that incorporates many of the most powerful and compelling features of the Age of<br />
Faith and the Age of Reason, while leaving behind the disembodied story lines that<br />
shake the celebration out of life.”31 However, as euphoric as this vision may sound, the<br />
introductory alarming question remains open: “Can we reach global empathy in time to<br />
avoid the collapse of civilization and save the Earth?”<br />
Writing about the post-emancipatory concept of emancipation, Boris Buden criticizes<br />
the contemporary experience of engagement, mapping out the contemporary
182 — 183<br />
Adam Budak<br />
31 Ibid., p. 173.<br />
32 Boris Buden, “Forever Young.<br />
Negri’s Multitude as Post-Emancipatory<br />
Concept of Emancipation,”<br />
available at:<br />
http://www.republicart.net/disc/<br />
empire/buden02_en.htm<br />
33 Ernesto Laclau,<br />
Emancipation(s), London,<br />
New York: Verso, 2007, p. 18.<br />
34 Boris Buden, “Forever Young.<br />
Negri’s Multitude as Post-Emancipatory<br />
Concept of Emancipation,”<br />
op. cit.<br />
impossibility of identification with the act of engagement: “We are still engaged, we<br />
still raise our voices where we find it appropriate or just, we articulate our protests<br />
and our solidarity, but somehow we only do it half-heartedly. We do it with an irritating<br />
feeling of discomfort, that we can never seem to get rid of. Why is that?”32<br />
According to Buden, we can no longer clearly distinguish our emancipatory interest<br />
from other interests and distinctly separate ourselves from the political positions and<br />
opinions that we do not share. Investigating the logic of emancipation, Ernesto Laclau<br />
claims that we no longer live in an age of emancipation. The philosopher speculates:<br />
“We are today coming to terms with our own finitude and with the political possibilities<br />
that it opens.This is the point from which the potentially liberatory discourses<br />
of our postmodern age have to start. We can perhaps say that today we are at the<br />
end of emancipation and at the beginning of freedom.”33 The end of the Cold War, the<br />
explosion of new ethnic and national identities, the social fragmentation under late<br />
capitalism, and the collapse of universal certainties in philosophy and social and<br />
historical thought had, according to Laclau, changed our expectations of emancipation<br />
and altered its classical notion as formulated since the Enlightenment, leading<br />
towards the failure or rather disappearance of emancipation from the political horizon<br />
of our era. Laclau examines the internal contradictions of the notion of “emancipation”<br />
as it emerged from the mainstream of modernity. Emancipation means at one and the<br />
same time radical foundation and radical exclusion; that is, it postulates, at the same<br />
time, both a ground of the social and its impossibility. The production of an emancipatory<br />
discourse depends too upon the relation between universalism and particularism,<br />
which is inherent in it. As Laclau observes, “Emancipation is strictly linked to the<br />
destiny of the universal (…) without the emergence of the universal within the historical<br />
terrain, emancipation becomes impossible.” Searching for the possibilities of acting<br />
politically “beyond emancipation”, Laclau distinguishes between two dimensions of<br />
emancipation: one radical (grounded in itself, excluding that which hinders its completion<br />
as a radical otherness) and the other non-radical (grounded in common with its<br />
Other, influencing all spheres of society), stating the failure of both as they became<br />
indistinguishable while facing the fact that the society is no longer transparent to<br />
itself and that the ground of this society can no longer be imagined, followed too by<br />
the disappearance of the universal from the historical terrain. Buden, after Laclau,<br />
diagnoses the current crisis of emancipation, pointing out the society’s troublesome<br />
relationship to engagement and empathy and the confusion around sciety’s ambiguous<br />
status: “Today, instead of the emancipation, we can only speak of a plurality of<br />
emancipations. The fact that we can no longer clearly distinguish and separate them<br />
from one another, is due specifically to their fundamental opacity. In fact, we can no<br />
longer find any unified ground, to which all emancipatory struggles could be reduced.<br />
Without this grounding - without the ground of society being postulated - there is no<br />
exclusion, no outside anymore. The societies in which we live, can no longer be imagined<br />
as radically separable, and we can draw no clear line of division, through which<br />
our emancipatory interest excludes something in society that should be excluded. Nor<br />
can we identify with a subject that universally represents the ground of society. This<br />
is the reason for the discomfort that constantly accompanies our current emancipatory<br />
engagement.”34<br />
Yet, Hannah Arendt’s sensing of emancipation as a faculty of thinking, acting (with<br />
each other), and judging seems to correspond closer with still another take at defining<br />
emancipation, the one elaborated by Jacques Rancière. In his The Emancipated<br />
Spectator, Rancière points out: “Emancipation begins when we challenge the opposition<br />
between viewing and acting; when we understand that the self-evident facts that<br />
structure the relations between saying, seeing and doing themselves belong to the<br />
structure of domination and subjection. It begins when we understand that viewing is
35 Jacques Rancière,<br />
The Emancipated Spectator,<br />
London, New York: Verso 2009,<br />
p. 13.<br />
36 Ibid., p. 22.<br />
37 Butler, Precarious Life, p. 20.<br />
38 Ibid., p. 22.<br />
39 Ibid., p. 29.<br />
40 Ibid., p. 43.<br />
also an action that confirms or transforms this distribution of positions. The spectator<br />
also acts, like the pupil or scholar. She observes, selects, compares, interprets.”35 Rancière<br />
legitimates his own reading of emancipation by returning to the original meaning<br />
of the word “emancipation”: emergence from a state of minority. For the French philosopher,<br />
emancipation plays an important social role of a particular ethical charge, which<br />
influences the society’s development and conditions its progress. It is “a process rather<br />
than a goal, a break in the present rather than an ideal put in the future.” Rancière<br />
distances himself from the idea that emancipation strives for any utopia that can be<br />
reached, that there is an end to the (political) struggle for recognition. Emancipation<br />
is understood as the call for equality, and as such it is processed over and over and<br />
after every victory for a particular group, when the dissensus becomes consensus, and<br />
a new “partage du sensible” is established and a different group is shared out, made<br />
invisible, mute, unimportant. In Ranciere’s grammar of spectatorship, emancipation<br />
means the blurring of the opposition between they who look and they who act, they<br />
who are individuals and they who are members of a collective body. An emancipated<br />
community is a community of narrators and translators 36, the author of The Emancipated<br />
Spectator claims, where the very emancipation is perceived as the process of<br />
verification of the equality of intelligence.<br />
An urgency of action, a challenge of empathy as well as a possibility of emancipation<br />
are crucial issues for Judith Butler’s politics of precarious life. What are the dimensions<br />
of human vulnerability? How does the vulnerability shape the human condtion at<br />
large? The philosopher wonders and reflects, “The question that preoccupies me in the<br />
light of recent global violence is, What counts as human? Whose lives count as lives?<br />
And, finally, What makes for a grievable life?”37. Butler’s is a dictionary of urgent ethical<br />
questions, articulated by vulnerable beings, exposed to violence and experiencing<br />
mourning, grief and loss: “(…) something takes hold of you: where does it come from?<br />
What sense does it make? What claims us at such moments, such when we are not the<br />
masters of ourselves? To what are we tied? And by what are we seized? (…) Who ‘am’<br />
I, without you?”38 The need to understand violence lies at the core of Butler’s anthology<br />
of essays, entitled Precarious Life. In-between mourning, fear, anxiety and range,<br />
“violence is surely a touch of the worst order, a way a primary human vulnerability to<br />
other humans is exposed in its most terrifying way, a way in which we are given over,<br />
without control, to the will of another, a way in which life itself can be expunged by<br />
the willful action of another.” Vulnerability is a fragile and precious fabric of humanity,<br />
susceptible to damage, threatened and unprotected, put at risk, a vulnerability to a<br />
sudden address from elsewhere that we cannot preempt.39 How to negotiate it? What<br />
are the options and long-term strategies? “There is a possibility of appearing impermeable,<br />
of repudiating vulnerability itself,” Butler speculates, “by insisiting on a ‘common’<br />
corporeal vulnerability, I may seem to be positing a new basis for humanism (…) a<br />
vulnerability must be perceived and recognized in order to come into play in an ethical<br />
encounter, and there is no guarantee that it will happen. Not only is there always the<br />
possibility that a vulnerability will not be recognized and that it will be constituted as<br />
the ‘unrecognizable,’ but when a vulnerability is recognized, that recognition has the<br />
power to change the meaning and structure of the vulnerability itself. In this sense,<br />
if vulnerability is one precondition for humanization, and humanization takes place<br />
differently through variable norms of recognition, then it follows that vulnerability is<br />
fundamentally dependent on existing norms of recognition if it is to be attributed to<br />
any human subject.”40 Still new pressing questions appear, piling up, taking charge,<br />
and provoking responsibility: how do we deal with vulnerability? How do we protect<br />
ourselves in a state of alarm, emergency and a collective resistance? Butler adds: “do<br />
we want to say that it is our status as ‘subject’ that binds us all together even though,
184 — 185<br />
Adam Budak<br />
Greeks in a Chokehold,<br />
front page of the<br />
Frankfurter Rundschau,<br />
March 2, 2010<br />
41 Ibid., pp. 48-49.<br />
42 Ibid., p. 33.<br />
43 Ibid., p. 129.<br />
44 Ibid., p. 130.<br />
45 Ibid., p. 131.<br />
for many of us, the ‘subject’ is multiple or fractured? (…) What allows us to encounter<br />
one another?41 Whose lives are real? How might reality be remade?”42<br />
Elaborating the ethical demands and examining the powers of murning and violence,<br />
Judith Butler calls for the consideration of the structure of address itself. Such is,<br />
according to the philosopher, the most important obligation during our times – an<br />
ability to respond to the address, perceived as “a comportment toward the Other only<br />
after the Other has made a demand upon me, accused me of a failing, or asked me to<br />
assume a responsibility.”43 The mode of address too is crucial for understanding how<br />
moral authority is introduced and sustained. For Butler, addressing someone when we<br />
speak also means to enter into a sort of coexistence, thus something about our existence<br />
proves precarious when that address fails. The structure of address is directly<br />
linked to how moral authority operates and is being introduced: “More emphatically,<br />
however, what binds us morally has to do with how we are addressed by others in ways<br />
that we cannot avert or avoid; this impingement by the other’s address constitutes us<br />
first and foremost against our will or, perhaps put more appropriately, prior to the formation<br />
of our will.”44 Butler considers “face,” the notion introduced by Emmanuel Levinas,<br />
in order to explain how it is that others make moral claims upon us, address moral<br />
demands to us, ones that we do not ask for, ones that we are not free to refuse.45 In<br />
her view, the approach to the face is the most basic mode of responsibility. “To expose<br />
myself to the vulnerability of the face,” such seems to be the most courageous challenge.<br />
The face as the extreme precariousness of the other; the face as a situation<br />
of a discourse (“face and discourse are tied”); the face as a condition of humanization46;<br />
the face as a representation of that for which no identification is possible, an<br />
accomplishment of dehumanization and a condition for violence47: it is exactly here, at<br />
the face-stage, where the exhibition <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Empathy and Emancipation in<br />
Precarious Times begins (gently) unfolding.<br />
The art works gathered in the exhibition form a collection of allegories of the turbulent<br />
times we are living through. In this study of human portraiture, the face appears as a<br />
landscape of humanity; it is the mirror-surface where the vulnerability and frailty of<br />
human affairs are being reflected; an agent of an injured identity, exposed to displacement<br />
and dispossession.<br />
The Albanian artist, Adrian Paci’s film Per Speculum (2006) borrows its title phrase<br />
from St. Paul’s Letter to the Corinthians: “Videmus nunc per speculum in aenigmate:<br />
tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut<br />
et cognitus sum” (For now we see through a glass darkly; but then face to face; now<br />
I know in part; but then shall I know even as also I am known) (13:12, King James<br />
Version). The film’s opening image, picturing a group of children, portrayed in an idyllic,<br />
almost biblical landscape, staring directly into the camera’s eye in a strangely<br />
disquieting, confrontational way, soon is revealed as being a mere reflection in a<br />
gigantic mirror, positioned in front of them as to create a perfect illusion of the<br />
other, heterotopic space, close but uncannily distant. Children’s faces are emotionless,<br />
though their gazes bear a charge of accusation, a genuine sense of wickedness<br />
and lost innocence. Paci’s scene may be perceived as an iconic moment, indicating,<br />
in accordance with the passage from St. Paul, that any physical representation or<br />
reflection is always inaccurate and distorted; approached differently, it may signify<br />
a collapse of any identification efforts, referring in a more or less literal way to the<br />
failure of the Lacanian mirror stage, a crucial moment in identity formation where the<br />
fragmented image bececomes a recognizable coherent entity, marking child’s entry<br />
into the world. Per Speculum’s narrative progresses slowly although radically, as soon
186 — 187<br />
Adam Budak<br />
46 Ibid., p. 141.<br />
47 Ibid., p. 145.<br />
48 “As a boy, Paci remembers<br />
playing a similar game with friends<br />
– one he was reminded of when he<br />
saw news footage of Palestinian<br />
children shining light from broken<br />
mirrors into the eyes of soldiers,”<br />
in: Christy Lange , “Through a<br />
Glass, Darkly,” in “Adrian Paci: per<br />
speculum,” edited by Emma Dean<br />
and Michael Stanley, Milton Keynes<br />
Gallery, 2007.<br />
49 “Although I am mainly known<br />
as a video artist, I am in actual<br />
fact a painter. More precisely, a<br />
portrait painter. I did numerous<br />
portraits between the ages of 10<br />
and 22, and at high school my<br />
friends and I were often on the<br />
look-out for models to sit for our<br />
drawings. They were always people<br />
from off the street, old people<br />
just hanging around and watching<br />
the time pass. At the studio they<br />
would sit in front of us for hours,<br />
without any special pose. They<br />
simply continued doing what they<br />
would have been doing anyway. I<br />
worked on these faces for years,<br />
doing studies in pencil, tempera<br />
and oils, modeling their wrinkles,<br />
deciphering their regard, reproducing<br />
their skin in paint.” Adrian Paci<br />
in conversation with Mirjam Varadinis<br />
in Adrian Paci. Electric Blue,<br />
Kunsthaus Zürich, 2010, p. 6.<br />
the mirror gets broken in a violent although playful act of a game and the image disperses<br />
into pieces. So disappears the communal spirit of a group and now the children<br />
are scattered throughout the branches of a momumental tree, engaged in yet another<br />
new “funny game”48: each holding a piece of shattered mirror, and producing radiant<br />
bowls of light by bouncing the sunlight back into the camera’s lens, thus cruelly<br />
blinding the spectator with its intense, unbearable reflection. In this film, which can<br />
be regarded as the uncanny performance of a face and a drama of looking, Adrian Paci<br />
marks an impossibility of a face and a failure of address. Suspended in an archetypical<br />
dimension of time and space, equipped with the striking metaphorical density of a<br />
tale on life and death, Per Speculum is a profound study of deception, which critically<br />
undermines all received truths, perceptions and meanings. It also expresses the<br />
fragility of the human condition, exposed anger and the aggression of latent traumas,<br />
self-destructive gestures and instabilities of precarious times, caught in the moment<br />
of anticipation and awakening. Paci’s Turn on (2004) already touched upon similar<br />
issues, however it refered to a real-life fabric – the political situation in the artist’s<br />
native country. The film is pratically a tableau vivant of 18 unemployed workers from<br />
Paci’s hometown, Shkoder, sitting on the stairs of a city square and performing the<br />
simple activity of turning on the petrol-fuelled generators that provide electricity to<br />
the lightbulbs, carried in their hands as if they were trophees of a lost civilization.<br />
Here, the human is a source of Light, a maker of Light. The artist concentrates on the<br />
close-ups of the men’s sun-wrinkled faces, composing as if frozen landscapes of vulnerability,<br />
paralyzed in an expression of resignation, futility and failure. In this array of<br />
faces, gazing at the camera’s lens, the spectator is addressed and the moral faculty is<br />
being activated. The film is a moving document of survival and a testimony of transformations:<br />
an almost spiritual, illuminating spectacle where the aggressive, noisy<br />
sound of the engines contradicts the fragility of the generated light and the tired<br />
and disillusioned faces of the workers, the witnesses of dramatic, political upheaval<br />
and economic collapse, hoping for a bright tomorrow in a ritual of senseless, stoical<br />
waiting. Paci’s scene has the quality of an ancient drama: we are spectators in the<br />
theatre of quasi-heroic gestures, on the ruins of Enlightenment where grand emotions<br />
of morality are staged with pathos and grandeur. The artist’s orchestrations of reason,<br />
faith and empathy, Turn on and Per Speculum, are close-up portraits of humanity in<br />
suspension between hope and transience, submerged in a trance of expectation, daydreaming<br />
a better future.<br />
Adrian Paci’s most recent film, Electric Blue (2010) narrates yet another story of<br />
survival and depicts yet another case study of a human life, torn between the moral,<br />
individual choice and the impositions of a system: the Albanian political and economic<br />
meltdown of the 1990s. Based upon facts, the film is an attempt at a social portraiture49,<br />
woven of broken dreams, political tension and the complexity of a historical<br />
moment of transformation that challenges morality and an individual sense of ethics.<br />
To escape poverty, a man once passionate about film-making opens a porno cinema<br />
under the name “Electric Blue” (to commemorate an erotic programme on one of the<br />
Yugoslavian channels), although he soon starts to replace the archive of indecent sex<br />
scenes with footage from the television news, reporting on war scenes from the time<br />
of NATO’s incipient bombing campaign against Serbia. Such is Paci’s ironic take on “sex,<br />
wars and videotapes,” a powerful and captivating story of violence, abuse and ethical<br />
traps. Here too, the texture of human face close-ups (and especially the proximity<br />
and intimacy evoked by them) constitutes formally and emotionally the main surface<br />
of action and experience, generating a sense of empathy and compassion. Paci consciously<br />
uses the face to depict the conflict and to literally visualize the literal drama<br />
of a singular but also a collective fate. “I am interested in the moment of tension as<br />
a metaphor for the world and its state of constant becoming,” the artist claims and
50 Adrian Paci, in: Adrian Paci.<br />
Electric Blue, op. cit., p. 7.<br />
51 Lida Abdul, quoted in: Els<br />
van der Plas, “On Beauty and<br />
Other Unfinished Things,” www.<br />
princeclausfund.org/…/lectureonbeautyandotherunfinishedthings-<br />
ElsvanderPlas.doc.<br />
52 Lida Abdul, at: http://www.<br />
lidaabdul.com/statement.htm.<br />
53 Ibid.<br />
54 Ibid.<br />
continues: “Vulnerability and fragility are, in my opinion, basic human conditions, able<br />
to confer beauty and dignity at the same time.”50<br />
The video and photographic work of the Afgan artist, Lida Abdul is a laboratory of<br />
empathy and emancipation, a site of both action and apocalypse. As a faithful diarist<br />
of her own native country’s collapse, the artist is a writer of disaster, a witness to<br />
a crime of and against humanity. “Here,” confesses Lida Abdul, “are the ruins of my<br />
country, of my history and my culture. I do not accept it, so I will shout it out with a<br />
beauty that hurts.”51 Abdul’s White House (2005) depicts the architecture of a ruin<br />
as site of a touching ritual, charismatically performed by the artist herself, mourning<br />
and lamenting upon the cruelties of war and absurdities of a conflict. White House is a<br />
moving drama of a homecoming: by painting the ruins of a bombed building near Kabul<br />
with a white paint, the artist desperately manifests the necessity of a new beginning<br />
as well as an almost utopian desire to return to a normalcy. There is an uncanny stoic<br />
quiet and stillness, associated with the artist’s process, however filled with both<br />
resignation and a sense of hopelessness but also with the promise of a new time, a<br />
new era soon to come. Such is Abdul’s symbolic act of cleansing, removing the past,<br />
writing history anew on a white page of life, a site of potentiality and a future. According<br />
to the artist: “An art of the future would have to be simultaneously an appeal and<br />
an indictment. I have tried to comprehend the disaster that has ravaged my country<br />
for more than two decades. Language, notions of domesticity and perceptions of the<br />
other are all transformed so radically that survivors/refugees often refuse to talk about<br />
what they went through. We have all known the history of this silence. There is always<br />
the fear that the works of these dissident artists, too close to an unfolding ‘politics’<br />
may compromise their artistic intentions. In my work, I try to juxtapose the space of<br />
politics with the space of reverie, the space of shelter with that of the desert; in all<br />
of this I try to perform the ‘blank spaces’ that are formed when everything is taken<br />
away from people.”52 Abdul’s artistic ethos and her mission is to provide evidence of<br />
the atrocities and injustice of the violent times we live in: “Artists are the wandering<br />
souls of the world who move from one place to another making art that witnesses, that<br />
challenges and that asks other questions. They are celebrated, ignored, persecuted<br />
and sometimes even killed for refusing to take sides in the game of ‘us’ against ‘them’;<br />
they are always the innocents abroad who are often exiles in their own countries of<br />
birth.”53 Whitewashing the ruins is a sign of protest too, as much as the narrative of<br />
In Transit (2008) which depicts children engaged in quasi-ritualistic games around<br />
the shot-down Russian aircraft in the field of a former soccer stadium is an act of<br />
accusation and indication of guilt. Abdul portrays a wounded landscape of selfhood in<br />
ruins. Hers is a choreography of human pain and suffering, acted out on the rubbles of<br />
civilization,almost as a therapy, a purifiyng gesture, of a cathartic nature, as for the<br />
artist, “Art is always a petition for another world, a momentary shattering of what is<br />
comfortable so that we become more sophisticated in reclaiming the present.”54 Lida<br />
Abdul’s most recent two-channel video work, Man in the Sea (2010) is a poetic study<br />
of a warrior’s face and a heroic gesture, here staged within the nostalgic and romanticized<br />
décor of self-annihilation and symbolic erasure.Yet another struggle with the<br />
architecture of hope, Abdul’s film is rather pessimistic evidence of a political impass<br />
and the absence of any rebellious alternative. The zoomed-in face almost entirely fills<br />
up the video screen, as if literally becoming the projection surface of a mutilated identity.<br />
Mute and powerless, Abdul’s hero disappears in the sea.<br />
Annulment and erasure, as well as negation and absurdity, constitute the Belgian artist<br />
Kris Martin’s version of negotiating the human condition. Subversive at its core, his<br />
sculptural work and conceptual practice oscillate around the themes of finitude and
188 — 189<br />
Adam Budak<br />
sudden appearance, where death and the possibility of a new beginning are confronted<br />
by the relativeness of time and futility of any resistance. As such, Martin’s oeuvre is<br />
immersed in a philosophical discourse that profoundly touches upon the major grand<br />
narratives of humanity. The presence of history intertwined with the deep reflection<br />
upon the abstract notions of space and time render a work that illuminates with the<br />
strength of allegory and brings in a metaphysical dimension. Martin’s outstanding<br />
and uncanny sculpture Mandi VIII (2006) is a mise-en-scene of failure and unfulfilled<br />
desire, still yet another contribution to a series of works, conceived under the common<br />
title Mandi, a title which originates from an expression the artist encountered in Italy,<br />
where the departure boards are fabricated, a word which is a colloquial term for “good<br />
bye” and whose etymology includes the melange of words mano (hand) and dio (God)<br />
meaning to leave “in the hands of God.” As a powerful expression of lamentation over<br />
humanity’s loss of certitude and clarity, Mandi VIII articulates human drives towards<br />
emancipation and nobility. Based upon the classic Hellenic marble sculpture Laocoön<br />
and His Sons (dated probably from the 1st century AD, excavated in Rome in 1506 and<br />
acquired for the Vatican collections, where it still is today), depicting the Trojan priest<br />
Laocoon and his twin sons, Antiphas and Thymbraeus, assailed by a fearsome sea serpent,<br />
sent to punish him for his hostility to the will of the god Apollo, Martin’s Mandi<br />
VIII is yet another exercise in the artist’s favorite strategy of appropriating diverse<br />
readymades from the antique artefacts and masterpieces of literature to everyday<br />
objects and even more ephemeral phenomena of nature, shifting the contexts and<br />
traveling with the meaning, thus activating uncertainty, doubt and a desire for further<br />
enquiry. A controversial subject of study and adoration from the Roman poet, Virgil’s<br />
epic poem The Aeneid through the eighteenth century’s detailed scientific investigations<br />
by the historian Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) who identified the<br />
sculpture as “noble simplicity and quiet grandeur” and by the philosopher Gotthold<br />
Ephraim Lessing (1729-1781) who considered it from the point of view of a philospher<br />
of asthetics and used it as a case study in defining the difference between visual arts<br />
and literature, to Jacques Ranciere who in his The Aesthetic Unconscious praises the<br />
sculpture for the expression of the victory of classical serenity over emotion, Laocoön<br />
and His Sons has stimulated the imagination and was exposed to a multiplicity of<br />
beyond-universal readings. Almost faithful to the original, rendered as its plaster<br />
replica, Kris Martin’s version of the iconic statue, described by Pliny the Elder as the<br />
greatest of all art works, is a slightly edited one, ironic if not sarcastic “intervention”:<br />
the artist removes the serpent, leaving the group fighting against an invisible force,<br />
thus significantly altering the sculptural composition’s sense, focusing now more on<br />
the idealized beauty of the men’s struggling bodies rather than on the representation<br />
of pain and suffering as well as violence, crime and punishment, the grand themes that<br />
were attached to the reading of this sculpture for centuries. The artist tricks the spectator,<br />
now left with a disquieting absence in regards to the historical reference, manipulating<br />
his/her senses, unexpectedly opening the void – possibly an unknown aggressor<br />
or an invisible source of suffering – to often overly paranoid speculations. Who are<br />
we fighting with? The reason for struggle becomes abstract and phantasmagoric: in<br />
spasm and convulsion we are left with ourselves and against ourselves. Fate and power<br />
are (temporarily?) removed from a horizon of our existential experience. Mandi VIII is a<br />
powerful, however silent hymn for humanity in precarious times of distress and anxiety.<br />
The anatomist Sir Charles Bell (1774-1842) who studied Laocoön and His Sons in<br />
his book The Anatomy and Philosophy of Expression As Connected with the Fine Arts<br />
empasized a silence in Laokoon’s suffering: “that most terrible silence in human conflict,<br />
when the outcry of terror or pain is stifled in exertion; for during the struggle with<br />
the arms, the chest must be expanded or in the act of rising; and therefore the voice,<br />
which consists of the expulsion of the breath by the falling or compression of the
55 Charles Bell, The Anatomy<br />
and Philosophy of Expression<br />
As Connected with the Fine Arts,<br />
as quoted in William Schupbach,<br />
“Laokoon and the Expression of<br />
Pain,” http://www.wellcome.ac.uk/<br />
en/pain/microsite/culture3.html.<br />
56 Radiohead: Pyramid Song.<br />
2001.<br />
57 Susan Philipsz quoted<br />
in Charlotte Higgins, “Susan<br />
Philipsz: Lament for a Drowned<br />
Love,” http://www.guardian.co.uk/<br />
artanddesign/2010/apr/04/susanphilipsz-glasgow-internationalinterview.<br />
chest, is suppressed.”55 Such disquieting silence accompanies the suffering of Laokoon<br />
and his sons, tormented by pain, the face of a hero in spasm and the body in convulsion:<br />
we are witnessing a moment of awakening, an announcement of a silent apocalypse<br />
yet to come; we are on a threshold of empathy and emancipation. This uncanny<br />
silence and the impossibility of a sound are characteristic features of Kris Martin’s<br />
entire oeuvre. His sculpture Bells (2008) is a melancholic and fragile metaphor of an<br />
existence in suspension: two bronze bells are connected one with another in an almost<br />
love-like gesture, which simultaneously renders their function inactive. No sound may<br />
be uttered; no action can be performed; neither joy of life nor sorrow of death or danger<br />
can be announced. Here, in this dramatic act of denial and isolation, Martin presents<br />
another study of erasure, another expression of finitude and mortality. Seductive in its<br />
simplicity and striking intimacy, Bells comments upon the hopelessness and inertia of<br />
contemporary alienated societies. Its muteness is a testimony to a human condition,<br />
imprisoned in its own potency and self-will.<br />
Kris Martin’s performance of silence is complemented by the Scottish artist, Susan<br />
Philipsz’s performance of voice. “I jumped in the river and what did I see? Black-eyed<br />
angels swam with me,” so begins, presented in the exhibition <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>.<br />
Empathy and Emancipation in Precarious Times Philipsz’s The River Cycle (2005),<br />
sung a cappella with her own voice, the artist’s moving incantation, appropriating the<br />
psychodelic lyrics of Pyramid Song (2001), performed by Thom Yorke, the leader of the<br />
band Radiohead. Evoking a sense of nostalgia and dislocation, the installation offers<br />
a poetic journey, simultaneously real and magical, through the universal themes of<br />
longing, loss and grief, the artist’s recurring topics, woven out of the fabrics of private<br />
memory and collective experience. The journey leads through the mythical Styx to the<br />
land of afterlife as we are apparently confronted with the subject’s death, or any other<br />
significant rite of passage. Phlipsz’s performance of The River Cycle is a reverie, offering<br />
an illusion of a time slow-down and a space on the other side of Cocteau’s mirror,<br />
there where finality and mortality conspire with the sense of liberation and fulfillment:<br />
“There was nothing to fear and nothing to doubt; there was nothing to fear and nothing<br />
to doubt.”56 The artist creates sculptural environments of a bewildering audible<br />
volume and intensity, resulting from her profound investigations of the psychological<br />
and sculptural potential of a sound and the ways in which sound defines the architectural<br />
space and the public place. Employing diverse acoustic and narrative techniques<br />
that affect the spectator’s sensuality and perception (such as sound’s reverberations,<br />
echoes, overlapping voices, loops and transe-like repetitions) and appropriating the<br />
musical, literary and cinematic references from Will Oldham to James Joyce and<br />
David Bowie, as well as using well-known folk songs, fairy-tales, ballads or lullabies,<br />
Phlipsz conceives captivating and cathartic seances of psychophysiological collective<br />
audio-hypnosis. With her mainly a cappella renditions, the artist explores the “emotive<br />
effects of song; how it triggers memory and redefines a place (…). With my work<br />
I’m trying to bring an audience back to their environment, not the opposite. What I’m<br />
trying to do is make [you] more aware of the place you’re in while also heightening<br />
your own sense of self. So the siting of this work is very important, the site becomes<br />
the visual element.”57 Often installed in unexpected corners of the public realm (under<br />
a bridge, in a shrine, in a hillside shelter, in cemetries, or piped through the speakers<br />
of a Tesco supermarket), Philipsz’s haunting songs strive for belonging and acceptance.<br />
Songs as homage, songs as memorials, suspended between the past and the<br />
present, obsessive litanies and lamentations mourning the disappearance of the loved<br />
one, murder ballads and hymns on unfulfilled love and desire, or even radio interval<br />
signals, sourced from around the world on the vibraphone (recorderd by the artist<br />
herself for her recent installation, You are not alone for Oxford’s Radcliffe Observatory,
190 — 191<br />
Adam Budak<br />
58 Peio Aguirre, “When the Body<br />
Speaks. On the Work of Susan<br />
Philipsz,” in A Prior, number 16,<br />
available at: http://www.aprior.<br />
org/articles/33.<br />
59 Marcel Dzama quoted in M. J.<br />
Thompson, “The Infinitude of Cool,”<br />
Border Crossings 107, August<br />
2008, p. 1000.<br />
a fine 18th-century building based on Athens’ ancient Tower of the Winds) – these are<br />
Susan Philipsz’s sincere testimonies to the uncanniness of human fate. In fact, with<br />
Philipsz’s work, we are at the foundation of the human condition, at the moment of the<br />
subjectivity’s formation and the identification processes when the empathic qualities<br />
are shaped and emancipatory drives are generated. As Peio Aquirre observes: “Repetition—singing<br />
over and over again, listening and hearing one’s own voice—has an effect<br />
that, in psychoanalysis, is related to the acquisition of subjectivity. With the song’s<br />
repetition, we identify with the voice and with the imaginary body tied to that voice. It<br />
is through repetition that the child (in lullabies and in fairy tales) loses his/her fear of<br />
the outside and becomes an autonomous subject. This is the true purpose of the loop<br />
in Philipsz’s work. The loop is a mechanism that, in its infinitude, becomes an emitter<br />
of the eternal return, penetrating consciousness though the unhurried, cyclical and<br />
soothing effect of the sound.”58 Inhabited by spectral voices, composed of sounds of<br />
the past, of memories and of recollections, Philipsz’s melancholic and metaphysical<br />
work is both a mourning over the time lost and a celebration of a return and a restored<br />
hope.<br />
Reverie is a bewildering realm of production for the Canadian artist, Marcel Dzama’s<br />
performative, polyphonic oeuvre (drawings, collages, sculptures, dioramas, videos),<br />
which mingles collective memory and cultural legacy (ancient imagery and texts, such<br />
as myths, sagas, folk songs and tales, the primary sources of humanity’s culture and<br />
civilisation’s wisdom) with the most intimate, dream-like experience as well as with<br />
the working of the other, uncontrolled states of consciouness. Thus Dzama mounts his<br />
own, unique and exclusive, private mythology, hypersymbolic microcosm, haunted by<br />
psychophysiological pathology: we are in the (brave new) world on the edge of civilisational<br />
frenzy, at the limits of sanity, out of faith, beyond reason, in a deranged theatre<br />
of excess. “I like the idea of making up a mythology or old folklore,” says the author<br />
of half-human, half-animal creatures, hybrids of extraterrestrial fantasies, cyborgs<br />
of post-technological hysteria. “I draw during the day but my ideas come at night,”59<br />
continues the artist whose imagination inhabits the liminal areas between dream and<br />
waking, while elaborating a dark vocabulary of psychosis and post-human delirium.<br />
Grotesque and carnivalesque, Marcel Dzama’s work marries the presumed innocence of<br />
childhood’s memory and the cruelty of the adult world. Violence in its micro and macro<br />
scales conducts the plot, which oscillates around the topics of humiliation, anger,<br />
hatred and abuse. His series Drawings for Dante (2002) narrates the contemporary<br />
macabresque in the mode of a school-child’s notebook drawing. The artist’s quasiinfantalized,<br />
almost cartoon-like version of the human Inferno is too transgressive to<br />
act as a mere caricature or a satire on the world gone mad. It is a manifesto of destructive<br />
and absurd power at the dawn of civilization, a quest for awakening. Dzama’s<br />
monumental The Course of <strong>Human</strong> History Personified (2005) marks the artist’s own<br />
subjective gesture of rewriting history as a sequel of barbarian conquests, domination<br />
and brutality, boldly staging the fearful nature and anomaly of humanity on the ruins<br />
of morality, in the shadow of death. Here too, gore-like omnipresent violence is an<br />
ordinary matter, quite ornamental, almost leisure-time, regular everyday-life activity,<br />
permissible, an unavoidable part of reality where all taboos have been erased. The<br />
hidden, the unknowable, the unthinkable as the title of Dzama’s drawing of 2007<br />
indicates: these are the areas of the human psyche the artist is interested in investigating<br />
and exposing. The diorama Knowing precisely where to cut (2008) is the artist’s<br />
truly bewitched, bothered and bewildered version of an anachronistic dance macabre,<br />
featuring film noir-like characters, grotesque victims, locked in the cage of humanity,<br />
surrounded by taxidermic mice and artificial birds, mythological messengers of lost<br />
spirituality. Inspired by Mexican shrines and Joseph Cornell’s boxes, and recalling the
60 Mark Manders, in The Absence<br />
of Mark Manders, Kunstverein<br />
Hannover, Bergen Kunsthall,<br />
S.M.A.K. Ghent, Kunsthaus Zürich,<br />
(Ostfildern: Hatje Cantz 2007),<br />
p. 53.<br />
61 Ibid., p. 22.<br />
62 Ibid., p. 120.<br />
recessed displays in natural history museums, Dzama’s dioramas are showcases for<br />
Dantesque and Kafkaquese rituals of social ordeal. Dzama’s Pip (2004) is yet another<br />
assemblage, composed of the grotesque figure of a (human) animal, dressed in an elegant<br />
if not pedantic suit of felt and fake fur, wire mash, paper maché, plastic foam and<br />
rubber, and accompanied by drawings and watercolours that apparently represent the<br />
hero’s (bureaucratic) credo (including messages such as “we will disappear” or “lost in<br />
endless time,”, as well as Pip’s biography). Here too, we are in the realm of burlesque,<br />
or on the stage of a marionette theatre, which evokes the memory of high school<br />
performances based upon the haunted house experience of an uneasy, traumatic childhood.<br />
Simultaneously strange and familiar, Dzama’s imagery depicts the world upside<br />
down, on the constant desperate search for its own renewal and recovery. His hyperlong<br />
drawing in three sections, Ulysses, (2009) as well as series of collages (2008-<br />
2009) are diaries of civilization, inhabited by infamous ghosts of former eras and<br />
shadow-like characters from old silent movies, engaged in the perverse practices of<br />
violence and pornography. This neodadaist theatrics of acute anxiety is the dehumanized<br />
world of today – tormented by wars and terrors, suffering of moral decay and ethical<br />
collapse. Dzama’s anti-glamorous heroes: male or female warriors, overexposing<br />
their white weapons or self-made guns, commedia dell’arte-like victims of atrocities<br />
and cruelties with their mutilated or dismembered bodies and injured psychos, hopeless<br />
terrorists and impotent opressors, always inhabiting the in-between of animal<br />
and human worlds - are ridiculous and miserable actors of performance of power which<br />
turns into spectacle of horror. In his devastating, perhaps too cynical, investigations of<br />
contemporary evil, Dzama orchestrates a storyboard of society’s failure to empathise.<br />
He depicts the precarious world of interrupted intimacy and violated innocence. Values<br />
are cancelled, virtues are invalid and the sacred is absent. But – no fear! We are in the<br />
pleasure dome of an adult dreamscape. Wake up!<br />
The sculptural and installative work of the Dutch artist, Mark Manders is an anatomy<br />
of self and a pursuit of the absence of the artist who defines himself as follows: “The<br />
artist Mark Manders is a fictional person. He is a character who lives in a logically<br />
designed and constructed world, which consists of thoughts that are congealed at<br />
their moment of greatest intensity. It is someone who disappears into his actions. He<br />
lives in a building that he continually abandons; the building is uninhabited, in fact.”60<br />
As the poetic self-portrait of an individual, torn by a desire to belong and an urge to<br />
escape the confines of communal idioms and a landscape of an inner world, Manders’<br />
poignant oeuvre reflects humanity in a state of profound fragmentation, on the<br />
threshold of a possible and necessary new beginning. A séance of psychotic catharsis,<br />
it carries the promise of a rejuvenated subject, freed of the cocoon of social routine,<br />
constructing its corporeal and mental architecture as a “monument in ruins” and a<br />
lament over civilization’s collapse. “After all, what am I? A human being who unfolds<br />
into a horrifying amount of language and material by means of very precise conceptual<br />
constructions,”61 confesses the author of Self-portrait as a Building an on-going conceptual<br />
project, a sort of manifesto of a life-time, conducted by Manders since 1986,<br />
initialy planned as an oeuvre of literature, eventually focused on the spatial unfolding<br />
of the artist’s psychological self. Obsessively pursued as the investigation of a thought<br />
and the process of thinking, it develops an idea of selfhood as an architecture and<br />
a composition in space. The building is the prototype of the self in process, a living<br />
organism, a laborartory of identity production: “The building is like a gigantic set<br />
frozen in time with lots of rooms that all seem as if they have just been abandoned<br />
(…) Like an encyclopedia, the building is always ready, even though it keeps on changing<br />
and growing or shrinking.”62 Andrea Wiarda identifies Manders’ Self-portrait as a<br />
Building as “the mythical container of his attempt to understand his position in the
192 — 193<br />
Adam Budak<br />
63 Andrea Wiarda, “Mark Manders”<br />
in Kaleidoscope, March-April 2009.<br />
64 Ibid.<br />
65 Mark Manders, “The Absence<br />
of Mark Manders,” op. cit., p. 45.<br />
evolution of the human world as a paradigmatic construction.”63 The artist is engaged<br />
in the fundamental process of a particular myth-making, combining the semantics of<br />
totemism and the universal human narratives with the vocabulary of the contemporary<br />
experience of a daily life and domesticity. Manders’ sculpture Unfired Clay Figure<br />
(2005-2006) depicts a construction, or rather an excavation-site of subjectivity at the<br />
critical moment of origin and transformation, and it foregrounds a vulnerability of the<br />
human condition itself, designing a (utopian) psychological scenario, deeply suspended<br />
between the perils of reality and a dream-like phantasy. A bisected male figure, split<br />
and seemingly damaged, monumental though and sublime in its obvious reference to<br />
the heroic style of antiquity or to a precious archeological discovery, raw and incomplete,<br />
is Manders’ mysterious witness of (and to) himself – a subject of contemplation,<br />
caught in a trap of its own incapability to narrate the world – but at the same time, of<br />
fragile humanity in arrested movement of its own limited potency and ethical responsibility.<br />
We are in-between the Deleuzian plateaux of difference and repetition, ambiguity<br />
and schizophrenia, in a landscape of separation. The gestalt of Unfired Clay Figure<br />
is literally split, as much as Two Interconnected Houses (2010) are united, becoming<br />
one organism, the artist’s spatial psyche. 80 black and white slides invite one to take<br />
an uncanny journey between two interiors of ambiguous identity (an artist’s atelier?<br />
abandoned anonymous apartment? a storage place? an archive? a haunted shelter),<br />
recalling in fact Kafka’s burrow, a particular dark passage through the psyche’s tunnels,<br />
a metamorphosis. Two Interconnected Houses map indeed the human brain; the series<br />
is a powerful articulation of Manders’ self-portrait as a building that oscillates “actually<br />
between two world views: the world as constructed from atom-like semi-truths<br />
and the one in which these truths are accepted as facts.”64 Clay Figure with Iron Chair<br />
(2009) constitutes yet another attempt at self-portraiture: a hybrid of a dismembered<br />
human (female) figure and a chair, abandoned and mute, in a gesture of hopelessness,<br />
a metaphor for a world in paralysis and arrest. The intimacy of the scene is disturbing;<br />
it embarrasses and leaves the spectator with a sense of shame and guilt. Detachment<br />
and nonbelonging are agents of otherness. Manders’ auratic oeuvre is squatted by<br />
morbid, phantom-like creatures, hovering between the mundane and the mythic, pursuing<br />
their own absence, searching for the author, as the artist in a 1994 text, titled<br />
“The Absence of Mark Manders,” wrote himself: “The realization that life is taking its<br />
course, even without you, is an intense human experience; it shows the finiteness of<br />
personality.”65<br />
The self-mutilated, frozen figures of Mark Manders’ Self-portrait as a Building mirror<br />
the Austrian artist, Maria Lassnig’s life-long consequent unfolding of her own impressively<br />
bold act of self’s portraiture. For Lassnig, self-portraiture is either a masquarade<br />
(self-portrait as ...) or a community of identities (self-portrait with...). Luce Irigaray<br />
defines this aspect of Lassnig’s oeuvre as an “impossible portraying” and locates it<br />
within the frame of gender differentiation: “If a masculine picture generally seems to<br />
be a little frozen, a feminine picture rather looks moving. A man needs some effort to<br />
set the shapes in motion while, for a woman, they are constantly one way or another<br />
on the move. Perhaps because she tries to seize something which is elusive, indiscernible<br />
– her own flesh. To allude to it, Maria Lassnig has thus assumed an other identity<br />
– even an animal or plant identity (see Self-portrait as Animal, 1963, and also Mother<br />
and Daughter, 1966) – or to add something to her flesh which immobilizes it around an<br />
object, a thing, or through an act, a role, a function, sometimes behind a screen – why<br />
not of plastic? (see Self-portrait with Staf“, 1971, Self-portrait with Pickle Jar, 1971,<br />
Self-portrait as a Prophet, 1967). It is no longer a question of a mere self-portrait.<br />
This seems impossible to be realized. The flesh flows outside of any reproduction.”66<br />
Lassnig’s self-portraiture is a theatre stage where the drama of the human condition
66 Luce Irigaray, “How to Make<br />
Feminine Self-Affection Appear?”<br />
in: Two or Three or Something.<br />
Maria Lassnig, Liz Larner, edited<br />
by Adam Budak, Peter Pakesch,<br />
Kunsthaus Graz 2006, p. 41.<br />
67 Maria Lassnig in: http://<br />
www.artknowledgenews.com/<br />
Maria_Lassnig.html.<br />
68 Silke Andrea Schummer,<br />
quoted in Russell Ferguson, “Iron<br />
Virgin and Fleshy Virgin,” in Two or<br />
Three or Something. Maria Lassnig,<br />
Liz Larner, op. cit., p. 88.<br />
69 Maria Lassnig in “Inside Out,”<br />
conversation with Jörg Heiser,<br />
Frieze 103, November – December<br />
2006.<br />
is acted out by a crowd of amateur actors, performing an array of characters of the age<br />
of morality in crisis. In a way similar to Manders, each of Lassnig’s paintings is being<br />
considered as a self-portrait – a shelter, an escape into identities beyond her own, a<br />
rehearsal or audition for a true self yet to come. All her subjects derive from a process<br />
that the artist describes as “body awareness“ where the physical appearance of the<br />
body is extended through the dimension of sensation. The body is not depicted as it is<br />
perceived from the outside; instead, it is a production of introspection, an experience<br />
from the inside. Very often humanoid-like and alien, grotesque and distorted, Lassnig’s<br />
body is dismembered and contorted, in spasm and agony, suffering the existential pain,<br />
tormented by both hyper-affection and violence. Her figures are often defective, supported<br />
by crutches, with dysmorphic or tortured parts. Skin is viewed as a membrane<br />
that registers sensations such as heat, cold, tension, pressure, weight, painted by the<br />
artist as the outlines of the body in lines and smudges of vibrant colour that pulse<br />
with energy; flesh is portrayed as “naked” open matter, stripped, exhibitionistic, “drastic”<br />
tissue, susceptible to wounds, injury or simply, to aging. Lassnig’s “physical event<br />
of bodily experience” leaves the spectator with a feeling of psychological discomfort<br />
and unease: here, in this disturbing corporeal decor, we are at the core of human frailty,<br />
in the house of physical and psychic butchery of contemporary civilization turned<br />
into a shrine of elemental passions and ordinary feelings, as the artist herself in an<br />
unbelieveably innocent though seemingly provocative way comments upon her “drastic”<br />
paintings: “I do not aim for the big emotions when I’m working, but concentrate<br />
on small feelings: sensations in the skin or in the nerves, all of which one feels.”67<br />
Simultaneously, tragic and humorous, violent and tender, her work evokes urgent<br />
moral imperatives and articulates the human condition in a state of ethical alert and<br />
as such, it remains within the sphere of privacy and overwhelming intimacy, as Silke<br />
Andrea Schummer rightly comments upon Lassnig’s self-portraits, Womanpower (1979)<br />
notwithstanding: “She has never related the display of her body to a social issue. In<br />
her case, the body is both a private instrument of perception and a topic of research,<br />
but not a repository of social functions or a social metaphor.”68 Indeed, Lassnig herself<br />
expressed her dislike for Womanpower, once perceived as an icon for women’s emancipatory<br />
tendences, disclaiming it as one of the silliest and her least favorite paintings<br />
(“It’s interesting as a title, but not as a picture.”69) The artist though has always been<br />
manifesting her independent position and emancipatory drives. The exhibition <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong>. Empathy and Emancipation in Precarious Times presents two extraordinary<br />
studies of Lassnig’s self-portraiture: Woman Laokoon (1976) and Stilleben mit rotem<br />
Selbstportrait (Still Life with Red Self-portrait) (1969). Facing provocative Woman<br />
Laokoon, this sublime study of hysteria, we are in the presence of humanity at its<br />
most sincere and devastating moment of personal fear and suffering. The directness<br />
of this representation is strikingly daring and aggressive, passing beyond any moral<br />
standards, regarding intimacy and its public exposure. Gazing into this memorable face<br />
in pain, we are in the mirror of the human condition, between powerlessness, impossibility<br />
of action and hopelessness.<br />
Judith Butler’s quest for “being addressed” and Hannah Arendt’s “will to understand”<br />
receive their unusually alarming expression in the Dutch artist, Renzo Martens’ filmic<br />
work-in-progress, harshly entitled Episode 1 (2000/2003) and Episode 3 (2009). These<br />
are indeed episodes, tv-like serialized stories from the world, captivating reports on<br />
life in a state of exception, filtered by the artist/author’s very intimate experience of<br />
his own private life. In fact, Episode 1 and Episode 2 are Martens’ self-portraits, featuring<br />
the artist himself narrating, infiltrating and in a Brechtian way alienating the storyline,<br />
thus critically foregrounding a dramatic contrast between realities and worlds<br />
in general. For Episode 1, the artist travels to the war zone of Chechenya in order to<br />
give the video camera into the hands of the disillusioned refugees to film him, while
194 — 195<br />
Adam Budak<br />
70 Renzo Martens, in: http://www.<br />
modernedition.com/art-articles/<br />
contemporary-dutch-art/dutchcontemporary-artists.html.<br />
71 Rancière, The Emancipated<br />
Spectator, op. cit., pp. 83-107.<br />
asking the most simple however unexpected question: “What do you think of me?” The<br />
perspective is reversed now: the (media) image is produced by a victim and pointed<br />
towards the Western world. “What is your theme? Why are you here? Why do you need<br />
somebody else to tell you where your place is? Why do you film this?” - such accusative<br />
and hostile questions bounce back, while the camera is penetrating the artist’s<br />
face, challenging his shamelss exhibitionism. The scene is embarrassing and mutually<br />
humiliating; the sense of unease and despair is devastating: “Who is responsible for<br />
this? How can we understand each other?” As irritating as it is deeply moving, the<br />
artist’s gesture investigates the possibility of an empathy and studies the perception<br />
of the “Other”: “I made Episode 1 as a delegate of the viewing public, an audience that<br />
is mostly interested in themselves. So I didn’t ask the people how they felt now their<br />
legs had been amputated and those kinds of questions. But I asked them how they<br />
thought I felt. If they thought I was handsome or how I should seduce my girlfriend<br />
back in Brussels. ...I turned it around because in reality it’s much more about how we<br />
feel and less about how they feel.”70 Although Martens’ footage seemingly features<br />
the usual portrait of any war (with images of devastated cities in ruins, refugee camps<br />
with endless rows of tents, heavily armed soldiers of a border patrol, suffering civilians,<br />
starving for food supplies, NGO employees, elaborating help programmes, journalists,<br />
hunting for images of terror and disaster), the artist’s concern is rather focused on how<br />
moral and ethical faculties operate in such extreme situations of territories under fire.<br />
Martens uncovers the hypocrysy of the global media system and the collapse of any<br />
humantarian aid efforts to relieve the tragedy of the inhabitants of a war zone. In fact,<br />
Episode 1 is a study of abuse and exploitation. “I want tears,” responds an NGO worker,<br />
while unveiling the mechanisms of humanitarian help, determined by the presence of<br />
the cameras and media coverage. Martens further manipulates the equilibrium of the<br />
spectator’s moral agency: immersed within the tissue of the film’s quasi journalistic<br />
narrative, and recalling the genre of a diary or love letter, the artist’s personal feeling<br />
towards his girlfriend, Marie, addressed with declarations of love directly to the camera<br />
lens in crucial, most dramatic moments of the film (“It’s me darling. It’s about time you<br />
love me”) punctuates the artist’s voyage through hell and acts as Brechtian alienation<br />
effect, interrupting our stereotypical view and strengthening the sense of truth and<br />
sincerity. Balancing on the thin line of ethical correctness, Martens’ provocative film<br />
is both, artist’s self-analysis as well as his political, profoundly human intervention<br />
into the fabrics of precarious life where love affair and atrocities of war participate in a<br />
necessary and urgent act of communal and individual catharsis.<br />
Episode 3 marks the artist’s further step in investigating the “pain of Others” via the<br />
analysis of mechanisms of global politics and economy. This time, Martens embarks on<br />
a Dantesque expedition into the interior of Congo and witnesses a society, tormented<br />
by war, extreme misery and injustice. Here too, the narrative is double-layered and<br />
it includes a self-reflexive component which addresses the politics of image production,<br />
and in particular, the ethics and economics that constitute the representation<br />
of post-colonial suffering. “What makes an image intolerable?” asks Martens after<br />
Rancière, touching in a provocative way upon the regime of visibility and tracing shift<br />
from the intolerable in the image to the intolerability of the image, which, according<br />
to Rancière, has found itself at the heart of the tensions affecting political art.71<br />
The artist’s critique of Western photojournalism points towards the abuse of human<br />
misery and poverty, considered as a “packaged” commodity, destined for the perception<br />
of Western world. Martens boldly addresses the overwhelming poverty and suffering<br />
of a nation driven by violence and calamity that were turned by media into an<br />
image-industry and fascinating spectacle, echoing Susan Sontag’s reflection upon the<br />
psychology of disaster images and evil, when she asks: “Is there an antidote to the
72 Susan Sontag, Regarding<br />
the Pain of the Others, New York:<br />
Picador, 2003, p. 122.<br />
73 Ibid., p. 97.<br />
74 Martens confesses in an e-mail<br />
conversation with the author,<br />
May 2010: “’Episode 1 and Episode<br />
3 are the outer panels of a triptych,<br />
portraying images of poverty,<br />
war and historical devastation as<br />
commodities. They show earthly<br />
narratives, with rebels, priests,<br />
judges, greed and cameras, and<br />
representation itself as part of the<br />
confusion. Like in medieval altar<br />
pieces, the middle panel, Episode<br />
2, will, one day, transcend this<br />
all.” I do hope so, I can’t wait for<br />
Episode 2 to appear!<br />
75 Sontag, Regarding the Pain of<br />
the Others, p. 105.<br />
76 Idib., p. 8.<br />
perennial seductiveness of war?”72 and points out the almost obsessive human interest<br />
in them, already studied by Edmund Burke in his A Philosophical Enquiry into the<br />
Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757): “There is no spectacle we so<br />
eagerly pursue, as that of some uncommon and grievous calamity.”73 Martens unveils<br />
the masks of pseudo-humanitarian international aid agencies and their ruthless exploitation<br />
of human tragedy, and, against the grain, he searches for alternative solutions:<br />
the artist’s proposal is as surprising and desperate as it might sound ironic and cynical<br />
– “enjoy please the poverty” is Martens’ subversive slogan of his emancipatory course,<br />
launched for the Congolese amateur photographers, an academy of survival and a<br />
school of their own misery’s management, a controversial “enlightenment” lesson. “I<br />
teach them how to deal with life,” so the artist comments upon his idea of providing<br />
the local inhabitants with a kind of educational package of know how according to<br />
which the misfortune can become a source of income. Instructed by Martens, they<br />
begin copying Western photojournalists by taking images of war, rape and poverty<br />
that haunt and surround them instead of images of festivities and family events that<br />
belong to the joys of their everyday life but whose market value is incomparably lower<br />
than the benefit received from the sensational and drastic imagery: documents of suffering,<br />
cruelty and evil.<br />
Martens’ is a particular unique genre, a brave mode of meta-speech oscillating<br />
between (performative) documentary, docu-drama, performance, an emancipated traveloque<br />
that combines a subjective narrative with a critical approach to the registered<br />
material. The artist/narrator is practicing a kind of travesty too: in Episode 1 he takes<br />
on the role of a Western journalist-amateur whereas in Episode 3 he rather acts as a<br />
utopist, a naïve and uninitiated activist, a cynical coach, bringing know how to endangered<br />
areas in crisis. Between detachment and engagement, accusation and protest,<br />
the artist’s chameleonic and heterotopic character is one of many: a cool observer and<br />
merciless intrudor, a passionate preacher and messiah, a witness and martyr, narcissistic<br />
adventurer and alien, and, last but not least, a metteur-en-scène, staging his grandious<br />
Herzogesque “Enjoy Please the Poverty” anti-Broadway show! Narrating in a first<br />
person and bringing himself into a frame, Martens foregrounds his own position and<br />
an address: “the artist is present.” In fact, we deal with a genre of extreme radical sefportraiture<br />
– an artistic act as a higest form of responsibility and ethical awareness.<br />
Renzo Martens’ Episodes are studies of hope and hopelessness. Despair and resignation<br />
contribute also to the vulnerability and frailty of humanity in a state of emergency.<br />
The artist’s oeuvre, planned as a triptych 74, is an essay on suffering, and as such it<br />
bears an almost religious quality in approaching ethical matters, especially the nature<br />
of compassion. Martens’ critique of the mediatised world leads towards the diagnosis<br />
of a society, unable to empathise. Thus, once more the artist evokes Susan Sontag’s<br />
observation of the contemporary politics of images and media: “In a world saturated,<br />
no, hyper-saturated with images, those that should matter have a diminishing effect:<br />
we become callous. In the end, such images just make us a little less able to feel, to<br />
have our conscience pricked.”75 Analysing Virginia Woolf’s reflection upon war images,<br />
Sontag states: “Not to be pained by these pictures, not to recoil from them, not to<br />
strive to abolish what causes this havoc, this carnage – these, for Woolf, would be the<br />
reactions of a moral monster. And, she is saying, we are not monsters, we members<br />
of the educated class. Our failure is one of imagination, of empathy: we have failed<br />
to hold this reality in mind.”76 The empathy in crisis seems to be the most important<br />
and precious theme of Renzo Martens’ oeuvre, but simultaneously, it seems that this<br />
oeuvre’s most ambitious challenge, conducted in the shadow of a neon light “enjoy<br />
please the poverty,” is the urge to overcome the human suffering with the mobilizing<br />
and miraculous power of compassion and sublimation. Julia Kristeva articulates
196 — 197<br />
Adam Budak<br />
77 Julia Kristeva, This Incredible<br />
Need to Believe, New York:<br />
Columbia University Press, 2009,<br />
pp. 97-98.<br />
78 Alain Badiou, The Century,<br />
Polity Press 2007, p. 122.<br />
79 Ibid., p. 147.<br />
80 Ibid., p. 141.<br />
this challenge in a most engaging way and defines it as a task of the future human<br />
generations to come. Her manifesto is a call for action and togetherness: “This civilization<br />
– from the Christ (…) to Mozart whose renown is worldwide – this civilization, ours,<br />
today menaced from the outside and by our own inability to interpret and renew it,<br />
bequeaths us thus its subtle triumph over human suffering, transformed, without losing<br />
sight of the suffering to death of the divine itself. It is incumbent on us to take up<br />
this heritage once again, to give it meaning, and to develop it in the face of the current<br />
explosions of the death drive. Totalitarian regimes and, in a different, but symmetrical<br />
way, the modern automation of species, claim to put an end to, eradicate, or ignore<br />
suffering, the better to force it upon us as means of exploitation or manipulation. The<br />
only alternative to these different forms of barbarism founded on the denial of malaise<br />
is to work through distress again and again: as we try to do, as you try to do. Differently,<br />
and very often each against the others. Against or ‘right against’? Still, when<br />
new barbarians, having lost even the capacity to suffer, strew pain and death around<br />
and in us; when poverty grows by leaps and bounds in the global world, face to face<br />
with extravagant accumulations of wealth, which doesn’t care, aren’t compassion and<br />
sublimation not much help? Of course. What I do know, however, is that no political<br />
action could step in for them if the humanism – itself a kind of suffering – didn’t give<br />
itself the means to interpret and reinvent this ‘loving intelligence’ that comes and is<br />
inseparable from the Man of pain and suffering’s compassion that might be confused<br />
with the divine itself. Such is the challenge of the planetary era, which I receive as an<br />
exciting and long-term vocation, and which we will not be able to take up unless we try<br />
to think and act together (…).”77<br />
Life, action, togetherness, and the essence of “we,” perceived not as an agreement or<br />
fusion, but rather as “the maintenance of the inseparate”78 – these are the principles<br />
that define the human conditon and orchestrate the equilibrium of empathy and<br />
emancipation, driven by the experience of suffering. Alain Badiou concludes his chapter<br />
on cruelty with an apotheosis of Action: “To produce an unknown intensity against a<br />
backdrop of suffering, through the always improbable intersection of a formula and<br />
an instant: this was the century’s desire. Which explains why, despite its multifaceted<br />
cruelty, it managed – through its artists, scientists, militants and lovers – to be Action<br />
itself,”79 and quotes Andre Breton’s praise of pain and suffering as an inseparable<br />
and enriching experience of life: “It’s there, at that poignant moment when the weight<br />
of endured suffering seems about to engulf everything, that the very excessiveness<br />
of the test causes a change of sign, tending to bring the inaccessibly human over to<br />
the side of the accessible and to imbue the latter with a grandeur which it couldn’t<br />
have known without it (…) One must go to the depths of human suffering, discover its<br />
strange capacities, in order to salute the similarly limitless gift that makes life worth<br />
living.”80
Empathy and Emancipation<br />
in Precarious Times1<br />
The understanding heart<br />
and expanded judgment, in<br />
the eyes of Hannah Arendt<br />
Sophie Loidolt
1 This essay is a meditation on<br />
the terms “empathy” and “emancipation”<br />
in the context of Hannah<br />
Arendt’s work. The title is taken<br />
from the English title of the<br />
exhibition rather than the German<br />
(Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten). Although<br />
empathy and emancipation are<br />
common enough terms in the literature<br />
today, their original meaning<br />
is nonetheless often unclear. That<br />
is why it seemed more interesting<br />
here to undertake clarifi cation<br />
through Arendt’s eyes and therewith<br />
propose a new understanding<br />
of the terms. In contrast with<br />
“selfdetermination” (which<br />
is more akin to “autonomy”), I<br />
have emphasised “selfliberation,”<br />
the meaning that “emancipation”<br />
has had since the 17th/18th<br />
century Enlightenment. (In Latin,<br />
emancipare meant to grant a son<br />
or a slave his independence, and<br />
so had a passive aspect.) Moreover,<br />
it seemed to me that the dynamic<br />
process latent in “selfliberation”<br />
is an exciting factor visàvis<br />
“feeling.” Empathy (which may also<br />
indicate “emotional competence”)<br />
is in this respect conceptually<br />
wider than “sympathy” or “fellow<br />
feeling.” The process of “understanding”<br />
has to be empathetic,<br />
which meant that Arendt’s emphasis<br />
on Kant’s erweiterte Denkungsart<br />
(expanded thinking) could<br />
be better tied in with an affective,<br />
i.e. emotional, perspective.<br />
2 Arendt, Über die Revolution,<br />
p. 115.<br />
3 Op. cit., p. 114. Arendt is quoting<br />
here from a petition by one<br />
of the Paris sections during the<br />
Revolution: “For pity’s sake, for<br />
the love of humanity, be inhuman!!”<br />
4 Ibid., p. 113.<br />
5 Loc. cit.<br />
6 Ibid., p. 112.<br />
Is there a connection between empathy and emancipation? Or, putting it another way,<br />
can our power of empathy help us in the process of social and political selfliberation?<br />
Or does wallowing in pity, which is used with such precision in the media today to<br />
maximize profits, only cloud our judgment? What does emancipation mean in fact in<br />
a world dominated by systematic injustices, whereby a thin “emancipated” stratum<br />
contrasts with a large mass of people who scarcely have anything to lose? And hasn’t<br />
the exalted idea of the Enlightenment given way to general emancipation fatigue and<br />
consumptionoriented indifference in our own privileged place in the world after the<br />
disasters of the first half of the twentieth century? It is worth rethinking and reconsidering<br />
these concepts. As her “human condition” furnished us with one of the basic<br />
thematic inspirations for this exhibition, Hannah Arendt can give us food for thought<br />
here as well. And as always, she thinks against the grain.<br />
1. Empathy: “I want to understand”<br />
If we understand empathy as empathetic, caring “compassion” or “pity,” Arendt immediately<br />
puts clear water between herself and a whole tradition of revolutionaries<br />
and social reformers who made sympathy with the suffering masses the basic motive<br />
of their thought and action. Compassion cannot be a political principle, according<br />
to Arendt. There is of course something scandalous in that. For Arendt, however, the<br />
issue is twofold, and both have to do with the emotional character of the compassion.<br />
The first point, which Arendt brings out mainly in her analysis of the French Revolution,<br />
concerns the flipover of sympathy with les misérables into a “policy of virtue” that<br />
can all too easily turn out to be a policy of terror. The Rousseauinspired leaders of<br />
the French Revolution offset their excessive demands in respect of the looming<br />
social question of the impoverished masses by the “immoderation of their emotions,<br />
which made [all] revolutionaries strangely insensitive to the actualities of the situation<br />
and above all to the reality of people, whom they were always willing to sacrifice<br />
for the cause or the course of history:2 Par pitié, par amour pour l’humanité, soyez<br />
inhumains!3<br />
The second point that concerns us more closely here is the actual nature of the<br />
compassion as an emotion. Arendt distinguishes between “feeling” and “passion.”<br />
By passion she means, like páthos in Greek, a kind of suffering, something I am drastically<br />
exposed to. Like Rousseau, she considers it a fundamental human characteristic<br />
to be overwhelmed by this emotion in the face of the suffering of others. Feeling on<br />
the other hand contains something selfreflective, a feeling of self, and is therefore<br />
exposed to sentimentality (which Rousseau and a whole generation after him likewise<br />
cultivated). Pity, which according to Arendt “keeps its object at a sentimental distance,”4<br />
therefore tends to revel in its own selffeeling, which almost automatically<br />
leads to glorifying the suffering of others. Arendt distinguishes this “sentimental<br />
sentimentality of pity” (mitleid) from the true passion of mit-leiden or “cosuffering,<br />
which forgets itself in passion.”5 In terms of political and dedicated action, however,<br />
she attributes to both variants a denial in favour of an attitude of solidarity. This does<br />
not feel “drawn to the weak,”6 but weighs up one passion against the other in freedom,<br />
and devises a permanent community of interests with the oppressed and exploited,<br />
over and above changes of moods and feelings. For Arendt, the thing is for a principle<br />
to inspire me from as it were the “outside,” since its idea remains constant, whereas<br />
feeling and passion motivate from the “inside” and are therefore more unreliable. My<br />
emotional motives may change, principles don’t.<br />
One can clearly see from these passages on what grounds Arendt prefers the principle<br />
of solidarity to the feeling of pity, and “reason” to the “emotions,” because the latter
200 — 201<br />
Sophie Loidolt<br />
Hannah Arendt<br />
(190675)<br />
7 Ibid., p. 113.<br />
8 Arendt, “Fernsehgespräch<br />
mit Günter Gaus,” p. 62.<br />
9 Arendt, Menschen in<br />
finsteren Zeiten, p. 30.<br />
are fickle, heteronomous, possibly complacent and above all manipulable. That does<br />
contain, for all the classic philosophical distrust of feeling, above all the grain of truth<br />
that the mediagenerated pity machinery may do a lot of good in humanitarian or other<br />
disasters by getting donations flowing, but attention soon shifts elsewhere and the<br />
emotions soon need to be fed once again with something new. In this case, pity does<br />
not lead to freedom. The victims are not liberated from their oppressive situation<br />
(as only permanent assistance could do that), and those who help at a distance are left<br />
with the discomfort of being exposed to a flood of images that ultimately show<br />
nothing except that one is powerless in the face of the enormous suffering around the<br />
world. Solidarity, to Arendt, is founded on principles of the greatness, honour and<br />
dignity of man and therefore seems colder and more abstract than specific pity – but it<br />
is these very principles however that “inspire and guide action”7 – while pity on the<br />
other hand remains frozen in (at worst, complacent) passivity or at best goes off in a<br />
fizz of action that may quickly peter out again, i.e. it is not “channelled.” So doesn’t<br />
empathy take us anywhere down the road to liberation?<br />
Arendt takes a different approach. The rejection of emotion as a political motive is not<br />
the whole story, and it would be rather a cliché to describe only Arendt in her sobriety<br />
as an abstract thinker. A statement by this thinker that has become wellknown is:<br />
“I want to understand.” And this process of understanding has nothing to do with cool<br />
rationalism. We might rather say that Arendt appropriated an entirely individual way<br />
of understanding that was dominated first and foremost by her encounter with the<br />
Holocaust, which had so directly affected her. “Something happened there none of us<br />
can cope with.”8<br />
Arendt countered her consternation with the active work of understanding. And this<br />
understanding – as works by Seyla Benhabib and in particular Peter Trawny have<br />
shown – is characterized by the ethical gesture of “narrative doing” (Benhabib) and<br />
the “hermeneutics of an understanding heart” (Trawny). At this point, at least two brief<br />
explanations are necessary.<br />
(1) In Arendt, understanding immediately turns into narration, i.e. understanding takes<br />
the form of narration. This narration has an ethical character, because it corresponds<br />
profoundly to the human condition: people exist in time, they are born, they die. Since<br />
they can speak and act, there is a story to be told about them. Arendt associates the<br />
ability to act, being able to make a start and introduce novelty into the world, with the<br />
conditionality of being born, which she calls natality. Arendt thus contrasts the classic<br />
“condition” of mortality and finiteness with natality. We are mortals, but equally we<br />
are creatures that can make a beginning. And only because we are mortal and beginners<br />
who appear on the world stage and as newcomers thrust our thread into the fabric<br />
of what exists, who live, dwell and leave works behind, acting and then disappearing<br />
again, can a story about each of us be told.<br />
In acting, you reveal most clearly “who you are.” You give information about your<br />
distinctive and unique individuality, which never merely coagulates in “character” but<br />
always bears the inaccessible event within. But since action is often dissipated in the<br />
selfforgetting of everyday life, the sense of what we do usually only becomes apparent<br />
in the subsequent narrative. Odysseus, writes Arendt in her Denktagebuch (Philosophical<br />
Diary), wept when a storyteller of the Phaeacians told the story of the defeat of Troy<br />
with the wooden horse trick. His tears were his admission that what happened was his<br />
bios, his life: “The tragic hero becomes cognisant when he reexperiences what he has<br />
done as suffering, and in this pathos, the suffering of done things, the weave of deeds<br />
first becomes an event.”9 The event only comes about from being moved by pathos<br />
as a possibility of “sense,” through which we not only act, but can also see ourselves<br />
as actors with a story. And this acceptance and elaboration of “sense” continues and
10 Op. cit., p. 31.<br />
11 Arendt, Das Urteilen, p. 16.<br />
12 Loc. cit.<br />
13 Arendt, Über die Revolution,<br />
p. 86.<br />
14 Cf. Trawny, Verstehen<br />
und Urteilen, p. 288.<br />
enables us to come to terms with the event and what has been done. The stranger’s<br />
sorrow is noted, and Odysseus is asked to say who he is and tell his story – which he<br />
immediately does. In this way, according to Arendt, another “transformation” takes<br />
place. Storytelling is on the one hand a way of understanding the sense of our actions<br />
in a web of human references in the first place, but on the other hand it is an ethical<br />
strategy that remains in life and in conversation with others:<br />
If there is ever such a thing as coping with the past, it lies in retelling what has<br />
happened. But this retelling, which shapes the story, solves no problems and eases<br />
no suffering. It does not sort anything out for good. In fact, as long as the meaning<br />
of what happened remains live – and this may involve very long periods – it prompts<br />
the endless retelling of the story. Poets in a very general way, and historiographers<br />
in a very specific sense, have a duty to initiate this storytelling and to guide us within<br />
it. And we, who are generally neither poets nor historians, know full well what is<br />
going on here from our own experience of life, where we too have a need to recall<br />
what mattered in our lives by telling or retelling it.10<br />
(2) Storytelling is above all telling the stories and deeds of others, particularly the<br />
deeds we consider memorable. Here again a characteristic feature of Arendt's storytelling<br />
ethos show through. It is targeted directly at history, the “pseudodivinity of the<br />
modern age.”11 The harshness of the notion of the “victors of history” is familiar. The<br />
losers are dead, forgotten or destroyed – not just physically wiped out but consigned<br />
to the darkness of oblivion as well, so that often not even the names of those who<br />
were murdered in the camps or killed on the battlefield or died in sheer poverty remain<br />
any more. We can regain our human dignity from this pseudodeity called history by<br />
retelling and judging, according to Arendt, by refusing it the right of Last Judgment.<br />
Arendt liked to quote in this connection a dictum by Cato: Victrix causa deis placuit,<br />
sed victa Catoni (“The victorious matter pleases the gods, but the defeated one<br />
pleases Cato”).12 Even if a good, bold, brave deed was doomed to defeat, even if it was<br />
“pointless” for the outcome of a story – we can judge it worth remembering and retelling.<br />
That is the protest of humanity against the history of the victors. We must not<br />
allow the criteria of our judgment to be prescribed by who was the stronger or the victor.<br />
We are not forced to think that only what is successful is good.<br />
Even in the face of wars, oppression and the crushing poverty of the present day in<br />
many parts of the world, storytelling is an important strategy against forgetting. The<br />
misfortune of poverty lies especially in the fact that “life has no consequence in the<br />
world, leaving no trace in it.”13 As Brecht said:<br />
For some are in the dark<br />
And others in the light.<br />
Those in the light are seen,<br />
Those in the dark are not.<br />
The process of understanding therefore means first and foremost telling a story. But<br />
storytelling never means just delineating. It requires not just judgment in the how of a<br />
story but more. The ethical element of this narrative understanding is judgment,14 by<br />
rising above the mere events of the story and delivering a judgment on them. In this<br />
sense, Arendt recalls that the Greek word historein (“investigate so as to tell how it<br />
was”) is originally found in Homer as histor and this histor in Homer is the judge. What<br />
it involves therefore is stepping back before the great painting of the event to view<br />
so as to glean the “sense” and reclaim it for humanity in judgment. It should never be<br />
forgotten that this process of judging and extracting meaning is for Arendt one that
202 — 203<br />
Sophie Loidolt<br />
Immanuel Kant<br />
(17241804)<br />
15 Cf. Trawny, Denkbarer<br />
Holocaust, p. 76.<br />
16 Cf. Kant, Kritik der<br />
Urteilskraft, B 158.<br />
can take place only in plurality – and that for Arendt “meaning” or “sense” is not about<br />
an absolute truth but the fact that people can be “at home” in a world, know the ropes,<br />
and be reconciled to what has happened by the very act of coming to a judgment about<br />
it. That is why it is about “thinking for oneself” and “coming to a conclusion,” just as in<br />
the process of exchange and discussion with Others. Arendt ascribes above all to poets<br />
(we might perhaps say in a broader sense, artists) an outstanding capacity for the<br />
first narration. They are most likely to be able to grasp the sense of the action because<br />
(ideally) they are free, i.e. because they are independent of both the scientific and<br />
the social consensus.15 But the power of judgment belongs to us all. This is not just a<br />
matter of being affected but of a first emancipation, a selfliberation for judgment. The<br />
empathy of understanding emancipates us to the extent that we can assume different<br />
positions in our thinking.<br />
2. Emancipation: thinking, acting, judging<br />
“Judge” here does not mean “condemn” or even “pass sentence.” Nor does it not merely<br />
mean to have an opinion considered your own. Judging is more of an active process,<br />
going through and weighing up many different points of view, pondering on your own<br />
perspective and taking in other people’s. Mental effort, imagination and reflection<br />
are required before you arrive at a judgment, having thought through your considered<br />
position and formed an opinion (as opposed to opinions that just occur to you or more<br />
or less burst out of you).<br />
Arendt develops her theory of judgment on the basis of the first part of Kant’s Critique<br />
of Judgement, which is about aesthetic judgments – because Kant was aware that in<br />
“judgments of taste” you can’t just simply apply categories to “cases,” realising that<br />
judgment here fulfils a very special, “reflective” task. That is why he calls these judgments<br />
where there are no general benchmarks for assessment “reflective judgments”<br />
as opposed to “determinative judgments,” which merely subsume and to that extent<br />
do not represent any challenge to one’s powers of judgement. Arendt is now of the<br />
opinion that basically the same criterion should apply to both aesthetic and political<br />
judgments, i.e. judgments about human affairs. In both cases, individual cases are<br />
involved. There is no striving for absolute truth. It is a widely disputed point, but<br />
although there can be no objective opinion, it is not all purely subjective, random and<br />
arbitrary, either.<br />
Reflective judgments are not in fact just a statement of a personal feeling, but very<br />
much emancipation from my direct affectedness so as to allow me a wider perspective,<br />
Kant’s erweiterte Denkungsart (expanded thinking).16 Arendt sticks closely to Kant<br />
here, who distinguishes between “sensory taste” and “reflective (considered) taste.”<br />
Sensory taste merely a personal feeling limited to my (or whoever’s) individual sensuality<br />
and expresses my arbitrary direct response to what affects me (for example, I<br />
like spinach). I’m not making a judgment here in a strict sense but just reproducing my<br />
state, confirming and asserting it – I am not distancing myself in any way from what<br />
directly appeals to me or repels me. Reflective (considered) taste, however, demands<br />
something quite different from me. It is not a direct response to a stimulus, but sets<br />
off a thought process in me, the result of which is a judgment that lays claim to intersubjective<br />
agreement (not absolute truth!). Only here am I really judging – I should<br />
really be speaking in the plural – only here is there something worth arguing about,<br />
which can be an object of communication over and beyond our personal sensuality. The<br />
communication is in fact not just about personal pleasurable sensations (which would<br />
become uninteresting very quickly – I like blue, you like yellow), but about things<br />
we can share, because or inasmuch as all of us have a detached attitude. The object or<br />
event is now seen from several sides. It is not a matter of reaching an objective truth
17 Scholem, Letter 64<br />
(23rd June 1963), p. 98.<br />
18 Arendt, Ich will verstehen,<br />
p. 35.<br />
19 Cf. Arendt, Vom Leben<br />
des Geistes, p. 14f.<br />
about the object, but imagining it in its pluralistic manifestations and then asking:<br />
What would my judgment be now?<br />
This exercise in thinking, taking in different points of view, Kant calls “operation of<br />
reflection,” the first step of which is to “teach your imagination to go visiting.” Arendt<br />
again links this with the figure of the blind poet (Homer), who is not directly affected by<br />
an action because his eyes are unseeing. This capacity for distancing and representation<br />
(where the imagination is in charge) brings us within a reasonable distance of the<br />
object. It creates the conditions for a relative impartiality without our becoming insensitive<br />
– because what is represented or reflected still affects me, arousing plea sure or<br />
aversion, only on another, mediated and not directly inevitable level.<br />
In a further step, the operation of reflection utilises Kant's principles of enlightened<br />
thinking: 1. to think for oneself (unprejudiced thinking), 2. putting oneself in the position<br />
of everyone else (expanded thinking), and 3. thinking in agreement with oneself (i.e. not<br />
contradicting oneself, being consistent). Now what does putting oneself in the position<br />
of everyone else mean? It cannot mean of course either thinking for other people or<br />
knowing exactly what other people feel or feeling in their place, feeling what they feel. In<br />
this sense, empathy does not come to bear, as Arendt stresses very clearly.<br />
It is more the case that I understand where the other person is coming from, and that<br />
that is a different part of the world from mine, where things look different. What<br />
it means is being able to adopt a different perspective on the world. In this context,<br />
independent thought is still required. How I would think and judge in that position?<br />
Without that possibility, I would have to consider any other judgment from anyone correct,<br />
or rather, out of reach of my judgment and therefore correct. The consequence would<br />
be that there is basically nothing in common that we could judge and argue about so<br />
splendidly. There would no longer be any sensus communis, i.e. consensus – the thing I<br />
expect from others when I put forward my judgment (according to Kant). Says Arendt,<br />
we would no longer have a world in common (in the sense of a web of references), which<br />
is created only through shared communication about this world, and is constantly being<br />
created afresh and dynamically changing. Instead, we would all be firmly cooped up in<br />
our own sensus privatus (private perception, or logical idiosyncracy), which would rapidly<br />
lapse into rampant ideological idiosyncracy that no longer allows any other views to<br />
intrude. Kant diagnoses this as a symptom of madness.<br />
That is why Arendt finds it so important to emphasise that such judgment, which at<br />
least tries to put itself in the position of others, is essential if we are to shoulder “care<br />
for the world” together with others. In this sense, she also responds to Gershom Scholem<br />
(who said of the Eichmann controversy: “I do not presume to judge. I was not there.”):17<br />
“And if you are perhaps right that there cannot yet be a ‘balanced judgement,’ though<br />
I doubt it, I believe that we will only be able to come to terms with this past when we<br />
begin to judge, and do so forcefully.”18 Thus for Arendt it is not a matter of the ultimate<br />
validity of the decision or the fear of making incorrect judgments but of holding fast<br />
to the judgment process. For her, not judging any more is far more dangerous. And not<br />
only because judgment is necessary for reconciliation, so that punishment or forgiveness<br />
may follow. Arendt diagnosed the inability to think and judge for oneself as coincidental<br />
with (or perhaps first apparent in) the rise of totalitarianism and the simul taneous<br />
collapse of the old system of values. The Eichmann phenomenon, according to Arendt,<br />
was characterized mainly by the incapacity or switching off (or at any rate, nonuse) of<br />
personal powers of judgment.19<br />
Emancipation, which takes place therefore in the process of understanding and judging,<br />
is emancipation from being shut up in one’s own viewpoint and selfliberation towards<br />
the shared world. This mutuality is not absolute or monolithic, tantamount to an
204 — 205<br />
Sophie Loidolt<br />
Daniel Wiesenfeld,<br />
animal laborans: Putzfrau, 2006<br />
Oil on canvas; 120 × 200 cm<br />
Daniel Wiesenfeld,<br />
animal laborans: Büro, 2006<br />
Oil on canvas; 120 × 200 cm<br />
20 Arendt, Vita activa, p. 157.<br />
21 Kant, Kritik der Urteilskraft,<br />
B 28.<br />
22 Ibid., B 122. Judgment would<br />
thus consist of building an image<br />
that cannot make use of the<br />
direct instincts of the masses –<br />
and nonetheless does not retreat<br />
into an elitist ivory tower but<br />
stands up to public evaluation<br />
and capacity for approval.<br />
23 Arendt, Was ist Politik?, p. 181.<br />
In this fragmentary text,<br />
Arendt is oriented to Nietzsche.<br />
24 Arendt, Verstehen und Politik,<br />
p. 126.<br />
25 Cf. Trawny, Verstehen und<br />
Urteilen, p. 286f.<br />
obligation for consensus, but a “between” that remains permanently in negotiation<br />
and has a sense and worldcreating function, as long as communication and living<br />
judgment remain intact. For this emancipation, we need empathy not in the sense<br />
of compassion or feeling with others, but in the sense of understanding and judging.<br />
Different viewpoints should not be merged into a single viewpoint. They should<br />
open up a between-space of communication, the only place where solutions can be<br />
found in which others do not feel pushed about or infantilised. For this we need the<br />
erweiterte Denkungsart, expanded thinking, which we need to practise and put to<br />
the test in stories, judgments and discussions. Without these, we will never be able<br />
to get through or speak to anyone else so that they understand us, and ultimately<br />
never be able to understand ourselves what common world is and can be – over and<br />
beyond a divided globe.<br />
Judgment thus does not mean being emancipated over the backs of sufferers as merely<br />
unfeeling spectators, but means, according to Arendt, responsibly accepting the job<br />
of understanding the sense, keeping open the “between space” and shouldering the<br />
“care for the world.” Emancipation must therefore have yet another dimension, i.e.<br />
action. And action means for Arendt always acting with each other, i.e. neither against<br />
each other nor for each other. The pure intention of “for” – the good deed – is not<br />
that what Arendt considers the highest form of freedom, which she calls the “sense of<br />
politics.” It is more a matter of “acting in concert,” the experience of achieving something<br />
together, starting something new, and changing the world.<br />
3. “Caring for the world” in times of globalisation?<br />
But is that still possible in a globalised world? Are we able to act at all and change<br />
anything, or are there in fact simply processes under way (economic processes, natural<br />
processes, etc) we can no longer react to? Hannah Arendt warned us of this more<br />
than 50 years ago. It does not have always to be totalitarianism that forces a single<br />
relentless face on the world. The oikonomia (household management, i.e. life) forces us<br />
with as great an imperative today – but now on a globalised dimension – into a single<br />
perspective that makes multiple perspectives obsolete and finally makes us forget that<br />
we were indeed always able to “make a new start.”<br />
Emancipation is in this sense also liberation from the imperative, or rather, liberation<br />
from the perspective in which certain things appear to us as unalterable imperatives.<br />
Arendt calls this perspective that of the animal laborans, the working creature, which<br />
sees fastmoving consumer goods in everything and is completely harnessed into the<br />
processual nature of producing and consuming. Modern life in western, capitalist mass<br />
societies is according to Arendt characterised by the outlook of the job holder, whose<br />
sole individual decision consists of giving up his own identity in order to function<br />
automatically in the stream of life and numb his own senses. Leisure, which we acquire<br />
at the expense of others, does not release us for the “higher” things (as Marx hoped),<br />
but is “never used for anything than consumption, and the more time is left [to animal<br />
laborans], the greedier and more menacing his wishes and appetite become.”20 This<br />
shiftingsand world ultimately also harbours the embryos of the “banality of evil” that<br />
Arendt criticised so prominently in another place. In it, the capacities that respond<br />
to the basic condition of plurality are lost. Judgement fatigue culminates in abstention<br />
from judgement, acting is swapped for mere “behaviour” and the multiple perspective<br />
of the world is standardised into a streamlined process of life and consumer behaviour.<br />
Arendt talks of an “atrophy of experience.”<br />
It sounds easier than it is to emancipate oneself from this climate of atrophied experience<br />
and (pseudotolerant) indifference. The world in which we live “does something
Literature<br />
Hannah Arendt, Das Urteilen. Texte<br />
zu Kants politischer Philosophie,<br />
ed. and with an essay by Ronald Beiner,<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 1998.<br />
Hannah Arendt, Denktagebuch<br />
1950–1973, ed. by Ursula Ludz and<br />
Ingeborg Nordmann, New York & Munich:<br />
Piper Verlag, 2002.<br />
Hannah Arendt, Ich will verstehen.<br />
Selbstauskünfte zu Leben und Werk,<br />
ed. by Ursula Ludz, Munich & Zurich:<br />
Piper Verlag, 1996.<br />
Hannah Arendt, Menschen in finsteren<br />
Zeiten (Men in Dark Times, New York<br />
1968), ed. by Ursula Ludz,<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 1989.<br />
Hannah Arendt, Über die Revolution<br />
(On Revolution, New York 1963),<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 1994.<br />
Hannah Arendt, Vita activa. Vom tätigen<br />
Leben (<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>, Chicago 1958),<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 1981.<br />
Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes.<br />
Das Denken. Das Wollen (Life of the Mind,<br />
New York 1978), ed. by Mary McCarthy,<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 1981.<br />
Hannah Arendt, Was ist Politik?<br />
Fragmente aus dem Nachlass, ed. by<br />
Ursula Ludz, foreword by Kurt Sontheimer,<br />
Munich & Zurich: Piper Verlag, 2003.<br />
Hannah Arendt, “Fernsehgespräch mit<br />
Günter Gaus,” in: Hannah Arendt, Ich will<br />
verstehen. Selbstauskünfte zu Leben<br />
und Werk, ed. by Ursula Ludz, Munich &<br />
Zurich: Piper Verlag, 1996, pp. 46–72.<br />
Hannah Arendt, “Kultur und Politik,” in:<br />
Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit<br />
und Zukunft. Übungen im politischen<br />
Denken I, ed. by Ursula Ludz, Munich &<br />
Zurich: Piper Verlag, 1994, pp. 277–304.<br />
Hannah Arendt, “Verstehen und Politik,”<br />
in: Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit<br />
und Zukunft. Übungen im politischen<br />
Denken I, ed. by Ursula Ludz, Munich &<br />
Zurich: Piper Verlag, 1994, pp.110–127.<br />
Seyla Benhabib, Hannah Arendt. Die<br />
melancholische Denkerin der Moderne,<br />
Hamburg: Rotbuch, 1998.<br />
Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft<br />
(Critique of Judgment), ed. by<br />
Wilhelm Weischedel, Werkausgabe X,<br />
Frankfurt: Suhrkamp, 1974.<br />
Gershom Scholem, Briefe. Band II,<br />
194870, ed. by Itta Shedletzky, Munich:<br />
Beck Verlag, 1995.<br />
Peter Trawny, Denkbarer Holocaust.<br />
Die politische Ethik Hannah Arendts,<br />
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005.<br />
Peter Trawny, “Verstehen und Urteilen.<br />
Hannah Arendts Interpretation der<br />
Kantischen ‘Urteilskraft’ als politischethische<br />
Hermeneutik,” in: Zeitschrift für<br />
philosophische Forschung 60/2, 2006,<br />
pp. 269–289.<br />
to us.” It roosts in our deepest psyche, structures and shapes our feelings, and even<br />
being flushed out becomes a kind of routine that requires the loudspeaker control<br />
to be adjusted more and more frenetically. In our lethargic democracies, politics and<br />
the media therefore work more strongly and principally with “appeal and emotion”21<br />
(to quote a term of Kant again), and make use of the “melting emotion,”22 which is more<br />
likely to generate intellectual “deserts”23 (Arendt) than specific action and discussion<br />
spaces. At the same time, there is growing distrust of the public political arena<br />
as a place to negotiate affairs that affect everyone. The more opportunities we have<br />
for communication, the more the space for qualified public communication seems to<br />
shrink – or indeed undergo fundamental change. Here of course we cannot go into the<br />
question as to how these changes ultimately affect politics qua the koinon (the common<br />
polity) in our societies and on the whole world. However, we can at any rate say that<br />
“public space” such as Arendt imagined it has thoroughly changed as a result of blogs,<br />
Twitter and YouTube, and does not always generate an unhealthy mixture of “private”<br />
and “public” (if these were indeed ever so clearly distinguishable). We have and can<br />
endeavour therefore to leave space open for judgement and action within these indecidabilities<br />
that really enables a “between” of plural perspectives as “world,” and not<br />
just allows us the illusion of a networked globe flickering across our screens in a flood<br />
of virtual imagery.<br />
At the same time – to return once again to Arendt’s variant of empathy – it is also a<br />
question of seeking an “understanding heart,” as did King Solomon, whose story Arendt<br />
emphatically quotes in her essay on understanding and politics. The “understanding<br />
heart” is the “greatest gift a human being can receive or desire. … Only the human<br />
heart – as far removed from sentimentality as from all written material – is ready to<br />
carry the burden in the world that the divine gift of action, of being a beginning, and<br />
therefore of the capacity to start over, has imposed on us.”24 According to Arendt, we<br />
need our powers of judgement, plus the assistance of the understanding heart as a<br />
capability over and beyond the “head” and “gut instinct,” as the capability that resides<br />
between the merely intellectual and the merely emotional, and in understanding does<br />
not lose strength to act. This understanding may demand practical consequences,25<br />
particularly in a world in which we are no longer prima facie “local” and which can<br />
become eerie and desolate in its globalism; a world in which the current categories and<br />
criteria, the old traditions and metaphysical images of world and history have broken<br />
off and/or are increasingly globally deconstructed. The reflecting powers of judgement<br />
and the understanding heart are particularly required where we have no handrails.
The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Hannah Arendt
2. Augustine, who is usually credited<br />
with having been the first to<br />
raise the so-called anthropological<br />
question in philosophy, knew<br />
this quite weIl. He dis tinguishes<br />
between the questions of “Who<br />
am I?” and “What am I?” the first<br />
being directed by man at himself<br />
(“And I directed myself at myself<br />
and said to me: You, who are you?<br />
And I answered: A man” - tu, quis<br />
es? (Confessions x. 6]) and the<br />
second being addressed to God<br />
(“What then am I, my God? What<br />
is my nature?” - Quid “ergo sum,<br />
Deus meus? Quae natura sum?<br />
(x. 17]). For in the “great mystery,”<br />
the grande profudum, which man<br />
is (iv. 14), there is “some thing of<br />
man (aliquid hominis] which the<br />
spirit of man which is in him itself<br />
knoweth not. But Thou, Lord, who<br />
has made him (fecisti eum] knowest<br />
every thing of him [eius omnia)”<br />
(x. 5). Thus, the most familiar of<br />
these phrases which I quoted in<br />
the text, the questio mihi factus<br />
sum, is a question raised in the<br />
pres ence of God, “in whose eyes<br />
I have become a question for<br />
myself” (x. 33). In brief, the answer<br />
to the question “Who am I?” is<br />
simply: “You are a man - whatever<br />
that may be”; and the answer to<br />
the question “What am I?” can be<br />
given only by God who made man.<br />
The question about the nature of<br />
man is no less a theological question<br />
than the question about the<br />
nature of God; both can be settled<br />
only within the framework of a<br />
divinely revealed answer.<br />
Chapter 1<br />
The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
1 Vita Activa and the human condition (excerpt)<br />
The human condition comprehends more than the conditions under which life has been<br />
given to man. Men are conditioned beings because everything they come in contact<br />
with turns imme diately into a condition of their existence. The world in which the vita<br />
activa spends itself consists of things produced by human ac tivities; but the things<br />
that owe their existence exclusively to men nevertheless constantly condition their<br />
human makers. In addition to the conditions under which life is given to man on earth,<br />
and partly out of them, men constantly create their own, self-made conditions, which,<br />
their human origin and their variability not withstanding, possess the same conditioning<br />
power as natural things. Whatever touches or enters into a sustained relationship with<br />
human life immediately assumes the character of a condition of human existence. This<br />
is why men, no matter what they do, are always conditioned beings. Whatever enters<br />
the human world of its own accord or is drawn into it by human effort becomes part<br />
of the human condition. The impact of the world’s reality upon human existence is feIt<br />
and received as a conditioning force. The objectivity of the world - its object- or thingcharacter<br />
- and the human condition supplement each other; because human existence<br />
is conditioned existence, it would be impossible without things, and things would be<br />
a heap of unrelated articles, a non-world, if they were not the conditioners of human<br />
existence.<br />
To avoid misunderstanding: the human condition is not the same as human nature, and<br />
the sum total of human activities and capabilities which correspond to the human<br />
condition does not con stitute anything like human nature. For neither those we discuss<br />
here nor those we leave out, like thought and reason, and not even the most meticulous<br />
enumeration of them all, constitute essential characteristics of human existence in the<br />
sense that without them this existence would no longer be human. The most radical<br />
change in the human condition we can imagine would be an emigration of men from the<br />
earth to some other planet. Such an event, no longer totally impossible, would imply<br />
that man would have to live under man-made conditions, radically different from those<br />
the earth offers him. Neither labor nor work nor action nor, indeed, thought as we<br />
know it would then make sense any longer. Yet even these hypothetical wanderers<br />
from the earth would still be human; but the only statement we could make regarding<br />
their “nature” is that they still are conditioned beings, even though their condition is<br />
now self-made to a considerable extent.<br />
The problem of human nature, the Augustinian quaestio mihi factus sum (“a question<br />
have I become for myself”), seems un answerable in both its individual psychological<br />
sense and its gen eral philosophical sense. lt is highly unlikely that we, who can know,<br />
determine, and define the natural essences of all things sur rounding us, which we<br />
are not, should ever be able to do the same for ourselves - this would be like jumping<br />
over our own shadows. Moreover, nothing entitles us to assume that man has a nature<br />
or essence in the same sense as other things. In other words, if we have a nature<br />
or essence, then surely only a god could know and define it, and the first prerequisite<br />
would be that he be able to speak about a “who” as though it were a “what.”2 The<br />
perplexity is that the modes of human cognition applicable to things with “natural”<br />
qualities, including ourselves to the limited extent that we are specimens of the most<br />
highly developed species of organic life, fail us when we raise the question: And<br />
who are we? This is why attempts to define human nature almost invariably end with<br />
some construction of a deity, that is, with the god of the philoso phers, who, since<br />
Plato, has revealed himself upon closer inspec tion to be a kind of Platonic idea of man.
208 — 209<br />
Hannah Arendt<br />
Of course, to demask such philosophic concepts of the divine as conceptualizations<br />
of human capabilities and qualities is not a demonstration of, not even an argument<br />
for, the non-existence of God; but the fact that attempts to define the nature of<br />
man lead so easily into an idea which defi nitely strikes us as “superhuman” and<br />
therefore is identified with the divine may cast suspicion upon the very concept of<br />
“human nature.”<br />
On the other hand, the conditions of human existence - life it self, natality and mortality,<br />
worldliness, plurality, and the earth - can never “explain” what we are or answer the<br />
question of who we are for the simple reason that they never condition us absolute ly.<br />
This has always been the opinion of philosophy, in distinction from the sciencesanthropology,<br />
psychology, biology, etc. which also concern themselves with man. But<br />
today we may al most say that we have demonstrated even scientifically that, though<br />
we live now, and probably always will, under the earth’s conditions, we are not<br />
mere earth-bound creatures. Modern nat ural science owes its great triumphs to having<br />
looked upon and treated earth-bound nature from a truly universal viewpoint, that<br />
is, from an Archimedean standpoint taken, wilfully and explicitly, outside the earth.<br />
Chapter 5<br />
Action<br />
All sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them.<br />
Isak Dinesen<br />
Nam in omni actione principaliter intenditur ab agente, sive necessitate naturae<br />
sive voluntarie agat, propriam similitudinem explicare; unde fit quod omne agens, in<br />
quantum huiusmodi, delectatur, quia, cum omne quod est appetat suum esse, ac in<br />
agendo agentis esse modammodo amplietur, sequitur de ne cessitate delectation. ...<br />
Nihil igitur agit nisi tale exi stens quale patiens fieri debet.<br />
(For in every action what is primarily intended by the doer, whether he acts from<br />
natural necessity or out of free will, is the disclosure of his own image. Hence it comes<br />
about that every doer, in so far as he does, takes delight in doing; since everything<br />
that is desires its own being, and since in action the being of the doer is somehow<br />
inten sified, delight necessarily follows … Thus, nothing acts unless [by acting) it makes<br />
patent its latent self.)<br />
Dante<br />
24 The disclosure of the agent in speech and action<br />
<strong>Human</strong> plurality, the basic condition of both action and speech, has the twofold character<br />
of equality and distinction. If men were not equal, they could neither understand<br />
each other and those who came before them nor plan for the future and foresee the<br />
needs of those who will come after them. If men were not dis tinct, each human being<br />
distinguished from any other who is, was, or will ever be, they would need neither<br />
speech nor action to make themselves understood. Signs and sounds to communicate<br />
immediate, identical needs and wants would be enough.<br />
<strong>Human</strong> distinctness is not the same as otherness - the curious quality of alteritas<br />
possessed by everything that is and therefore, in medieval philosophy, one of the four<br />
basic, universal charac teristics of Being, transcending every particular quality. Otherness,<br />
it is true, is an important aspect of plurality, the reason why all our definitions<br />
are distinctions, why we are unable to say what anything is without distinguishing<br />
it from something else. Other ness in its most abstract form is found only in the sheer<br />
multipli cation of inorganic objects, whereas all organic life already shows variations
1 This description is supported<br />
by recent findings in psychology<br />
and biology which also stress the<br />
inner affinity between speech and<br />
action, their spontaneity and practical<br />
purposelessness. See especially<br />
Amold Gehlen, Der Mensch:<br />
Seine Natur und seine Stellung in<br />
der Welt (1955), which gives an<br />
excellent summary of the results<br />
and interpretations of current<br />
scientific research and contains<br />
a wealth of valuable insights.<br />
That Gehlen, like the scientists<br />
upon whose results he bases his<br />
own theories, believes that these<br />
specifically human capabilities<br />
are also a “biological necessity,”<br />
that is, necessary for a biologically<br />
weak and ill-fitted organism<br />
such as man, is another matter<br />
and need not concern us here.<br />
2 De civitate Dei xii. 20.<br />
3 According to Augustine, the two<br />
were so different that he used<br />
a different word to indicate the<br />
beginning which is man (initium),<br />
designating the beginning of the<br />
world by principium, which is the<br />
standard translation for the first<br />
Bible verse. As can be seen from<br />
De civitate Dei xi. 32, the word<br />
principium carried for Augustine<br />
a much less radical meaning; the<br />
beginning of the world “does not<br />
mean that nothing was made<br />
before (for the angels were),”<br />
whereas he adds explicitly in the<br />
phrase quoted above with reference<br />
to man that nobody was<br />
before him.<br />
and distinctions, even between specimens of the same species. But only man can<br />
express this distinction and distinguish himself, and only he can communicate himself<br />
and not merely something - thirst or hunger, affection or hostility or fear. In man,<br />
other ness, which he shares with everything that is, and distinct ness, which he shares<br />
with everything alive, become uniqueness, and human plurality is the paradoxical<br />
plurality of unique beings.<br />
Speech and action reveal this unique distinctness. Through them, men distinguish<br />
themselves instead of being merely dis tinct; they are the modes in which human<br />
beings appear to each other, not indeed as physical objects, but qua men. This appearance,<br />
as distinguished from mere bodily existence, rests on initiative, but it is an initiative<br />
from which no human being can refrain and still be human. This is true of no other<br />
activity in the vita activa. Men can very weIl live without laboring, they can force others<br />
to labor for them, and they can very weIl decide merely to use and enjoy the world of<br />
things without themselves adding a single useful object to it; the life of an exploiter or<br />
slave holder and the life of a parasite may be unjust, but they certainly are human.<br />
A life without speech and without action, on the other hand - and this is the only way<br />
of life that in earnest has re nounced all appearance and all vanity in the biblical sense<br />
of the word - is literally dead to the world; it has ceased to be a human life because it<br />
is no Ionger lived among men.<br />
With word and deed we insert ourselves into the human world, and this insertion is<br />
like a second birth, in which we confirm and take upon ourselves the naked fact of our<br />
original physical appearance. This insertion is not forced upon us by necessity, like<br />
labor, and it is not prompted by utility, like work. It may be stimulated by the presence<br />
of others whose company we may wish to join, but it is never conditioned by them; its<br />
impulse springs from the beginning which came into the world when we were born and<br />
to which we respond by beginning something new on our own initiative.1 To act, in<br />
its most general sense, means to take an initiative, to begin (as the Greek word archein,<br />
“to begin,” “to lead,” and eventually “to rule,” indicates), to set something into motion<br />
(which is the original meaning of the Latin agere). Because they are initium, newcomers<br />
and beginners by virtue of birth, men take initiative, are prompted into action. [Initium]<br />
ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit (“that there be a beginning,<br />
man was created before whom there was nobody”), said Augustine in his political<br />
philosophy.2 This beginning is not the same as the beginning of the world;3 it is not the<br />
beginning of something but of somebody, who is a beginner himself. With the creation<br />
of man, the principle of beginning came into the world itself, which, of course, is<br />
only another way of saying that the principle of freedom was created when man was<br />
created but not before.<br />
It is in the nature of beginning that something new is started which cannot be<br />
expected from whatever may have happened before. This character of startling unexpectedness<br />
is inherent in all beginnings and in all origins. Thus, the origin of life from<br />
inorganic matter is an infinite improbability of inorganic proc esses, as is the coming<br />
into being of the earth viewed from the standpoint of processes in the universe, or<br />
the evolution of human out of animal life. The new always happens against the overwhelming<br />
odds of statistical laws and their probability, which for all practical, everyday<br />
purposes amounts to certainty; the new therefore always appears in the guise of<br />
a miracle. The fact that man is capable of action means that the unexpected can be<br />
expected from him, that he is able to perform what is infinitely improbable. And this<br />
again is possible only because each man is unique, so that with each birth something<br />
uniquely new comes into the world. With respect to this somebody who is unique<br />
it can be truly said that nobody was there before. If action as beginning corresponds<br />
to the fact of birth, if it is the actualization of the human condition of natality, then<br />
speech corresponds to the fact of distinctness and is the actualization of the human
210 — 211<br />
Hannah Arendt<br />
4 This is the reason why Plato<br />
says that lexis (“speech”) adheres<br />
more closely to truth than praxis.<br />
condition of plurality, that is, of living as a distinct and unique being among equals.<br />
Action and speech are so closely related because the primordial and specifically<br />
human act must at the same time contain the answer to the question asked of every<br />
newcomer: “Who are you?” This disclosure of who somebody is, is implicit in both his<br />
words and his deeds; yet obviously the affinity between speech and revelation is much<br />
closer than that between action and reve lation,4 just as the affinity between action<br />
and beginning is closer than that between speech and beginning, although many, and<br />
even most acts, are performed in the manner of speech. Without the accompaniment of<br />
speech, at any rate, action would not only lose its revelatory character, but, and by the<br />
same token, it would lose its subject, as it were; not acting men but performing robots<br />
would achieve what, humanly speaking, would remain incompre hensible. Speechless<br />
action would no Ionger be action because there would no longer be an actor, and the<br />
actor, the doer of deeds, is possible only if he is at the same time the speaker of words.<br />
The action he begins is humanly disclosed by the word, and though his deed can be<br />
perceived in its brute physical appear ance without verbal accompaniment, it becomes<br />
relevant only through the spoken word in which he identifies himself as the actor,<br />
announcing what he does, has done, and intends to do.<br />
No other human performance requires speech to the same extent as action. In all other<br />
performances speech plays a subordi nate role, as a means of communication or a mere<br />
accompaniment to something that could also be achieved in silence. It is true that speech<br />
is extremely useful as a means of communication and in formation, but as such it could<br />
be replaced by a sign language, which then might prove to be even more useful and<br />
expedient to convey certain meanings, as in mathematics and other scientific disciplines<br />
or in certain forms of teamwork. Thus, it is also true that man’s capacity to act, and<br />
especially to act in concert, is extremely useful for purposes of self-defense or of pursuit<br />
of interests but if nothing more were at stake here than to use action as a means to an<br />
end, it is obvious that the same end could be much more easily attained in mute violence,<br />
so that action seems a not very efficient substitute for violence, just as speech, from the<br />
viewpoint of sheer utility, seems an awkward substitute for sign language.<br />
In acting and speaking, men show who they are, reveal actively their unique personal<br />
identities and thus make their appearance in the human world, while their physical<br />
identities appear without any activity of their own in the unique shape of the body and<br />
sound of the voice. This disclosure of “who” in contradistinction to “what” somebody<br />
is – his qualities, gifts, talents, and short comings, which he may display or hide –<br />
is implicit in everything somebody says and does. It can be hidden only in complete<br />
silence and perfect passivity, but its disclosure can almost never be achieved as a<br />
wilful purpose, as though one possessed and could dispose of this “who” in the same<br />
manner he has and can dispose of his qualities. On the contrary, it is more than likely<br />
that the “who,” which appears so clearly and unmistakably to others, remains hidden<br />
from the person himself, like the daimon in Greek religion which accompanies each<br />
man throughout his life, always looking over his shoulder from behind and thus visible<br />
only to those he encounters.<br />
This revelatory quality of speech and action comes to the fore where people are with<br />
others and neither for nor against them - that is, in sheer human togetherness.<br />
Although nobody knows whom he reveals when he discloses himself in deed or word,<br />
he must be willing to risk the disclosure, and this neither the doer of good works,<br />
who must be without self and preserve complete anonymity, nor the criminal, who<br />
must hide himself from others, can take upon themselves. Both are lonely figures, the<br />
one being for, the other against, all men; they, therefore, remain outside the pale of<br />
human intercourse and are, politically, marginal figures who usually enter the historical<br />
scene in times of corruption, dis integration, and political bankruptcy. Because of its<br />
inherent tendency to disclose the agent together with the act, action needs for its full
5 William Faulkner’s A Fable<br />
(1954) surpasses almost all of<br />
World War I literature in perceptiveness<br />
and clarity because<br />
its hero is the Unknown Soldier.<br />
6 Oute legei oute kryptei alla<br />
sēmainei (Diels, Fragmente der<br />
Vorsokratiker [4th ed., 1922],<br />
frag. B93).<br />
7 Socrates used the same word<br />
as Heraclitus, sēmainein (“to show<br />
and give signs”), for the manifestation<br />
of his daimonion (Xenophon<br />
Memorabilia i. 1.2,4). If we are to<br />
trust Xenophon, Socrates likened<br />
his daimonion to the oracles and<br />
insisted that both should be used<br />
only for human affairs, where<br />
nothing is certain, and not for<br />
problems of the arts and crafts,<br />
where everything is predictable(7-9.<br />
ibid.).<br />
appearance the shining brightness we once called glory, and which is possible only in<br />
the public realm.<br />
Without the disclosure of the agent in the act, action loses its specific character and<br />
becomes one form of achievement among others. It is then indeed no less a means to<br />
an end than making is a means to produce an object. This happens whenever human<br />
togetherness is lost, that is, when people are only for or against other people, as for<br />
instance in modern warfare, where men go into action and use means of violence in<br />
order to achieve certain objectives for their own side and against the enemy. In these<br />
instances, which of course have always existed, speech becomes indeed “mere talk,”<br />
simply one more means toward the end, whether it serves to deceive the enemy or to<br />
dazzle everybody with propaganda; here words reveal nothing, disclosure comes only<br />
from the deed itself, and this achievement, like all other achievements, cannot disclose<br />
the “who,” the unique and distinct identity of the agent.<br />
In these instances action has lost the quality through which it transcends mere productive<br />
activity, which, from the humble making of use objects to the inspired creation<br />
of art works, has no more meaning than is revealed in the finished product and does<br />
not intend to show more than is plainly visible at the end of the production process.<br />
Action without a name, a “who” attached to it, is meaningless, whereas an art work<br />
retains its relevance whether or not we know the master’s name. The monuments to<br />
the “Unknown Soldier” after World War I bear testimony to the then still existing need<br />
for glorification, for finding a “who,” an identifiable somebody whom four years of<br />
mass slaughter should have revealed. The frustration of this wish and the unwillingness<br />
to resign oneself to the brutal fact that the agent of the war was actually nobody<br />
inspired the erection of the monuments to the “unknown,” to all those whom the war<br />
had failed to make known and had robbed thereby, not of their achievement, but of<br />
their human dignity.5<br />
25 The web of relationships and the enacted stories<br />
The manifestation of who the speaker and doer unexchangeably is, though it is plainly<br />
visible, retains a curious intangibility that confounds all efforts toward unequivocal verbal<br />
expression. The moment we want to say who somebody is, our very vocabulary leads us<br />
astray into saying what he is; we get entangled in a de scription of qualities he necessarily<br />
shares with others like him; we begin to describe a type or a “character” in the old meaning<br />
of the word, with the result that his specific uniqueness escapes us.<br />
This frustration has the closest affinity with the well-known philosophic impossibility<br />
to arrive at a definition of man, all defi nitions being determinations or interpretations<br />
of what man is, of qualities, therefore, which he could possibly share with other living<br />
beings, whereas his specific difference would be found in a determination of what<br />
kind of a “who” he is. Yet apart from this philosophic perplexity, the impossibility, as<br />
it were, to solidify in words the living essence of the person as it shows itself in the<br />
flux of action and speech, has great bearing upon the whole realm of human affairs,<br />
where we exist primarily as acting and speaking beings. It excludes in principle our ever<br />
being able to handle these affairs as we handle things whose nature is at our disposal<br />
because we can name them. The point is that the manifes tation of the “who” comes<br />
to pass in the same manner as the no toriously unreliable manifestations of ancient<br />
oracles, which, ac cording to Heraclitus, “neither reveal nor hide in words, but give<br />
manifest signs.”6 This is a basic factor in the equally notorious uncertainty not only<br />
of all political matters, but of all affairs that go on between men directly, without the<br />
intermediary, stabilizing, and solidifying influence of things.7<br />
This is only the first of many frustrations by which action, and consequently the<br />
togetherness and intercourse of men, are ridden. It is perhaps the most fundamental
212 — 213<br />
Hannah Arendt<br />
8 Materialism in political theory<br />
is at least as old as the Platonic-<br />
Aristotelian assumption that<br />
political communities (poleis) -<br />
and not only family life or the<br />
coexistence of several households<br />
(oikiai) – owe their existence to<br />
material neces sity. (For Plato see<br />
Republic 369, where the polis’ origin<br />
is seen in our wants and lack<br />
of self-sufficiency. For Aristotle,<br />
who here as elsewhere is closer to<br />
current Greek opinion than Plato,<br />
see Politics 1252b29: “The polis<br />
comes into existence for the sake<br />
of living, but remains in existence<br />
for the sake of living well.”) The<br />
Aristotelian concept of sympheron,<br />
which we later encounter in Cicero’s<br />
utilitas, must be understood<br />
in this context. Both, in turn, are<br />
forerunners of the later interest<br />
theory which is fully developed<br />
as early as Bodin - as kings rule<br />
over peoples, Interest rules over<br />
kings. In the modern development,<br />
Marx is outstand ing not because<br />
of his materialism, but because he<br />
is the only political thinker who<br />
was consistent enough to base<br />
his theory of material interest on<br />
a demonstrably material human<br />
activity, on laboring - that is, on<br />
the metabolism of the human<br />
body with matter.<br />
of those we shall deal with, in so far as it does not rise out of comparisons with more<br />
reliable and productive activities, such as fabrication or contemplation or cognition or<br />
even labor, but indicates something that frustrates action in terms of its own purposes.<br />
What is at stake is the revela tory character without which action and speech would<br />
lose all human relevance.<br />
Action and speech go on between men, as they are directed toward them, and they<br />
retain their agent-revealing capacity even if their content is exclusively “objective,”<br />
concerned with the matters of the world of things in which men move, which<br />
physi cally lies between them and out of which arise their specific, ob jective, worldly<br />
interests. These interests constitute, in the word’s most literal significance, something<br />
which inter-est, which lies be tween people and therefore can relate and bind<br />
them together. Most action and speech is concerned with this in-between, which<br />
varies with each group of people, so that most words and deeds are about some<br />
worldly objective reality in addition to being a disclosure of the acting and speaking<br />
agent. Since this disclosure of the subject is an integral part of all, even the most<br />
“objective” intercourse, the physical, worldy in-between along with its interests<br />
is overlaid and, as it were, overgrown with an altogether dif ferent in-between which<br />
consists of deeds and words and owes its origin exclusively to men’s acting and<br />
speaking directly to one another. This second, subjective in-between is not tangible,<br />
since there are no tangible objects into which it could solidify; the process of<br />
acting and speaking can leave behind no such results and end products. But for all<br />
its intangibility, this in-between is no less real than the world of things we visibly<br />
have in common. We call this reality the “web” of human relationships, indicating by<br />
the metaphor its somewhat intangible quality.<br />
To be sure, this web is no less bound to the objective world of things than speech is to<br />
the existence of a living body, but the rela tionship is not like that of a facade or, in<br />
Marxian terminology, of an essentially superfluous superstructure affixed to the useful<br />
structure of the building itself. The basic error of all materialism in politics - and this<br />
materialism is not Marxian and not even modern in origin, but as old as our history of<br />
political theory 8 - is to overlook the inevitability with which men disclose them selves<br />
as subjects, as distinct, and unique persons, even when they wholly concentrate upon<br />
reaching an altogether worldly, material object. To dispense with this disclosure, if<br />
indeed it could ever be done, would mean to transform men into something they are<br />
not; to deny, on the other hand, that this disclosure is real and has consequences of<br />
its own is simply unrealistic.<br />
The realm of human affairs, strictly speaking, consists of the web of human reIationships<br />
which exists wherever men live to gether. The disclosure of the “who” through<br />
speech, and the setting of a new beginning through action, always fall into an already<br />
existing web where their immediate consequences can be felt. Together they start<br />
a new process which eventually emerges as the unique life story of the newcomer,<br />
affecting uniqueIy the life stories of all those with whom he comes into contact. It<br />
is because of this already existing web of human reIationships, with its innumerable,<br />
conflicting wills and intentions, that action al most never achieves its purpose; but it<br />
is also because of this medium, in which action alone is real, that it “produces” stories<br />
with or without intention as naturally as fabrication produces tangible things. These<br />
stories may then be recorded in documents and monuments, they may be visible in use<br />
objects or art works, they may be told and retold and worked into all kinds of material.<br />
They themseIves, in their living reality, are of an altogether dif ferent nature than these<br />
reifications. They tell us more about their subjects, the “hero” in the center of each<br />
story, than any product of human hands ever teIls us about the master who produced<br />
it, and yet they are not products, properly speaking. Although everybody started his<br />
life by inserting himself into the human world through action and speech, nobody is
9 Laws 803 and 644.<br />
the author or producer of his own life story. In other words, the stories, the results of<br />
action and speech, reveal an agent, but this agent is not an author or producer. Somebody<br />
began it and is its subject in the twofold sense of the word, namely, its actor and<br />
sufferer, but nobody is its author.<br />
That every individual life between birth and death can even tually be told as a story<br />
with beginning and end is the prepolitical and prehistorical condition of history, the<br />
great story without beginning and end. But the reason why each human life teIls its<br />
story and why history ultimateIy becomes the storybook of man kind, with many actors<br />
and speakers and yet without any tangible authors, is that both are the outcome of<br />
action. For the great unknown in history, that has baffled the philosophy of history in<br />
the modern age, arises not only when one considers history as a whole and finds that<br />
its subject, mankind, is an abstraction which never can become an active agent; the<br />
same unknown has baffled political philosophy from its beginning in antiquity and<br />
contrib uted to the general contempt in which philosophers since Plato have held the<br />
realm of human affairs. The perplexity is that in any series of events that together<br />
form a story with a unique mean ing we can at best isolate the agent who set the whole<br />
process into motion; and although this agent frequently remains the subject, the “hero”<br />
of the story, we never can point unequivocally to him as the author of its eventual<br />
outcome.<br />
It is for this reason that Plato thought that human affairs (ta tōn anthrōpōn pragmata),<br />
the outcome of action (praxis), should not be treated with great seriousness; the<br />
actions of men appear like the gestures of puppets led by an invisible hand behind the<br />
scene, so that man seems to be a kind of plaything of a god.9 It is note worthy that<br />
Plato, who had no inkling of the modern concept of history, should have been the first<br />
to invent the metaphor of an actor behind the scenes who, behind the backs of acting<br />
men, pulls the strings and is responsible for the story. The Platonic god is but a symbol<br />
for the fact that real stories, in distinction from those we invent, have no author; as<br />
such, he is the true forerunner of Providence, the “invisible hand,” Nature, the “world<br />
spirit,” class interest, and the like, with which Christian and modern philosophers of<br />
history tried to solve the perplexing problem that although history owes its existence<br />
to men, it is still obviously not “made” by them. (Nothing in fact indicates more clearly<br />
the political nature of history - its being a story of action and deeds rather than of<br />
trends and forces or ideas - than the introduction of an invisible actor behind the scenes<br />
whom we find in all philoso phies of history, which for this reason alone can be recognized<br />
as political philosophies in disguise. By the same token, the simple fact that Adam<br />
Smith needed an “invisible hand” to guide econom ic dealings on the exchange market<br />
shows plainly that more than sheer economic activity is involved in exchange and that<br />
“eco nomic man,” when he makes his appearance on the market, is an acting being and<br />
neither exclusiveIy a producer nor a trader and barterer.)<br />
The invisible actor behind the scenes is an invention arising from a mental perplexity<br />
but corresponding to no real experience. Through it, the story resulting from action is<br />
misconstrued as a fictional story, where indeed an author pulls the strings and directs<br />
the play. The fictional story reveals a maker just as every work of art clearly indicates<br />
that it was made by somebody; this does not belong to the character of the story itself<br />
but only to the mode in which it came into existence. The distinction between a real<br />
and a fictional story is precisely that the latter was “made up” and the former not made<br />
at all. The real story in which we are engaged as long as we live has no visible or<br />
invisible maker be cause it is not made. The only “somebody” it reveals is its hero, and<br />
it is the only medium in which the originally intangible mani festation of a uniquely<br />
distinct “who” can become tangible ex post facto through action and speech. Who<br />
somebody is or was we can know only by knowing the story of which he is himself the<br />
hero - his biography, in other words; everything else we know of him, including the
214 — 215<br />
Hannah Arendt<br />
10 In Homer, the word hērōs has<br />
certainly a connotation of distinction,<br />
but of no other than every<br />
free man was capable. Nowhere<br />
does it appear in the later meaning<br />
of “half-god,” which perhaps arose<br />
out of a deification of the ancient<br />
epic heroes.<br />
11 Aristotle already mentions<br />
that the word drama was chosen<br />
because drontes (“acting people”)<br />
are imitated (Poetics 1448a28).<br />
From the treatise itself, it is<br />
obvious that Aristotle’s model for<br />
“imitation” in art is taken from the<br />
drama, and the generalization of<br />
the concept to make it applicable<br />
to all arts seems rather awkward.<br />
12 Aristotle therefore usually<br />
speaks not of an imitation of<br />
action (praxis) but of the agents<br />
(prattontes) (see Poetics 1448al<br />
ff., 1448b25, 1449b24 ff.). He is<br />
not consistent, however, in this<br />
use (cf. 1451a29, 1447a28). The<br />
decisive point is that tragedy does<br />
not deal with the qualities of men,<br />
their poiotes, but with whatever<br />
happened with respect to them,<br />
with their actions and life and<br />
good or ilI fortune (1450315-18).<br />
The content of tragedy, therefore,<br />
is not what we would call character<br />
but action or the plot.<br />
13 That the chorus “imitates less”<br />
is mentioned in the Ps. Aristotelian<br />
Problemata (918b28).<br />
14 Plato already reproached<br />
Pericles because he did not “make<br />
the citizen better” and because<br />
the Athenians were even worse at<br />
the end of his career than before<br />
(Gorgias 515).<br />
15 Recent political history is full<br />
of examples indicating that the<br />
term “human material” is no harmless<br />
metaphor, and the same is<br />
true for a whole host of mod ern<br />
scientific experiments in social<br />
engineering, biochemistry, brain<br />
surgery, etc., all of which tend to<br />
treat and change human material<br />
like other matter. This mechanistic<br />
approach is typical of the modern<br />
age; antiquity, when it pursued<br />
similar aims, was inclined to think<br />
of men in terms of savage animals<br />
who need he tamed and domesticated.<br />
The only possible achievement<br />
in either case is to kill man,<br />
not indeed necessarily as a living<br />
organism, but qua man.<br />
work he may have produced and left behind, tells us only what he is or was. Thus,<br />
although we know much less of Socrates, who did not write a single line and left no<br />
work behind, than of Plato or Aristotle, we know much better and more intimately<br />
who he was, because we know his story, than we know who Aristotle was, about whose<br />
opinions we are so much better informed.<br />
The hero the story discloses needs no heroic qualities; the word “hero” originally, that<br />
is, in Homer, was no more than a name given each free man who participated in the<br />
Trojan enterprise10 and about whom a story could be told. The connotation of cour age,<br />
which we now feel to be an indispensable quality of the hero, is in fact already present<br />
in a willingness to act and speak at all, to insert one’s self into the world and begin a<br />
story of one’s own. And this courage is not necessarily or even primarily related to a<br />
willingness to suffer the consequences; courage and even boldness are already present<br />
in leaving one’s private hiding place and show ing who one is, in disclosing and exposing<br />
one’s self. The extent of this original courage, without which action and speech and<br />
therefore, according to the Greeks, freedom, would not be pos sible at all, is not less<br />
great and may even be greater if the “hero” happens to be a coward.<br />
The specific content as weIl as the general meaning of action and speech may take<br />
various forms of reification in art works which glorify a deed or an accomplishment and,<br />
by transformation and condensation, show some extraordinary event in its full<br />
signifi cance. However, the specific revelatory quality of action and speech, the implicit<br />
manifestation of the agent and speaker, is so indissolubly tied to the living fIux<br />
of acting and speaking that it can be represented and “reified” only through a kind of<br />
repetition, the imitation or mimesis, which according to Aristotle prevails in all arts but<br />
is actually appropriate only to the drama, whose very name (from the Greek verb dran,<br />
“to act”) indicates that play acting actually is an imitation of acting.11 But the imitative<br />
ele ment lies not only in the art of the actor, but, as Aristotle rightly claims, in the<br />
making or writing of the play, at least to the extent that the drama comes fully to life<br />
only when it is enacted in the theater. Only the actors and speakers who re-enact the<br />
story’s plot can convey the full meaning, not so much of the story itself, but of the<br />
“heroes” who reveal themselves in it.12 In terms of Greek tragedy, this would mean that<br />
the story’s direct as well as its universal meaning is revealed by the chorus, which does<br />
not imitate 13 and whose comments are pure poetry, whereas the in tangible identities<br />
of the agents in the story, since they escape all generalization and therefore all<br />
reification, can be conveyed only through an imitation of their acting. This is also why<br />
the theater is the political art par excellence; only there is the political sphere of<br />
human life transposed into art. By the same token, it is the only art whose sole subject<br />
is man in his relationship to others.<br />
26 The frailty of human affairs<br />
Action, as distinguished from fabrication, is never possible in isolation; to be isolated<br />
is to be deprived of the capacity to act. Action and speech need the surrounding presence<br />
of others no less than fabrication needs the surrounding presence of nature for its<br />
material, and of a world in which to place the finished product. Fabrication is surrounded<br />
by and in constant contact with the world: action and speech are surrounded by<br />
and in constant con tact with the web of the acts and words of other men. The popular<br />
belief in a “strong man” who, isolated against others, owes his strength to his being<br />
alone is either sheer superstition, based on the delusion that we can “make” something<br />
in the realm of human affairs - “make” institutions or laws, for instance, as we make<br />
tables and chairs, or make men “better” or “worse”14 - or it is conscious despair of all<br />
action, political and non-political, coupled with the utopian hope that it may be possible<br />
to treat men as one treats other “material.”15 The strength the individual needs
16 For archein and prattein see<br />
especially their use in Homer (cf. C.<br />
Capelle, Wörterbuch des Homeros<br />
und der Homeriden [1889]).<br />
for every process of production becomes altogether worthless when action is at stake,<br />
regardless of whether this strength is intellec tual or a matter of purely material<br />
force. History is fuIl of examples of the impotence of the strong and superior man who<br />
does not know how to enlist the help, the co-acting of his fellow men. His failure is<br />
frequently blamed upon the fatal inferiority of the many and the resentment every<br />
outstanding person inspires in those who are mediocre. Yet true as such observations<br />
are bound to be, they do not touch the heart of the matter.<br />
In order to ilIustrate what is at stake here we may remember that Greek and Latin,<br />
unlike the modern languages, contain two altogether different and yet interrelated<br />
words with which to des ignate the verb “to act.” To the two Greek verbs archein<br />
(“to begin,” “to lead,” finaIly “to rule”) and prattein (“to pass through,” “to achieve,”<br />
“to finish”) correspond the two Latin verbs agere (“to set into motion,” “to lead”) and<br />
gerere (whose original meaning is “to bear”).16 Here it seems as though each action<br />
were divided into two parts, the beginning made by a single person and the achievement<br />
in which many join by “bear ing” and “finishing” the enterprise, by seeing it<br />
through. Not only are the words interrelated in a similar manner, the history of their<br />
usage is very similar too. In both cases the word that originally designated only the<br />
second part of action, its achieve ment - prattein and gerere - became the accepted<br />
word for action in general, whereas the words designating the beginning of action<br />
became specialized in meaning, at least in political language. Archein came to mean<br />
chiefly “to rule” and “to lead” when it was specifically used, and agere came to mean<br />
“to lead” rather than “to set into motion.”<br />
Thus the role of the beginner and leader, who was a primus inter pares (in the case of<br />
Homer, a king among kings), changed into that of a ruler; the original interdependence<br />
of action, the dependence of the beginner and leader upon others for help and the<br />
dependence of his followers upon him for an occasion to act themselves, split into two<br />
altogether different functions: the func tion of giving commands, which became the<br />
prerogative of the ruler, and the function of executing them, which became the duty<br />
of his subjects. This ruler is alone, isolated against others by his force, just as the<br />
beginner was isolated through his initiative at the start, before he had found others to<br />
join him. Yet the strength of the beginner and leader shows itself only in his initiative<br />
and the risk he takes, not in the actual achievement. In the case of the successful<br />
ruler, he may claim for himself what actually is the achievement of many - something<br />
that Agamemnon, who was a king but no ruler, would never have been permitted.<br />
Through this claim, the ruler monopolizes, so to speak, the strength of those without<br />
whose help he would never be able to achieve anything. Thus, the delusion of extraordinary<br />
strength arises and with it the fallacy of the strong man who is powerful<br />
because he is alone.<br />
Because the actor always moves among and in relation to other acting beings, he is<br />
never merely a “doer” but always and at the same time a sufferer. To do and to suffer<br />
are like opposite sides of the same coin, and the story that an act starts is composed<br />
of its consequent deeds and sufferings. These consequences are boundless, because<br />
action, though it may proceed from nowhere, so to speak, acts into a medium where<br />
every reaction becomes a chain reaction and where every process is the cause of new<br />
proc esses. Since action acts upon beings who are capable of their own actions, reaction,<br />
apart from being a response, is always a new action that strikes out on its own and<br />
affects others. Thus action and reaction among men never move in a closed circle and<br />
can never be reliably confined to two partners. This boundlessness is characteristic<br />
not of political action alone, in the narrower sense of the word, as though the bound<br />
lessness of human interrelated ness were only the result of the boundless multitude<br />
of people involved, which could be escaped by resigning oneself to action within a<br />
limited, graspable framework of circumstances; the smallest act in the most limited
216 — 217<br />
Hannah Arendt<br />
17 It is interesting to note that<br />
Montesquieu, whose concern<br />
was not with laws but with the<br />
actions their spirit would inspire,<br />
defines Iaws as rapports subsisting<br />
between different beings<br />
(Esprit des lois, Book I, ch. 1;<br />
cf. Book XXVI, ch. 1). This definition<br />
is surprising because laws<br />
had always been defined in terms<br />
of boundaries and limitations.<br />
The reason for it is that<br />
Montesquieu was less interested<br />
in what he called the “nature<br />
of government” – whether it was<br />
a re public or a monarchy, for<br />
instance - than in its “principle ...<br />
by which it is made to act, …<br />
the human passions which set it<br />
in motion” (Book III, ch. 1).<br />
circumstances bears the seed of the same boundlessness, because one deed, and<br />
sometimes one word, suffices to change every constellation.<br />
Action, moreover, no matter what its specific content, always establishes relationships<br />
and therefore has an inherent tendency to force open all limitations and cut across<br />
all boundaries.17 Limitations and boundaries exist within the realm of human affairs,<br />
but they never offer a framework that can reliably withstand the on slaught with which<br />
each new generation must insert itself. The frailty of human institutions and laws<br />
and, generally, of all matters pertaining to men’s living together, arises from the<br />
human condi tion of natality and is quite independent of the frailty of human nature.<br />
The fences inclosing private property and insuring the limitations of each household,<br />
the territorial boundaries which pro tect and make possible the physical identity of<br />
a people, and the laws which protect and make possible its political existence, are of<br />
such great importance to the stability of human affairs precisely because no such<br />
limiting and protecting principles rise out of the activities going on in the realm of<br />
human affairs itself. The limita tions of the law are never entirely reliable safeguards<br />
against ac tion from within the body politic, just as the boundaries of the territory<br />
are never entirely reliable safeguards against action from without. The boundlessness<br />
of action is only the other side of its tremendous capacity for establishing relationships,<br />
that is, its specific productivity; this is why the old virtue of moderation, of<br />
keeping within bounds, is indeed one of the political virtues par excellence, just as<br />
the political temptation par excellence is indeed hubris (as the Greeks, fully experienced<br />
in the potentialities of action, knew so well) and not the will to power, as we<br />
are inclined to believe.<br />
Yet while the various limitations and boundaries we find in every body politic may offer<br />
some protection against the inherent boundlessness of action, they are altogether<br />
helpless to offset its second outstanding character: its inherent unpredictability. This<br />
is not simply a question of inability to foretell all the logical con sequences of a particular<br />
act, in which case an electronic com puter would be able to foretell the future, but<br />
arises directly out of the story which, as the result of action, begins and establishes<br />
itself as soon as the fleeting moment of the deed is past. The trouble is that whatever<br />
the character and content of the subse quent story may be, whether it is played in<br />
private or public life, whether it involves many or few actors, its full meaning can reveal<br />
itself only when it has ended. In contradistinction to fabrication, where the light<br />
by which to judge the finished product is provided by the image or model perceived<br />
beforehand by the craftsman’s eye, the light that illuminates processes of action,<br />
and therefore all historical processes, appears only at their end, frequently when all<br />
the participants are dead. Action reveals itself fully only to the storyteller, that is,<br />
to the backward glance of the historian, who indeed always knows better what it was<br />
all about than the par ticipants. All accounts told by the actors themselves, though<br />
they may in rare cases give an entirely trustworthy statement of in tentions, aims, and<br />
motives, become mere useful source material in the historian’s hands and can never<br />
match his story in signifi cance and truthfulness. What the storyteller narrates must<br />
neces sarily be hidden from the actor himself, at least as long as he is in the act or<br />
caught in its consequences, because to him the mean ingfulness of his act is not in<br />
the story that follows. Even though stories are the inevitable results of action, it is not<br />
the actor but the storyteller who perceives and “makes” the story.
The Empathic<br />
Civilization<br />
The Race to Global<br />
Consciousness<br />
in a World in Crisis<br />
Jeremy Rifkin
Part I<br />
Homo Empathicus<br />
Chapter 2<br />
The New View of <strong>Human</strong> Nature<br />
What are we made of? In an age obsessed with material inter ests, it’s not surprising<br />
that biologists – not to mention chemists and physicists – have looked to material<br />
explanations in their efforts to capture the essence of life. Most of our philosophers,<br />
till late, have been no less unequivocal in their belief that our essential nature is<br />
materialist to the core. To wit: Every individual seeks to secure his or her material wellbeing<br />
and to incorporate the world into themselves. The pop star Madonna captured<br />
the spirit of the age when she proclaimed to be a “material girl” in a “material world.”<br />
As we noted in Chapter 1, Hobbes viewed human nature as aggres sive and selfinterested.<br />
We are born to fight and compete and are engaged in a relentless struggle<br />
with one another to dominate and prevail and secure our material well-being at the<br />
expense of our fellows. John Locke took a gentler, even benign approach, arguing that<br />
in a pure state of nature human beings are sociable and kindly disposed to one another.<br />
Nonetheless we are, according to Locke, acquisitive by nature and use our mental<br />
and physical labor to expropriate the mate rial world and reshape it into productive<br />
property. ]eremy Bentham and the utilitarians agreed with Locke that we are by nature<br />
materialists and, as such, seek to optimize pleasure and mitigate pain.<br />
In the late nineteenth century, the burgeoning interest in the work ings of the human<br />
mind gave rise to the new field of psychology. Scholars turned their attention to what<br />
drives the human psyche itself. Although less interested in abstract philosophical<br />
musings on the nature of man and more concerned with clinical scientific observation<br />
of how the human mind actually works, many – but not all – of the early psy chologists<br />
retained their material biases and preconceptions about the nature of human nature.<br />
Like Adam Smith, they assumed that each individual is born to pursue his or her naked<br />
economic self-interest. And following Darwin's lead, they presumed that each human<br />
being's primary concern is his or her own physical survival and perpetuation.<br />
Freud: the last great utilitarian<br />
Although Sigmund Freud is often regarded as a seminal thinker, responsible for<br />
reshaping the human conversation regarding the nature of human nature, in many of<br />
the most important aspects of his theo retical speculations, he scrupulously followed<br />
the materialists’ script. Freud managed to combine in his thesis a secular version<br />
of the ear lier, medieval church notion of man’s fallen and depraved nature with the<br />
materialist narrative of the eighteenth-century Enlightenment. His terrifying and<br />
devastating portrait of human nature was so evocative and powerful that it has continued<br />
to frame the public perception of the human story all the way to the present<br />
day, with consequences that reverberate across every aspect of society, from the way<br />
we parent chil dren to the conduct of social life, the workings of commerce, and the<br />
enactment of public policy.<br />
Freud’s great legacy is that he eroticized material self-interest. It wasn’t long before<br />
the new eroticized version of human nature was hijacked by a contemporary of Freud,<br />
John B. Watson, another early pioneer in the field of psychology, who left the fold<br />
to apply the new psychological insights in the new realm of mass advertising. Much<br />
of the success of consumer capitalism over the course of the past century is due,<br />
in no small part, to the eroticization of desires and the sexual ization of consumption.<br />
Our advertising appeals are permeated with erotic references.
220 — 221<br />
Jeremy Rifkin<br />
1 Sigmund Freud, Civilization and<br />
Its Discontents. James Strachey,<br />
trans. (New York: W.W. Norton,<br />
1961), p. 23.<br />
2 Ibid., p. 41.<br />
3 Ibid., p. 48.<br />
4 Ibid., p. 58.<br />
5 Ibid., p. 59.<br />
6 Ibid.<br />
7 Ibid., p. 62.<br />
Freud begins by asking what men “demand of life and wish to achieve in it.” Here he<br />
lines up squarely with nineteenth-century utili tarian theory, suggesting that the<br />
human endeavor has two sides, a positive and a negative one. It aims, on the one hand,<br />
at an absence of pain and unpleasure and, on the other, at the experiencing of strong<br />
feelings of pleasure.1<br />
Freud takes his thesis a step further, arguing that<br />
[i]f we assume quite generally that the motive force of all human activities is<br />
a striving towards the two confluent goals of utility and a yield of pleasure,<br />
we must suppose that this is also true of the manifestations of civilization ….2<br />
Freud then asks rhetorically what afforded man the “strongest expe rience of satisfaction,<br />
and in fact provided him with the prototype of all happiness.” He concludes that it is<br />
“sexual relations” and, that being the case, man decided that “he should make genital<br />
eroticism the central point of his life.”3<br />
The drive for sexual satisfaction is so powerful, says Freud, that all external reality<br />
becomes merely instrumental to achieving sexual release. If unrestrained, man allows<br />
nothing to impede his quest for sexual climax. He is, therefore, driven by libido and<br />
is aggressive by nature, seeking only to satisfy his unquenchable sexual appetite. He<br />
is, in fact, a monster. Freud writes:<br />
The element of truth behind all of this, which people are so ready to disavow, is that<br />
men are not gentle creatures who want to be loved, and who at the most can defend<br />
themselves if they are attacked; they are, on the contrary, creatures among whose<br />
instinctual endowments is to be reckoned a powerful share of aggressiveness. As a<br />
result, their neighbour is for them not only a potential helper or sexual object, but<br />
also someone who tempts them to satisfy their aggressiveness on him, to exploit his<br />
capacity for work without compensation, to use him sexually without his consent,<br />
to seize his possessions, to humiliate him, to cause him pain, to torture and to kill him.<br />
Homo homini lupus.4<br />
Man is revealed as “a savage beast to whom consideration towards his own kind is<br />
something alien.”5<br />
Civilization, in turn, is little more than an elaborate psycho-cultural prison set up to<br />
restrain man’s aggressive sexual drive, lest it lead to a per petual war of all against all<br />
and mutual destruction. Freud goes so far as to explain away love as an “aim inhibited”<br />
method designed to curb the more primitive sexual drive and aggression. As for the<br />
Golden Rule that one should “love one’s neighbor as oneself,” Freud is dismissive, saying<br />
“nothing else runs so strongly counter to the original nature of man.”6<br />
Society, in Freud’s schema, is merely an expedient compromise man has begrudgingly<br />
accepted, in which he has “exchanged a portion of his possibilities of happiness for<br />
a portion of security.”7<br />
lf man’s nature is to destroy and kill one another, as Freud suggests, then how do<br />
we account for the fact that life itself appears to seek more order, complexity, and<br />
integration? Freud, like many of his contempo raries, was forced to wrestle with the<br />
new scientific field of thermo dynamics and the laws of conservation of energy, which<br />
observe that biological organisms and living communities are caught in a relentless<br />
struggle to create greater order and complexity against the inevitable pull of entropy,<br />
equilibrium, and death. lf the drive to destruction and death were all that man was<br />
about at his biological core, then it would appear that human nature was at odds with<br />
both Darwin’s theory of biological evolution and the newly emerging laws of thermodynamics.<br />
Freud found his way out of the dilemma by positing what he called the “death
8 Ibid., pp. 65–66.<br />
9 Ibid., p. 66.<br />
10 Ibid.<br />
11 Róheim quoted in Ian D. Suttie,<br />
The Origins of Love and Hate<br />
(New York: Julian Press, 1952),<br />
p. 227.<br />
12 Suttie, The Origins of Love<br />
and Hate, pp. 227–228.<br />
13 Ibid., p. 231.<br />
14 Freud, Civilization and Its<br />
Discontents, 2nd ed. Introduction<br />
by Peter Gay. James Strachey,<br />
trans. (New York: W.W. Norton,<br />
1989), p. 11.<br />
instinct.” It was to become the centerpiece of his view of human nature. Freud says<br />
that the notion of the death instinct came to him when he wrote Beyond the Pleasure<br />
Principle in 1920,<br />
Starting from speculations on the beginning of life and from biological parallels,<br />
I drew the conclusion that, besides the instinct to preserve living substance and<br />
to join into ever larger units, there must exist another, contrary instinct seeking<br />
to dissolve those units and to bring them back to their primeval, inorganic state.<br />
That is to say, as well as Eros there was an instinct of death. The phenomena of life<br />
could be explained from the concurrent or mutually opposing action of these two<br />
instincts.8<br />
Freud viewed the death instinct – the drive to aggressiveness and destruction –<br />
as a force that could be<br />
pressed into the service of Eros, in that the organism was destroying some other<br />
thing, whether animate or inanimate, instead of destroying its own self. Conversely,<br />
any restriction of this aggressiveness directed outwards would be bound to increase<br />
the self-destruction, which is in any case proceeding.9<br />
In the first instance, the death instinct manifests itself in the form of sadism and<br />
in the second instance, masochism, both of which are expressions of the instinctual<br />
sexual drive. That sexual drive seeks release in omnipotence and power over<br />
others in the case of sadism and in humiliation and self-destruction in the case of<br />
masochism.10<br />
Freud ultimately concluded that all of life was at the service of the death instinct.<br />
His deeply pessimistic view of human nature was embraced by many of the leading<br />
thinkers of the day. Freudian psy choanalyst Géza Róheim referred to the death instinct<br />
as the “pillar of metapsychology.”11 Not everyone, however, was won over to Freud’s<br />
dark assessment of the human spirit. lan D. Suttie was one of a number of psychologists<br />
who broke away from Freud’s analysis in the 1920s and 1930s, referring to<br />
his theory as<br />
the supreme expression of hatred, elevating this, as it does, to the status of a primal,<br />
independent purpose in life – a separate appetite which like hunger requires no<br />
external provocation and is an end-in-itself.12<br />
Every other human emotion, in Freud’s world, is but a residual repression of the sexual<br />
drive and the death instinct. Even love and tenderness are viewed as repressed or<br />
weakened expressions of the erotic impulse.13 Civilization has only one purpose: to<br />
become the means by which human beings satisfy their libidinal needs by pursuing<br />
mastery over others and advancing their material self-interest.<br />
Strangely absent from Freud’s analysis is any deep consideration of motherly love, a<br />
powerful and undeniable force found among ani mals that nurse their young. Herein lies<br />
a clue to Freud’s own per sonal psychology and even pathology. In Civilization and Its<br />
Discontents, Freud makes a revealing admission that speaks volumes. Regarding the<br />
infant’s feeling of oneness with the mother, Freud writes, “I can not discover this oceanic<br />
feeling in myself.”14 While he acknowledges that others might have such a feeling, it<br />
eludes him. Freud regards the infant, as the later adult he will become, as libido driven<br />
from the outset. The mother is not an object of love and affection but, rather, an object<br />
of sexual and material utility, whose sole purpose is to ful fill the infant’s internal drive<br />
for sexual satisfaction and pleasure. Attachment, love, affection, and companionship
222 — 223<br />
Jeremy Rifkin<br />
15 Freud quoted in Suttie,<br />
The Origins of Love and Hate,<br />
p. 236, (Suttie’s emphasis).<br />
16 Suttie, The Origins of Love and<br />
Hate, p. 236, (Suttie’s emphasis).<br />
17 Freud, Civilization and Its<br />
Discontents, p. 19.<br />
18 Ashley Montagu, introduction<br />
to Suttie, The Origins of Love<br />
and Hate, p. i.<br />
are illusions. The entire parenting relationship, from beginning to end, is utilitarian and<br />
designed to optimize the child’s pleasure. Freud writes that “[i]f the nurseling longs to<br />
behold the mother, it is only because it knows from experience that she satisfies all its<br />
requirements without delay.”15 As Suttie points out:<br />
This dictum definitely denies the possibility of the inheritance of a craving for companionship<br />
apart from that affording satisfaction to the bodily appetites. According<br />
to Freud then the infant learns to value the mother as a utility to itself.16<br />
Freud raises the interesting question as to whether the oceanic feel ing of oneness<br />
so often talked about in infancy might play itself out later in life in terms of the need<br />
for religion and attachment to God but dismisses it as unlikely, at least in regard to<br />
a substitute for a mother’s care. Far more likely, says Freud, is that the source of the<br />
religious impulse is found in “the child’s feeling of helplessness and the longing it<br />
evokes for a father.” Here’s where Freud reveals his own emotional blind spot and that<br />
of the age in which he grew up.<br />
I could not point to any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.<br />
Thus the part played by the “oceanic” feeling, which I suppose seeks to reinstate<br />
limitless narcissism … cannot possibly take the first place. The derivation of the<br />
religious attitude can be followed back in clear outline as far as the child’s feeling<br />
of helplessness …. There may be something else behind this, but for the present it is<br />
wrapped in obscurity.17<br />
The religious impulse then, for Freud, is utterly utilitarian and directed to a father<br />
figure, who can guarantee a sense of security. Mater nal love and care and the sense<br />
of mutual affection and companionship are figments of the imagination masking<br />
a deeper, narcissistic drive.<br />
Nearly a quarter of a century after Freud laid out his thesis, the dis tinguished<br />
twentieth-century anthropologist Ashley Montagu would write that the psychological<br />
foundation of Freud’s belief was deeply mired in a masculine mystique in which<br />
the feminine plays only a mar ginal role, if at all. Freud’s psychoanalysis, wrote<br />
Montagu,<br />
is a patriarchal psychology – the nature of women seems utterly to have escaped<br />
Freud, and he virtually confessed as much, and for this reason … he never quite<br />
grasped the the meaning of the relationship between mother and child or the<br />
meaning of love.18<br />
Freud was the last of the old guard. A master storyteller, he gave a brilliant secular<br />
defense of the ancient patriarchal narrative, whose roots lay in the great hydraulic<br />
civilizations of the Near and Far East, and that flowered with the Abrahamic religions<br />
and Confucianism. In a grand last stand, Freud brought the full force of the newly<br />
discovered unconscious to bear, arguing that male dominance is the natural order of<br />
things. The story of the Oedipus complex was an imaginative bit of theater designed<br />
to lock in the male protagonist as the central figure in human history. As to the role<br />
of the female, Freud was, by his own admission, perplexed about what endowed her<br />
character, aside from bearing children and nursing them with her milk. Whatever other<br />
mental and emotional makeup she might possess and express, Freud reasoned, was<br />
forever a pale shadow of the male. It’s no wonder, then, that Freud explained away the<br />
female psyche, arguing that the sum total of her behavior is ultimately a reflection of<br />
“penis envy,” which she brings with her from the womb.
But even Freud’s spirited and ingenious defense of male dominance couldn’t hold the<br />
line against the forces of history that were begin ning to chip away at the patriarchal<br />
foundation of civilization that had stood the test of time for more than five thousand<br />
years. The new communications/energy complexes of the First and Second Industrial<br />
Revolutions broke down the patriarchal walls, freeing women from centuries of slavery,<br />
serfdom, and servanthood. Print, especially the romance novel, allowed women to<br />
put a mirror to their relationships and to themselves and begin the arduous journey<br />
of discovering their selfhood. At the same time, the telephone provided a new source<br />
of communication that allowed millions of women to escape the confines of their<br />
hornes and begin to share their lives with one another across electrical wires, creating<br />
a powerful new networking tool for exploring their mutual gender interests. (When<br />
we think of the early telephone, the picture that comes to mind is women conversing<br />
with one another on party lines.) While the novel provided a tool for self-reflection, the<br />
telephone provided a tool for gossip and helped create a sense of gender solidarity.<br />
Both forms of communications would play a role in liberating women from the watchful<br />
eye of men, allowing them to find their identity and their voice. Before mass literacy<br />
and print and the telephone, women’s ability to think on their own and join in solidarity<br />
beyond the nar row range of sequestered conversation among female members<br />
of an extended family was limited. The overwhelming male presence ensured their<br />
docility. The print and electrical communications revolutions gave women the tools<br />
they needed to extend their minds and their hori zons and find their womanhood. The<br />
cinema, radio, and TV gave women additional communications outlets to explore and<br />
expand their identities.<br />
Public schooling and mass literacy began to put women on an even communications<br />
playing field with men. The introduction of the auto mobile, the electrification of<br />
homes and the advent of mass-produced home appliances and other household goods<br />
freed women, at least par tially, from the backbreaking tasks of providing all of the<br />
necessities of life for kin. Steam power and later electricity also shifted manufactur ing,<br />
logistics, and services from physical to mental and emotional labor, allowing women<br />
to take their place in the factories and front offices of modern commerce. While their<br />
talents and skills were less fully employed than men’s and they were paid only a<br />
fraction of the com pensation, the emergence of the semi-independent female wage<br />
earner cannot be exaggerated in the historical shift in gender relations.<br />
Freud wrote his stories during the very decades that Europe and America and other<br />
enclaves of the world were transitioning from a First to a Second industrial revolution.<br />
His most eloquent tracts were written in the 1920s, when the factories were shift-<br />
ing over from steam power to electrification, women were taking the wheel in Henry<br />
Ford’s Model T car, and female liberation was becoming all the rage. The writer<br />
F. Scott Fitzgerald branded the new women the flappers and their image of defiance<br />
of male domination became the signature for what would be called the Roaring<br />
Twenties.<br />
What babies really want<br />
All of this was not lost on a younger generation of psychologists who began to<br />
question the central tenets of Freud’s vision of human nature. Fittingly, the first<br />
psychologist of standing to challenge Freud’s thesis, though quite unintentionally,<br />
was a woman, Melanie Klein. Her theory of “object relations” opened the door a<br />
crack, but it was just enough allow others to crash through the Freudian fortress<br />
and herald to the world a new story about the nature of human nature – one more<br />
com patible with the new technological, commercial, and social forces that were<br />
reshaping civilization.
224 — 225<br />
Jeremy Rifkin<br />
19 Sigmund Freud, Three Essays<br />
on the Theory of Sexuality, James<br />
Strachey, trans. and ed. (New York:<br />
Basic Books, 2000), pp. 1–2.<br />
20 Ibid., p. 83.<br />
21 G. Gerson, “Object Relations<br />
Psychoanalysis as Political Theory,”<br />
Political Psychology, Vol. 25,<br />
No. 5, 2004, p. 773.<br />
22 P. Buckley, “Instincts Versus<br />
Relationships: The Emergence<br />
of Two Opposing Theories,” in<br />
Peter Buckley, ed. Essential Papers<br />
on Object Relations (New York:<br />
New York University Press, 1986),<br />
p. 2.<br />
23 W.R.D. Fairburn, Psychoanalytic<br />
Studies of the Personality (Hove,<br />
U.K.: Brunner-Routledge, 2003<br />
(1952)), p. 33.<br />
Klein restored the mother to a primary role in the human story, although again, it<br />
should be emphasized that she had no thought of doing so, and she regarded herself<br />
as a staunch disciple of Freud to the end of her life.<br />
Freud was the first to use the term “object” in his discussion of the sexualization of<br />
relationships. In his 1905 work titled Three Essays on the Theory of Sexuality, Freud<br />
categorized “the person from whom sexual attraction proceeds the sexual object<br />
and the act towards which the instinct tends the sexual aim.”19 Each individual,<br />
according to Freud, is aggres sively moving from one object to another in search<br />
of satisfying his or her sexual desire, with the goal of “temporary extinction of the<br />
libido.”20<br />
Klein, who is credited with pioneering the British school of object relations, stayed<br />
true to Freud’s script, with a single exception. While she agreed with Freud that both<br />
libido and aggression are the primary drives, she put more emphasis on the latter.<br />
The aggression is first directed at the mother’s breast. The infant splits the primary<br />
object, the breast, into the good breast that satisfies his libidinal drive and the bad<br />
breast that frustrates and persecutes him, denying him satisfaction.<br />
Klein departs from Freud in still another important respect, arguing that the ego is<br />
at play in a primitive form from birth, allowing the infant the ability to create internalized<br />
object relations. By asserting that some form of consciousness is present<br />
from early infancy, Klein inferred that the baby’s first internalized object is the mother,<br />
not the father.<br />
In the early stages of infancy, then, the baby’s natural aggression is directed toward<br />
the mother, not the father. But because the breast is split into a good breast and a bad<br />
breast, the infant comes to have ambiguous feelings toward the object. As the infant<br />
matures and begins to recognize the mother as more than breasts and as a caring being,<br />
the ambivalence leads to the fear that his aggression could harm the good object,<br />
and he begins to feel a sense of remorse and guilt and the desire to make reparation,<br />
lest he destroy the relationship he depends on to satisfy his libido.<br />
Although Klein continued to believe that an infant’s primary drive is libidinal and<br />
aggressive, she opened up the possibility, at least, that human relationships could<br />
be tempered by sociability.21 Yet because she believed, like Freud, that the destructive<br />
urge and the death instinct were wired into the human psyche, she was unable<br />
to turn the corner and believe that sociability was a primary drive and not just a<br />
compen satory one.22<br />
Others, however, took advantage of the small bit of hope Klein introduced and<br />
mounted an all-out assault on the Freudian premise that the baby is born to expropriate<br />
and destroy in the pursuit of libido. Unlike Klein, who believed that sociability<br />
was a secondary response to a more primary aggressive drive, psychologists like<br />
William Fair bairn, Heinz Kohut, Donald Winnicott, and lan Suttie suggested that<br />
sociability is the primary drive and that a preoccupation with libido, aggression, and<br />
destruction is a compensatory response to the thwart ing of that most basic of all<br />
human needs. For those psychologists, relationships with objects are not driven by<br />
expediency and the need to satisfy libido but, rather, by the need for human connection,<br />
love, affection, and companionship.<br />
Fairbairn launched the rebellion with a simple question: “Why does a baby suck his<br />
thumb?” Fairbairn suggested that “[u]pon the answer to this simple question depends<br />
the whole validity of the conception of erotogenic zones and the form of libido theory<br />
based upon it.”23<br />
Freud would have us believe that the baby sucks its thumb “because his mouth is<br />
an erotogenic zone and sucking provides him with erotic pleasure.” While it might<br />
at first glance seem convincing, Fairbairn asks a second question: “Why his thumb?”<br />
Fairbairn says that “the answer to this question is – ‘Because there is no breast to
24 Ibid.<br />
25 Ibid., p. 34.<br />
26 Ibid., pp. 39–40.<br />
27 Ibid., p. 39.<br />
28 Ibid., p. 60.<br />
suck.’” Fairbairn posits that thumb sucking “represents a technique for dealing with<br />
an satisfactory object-relationship …. ”24 In other words, the infant is providing a<br />
substitute object-relationship to satisfy himself because he is being denied what he<br />
really desires, which is a relationship with the mother’s breast and the mother herself.<br />
Here Fairbairn parts company with Freud and Klein, creating a schism in psychoanalytical<br />
theory. He writes:<br />
It must always be borne in mind, however, that it is not the libidinal attitude which<br />
determines the object-relationship, but the object-relationship which determines<br />
the libidinal attitude.25<br />
All of the forms of infantile sexuality that Freud was so obsessed with, says Fairbairn,<br />
are compensatory actions to alleviate the infant’s anxiety over what he really desires<br />
but is partially or mostly denied. And what does every child desire above all else and<br />
fear he may be denied? Fairbairn is unequivocal on this matter.<br />
Frustration of his desire to be loved as a person and to have his love accepted is<br />
the greatest trauma that a child can experience; and it is this trauma above all that<br />
creates fixations in the various forms of infantile sexuality to which a child is driven<br />
to resort in an attempt to compensate by substitutive satisfactions for the failure<br />
of his emotional relationships with his outer objects.26<br />
When a child feels he is not loved as a person or that his love is not accepted,<br />
his maturation stalls, and he begins to develop aberrant relationships and express<br />
pathological symptoms, including aggression, obsession, paranoia, and hysterical<br />
and phobic behavior.27 All of these behaviors stem from a deep feeling of isolation<br />
and abandonment.<br />
Fairbairn reaches the inescapable conclusion that Freud’s view of human nature was<br />
dead wrong in two essential respects – the primary importance of the libidinal drive<br />
and gratification.<br />
Amongst the conclusions formulated … are the following: (1) that libidinal “aims”<br />
are of secondary importance in comparison with object relationships, and (2) that<br />
a relationship with the object, and not gratification of impulse, is the ultimate<br />
aim of libidinal striving.28<br />
The implications of these two observations are enormous, as they challenge the<br />
very bedrock assumptions of Freud’s story about the nature of human nature. Freud,<br />
recall, believed that the libido is an intrinsic and primary force. The infant seeks<br />
unlimited pleasure in var ious eroticized forms from the very start of life – the pleasure<br />
principle. Even before there is an ego there is an id, a primal force in search of libidinal<br />
satisfaction. But, eventually, the pleasure principle must be reined in by society if<br />
orderly social intercourse is to take place. There fore, the “reality principle” is superimposed<br />
by society in the form of parental restraints, beginning with toilet training<br />
and other condition ing agents. These restraints help form the ego, which is little<br />
more than a mechanism to repress libidinal drives and control the id in the name of<br />
socialization.<br />
Fairbairn turns Freud’s thesis on its heels, arguing that the ego struc ture begins<br />
to develop at birth and that impulses are means by which the ego seeks relationships<br />
with others. In other words, the reality prin ciple exists from the get-go. Every<br />
infant seeks the other and is forming strands, if not bonds, of socialization from birth.<br />
Fairbairn makes the point that “[u]ltimately ‘impulses’ must be simply regarded as
226 — 227<br />
Jeremy Rifkin<br />
29 Ibid., p. 88.<br />
30 Ibid., p. 89.<br />
31 Heinz Kohut, The Restoration<br />
of the Self (New York: International<br />
University Press, 1977),<br />
p. 116.<br />
32 Arne Johan Vetlesen, Perception,<br />
Empathy and Judgment:<br />
An Inquiry into the Preconditions<br />
of Moral Performance (University<br />
Park, PA: Pennsylvania State<br />
University Press,1994), p. 262.<br />
33 Kohut, The Restoration<br />
of the Self, p. 123.<br />
34 Ibid., p. 122.<br />
35 Heinz Kohut, Self Psychology<br />
and the <strong>Human</strong>ities: Reflections<br />
on a New Psychoanalytical<br />
Approach, Charles B. Strozier, ed.<br />
(New York: W. W. Norton, 1985),<br />
p. 166.<br />
consti tuting the forms of activity in which the life of the ego structures con sists,”<br />
and that activity is directed toward creating relationships.29<br />
The reality principle, in Fairbairn’s schema, is primary. The infant is continuously<br />
engaged in making connections with the other – to the end of affecting relationships.<br />
This is what the reality principle is all about. To the extent that the primary aim of<br />
sociability is thwarted and the ego is not allowed to mature properly, the pleasure<br />
principle becomes a poor substitute. Fairbairn is unsparing in his critique of Freud’s<br />
central thesis. He explains his differences with Freud this way:<br />
In accordance with this point of view, the pleasure principle will cease to be regarded<br />
as the primary principle of behaviour and will come to be regarded as a subsidiary<br />
principle of behavior involving an impoverishment of object-relationships and coming<br />
into operation in proportion as the reality principle fails to operate, whether this<br />
be on account of the immaturity of the ego structure or on account of a failure of<br />
development on its part.30<br />
Others joined Fairbairn in criticizing Freud’s thesis and rounding out a counter-theory<br />
of human nature centered on the importance of social relationships to the development<br />
of the psyche and selfhood. Heinz Kohut agreed with Fairbairn that the destructive<br />
drive is not intrinsic to man’s makeup but, rather, an expression of the failure to<br />
build trusting relationships. He added, however, an important caveat to Fairbairn’s<br />
analysis, the important role that empathy plays in the devel opment of a mature self<br />
and the dire consequences to the formation of the ego if it is absent.<br />
In The Restoration of the Self, Kohut argues, like Fairbairn, that the destructive drive –<br />
whether aimed at others or oneself – occurs when the infant experiences repeated<br />
failures in connecting emotionally with a self object. He writes:<br />
Man’s destructiveness … arises originally as the result of the failure of the self-<br />
object environment to meet the child’s need for optimal – not maximal, it should<br />
be stressed – empathic responses. Aggression … as a psychological phenomenon,<br />
is not elemental.31<br />
Although Kohut acknowledges that infants are born with a drive to be assertive, he<br />
distinguishes that from overt aggression, rage, and destructiveness. The former is<br />
instrumental to ego formation and the development of a mature self, while the latter<br />
represents a failure of the self-object relationship to blossom because of an empathic<br />
deficit on the part of the parent or parents.32<br />
Kohut’s own clinical observations of patients over the years convinced him that it<br />
is not the drives themselves but “the threat to the organi zation of the self” that<br />
is so critical to development.33 If the empathic response of the parents is weak or<br />
non existent, the child’s development is arrested. It’s in these circumstances that<br />
the drives “become powerful constellations in their own right” and destructive rage<br />
sets in.34<br />
Kohut takes a swipe at Freud’s preoccupation with the sexual anat omy, saying that<br />
“a child is much more significantly influenced by the empathic attitude of the grownups<br />
around him or her than by the giv ens of organic equipment.” When a small boy “discovers<br />
that his penis is very small as compared with the penis of a grown man,” it is of<br />
little importance and hardly relevant to the adult he will become. But the importance<br />
of having admiring and empathic parents is critical to the kind of person he eventually<br />
will be. Kohut concludes that “the importance of the matrix of empathy in which we<br />
grow up cannot be overestimated.”35
36 Ibid., p. 167.<br />
37 D.W. Winnicott, <strong>Human</strong> Nature<br />
(Philadelphia: Brunner/Mazel,<br />
1988), p. 131.<br />
38 D.W. Winnicott, Through<br />
Paediatrics to Psychoanalysis<br />
(London: Karnac, 1984), p. 99.<br />
39 Winnicott, <strong>Human</strong> Nature,<br />
p. 103.<br />
40 Ibid., p. 102.<br />
Kohut makes a final observation that is worth noting. He found that it makes little<br />
difference who the early parental provider is, as long as she or he provides the<br />
appropriate empathic response for the child’s development. He referenced an example,<br />
reported by Anna Freud and Sophie Dann, to emphasize the point that a biological<br />
mother is not essential to providing the necessary empathic environment to nourish<br />
the child’s developmental process. Freud and Dann related the story of six children<br />
who had survived a German concentration camp in World War II. Over the course of<br />
their three years of imprisonment, they were taken care of by an ever-changing set<br />
of mothers. As each set of mother surrogates was exterminated, others took their<br />
place, until their own deaths. Although the children were justifiably disturbed by the<br />
experience, they had a reasonably cohesive self, which can only be attributed to the<br />
empathic regard and affection they were given by the many women who took care<br />
of them.36<br />
While Fairbairn and Kohut mounted a full frontal assault on Freud’s theory of human<br />
nature, another of their contemporaries, Donald Winnicott, a pediatrician by background,<br />
launched a more subtle but no less effective attack based on his decades<br />
of work with infants. Winnicott challenged the very notion of the self-absorbed little<br />
individual who views the world as so much bounty to feed its insatiable appetites.<br />
Winnicott argued that the idea of an individual baby, per se, is a mis nomer. Babies<br />
don’t exist on their own. They don’t even have a coher ent sense of self. “At this very<br />
early stage,” says Winnicott, “it is not logical to think in terms of an individual …<br />
because there is not yet an individual self there.”37 Although considered counter<br />
intuitive at the time – but rather obvious with hindsight – Winnicott was making an<br />
insightful point; that while a baby is formed in the womb, an individual is formed<br />
in a relationship.<br />
If you show me a baby you certainly show me also someone caring for a baby, or at<br />
least a pram with someone’s eyes and ears glued to it. One sees a “nursing couple.”38<br />
What Winnicott is saying is that a relationship precedes an indi vidual, not the other<br />
way around. In other words, individuals don’t create society. Rather, society creates<br />
individuals. This simple observa tion challenged the very core of modernity, with its<br />
emphasis on the self-contained, autonomous individual exerting its will on the world.<br />
Winnicott drove his thesis home with a telling account of a baby’s first glimmer of<br />
self-consciousness. He asks us to consider the overriding importance of the baby’s<br />
first act … finding his mother’s nipple. From his years of pediatric experience, Winnicott<br />
observed that the way the baby is introduced to his mother’s nipple sets the course<br />
for the child’s future development as an individual being. Because this initial act is<br />
also the baby’s very first initiation into a relationship with another being, the way the<br />
relationship is entered into is determinative of the kind of expec tations – or lack of<br />
expectations – a child develops regarding others.<br />
In the very first feed, says Winnicott, the mother must allow the baby to find the<br />
nipple, making the experience a playful present and, more important, giving the<br />
baby the sense – although dimly perceived – that he has created the nipple and, by<br />
doing so is “creating the world.”39 What is going on here, observes Winnicott, is that<br />
“[t]he mother is waiting to be discovered.”40 This marks the beginning of the baby’s<br />
first relationship and guides his development to selfhood. It is through this creative<br />
act that the sense of “I” and “thou” later develops. Win nicott sums up the importance<br />
of the first feed.<br />
Memories are built up from innumerable sense-impressions associated with the<br />
activity of feeding and of finding the object. In the course of time there comes a
228 — 229<br />
Jeremy Rifkin<br />
41 Ibid., p. 106.<br />
42 Ibid., p. 108.<br />
43 Ibid., p. 104.<br />
44 Suttie, The Origins of Love and<br />
Hate, p. 4, (Suttie’s emphasis).<br />
45 Ibid., p. 6.<br />
state in which the infant feels confident that the object of desire can be found, and<br />
this means that the infant gradually tolerates the absence of the object. Thus starts<br />
the infant’s concept of external reality …. Through the magic of desire one can say<br />
that the baby has the illusion of magical creative power, and omnipotence is a fact<br />
through the sensitive adaptation of the mother. The basis for the infant’s gradual<br />
recognition of a lack of magical control over external reality lies in the initial omnipotence<br />
that is made a fact by the mother’s adaptive technique.41<br />
If the mother, for example, does not allow the child to playfully discover and magically<br />
create the nipple but, rather, places the baby’s mouth onto her breast, the child<br />
is denied the opportunity of building up the sensory memories that will allow him<br />
to eventually perceive himself as a separate individual who acts on and with separate<br />
others. By the way the mother enters into this first relationship with the baby, then,<br />
she is helping him become an individual being. From the very beginning, the relationship<br />
creates the individual.<br />
The failure to allow the infant to “contribute” thwarts the relationship – it takes two<br />
to tango – and arrests his development of selfhood. Winnicott cautions that<br />
[i]t is very easy to be deceived and to see a baby responding to skillful feeding,<br />
and to fail to notice that this infant who takes in an entirely passive way has never<br />
created the world, and has no capacity for external relationships, and has no future<br />
as an individual.42<br />
Winnicott concludes that<br />
[t]here is perhaps no one detail which the psychologist can teach which if accepted<br />
would have a more profound effect on the mental health of the individuals of the<br />
community than this matter of the need for the infant to be the creator of the nipple<br />
of the breast of the mother.43<br />
Fairbairn, Kohut, and Winnicott, each in their own fashion, chipped away at the<br />
assumptions of Freudian psychoanalysis, creating a counter -theory of human nature<br />
that emphasized the importance of social rela tionships over libidinal drives in the<br />
development of the individual psyche and selfhood. lan Suttie took the process one<br />
step further, pos iting an alternative explanation of the nature of human nature that,<br />
in every respect, is the mirror opposite of Freud’s views on the subject.<br />
Suttie recalls that his journey to an alternate view of human nature began when he<br />
saw the possibility that the biological need for nurture might be psychologically<br />
presented in the infant mind, not as a bundle of practical organic necessities<br />
and potential privations, but as a pleasure in responsive companionship and as<br />
a correlative discomfort in loneliness and isolation.44<br />
Suttie came to see “the innate need-for-companionship” as the infant’s primary means<br />
of assuring self-preservation and argued that it is the core of human nature.45<br />
Suttie, like Fairbairn, Kohut, and Winnicott, viewed Freud’s notion that libido governs<br />
human nature as unfounded, in both theory and practice. The idea that an unformed<br />
infant’s desires for his mother are all sexualized from the very outset of life and then<br />
spread to every other relationship an individual is engaged in later on in life seemed<br />
at odds with common sense and the emotional experience of the vast majority of<br />
people. Rather, Suttie opined that all of a person’s later interests – the way we play,<br />
cooperate, compete, and seek out cultural and politi cal interests, are a substitute for
46 Ibid., p. 16, (Suttie’s emphasis).<br />
47 Ibid., p. 18.<br />
48 Ibid., p. 22.<br />
49 Ibid., p. 49.<br />
50 Ibid., p. 50.<br />
51 Ibid., p. 53.<br />
the first relationship, the bond between infant and mother. Suttie says that “[b]y<br />
these substitutes we put the whole social environment in the place once occupied<br />
by mother.”46<br />
Suttie is at odds with Thomas Hobbes and the later Enlightenment thinkers, who<br />
argued that material self-interest is the guiding moti vation of human beings.<br />
Instead, Suttie argues, like Johan Huizinga and others, that play is the most important<br />
social activity because it is where we create companionship, engender trust, and<br />
exercise human imagination and individual creativity. Play is where we overcome our<br />
sense of existential loneliness and recapture the feeling of companion ship we first<br />
discovered with our primordial playmates, our mothers.47 Suttie bolsters his claim<br />
that companionship and play are essential to becoming a human being by pointing<br />
out that<br />
the period between infancy and adulthood … [is] … dominated by an almost<br />
insatiable social need, which uses the plastic energy of human interest for its<br />
satisfaction in play.48<br />
Unlike Freud, who viewed tenderness as a weak sublimation of sex ual arousal, Suttie<br />
saw it as a primary force that manifests itself from the very beginning of life. His<br />
notion of “tenderness” overlaps with Kohut’s ideas on the importance of the empathic<br />
bond in the creation of social relations.<br />
Suttie dismisses the idea that all human relations – even among infants – are driven<br />
by the quest to assert power over one another. While such behavior exists as some<br />
infants mature into childhood, it represents a secondary impulse arising from a deficit<br />
in tender reci procity in the very first social relationship with a mother. Suttie says<br />
that to believe that a very young infant is aware of a sense of gain or loss of power in<br />
his or her relationship with the mother before he has even developed a rudimentary<br />
consciousness of self is absurd. This is because<br />
[t]he primal state is not one of omnipotence, for omnipotence implies the consciousness<br />
of self as distinct from mother, which differentiation (as is known) cannot exist<br />
in early infancy. Prior to this differentiation of the self from the not self, as I have<br />
shown, there can be no question of power, nor a conflict of interest or wish nor any<br />
awareness of the distinction between gain or loss. The interactions between mother<br />
and infant are entirely pleasurable or unpleasurable and convey no sense of advantage<br />
or defeat to either side.49<br />
It is only when the mother refuses to give herself to the infant or rejects gestures of<br />
affection or gifts from the baby that “anxiety, hate, aggression (which Freud mistakes<br />
for a primary instinct), and the quest for power” begin to manifest themselves.50<br />
The infant begins life, then, according to Suttie, with an inchoate but nonetheless<br />
instinctual need to receive as weIl as give gifts, which is the basis of all affection.<br />
Reciprocity is the heart of sociality and what relationships are built on. If reciprocity is<br />
blocked, the development of selfhood and sociability is stunted and psychopathology<br />
emerges.51<br />
The most social animal<br />
While object relationship theorists like Fairbairn, Kohut, Winnicott, and Suttie were<br />
raising the hackles of traditional Freudian analysts with their belief that babies are<br />
prewired for companionship and sociability rather than driven by sexual libido, other<br />
researchers, often working independently of one another, were coming to the same
230 — 231<br />
Jeremy Rifkin<br />
52 David Levy, “Primary Affect<br />
Hunger,” American Journal of<br />
Psychiatry, 94, 1937, p. 644.<br />
53 L. Bender and H. Yarnell,<br />
“An Observation Nursery: A Study<br />
of 250 Children on the Psychiatric<br />
Division of Bellevue Hospital,”<br />
American Journal of Psychiatry, 97,<br />
1941, pp. 1, 169.<br />
54 Robert Karen, Becoming<br />
Attached: First Relationships and<br />
How They Shape Our Capacity to<br />
Love (New York: Oxford University<br />
Press), p. 19.<br />
conclusion. In a series of controlled studies of infants raised in orphanages and/or<br />
adopted out to foster parents, psychologists were reporting disturbing findings that<br />
bolstered the sociability thesis.<br />
Psychoanalyst David Levy was interested in infants raised by over protective mothers.<br />
He established a control group made up of chil dren who had never had maternal care<br />
as infants and who subsequently were unable to establish attachment bonds with<br />
adoptive parents. Most of these children had spent their early years in orphanages and<br />
later boarding homes before being placed with a family. His attention soon turned to<br />
the control group, however, as he began to notice a fright ening pattern. The children<br />
who lacked early bonding with a mother figure, although often affectionate on the surface,<br />
showed little or no real emotional warmth underneath. They were often sexually<br />
aggres sive and engaged in antisocial behavior, including consummate lying and stealing.<br />
Virtually all of them were unable to make meaningful friendships. Levy categorized<br />
those children as suffering from “primary affect hunger.” They were unable to express<br />
the full range of human feelings that grow out of a meaningful relationship with a<br />
mother fig ure. Levy asked the rather chilling question of whether it is possible “that<br />
there results a deficiency disease of the emotional life, compa rable to a deficiency of<br />
vital nutritional elements within the developing organism.”52<br />
Other researchers were noticing equally disquieting behavior among infants confined<br />
to orphanages and other public institutions. Loretta Bender, the head of the child<br />
psychiatry ward at Bellevue Hospital in New York City, observed that such children are<br />
eerily antihuman. She wrote:<br />
They have no play pattern … cannot enter into group play but abuse other children,<br />
and cling to adults and exhibit a temper tantrum when cooperation is expected.<br />
They are hyperkinetic and distractible; they are completely confused about human<br />
relationships, and … lose themselves in a destructive fantasy life directed both<br />
against the world and themselves.53<br />
Deprived of maternal care, these children developed psychopathic personalities.<br />
The lack of maternal care in these institutions was exacerbated by the hygienic<br />
standards imposed, ironically to safeguard the physical health of the children. Recall<br />
in Chapter 1 the mention of the almost obsessive preoccupation with maintaining<br />
a sterile living environ ment in orphanages and foundling hospitals so as not to spread<br />
disease. Toward this end, personnel were discouraged from ever touching babies<br />
or picking them up and cuddling them for fear of spreading germs and disease. Most<br />
infants were prop-fed so that the attendant would not need to come into physical<br />
contact at all with the infant. The infants languished. Shockingly, death rates in some<br />
of the orphanages ranged from 32 percent to 75 percent in the first two years of<br />
infancy. Although well fed and raised in clean environments, these children were dying<br />
in droves. The infants were often misdiagnosed as malnourished or were categorized<br />
as suffering from “hospitalism,” all of which masked the underlying problem.54 Denied<br />
affection and maternal companionship, the infants lost the will to live.<br />
Those governing protocols remained the norm for orphanages from before World War I<br />
to the 1930s, despite the mounting evidence that something was very wrong in the<br />
management of those institutions. It wasn’t until 1931, when a pediatrician, Harry<br />
Bakwin, became head of the pediatric unit at Bellevue Hospital, that conditions on the<br />
infant wards began to change. Bakwin published a paper, titled “Loneliness in Infants,”<br />
in which he connected the dots between infant death and emotional starvation. In a<br />
particularly telling and sad passage of the paper, he observed that the obsession with<br />
isolating infants had reached tragic proportions in the hospital. He noted that the<br />
management had gone so far as to devise
55 Harry Bakwin, “Loneliness<br />
in Infants,” American Journal of<br />
Diseases of Children 63, 1941,<br />
p. 31.<br />
56 Karen, Becoming Attached,<br />
p. 20.<br />
57 Ibid., pp. 20–21.<br />
58 Ibid., p. 21.<br />
59 Ibid., p. 24.<br />
a box equipped with inlet and outlet valves and sleeve arrangements for the<br />
attendants. The infant is placed in this box and can be taken care of almost<br />
untouched by human hands.55<br />
Bakwin ordered new signs be put up across the pediatric unit that read: “Do not<br />
enter this nursery without picking up a baby.”56 Infec tion rates declined, and infants<br />
began to thrive.<br />
At the same time, other researchers were finding a correlation between intelligence<br />
and language skills and emotional deprivation. Children raised in orphanages<br />
often tested with low and even retarded IQs, while those in foster care tested<br />
normally.57 Those studies flew in the face of the orthodox thinking of the time that<br />
IQ was inherited.<br />
In a landmark study conducted by Harold Skeels of the lowa Child Research Welfare<br />
Station, thirteen children from orphanages, all below two-and-a-half years of age, were<br />
each placed in the care of a feeble minded older girl in a public institution. During a<br />
nineteen-month period, the average IQ of the infants under the care of the older girls<br />
shot up from 64 to 92, demonstrating that emotional bonds play a far more crucial<br />
role in the development of human intelligence than previ ously suspected.58 The longheld<br />
conventional wisdom that individual human intelligence is preordained by one’s<br />
biology no longer seemed convincing. Was it possible that a child’s mental intelligence<br />
flowed from the innate emotional need for affection and companionship?<br />
The mounting number of studies on infant care and lack thereof in the 1930s and<br />
1940s began to slowly shift opinions within the psychiat ric profession regarding<br />
the nature of human nature. But it was the vis ceral, emotional impact of a single film<br />
that shook the very foundations of the field and changed forever the ideas about<br />
proper professional care of children, and parenting as weIl.<br />
In 1947, a short amateur film was shown to a small group of physi cians and psychoanalysts<br />
at the New York Academy of Medicine. The film, made by René Spitz,<br />
a psychoanalyst, was entitled Grief: A Peril in Infancy. It was a silent film, shot in black<br />
and white, showing a number of infants who had been previously attended by mothers,<br />
but forced by various circumstances to be placed in a foundling home, where there<br />
was only a single nurse and five assistant nurses for forty-five babies.<br />
The first little baby is shown just after her mother had dropped her off for a threemonth<br />
stay. The baby is smiling, giggling, and playing with an adult supervisor. Seven<br />
days later, the same child has turned into another person. She looks forlorn and is<br />
unresponsive. She sobs uncon trollably, sometimes kicking the adult supervisor. Her<br />
expression is one of utter terror. The film scans other babies who appear dazed,<br />
depressed, and lifeless. Many of the babies are emaciated and exhibit stereotypical<br />
behaviors, including gnawing at their hands. A number of the babies cannot even sit<br />
or stand. They remain expressionless and motionless, devoid of spirit. They are empty<br />
shells. A title card appears on the screen saying, “The cure: Give mother back to baby.”59<br />
The impact of the film on the psychologists, doctors, and nurses was overwhelming.<br />
Some openly wept. In the coming years, thousands of professional psychologists,<br />
psychiatrists, social workers, doctors, and nurses would view the film. Many more<br />
read Spitz’s book on the sub ject, The First Year of Life. It transformed the debate over<br />
infant care, but it would be two more decades before a solid majority of the pediatric<br />
profession would embrace the underlying findings and the implications that flowed<br />
from the Spitz film.<br />
The man most responsible for advancing a coherent theory to explain what Spitz and<br />
the other researchers were chronicling was an English psychiatrist, John Bowlby.<br />
His Attachment Theory was articulated in a series of three scientific papers delivered<br />
at the British Psychoanalytic Society in London between 1958 and 1960. The first
232 — 233<br />
Jeremy Rifkin<br />
60 John Bowlby, foreword to<br />
M.D.S. Ainsworth, Infancy in<br />
Uganda: Infant Care and the<br />
Growth of Love (Baltimore: John<br />
Hopkins University Press, 1967),<br />
p. V.<br />
61 John Bowlby, The Making and<br />
Breaking of Affectional Bonds<br />
(London: Tavistock Publications,<br />
1979), p. 128.<br />
62 Ibid.<br />
63 Karen, Becoming Attached,<br />
interview with Bowlby, January<br />
14–15, 1989, p. 90.<br />
64 Bowlby, The Making and<br />
Breaking of Affectional Bonds,<br />
pp. 128–129.<br />
65 Ibid., p. 131.<br />
paper, titled “The Nature of the Child’s Tie to His Mother,” rattled the psychoanalytic<br />
community and eventually helped lay to rest Freud’s view of human nature.<br />
Building on object relations theory, and especially the pioneering insights of Fairbairn,<br />
Bowlby argued that a child’s first relationship with a mother shapes the individual’s<br />
emotional and mental life for a lifetime. Like Fairbairn, Bowlby believed that a child’s<br />
primary drive is to seek relationships with others. He wrote:<br />
When a baby is born he cannot tell one person from another and indeed can hardly<br />
tell person from thing. Yet, by his first birthday he is likely to have become a connoisseur<br />
of people. Not only does he come quickly to distinguish familiars from strangers<br />
but amongst his familiars he chooses one or more favorites. They are greeted with<br />
delight; they are followed when they depart; and they are sought when absent. Their<br />
loss causes anxiety and distress; their recovery, relief and a sense of security. On this<br />
foundation, it seems, the rest of his emotional life is built – without this foundation<br />
there is risk for his future happiness and health.60<br />
Like other object relations theorists, Bowlby disagreed with the still-dominant Freudian<br />
theory that the craving for food is the pri mary human motivation and that personal<br />
relationships are mainly sec ondary and sought after to satiate libidinal drives.61 But<br />
Bowlby went a giant step beyond his colleagues by grounding object relations in<br />
evolutionary biology, giving it the necessary scientific gravitas to chal lenge and overturn<br />
the Freudian orthodoxy.<br />
Bowlby’s theory was greatly influenced by the work of the Austrian ethologist Konrad<br />
Lorenz. Back in 1935, Lorenz published an impor tant work on imprinting in birds. His<br />
observations became the founda tion for Bowlby’s own theory on human attachment.<br />
In an article titled “The Companion in the Bird’s World,” Lorenz reported that in some<br />
species of bird, like ducks and geese, the ducklings and goslings bond quickly to the<br />
first adult with whom they come in contact. Bowlby was impressed that<br />
[a]t least in some species of bird, [Lorenz] had found, strong bonds to a mother figure<br />
develop during the early days of life without any reference to food and simply through<br />
the young being exposed to and becoming familiar with the figure in question.62<br />
Bowlby had hit upon a body of work coming from the field of ethology that validated<br />
his own observations of how human infants develop. He would later recount his<br />
epiphany:<br />
I mean talk about eureka. They were brilliant, first-class scientists, brilliant observers,<br />
and studying family relationships in other species – relationships which were<br />
o bviously analogous with that of human beings – and doing it so frightfully weIl.<br />
We were fumbling around in the dark; they were already in brilliant sunshine.63<br />
In his 1979 book, The Making and Breaking of Affectional Bonds, Bowlby would<br />
acknowledge the great debt he owed to Lorenz and his fellow ethologists. He wrote:<br />
I outlined a theory of attachment in a paper published in 1958 … [a]rguing that<br />
the empirical data on the development of a human child’s tie to his mother can be<br />
understood better in terms of a model derived from ethology …. 64<br />
Bowlby observed that attachment behavior exists in almost all species of mammals.<br />
An immature animal will bond to a mature adult, almost always a mother, generally for<br />
protection, and such behavior is different from feeding and sexual behavior.65
66 Ibid., p. 133.<br />
67 Ibid., p. 136.<br />
68 Ibid.<br />
While all of this appears incontrovertible, Bowlby took the ethologists’ insights a step<br />
further, noting that among mammals, attachment behavior is only part of the unfolding<br />
relationship with the mother. A seemingly antithetical behavior is also at work. He<br />
noted that in mammals, “exploratory activity is of great importance in its own right,<br />
enabling a person or an animal to build up a coherent picture of environmental features<br />
which may at any time become of importance for survival.” Bowlby points out that<br />
[c]hildren and other young creatures are notoriously curious and inquiring, which<br />
commonly leads them to move away from their attachment figure. In this sense<br />
exploratory behaviour is antithetical to attachment behaviour. In healthy individuals<br />
the two kinds of behaviour normally alternate.66<br />
The critical question is what connects the two forms of behavior that are so widely<br />
observed among mothers and their infants in the animal world? It is here that Bowlby<br />
found the dialectic relations that exists between attachment and independence<br />
that would shape his own theory about human nature. The just good enough parent,<br />
says Bowlby, provides a child “with a secure base” and “encourage(s] to explore<br />
from it.”67<br />
Unless a parent provides a baby with a secure sense of protection, care, and affection,<br />
he or she will not be able to develop to the point of engaging the world and becoming<br />
an independent being. Yet, at the same time, a parent needs to encourage the baby’s<br />
innate desire to explore and engage the world that surrounds. It is the success or<br />
failure of this delicate process that determines the future emotional life and sociability<br />
of every child. Bowlby concludes that a just good enough parent needs to have an<br />
intuitive and sympathetic understanding of the child’s attachment behaviour and<br />
a willingness to meet it and thereby terminate it, and, second, recognition that one<br />
of the commonest sources of a child’s anger is the frustration of his desire for love<br />
and care, and that his anxiety commonly reflects uncertainty whether parents will<br />
continue to be available. Complementary in importance to a parent’s respect for a<br />
child’s attachment desires is respect for his desire to explore and gradually to extend<br />
his relationships both with peers and with other adults.68<br />
If the parent is able to create the right balance between maintain ing secure attachment<br />
and at the same time encouraging independent exploration, the child will<br />
develop a healthy sense of self and acquire the appropriate emotional maturity to<br />
engage others and develop meaning ful relationships. If, however, the parent is not<br />
able to provide a sense of warmth and security and allow the infant to explore the<br />
world, the child will grow up with an arrested sense of self and be unable to enter into<br />
more than superficial relationships with others.<br />
Bowlby did not devote a lot of attention to the question of why one parent might be<br />
better attuned than another to make the process work. Subsequent research into<br />
the parent/ child dynamic, however, clearly shows that the more empathic the mother<br />
or father figure, the more able they are to identify emotionally and cognitively and<br />
to read their child’s needs. A parent with immature, inadequate, or deficient empathic<br />
sensitivity is not going to be as successful in producing a well-adjusted, trusting, and<br />
caring child, who feels both secure and independent and able to enter into meaningful<br />
relationships with oth ers. And a child without a consistent parent figure or who<br />
is without one altogether is unable to establish meaningful social relationships from<br />
the get-go.<br />
Bowlby’s own research suggested that in the United States and Britain more than half<br />
the children were growing up with the proper parenting to allow them to thrive, while
234 — 235<br />
Jeremy Rifkin<br />
69 Ibid.<br />
70 Ibid., p. 137.<br />
71 Ibid., p. 141.<br />
72 John B. Watson, Psychological<br />
Care of Infant and Child (New York:<br />
W.W. Norton, 1928), pp. 81–82.<br />
more than one third were not.69 The latter grew up with parents who were unresponsive<br />
to the child’s care-eliciting behavior or disparaged the child or rejected the child<br />
outright. Any of those parental behaviors can lead the child to live in a constant state<br />
of anxiety -what Bowlby calls anxious attachment – for fear of losing an attachment<br />
figure and result in a range of pathogenic behavior, from neurotic and phobic in nature<br />
to psychotic and sociopathic.70<br />
A child can also exhibit what Bowlby calls a compulsive self-reliant behavior, just the<br />
opposite of anxious attachment. Instead of seeking love that is elusive, he or she<br />
keeps a stiff upper lip and attempts to be completely autonomous and without need<br />
of the warmth and affection of others. This behavior is often referred to as avoidant.<br />
These children are distrustful of close relationships and often crack under stress and<br />
experience a high rate of depression.<br />
Bowlby emphasized that<br />
whatever representational models of attachment figures and of self an individual<br />
builds during his childhood and adolescence, tend to persist relatively unchanged<br />
into and throughout adult life.71<br />
In other words, he or she will tend to attach to new people in his life – friends, a spouse,<br />
an employer – in the same manner and express ing the same behavioral repertoire as<br />
he or she did with their first adult attachment figure in infancy.<br />
Bowlby’s analysis seems rather commonplace today. Yet we need to understand that<br />
it wasn’t until the 1960s that pediatricians in the United States and the UK began<br />
to take notice and change the way they counseled parents on relating to their infants<br />
and not until the late 1970s that pediatricians in continental Europe caught up to<br />
the change in infant care.<br />
Bowlby’s theory wasn’t accepted overnight. The opposition was fierce. The Freudians<br />
were reluctant to give up their materialist and utilitarian ideas about human nature<br />
and clung to the notion that the body is biologically driven to satiate material and<br />
sexual desires. Oth ers argued that attachment theory put far too much emphasis<br />
on the relationship with the parent in how the child develops and not enough on the<br />
inborn temperament of the child.<br />
The behavioralists were equally unimpressed, arguing that there is no evidence to<br />
suggest that infants are biologically wired for compan ionship. Rather, they are<br />
born tabula rasa, and because they seek plea sure and attempt to avoid pain, their<br />
behavior is infinitely malleable by proper conditioning. The behavioralists were<br />
particularly dismissive of Bowlby’s attachment theory. After all, they adhered to<br />
the notion, advanced by the psychologist John B. Watson in the 1920s, that too<br />
much affection and “coddling” of babies spoiled them and made them less malleable<br />
to molding later on. Watson counseled young mothers to<br />
[t]reat them [the babies] as though they were young adults. Dress them, bathe<br />
them with care and circumspection. Let your behavior always be objective and kindly<br />
firm. Never hug and kiss them, never let them sit on your lap. If you must, kiss<br />
them once on the forehead when they say goodnight. Shake hands with them in the<br />
morning. Give them a pat on the head if they have made an extraordinary good job<br />
of a difficult task.72<br />
Even some early feminists and professional career women were miffed, arguing that<br />
Bowlby was attempting to imprison women in the traditional role of sole caretaker of<br />
children. It should be pointed out that Bowlby had no such intention in mind. Although<br />
he was quick to emphasize that a baby needs a consistent parent figure until the age
73 Karen, Becoming Attached,<br />
interview with Ainsworth, 1988,<br />
p. 147.<br />
74 Karen, Becoming Attached,<br />
p. 172.<br />
of three, the attachment figure could be the biological mother or father or other<br />
relative or even a nanny. Still, his caveats did little to quell the uproar.<br />
All of the critics were like-minded in one respect. If attachment behavior is biologically<br />
wired, as Bowlby suggested, they demanded the scientific findings that could validate<br />
his theory. They got what they were looking for from Mary Ainsworth, a Canadian<br />
psycholo gist who had enjoyed a long working relationship with Bowlby. In the 1960s,<br />
Ainsworth initiated a series of studies at Johns Hopkins Uni versity in Baltimore,<br />
Maryland, that would provide Bowlby with the rigorous research data that he needed<br />
to show that his theory matched reality. Ainsworth developed four scales to rate a<br />
mother’s way of being with her baby and then compared her behavior with the reaction<br />
of her baby. Was the mother sensitive to the baby’s signals? Did she express acceptance<br />
or rejection of the baby? Did she accommodate the baby’s desires and synchronize<br />
with his rhythms, or did she interfere, forc ing the child to accept her pace when handling,<br />
playing, or feeding? And how available was she to the baby? Conversely, how often<br />
did she ignore the infant?<br />
Ainsworth then concocted a brilliantly simple protocol, which she called “The Strange<br />
Situation,” to assess Bowlby’s thesis. She explained that the idea was to place the<br />
mother and her baby in a “strange envi ronment” with toys to encourage exploration.<br />
A stranger would be introduced so that researchers could observe the baby’s response.<br />
At a certain point, the mother would leave the baby with the stranger. The researcher<br />
would then observe how the baby responded to the depar ture and subsequently to her<br />
mother’s return. They would then create a second situation with the baby by itself in<br />
the room, to observe whether the baby’s stress would ease when the stranger returned.<br />
Finally, they would make room for another reunion with the mother. Ainsworth said<br />
that she and her colleagues devised the whole idea in less than an hour.73<br />
The studies backed up Bowlby’s thesis that the securely attached baby is able to<br />
reach out on his or her own to explore the world, while the insecurely attached baby<br />
has difficulty doing so. Ainsworth observed three distinct behavioral sets among<br />
the children: the securely attached, who were upset when their moms left but greeted<br />
them eagerly upon their return and who were comforted by their mother’s embrace;<br />
the avoidantly attached, who seemed more aloof from their mothers but who sometimes<br />
attacked them – even though these children were also upset when their mothers<br />
left the room, they showed no interest in her upon her return, and the ambivalently<br />
attached, who were the most anxious, and who, unlike the avoidant children, were<br />
clingy and demanding at home, and who, like the other children, were upset when their<br />
mothers left the room but were inconsolable in their grief upon the mothers’ return.<br />
The mothers of “securely attached children” were far more likely to hold them longer<br />
and attend to their needs. They were more emotion ally engaged and more consistently<br />
attentive. In contrast, the mothers of the ambivalent children were more arbitrary<br />
and unpredictable in their responsiveness, while the mothers of the avoidant children<br />
were more rejecting in their behavior.74<br />
Ainsworth’s studies poured cold water over the long-dominant belief that babies<br />
should not be overly cuddled or picked up and given too much attention, lest they<br />
become too clingy and dependent and fail to develop a sense of independence and<br />
autonomy. Quite the contrary. The children who were the most securely attached<br />
and who had been provided an ample amount of care, attention, and affection were<br />
the most likely to separate from their mothers and play and explore the world around<br />
them, while the least securely attached were the most likely to cling or avoid others<br />
altogether, isolate themselves, and fail to develop a sense of independence. Ainsworth<br />
emphasized that it was not the amount of time mothers held their babies that made<br />
them more secure but, rather, the way they held them. They showed much more<br />
tender ness and affection and were careful never to be rough in han dling their child.
236 — 237<br />
Jeremy Rifkin<br />
75 L. Alan Sroufe, talk at City<br />
University of New York, Graduate<br />
Center, February 10, 1989. Quoted<br />
in Karen, Becoming Attached,<br />
p. 195.<br />
76 John Bowlby, Attachment and<br />
Loss, Vol. I: Attachment (New York:<br />
Basic Books, 1982), p. 368.<br />
And, equally important, they held their babies when the infants wanted to be held,<br />
demonstrating that they perceived the infants’ intentions as a separate being.<br />
Ainsworth later went on to hone her studies, adding several subgroup categories<br />
to further refine the notion of secure, ambivalent, and avoidant children. She provided<br />
a scientifically valid method of identifying the how and why of the parental/child<br />
relationship and bond.<br />
Ainsworth’s strange situation protocol was taken up by other researchers in the field<br />
and their studies confirmed and reinforced her original findings. L. Alan Sroufe and<br />
Byron Egeland, at the Univer sity of Minnesota, followed up with children who had been<br />
assessed in the strange situation protocol as infants and found that their sub sequent<br />
behavior at various stages of life, all the way into adulthood, tracked almost seamlessly<br />
with their initial assessment as toddlers, just as Bowlby had theorized and<br />
Ainsworth had later predicted in her first tests of the attachment behavior years earlier.<br />
The studies showed that the more securely attached infants grew up to be the more<br />
socia ble adults. They were more sensitive to others, shared higher levels of cooperation<br />
with peers, and developed more intimate relation ships. What those children all shared<br />
in common was a highly devel oped, empathic consciousness. And why is this the case?<br />
Sroufe said to understand this, one needs to start with the observation that “[i]f you’re<br />
in a relationship, the relationship is part of you.” Sroufe then asks rhetorically:<br />
How do you get an empathic child? You get an empathic child not by trying to teach<br />
the child and admonish the child to be empathic, you get an empathic child by being<br />
empathic with the child. The child’s understanding of relationships can only be from<br />
the relationships he’s experienced.75<br />
Yet despite the consistency of findings in the studies, there were still some who<br />
remained unconvinced. The emerging field of behav ioral genetics provided fodder for<br />
the critics. Studies conducted at the University of Minnesota of identical twins separated<br />
at birth and reared in different homes and environments seemed to add weight<br />
to the idea that one’s genes are a more decisive determiner of one’s emo tional development<br />
than environmental factors. A spate of studies of identical twins reared apart<br />
reported on the uncanny mirror likeness in mood and behavior, casting some doubt<br />
on the Bowlby thesis. But it should be pointed out that Bowlby and Ainsworth were<br />
quite aware that each baby is born with inborn rhythms and behavioral predispositions<br />
and that they affected their subsequent attachment behavior. Bowlby commented<br />
An easy newborn may assist an uncertain mother to develop a favorable pattern of<br />
care. Conversely, a difficult unpredictable newborn may tip the balance the other<br />
way. Yet all the evidence shows that a potentially easy baby is still likely to develop<br />
unfavorably if given unfavorable care and also, more fortunately, that with only few<br />
exceptions a potentially difficult baby can develop favorably if given sensitive care.<br />
The capacity of a sensitive mother to adapt to even a difficult unpredictable baby and<br />
thereby enable him to develop favorably is perhaps the most heartening of all recent<br />
findings in the field.76<br />
The question then was this: Acknowledging that both nature and nurture come into<br />
play in the establishment of the attachment bond, is one likely to play a more important<br />
role than the other? Dymph van den Boom, professor of general pedagogy at the<br />
University of Amster dam, conducted an elegant study to assess the importance of<br />
nature versus nurture in attachment behavior.<br />
Critics have long argued that babies who exhibit irritability from birth are less likely to<br />
create secure bonds and more likely to be anx ious at the end of their first year. To test
77 Karen, Becoming Attached,<br />
p. 304.<br />
78 Ibid., p. 312.<br />
the assumption, van den Boom studied one hundred babies who had been diagnosed<br />
as highly irritable at birth. These infants were not only far more difficult than smiling<br />
babies, but they also were born to low-income families whose parents were uneducated<br />
and stressed by their dire circumstances and less likely to exhibit the patience<br />
and calm attentiveness required for their new born to become securely attached.<br />
The hundred pairs of children and mothers were divided in half. One group of mothers<br />
received three counseling sessions of two hours each between their babies’ sixth and<br />
ninth months to deepen their sen sitivity to their babies and the efficacy of their care.<br />
The other mothers received no counseling assistance. The results of the counseling<br />
were dramatic. Of the mothers who received counseling, 68 percent of their children<br />
were categorized as “securely attached” at one year old, while in the control group<br />
only 28 percent of the babies were categorized as secure. So while critics are right that<br />
irritable babies are less likely to become securely attached as suggested by the low<br />
rate of success in the control group, counseling of mothers upped the success ratio to<br />
nearly 70 percent.77<br />
Robert Karen, the author of Becoming Attached: First Relationships and How They<br />
Shape Our Capacity to Love, observes that babies’ brains are largely unformed at birth<br />
but become organized in the first months of life. The brain circuitry becomes wired<br />
as the result of the baby’s interaction with the mother, which is the child’s primary<br />
environmen tal world. This being the case, it’s reasonable to conclude, says Karen, that<br />
[t]he baby’s ability to regulate itself, especially in all those areas related to emotion,<br />
depends on parental attunement and empathy; and if the mother fails to attune<br />
to the baby emotionally, the baby’s brain may exhibit lasting physiological deficits.78<br />
Object relations theorists put a new mirror to human nature, and what they saw<br />
reflected a view of our species as an affectionate, highly social animal who craves<br />
companionship, abhors isolation, and is bio logically predisposed to express empathy<br />
to other beings.<br />
But are we unique among the social animals in our ability to empathize with one<br />
another and our fellow creatures? New scientific discoveries over the past decade<br />
have forced a wholesale reappraisal in our thinking about the very nature of biological<br />
evolution. The conventional notion of evolution, with the emphasis on the competi tive<br />
struggle to secure resources and reproduce offspring, is being tem pered, at least at<br />
the mammalian level, with new findings suggesting that survival of the fittest may be<br />
as much about pro-social behavior and cooperation as physical brawn and competition.<br />
Moreover, at least some other species express empathic distress. The new insights into<br />
the biological roots of social behavior are beginning to have a paradigmatic effect on<br />
the way we perceive the living world around us as weIl as our own role in the unfolding<br />
story of life on Earth.<br />
The message is we are not alone in our ability to empathize. This simple but profound<br />
realization can’t help but change the way we per ceive our fellow creatures as well as<br />
strengthen our sense of responsibil ity to steward the Earth we cohabit.
Precarious Life<br />
The Powers<br />
of Mourning<br />
and Violence<br />
Judith Butler
5<br />
Precarious Life<br />
… the surplus of every sociality over every solitude. Levinas<br />
At a recent meeting, I listened to a university press director tell a story. It was unclear<br />
whether he identified with the point of view from which the story was told, or whether<br />
he was relaying the bad news reluctantly. But the story he told was about another<br />
meeting, where he was listening, and there a president of a university made the point<br />
that no one is reading humanities books anymore, that the humanities have nothing<br />
more to offer or, rather, nothing to offer for our times. I’m not sure whether he was<br />
saying that the university president was saying that the humanities had lost their<br />
moral authority, but it sounded like this was, in fact, someone’s view, and that it was<br />
a view to take seriously. There was an ensuing set of discussions at the same meeting<br />
in which it was not always possible to tell which view was owned by whom, or whether<br />
anyone really was willing to own a view. It was a discussion that turned on the<br />
question, Have the humanities undermined themselves, with all their relativism and<br />
questioning and “critique,” or have the humanities been under mined by all those<br />
who oppose all that relativism and questioning and “critique”? Someone has undermined<br />
the humanities, or some group of people has, but it was unclear who, and<br />
it was unclear who thought this was true. I started to wonder whether I was not in the<br />
middle of the humanities quandary itself, the one in which no one knows who is<br />
speaking and in what voice, and with what intent. Does anyone stand by the words<br />
they utter? Can we still trace those words to a speaker or, indeed, a writer? And which<br />
message, exactly, was being sent?<br />
Of course, it would be paradoxical if I were now to argue that what we really need is<br />
to tether discourse to authors, and in that way we will reestablish both authors<br />
and authority. I did my own bit of work, along with many of you, in trying to cut that<br />
tether.But what I do think is missing, and what I would like to see and hear return<br />
is a consideration of the structure of address itself. Because although I did not know<br />
in whose voice this person was speaking, whether the voice was his own or not,<br />
I did feel that I was being addressed, and that something called the humanities was<br />
being derided from some direction or another. To respond to this address seems<br />
an important obligation du ring these times. This obligation is something other than<br />
the rehabilitation of the author-subject per se. It is about a mode of response that<br />
follows upon having been addressed, a comportment toward the Other only after the<br />
Other has made a demand upon me, accused me of a failing, or asked me to assume<br />
a responsibility. This is an exchange that cannot be assimilated into the schema in<br />
which the subject is over here as a topic to be reflexively interrogated, and the Other<br />
is over there, as a theme to be purveyed. The structure of address is important for<br />
understanding how moral authority is introduced and sustained if we accept not just<br />
that we address others when we speak, but that in some way we come to exist, as<br />
it were, in the moment of being addressed, and something about our existence proves<br />
precarious when that address fails. More emphatically, however, what binds us morally<br />
has to do with how we are addressed by others in ways that we cannot avert or avoid;<br />
this impingement by the other’s address constitutes us first and foremost against<br />
our will or, perhaps put more appropriately, prior to the formation of our will. So if<br />
we think that moral authority is about finding one’s will and standing by it, stamping<br />
one’s name upon one’s will, it may be that we miss the very mode by which moral<br />
demands are relayed. That is, we miss the situation of being addressed, the demand<br />
that comes from elsewhere, sometimes a nameless elsewhere, by which our obligations<br />
are articulated and pressed upon us.
240 — 241<br />
Judith Butler<br />
1 Emmanuel Levinas and Richard<br />
Kearney, “Dialogue with Emmanuel<br />
Levinas,” in Face to Face with<br />
Levinas, Albany: SUNY Press,<br />
1986, pp. 23–4. Levinas develops<br />
this conception first in Totality<br />
and Infinity: An Essay on Exteriority,<br />
trans. Alphonso Lingis,<br />
Pittsburgh: Duquesne University<br />
Press, 1969, pp. 187–203, I cull<br />
quotations from his later work<br />
because I believe they give a more<br />
mature and incisive formulation<br />
of the face.<br />
Indeed, this conception of what is morally binding is not one that I give myself; it<br />
does not proceed from my autonomy or my reflexivity. It comes to me from elsewhere,<br />
unbidden, unexpected, and unplanned. In fact, it tends to ruin my plans, and if my<br />
plans are ruined, that may well be the sign that something is morally binding upon me.<br />
We think of presidents as wielding speech acts in willful ways, so when the director<br />
of a university press, or the president of a university speaks, we expect to know what<br />
they are saying, and to whom they are speaking, and with what intent. We expect the<br />
address to be authoritative and, in that sense, to be binding. But presidential speech<br />
is strange these days, and it would take a better rhetorician than I am to understand<br />
the mysteriousness of its ways. Why should it be, for instance, that Iraq is called a<br />
threat to the security of the “civilized world” while missiles flying from North Korea,<br />
and even the attempted hostage-taking of US boats, are called “regional issues”? And<br />
if the US President was urged by the majority of the world to withdraw his threat of<br />
war, why does he not seem to feel obligated by this address? But given the shambles<br />
into which presidential address has fallen, perhaps we should think more seriously<br />
about the relation between modes of address and moral authority. This may help us<br />
to know what values the humanities have to offer, and what the situation of discourse<br />
is in which moral authority becomes binding.<br />
I would like to consider the “face,” the notion introduced by Emmanuel Levinas, to<br />
explain how it is that others make moral claims upon us, address moral demands<br />
to us, ones that we do not ask for, ones that we are not free to refuse. Levinas makes<br />
a preliminary demand upon me, but his is not the only demand that I am bound to<br />
follow these days. I will trace what seem to me the outlines of a possible Jewish ethic<br />
of non-violence. Then I will relate this to some of the more pressing questions of<br />
violence and ethics that are upon us now. The Levinasian notion of the “face” has caused<br />
critical consternation for a long time. It seems to be that the “face” of what he calls<br />
the “Other” makes an ethical demand upon me, and yet we do not know which demand<br />
it makes. The “face” of the other cannot be read for a secret meaning, and the imperative<br />
it delivers is not immediately translatable into a prescription that might be linguistically<br />
formulated and followed.<br />
Levinas writes:<br />
The approach to the face is the most basic mode of responsibility …. The face is not<br />
in front of me (en face de moi), but above me; it is the other before death, looking<br />
through and exposing death. Secondly, the face is the other who asks me not to let<br />
him die alone, as if to do so were to become an accomplice in his death. Thus the face<br />
says to me: you shall not kill. In the relation to the face I am exposed as a usurper<br />
of the place of the other. The celebrated “right to existence” that Spinoza called the<br />
conatus essendi and defined as the basic principle of all intelligibility is challenged<br />
by the relation to the face. Accordingly, my duty to respond to the other suspends my<br />
natural right to self-survival, le droit vitale. My ethical relation of love for the other<br />
stems from the fact that the self cannot survive by itself alone, cannot find meaning<br />
within its own being-in-the-world …. To expose myself to the vulnerability of the face<br />
is to put my ontological right to existence into question. In ethics, the other’s right<br />
to exist has primacy over my own, a primacy epitomized in the ethical edict: you shall<br />
not kill, you shall not jeopardize the life of the other.1<br />
Levinas writes further:<br />
The face is what one cannot kill, or at least it is that whose meaning consists in saying,<br />
“thou shalt not kill.” Murder, it is true, is a banal fact: one can kill the Other; the<br />
ethical exigency is not an ontological necessity …. It also appears in the Scriptures,
2 Emmanuel Levinas, Ethics and<br />
Infinity, trans. Richard A. Cohen,<br />
Pittsburgh: Duquesne University<br />
Press, 1985, p. 87. Cited in the<br />
text as EI.<br />
3 Emmanuel Levinas, “Peace and<br />
Proximity,” in Basic Philosophical<br />
Writings, ed. Adriaan T. Peperzak,<br />
Simon Critchley, and Robert<br />
Bernasconi, Bloomington: Indiana<br />
University Press, 1996. p. 167.<br />
Cited in the text as PP.<br />
to which the humanity of man is exposed inasmuch as it is engaged in the world.<br />
But to speak truly, the appearance in being of these “ethical peculiarities” – the<br />
humanity of man – is a rupture of being. It is significant, even if being resumes and<br />
recovers itself.2<br />
So the face, strictly speaking, does not speak, hut what the face means is nevertheless<br />
conveyed by the commandment, “Thou shalt not kill.” It conveys this commandment<br />
without precisely speaking it. It would seem that we can use this biblical command to<br />
understand something of the face’s meaning, hut something is missing here, since the<br />
“face” does not speak in the sense that the mouth does; the face is neither reducible<br />
to the mouth nor, indeed, to anything the mouth has to utter. Someone or something<br />
else speaks when the face is likened to a certain kind of speech; it is a speech that<br />
does not come from a mouth or, if it does, has no ultimate origin or meaning there. In<br />
fact, in an essay entitled “Peace and Proximity,” Levinas makes plain that “the face<br />
is not exclusively a human face.”3 To explain this, he refers to Vassili Grossman’s text<br />
Life and Fate, which he describes as:<br />
the story … of the families, wives, and parents of political detainees traveling to<br />
the Lubyanka in Moscow for the latest news. A line is formed at the counter, a line<br />
where one can see only the backs of others. A woman awaits her turn: [She] had<br />
never thought that the human back could be so expressive, and could convey states<br />
of mind in such a penetrating way. Persons approaching the counter had a particular<br />
way of craning their neck and their back, their raised shoulders with shoulder blades<br />
like springs, which seemed to cry, sob, and scream. (PP, 167)<br />
Here the term “face” operates as a catachresis: “face” describes the human back, the<br />
craning of the neck, the raising of the shoulder blades like “springs.” And these bodily<br />
parts, in turn, are said to cry and to sob and to scream, as if they were a face or, rather,<br />
a face with a mouth, a throat, or indeed, just a mouth and throat from which vocalizations<br />
emerge that do not settle into words. The face is to be found in the back and the<br />
neck, but it is not quite a face. The sounds that come from or through the face are<br />
agonized, suffering. So we can see already that the “face” seems to consist in a series<br />
of displace ments such that a face is figured as a back which, in turn, is figured as a<br />
scene of agonized vocalization. And though there are many names strung in a row here,<br />
they end with a figure for what cannot he named, an utterance that is not, strictly speaking,<br />
linguistic. Thus the face, the name for the face, and the words by which we are<br />
to understand its meaning –”Thou shalt not kill” – do not quite deliver the meaning of<br />
the face, since at the end of the line, it seems, it is precisely the wordless vocalization<br />
of suffering that marks the limits of linguistic translation here. The face, if we are to put<br />
words to its meaning, will be that for which no words really work; the face seems to be<br />
a kind of sound, the sound of language evacuating its sense, the sonorous substratum<br />
of vocalization that precedes and limits the delivery of any semantic sense.<br />
At the end of this description, Levinas appends the following lines, which do not quite<br />
accomplish the sentence form: “The face as the extreme precariousness of the other.<br />
Peace as awakeness to the precariousness of the other” (PP, 167). Both statements<br />
are similes, and they both avoid the verb, especially the copula. They do not say that<br />
the face is that precariousness, or that peace is the mode of being awake to an Other’s<br />
precariousness. Both phrases are substitutions that refuse any commitment to the<br />
order of being. Levinas tells us, in fact, that “humanity is a rupture of being” and in the<br />
previous remarks he performs that suspension and rupture in an utterance that is both<br />
less and more than a sentence form. To respond to the face, to understand its meaning,<br />
means to be awake to what is precarious in another life or, rather, the precariousness
242 — 243<br />
Judith Butler<br />
4 The theological background of<br />
this can be found in Exodus. God<br />
makes clear to Moses that no one<br />
can see God’s face, that is, that<br />
the divine face is not for seeing<br />
and not available to representation:<br />
“Thou canst not see my face:<br />
for there shall no man see me, and<br />
live” (33: 20, King James); later,<br />
God makes plain that the back can<br />
and will substitute for the face:<br />
“And I will take away mine hand,<br />
and thou shalt see my back parts;<br />
but my face shall not be seen”<br />
(33: 23). Later, when Moses is<br />
carrying God’s words in the form of<br />
the commandments, it is written,<br />
“And when Aaron and all the children<br />
of Israel saw Moses, behold,<br />
the skin of his face shone; and<br />
they were afraid to come nigh him”<br />
(34: 30). But Moses’ face, carrying<br />
the divine word, is also not to be<br />
represented. When Moses returns<br />
to his human place, he can show<br />
his face: “And till Moses had done<br />
speaking with them, he put a veil<br />
on his face. But when Moses went<br />
in before the Lord to speak with<br />
him, he came out, and spake unto<br />
the children of Israel that which he<br />
was commanded. And the children<br />
of Israel saw the face of Moses,<br />
that the skin of Moses’ face shone:<br />
and Moses put the veil on his face<br />
again, until he went in to speak<br />
with him.” I thank Barbara Johnson<br />
for calling these passages to my<br />
attention.<br />
5 Levinas writes, “But that face<br />
facing me, in its expression –<br />
in its mortality – summons me,<br />
demands me, requires me: as if<br />
the invisible death faced by the<br />
face of the other … were ‘my business.’<br />
As if, unknown by the other<br />
whom already, in the nakedness<br />
of his face, it concerns, it ‘regarded<br />
me’ before its confrontation with<br />
me, before being the death that<br />
stares me, myself, in the face.<br />
The death of the other man puts<br />
me on the spot, calls me into<br />
question, as if I, by my possible<br />
indifference, became the accomplice<br />
of that death, invisible to<br />
the other who is exposed to it; as<br />
if even before being condemned to<br />
it myself, I had to answer for that<br />
death of the other, and not leave<br />
the other alone to his deathly<br />
solitude,” in Emmanuel Levinas,<br />
Alterity and Transcendence, New<br />
York: Columbia University Press,<br />
1999, pp. 24–5.<br />
of life itself. This cannot be an awakeness, to use his word, to my own life, and then<br />
an extrap olation from an understanding of my own precariousness to an understanding<br />
of another’s precarious life. It has to be an under standing of the precariousness of<br />
the Other. This is what makes the face belong to the sphere of ethics. Levinas writes,<br />
“the face of the other in its precariousness and defenselessness, is for me at once<br />
the temptation to kill and the call to peace, the ‘You shall not kill’” (PP, 167). This last<br />
remark suggests something quite disarming in several senses. Why would it be that<br />
the very precariousness of the Other would produce for me a temptation to kill? Or<br />
why would it produce the temptation to kill at the same time that it delivers a demand<br />
for peace? Is there something about my apprehension of the Other’s precariousness<br />
that makes me want to kill the Other? Is it the simple vulnerability of the Other that<br />
becomes a murderous temptation for me? If the Other, the Other’s face, which after<br />
all carries the meaning of this precariousness, at once tempts me with murder and<br />
prohibits me from acting upon it, then the face operates to produce a struggle for me,<br />
and establishes this struggle at the heart of ethics. It would seem that it is God’s<br />
voice that is represented by the human voice, since it is God who says, through Moses,<br />
“Thou shalt not kill.” The face that at once makes me murderous and prohibits me from<br />
murder is the one that speaks in a voice that is not its own, speaks in a voice that is<br />
no human voice.4 So the face makes various utterances at once: it bespeaks an agony,<br />
an injurability, at the same time that it bespeaks a divine prohibition against killing.5<br />
Earlier in “Peace and Proximity,” Levinas considers the vocation of Europe, and wonders<br />
whether the “Thou shalt not kill” is not precisely what one should hear in the very<br />
meaning of European culture. It is unclear where his Europe begins or ends, whether it<br />
has geographical boundaries, or whether it is produced every time the commandment<br />
is spoken or conveyed. This is, already, a curious Europe whose meaning is conjectured<br />
to consist in the words of the Hebrew God, whose civilizational status, as it were,<br />
depends upon the transmission of divine interdictions from the Bible. It is Europe in<br />
which Hebraism has taken the place of Hellenism, and Islam remains unspeakable.<br />
Perhaps Levinas is telling us that the only Europe that ought to be called Europe is<br />
the one that elevates the old Testament over civil and secular law. In any case, he<br />
seems to be returning to the primacy of interdiction to the meaning of civilization itself.<br />
And though we might be tempted to understand this as a nefarious Eurocentrism,<br />
it is probably also important to see that there is no recognizable Europe that can be<br />
derived from his view. In fact, it is not the existence of the interdiction against murder<br />
that makes Europe Europe, but the anxiety and the desire that the interdiction produces.<br />
As he continues to explain how this commandment works, he refers to Genesis,<br />
chapter 32, in which Jacob learns of his brother and rival Esau’s imminent approach.<br />
Levinas writes, “Jacob is troubled by the news that his brother Esau – friend or foe –<br />
is marching to meet him ‘at the head of four hundred men.’ Verse 8 tells us: ‘Jacob was<br />
greatly afraid and anxious.’’’ Levinas then turns to the commentator Rashi to understand<br />
“the difference between fright and anxiety,” and concludes that “[Jacob] was<br />
frightened of his own death but was anxious he might have to kill” (PP, 164).<br />
Of course, it is unclear still why Levinas would assume that one of the first or primary<br />
responses to another’s precariousness is the desire to kill. Why would it be that the<br />
spring of the shoulder blades, the craning of the neck, the agonized vocalization conveying<br />
another’s suffering would prompt in anyone a lust for violence? It must be that<br />
Esau over there, with his four hundred men, threatens to kill me, or looks like he will,<br />
and that in relation to that menacing Other or, indeed, the one whose face represents<br />
a menace, I must defend myself to preserve my life. Levinas explains, though, that<br />
murdering in the name of self-preservation is not justified, that self-preservation is<br />
never a sufficient condition for the ethical justification of violence. This seems, then,
like an extreme pacifism, an absolute pacifism, and it may well be. We may or may not<br />
want to accept these consequences, but we should consider the dilemma they pose<br />
as constitutive of the ethical anxiety: “Frightened for his own life, but anxious he might<br />
have to kill.” There is fear for one’s own survival, and there is anxiety about hurting<br />
the Other, and these two impulses are at war with each other, like siblings fighting. But<br />
they are at war with each other in order not to be at war, and this seems to be the<br />
point. For the non violence that Levinas seems to promote does not come from a peaceful<br />
place, but rather from a constant tension between the fear of undergoing violence<br />
and the fear of inflicting violence. I could put an end to my fear of my own death by<br />
obliterating the other, although I would have to keep obliterating, especially if there<br />
are four hundred men behind him, and they all have families and friends, if not a nation<br />
or two behind them. I could put an end to my anxiety about becoming a murderer by<br />
reconciling myself to the ethical justification for inflict ing violence and death under<br />
such conditions. I could bring out the utilitarian calculus, or appeal to the intrinsic<br />
rights of individuals to protect and preserve their own rights: We can imagine uses<br />
of both consequentialist and deontological justifications that would give me many<br />
opportunities to inflict violence righteously. A consequentialist might argue that it<br />
would be for the good of the many. A deontologist might appeal to the intrinsic worth<br />
of my own life. They could also be used to dispute the primacy of the interdiction on<br />
murder, an interdiction in the face of which I would continue to feel my anxiety.<br />
Although Levinas counsels that self-preservation is not a good enough reason to kill,<br />
he also presumes that the desire to kill is primary to human beings. If the first<br />
impulse towards the other’s vulnerability is the desire to kill, the ethical injunction is<br />
precisely to militate against that first impulse. In psychoanalytic terms, that would<br />
mean marshal ing the desire to kill in the service of an internal desire to kill one’s own<br />
aggression and sense of priority. The result would probably be neurotic, but it may<br />
be that psychoanalysis meets a limit here. For Levinas, it is the ethical itself that gets<br />
one out of the circuitry of bad conscience, the logic by which the prohibition against<br />
aggression becomes the internal conduit for aggression itself. Aggression is then turned<br />
back upon oneself in the form of super-egoic cruelty. If the ethical moves us beyond<br />
bad conscience, it is because bad conscience is, after all, only a negative version of<br />
narcissism, and so still a form of narcissism. The face of the Other comes to me from<br />
outside, and interrupts that narcissistic circuit. The face of the Other calls me out of<br />
narcissism towards something finally more important.<br />
Levinas writes:<br />
The Other is the sole being I can wish to kill. I can wish. And yet this power is quite<br />
the contrary of power. The triumph of this power is its defeat as power. At the very<br />
moment when my power to kill realizes itself, the other has escaped me …. I have not<br />
looked at him in the face, I have not encountered his face. The temptation of total<br />
negation … this is the presence of the face. To be in relation with the other face to<br />
face is to be unable to kill. It is also the situation of discourse. (9)<br />
It is also the situation of discourse …<br />
… this last is no idle claim. Levinas explains in one interview that “face and discourse<br />
are tied. It speaks, it is in this that it renders possible and begins all discourse” (EI, 87).<br />
Since what the face “says” is “Thou shalt not kill,” it would appear that it is through<br />
this primary commandment that speaking first comes into being, so that speaking first<br />
comes into being against the backdrop of this possible murder. More generally, discourse<br />
makes an ethical claim upon us precisely because, prior to speaking, something<br />
is spoken to us. In a simple sense, and perhaps not quite as Levinas intended, we are
244 — 245<br />
Judith Butler<br />
first spoken to, addressed, by an Other, before we assume language for ourselves. And<br />
we can conclude further that it is only on the condition that we are addressed that we<br />
are able to make use of language. It is in this sense that the Other is the condition of<br />
discourse. If the Other is obliterated, so too is language, since language cannot survive<br />
outside of the conditions of address.<br />
But let us remember that Levinas has also told us that the face – which is the face of<br />
the Other, and so the ethical demand made by the Other – is that vocalization of agony<br />
that is not yet language or no longer language, the one by which we are wakened to<br />
the precariousness of the Other’s life, the one that rouses at once the temptation to<br />
murder and the interdiction against it. Why would it be that the inability to kill is the<br />
situation of discourse? Is it rather that the tension between fear for one’s own life and<br />
anxiety about becoming a murderer constitutes the ambivalence that is the situation<br />
of discourse? That situation is one in which we are addressed, in which the Other directs<br />
language towards us. That language communicates the precariousness of life that<br />
establishes the ongoing tension of a non-violent ethics. The situation of discourse is<br />
not the same as what is said or, indeed, what is sayable. For Levinas, the situation of<br />
discourse consists in the fact that language arrives as an address we do not will, and<br />
by which we are, in an original sense, captured, if not, in Levinas’ terms, held hostage.<br />
So there is a certain violence already in being addressed, given a name, subject to a set<br />
of impositions, compelled to respond to an exacting alterity. No one controls the terms<br />
by which one is addressed, at least not in the most fundamental way. To be addressed<br />
is to be, from the start, deprived of will, and to have that deprivation exist as the basis<br />
of one’s situation in discourse.<br />
Within the ethical frame of the Levinasian position, we begin by positing a dyad. But<br />
the sphere of politics, in his terms, is one in which there are always more than two<br />
subjects at play in the scene. Indeed, I may decide not to invoke my own desire to<br />
preserve my life as a justification for violence, but what if violence is done to someone<br />
I love? What if there is an Other who does violence to another Other? To which Other<br />
do I respond ethically? which Other do I put before myself? Or do I then stand by?<br />
Derrida claims that to try and respond to every Other can only result in a situation of<br />
radical irresponsibility. And the Spinozists, the Nietzscheans, the utilitarians, and the<br />
Freudians all ask, “Can I invoke the imperative to preserve the life of the Other even<br />
if I cannot invoke this right of self-preservation for myself?” And is it really possible<br />
to sidestep self-preservation in the way that Levinas implies? Spinoza writes in The<br />
Ethics that the desire to live the right life requires the desire to live, to persist in one’s<br />
own being, suggesting that ethics must always marshal some life drives, even if, as<br />
a super-egoic state, ethics threatens to become a pure culture of the death drive.<br />
It is possible, even easy, to read Levinas as an elevated masochist and it does not help<br />
us to avert that conclusion when we consider that, when asked what he thought<br />
of psycho analysis, he is said to have responded, is that not a form of pornography?<br />
But the reason to consider Levinas in the context of today is at least twofold. First,<br />
he gives us a way of thinking about the relationship between representation and<br />
humanization, a relationship that is not as straightforward as we might like to think.<br />
If critical thinking has something to say about or to the present situation, it may well<br />
be in the domain of representation where humanization and dehumani zation occur<br />
ceaselessly. Second, he offers, within a tradition of Jewish philosophy, an account of<br />
the relationship between violence and ethics that has some important implications<br />
for thinking through what an ethic of Jewish non-violence might be. This strikes me as<br />
a timely and urgent question for many of us, especially those of us supporting the<br />
emergent moment of post-Zionism within Judaism. For now, I would like to reconsider<br />
first the problematic of human ization if we approach it through the figure of the face.
6 Levinas distinguishes sometimes<br />
between the “countenance”<br />
understood as the face within perceptual<br />
experience, and the “face”<br />
whose coordinates are understood<br />
to transcend the perceptual field.<br />
He also speaks on occasion about<br />
“plastic” representations of the<br />
face that efface the face. For the<br />
face to operate as a face, it must<br />
vocalize or be understood as the<br />
workings of a voice.<br />
7 See Lila Abu-Lughod, “Do<br />
Muslim Women Really Need<br />
Saving? Anthropological Reflections<br />
on Cultural Relativism and<br />
Others,” American Anthropologist,<br />
104: 3, pp. 783–90.<br />
When we consider the ordinary ways that we think about human ization and dehumanization,<br />
we find the assumption that those who gain representation, especially<br />
self-representation, have a better chance of being humanized, and those who have no<br />
chance to represent themselves run a greater risk of being treated as less than human,<br />
regarded as less than human, or indeed, not regarded at all. We have a paradox before<br />
us because Levinas has made clear that the face is not exclusively a human face, and<br />
yet it is a condition for humanization.6 On the other hand, there is the use of the face,<br />
within the media, in order to effect a dehumanization. It would seem that personification<br />
does not always humanize. For Levinas, it may well evacuate the face that does<br />
humanize; and I hope to show, personification sometimes performs its own dehumanization.<br />
How do we come to know the difference between the inhuman but humanizing<br />
face, for Levinas, and the dehumanization that can also take place through the face?<br />
We may have to think of different ways that violence can happen: one is precisely<br />
through the production of the face, the face of Osama bin Laden, the face of Yasser<br />
Arafat, the face of Saddam Hussein. What has been done with these faces in the media?<br />
They are framed, surely, but they are also playing to the frame. And the result is invariably<br />
tendentious. These are media portraits that are often mar shaled in the service<br />
of war, as if bin Laden’s face were the face of terror itself, as if Arafat were the face of<br />
deception, as if Hussein’s face were the face of contemporary tyranny. And then there<br />
is the face of Colin Powell, as it is framed and circulated, seated before the shrouded<br />
canvas of Picasso’s Guernica: a face that is foregrounded, we might say, against a<br />
background of effacement. Then there are the faces of the Afghan girls who stripped<br />
off, or let fall, their burkas. One week last winter, I visited a political theorist who<br />
proudly displayed these faces on his refrigerator door, right next to some apparently<br />
valuable supermarket coupons, as a sign of the success of democracy. A few days later,<br />
I attended a conference in which I heard a talk about the important cultural meanings<br />
of the burka, the way in which it signifies belonging-ness to a community and religion,<br />
a family, an extended history of kin relations, an exercise of modesty and pride, a protection<br />
against shame, and operates as well as a veil behind which, and through which,<br />
feminine agency can and does work.7 The fear of the speaker was that the destruction<br />
of the burka, as if it were a sign of repression, backwardness or, indeed, a resistance<br />
to cultural modernity itself, would result in a significant decimation of Islamic culture<br />
and the extension of US cultural assumptions about how sexuality and agency ought<br />
to be organized and represented. According to the triumphalist photos that dominated<br />
the front page of the New York: Times, these young women bared their faces as an act<br />
of liberation, an act of grat itude to the US military, and an expression of a pleasure that<br />
had become suddenly and ecstatically permissible. The American viewer was ready, as<br />
it were, to see the face, and it was to the camera, and for the camera, after all, that the<br />
face was finally bared, where it became, in a flash, a symbol of successfully exported<br />
American cultural prog ress. It became bared to us, at that moment, and we were, as it<br />
were, in possession of the face; not only did our cameras capture it, but we arranged for<br />
the face to capture our triumph, and act as the rationale for our violence, the incursion<br />
on sovereignty, the deaths of civilians. Where is loss in that face? And where is the<br />
suffering over war? Indeed, the photographed face seemed to conceal or displace the<br />
face in the Levinasian sense, since we saw and heard through that face no vocalization<br />
of grief or agony, no sense of the precariousness of life.<br />
So we seem to be charting a certain ambivalence. In a strange way, all of these faces<br />
humanize the events of the last year or so; they give a human face to Afghan women;<br />
they give a face to terror; they give a face to evil. But is the face humanizing in each<br />
and every instance? And if it is humanizing in some instances, in what form does this<br />
humanization occur, and is there also a dehumanization performed in and through the
246 — 247<br />
Judith Butler<br />
8 For an extended discussion of<br />
the relation between the media<br />
image and human suffering,<br />
see Susan Sontag’s provocative<br />
Regarding the Pain of Others,<br />
New York: Farrar, Straus, and<br />
G iroux, 2002.<br />
face? Do we encounter those faces in the Levinasian sense, or are these, in various<br />
ways, images that, through their frame, produce the paradigmatically human, become<br />
the very cultural means through which the paradigmatically human is established?<br />
Although it is tempting to think that the images themselves establish the visual norm<br />
for the human, one that ought to be emulated or embodied, this would be a mistake,<br />
since in the case of bin Laden or Saddam Hussein the paradigmatically human is<br />
understood to reside outside the frame; this is the human face in its deformity and<br />
extremity, not the one with which you are asked to identify. Indeed, the disidentification<br />
is incited through the hyperbolic absorption of evil into the face itself, the eyes. And<br />
if we are to understand ourselves as interpellated anywhere in these images, it is<br />
precisely as the unrepresented viewer, the one who looks on, the one who is captured<br />
by no image at all, but whose charge it is to capture and subdue, if not eviscerate,<br />
the image at hand. Similarly, although we might want to champion the suddenly bared<br />
faces of the young Afghan women as the celebration of the human, we have to ask<br />
in what narrative function these images are mobilized, whether the incursion into<br />
Afghanistan was really in the name of feminism, and in what form of feminism did it<br />
belatedly clothe itself. Most importantly, though, it seems we have to ask what scenes<br />
of pain and grief these images cover over and derealize. Indeed, all of these images<br />
see m to suspend the precariousness of life; they either represent American triumph,<br />
or provide an incitement for American military triumph in the future. They are the<br />
spoils of war or they are the targets of war. And in this sense, we might say that the<br />
face is, in every instance, defaced, and that this is one of the representational and<br />
philosophical consequences of war itself.<br />
It is important to distinguish among kinds of unrepresentability. In the first instance,<br />
there is the Levinasian view according to which there is a “face” which no face can fully<br />
exhaust, the face understood as human suffering, as the cry of human suffering, which<br />
can take no direct representation. Here the “face” is always a figure for something<br />
that is not literally a face. Other human expressions, however, seem to be figurable as<br />
a “face” even though they are not faces, but sounds or emissions of another order. The<br />
cry that is represented through the figure of the face is one that confounds the senses<br />
and produces a clearly improper comparison: that cannot be right, for the face is not<br />
a sound. And yet, the face can stand for the sound precisely because it is not the sound.<br />
In this sense, the figure underscores the incommensurability of the face with whatever<br />
it represents. Strictly speaking, then, the face does not represent anything, in the<br />
sense that it fails to capture and deliver that to which it refers.<br />
For Levinas, then, the human is not represented by the face. Rather, the human is<br />
indirectly affirmed in that very disjunction that makes representation impossible, and<br />
this disjunction is conveyed in the impossible representation. For representation to<br />
convey the human, then, representation must not only fail, but it must show its failure.<br />
There is something unrepresentable that we nevertheless seek to represent, and that<br />
paradox must be retained in the representation we give.<br />
In this sense, the human is not identified with what is represented but neither is it<br />
identified with the unrepresentable; it is, rather, that which limits the success of any<br />
representational practice. The face is not “effaced” in this failure of representation,<br />
but is constituted in that very possibility. Something altogether different happens,<br />
however, when the face operates in the service of a personification that claims to<br />
“capture” the human being in question. For Levinas, the human cannot be captured<br />
through the representation, and we can see that some loss of the human takes pIace<br />
when it is “captured” by the image.8<br />
An example of that kind of “capture” takes place when evil is personified through the<br />
face. A certain commensurability is asserted between that ostensible evil and the face.
9 For a discussion of “failure” as<br />
basic to a psychoanalytic conception<br />
of the psyche, see Jacqueline<br />
Rose, Sexuality in the Field<br />
of Vision, London: Verso, 1986,<br />
pp. 91–3.<br />
10 Levinas writes, “one can say<br />
that the face is not ‘seen.’ It is<br />
what cannot become a content,<br />
which your thought would<br />
embrace; it is uncontainable, it<br />
leads you beyond” (EI, pp. 86–7).<br />
This face is evil, and the evil that the face is extends to the evil that belongs to humans<br />
in general – generalized evil. We personify the evil or military triumph through a face that<br />
is supposed to be, to capture, to contain the very idea for which it stands. In this case,<br />
we cannot hear the face through the face. The face here masks the sounds of human<br />
suffering and the proximity we might have to the precariousness of life itself.<br />
The face over there, though, the one whose meaning is portrayed as captured by evil<br />
is precisely the one that is not human, not in the Levinasian sense. The ‘’I’’ who sees<br />
that face is not identified with it: the face represents that for which no identification is<br />
possible, an accomplishment of dehumanization and a condition for violence.<br />
Of course, a fuller elaboration of this topic would have to parse the various ways that<br />
representation works in relation to human ization and dehumanization. Sometimes<br />
there are triumphalist images that give us the idea of the human with whom we are to<br />
identify, for instance the patriotic hero who expands our own ego boundary ecstatically<br />
into that of the nation. No understanding of the relation ship between the image and<br />
humanization can take place without a consideration of the conditions and meanings<br />
of identification and disidentification. It is worth noting, however, that identification<br />
always relies upon a difference that it seeks to overcome, and that its aim is accomplished<br />
only by reintroducing the difference it claims to have vanquished. The one with<br />
whom I identify is not me, and that “not being me” is the condition of the identification.<br />
Otherwise, as Jacqueline Rose reminds us, identification collapses into identity, which<br />
speIls the death of identification itself.9 This difference internal to identification is<br />
crucial, and, in a way, it shows us that disidentification is part of the common practice<br />
of identification itself. The triumphalist image can communicate an impossible overcoming<br />
of this difference, a kind of identification that believes that it has overcome<br />
the difference that is the condition of its own possibility. The critical image, if we can<br />
speak that way, works this difference in the same way as the Levinasian image; it must<br />
not only fail to capture its referent, but show this failing.<br />
The demand for a truer image, for more images, for images that convey the full horror<br />
and reality of the suffering has its place and importance. The erasure of that suffering<br />
through the prohibition of images and representations more generally circumscribes<br />
the sphere of appearance, what we can see and what we can know. But it would be a<br />
mistake to think that we only need to find the right and true images, and that a certain<br />
reality will then be conveyed. The reality is not conveyed by what is represented within<br />
the image, but through the challenge to representation that reality delivers.10<br />
The media’s evacuation of the human through the image has to be understood, though,<br />
in terms of the broader problem that normative schemes of intelligibility establish<br />
what will and will not be human, what will be a livable life, what will be a grievable<br />
death. These normative schemes operate not only by producing ideals of the human<br />
that differentiate among those who are more and less human. Sometimes they produce<br />
images of the less than human, in the guise of the human, to show how the less than<br />
human disguises itself, and threatens to deceive those of us who might think we<br />
recognize another human there, in that face. But sometimes these normative schemes<br />
work precisely through providing no image, no name, no narrative, so that there never<br />
was a life, and there never was a death. These are two distinct forms of normative<br />
power: one operates through producing a symbolic identification of the face with the<br />
inhuman, foreclosing our apprehension of the human in the scene; the other works<br />
through radical effacement, so that there never was a human, there never was a life,<br />
and no murder has, therefore, ever taken place. In the first instance, something that<br />
has already emerged into the realm of appearance needs to be disputed as recognizably<br />
human; in the second instance, the public realm of appearance is itself constituted<br />
on the basis of the exclusion of that image. The task at hand is to establish modes of<br />
public seeing and hearing that might weIl respond to the cry of the human within the
248 — 249<br />
Judith Butler<br />
sphere of appear ance, a sphere in which the trace of the cry has become hyperbolically<br />
inflated to rationalize a gluttonous nationalism, or fully obliterated, where both alternatives<br />
turn out to be the same. We might consider this as one of the philosophical<br />
and representational implications of war, because politics – and power – work in part<br />
through regulating what can appear, what can be heard.<br />
Of course, these schemas of intelligibility are tacitly and force fully mandated by<br />
those corporations that monopolize control over the mainstream media with strong<br />
interests in maintaining US military power. The war coverage has brought into relief<br />
the need for a broad de-monopolozing of media interests, legislation for which has<br />
been, predictably, highly contested on Capitol HilI. We think of these interests as<br />
controlling rights of ownership, but they are also, simul taneously, deciding what will<br />
and will not be publicly recognizable as reality. They do not show violence, but there<br />
is a violence in the frame in what is shown. That latter violence is the mechanism<br />
through which certain lives and deaths either remain unrepresentable or become<br />
represented in ways that effects their capture (once again) by the war effort. The<br />
first is an effacement through occlusion; the second is an effacement through<br />
representation itself.<br />
What is the relation between the violence by which these ungriev able lives were lost<br />
and the prohibition on their public grievability? Is the prohibition on grieving the<br />
continuation of the violence itself? And does the prohibition on grieving demand a tight<br />
control on the reproduction of images and words? How does the prohibition on grieving<br />
emerge as a circumscription of representability, so that our national melancholia<br />
becomes tightly fitted into the frame for what can be said, what can be shown? Is this<br />
not the site where we can read, if we still read, the way that melancholia becomes<br />
inscribed as the limits of what can be thought? The derealization of loss – the insensitivity<br />
to human suffering and death – becomes the mechanism through which dehumanization<br />
is accomplished. This derealization takes place neither inside nor outside the<br />
image, but through the very framing by which the image is contained.<br />
In the initial campaign of the war against Iraq, the US govern ment advertised its military<br />
feats as an overwhelming visual phenomenon. That the US government and military<br />
called this a “shock and awe” strategy suggests that they were producing a visual<br />
spectacle that numbs the senses and, like the sublime itself, puts out of play the very<br />
capacity to think. This production takes place not only for the Iraqi population on<br />
the ground, whose senses are supposed to be done in by this spectacle, but also for<br />
the consumers of war who rely on CNN or Fox, the network that regularly inter spersed<br />
its war coverage on television with the claim that it is the “most trustworthy” news<br />
source on the war. The “shock and awe” strategy seeks not only to produce an aesthetic<br />
dimension to war, but to exploit and instrumentalize the visual aesthetics as part of<br />
a war strategy itself. CNN has provided much of these visual aesthetics. And although<br />
the New York Times belatedly came out against the war, it also adorned its front pages<br />
on a daily basis with romantic images of military ordnance against the setting sun in<br />
Iraq or “bombs bursting in air” above the streets and homes of Baghdad (which are not<br />
surprisingly occluded from view). Of course, it was the spectacular destruction of the<br />
World Trade Center that first made a claim upon the “shock and awe” effect, and the<br />
US recently displayed for all the world to see that it can and will be equally destructive.<br />
The media becomes entranced by the sublimity of destruction, and voices of dissent<br />
and opposition must find a way to intervene upon this desensitizing dream machine<br />
in which the massive destruction of lives and homes, sources of water, electricity, and<br />
heat, are produced as a delirious sign of a resuscitated US military power.<br />
Indeed, the graphic photos of US soldiers dead and decapitated in Iraq, and then the<br />
photos of children maimed and killed by US bombs, were both refused by the mainstream<br />
media, supplanted with footage that always took the aerial view, an aerial view
whose perspective is established and maintained by state power. And yet, the moment<br />
the bodies executed by the Hussein regime were uncovered, they made it to the front<br />
page of the New York Times, since those bodies must be grieved. The outrage over their<br />
deaths motivates the war effort, as it moves on to its managerial phase, which differs<br />
very little from what is commonly called “an occupation.”<br />
Tragically, it seems that the US seeks to preempt violence against itself by waging<br />
violence first, but the violence it fears is the violence it engenders. I do not mean to<br />
suggest by this that the US is respon sible in some causal way for the attacks on its<br />
citizens. And I do not exonerate Palestinian suicide bombers, regardless of the terrible<br />
conditions that animate their murderous acts. There is, however, some distance to<br />
be traveled between living in terrible conditions, suffering serious, even unbearable<br />
injuries, and resolving on murder ous acts. President Bush traveled that distance quickly,<br />
calling for “an end to grief” after a mere ten days of flamboyant mourning. Suffering<br />
can yield an experience of humility, of vulnerability, of impressionability and dependence,<br />
and these can become resources, if we do not “resolve” them too quickly; they<br />
can move us beyond and against the vocation of the paranoid victim who regenerates<br />
infinitely the justifications for war. It is as much a matter of wrestling ethically with<br />
one’s own murderous impulses, impulses that seek to quell an overwhelming fear, as<br />
it is a matter of apprehending the suffering of others and taking stock of the suffering<br />
one has inflicted.<br />
In the Vietnam War, it was the pictures of the children burning and dying from napalm<br />
that brought the US public to a sense of shock, outrage, remorse, and grief. These were<br />
precisely pictures we were not supposed to see, and they disrupted the visual field and<br />
the entire sense of public identity that was built upon that field. The images furnished<br />
a reality, but they also showed a reality that disrupted the hegemonic field of representation<br />
itself. Despite their graphic effectivity, the images pointed somewhere else,<br />
beyond themselves, to a life and to a precariousness that they could not show. It was<br />
from that apprehension of the precariousness of those lives we destroyed that many<br />
US citizens came to develop an important and vital consensus against the war. But<br />
if we continue to discount the words that deliver that message to us, and if the media<br />
will not run those pictures, and if those lives remain unnameable and ungrievable, if<br />
they do not appear in their precariousness and their destruction, we will not be moved.<br />
We will not return to a sense of ethical outrage that is, distinctively, for an Other, in<br />
the name of an Other. We cannot, under contemporary conditions of representation,<br />
hear the agonized cry or be compelled or commanded by the face. We have been turned<br />
away from the face, sometimes through the very image of the face, one that is meant<br />
to convey the inhuman, the already dead, that which is not precariousness and cannot,<br />
therefore, be killed; this is the face that we are nevertheless asked to kill, as if ridding<br />
the world of this face would return us to the human rather than consummate our<br />
own inhumanity. One would need to hear the face as it speaks in something other than<br />
language to know the precariousness of life that is at stake. But what media will let<br />
us know and feel that frailty, know and feel at the limits of representation as it is<br />
currently cultivated and maintained? If the humanities has a future as cultural criticism,<br />
and cultural criticism has a task at the present moment, it is no doubt to return us to<br />
the human where we do not expect to find it, in its frailty and at the limits of its capacity<br />
to make sense. We would have to interrogate the emergence and vanishing of the<br />
human at the limits of what we can know, what we can hear, what we can see, what<br />
we can sense. This might prompt us, affectively, to reinvigorate the intellectual projects<br />
of critique, of questioning, of coming to understand the difficulties and demands of<br />
cultural trans lation and dissent, and to create a sense of the public in which oppositional<br />
voices are not feared, degraded or dismissed, but valued for the instigation to a sensate<br />
democracy they occasionally perform.
250 — 251
Appendix
252 — 253<br />
Index
Lida Abdul<br />
White House, 2005<br />
16 mm film on DVD, 4 min 58 s<br />
Courtesy of the artist<br />
and Giorgio Persano, Torino<br />
In Transit, 2008<br />
16 mm film on DVD, 4 min 55 s<br />
Courtesy of the artist<br />
and Giorgio Persano, Torino<br />
Man in the Sea, 2010<br />
Two-channel film installation,<br />
film on DVD, 3 min 44 s<br />
Courtesy of the artist<br />
and Giorgio Persano, Torino<br />
Marcel Dzama<br />
Pip, 2004<br />
Sculpture: clothing with felt<br />
and fake fur, wire mesh, paper<br />
maché, plastic foam, rubber,<br />
185 × 60 × 45 cm; accompanied<br />
by 5 unframed drawings<br />
and 1 framed watercolour<br />
Private collection, Munich<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Knowing precisely where to cut,<br />
2008<br />
Diorama: wood, 2 sliding<br />
glass panels, plaster, cardboard,<br />
acrylic, rope, metal,<br />
taxidermic mice, artificial birds,<br />
91.4 × 76.8 × 45.7 cm<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Zürich redet mit Helvetia, 2008<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Lits et ratures, 2008<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Whose hell hoof resounds<br />
like heaven’s thunder, 2008<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Presence is unsustainable or<br />
The circle of traitors, 2008<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Surrounded by his dark machines<br />
and the rage of the wild<br />
or An epic of humanity, 2008<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Poor Bertrand de Born, 2009<br />
Collage on paper, 30.2 × 22.9 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Ulysses, 2009<br />
Graphite, ink, watercolour,<br />
tracing paper on piano scroll,<br />
3 sections: 28.5 × 234.5 cm,<br />
28.5 × 222 cm, 28.5 × 187.8 cm<br />
Deutsche Bank Collection<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf; David Zwirner,<br />
New York<br />
Maria Lassnig<br />
Stilleben mit rotem<br />
Selbstportrait, 1969<br />
Oil/canvas, 81 × 97 cm<br />
Neue Galerie Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Woman Laokoon, 1976<br />
Oil/canvas, 193 × 127 cm<br />
Neue Galerie Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Mark Manders<br />
Small Unfired Clay Figure,<br />
2006/07<br />
Iron, painted epoxy, wood,<br />
painted wood, book,<br />
153.5 × 64 × 29 cm<br />
Collection Raf Simons, Belgium<br />
Courtesy of Zeno X Gallery,<br />
Antwerp<br />
Clay Figure with Iron Chair, 2009<br />
Painted bronze, iron,<br />
81 × 177 × 59 cm<br />
Private collection<br />
Courtesy of Zeno X Gallery,<br />
Antwerp<br />
Two Interconnected Houses,<br />
2010<br />
80 black and white slides<br />
for a carousel-projector<br />
Courtesy of Zeno X Gallery,<br />
Antwerp<br />
Renzo Martens<br />
Episode 1, 2000/03<br />
Video installation, Hi-8 to HD,<br />
sound, color, 45 min<br />
Courtesy of Galerie Fons Welters<br />
and Wilkinson Gallery<br />
Episode 2, 2010<br />
Episode 3, 2009<br />
Video installation, PAL 16:9, HD,<br />
sound, color, 90 min; 2 metal<br />
trunks with master tape, some<br />
neon signs, a picture made<br />
in collaboration with Aphoka,<br />
Association des Photographes de<br />
Kanyabayonga, 84 × 47 × 35 cm<br />
and 65 × 30 × 24 cm<br />
Courtesy of Galerie Fons Welters<br />
and Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in collaboration with<br />
Renzo Martens, Child, 2007<br />
Photograph, 62 × 40 cm<br />
Courtesy of Galerie Fons Welters<br />
and Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in collaboration with Renzo<br />
Martens, Three Children, 2007<br />
Photograph, 40 × 62 cm<br />
Courtesy of Galerie Fons Welters<br />
and Wilkinson Gallery<br />
Association des Photographes<br />
de Kanyabayonga, Aphoka,<br />
in collaboration with Renzo<br />
Martens, Mother and Child, 2007<br />
Photograph, 62 × 40 cm<br />
Courtesy of Galerie Fons Welters<br />
and Wilkinson Gallery<br />
Kris Martin<br />
Mandi VIII, 2006<br />
Plaster, 221 × 150 × 100 cm<br />
David Roberts Collection,<br />
London<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf<br />
Bells, 2008<br />
Bronze bells,<br />
30 × 50 × 60 ○/ 30 cm<br />
Courtesy of Sies + Höke,<br />
Düsseldorf<br />
Adrian Paci<br />
Turn on, 2004<br />
Film on DVD, 3 min 33 s<br />
Courtesy of the artist;<br />
Francesca Kaufmann, Milano;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zurich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Per Speculum, 2006<br />
35 mm film, 6 min 53 s<br />
Courtesy of the artist;<br />
Francesca Kaufmann, Milano;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zurich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Electric Blue, 2010<br />
HD Video, approx. 15 min<br />
Courtesy of the artist;<br />
Francesca Kaufmann, Milano;<br />
Peter Kilchmann Galerie, Zurich;<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
Susan Philipsz<br />
The River Cycle, 2009<br />
Sound installation, 2 min 15 s<br />
Courtesy of the artist
254 — 255<br />
Biographies<br />
Lida Abdul<br />
Born 1973 in Kabul (AF),<br />
lives and works in Kabul (AF),<br />
California (US), and Europe<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Fundação Calouste Gulbenkian,<br />
Lisbon<br />
Krannert Art Museum, University<br />
of Illinois, Champaign<br />
Ruins: Stories of Awakening,<br />
Anna Schwartz Gallery,<br />
Melbourne<br />
2008<br />
In Transit, Giorgio Persano,<br />
Torino; Le Print Temps Septembre,<br />
Toulouse Art Festival, Toulouse;<br />
OK Centrum für<br />
Gegenwartskunst, Linz<br />
Western Front Exhibitions &<br />
Centre A, Vancouver<br />
IDEA Space, Colorado College,<br />
Colorado Springs<br />
Indianapolis Museum of Art,<br />
Indianapolis<br />
Alessandra Bonomo, Rome<br />
GSK Royal Academy of Arts,<br />
London<br />
2007<br />
Modern Mondays, MoMA,<br />
New York<br />
Musée Chagall, Nice<br />
Musée national Picasso, Vallauris<br />
ICA Prefix Institute of Contemporary<br />
Art, Toronto<br />
National Museum of Kabul, Kabul<br />
White House, Netwerk Centrum<br />
voor hedendaagse kunst, Aalst<br />
What We Saw Upon Awakening,<br />
Location One, New York<br />
2006<br />
Petition for Another World,<br />
Museum Voor Moderne Kunst,<br />
Arnhem<br />
Giorgio Persano, Torino<br />
After War Games, Musées Palais<br />
du Tau de Reims, Reims<br />
Pino Pascali Museo d’Arte<br />
Contemporanea, Polignano a Mare<br />
Now, Here, Over There. Lida Abdul/<br />
Tania Bruguera, FRAC Lorraine,<br />
Metz<br />
What We Saw Upon Awaking,<br />
CAC Brétigny, Brétigny<br />
2005<br />
Afghan Pavilion, La Biennale<br />
di Venezia, Venice<br />
Video des Monats #6:<br />
Lida Abdul, Kunsthalle Wien,<br />
Ursula Blickle Videolounge,<br />
Vienna<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
The individual and the war, AZKM<br />
Ausstellungshalle zeitgenössische<br />
Kunst Münster, Münster<br />
HomeLessHome, Museum on the<br />
Seam, Jerusalem<br />
CUE: Artist’ Videos, Vancouver<br />
Art Gallery, Vancouver<br />
Monument to Transformation,<br />
Galeria Miroslav Kraljevic, Zagreb<br />
Spatial City: An Architecture of<br />
Idealism, Institute of Visual Arts,<br />
Milwaukee; Hyde Park Art Center,<br />
Chicago; Museum of Contemporary<br />
Art, Detroit<br />
2009<br />
Anabasis: On Rituals of Homecoming,<br />
Ludwik Grohman Villa,<br />
Lodz<br />
Futur, FRAC Aquitaine, Bordeaux<br />
Bilderschlachten, EMAF<br />
European Media Art Festival,<br />
Osnabrück<br />
Monument to Transformation,<br />
City Gallery Prague, Prague<br />
Stranded Positions,<br />
Ausstellungs raum Klingental,<br />
Basel<br />
History of Violence, Haifa<br />
Museum of Art, Haifa<br />
The End, The Andy Warhol<br />
Museum, Pittsburgh<br />
Dream and Reality. Contemporary<br />
Art from the Near East,<br />
Zentrum Paul Klee, Bern<br />
Moving Perspectives: Lida Abdul<br />
and Dinh Q Le, Smithsonian<br />
Freer Gallery of Art and Arthur<br />
M. Sackler Gallery, Washington<br />
Riwaq Biennial, Ramallah<br />
2008<br />
Eurasia. Geographic cross-overs<br />
in art, MART Museo di Arte<br />
Moderna e Contemporanea<br />
di Trento e Rovereto, Trento/<br />
Rovereto<br />
4th Triennale of Contemporary<br />
Art Oberschwaben, Zeppelin<br />
Museum, Friedrichshafen<br />
Biennale Cuvée, OK Centrum<br />
für Gegenwartskunst, Linz<br />
Yellow Cruise, Louis Vuitton<br />
Espace, Paris<br />
Artes Mundi 3rd Award Exhibition,<br />
National Museum of Cardiff,<br />
Cardiff<br />
Lida Abdul: In Transit,<br />
Video formes Festival,<br />
Clermont-Ferrand<br />
Intimacies of Distant War,<br />
Samuel Dorsky Museum of Art,<br />
New York<br />
Open Sky, Kunstverein<br />
Medienturm, Graz<br />
2007<br />
Illuminations, Tate Modern,<br />
London<br />
2nd Moscow Biennial of Contemporary<br />
Art, Moscow<br />
8th Sharjah Biennial, Sharjah<br />
Re-thinking Dissent,<br />
4th Göteborg International<br />
Biennial for Contemporary Art,<br />
Gothenburg<br />
3rd Auckland Triennial, Auckland<br />
Thermocline of Art: New Asian<br />
Waves, ZKM, Karlsruhe<br />
Memorial to Iraq War, ICA,<br />
London<br />
Timeout: Art and Sustainability,<br />
Kunstmuseum Liechtenstein,<br />
Vaduz<br />
Global Feminisms, Brooklyn<br />
Museum, New York; traveling<br />
show<br />
Asian Attitude/Transient Forces,<br />
The National Museum, Poznan;<br />
Zendai Museum of Modern Art,<br />
Shanghai; traveling show<br />
2006<br />
27th Sao Paulo Biennial,<br />
Sao Paulo<br />
First Chapter_Trace Root,<br />
Gwangju Biennale, Gwangju<br />
The Doubtful Strait. A Visual Art<br />
Event, Museo de Arte y Diseño<br />
Contemporáneo, Costa Rica<br />
Mens, S.M.A.K, Gent; K.U.,<br />
Leuven<br />
Painting as a Way of Living,<br />
Istanbul Museum of Modern Art,<br />
Istanbul<br />
The UnQuiet World,<br />
The Australian Centre for<br />
Contemporary Art, Victoria<br />
Undercurrents06, Göteborg<br />
Konstmuseum, Gothenburg<br />
Courants Alternatifs, Le Parvis<br />
Centre d’art contemporain,<br />
Ibos-Tarbes; CAPC Musée d’art<br />
contemporain, Bordeaux<br />
Painting Ruins, Foundation for<br />
Culture and Civil Society, Kabul<br />
Fast Futures: Asian Video Art,<br />
Mumbai<br />
ACAW Asian Contemporary Art<br />
Week, Brooklyn Art Museum,<br />
New York<br />
Nafas. Contemporary Art from<br />
the Islamic World, IFA, Berlin/<br />
Stuttgart<br />
Liberation, Tradition and<br />
Meaning/Women on the Edge<br />
of Culture, Milwaukee Institute<br />
of Art & Design, Milwaukee<br />
New territories, De Hallen,<br />
Bruges<br />
2005<br />
Between the Furniture and<br />
the Building (Between a Rock<br />
and a Hard Place), CAC Brétigny;<br />
FR66, Paris<br />
Wall to Destroyed, FRAC Lorraine,<br />
Metz<br />
Irreducible. Contemporary Short<br />
Form Video, Miami Central, Miami<br />
In the Shadow of Heroes,<br />
Central Asian Biennale,<br />
Kyrgyz Republic<br />
Video Lounge,<br />
South London Gallery, London<br />
Vinyl,<br />
Redux Projects Gallery, London<br />
Taste of others,<br />
Apex Art, New York<br />
2004<br />
Contemporaneity, Academy<br />
of Fine Arts, Tashkent; National<br />
Museum of Arts, Bishkek;<br />
Foundation for Culture and<br />
Civil Society, Kabul<br />
On healing, D.U.M.B.O., Brooklyn<br />
Poetics of Proximity,<br />
Chapman University, Orange<br />
2003<br />
Shibuya UNESCO Association,<br />
Tokyo<br />
Colors of God, Layola Marymount<br />
University, Los Angeles<br />
Open Ticket, Guggenheim Gallery<br />
Chapman College, Orange<br />
Wide Awake, Highways,<br />
Los Angeles<br />
ENTERINTERCESSOR,<br />
Raid Projects, Los Angeles<br />
2002<br />
All Stars of LA Performance<br />
Art, City of Los Angeles Cultural<br />
Affairs Department, Hollywood<br />
Not in our Name,<br />
The Palace Art Speak, Hollywood<br />
Democracy When?, LACE<br />
Los Angeles Contemporary Art<br />
Exhibitions, Hollywood<br />
After the Ruins of Kabul,<br />
Highways, Santa Monica;<br />
Bumbershoot Festival, Seattle;<br />
The Palace Art Speak, Hollywood<br />
Project Enduring Look, Exhibition<br />
Studies Space, School of the Art<br />
Institute of Chicago, Chicago<br />
GENERATION WHY: ARTISTS<br />
OF CONSCIENCE SPEAK,<br />
Occidental College, Los Angeles<br />
2001<br />
Overflowing, Track-16,<br />
Santa Monica<br />
The Gathering, Highways,<br />
Santa Monica<br />
Slam, Highways, Santa Monica<br />
In Public, Art Center College<br />
of Art and Design, Pasadena<br />
CAPITAL ART, Track-16,<br />
Santa Monica<br />
All Star of LA, Knitting Factory,<br />
Los Angeles
Marcel Dzama<br />
Born 1974 in Winnipeg (CA),<br />
lives and works in Brooklyn,<br />
New York (US)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Musée d’Art Contemporain de<br />
Montréal, Montreal<br />
Marcel Dzama: Delila’s Dance,<br />
Galeria Helga de Alvear, Madrid<br />
2009<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
2008<br />
Edition 46, Marcel Dzama, in<br />
cooperation with Süddeutsche<br />
Zeitung Magazine, Pinakothek<br />
der Moderne, Munich<br />
Even the Ghost of the Past,<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
2007<br />
Oficina para Proyectos de Arte<br />
(OPA), Guadalajara<br />
Celluloid Ceremony, Galleri<br />
Magnus Karlsson, Stockholm<br />
Moving Picture, Timothy Taylor,<br />
London<br />
2006<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Centre for Contemporary Arts,<br />
Glasgow<br />
IKON Gallery, Brimingham<br />
The Richard L. Nelson Gallery &<br />
The Fine Arts Collection,<br />
UC Davis, Davis<br />
2005<br />
David Zwirner, New York<br />
Centre d’arte Santa Monica,<br />
Barcelona<br />
2004<br />
Timothy Taylor Gallery, London<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Christophe Daviet-Thery,<br />
Livres et Editions d’Artistes, Paris<br />
Galleri Magnus Karlsson,<br />
Stockholm<br />
Olga Korper, Toronto<br />
2003<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Rizzero Arte, Pescara<br />
Art Gallery of Windsor, Windsor/<br />
Ontario<br />
Perugi Artecontemporanea,<br />
Padova<br />
2002<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
Timothy Taylor Gallery, London<br />
2001<br />
Mendel Art Gallery, Saskatoon,<br />
Saskatchewan<br />
Galleri Magnus Karlsson,<br />
Stockholm<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Monica de Cardenas, Milan<br />
2000<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
More Famous Drawings,<br />
Plug In Gallery, Winnipeg<br />
Zeichnungen + Video,<br />
Diehl Vorderwuelbecke, Berlin<br />
1999<br />
Greene Gallery, Geneva<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
1998<br />
Espace Purplex, Rio de Janeiro<br />
Casa Triangulo, Sao Paulo<br />
Richard Heller Gallery,<br />
Santa Monica<br />
Art Pace Foundation,<br />
San Antonio<br />
Art Forum Berlin, Berlin<br />
David Zwirner Gallery, New York<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2011<br />
Fairy Tales, Monsters and the<br />
Genetic Imagination, First Center<br />
for the Visual Arts, Nashville<br />
2010<br />
CUE: Artists’ Videos, Vancouver<br />
Art Gallery, Vancouver<br />
Monster, West Vancouver<br />
Museum, West Vancouver<br />
2009<br />
Wonderland, KAdE, Amersfoort<br />
Compass in Hand: Selections<br />
from The Judith Rothschild<br />
Foundation Contemporary<br />
Drawings Collection, The<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
Mi Vida. From Heaven to Hell:<br />
Life Experiences in Art from the<br />
MUSAC Collection, Mucsarnok<br />
Kunsthalle, Budapest<br />
Private Universes, Dallas<br />
Museum of Art, Dallas<br />
Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv<br />
2008<br />
The Other Mainstream II:<br />
Selections from the Collection<br />
of Mikki and Stanley Weithorn,<br />
Arizona State University Art<br />
Museum, Tempe<br />
The Gallery, David Zwirner,<br />
New York<br />
2007<br />
Running Around the Pool,<br />
Museum of Fine Arts, The College<br />
of Visual Arts, Theatre & Dance,<br />
Florida State University,<br />
Tallahassee<br />
Cult Fiction, The New Art Gallery,<br />
Walsall; Nottingham Castle,<br />
Nottingham; Leeds City Art<br />
Gallery, Leeds; Aberystwyth Art<br />
Gallery, Aberystwyth;<br />
Tullie House, Carlisle<br />
Hinter den Sieben Bergen,<br />
Patricia Low Contemporary,<br />
Gstaad<br />
Royal Art Lodge – Where is Here?,<br />
Winnipeg Art Lodge, Winnipeg<br />
2006<br />
Into Me/Out of Me, P.S.1<br />
Contemporary Art Center,<br />
New York; Kunst-Werke Berlin<br />
e.V. – Institute for Contemporary<br />
Art, Berlin; MACRO Museo d’Arte<br />
Contemporanea Roma, Rome<br />
Since 2000: Printmaking Now,<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
Parallel Visions II: “Outsider”<br />
and “Insider” Art Today,<br />
Gallerie St. Etienne, New York<br />
Faces of a Collection, Kunsthalle<br />
Mannheim, Mannheim<br />
New Prints 2006, International<br />
Print Center New York, New York<br />
The Compulsive Line: Etching<br />
1900 to Now, Museum of Modern<br />
Art, New York<br />
Down by Law, 2006 Whitney<br />
Biennial, Whitney Museum of<br />
American Art, New York<br />
2005<br />
Words, Andrea Rosen Gallery,<br />
New York<br />
Eccentric Modern,<br />
The Foundation To-Life, New York<br />
The Gallery,<br />
Magnus Karlsson, Stockholm<br />
Max Ernst and the Tradition of<br />
the Modern, Städtische Kunsthalle<br />
Mannheim, Mannheim<br />
New Work/New Acquisitions, The<br />
Museum of Modern Art, New York<br />
La Melange des Genres, Musée<br />
des Beaux-Arts de Rouen, Rouen<br />
Pensieri dei serpenti by The<br />
Royal Art Lodge, Perugi artecontemporanea,<br />
Padova<br />
Surface, Lucas Schoormanns<br />
Gallery, New York<br />
Funny Cuts, Staatsgalerie<br />
Stuttgart, Stuttgart<br />
Emergencias, Museo de Arte<br />
Contemporaneo, León<br />
Strips & Characters – Kunst<br />
unter dem Einfluss von Comics,<br />
Kunstverein, Wolfsburg<br />
Central Station – The Harald<br />
Falckenberg Collection,<br />
La Maison Rouge, Paris<br />
Security Check. Painting after<br />
Romanticism, Arndt & Partner,<br />
Zürich<br />
2004<br />
Pride in Workmanship,<br />
The Royal Art Lounge,<br />
Houldsworth Gallery, London<br />
Galerie Anne de Villepoix, Paris<br />
2003<br />
Royal Art Lodge: Ask the Dust<br />
The Drawing Center, New York;<br />
The Power Plant, Contemporary<br />
Art Gallery, Toronto; De Vleeshal,<br />
Middelburg<br />
For the Record: Drawing<br />
Contemporary Life,<br />
Vancouver Art Gallery, Vancouver<br />
The Great Drawing Show 1550 –<br />
2003, Michael Kohn Gallery,<br />
Los Angeles<br />
Odd Fellows, Pennsylvania<br />
Academy of Fine Arts,<br />
Philadelphia<br />
Sweet Tooth, Mixture<br />
Contemporary Art, Houston<br />
Zwischenbilanz,<br />
Kunstforum Baloise, Basel<br />
MosaiCanada: Sign and Sound,<br />
The Seoul Museum of Art, Seoul<br />
2002<br />
Fantasyland, Dámelio Terras<br />
New York, New York<br />
Fantasy Underfoot, Corcoran<br />
Biennal, Washigton D.C.<br />
2001<br />
I love NY, David Zwirner,<br />
New York<br />
The Royal Art Lodge, Perugi<br />
Artcontemporanea, Padova<br />
The Royal Art Lodge: Amounts<br />
of Blood, Atycore, Toronto<br />
IN FUMO, Galleria of Modern and<br />
Contemporary Art, Bergamo<br />
Amused: Humour in Contemporary<br />
Art, Carrie Secrist Gallery,<br />
Chicago<br />
2000<br />
Artcore Gallery, Toronto<br />
Dr. Wings, Galerie Air de Paris,<br />
Paris<br />
Babylon, Galerie Philomene<br />
Magers, Munich<br />
Selections from the Manilow<br />
Collection, MOCA, Chicago<br />
Double Whammy,<br />
Atelier Gallery, Vancouver<br />
Greetings from Winnipeg,<br />
MCAD, Minneapolis<br />
Drawing Show,<br />
Chicago Institute of Art, Chicago<br />
Drawings 2000,<br />
Barbara Gladstone, New York<br />
1999<br />
Draw, Ten in One Gallery, Chicago<br />
Castelli di Carte,<br />
Galeria Claudia Gian Ferrari, Milan<br />
Sit(E)ings: Trajectories for a<br />
Future, Winnipeg Art Gallery,<br />
Winnipeg<br />
Greetings from Winnipeg,<br />
Minneapolis College of Art &<br />
Design, Minneapolis<br />
1998<br />
Selections Spring 98,<br />
The Drawing Center, New York<br />
Laughing, Plug In Gallery,<br />
Winnipeg
256 — 257<br />
Biographies<br />
Maria Lassnig<br />
Born 1919 in Kappel am<br />
Krappfeld, Carinthia (AT),<br />
lives and works in Vienna (AT)<br />
and Carinthia (AT)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Städtische Galerie im Lenbachhaus<br />
und Kunstbau, Munich<br />
2009<br />
Maria Lassnig. In the Mirror<br />
of Possibilities. Watercolours and<br />
Drawings from 1947 to Today,<br />
Museum Ludwig, Cologne<br />
The Ninth Decade, Museum<br />
moderner Kunst Stiftung Ludwig,<br />
Vienna<br />
2008<br />
Contemporary Arts Center,<br />
Cincinnati<br />
Serpentine Gallery, London<br />
2007<br />
Hauser & Wirth, Zürich<br />
2006<br />
Maria Lassnig: Körper und<br />
Seele malen, Museum für<br />
Gegenwarts kunst Siegen, Siegen<br />
Maria Lassnig: Körperbilder,<br />
Museum Moderner Kunst<br />
Kärnten, Klagenfurt<br />
2005<br />
Maria Lassnig/Eiserner Vorhang,<br />
Museum in Progress, Vienna<br />
Maria Lassnig – body. fiction.<br />
nature, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Vienna<br />
Maria Lassnig. Animationsfilme –<br />
Retrospektive, culture2culture,<br />
Vienna<br />
2004<br />
Maria Lassnig – Paintings,<br />
Hauser & Wirth, London<br />
2003<br />
Verschiedene Arten zu sein,<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich<br />
2002<br />
Friedrich Petzel Gallery, New York<br />
Maria Lassnig. Körperporträts,<br />
Museum für Gegenwartskunst,<br />
Siegen<br />
Maria Lassnig. Eine andere<br />
Dimension. Skulpturen.<br />
Galerie Ulysses, Vienna<br />
2001<br />
Maria Lassnig. Bilder 1989 – 2001,<br />
kestnergesellschaft, Hannover<br />
1999<br />
FRAC des Pays de la Loire,<br />
Nantes<br />
1997<br />
Kunsthalle Bern, Bern<br />
Kunsthalle Mücsarnoc, Budapest<br />
1995/96<br />
Retrospektive der Zeichnungen<br />
und Aquarelle, Kunstmuseum<br />
Bern, Bern<br />
Musée national d’art moderne,<br />
Paris<br />
Kulturhaus der Stadt Graz, Graz<br />
1994<br />
Das Innere nach Außen,<br />
Stedelijk Museum, Amsterdam<br />
1992<br />
Galerie Klewan, Munich<br />
Galerie Ulysses, Vienna<br />
1991<br />
Galerie Busche, Cologne<br />
Raymond Bollag, Zürich<br />
1988–90<br />
Neue Galerie Graz, Graz<br />
Mit dem Kopf durch die Wand,<br />
Kunstmuseum Luzern, Luzern<br />
Kunstverein Hamburg, Hamburg<br />
Wiener Secession, Vienna<br />
Galerie Barbara Gross, Munich<br />
Graphische Sammlung Albertina,<br />
Vienna<br />
1987<br />
Galerie Thaddaeus Ropac,<br />
Salzburg<br />
Edition Hundertmark, Cologne<br />
Galerie Onnasch, Berlin<br />
1985<br />
Museum moderner Kunst<br />
Stiftung Ludwig Wien, Vienna<br />
Kunstmuseum Düsseldorf,<br />
Düsseldorf<br />
Kunsthalle Nürnberg, Nuremberg<br />
Kärntner Landesgalerie,<br />
Klagenfurt<br />
1982–84<br />
Retrospektive der Zeichnungen<br />
und Aquarelle, Kunstverein<br />
Mannheim, Mannheim<br />
(travelling exhibition)<br />
1981<br />
Galerie Heike Curtze, Vienna<br />
1978<br />
Haus am Lütowplatz, Berlin<br />
1977<br />
Retrospektive des grafischen<br />
Werks, Graphische Sammlung<br />
Albertina, Vienna<br />
Galerie Kalb, Vienna<br />
1975<br />
Gallery Cortella, New York<br />
1974<br />
Green Mountains Gallery,<br />
New York<br />
1962/63<br />
Kärntner Landesmuseum,<br />
Klagenfurt<br />
1960<br />
Galerie nächst St. Stephan,<br />
Vienna<br />
1956<br />
Galerie Würthle, Vienna<br />
1954<br />
Zimmergalerie, Frankfurt<br />
1952<br />
Art-Club-Galerie, Vienna<br />
1950<br />
Galerie Cosmos, Vienna<br />
1948<br />
Galerie Kleinmayr, Klagenfurt<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Nur Papier, und doch die ganze<br />
Welt ... 200 Years Graphic<br />
Collection, Staatsgalerie<br />
Stuttgart, Stuttgart<br />
The Dissolve. SITE Santa Fe<br />
Biennial 2010, Santa Fe<br />
Vermeer. Die Malkunst, Kunsthistorisches<br />
Museum, Vienna<br />
2009<br />
The Female Gaze: Women Look at<br />
Women, Cheim & Read, New York<br />
The Presence of the Line.<br />
A Selection of New Acquisitions<br />
from the 20th and 21st Centuries,<br />
Pinakothek der Moderne, Munich<br />
Best of Austria – Eine Kunstsammlung,<br />
Lentos Kunstmuseum,<br />
Linz<br />
2008<br />
Life on Mars: 55th Carnegie<br />
International, Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh<br />
Drawing a Tension, Fundação<br />
Calouste Gulbenkian, Lisbon<br />
Baselitz bis Lassnig, Sammlung<br />
Essl, Klosterneuburg/Vienna<br />
Mind Expanders. Performative<br />
Körper – Utopische Architekturen<br />
um ’68, MUMOK – Museum<br />
Moderner Kunst Stiftung Ludwig<br />
Wien, Vienna<br />
2007<br />
Wien – Paris, Belvedere, Vienna<br />
Critical Mass – Kritische Masse,<br />
Kunsthalle Bern, Bern<br />
WACK! Art and the Feminist<br />
Revolution, National Museum of<br />
Women in the Arts, Washington<br />
DC; MOCA – Museum of<br />
Contemporary Art, Los Angeles;<br />
P.S.1, Long Island City<br />
Kunst nach 1970. Aus der<br />
Sammlung der Albertina,<br />
Albertina, Vienna<br />
2006<br />
Eye on Europe, MoMA, New York<br />
Two or Three or Something.<br />
Maria Lassnig, Liz Larner,<br />
Kunsthaus Graz, Graz<br />
Österreich: 1900 – 2000,<br />
Konfrontationen und<br />
Kontinuitäten, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Vienna<br />
Into me/Out of me, P.S.1,<br />
Long Island City; MACRO – Museo<br />
d’Arte Contemporanea, Rome<br />
2005<br />
Ars Pingendi, Neue Galerie Graz,<br />
Graz<br />
Leporello, Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Zeitgenössische österreichische<br />
Kunst und Malerei der Nachkriegs<br />
zeit aus der Sammlung Essl,<br />
Museo de Arte Moderno<br />
de México, Mexico City<br />
(travelling exhibition)<br />
Das neue Österreich, Österreichische<br />
Galerie Belvedere, Vienna<br />
2003<br />
Grotesk! 130 Jahre Kunst der<br />
Frechheit, Haus der Kunst,<br />
Munich<br />
La Biennale di Venezia, Dreams<br />
and Conflicts – The Viewer’s<br />
Dictatorship, Venice<br />
Warum! Bilder Diesseits<br />
und Jenseits des Menschen,<br />
Gropius Bau, Berlin<br />
EXPRESSIV!, Fondation Beyeler,<br />
Basel<br />
2001<br />
Reisen ins Ich, Sammlung Essl,<br />
Klosterneuburg/Vienna<br />
Abbild, steirischer herbst,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>,<br />
Graz<br />
Austrian Contemporary Art,<br />
Shanghai Art Museum, Shanghai<br />
2000<br />
Die verletzte Diva, Kunstverein<br />
München, Munich;<br />
Kunsthalle Baden, Baden-Baden<br />
Das Bild des Körpers,<br />
Rupertinum, Salzburg<br />
1999<br />
Jahrhundert der Frauen,<br />
Kunstforum, Vienna<br />
1997<br />
documenta X, Kassel<br />
1996<br />
Malerei in Österreich 1945 – 1995.<br />
Die Sammlung Essl,<br />
Künstlerhaus Wien, Vienna<br />
Kunst aus Österreich 1896 – 1996,<br />
Kunsthalle Bonn, Bonn<br />
1995<br />
La Biennale di Venezia,<br />
Identità e Alternità, Venice<br />
Feminine-Masculine,<br />
Musée national d’art moderne,<br />
Centre George Pompidou, Paris<br />
1986<br />
Zeichen und Gesten. Informelle<br />
Tendenzen in Österreich,<br />
Wiener Secession, Vienna<br />
1982<br />
documenta 7, Kassel<br />
1980<br />
La Biennale di Venezia,<br />
Austrian pavilion, Venice
Mark Manders<br />
Born 1968 in Volkel (NL),<br />
lives and works in Arnhem (NL)<br />
and Ronse (BE)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2011<br />
Walker Art Center, Minneapolis<br />
Douglas Hyde Gallery, Dublin<br />
Aspen Art Museum, Aspen<br />
Castello di Rivoli, Torino<br />
2010<br />
Hammer Museum, Los Angeles<br />
Carillo Gil Museum of Art,<br />
Mexico City<br />
Jarla Partilager, Stockholm<br />
Zeno X Gallery, Antwerp<br />
2009<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
The Absence of Mark Manders,<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich;<br />
S.M.A.K., Ghent; Kunsthall<br />
Bergen, Bergen; Kunstverein<br />
Hannover, Hannover<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
2006<br />
Mark Manders: Short Sad<br />
Thoughts, BALTIC Centre for<br />
Contemporary Art, Gateshead<br />
2005<br />
Parallel Occurance, IMMA - Irish<br />
Museum of Modern Art, Dublin<br />
Mark Manders: Fragments<br />
from Self Portrait as a Building,<br />
Solo Projects, Los Angeles<br />
MATRIX 214: The Absence of<br />
Mark Manders, Berkeley Art<br />
Museum, Berkeley<br />
2004<br />
Silent Studio, Zeno X Storage,<br />
Antwerp – Borgerhout<br />
2003<br />
The Art Institute Chicago,<br />
Chicago<br />
The Renaissance Society, Chicago<br />
Pinakothek der Moderne, Munich<br />
Kaleidoscope Night,<br />
Kröller-Müller Museum, Otterlo<br />
Yellow Bathtub, Cobra Museum<br />
voor Moderne Kunst, Amstelveen<br />
Fragments from Self Portrait<br />
as a Building, Moore College<br />
of Art and Design, Philadelphia;<br />
Art Gallery of York University,<br />
Toronto<br />
Night Drawings from Self<br />
Portrait as a Building, Kabinet<br />
OverHolland/Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Reduced November Room,<br />
Greene Naftali Gallery, New York<br />
Room with Several Night<br />
Drawings and One Reduced<br />
Night Scene, The Drawing Center,<br />
New York<br />
1999<br />
Galerie Friedrich, Bern<br />
1998<br />
Self Portrait in a surrounding<br />
area, Biennale Sao Paolo,<br />
Sao Paolo<br />
14 Fragments from Self Portrait<br />
as a Building, Staatliche<br />
Kunsthalle, Baden-Baden<br />
1997<br />
The Douglas Hyde Gallery, Dublin<br />
Zeno X Gallery, Antwerp<br />
De Appel, Amsterdam<br />
1995<br />
Galerie Erika + Otto Friedrich,<br />
Bern<br />
1994<br />
Mark Manders shows some<br />
fragments of his Self Portrait,<br />
MUHKA, Antwerp<br />
Van Abbemuseum, Eindhoven<br />
Zeno X Gallery, Antwerp<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2011<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections, DESTE<br />
Foundation, Athens; Magasin 3<br />
Stockholm Konsthall, Stockholm<br />
2010<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections,<br />
La maison rouge, Paris; Ellipse<br />
Foundation, Cascais<br />
Animism, Kunsthalle Bern, Bern<br />
Skin Fruit: Selection from<br />
the Dakis Joannou Collection,<br />
New Museum, New York<br />
Contemplating the Void:<br />
Interventions in the Guggenheim<br />
Museum, Guggenheim Museum,<br />
New York<br />
What happens next is a secret,<br />
The Irish Museum of Modern Art,<br />
Dublin<br />
2009<br />
Investigations of a Dog. Works<br />
from the FACE Collections,<br />
Fondazione Sandretto<br />
Re Rebaudengo, Torino<br />
Works by Charles Long, Mark<br />
Manders, Thomas Schütte and<br />
Ian Kiaer with paintings by Luc<br />
Tuymans, Jarla Partilager, Berlin<br />
A Story of the Image: Old and<br />
New Masters from Antwerp,<br />
National Museum of Singapore,<br />
Singapore; Shanghai Art Museum,<br />
Shanghai<br />
Walking in my Mind, The Hayward,<br />
Soutbank Centre, London<br />
Le sang d’un poète, Biennale<br />
Estuaire Nantes – Saint Nazaire,<br />
Nantes<br />
The Eventual, Futura Center for<br />
Contemporary Art, Prague<br />
The Quick and the Dead, Walker<br />
Art Center, Minneapolis<br />
Ophelia. Sehnsucht, melancholie<br />
en doodsverlangen, Museum<br />
voor Moderne Kunst, Arnhem<br />
2008<br />
The Order of Things, MuHKA,<br />
Antwerp<br />
Transformation AGO, The Art<br />
Gallery of Ontario, Ontario<br />
Foyer: language and space at<br />
the border, CAC, Contemporary<br />
Art Center, Vilnius<br />
Life on Mars, the 55th Carnegie<br />
International, Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh<br />
2007<br />
Destroy Athens, 1st Athens<br />
Biennial, Athens<br />
(I’m Always Touched) By Your<br />
Presence, Dear - New Acquisitions,<br />
IMMA The Irish Museum of<br />
Modern Art, Dublin<br />
Comfort/Discomfort, Stedelijk<br />
Museum, ’s-Hertogenbosch<br />
Works on paper, Zeno X Gallery &<br />
Zeno X Storage, Antwerp<br />
2006<br />
The Secret Theory of Drawing:<br />
Dislocation & Indirection<br />
in Contemporary Drawing,<br />
The Drawing Room, London<br />
Ergens/Somewhere, MuHKA,<br />
Antwerp<br />
Roma Publications, Culturgest,<br />
Lisbon<br />
Transforming Chronologies:<br />
An Atlas of Drawings, Part Two,<br />
MoMA, New York<br />
Of Mice and Men, Berlin Biennale,<br />
Berlin<br />
2005<br />
Recent Acquisitions, LA MOCA,<br />
Los Angeles<br />
2004<br />
Manifesta 5, European<br />
Biennale of Contemporary Art,<br />
San Sebastian<br />
Drafting Deceit, Apexart,<br />
New York<br />
Sculptural Sphere, Goetz<br />
Collection, Munich<br />
2003<br />
Gelijk het leven is, S.M.A.K.,<br />
Ghent<br />
Taktiken des EGO, Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum,<br />
Duisburg<br />
Post-Nature. Nove Artistas<br />
Holandeses, Instituto Tomie<br />
Ohtake, Sao Paulo<br />
2002<br />
On Paper 1, Galerie Friedrich,<br />
Basel<br />
Contemporary Drawing: Eight<br />
Propositions, Museum of Modern<br />
Art, New York<br />
EU2, Stephen Friedman Gallery,<br />
London<br />
documenta 11, Kassel<br />
2001<br />
Plateau of <strong>Human</strong>kind, Italian<br />
pavilion, La Biennale di Venezia,<br />
Venice<br />
Free Sport, Greene Naftali,<br />
New York<br />
Squatters, Casa de Serralves,<br />
Porto<br />
Post-Nature: Nine Dutch Artists,<br />
Palazzo Ca’Zenobio, La Biennale<br />
di Venezia, Venice<br />
2000<br />
Face to Face, Kabinet Overholland<br />
in het Stedelijk Museum,<br />
Amsterdam<br />
Territory, Tokyo Opera City Art<br />
Gallery, Tokyo<br />
Drawings 2000, Barbara<br />
Gladstone Gallery, New York<br />
1999<br />
Transmitter, Bonner Kunstverein,<br />
Bonn<br />
De Opening, S.M.A.K., Ghent<br />
Collection, Van Abbemuseum,<br />
Eindhoven<br />
1998<br />
Shopping the Stars, Zeno X Gallery,<br />
Antwerp<br />
Entr’Acte, Stedelijk Van Abbemuseum,<br />
Eindhoven<br />
Vertical Time, Barbara Gladstone<br />
Gallery, New York<br />
1997<br />
Personal Absurdities,<br />
Galerie Gebauer, Berlin<br />
Premio Fondazione Sandretto<br />
Re Rebaudengo per l’Arte, Torino<br />
Belladonna, Firstsite at the<br />
Minories, ICA, London<br />
1996<br />
Making a Place, Snug Harbor<br />
Cultural Center, New York<br />
Accrochage, Zeno X Gallery,<br />
Antwerp<br />
1995<br />
Orientasi/Oriëntatie, National<br />
Museum of Modern Art, Jakarta<br />
Country Cöde,<br />
Bravin Post Lee, New York<br />
1994<br />
This is the show and the show<br />
is many things, Museum van<br />
Hedendaagse Kunst, Ghent<br />
Du Concept à l’Image.<br />
Art Pays-Bas XXe siècle,<br />
Musée d’Art Moderne de la ville<br />
de Paris, Paris<br />
1993<br />
La Biennale di Venezia, Scuola<br />
de San Pasquale, Venice<br />
1992<br />
Prix Nl 1992. 7 kunstenaars,<br />
Galerie Nouvelles Images,<br />
Den Haag<br />
Prix de Rome, Museum Fodor,<br />
Amsterdam; Rijksakademie,<br />
Amsterdam; Beeldhouwkunst,<br />
Oude Kerk, Amsterdam
258 — 259<br />
Biographies<br />
Renzo Martens<br />
Born 1973 in Sluiskil (NL),<br />
lives and works in Amsterdam<br />
(NL), Brussels (BE) and<br />
Kinshasa (CD)<br />
Solo Exhibitions<br />
2009<br />
Episode 3, Wilkinson Gallery,<br />
London<br />
2008<br />
Episode 3, Stedelijk Museum<br />
Bureau, Amsterdam<br />
2005<br />
Episode 1, Vtape, Toronto<br />
2004<br />
Episode 1, Marres Centre<br />
for Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
2003<br />
Episode 1, Galerie Fons Welters,<br />
Amsterdam<br />
1999<br />
Rien ne va plus, De Merodestraat,<br />
Brussels<br />
Group Exhibitions<br />
2010<br />
Monumentalism, Stedelijk<br />
Museum, Amsterdam<br />
Berlin Biennale, Berlin<br />
MyWar. Identity and Appropriation<br />
Under War <strong>Condition</strong>, FACT,<br />
Liverpool<br />
Self as disappearance, Centre<br />
d’art contemporain La synagogue<br />
de Delme, Delme<br />
Morality Act III. And the moral<br />
of the story is …, Witte de With,<br />
Rotterdam<br />
2009<br />
Recente Aanwinsten, De Hallen,<br />
Haarlem<br />
Rien ne va plus, Van Abbe<br />
Museum, Eindhoven<br />
Le Temps de la Fin, Espace<br />
d’art contemporain La Tolerie,<br />
Clermont-Ferrand<br />
Exploring the Age of Repression,<br />
Pavilion, Bucharest<br />
Endurance. Daring Feats of<br />
Risk, Survival and Perseverance,<br />
Abington Art Center, Philadelphia<br />
Images Recalled, Fotofestival,<br />
Ludwigshafen<br />
Until the End of the World,<br />
AMP Gallery, Athens<br />
Monumentalismus. One’s History<br />
is Another’s Misery, Autocenter,<br />
Berlin<br />
Muhka Media, Muhka, Antwerp<br />
Hors Pistes (filmscreening<br />
Episode 3), Centre Pompidou,<br />
Paris<br />
Kunstenfestivaldesarts, Brussels<br />
2008<br />
Matter of Fact; Aftermath<br />
(Capacete/A Gentil Carioca/<br />
Galeria Vermelho), Sao Paulo<br />
Brussels Biennial, Brussels<br />
Manifesta 7. Matter of Fact<br />
(The European Biennial of<br />
Contemporary Art), Rovereto<br />
L’Art en Europe. Experience<br />
Pommery #5, Domaine Pommery,<br />
Reims<br />
Neither Either Nor Or,<br />
Württembergischer Kunstverein,<br />
Stuttgart<br />
To Burn Oneself with Oneself:<br />
the Romantic Damage Show,<br />
De Appel, Amsterdam<br />
2007<br />
Modern Solitude, Galerie Fons<br />
Welters, Amsterdam<br />
Brave New World, Cobra Museum,<br />
Amstelveen<br />
Nothing Else Matters,<br />
Museum de Hallen, Haarlem<br />
Speakers, Aeroplastics Gallery,<br />
Brussels<br />
Magazine Project, documenta 12,<br />
Kassel<br />
2006<br />
A Picture of War is not War,<br />
Wilkinson Gallery, London<br />
Excess, Z’33, Hasselt<br />
An Evening with …,<br />
Platform Garanti, Istanbul<br />
Frieze Art Fair, Wilkinson Gallery,<br />
London<br />
2005<br />
I Love Video Art, Musée d’Art<br />
Contemporain, Strasbourg<br />
Undercurrents, Basis Actuele<br />
Kunst (BAK), Utrecht<br />
Reprise, Marres Centre for<br />
Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
Inner and Outer Worlds,<br />
Argos festival, Argos<br />
Soft Target,<br />
Basis Actuele Kunst, Utrecht<br />
2004<br />
Constructing Visions,<br />
TENT, Rotterdam<br />
Mediamatic Supersalon,<br />
Mediamatic, Amsterdam<br />
Plug-In, Futura, Prague<br />
Yugoslav Biennial, Vrsac<br />
Monitoring,<br />
Kunstverein Kassel, Kassel<br />
IDFA, Amsterdam<br />
2003<br />
Urban Dramas,<br />
De Singel, Antwerp<br />
Etablissements d’en face<br />
projects, Brussels<br />
Blick zum Nachbarn.<br />
Kunstfilmbiennale, Cologne<br />
Art Cologne<br />
Galerie Fons Welters,<br />
Amsterdam<br />
2002<br />
De Avonden, De Appel,<br />
Amsterdam
Kris Martin<br />
Born 1972 in Kortrijk (BE),<br />
lives in Ghent (BE)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
White Cube, London<br />
Almine Rech, Brussels<br />
2009<br />
Aspen Art Museum, Aspen<br />
Sies + Höke, Düsseldorf<br />
Johann König, Berlin<br />
2008<br />
Wattis Institute for Contemporary<br />
Arts, San Francisco<br />
Museum Dhondt-Dhaenens,<br />
Deurle<br />
Eldorado. Kris Martin. Inter pares,<br />
Galleria d’Arte Moderna e<br />
Contemporanea GAMeC, Bergamo<br />
Marc Foxx, Los Angeles<br />
White Cube, London<br />
2007<br />
P.S.1 MoMA, Contemporary Art<br />
Center, New York<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
My Private #5, Piazza San Marco,<br />
Venice<br />
Marc Foxx, Los Angeles<br />
2006<br />
Deus ex machina, Johann König,<br />
Berlin<br />
2005<br />
Neuer Aachener Kunstverein,<br />
Aachen<br />
Sies + Höke Galerie, Düsseldorf<br />
2004<br />
Beaulieu Gallery,<br />
Wortegem-Petegem<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Contemplating the Void,<br />
Guggenheim Museum, New York<br />
Triennale Kleinplastik, Fellbach<br />
Berlin – Paris, Johann König,<br />
Berlin; Galerie Philippe Jousse,<br />
Paris<br />
2009<br />
Beg Borrow and Steal,<br />
Rubell Family Collection, Miami<br />
A l’épreuve, Institute d’Art<br />
Contemporain, Villeurbanne<br />
Earth: Art of a changing world,<br />
GSK Contemporary, 2009,<br />
Royal Academy of Arts, London<br />
Silent, Hiroshima City Museum<br />
of Contemporary Art, Hiroshima<br />
Morality, Witte de With, Center<br />
for Contemporary Art, Rotterdam<br />
Das Gespinst. Die Sammlung<br />
Schürmann zu Gast im Museum<br />
Abteiberg, Mönchengladbach<br />
The Importance of the Zebra Fish,<br />
Pilar Parra & Romero, Madrid<br />
Moby Dick, Wattis Institute for<br />
Contemporary Arts, San Francisco<br />
cargo manifest,<br />
Bayrische Staatsoper, Munich<br />
The Site of Silence – Der Ort<br />
der Stille, Ausstellungshalle<br />
zeitgenössische Kunst, Münster<br />
Heaven, 2nd Athens Biennale,<br />
Athens<br />
Beginnings, Middles, And Ends,<br />
Galerie Georg Kargl, Vienna<br />
Magritte et la Lumière,<br />
Almine Rech Galerie, Brussels<br />
The Quick and the Dead,<br />
Walker Art Center, Minneapolis<br />
On second readings, Galeria<br />
Estrany-de la Mota, Barcelona<br />
Born in the morning, dead<br />
by night, Leo König, New York<br />
2008<br />
Heavy Metal, Kunsthalle zu Kiel,<br />
Kiel<br />
Political/Minimal, KW – Institute<br />
for Contemporary Art, Berlin<br />
Ars in Cathedrali, Cathédrale<br />
Saints-Michel-et-Gudule,<br />
Brussels<br />
Library, UOVO Open Office, Berlin<br />
The Krautcho Club/In and Out<br />
of Place, Forgotten Bar Project,<br />
Berlin and Project Space 176,<br />
London<br />
This is not a void,<br />
Galerie Luisa Strina, São Paulo<br />
When a clock is seen from the<br />
side it no longer tells the time,<br />
Johann König, Berlin<br />
FADE IN/FADE OUT,<br />
Bloomberg Space, London<br />
L’Argent, FRAC Ile-de-France,<br />
Paris<br />
Speicher fast voll – Sammeln und<br />
Ordnen in der Gegenwartskunst,<br />
Kunstmuseum, Solothurn<br />
The Eternal Flame,<br />
Kunsthaus Baselland, Basel<br />
Boros Collection, Berlin<br />
Past – Forward, Zabludowicz<br />
Collection 176, London<br />
Traces du sacré,<br />
Centre Georges Pompidou, Paris<br />
You Dig the Tunnel – I’ll Hide<br />
the Soil, White Cube, London<br />
God is design …, Galeria Fortes<br />
Vilaça, São Paulo<br />
Section des Miroirs, School of the<br />
Art Institute of Chicago, Chicago<br />
Der eigene Weg/Perspektiven<br />
belgischer Kunst, Museum<br />
Küppersmühle für Moderne<br />
Kunst, Duisburg<br />
Countdown, Center for Curatorial<br />
Studies, New York<br />
All-Inclusive. Die Welt des<br />
Tourismus, Schirn Kunsthalle,<br />
Frankfurt<br />
2007<br />
Gehen Bleiben,<br />
Kunstmuseum Bonn, Bonn<br />
Passengers, Wattis Institute<br />
for Contemporary Arts,<br />
San Francisco<br />
The Office, Tanya Bonakdar<br />
Gallery, New York<br />
The Long Goodbye,<br />
Vanmoerkerke collection,<br />
Oostende<br />
The skeleton in art,<br />
Cheim & Read, New York<br />
For Sale, Cristina Guerra<br />
Contemporary Art, Lisbon<br />
Learn to Read,<br />
Tate Modern, London<br />
Invisible,<br />
Max Wigram Gallery, London<br />
Absent Without Leave,<br />
Victoria Miro Gallery, London<br />
Some Time Waiting,<br />
Kadist Art Foundation, Paris<br />
Ci vediamo a casa,<br />
Perarolo di Cadore, Belluno<br />
Trobleyn/Laboratorium,<br />
Jan Fabre, Antwerp<br />
2006<br />
My private escaped from Italy,<br />
International Center of Art<br />
and Landscape on the island of<br />
Vassivière, Beaumont du Lac<br />
Protections. This is not an<br />
Exhibition, Kunsthaus Graz, Graz<br />
Faster! Bigger! Better!<br />
Signetwerke der Sammlungen,<br />
ZKM, Museum für neue Kunst,<br />
Karlsruhe<br />
Nichts weiter als ein Rendezvous,<br />
Künstlerhaus Bremen, Bremen<br />
Designing Truth, Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum,<br />
Duisburg<br />
Of Mice and Men, 4th Berlin<br />
Biennale for Contemporary Art,<br />
Berlin<br />
Message personnel,<br />
Yvon Lambert, Paris<br />
2005<br />
SEE history 2005 – Der private<br />
Blick, Kunsthalle zu Kiel, Kiel<br />
Post Notes, Midway<br />
Contemporary Art, Minnesota<br />
2003<br />
Gelijk het leven is, SMAK<br />
Stedelijk Museum voor Actuele<br />
Kunst, Ghent<br />
The distance between Me and<br />
You, Lisson Gallery, London<br />
2001<br />
Verklärte Nacht, Sonsbeek 9,<br />
Arnhem<br />
2000<br />
Wahnsinn, Garden of Museum<br />
Dhondt-Dhaenens, Deurle
260 — 261<br />
Biographies<br />
Adrian Paci<br />
Born 1969 in Shkoder (AL),<br />
lives and works in Milan (IT)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
Motion Picture(s),<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich<br />
francesca kaufmann, Milan<br />
Gestures,<br />
Peter Blum Gallery, New York<br />
I mutanti, Villa Medici, Rome<br />
2009<br />
Centro di Permanenza<br />
temporanea, Outlet Project<br />
Room, Istanbul<br />
2008<br />
Subjects in Transit, CCA, Tel Aviv<br />
Kunstverein Stuk, Leuven<br />
Kunstverein Hannover, Hannover<br />
Bonniers Konsthall, Stockholm<br />
2007<br />
Pino Pascali Prize XI Edition,<br />
Museo Pino Pascali, Polignano<br />
a Mare<br />
Smith - Stewart Gallery, New York<br />
Museum am Ostwall, Dortmund<br />
Per Speculum, Milton Keynes<br />
Gallery, Milton Keynes<br />
2006<br />
Per Speculum,<br />
francesca kaufmann, Milan<br />
Galleria Civica di Modena,<br />
Modena<br />
BAK, Utrecht<br />
Modern Times, MAN, Nuoro<br />
2005<br />
P.S.1, MoMA, New York<br />
Yale University, New Haven<br />
Perspectives 147: Adrian Paci,<br />
Contemporary Arts Museum,<br />
Houston<br />
MC projects, Los Angeles<br />
Galerie Peter Kilchmann, Zürich<br />
First at Moderna,<br />
Moderna Museet, Stockholm<br />
Exit Gallery, Pec, Kosovo<br />
2004<br />
Slowly, francesca kaufmann,<br />
Milan<br />
Turn on, ViaFarini, Milan<br />
2003<br />
A Toll on Rituals,<br />
BAC Baltic Art Center, Visby<br />
Galerie Peter Kilchmann, Zürich<br />
2002<br />
Sorella Morte,<br />
francesca kaufmann, Milan<br />
Galleria Irida, Sofia<br />
Galleria d’Arte Moderna e<br />
Contemporanea, Bergamo<br />
Claudio Poleschi, Lucca<br />
2001<br />
BildMuseet, Umeå<br />
Fondazione Lanfranco Baldi,<br />
Florence<br />
Home Sweet Home, Artropia,<br />
Milan<br />
1996<br />
National Gallery of Art, Tirana<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2010<br />
International Biennale of<br />
Contemporary Art, Poznan<br />
Languages and Experimentations,<br />
MART, Rovereto<br />
Les Mutants, Villa Medici, Rome<br />
Artes Mundi, National Museum<br />
Cardiff, Cardiff<br />
The Library of Babel/In and<br />
Out of Place, 176 Zabludowicz<br />
Collection, London<br />
ATOPIA – Art and the City in the<br />
21st Century, Centro de Cultura<br />
Contemporania de Barcelona,<br />
Barcelona<br />
… on the eastern front,<br />
The Ludwig Museum, Budapest<br />
Suspended Spaces No 1 –<br />
from Famagusta, La Maison de<br />
la Culture d’Amiens, Amiens<br />
2009<br />
Los de arriba y los de abajo,<br />
Sala de Arte Publico Siqueiros,<br />
Mexico City<br />
The Symbolic Efficiency of<br />
the Frame, 4th T.I.C.A.B, Tirana<br />
International Contemporary<br />
Art Biennial, Tirana<br />
The World is Yours, Louisana<br />
Museum of Modern Art,<br />
Humlebaek<br />
The Spectacle of the Everyday,<br />
10th Biennale de Lyon, Lyon<br />
Heaven, 2nd Athens Biennale,<br />
Athens<br />
Windows upon Oceans – 8th<br />
Baltic Biennial of Contemporary<br />
Art, National Museum, Szczecin<br />
Havana Biennial, Havana<br />
Panoramica, Museo Tamayo,<br />
Mexico<br />
2008<br />
Ich will/I will, Kunsthalle<br />
Exnergasse, Vienna<br />
Memories for Tomorrow: Works<br />
from The UBS Art Collection,<br />
Shanghai Art Museum, Shanghai<br />
Shifting Identities, Kunsthaus<br />
Zürich, Zürich; CAC, Vilnius<br />
Lost Paradise, Zentrum Paul Klee,<br />
Bern<br />
Peripheral look and collective<br />
body, Museion, Bolzano<br />
Street & Studio, Tate Modern,<br />
London; Museum Folkwang,<br />
Essen<br />
2007<br />
Land of <strong>Human</strong> Rights,<br />
Rotor, Graz<br />
Transculture,<br />
Bunkier Sztuki, Krakow<br />
Borderland, Brussels Biennale I,<br />
BOZAR - Palais des Beaux-Arts,<br />
Brussels<br />
Senso Unico, P.S.1, MoMA,<br />
New York<br />
2006<br />
Fremd bin ich eingezogen,<br />
Kunsthalle Fridericianum, Kassel<br />
Exposed Memory, Hungarian<br />
University of Fine Arts, Budapest<br />
Wherever we go,<br />
Spazio Oberdan, Milan<br />
Busan Biennale 2006, Busan<br />
Equal and less equal,<br />
Museum of the Seam, Jerusalem<br />
The Grand Promenade, National<br />
Museum of Contempary Art,<br />
Athens<br />
Of the one and the many,<br />
Platform Garanti Contemporary<br />
Art Center, Istanbul<br />
Zone of Contact, 15th Biennale<br />
of Sydney, Sydney<br />
60 Seconds Well Spent,<br />
Frankfurter Kunstverein, Frankfurt<br />
Biennale Cuvée, O.K. Centrum<br />
für Gegenwartskunst, Linz<br />
Shoot the Family, Cranbrook<br />
Art Museum, Bloomfield Hills;<br />
Knoxville Museum of Art,<br />
Knoxville; Western Gallery,<br />
Bellingham; David and Sandra<br />
Bakalar Gallery, Boston;<br />
Contemporary Art Museum<br />
St. Louis, St. Louis; Columbus<br />
College of Art and Design,<br />
Columbus<br />
2005<br />
La Biennale di Venezia, Venice<br />
Berlin Photography Festival,<br />
Martin-Gropius-Bau, Berlin<br />
More Than This! Negotiating<br />
Realities, Göteborg International<br />
Biennial for Contemporary Art,<br />
Gothenburg<br />
KunstFilmBiennale, Museum<br />
Ludwig, Cologne<br />
Projekt Migration, Kölnischer<br />
Kunstverein, Cologne<br />
Arbeit – work/labour, Galerie<br />
im Taxipalais, Innsbruck<br />
2004<br />
Biennale di Sevilla, Sevilla<br />
New Video/New Europe, Museum<br />
of Contemporary Art, St. Louis<br />
Exiting Europe, Galerie für<br />
Zeitgenössische Kunst, Leipzig<br />
Se Bashku, Museum of<br />
Contemporary Art, Uppsala<br />
I Nuovi Mostri, Fondazione<br />
Trussardi, Milan<br />
New Video, New Europe, The<br />
Renaissance Society, Chicago<br />
2003<br />
Looking Awry, Apex Art, New York<br />
Skin Deep, MART, Museo di arte<br />
moderna e contemporanea,<br />
Rovereto<br />
Gestures, Printemps de<br />
Septembre, Festival of Contemporary<br />
Images, Toulouse<br />
BALKAN – In den Schluchten,<br />
Kunsthalle Fridericianum, Kassel<br />
Blut & Honig, Zukunft ist am<br />
Balkan, Essl Museum,<br />
Klosterneuburg/Vienna<br />
Multitudes – Solitudes,<br />
Museion, Bolzano<br />
Isola (Art) Project Milano,<br />
MAMCO musée d’art moderne<br />
et contemporain, Geneva<br />
Bitter/Sweet Harmony –<br />
Contemporary Albanian Art,<br />
Digital ArtLab, Holon<br />
Durchzug/Draft,<br />
Kunsthalle Zürich, Zürich<br />
2002<br />
In Search of Balkania,<br />
Neue Galerie Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>,<br />
Graz<br />
EXIT, Fondazione Sandretto<br />
Re Rebaudengo, Torino<br />
It’s ain’t much but it’s home,<br />
Binz 39 (with Emmanuel Licha),<br />
Zürich<br />
Rain, Fotofest, Houston<br />
Home, Collegium Artisticum,<br />
Sarajevo<br />
2001<br />
Short Stories,<br />
Fabbrica del Vapore, Milan<br />
I Biennale di Valencia, Valencia<br />
Biennale di Tirana, Tirana<br />
Generator,<br />
Claudio Poleschi, Lucca<br />
Le Mois de la Photo à Montréal,<br />
Montreal<br />
Beautiful Strangers,<br />
ifa-Galerie, Berlin<br />
Ostensiv,<br />
Kunstraum Leipzig, Leipzig<br />
Arteast Collection 2000+,<br />
Orangerie Congress, Innsbruck<br />
2000<br />
Oberhausen Short Film Festival,<br />
Oberhausen<br />
BAN Exhibition, International<br />
House, Brussels<br />
Manifesta 3, Ljubljana<br />
Arteast Collection 2000,<br />
Museum of Modern Art, Ljubljana<br />
Kasseler Dokumentarfilm-<br />
und Videofest, Kassel<br />
In & Out, National Gallery of Art,<br />
Tirana<br />
1999<br />
La Biennale di Venezia, Venice<br />
Lost & Found, Center for<br />
Electronic Media de Waag,<br />
Amsterdam<br />
1998<br />
Permanent Instability,<br />
National Gallery of Art, Tirana
Susan Philipsz<br />
Born 1965 in Glasgow (GB),<br />
lives and works in Berlin (DE)<br />
Solo Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2011<br />
Ludwig Forum für internationale<br />
Kunst, Aachen<br />
2010<br />
When Day Closes, IHME Project<br />
2010, Pro Arte Foundation,<br />
Helsinki<br />
Lowlands, Glasgow International,<br />
Glasgow<br />
I See a Darkness,<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
Kunst Halle Sankt Gallen,<br />
St. Gallen<br />
Mizuma and One Gallery, Beijing<br />
Peabody Essex Museum, Salem<br />
We Shall Be All, Museum of<br />
Contemporary Art, Chicago<br />
2009/10<br />
Ellen De Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
The Shortest Shadow,<br />
Wexner Centre for the Arts,<br />
Ohio State University, Columbus<br />
2009<br />
Appear to Me,<br />
Silo Monastery, Burgos<br />
Lowlands,<br />
Museum Ludwig, Cologne<br />
Long Gone, CoCA, Torun<br />
Carried by the Winds,<br />
Radcliffe Observatory,<br />
Modern Art Oxford, Oxford<br />
From a Distance,<br />
Imperial War Museum, Duxford<br />
2008/09<br />
I See a Darkness,<br />
Jarla Partilager, Stockholm<br />
2008<br />
Here Comes Everybody,<br />
Tanya Bonakdar Gallery, New York<br />
Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin<br />
Alpine Architecture<br />
(with Monica Sosnowska),<br />
Alte Fabrik, Rapperswil<br />
More Than This,<br />
Juan Miro Foundation Gardens,<br />
Palma de Mallorca<br />
Yale Art Gallery Commission,<br />
New Haven<br />
Imperial War Museum<br />
Commission, Duxford<br />
Out of Bounds: Susan Philipsz,<br />
ICA – Institute of Contemporary<br />
Art, London<br />
2007<br />
Did I Dream You Dreamed About<br />
Me, Mitzuma Gallery, Tokyo<br />
CGAC, Santiago de Compostela<br />
Art Statements Basel, Basel<br />
2006<br />
Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin<br />
ARCO Art Fair, Madrid<br />
Reception 3 (with Robert Barry),<br />
Büro Friedrich, Berlin<br />
Stay With Me, Malmö Konsthall,<br />
Malmö<br />
Appendiks, Copenhagen<br />
2004<br />
Kunstverein Arnsberg E.V.,<br />
Arnsberg<br />
Ellen de Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
Let Us Take You There (with Paul<br />
Rooney), Site Gallery, Sheffield<br />
2003<br />
38 Langham Street, London<br />
2002<br />
Ellen de Bruijne Projects,<br />
Amsterdam<br />
Pledge, Temple Bar Gallery,<br />
Dublin<br />
2001<br />
Tomorrow Belongs To Me,<br />
Stadtlabor, Lüneburg<br />
2000<br />
I Remember You,<br />
The Old Museum Arts Centre,<br />
Belfast<br />
Some Place Else (with Mary<br />
McIntyre), Consortium Gallery,<br />
Amsterdam<br />
1999<br />
Red Standard (with Eoghan<br />
McTigue), The New Works Gallery,<br />
Chicago<br />
1998<br />
Strip Tease, The Annual<br />
Programme, Manchester<br />
Group Exhibitions<br />
(Selection)<br />
2011<br />
Freeze, Wexner Center for the<br />
Arts, The Ohio State University,<br />
Columbus<br />
Estuaire, Nantes, Saint Nazaire<br />
2010<br />
Haunted, Solomon R.<br />
Guggenheim Museum, New York<br />
Contemplating the Void:<br />
Interventions in the Guggenheim<br />
Museum, Solomon R.<br />
Guggenheim Museum, New York<br />
29th Bienal de São Paulo,<br />
São Paulo<br />
RES PUBLICA, Calouste<br />
Gulbenkian Foundation, Lisbon<br />
ESPECTRAL (Spectral),<br />
CGAC Centro Galego de Arte<br />
Contemporánea, Santiago de<br />
Compostela<br />
Brondo Sculpture Park, Warsaw<br />
2009/10<br />
Mirrors, MARCO Museo de Arte<br />
Contemporanea, Vigo<br />
2009<br />
The Quick and the Dead,<br />
Walker Arts Center, Minneapolis<br />
Le sang d’un poète, Estuaire<br />
Nantes Saint-Nazaire Biennale,<br />
Nantes<br />
The Past in the Present,<br />
LABoral Centro de Arte, Gijón<br />
The Collection, Siobhan Davies<br />
Dance & Victoria Miro Gallery,<br />
London<br />
PLOT/09: This World & Nearer<br />
Ones, Public Project for Governor’s<br />
Island produced in conjunction<br />
with Creative Time, New York<br />
Quizas me puedas contar orta<br />
historia …, Museo de Cáceres,<br />
Cáceres<br />
1989. Ende der Geschichte<br />
oder Beginn der Zukunft,<br />
Kunsthalle Wien, Vienna<br />
2008<br />
Life on Mars: 55th Carnegie<br />
International, Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh<br />
Sound of Music, Marres Centre<br />
for Contemporary Culture,<br />
Maastricht<br />
God and Goods, Villa Manin<br />
Centre for Contemporary Art,<br />
Passariano, Codroipo<br />
Tales of Time and Space,<br />
Folkstone Triennial, Folkstone<br />
Revolutions: Forms That Turn,<br />
Sydney Biennale, Sydney<br />
Unknown Pleasures,<br />
Aspen Art Museum, Aspen<br />
U Turn, Copenhagen Triennale,<br />
Copenhagen<br />
2007<br />
Skulptur Projekte Münster 07,<br />
Münster<br />
for REE, Marc Foxx, Los Angeles<br />
Madrid Abierto, Madrid<br />
Unmonumental, New Museum<br />
for Contemporary Art, New York<br />
Busan Biennale, Busan<br />
2006<br />
Radio Waves Goodbye, Live<br />
Radio Project, Hidden Rythms,<br />
Nijmegen<br />
Ars 06, Museum of Contemporary<br />
Art KIASMA, Helsinki<br />
2005<br />
Guangzhou Triennale, Guangzhou<br />
Torino Triennale, church of<br />
Santa Crux, Rivoli<br />
Argos Festival, Brussels<br />
Leaps of Faith, Nicosia<br />
Our Surroundings, Dundee<br />
Contemporary Arts, Dundee<br />
2004<br />
The Stars Are So Big, The Earth<br />
is So Small ... Stay As You Are,<br />
c/o Esther Schipper, Berlin<br />
I Feel Mysterious Today, Palm<br />
Beach Institute of Contemporary<br />
Art, Palm Beach<br />
Pass The Time of Day,<br />
Maryron Park, London<br />
Art Forum Berlin,<br />
Ellen De Bruijne Projects, Berlin<br />
Platform Garanti Contemporary<br />
Art Center, Istanbul<br />
Depicting Love,<br />
Künstlerhaus Bethanien, Berlin<br />
Space to Face, Westfälischer<br />
Kunstverein, Münster<br />
Berlin North,<br />
Hamburger Bahnhof, Berlin<br />
Beck’s Futures 2004,<br />
ICA Galleries, London<br />
2003<br />
Susan Philipsz, Paul Pfeiffer,<br />
Brian Fridge, Art Pace<br />
Foundation, San Antonio<br />
The Echo Show, Tramway,<br />
Glasgow<br />
Days Like These: The Triennial<br />
of British Art, Tate Britain, London<br />
The Moderns, Museo d’Arte<br />
Contemporanea, Castello di<br />
Rivoli, Torino<br />
2001<br />
The Glen Dimplex Awards, Irish<br />
Museum of Modern Art, Dublin<br />
The International Language,<br />
grassy knoll productions, Belfast<br />
Tirana Biennale, Tirana<br />
Sloan/Philipsz/McTigue,<br />
The Plug In Gallery, Winnipeg<br />
Total Object Complete with<br />
Missing Parts, Tramway, Glasgow<br />
Loop, Kunsthalle der<br />
Hypo-Kulturstiftung, Munich<br />
Islands and Aeroplanes,<br />
Sparwasser HQ, Berlin<br />
New York New Sounds, Musée<br />
d’art contemporain de Lyon, Lyon<br />
2000<br />
Manifesta 3, Ljubljana<br />
The Internationale, Kunst-Werke,<br />
Berlin<br />
1999<br />
Melbourne International Biennial,<br />
Melbourne
262 — 263<br />
Authors
Hannah Arendt (born Hanover<br />
1906, died New York 1975) was<br />
a social and political theorist.<br />
She studied philosophy,<br />
theology and Greek under Martin<br />
Heidegger, Edmund Husserl<br />
and Karl Jaspers and others. After<br />
briefly being detained by the<br />
Gestapo, she emigrated to Paris<br />
in 1933, where she worked as<br />
a social worker for Jewish institutions.<br />
In 1940, she was interned<br />
at Camp Gurs, but escaped.<br />
From 1941, she lived in New York,<br />
1944-46 Head of Research<br />
for the Conference on Jewish<br />
Relations, 1946-49 Chief Editor<br />
of Salman Schocken Verlag,<br />
1948-52 Director of the Jewish<br />
Cultural Reconstruction Organization<br />
(rescue of Jewish cultural<br />
artefacts), 1953 several guest<br />
lectures (including Princeton<br />
and Harvard), professorship<br />
at Brooklyn College, New York,<br />
1959 first woman guest professor<br />
at Princeton, 1963 professor<br />
at the University of Chicago,<br />
1967 at the New School for<br />
Social Research in New York.<br />
Publications (selection):<br />
Origins of Totalitarianism (1951);<br />
Rahel Varnhagen. The Life of<br />
a Jewess (1958, 1997);<br />
The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong> (1958);<br />
Eichmann in Jerusalem.<br />
A Report on the Banality of<br />
Evil (1963); On Revolution (1963);<br />
On Violence (1970); Responsibility<br />
and Judgment (1982).<br />
Judith Butler, born 1956 in<br />
Cleveland, Ohio. Philosopher and<br />
philologist. She gained her<br />
doctorate at Yale, and in 1991<br />
was appointed Professor of<br />
<strong>Human</strong> Sciences at Johns<br />
Hopkins University, Baltimore.<br />
Since 1993, she has taught at<br />
Berkeley, University of California,<br />
where she accepted the Maxine<br />
Elliot chair in Rhetoric and<br />
Comparative Literature. Her<br />
principal fields of research are<br />
feminist theory, philosophy<br />
and literature, political theory,<br />
with an explicit emphasis on<br />
gender and sexuality. Her most<br />
important publications include<br />
Gender Trouble: Feminism and<br />
the Subversion of Identity (1990);<br />
Bodies That Matter: On the<br />
Discursive Limits of “Sex” (1993);<br />
Excitable Speech: A Politics of<br />
the Performative (1997); The<br />
Psychic Life of Power: Theories in<br />
Subjection (1997); Antigone’s<br />
Claim: Kinship Between Life and<br />
Death (2000); Precarious Life:<br />
The Powers of Mourning and<br />
Violence (2004); Undoing<br />
Gender (2004); Who Sings the<br />
Nation-State?: Language,<br />
Politics, Belonging (with Gayatri<br />
Spivak, 2007), Frames of War:<br />
When Is Life Grievable? (2009).<br />
Sophie Loidolt is an assistant<br />
lecturer at the Institute for<br />
Philosophy of the University of<br />
Vienna. She is currently working<br />
on a project on Hannah Arendt<br />
called Arendt and Kant. Transformation<br />
of the Enlightenment,<br />
with the support of an APART<br />
scholarship from the Austrian<br />
Academy of Sciences. She has<br />
made research visits to New York,<br />
Paris and Leuven/Belgium.<br />
Books published: Anspruch und<br />
Rechtfertigung. Eine Theorie<br />
des rechtlichen Denkens im<br />
Anschluss an die Phänomenologie<br />
Edmund Husserls (2009);<br />
Das Fremde im Selbst. Das<br />
Andere im Selben. Transformationen<br />
der Phänomenologie<br />
(co-edited with Matthias<br />
Flatscher, 2010).<br />
Jeremy Rifkin, born in Denver,<br />
Colorado in 1943. Sociologist and<br />
economist, journalist, founder<br />
and chairman of the Foundation<br />
on Economic Trends (FOET) in<br />
Washington D.C. Teaches at the<br />
Wharton School of the University<br />
of Pennsylvania. Adviser for<br />
the EU and various governments<br />
worldwide. Numerous book<br />
publications to do with futuristic<br />
topics that affect scientific and<br />
technical changes in the world of<br />
work, business, society and the<br />
environment, including The End<br />
of Work: The Decline of the Global<br />
Labor Force and the Dawn of<br />
the Post-Market Era (1995), The<br />
Biotech Century: Harnessing the<br />
Gene and Remaking the World<br />
(1998), The Age Of Access: The<br />
New Culture of Hypercapitalism,<br />
Where All of Life is a Paid-For<br />
Experience (2000), The Hydrogen<br />
Economy: The Creation of the<br />
Worldwide Energy Web and the<br />
Redistribution of Power on Earth<br />
(2002), The European Dream:<br />
How Europe’s Vision of the<br />
Future is Quietly Eclipsing the<br />
American Dream (2004,<br />
Corine International Book Prize)<br />
and The Empathic Civilization:<br />
The Race to Global Consciousness<br />
In a World In Crisis (2010).
264 — 265<br />
Imprint<br />
This catalogue is published<br />
on the occasion of the exhibition<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Empathy and Emancipation<br />
in Precarious Times<br />
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
June 12 – September 12, 2010<br />
Curator<br />
Adam Budak<br />
Editors<br />
Adam Budak,<br />
Peter Pakesch<br />
Assistant Editor<br />
Johanna Ortner<br />
Translation<br />
Paul Aston,<br />
Ulrike Bischoff,<br />
Waltraud Götting,<br />
Christof Huemer,<br />
Otmar Lichtenwörther,<br />
Xenia Osthelder,<br />
Karin Wördemann<br />
Lectorship<br />
Martha Davis Konrad,<br />
Bernd Eicher,<br />
Stefan Schwar<br />
Art Direction<br />
and Design<br />
Harald Niessner,<br />
visuelle Kommunikation<br />
with<br />
Katharina Untertrifaller<br />
Print Supervision<br />
Michael Neubacher<br />
Reproduction Works<br />
and Print<br />
Medienfabrik Graz<br />
Paper<br />
Hello Silk 170g,<br />
Biotop3 100g,<br />
Cyclus 100g,<br />
Invercote 300g<br />
Font<br />
Tram <strong>Joanneum</strong><br />
The work is subject to copyright.<br />
All rights reserved, whether the<br />
whole or parts of the material<br />
is concerned, especially those<br />
of translation, reprinting, re-use<br />
of illustrations, broadcasting,<br />
reproduction by photocopying<br />
machines or similar means, and<br />
storage in data banks.<br />
2010 © Artists, authors,<br />
Kunsthaus Graz, and Verlag der<br />
Buchhandlung Walther König,<br />
Cologne<br />
Published by<br />
Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Cologne<br />
Ehrenstr. 4, 50672 Köln<br />
Tel +49-221/20596-53<br />
Fax +49-221/20596-60<br />
verlag@buchhandlung-<br />
walther-koenig.de<br />
The Deutsche Nationalbibliothek<br />
lists this publication in the<br />
Deutsche Nationalbibliografie;<br />
detailed bibliographic data are<br />
available at http://dnb.d-nb.de.<br />
Distribution<br />
Switzerland<br />
Buch 2000<br />
c/o AVA Verlagsauslieferungen<br />
AG<br />
Centralweg 16<br />
CH-8910 Affoltern a.A.<br />
Tel. +41-44/762 42 00<br />
Fax +41-44/762 42 10<br />
a.koll@ava.ch<br />
UK & Eire<br />
Cornerhouse Publications<br />
70 Oxford Street<br />
GB-Manchester M1 5NH<br />
Tel +44-161/200 15 03<br />
Fax +44-161/200 15 04<br />
publications@cornerhouse.org<br />
Outside Europe<br />
D.A.P. / Distributed Art Publishers,<br />
Inc.<br />
155 6th Avenue, 2nd Floor<br />
New York, NY 10013<br />
Tel +1-212/627-1999<br />
Fax +1-212/627-9484<br />
www.artbook.com<br />
Printed in Austria<br />
ISBN 978-3-86560-845-1
Copyrights<br />
© Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Cologne<br />
and Kunsthaus Graz<br />
© for the reproduced works<br />
by the artists or their estates<br />
© for the texts by the authors,<br />
translators or their estates<br />
© for the reproduced photographs<br />
by the photographers<br />
or their estates:<br />
Courtesy of the artist and<br />
Giorgio Persano, Torino:<br />
pp. 15–17, 19–22, 25–27<br />
Achim Kukulies, Düsseldorf:<br />
pp. 30/31, 40/41, 44/45, 48–53<br />
Martin Url/Deutsche Bank<br />
Collection: pp. 32/33<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>/<br />
Nicolas Lackner: p. 47<br />
Courtesy of Zeno X Gallery,<br />
Antwerp: pp. 34–39, 43<br />
Cover<br />
Kris Martin, Mandi VIII, 2006<br />
Photo: Achim Kukulies,<br />
Düsseldorf<br />
We have made every effort to<br />
find all copyright holders. If we<br />
omitted to do so in individual<br />
instances, we should be most<br />
grateful if these copyright<br />
holders informed the publisher.<br />
First Publications<br />
and Translations<br />
Peter Pakesch<br />
Foreword<br />
(translated by Paul Aston)<br />
Adam Budak<br />
The Frailty of <strong>Human</strong> Affairs:<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>, or on Empathy and<br />
Emancipation in Precarious Times<br />
Sophie Loidolt<br />
Empathy and Emancipation in<br />
Precarious Times. The understanding<br />
heart and expanded judgment,<br />
in the eyes of Hannah Arendt<br />
(translated by Paul Aston)<br />
Hannah Arendt<br />
The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Chapter 1: The <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
(excerpt), Chapter 5: Action<br />
Reprint<br />
© 1958 by The University of Chicago<br />
Jeremy Rifkin<br />
The Empathic Civilization. The Race<br />
to Global Consciousness in a World<br />
in Crisis<br />
Part I: Homo Empathicus, Chapter 2:<br />
The New View of <strong>Human</strong> Nature<br />
Reprint from: Jeremy Rifkin, The<br />
Empathic Civilization. The Race to<br />
Global Consciousness in a World in<br />
Crisis, New York: Jeremy P. Tarcher/<br />
Penguin 2009, pp. 47-81.<br />
Judith Butler<br />
Precarious Life. The Powers<br />
of Mourning and Violence<br />
5: Precarious Life<br />
Reprint<br />
© 2004 by Verso<br />
Kunsthaus Graz,<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
Peter Pakesch, Director<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong><br />
and Kunsthaus Graz<br />
Gabriele Hofbauer,<br />
Director’s Assistant<br />
Katrin Bucher Trantow, Curator<br />
Adam Budak, Curator<br />
Katia Schurl, Johanna Ortner,<br />
Curatorial Assistants<br />
Elisabeth Ganser, Registrar<br />
Werner Urdl, Registrar Assistant<br />
Magdalena Reininger,<br />
Registrar Intern<br />
Paul-Bernhard Eipper,<br />
Conservator<br />
Monika Holzer-Kernbichler,<br />
Astrid Bernhard, Educational<br />
Team, Art and Architecture<br />
Eva Ofner, Anke Leitner, Supervision<br />
Education and Staff Coordination<br />
Markus Hall, Silvia Münzer,<br />
Maria Ogawa, Eva Strunz,<br />
Information Staff<br />
Teresa Ruff, Office Management<br />
Andreas Schnitzler, Head of<br />
External Relations Department<br />
Sabine Bergmann,<br />
Christoph Pelzl, Press<br />
Elisabeth Weixler, Marketing<br />
Astrid Rosmann,<br />
Bettina Kindermann, Marketing<br />
Assistant, Public Relations<br />
Barbara Ertl-Leitgeb, Webmaster<br />
Jörg Eipper Kaiser,<br />
Writer and Proofreader<br />
Gabriela Filzwieser,<br />
Event Management<br />
Sarah Spörk,<br />
Event Management Assistant<br />
Helga Bauer,<br />
Tourism Representative<br />
Leo Kreisel-Strauß, Michael<br />
Posch, Chiara Pucher, Graphics<br />
Bernd Dörling, Head of System<br />
Administration<br />
Andreas Graf, Norbert Körbler,<br />
Georg Pachler, Stefan Zugaj,<br />
System Administration<br />
Erik Ernst,<br />
Technical Maintenance<br />
Irmgard Knechtl,<br />
Assistant Technical Maintenance<br />
and Construction Team<br />
Robert Bodlos,<br />
Head of Construction Team<br />
Erich Aellinger, Walter Ertl,<br />
Markus Ettinger, Bernd Klinger,<br />
Gerhard Resch, Klaus Riegler,<br />
Peter Rumpf, Michael Saupper,<br />
Stefan Savič, Peter Semlitsch,<br />
Andreas Zerawa, Construction<br />
and Technical Team
266 — 267<br />
Kunsthaus Graz thanks<br />
Sophie Loidolt<br />
Giorgio Persano, Torino:<br />
Celeste Meoli<br />
Sies + Höke, Düsseldorf:<br />
Nina Höke, Alexander Sies,<br />
Diana Hunnewinkel,<br />
Julia Köhler, Nuria Molina,<br />
Johanne Tonger-Erk<br />
Deutsche Bank Collection:<br />
Friedhelm Hütte,<br />
Claudia Schicktanz,<br />
Carmen Schäfer<br />
David Zwirner, New York<br />
Neue Galerie Graz am<br />
<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>:<br />
Christa Steinle,<br />
Monika Binder-Krieglstein,<br />
Gudrun Danzer,<br />
Günther Holler-Schuster<br />
Raf Simons<br />
Raf Simons Studio:<br />
Bianca Luzi<br />
Zeno X Gallery, Antwerp:<br />
Frank Demaegd,<br />
Hanneke Skerath<br />
The David Roberts Art<br />
Foundation: Vincent Honoré,<br />
Sandra Pusterhofer<br />
Ilse Joliet<br />
Galerie Fons Welters:<br />
Fons Welters,<br />
Rosa Juno Streekstra<br />
Wilkinson Gallery:<br />
Amanda Wilkinson,<br />
Dan Coopey, Chris Jacob<br />
Stedelijk Museum:<br />
Jelle Bouwhuis<br />
Francesca Kaufmann,<br />
Milan: Francesca Kaufmann,<br />
Julia Koropoulos,<br />
Lucia Mannella<br />
Peter Kilchmann Galerie,<br />
Zurich<br />
Peter Blum Gallery,<br />
New York<br />
Kunsthaus Zürich:<br />
Franziska Lentzsch,<br />
Mirjam Varadinis<br />
KIZ RoyalKino:<br />
Nikos Grigoriadis<br />
The Austrian Filmmuseum:<br />
Andrea Glawogger,<br />
Franz Kaser-Kayer<br />
Frank Bode, Eoghan McTigue<br />
Isabella Bortolozzi Galerie,<br />
Berlin<br />
Witte de With, Rotterdam:<br />
Anne-Claire Schmitz,<br />
Paul van Gennip<br />
Grazer Kunstverein:<br />
Søren Grammel<br />
Mondriaan Foundation,<br />
Amsterdam:<br />
Gitte Luiten, Coby Reitsma,<br />
Marijn Veenhuijzen<br />
We owe special thanks<br />
to the artists of the<br />
exhibition and to all<br />
private lenders<br />
who do not wish to be<br />
mentioned by name.<br />
Supported by<br />
Stadt Graz, Land Steiermark, A1
Kunsthaus Graz<br />
<strong>Universalmuseum</strong><br />
<strong>Joanneum</strong>
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />
in prekären Zeiten<br />
Der vorliegende Katalog bietet eine Reise in die<br />
menschliche Ethik, in der die Strukturen der<br />
Rede, der Verantwortung und der moralischen<br />
Handlungsfähigkeit auf dem Spiel stehen.<br />
„Wer sind wir?“, fragt Hannah Arendt in ihrem<br />
Werk Vita activa oder Vom tätigen Leben und<br />
bezieht sich dabei auf Prozesse des Denkens,<br />
Wollens und Beurteilens. „Aus was sind wir<br />
gemacht?“, fragt Jeremy Rifkin und stellt den<br />
Homo Empathicus, den Protagonisten seiner<br />
„neuen Sicht auf die menschliche Natur“, vor.<br />
„Was gilt als menschlich? Was erlaubt uns, einander<br />
zu begegnen?”, untersucht Judith Butler.<br />
Dieser Ausstellungskatalog ist ein Porträt<br />
einer prekären Welt der Instabilität, in der<br />
die Zerbrechlichkeit der menschlichen Verhältnisse<br />
entlarvt wird. Zwischen Emanzipation<br />
und Verzweiflung, zwischen kollektiven<br />
Wünschen und individualistischer Mentalität<br />
sammelt die Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Modelle zeitgenössischer Realitäten. Sie<br />
fragt nach der Chance auf Hoffnung und sucht<br />
dabei nach der Möglichkeit des Heroischen<br />
im Zeitalter der korrumpierten Werte.<br />
Mit Texten von Adam Budak, Sophie Loidolt,<br />
Hannah Arendt, Jeremy Rifkin, Judith Butler<br />
und einem Vorwort von Peter Pakesch.<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />
Empathy and Emancipation<br />
in Precarious Times<br />
The present catalogue offers a journey<br />
into human ethics where the structures<br />
of address, responsibility and moral<br />
agency are at stake. “Who are we?”<br />
asks Hannah Arendt in her <strong>Human</strong><br />
<strong>Condition</strong> and refers to processes of<br />
thinking, willing and judging. “What<br />
are we made of?” asks Jeremy Rifkin<br />
while introducing Homo Empathicus,<br />
the main protagonist of his “new view<br />
of human nature.” “What counts as<br />
human? What allows us to encounter<br />
one another?” investigates Judith Butler.<br />
This exhibition catalogue is the portrait<br />
of a precarious world of instability,<br />
where the frailty of human affairs is<br />
exposed. Between emancipation and<br />
despair, between communal desire and<br />
individu alistic mentality, the exhi bition<br />
<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong> collects models<br />
of contempo rary realities. It asks for<br />
a chance of hope and searches for<br />
possi bilities of the heroic in an age of<br />
corrupted values.<br />
With texts by Adam Budak, Sophie Loidolt,<br />
Hannah Arendt, Jeremy Rifkin, Judith<br />
Butler, and a foreword by Peter Pakesch.<br />
Lida Abdul<br />
Marcel Dzama<br />
Maria Lassnig<br />
Mark Manders<br />
Renzo Martens<br />
Kris Martin<br />
Adrian Paci<br />
Susan Philipsz
978-3-86560-845-1<br />
Verlag der Buchhandlung<br />
Walther König, Köln