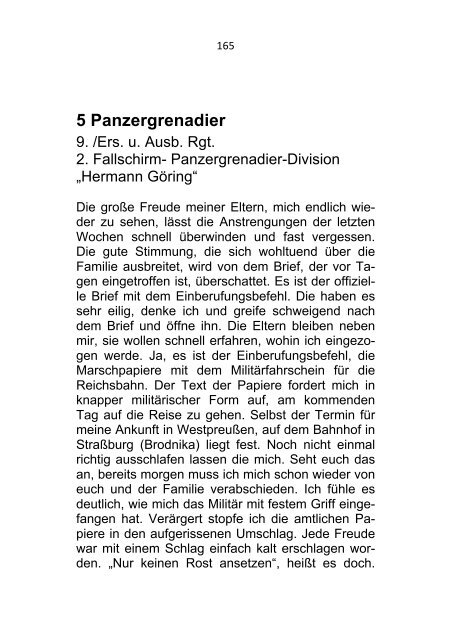Panzergrenadier - Klaus Weniger
Panzergrenadier - Klaus Weniger
Panzergrenadier - Klaus Weniger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
165<br />
5 <strong>Panzergrenadier</strong><br />
9. /Ers. u. Ausb. Rgt.<br />
2. Fallschirm- <strong>Panzergrenadier</strong>-Division<br />
„Hermann Göring“<br />
Die große Freude meiner Eltern, mich endlich wieder<br />
zu sehen, lässt die Anstrengungen der letzten<br />
Wochen schnell überwinden und fast vergessen.<br />
Die gute Stimmung, die sich wohltuend über die<br />
Familie ausbreitet, wird von dem Brief, der vor Tagen<br />
eingetroffen ist, überschattet. Es ist der offizielle<br />
Brief mit dem Einberufungsbefehl. Die haben es<br />
sehr eilig, denke ich und greife schweigend nach<br />
dem Brief und öffne ihn. Die Eltern bleiben neben<br />
mir, sie wollen schnell erfahren, wohin ich eingezogen<br />
werde. Ja, es ist der Einberufungsbefehl, die<br />
Marschpapiere mit dem Militärfahrschein für die<br />
Reichsbahn. Der Text der Papiere fordert mich in<br />
knapper militärischer Form auf, am kommenden<br />
Tag auf die Reise zu gehen. Selbst der Termin für<br />
meine Ankunft in Westpreußen, auf dem Bahnhof in<br />
Straßburg (Brodnika) liegt fest. Noch nicht einmal<br />
richtig ausschlafen lassen die mich. Seht euch das<br />
an, bereits morgen muss ich mich schon wieder von<br />
euch und der Familie verabschieden. Ich fühle es<br />
deutlich, wie mich das Militär mit festem Griff eingefangen<br />
hat. Verärgert stopfe ich die amtlichen Papiere<br />
in den aufgerissenen Umschlag. Jede Freude<br />
war mit einem Schlag einfach kalt erschlagen worden.<br />
„Nur keinen Rost ansetzen“, heißt es doch.
166<br />
Hast du das schon vergessen? Natürlich nicht, aber<br />
einmal im eigenen Bett auszuschlafen, das hätten<br />
sie mich doch lassen können.<br />
Die Familienmitglieder stellen sich auf die Verabschiedung<br />
des jüngsten Familienmitgliedes ein.<br />
Man sieht in mir auch keinen jugendlichen mehr.<br />
Und morgen, wie werde ich den dritten Abschied<br />
überstehen? Und dann wird es einen Abschied geben,<br />
der mehr Fragen aufwirft, als beantwortet werden<br />
können. Wie lange werde ich wegbleiben?<br />
Wann werde ich wieder kommen? Werde ich überhaupt<br />
wieder zurückkommen? Ich habe keinerlei<br />
Vorstellungen von dem, was mich ab morgen erwartet.<br />
Vorsorglich werde ich eine Schutzmauer um<br />
mich herum aufbauen. Daran kann dann alles, auch<br />
meine Furcht vor dem Unbekannten, abprallen.<br />
Jetzt stelle ich alle in mir aufkeimenden Vorahnungen<br />
erst einmal ab. Ich muss es tun, weil ich überleben<br />
will. Die Eltern sollen meine Schutzmauer<br />
nicht merken. Ab jetzt werde ich auch für meine<br />
Familienangehörigen nicht mehr offen zugänglich<br />
sein. Ich weiß nicht, wie ich mich meinen Eltern gegenüber<br />
verhalten soll, damit ihnen der Abschied<br />
nicht so schwer fällt. Es ist mein eiserner Wille und<br />
die mir anerzogene Disziplin. Ich will überleben.<br />
Weil ich nur noch an meine Reise denke, beschäftige<br />
mich schon sehr früh, noch vor dem Aufstehen,<br />
mit dem Kofferpacken. Die eine Nacht im eigenen<br />
Bett hat mir keinerlei Ruhe gebracht. Es wird in der<br />
Familie nicht ausgesprochen, was jeden vor dem<br />
Abschied bewegt. Meine Eltern finden keine Worte.<br />
Mir erscheinen sie übernervös. Wir wissen es, der<br />
heutige Abschied wird einer für eine lange Zeit sein.<br />
Ich bin für jede Minute dankbar, die in Ruhe ver-
167<br />
geht. Ohne Grund, nur um die Zeit totzuschlagen,<br />
suche ich hier und greife da. Es ist ein sinnloses<br />
Tun. Wer kann in den Augenblicken ermessen und<br />
es aussprechen, wie das Leben in diesem verdammten<br />
Krieg, mit all den zu erwartenden Prüfungen,<br />
weitergehen wird? Es kommen keine Antworten.<br />
Zwischendurch ertappe ich mich beim Blick auf<br />
die Armbanduhr. In der nächsten Stunde werde ich<br />
mit dem Eilzug den Bahnhof meiner Heimatstadt<br />
verlassen. Fragen und Antworten gleiten mir, wie<br />
die Zeit, ungefragt und unbeantwortet, zwischen<br />
meinen Fingern davon. Innerlich bin ich bereits auf<br />
meiner Reise. Die in unserem Alter mit sechzehn<br />
Jahren zum Militär einberufenen jungen Männer<br />
verlassen ihr Heim und ihre Familie. Noch erkennen<br />
wir nicht den harten Bruch in unserem Leben. Diesen<br />
werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt,<br />
wenn überhaupt verstehen. Morgen werde ich mich<br />
wieder in eine neue Kameradschaft einfügen. Und<br />
für jeden meiner künftigen Kameraden wird die<br />
Entwicklung zum Einzelkämpfer innerhalb der Gemeinschaft<br />
weitergehen. Wir haben Kenntnis von<br />
den großen Menschenverlusten an den Fronten.<br />
Trotzdem hoffen die meisten von uns auf ein Wiedersehen.<br />
Ich verschwende keinen Gedanken an<br />
meine Zukunft. Da sind Kameraden, die sich aufgegeben<br />
haben. Sie haben es zu Hause auf eine besondere<br />
Art vermittelt, dass sie das Gefühl haben,<br />
nicht wiederzukehren. Trotz aller unterschiedlichen<br />
Gedankenfetzen, die sich mit Unwägbarkeiten herumschlagen,<br />
fühle ich mich von der Hoffnung und<br />
vom Vertrauen begleitet, ja getragen: ich werde den<br />
Krieg überleben. Es ist sicherlich zum Zeitpunkt der<br />
Abreise nur ein Wunsch von vielen, den ich mit mir
168<br />
forttragen werde. Mit diesen Vorstellungen habe ich<br />
mich dann nicht mehr beschäftigt. Mein, nur Stunden<br />
dauernder Kurzaufenthalt zu Hause, verursacht<br />
in mir emotional belastende, kalte und heiße Gefühlsduschen.<br />
Mir fehlt einfach die Fähigkeit mit<br />
meinen Gefühlen umzugehen. Etwas Schmerzhaftes<br />
kommt, wenn auch nur unterschwellig, in mir<br />
hoch. Ich spüre den Druck des Abschieds jetzt sehr<br />
deutlich. „Wenn du in den Zug einsteigst, sage ich<br />
mir, dann bist du dir darüber im Klaren, jetzt wird es<br />
bitterer Ernst. Ich werde die seelischen Belastungen<br />
so gut wie möglich verdrängen. - - Nur jetzt keine<br />
Gefühle zeigen. - - Ablenken! - - Kommt der Zug? - -<br />
- Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange. Die Gegenwart<br />
scheint festzustehen, sie bleibt an mir hängen!<br />
Über die Dauer meiner Abwesenheit von meiner<br />
Familie, von meinem Zuhause, bestimmt nun<br />
das Militär: Die Dauer des Einsatzes als Luftwaffenhelfer<br />
lag nicht fest. Beim RAD waren es genau<br />
acht Wochen. Das System der zwingt uns zur eisernen<br />
Selbstbeherrschung. Der Abschied geht weiter.<br />
„Versprich es mir, dass du gut auf dich aufpasst!<br />
- - Ja - - - sei bitte vorsichtig! - - - Ja und komm bald<br />
wieder heim! - - Ja“. Das sind die guten Wünsche,<br />
die mir meine Mutter zuruft. Und ich empfinde all<br />
diese guten Wünsche und Aussagen der Mutter als<br />
peinlich. Und auch mein ständiges „Ja!“ Das kann<br />
doch keine Antwort sein. Das „Ja“ ist mir beim zweiten<br />
Mal schon lästig. Das „Ja“ ist nur eine stereotype<br />
Reaktion. Und wie soll ein 16 Jähriger auf die<br />
guten Wünsche der Mutter antworten? Weil ich mit<br />
der Situation nicht umgehen kann, habe ich innerlich<br />
längst abgeschaltet. Das „Ja“ ist jedoch nicht<br />
als ein Echo zu erklären. Nein, derjenige, der ver-
169<br />
abschiedet wird, nimmt die guten Wünsche als eine<br />
Art Liebeserklärung der Mutter willig und gehorsam<br />
in sich auf. Es darf aber niemand dabei sein und<br />
dieses hören. Die zwischen der Mutter und dem<br />
Sohn bestehenden unausgesprochenen Bindungen<br />
und Gefühlsregungen gehen nur die beiden etwas<br />
an. Und so versteht die Mutter das „Ja“ als mehr als<br />
nur eine simple Reaktion. Dieses alles gehört zum<br />
Ritus zwischen den beiden. Ob Außenstehende so<br />
ein Gespräch als kalt oder unfreundlich empfinden,<br />
interessiert die zwei überhaupt nicht. Die Wünsche<br />
und Hoffnungen graben sich bei beiden tief und unauslöschbar<br />
ein. Bis an das eigene Lebensende<br />
wird er sich an die innigen Wünsche der Mutter zum<br />
Abschied erinnern. Sie haben nun in mir bereits<br />
mehr als ein halbes Jahrhundert überlebt. Mit meinem<br />
Koffer in der Hand marschiere ich mit schnellen<br />
Schritten zum Bahnhof. Mit dem Eilzug verlasse<br />
ich heute Mittag nicht nur meine Heimatstadt zum<br />
dritten Mal, nein, nun auch unwiderruflich meine<br />
Jugendzeit. Meine Reise geht in die unbekannte<br />
Zukunft. Hoffentlich an einen Ort, der weit hinter der<br />
Front liegt. „Was kennst du denn schon von der<br />
Front“ - - fragt mich unerwartet meine innere Stimme.<br />
Sie erwartet eine Antwort. Was ich von der<br />
Front kenne? Nichts! - -Was ich zu kennen glaube,<br />
das habe ich nur gehört oder in den Wochenschauen<br />
gesehen. Es werden im Kino, so ist es bekannt,<br />
die von den Kriegsberichterstattern an verschiedenen<br />
Fronten aufgezeichnete Filme gezeigt. Das sage<br />
ich zu mir, mit voller Überzeugung. Denkste!<br />
Laut spüre ich „Denkste“ als Antwort. Denn bevor<br />
die Filmaufnahmen mit den Berichten in der Wochenschau<br />
der Öffentlichkeit gezeigt werden, müs-
170<br />
sen die ausgewählten Sequenzen geschnitten und<br />
von der Propaganda bearbeitet werden. Anschließend<br />
kommen die laufenden Bilder mit zackiger<br />
Militärmusik und mit „Siegesfanfaren“ unterlegt an<br />
die Öffentlichkeit. Es wird ständig auf die positiven<br />
Leistungen unserer tapferen Krieger hingewiesen.<br />
Gefallene deutsche Soldaten und vernichtetes<br />
deutsches Kriegsgerät, findet man nicht in der Wochenschau.<br />
Filmausschnitte abgeschossener und<br />
brennender sowjetischer Panzer liefert nur die<br />
Feindseite. Berichte von eigenen Verlusten sieht<br />
kein Volksgenosse. Vielleicht ist es technisch nicht<br />
möglich. Der Rückzug der „Deutschen Wehrmacht“<br />
beginnt auf breiter Front im Osten nach dem Verlust<br />
der 6. Armee in Stalingrad Anfang 1943. Es kann<br />
keinen erneuten Vormarsch ohne Halt und Umkehr<br />
geben. Und ohne neue, unverbrauchte aktive Militärkräfte,<br />
das sind frische, noch unerfahrene Soldaten.<br />
Wie sollen dann die Siege kommen? Neuerdings<br />
heißt es sinngemäß: Der Marsch geht an allen<br />
Fronten kämpfend zurück. „Verbrannte Erde“ ist<br />
es, was wir im Osten zurücklassen. Ich habe das<br />
Gefühl: die gewaltigen Explosionen sollen uns junge<br />
Männer auf unsere gewaltigen Leistungen hinweisen,<br />
die unsere Frontkämpfer erbringen. Viele der<br />
unmittelbar nacheinander folgenden Explosionen<br />
gehören einfach nicht zusammen. Eine Manipulation<br />
mit den Filmabschnitten, lassen in mir einen<br />
Zweifel an der Echtheit aufkommen. Ich vermute<br />
stark, dass es sich um gesammelte Aufnahmen, die<br />
aus verschiedenen Zeiten stammen. Der Vernichtungskrieg<br />
erlebt jedoch noch weitergehende Steigerungen.<br />
Es gibt nur noch die erbarmungslose,<br />
barbarische und radikale Zerstörung und Vernich-
171<br />
tung des Feindes. Wird sich der Krieg dabei selbst<br />
zerstören? Und so absurd es auch klingen mag,<br />
genau zu diesem Zeitpunkt des Nachdenkens<br />
befinde ich mich, in dieser Phase des wahnsinnigen<br />
Krieges, mit meinen jungen künftigen Kameraden<br />
auf unserem Weg in den Krieg. Zu einem Zeitpunkt,<br />
wo es nicht mehr vorwärts, sondern nur noch zurück-<br />
geht. Und ich bin auf dem Wege nach Westpreußen.<br />
Ist das - die Ostfront? All diese Gedanken<br />
werden tapfer an die Seite geschoben. Unsere HJ-<br />
Führer haben uns immer nur auf positive Ergebnisse<br />
an den Fronten eingeschworen. Und heute? Was<br />
bedeutet es, wenn man von Frontbegradigungen<br />
hört? Frontbegradigungen sind gleichbedeutend mit<br />
Rückzugs-bewegungen. Dieses passt auf keinen<br />
Fall in unser Gefühlsleben. Schon gar nicht in unsere<br />
Erwartungen, die wir noch durch unsere Verblendung<br />
an den Krieg haben. Das ist bestimmt nur ein<br />
Trick, den die Feindpropaganda über uns ausgießt.<br />
Innerlich werden die Aussagen nur mit dem Bleistift<br />
registriert und unter Verschluss gehalten. So werden<br />
wir die Meldungen, wenn sie sich „hoffentlich<br />
als unrichtig“ herausstellen, wieder ausradieren. Bei<br />
nächster Gelegenheit stellt sich dann heraus, mit<br />
der Rücknahme unserer Truppe an der Stelle X haben<br />
wir mit einem gelungenen Manöver und einer<br />
seitlich geführten Zangenbewegung eine Armee des<br />
Feindes eingekesselt und vernichtet. Wer ahnt oder<br />
weiß es, was der Wahrheit entspricht. Jede positive<br />
Meldung produziert in uns jungen Männern Stolz.<br />
Wir haben, wenn auch vielleicht nur für den nächsten<br />
Augenblick, weil wir nun wieder vorausblicken<br />
können, auf das Ausradieren der alten Meldungen<br />
verzichtet. Es ist uns völlig gleichgültig, ob die Mel-
172<br />
dungen auch den Tatsachen entsprechen und die<br />
echten Plätze beschrieben werden. Meine Gefühle<br />
für meine Sicherheit und meine Unsicherheit<br />
gewinnen wechselweise Oberhand. Also, so<br />
schlimm, wie ich es mir manchmal vorstelle, kann<br />
es und wird es wohl doch nicht an der Front sein.<br />
Dabei denke ich fast zeitgleich wieder an die vielen<br />
Todesanzeigen. An die, mit den Hakenkreuzen in<br />
der Tagespresse. Es ist ein fortwährender Wechsel<br />
in der Selbsttäuschung. Ich erkenne es aber nicht.<br />
Entweder will ich nicht oder ich kann es nicht. Wir<br />
noch bartlosen Männer wollen noch viel erleben.<br />
Wir können uns keiner Täuschung von außen beugen.<br />
Die Todesanzeigen mit dem Eisernen Kreuz in<br />
der Tageszeitung verdränge ich jetzt lieber wieder.<br />
Diese Todesanzeigen gelten auch unseren gefallenen<br />
Schulkameraden. Und schon ist alles wieder<br />
da. Die Gedanken können nicht abgestellt werden.<br />
Was ist mit den Todesanzeigen, die mit dem „Eisernen<br />
Kreuz“ versehen sind? Ich bekomme keine<br />
Antwort, weil ich die Frage mir selbst stelle. Wen<br />
soll ich fragen? Und so wird die Sache einfach unerledigt<br />
abgelegt. Die gewaltige Propagandamaschine<br />
hat im Verlauf des Krieges die Qualität ihrer sensitiven<br />
Ohren laufend gesteigert. Gehen dieser Einrichtung<br />
Gerüchte mit negativem Inhalt von den Volksgenossen<br />
ins Netz, dann folgen von der Propaganda<br />
die Siegesfanfaren. Während des Wehrmachtsberichts<br />
positive Schlagzeilen bringt und zum Abschluss<br />
stramme Marschmusik aus dem Radio erklingt.<br />
Diese mitreißenden Takte der Militärmusik<br />
veranlassen dann die Menschen, auch noch vor<br />
heller Begeisterung, im Takt mit den Fingern auf die<br />
Tischplatte zu trommeln. Spätestens zu diesem
173<br />
Zeitpunkt haben sich die schmerzhaft empfundenen<br />
Gedanken nach Niederlagemeldungen wieder aufgelöst.<br />
Sie sind stets auf der Lauer, bei nächster<br />
Gelegenheit erscheinen sie wieder drohend. Auch<br />
meine Gedanken haben sich nicht aufgelöst, sie<br />
haben sich versteckt. Sie gehen ohne Pause und<br />
Übergang, auf die unmittelbare Zukunft gerichtet,<br />
ununterbrochen weiter. Was auf uns, auf meine<br />
neuen Kameraden und auf mich wartet, liegt noch<br />
so weit weg. Zunächst werden wir eine Ausbildung<br />
erhalten und dann werden wir schon sehen. Einen<br />
zusätzlich erforderlichen Seelenpanzer werde ich<br />
mir am besten jetzt zulegen. Der wievielte es sein<br />
wird, weiß ich nicht mehr. Der Panzer soll mich vor<br />
den Auswirkungen der Gedanken, die mich ständig<br />
bedrohen, und den latent vorhandenen Ängsten,<br />
schützen. Im Bahnhofsgebäude und auf dem Bahnsteig<br />
warten viele uniformierte Männer verschiedener<br />
Waffengattungen sowie Reisende in Zivil. Sie<br />
alle müssen heute nach Berlin. Der Eilzug wird doch<br />
nicht hier eingesetzt, der kommt doch von weit her.<br />
Der ist bestimmt schon überladen. Na, hoffentlich<br />
kann ich mir einen Platz im Zug verschaffen. Was<br />
soll ich machen, wenn mich der Zug nicht mitnimmt?<br />
Wie soll ich dann pünktlich in Brodnika<br />
sein? Der Mittagseilzug ist, wie befürchtet, restlos<br />
überfüllt. Er rollt langsam in den Bahnhof ein. Luft<br />
schnappen. Fenster runter lassen. Der normale<br />
Einstieg wird verwehrt. Wer in den Zug will, der<br />
muss durchs Fenster. Die Mitreisenden mit ihren<br />
Koffern und andere unförmige Gepäckstücke heben<br />
und schieben sich gegenseitig irgendwie in den<br />
Zug. Trotz der herrschenden Enge helfen sich die<br />
Menschen gegenseitig. Denn jeder Einzelne ist ir-
174<br />
gendwann auf die Hilfe eines anderen Menschen<br />
angewiesen. Vielleicht ziehen sie, weil im Westen<br />
von den Bomben verjagt von einem kleinen Keller<br />
nun in einen größeren Keller irgendwo im Osten, wo<br />
sie sich mehr Sicherheit erhoffen. Die Gründe, in<br />
diesen Zeiten auf die Reise zugehen sind vielfältig.<br />
Ich denke: viele Menschen sind nur in Bewegung,<br />
weil sie keine Ruhe mehr finden. Was die Mitreisenden<br />
im Osten erwartet, können sie nicht erkennen.<br />
Wir alle sind in diesem Zug auf der Suche unterwegs.<br />
Es ist kurz nach 12°° Uhr. In der nächsten<br />
Minute erhalten wir das Zeichen für die Abfahrt.<br />
Zwei gute Stunden sind es bis zum Potsdamer-<br />
Bahnhof in Berlin. Knapp 200 Kilometer trennen<br />
mich vom ersten Zielbahnhof. Sitzplatz? Nein, daran<br />
denke ich nicht. Früher habe ich die Fahrt nach<br />
Berlin auch meistens stehend erlebt. Ich hatte damals<br />
immer eine bessere Sicht im Seitengang. Bedächtig<br />
setzt sich der Zug, heftig knarrend in Bewegung.<br />
Er rollt in Richtung Osten. Potsdamer Bahnhof,<br />
ich komme. Bei der herrschenden Enge bekommt<br />
man in dem, für maximal 8 Personen eingerichtete<br />
Abteile kaum Luft. Mit mir fahren 14 Personen<br />
im Abteil zusammengepfercht. Das Fenster<br />
bleibt geschlossen. Mit den mir wohlbekannten Bildern<br />
der Landschaft kommen viele meiner Erinnerungen<br />
an Berlin zurück. In wenigen Minuten werden<br />
wir Magdeburg erreichen. Die überladenen<br />
Waggons geben vor jedem Halt kreischende Geräusche<br />
von sich. Bis zum endgültigen Halt auf dem<br />
Hauptbahnhof Magdeburgs schreien die Bremsen.<br />
Ich sehe eine Menschenmenge, die ihr Gepäck geschultert<br />
hat, um den Zug zu stürmen. Mein Koffer<br />
dient mir, nach dem Aus- und Einsteigen, nunmehr
175<br />
als Sitzplatz im Seitengang des Waggons. Ächzend<br />
verlässt der Zug Magdeburg. Polternd rollt er über<br />
die erste Brücke. Noch einmal geht mein Blick auf<br />
die vorbeiziehende Stadt. Auf dem oberen Rand<br />
eines der hohen Häuser erkenne ich noch einen<br />
Namenszug. Und weiter erinnere ich mich: An der<br />
Stirnseite der Brücke, über die der Zug rollt, steht<br />
der Spruch: „Unsereiner trinkt Bodensteiner“. Mit<br />
einem letzten Blick verabschiede ich mich endgültig<br />
von dieser Stadt. Der Elbstrom kommt langsam in<br />
Sicht, und nach einer geräuschvollen Überquerung<br />
der stählernen Eisenbahnbrücke hat der Eilzug die<br />
Stadt hinter sich gelassen. Ich habe viele gute Erinnerungen<br />
an Magdeburg. Nun entschwindet sie und<br />
löst sich in der warmen, sonnendurchfluteten<br />
Herbstlandschaft auf. Ohne Halt geht es mit der<br />
gleichen Geschwindigkeit weiter, und schon passiert<br />
der Zug den Bahnhof von Burg. Auf der Geraden,<br />
wie mit einem Lineal gezogenen Strecke geht<br />
es durch dichten Wald. Es dauert nicht lange, dann<br />
rollt der Zug durch den Bahnhof von Genthin. Fahrplanmäßig,<br />
ebenfalls ohne einen Halt, geht es durch<br />
Brandenburg. Endlich, nach einem kurzen Halt in<br />
Potsdam nähert sich der Zug endlich Berlin. Die gut<br />
zwei Stunden dauernde Fahrt bringt den Zug dicht<br />
an einen Teil der vielen Wasserflächen Potsdams<br />
heran. Der Fahrgast, der diese Gegend nicht kennt,<br />
kann den Eindruck gewinnen, als rolle der Zug<br />
durch die Havel. Endlich, ich kann es kaum erwarten,<br />
so gegen 14.20 Uhr läuft der Zug in die große<br />
Halle des Potsdamer-Bahnhofs ein. Ich bin in Berlin<br />
und freue mich sehr darüber. Endlich wieder echte<br />
Berliner Luft! Früher, als Junge, als ich fast regelmäßig<br />
meine Sommerferien in Berlin verbringen
176<br />
durfte, bin ich hier auf diesem Bahnsteig immer von<br />
Onkel Bruno abgeholt worden. Ich sehe ihn noch,<br />
wie er neben dem einfahrenden Zug stand und<br />
meine Augen gesucht hat. Heute treffe ich nicht auf<br />
seine suchenden Augen. Heute erwartet mich niemand.<br />
In wenigen Stunden verlasse ich Berlin ohnehin<br />
schon wieder. Von meiner Durchreise wissen<br />
meine Familienangehörigen hier in Berlin nichts. Ich<br />
will keine weitere Begrüßung, und vor allem keinen<br />
zweiten Abschied an einem Tag. Mein Fahrziel in<br />
der späten Nacht ist der Ort Strasburg, der in Westpreußen<br />
liegt. Auf der Durchreise an dieser Stelle<br />
zu verweilen, bedeutet mir, neue Eindrücke zu gewinnen.<br />
Ich will sie mitnehmen. Der Potsdamer-<br />
Bahnhof ist größer als in meiner Erinnerung. Ich will<br />
ihn heute in Ruhe besichtigen. Die Reichshauptstadt<br />
hat schon immer allen Ankommenden Beine<br />
gemacht. Wer kann mir schon sagen, ob ich jemals<br />
mein Berlin und den Potsdamer Bahnhof wiedersehen<br />
werde. Das weiche Licht der wärmenden<br />
Herbstsonne bringt mir sofort viele Erinnerungen an<br />
mein Berlin zurück. Der Potsdamer-Bahnhof verlangt<br />
nun meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Nachdem<br />
ich aus dem Zug ausgestiegen bin rieche ich<br />
sie wieder, die „Berliner-Luft-Geruchsmischung“,<br />
und mit ihr die Erinnerung an meine Kindheit. Von<br />
meinem 10. Lebensjahr an bin ich allein Berlin gefahren.<br />
Ich fühlte und fühle mich hier, an diesem<br />
Ort, einfach gut. Mir ist so, als sei ich heute wieder<br />
mit einem „alten Bekannten“ zusammengetroffen.<br />
Die in ihrer Größe beeindruckende Halle des Bahnhofs<br />
nimmt Züge aus nah und fern auf. Die Ankommenden<br />
steigen schnell aus und die Abreisenden,<br />
werden von den Waggons regelrecht eingeso-
177<br />
gen. Alles geschieht in Eile. Bisweilen dringen<br />
Dampf und Qualm der Lokomotiven als Werbung<br />
bis vor die Fahrkartenschalter in der<br />
Bahnhofsvorhalle. Diese Werbung fordert jeden<br />
Reisewilligen auf, sich die Fahrkarte zu kaufen.<br />
Auch hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen.<br />
Ich habe heute nur die Gepäckträger vermisst.<br />
Trotz des Krieges läuft hier scheinbar alles wie früher.<br />
Der Gesamteindruck des Potsdamer Bahnhofs<br />
sagt mir, dass ich mich hier in einer „Kathedrale“<br />
der Eisenbahn befinde. Nur zur Vervollständigung<br />
meiner Gedanken spreche ich das Bild „Kathedrale“<br />
an. Für mich gehören die Dome und großen Kirchen<br />
in die erste Gruppe der Kathedralen. In die zweite<br />
Gruppe gehören die gewaltigen Gebäude, in denen<br />
die Staatsführung regiert, und die öffentlichen Bauwerke,<br />
in denen Banken oder die großen Geschäfte<br />
etabliert sind. Diese Einrichtungen gehören nach<br />
meinem Verständnis zu den Kathedralen der „Weltlichen<br />
Macht“. Auf einen jungen Mann in meinem<br />
Alter, der den Anblick dieser gewaltigen Gebäude<br />
erst seit seiner Besuche im Kriege gewohnt ist, wirken<br />
die übereinander gestapelten Gesteinsmassen<br />
trotzdem erdrückend. In meinen Schulferien habe<br />
ich mir über die “Kathedralen“ keine Gedanken gemacht.<br />
Man sehe nur auf die großformatigen Steine<br />
der Erdgeschosse. Sie bleiben für mich, die steingewordenen<br />
Zeichen der Macht. Von diesen Attributen<br />
werden Menschen nicht zum Besuch eingeladen.<br />
Diese Form der „Macht“ soll nach meinem<br />
Empfinden, das Lebewesen Mensch untertänig machen<br />
und halten. Nach diesen grüblerischen Gedanken<br />
muss ich jetzt in die Wirklichkeit zurückfinden.<br />
Heute wäre ich gern geblieben. Doch diesmal
178<br />
verlasse ich Berlin mit einem mich plötzlich stark<br />
bedrückendem Gefühl. Weiter trage ich mein Berlin<br />
fest in mir. Daran haben auch die vielen<br />
Zerstörungen und Trümmer nichts ändern können.<br />
Doch nun heißt es auch für mich: ‚Du hast zu gehorchen’.<br />
Noch vor Sonnenuntergang werde ich auf<br />
Kosten der Allgemeinheit zu dem schriftlich festgelegten<br />
Zielbahnhof fahren. Durch die Entfernung<br />
von meiner Heimat und den bevorstehenden Abschied<br />
von Berlin verändern sich meine Gefühle. Mit<br />
dem militärischen Befehl in der Tasche, muss ich<br />
mein Berlin verlassen. Nicht um zurück nach Hause<br />
zu fahren. Jetzt spüre ich, wie ich von einer unbekannten<br />
Kraft verdrängt werde. Ich muss mit dem<br />
Zug in eine mir völlig unbekannte Gegend fahren.<br />
Nun wird es Zeit, dass ich zum „Stettiner-Bahnhof“<br />
komme! Auf meinem Fußweg dahin durchlebe ich<br />
Erinnerungen an einen meiner letzten Besuche<br />
1942: Bereits zu Beginn des Krieges, im Herbst<br />
1939, brauchte man schon sehr viel Geduld, um nur<br />
den telefonischen Kontakt innerhalb von Familien<br />
aufrecht zu erhalten. Die Telefonvermittlung für<br />
Ferngespräche, die ausschließlich per Hand über<br />
das Postamt gingen, waren ständig überlastet.<br />
Nach schweren Luftangriffen auf Berlin war es<br />
plötzlich der Wunsch meiner Mutter: Fahr mit dem<br />
Eilzug nach Berlin und erkundige dich, wie es den<br />
Verwandten geht. Onkel Bruno und Tante Emilie,<br />
sie ist eine Schwester meiner Mutter. Wenn sie Hilfe<br />
benötigen, du bist ja da, du kannst ihnen dann tüchtig<br />
helfen. Es ist Anfang des Winters 1942/1943.<br />
Weit im Westen der Reichshauptstadt, etwa am<br />
Westkreuz, musste ich meinen Zug verlassen. Die<br />
Straßen waren trocken und in kalten Nebel und
179<br />
Dunst gehüllt. Aus technischen Gründen, wie es<br />
amtlich hieß, fuhr der Eilzug nicht bis zum Potsdamer-Bahnhof.<br />
Die Strecke war in der letzten Nacht<br />
bombardiert, und noch nicht wieder freigegeben<br />
worden. Über Nebenstraßen marschierte ich zum<br />
Kurfürstendamm. Rechts und links lagen in den<br />
Straßen die Schuttmassen herabgestürzter Fassaden<br />
auf den Bürgersteigen und der Straße. Und<br />
Qualm kam noch aus einzelnen, nicht vollständig<br />
ausgebrannten Häusern. Zwischen dem Schutt lagen<br />
auf den Straßen zerstörte und verstreute Überreste<br />
der Straßenlaternen und der Oberleitungen<br />
der Straßenbahn mit Halteseilen und Verankerungen.<br />
Diese Anker trugen teilweise noch ihre herausgerissenen<br />
dicken Stein- und Mörtel-Pakete.<br />
Zweiflammige Kandelaber mit den zerbrochenen<br />
Glaskörpern lagen kreuz und quer auf der Straße.<br />
Überbleibsel der Kultur, ein Bild vollkommener Zerstörung.<br />
An verschiedenen Stellen sah ich unter<br />
Druck stehende Wasserschläuche, deren Spritzen<br />
abgesperrt waren, am Straßenrand lagen. Mir waren<br />
die feinen Wasserfontänen, die aus den Löchern<br />
beschädigter Schläuche kamen aufgefallen.<br />
Das Wasser verteilte sich in alle Richtungen. Die<br />
Menschen versuchten an dieser Stelle, Reste beweglicher<br />
Güter zwischen den Trümmern freizulegen<br />
und zu bergen. Sonst lag eine bedrückende<br />
Ruhe über dem Geschehen. Weiter waren andere<br />
verzweifelte Menschen dabei, das Feuer in einem<br />
Keller zu löschen. Unter den Luftschutzhelmen und<br />
mit den Feuerwehrspritzen in den Händen, kamen<br />
sie dennoch nicht zur Ruhe. Fahrzeuge, die seit<br />
dem Einsetzen des Fliegeralarms von den Menschen<br />
verlassen wurden, liegen zerstört oder aus-
180<br />
gebrannt herum. Vereinzelte Bombentrichter, teils<br />
gefüllt mit Wasser oder den Resten der Zivilisation,<br />
zeigen das ganze Elend. Die in den frühen Stunden<br />
des Tages anwesenden, sich abmühenden Menschen<br />
waren neben den aufsteigenden Rauchschwaden,<br />
das einzige Lebenszeichen in den Straßen,<br />
durch die ich meinen Weg suchte. Mein Weg<br />
führte mich an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche<br />
vorbei, weiter auf der Tauentzienstraße bis zum<br />
Wittenbergplatz, beim KaDeWe, marschierte ich<br />
rechts ab in Richtung Martin-Luther Straße. Mein<br />
Weg endete am Haus mit der Wohnung der Verwandten.<br />
Ich konnte das vierstöckige Wohnhaus<br />
nicht mehr von der Straßenseite betreten. Ich suchte<br />
und fand den Weg durch das Nebenhaus in der<br />
nächsten Querstraße. Durch den Seiteneingang<br />
kam ich über den Hof und gelangte über die vom<br />
Staub bedeckte, angerostete eiserne Wendeltreppe<br />
die erste Etage und klopfte an die Küchentür. Nach<br />
einer Weile und erneutem Klopfen wurde die Tür<br />
langsam aufgeschlossen aber noch nicht gleich geöffnet.<br />
Sehr zögerlich öffnete sich die Tür. Die Verwandten<br />
standen lebend vor mir. Sie waren erschrocken,<br />
als sie mich in der Tür sahen. „Wo<br />
kommst du denn her?“ Dieses war die erste Frage,<br />
und sie kam wie aus einem Munde. Ich erzählte<br />
ihnen, warum ich komme. Sie waren sehr erfreut<br />
darüber, dass wir uns so um sie besorgt hatten und<br />
sie nicht vergessen waren. Der Bombenkrieg und<br />
die stundenlangen Aufenthalte im Keller haben beide<br />
sehr mitgenommen. Und ich sollte auch gleich in<br />
der ersten Nacht einen Bombenangriff in Berlin erleben.<br />
Ich saß mit ihnen und den anderen Bewohnern<br />
des Hauses im Keller. Es war auf mich, bezo-
181<br />
gen auf Dauer und Schwere ein starker Luftangriff.<br />
So einen Angriff habe ich vorher nicht erleben müssen.<br />
Eine bei jedem Fliegeralarm gegenwärtige<br />
Angst lähmt die Nerven der Menschen. Nicht auszudenken,<br />
bei einem Luftangriff im Keller verschüttet<br />
zu werden, oder durch einen Wasserrohrbruch<br />
im Keller ertrinken zu müssen. Dann folgt die Angst<br />
vor dem Feuer. Vielleicht mit lebendigem Körper zu<br />
verbrennen. Hier habe ich festgestellt: Dem eigenen<br />
Schicksal kann man doch nicht entkommen. Der<br />
gefühllose und andauernde harte Griff der Unruhe<br />
konnte von den fahlen Gesichtern der hilflosen<br />
Menschen abgelesen werden. Als Ventil, um sich,<br />
wenn auch nur vorübergehend, von dem Druck zu<br />
befreien, diente vereinzelt ein Wimmern oder ein<br />
Aufschrei. Der Luftschutzwart, häufig sind es Frauen,<br />
hielt die Hausbewohner hinter den geschlossenen<br />
Kellertüren fest. Die als „Schutzräume“ bezeichneten<br />
Keller unter den vierstöckigen Häusern<br />
sind den Menschen mit der Dauer des Luftkrieges<br />
zum Überleben in der Hausgemeinschaft vertraut<br />
geworden. Zusammengekauert hockten sie auf ihren<br />
angestammten Plätzen. Das nur spärliche elektrische<br />
Licht ließ die Gesichter grau erkennen. Die<br />
fernen und nahen Explosionen einschlagender<br />
Bomben ließen im Keller den Putz von den Wänden<br />
und Decken abplatzen. Dann kam das häufig flackernde<br />
Licht, nach längeren Unterbrechungen endlich<br />
wieder. Das ungute Gefühl vermittelte den<br />
Menschen, das der Fliegeralarm von Mal zu Mal<br />
länger dauerte. Sie alle beteten und hofften für ihr<br />
Überleben. Nach der endgültigen Entwarnung in<br />
dieser Nacht und einem befreienden Aufatmen, ging<br />
es in die Wohnungen zurück. Im Treppenhaus la-
182<br />
gen Trümmer. In der ersten Etage war der von den<br />
Druckwellen der Explosionen angerichtete Schaden,<br />
sofort erkennbar. Die Fenster zur Straße, von<br />
der Wucht des Luftdruckes zersplittert und auseinander<br />
gerissen, waren in die Räume hineingeflogen.<br />
Zwei Halbstein gemauerte Zwischenwände waren<br />
nahezu eingestürzt. Überall in der Wohnung verteilt<br />
lagen die Reste des herausgebrochenen Parkettfußbodens.<br />
Zerbrochene Möbel und die Teppiche<br />
lagen unter dem Schutt des Krieges. Tapetenreste<br />
an den Bruchstücken der umgestürzten Zwischenwände<br />
waren sichtbar. Ohne Pause begannen wir<br />
mit der Schuttbeseitigung. Der übliche Haushaltseimer<br />
war in der Küche ohne Schaden geblieben.<br />
Auf dem Gehweg vor dem Hause wurde der Schutt<br />
der letzten Nacht auf den Schutt der Vortage gekippt.<br />
Glücklicherweise, so, als wäre ein heimlicher<br />
Wunsch seiner Eltern wahr geworden, traf am<br />
nächsten Tag, mein Vetter auf Urlaub aus Nordnorwegen<br />
ein. Wir konnten nun gemeinsam bei der<br />
Herrichtung der Wohnung helfen. Zunächst mussten<br />
die Fenster instand gesetzt werden. Die ausgebrochenen<br />
alten Fensterteile, soweit wir das Holz<br />
verwenden konnten, nagelten wir notdürftig wieder<br />
zusammen. Dann besorgten wir am nächsten Morgen<br />
den ‚Bezugschein für Glasgeweberollen’. Im<br />
Rathaus Schöneberg haben wir, wenn auch nur<br />
widerwillig, - wahrscheinlich wollten die Amtspersonen<br />
den angeblichen kleinen Rest an Glasgewebe<br />
für den nächsten Ansturm strecken - den Bezugschein<br />
erhalten. Sicher hat das ‚Ehrenkleid des<br />
Führers’, - die Wehrmachtsuniform meines Vetters -<br />
dazu beigetragen, dass wir dann das dringend benötigte<br />
Material auch kaufen konnten. In einem La-
183<br />
den im Hinterhof erhielten wir das Glasgewebe.<br />
Sparsam, in kleinen Stücken, haben wir es dann als<br />
‚Lichtspender’ in die Fensteröffnungen genagelt. Ob<br />
es und wie lange es halten konnte? Das wusste von<br />
uns keiner. Unsere Arbeit konnte in der nächsten<br />
Stunde für immer vernichtet sein. Während der<br />
Ausbesserung sagt mein Vetter: ‚Wir haben uns die<br />
Arbeit gemacht, meine Eltern sind darüber froh.<br />
Doch wie lange wird es halten?’ Materialien für Reparaturen<br />
waren nicht mehr zu bekommen. Mit der<br />
Zeit fehlten auch den älteren Menschen die nötigen<br />
Kräfte, um sich zu helfen. Persönlich habe ich nach<br />
meinem Besuch, Anfang Winter 1942/43 keinen<br />
Kontakt mehr mit den Verwandten. Mein Vetter war<br />
nach seinem Urlaub wieder nach Nordnorwegen zu<br />
seiner Einheit zurückgekehrt. Nach einem vergleichbaren<br />
Luftangriff der letzten Tage bin ich dann<br />
zwei Tage später zurück nach Helmstedt gefahren.<br />
Dieses sind Gedanken an die letzten Tage in Berlin.<br />
Nun haben wir Anfang Oktober 1944. Gegen 14,20<br />
Uhr bin ich am Potsdamer Bahnhof eingetroffen.<br />
Den ersten Abschnitt meiner Reise nach Westpreußen,<br />
wo ich mich morgen in der Frühe beim Militär<br />
zu melden habe, habe ich erreicht. Bei meiner Ankunft<br />
herrscht Sonnenschein, und nun laufe ich bei<br />
strömenden Regen mit dem Koffer in der Hand, in<br />
Richtung Stettiner-Bahnhof. Dort soll am Abend der<br />
zweite Abschnitt meiner Reise beginnen. Auf meinem<br />
Fußmarsch zum Bahnhof „Friedrichstraße“<br />
finde ich in einer Seitenstraße eine Filiale von<br />
„Aschinger“. Vielleicht habe ich Glück und kann<br />
noch von der angebotenen „Suppe mit Einlage, ohne<br />
Marken“ etwas bekommen. „Bestecke sind mitzubringen“,<br />
steht da auf dem Aushang. Na ja, und
184<br />
ich habe kein Besteck, was mache ich mit der Suppe?<br />
Nun lese ich noch den kleingeschriebenen<br />
Nachtrag: ‚Besteckausleihe gegen Pfand’. Ich bezahle<br />
die 20 Reichsmark und erhalte einen mit einer<br />
roten Farbe überzogenen, verbogenen Miet-<br />
Blechlöffel. Der soll mir jetzt helfen, dass ich die<br />
undefinierbare Suppe essen kann. Ich denke im<br />
Stillen, die Menschen, die hier häufiger eine Mahlzeit<br />
zu sich nehmen, haben bestimmt immer das<br />
eigene Essbesteck bei sich. Ich betrachte noch<br />
einmal den roten Blechlöffel. Schon habe ich Kontakt<br />
zu meinem Nachbarn. Sei froh, dass der Löffel<br />
eine Farbschicht hat, denn ohne Anstrich würde dir<br />
die Suppe nicht schmecken. ‚Und wo bleiben die<br />
kleinen und kostenlosen Brötchen?’ frage ich. Mein<br />
Nachbar grinst. ‚Was’, höre ich ihn, seine Frage<br />
klingt leise, Kann man hier etwas ohne Brotmarken<br />
bekommen. ‚Hier gibt es kostenlos kleine Brötchen<br />
für den zahlenden Gast?’ Ich antworte mit ‚Ja, das<br />
ist aber schon lange her’. Grußlos, wie wir uns getroffen<br />
haben trennen wir uns wieder. Ich gebe meinen<br />
Teller und den Löffel an der Essenausgabe ab<br />
und stecke die 20 Reichsmark wieder in meine<br />
Geldbörse. Für mich wird es jetzt Zeit. Pünktlich<br />
erreiche ich den Stettiner Bahnhof. Mein Zug nach<br />
Königsberg steht schon am Bahnsteig. Reisende,<br />
die mit und vor mir auf dem Bahnsteig eintreffen<br />
steigen schnell in den Zug ein. Bei dem Regen<br />
bleibt keiner auf dem kalten und zugigem Bahnsteig.<br />
Komisch denke ich, wartet der Zug vielleicht<br />
auf mich? Schnell steige auch ich ein und suche mir<br />
in einem Abteil einen Eckplatz. Ich setze mich in<br />
Fahrtrichtung auf die rechte Seite. Vereinzelt, steigen<br />
nun zu mir einige Menschen, die mit großem
185<br />
Gepäck, in Form von Koffern und Körben auf die<br />
Reise nach Ostpreußen gehen wollen. Ich denke an<br />
den herrlichen Sonnenschein am Mittag. Da war ich<br />
mit einem Bündel<br />
Erinnerungen beschäftigt und jetzt vom Regen wieder<br />
einmal durchweicht, sitze ich im Zug und werde<br />
in Richtung Ostnordost in die Nacht fahren. Meine<br />
Reise wird über Schneidemühl, Bromberg nach<br />
Strasburg, einer kleinen Bahnstation irgendwo in<br />
Westpreußen gehen. Dieser D-Zug fährt nach Königsberg<br />
weiter. Nach einem lang gezogenen Pfeifton<br />
der Lokomotive und dem kräftigen Pfiff der Trillerpfeife<br />
setzt sich der Zug in Bewegung. Draußen<br />
ist es stockdunkel. Der kalte Regen prasselt gegen<br />
die Fenster. Die Zugabteile sind ungeheizt. Die<br />
Feuchtigkeit meines Anzuges geht mir durch und<br />
durch, bis auf die Haut. Die Abteilbeleuchtungen<br />
sind kriegsbedingt abgedunkelt. Allmählich sind die<br />
Umrisse der Mitreisenden und des Abteils schemenhaft<br />
zu erkennen. Die Fenstervorhänge sind<br />
weitgehend zerrissen, die Verdunklungen sind beschädigt.<br />
Nach kurzer Fahrt fallen alle Reisenden,<br />
jeder mit seinem eigenen knurrenden Magen in den<br />
Schlaf. Ihre halboffenen Münder geben unregelmäßig<br />
leise und laute Schnarchgeräusche von sich. Ich<br />
wende mich nach innen und kehre noch einmal auf<br />
die Eindrücke zurück, die ich auf dem Weg vom<br />
‚Potsdamer zum Stettiner’ gewonnen habe. Viel frischer<br />
Trümmerschutt liegt in den Straßen. Abgekämpft,<br />
in gebückter Haltung, versuchen Menschen<br />
mit Schaufeln und Besen die Fahrbahnen zu säubern.<br />
Die vielen zerstörten oder ausgebrannten<br />
Häuser, die vorgestern, gestern und vielleicht erst in<br />
der letzten Nacht vernichtet worden sind sehe ich
186<br />
jetzt an. Nun stehen sie nur noch für mich als Ruinen<br />
in Reih und Glied. Die Überbleibsel von Wohnkultur.<br />
Wie können und werden die vielen Menschen,<br />
die zwischen und in den Ruinen leben<br />
müssen, damit zurechtkommen? Mir bereitet diese<br />
Katastrophe große seelische Schmerzen. In allen<br />
Städten, die ich bisher im Krieg gesehen habe: ob<br />
in Braunschweig, in Hannover, überall sehen<br />
Trümmer gleich aus. Und diese Trümmer und Ruinen<br />
sind es, die sogar den Namen der jeweiligen<br />
Stadt ausgelöscht haben. Trümmer ohne Hoffnung.<br />
Und die Menschen sind innerlich abgestumpft und<br />
tief entmutigt. Ihre Hoffnungen sind von den umgestürzten<br />
Mauern begraben worden. Aus den Trümmern<br />
herausragende und qualmende Ofenrohre<br />
geben die letzten Lebenszeichen der zerstörten<br />
Häuser. Auch wenn die Menschen in den Trümmern<br />
ohnmächtig sind und nichts gegen ihre aussichtslose<br />
Lage unternehmen können, gehen sie weiter<br />
pflichtbewusst, und der Partei folgend, ihrer kriegswichtigen<br />
Arbeit nach. Die um sie herum zerstörte<br />
Welt nehmen sie nicht mehr voll zur Kenntnis. Und<br />
die Partei fordert immer weiter von jedem deutschen<br />
Menschen einen noch stärkeren Einsatz im<br />
Kampf für den ‚bestimmt kommenden Endsieg’. Die<br />
deutschen Menschen dürfen nur noch siegen. Das<br />
ist ihre ‚völkische patriotische Pflicht’. Denn, sollte<br />
das Volk untergehen, dann wird es nur deshalb<br />
sein, weil es nicht genug gekämpft hat.
187<br />
An dieser Stelle möchte ich: den Bildhauer, Graphiker<br />
und<br />
Schriftsteller Ernst Barlach,<br />
1870-1938,<br />
erwähnen.<br />
Ernst Barlach hat über jene unbegreiflichen Prozesse,<br />
die dazu führen, dass Menschen sich wirklich<br />
mit allem abfinden, folgendes formuliert:<br />
„Die Menschen werden sich<br />
mit den unvorstellbaren<br />
Gräueltaten, mit dem Verzicht<br />
auf das Licht zurechtfinden.<br />
Die Dunkelheit über<br />
uns wird sein, als wäre das<br />
Licht nie gewesen und sie<br />
werden sagen, was fragen<br />
wir nach Licht, fort mit Licht<br />
und Helle“.<br />
Aus dem Roman: „Der gestohlene Mond“.<br />
Mein Blick nach innen geht weiter: auf meine letzten<br />
Stunden in der Reichshauptstadt Berlin. Ich denke<br />
an den Anblick, all der Trümmer und all diese in den<br />
Himmel emporragenden Fassaden, mit den leeren<br />
Fensterhöhlen, durch die nie wieder Menschen hinausschauen<br />
werden. Wo die Sonne und der Mond<br />
ins Leere gehen. Wir müssen nur noch diesen Krieg<br />
gewinnen. Also, nur keine Sorgen machen. Wir<br />
werden alles besser aufbauen. Für die Zeit bis zum
188<br />
baldigen Endsieg kommen die kleinen Hakenkreuzfähnchen<br />
aus Papier und die Transparente auf den<br />
Trümmerschutt: „Unsere Mauern brechen, unsere<br />
Herzen nie“. Und: „Führer befiehl, wir folgen dir - -<br />
bis ins Grab“. Den Kriegstoten, den Menschen und<br />
den Papierfähnchen werden weitere Menschen und<br />
Papierfähnchen folgen. Die Fähnchen werden weiter<br />
über den Trümmern flattern, bis zu dem Zeitpunkt,<br />
wo auch sie vom Regen aufgeweicht sind.<br />
Die erschlagenen Menschen werden, wie die Fähnchen,<br />
tiefer unter dem Trümmerschutt verschwinden.<br />
Wofür stehen die Hakenkreuzfähnchen? Wann<br />
werden sie keine Papierfähnchen mehr haben?<br />
Überlebende haben an den Resten der Hauseingänge<br />
mit Kreide Mitteilungen hinterlassen. Sie geben<br />
Auskunft über das Schicksal und den Verbleib<br />
einzelner Personen und Familien, die in den zerstörten<br />
Häusern gelebt haben. Manchmal sind es<br />
mehrere Familienmitglieder, die der Bombenkrieg<br />
gemordet hat. Angehörige und Bewohner finden<br />
sich vor den Trümmern der Häuser ein, in denen sie<br />
selbst einmal gelebt haben. Sie suchen ihre Mitmenschen.<br />
Männer und Väter, die von den Fronten<br />
auf Heimaturlaub kommen, stehen vor den Trümmern<br />
ihres Lebens. Sie müssen auch teilweise den<br />
Verlust ihrer Angehörigen verkraften. Suchende<br />
Fronturlauber, die vor den Resten der Häuser stehen,<br />
in denen sie mit der Familie gelebt haben, und<br />
nun nur noch die Namen ihrer Angehörigen mit<br />
Kreide angeschrieben finden, werden die genannte<br />
Unterkunft aufsuchen. Sie hoffen darauf dort ihre<br />
Angehörigen wieder zu finden. Ihr Wunsch ist nun,<br />
dass diese Bleibe noch existiert. Da sind Soldaten<br />
die aus dem Krieg auf Urlaub kommen oder auf der
189<br />
Durchreise sind, Soldaten, die aus dem Lazarett<br />
kommen, die ihre Angehörigen finden.<br />
Andere Soldaten und Zivilisten, die ihrerseits an<br />
dem Verlust ihrer Familie, ihrer Freunde zugrunde<br />
gehen, suchen eine geeignete Möglichkeit sich zu<br />
töten. Feldgraue, die an dem Verlust zerbrechen,<br />
kehren um und fahren zurück zu ihrer Frontfamilie.<br />
Dort suchen sie zur Erlösung von der Not den Tod<br />
an der Front. Bilder und Erfahrungen haben sich in<br />
mir festgesetzt. Diese Ereignisse, die uns ständig<br />
begleiten, bedrücken mich sehr. Ich bin ein Teil des<br />
Krieges geworden. Ich werde alles mich belastende<br />
weiter verdrängen. Wohl wissend, was alles bisher<br />
geschah, stürme ich weiter. Ab Morgen mit meinen<br />
neuen Kameraden, von der Partei-Propaganda bearbeitet,<br />
marschieren wir gemeinsam in den Krieg.<br />
Während der langen Eisenbahnfahrt in dieser Nacht<br />
ist mir jedes Gefühl für Zeit und Raum abhandengekommen.<br />
Die „Aschinger-Suppe“, die ich nahe<br />
der Friedrichstraße in Berlin verzehrt habe, hat sich<br />
längst verbraucht. Mein Magen schreit lauthals: „Ich<br />
habe Hunger!“ Ich spüre plötzlich, wie sich die Geschwindigkeit<br />
des Zuges abnimmt. Daran erkenne<br />
ich jetzt aus dem leichten Schlaf und meinen Gedanken<br />
erwachend, wieder einen nahenden Bahnhof.<br />
In wenigen Augenblicken wird der D-Zug anhalten.<br />
Mit quietschenden Bremsen steht er dann, wie<br />
festgenagelt. Ich bin hellwach. Mit der Handkante<br />
wische ich die feuchten Ablagerungen von der<br />
Glasscheibe des Abteilfensters. Suchend geht mein<br />
Blick in die Dunkelheit. „Na, das würde mir jetzt<br />
noch fehlen, wenn ich mein Ziel verpasst hätte“<br />
denke ich. Ich bin plötzlich nervös. Was steht da auf<br />
dem unbeleuchteten Bahnhofsschild? - - Ist es
190<br />
Strasburg/Westpr. Hat vielleicht eine Sinnestäuschung<br />
den Namen der Zielstation - nur für mich<br />
erkennbar - aufgemalt? - - - Nein, es stimmt, ich bin<br />
da! - - Schnell raus! - - Mensch, mache hin treibe<br />
ich mich an, bevor der Zug weiterfährt. Mit einem<br />
Satz, so als hätte mich der Zug hinausgeworfen,<br />
stehe ich neben meinem Koffer, in Strasburg im<br />
Regen auf dem Bahnsteig. Da ist kein „Hurra! Ich<br />
bin in Westpreußen!“. Dieses Westpreußen ist für<br />
mich nur ein Landstrich auf der Landkarte. Dort<br />
kann ich ihn finden. Hier, am Bahnhof, sagt mir<br />
„Westpreußen“ und das mitten in der Nacht überhaupt<br />
nichts. Ich habe noch nicht einmal mitbekommen,<br />
ob mit mir noch jemand ausgestiegen ist.<br />
Ein, zwei Türen schlagen zu. Ein Pfiff, und schwerfällig<br />
bewegt sich der Zug vorwärts. Er nimmt wieder<br />
Fahrt auf. Meine Augen treffen noch einmal auf<br />
die an den Einstiegen der Waggons befindlichen<br />
kleinen blassblauen Lichter Ich stehe immer noch<br />
mit meinem knurrenden Magen, meinem Koffer auf<br />
dem Bahnsteig. Wir drei verabschieden uns nun<br />
von dem D-Zug. Ein wehmütiger Blick, als könne ich<br />
mich nicht von dem Zug trennen, folgen meine Augen<br />
den kleiner werdenden, abgedunkelten roten<br />
Lichtern des letzten Waggons. Noch einen Augenblick.<br />
Nun hat sich der Zug in der Dunkelheit und im<br />
niedergehenden Sprühregen aufgelöst. „Ach, was<br />
soll ich in denn in Königsberg?“ Hier ist mein Ziel.<br />
Mit einem Schlag hat mich die Wirklichkeit wieder.<br />
Der Regen verhindert ein ungehindertes Aufschauen.<br />
Das Bahnhofsgebäude ist nicht recht zu erkennen.<br />
Um mich herum absolute Leere. Die Außenbeleuchtung<br />
ist ausgeschaltet. Bei dem Dreckswetter<br />
und mitten in der Nacht auf diesem Bahnsteig,
191<br />
komme ich mir zum ersten Mal in meinem Leben<br />
abgemeldet und verlassen vor. Ich ziehe mit<br />
meinem Koffer los. Nach gut fünfzig Schritten stehe<br />
ich vor einer hohen doppelten Tür. „Warteraum für<br />
Reisende“ steht schwarz auf dem weißen Emailschild.<br />
Ich öffne den rechten Türflügel und betrete<br />
einen großen, abgedunkelten Raum. Meine Schritte<br />
höre ich auf den geölten Dielenbohlen. Die Stiefel<br />
hinterlassen nasse Abdrücke. Eine blassgelb wirkende<br />
Funzelbeleuchtung hängt an einer langen<br />
Leitung von der Decke herab. Die hinteren Ecken<br />
des Raumes liegen, vom Mobiliar verdeckt, im Dunkeln.<br />
Mir kommt es vor, als sei ich in einer Friedhofskapelle<br />
gelandet. Hier herrscht Grabesstille.<br />
Sind hinter dem schwarzen, samtenen Tuch Bilder?<br />
Als ich den Raum vor einigen Augenblicken betrat,<br />
hat sich sofort ein seltsamer Geruch in meiner Nase<br />
festgesetzt. Es ist eine Mischung aus Fußbodenöl,<br />
faulenden Kartoffeln und feuchtem Kalk. Als Einziger<br />
habe ich für diese Nacht hier Zuflucht gefunden.<br />
Nach und nach zeigen sich mir die Einrichtungsgegenstände.<br />
Bei der Betrachtung der Theke aus<br />
dunklem Holz. denke ich wegen der Größe an einen<br />
Fürstensarg. Allein im diesem Warteraum sitze ich<br />
an dem hölzernen, hellgescheuerten Tisch. Den<br />
metallisch glänzenden Rand der Theke nehmen<br />
meine Augen zur Kenntnis. Sie umarmen anschließend<br />
den in der Ecke stehenden runden, gusseisernen<br />
Ofen. Er präsentiert sich in seiner ganzen<br />
Schönheit und Größe. Das leicht geknickte Ofenrohr,<br />
das hinter der jetzt kalten Wärmequelle angebracht<br />
ist, zeigt wie ein riesiger schwarzer Zeigefinger<br />
fast senkrecht in die Höhe. Das Rohr hält sich<br />
an der getünchten Wand fest. Mich friert beim An-
192<br />
blick des Ofens. Was soll es, es ist Krieg, da macht<br />
es doch nichts aus, wenn man eine Nacht ohne<br />
Wärme verbringt. Selbst eine Mehrzahl von kalten<br />
Nächten würde mir nichts bedeuten. Diese Tatsache<br />
erinnert mich sofort an meine Luftwaffenhelferzeit,<br />
damals im Lager bei Immendorf. Die Müdigkeit<br />
lässt alle Gedanken an den Wärmespender absterben.<br />
An meinem Holztisch bleibe ich sitzen. Den<br />
Kopf habe ich auf die Unterarme gelegt. Ich schlafe<br />
endlich in meinen klammen Sachen ein. Von Zeit zu<br />
Zeit wache ich nur deshalb auf, weil mir die Arme<br />
eingeschlafen sind. Nur mein vor Hunger grollender<br />
Magen begleitet meinen Schlaf. „Es gibt nichts zu<br />
essen“. - Mit dem Gedanken: Hoffentlich löscht<br />
niemand das Licht, falle ich in einen bleischweren<br />
Schlaf. Doch nach Minuten, so scheint es mir, bin<br />
ich wieder hellwach. Kommt da vielleicht noch ein<br />
späterer Zug in der Nacht? Oder erst gegen Morgen?<br />
Mit der Hoffnung, auf dem richtigen Bahnhof<br />
gelandet zu sein, schlafe ich dann zwischendurch<br />
wieder ein. Draußen wütet der Regen ohne Pause.<br />
Später weckt mich ein Bediensteter der Reichsbahn.<br />
Leicht gerädert, aber schon wieder hellwach,<br />
springe ich auf, schnappe meinen Koffer und treffe<br />
auf dem Bahnsteig einige junge Männer die wohl<br />
gerade mit dem Zug angekommen sind. Na, Gott<br />
sei Dank, diese Nacht hat ja nur ein paar Stunden<br />
gedauert. Ohne „Großen Bahnhof“ werden wir von<br />
einem Uniformierten unserer Truppe auf einem<br />
Fahrzeug in Marsch gesetzt und kommen noch am<br />
späten Vormittag, kurz vor Einbruch der erneuten<br />
Dunkelheit, im Lager an. Für mich ist es an diesem<br />
Tag nicht richtig hell geworden. Sicher liegt es an<br />
der Jahreszeit und an der Ortslage im Osten. Mit
193<br />
Stacheldraht umzäuntes Gelände wird von mehreren<br />
Doppelposten bewacht.<br />
Der Dauerregen arbeitet immer noch kräftig. Den<br />
Rest des Weges marschieren wir durch knöcheltief<br />
schlammigen Untergrund. Mit dem Dreck an den<br />
Stiefeln betreten wir eine neue Baracke. Sie ist kalt<br />
und feucht. Es riecht nach frischem Holz und nach<br />
Bittermandelöl. Aus Mangel an Sitzgelegenheiten<br />
setzen wir uns auf geschlossene graue Holzkisten.<br />
Nun warten wir, wie gelernt, geduldig wie Schafe,<br />
auf die Verpflegung. Werden wir heute noch eingekleidet?<br />
Wo haben die hier ihre Kleiderkammer? Ist<br />
dieser große Raum mit den gestapelten Kisten unsere<br />
Unterkunft? Wo werden wir schlafen? Wir<br />
müssen feststellen, dass es mit der Einkleidung<br />
heute nichts wird. Hier ist überhaupt kein Betrieb.<br />
Mit uns, den Figuren in Zivil, kann man gar nichts<br />
anfangen. Wir stammen, der Gedanke entwickelt<br />
sich so nach und nach, sicher aus einer Fehlbestellung,<br />
und wir sind nun die Fehlsendung. Es dauert<br />
noch lange, dann erhalten wir Essen und Trinken.<br />
Wir sitzen und jeder erhält zum Kommissbrot eine<br />
dicke Scheibe Jagdwurst und einen Becher mit lauwarmem<br />
Malzkaffee. Die dicke Scheibe Jagdwurst<br />
trocknet vor unseren Augen ein. Fragen von uns<br />
kommen keine. Was sollten wir und wen können wir<br />
fragen? Wir haben doch nur zu Antworten. Es<br />
herrscht allgemeine Funkstille Diese erste Nacht<br />
verbringen wir in der Baracke. Wir sitzen weiter auf<br />
den mit Schießpulver gefüllten Kisten. Heute, wo ich<br />
noch einmal den Text überarbeite, stelle ich fest,<br />
dass es bereits damals Verbindungen zu dem<br />
Schiesspulver gegeben hat. Das Schießpulver war<br />
für uns das kommende Kanonenfutter bestimmt.
194<br />
Unseren Aufenthalt, in diesem von aller Welt verlassenen<br />
Lager, haben wir uns ganz anders<br />
vorgestellt. Unsere Erwartungen, haben wir viel zu<br />
hoch angesetzt. Die Soldaten im Lager Rippin, würden<br />
sich auf uns angehende Soldaten freuen. Wir<br />
sind doch gekommen, so war der Gedanke, um mit<br />
ihnen nach unserer Ausbildung endlich in den Krieg<br />
zu kommen. An die Front! Was sollen wir später<br />
berichten, wenn wir hier nur in der Baracke sitzen.<br />
Doch die Annahme war bereits im Ansatz falsch.<br />
Wir machen den Kameraden, die hier ihren Dienst<br />
leisten, nur zusätzliche Arbeit. Sie nehmen uns<br />
noch nicht einmal zur Kenntnis. Welch eine Ernüchterung<br />
macht sich in diesen Stunden in mir breit.<br />
Außerhalb des eingezäunten Lagers sehen wir gelegentlich<br />
Soldaten. Sie sind immer zu zweit unterwegs.<br />
Über dem Mantel tragen sie geschultert das<br />
Gewehr, den Stahlhelm auf dem Kopf und je zwei<br />
Stielhandgranaten zwischen dem Mantel und Koppel.<br />
Nur durch die geschlossenen Fenster können<br />
wir unsere Beobachtungen machen. Wir kommen<br />
nicht vor die Tür. Das heißt: wir sind in der Baracke<br />
selbst nur festgesetzte Zivilisten. Voll Stumpfsinn,<br />
Leere und Langeweile vergehen die Stunden, Tage<br />
und Nächte. Hier lernen wir die „Hohe Schule“ des<br />
Soldatenlebens kennen: Es ist das Warten! Wie<br />
heißt es doch: „Die längste Zeit des Lebens wartet<br />
der Soldat vergebens“. Früher habe ich diesen<br />
Ausdruck als einen Spaß angesehen, heute spüre<br />
ich die Wahrheit. Draußen herrscht Sauwetter! An<br />
die einzelnen Uhrzeiten für unsere Versorgung mit<br />
der Nahrung und Getränken kann ich mich nicht<br />
mehr erinnern. Mir erscheint es, als läuft die Versorgung<br />
regelmäßig. Es fehlt mir die Erinnerung, ob
195<br />
wir in den Tagen eine ordentliche Waschmöglichkeit<br />
benutzen konnten. Selbst an die beim Militär<br />
vorhandene Latrine erinnere ich mich nicht. Unser<br />
Gepäck steht immer noch ungeöffnet an der Stelle,<br />
an der wir sie nach unserer Ankunft abgestellt haben.<br />
Unsere Kleidung ist über die Tage und Nächte<br />
längst am Körper getrocknet. Beim nächsten Regen,<br />
der auch für uns kommt wird sich die Kleidung<br />
wieder dehnen. Mein Anzug ist wie die allgemeine<br />
Kleidung eine echte Kriegsausgabe! Die früher üblichen<br />
Stoffe, gibt es nicht mehr. In den Kriegsjahren<br />
kommen nach und nach Stoffe zur Verarbeitung, die<br />
im allgemeinen Sprachgebrauch, aus „Kartoffelkraut“<br />
hergestellt werden. Jedenfalls war die am<br />
Körper getrocknete Kleidung geschrumpft. So enden<br />
die Ärmel der Jacke fast am Ellenbogen und<br />
die Hosen haben Hochwasser. Mit Erkältungen,<br />
Halsschmerzen und Schnupfen haben wir dank der<br />
Spritzen keine Probleme. Das kennen wir nicht.<br />
Nach etwa vier Tagen werden wir ohne jede Ankündigung,<br />
wieder mit unserem Gepäck in Marsch<br />
gesetzt. Ohne eine Erklärung, wohin es gehen wird,<br />
bringt uns ein Befehl unserer Einheit wieder in Bewegung.<br />
Mit einem LKW und später zu Fuß geht es<br />
weiter. Kommen wir vielleicht, an einen noch trostloseren<br />
Ort, als an den vorigen? Vielleicht können<br />
wir das Warten woanders noch besser lernen. Wir<br />
verlassen im Regen den Ort der grenzenlosen Öde.<br />
Völlig von der Umwelt abgekapselt, haben wir die<br />
Tage und Nächte wie „Sträflinge“ abgesessen. Ich<br />
blicke nicht zurück. Unser gemeinsames Ziel für<br />
heute ist ein von den Militärs willkürlich festgelegter<br />
Haltepunkt ohne Bahnsteig, irgendwo an einer Eisenbahnlinie.<br />
Auf keiner Landkarte ist diese Stelle
196<br />
als „Haltestelle“ vermerkt. Wir noch Zivilisten erreichen<br />
zu Fuß die vorgesehene Stelle am doppelten<br />
Schienenstrang. Das Erlebnis und die Erfahrungen<br />
mit „Rippin“ in Westpreußen, vergessen wir ganz<br />
schnell. Auf der mannshohen Böschung und einer<br />
aufgehäuften Schotterunterlage liegen Holzschwellen,<br />
die den doppelten Schienenstrang tragen. Vor<br />
uns liegen, etwa in Augenhöhe die Gleispaare. Ich<br />
sehe auf die Köpfe der Schwellen. Nach einer Weile<br />
erkenne ich, die vom Regen glänzenden S-förmigen<br />
Klammern, die in die Stirnseiten der Schwellen eingeschlagen<br />
sind. An diesen S-Klammern halten sich<br />
meine Augen fest. Die S-Klammern ziehen mich in<br />
ihren Bann. Ich fühle, wie sie mich anblinzeln. Sie<br />
scheinen mich zu fragen: ‚Was suchst du hier? - - -<br />
Hau bloß ab! - - Wir wollen schlafen’. Stumpf und<br />
wortlos warten wir. An einem langsam lauter werdenden,<br />
schnurrenden Rollgeräusch eiserner Räder<br />
erkennen wir, dass ein Zug kommt. Der feine Dauerregen<br />
hat nach einer kurzen Pause, seine Tätigkeit<br />
wieder voll aufgenommen. Zögerlich trudelt der<br />
Zug heran und bleibt mit lautem Quietschen stehen.<br />
Die Lokomotive schnauft und die Speisewasserpumpe,<br />
sie gehört zum Dampfkessel, gibt einen<br />
gleichbleibenden Takt an. Wie von Geisterhand gesteuert,<br />
werden von innen nacheinander zwei Waggontüren<br />
geöffnet. Die Waggons müssen mit Menschen<br />
und ihrem Gepäck überfüllt sein, denn man<br />
kann von außen ihre Füße sehen. Und da sollen wir<br />
auch noch einsteigen? - - - „Steigen Sie ein und<br />
halten Sie den Eisenbahnbetrieb nicht auf“, überschlägt<br />
sich eine schnarrende Militärstimme, von<br />
den Soldaten, die uns hierher begleitet haben. Der<br />
Einstieg wird außerordentlich schwierig. Jeder von
197<br />
uns Zivilisten ist gezwungen, die Böschung und den<br />
schräg ansteigenden Schotterunterbau<br />
des Gleiskörpers zu überwinden. Mit großer Anstrengung<br />
erreiche ich mit einer Hand die erste Stufe<br />
des Einstiegs. Über die drei Stufen am Ein- und<br />
Ausstieg, zieht sich jeder nach und nach, das Gepäck<br />
vor sich herschiebend, abwechselnd mit der<br />
einen und der anderen Hand empor. Nach einigem<br />
Knurren haben wir es endlich geschafft. Wir dringen<br />
als Fremdlinge in den Transportzug ein und sind im<br />
Waggoninneren angekommen. Wir haben die vor<br />
uns stehenden Menschen weiter in die Enge gedrückt.<br />
Der letzte Absatz des Stiefels eines Kameraden<br />
ist noch fast draußen, da wird die Tür von<br />
außen mit voller Wucht zugeschlagen. Der mit einem<br />
Schlag nach oben springende Bügel der<br />
Schließeinrichtung landet, wegen des fehlenden<br />
Schutzbügels, mit einem heftigen Schlag in seinem<br />
Rücken. Und das nur, weil er nicht schnell genug im<br />
Waggon war. Den heftigen Schmerz des kraftvollen<br />
Schlags kommentiert er mit ‚Verdammte Sch.....’<br />
Und von draußen höre ich noch: ‚Na, die sind wir<br />
nun endlich wieder los’. Welch ein Stumpfsinn! Wären<br />
denn die Kameraden, die wir hier zurück lassen,<br />
nicht lieber mit uns mitgefahren? Wer weiß das<br />
schon. Ich denke: bei den älteren Soldaten, die hier<br />
mit uns zur Haltestelle gekommen sind, kommen<br />
die gleichen Anzeichen nach innerer Ablehnung.<br />
Genauso, wie bei den älteren Munitionskanonieren,<br />
damals an der „AchtAcht“. Nach meiner Ansicht<br />
kann die bei den Soldaten übliche Verblödung wohl<br />
kaum noch gesteigert werden. Mein Empfinden wird<br />
dabei noch von dem dauernden Regen und der<br />
Vorwinterlichen Zeit gestärkt. Was werden die Män-
198<br />
ner dieser Einheit in Rippin machen, wenn die Sowjets<br />
ihren Vormarsch in Richtung Westen<br />
vorantreiben? Der Zug rollt weiter. Dass er rollt, das<br />
habe ich wirklich gar nicht mehr mitbekommen. Zunächst<br />
sind wir damit beschäftigt, Platz für uns und<br />
unser Gepäck zu organisieren. Auf dem verdreckten<br />
Fußboden, im schmalen Seitengang des Waggons,<br />
schieben, heben und drücken wir unsere Gepäckstücke.<br />
Na endlich, wir fallen auf und zwischen<br />
sie. An Schlaf ist nicht zu denken. Erst vor sich hin<br />
dämmern, dann wegen Übermüdung und vor Hunger<br />
einschlafen. Mit unserer immer noch feuchten<br />
Kleidung nehmen wir die kleinen Wasserlachen unserer<br />
Gepäckstücke vom Fußboden auf. Zu den<br />
Toiletten und den Waschmöglichkeiten, gibt es keinen<br />
Zutritt. Diese kleinen Räume sind, wie wir durch<br />
die geöffnete Tür erkennen, bis zur Decke mit Reisegepäck<br />
und Ausrüstungsgegenständen vollgestopft.<br />
Und keiner der Anwesenden Wehrmachtsangehörigen<br />
wird in der Nacht von seinem Sitzplatz<br />
aufstehen. Sie warten nun nicht mehr ungeduldig<br />
auf das Ziel der Reise. Sie haben sich eingerichtet.<br />
Sie sitzen alle völlig bewegungslos auf ihren erkämpften<br />
Sitzplätzen. Keiner spürt die Beckenknochen<br />
des Nachbarn. Daran haben sie sich auch<br />
schon lange gewöhnt. Sie schwitzen das Wasser<br />
aus ihren Körpern buchstäblich durch die Rippen.<br />
Der Zug rollt weiter durch die Nacht. Über Posen<br />
erreichen wir Frankfurt/Oder. Jetzt steht es wohl<br />
fest. Wir fahren nach Berlin. Es wird bis zu unserem<br />
Ziel noch eine beachtliche Strecke sein. Gott sei<br />
Dank sind die Fenster dicht. Von wegen: „Warmer<br />
Mief ist besser als kalter Ozon“. Und: „Es ist schon<br />
manch einer erfroren aber noch keiner erstunken“.
199<br />
Wenn sie im Zug das gleiche Schicksal haben, so<br />
eng eingepfercht sitzen müssen, dann können sie<br />
auch gemeinsam die immer wieder genutzte Atemluft<br />
teilen. Nach meiner Ansicht gibt es für diese<br />
allgemein eingesetzten Ausdrücke überzeugende<br />
Gründe. Je nach Jahreszeit verhalten sich die Soldaten<br />
entsprechend den herrschenden Wetterverhältnissen.<br />
Bei Kälte hocken sie einfach dichter zusammen.<br />
Sie suchen die Nähe zu dem Kameraden<br />
wegen der Kälte. In den übrigen Zeiten hocken sie<br />
in lockerer Form zusammen. Draußen peitscht der<br />
Regen gegen die von der Nacht ausgefüllten und<br />
geschlossenen Waggonfenster. Verdunklungen sind<br />
nicht vorhanden. Vorhänge in den Abteilen, sofern<br />
man die Stoffreste als solche bezeichnen kann, sind<br />
zugezogen. Es gibt kein Licht. Wo kommen bloß all<br />
die Soldaten her? Ihre vollgestopften Rucksäcke,<br />
hängen von der Decke oder stapeln sich über ihnen<br />
in den Gepäcknetzen bis zur Decke. Ich werde es<br />
nicht erfahren, woher der Zug kommt. Ich frage<br />
nicht. Für die Männer ist es nur wichtig, ungestört<br />
gerollt zu werden. Erst am Zielbahnhof, wo immer<br />
der sein wird, werden die während der Fahrt ausdruckslosen<br />
Menschen langsam zu einer gewissen<br />
Normalität zurückkehren. Diese schlafende, gesichtslose<br />
Masse Mensch wabert und schaukelt im<br />
gleichen Rhythmus, genauso, wie die Räder sich<br />
unter den Waggons an den Achsen der Drehgestelle<br />
drehen. Die rollenden Räder, ihre Sprünge über<br />
die paarweise angeordneten Schienenstöße, rütteln<br />
und schütteln uns ohne jedes Zartgefühl hart durch.<br />
Ich glaube, dass wir am Ende dieser Nachtfahrt völlig<br />
gerädert, mit abgewetzten blanken Nervenenden<br />
am Ziel ankommen werden. Durch die geöffnete
200<br />
Abteiltür, die sich nahe an meinem Kopf befindet,<br />
kann ich meine Umgebung gut erkennen. Mit der<br />
Dauer des Krieges zeigt sich auch hier die unbarmherzige<br />
Wirkung einer mangelnden Versorgung der<br />
Menschen mit Nahrungsmitteln. Es betrifft seit Beginn<br />
des Krieges, seit September 1939, alle Wehrmachtsangehörigen<br />
die durch den Krieg hin und her<br />
pendeln. Denke ich nur an die langen Strecken die<br />
mit der Eisenbahn bewältigt werden. Von den verschiedenen<br />
Fronten im Westen und dann im Osten.<br />
Keineswegs dürfen die Truppenteile, die in Nordeuropa,<br />
bis nach Nordnorwegen und Finnland und die<br />
im Süden, in Italien eingesetzt sind vergessen werden.<br />
Jetzt schreiben wir das Jahr 1944 und etwa<br />
den 10. Tag des Monats Oktober. Durstig, hungrig<br />
und verdreckt, in der Zivilkleidung, die über Nacht<br />
wieder an unseren Körpern getrocknet sind, fahre<br />
ich mit den jungen Männern im gleichen Zug auf<br />
Kosten des Militärs und der Allgemeinheit durch die<br />
Gegend. Mein Geruchssinn ist mir in der Zeit von<br />
dem Einsatz als Luftwaffenhelfer im Januar 1944<br />
bis jetzt so gut wie abhandengekommen. Wahrnehme<br />
ich nur noch den Geruch der Erde, von<br />
brennenden und qualmenden Gegenständen und<br />
den Gestank der Verwesung, der Zersetzung, der<br />
Fäulnis wahr. Waren da sonst noch andere Gerüche?<br />
Mir stellt sich zum Beispiel die Frage nicht,<br />
wann und wo ich mich in den letzten Tagen habe<br />
waschen können. Ich erinnere mich nicht an eine<br />
ordentliche Wasserstelle in Rippin / in Westpreußen.<br />
Hat es da überhaupt sanitäre Anlagen gegeben?<br />
Selbst wenn es all diese Einrichtungen gegeben<br />
haben sollte, dann habe ich sie vollkommen<br />
vergessen. Von sowjetischen Schlachtfliegern blei-
201<br />
ben wir bei dem Sauwetter sicher verschont. Trotz<br />
aller Widrigkeiten der letzten Tage und dieser Nacht<br />
erreichen wir am frühen Morgen Berlin. „Alles aussteigen,<br />
der Zug endet hier!“. Alles funktioniert wie<br />
einstudiert. Einige der Landser holen aus ihren<br />
Rucksäcken den zusammengerollten Mantel heraus<br />
und ziehen ihn über die Uniform. Den Rucksack<br />
nehmen sie auf und marschieren zum Bahnhof hinaus.<br />
Ich sehe, die Soldaten sind nur vereinzelt in<br />
Gruppen erkennbar. Die große Zahl von ihnen verschwindet<br />
allein in der Masse. In dieser Kleiderordnung<br />
erscheinen Frontsol daten seit einiger Zeit im<br />
Straßenbild. ‚Das sieht ungepflegt aus, es ist eine<br />
Schande, dass die Männer so rumlaufen’ müssen.<br />
Selbst in dieser schweren Zeit, finden sich noch<br />
Menschen, die nach Ordnung verlangen. Diese und<br />
vergleichbare Bemerkungen, die Landser hören so<br />
etwas nicht. Anmerken will ich eine Begegnung an<br />
einem U-Bahnhof. Auf den Treppenstufen zu einer<br />
U-Bahnstation in Berlin, sah ich einen Soldaten, der<br />
mit einem zerknitterten Mantel bekleidet, seinen<br />
schweren Rucksack ordentlich auf dem Rücken von<br />
einem Offizier angehalten wurde. Der Fronturlauber<br />
hat den Offizier nicht gegrüßt. Der in seiner sauberen<br />
Offiziers-Uniform Gekleidete machte auf der<br />
Stufe kehrt und forderte den Soldaten lautstark auf,<br />
ihn ordentlich zu grüßen. Die heftige Reaktion des<br />
Soldaten hat den Offizier blass werden lassen. Anwesenden<br />
Zivilisten zeigten sich, schweigend, vom<br />
Mut des Soldaten beeindruckt. Der akkurate Offizier<br />
hat den Frontsoldaten laufen lassen. Was die Männer,<br />
die von irgendeiner Front auf Urlaub kommen,<br />
treibt, ist der Wunsch ihre Familienangehörigen<br />
wieder in die Arme zu nehmen. Wir sind nun auf
202<br />
dem Wege zu unserer Kaserne in Reinickendorf –<br />
Ost. An alten und frischen Trümmern gehen wir<br />
vorbei. Wie sieht es mit der U-Bahn aus? Die U-<br />
Bahn fährt nur eingeschränkt nur auf einigen Strecken.<br />
Mit der S-Bahn? Und wie ist es mit der Straßenbahn?<br />
Ohne Oberleitungen? ‚Das kannste alles<br />
vergessen. Da geht wohl kaum etwas’. Auf beiden<br />
Seiten der Straßen liegen frische Trümmer, und<br />
auch eine vor einigen Minuten auf die Straße herabgestürzte<br />
Hausfront. Der Staub wird noch eine<br />
lange Zeit über dieser Stelle liegen. Der eine oder<br />
andere Straßenbahnzug liegt umgestürzt, ausgebrannt<br />
oder zertrümmert auf oder neben den Schienen.<br />
An vielen Stellen sind die Menschen mit Aufräumungsarbeiten<br />
beschäftigt. Sie schaufeln den<br />
Schutt der zerbombten Häuser von den Straßen in<br />
die Hausreste. Selbst mit Besen versuchen sie<br />
Grund in die Unordnung zu bringen. Seit meiner<br />
Abreise vor einigen Tagen hat sich hier nichts geändert.<br />
Beim Anblick der frischen Trümmerberge, ist<br />
es wohl doch nicht so gut, wieder hierher, nach Berlin<br />
zu kommen. Wir sind auf Befehl einfach wieder<br />
hier. In der Ferne, in Rippin, da sehnte ich mich<br />
nach Berlin. Nach Berlin, das sich über die langen<br />
Kriegsjahre grundlegend verändert hat, nach der<br />
Stadt, zu der ich mich immer hingezogen fühle. Berlin,<br />
ich bin heute zurückgekommen! In Erinnerung<br />
bleiben wird in mir aber nichts anderes von Berlin,<br />
als das Berlin, das ich noch als Junge kennen gelernt<br />
habe. Nur so kann ich Berlin in meinem Herzen<br />
behalten. Gegenwärtig, wo ich das ganze Elend<br />
vor Augen habe, da sind meine Gefühle für diese<br />
Stadt stark belastet. All meine Liebe zu Berlin ist<br />
vom ‚Heute’, wir sind im Oktober 1944, aufgefres-
203<br />
sen worden. Die Wirklichkeit verfolgt jeden von uns<br />
ständig mit dem Bombenkrieg, mit dem Tod und<br />
den Trümmern. Auch ich kann dieser Wirklichkeit<br />
nicht entfliehen. In der Hoffnung, bald eine Mahlzeit<br />
zu erhalten, meldet sich bei mir der Magen mit heftigem<br />
Knurren. Es war ein langer Weg vom Ankunftsbahnhof<br />
bis zum Haupteingang unserer Kaserne.<br />
Jeder von uns Zivilisten sucht für sich, er ist<br />
ja zum Einzelkämpfer erzogen worden, seinen Weg<br />
zur Hauptwache der ‚HG-Kaserne’. Denn jeder hat<br />
von uns den Ehrgeiz dort als erster anzukommen.<br />
Meine Annahme, dass wir nun hier am Stammsitz<br />
der ‚Division Hermann Göring’ freundlich empfangen<br />
werden, war bereits beim Anblick der Wachmannschaft<br />
verschwunden. Auch hier sind wir nur<br />
Zivilisten. Doch irgendwie, ich kann es nicht beschreiben,<br />
machen sie uns Mut. ‚Wenn Sie erst<br />
einmal von den Ausbildern spanlos umgeformt worden<br />
sind, dann werden Sie Soldaten sein’. Wir, sind<br />
es vier oder sind es sechs junge Männer, die auf<br />
dem Umweg über Rippin hier ankommen, marschieren<br />
nun, von einem Unteroffizier begleitet durch ein<br />
gepflegtes, parkähnliches Anwesen. Die Kasernenanlage<br />
scheint riesig zu sein. Wir kommen an zweigeschossigen<br />
Gebäuden vorbei, die einen hellen<br />
Außenanstrich haben. Die Häuser stehen zwischen<br />
Kieferngruppen. Welch ein Kontrast zu dem Aufenthalt<br />
im Lager Rippin / Westpreußen. Eingefasst sind<br />
auch hier, wie beim Reichsarbeitsdienst, die Gebäude<br />
von gepflegten Rasenflächen. Die makellosen<br />
Asphaltstraßen und die geharkten Wege machen<br />
den Eindruck tiefen Friedens. ‚Hier ist es, als<br />
sei Frieden’, stelle ich fest. Die vergangenen Tage,<br />
auch die Trümmer in Berlin verschwinden auf ein-
204<br />
mal aus meinen Gedanken. Die in Augenblicken<br />
wieder gefundene positive Grundeinstellung nun<br />
endlich in die gewünschte Uniform zukommen wird<br />
von der hier herrschenden Ordnung unterstützt und<br />
verstärkt. Weit hinter diesen modernen Gebäuden<br />
stehen am Ende des beachtlichen Geländes, viergeschossige<br />
Bauten für die Rekruten. Diese Gebäude<br />
hinterlassen bei uns, die wir aus Rippin hier<br />
angekommen sind einen starken Eindruck. In meiner<br />
Erinnerung habe ich alte Kasernen mehrstöckige<br />
rote Ziegelsteinbauten. Wir Zivilisten sind nach<br />
der Auffassung des Militärs, junge Männer, die noch<br />
nicht richtig marschieren können. Deshalb heißt es<br />
bei den Ausbildern: ‚Die Rekruten müssen richtig<br />
ans Laufen gebracht werden’. Hier, in dieser Kaserne,<br />
werden wir in einem Umformprozess vom Zivilisten<br />
zum Soldaten gemacht. In einem Teil des Rekrutenblocks<br />
werden wir, mit den anderen heute<br />
eintreffenden jungen Männern, die Anzahl ist mir<br />
nicht bekannt, ich schätze wir sind zusammen etwa<br />
Einhundertzwanzig bis Einhundertfünfzig Mann in<br />
den Militärdienst übernommen. Mir ist die Zusammenführung<br />
aller angehenden Rekruten nicht aufgefallen.<br />
Nach der beim Militärdienst üblichen Registrierung<br />
und der Einkleidung jungen Männer, treten<br />
alle auf der Rückseite des Rekrutenblocks im weißen<br />
Drillichzeug an. Es folgt die Aufstellung der<br />
Kompanie. Angetreten in drei Reihen stehen wir<br />
„Neuen“ ungeordnet und warten. Wir werden namentlich<br />
aufgerufen. Jede einzelne Gruppe besteht<br />
aus 10 Rekruten, dem Unteroffizier als Gruppenführer<br />
und aus seinem Stellvertreter, einem Gefreiten.<br />
Nach Aufruf des zehnten Mannes übernimmt der<br />
namentlich aufgerufene Unteroffizier mit seinem
205<br />
Stellvertreter seine Gruppe. Während der Wartezeit<br />
haben wir, die angehenden Rekruten, die<br />
Unteroffiziere in Ruhe anschauen können. „Na klar“,<br />
genau diesen Unteroffizier, der unsere Gruppe<br />
übernimmt und seinen Stellvertreter, den Gefreiten,<br />
von denen beiden wollte ich keinen für unsere<br />
Gruppe. Ich denke: ‚Wo kommen die bloß her?<br />
Ausgerechnet diese beiden Typen haben wir nun<br />
am Hals’. Ob mir ein anderer Unteroffizier besser<br />
gefallen hätte? Das kann ich nicht sagen. Sicher<br />
wäre ich auch da voreingenommen gewesen.<br />
Kommt unser Unteroffizier, der Gruppenführer vielleicht<br />
aus Ostpreußen? Diese Frage stellt sich sofort,<br />
denn schon früher waren beim Militär die Gruppenführer<br />
Männer, die am lautesten brüllen. Man<br />
sagt ihnen nach, dass sie den richtigen Ton für die<br />
Behandlung der Rindviecher haben. Somit sind sie<br />
bestens geeignet mit uns jungen Rekruten umzugehen.<br />
Auf Kommando steht in Windeseile die Kompanie<br />
mit den drei Zügen und den Gruppen vor dem<br />
Spieß angetreten. Der Spieß, Hauptfeldwebel, ‚Mutter<br />
der Kompanie’, brüllt wie von ihm erwartet, seine<br />
Kommandos. „Kompanie - - still gestanden. - - richt<br />
- - euch, - - -Augen - - gerade - aus. Zur Meldung an<br />
- - „die Augen- - links’ Es folgt die Meldung an den<br />
Kompaniechef. Dieser sieht zum ersten Mal seine<br />
Kompanie. Nach der Begrüßung übernimmt der<br />
Spieß die Kompanie. Den Namen des Unteroffiziers,<br />
unserer Gruppe, habe ich vergessen.<br />
Jedoch den Namen des Gruppenführer-<br />
Stellvertreter, den kleinen‘, Dackelbeinigen Gefreiten,<br />
den werde ich nie vergessen. - An dieser Stelle<br />
muss ich einmal über diesen Mann lästern. Es ist<br />
keine Diskriminierung der Person. -Es ist der Gefrei-
206<br />
ter Neuf. Er kommt aus Saarbrücken. Ein richtiges<br />
kleines Ekelpaket. Wir nennen ihn wegen seiner<br />
Körpergröße ‚Mündungsschoner’. Am nächsten<br />
Morgen werden wir von unserem Spieß, vor dem<br />
Morgenappell mit den Worten „Guten Morgen, Amateurfosen“<br />
begrüßt. Diese Begrüßungsformel empfinde<br />
ich als eine Aussage des Spießes, der uns<br />
jungen Rekruten damit sagen will, dass er der<br />
Spieß ist. Und das wir mit unseren Problemen immer<br />
zu ihm kommen können. Weiter will er damit für<br />
alle Zeiten in unsere Herzen einmarschieren. Bei<br />
mir hat er sich festgesetzt. Mit diesem Ruf hat er<br />
sich als ‚Mutter und gleichzeitig als Vater’ idealisiert.<br />
Alle unsere derzeitigen Vorgesetzten, vom Gruppenführerstellvertreter<br />
bis einschließlich des Kompaniechefs,<br />
den Oberleutnant, sind ausschließlich<br />
für unsere Ausbildung zuständig. Sie sind, wie wir<br />
erfahren und gelernt haben „Ausbilder“. Auf sie allein<br />
wird es ankommen, wie gut wir unsere Lektionen<br />
lernen. Und wie es in der ‚Heeresdienstvorschrift’,<br />
wir bei der Luftwaffe, werden den gleichen<br />
Text haben, geschrieben steht: Wir werden eine<br />
harte Ausbildung erhalten. Die Ausbilder haben die<br />
lautesten Stimmen. Keiner von Ihnen hat Fronterfahrung.<br />
Nach Abschluss und Abnahme der fertig<br />
ausgebildeten Truppe, werden wir dann unsere<br />
fronterfahrenen Vorgesetzten erhalten. Diese Information<br />
haben wir so nebenbei während einer Unterrichtsstunde<br />
erhalten. Die dann aufzustellenden<br />
einzelnen Gruppen werden aus Frontsoldaten und<br />
uns jungen Soldaten neu gebildet. Die Kameraden<br />
mit der Fronterfahrung befinden sich zur Zeit als<br />
Verwundete oder als Kranke in Lazaretten. Dass
207<br />
unser Bataillon niemals fronterfahrene Soldaten<br />
erhalten wird, ist uns gegenüber nie geäußert<br />
worden. Von der Waffenkammer erhält jeder Rekrut<br />
sein Gewehr, einen Karabiner 98 k. Mit Platzpatronen<br />
werden wir unsere Schießausbildung auf dem<br />
Übungsgelände durchführen. Für eine „qualifizierte<br />
und hervorragende“ Ausbildung der Rekruten erhalten<br />
unsere Ausbilder von Zeit zu Zeit, doch sehr<br />
vereinzelt, Kriegsverdienstkreuze - Zweiter Klasse,<br />
ohne Schwerter. Die Chefausbilder überreichen die<br />
Auszeichnungen anlässlich eines besonderen Appells.<br />
Wer eine derartige Auszeichnung erhält, trägt<br />
diese mit großem Stolz. So, als sei es das ‚Ritterkreuz’.<br />
Der Gefreite Neuf. aus Saarbrücken, betreut<br />
uns weiter militärisch. Zusätzlich ist er für den Post<br />
ein- und - Ausgang der Rekruten der Gruppe zuständig.<br />
Bevor er einem Soldaten aus der Gruppe<br />
die Post aushändigt, lässt er ihn je nach Lust und<br />
Laune zwanzig oder fünfzig Liegestütze machen.<br />
Auch bei ihm steht der gebrüllte Ton an erster Stelle.<br />
Ich erinnere mich: Während der ersten beiden<br />
Wochen bekomme ich von meiner Mutter etwa<br />
zweimal in der Woche ein Paket mit einem großen<br />
Quarkstollen. Diese besondere Behandlung eines<br />
Rekruten mag der Mündungsschoner gar nicht. Der<br />
Inhalt jedes Paketes wird brüderlich in der Gruppe<br />
geteilt. Wegen der militärischen Kommando- und<br />
Befehlsstruktur, wir sind als Rekruten noch in der<br />
Grundausbildung, habe ich ihn nicht an der Verteilung<br />
meiner „Zuckerstücke“ teilnehmen lassen. Ich<br />
kann sogar wegen des Versuches, einen Vorgesetzten<br />
zu bestechen, Ärger bekommen. Ich empfinde<br />
es seit unserer ersten Kontaktaufnahme, dass<br />
er mich besonders tief in sein Herz geschlossen
208<br />
hat. Während unserer Ausbildung kann er unsere<br />
Gruppe nach seiner Lust attackieren. Ich denke, wir<br />
sind ihm alle viel zu lang geraten. Sind wir mit unserem<br />
ersten Zug auf dem Marsch, dann bilden die<br />
drei Stellvertreter der Gruppenführer des Zuges<br />
immer das Schlusslicht. Das heißt, wenn wir unsere<br />
Schrittlänge um wenige Zentimeter verlängern,<br />
dann muss der Gefreite Neuf. bei seiner Körperlänge<br />
„Riesenschritte“ machen.<br />
*’Lästern über etwas’ gehörte auch während des Zweiten Weltkrieges zum<br />
festen Bestandteil des Soldatenlebens. Mit der Lästerei konnte man den<br />
Druck des harten Dienstes über das geöffnete Ventil ‚Lästern und meckern’<br />
verbal herauslassen.<br />
Die Ausbildung beim Reichsarbeitsdienst war in den<br />
Grundzügen mit der Grundausbildung bei HG vergleichbar.<br />
Eine zweite oder dritte Grundausbildung<br />
wurde wohl immer deshalb erforderlich, weil keine<br />
Ausbildung so gut und erfolgreich sein kann, wie<br />
die, die gerade durchgeführt wird.<br />
HG = Hermann – Göring.<br />
Das Militär lässt keinerlei persönliche Bindungen<br />
zwischen den Soldaten zu. Außerhalb der Kasernenmauer<br />
liegt an einem Fußweg eine parallel verlaufende<br />
Straße. Dahinter stehen hohe Kiefern. Sie<br />
verdecken den freien Blick auf ein riesiges Übungsgelände.<br />
Am südlichen Ende unseres großen Rekrutenbaues<br />
marschieren wir durch das Tor auf das<br />
gegenüberliegende Gelände. Nach der Ausbildung<br />
im Gelände marschieren wir den gleichen Weg<br />
zackig, mit einem Lied auf den Lippen in die Kaserne<br />
zurück. Zwei Tage vergehen, da erleben wir unsere<br />
erste Nachtübung, die Gruppenweise geordnet,<br />
durchgeführt wird. Der Unteroffizier erklärt uns
209<br />
den Polarstern. Er erklärt uns, wo und wie wir ihn<br />
finden. Wo der Nordstern, auch Polarstern genannt<br />
ist, da ist Norden. ‚Merken Sie sich das. Behalten<br />
Sie diese Tatsache und verankern Sie diese in Ihrem<br />
Gedächtnis. Sie werden es später noch gebrauchen,<br />
wenn Sie sich im Gelände verlaufen haben.<br />
Mit Hilfe des Polarsterns, einer richtigen Karte<br />
und dem Kompass, den Sie bei sich tragen, finden<br />
sie immer zurück zu Ihrer Einheit’. Geradezu gläubig<br />
nehmen wir diese militärisch wichtige Grundwahrheit<br />
zur Kenntnis. Ich habe das Gefühl: bei dieser<br />
Einheit bin ich gut aufgehoben. Der Unteroffizier<br />
geht fast freundschaftlich mit uns um. Doch bereits<br />
am nächsten Tag ändert sich der Ton. Er verschärft<br />
sich bis zum Brüllen. Nachtübungen, Grundwehrdienst,<br />
dann Ausbildung an den Waffen. Gruppenweise<br />
wechseln sich die Ausbildungen im Gelände<br />
ab. Es vergehen nur wenige Tage in der Kaserne,<br />
da fliegen wir, ohne eine Erklärung, hinaus und landen<br />
in der Barackenkaserne in Hohenschöpping.<br />
Hohenschöpping liegt mit der S-Bahn zu erreichen,<br />
eine Station vor Velten. Nach Velten bin ich nicht<br />
gekommen. Hier kommen wir wieder in jämmerlichen<br />
Holzbaracken. Baracken ähnlich der abgebrannten<br />
Unterkünfte bei Immendorf, damals bei<br />
der AchtAcht! Hier in Hohenschöpping nimmt der<br />
harte Drill auf dem betonierten Kasernenhof kein<br />
Ende. Nein, der Drill wird weiter und weiter, bis zum<br />
Umfallen praktiziert. Selbst dann werden wir weiter<br />
geschliffen, wenn auch unsere Ausbilder lange wissen,<br />
dass wir schnelle Burschen sind. Wir können<br />
sogar, und dieses ist die vollendete Kür der Grundausbildung<br />
mit affenartiger Geschwindigkeit ‚Auf<br />
dem Koppelschloss kehrt machen’. Und dieses na-
210<br />
türlich, ohne dabei irgendwo anzustoßen. Diese<br />
Redensart ist durch den harten, fast unmenschlich<br />
zu nennenden Drill, auch Schleiferei genannt, in<br />
Hohenschöpping entstanden. Eine Alternative ist<br />
erforderlich, damit wir nicht einseitig ausgebildet<br />
werden. Wir sind sogar auf Kommando fähig, ‚Unter<br />
der Grasnarbe wandeln’. Das heißt, wir können uns<br />
so flach auf dem Erdboden bewegen, dass uns kein<br />
Feind sehen kann. Mit dem Drill gibt es kein Ende.<br />
Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Die<br />
Ausbilder haben ihre Befehle, und diese führen sie<br />
stumpfsinnig und gnadenlos aus. Es muss entsprechend<br />
des Leitsatzes: „Die Knochen dürfen über<br />
Nacht nicht den beim Militär so gefürchteten Rost<br />
ansetzen“, gehandelt werden. Selbst wenn die Ausbilder<br />
ihre Brüllstimmen verlieren verbergen sie es<br />
meisterhaft. Wozu gibt es Trillerpfeifen! Man gewinnt<br />
auch den Eindruck: „Wer von den Ausbildern<br />
am lautesten brüllt, der wird von den Vorgesetzten<br />
gehört und wahrgenommen“. Diese Aussage kann<br />
aber nicht stimmen, denn die Ausbilder brüllen immer<br />
weiter. Ihre Vorgesetzten registrieren ihr brüllen<br />
wohl doch nicht. Sie verlangen die Brüller und hören<br />
die Schreier mit Wohlgefallen. In Ergänzung zu der<br />
permanenten Schleiferei erfolgt die Ausbildung an<br />
allen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Da ist<br />
der Karabiner 98k, die Braut des Soldaten.<br />
Das Karabinerschloss* haben wir zu jeder Zeit in die Einzelteile zerlegen<br />
und wieder zusammenbauen können.<br />
Auf unserem Gelände lernen wir den Umgang mit<br />
der Übungs- Stielhandgranate und anschließend<br />
das Werfen mit der scharfen Handgranate. Ein anderer<br />
Ausbilder gibt uns die Einweisungen und die
211<br />
Ausbildung am Maschinengewehr 42. Von der großen<br />
Feuerkraft hören wir: Man kann mit dem MG 42<br />
in der Minute 2000, ja, zweitausend Schuss abfeuern.<br />
Dass diese Leistung nur theoretisch möglich<br />
ist, wird dagegen verschwiegen. Wir lernen am MG,<br />
wie man unter anderem die Fähigkeit erwirbt, einen<br />
heißgeschossenen MG-Lauf ohne Schwierigkeit zu<br />
wechseln. Jetzt wird es ernst! Aus meiner Gruppe<br />
werden fünf Mann zum Schießen mit dem MG befohlen.<br />
Wir erhalten fabrikneue, bisher noch nicht<br />
beschossene Maschinengewehre. Im Abstand von<br />
wenigen Metern liegen die eingewiesenen Schützen<br />
nebeneinander und hinter ihrem MG. Ein Munitionsgurt<br />
mit 50 Schuss wird in die Ladevorrichtung<br />
eingeführt. Der erste Soldat erhält den Schießbefehl.<br />
Dann folgt das Kommando: „5 Schuss, - - -<br />
Feuer frei“. Der MG-Schütze nimmt darauf das MG<br />
hinter dem Abzug hoch und stemmt seine Schulter<br />
fest hinter den Kolben. Als Ziel stehen in einer Entfernung<br />
von etwa 200 m, in der Tiefe des Geländes<br />
gestaffelt Pappkameraden, von etwa einem Quadratmeter<br />
Größe. Sie stellen den Stahlhelm mit dem<br />
Kopf und einem Teil der Schulter eines Soldaten<br />
dar. Das ist der Feind! Mit dem Finger am Abzug,<br />
die Augen über die Zieleinrichtung auf den „Pappkameraden“<br />
gerichtet und gezielt, drückt der Schütze<br />
über den Druckpunkt ab. Das Schloss trägt den<br />
Schlagstift zum Schießen und den Hebel zum Sichern.<br />
Im Bruchteil einer Sekunde sind die fünf<br />
Schuss hintereinander gefeuert. Niemand von uns<br />
kann sie zählen. Der Feuerbefehl wiederholt sich<br />
und der nächste Schütze hat die 50 Schuss in gleichen<br />
Schritten abgegeben. Dabei gelingt es ihm,<br />
das anpeilte Ziel, einen der Pappkameraden, zu
212<br />
treffen. Mir dagegen ist das Glück beim Schießen<br />
nicht beschieden. Mein erster Einsatz am MG 42<br />
endet damit: 1. ich habe den Pappkameraden nicht<br />
getroffen. 2. in einem Durchgang habe ich die 50<br />
Schuss in und durch die blattlosen Baumkronen der<br />
hohen Buchen geschossenes folgt der Befehl „Achtung“.<br />
Ich stehe neben dem Maschinengewehr<br />
stramm. Sie haben es mir in die Ohren gebrüllt: Ich<br />
sei unfähig und zu dämlich zum Sch - - - - -. Sie<br />
schieben noch nach: Diese Aussage soll mich unbedingt<br />
tief in meiner Seele treffen: ‚Sie werden<br />
niemals ein tauglicher Maschinengewehrschütze’.<br />
Mit meiner mangelhaften Leistung habe ich das<br />
doch gerade bewiesen. Zur Strafe renne ich nun,<br />
mit der Gasmaske vor dem Gesicht, in jeder Hand<br />
einen mit Munition gefüllten Munitionsbehälter ausgestattet,<br />
einen aufgeschütteten Sandberg hinauf<br />
und herunter. Unter den gebrüllten Sätzen des Vorgesetzten<br />
springe ich in den Ring: „Sie sollen laufen<br />
und nicht rutschen. Halten Sie ihre Knie und Knochen<br />
zusammen. Von Hinsetzen hat hier niemand<br />
etwas gesagt“. Immer wieder mühe ich mich ab, um<br />
die Spitze des Sandberges zu erreichen. Der vorhandene<br />
Raum zwischen der Gasmaske und meinem<br />
Gesicht hat sich nach wenigen Augenblicken<br />
mit beißendem Schweiß gefüllt. Meine Arme erreichen<br />
fast eine Länge, dass die Munitionskästen<br />
über den Erdboden schleifen. Später, da sollte ich<br />
doch noch froh darüber sein, kein tüchtiger MG-<br />
Schütze geworden zu sein. Ich bin überzeugt, meine<br />
damaligen Gespräche im Lazarett mit Gerd Lü.<br />
beschützten mich auch später. Daran anschließend<br />
folgt die Einweisung und Ausbildung an den neuen<br />
Sturmgewehren 44, sowie an anderen Gebrauchs-
213<br />
gegenständen die zur Vernichtung des Menschen<br />
dienen. Unsere Ausbildung wird nur von der<br />
Mittagspause unterbrochen. Vor dem ‚Essen Fassen’<br />
ist ein Appell fällig. Die Fingernägel müssen<br />
sauber, die Hände gewaschen sein, die Essschüssel<br />
und das Essbesteck haben vor Sauberkeit zu<br />
glänzen. Die Speise empfangen wir in dicken weißen<br />
Steingutschüsseln. Drei oder vier kleine, lauwarme,<br />
alt und graue Pellkartoffeln werden ins<br />
Krätzchen geworfen. Am Tisch pellt jeder Soldat<br />
seine kalten Kartoffeln mit seinem Besteck-Messer.<br />
Und anschließend geht es wieder hinaus ins Gelände.<br />
Unsere „Vorturner“ können, wie sie sagen, unsere<br />
zarten Stimmen unter der Gasmaske nicht hören.<br />
So brüllen wir die Lieder unter der Gasmaske<br />
und verbessern damit das Handwerk eines <strong>Panzergrenadier</strong>s.<br />
Die Ausbildung am Granatwerfer steht<br />
auf dem Tagesplan. Dieses Vorhaben wird jedoch<br />
auf einen anderen Tag verschoben. Dafür marschiert<br />
der erste Zug am nächsten Morgen mit den<br />
Gewehren 98 k zum Scharfschießen auf einen<br />
Schießstand, dieser liegt etwa zwei Kilometer von<br />
der Kaserne entfernt im Wald. Damit die jungen<br />
Soldaten wirklich das Letzte aus sich herausholen,<br />
werden wir auf dem Marsch dorthin - psychologisch<br />
behandelt und fertig gemacht. Immer kräftig singen,<br />
man höre nichts, durchdringt es die Ohren der Rekruten.<br />
Plötzlich erfolgt das Kommando: ‚Volle Deckung!<br />
Achtung! Stehen Sie stramm. Tiefflieger* von<br />
rechts ab in den Graben. Achtung!“ - - Antreten und<br />
dann weiter marschieren. Ob das Ergebnis des<br />
Schießens mit dem Karabiner schlecht oder gut<br />
war, das spielte keine Rolle. Das Kommando: ‚Tiefflieger<br />
von rechts’ ist lediglich ein Befehl, der befolgt
214<br />
werden muss. Es hätte auch ‚Panzer von links’ heißen<br />
können. Wichtig allein war die ständige<br />
Bewegung im Gelände, und dafür wurde keine Gelegenheit<br />
ausgelassen. In unregelmäßigen Abständen<br />
müssen wir in einem Waldstück 24 Stunden<br />
lang Wache schieben. Nahe unserer Kaserne bewachen<br />
wir die, augenblicklich vom hohen Schnee<br />
zugedeckten, vorhandenen Panzer verschiedener<br />
Typen, die Halbkettenfahrzeuge, LKW und PKW.<br />
Jeweils drei Stunden Wache und drei Stunden Pause.<br />
Der Dreistunden-Rhythmus geht uns schon<br />
nach dem zweiten Wechsel gewaltig auf den Geist.<br />
Es ist einfach nicht zu glauben: Wir müssen abgestellte<br />
Kriegsgeräte bewachen. Das Wacheschieben<br />
kommt mir wie ein böser Traum vor. In diesen 24<br />
Stunden Wache stehen wir im tiefen Schnee. Drei<br />
Stunden im Schnee, danach für drei Stunden von<br />
draußen, in einem ungeheizten Beton-Tiefbunker.<br />
Die wachfreie Zeit müssen wir in dem Bunker<br />
verbringen. Senkrecht steigen wir in einen tiefen,<br />
schmalen Schacht ab. Jede Stufe nach unten vermehrt<br />
in mir Platzangst. Die im Betonbunker herrschende<br />
Kälte, die Nässe und das am Boden einige<br />
Zentimeter hoch Wasser steht bringt mich fast um.<br />
In den nassen, klammen Uniformen am unterkühlten<br />
Körper verbringen wir hier die Zeit bis zum<br />
nächsten Wachwechsel. Unsere angetauten, nassen<br />
Schnürstiefel bleiben an den Füßen. Wir sind<br />
gezwungen, auf den schmalen eisernen Betten,<br />
vierfach übereinander angeordnet, zu ruhen. Nur<br />
mit alten, moderig riechenden, schmutzigen Decken<br />
können wir uns in diesem Bunker zudecken. Diese<br />
Decken werden von uns und vielen anderen Kameraden<br />
benutzt. Diese Decken sind gewiss seit ihrer
215<br />
ersten Anlieferung, dass scheint lange her zu sein,<br />
in dieser Höhle. Mit welcher Decke werde ich mich<br />
beim nächsten 24-Stunden-Einsatz zudecken? Tageslicht<br />
haben die verdreckten Decken nach meiner<br />
Meinung nie gesehen. Unsere nachfolgenden Kameraden<br />
werden sie auch benutzen. Keiner von uns<br />
wird sich dazu äußern. Zum Gehorsam erzogen,<br />
werden wir die 24 Stunden Wache ohne zu murren<br />
ableisten. Innerlich bin ich nicht mit dem Zustand<br />
des Bunkers einverstanden. Doch wen interessieren<br />
meine Gedanken. Einen Kameraden ansprechen,<br />
das gibt nur Ärger. Drei oder viermal war ich zusammen<br />
mit der Gruppe in diesem Bunker. An diesem<br />
Außenposten habe ich keinen, unserer Ausbilder-Offiziere<br />
gesehen. Der höchste Dienstgrad, an<br />
den ich mich erinnere ist ein Feldwebel. Und in diese<br />
Höhle, in diesen Bunker, kommt keiner der Herren<br />
Offiziere. Die sitzen, und davon bin ich überzeugt,<br />
bestimmt nach Dienstschluss bequem in ihrem<br />
Offizierskasino. Nur dort finden sie neben ihren<br />
persönlichen Kleinkriegen untereinander auch die<br />
nötige Zeit, um mit der Hand über ihren Ärmelstreifen<br />
zu streichen. Was sie mit uns treiben, empfinde<br />
ich als reine Schikane. Doch da steht die Absicht<br />
dahinter, dass wir beim Fronteinsatz nicht einfach<br />
fliehen, wenn es einmal schwierig wird. Mit Erkältungen,<br />
mit Halsschmerzen oder sonstigen Ausfallerscheinungen<br />
haben wir nichts zu tun. Ich erinnere<br />
mich an meine achtzehn Spritzen, die ich innerhalb<br />
von fünf Monaten bekommen habe. Wir alle haben<br />
sie ohne Ausnahme bekommen. Niemand hat uns<br />
gesagt wofür und/oder wogegen die Spritzen gut<br />
sind. Eine besondere Auszeichnung für unsere<br />
Gruppe ist es, wenn wir, unter der Aufsicht eines
216<br />
Unteroffiziers, zur Brandwache in die Stadtmitte von<br />
Berlin fahren. Das ist das Zuckerbrot, damit sollen<br />
wir wieder aufgebaut werden. Wir tragen die gleichen<br />
Uniformen wie die Panzersoldaten. Es ist unsere<br />
schwarze Ausgehuniform. Sie hat an der Spitze<br />
der Kragen, weiße Spiegel mit je einer silberfarbenen<br />
Schwinge. Die Division Hermann Göring eine<br />
Eliteeinheit der Luftwaffe. Die Division war im Laufe<br />
der Zeit ihrer Entwicklung, auch mit Fallschirmjägern,<br />
<strong>Panzergrenadier</strong>en und Panzereinheiten ausgestattet<br />
worden. Über die schwarzen Spiegel an<br />
den SS-Uniformen habe ich bereits berichtet. Die<br />
weißen Spiegel gehören ausschließlich Division<br />
HG. Das Hoheitsabzeichen mit Hakenkreuz, den<br />
Luftwaffenadler, tragen wir über der Brusttasche.<br />
Der dunkelblau eingefasste Ärmelstreifen, mit dem<br />
Namenszug ‚HERMANN-GÖRING’, ist am rechten<br />
Unterarm angenäht. Das Koppelzeug tragen wir<br />
sichtbar umgeschnallt. Auf unseren Fahrten in die<br />
Stadt werden wir gelegentlich von Zivilisten angesprochen:<br />
„Was seid ihr denn für Soldaten, habt<br />
Panzeruniformen an, tragt den Luftwaffenadler und<br />
habt weiße Spiegel?“ Auf unsere Ärmelstreifen<br />
kommen sie erst, wenn sie uns eine längere Zeit<br />
gemustert haben. „Wir fliegen die neuen Flugzeuge<br />
mit Holzgas“ antwortet der Unteroffizier jedes Mal,<br />
mit einem gequälten Lächeln auf den Lippen. Das<br />
ist das einzige Lächeln, das wir bei ihm sehen. Zur<br />
Brandwache eingeteilt, sitzen wir tatenlos herum.<br />
Auf unserer Rückfahrt nach Hohenschöpping sind<br />
wir froh, wenn die Nacht mehr oder weniger ruhig<br />
geblieben war Ich erinnere mich an den letzten<br />
Brandschutzeinsatz. Ich wollte unbedingt wissen,<br />
wie es hinter einer großen Bühne aussieht. Auf ei-
217<br />
gene Faust habe ich mir das Theater hinter dem<br />
„Eisernen Vorhang“ genauer angesehen. In einer<br />
der vielen Garderoben finde ich ein mit weißen Fliesen<br />
bis an die Decke gekacheltes Bad. Eine übergroße<br />
Badewanne, die bis zum Überlauf mit Löschwasser<br />
gefüllt ist, nimmt ihren Platz an der Längsseite<br />
ein. Da ich warmes Wasser dem Wasserhahn<br />
entnehmen kann, habe ich sofort das Wasser gewechselt.<br />
Nahezu bis zum Hals sitze ich im tiefen,<br />
warmen Wasser. „So wie hier hast du in deinem<br />
Leben noch nie gebadet“ stelle ich voller Freude<br />
fest. An der hellgefliesten Wand ist ein funktionstüchtiger<br />
Telefonapparat installiert. Von hier aus<br />
rufe ich meine Verwandten an und erzähle ihnen<br />
von meinem Wannenbad. Die Wanne mit kaltem<br />
Wasser aufgefüllt, verlasse ich die von mir sehr ordentlich<br />
gesäuberte Einrichtung. Tage später erhalte<br />
ich zusammen mit einem anderen Kameraden<br />
den lang ersehnten Stadtausgang. „Benehmen in<br />
der Öffentlichkeit“ wird in Lehrstunden behandelt.<br />
Der Besuch des Scheunenviertels, wo auch immer<br />
dieses Viertel in Berlin liegt, ist uns strikt verboten.<br />
Warum der Besuch des Viertels ausdrücklich für<br />
uns verboten ist, weiß ich nicht. In der staubfrei gebürsteten<br />
Ausgehuniform, die Hände und Fingernägel<br />
sauber, mit einem sauberen Kamm und frischem<br />
Taschentuch ausgerüstet, erhalten wir zwei<br />
auf der Schreibstube den Tagesurlaubschein. Wie<br />
der Blitz eilen wir nach der Abmeldung an der Wache<br />
durch das Kasernentor zum S-Bahnhof Hohenschöpping.<br />
Unser Weg führt an Standardbaracken<br />
vorbei. Hinter einer hohen Einzäunung aus doppelreihig<br />
angeordnetem, eng verlaufendem Stacheldraht<br />
stehen verschiedene Baracken. Frauen in
218<br />
dunkelolivefarbenen Uniformen, sie sehen aus wie<br />
altgediente Infanteristen, sind auf dem Vorplatz.<br />
Diese Einrichtung gehört zum „Konzentrationslager<br />
Sachsenhausen“ höre ich durch Zufall. Niemand<br />
weiß, wo das „Sachsenhausen“ ist. Und es ist auch<br />
nicht gut, so etwas zu wissen. Mit der S-Bahn fahren<br />
wir gemeinsam bis zum Bahnhof Zoologischer<br />
Garten. Hier wollen wir uns am Abend zur Rückfahrt<br />
treffen. Die umliegenden Straßen sind, soweit das<br />
Auge reicht, voller Unrat. Lose Akten, Zeitungen<br />
und sonstige Papiere, fliegen durch die Gegend.<br />
Zwischen zerbrochenen Möbeln liegt ein großer<br />
Haufen Glassplitter. Der andauernde Wind wirbelt<br />
und treibt den losen Müll zusammen mit dem Gestank<br />
nach Brand durch die Straßen. Der feine,<br />
dichte Staub in der Atmosphäre zeigt meinen Augen<br />
bereits am Mittag eine müde Sonne, und die Temperatur<br />
bleibt trotzdem angenehm warm. Vom<br />
Bahnhof Zoo kommend, gehe ich durch die Joachimsthaler<br />
Straße. Etwa zweihundert Meter trennen<br />
mich vom Kurfürstendamm. Links von mir liegen<br />
auf dem Asphalt ungeschützte Versorgungsleitungen.<br />
Zwischen den Menschen, die auf mich zukommen,<br />
erblicke ich einen Leutnant des Heeres.<br />
Den werde ich mit meinem gestreckten linken Arm<br />
grüßen. Warum, das weiß ich nicht. Ist es Übermut?<br />
Sehe ich keine andern Uniformträger? Ich grüße die<br />
Uniform des Offiziers mit erhobenem und ausgestrecktem<br />
linken Arm. Ich sehe nur seine Gestalt,<br />
nicht sein Gesicht. Der Offizier grüßt. Ich spüre wie<br />
er stehen bleibt. Dieses nehme ich aber nur im Unterbewusstsein<br />
wahr. Als er sich umdreht, halte ich,<br />
wie auf Kommando gedrillt inne. In diesem Augenblick<br />
fühle ich die Gehorsams-Pflicht. Erstaunt höre
219<br />
ich seine Stimme, die etwas Ziviles hat. ‚Wo kommen<br />
Sie denn plötzlich her?’. Hatte er gemerkt,<br />
dass ich ihn mit dem linken ausgestreckten Arm<br />
gegrüßt habe? Überrascht drehe ich mich um. Ich<br />
warte auf - - doch da schießt es mir schon durch<br />
den Kopf, ich erkenne das Gesicht dieses Mannes<br />
sofort wieder. Die Sache mit dem Gruß hat er gar<br />
nicht bemerkt. Im Lazarett meiner Heimatstadt waren<br />
wir Bettnachbarn. Damals im Mai - Juni 44, da<br />
war er Fähnrich. Ja, mit einem Wiedersehen hat<br />
keiner von uns gerechnet. Der Leutnant ist auf Heimaturlaub.<br />
Er hat seine Frontbewährung als Fähnrich<br />
ohne Verwundung überstanden. Wir freuen uns<br />
beide, wie große Jungen, über unser Wiedersehen.<br />
Er will mich in meiner Kaserne in Hohenschöpping<br />
besuchen. Wir verabschieden uns. Über den Kurfürstendamm<br />
gehe ich den bisher beschriebenen<br />
Fußweg. Es ist die gleiche Strecke, die ich schon<br />
als Junge gelaufen bin. U-Bahn fahren? Straßenbahn<br />
fahren? Das war einmal. Weiter an der ‚Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche’<br />
vorbei gehe ich entlang<br />
der Tauentzienstraße bis zum „KaDeWe“ am<br />
Wittenbergplatz. Vor dem U-Bahnhof Wittenbergplatz,<br />
gegenüber vom „KaDeWe“, klafft ein riesiger<br />
runder Krater. Die Decke über den U - Bahn-<br />
Gleisen hat eine Bombe durchschlagen. Von oben<br />
sind die Schienen der Bahn sichtbar. Daneben, am<br />
Eingangsgebäude zur U-Bahn Station Wittenbergplatz<br />
liegt neben den Straßenbahnschienen ein<br />
ausgebrannter Triebwagen der Straßenbahn. Mein<br />
Weg endet vor dem Wohnhaus, in dem meine Verwandten<br />
in der ersten Etage leben. Die noch vorhandenen<br />
Mieter haben, wie ich sehe die große<br />
Haustür von außen mit Schuttbergen zugepackt und
220<br />
die Innenseite mit zerbrochenen Möbelteilen zugestellt.<br />
Sie wollen, wie ich bei meinem Besuch höre,<br />
Einbrechern keine Möglichkeit geben, die noch<br />
nutzbaren Wohnungen im Haus zu plündern. Unser<br />
Wiedersehen ist für mich belastend. Einerseits freuen<br />
sie sich mich zu sehen, fragen mich aus, wo ich<br />
mich zur Zeit aufhalte, andererseits haben sich der<br />
Onkel Bruno und Tante Emilie sehr verändert. Beide<br />
fühlen sich alt und müde. Der von mir noch erwartete<br />
Antrieb und ihre lebensbejahende Einstellung<br />
ist ihnen abhandengekommen. Der Bombenkrieg<br />
hat ihnen allen Mut genommen. Gemeinsam<br />
mit meinem Vetter, haben wir im Winter 42, vor zwei<br />
Jahren, die Fenster zur Straße hin notdürftig mit<br />
Glasgewebe reparieren können, seine Eltern haben<br />
in den letzten Wochen nichts gehört. Ich denke, der<br />
hat ein hartes Soldatenleben. Als Obergefreiter, er<br />
sagte mir, als wir uns das letzte Mal bei der Fensterreparatur<br />
gesehen haben, er habe nun seinen<br />
höchsten Dienstgrad erreicht und er warte darauf,<br />
endlich von Kirkenes fortzukommen. Meine Kusine,<br />
verheiratet, zwei Kinder, hat ihren Mann, einen<br />
Hauptmann der Luftwaffe nicht an der Front im<br />
Kaukasus, sondern durch einen tragischen Unfall in<br />
Bremen verloren. Er war vor Wochen von der Front<br />
in den Generalstab befohlen worden. Ob die Fenster<br />
bei Onkel Bruno und Tante Emilie in Berlin-<br />
Schöneberg noch heute existieren? Ich weiß es<br />
nicht und ich habe auch nicht danach gefragt. Wir<br />
sitzen in einem Zimmer zur Hofseite zusammen. Es<br />
war mein letzter Besuch bei den Verwandten. Zwei<br />
oder drei Tage nach dem überraschenden Treffen<br />
auf der Joachimtalerstraße meldet sich der Leutnant<br />
in Hohenschöpping. Über den ‚Offizier vom Dienst’
221<br />
meiner Kompanie hat er einen Besuchstermin erhalten.<br />
Zusammen verbringen wir einen friedlichen<br />
Nachmittag in unserem Soldatenheim. Über den<br />
Krieg haben wir nicht gesprochen. Nur persönliche<br />
Dinge waren von Bedeutung. Bevor er wieder seinen<br />
Dienst antreten wird, telefonieren wir noch einmal<br />
miteinander. Der Krieg trennt uns auf seine<br />
Weise. Ich bedaure es sehr, ich habe nie wieder<br />
etwas von ihm gehört. Die kommenden eigenen<br />
Eindrücke, der ständige Wechsel im Geschehen,<br />
haben seinen Namen in meinem Gedächtnis gelöscht.<br />
Es war eine gute Begegnung mit ihm. Hoffentlich<br />
hat er den Krieg überlebt. Im vorerwähnten<br />
Soldatenheim findet unsere Weihnachtsfeier, es ist<br />
das Weihnachtfest 1944 statt. An der Stirnseite des<br />
Saales ist ein Spruch angebracht: „Gott schütze uns<br />
vor Wetter und Wind und vor Kameraden, die keine<br />
sind“. Diesen Spruch habe ich mir gemerkt. An Kameradschaft<br />
habe ich zu dem Zeitpunkt noch geglaubt.<br />
Kompanieweise wird in dem großen Raum<br />
die militärische Feier abgehalten. An langen Tischen<br />
sitzen wir jungen Soldaten und feiern Weihnachten.<br />
Militärische Weihnachtsfeiern sollen etwas<br />
Besonderes sein, sagen unsere Vorgesetzten. Die<br />
langen Tische sind mit weißem Papier von der Rolle<br />
gedeckt und mit Tannenzweigen geschmückt. Vor<br />
jedem Soldaten steht ein leerer weißer Teller. Das<br />
Essbesteck hat jeder mitzubringen. Nach einer Ansprache,<br />
gespickt mit kriegswichtigen Parolen en,<br />
gibt es nach dem Essen noch irgendwelche Marketenderwaren.<br />
Schuhcreme, ein Stück RIF-Seife,<br />
Schreibpapier von „Schreibste ihm, Schreibste ihr“,<br />
das waren die wertvollsten Geschenke. Da waren<br />
einige ältere Kameraden, sie kamen aus Lazaret-
222<br />
ten, die haben sich über die Verteilung von Tabak in<br />
Form kleiner, loser Häufchen auf kleinen<br />
Papierzetteln mit einigen Blättern Zigarettenpapier<br />
sehr verärgert gezeigt. Sie haben ihre Verärgerung<br />
erklärt. Der für die ordentliche Abwicklung unserer<br />
Weihnachtsfeier befohlene Hauptmann J. hat sich,<br />
wie wir erfahren haben, an den Zuteilungen bereichert.<br />
An die Öffentlichkeit ist davon aber nichts<br />
getreten. Ein deutscher Offizier einer Eliteeinheit<br />
soll seine Soldaten bestohlen haben! Der Hauptmann<br />
habe, so ist es bekannt, Umgang mit Damen,<br />
die von ihm gepflegt werden. Mit Sicherheit haben<br />
die Damen von dem Hauptmann Zuwendungen erhalten,<br />
die für die Soldaten bestimmt waren. Dieses<br />
„Leitbild“ ist inzwischen verschwunden, abkommandiert<br />
worden. Die Weihnachtsfeier war zu einer belanglosen,<br />
faden Veranstaltung, verkommen. Nur.<br />
angefüllt mit Durchhalte-Parolen. Noch vor Anbruch<br />
des neuen Tages, gegen 3. °° Uhr marschiert die<br />
Kompanie zu einer nahe liegenden Kiesgrube.<br />
„Dämmerungsschießen“ ist angesagt. Bei den sich<br />
ständig verändernden Lichtverhältnissen sollen wir<br />
mit unseren neuen Sturmgewehren 44 auf die in der<br />
Kiesgrube aufgestellten Pappkameraden schießen.<br />
Mit meinen Kameraden aus der Gruppe liege ich im<br />
seitlichen Abstand von etwa zwei Metern auf der<br />
Erde. Wir zielen in die Nacht und können noch nicht<br />
„Kimme und Korn“ in Deckung bringen. Wir erhalten<br />
„Einzelfeuer - - - Feuer frei“. Wir schießen, als das<br />
Tageslicht gerade anbricht, und wir die Zieleinrichtungen<br />
erkennen und die Pappkameraden sehen.<br />
Ein großer Hund, ein Spitz mit honigfarbenem Fell,<br />
hat unsere Schießerei gehört. Er irrt jetzt in der<br />
ausgedehnten Kiesgrube herum. Es ist streunender
223<br />
Einzelgänger nehme ich an. Weglaufen könnte er,<br />
aber es scheint mir, er weiß in diesem Augenblick<br />
nicht wohin. Das ist etwas nach dem Herzen unseres<br />
Kompaniechefs‚ Einzelfeuer einstellen’. Oberleutnant<br />
T. verlangt ein Sturmgewehr. Er, unser<br />
Verheizer, jetzt sehr aufgeregt, zielt auf den Hund.<br />
Er wird uns zeigen, wie man den Feind vernichtet.<br />
Zum Feind erklärt, schießt er auf den Hund. Der<br />
erste und der zweite Schuss gehen in den Sand. Er<br />
will ihn sicher nur verjagen, denke ich noch. Mit<br />
dem dritten Schuss trifft er ihn mit einem Streifschuss.<br />
Der Hund schreit und winselt laut auf. Er<br />
wird ihn töten, ihn nicht verjagen. Warum tut er das?<br />
Er ist Forstmeister, Beamter, und jetzt schießt er<br />
hier auf einen Hund? Der nächste Treffer bringt kein<br />
Ende für das leidende Tier. Wieder ein Streifschuss.<br />
Mit einem noch größeren Aufschrei reagiert das Tier<br />
fürchterlich. Nun springt ein Ausbilder zur Erlösung<br />
des Hundes auf und erschießt ihn. ‚Na, wie habe ich<br />
das gemacht’ liegt es triumphierend auf dem Gesichtsausdruck<br />
unseres Kunstschützen, des Herrn<br />
Oberleutnant T. Er strahlt über das ganze Gesicht<br />
und ist der Überzeugung, er habe den erlösenden<br />
Schuss abgegeben. Welch ein menschlicher Versager!<br />
Noch sind wir uns nicht der Tragweite bewusst,<br />
als der Stab der Frontoffiziere bei uns eintrifft. Die in<br />
der Kaserne in Hohenschöpping stationierten Kompanien<br />
werden an den nächsten Tagen einzeln und<br />
nacheinander für den Fronteinsatz im Gelände geprüft<br />
und abgenommen. Für uns ist das ab jetzt kein<br />
Spiel mehr, es wird jetzt Ernst. Kompanie nach<br />
Kompanie rückt aus und wird der Reihe nach auf<br />
unserem Gelände eine Übung unter dem Befehl von<br />
Oberst M. durchführen. Einige Tage vor dem Däm-
224<br />
merungsschießen haben wir unsere Karabiner gegen<br />
die neuen Sturmgewehre 44 in der Waffenkammer<br />
getauscht. Von nun an marschieren wir<br />
nicht mehr mit Platzpatronen im Gewehr ins Gelände.<br />
Unsere Sturmgewehre 44 haben je Magazin 30<br />
Schuss Munition. Unsere Kompanie marschiert als<br />
letzte zur Abnahme aus. Unser Kompaniechef befiehlt:<br />
Die Kompanie rückt in unserer Ausgehuniform<br />
aus. Es ist die schwarze Uniform der Panzersoldaten.<br />
Wir sind etwa zwei Kilometer auf der Straße<br />
marschiert, da erscheint plötzlich ein Offizier des<br />
Stabes und stoppt unseren Marsch. Unser Kompaniechef<br />
erhält die Anweisung sofort mit der Kompanie<br />
zurück zu marschieren. Innerhalb von zwanzig<br />
Minuten sind wir in unserer normalen Uniform angetreten<br />
und marschieren auf der Straße in Richtung<br />
des Übungsgeländes. Vor unserem Auftritt als letzte<br />
Kompanie haben sich die Kompaniechefs aller Einheiten<br />
nach der jeweiligen Abnahme ihrer Soldaten<br />
zusammengesetzt um sich zu informieren, was dem<br />
Oberst M. aufgefallen ist. Es geht, wie man beim<br />
Morgenappell gehört hat, nur um Verbesserungen<br />
beim Fronteinsatz. So habe ich es in Erinnerung.<br />
Ich denke: Nachdem wir mit unserer Ausgehuniform<br />
nicht über den Acker gescheucht werden, uns noch<br />
einmal umziehen mussten, kann es sich nicht nur<br />
um Verbesserungen beim künftigen Einsatz handeln.<br />
Wir glauben in unserer Gruppe: Nach der jeweiligen<br />
Manöverkritik will der nächste Kompaniechef<br />
seinen Haufen besonders gut über die Abnahme<br />
bringen. In diesem Zusammenhang wird nicht<br />
die Frage gestellt, wie man eine Kompanie am besten<br />
verheizen kann. Wichtig ist doch nur, unser<br />
Kompaniechef wird gut bei seinen Vorgesetzten
225<br />
angesehen. Unser Ausbilder-Kompaniechef, der<br />
Herr Oberleutnant T. benutzt jetzt häufig seine Lieblingsvokabel<br />
„Verheizen“. Wir kennen diesen Ausdruck<br />
nur von ihm. Wir sind noch nicht dahinter gekommen,<br />
warum er diesen Begriff jetzt so häufig<br />
benutzt. Zunächst schien es wohl nur ein dümmliches<br />
Gerede zu sein, um uns kleinen Soldaten etwas<br />
Besonderes zu sagen. Für ihn sind alle Soldaten<br />
nur zum Kämpfen da, Töten und Sterben, das<br />
ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Endsieg für<br />
unseren Führer erkämpfen. Ihm haben wir Treue<br />
und Gehorsam versprochen. Dieses werden wir<br />
einhalten. Er wird sich hüten, uns zu sagen was wir<br />
für ihn sind. Unsere Vorgesetzten sind, bis zur Aufstellung<br />
einer Marschkompanie zum Fronteinsatz<br />
nur ‚Ausbilder’. Oberst M. sieht uns auf dem Marsch<br />
ins Gelände und übernimmt den Befehl über die<br />
Kompanie. Es folgt eine kurze Ansprache. Er sagt<br />
uns, was er bei der Abnahme erwartet. Die Befehle<br />
werden nun ausschließlich von ihm erfolgen. Sie<br />
sind so durchzuführen, wie sie uns in der Ausbildung<br />
und im Drill vermittelt worden sind. Spätere<br />
Nachbehandlungen durch unsere Ausbilder sind<br />
ausgeschlossen. Wir zeigen den Vormarsch im Gelände<br />
unter außerordentlich erschwerten Bedingungen.<br />
Aus zwei oder drei schweren Maschinengewehren<br />
werden wir beim ‚Sprung auf Marsch,<br />
Marsch’, in 2 m Höhe über Kopf beschossen. Die<br />
Geschosse pfeifen schneidend um unsere Ohren<br />
und über unsere Köpfe hinweg. Und wir spüren<br />
auch, dass wir von vorn beschossen werden. Jetzt<br />
wird es sich herausstellen, ob wir uns auch wirklich<br />
„unter der Grasnarbe“ vorwärts bewegen können.<br />
Nach etwa zwei Stunden im Gelände ist die militäri-
226<br />
sche Übung mit dem Marsch zurück in die Kaserne<br />
wie gewohnt, stramm und einem Lied auf den<br />
Lippen abgeschlossen. Nach dem Mittagsappell<br />
und dem Mittagessen haben wir zwei Stunden<br />
Bettruhe. Nur der „UvD“ und die Mannschaft der<br />
Schreibstube haben Dienst. Unsere Ausbilder, bis<br />
einschließlich Feldwebel mit Portepee und Unteroffiziere,<br />
erhalten ihrerseits eine Nachbehandlung im<br />
Gelände. Die Offiziere des Bataillons werden sich in<br />
der Zeit den Abschlußbericht anhören. Die militärische<br />
Abnahme der in Hohenschöpping stationierten<br />
Kompanien unseres Bataillons ist damit abgeschlossen.<br />
Nun sind wir fronttauglich. Auf dem Vorplatz<br />
an den Garagen steht unerwartet ein „Panzer<br />
III“. Den hat man uns über Nacht gebracht, stellt<br />
einer der Ausbilder-Unteroffiziere fest. Bei der Betrachtung<br />
des Panzers sehen wir ein großes Loch in<br />
der Panzerung. Die explodierende Granate hatte<br />
einen Teil Panzerung herausgesprengt. Von dem<br />
an dieser Stelle einmal sitzenden Soldaten ist nur<br />
die festgebrannte Sitzfläche der Hose übrig geblieben.<br />
Obwohl der Innenraum des Panzers weitgehend<br />
ausgeräumt war, konnte man das Geschehene<br />
an den Spuren nachvollziehen. Unser Bataillon,<br />
oder ein Teil davon, sollte ursprünglich an „Panzerjägern“<br />
ausgebildet werden. Zu dem Zeitpunkt, als<br />
wir hier ankamen, waren einige dieser Stahlkolosse<br />
vorhanden. Doch außer unserer Ausgehuniform<br />
haben wir keinen weiteren Panzer gehabt. Für eine<br />
Panzerausbildung kommt das alles nicht mehr in<br />
Frage, weil das erforderliche Personal fehlt. Meinen<br />
Kameraden und mir ist dieser Begriff „Verheizen“<br />
erst seit der Vereidigung bekannt. Verheizen, das<br />
heißt nichts anderes, als die „Truppe“ beim Front-
227<br />
einsatz ins feindliche Feuer schicken. Wie unschwer<br />
zu erkennen ist, unsere Truppe wird nur auf den<br />
Angriff ausgebildet. Eine Verteidigung in einer Stellung<br />
ist nicht vorgesehen. “Vorwärts stürmen“ heißt<br />
die Parole. Ich denke: die ständige Benutzung dieser<br />
Aussage durch unseren Kompaniechef entspricht<br />
einer besonders perfiden Grundhaltung eines<br />
Menschen. Beim Oberleutnant T. wirkte „Verheizen“<br />
noch vergnüglich. Er war „Ausbilder-<br />
Offizier“. Die Front braucht er nicht zu fürchten, solange<br />
er macht was seine Obrigkeit von ihm und<br />
seinen Gleichgesinnten verlangt. Nachbehandlungen<br />
heißt: Sollte die geforderte Leistung nicht von<br />
den Soldaten erbracht werden, dann haben wir in<br />
der Kompanie kein Strafexerzieren zu befürchten.<br />
Es wird sicher die letzte Mittagspause beim Militär<br />
sein. Vielleicht war es ein Geschenk. Das Portepee<br />
ist die Säbelquaste. Diese wird als Auszeichnung<br />
vom Unteroffizier aufwärts am Seitengewehr getragen.<br />
In den nächsten Tagen haben wir Alarmbereitschaft.<br />
Unsere Spinde werden von jedem einzelnen<br />
geleert und gereinigt. Unsere Unterwäsche, bis hin<br />
zum Mantel, alles verstauen wir in unserem Rucksack.<br />
Unsere Ausgehuniform liefern wir auf der<br />
Kammer ab. Die Vorhangschlösser für die Spinde<br />
sind jetzt an den verschlossenen Rucksäcken. Die<br />
Waffen, die neuen Sturmgewehre 44, werden uns<br />
von der Waffenkammer ausgehändigt und bleiben<br />
in unmittelbarer Nähe jedes Soldaten. In der Nacht<br />
liegen sie neben dem Soldaten auf dem Bett, ohne<br />
Magazin und ohne Munition. Die Unterkunft die Baracke<br />
und das Revier wird gesondert von uns gesäubert.<br />
Geschlafen wird in der Uniform, ohne<br />
Schnürstiefel. Zwei Tage vergehen, dann wird der
228<br />
Alarm beendet und alles wird in umgekehrter Reihenfolge<br />
zurückgespult. Waffenrückgabe an die<br />
Waffenkammer, Spinde einräumen und schon sind<br />
wir wieder im alten Trott. Dieses war ein Probealarm.<br />
Am nächsten Nachmittag beginnt das gleiche<br />
Spiel von vorn. Es fehlt der richtige Schwung beim<br />
zweiten Alarm. Nach einer Stunde stellt sich heraus,<br />
dass wir keinen Stellungswechsel machen. Der<br />
zweite Alarm war nur ein Übungsalarm. Alles zurück<br />
Marsch, Marsch. Doch mit einem Schlag, gibt es<br />
plötzlich keine Entwarnung mehr. Wie vom Blitz getroffen,<br />
kommt für uns das Kommando „Alarm“. Die<br />
gerade zurückgetragenen Waffen werden wieder an<br />
die Soldaten ausgegeben. „Die Kompanie tritt innerhalb<br />
von zwanzig Minuten feldmarschmäßig, mit<br />
voller Ausrüstung, im Gang der Baracke an“, brüllt<br />
der „O v D“, der „Offizier von Dienst“. Nun tragen wir<br />
unser Sturmgepäck am Tragegestell eingehakt auf<br />
dem Rücken. Der Brotbeutel mit der „Eisernen Ration“,<br />
das Kochgeschirr, das Besteck, die Feldflasche,<br />
der Feldspaten und nicht zu vergessen, den<br />
Gasmaskenbehälter mit der Gasmaske kommen<br />
alle aufgezählten Gegenstände, geordnet an das<br />
Koppelzeug. Der Stahlhelm sitzt auf dem Kopf. Das<br />
Sturmgewehr befindet sich mit dem Tragriemen an<br />
der rechten Schulter. Der gepackte Rucksack steht<br />
auf dem Fußboden vor jedem Soldaten. Alles geht<br />
in Windeseile über die Bühne. Wir haben es ja vorher<br />
mehr als nur zweimal geübt. Wir verlassen unsere<br />
Baracken-Kaserne in Hohenschöpping. Die<br />
Bettgestelle mit den Matratzen bleiben ohne uns<br />
zurück. Ab jetzt wird es ernst werden. Wir sitzen auf<br />
unseren LKWs und fahren hinaus in die Nacht. Es<br />
geht kein Blick von mir zurück. Meine Gedanken an
229<br />
diesen Ort liegen jetzt in der Vergangenheit abgelegt.<br />
Wohin die Fahrt mit uns in der Nacht geht,<br />
unser Ziel, geht uns nichts an. Mit Tempo geht es<br />
über die Reichsautobahn in Richtung Nord, in Richtung<br />
Stettin. Fahren die uns jetzt an die Oder? Auf<br />
der Fahrt stelle ich mir plötzlich die Frage: Aus welchem<br />
Grund ist unser Bataillon nicht mit älteren,<br />
fronterfahrenen Soldaten ausgestattet worden? Wo<br />
sind denn unsere Frontkämpfer? Antworten auf diese,<br />
für uns doch lebenswichtige Frage, erhalte ich<br />
nicht. Haben wir überhaupt diese Frage gestellt?<br />
Bestimmt nicht. Den Ausbilder-Kompaniechef,<br />
Oberleutnant T. die Kompanie- und Zugführer und<br />
die Ausbilder sind wir nicht losgeworden. Einen Gedanken<br />
daran, ob wir die letzten sind, die eine Ausbildung<br />
erhalten haben, verschwenden wir nicht.<br />
Die Ausbilder, die uns neben dem ständigen Exerzieren<br />
das Töten beigebracht haben, sind jetzt mit<br />
uns auf dem Wege an die Front. Noch in der Nacht<br />
erreichen wir Greiffenberg. Ich denke, dass es jetzt<br />
Mitte Januar 1945 ist. Vor einem großen Gebäude<br />
steigen wir von den Fahrzeugen ab. Unsere Rucksäcke<br />
bleiben auf den LKWs. Feldmarschmäßig<br />
ausgestattet, marschieren wir, der Erste Zug, weiter.<br />
Nach etwa drei Kilometern erreichen wir gegen<br />
5. °° Uhr Günterberg. Es ist noch stockdunkel. Hier<br />
werden wir zum Dienst eingeteilt. Fünf Kameraden<br />
meiner Gruppe finden in einem Kuhstall Unterkunft,<br />
vier Mann und ich werden mit unserem Gruppenführer,<br />
dem Unteroffizier, zur nahe liegenden Reichsstraße<br />
198 abkommandiert. In Blickrichtung Nord –<br />
GRAMZOW bringen wir rechts neben der Straße<br />
ein Maschinengewehr in Stellung. Alle an unserem<br />
Posten vorbeifahrenden Fahrzeuge werden von
230<br />
einer Sondereinheit der Feldjäger angehalten und<br />
überprüft. Später werden wir abgelöst. Auf Befehl<br />
unseres Feldwebels hat der Bauer sein Wohnzimmer<br />
ausräumen und den Fußboden mit Stroh ausfüllen<br />
müssen. Möbel raus, Stroh rein. Bis zum<br />
nächsten Umzug findet die Gruppe eine trockene<br />
Unterkunft. Vom Holzfußboden merken wir nichts.<br />
Das Stroh gibt uns Wärme. Unser Gruppenführer<br />
hat die Bäuerin „gebeten“, sie solle uns Pellkartoffeln<br />
kochen. Als Ausbilder fehlte ihm die Härte eines<br />
Frontkämpfers. Seine Annahme, die Bäuerin würde<br />
uns freiwillig zu den Pellkartoffeln eine „Stippe“ liefern,<br />
erfüllte sich nicht. Es gab nur warme Pellkartoffeln.<br />
Nach zwei Tagen machen wir Stellungswechsel.<br />
Wie in den letzten beiden Tagen, fliegen<br />
tagsüber zu unregelmäßigen Zeiten zwei sowjetische<br />
„IL-2 m3 Sturmowik“ Schlachtflugzeuge auf<br />
beiden Seiten der Front nach Norden und Süden.<br />
Wir nennen sie, „Max und Moritz“. Vereinzelt<br />
schleudert einer der MG-Schützen die eine oder<br />
andere handliche Bombe aus seiner nach hinten<br />
offenen Kabine. Sie machen damit Störfeuer. Unsere<br />
eigenen Flugzeuge sind sicher an anderen Stellen<br />
der Oderfront im Einsatz. Hier zeigen sie sich<br />
nicht. Am Tage und in den Nachtstunden meldet<br />
sich unregelmäßig die sowjetische Artillerie mit ihrem<br />
Störfeuer. Das vor uns liegende freie Gelände<br />
zur Oder wird von der Sowjetartillerie mit Granaten<br />
belegt. Nachts hören wir die Abschüsse der Granaten<br />
aus den Geschützen auf der östlichen Oderseite.<br />
Geräuschvoll gurgeln sie über die Oder und<br />
schlagen nach Sekunden mit großem Krachen irgendwo<br />
ein. Es sind jeweils vier Granaten. Ihre Explosionen<br />
hinterlassen flache Trichter auf dem Ac-
231<br />
ker. Wir können nicht voraussehen, wann und wo<br />
die nächsten Granatensalven einschlagen werden.<br />
In einer „Auffanglinie“ haben wir mit der Kompanie<br />
Stellung bezogen. Die Entfernung zur Oder kennen<br />
wir nicht. Wenn wir aus unserer Stellung abgelöst<br />
werden, dann liegen wir in einem etwas höher gelegenen<br />
Waldstück. Dort haben wir, mit je vier Mann,<br />
ein Zelt aus Dreieckzeltplanen gebaut. Jeder Soldat<br />
hat seine Dreiecksplane. Die Seitenwände der quadratisch<br />
ausgehobenen Erdlöcher sind seitlich mit<br />
Faschinen befestigt, damit uns der Sand nicht beim<br />
Schlafen verschüttet. Die Kompanie ist, wenn auch<br />
in einzelnen Zügen voneinander getrennt, beim Appell<br />
mit Nennung der Tageslosung vergattert worden.<br />
Unsere, zur Wache befohlenen Kameraden<br />
können nun zu jeder Tageszeit wohl hauptsächlich<br />
in der Nacht verdächtige Geräusche ansprechen<br />
und nach der Tageslosung fragen. Sollte sich eine<br />
oder mehrere Personen in der Nähe unseres Lagers<br />
bewegen, so können die Kameraden diese<br />
festnehmen. ‚Halt, wer da? Nennen Sie die Tageslosung’.<br />
Die letzte Entscheidung über den Gebrauch<br />
der Waffe ist festgelegt. Jeder Soldat darf nur seine<br />
Waffe geladen und gesichert mit zum Wachdienst<br />
nehmen. Aus Sicherheitsgründen ist es bei Strafe<br />
verboten, die Waffe seines von der Wache abzulösenden<br />
Kameraden zu übernehmen. Eines Nachts<br />
fällt unerwartet ein Schuss. Das Geschoss ist in<br />
eine Kiefer eingeschlagen. Die vorgeschriebene<br />
Meldung, warum der Schuss gefallen ist, ist geschrieben.<br />
Alles hat seine Ordnung zu haben, alles<br />
muss nachweisbar sein. Was wäre, wenn der<br />
Schuss einen Kameraden getötet hätte? Die Frage,<br />
warum dieses geschehen konnte, wird nicht weiter
232<br />
verfolgt. In windstillen, klaren und eiskalten Nächten<br />
kommt regelmäßig ein Doppeldecker der Sowjets<br />
über unseren Wald gesegelt. Die Richtung, aus der<br />
er kommt, ist immer die gleiche. Mit einer Reihe<br />
weißglühender Leuchtkugeln überprüfen die Sowjets,<br />
ob wir schlafen. Wir schlafen nicht, wir sind<br />
hellwach. Es ist eine „Nähmaschine“ (aus der deutschen<br />
Landser Sprache), ein altertümlicher Doppeldecker<br />
der Sowjets, vom Typ U-2. Heute Nacht erwarten<br />
wir sie noch. Zwischen den hohen Kiefern<br />
befindet sich unser Feuerplatz. Um einen Kreis von<br />
etwa 2,00 m Durchmesser ist ein Graben von fast<br />
50 cm Breite ausgehoben worden. Dort stellen wir<br />
unsere Füße ab. Der Aushub dient uns als Schutz<br />
und Rückenlehne. Tag und Nacht sitzen Kameraden,<br />
die keine Aufgaben oder keine Wache haben,<br />
am wärmenden Feuer. Das alles hat mit Lagerfeuerromantik<br />
nichts zu tun. Die Nächte sind teilweise<br />
bitter kalt. Die Wachfreien liegen auf der sandigen<br />
Erde und schlafen in den zweimal zwei Meter großen<br />
Erdlöchern unter den Zelten aus Dreieckszeltplanen.<br />
Trotz des Schlafens bleiben die Ohren weit<br />
geöffnet. Jeder lauscht in die Stille der Nacht. Aus<br />
weiter Entfernung können wir die U2, die Nähmaschine<br />
hören. Sie kommt langsam aber sicher wie<br />
bisher, über unseren Kiefernwald. Noch bevor die<br />
Maschine unseren Wald erreicht, haben wir unser<br />
Lagerfeuer mit dem abgetrennten Deckel eines<br />
Blechfasses und mit dem Sand des Bodens abgedeckt.<br />
- -Da, - - jetzt ist sie gleich über uns. Ihr Erkennungszeichen<br />
ist der schnarrende Motor. Gekonnt,<br />
erstirbt der Motor mit einem Schluckauf. Fast<br />
geräuschlos, nur mit den singenden Tönen der<br />
Spanndrähte des Doppeldeckers, die durch den
233<br />
Flugwind erzeugt werden, segelt die Maschine hoch<br />
über uns hinweg. Mit je einem feinen Knall platzen<br />
über unseren Köpfen nacheinander etwa zehn<br />
Leuchtkugeln. Ihre weithin hell weiß glühenden Kugeln<br />
gleiten und schweben an kleinen Fallschirmen<br />
über die Wipfel der hohen Kiefern. Nach kurzer<br />
Brenndauer wird das Licht der Leuchtkugeln nacheinander<br />
wieder abgeschaltet. Dieses sind harmlose<br />
Geschenke, die uns der Vogel mitbringt. Nach<br />
einer Weile kommt dann, mit einem lauten<br />
„Brrrupp“, das Motorgeräusch wieder an unsere Ohren.<br />
Regelmäßig erleben wir das gleiche Spiel. Andere,<br />
tödliche Geschenke, wirft der „Vogel“ Gott sei<br />
Dank, nicht auf uns. Keiner von uns hat das Flugzeug<br />
je gesehen. Und die Sowjets haben uns am<br />
Boden ebenfalls nicht ausfindig gemacht. Das nehme<br />
ich jedenfalls an. Was kann geschehen, wenn<br />
wir ohne Befehl unserer Vorgesetzten mit unseren<br />
Sturmgewehren durch die Baumkronen auf den Vogel<br />
schießen? Mit Sicherheit wären dann ihre Kameraden<br />
mit Bomben gekommen. In solchen Situationen<br />
sind auch Soldaten keine Selbstmörder. Unsere<br />
Kriegsführung sagt: schlafende Hunde werden<br />
wir nicht wecken. Im Anschluss, das heißt: neben<br />
unserer Einheit hat sich ein Bataillon der Marineinfanterie,<br />
oder ein Teil davon, eingerichtet. Etwa 100<br />
m von uns entfernt steht ihre Feldküche. Sie ist dort<br />
mit einem beleibten Küchenbullen, dem Küchen-<br />
Feldwebel, in Stellung gegangen. In einem gesonderten<br />
getarnten Küchenfahrzeug werden, mit anderen<br />
Nahrungsmitteln, verschiedene Sorten Trockengemüse<br />
in dicken Papiersäcken ständig unter<br />
Verschluss gehalten. Da wir zu dem Fahrzeug keinen<br />
Zugang haben können, konzentrieren wir uns
234<br />
auf die angebrochenen Säcke des Trockenfutters.<br />
Die befinden sich unter der Sitzklappe<br />
der Protze* an der Feldküche. Der Raum unter dem<br />
Sitz ist für die Munition der Kanone vorgesehen.<br />
Und da sind nun die angebrochenen Säcke mit dem<br />
Trockengemüse untergebracht. Wir haben sofort<br />
heraus bekommen, dass wir das Trockenfutter am<br />
besten in unseren Hosentaschen unterbringen können.<br />
Wir haben zu jeder Zeit den Zugriff. Und für<br />
unseren Nachschub an Futter werden wir schon<br />
sorgen.<br />
Die Protze ist der Vorderwagen für eine Kanone. Gezogen<br />
wurde die Protze mit der daran angehängten<br />
Kanone von Pferden.<br />
Zu unserem Glück hat der Küchenbulle die Sitzklappe<br />
nie mit einem Vorhangschloss fest verschlossen.<br />
Das hängt nur als Attrappe dran. Seit<br />
seiner Ankunft haben wir alles, was mit Mundvorräten<br />
zu tun hat, längst aus unseren Viermannzelten<br />
beobachtet. Wir laufen von jetzt an, mit mehr als<br />
einer Handvoll von dem Trockengemüse, bevorzugt<br />
werden Mohrrüben, in unseren Hosentaschen herum.<br />
So etwas Gutes kennen wir nicht. Unsere eigene<br />
Verpflegung kommt unregelmäßig in Essenbehälter.<br />
Unsere Verpflegung ist mengenmäßig als<br />
ausreichend zu bezeichnen. Von der Qualität ist sie<br />
essbar. Vom Geschmack kann keine Rede sein Der<br />
Hunger entscheidet über die Qualität. Unsere Brotration:<br />
ein Drittel Kommissbrot pro Tag.. Die zur<br />
Verteilung kommende Jagdwurst trocknete bereits<br />
bei der Ausgabe. Fett und Kunsthonig war für mich<br />
nicht so wichtig. Nach dem Genuss von Kunsthonig,<br />
selbst in kleinster Menge, bekam ich für einen Tag<br />
heftiges Sodbrennen. Dagegen ist mir das trockene
235<br />
Gemüse immer willkommen. Dass wir ständig unter<br />
Hunger leiden, weiß der Dicke. Aus welchem Grund<br />
sollten wir uns sonst an seine Einrichtung anschleichen.<br />
Er braucht uns nur in unsere hungrigen Augen<br />
zu sehen. Er ist uns vielleicht wie seinen eigenen<br />
Kindern, zugetan. Fast regelmäßig reinigen wir<br />
seinen voluminösen Kochtopf. Vor der eigentlichen<br />
Reinigung schneiden wir den angesetzten Boden<br />
der dicken Suppe aus seiner Gulaschkanone heraus.<br />
Von Zeit zu Zeit, wenn die Luft rein ist, meldet<br />
er sich mit Handzeichen. Noch, bevor er seine Hand<br />
wieder herunter genommen hat, sind wir bereits zur<br />
Stelle. Die am Boden festsitzende oder angebrannte<br />
Der Küchenfeldwebel hat keine Kanone, sondern<br />
eine „Gulaschkanone“ und eine Pferdebespannung.<br />
Für die Protze gab es bei der Wehrmacht keine andere<br />
Bezeichnung. Nahrung schmeckt uns jetzt<br />
besser als jeder Kuchen. Mir kommt es vor, als<br />
würde er häufiger als üblich den Rest der Suppe am<br />
Boden anbacken lassen. Täglich, etwa in der Mittagszeit,<br />
ist er mit seiner Gulaschkanone unterwegs<br />
zu seiner Truppe, um die frische Suppe abzuliefern.<br />
Wir freuen uns jedes Mal, wenn er seinen Standort<br />
in unserer Nähe wieder eingenommen hat. Dann<br />
melden sich bei uns gleich die „Pawlowschen Hunde“.<br />
Heute bleibt der Stellplatz seiner Gulaschkanone<br />
verwaist. Wie es sich dann herausstellt, haben<br />
ihm die Sowjets mit ihrer Artillerie den großen<br />
„Fress-Koch-Topf“ mit samt Protze und den beiden<br />
Pferden unter dem Hintern weggeschossen und<br />
dabei unseren Dicken und seine Zwei Pferde getötet.<br />
Unser, immer zu Scherzen aufgelegte „Dicke“<br />
war plötzlich nicht wiedergekommen. Er war, zusammen<br />
mit seiner Feldküche und seinen beiden
236<br />
Pferden „auf dem Felde der Ehre, für Führer, Volk<br />
und Vaterland“ gefallen. Sein Tod und der Verlust<br />
seiner guten Küche, war für uns sehr schmerzlich.<br />
Mit einem Schlag gab es seine Gulaschkanone und<br />
sein Trockengemüse nicht mehr. Die neue Küche<br />
fand einen anderen Standort. Für uns war sie nun<br />
nicht mehr erreichbar. Einige Nächte später lässt<br />
uns die eigene Körperwärme in unseren Erdlöchern<br />
nicht mehr schlafen. Jeder von uns hat sich über<br />
dem Brustbein die Haut blutig gekratzt. Kratzen ist<br />
für jeden von uns unangenehm. Die heimliche Kratzerei<br />
war für jeden von uns tabu, darüber spricht<br />
man nicht. Einer der Kameraden hat etwas gemeldet.<br />
Ohne Verzug wird die Kompanie einem Sanitätsfeldwebel<br />
vorgeführt. Der braucht sich die Ergebnisse<br />
der Kratzerei nicht lange anzusehen. Die<br />
Männer haben Läuse! Für uns ist es kein schrecklicher<br />
Gedanke, wenn man mit Läusen herumläuft.<br />
Dass Läuse Überträger von Typhus auf den Menschen<br />
sind, davon haben wir nie etwas gehört. Typhus,<br />
dieses Wort kennen wir. Das ist aber kein<br />
Begriff für uns. Läuse sind eine unabwendbare Zugabe<br />
zum Soldatenleben aus kriegsbedingtem<br />
Mangel an Hygiene. Wir haben nie warmes Wasser<br />
und kaum Seife. Kernseife hat die Mutter zu Hause.<br />
Somit besteht für uns keine Möglichkeit, den üblichen<br />
Waschgang regelmäßig zu erledigen. Wir finden<br />
diesen Mangel gar nicht schlimm. Andere Soldaten<br />
sind ja schon Jahre im Krieg und im Dreck.<br />
Versuche, den Biestern ein Garaus zu machen,<br />
scheitert aus Mangel an wirksamen Mitteln. Und die<br />
Läuse zwischen den Daumennägeln zu zerquetschen<br />
und sie damit ausrotten, ist ein absolut untaugliches<br />
Mittel. Die Kompanie marschiert zu ei-
237<br />
nem nahe gelegenen Gehöft. Hier empfangen wir<br />
neue Unterwäsche. Jeder wirft seine verdreckte<br />
Unterwäsche in einen offenen, mit weißer Kalkmilch<br />
gefüllten Behälter. Die saubere Unterwäsche gibt<br />
mir das Gefühl von Sauberkeit auch ohne Waschen.<br />
Darüber kommt unsere verdreckte alte Uniform. Die<br />
verlauste Unterwäsche sind wir los. Nun haben wir<br />
keine Läuse mehr! Im Vertrauen auf eine Lause<br />
freie Zukunft marschieren wir zurück in unsere<br />
Waldstellung. Tage darauf verlassen wir die Stellung<br />
und marschieren nach Biesenbrow. Im Saal<br />
einer Gaststätte finden wir unser Nachtlager. Draußen<br />
schneit es zum wiederholten Mal und der Frost<br />
ist angesagt. Mitgekommen sind die, von uns noch<br />
nicht erkannten, Nissen die sich an den Knopflöchern<br />
und in den Falten des Uniformstoffes festsitzen.<br />
Nun schlagen wir uns mit dem Nachwuchs der<br />
Läuse herum. Die sind noch viel hungriger als die<br />
alten, die vielleicht noch in der Kalkmilch schwimmen.<br />
Die jungen, mit den roten Punkten im transparenten<br />
Körper, quälen uns gewaltig. Es ist nicht verständlich,<br />
dass wir nicht über die geeigneten Mittel<br />
verfügen um diese Läuseplage zu töten. Von unseren<br />
Vorgesetzten hören wir nichts. Na ja, wir haben<br />
doch unsere „Ausbilder“ bei uns. Haben die keine<br />
Schwierigkeiten mit den Läusen? Wir werden doch<br />
die Schnauze halten. Und wir haben doch erst vor<br />
Tagen frische Unterwäsche bekommen. Also, da<br />
gibt es nichts zu meckern. Damit wir nicht einrosten,<br />
marschieren wir täglich von Biesenbrow nach Günterberg,<br />
um dann abends wieder in einem Saal einer<br />
Gaststätte in Biesenbrow zu landen. Zwischendurch<br />
bauen wir unsere Stellungen im Welsebruch<br />
weiter aus. Wir bauen an Schützengräben, und pla-
238<br />
gen uns mit dem Aushub der Einmann- und Zweimannlöcher.<br />
Dann hocken wir stundenlang in den<br />
Zweimannlöchern und warten auf den Ernstfall. Wir<br />
übernachten nun auch in den bunkerähnlichen Unterständen.<br />
Ein Blechofen soll uns in der nassen<br />
und kalten Erde Wärme geben. Um den Rauch<br />
nach außen abführen zu können, wird dafür eine<br />
sonderbare Konstruktion gebaut. Der Unterstand<br />
hat seine Wärme mit dem Rauch gemischt und der<br />
hängt an der Rundholzdecke. Dieses bedeutet,<br />
draußen jagt uns die eisige Kälte in den Unterstand<br />
und im Unterstand jagt uns der beißende Rauch<br />
hinaus ins Freie. Gesägte Rundhölzer mit Holzstangen<br />
bilden zusammen halbwegs geeignete Sitz und<br />
Liegeflächen. Gegen den Qualm schütze ich mich<br />
mit dem vom Militär gelieferten, gestrickten Ohrenschützer,<br />
den ich mir ganz über das Gesicht ziehe.<br />
Die Ohrenschützer bestehen aus einem dehnbaren,<br />
gestrickten Schlauch. Dieser wird über den Kopf<br />
gezogen, wobei das Gesicht frei bleibt. An die Kälte,<br />
an den frischen Schnee, der in der letzten Nacht<br />
gefallen ist, an den Dreck gewöhnen wir uns<br />
schnell. Gestern haben wir zusätzlich zu unserer<br />
normalen Uniform eine dickere, innen weiße und<br />
außen mit Tarnmusterung versehene Zusatzkleidung<br />
erhalten. Diese Bekleidung hält, wie es sich<br />
beim ersten Einsatz herausstellt, nur kurzfristig etwas<br />
die Kälte ab. Nach wenigen Stunden dringt<br />
schon die Nässe bis auf die Haut durch. Sie kriecht<br />
uns bis in die Knochen. Die sehr eingeschränkten<br />
Bewegungsmöglichkeiten in den Löchern und in der<br />
dicken Uniform erziehen uns, nun auch Kälte und<br />
Nässe des Winters zu ertragen. Bei dem Sauwetter<br />
lassen uns sogar unsere Läuse in Ruhe. Was aber,
239<br />
wenn es draußen warm wird? Darüber schweigen<br />
wir. Keiner der Kameraden hat sich über die Nässe<br />
und Kälte geäußert. Nur nicht negativ auffallen.<br />
Sonst kommen unweigerlich die Pferde und ihre<br />
großen Köpfe ins Spiel von wegen Denkens. Nach<br />
kurzer Zeit, so nach zwei Tagen, sind wir wieder auf<br />
der Suche nach neuen Plätzen, an denen wir uns<br />
wieder mit dem Eingraben beschäftigen. Wir dürfen<br />
auf keinem Fall müde werden. Was uns gut tut ist<br />
Marschieren und mit unseren Feldspaten verschieden<br />
große Löcher in die Erde graben. Nach Tagen<br />
und Nächten in den neuen Löchern sind wir froh,<br />
wieder -in unseren aufgeweichten Stiefeln- in unseren<br />
Wald zu kommen, wo wir noch immer den Besuch<br />
einer „U 2“ in den Nächten haben. An das häufige<br />
Schneetreiben haben wir uns gewöhnt. Bisher<br />
sind wir von Angriffen der sowjetischen Armee verschont<br />
geblieben. Gelegentlich hören und sehen wir<br />
ihr Störfeuer. Ich erinnere mich an die Bauernstube<br />
in Günterberg, da war es noch am besten, da haben<br />
wir auf Stroh schlafen können. Das war in den ersten<br />
Tagen in der Natur, außerhalb einer ordentlichen<br />
Kaserne. Wir leben in vollem Vertrauen darauf,<br />
dass unsere Verantwortlichen alles richtig machen.<br />
Vertrauen ist das, was wir noch haben. Wir<br />
behalten es aber in uns unter Verschluss. Unser<br />
Kompaniechef, Oberleutnant T. kommt heute auf<br />
einem Apfelschimmel angeritten. Er begleitet uns<br />
jetzt wie ein Feldherr seine (Armee) von Biesenbrow<br />
nach Günterberg. Am Ende des Tages begleitet<br />
er uns zurück. Seitlich abgesetzt wiegen sich<br />
beide Körper unharmonisch über den Acker dahin.<br />
Für die Marschordnung der Kompanie sind die Zugführer,<br />
die Leutnants, zuständig. Diese geben die
240<br />
Kommandos, wenn der Alte nicht dabei ist. Eines<br />
Tages zeigt uns der Chef, wie gut er mit seinem<br />
Pferd harmoniert. Er will uns sein Können vorführen.<br />
Im Galopp preschen beide über das leicht gefrorene<br />
Gelände heran und setzen vor einem Straßengraben<br />
zum Sprung an. Zack! Der Gaul setzt<br />
über den Straßengraben. Ja, er sollte! - - - Ja, Er<br />
sollte es ja auch. - -Ich kann es nicht beurteilen, ob<br />
der Absprung wirklich stimmt, der Graben nicht zu<br />
tief oder zu breit war. Das Pferd steht plötzlich wie<br />
aus einem Guss, so als wäre es vom Blitz getroffen,<br />
fest auf der Absprungstelle. Oberleutnant T. hat den<br />
großen Sprung über den Graben allein ausgeführt.<br />
Von einer eleganten Landung auf dem schneebedeckten<br />
Sommerweg war nicht zu sprechen. Unbeirrt<br />
marschieren wir weiter. In uns allen, das behaupte<br />
ich einfach, hat sich, wenn auch nur für einen<br />
Moment Schadenfreude entwickelt. Jetzt humpelt<br />
er gramgebeugt, auf den Spazierstock gestützt,<br />
herum. Wir sehen sein schmerzverzerrtes Gesicht.<br />
Der Offizier, der sich auf den Spazierstock abstützen<br />
muss, kommt sich auch noch vor wie der personifizierte<br />
„Alte Fritz“. Oberleutnant T. im Augenblick<br />
jedenfalls ein Quell der Heiterkeit, kommt nun<br />
ohne seinen Apfelschimmel. Der bleibt zunächst<br />
verschwunden. Ich denke: das Pferd wird sich von<br />
der Attacke erholen müssen. Vielleicht hat er auch<br />
das Pferd, wie damals den Hund in der Kiesgrube,<br />
aus Wut erschossen. Uns ist der Pferdepfleger, ein<br />
Obergefreiter, erhalten geblieben. Er ist der einzige<br />
Soldat mit Fronterfahrung. Nach einer Verwundung<br />
ist er zu uns gekommen. Mit unseren Übungen zwischen<br />
Biesenbrow und Günterberg, unseren Erdarbeiten<br />
im Gelände und den Aufenthalten in unserem
241<br />
Wald, sind wir pausenlos in Bewegung und voll beschäftigt.<br />
Mit Fug und Recht werden wir später<br />
einmal sagen können: wir hätten den Welsebruch<br />
mit unseren Feldspaten allein umgegraben. Eines<br />
Abends haben sie uns in Günterberg in einem geschlossenen<br />
Hof einen Farbfilm „Das Bad auf der<br />
Tenne“ gezeigt. Einsetzendes Störfeuer der sowjetischen<br />
Artillerie unterbricht jeden Filmabend. Wir<br />
haben uns mit dem gezeigten Teil, es war vielleicht<br />
erst der Anfang der zweiten Filmrolle, zufrieden gegeben.<br />
In Günterberg habe ich gegen meine Absicht,<br />
nie wieder diesen blöden Kunsthonig zu essen,<br />
verstoßen. Mein Magen hat sofort rebelliert.<br />
Das mir zustehende eine Drittel eines Kommissbrotes<br />
habe ich in meinen Brotbeutel gesteckt. Ich<br />
werde es in den nächsten Tagen als Zubrot verzehren.<br />
An die folgende Episode erinnere ich mich sehr<br />
genau: Wie es zu dem Treffen mit der Frau des<br />
Schulmeisters kam, das weiß ich nicht mehr. Ich<br />
denke: sie hat mich angesprochen und mich zum<br />
Mittagessen eingeladen. Dieses habe ich als Soldat<br />
ablehnen müssen. Ich bat sie, mir von meinen hartgewordenen<br />
Brotresten eine Brotsuppe zu kochen.<br />
Mein Kochgeschirr, angefüllt mit der Suppe habe<br />
ich zur verabredeten Zeit, innerhalb der Mittagspause<br />
dankend entgegen genommen. Da waren kein<br />
Zucker, kein Kakao und keine Früchte in der Brotsuppe.<br />
Vor Hunger hat mir die leicht gesalzene dicke<br />
Suppe gut geschmeckt. Soldaten unserer Kompanie<br />
haben jetzt im Winter eine Kartoffelmiete eines<br />
Bauern aufgebrochen und daraus Kartoffeln<br />
geklaut. Der Inhalt der Miete, die Kartoffeln waren<br />
alle gefroren und damit nicht mehr essbar. Dieser<br />
Einbruch in den Vorrat an Nahrungsmittel fremder
242<br />
Eigentümer ist vom Militär nicht weiter verfolgt worden.<br />
Ich muss noch den Schluss der Filmvorführung<br />
ergänzen. Bis zum endgültigen Abzug aus dieser<br />
Gegend benutzen wir die im Film eingesetzte Floskel<br />
‚Bombolo’ als Gruß. Kameraden aus unserer<br />
Einheit erwidern den Gruß mit ‚Avanti’. Tage später<br />
kommen wir zu dritt von einem Spähtrupp zurück.<br />
Mit gewaltigem Hunger ziehen wir drei Mann in den<br />
Wald. Wir müssen auf unser Essen warten. ‚Kameraden,<br />
heute gibt es jede Menge Suppe’, ruft einer<br />
unserer Kameraden frohgelaunt in den Wald. Tatsächlich,<br />
in den Essenskübeln ist an diesem Abend<br />
mehr dicke Kartoffelsuppe als sonst üblich. Und<br />
heute sind Fleischstücke darin. Die Kochgeschirre<br />
werden abgefüllt. Jeder von uns beeilt sich und<br />
sucht sich einen geeigneten Platz auf dem Waldboden.<br />
Schon ist der Löffel in der Hand. Gierig stürzt<br />
sich jeder auf sein Essen. Bah, - - was für ein Hundefraß?<br />
- - Kein Wunder, soviel Essen war doch<br />
noch nie für die über Tage abwesenden Kameraden<br />
übrig geblieben. Man hätte es ja wissen müssen.<br />
Das Essen ist mit der Rache des Oberleutnants T.<br />
gekocht. Diese nicht mundgerechten Fleischstücke<br />
stammen von seinem Gaul. Uns dienen sie jetzt als<br />
Wurfgeschosse. Ob all die anderen Kameraden das<br />
Essen genossen haben bezweifele ich stark. Das<br />
Saubermachen des Kochgeschirrs und des Essbestecks<br />
ist eine äußerst delikate Angelegenheit.<br />
Es gibt nur Essen, wenn jeder ein sauberes Kochgeschirr<br />
beim Appell vorzeigt. Das Reinigen ist jedoch<br />
äußerst schwierig. Angetrocknete Essensreste<br />
aus dem Kochgeschirr zu entfernen, ist fast unmöglich.<br />
In unserem Wald gibt es kein Wasser. Dagegen<br />
haben wir keinen Mangel an feinem Sand. Am
243<br />
Ende ist jedes Kochgeschirr zum Essensempfang<br />
blitzsauber. Mit dem Schnee kommen weitere<br />
physische Belastungen auf uns zu. Der Schnee hat<br />
draußen in der Nacht wieder alles zugedeckt. Vom<br />
Wacheschieben in den nassen Stiefeln zeigen sich<br />
bei den Trägern die ersten Anzeichen von Frost an<br />
den Füßen. Für uns gibt es keine andere Möglichkeit,<br />
als die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten.<br />
Eine Krankmeldung ist für uns nicht drin.<br />
Die Füße sind ja noch dran. Nicht nur meine Stiefel<br />
haben Risse vom Stacheldraht. Auch ich habe an<br />
den großen Zehen die ersten Zeichen von Frost. Ich<br />
versuche, andere Stiefel zu bekommen. Mein Zugführer,<br />
Leutnant, ein angeberischer Wichtigtuer, will<br />
mir neue Schnürstiefel besorgen. Morgen bin ich in<br />
Berlin sagt er mir. Welche Größe? 48 sage ich. Sie<br />
leben auf verdammt großem Fuß, meint er. Zwei<br />
Nächte später fliegen mir, mit dem Aufruf meines<br />
Namens, ein Paar neue, eingefettete Stiefel auf<br />
meine Decke, unter der ich fest schlafe. Ich bin froh<br />
über die Stiefel und bedanke mich. Für seinen persönlichen<br />
Einsatz will er dann auch täglich mehrmals<br />
von mir gelobt werden. Es ist schon ein Maulheld,<br />
unser Zugführer. Ein junger Leutnant der es<br />
versteht nach oben zu buckeln und nach unten zu<br />
treten. Er ist jeden Tag mit seinen wilden Sprüchen<br />
unterwegs. Wir sollen uns darauf einstellen. Er sieht<br />
bereits vor seinen Augen: ‚Die auf der Ostseite der<br />
Oder festsitzenden sowjetischen Truppen sind mit<br />
aller Kraft zu vernichten’. Er ist der Auffassung,<br />
dass die Sowjets nicht fähig seien, hierher zu kommen.<br />
Er spricht ständig von den bolschewistischen<br />
Untermenschen, die es zu vernichten gilt. Wir machen<br />
uns über sein Gerede keine Gedanken. Vor
244<br />
Tagen haben wir eine Kolonne sowjetischer Kriegsgefangener<br />
gesehen. Sie sind mit Sicherheit in<br />
ihren braunolivfarbenen Uniformen schon einige<br />
tausend Kilometer bis hierher an die Oder gelaufen.<br />
Es ist nicht erkennbar, was sie unter ihren unterschiedlich<br />
langen, verdreckten und zerschlissenen<br />
Mänteln tragen. Mit einem groben Strick Wäscheleine<br />
halten sie ihre Kleidung zusammen. Mit breiten<br />
Käppis, verdecken sie ihre kahlgeschorenen<br />
Köpfe. An den Schultern oder auf dem Rücken<br />
hängen Beutel. Runde, verbeulte, vom offenen<br />
Feuer schwarz gefärbte Blechbehälter mit Tragebügel<br />
sind am Körper festgemacht. An einer Abfallgrube<br />
greifen sie nach Essensresten. Die sind dort<br />
wahrscheinlich vor ein bis zwei Tagen abgekippt<br />
worden. Schnell füllen sie ihre Blechbehälter. Wo<br />
kommen die Sowjets plötzlich her? Ich verstehe es<br />
nicht, wie können die plötzlich neben uns erscheinen.<br />
Es ist uns verboten, sie anzusehen, doch ich<br />
sehe sie aus den Augenwinkeln an. Das sind unsere<br />
schlimmsten Feinde, die wir vernichten müssen.<br />
Das wird uns täglich verbal vermittelt. Doch den<br />
Feind so unvermittelt zu sehen, ihn auf menschliche<br />
Art so nahe zu spüren? Ich kann es nicht beschreiben.<br />
Ich nehme sie doch als Lebewesen zur Kenntnis.<br />
Sie wirken abgestumpft und gesichtslos. Sie<br />
tragen ihre Köpfe geneigt. Der eine oder andere<br />
Kriegsgefangene könnte wohl bei einem Blickkontakt<br />
mit einem meiner Kameraden oder mit mir aus<br />
der Kolonne herausgeholt werden. Ich meine: Jeder<br />
einzelne dieser Kriegsgefangenen hat seit seiner<br />
Festnahme Angst. Unsere Machthaber haben die<br />
Sowjets zu Untermenschen erklärt. Sie sind unsere<br />
ärgsten Feinde. Besser gesagt: Für uns existieren
245<br />
sie nicht. Deshalb beachten wir sie nicht. In mir hat<br />
ihre Anwesenheit Erschrecken verursacht. Die<br />
Kriegsgefangenen entfernen sie sich langsam von<br />
uns. Was sie an den Füßen tragen, daran habe ich<br />
keine Erinnerung. Wohin sie marschieren, was mit<br />
ihnen geschehen wird, liegt im Dunkeln. Warum bei<br />
den sowjetischen Soldaten die Köpfe kahlgeschoren<br />
wurden, ist mir nicht bekannt. Auch die „Deutsche<br />
Wochenschau“ zeigt nur gefangene Sowjets<br />
mit kahlgeschorenen Köpfen. Meine Kameraden<br />
haben sie auch gesehen, aber sie haben ebenfalls<br />
nie ein Wort über diese Menschen verloren. (es sind<br />
unsere Feinde, die müssen vernichtet werden) ‚Die<br />
Sowjets kommen nicht über die Oder’.Diese Aussage<br />
habe ich noch in meinen Ohren. Unser Zugführer<br />
hat uns heute Morgen nach dem Appell, als seine<br />
Tatsache zum wiederholten Mal lang und breit erklärt.<br />
‚Die Sowjets schaffen das einfach nicht’. ‚Ich<br />
freue mich, gemeinsam mit Ihnen, gegen die Sowjets<br />
für unser Vaterland zu kämpfen’. Vom zehnten<br />
Lebensjahr, das heißt: Von unserer Kindheit an,<br />
sind wir doch zum absoluten Gehorsam erzogen<br />
worden. Dieses bedeutet, uns ist von Anfang an, ab<br />
dem zehnten Lebensjahr die Möglichkeit ‚zu Denken’<br />
verschlossen Als Luftwaffenhelfer haben wir<br />
auf die Bomber unserer Feinde geschossen. Wir<br />
haben ihre Bomber abgeschossen. Wir sind zum<br />
Töten ausgebildet und erzogen worden. Damals fiel<br />
uns das Töten unserer Feinde nicht schwer. Die<br />
Bomber waren ja weit von uns entfernt. Jetzt, hier<br />
hinter der Front, sind wir noch nicht zum wirklichen<br />
Töten eingesetzt. Unser Eid und der Befehl unserer<br />
Vorgesetzten werden meine Kameraden und mich<br />
in dem Augenblick zum Töten zwingen, wenn sie
246<br />
uns den Befehl dazu geben. Gestern Morgen hat<br />
sich unser Leutnant und Zugführer krank gemeldet.<br />
Er müsse sich im Lazarett seinen verstauchten<br />
Rücken behandeln zu lassen, heißt es beim Morgenappell.<br />
‚Wer weiß schon, wobei der sich seinen<br />
Rücken verstaucht hat’. Wir sind uns in unserem<br />
Zug, ohne dass wir darüber nachdenken müssen<br />
einer Meinung: Der ‚Ausbilder-Leutnant’, unser Zugführer,<br />
muss irgendwo etwas früh genug gehört haben,<br />
dass die Kompanie und das Bataillon vor einem<br />
Fronteinsatz steht. Dieses militärische Wissen<br />
hat ihm die Entscheidung ermöglicht, sich vor dem<br />
eigenen Einsatz zu verdrücken. Dafür geht man<br />
schon gern ins Lazarett. Bei uns heißt es: ‚Von wegen,<br />
Zentner schwere Weiber stemmen und nun<br />
liegt er daneben’. So geht es durch unseren Zug.<br />
Wir hören noch: ‚Der Leutnant will alles daran setzen,<br />
damit er schnell wieder zu uns kommen kann’.<br />
Beim Morgenappell erfahren wir in einem Nebensatz<br />
von seinem Abgang ins Lazarett. „Gott sei<br />
Dank, den sind wir los. Den werden wir bestimmt<br />
nie wieder sehen“. Ich erinnere mich noch genau,<br />
es war Mitte April 1945. Während des Morgenappells<br />
macht sich Unruhe in unserer Kompanie breit.<br />
Unsere Vorgesetzten überrumpeln uns mit Meldungen<br />
und Kurzfassungen von Befehlen. Alles dauert<br />
eine gute halbe Stunde. Der eine und der andere<br />
Zug der Kompanie wird plötzlich in Windeseile neu<br />
durchgemischt. Jetzt sind andere Gruppierungen<br />
der Gruppen in neuen Zügen entstanden. Mein alter<br />
Kumpel Heinz. Kl. aus Fürth ist aus meiner Gruppe<br />
herausgenommen worden. Er wird zu einer Panzerbegleitkompanie<br />
abkommandiert. Wir, die wir von<br />
Anfang an seid Berlin zusammen sind, werden von-
247<br />
einander getrennt. Es gibt noch nicht einmal ein<br />
„Mach es gut Kumpel“. Wir verlieren uns innerhalb<br />
eines Augenblicks endgültig aus den Augen. Mit<br />
einem Wiedersehen rechnet keiner mehr. Meine<br />
Hoffnung auf eine Rückkehr aus dem Krieg begleitet<br />
ihn. Er wollte nach dem Krieg Förster werden, so<br />
hatte er es mir mehrmals erzählt. Ich denke, er wäre<br />
der richtige Mann für unseren Wald. In Gedanken<br />
rufe ich ihm nach: „Mach es gut alter Kumpel“. Doch<br />
das alles ist im nächsten Moment schon vorbei und<br />
vergessen. Nun wird es ernst für mich. Ich spüre es.<br />
Da braut sich etwas zusammen. Was wird auf uns<br />
zukommen? Am 18. April 1945 transportiert man<br />
uns zum Bahnhof von Angermünde. Unsere Waffen<br />
und Sturmgewehre werden neuen, jungen Soldaten<br />
übergeben. Wie ich mitbekomme, sollen unsere<br />
Nachfolger im Schnellverfahren zum Fronteinsatz<br />
ausgebildet werden. Ich kann es nicht nachvollziehen.<br />
Wo kommen den unsere Nachfolger her? Ich<br />
erfahre es nicht. Außerhalb des Bahnhofs nimmt<br />
uns ein Transportzug auf. Die Länge des Zuges<br />
kann ich nicht ausmachen, weil der Zug in einer<br />
Rechtskurve steht. Für unsere Verladung gibt es<br />
keinen Bahnsteig. Bis auf unsere Waffen sind wir<br />
feldmarschmäßig ausgerüstet. Der Zug besteht aus<br />
Personenwagen 3. Klasse und gedeckten Güterwagen.<br />
Mir kommt unsere Verladung in den Zug wie<br />
eine heimliche Abreise vor. Wir erfahren nichts. Es<br />
geht alles ohne Lärm, auf Kommando. Und wir eignen<br />
uns für die Verladung in den Truppentransportzug,<br />
wie ein gut eingearbeitetes und geöltes Werkzeug.<br />
Meine vor zwei Tagen zusammengestellte<br />
Gruppe sitzt in einem Abteil der 3. Klasse. Wir warten.<br />
- - - Gegen 15°° Uhr setzt sich unser Zug, lang-
248<br />
sam in Bewegung. Wir fahren, wie wir jetzt von unserem<br />
Gruppenführer hören, in Richtung Berlin.<br />
Werden wir jetzt in Berlin bleiben? Werden sie uns<br />
in Berlin verheizen? Oder wohin geht unsere Reise?<br />
Haben wir nur eine Schonfrist im Welsebruch gehabt?<br />
Wir sind zum Kriegsdienst und zum Töten<br />
unserer Feinde ausgebildet. Unser Bataillon ist für<br />
den Fronteinsatz abgenommen. Was uns nun noch<br />
fehlt, ist der Fronteinsatz. Was jetzt kommt, wissen<br />
wir nicht. Wir sind eingespannt im militärischen Teil<br />
unseres Lebens. Wir ahnen etwas Unaussprechliches.<br />
Was sollen wir aussprechen, dass wir noch<br />
nicht einmal formulieren können? Nur keine Gedanken<br />
machen. Ich beginne - mit der Verdrängung der<br />
Unwägbarkeiten. Spielt da Angst mit, die wir laut<br />
Eid nicht haben dürfen? Am Ende dieser Gedanken<br />
wird stehen: Wir wissen nichts und wollen auch<br />
nichts wissen. Seltsame Sinneswahrnehmungen<br />
habe ich: In mir wird aktiviert, was im nächsten Augenblick<br />
schon wieder verdrängt ist. Mir ist, als wäre<br />
ich gleichzeitig auf verschiedenen Bühnen des Lebens<br />
in Aktionen verwickelt. Ob wir eines Tages<br />
wieder frei sein werden, uns ohne militärischen<br />
Zwang bewegen werden können?<br />
Dieser Gedanke, Frage und Antwort<br />
kann sich in mir nicht entwickeln.<br />
Das steht alles in den Sternen. Der bisher ruhig verlaufende<br />
sonnige Tag zeigt sich mir verstaubt und<br />
abgenutzt. Wir erreichen Berlin-Weißensee. Auf<br />
freier Strecke bleiben wir für Momente stehen. Dann<br />
rollt der Zug langsam weiter. Auf einem parallel laufenden<br />
Gleis bewegt sich ein anderer Militärtrans-
249<br />
portzug. Der zieht mit steigender Geschwindigkeit<br />
an uns vorbei. Der, hauptsächlich aus Flachwagen<br />
bestehenden Zug befördert Panzerfahrzeuge, Halbkettenfahrzeuge,<br />
10,5 cm Geschütze und LKWs.<br />
Die Kameraden von der anderen Feldpostnummer<br />
liegen und stehen zwischen ihrem Kriegsmaterial.<br />
Einige lassen ihre Beine von den Waggons herabbaumeln.<br />
Jeder Feldgraue hat es sich auf seine<br />
Weise bequem gemacht. Die Männer machen auf<br />
mich einen erschöpften Eindruck. Sie nehmen von<br />
uns kaum Notiz. Sind sie auf dem Wege zu einem<br />
Einsatz? Während der Bahnfahrt können sie sich für<br />
eine Zeit wenigstens von den Strapazen erholen.<br />
Nach einigen Augenblicken haben wir sie endgültig<br />
verloren. Der Tag, es ist der 18. April löst sich endlich<br />
auf. Wir taumeln in den tiefen Schlaf oder dösen<br />
vor uns hin. Schlagartig einsetzender Geschützlärm<br />
reißt uns brutal aus dem Schlaf, zurück in die Realität.<br />
Ich höre das Bellen schwerer Flakgeschütze.<br />
Unser im Schritttempo dahin rollender Zug stoppt<br />
abrupt. Auf Befehl stürzen wir hinaus und gehen<br />
nach wenigen Schritten in Deckung. Vor Aufregung<br />
sind wir hellwach, doch die Müdigkeit zwingt uns zur<br />
Ruhe. Mit dem Kommando ‚Achtung!’ jagen wir in<br />
den Zug zurück. Wir führen in einem physisch und<br />
psychisch empfundenen Dämmerzustand Befehle<br />
aus wie Hampelmänner. Es dauert nicht lange,<br />
dann liegen wir wieder neben dem Zug. Dieses<br />
Spiel wiederholt sich in der Nacht mehrmals. Wir<br />
haben vom Morgen des 18.April bis jetzt bei Anbruch<br />
des neuen Tages, es ist der 19.April weder<br />
etwas zu trinken noch zu essen bekommen. Wir,<br />
meine Gruppe und ich sind wie gerädert. Und da<br />
sind dann auch Kameraden mit uns auf der Fahrt,
250<br />
die wohl nie schlafen. Wie oft wir schlaftrunken den<br />
Transportzug über Nacht verlassen haben, weiß ich<br />
nicht mehr. Ich spüre keinen Hunger und keinen<br />
Durst. Meine Sinneswahrnehmungen sind vollkommen<br />
abgeschaltet. Ich empfinde alles um mich herum<br />
gehüllt in eine riesige, undefinierbare, farb- und<br />
geräuschlose Dunstglocke. Das Sprechen findet<br />
nicht mehr statt. Die Nacht zum 19. April 1945 geht<br />
schleppend vorbei. Mir ist, als hätten mehrere<br />
Nächte zur gleichen Zeit stattgefunden. Die Sonne<br />
zeigt uns den neuen Tag. Alles erscheint hell und<br />
freundlich. Man merkt, wie die lähmende Müdigkeit<br />
aus dem Körper schwindet. Der Transportzug rollt<br />
weiter. Vielleicht empfinde ich die Gegenwart des<br />
frühen Morgens für mich nur allein positiv. Kameraden,<br />
wir sind ja mitten in Berlin’ stelle ich überrascht<br />
und mit Verwunderung fest. ‚Wir erreichen gerade<br />
den S-Bahnhof Berlin-Schöneberg’. Und hier hält<br />
der Zug. Die Uhr auf dem Bahnsteig zeigt fast 9°°<br />
Uhr. Einige von uns möchten gern wissen, wo wir in<br />
der letzten Nacht herumgefahren sind. Das kann<br />
doch alles nicht stimmen. Im Norden sind wir gestern<br />
am frühen Abend in Berlin-Weißensee angekommen,<br />
sind dann die Nacht, bis auf die vielen<br />
Halte, doch ständig gefahren. Und jetzt sind wir erst<br />
in Schöneberg? Hier, auf diesem Bahnhof, auf dem<br />
unser Zug nun wieder im Schritt-Tempo weiter fährt,<br />
werde ich zum wiederholtem Mal an meine Zeit als<br />
heranwachsender Jugendlicher in Berlin erinnert.<br />
Den S-Bahnhof Schöneberg kenne ich gut. Es sind<br />
zwei Bahnhöfe, die übereinander angeordnet sind.<br />
Der Zug hält mich fest, obwohl ich ihn gern verlassen<br />
möchte. Aber was soll ich denn noch hier? Meine<br />
Familienangehörigen sind ausgebombt. Ob sie
251<br />
wohl noch leben? Weiter gehen meine Gedanken<br />
nicht. Mein Berlin steht jetzt, während wir durch den<br />
Bahnhof von Schöneberg fahren, wohl vor seiner<br />
endgültigen Vernichtung. Einen Untergang der<br />
Reichshauptstadt, mit den über vier Millionen Einwohnern,<br />
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.<br />
Welch eine Schmach wäre das! Die jahrelangen<br />
Bombenangriffe, die gewaltigen Zerstörungen in der<br />
Stadt, und jetzt kommen auch noch die Sowjets mit<br />
ihren Truppen, Geschützen und Panzern. Sie werden<br />
mein Berlin vernichten, es dem Erdboden<br />
gleichmachen. So stelle ich mir den Untergang vor.<br />
Die sowjetische Artillerie soll bereits, heute ist der<br />
19.April 1945, die östlichen Stadtteile beschießen.<br />
Ich habe hier kein Artilleriefeuer wahrgenommen.<br />
Die Entfernung von hier bis zum Osten Berlins wird<br />
sicher um die 20 Kilometer betragen. Wird man so<br />
ein großes Gebiet, diese Fläche, das gesamte Berlin,<br />
überhaupt einschließen können? Das kann ich<br />
mir nicht vorstellen. Was wird mit all den Menschen<br />
geschehen, die dann in der Falle sitzen? In der Zeit,<br />
wo ich mich mit der Reichshauptstadt beschäftige,<br />
rollt unser Transportzug immer weiter. Weiter, immer<br />
weiter geht unsere Fahrt in den Tag und weiter<br />
ins Ungewisse. Jeder von uns hat seine eigene<br />
Angst. Von meinen Kameraden spricht keiner von<br />
seinen Empfindungen. Es wird alles verdrängt. Uns<br />
ist es verboten, Angst zu haben, das nationalsozialistische<br />
System hat sie uns ausgetrieben. Wie<br />
könnten wir sie zeigen? Wir, die wir alle seit vielen<br />
Jahren gleichgeschaltet sind, haben die uns verordnete<br />
„Sicherung“ damals, mit zehn Jahren, eingebaut<br />
bekommen. Wir sind und leben systemabhängig.<br />
Das System ist eine Art Käfig, der jeden Einzel-
252<br />
nen von uns innerhalb der Gemeinschaft fest umschließt.<br />
Ohne unser System können wir nicht<br />
bestehen. Unser Zug rollt weiter. Jetzt nähern wir<br />
uns dem Bahnhof Berlin-Oberschöneweide. Der<br />
Name wird nur durch Bahnhofsschilder bekannt.<br />
Augenblicke nach dem letzten Schild hält unser<br />
Transport auf freier Strecke. Wohnhäuser sehen wir<br />
nicht. Mit leerem Magen sehen wir mit müden Augenpaaren<br />
in die Gegend, ohne tatsächlich etwas<br />
zu sehen. Wir erkennen nicht einmal, wenn wir uns<br />
dabei gegenseitig anschauen. Gegen 14°° Uhr rollt<br />
es uns weiter in Richtung Süden. Werden wir über<br />
eine Nebenstrecke wieder in die Reichshauptstadt<br />
rollen, dann im östlichen Teil unserer Reichshauptstadt<br />
zum Kriegseinsatz kommen, oder geht unsere<br />
Fahrt fort von hier? Nach einigen Fahrminuten ist<br />
klar: Wir werden nicht in Berlin bleiben. Aber wohin<br />
fahren wir? Wir passieren „Königs-Wusterhausen“.<br />
Mir ist der Ort wegen des „Deutschlandsenders“ auf<br />
der Langwelle bekannt. Die Fahrt führt uns weiter<br />
über Lübben, nach Lübbenau. Dort bleibt unser<br />
Transportzug auf dem Bahnhof, an einem überdachten<br />
Bahnsteig, für eine längere Zeit stehen.<br />
Soweit ich das Bahnhofsgelände von meinem Fensterplatz<br />
einsehen kann, rührt sich hier nichts. Hier<br />
herrscht wieder eine trügerische Ruhe. Selbst die<br />
Luft scheint sich nicht zu bewegen. Das Gefühl von<br />
Durst und Hunger kommt wieder auf. Unerwartet<br />
werden wir von lauten Stimmen auf dem Bahnsteig<br />
abgelenkt, und so treten Hunger und Durst wieder<br />
in den Hintergrund zurück. Was gibt es da zu erfahren?<br />
Zunächst kommen nur einzelne der vorbeifliegenden<br />
Wortfetzen an unsere Ohren. Was wird jetzt<br />
auf dem Bahnsteig, unmittelbar unterhalb des Fen-
253<br />
sters, an dem ich sitze, gesprochen? Wir lauschen<br />
gemeinsam und gespannt. Das Zugpersonal<br />
befindet sich in einer lauten und heftigen Auseinandersetzung<br />
mit unserem Transportoffizier. Wir sehen<br />
diesen Major, mit leicht ergrautem Haar, hier<br />
auf dem Bahnsteig zum ersten Mal. Der Zugführer<br />
der Reichsbahn meldet dem Transportoffizier: ‚Die<br />
Reichsbahn kann die Weiterfahrt dieses Transportzuges<br />
nicht verantworten’. Es folgt die Begründung:<br />
‚Fliehende Menschen kommen aus Richtung Süden<br />
und Osten. Sie kommen mit ihren Habseligkeiten<br />
auf Handwagen, Schubkarren und in Kinderwagen<br />
verstaut’. Deswegen verweigert der Zugführer, der<br />
für den Zug und das Reichsbahn-Personal verantwortlich<br />
ist, die Weiterfahrt in die Richtung aus der<br />
die Fliehenden Menschen kommen. Ich sehe und<br />
höre ohne hinzuschauen, wie der Major seine Pistole<br />
zieht. Er zielt auf den Zugführer und befiehlt, sofort<br />
den bestehenden Befehl auszuführen. „Setzen<br />
Sie den Transportzug sofort in Marsch!“ Es war das<br />
einzige Mal, dass der Major den Zugführer angebrüllt<br />
hat. Alle Eisenbahner in Uniform tragen ihre<br />
Stahlhelme, unter ihnen ist auch eine Frau. Sie ziehen<br />
sich in ihr Abteil zurück. Der Transportführer<br />
bewegt sich zu seinem Abteil und steigt wohl als<br />
letzter in den anfahrenden Zug. Jetzt geht es ohne<br />
Unterbrechung, wenn auch anfangs zögerlich, weiter.<br />
Unser Zug rollt langsam aus dem Bahnhof von<br />
Lübbenau. Er verlässt nach Überquerung der<br />
Hauptstraße die Richtung nach Cottbus und rollt,<br />
Boblitz linker Hand passierend, weiter in Richtung<br />
Calau. Ich schreibe nun eine Art Protokoll des Majors,<br />
das es in dieser Form natürlich nicht gegeben
254<br />
hat. Ich beabsichtige mit meinem Protokoll, mich in<br />
die Gedanken und Empfindungen des Majors<br />
einzufühlen und sie mir für diesen Bericht hier anzueignen.<br />
„Was werden uns die Flüchtlinge bedeuten, die angeblich<br />
vor sowjetischen Truppen, die doch niemand<br />
von uns gesehen hat, die auf der Flucht sein<br />
sollen. Das sind doch hier alles nur Zivilisten. Mich<br />
interessiert nur mein Transport. Der Zugführer hat ja<br />
einsehen müssen, dass er sich wirklich nicht mit<br />
seinem Haufen den Befehlen des Militärs widersetzen<br />
kann. Der hat sich doch am Ende freiwillig, ja<br />
freiwillig, meinem Befehl unterworfen. Um meinen<br />
Auftrag zu erfüllen, hätte ich den Mann glatt umgelegt.<br />
Denn für die Reichsbahn, die den Weitertransport<br />
nicht durchführen wollte, hätte ich mich doch<br />
niemals vor das Kriegsgericht bringen lassen. Mein<br />
Zug fährt nach Senftenberg, dorthin, wo hin er<br />
muss. „Mag da kommen, was da will. Meinen Befehl<br />
werden die von der Reichsbahn schon ausführen.<br />
Wo kommen wir hin, diese Eisenbahner haben uns<br />
doch überhaupt nichts zu melden“. Ich kann mich<br />
nicht beruhigen. Von unserem Geschäft, haben diese<br />
Zivilisten doch überhaupt keine Vorstellung. Die<br />
haben nur das zu tun, was wir von ihnen verlangen.<br />
Befehl ist Befehl. Und der Befehl kommt von mir.<br />
Ich bin noch lange nicht mit den Reichsbahnern am<br />
Ende. Mit dem wiederholten Ausruf: „Befehl ist Befehl“<br />
kann ich mich wieder beruhigen. „Befehl ist<br />
Befehl!“ Damit festige ich meinen Dienstrang. Diese<br />
Leute von der Reichsbahn, - - und diese Flüchtlinge,<br />
wohin soll ich denn meine Gedanken noch lenken.<br />
„Wir müssen die Sowjets besiegen, das ist un-
255<br />
ser Auftrag“. Dieser Befehl schwirrt mir trotz aller<br />
Anstrengung immer durch den Kopf. „In Senftenberg,<br />
da können die vom Stab mit dem Zug und den<br />
Soldaten von mir aus machen, was sie wollen“. Nun<br />
habe ich meine innere Kraft wieder gefunden. Mein<br />
Stolz kommt wieder. Mit meinem nach links und<br />
rechts gelenkten Augenpaar streichele ich über<br />
meine Schulterstücke. Bei meinem nächsten Kasinoabend<br />
werde ich meinen Offizierskameraden zeigen,<br />
was ich für ein tüchtiger Offizier bin. „Bis Senftenberg<br />
habe ich das Kommando über den Zug und<br />
die Truppe!“.<br />
Dass dieses Protokoll annähernd den Gedanken,<br />
des Majors entspricht, das möchte ich annehmen.<br />
So, oder so ähnlich, hat er sich selbst Mut gemacht.<br />
Auf dem Bahnhof in Lübbenau sickern die ersten<br />
Informationen durch. Wir werden über Calau nach<br />
Senftenberg fahren. Unser Transport gehört zur<br />
Neuaufstellung der „Division Hermann Göring“. Der<br />
Raum Bad Muskau wird als erster Einsatzort genannt.<br />
Wer weiß schon wie weit es von hier aus<br />
nach Senftenberg ist, und wie lange es dauern wird,<br />
um dahin zu kommen. Und, ehrlich gesagt, ich will<br />
es plötzlich nicht mehr wissen. Ich schiebe auf diese<br />
Weise den Gedanken an den nahenden<br />
Kriegseinsatz von mir. Darüber, dass man verwundet<br />
oder getötet werden kann, ist unter uns nie gesprochen<br />
worden. Jetzt kann ich feststellen, dass<br />
wir schon abgestumpft sind. Wir sind vom ewigen<br />
Hin und Her, auch ohne einen Fronteinsatz stumpf.<br />
„Fronteinsatz, wie ist das, was passiert da?“ Nach<br />
dem mehrfachen Aus- und Einsteigen in der letzten<br />
Nacht haben sich die mehrschichtigen Papiertüten
256<br />
mit den trockenen Zwiebackstücken, unsere „Eiserne<br />
Ration“, im Brotbeutel aufgelöst, und sind zu<br />
Bruch gegangen. Der eine oder andere meiner jungen<br />
Kameraden hat inzwischen, trotz des strengen<br />
Verbotes, einfach vor lauter Hunger, die „Eiserne<br />
Ration“ verschlungen. Mit sehr gemäßigtem Tempo<br />
passieren wir eine Haltestelle mit dem Namen<br />
„Bischdorf“. Ich muss mir den Namen unbedingt<br />
merken. Warum ich ausgerechnet dieses Schild in<br />
mich hineinstopfe, weiß ich nicht. Es ist, wie ich<br />
beim Vorüberfahren merke, nur das Schild vorhanden.<br />
Einen Ort kann ich nicht sehen. Sollte es mir<br />
später möglich sein, mehr über den Ort in Erfahrung<br />
zu bringen, dann werde ich nachschauen. Ich sitze<br />
immer noch rückwärts zur Fahrtrichtung auf der linken<br />
Seite des Abteils. Von diesem Platz aus habe<br />
ich, mit meinem Kameraden gegenüber, die Auseinandersetzung<br />
zwischen dem Reichsbahnpersonal<br />
und dem Transportoffizier auf dem Bahnhof von<br />
Lübbenau erlebt. Unerwartet bremst jetzt unser Zug<br />
und bleibt auf freier Strecke stehen. Auf der linken<br />
Seite in Fahrtrichtung sehen wir eine Böschung. Es<br />
herrscht absolute Ruhe. Nur, was ist das? Man<br />
kann die Lokomotive schnaufen hören. Die in meinem<br />
Kopf aufkommenden Gedanken entfliehen. Wir<br />
lauschen angestrengt auf? Auf was? Ich habe die<br />
Vorstellung, dass wir mehr Sicherheit haben, wenn<br />
der Zug rollt. Warum? Während der Fahrt können<br />
wir nicht aussteigen. Hoffentlich geht es gleich weiter.<br />
Ich verdränge meine Gedanken. Niemand von<br />
uns wird es sich eingestehen, dass wir uns seit Minuten<br />
in einer äußerst komplizierten Lage befinden.<br />
Die Zeit wirkt, als wäre der Zug an den Schienen<br />
festgeschweißt.
257<br />
Warum bleiben wir jetzt stehen?<br />
Wer hat diesen Halt angeordnet?<br />
Hat vielleicht der Zugführer der Reichsbahn eigenmächtig<br />
gehandelt? - - -Oder was ist da vorn los?<br />
Sind dem Transportoffizier, nachdem er seinen „Befehl“<br />
noch einmal gelesen hat, andere Entscheidungen<br />
möglich geworden? - - - Wie könnte eine Verständigung<br />
zwischen dem Transportoffizier und<br />
dem Zug- und Lokführer gekommen sein? Vor innerer<br />
Anspannung sind mir diese Gedanken zu dem<br />
Zeitpunkt des Geschehens nicht gekommen. Mit<br />
einem heftigen Ruck fahren wir nun doch an. Na,<br />
Gott sei Dank, wir fahren. Wohin geht es? Vom Gefühl<br />
her wird der Zug jetzt geschoben. Geht es nun<br />
wieder zurück? Vielleicht doch nach Berlin? Die<br />
Waggons werden über die Puffer, von der Lokomotive<br />
aus, Tender voraus, gedrückt. Unser Zug rollt in<br />
die Richtung, aus der wir gerade gekommen sind.<br />
Auf diesem Teil der Strecke, von Lübbenau bis hier<br />
in der Höhe von Bischdorf, waren wir auf der sicheren<br />
Spur. Bis hier sind wir doch vorhin schon einmal<br />
gefahren. Die nächste Eisenbahnstation Calau, liegt<br />
vor uns auf der Spur, auf der unser Zug noch nicht<br />
gerollt ist. Wir sind von Angermünde bis hier rund<br />
24 Stunden auf der Schiene unterwegs. Also fahren<br />
wir nun doch nach Berlin zurück? Oder was ist jetzt,<br />
ohne weitere Vorwarnung, zu erwarten? Sitzen wir<br />
etwa schon fest? Knirschende und zerreibende Geräusche<br />
begleiten unseren Zug. Ein durch Mark und<br />
Bein dringendes Dröhnen hören wir durch die offenen<br />
Abteilfenster. Das sind Panzer. Die fabrizieren<br />
mit ihren aufheulenden Motoren einen ohrenbetäubenden<br />
Höllenlärm. Zurückblickend auf den<br />
19.04.1945, komme ich hier zu meiner Anmerkung,
258<br />
die den Weg der sowjetischen Panzer beschreiben<br />
kann, die neben uns, etwa parallel zur<br />
Eisenbahnlinie in die gleiche Richtung wie wir mit<br />
unserem Transportzug gefahren sind. Unser Halt<br />
auf freier Strecke ist weder von der Reichsbahn<br />
noch von dem Transportoffizier veranlasst worden.<br />
Ich glaube eher, dass der Lokführer und der Heizer<br />
die vor dem Zug liegende Strecke und Umgebung<br />
besonders intensiv beobachtet haben. Ich glaube,<br />
dass die Männer auf der Lokomotive die sowjetischen<br />
Panzer erkannt haben. Die Rückführung des<br />
Truppentransporters in Richtung Lübbenau erscheint<br />
mir daher logisch. Die sowjetischen Panzer<br />
fahren durch ein Waldgebiet. Der von den Panzerketten<br />
hochgewirbelte Sandboden wird heftig knirschend<br />
zu feinen Staub zermalmen.<br />
Beim Haltepunkt „Bischdorf“ fahren wir jetzt langsam<br />
über die Weiche zurück auf die rechte Fahrspur.<br />
Und hier, an dieser Stelle, fahren wir an ungefähr<br />
fünf offenen Güterwagen vorbei, die auf dem<br />
Gleis stehen, dass wir gerade verlassen haben. Güterwaggons<br />
ohne Lokomotive? Ich habe vor innerer<br />
Aufgeregtheit keine Lokomotive gesehen. Von dem,<br />
was sich jetzt vor meinen Augen zeigt bin ich atemlos<br />
und gefesselt. Auf den mit Kohlestaub verdreckten<br />
Böden der Waggons stehen, sitzen und liegen<br />
auf Tragen, verwundete deutsche Soldaten. Zum<br />
Teil tragen sie frische Verbände. Wo kommen plötzlich<br />
die verwundeten Kameraden her? Waren die<br />
Waggons ursprünglich an unseren Transportzug,<br />
vielleicht in Lübbenau, angehängt worden? Und das<br />
was ich erlebe, sind die Waggons hier an dieser<br />
Stelle, nach einer Fahrt von rund einem Kilometer,<br />
einfach wieder abgekoppelt worden? Ich kann es
259<br />
nicht begreifen, ich habe den Eindruck, man hat<br />
vorsätzlich die verwundeten Menschen an dieser<br />
Stelle einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich fühle<br />
mich beim Anblick der Männer unterdrückt, erschüttert<br />
und geschockt. Ich habe während der schleppenden<br />
Vorbeifahrt an den Waggons in die hohlen,<br />
verzweifelten, traurigen Augen der Männer gesehen.<br />
In ihre hilflosen Augen, die mich und meine<br />
Augen im gleichen Augenblick in voller Verzweiflung<br />
angesehen haben. Ich verspüre ihre tiefe Not. Wer<br />
wird sich jetzt um sie kümmern? Da ist doch kein<br />
Sanitäter, ich sehe jedenfalls keinen, der die Verwundeten<br />
betreuen kann. Und, wie soll der Sani von<br />
einem zum nächsten Waggon kommen? Was ich<br />
hier sehe, das kann ich nicht verstehen. Das gibt<br />
keinen Sinn. Nichts begreife ich. Meine Gedanken<br />
gehen ins Leere. Ich spüre sonst keine Unruhe in<br />
mir. Doch sehr langsam bearbeiten mich meine Gedanken<br />
im Untergrund. Ich empfinde eine in mir<br />
hochsteigende innere Anspannung. Der Pferdepfleger<br />
unseres Kompaniechefs, der Obergefreite, stellt<br />
mit seiner klaren, zutreffenden Aussage fest: „Nun<br />
sitzen wir mitten drin! Mitten, in der verdammten<br />
Sch - - - - - “. Der Rest geht im Lärm von Flugzeugmotoren<br />
unter. Er wird es wissen, er hat als einziger<br />
Fronterfahrung. Unsere Jagd-Maschinen schrauben<br />
sich über unserem Zug in die Höhe. Wir hören sie,<br />
aber schon sind sie wieder verschwunden. Die sowjetischen<br />
Panzer geben uns eine extra geräuschvolle<br />
Vorstellung. Ihre Motoren brüllen in kurzen<br />
Zeitabständen lautstark auf. ‚Mit unserem Geschrei,<br />
so die Sowjets, hämmern wir euch unsere gewaltige<br />
Kraft entgegen’. Wo stecken die Panzer? Das müssen<br />
Höllenmaschinen sein. Die Sowjets haben uns
260<br />
längst gesehen. Die warten nur noch auf uns. Einen<br />
rollenden Transportzug auf Schienen, den können<br />
die sich doch nicht entgehen lassen. Mit dem gewaltigen<br />
Krach der Motoren haben sie ihre T34 in<br />
Stellung gebracht. Durch die heruntergelassenen<br />
Fenster verstärkt sich noch der Krach in den Abteilen<br />
der Eisenbahnwagen. Wir können noch nicht<br />
erkennen, wo sich die Panzer aufhalten. Der durchdringende<br />
Druck von draußen, frisst an unseren<br />
Nerven. Das Dröhnen sitzt tief im Kopf. Nicht nur<br />
unsere Köpfe brummen. Auch unsere Körper. Noch<br />
nicht einmal mit den Augen suchen wir die Umgebung<br />
nach Panzern ab. Wir spüren nichts. Auch<br />
keine Lebensgefahr.<br />
Wohl aber eine innere Starre. Das rollende Geräusch<br />
unseres langsam fahrenden Zuges versucht<br />
uns vorerst zu beruhigen. Unser Transportoffizier,<br />
der Major, hat bestimmt keine Gefahr für die ihm<br />
anvertrauten Männer und für sich selbst erwartet.<br />
Wir zweifeln nicht an seiner Fähigkeit: Der Major ist<br />
seiner militärischen Aufgabe gewachsen. Nach dem<br />
Richtungswechsel geht unsere Fahrt zurück nach<br />
Lübbenau. Jetzt ergreifen die Sowjets die Initiative.<br />
Ihre Panzermotoren schweigen plötzlich.<br />
Ihre Geschütze zielen auf unseren Transportzug.<br />
Sie werden unseren Transportzug angreifen.<br />
In diesem Augenblick unterfahren wir eine lange<br />
Straßenbrücke.<br />
Worauf warten die Sowjets?<br />
Auf den richtigen Augenblick? ---<br />
Wann ist der richtige Augenblick?<br />
Wenn der Truppentransportzug, einschließlich Lokomotive<br />
unter der Brücke durchgefahren ist.
261<br />
Die vorhandene Deckung verlassen hat.<br />
Nur Geduld. - - - - - -. Nur keine Hast.<br />
Wir befürchten etwas, ohne es richtig wahrzunehmen.<br />
------<br />
Das uns Bedrohende ist nebelhaft.<br />
Noch ist es ein Nichts. --- Hoffnung, der Anspannung<br />
zu entgehen? ---- Nichts ist in mir.<br />
Ein sich aussichtslos entwickelndes Gefühl gibt<br />
nichts frei.<br />
Gedrillt, kann keiner von uns jungen Soldaten, wie<br />
auch ich nicht die innere Deckung verlassen.<br />
In mir ist nichts. - - - - - - -Absolut nichts.
262<br />
HIER, AN DIESER STELLE, AUF DIESEM AC-<br />
KER,<br />
DA HAT UNSER MILITÄRISCHER VORGESETZ-<br />
TER,<br />
DEN HEIZER DER REICHSBAHN ABGELÖST.<br />
WIR JUNGEN MÄNNER, IM FORMAT<br />
SO UNTERSCHIEDLICH,<br />
WIE DIE STÜCKE DER STEINKOHLE<br />
AUF DEM TENDER.<br />
WIR WERDEN NUN VON DER GROSSEN<br />
SCHAUFEL<br />
DES HEIZERS AUFGENOMMEN.<br />
WIR SIND NICHT FÄHIG,<br />
UNS AN DER SCHAUFEL FESTZUHALTEN.<br />
WIR WERDEN JETZT, GEMEINSAM IM FEUER<br />
DER PANZERGRANATEN LANDEN.<br />
WIR WERDEN UNSEREM<br />
EID UND GEHORSAM FOLGEN.<br />
WIR WERDEN GEMEINSAMEN IN DEN TOD<br />
GEHEN.<br />
Unser Kompaniechef, Herr Oberleutnant T..., Forstbeamter,<br />
gehört zu den Ausbildern. Während unserer<br />
Umformung vom Zivilisten zum <strong>Panzergrenadier</strong><br />
hat er oft die Vokabel “Verheizen“ benutzt. Hier, an<br />
dieser Stelle, gebe ich ihn als einen der vielen<br />
Verheizer der Soldaten zu erkennen Die Sowjets<br />
haben nur Berlin im Sinn und vor ihren Augen. Da<br />
wollen sie schnell hin. Was sich auf ihrem Wege zu<br />
ihrem Ziel gegen sie stellt, das werden sie mit<br />
Macht überwältigen, niederwerfen und zermalmen.<br />
Jetzt stehen wir ihnen mit unserem Transportzug im
263<br />
Wege. Für uns sollte es noch für einige Augenblicke<br />
so aussehen, als machten wir eine normale Fahrt<br />
durch eine schöne Landschaft. Die bittere Wahrheit<br />
ist mir bewusst geworden, dass die Macht des Militärs<br />
über alle menschliche Vernunft hinaus, sich,<br />
wie bei der Reichsbahn, mit vorgehaltener Pistole<br />
durchsetzt. Die herrschende Macht des Militärs hat<br />
schließlich in Lübbenau, das dem Militär verbriefte<br />
Recht durchgesetzt. Welch eine Heldentat, mit der<br />
wir unser militärisches Spiel beenden werden. Nach<br />
dieser Leistung, und mit diesem Ergebnis, schließt<br />
sich unser Vorhang für immer. Uns bleibt nichts.<br />
Nur die Regungslosigkeit vor dem zu erwartenden<br />
Beschuss.<br />
Wird unser Zug beschossen? --- Noch rollen wir mit<br />
zögernder Schrittgeschwindigkeit. ---- Nein, - der<br />
Zug ist nicht getroffen.<br />
--- noch nicht.<br />
Ist er jetzt getroffen worden? - - nein.<br />
Wo, an welcher Stelle ist unser Zug schon von den<br />
Panzergranaten getroffen?<br />
Gedanken hetzen wie Granatsplitter durch mein<br />
Hirn.<br />
In Fahrtrichtung rechts, für mich klar erkennbar, explodieren<br />
nacheinander zwei Panzergranaten. Das<br />
Mündungsfeuer der Panzer ist nicht zu sehen. Die<br />
Granaten hinterlassen zwei trockene, durchsichtige,<br />
graue Erdfontänen. Direkt links neben dem einzigen<br />
großen, zweigeteilten Busch auf dem Acker sind sie<br />
eingeschlagen. Schlagartig explodieren die nächsten<br />
Granaten aus den Panzerkanonen in unserem<br />
Zug. Der mit jedem Schuss aus den Panzern hoch<br />
wirbelnde Staub verschleiert die Sicht. Der Staub<br />
bleibt regelrecht über dem Geschehen stehen. Der
264<br />
Beschuss unseres Transportzuges geht durch die<br />
sowjetischen Panzer weiter. Ihre hochexplosiven 85<br />
mm Granaten durchschlagen unsere Waggons. Die<br />
nächste Granate schlägt in dem Waggon in Fahrtrichtung<br />
vor uns ein. Mit dem harten, trockenen<br />
Schlag der Explosion reißt allein der Druck mit<br />
Wucht einen Teil des Eisenbahnwagens auseinander.<br />
Wir fliegen, vollkommen betäubt, zwischen dem<br />
Staub der Holz- und Glassplitter durch unser Abteil<br />
und stoßen heftig gegeneinander. Die noch in<br />
Fahrtrichtung teilweise vorhandene Abteiltrennwand<br />
fängt uns auf. Jeder Explosionsknall steckt tief in<br />
den Ohren und in den vom Schock zitternden Gliedern.<br />
Mit dem ersten Einschlag stand der Zug mit<br />
hartem Schlag fest auf den Schienen. Für einen<br />
Moment noch einmal die absolute und gespenstige<br />
Grabesstille. Die Wagentüren fliegen auf, und wir<br />
hechten wie Hasen, vorübergehend stocktaub und<br />
benommen, hinaus. Mein Blickfeld ist stark eingeengt.<br />
Was links und rechts geschieht, kann ich nicht<br />
erkennen. Mit uns fliegen einige Rucksäcke aus<br />
dem Gepäcknetz. Sie haben sich beim Sprung an<br />
den Tragegestellen für das Sturmgepäck an den<br />
Uniformen eingehakt. Kameraden können sich davon<br />
befreien. Ohne Sicht, gehen unsere Sprünge<br />
nacheinander ins Freie. Wir landen nach- und miteinander<br />
in dem abgestorbenen Gestrüpp, das unmittelbar<br />
neben dem Schotter am Rand des Ackers<br />
steht. Ohne Kommando geht alles mit „Sprung-<br />
Aufmarsch- Marsch“ weiter vorwärts. Die Zeit vom<br />
Abschuss bis zum Einschlag und Explosion einer<br />
Granate ist auf der kurzen Distanz von etwa 200 m<br />
bei Direktbeschuss nicht messbar. Abschuss und<br />
Explosion sind ein Schlag. Der Staub der Erde, der
265<br />
mit jedem Schuss aufgewirbelt wird, hängt bleiern<br />
über uns. Die Sowjets können sich nun jede Zeit<br />
nehmen, denn unser Zug wird sich nicht mehr bewegen.<br />
Mit langsamer Schussfolge geht die Vernichtung<br />
unseres Zuges voran. Über die Gesamtlänge<br />
des Transportzuges ist uns nichts bekannt.<br />
Was neben den Soldaten an Kriegsgerät in den gedeckten<br />
Güterwagen mit auf der Fahrt ist, hat keiner<br />
von uns erfahren. Im Augenblick ist nicht erkennbar,<br />
ob der Zug in seiner Länge beschossen wird. Unser<br />
heutiges Endziel haben wir bereits an diesem Punkt<br />
erreicht. Für uns gibt es kein Senftenberg, kein Bad<br />
Muskau mehr. Unser Einsatzort ist hier. Hier, an<br />
dieser Stelle ist plötzlich unsere Front. Aufspringen,<br />
Stürmen, wie gelernt. Dabei Deckung suchen. Nach<br />
jedem zweiten Sprung runter auf den Erdboden.<br />
Und weiter vorwärts Stürmen. Wohin springen wir?<br />
Nach dem dritten, vierten Sprung, wir stehen unter<br />
dem Schock, blitzt Mündungsfeuer eines T34 Panzers.<br />
Zeitgleich spüre ich die Explosion der Granate<br />
in unserem Transportzug. Nur 150 bis 200 Meter<br />
Entfernung zwischen Panzer und Zug. Abrupt<br />
stoppt unser Sprung nach vorn. Ohne Kommando.<br />
Alles zurück auf die andere Seite des Transportzuges.<br />
Verdammt, die sowjetischen Panzer stehen<br />
direkt vor uns. Die Zeit eines einzigen Atemzuges<br />
hat zum Erkennen genügt. Da liegen nun unsere<br />
getöteten Kameraden, mit denen wir vor Augenblicken<br />
noch zusammen im Abteil gesessen haben,<br />
zusammen mit den schreienden Verwundeten zwischen<br />
und vor unseren Füßen. Die Gefallenen sind<br />
mit einem Schlag von all ihren Ängsten befreit. Sie<br />
haben alles überwunden. Uns bleibt die Angst, die<br />
Bestürzung und die Lähmung erhalten. Wie soll ich
266<br />
das jetzt begreifen? Ich begreife nichts. Fetzen der<br />
Schreie werden von den explodierenden Granaten<br />
niedergebrüllt und zerrissen. In diesen Momenten<br />
mache ich eine entsetzliche Entdeckung: In der<br />
Zeit, da wir von den Panzern beschossen werden,<br />
kann keiner von uns Nervenbündeln dem Kameraden<br />
an seiner Seite beistehen. Wir sind wie springende<br />
Bälle auf einer verzerrten Ebene zwischen<br />
den explodierenden Granaten. Blutleer, körperlos,<br />
unzugänglich. Vor meinen Augen erkenne ich keinen<br />
einzigen meiner Kameraden. Ich erhalte keine<br />
Signale. Ich sende keine Signale. Meine Hilflosigkeit,<br />
mein seelischer Zustand, vermittelt mir das<br />
Gefühl einer Untreue meinen Kameraden gegenüber.<br />
Jeder einzelne von uns ist immer nur für sich<br />
allein. Egal, wo wir uns auch aufhalten. Uns verbindet<br />
an dieser Stelle nur die unmittelbare Nähe des<br />
Todes. Zurück, die kleine Böschung hoch und zwischen<br />
Schotter, den Schwellen und Schienen einerseits,<br />
und den Rädern der Eisenbahnwagen mit den<br />
Streben andererseits, bilden ein starkes Hindernis.<br />
Kriechen, Sichtschutz, bloß nirgendwo hängen bleiben.<br />
Alle Bewegungsabläufe: um Deckung zu finden<br />
werden rein mechanisch erledigt. Genauso, wie<br />
man es uns eingedrillt hat. Mein Kopf arbeitet ohne<br />
mein dazutun unentwegt weiter. Wie viele T34 es<br />
sind, findet vor Entsetzen keiner heraus. Das ist der<br />
Wahnsinn! Unsere aufgeriebene Truppe stürmt,<br />
nachdem das schwierige Hindernis des Transportzuges<br />
überwunden ist, in Richtung Westen. Mit den<br />
explodierenden Granaten und den Geschossen aus<br />
ihren Maschinengewehren am Panzer, jagen sie<br />
uns über den Acker. Jede Explosion geht wie ein<br />
stählerner Stich durch meinen Körper. Es gibt für
267<br />
uns keine Deckung. Nun muss ich miterleben und<br />
sehen, wie zwei junge Ausbilder-Leutnants die ihre<br />
Ärmelstreifen, auf die sie bis zu diesem Zeitpunkt<br />
immer stolz waren, abreißen. Mit der Pistole in der<br />
Hand brüllt jeder von ihnen aus voller Kehle „Sammeln“.<br />
Ich sehe, dass die beiden weiter nach rechts<br />
über die Flur laufen. Meine innere Stimme warnt<br />
mich: „Sieh du zu, dass du hier Land gewinnst“. Bei<br />
freier Sicht über das ansteigende Gelände die<br />
Truppe unter Panzerbeschuss zu sammeln, ist doch<br />
glatter Mord an den Soldaten. Im Unterbewusstsein<br />
zieht es mich auch nicht dahin. Ich weiß es nicht<br />
warum ich meinen Weg suche. Jede einzelne abgeschossene<br />
Panzergranate zwingt jeden von uns<br />
immer wieder auf den Boden. Einzelne explodierende<br />
Einschläge höre ich. Wo sie einschlagen jedoch<br />
nicht. Dann verstummt auch das Maschinengewehrfeuer<br />
der Panzer. Der Untergrund, auf dem<br />
ich mich sprungweise und atemlos vorwärts arbeite,<br />
ist ein mit Kies belegter Feldweg. Rechts und links<br />
steht noch das honigfarbene Gestrüpp und Gras<br />
vom Vorjahr. Dieses Hetzen um das eigene Leben<br />
zwingt mich in einen Zustand der nicht mehr realen<br />
Sinneswahrnehmung. Wie betäubt nehme ich gerade<br />
noch die rasenden Schläge des Herzens und<br />
einen Geschmack nach Eisen* wahr. Was wirklich<br />
um mich herum geschieht, kann ich nicht mehr erkennen.<br />
Ich denke nun, ich bin völlig allein auf mich<br />
gestellt. Nur weiter, nur fort von hier. Schließlich<br />
vertraue ich darauf, außerhalb der Reichweite der<br />
Panzergranaten zu sein. Ich höre sie nicht mehr.<br />
Dann finde ich für einige Augenblicke Schutz zwischen<br />
den Trümmern der Straßenbrücke an der
268<br />
Reichsautobahn. Alle Soldaten, die über das ansteigende<br />
Gelände unter Panzerbeschuss<br />
gekommen sind treffen sich in einem Waldstück auf<br />
der Anhöhe<br />
Den Geschmack nach Eisen führe ich auf<br />
den feinen Abrieb der Eisenbahnschienen<br />
zurück. Diesen Staub habe ich während<br />
der zwei Reisetage im und vor Minuten<br />
unter dem Zug verstärkt eingeatmet.<br />
Ich weiß nicht mehr, wie ich in den Wald zu meinen<br />
Kameraden gekommen bin. Das plötzliche Auftauchen<br />
des Majors, nach dem Beschuss und der Vernichtung<br />
unseres Transportzuges wird mir ewig ein<br />
Rätsel bleiben. Auch ich finde mich hier ein*. Wir<br />
alle sind froh, dass wir uns von dem teilweise in<br />
Flammen stehenden Transportzug bis hier absetzen<br />
konnten. Plötzlich erscheint unser Transportoffizier,<br />
der Major. Wo kommt der überhaupt her? Mit ihm<br />
habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Sollen wir<br />
jetzt unseren Marsch unter seiner Führung zu Fuß<br />
fortführen? Das der Major, aus irgendeiner Deckung<br />
hier aufgetaucht ist, kann ich nicht nachvollziehen.<br />
In Lübbenau ist er doch auf dem Bahnhof, nach der<br />
Auseinandersetzung mit dem Reichsbahnpersonal<br />
in den Zug eingestiegen. Dass er den gleichen Weg<br />
wie all die anderen Soldaten über den Acker gelaufen<br />
sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Ein<br />
Major läuft doch nicht allein durch das Gelände. Wo<br />
ist seine Offiziersbegleitung geblieben? Uns ist vor<br />
Entsetzen und Erstarrung nicht einmal aufgegangen,<br />
dass uns der Major den sowjetischen Truppen<br />
zum Fressen vorgeworfen hat. Nun schnarrt er, als
269<br />
sei nichts vorgefallen. Dieses ist jedenfalls mein<br />
Eindruck. Mit der allgemein bekannten<br />
überheblichen und blasierten Militärstimme kräht er:<br />
„Wir müssen eine Auffangstellung bauen und die<br />
ersten Angriffe der Sowjets abwehren. Der Ansturm<br />
der sowjetischen Truppen mit ihren Panzern könne<br />
doch hier mit wenigen Mitteln aufgehalten werden“.<br />
Das ist doch unfassbar. Was versteht der unter wenigen<br />
Mitteln? Jemand hinter den Rücken der Kameraden<br />
verkündet wohl lauter als gewollt, voller<br />
Wut:<br />
„Seit wann kann man denn Panzer mit<br />
Verbandspäckchen aufhalten?“<br />
Wie wir jetzt feststellen, haben wir bis auf vereinzelte<br />
Kameraden noch nicht einmal diese Verdammten<br />
Verbandspäckchen. Ein Griff an die Uniformjacke<br />
genügt für diese Erkenntnis. Wir hören jetzt wie die<br />
im Zug mitgeführte Munition in unregelmäßigen Abständen<br />
explodiert. In diesen Minuten wird mir klar:<br />
„Mit Senftenberg, wo wir heute noch hinkommen<br />
sollen, wird es nichts.“.<br />
Morgen und übermorgen wird es neue Ziele geben.<br />
Aber dieses Senftenberg wird dann nicht mehr dabei<br />
sein. Niemand hört noch etwas von Senftenberg.<br />
Mir scheint: Selbst für das Militär hat es den<br />
Ort nie gegeben. Worauf werden wir uns jetzt einrichten<br />
müssen? Von einem Offizier ist weit und<br />
breit nichts mehr zu sehen. In diesen Minuten denke<br />
ich: ob uns jetzt noch jemand aufhalten kann?<br />
Wird man uns einfach laufen lassen? Ist der Krieg<br />
für uns jetzt vorbei? Wir jungen Soldaten begreifen<br />
es nicht, wieso hat dieses alles geschehen können?
270<br />
Über gefallene, verwundete oder vermisste Kameraden,<br />
wird nicht gesprochen. Es dauert noch<br />
etwas, da löst sich der versprengte Haufen im Wald<br />
langsam und stillschweigend auf. Wo der Major geblieben<br />
ist, ist mir nicht erzählt worden. Der hat es<br />
doch zugelassen, dass wir uns ohne Führung absetzen.<br />
Mit etwa dreißig anderen Kameraden marschieren<br />
in Richtung Westen. Wir marschieren in<br />
die Dunkelheit. Noch fehlt mir jede Orientierung.<br />
Damit der zusammengewürfelte Haufen nicht vollends<br />
einschläft, marschieren wir im Gleichschritt<br />
weiter. Gesprochen wird nicht. Von Zeit zu Zeit wird<br />
ein Kamerad, der vor Müdigkeit nicht mehr laufen<br />
kann in die Mitte genommen. Dort kann er vom gleichen<br />
Takt unterstützt die Augen schließen. Dieses<br />
mag undenkbar klingen, doch es ist Tatsache. Ich<br />
fasse noch einmal zusammen: Die gewaltige Erschütterung<br />
durch den Panzerbeschuss, die Vernichtung<br />
unseres Zuges hat mich völlig betäubt und<br />
überwältigt. Ich merke es nicht sofort. Noch auf dem<br />
Marsch stelle ich fest, dass die Namen und die Gesichter<br />
meiner Kameraden aus meiner Gruppe, aus<br />
meinem Gedächtnis gelöscht sind. Nur mein alter<br />
Kumpel, Heinz Kl. aus Fürth, ist mir, nach mehr als<br />
einem halben Jahrhundert, mit seinem damaligen<br />
Aussehen und seinem Namen in Erinnerung. Er<br />
war, wie bekannt, nicht in dem Transportzug. Gelegentlich<br />
denke ich noch heute an unsere gemeinsame<br />
Zeit. Die Vernichtung unseres Zuges und unser<br />
Rückzug vor den Panzern sind vorüber. Wie<br />
lange hat dieser Wahnsinn gedauert? Ich erinnere<br />
mich nicht. Ich bin mir sicher, mir ist am „Neunzehnte<br />
April 1945“ jedes Gefühl für Zeit und Raum ab-
271<br />
handengekommen. Dieser Tag, geht in den Abend<br />
und die Nacht über.<br />
Noch heute, nach mehr als 60 Jahren habe<br />
ich sporadisch heftige Träume, die auch mit<br />
der Vernichtung unseres Transportzuges zu<br />
tun haben.<br />
Wir marschieren in dieser Nacht durch Luckau.<br />
Einstöckige Häuser und das Kopfstein-pflaster in<br />
Luckau, habe ich noch vor meinen Augen. Unsere<br />
gefallenen und verwundeten Kameraden haben wir<br />
zurückgelassen. Meine Erinnerungen gehen noch<br />
einmal zurück zu unserem zerstörten Transportzug.<br />
Die Lokomotive, die unseren Zug zurückschiebt,<br />
findet Deckung zwischen der Straßenbrücke und<br />
dem Haus mit den Stallungen. Durch diese Deckung<br />
wird die Lokomotive nicht vollständig zerstört.<br />
An dem, was jetzt hinter uns liegt, sind wir nicht<br />
mehr beteiligt. In alter Manier verdrängen wir alles,<br />
was wir erlebt haben. Das Verdrängte ist erledigt.<br />
Erledigt? Bei mir ist nichts erledigt. In der Nacht<br />
zum 20. April 1945 werden wir von den Sowjets bedrängt.<br />
Die Sowjets, so denke ich, finden selbst in<br />
der Nacht keine Ruhe. Die ihnen gegebenen Befehle<br />
treiben sie an. Wir können sie nicht sehen und<br />
hören. Den Druck ihrer vorwärts Bewegung spüre<br />
ich. Mein Gefühl täuscht mich nicht. Ihre militärische<br />
Macht der Sowjets zwingt den Keil vorwärts. Es ist<br />
nicht ihr Tempo, es ist die, wie ich meine stoische<br />
Ruhe, die sie verbreiten. Am Morgen werden sie<br />
nach Norden schwenken. Sie haben nur noch Berlin<br />
vor ihren Augen. Unsere Weiterfahrt von Lübbenau<br />
nach Calau ist sicher die fragwürdigste Entschei-
272<br />
dung gewesen, die ich bisher beim Militär erlebt<br />
habe. An dieser Stelle muss ich mich zu dem Punkt<br />
„Kameradschaft“ äußern. So, wie ich die<br />
Kameradschaft erlebt habe. Ich gehe an die Stelle<br />
zurück, an der unser Transportzug vernichtet worden<br />
ist. Zwischen Lübbenau und Bischdorf, gegenüber<br />
von Boblitz, dort liegt das Gebiet an dem mir<br />
der Wert, die wahre Kette der Kameradschaft, die<br />
Bande der Brüderlichkeit, unmissverständlich vor<br />
Augen geführt worden ist: Die während meiner Rekrutenzeit<br />
in Berlin bis zum 19. April 1945 gelebte<br />
und erlebte echte Kameradschaft, ist an dieser Stelle<br />
mit einem Schlag in meinen Magen durch das<br />
psychische und physische Gemetzel, dem Blutvergießen<br />
einiger meiner, zur gleichen Zeit mit mir aus<br />
den Zug springenden und dabei von Granatsplittern<br />
der explodierenden Panzergranaten und Mg-Feuer<br />
getroffenen, verwundeten und getöteten Kameraden,<br />
abrupt zerstört worden. Die von den physischen<br />
Anstrengungen der Grundausbildung bis zu<br />
unserer Abnahme zum Fronteinsatz geknüpfte Kette<br />
der Kameradschaft ist an diesem Ort für mich<br />
unwiderruflich zerfallen. Dieses auseinander brechen<br />
der Kette Kameradschaft ist der mangelhaften<br />
Qualifikation unseres Transportoffiziers, seiner Unfähigkeit<br />
eine Truppe zu kommandieren zuzuschreiben.<br />
Der Offizier hat aus Angst, bei Nichterfüllung seines<br />
Auftrages, selbst vor das Kriegsgericht gestellt zu<br />
werden, es wohl überlegt und vorgezogen seine ihm<br />
anvertrauten Männer zu verheizen.<br />
Mir bleibt die Frage: Habe ich mich, wegen<br />
nicht geleistetem Beistand schuldiggemacht,
273<br />
weil ich keinem Kameraden Hilfe leistete?<br />
Bin ich zum Verräter an der Kameradschaft<br />
geworden? Für mich heißt es:<br />
Die Kameradschaft, an die wir gemeinsam<br />
als junge Soldaten glaubten, an der wir auch<br />
nie gezweifelt haben, gibt es in Wirklichkeit<br />
gar nicht. Erst später ist mir das bewusst<br />
geworden: „Die Kameradschaft muss noch<br />
erfunden werden“. Und so denke ich sicher<br />
nicht allein.<br />
Die jungen Männer werden durch den militärischen<br />
Drill von Anfang an in eine „Gemeinschaft“ gezwungen.<br />
Die Gruppe, in der ich mich am Anfang ihrer<br />
Aufstellung im Oktober 1944 befand, ist nur nach<br />
Körperlängen über 1,85 Meter und der Herkunft aus<br />
verschiedenen deutschen Landen aufgestellt worden.<br />
Diese Kriterien galten für die erste Zusammenstellung.<br />
Unsere Gruppe verdiente auch nach der<br />
Neuaufstellung Mitte April 45 in Biesenbrow, nicht<br />
einmal mehr den Begriff der „Übereinstimmung“.<br />
Die zu einer Gruppe gehören, haben sich während<br />
der harten Ausbildung nach und nach zu einer benannten<br />
„Einheit“ zusammenschweißen lassen. Bis<br />
zur Kameradschaft innerhalb einer Gruppe ist es ein<br />
langer Weg. Und eine durch Drill erzwungene „Gemeinschaft“<br />
kann nur in der Nicht-Selbständigkeit<br />
der Mitglieder enden. Das Gefühl von Schicksalsgemeinschaft<br />
innerhalb der Gruppe, entwickelt sich<br />
ausschließlich durch den ständig herrschenden militärischen<br />
Druck. Je stärker der Druck der militärischen<br />
Vorgesetzten, desto fester ist der Zusammenhalt.<br />
Die Auffassung, die „Einheit der Gruppe“<br />
habe etwas mit der „Kameradschaft“ zu tun, kann
274<br />
ich nicht nachvollziehen. Unter den Kameraden einer<br />
Gruppe, zehn Soldaten, (Ohne Gruppenführer<br />
und Stellvertreter) wird sich ein<br />
Vertrauensverhältnis nur sehr langsam entwickeln.<br />
Die Brauchbarkeit der Kette einer Gruppe, ist letztlich<br />
von der Qualität ihrer einzelnen Gliedern abhängig.<br />
Der auf unbestimmte Zeit gegründete Zusammenhalt<br />
hat nur dann Erfolg, wenn jeder Einzelne<br />
den gleichen Vorteil oder Nutzen hat. Auch<br />
dieser Zustand hat für mich noch nichts mit Kameradschaft<br />
zu tun. Bei meiner Ausbildung zum <strong>Panzergrenadier</strong><br />
bis zum Ende des Krieges habe ich<br />
keinen aktiven Frontoffizier und keinen fronterfahrenen<br />
Soldaten erlebt. Unsere Vorgesetzten waren<br />
reine Ausbilder. Sie waren ausschließlich für die<br />
Ausbildung der Soldaten an den Waffen und für den<br />
harten Drill zuständig. Sie haben es allein in der<br />
Hand, ob sich das Vertrauen durch den geringsten<br />
Eingriff weiter positiv oder negativ entwickeln soll.<br />
Überwiegt ein positiver Kameradschaftsgedanke, so<br />
erfolgt mit Sicherheit eine Aufteilung und Trennung.<br />
Dann heißt es, die Kompanie, oder den Zug durchmischen<br />
und neu aufstellen. Dieses geschieht mit<br />
Sicherheit dann, wenn die Vorgesetzten befürchten<br />
müssen, dass sie ihren ausschließlichen Einfluss<br />
auf ihre Truppe verlieren könnten. Das gesamte<br />
Militär, vom obersten Befehlshaber bis zum Gruppenfühler-Stellvertreter,<br />
einem Gefreiten, ist extrem<br />
eifersüchtig. Frühzeitig spüren sie eine denkbare<br />
Beschädigung ihrer Macht. Mit aller Härte und durch<br />
zusätzlichen Drill bekämpfen sie schon eine sich<br />
anschleichende Gefahr. Jede militärische Einrichtung<br />
kann nur nach festgelegten Vorschriften existieren.<br />
In dem System gibt es keine Möglichkeit
275<br />
gegen Vorschriften ohne Bestrafung zu handeln.<br />
Könnte sich da vielleicht schon der Ansatz einer<br />
möglichen Verschwörung oder einer Auflehnung<br />
gegen die Vorgesetzten zeigen? Haben einzelne<br />
Glieder der Gruppe einen besonderen Draht zueinander<br />
gefunden, dann besteht bereits aus der Sicht<br />
des Militärs die Gefahr, der Einflussnahme auf andere<br />
Kameraden innerhalb der Gruppe. Ich erinnere<br />
mich an das gute Verhältnis zu meinem alten Kumpel<br />
Heinz Kl. aus Fürth. Ich bin mir sicher, ich habe<br />
ihn damals aus den vorgenannten Gründen abgeben<br />
müssen. Ein kameradschaftliches Miteinander<br />
gilt nach meiner Überzeugung für jeden Einzelnen<br />
innerhalb einer Gruppe. Das ist aber nicht die Kameradschaft,<br />
wie ich sie letztlich beim Militär verstehe.<br />
Eine echte Kameradschaft kann sich nach<br />
meiner Auffassung erst bei längeren gemeinsam<br />
erlebten Kriegseinsätzen und dem erlebten Verlust<br />
von Kameraden entwickeln. Doch das ist für mich<br />
ein anderes Thema. Zu diesem Punkt halte ich abschließend<br />
fest: In all meinen Gedanken und Fragen<br />
an die und nach der Kameradschaft, ist letztlich<br />
in mir nie ein bitterer Nachgeschmack geblieben.<br />
Meine Augenzeugin des Geschehens, Frau Marie<br />
Orsin aus Groß-Klessow, gibt mir im September<br />
1993 ausführlich Auskunft über ihre Erlebnisse, am<br />
19. April 1945. Ihr gilt an dieser Stelle mein besonderer<br />
Dank für ihre Freundlichkeit und die gegebene<br />
Auskunft. Sie berichtet: „Am 19. April 1945 habe ich<br />
unser Haus und unser Grundstück, dieses liegt etwa<br />
100 m von der zweigleisigen Eisenbahnlinie entfernt,<br />
verlassen. Ich war auf dem Wege von Groß-<br />
Klessow nach Boblitz. Der Schrankenwärter hatte<br />
die Eisenbahnschranke geschlossen und blieb auf
276<br />
seinem Posten. Ich blieb vor der geschlossenen<br />
Schranke stehen und wartete wie auch der Schrankenwärter,<br />
auf einen Zug. Aus Richtung Lübbenau<br />
näherte sich der Zug, der aus Personenwagen und<br />
geschlossenen Güterwagen bestand. Für mich war<br />
es ein ganz normaler Zug. Als er an mir vorüber<br />
fuhr, habe ich an den Fenstern Soldaten gesehen,<br />
die mir zuwinkten. Ich tat das gleiche und freute<br />
mich darüber. Der Zug fuhr in Richtung Bischdorf<br />
und Calau weiter. Nach etwa 30 Minuten, so gegen<br />
16.30°° kam der Zug aus Richtung Calau - Bischdorf<br />
zurück. Die Lokomotive schob den Zug. Die<br />
Schranke war immer noch geschlossen und ich beschloss,<br />
zurück zu unserem Haus zu gehen. Ich<br />
hatte ein ungutes Gefühl in mir. Warum kommt der<br />
Zug zurück? Plötzlich hörte ich das Schießen. Der<br />
Zug wurde beschossen. Der Zug stand plötzlich<br />
ohne Bewegung da. Ich spürte eine furchtbare<br />
Angst in mir. Es schoss mir durch den Kopf: Was<br />
wird in den nächsten Stunden und Tagen mit uns<br />
geschehen? Was haben wir zu erwarten. Der Zug<br />
wurde beschossen und zerstört. Die Soldaten flohen<br />
aus dem Transportzug vor dem Fliegerbeschuss<br />
und dem Panzerbeschuss auf die Anhöhe.<br />
Sie heißt im Volksmund GULIZA. Der Lokführer und<br />
der Heizer lagen bis zum Einbruch der Nacht in der<br />
leeren Kartoffelmiete. Unser Haus wurde nicht beschossen.<br />
Nach meiner Erinnerung sind von den<br />
Panzern mehrere Granaten auf den Transportzug<br />
abgefeuert worden. Polen, die bei Bauern gearbeitet<br />
haben, plünderten den Zug oder das, was davon<br />
übrig geblieben war. Erst am 8. Mai 1945, dem Tage<br />
der Kapitulation, durften wir an die Reste des<br />
Zuges. Die gefallenen Soldaten wurden geborgen
277<br />
und am Bahndamm beerdigt. Drei tote Soldaten<br />
habe ich in dem zerschossenen Zug sitzen sehen.<br />
Sie hatte der Tod beim Kartenspiel überrascht.<br />
Weitere elf gefallene Soldaten lagen verstreut am<br />
Bahndamm“. Ich richtete meine Frage nach dem<br />
Verbleib der verwundeten Soldaten an die Augenzeugin.<br />
Sie konnte mir zu diesem Ereignis keine<br />
Auskunft geben. Sie nannte mir den Namen eines<br />
älteren Herrn, der in Bischdorf lebt. Ich besuchte<br />
den Herrn und bat ihn, mir über das Schicksal der<br />
Verwundeten zu berichten. Meine Frage im September<br />
1993: Was ist aus den verwundeten Soldaten<br />
geworden, die ich auf den offenen Güterwagen<br />
bei Bischdorf gesehen habe? Wo kamen die Kameraden<br />
her? Kamen sie aus dem Lazarett der Stadt<br />
Lübbenau? Ich habe sie mit ihren frischen Verbänden<br />
gesehen und ich habe in ihre verzweifelten Augen<br />
gesehen. Die mündliche Auskunft habe ich<br />
festgehalten: Ich bin am 19. April 1945 noch nicht<br />
hier gewesen. Ich habe mich nach meiner Rückkehr<br />
aus dem Kriege mit den Kriegsereignissen in meiner<br />
Heimat eingehend beschäftigt. „Die Verwundeten*,<br />
die sich ohne Hilfe von den Waggons absetzen<br />
konnten, sollen dieses getan haben. Liegend<br />
transportierte, nicht gehfähige werden wohl eine<br />
Flucht versucht haben. Ihre Fluchtversuche sollen<br />
ohne Erfolg geblieben sein. Alkoholisierte sowjetische<br />
Soldaten sollen die nicht geflohenen verwundeten<br />
Soldaten auf Fahrzeuge verladen und in einen<br />
nahe gelegenen Wald gebracht haben. Die<br />
Sowjets sollen sie dann dort erschossen haben“.<br />
Die Erschießung der Verwundeten Soldaten durch<br />
die Sowjets konnte und kann heute von mir nicht<br />
überprüft werden. Ich kann es daher auch nicht be-
278<br />
stätigen. Meine Gedanken dazu will ich aber äußern:<br />
Eine Verladung der Verwundeten auf Fahrzeuge,<br />
um sie anschließend in einen Wald zu<br />
fahren um sie dort zu erschießen, erscheint mir<br />
nicht überzeugend zu sein. Warum sollten die Sowjets<br />
einen zusätzlichen Transport durchführen? Ich<br />
vermute, dass die Verwundeten Soldaten, wenn<br />
überhaupt, auf ihren Waggons erschossen worden<br />
sind. Dieses wird wohl eher der Wirklichkeit im<br />
Kriegsverlauf zu entsprechen. Die in der Endphase<br />
des Zweiten Weltkrieges und speziell dieses Tages,<br />
mit den schweren Kampfhandlungen auf unserem<br />
Staatsgebiet, lassen das Geschehen überzeugend<br />
erscheinen. Der stürmische Vormarsch der Sowjets<br />
in Richtung auf Berlin war ihnen wichtig. Dass die<br />
Sowjets sich nicht um zurückgebliebene Verwundete<br />
kümmern konnten, wollten oder durften, kann ich<br />
nachvollziehen. Menschlich gesehen, kann man<br />
diese Entscheidung und die Tat, die deutschen<br />
Verwundeten zu erschießen, verurteilen. Können<br />
wir unsererseits völlig ausschließen, dass unsere<br />
Soldaten, bei ihrem stürmischen Vormarsch in der<br />
Sowjetunion, nicht auch gleiches getan haben? Wer<br />
hat unseren kämpfenden Soldaten befohlen, aufgefundene<br />
Verwundete, waffenlose Sowjetsoldaten<br />
und Zivilisten zu Erschießen oder sie einfach verhungern<br />
zu lassen? So unmenschlich es klingen<br />
mag: „Die verwundeten Soldaten konnten in der<br />
Endphase des Krieges nicht mehr in Lazaretten untergebracht<br />
und versorgt werden. Sie waren, wo<br />
immer sie sich aufhielten, nicht mehr vor den Übergriffen<br />
des Feindes sicher. Die verwundeten Soldaten<br />
sind einfach nicht mehr einsatzfähig. Sie sind<br />
nicht kriegsverwendungsfähig. Damals, wann immer
279<br />
es war, waren sie entsprechend ihres Eides verpflichtet<br />
und bereit gewesen, für ihren Führer und<br />
für die Heimat zu kämpfen. Sie haben jetzt nur das<br />
Pech, verwundet oder körperlich beschädigt zu<br />
sein. Die in dem Gebiet vorhandenen Streitkräfte,<br />
die jetzt selbst auf dem Rückzug sind, können sich<br />
nicht mehr mit den Verwundeten belasten. Auch<br />
haben nicht alle Soldaten in unserem Transportzug<br />
von den Verwundeten auf den offenen Waggons<br />
Kenntnis gehabt oder von ihnen gehört. Vielleicht<br />
haben sie auch nicht davon wissen wollen. Viele<br />
waren durch den eigenen Schutzwall, den auch ich<br />
gehabt habe, gegen diese Tatsache geschützt worden.<br />
Ob sie nur nicht hinsehen wollten? Für das<br />
Militär ist es doch das einfachste, die Verwundeten<br />
sich selbst und somit ihrem Schicksal zu überlassen.<br />
Man hat sie im Dreck der offenen Güterwagen<br />
zurückgelassen. Diese Männer werden, wie der<br />
sonstige „Schrott des Krieges“, einfach nicht mehr<br />
beachtet. Man hat sie für alle Zeit vergessen. Ich<br />
frage mich, kann man hier nach der Kameradschaft<br />
fragen? Für mich war sie selbst auf der Flucht! Sagen<br />
wir, so etwas kommt im Krieg immer vor? Denken<br />
wir wirklich so? Diese Aussage, können in meinen<br />
Augen, nur Zivilisten machen. Die Soldaten<br />
werden so ein Geschehen eher verdrängen. Denen<br />
ist es lieber, wenn sie nichts davon hören. Sie können<br />
ja bereits im nächsten Augenblick in eine gleiche<br />
Lage kommen. Wie werden wir uns beruhigen?<br />
Werden wir einfach nicht mehr daran erinnern? Machen<br />
wir es uns nicht zu einfach? Und ich habe mir<br />
damals, am Nachmittag des 19. April 1945, mit<br />
siebzehn Lebensjahren, meine Nerven damit beruhigt,<br />
dass die Verwundeten sicher in ein Lazarett
280<br />
kommen werden. Auch dann, wenn es ein Lazarett<br />
in der Kriegsgefangenschaft sein sollte. War da vielleicht<br />
doch eine Lokomotive vor den Waggons?<br />
Habe ich nicht die Tatsache, abgeschoben zu sein,<br />
mit meiner Frage verdrängt? Sollten die Waggons<br />
mit den Verwundeten, an der Weiche in Bischdorf,<br />
noch auf das rechte Fahrgleis gewechselt haben,<br />
dann gehe ich davon aus, dass es keine Weiterfahrt<br />
in Richtung Lübbenau gegeben hat. Denn wir, mit<br />
unserem Transportzug sind unmittelbar nach der<br />
Durchfahrt der Straßenbrücke unter Panzer-<br />
Beschuss geraten.<br />
Schreiben Amt Lübbenau 23.03.95 Antwort auf Frage 2<br />
Und die verwundeten Soldaten haben dann den<br />
Beschuss unseres Zuges, bei der kurzen Entfernung,<br />
noch gut sehen und hören können. Im Anhang<br />
der zum Buch ausgewählten Bilder wird das<br />
Soldatengrab auf dem alten, geschlossenen Friedhof<br />
der Gemeinde Groß-Klessow / Niederlausitz<br />
beschrieben.<br />
Das ehemalige Soldatengrab * kann nichts darüber<br />
aussagen, wie hoch der wirkliche Verlust an Soldaten<br />
war, die am 19.04.1945 bei der Vernichtung des<br />
Truppentransportzuges getötet worden sind. Dieses<br />
Massengrab sagt noch nicht einmal aus, ob es sich<br />
um „gefallene“ Soldaten handelt, die in dem Transportzug<br />
waren. Auf dem gleichen Friedhof soll es<br />
noch ein weiteres Soldatengrab gegeben haben.<br />
Nach Aussagen von Augenzeugen, halte ich fest:<br />
Bei einem Besuch des Friedhofes der Gemeinde<br />
Groß-Klessow im Mai 1990, die deutsche Vereini-
281<br />
gung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt,<br />
waren weder der auf dem Bild gezeigte Erinnerungsstein,<br />
noch andere Merkmale von beerdigten<br />
Soldaten vorhanden. Wer den Stein bestellt, wer ihn<br />
gefertigt, wer ihn aufgestellt hat und wer ihn schließlich<br />
bezahlt hat, hat bisher niemanden interessiert.<br />
Die Behörden*, waren nicht in der Lage zu erklären:<br />
ob es sich bei den beerdigten Menschen um gefallene<br />
Soldaten aus dem Transportzug handelt. Oder<br />
wie viele Gefallene und Verwundete Soldaten aus<br />
dem Transportzug amtlich registriert worden sind.<br />
Selbst die Frage: wohin die gefallenen Soldaten<br />
später verbracht worden sind, konnte von amtlicher<br />
Seite nicht beantwortet werden. Ich habe in diesem<br />
Zusammenhang den Eindruck gewonnen, dass dieses<br />
Kapitel nicht mehr lückenlos aufgearbeitet werden<br />
kann. Denn die Menschen vor Ort, waren auch<br />
nach der Vereinigung, sicher auch noch aus politischen<br />
Gründen nicht Willens oder nicht in der Lage<br />
waren, die Fragen zu beantworten. Die ehemals<br />
amtlichen Personen werden sich auch heute nicht<br />
mehr äußern. Ich glaube, dass bereits nach dem<br />
Waffenstillstand ab dem 8.Mai 1945 in der sowjetisch<br />
besetzten Zone deutsche Soldaten von den<br />
Sowjets nur als faschistische Krieger gesehen worden<br />
sind. Vielleicht hat die Propaganda der damaligen<br />
Sieger in ihrer Zone dieses Thema zum Tabu<br />
erklärt. Und die Menschen haben diese Beeinflussung<br />
für immer verinnerlicht. In diesem Zusammenhang<br />
möchte ich anfügen, dass ich auf Kriegerdenkmalen<br />
in kleinen Dörfern keine Hinweise auf<br />
den Zweiten Weltkrieg gefunden habe.<br />
Erläuterung:
282<br />
Diese hier folgende Nachbetrachtung ist mir für die<br />
Ausgewogenheit meines Berichtes unerlässlich. Es<br />
ist mir möglich, das Geschehen in diesen Tagen,<br />
auch aus Sicht der Sowjets festhalten. Ich habe in<br />
der „Lausitzer Rundschau“, Calau/NL, vom 16. März<br />
1995 einen Brief veröffentlichen lassen „Ehemaliger<br />
Soldat erinnert sich“. Darauf bekam ich Leserzuschriften,<br />
deren einer einen Artikel „die militärische<br />
Befreiung des Gebietes durch die Rote Armee in<br />
der zweiten Aprilhälfte 1945“ beigefügt war. Es<br />
handelt sich um die Zusammenfassung sowjetischer<br />
Kriegsberichte*, die im nachfolgenden Text<br />
auf das Wesentliche reduziert, ohne<br />
Kommentar wiedergegeben werden. Zur Vervollständigung<br />
meines Berichtes weise ich hier auf die<br />
Kriegslage um den 19.04.45 im Raum von Lübbenau<br />
und Calau/NL in chronologischer Reihenfolge<br />
hin.<br />
Die Vernichtung unseres Militärtransportzuges am<br />
19.04.1945 zeigt die ganze Sinnlosigkeit des Krieges.<br />
Schreiben Amt Lübbenau<br />
vom 23.03.95 Position 1<br />
Amt Lübbenau<br />
Schreiben vom 23.03.95 Frage 1<br />
Schreiben Fritz Jänchen, vom 17.03.95<br />
Beilage sowjetische Kriegsberichte in Kopie<br />
Am 16.04.1945:<br />
Die zwischen den Städten Forst und Bad Muskau<br />
tief gestaffelten deutschen Stellungen liegen an der
283<br />
Neiße. Die Länge der Neiße-Front zwischen den<br />
beiden Städten beträgt rund 30 Kilometer.<br />
Ab 04.15 Uhr in der Frühe werden die deutschen<br />
Stellungen von rund 230 Artilleriegeschützen,<br />
Werfern und Granatwerfern je Frontkilometer innerhalb<br />
von etwa 2,5 Stunden mit Dauerfeuer vernichtend<br />
geschlagen. Zum Verständnis heißt dieses: An<br />
diesem Frontabschnitt haben die Sowjets rund 6900<br />
Rohre zur Vernichtung deutscher Stellungen eingesetzt.<br />
Die Verluste der deutschen Soldaten waren<br />
sehr hoch. Mit diesem Angriff und Durchbruch beginnt<br />
die letzte Großoffensive der Sowjets an diesem<br />
Abschnitt. Die Großoffensive erfolgte unter<br />
dem Marschall der Sowjetunion Iwan Stepanowitsch<br />
Konew, Held der Sowjetunion.<br />
Am 17.04.1945 wird in Calau der Volkssturm mobilisiert,<br />
nachdem Teile der Division Großdeutschland“<br />
abgezogen waren.<br />
Am Morgen des 18. 04.1945<br />
wird in der Nähe von Calau der erste sowjetische<br />
Panzer gesichtet. Die Stadt Calau soll verteidigt<br />
werden. Etwa 350 Soldaten, Volkssturm und Hitlerjugend<br />
sollen den Ansturm der Roten Armee aufhalten.<br />
Gegen 20, °° Uhr ist von Südosten der Feuerschein<br />
und der Brandgeruch in CALAU wahrnehmbar.<br />
Am Morgen des 19 .04. 1945.<br />
Um 6.20 Uhr stehen Abteilungen des 7. Gardepanzerkorps<br />
der 3. Gardepanzerarmee der Roten Armee<br />
vor Bischdorf. Stundenlang rollen die sowjetischen<br />
Panzer durch den Ort in Richtung Schönfeld
284<br />
und Vorberg. Dieses bedeutet, die Rote Armee rollt<br />
weiter in nordwestlicher Richtung.<br />
Gegen 8°° Uhr<br />
heulen in Calau die Sirenen Panzeralarm. Die<br />
Glocken läuten „Sturm“. Die Panzersperren werden<br />
geschlossen.<br />
Gegen 9°° Uhr<br />
hat eine motorisierte SS-Einheit die Stadt Calau in<br />
Richtung Westen verlassen.<br />
Gegen 11°° Uhr<br />
nähern sich von Drebkau Vorausabteilungen der 1.<br />
Ukrainischen Front der Stadt und dem Bahnhof von<br />
Calau. Geschützdonner ist seit einiger Zeit zu hören.<br />
Um den Bahnhof von Calau, der außerhalb der<br />
Stadt liegt, wird heftig gekämpft. Deutsche Sturzkampfbomber,<br />
Ju 87, bombardieren das Heereslager*.<br />
Gegen 12.30 Uhr<br />
kommt aus Lübbenau ein Personenzug mit zwei<br />
Kompanien deutscher Soldaten. Dieses ist der erste<br />
Militärtransport. Noch vor dem Erreichen des Bahnhofes<br />
von Calau wird dieser Transport von sowjetischen<br />
Panzern der 1. Ukrainischen Front vernichtet.<br />
Gegen 13.20 Uhr<br />
schlagen in Calau die ersten Granaten in öffentlichen<br />
Gebäuden ein.<br />
Gegen 13.45 Uhr<br />
wird der erste T34 mit einer Panzerfaust zerstört.<br />
Gegen 15.30 Uhr<br />
fährt der zweite Militärtransport aus Lübbenau ab.
285<br />
Dieser Zug ist auf dem Wege über Calau nach<br />
Senftenberg. In diesem Zug sitzt der Autor des Berichtes<br />
“Der Gesang der Lerche bleibt“ mit seinen<br />
Kameraden. Dieser Transportzug erreicht Calau<br />
nicht mehr. Südlich von Bischdorf hält der Zug auf<br />
freier Strecke. Danach geht die Fahrt zurück nach<br />
Lübbenau. Nach Unterquerung der Straßenbrücke,<br />
es ist die damals von mir nicht erkannte Autobahnbrücke.<br />
gegenüber von Boblitz, wird unser Militärtransport<br />
von sowjetischen Panzern beschossen<br />
und weitgehend vernichtet. Der dritte Militärtransport<br />
ebenfalls auf dem Wege von Lübbenau über<br />
Calau nach Senftenberg, wird zwischen 15°° Uhr<br />
*und<br />
Aus dem Schreiben Hans Schulze Vetschau,19.0.95<br />
Amt Lübbenau, Schreiben vom 23.03.95<br />
16°° Uhr auf dem Bahnhof von Lübbenau von sowjetischen<br />
Panzern in Brand geschossen. Mitgeführte<br />
Munition beginnt zu explodieren. Der mutige<br />
Lokführer hat mit seiner Lokomotive den brennenden<br />
Zug** aus dem Bahnhof Lübbenau in Richtung<br />
Boblitz, auf freies Gelände geschoben. eine selbstlose<br />
Tat hat größeren Schaden im Bahnhofsbereich<br />
verhindern können. Das Heereslager ist ein Depot<br />
für die Versorgung der Wehrmacht Diesem dritten<br />
Zug, sollte noch der vierte und fünfte Transport mit<br />
Soldaten folgen. Darüber gibt es keine konkreten<br />
Informationen Den genauen Zeitpunkt, wann wir<br />
vier Mann, ein Feldwebel, ein Obergefreiter und<br />
zwei <strong>Panzergrenadier</strong>e, als kleine Gruppe unseren<br />
Marsch in Richtung Parchim begonnen haben, das<br />
weiß ich nicht mehr. Ich vermute, dass wir uns in<br />
kleinen Gruppen auf den Weg machen müssen.
286<br />
Einmal kann man uns von Meldestelle zu Meldestelle<br />
überwachen und die Marschverpflegung für vier<br />
Mann kann bei der Ausgabe besser organisiert<br />
werden. Wir folgen ausschließlich den Anweisungen<br />
unseres Marschbefehls. Diesen hat unser<br />
Feldwebel am 20.04.45 bei der ersten Meldestelle<br />
erhalten. Sein Inhalt ist mir nicht bekannt. Nur so<br />
viel ist mir in Erinnerung, wir sollen auf dem kürzesten<br />
Weg nach Parchim in Mecklenburg marschieren<br />
und uns dort melden. Jeden Tag hat der Feldwebel<br />
sich bei der jeweiligen Kommandantur mit<br />
dem Marschbefehl zum Abstempeln zu melden.<br />
Dort erhalten wir auch unsere Tagesverpflegung.<br />
Unser Marsch geht über die Orte Schlieben und<br />
Herzberg durch die „Annaburger Heide“ nach Prettin.<br />
Auf der „Annaburger Heide“ sind mir, beim<br />
Sprung in die Büsche, frische längliche Grabstellen<br />
aufgefallen. Zwischen hohen dunklen Kiefern sind<br />
sie auf dem Waldboden unregelmäßig angeordnet.<br />
Der Gedanke, die Erdhügel könnten erst vor Stunden<br />
entstanden sein, schockt mich vor Entsetzen.<br />
Beim Aufschauen zu den Baumkronen sehe ich<br />
Kleidungsstücke an Ästen hängen, wie sie von Insassen<br />
der Konzentrationslager getragen werden.<br />
Vereinzelt liegen halbverscharrte Kappen der verscharrten<br />
Opfer auf dem Waldboden. Diese furchtbare<br />
Entdeckung veranlasst mich, diesen Wald sofort<br />
zu verlassen. Ich eile schnell auf die Straße und<br />
folge meinen Kameraden. Meine wundgelaufenen<br />
Füße habe ich vor Schreck ganz vergessen. Über<br />
den grausigen Fund spreche ich nicht.<br />
Meine Beobachtungen habe ich in mir archiviert.
287<br />
Wir vier haben unerwartet auf einmal den gewaltigen<br />
Elbstrom vor Augen. Wir marschieren über die<br />
zur Sprengung vorbereitete Pontonbrücke auf die<br />
westliche Seite. Verstreut stehen ungeordnet Menschentrauben,<br />
hauptsächlich Soldaten des Heeres,<br />
auf der weiten Elbwiese. Vorgesetzte der einzelnen<br />
Einheiten sind damit beschäftigt, ihre Männer neu<br />
zu formieren. Drei von uns hoffen, wenigstens etwas<br />
an Verpflegung abzustauben. In unseren Uniformen<br />
der Luftwaffe, unserem Ärmelstreifen an der<br />
Jacke, finden wir uns im Glied einer Heereseinheit<br />
wieder. Unser Feldwebel steht abseits und wartet<br />
darauf, was da auf uns zukommen wird. Nach wenigen<br />
Momenten erscheint ein Spieß. Wir erkennen<br />
sehr schnell, dass diese Einheit schon länger besteht.<br />
Und ausgerechnet hier sind wir, nur unserem<br />
Hunger im Nacken folgend, eingedrungen. Aus dem<br />
fremden „Verein“ einfach zu verschwinden, das<br />
können wir nicht. Das sähe ja nach Feigheit aus.<br />
Der Spieß merkt sofort den fremden Stallgeruch*.<br />
Seine Männer kennt er. Noch bleiben sie ruhig stehen.<br />
Plötzlich, wie auf ein Handzeichen des Hauptfeldwebels,<br />
zeigen uns seine Männer, was in ihnen<br />
steckt. Sie schieben uns drei direkt vor die Nase<br />
des Spießes. Welch ein Fressen für den Spieß. Wir<br />
stehen ohne Kommando vor der Front. Unsere Vorführung<br />
war nur kurz. Bis jetzt hatte unser Feldwebel<br />
abgewartet. Nun zeigt er dem Hauptfeldwebel<br />
unsere Papiere. „Sie können nicht in unserer Einheit<br />
bleiben. Sie gehören zur Luftwaffe. Und Sie machen<br />
auch noch Dienst beim ‚Dicken Hermann’. Sie müssen<br />
sich selbst auf den Weg zu ihrer Einheit machen!“<br />
Hier endet unser Versuch, um an zusätzliches<br />
Futter zu kommen. Nun sind wir wieder zu
288<br />
viert auf den Elbwiesen unterwegs. Uns zieht es in<br />
Richtung Norden, nach Parchim. Zu diesem Zeitpunkt,<br />
noch völlig unerwartet fliegt die Pontonbrücke<br />
mit einem wuchtigen Knall in die Luft. Unterschiedlich<br />
große, gesplitterte Holzteile der Brücke<br />
fallen wie Müll auf die vorhandenen Brückenköpfe<br />
und alles, was schwimmfähig und auf dem Wasser<br />
gelandet ist, schwimmt mit dem Fluss davon. Jetzt<br />
hat der Spieß fremde Männer in fremden Uniformen<br />
zwischen seiner Truppe entdeckt. Der Begriff Stallgeruch<br />
ist vielseitig einzusetzen. Mir kommt ein<br />
schrecklicher Gedanke: Mit dem Staub schwimmt<br />
auch unsere Chance an einen ordentlichen Übergang<br />
über diesen Strom nach Ost und nach West<br />
davon. Werden wir überhaupt, wenn wir die Seiten<br />
wechseln müssen, wieder einen trockenen Übergang<br />
finden? Parchim liegt von hier aus gesehen,<br />
im Norden und westlich der Elbe. Am Ende unseres<br />
Marsches nach Parchim müssen wir endgültig auf<br />
der Westseite der Elbe ankommen. Nach dem Verlust<br />
der Pontonbrücke ist für mich jetzt auf der von<br />
uns verlassenen Ostseite eine unwirkliche Ruhe<br />
eingetreten. Von all den Kameraden, die wir zurücklassen<br />
mussten, sprechen wir nicht mehr. Unser<br />
„Dicker“, der Obergefreite, wedelt mit seinem Spazierstock<br />
durch die Luft. Plötzlich rennt er in Windeseile<br />
zu den herrenlosen Kartons, die sich vor<br />
ihm auf der Wiese stapeln. Niemand scheint bisher<br />
die großen Pappkartons bemerkt zu haben. Ich eile<br />
hinter ihm her. ‚Mann, da sind ja Zigarrenkisten<br />
drin!’ Ein Freudenfest für den Dicken. Hier kann er<br />
sich endlich für die nächsten Jahre mit Zigarren<br />
eindecken. Doch er bleibt bescheiden. Geradezu<br />
generös lassen wir die Fundsache liegen. Wir müs-
289<br />
sen weiter. Wir stehen unter dem Druck des<br />
Marschbefehls. Es geht nun für uns an der Ortschaft<br />
Dommitsch vorbei, dann über die „Dübener<br />
Heide“. Unser nächstes Ziel ist die Stadt Gräfenhainichen.<br />
Am Eingang einer Fabrikanlage steht ein<br />
Pförtner.<br />
Er verteilt an die vorbeiziehenden Soldaten Päckchen<br />
mit Feinschnitt-Tabak und Zigarettenpapier.<br />
Nun können wir unsere Zigaretten selbst drehen.<br />
Nach Stunden erreichen wir wieder die Elbe. Auf<br />
einer noch in Betrieb befindlichen Fähre überqueren<br />
nahe der Stadt Coswig den Strom. Wir sind trockenen<br />
Fußes, aber auch wieder auf dem Ostufer, wie<br />
befürchtet gelandet. Während der Überfahrt sagt<br />
uns der Feldwebel: Kameraden, wir sind heute am<br />
Wörlitzer Park vorbei gekommen. Ich habe noch nie<br />
früher etwas von dem Wörlitzer Park gehört. Der<br />
Feldwebel muss es wissen, denn er kommt aus<br />
Cottbus. Allein die Tatsache, wieder auf der Ostseite<br />
der Elbe zu sein, erfüllt mich mit Verdruss. Wenn<br />
wir nicht in den Händen der Sowjets landen wollen,<br />
dann müssen wir irgendwann wieder auf die Westseite<br />
der Elbe wechseln. Hoffentlich haben wir<br />
Glück und finden wieder eine Fähre. Am Westufer<br />
der Mulde, haben die amerikanischen Truppen, so<br />
erfahren wir, eine Pause eingelegt. Der Fluss Mulde<br />
kommt aus dem Süden und mündet bei Dessau in<br />
die Elbe. Und die Elbe fließt hier in Richtung Westen.<br />
Wir marschieren nach Norden. Alle Gedanken<br />
an Gefahr werden schnell von den ständig wechselnden<br />
Eindrücken auf unserem Marsch nach Norden<br />
in den Hintergrund gedrängt. ‚Wir müssen verdammt<br />
aufpassen, die Elbe, die kann uns zum Verhängnis<br />
werden’. Dieses ist der unter uns ausge-
290<br />
sprochene Gedanke. Wo die Sowjets sind, erfahren<br />
wir nicht. ‚Die Sowjets brauchen sich doch nur zu<br />
beeilen, schnappen uns, und wir gehen gemeinsam<br />
nach Sibirien’. Die anstrengenden Märsche in den<br />
letzten Tagen haben uns weiter abstumpfen lassen.<br />
Wie mit einem Schlüssel aufgezogen, marschieren<br />
wir, rein mechanisch in Richtung Parchim. Nun<br />
melden sich Hunger und Durst. Wir vier saßen vor<br />
Tagen in verschiedenen Abteilen des zerstörten<br />
Transportzuges. Gesehen haben wir uns erst nach<br />
dem Verlust unseres Transportzuges. Der Feldwebel<br />
hat unseren Marschbefehl. Wir müssen uns ohne<br />
Verzug in Parchim, in Mecklenburg, melden’,<br />
heißt es im Befehl. Die tägliche Meldung wird von<br />
einer Militärdienststelle mit einem Stempel bestätigt.<br />
Dort erhalten wir auch unsere tägliche Marschverpflegung.<br />
Alles, was zu geschehen hat, läuft militärisch<br />
planmäßig ab. Auch das Warten. ‚Die längste<br />
Zeit des Lebens wartet der Soldat vergebens’.<br />
Stempelalbdrücke mit Datum dienen uns als Bestätigung<br />
unserer Existenz. Sie sind die Hauptsache<br />
auf dem Marschbefehl. Und wehe, wir würden uns<br />
verlaufen, unseren Weg nicht finden. Irgendwo für<br />
ein bis zwei Tage verschwinden. Das Militär kann<br />
keine extra Touren erlauben. Völlig verstaubt, verdreckt<br />
und vom Schweiß äußerlich, wie auch innerlich<br />
verklebt, grau und ausgehungert, marschieren<br />
wir, manchmal sogar im Gleichschritt, weiter nach<br />
Norden. An einer mir nicht mehr bekannten Stelle<br />
haben wir auf unserem Marsch einige Pakete<br />
Knäckebrot organisiert. Jeder von uns versucht mit<br />
dem Knäckebrot, dass in Papier eingewickelt ist<br />
irgendwie fertig zu werden. Mitnehmen kann ich<br />
meine vier Päckchen, in jedem sind vielleicht 250
291<br />
Gramm, nur in den Hosenbeinen meiner Uniform.<br />
Nach und nach ziehe ich mir, so machen es auch<br />
meine drei Kameraden, eine Scheibe davon heraus<br />
und verzehre sie langsam. Ohne Wasser, nur mit<br />
Speichel verarbeitet, habe ich plötzlich meinen Magen<br />
überstrapaziert. Ich habe das Gefühl, als reiben<br />
sich zerbrochene, scharfkantige Dachziegel an den<br />
Magenwänden. Hinzu kommt, das beim Marschieren<br />
das Knäckebrot in den schadhaften Papierhüllen<br />
nach und nach zerbrechen. Zerbröselndes<br />
Knäckebrot klebt jetzt auch schon in den Fußlappen<br />
an den blutig gelaufenen Füßen fest. Seit Ende<br />
März sind meine Füße mit immer denselben Fußlappen<br />
unterwegs. Meinen drei Kameraden geht es<br />
ebenso. Ich kann mich aber nicht von den Resten<br />
des Knäckebrotes trennen. Wer weiß, wann es wieder<br />
etwas zu essen gibt. An den Rückseiten der<br />
Häuser suchen wir Wasserleitungen mit Wasserhähnen.<br />
Doch die vorhandenen Wasserstellen sind<br />
abgesperrt. Die Menschen in den Häusern haben<br />
ihre Wasserleitungen, wie man es im Winter macht,<br />
abgestellt. Menschen haben wir in den Ortschaften<br />
nie gesehen. Sie halten sich versteckt, beobachten<br />
uns aus der Ferne oder sind geflüchtet. Wo ist der<br />
nächste Wasserhahn, der uns Wasser geben kann?<br />
Wir durchstreifen einen Teil des „HOHEN FLÄ-<br />
MING“. Rasten über Nacht in der Nähe der Stadt<br />
Wiesenburg. Nur nicht in Richtung Berlin marschieren.<br />
Weiter geht es nach Norden. Bei Zi-e-sar unterqueren<br />
wir die Reichsautobahn. Unsere müden<br />
Blicke bei der hellen Sonne gehen in Richtung Westen,<br />
nach Magdeburg. Der Marschbefehl treibt uns<br />
aber weiter nordwärts. Wir müssen uns beeilen.<br />
Kurze Verschnaufpausen haben wir nur, um unsere
292<br />
karge Nahrung zu verzehren. Wir funktionieren nur<br />
noch so, einfach so, wie uns befohlen. An manchen<br />
Tagen sind wir ohne einen Tropfen Wasser über die<br />
staubigen Landstraßen und durch Dörfer, ohne<br />
Wasser oder Menschen zu finden, gezogen. Die<br />
Ortsnamen nehmen wir nicht zur Kenntnis.<br />
Im Sonnenschein geht es weiter in Richtung Genthin.<br />
Neun Tage und Nächte sind wir schon zu unserem<br />
neuen Ziel „Parchim“ in Mecklenburg zu Fuß<br />
unterwegs. Dort solle eine neue Division aufgestellt<br />
werden, sagt uns der Feldwebel. Endlich, am<br />
28.April 1945, einem Sonnabend, ziehen wir Vier<br />
am späten Nachmittag in Genthin ein. Hinter dem<br />
Ortsschild von Genthin gehen die Augen unseres<br />
Feldwebels auf die Suche nach einer Waschmöglichkeit.<br />
Die erste Möglichkeit, an eine Wasserstelle<br />
zum Waschen zu gelangen, könnte die vor uns liegende<br />
Gastwirtschaft sein. Doch die Wirtsleute, es<br />
waren nur zwei oder frei Frauen, wollen uns verwahrloste<br />
und verdreckte Krieger nicht haben. Sie<br />
haben nicht direkt Nein! gesagt. Wir hätten den<br />
Menschen in der Gastwirtschaft nur unseren Dreck<br />
und Arbeit hinterlassen. Und, schon stehen wir wieder<br />
auf der Straße. Unser Feldwebel überlegt den<br />
nächsten Schritt, da setzen plötzlich Sirenen mit<br />
jaulendem Flieger-Vollalarm ein. Ach ja, die Sirenen<br />
und die Bomber gibt es ja auch noch. Die habe ich<br />
schon vergessen. Bomber! Die viermotorigen<br />
Bomber nähern sich. Mit dem Nerven fressenden<br />
Motorenlärm überfliegen sie uns. Mit der Stille ist es<br />
schlagartig vorbei. Die über uns hinweg donnernden<br />
Bomber schrecken mich jedoch nicht mehr. Da, - -<br />
ein Fingerzeig aus der Gaststätte, eine Einladung<br />
nun doch zu kommen und wir sind im Gebäude. Wir
293<br />
erhalten warme Getränke und etwas Nahrhaftes,<br />
nachdem wir uns nacheinander in einer großen<br />
Waschschüssel oberflächlich gewaschen haben. Es<br />
ist immer noch Fliegeralarm. Die Bomber haben wir<br />
inzwischen vergessen.<br />
Sie sind nicht mehr zu hören. Mit Einbruch der Dunkelheit<br />
verlassen wir das Haus.Wir stehen in der<br />
Finsternis. In östlicher Richtung erblicken wir am<br />
Horizont den Widerschein eines Flächenfeuers. Unterhalb<br />
der geschlossenen Wolkendecke breitet sich<br />
das Feuer aus. Man riecht hier förmlich den Brandgeruch.<br />
Das wird Brandenburg sein. Verdammt<br />
noch mal, nimmt das alles denn kein Ende? Um uns<br />
herrscht Stille. Im Widerschein der fernen Feuer<br />
erkennen wir langsam unsere Umgebung. Und zu<br />
dieser Zeit, sind die Bomber sicher schon wieder<br />
auf ihrer Rückreise. Da hinten, irgendwo weit weg<br />
im Westen verlieren sich ihre Spuren. Wir sind auf<br />
der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit in<br />
Genthin. In völliger Dunkelheit treffen wir auf einen<br />
leeren, aus etwa zwanzig gedeckten Güterwagen<br />
bestehenden Zug ohne Lokomotive, auf dem Bahnhofsgelände.<br />
Der Zug steht mit offenen Waggontüren<br />
auf dem Abstellgleis und endet unmittelbar vor<br />
dem Prellbock. Für uns gibt es nur noch: Einsteigen<br />
in den letzten Waggon und pennen. ‚Über Nacht<br />
werden die den Güterzug nicht abholen‘ so der<br />
Feldwebel. Völlig übermüdet fallen wir in das vorhandene<br />
alte und brüchige Stroh. Wir schlafen endlich<br />
wieder einmal auf einem Holzboden und auf<br />
Stroh. Viele der letzten Nächte haben wir nur auf<br />
dem Waldboden verbracht. Es ist und bleibt auf<br />
dem Bahnhofsgelände über Nacht ruhig. Zwischendurch<br />
meldet sich der Magen wieder. Es ist das
294<br />
verdammte Knäckebrot. Am frühen Morgen verlassen<br />
wir den Schlafplatz und freuen uns auf einen<br />
sonnigen Tag, der gerade anbrechen will. „Ich habe<br />
gestern unsere Papiere nicht abstempeln lassen,<br />
sagt der Feldwebel ganz beiläufig“. „Das werde ich<br />
heute bei der Ortskommandantur in Genthin nachholen“.<br />
Nachdem wir uns gegenseitig vom Stroh<br />
befreit haben, suchen wir nach einer Möglichkeit,<br />
wo wir endlich mal richtig frühstücken können. „Da<br />
ist heute reiner Luxus angesagt!“ Wir haben bisher<br />
noch nie Geld von unserem Sold ausgeben können.<br />
Mindestens einhundert Reichsmark, in fünf zwanzig<br />
Reichsmark-Scheinen, mit dem Hakenkreuz, hat<br />
jeder von uns bei sich. „Heute werden wir uns etwas<br />
Besonderes erlauben“ meint der Dicke. „Fragen wir<br />
doch einfach den Mann mit der roten Mütze im<br />
Bahnhof“ sagt der Feldwebel. Dieser verschwindet<br />
gerade in seinem Dienstraum. Der kennt sich doch<br />
hier im Ort aus. Er wird uns Auskunft geben’. Heute<br />
Morgen, da sind wir wohl übermütig! Na, ja, bei dem<br />
Gedanken an ein gutes Frühstück. Für einen Augenblick<br />
haben wir sogar den Krieg vergessen. Vielleicht<br />
finden wir ein geöffnetes Café. „Auf, zum<br />
Mann mit der roten Mütze“ meint der Feldwebel. In<br />
wenigen Sätzen haben wir die Gleispaare übersprungen<br />
und stehen vor der Tür zum Dienstraum.<br />
Ohne anzuklopfen, Militär klopft nie an, betreten wir<br />
Vier den Raum. Der Mann hängt gerade seine rote<br />
Mütze auf den Haken. Er dreht sich um und empfängt<br />
uns mit einer schroffen, militärisch knappen<br />
Stimme: „Wo kommen Sie denn her?“. Wir bleiben<br />
völlig ruhig. ‚Was will der von uns?’ - fragt einer<br />
meiner Kameraden. ‚Warum meckert er?’ ‚Da uns<br />
Genthin für die letzte Nacht keine Unterkunft zur
295<br />
Verfügung gestellt hat’, sagt unser Feldwebel arglos,<br />
‚da haben wir da drüben im Güterzug, im letzten<br />
Waggon übernachtet und ausgesprochen gut geschlafen’.<br />
Er zeigt mit dem Zeigefinger seiner linken<br />
Hand in die Richtung der Güterwagen. Das Gesicht<br />
des Eisenbahners färbt sich rot, als wolle er im<br />
nächsten Augenblick platzen, so rot wie seine Mütze.<br />
Dann schreit er los: ‚Verlassen sie sofort meinen<br />
Dienstraum!’. ‚Was soll das mit der Schreierei?<br />
Warum sind Sie so ruppig?’. Erwidert der Feldwebel<br />
mit fester Stimme. Die Antwort ist knapp. Es folgt<br />
nur noch der Ausruf: „Typhus!“ - - - „Typhus*?“<br />
„Kehrt, Marsch - Marsch, Kameraden“ und schon<br />
sind wir wieder draußen auf dem Bahnsteig. Nach<br />
dieser Attacke verlassen wir den Bahnhof in Genthin.<br />
Wir marschieren in die Stadt und suchen ein<br />
Café. Dieser Ort, der sich Genthin nennt, hat uns<br />
nicht gerade freundlich begrüßt und empfangen. Wir<br />
sind hier nicht erwünscht. Mit Genthin haben wir<br />
kein Glück. Da war die Schwierigkeit am letzten<br />
Abend mit der Gaststätte, daran anschließend die<br />
Übernachtung in dem verseuchten Güterzug auf<br />
dem Bahnhofsgelände. Wir legen auch keinen großen<br />
Wert auf diesen Ort**.Wir werden nach dem<br />
Frühstück sofort weiter nach Schollene marschieren.<br />
In der Stadt herrscht eine unwirkliche Ruhe. An<br />
der Hauptstraße, die parallel an einem rechteckigen<br />
Platz vor dem Rathaus einmündet, wird an diesem<br />
Morgen das Schaufenster eines Cafés geputzt.<br />
‚Morgen kann die sowjetische Armee hier sein und<br />
die putzen zum Empfang die Fensterscheiben’ stellt<br />
der Dicke fest und schüttelt dabei sein Haupt. Wir<br />
verlangen Einlass und verstauen uns auf den mit<br />
Plüsch gepolsterten Sitzbänken. Der Dicke meldet
296<br />
sich: ‚Die haben es wohl verstanden mit der Fensterputzerei.<br />
Das Mädchen ist mit ihrem Putzeimer<br />
verschwunden’. Flach liegen, denke ich. Nur schlafen,<br />
das ist mein Wunsch. Ich finde aber keine Ruhe.<br />
Das Knäckebrot raspelt ohne Pause weiter im<br />
Magen. Von meinem Platz, der Plüschbank aus,<br />
sehe ich durch die Gardine auf die gegenüberliegenden<br />
Häuser. Mein Blick trifft auf eine Ansammlung<br />
älterer Männer in Zivil und Hitlerjungen in Uniformen.<br />
Sie sind mit Gewehren und Panzerfäusten<br />
ausgerüstet. Das sind doch die Männer vom „Volkssturm“<br />
geht es durch meinen Kopf. Wollen die hier<br />
einen Privatkrieg veranstalten? Wollen oder sollen<br />
sie auf Befehl ihres örtlichen Parteimenschen vielleicht<br />
die Sowjets aufhalten? Ich denke: die etwa 20<br />
jungen und alten Männer sind innerlich zerrissen.<br />
Einige sind sicher fanatisch und wollen unbedingt<br />
den Befehlen des Führers folgen. Auf mich wirken<br />
die selbst ernannten Krieger wie ein zusammengefegter<br />
Haufen, der nur noch zum Sterben für den<br />
Führer und für das Vaterland angetreten ist. Sie<br />
sind sicher das allerletzte Aufgebot. Hat der obere<br />
„Goldfasan“ sie vor seinem eigenen Abmarsch aufgeboten?<br />
Hat er sich vielleicht gleich danach mit<br />
seiner Familie abgesetzt? Oder war es ein Panzeralarm,<br />
der sie hat antreten lassen? Jetzt erklärt sich<br />
mir auch die hier herrschende trügerische Ruhe.<br />
Unser Feldwebel wird gleich in das Rathaus gehen<br />
und unsere Marschpapiere in der Dienststelle abstempeln<br />
lassen. Daran anschließend wird er sich<br />
um unsere Verpflegung für gestern und heute<br />
kümmern. Ein ohrenbetäubender, dumpfer Knall<br />
erschüttert plötzlich unsere friedliche Welt. Die<br />
Schaufensterscheibe bebt und schwingt, als wolle
297<br />
sie nachgeben oder gar zerspringen. Die Explosion<br />
vernichtet die sonntägliche Stille und damit unser<br />
Frühstück in Genthin. Der über Nacht auf dem<br />
Bahnhof stehende Güterzug war sicher zur Reinigung<br />
und Desinfizierung abgestellt worden. Nach<br />
dem brüchigen und alten Stroh zu urteilen, waren<br />
Menschen mit Typhus transportiert worden. Meine<br />
Ohren sind wie taub. Mein Kopf ist dumpf. Schneller<br />
als erwartet ist hier der Krieg ausgebrochen. Es ist<br />
nicht nachvollziehbar, aber alle Explosionen geschehen<br />
in diesem Kriege ohne jede Vorwarnung.<br />
Sind die trügerischen Zeitphasen der absoluten Ruhe<br />
vor Explosionen ein Zeichen für kommendes<br />
Unheil? Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet<br />
werden. Wir sind hier wieder einmal eiskalt<br />
** In den Jahren nach 1991-93 habe ich mehrmals Genthin<br />
besucht und fand den Ort in einer friedlichen Atmosphäre wieder.<br />
Der Besuch des Cafés brachte sofort die Erinnerungen an<br />
den 28. und 29. und 30. April 1945 zurück.<br />
überrascht worden. Die „Krieger“ da draußen, ja, wo<br />
sind sie? Die sind wie die Vögel fortgeflogen. Ihr<br />
Sammelplatz ist leergefegt. Im Laufschritt verlassen<br />
wir den Gastraum durch die Hintertür, ohne unsere<br />
Zeche zu bezahlen. Wir springen durch den rückwärtigen<br />
Garten und finden uns an der Eisenbahnlinie<br />
Magdeburg-Berlin wieder. „Wir setzen uns nach<br />
Westen ab, in Richtung Burg“, entscheidet unser<br />
Feldwebel. Nach Parchim geht es in Richtung Norden.<br />
Nach etwa zwei Kilometern Dauerlauf verlassen<br />
wir die Bahnlinie und jagen, schnelllaufend,<br />
weiter nach Norden. Es geht über einen Wassergraben,<br />
über Wiesen und Zäune. Da liegt plötzlich,<br />
vor uns, querab eine breite Wasserstraße. Diese
298<br />
hält unseren Marsch auf. Auf der Deichkrone des<br />
Elbe-Havel-Kanals angekommen, lassen wir uns<br />
auf den Boden fallen. Und wieder zerfällt ein Teil<br />
meines Knäckebrotes. „Und wie kommen wir nun<br />
über den Kanal? Wir sind doch völlig umsonst<br />
hierher gerannt“ meint der Dicke. „Sollen wir nun<br />
auch noch an das andere Ufer schwimmen?“ folgt<br />
noch, nachdem er sich wieder beruhigt hat. Den<br />
ersten Schock haben wir überwunden. In westlicher<br />
Richtung liegen Selbstfahrer-Kähne auf unserer<br />
Kanalseite. Von dort kommen, ohne jedes Misstrauen,<br />
Frauen von den Kähnen und bieten uns<br />
warmes Essen an. Ihrer Sprache nach haben wir<br />
hier Niederländer getroffen. Es ist gerade Mittagszeit.<br />
„Da kommen wir ja zur richtigen Zeit“, meint<br />
mein Kumpel. „Die müssen uns mit ihrem Kahn<br />
übersetzen“ sagt der Feldwebel. „Jetzt machen wir<br />
aber erst einmal Pause“ fügt er an. Bei mir haben<br />
sich die Magenschmerzen wieder gemeldet. Nach<br />
Anraten einer der Schifferfrauen versuche ich etwas<br />
zu essen. Die Wärme, die sich mit dem Essen bis in<br />
den Magen verbreitet, empfinde ich als wohltuend.<br />
Das gilt ebenso für die freundlichen Worte der<br />
Frauen. Doch ich bleibe vorsichtig. Da ist nicht nur<br />
das Knäckebrot an den Magenschmerzen und<br />
Krämpfen schuld. Rein äußerlich haben wir die Vernichtung<br />
unseres Transportzuges bei Boblitz bewältigt,<br />
und den sowjetischen Truppen sind wir nicht in<br />
die Hände gefallen. Und die letzten zehn Tage werden<br />
wir später, wenn es möglich sein wird, einmal<br />
verarbeiten. Auf der südlichen Seite des Kanals sehen<br />
wir in Richtung Genthin zwei festgemachte<br />
Lastkähne. Vor einem steht ein Soldat unter Gewehr<br />
auf Wache. Von Zeit zu Zeit betritt ein Mann,
299<br />
in Offiziersuniform gesteckt, torkelnd die Szene.<br />
Von einem wachfreien Soldaten erfahren wir, dass<br />
die Kähne mit Marketenderwaren* vollgestopft sind.<br />
Sie liegen seit Wochen hier. Truppenverbände sollten<br />
die Waren vor Tagen übernehmen. Wenn die<br />
ausbleiben, dann müssten sie die Ladungen in<br />
Brand setzen und die Kähne sprengen. Die Niederländer<br />
kommen nach dem Essen zu uns und bieten<br />
uns Unterkunft und Schutz auf ihren Fahrzeugen<br />
an. Warum sie das tun, können wir nicht erkennen.<br />
Wieso machen sie uns so ein Angebot. Wir können<br />
das nicht annehmen. Das mit dem Schutz kann nur<br />
ein Missverständnis sein. Zu allem Überfluss bieten<br />
sie uns sogar Zivilkleidung an. Sie erzählen, sie<br />
seien mehrfach von deutschen Soldaten überprüft<br />
worden. Weil ihre Papiere in Ordnung sind, würde<br />
man sie in Ruhe lassen. Wir könnten, so sagen sie,<br />
in ihrer Obhut völlig sicher sein. Wir kennen unsere<br />
Leute besser und lehnen ihr Angebot dankend ab.<br />
Unsere Uniformen behalten wir an. Unter keinen<br />
Umständen werden wir sie gegen Zivilsachen tauschen.<br />
In Zivil wäre unsere weitere Existenz gleich<br />
Null. Aus Mangel an einer besseren Unterkunft<br />
verbringen wir eine Nacht unter Deck, auf dem Vorschiff<br />
einer der Kähne. Spät in der Nacht erscheint<br />
der Feldwebel, er ist erfreut über seine Leistung. Mit<br />
sich bringt er eine Kiste mit Bols-Likör in handelsüblichen<br />
Flaschen. Meine drei Kameraden nehmen<br />
sich den Likör zur Brust und so geht für sie die<br />
Nacht vom Sonntag zum Montag, auch nur langsam,<br />
mit dem „an Land gezogenen“ Likör, vorbei.<br />
Der Montagmorgen bricht an. Der sich langsam auflösende<br />
Nebel verspricht uns strahlenden Sonnenschein<br />
für den Tag. - Verdammt noch mal! - - Wir
300<br />
sitzen noch auf dem Südufer. Meine drei „Saufköppe“<br />
haben sicher alles vergessen. Ich denke schon<br />
weiter: Unsere Marschpapiere sind gestern nicht<br />
abgestempelt worden. Und die Verpflegung haben<br />
wir nicht erhalten. Nur mit Verzögerung verlässt der<br />
Alkoholdunst und die Süße des Likörs ihre Köpfe.<br />
Wir müssen sofort über den Kanal, mag da kommen,<br />
was will. Was oder wer hindert uns überhaupt<br />
noch? Also los! - - - Nach einer kurzen Verhandlung<br />
und dem üblichen Palaver setzen uns die Schiffer<br />
mit einer Schottelschaluppe über den Kanal. Ich bin<br />
nun beruhigt. Wir haben am nördlichen Ufer wieder<br />
festen Boden unter den Füßen. Die Gedanken sind<br />
jetzt darauf gerichtet, wie wir nach Schollene kommen.<br />
Der Ort liegt in nördlicher Richtung von unserem<br />
gegenwärtigen Standort. Wir vermuten, dass<br />
wir hier westlich an Genthin vorbei gekommen sind.<br />
Wir werden bald auf die Straße stoßen, die uns den<br />
Weg nach Schollene weist. Wir folgen unserem<br />
Marschbefehl. Das Ereignis mit der gewaltigen Explosion<br />
gestern am Sonntag haben wir unerledigt<br />
abgelegt. Wir haben keinen Menschen getroffen,<br />
den wir dazu hätten befragen können. Auf einem<br />
Feldweg zwischen Äckern nähern wir uns einer<br />
querverlaufenden Landstraße. Diese haben wir<br />
dann einsehen können, nachdem wir an dem Kiefernwald<br />
und an der dichten Schonung vorbei marschiert<br />
sind. Wo geht es weiter? Unser nächstes<br />
Ziel ist Schollene. Vor uns stehen plötzlich, wie aus<br />
einer fremden Welt kommend, vier Frauen in geblümten<br />
Kittelschürzen. Sie stehen mitten auf der<br />
Straße. Was machen die hier, warum halten sie sich<br />
ausgerechnet hier auf? Doch das interessiert uns<br />
nicht. Obwohl wir die von Baumreihen begrenzte
301<br />
Straße aus größerer Entfernung erkennen konnten,<br />
haben wir keine Menschen wahrgenommen. An den<br />
sichtbar gelben Quadraten und dem aufgenähten<br />
blauen „P“ erkennen wir in ihnen polnische<br />
(Zwangs)-Arbeiterinnen. „Sie werden uns sagen<br />
können, wie wir nach Schollene kommen“ meint<br />
unser Feldwebel. Ihre Kennzeichnung, mit dem „P“<br />
* auf ihrer Kleidung beachten wir dabei nicht. Wir<br />
verhalten uns ihnen gegenüber so, als wären sie<br />
normale Spaziergänger.<br />
Marketender: Im 16. bis 19. Jahrhundert, fahrende<br />
Händler, die Truppen begleiteten und versorgten.<br />
Aus -Deutsche Buch Gemeinschaft-. Lexikon 1957,<br />
Ullsteinhaus Berlin 1960. Früher waren die Marketender<br />
Händler bei der Feldtruppe. Bei diesen<br />
Händlern konnten die Soldaten für Ihren Sold einkaufen.<br />
DUDEN 2000<br />
Die vier Frauen mit dem „P“ beachten wir bewusst<br />
nicht weiter. ‚Sie müssen durch diesen Wald bis zur<br />
nächsten Straße gehen’, sagt eine der Frauen in<br />
recht gutem Deutsch. ‚Gehen Sie durch den Wald,<br />
dann weiter auf der Straße, dann kommen Sie an<br />
eine andere Straße mit einem Schild Schollene’ So<br />
war die Auskunft. Na, Gott sei Dank, wir sind auf<br />
dem richtigen Wege. Wir danken ihnen und setzen<br />
unseren Weg fort. Wir gehen und überqueren die<br />
Straße. Noch zwei, drei Schritte um dann in den<br />
angrenzenden Wald zu kommen, da trifft uns völlig<br />
unerwartet der nächste Schlag. Wie von einer Geisterhand<br />
gesteuert, sind wir blitzartig überrumpelt.<br />
Nun stehen wir vier wie versteinert da. Der Schock<br />
sitzt uns nicht nur im Nacken. Ohne jede Vorwarnung,<br />
sind zwei bis an die Zähne bewaffnete, getarnte<br />
deutsche Soldaten aus dem nahe Straßen-
302<br />
graben aufgesprungen. Sie nehmen uns fest. Was,<br />
ein übler Scherz? - - Nein. Ich fühle blitzschnell, die<br />
nehmen ihren Auftrag sehr ernst. - - Geschockt, mit<br />
Flimmern vor den Augen, erkenne ich plötzlich nur<br />
meine Lage. Die zwei bewaffneten Feldgrauen<br />
verbieten uns das Sprechen und bringen uns ganz<br />
schnell ans Laufen. Im Schrecken suche ich innerlich<br />
nach Zeugen. Da sind doch die polnischen<br />
Frauen. Plötzlich werde ich von einer hirnverbrannten<br />
Verwirrung verfolgt. Ich suche den rettenden<br />
Strohhalm. - - - Ich will nicht glauben, dass die polnischen<br />
Frauen plötzlich keine Zeugen für uns sein<br />
könnten. Gott sei Dank, die sind über alle Berge.<br />
Hätte das nicht eine weitere Eskalation unserer Situation<br />
geben können? - - Junge polnische Frauen<br />
als Zeugen für deutsche Soldaten? - - - Etwas<br />
Dümmeres konnte mir nicht einfallen. Und eine eindeutige<br />
Verbindung zwischen uns und den polnischen<br />
Frauen wäre doch schnell gefunden. Unsere<br />
eigenen Soldaten hätten uns, ohne je zur Rechenschaft<br />
gezogen zu werden, einfach umlegen können.<br />
Was haben wir jetzt zu erwarten? Die Soldaten<br />
wissen genau, wo wir herkommen. Sie haben uns<br />
schon auf dem Feldweg, spätestens an der Schonung,<br />
erkennen müssen. Wir sind das gefundene<br />
Fressen für die beiden. Sie haben auch unser Gespräch<br />
mit den Frauen verfolgen können. Wir waren<br />
auf dem Weg nach Schollene. Eine Fluchtabsicht in<br />
Richtung Westen war aus meiner Sicht doch nicht<br />
zu erkennen. Wir wollten uns nicht absetzen, keine<br />
Fahnenflucht begehen. Wir wollten nicht abhauen.<br />
Auch nicht in Richtung Ferchland*. Der Ort Ferchland<br />
war uns bis zu dem Zeitpunkt unserer Festnahme<br />
nicht bekannt. Wir kamen zu Fuß aus der
303<br />
Niederlausitz, haben keinerlei Kontakte zu anderen<br />
Soldaten in diesem Gebiet um Genthin gehabt. Die<br />
Posten müssen uns gegenüber den Ort Ferchland<br />
genannt haben. Sie wollten sicher herausfinden, ob<br />
wir dahin marschieren wollten. Schweigend laufen<br />
wir, von aufgepflanzten Seitengewehren begleitet,<br />
in Richtung Genthin. Wirre Gedanken, Ungereimtheiten,<br />
ja Widersprüchliches, ein ganzes Sortiment<br />
„tief greifender Nervosität“ durchzuckt mein Gehirn.<br />
Dann folgt ein Schritt in die innere Beruhigung. „Es<br />
wird sich alles aufklären lassen“, denke ich. „Es wird<br />
sich doch nachweisen lassen, dass wir keine Deserteure<br />
sind“. Woran das erkennbar sein soll, das<br />
weiß ich nicht. Schon kommen wieder Zweifel auf.<br />
Ich versuche Ordnung in meine Gefühle zu bringen.<br />
Was spricht für uns? ‚Natürlich, es müssen unsere<br />
Marschpapiere nur vervollständigt werden’. - - Die<br />
von unserem Feldwebel mündlich vorzutragenden<br />
Angaben über unseren Marsch bis Genthin kann<br />
man überprüfen. Die letzten Stempel müssen nur<br />
nachgeholt werden. Füge ich als Strohhalm an.<br />
Damit beruhige ich mich wieder. Aber wie lange?<br />
Und auf die uns noch zustehende Verpflegung können<br />
wir notfalls verzichten. Nach weiteren Gedankensprüngen<br />
halte ich unsere Festnahme innerlich,<br />
ohne mich mit meinen anderen Kameraden verständigen<br />
zu dürfen, für Unsinn. Mit dem Gedanken<br />
„Es wird sich schon alles aufklären“ beruhige ich<br />
mich zum wiederholten Male. Ob wir vier uns, durch<br />
das Sprechverbot voneinander getrennt, auf unserem<br />
Weg nach Genthin wirklich beruhigen, kann ich<br />
nicht mehr sagen. In immer kürzeren Abständen<br />
erscheinen wieder und wieder die Bilder unserer<br />
plötzlichen Festnahme vor meinen Augen. Ohne
304<br />
Kontakt miteinander gewinnen wir hoffentlich, wenn<br />
auch jeder nur für sich, langsam wieder an Oberwasser.<br />
Wie lange wir auf der Straße nach Genthin<br />
marschieren, erinnere ich nicht. Wir marschieren<br />
ohne jede Witterung, einfach stumpfsinnig<br />
nebeneinander im Gleichschritt dahin. Treiben die<br />
beiden bewaffneten Posten nur ein Spiel mit uns?<br />
Oder werden sie uns erschießen? Die werden uns<br />
nicht erschießen! Doch Möglichkeiten zu einer Bestrafung<br />
werden die schon finden. Die wachsende<br />
Angst lässt kein Denken zu. Von uns zeigt niemand<br />
eine Reaktion mehr. Wir sehen uns nicht an. Ich<br />
spüre sie physisch, die aufgepflanzten Seitengewehre.<br />
Die Straße, auf der die Soldaten uns festgenommen<br />
haben führt in westliche Richtung nach<br />
Ferchland. Vom Punkt des Überfalls sind es etwa<br />
10 Kilometer bis Ferchland. Wo bringen die uns<br />
hin? Was wird jetzt kommen? Wir sind vogelfrei. Wir<br />
Vier können die Situation, in der wir uns befinden,<br />
nicht begreifen. Mit uns marschiert nur Erbarmungslosigkeit,<br />
Grausamkeit, Barbarei und Tyrannei. Wir<br />
Vier erkennen aber schnell, dass wir in Kürze hilflos<br />
einer absoluten Macht gegenüber stehen werden.<br />
Wie gefährlich die Situation für uns Festgenommene<br />
ist, will ich erklären: Wir vier Männer kommen<br />
von sowjetischen Panzern am 19. April 1945 beschossen<br />
und von der Ostfront in Deutschland verjagt<br />
bei Lübbenau/Niederlausitz an diesen Ort. Am<br />
20. April 1945 erhalten wir von einer Meldestelle<br />
des Militärs den Marschbefehl, uns sofort und ohne<br />
Verzögerung auf den Marsch nach Parchim in<br />
Mecklenburg zu begeben. Jeden Nachmittag haben<br />
wir uns bei einer Meldestelle des Militärs zu melden.<br />
Unser Feldwebel, „Ausbilder“ in unserer Kompanie,
305<br />
trägt die Verantwortung für uns vier. Er geht jeweils<br />
allein in die Meldestelle und kommt anschließend<br />
mit dem abgestempelten Marschbefehl und die<br />
Marschverpflegung für den Tag zu uns zurück.<br />
Dann marschieren wir weiter und rasteten am<br />
Abend irgendwo im Gelände. Entweder unter Bäumen,<br />
am Waldrand oder in einer Scheune. Wir bewegten<br />
uns nicht auf Landstraßen, sondern abgesetzt<br />
annähernd parallel dazu. Durch Dörfer ziehen<br />
wir nur in der Hoffnung dort Trinkwasser aus Wasserhähnen<br />
auf der Rückseite der Häuser zu finden.<br />
Doch sind in der Regel die Wasserhähne abgesperrt.<br />
Die Menschen in den Dörfern haben ohnehin<br />
Angst vor einer Horde unbewaffneter Soldaten, die<br />
verdreckt, ungeordnet an ihren Häusern einfach<br />
vorbei ziehen. Wie es scheint haben die Menschen<br />
auch davon gehört, dass Soldaten Häuser plündern.<br />
Am 28.April hatten wir dann Genthin erreicht. Am<br />
29.April werden wir von einer gewaltigen Explosion<br />
in Genthin, zur Stadt hinaus gejagt. Was an dem<br />
Tage in Genthin geschehen ist, davon haben wir<br />
keine Ahnung. Da wir kein deutsches Militär antreffen,<br />
nehmen wir an, dass wir nun irgendwo im Niemandsland<br />
von deutschen Truppen abgeschnitten<br />
sind. Wir haben uns keine Gedanken gemacht,<br />
denn wir haben den Marschbefehl jeden Tag bis auf<br />
den 29. und 30. April abstempeln lassen können.<br />
Einen Nachweis, dass wir uns korrekt verhalten haben,<br />
ist doch durch das Geschehen in Genthin bei<br />
unserer nächsten Meldestelle nachzutragen und zu<br />
bestätigen. Am 30.April haben wir den Elbe-Havel-<br />
Kanal mit Hilfe der Niederländer überquert. Auf unserem<br />
Marsch erreichten wir die Straße mit den vier<br />
polnischen Frauen. Die Überrumpelung der zwei
306<br />
bewaffneten Soldaten auf uns war gelungen. Zwei<br />
Entscheidungen waren bei unserer Festnahme<br />
möglich. Als erste Entscheidung: Der Vorposten*<br />
der deutschen Einheit, hätten uns sofort auf der<br />
Stelle, ohne Festnahme erschießen können.<br />
Die zweite Entscheidung: sie nehmen uns fest und<br />
bringen uns zurück zu ihrer Einheit. In unserem Fall<br />
war es jedoch so: Wir marschieren noch vor und an<br />
den Vorposten vorbei. Wir vier Mann sind unbewaffnet.<br />
Aus Sicht des Vorpostens musste es nahe<br />
liegend sein, dass wir uns absetzen wollen. Denn<br />
warum laufen wir ausgerechnet nur wenige Meter<br />
an ihnen vorbei? Wir haben keinen Verdacht gehabt,<br />
dass man uns auf unserem Wege nach Parchim<br />
noch einmal aufhalten wird. Auf der anderen<br />
Seite wären wir nicht so dreist gewesen und hätten<br />
die Posten nur provozieren wollen. Ich folgere aus<br />
der Aktion: Wenn unser Feldwebel Frontdiensterfahrung<br />
gehabt hätte, wäre es wohl zu der ersten<br />
Entscheidung der Vorposten gekommen. Auch,<br />
wenn wir im Recht sind, müssen wir uns der militärischen<br />
Willkür beugen. Da. - - Wir werden erwartet.<br />
Aus etwa 50 m Entfernung sehen wir vor uns auf<br />
der Straße einen dekorierten Offizier stehen. Wohl<br />
ein Major, ohne rechten Arm, körperlich stark untersetzt.<br />
Mit seiner gedrungenen Gestalt steht er breitbeinig<br />
und stramm da. Er brüllt und schäumt wo er<br />
uns sieht vor Wut. Wir sind ihm ausgeliefert. Der<br />
Sonnenschein bündelt seine Strahlen auf uns, wie<br />
ein Scheinwerfer, der diese Szene mit seinem grellen<br />
Licht in die Öffentlichkeit reißt. Doch es sind<br />
keine Zuschauer da. Die arrogante, militärisch laut<br />
schnarrende, sich dabei überschlagende und schrille<br />
Stimme brüllt: ‚Traben - sie - an!’ Wir traben an
307<br />
(Laufschritt) und nehmen vor dem Major der Wehrmacht,<br />
die militärisch stramme Haltung ein. Unser<br />
Feldwebel, sofort wieder zuversichtlich, wieder ganz<br />
in seinem Element, beginnt mit der Meldung. Das<br />
zweite Wort hat er noch nicht über seine Lippen<br />
gebracht, da liegt er schon ohne Kopfbedeckung,<br />
von einem beispiellos harten Fausthieb getroffen,<br />
mit blutendem Gesicht nach vorn gestürzt, flach auf<br />
der Straße. Wir drei zucken wie Schafe verkrampft<br />
zusammen. Wir stehen wie vor der Abschlachtung<br />
da. Unser Feldwebel, geschockt, steht auf und<br />
nimmt wieder Haltung an. Das mit Blut verschmierte<br />
Gesicht hat er mit einer Hand abgewischt. Der Rest<br />
trocknet allein. Das blutleere Gesicht wird von den<br />
Spuren des antrocknenden Blutes abgedeckt. Die<br />
Kanonade der Raserei geht weiter. Nun gegen seine<br />
eigenen Soldaten gerichtet, folgt ein verstärkter<br />
Wutausbruch: „Sie hätten diese üblen, feigen<br />
Schweine gleich umlegen sollen. --- Gar nicht erst<br />
festnehmen. --- Jetzt haben wir hier den Ärger damit!“<br />
hämmert der Offizier. Mit hochrotem Kopf zeigt<br />
er sich tobend seinen Soldaten. Wir erleben ihn wie<br />
einen subalternen Diktator, der außer sich ist, der<br />
nur noch vom „Durchhaltefanatismus“ getrieben<br />
wird. Der Vorposten hat die Aufgabe, dass vor einer<br />
Einheit liegende Gelände zu beobachten. Der Vorposten<br />
ist mit unterschiedlichen Vollmachten ausgestattet.<br />
Nach meinem Empfinden hat der Offizier<br />
auf diesem Posten Angst vor dem, was schon bald<br />
auf ihn zukommen wird. Seine Angst macht ihn gefährlich.<br />
Der Major will sich gar nicht mehr beruhigen.<br />
Von diesem Offizier haben wir nichts zu erwarten.<br />
Mit dem Schlag in das Gesicht unseres Feldwebels<br />
ist der seelische Tiefpunkt in uns erreicht. Er
308<br />
brüllt und schreit. „Ab in den Wald!“. Nun brüllt er<br />
noch hinter uns her: „Sie sind in meinen Augen nur<br />
feige Schweine, sie sind in meinen Augen üble<br />
Fahnenflüchtige, Deserteure“. Der Major hat sich<br />
selbst zum „Herrgott“ gemacht.<br />
Er ist felsenfest davon überzeugt: dass wir abhauen<br />
wollten. Bei unserem Marsch durch das Niemandsland<br />
hätten wir nur auf eine günstige Gelegenheit<br />
gewartet. Er unterstellt uns sogar, dass wir unsere<br />
Uniform gegen Zivilsachen getauscht hätten, wenn<br />
uns nicht der Doppel-Posten aufgegriffen hätte. Wir<br />
wollten nach seiner festen Überzeugung nicht mehr<br />
bis zum Endsieg kämpfen. Wir wollten uns vom<br />
Krieg absetzen. Mit weiteren Anwürfen macht er<br />
sich Mut. Nun spricht er sich selbst an: „Die glauben<br />
nicht mehr an den Endsieg. denen werde ich es<br />
jetzt zeigen. Ich werde sie der einzigen Strafe zuführen,<br />
die sie verstehen. Diese feigen Verräter<br />
brechen mit ihrem Eid die Verpflichtung zur Treue<br />
zu unserem Führer. Sie begehen damit den<br />
schlimmsten Verrat an ihren im Kampf gefallenen<br />
Kameraden. An all den Opfern, die in diesem Kriege<br />
ihr Leben für ihren geliebten Führer und für das Vaterland<br />
tapfer gegeben haben. Die Kampfmoral<br />
meiner Truppe muss bis zum Endsieg voll erhalten<br />
bleiben“. Mit seinem Verhalten uns gegenüber, zeigt<br />
der Major seine angeschlagene Macht: Wir vier, und<br />
die noch später festgenommenen Männer sind seiner<br />
Willkür ausgeliefert. Der Major will uns vernichten.<br />
Wir halten die Schnauze. Einen Aufschrei gegen<br />
die Festnahme? Nein! Der Offizier könnte jetzt<br />
seine Pistole ziehen. Er könnte uns mit gezielten<br />
Schüssen niederstrecken. Einfach so. Einfach töten.<br />
Den Rest müssten dann seine Leute machen. Ich
309<br />
komme noch einmal auf die vier Polinnen zurück*:<br />
Haben vielleicht die Vorposten-Soldaten die Frauen<br />
aufgefordert an der Stelle, wo wir auf sie treffen,<br />
stehen zu bleiben um ihrerseits unser Gespräch<br />
besser belauschen zu können? Abwarten! Innerlich<br />
tief abtauchen. Wohin? - - - Zeigt seine Truppe vielleicht<br />
auch schon Auflösungserscheinungen.*Uns<br />
vernichten, bringt bestimmt eine Straffung seiner<br />
Truppe und mehr Ordnung in seinen Laden. Seine<br />
Einheit, hat den im Zick - Zack verlaufenden Schützengraben,<br />
der etwa 250 m vor dem Punkt, an dem<br />
uns der Major festhält gegen die Amerikaner besetzt.<br />
Wir sind dort auf unserem Marsch vorbeigekommen.<br />
Bis auf die Hundemarke haben sie uns<br />
vier unsere persönlichen Sachen und die Papiere<br />
abgenommen. Die beiden Vorposten-Soldaten sind<br />
nicht mehr anwesend. Vermutlich haben sie inzwischen<br />
wieder ihre Position eingenommen. Unter<br />
den Augen der für uns neuen Wachposten, die uns<br />
mit aufgepflanztem Seitengewehr bewachen, sollen<br />
wir nun etwa zwei Meter lange und etwa 60 cm breite<br />
Gruben ausheben. Urplötzlich stehen vor meinen<br />
Augen die Bilder der unregelmäßig angeordneten<br />
Hügel, die ich in einem der Kiefernwälder gesehen<br />
habe. Dort hat man Insassen aus Konzentrationslagern,<br />
auf ihrem Wege ins Ungewisse, umgelegt. Die<br />
dort ermordeten Menschen haben vor ihrem eigenen<br />
Tod die gleiche Angst empfunden, wie es die<br />
Angst ist, die sich in unseren Herzen entwickelt. Die<br />
Angst lähmt uns. Wie lange wird es dauern, bis uns<br />
die Angst getötet hat. Werden wir hier unser Ende<br />
finden? Wir merken und sehen es, wir sind nicht<br />
allein aufgegriffen worden. Vielleicht wird mit jeder<br />
weiteren Festnahme unsere Überlebenschance
310<br />
größer. Ich denke darüber nach, was es mit der<br />
Anwesenheit der vier Polenfrauen auf sich haben<br />
kann. Hat uns vielleicht ihre Gegenwart vor dem<br />
Erschießen bei der Festnahme bewahrt?<br />
Ich verstehe nicht, warum die Polinnen sofort nach<br />
unserer Festnahme verschwunden sind.<br />
Ich vermute: der Major hat an diesem Tage innerlich<br />
eine so starke krankhafte Furcht gehabt, dass er vor<br />
seinen Vorgesetzten, wegen der ihm übertragenen<br />
Aufgabe, nicht mehr bestehen könnte. Das alles<br />
wurde ihm zu viel. Was wird aus ihm werden? Kann<br />
er noch einmal zurück in seine militärische Vergangenheit?<br />
Nicht nur seine Angst, nun wird auch ihn<br />
der Krieg fressen.<br />
Mit uns vier Mann sind weitere zehn bis zwölf Soldaten<br />
in Uniform und einige, die ihre Kleidung gewechselt<br />
haben, in dem Waldstück gelandet. Mit<br />
dem Feldspaten gehen wir, immer im Wechsel, an<br />
die Arbeit. Wir müssen Zeit schinden. Die unter dem<br />
Gras flach liegenden Kiefernwurzeln lassen sich<br />
nicht mit Feldspaten durchtrennen. Unsere Erdarbeit<br />
wird verzögert. Wir müssen versuchen, die Arbeiten<br />
noch weiter zu verzögern. Die Posten bleiben<br />
ruhig. Sie halten sich, etwa 10 Schritt von uns entfernt,<br />
schweigend auf. Welche Gedanken sie bei<br />
dieser Sonderaktion haben, kann ich nicht wahrnehmen.<br />
Ihnen scheint auch dieses hier scheißegal<br />
zu sein. Sie sind abgestumpft. Auf der Straße hält<br />
gerade ein rumpelnder LKW mit Anhänger. Ohne<br />
Zeichen einer Reaktion gesellt sich der Fahrer zu<br />
uns und ist jetzt ein Mitgefangener. Von der Festnahme<br />
verdattert, empört, meldet er sich sogleich<br />
lauthals. ‚Ich habe leere Benzinfässer geladen und
311<br />
bin auf dem Wege nach Jerichow, einem Ort an der<br />
Elbe. Dort soll ich von einem Tankschiff Treibstoff<br />
für eine Panzerabteilung abholen’. Kein Posten hindert<br />
den aufgeregten Mann zu sprechen, seinen<br />
Widerstand gegen die Willkür zu artikulieren. Uns<br />
bleibt weiter das Sprechen verboten. Mich unterdrückt<br />
die Anspannung. Mich beherrscht der Gedanke,<br />
hier im Waldstück einfach umgelegt zu werden.<br />
Alles um mich herum gräbt sich in eine unsichtbare<br />
Wolke ein. Meine Ohren nehmen Wortfetzen<br />
und Geräusche auf, die von den eigenen Nerven<br />
produziert werden. Vor den Augen vorüberziehende<br />
Bilder erkenne ich farblos. Was in mir abgestorben<br />
ist, windet sich schmerzlos aus meinem<br />
Körper. Ich bin nicht aufnahmefähig. Ich stiere Löcher<br />
in die Luft, ich träume. Und da:<br />
Ein ankommendes Motorrad höre ich nicht. Ich sehe<br />
einen Soldaten, der von seinem Motorrad abspringt.<br />
Er trägt einen übergroßen Kradmantel. Eine große<br />
Pistole steckt in einer offenen Pistolentasche. Ein<br />
Stahlhelm sitzt auf seinem Kopf. Der Soldat steht im<br />
nächsten Augenblick auf der Straße vor einem Offizier.<br />
Ich höre keine Meldung, ich nehme sonst<br />
nichts wahr.<br />
Mit einem Klick kehre ich zurück und erkenne den<br />
Kradfahrer, der auf der Straße von seinem Motorrad<br />
mit geschlossenem Mantel abgestiegen ist. Er meldet<br />
sich und überreicht dem Major einen geschlossenen<br />
Umschlag. Es ist der Einarmige, der die Meldung<br />
entgegen nimmt. Der Umschlag geht an den<br />
Kradfahrer zurück, der ihn öffnet. Ich nehme weiter<br />
nichts von dem, was um mich herum geschieht zur<br />
Kenntnis. Es ist sicher ein Melder, der hier auf der
312<br />
Bildfläche erscheint. Wo kommt der her? Wird er<br />
Befehle für den Major haben? Geht es um uns?<br />
Sein Eintreffen bringt einen unmittelbaren Wandel<br />
des bisherigen Geschehens. Nun wird der Fahrer<br />
des LKWs zu seinem Fahrzeug gerufen. Innerhalb<br />
eines Augenblickes sehen die Aufgegriffenen, wenn<br />
auch zögerlich, wieder auf. Ich sehe jetzt mit ruckartigen<br />
Bildsprüngen, dass der Anhänger abgekoppelt<br />
wird. Das Fahrzeug steht plötzlich in Fahrtrichtung<br />
Genthin. Leere Benzinfässer poltern auf das Straßenpflaster.<br />
Soldaten rollen sie an den Straßenrand.<br />
Vorsichtig setzen wir vier uns nun auch in<br />
Bewegung. Dann springen wir, als sei nichts passiert<br />
wie gejagte Hasen aus dem Wald heraus. Wir<br />
tun so, als sei schon alles vorbei. Nur fort von hier!<br />
Gegenseitig helfen wir uns auf die Ladefläche. Da, -<br />
- die Wachposten, mit aufgepflanztem Seitengewehr<br />
sind wieder gegenwärtig und steigen zu uns<br />
Festgesetzten auf das Fahrzeug. Sprechverbot<br />
während der Fahrt. Wohin bringen sie uns? Schaukelnd<br />
geht unsere Fahrt auf dem LKW vorwärts. Die<br />
glänzenden Seitengewehre bewachen uns weiter.<br />
Alle Aktionen laufen völlig mechanisch ab. Einen<br />
Funken Hoffnung trägt jeder, wenn auch versteckt,<br />
auf dem LKW in sich. Unsere Fahrt endet vor dem<br />
Rathaus in Genthin. Am letzten Sonntagvormittag,<br />
das war doch erst gestern, waren wir in dem Café,<br />
das dem Rathaus schräg gegenüberliegt. Von dem<br />
Café nehme ich keine Notiz. Nur an die Volkssturmmänner<br />
und Hitlerjungen, die an der Ecke<br />
standen, erinnere ich mich. Das alles scheint aber<br />
schon so lange her zu sein. Wir verlassen das<br />
Fahrzeug und werden in das aus roten Ziegelsteinen<br />
erbaute Gebäude geführt. Über die breite Trep-
313<br />
pe geht es zum Hochparterre und anschließend auf<br />
der Treppe zur ersten Etage. Wir warten. Die Posten<br />
erinnern alle Wartenden daran, dass wir<br />
Sprechverbot haben.<br />
Obwohl ich von unseren Bewachern nicht berührt<br />
werde, spüre ich physisch die aufgepflanzten Seitengewehre.<br />
Wann hat dieser Unsinn hier ein Ende?<br />
Wenigstens sind wir vier Mann nicht voneinander<br />
getrennt worden. Einer der Mitgefangenen, er<br />
ist in Zivil und steht fast auf Tuchfühlung zwischen<br />
uns, bringt uns durch sein lautes Sprechen in eine<br />
unangenehme Lage. Das Schweigen wird von der<br />
lauten Stimme dieses verstörten Kameraden in Zivil<br />
unterbrochen. Die Posten bleiben ruhig. Er erzählt<br />
uns lauthals seine ganze Militärgeschichte. Vielleicht<br />
war er auf der Flucht. Bei seiner Festnahme,<br />
die ihn sicher überrascht hat, wird er wohl auf die<br />
ihm gestellten Fragen falsch geantwortet haben.<br />
Nun bietet er meinem Kameraden und mir seine<br />
Taschenuhr an. Er möchte, dass seine Uhr als eine<br />
Erinnerung an ihn und an diese Stunde sein soll. Er<br />
erklärt uns beiden, dass er nicht daran glaube, hier<br />
heil heraus zu kommen. Die Posten bleiben ruhig.<br />
Sie scheinen schon Erfahrungen mit Kameraden,<br />
die im Kriege aus den verschiedensten Gründen<br />
geistig verwirrt waren. Auch der Mann, der zwischen<br />
uns steht ist in diesen Momenten nicht mehr<br />
ansprechbar. Er sagt uns sinngemäß, dass er die<br />
Tatsache, Zivilist zu sein, nicht beweisen kann.<br />
Deshalb will er seine Taschenuhr, die ihn durch den<br />
gesamten Krieg, bis an diesen Ort begleitet habe,<br />
verschenken. Niemand von uns will die Taschenuhr<br />
weder anfassen noch haben. Ich halte fest: Wir vier<br />
haben dem verzweifelten Mann in seiner seelischen
314<br />
Not, nur mit geschlossenen Ohren zugehört. Keiner<br />
von uns hat ihm geantwortet. Wir haben uns längst<br />
abgewandt. Aus eigener Angst ums eigene Leben,<br />
die sich bei uns binnen Sekunden aufgebaut hat,<br />
sind wir zu nichts mehr fähig. Mein Hals ist zugeschnürt.<br />
Mein Mund ist verschlossen. Ich kann diesem<br />
Menschen keinen Beistand leisten. Seinen Hilfeschrei<br />
habe ich gehört. Doch ich habe nichts getan<br />
um ihm zu helfen. Mein und damit unser<br />
Schicksal liegt hier auf der Treppe noch völlig im<br />
Dunkeln. Geleitet durch den eigenen Instinkt, selbst<br />
überleben zu wollen, habe ich nicht anders reagiert.<br />
Wir wissen doch selbst nicht, ob wir hier herauskommen<br />
werden. Der weitere Aufstieg auf der<br />
Treppe vollzieht sich sehr zögerlich.<br />
Einige der aufgegriffenen Männer sind durch die<br />
hohe Doppeltür gegangen. Wir haben keinen von<br />
ihnen wieder gesehen. Ich drehe mich zur Seite.<br />
Mein Blick geht frei in den Innenhof des Rathauses.<br />
Ich sehe viele amerikanische Soldaten, die in unserer<br />
Gefangenschaft sind. Teilweise tragen sie noch<br />
ihre Stahlhelme. Zum ersten Mal sehe ich amerikanische<br />
Soldaten in ihren Khakiuniformen. Jetzt<br />
kommen wir Vier an die Reihe. Wir betreten einen<br />
hohen Raum. Unser Feldwebel macht Meldung und<br />
überreicht dem Stadtkommandanten oder seinem<br />
Beauftragten, einem älteren Offizier, unsere<br />
Marschpapiere. Bei der Festnahme haben die Soldaten<br />
uns nichts abgenommen. Der Major, der uns<br />
festgesetzt hat, hat nicht nach unseren Papieren<br />
gefragt. Der wollte bestimmt keine Papiere von uns<br />
sehen, denn dann hätte er uns nicht in den Wald<br />
schicken dürfen. Auf einem ausladenden Kartentisch<br />
liegen Generalstabskarten und -Stabspapiere.
315<br />
Unsere Marschpapiere werden geprüft. Scheinbar<br />
endlose Augenblicke vergehen. Weiter wartend,<br />
fühle ich eine Entkrampfung. Spuren von innerer<br />
Körperwärme kommen zurück .Meine Hoffnung - -<br />
die ersehnte Wendung unserer Lage in die Freiheit<br />
bringt uns langsam zurück ins Leben. Der Schmerz<br />
der Willkür, die Aussichtslosigkeit in der Realität, die<br />
gewaltige Nervenanspannung fällt wie abgeschlagen<br />
von uns ab. Und dieses geschieht genau in<br />
dem Augenblick, wo der Offizier eine Sekretärin<br />
beauftragt, unsere Marschpapiere zu ergänzen und<br />
sie anschließend dem Feldwebel auszuhändigen.<br />
Abgestempelte Marschpapiere mit Datumsangabe<br />
werden ausgehändigt. Gemeinsam, wie auf ein<br />
Kommando, reißen wir die Hacken zusammen, machen<br />
eine Kehrtwendung und treten ab. Ohne einen<br />
Blick zurück sind wir auf der Straße. Die militärische<br />
Willkür, die Brutalität haben wir in übelster Form zu<br />
spüren bekommen. Ein reiner Zufall, oder das Unberechenbare,<br />
das in der Macht der Mächtigen liegt,<br />
lässt Menschen zu Mördern und zu Opfern werden.<br />
Während der Bearbeitung dieses Vorganges kommen<br />
mir meine Gedanken. Was sind die Gründe,<br />
dass uns der Major vernichten wollte?<br />
Ich stelle mir vor: Der Major ist an dieser Stelle hinter<br />
dem Schützengraben seiner Einheit unsicher<br />
geworden. Vor seiner Einheit war bis zum Elbstrom<br />
Niemandsland. Und da laufen deutsche Soldaten<br />
zwischen den Amerikanern und seiner Stellung von<br />
Süden nach Norden vorbei. Das kann doch nicht in<br />
Ordnung sein. Seine Vorposten haben den Auftrag,<br />
deutsche Soldaten, die zwischen den Fronten ’spazieren<br />
gehen’, die bewaffnet oder unbewaffnet sind,
316<br />
die sich auf irgendeine Weise vom Kriegsdienst absetzen,<br />
das heißt, die desertieren, festzunehmen.<br />
Die Aufgegriffenen sind bei ihm abzuliefern. Dieses<br />
scheint mir bis hier eine plausible Erklärung des<br />
Vorganges zu sein. Meine Vermutung ist: Der Major,<br />
dem wir zugeführt werden ist gar kein echter<br />
Frontoffizier. Auf diesem Posten hat er die Grenze<br />
seiner Fähigkeiten überschritten. Militärisch aus<br />
Mangel an Qualifikation, unfähig, den ihm übertragenen<br />
Auftrag zu erfüllen.<br />
Als echter Frontoffizier hätte er die vor seiner Stellung,<br />
vor seinem Schützengraben, aufgegriffenen<br />
Wehrmachtsangehörigen sicher nicht erschießen<br />
lassen. Er hätte sie festgesetzt und sie an seine<br />
Vorgesetzte Abteilung zur Überprüfung der Person,<br />
der Papiere weiter geleitet. Seine angeblichen Befehle<br />
an die Vorposten, die aufgegriffenen Soldaten,<br />
die sich unerlaubt im Niemandsland befinden gleich<br />
an Ort und Stelle zu erschießen, haben die Männer<br />
nicht ausgeführt. Ich denke: Diesen Befehl hat der<br />
Major nie eindeutig gegeben. Vielleicht haben die<br />
Soldaten ihren Major nicht akzeptiert, weil er die<br />
Einheit erst übernommen hat. War es vielleicht nur<br />
eine Kampfgruppe zur Sicherung Genthins? Gedanken<br />
ohne Ende durchziehen mein Hirn. Mit gültigen<br />
Marschpapieren, geht unser Marsch nach<br />
Schollene sofort aber ohne Marschverpflegung weiter.<br />
Die Augen des um Hilfe flehenden Soldaten in<br />
Zivil habe ich noch lange vor meinen Augen. Ich<br />
kann sie nicht vergessen. wird es so friedlich wie in<br />
diesem Moment weitergehen, eine Stunde oder<br />
zwei Tage? Jeder Augenblick birgt neue lebensbedrohende<br />
Von den wartenden Soldaten und Zivili-
317<br />
sten haben wir uns nun aber abgesetzt und somit<br />
diese Begegnung schnell verdrängt. Auch wenn es<br />
nicht glaubhaft sein mag, über unser Erlebnis,<br />
westlich von Genthin haben wir nicht mehr gesprochen.<br />
Zufrieden, diesem Nervenkrieg entkommen<br />
zu sein, ziehen wir weiter. Aber wir sind nicht wirklich<br />
frei. Wir müssen noch den Krieg überstehen.<br />
Wie lange Gefahren. Die amerikanischen Soldaten,<br />
die ich im Innenhof des Rathauses gesehen habe,<br />
waren bei ihrem Stoßangriff am Sonntag bei Genthin<br />
in die Gefangenschaft geraten. In meinen Gedanken<br />
gehe ich noch einmal zurück zu den zwei<br />
Soldaten, die uns aufgegriffen und festgenommen<br />
haben. Ihnen sollen wir dankbar sein, dass sie uns<br />
nicht bei der Festnahme umgelegt haben. Jetzt, da<br />
wir weiter marschieren, stelle ich fest, wir haben<br />
verdammt viel Glück gehabt. Unterwegs nimmt uns<br />
Vier ein LKW mit. Bis in die Nähe von Schollene<br />
können wir auf der Ladefläche mitfahren. Den Rest<br />
des Weges bis Havelberg marschieren wir wieder.<br />
Am Spätnachmittag überschreiten wir die Havelbrücke<br />
in Havelberg. Auf einem Platz neben der<br />
Kirche warten wir auf die Rückkehr unseres Feldwebels.<br />
Er meldet sich bei der Stadtkommandantur<br />
und lässt dort unsere Marschpapiere abstempeln.<br />
Wir erwarten ihn mit der Marschverpflegung zurück.<br />
Der Schock von Genthin steckt uns noch gewaltig in<br />
den Knochen. Wir warten geduldig. Wir müssen<br />
wohl noch zwei Tage bis Parchim marschieren. Ob<br />
es dort eine Ruhepause geben wird? Kaum zu vermuten.<br />
Es war eine verdammte Schinderei, das<br />
Laufen vom Spätnachmittag des 19. April bis heute,<br />
dem 1. Mai 1945. Uns hat das restlos gelangt. Heute<br />
lässt uns der Feldwebel aber länger als gewohnt
318<br />
warten. - - Na, endlich, da erscheint er auf der Bildfläche.<br />
Ohne Umschweife berichtet er: „Kameraden,<br />
hier ist unsere Reise zu Ende Der Stadtkommandant<br />
hat mir gesagt: Ich kann Sie mit ihren Leuten<br />
zwar nicht festhalten, weil Sie zur Truppe von Hermann<br />
Göring gehören. Aber, sie werden Parchim<br />
mit Sicherheit nicht mehr erreichen. Wir nehmen an,<br />
oder haben bereits Meldungen, dass die sowjetischen<br />
Panzer in der kommenden Nacht oder am<br />
frühen Morgen des 2. Mai 1945, irgendwo nördlich<br />
von Wittenberge bis zur Elbe vorstoßen werden. Für<br />
Sie und ihre Männer wird es das Beste sein, wenn<br />
Sie sich unserer, heute aufzustellende Kampfgruppe<br />
anschließen“. Zu unserem Ziel Parchim kommen<br />
wir nicht mehr. „Und uns sagt doch keiner was,<br />
warum wir wie die Idioten hierher gerannt sind“, hält<br />
der Dicke fest. So sprechen wir Vier über unsere<br />
neue Lage. Wir erhalten Waffen und Munition und<br />
werden uns südlich, etwa zwei bis drei Kilometer<br />
von Havelberg entfernt, in dem jungen Gemischtwald<br />
niederlassen. Nachdem uns die Sowjets am<br />
19. April 1945 unseren Transportzug mit ihren T34<br />
Panzern vernichtet haben, da war unsere Reise<br />
nach Senftenberg ins Wasser gefallen. Da gab es<br />
unser wichtiges Ziel, Senftenberg nicht mehr. Morgen,<br />
am 2. Mai 1945, da werden uns die Sowjets<br />
nicht mehr nach Parchim lassen, da sind uns dann<br />
wieder diese verdammten T34 im Wege. Wir stellen<br />
gemeinsam fest: Wir werden kein Ziel mehr erreichen.<br />
Am Abend des 1.Mai 1945 haben wir es noch<br />
nicht erkennen können, aber wir sind an unserem<br />
Ziel angekommen. Die Sowjets treiben uns unaufhaltbar<br />
weiter in die Enge. Mit Feldspaten und Dreieckzeltplane<br />
ausgestattet, erleben wir die Aufstel-
319<br />
lung der Kampfgruppe. Bei der Verteilung der Waffen<br />
entsteht bei den aus verschiedenen Gruppen<br />
stammenden Soldaten ein Durcheinander. Wir sind<br />
uns vollkommen fremd. Bis zum ‚Endsieg’ können<br />
wir auch nicht mehr Kameraden werden. Trotz innerer<br />
Meckerei werden wir die Waffen, alles Beutematerial,<br />
nicht mehr los. Wir müssen sie annehmen<br />
und durch die Gegend schleppen. Damit nicht genug.<br />
Um Gruppenbildungen zu vermeiden, werden<br />
wir Vier auch noch voneinander getrennt. Diese<br />
Tatsache ist für mich sehr bitter, denn nun bin ich<br />
allein. Mit fremden Soldaten sprechen, die um<br />
Grunde nur noch abhauen wollen, das werde ich<br />
nicht. Der Feldwebel bekommt ein Kommando. Der<br />
Obergefreite verschwindet irgendwo zwischen den<br />
älteren Soldaten. Selbst wir beiden jungen <strong>Panzergrenadier</strong>e<br />
werden getrennt. Was die mit uns machen,<br />
das ist alles Schikane in Reinkultur. „Gruppenbildungen<br />
innerhalb der Kampfgruppe, die den<br />
militärisch operativen Forderungen entgegenstehen,<br />
werden nicht geduldet“. Richtig durchmischen und<br />
dann wieder neu aufbauen. So wird es gemacht.<br />
Auf der unbefestigten Straße, die als „Königsallee“<br />
in Havelberg bekannt ist, ziehen wir nach Süden.<br />
Unter amerikanischer Aufsicht, die liegen auf der<br />
Westseite der Elbe, schlagen wir im Wald unser<br />
Nachtlager auf der Ostseite der Elbe auf. Das anschwellende<br />
harte Dröhnen von Panzermotoren, die<br />
Kettengeräusche, nehmen unsere ganze Aufmerksamkeit<br />
in Anspruch. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit<br />
rasseln mehrere Panzerkampfwagen vom Typ<br />
VI Ausf. Tiger an uns vorbei. Die Rohre* haben sie<br />
auf sechs gedreht. Die massiven Stahlkisten wirbeln<br />
und ziehen eine gewaltige Staubwolke hinter sich
320<br />
her. Sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen<br />
sind. Ihr Ziel ist sicher Havelberg. Wohin?<br />
Werden sie ihre Fahrzeuge irgendwo am Rand *Bei<br />
normaler Fahrt eines Panzers wird die Kanone mit<br />
Turm nach hinten gedreht und auf einem Stahlgerüst<br />
abgestützt und festgeschraubt. Das Geschütz<br />
in diesem Panzer, eine AchtAcht, hat ein hohes Eigengewicht.<br />
Der auf sechs gedrehte Turm wird so<br />
auf dem Marsch geschont. Hier, auf der Ostseite<br />
der Elbe, sollen die Amerikaner nicht provoziert<br />
werden. Dieser Typ Panzer hat 5 Mann Besatzung,<br />
und 56 t Kampfgewicht. stehen lassen müssen?<br />
Werden sie noch kämpfen? Wie werden wir die<br />
Nacht verbringen. Die Wärme der Sonne nimmt<br />
langsam ab. Ich sitze jetzt auf dem Waldboden und<br />
verzehre meine kärgliche Verpflegung. Die Nacht<br />
kommt, und um mich herum macht alles einen unerwartet<br />
friedlichen Eindruck. Am 2. Mai 1945, gegen<br />
vier Uhr in der Frühe, wird „Stellungswechsel“<br />
befohlen. Die Sonne bemüht sich mit Erfolg. Sie<br />
weckt uns mit ihren wärmenden Strahlen. In Schützenreihe<br />
marschieren wir nach Havelberg zurück.<br />
Über eine Einfahrt kommen wir auf einen gepflasterten<br />
Hof. Zur Straße steht ein Wohngebäude, der<br />
Hof ist von Stallungen eingefasst. Bis zum nächsten<br />
Stellungswechsel bleibt die Kampfgruppe hier. Unsere<br />
Beutewaffen lagern jetzt in einer Ecke des Hofes.<br />
Wir vergessen sie. Mit einem anderen Soldaten<br />
bin ich zur Wache an unserer Einfahrt eingeteilt.<br />
Militär-Fahrzeuge verschiedener Größen fahren in<br />
Richtung Westen. Die Feldgendarmerie regelt den<br />
Straßenverkehr. Gegenwärtig ziehen 15 cm Langrohre,<br />
ohne Lafetten, an uns vorbei. Es herrscht<br />
durch den anwachsenden Verkehr eine betriebsbe-
321<br />
dingte Unruhe auf der Straße. Sind das vielleicht<br />
schon Zeichen der Auflösung? Bei dem Gedränge<br />
hält nun auch noch vor unserer Hofeinfahrt ein kleiner<br />
LKW.<br />
Der versperrt uns die freie Sicht auf den Verkehr’<br />
denke ich. Auf einmal steht der Fahrer des kleinen<br />
LKWs vor mir. Er sucht eine Einheit. Ich kenne die<br />
nicht, denn unsere Kampfgruppe ist erst vor einer<br />
halben Stunde hier eingezogen. ‚Ich habe die Ladung<br />
mit den Stiefeln dabei’, erklärt der Fahrer, sich<br />
dabei hilfesuchend umschauend. ‚Das ist hier, erwidere<br />
ich, ohne zu wissen, was wirklich los ist. Du<br />
bist bei uns richtig! Füge ich meiner Behauptung<br />
hinzu. Neue Stiefel, die kommen mir gerade zur<br />
passenden Zeit. Mensch, da kann ich doch endlich<br />
meine ausgelatschten Stiefel umtauschen’. Der<br />
Fahrer setzt seinen LKW mit Schwung rückwärts<br />
auf den Hof. Nagelneue, unbehandelte Stiefelpaare<br />
wirft der Fahrer auf den Hof, reißt die Plane herunter,<br />
schließt das Fahrzeug und schon hat das Fahrzeug<br />
den Hof verlassen. Bei dem Drunter und Drüber<br />
und der Unruhe ist es vollkommen egal, wo<br />
letztlich die Sendung mit den Stiefeln gelandet ist.<br />
Meine Wache geht zu Ende und ich suche mir als<br />
erstes neue Schnürstiefel. Die haben sogar Schnürsenkel<br />
mitgeliefert. Meine alten Stiefel fliegen an<br />
den Rand. Ich gehe auf die Straße und schaue mich<br />
um. Neben dem Eingang zum Hof hält gerade ein<br />
Funkwagen auf der linken Seite der Straße. Was<br />
bringt der wohl? Von den Soldaten steigt niemand<br />
aus. Soeben höre ich, der Funker hat eine Meldung<br />
von seiner Einheit empfangen. Einer der Soldaten,<br />
der am offenen Fenster des Fahrzeuges sitzt, wie-
322<br />
derholt jetzt lauthals den Funkspruch: ‚Kameraden,<br />
Hitler ist in Berlin gefallen.<br />
- - - - Parole Heimat. - - Kameraden, es geht nach<br />
Hause’. Andere, zufällig an der Straße wartende<br />
Soldaten, hören wie ich diese Meldung. Sie zeigen<br />
keinerlei Reaktion, man hat die Schnauze gestrichen<br />
voll. Und eine so beiläufig gemeldete wichtige<br />
Nachricht, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.<br />
Wer weiß, was dahinter steckt? Es ist gut,<br />
wenn man überleben will, seine Schnauze zu halten.<br />
Die Soldaten trotten, mit der Neuigkeit in ihren<br />
Köpfen, weiter. - - Nur keine Reaktion zeigen. Abgetaucht<br />
bleiben. In diesem Moment ist mir: Diese<br />
Meldung hat niemand gehört, also gibt es sie nicht.<br />
Und noch immer geht alles beim Militär seinen geregelten<br />
Gang. Jedenfalls hat es den Anschein. Das<br />
ist Tarnung! Wirklich alles? Es wird weiter verdrängt<br />
und den Befehlen pariert. Ich sehe auf meine neuen<br />
Stiefel herunter und stelle fest: Über die Stiefellieferung<br />
habe ich mich wohl nur allein gefreut. Meine<br />
alten Stiefel haben kaum einen Monat Dienst im<br />
Gelände überstanden. Einige der Soldaten, die nun<br />
zu der gestern gebildeten Kampfgruppe gehören,<br />
sitzen mit ihren Rücken an das Gebäude gelehnt<br />
auf dem Boden des Hofes. Wo kommen denn die<br />
her? Sie haben sich bewusst, mit ihrem Offiziersstoff<br />
am Leibe, von uns Soldaten abgesondert. Das<br />
sollen, so erfahre ich, überzählige Zahlmeister sein.<br />
Das ist mir egal. Sie sind jetzt in den normalen Militärdienst<br />
eingegliedert. Vom Alter her sind sie nicht<br />
für den Fronteinsatz ausgebildet. Die Militärführung<br />
hat sie von ihren vollen Töpfen fortgejagt. Sie wollen<br />
jetzt unsere Töpfe mit Leerfressen. Doch unsere<br />
Töpfe sind schon lange leer. Mit einem anderen
323<br />
jungen Soldaten, den ich gestern hier getroffen habe,<br />
bin ich auf der Suche nach Naturalien. Denn<br />
ohne eine Erklärung der Kampfgruppen-Leitung<br />
müssen wir auf das Frühstück verzichten.<br />
Hier gibt es nichts<br />
aber davon haben wir jede Menge<br />
Im Angebot sind: kein frisches Brot, keine Butter,<br />
kein Schinken und kein heißer Kaffee. Wurst und<br />
Käse gibt es auch nicht, ja, es gibt auch keine<br />
Mehrfrucht oder Vielfrucht-Marmelade. Bei uns fällt<br />
sogar das zum Trinken erforderliche Wasser in den<br />
Sand. Kein Wort über unsere Lage. Unser Verein<br />
sollte ein Schild über unserem Eingang befestigen:<br />
Das wäre dann keine Propaganda. Es ist die reine<br />
Wahrheit. ‚Seht doch zu, wie ihr durchkommt!’.<br />
Das ist der unausgesprochene Tagesbefehl.<br />
Den militärischen Tagesbefehl kennen wir<br />
noch nicht. Diesen werden unsere Vorgesetzten der<br />
Kampfgruppe nachreichen. Inzwischen durchstöbern<br />
wir Zwei die Umgebung. Wir rennen ziellos<br />
umher und landen auf einem Fabrikgelände. Hier<br />
treffen wir auf eine Menschentraube, die dichtgedrängt<br />
an der Rampe steht. Uns zwei nimmt keiner<br />
der wartenden Menschen zur Kenntnis. Über einen<br />
abseits liegenden zweiten Eingang betreten wir einen<br />
Lagerraum. Aus einem Stapel von Kartons<br />
nimmt jeder von uns nur zwei Dosen heraus. Damit<br />
verschwinden wir und finden uns auf unserem Hof<br />
wieder. Ich schaffe es, trotz aller Schwierigkeiten,<br />
eine der Dosen zu öffnen. Der kräftige Geruch von<br />
gekochtem Fleisch, der aus der handwarmen Büch-
324<br />
se kommt, zwingt mich, ganz schnell einen großen<br />
Bissen von dem Fleisch zwischen die Zähne zu bekommen.<br />
Den nahrhaften Fleischsaft verschmähe<br />
ich aus Unwissenheit. Vom Hunger gepeinigt, mit<br />
zittrigen Händen, versuche ich das Fleisch aus der<br />
Büchse zu zerren. Mit der linken Hand die Büchse<br />
am unteren Ende umfassen und mit der Gabel in<br />
der rechten Hand das Fleisch stückweise herausziehen,<br />
das ist alles eine Sache von Augenblicken.<br />
Der Fleischsaft quillt, von der Handwärme verdünnt,<br />
über den Dosenrand. Er verteilt sich in der linken<br />
Hand und landet am Ende zwischen meinen Füßen<br />
auf dem Erdboden. Unkontrolliert, wacklig vor lauter<br />
Magenknurren, würge ich dieses trockene Fleisch<br />
Bissen für Bissen in mich hinein. Mein Kumpel<br />
macht die gleichen Anstrengungen. Da sitzen wir<br />
beiden, schlagen uns voll und haben keinen Blick in<br />
die Richtung der anderen Kameraden haben. Nach<br />
spätestens dem dritten Biss fangen meine Kaumuskeln<br />
an zu schmerzen. Beim RAD hat man uns<br />
„Schlingen der Nahrung“ erfolgreich beigebracht.<br />
Das habe ich nicht verlernt. Der Schluckauf verlangt<br />
jetzt nach Wasser. Der muss warten. Etwas Trinkbares<br />
suche ich in Gedanken. Der Durst verstärkt<br />
sich. Am Gebäude Hofseite ist kein Wasserhahn.<br />
Gebäude betreten grundsätzlich verboten. Irgendwann<br />
werde ich den Schluckauf verlieren. Das<br />
Würgen der Nahrung macht mir Schmerzen in der<br />
Brust. Der Rest und die andere ungeöffnete Büchse<br />
bleiben liegen. Ich muss laufen, ich muss fort von<br />
hier. Um dann gleich wieder zurück zu kommen.<br />
Mein Kumpel und ich sind innerlich unruhig und so<br />
entscheiden wir, Havelberg zu besichtigen. Wir<br />
Zwei sind wieder unterwegs. Vom Fleisch aus den
325<br />
Büchse gestärkt laufen wir mit vollem Schwung<br />
über die Havelbrücke in die Stadt. An beiden Seiten<br />
sind Kisten mit Sprengstoff auf den Fußwegen gestapelt.<br />
Wie erkennbar, bereiten Pioniere die<br />
Straßenbrücke für eine Sprengung vor. Ähnlich<br />
streunender Hunde jagen wir ziellos weiter durch<br />
die Stadt. Wir funktionieren, von Rastlosigkeit getrieben,<br />
völlig mechanisch. Ich empfinde, dass der<br />
Raum und damit unsere Bewegungsfreiheit in der<br />
Stadt immer kleiner wird. In der Falle sind wir bereits,<br />
nur erkennen wir sie noch nicht. Über eine<br />
zweite Brücke erreichen wir eine Steintreppe. Diese<br />
hasten wir, zwei Stufen auf einmal nehmend, empor.<br />
Oben hängen wir uns sogleich über die Brüstung<br />
und sehen auf den Ort und die Kirche. An der<br />
Kirche haben wir nach unserer Ankunft auf unseren<br />
Feldwebel gewartet. Unsere leeren Augen haben<br />
die Fachwerk- und Ziegelbauten mit den roten Ziegeldächern<br />
gar nicht bewusst zur Kenntnis genommen.<br />
Hier oben suchen wir nichts. Nur unsere nicht<br />
zu erklärende Unruhe hat uns hierher getrieben.<br />
Der auf dieser Anhöhe stehende wuchtige Kirchenbau<br />
aus Feld- und Ziegelsteinen nimmt mich nur für<br />
einen Augenblick gefangen. Der Bau ist größer, als<br />
der, der Kirche in der Stadt. Ist das vielleicht ein<br />
DOM? Die Ruhelosigkeit treibt uns weiter. Wir haben<br />
keine Zeit. Wir springen die Steinstufen wieder<br />
hinunter, rennen zu unseren Kameraden zurück.<br />
Auf dem Rückweg spüre ich etwas. Eine innere<br />
Stimme sagt mir: „Es gibt keinen Ausweg mehr für<br />
dich aus dieser Lage. Du nicht allein, alle sind jetzt<br />
in der Falle“. Vielleicht werden auch die anderen die<br />
Falle, in der wir stecken, in den nächsten Stunde<br />
erkennen. Wir stehen vor dem letzten Hindernis, wir
326<br />
sind eingekeilt von Havel und Elbe. Über die Havel<br />
können wir noch. Aber wo werden wir auf die angekündigten<br />
sowjetischen Panzer treffen? Die sind<br />
sicher an ihrem Ziel bei Wittenberge angekommen.<br />
Unser Weg kann nur noch die Flucht über die Elbe<br />
sein. Wie kommen wir darüber? Gibt es vielleicht<br />
eine Brücke? Ich war noch nicht an der Elbe. Gestern,<br />
am 1.Mai 1945, daran erinnere ich mich. Da<br />
hat man uns Vier, als wir angekommen sind<br />
zwangsweise in die Kampfgruppe gesteckt. Ich<br />
denke: nur nach außen soll es eine geschlossene<br />
Einheit sein. Es ist aber nur ein Haufen ohne ordentliche<br />
Gliederung. Wie man heute Morgen, am<br />
2.Mai 1945 zu erkennen ist, soll sicherlich der Haufen<br />
von Soldaten, die aus unterschiedlichen Truppenteilen<br />
kommen, nur in einer Kampfgruppe gesammelt<br />
werden. Von uns soll sich niemand absetzen.<br />
Hat der zuständige Kommandant von Havelberg<br />
deshalb den Begriff Kampfgruppe gewählt?<br />
Am letzten Abend und über Nacht waren noch weitere<br />
Soldaten eingetroffen. Von den Massen an<br />
Nachzüglern erfahre ich erst heute. Die konnten<br />
doch heute keine weitere Kampfgruppe bilden. Jeder<br />
Soldat, der sich hier eingefunden hat, ob an unsere<br />
Kampfgruppe gebunden oder zu den vielen<br />
Nachzüglern gehört, ist auf der Flucht. Nach den<br />
Erkenntnissen der letzten Nacht und des heutigen<br />
Morgens kann man nur noch von der gewaltigen<br />
Ansammlung „verlorener“ Menschen sprechen. Von<br />
Menschen, die nicht in die sowjetische Kriegsgefangenschaft<br />
wollen, und die nur noch auf ein baldiges<br />
Ende des Krieges hoffen. Und hier setzen sich<br />
meine Empfindungen in die Erkenntnis um, jeder ist<br />
heute, an diesem Ort, für sich allein. Gemeinsam
327<br />
sind wir verloren. Wir erkennen es nur noch nicht.<br />
Ich denke, für die Kampfgruppe wird es spätestens<br />
morgen, am 03. Mai 1945, kein Überleben mehr<br />
geben. Ich mache mir darüber keine Gedanken.<br />
Wir werden keinen weiteren Tag in Freiheit erleben.<br />
Und hier, in oder vor Havelberg werden wir nicht<br />
über Nacht bleiben können. Diese ‚Kampfgruppe’<br />
sucht keine ‚Unterkunft’, und eine Versorgung der<br />
Soldaten ist nicht vorgesehen. Das habe ich längst<br />
verstanden. Und so erkenne ich, der ‚Verein<br />
Kampfgruppe’ befindet sich in Auflösung. Was ist<br />
aus den anderen Truppenteilen geworden, die hier<br />
in und durch den Ort gezogen sind? - - - - Übrigens,<br />
wo wollen die noch hinziehen? Jeder Gedanke ist<br />
völlig ziellos. Ich kann mit keiner Menschenseele<br />
sprechen. Ruhelos ziehen die Gedanken weiter. Sie<br />
suchen den Punkt, wo es für mich zu lebenswichtigen<br />
Entscheidungen kommen muss. Gedanken<br />
machen, das ist nur den Vorgesetzten vorbehalten.<br />
Nachdem sie nicht mehr anwesend sind, werde ich<br />
nun für mich entscheiden. Den führenden Militärs<br />
geht der „Arsch auf Grundeis“, durchschaue ich. Ich<br />
spüre einen sich ständig verstärkenden physischen<br />
Druck, den die näher kommenden sowjetischen<br />
Truppen auf mich machen. Im Augenblick herrscht<br />
noch Ruhe. Wie lange noch? Diesen Druck auf uns<br />
werden sie weiter erhöhen. Das Unheil nähert sich<br />
der Stadt Havelberg. Es ist der 2. Mai 1945. Auf der<br />
Straße eilen junge Männer in SS-Tarnuniformen an<br />
mir vorbei. Jeder von ihnen schleppt vier Panzerfäuste<br />
auf seinen jugendlichen Schultern. Mit hochroten<br />
Köpfen hetzen sie vor Angst, nicht rechtzeitig<br />
an ihr Ziel zu kommen. Sie laufen um ihr Leben. Sie<br />
wollen sicher noch vor den Sowjets an einer be-
328<br />
stimmten Stelle eintreffen, wo sie ihren Feind mit<br />
ihren Panzerfäusten empfangen können. Die Burschen<br />
haben noch nicht einmal ordentliche Stiefel<br />
an den Füßen. Ihre innere Unruhe ist die gleiche,<br />
wie wir Zwei sie vor zwei Stunden bei der abgehetzten<br />
Lauferei durch Havelberg erlebt haben. Der Befehl<br />
ihrer Vorgesetzten an die großen Jungen lautet:<br />
‚Den persönlichen Einsatz bringen und kämpfen für<br />
den Führer, für das Vaterland, bis zum letzten Blutstropfen,<br />
bis zum Endsieg weiter kämpfen’. Der<br />
kompromisslose Wettlauf zwingt sie, gleich Selbstmördern,<br />
in ihren sicheren Untergang. Sie werden<br />
ihren Endsieg bekommen. Die jungen Männer sind,<br />
wenn es hoch kommt, fünfzehn Jahre alt. Sie kann<br />
jetzt niemand mehr aufhalten. Die allgemein herrschende<br />
innere Überreizung und Unruhe dringt in<br />
die bedrängten Soldaten ein. Von den anstürmenden<br />
sowjetischen Truppen, von der Havel und der<br />
Elbe. Ich vergleiche unsere Situation mit einem<br />
Raubtierkäfig. Auf dem Hof spricht mich ein älterer<br />
Gefreiter in Offiziersuniform an. „Kamerad, ich habe<br />
die Möglichkeit, mit einem Boot auf die andere Seite<br />
der Elbe zu fahren. - - Kann ich das tun? - - - dann<br />
fügt er gleichzeitig noch hinzu „dieses bedeutet<br />
doch, - - - ich setze mich unerlaubt von der Truppe<br />
ab“. Ich sehe den Mann an. Ich höre wohl nicht richtig.<br />
- - - Klick! macht es bei mir. Es hat bei mir bis<br />
hierher schon häufiger Klick gemacht. So eine verfängliche<br />
Frage. „Tut mir leid, ich kenne mich hier<br />
nicht aus“. Mit seiner Frage hat er mich wohl irritieren<br />
wollen. Ich weiß doch, Havelberg liegt an der<br />
Havel und nicht an der Elbe. Zu diesem Zeitpunkt<br />
ist mir nicht bekannt, dass man über eine Havel-<br />
Schleuse auf kurzem Wege an die Elbe kommen
329<br />
kann. Die undurchsichtige Lage und der Druck der<br />
Sowjets, nehmen durch ihre Vorwärtsbewegung<br />
ständig zu. Die Sowjets wollen so schnell wie nur<br />
möglich, mit ihrer Sturmspitze die Elbe erreichen.<br />
Sie wollen uns überwältigen und vernichten. Ihre<br />
Absicht spüre ich physisch immer stärker. So real<br />
wie die aufgepflanzten Seitengewehre in Genthin<br />
vor und im Rathaus waren. Gegen die Sowjets können<br />
wir nicht mehr kämpfen. Womit denn? Die Sowjets<br />
haben uns bereits überrannt. So selbstverständlich<br />
wie alle Soldaten, will auch ich aus dieser<br />
lebensbedrohenden Schwierigkeit herauskommen.<br />
Wie das gehen kann und ob es gelingen wird, ich<br />
habe keine Ahnung. Jede Minute wird Möglichkeiten<br />
anbieten und mehrere Hinweise oder Antworten<br />
aufzeigen. „Abwarten und Tee trinken“. „Die Nase in<br />
den Wind halten und die richtige Witterung herausfiltern“.<br />
Alles leichter gesagt als getan. Ich gebe es<br />
zu, es ist alles nur ein dummes Gerede. Dem eigenen<br />
Instinkt folgen. Es gibt aus meiner Sicht nur<br />
noch den Weg bis zur Elbe vor mir. Der Hauptfeldwebel<br />
der Kampfgruppe geht mit einem älteren Offizier<br />
auf dem Hof auf und ab. Von ihrem Gespräch<br />
kann ich trotz größter Anstrengung nichts erfahren.<br />
Inzwischen wandelt sich mit jedem Schritt, draußen<br />
auf der Straße das Bild und die militärische Lage.<br />
Auch haben sich Soldaten unserer Kampfgruppe<br />
langsam, nach und nach abgesetzt. Sie verschwinden,<br />
wie man sagt, in den Büschen. Und da müssen<br />
sie doch wieder herauskommen. Während des allgemeinen,<br />
nicht offenen Aufbruchs nehme ich an,<br />
dass die Soldaten sich in Richtung Elbe absetzen.<br />
Nun stelle ich fest, dass die Aufpasser die „Kettenhunde*“<br />
sich abgesetzt haben. Die für die militäri-
330<br />
sche Ordnung eingesetzten „Großmäuler“ haben<br />
ihre glänzenden „Umhängeschilder*“ hinter einer<br />
der nächsten Hausecken abgelegt. Ihre Erkennungszeichen<br />
sind sehr schnell abgetrennt. Fein<br />
haben sie das gemacht. Sie sind jetzt nur noch Soldaten<br />
des Heeres. So schnell kann man sich verwandeln.<br />
Und keiner merkt etwas davon. Für sie ist<br />
der Krieg vorbei und zu Ende. Rette sich, wer kann!<br />
Bis vor wenigen Minuten haben sie noch an den<br />
sich absetzenden Kameraden mit ihren Geschützen<br />
und den Langrohren der Artillerie herumkommandiert<br />
oder die Kameraden je nach Lust und Laune<br />
kujoniert. Wo ist denn mein letzter Kumpel? Wo ist<br />
der abgeblieben? Der hat sich seitlich auch in die<br />
Büsche verdrückt, ohne sich von mir zu verabschieden.<br />
Wo sind denn nun die beiden Diagonalläufer,<br />
der Offizier und der Spieß? Dieses ständige Laufen,<br />
war nur Tarnung, stelle ich erbost fest. Ich habe<br />
doch nicht geträumt, ich habe die beiden doch gerade<br />
noch gesehen. Ihren Aufbruch habe ich nicht<br />
bemerkt. Jetzt spüre ich, da sie weg sind, wie sich<br />
die Frage: Soll ich noch warten? Soll ich jetzt abhauen?<br />
Finde ich noch jemanden? Vielleicht meinen<br />
letzten Kumpel? Willst du dich nicht auch absetzen?<br />
in mir materialisiert. Ach ja, aber da steckt<br />
mir noch Genthin in den Knochen. Mache ich mich<br />
jetzt zum Freiwild? Marschpapiere habe ich doch<br />
nicht, was dann? - - - Ich setze mich jetzt ab. Damit<br />
sind all die offenen Fragen endgültig beantwortet.<br />
Am Ende unserer Militärzeit haben wir uns, ohne<br />
ein Wort, voneinander und für immer verabschiedet.<br />
An die vielbeschworene Kameradschaft habe ich<br />
während des langsam verlaufenden allgemeinen<br />
Aufbruchs nicht gedacht. Militärpolizei. Mir ist die
331<br />
militärische Bezeichnung dieser Schilder nicht in<br />
Erinnerung. Von der Kampfgruppe habe nichts<br />
mehr gehört. Noch nicht einmal den Namen der<br />
„Kampfgruppe“ habe ich mir merken können. Den<br />
habe ich irgendwo zwischen Havelberg und der Elbe<br />
verloren. Nach dem Namen der Kampfgruppe<br />
habe ich zwischendurch immer wieder gesucht. Ich<br />
denke die Kampfgruppe hatte den Namen „Friedberg“<br />
Von der Stiefellieferung ist am Ende auch<br />
nichts übrig geblieben. Paarweise haben sie ihre<br />
passenden Füße gefunden. Die abgenutzten, aufgerissenen<br />
und schiefgelaufenen, teils von ihren<br />
Nägeln befreiten Stiefel, paarweise und einzeln,<br />
liegen auf einem Haufen in einer Ecke. Auch meine<br />
alten liegen dazwischen. Die Waffen, mit denen wir<br />
gestern noch ausgestattet worden sind, liegen da<br />
als Schrott. Ich haue ab. Innerlich bin ich nicht ganz<br />
gefestigt. Ich laufe, mitgerissen von den vielen Soldaten.<br />
Gemeinsam, schweigend geht es in Richtung<br />
Elbe. Ich fühle mich wie ein Anhängsel, wie ein verlassener<br />
Hund. Die Straße zur Elbe führt eine ganze<br />
Strecke geradeaus durch einen lichten Wald.<br />
Linker Hand sind verlassene Schützengräben.<br />
Stahlhelme und Gewehre liegen, in Reihen wie unter<br />
Aufsicht geordnet, nebeneinander. Die langen<br />
Rohre, die vor Stunden an uns vorbeigerollt sind,<br />
liegen abgelegt, rechts neben der Straße im Dreck.<br />
Ich marschiere zwischen der riesigen Menschenansammlung<br />
abgekämpfter Soldaten. Sie, die bewaffnet<br />
sind, werfen jetzt nacheinander ihre bis hierher<br />
getragenen Gewehre, Pistolen und sonstiges<br />
Kriegsgerät auf einzelne Haufen. Hier sehe ich den<br />
ersten amerikanischen Soldaten, der ganz allein auf<br />
sich gestellt irgendwelche Anweisungen mit seinen
332<br />
Händen gibt. Ein deutscher Offizier kommt in seinem<br />
Kübelwagen, aufrecht neben seinem Fahrer<br />
stehend, angerollt. Der Wagen bleibt etwa zehn Meter<br />
vor dem Amerikaner stehen. Der Offizier salutiert<br />
mit der rechten Hand an seinem Stahlhelm* und<br />
meldet seine Einheit in der Gefangenschaft an. „Ich<br />
melde die - - Einheit - - in die Gefangenschaft“. Ich<br />
habe seine laute, arrogant schnarren de Stimme<br />
gehört. Er bildete wohl mit seinem Fahrer, der<br />
gleichzeitig sein Bursche ist, die Vorhut. Will der<br />
Offizier nun darauf aufmerksam machen, dass er<br />
auf dem anderen Ufer eine für ihn angemessene<br />
Übernachtungsmöglichkeit benötigt. Möglichst ein<br />
Hotel oder auch ein amerikanisches Offizierskasino.<br />
Was für ein eingebildetes Arschloch ist dieser Überläufer.<br />
Das ist kein Frontoffizier, der ist sicher nur<br />
für den Innendienst und das Offizierskasino tauglich.<br />
Der sitzt mitten im Dreck und spielt sich auf, als<br />
sei er ein Fürst. Der amerikanische Soldat winkt ab.<br />
Ohne den Gruß zu erwidern, ruft er in die Richtung,<br />
wo der Offizier in seinem Wagen immer noch steht:<br />
„Raus da, verlass deinen Wagen“ oder so ähnlich.<br />
Mit seinem Ausruf, mit lauter Stimme hervorgebracht,<br />
unterstreicht er seine unmissverständliche<br />
Geste. Der Fahrer stellt den Motor ab, lässt den<br />
Zündschlüssel stecken und steigt aus. Er folgt seinem<br />
Offizier in die Gefangenschaft. So einfach kann<br />
es sein. Die sind noch nicht einmal dabei ins<br />
Schwitzen gekommen. Ich fühle mich, nachdem ich<br />
diese Anmeldung in die Gefangenschaft erlebt habe,<br />
etwas sicherer. Mein Überlebenswille ist jetzt<br />
stärker als je zuvor. Von weitem erkenne ich den<br />
Strom durch das frische Grün an den Bäumen. Es<br />
sind vielleicht noch tausend Meter bis zur Elbe.
333<br />
Zwischen den Soldaten sind auch flüchtende Zivilisten.<br />
Inmitten der Kolonnen erreiche ich den breiten<br />
Elbstrom. Anfangs funktionierten die Feldgrauen<br />
sogar noch im Gleichschritt. Dann marschieren sie<br />
wieder „ohne Tritt“. Ich erreiche einen Zustand, wo<br />
ich die mit mir marschierenden grauen Gestalten<br />
nicht mehr als einzelne erkenne. Sie verlieren ihre<br />
Gesichter. Ihre Gestalten sind graue Objekte.<br />
Marschtritte nehme ich nicht mehr wahr. Westlich<br />
von Havelberg wird die größere Anzahl der von der<br />
Elbe festgehaltenen Soldaten in sowjetische<br />
Kriegsgefangenschaft gehen. Und hier wird eine<br />
unbekannte Anzahl von Soldaten ertrinken. Hier ist<br />
keine Brücke. Eine Fähre gibt es nicht. Viele der<br />
Männer, die nach den Strapazen des Krieges und<br />
der letzten Tage endlich hier die Elbe erreicht haben,<br />
waren an dieser Stelle in ihren Tod gegangen.<br />
Ich habe es mit verschwommen Augen gesehen,<br />
wie Soldaten, in voller Uniform, einschließlich ihrer<br />
Stiefel oder Knobelbecher in den Fluss gestiegen<br />
waren. Wie einige mit leeren Benzinkanistern, aufgepumpten<br />
Schläuchen aus Autoreifen oder mit<br />
anderen ungeeigneten Mitteln versucht haben, auf<br />
die andere Seite der Elbe zu kommen. Die gewaltige<br />
Angst vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft<br />
hat sie regelrecht ins Wasser getrieben. Viele<br />
Kameraden haben den Weg durch das Wasser<br />
nicht geschafft, sie sind vielleicht nach dem ersten<br />
Schritt umkehrt oder sie sind untergegangen. Meine<br />
Konzentration beschränkt sich nur auf meine Existenz.<br />
Nun liegt der breite Strom vor mir. In mir hat<br />
sich alles entschieden. Die Frage, wie ich durch den<br />
Fluss kommen werde, stellt sich mir nicht. Ohne<br />
seelischen Schaden zu nehmen, könnte ich aus
334<br />
dieser Anspannung nicht mehr zurück. Ich erlebe es<br />
deutlich, ich bin jetzt mein eigener Gefangener.<br />
Mein Soldbuch zerreißen, es schnell ins Wasser der<br />
Elbe ablegen, dann die „Hundemarke“ abnehmen,<br />
sie zerbrechen und beide Teile in der Nähe des<br />
Ufers in die Elbe werfen. Mit dem Durchbrechen der<br />
Erkennungsmarke gelte ich nicht mehr als ein lebender<br />
Soldat. Dass ich mich, theoretisch, organisatorisch<br />
gesehen, bereits selbst umgebracht habe,<br />
erkenne ich nicht. Meine Dreiecksplane nimmt meinen<br />
irdischen Besitz auf. Das sind: Meine Uniformhose,<br />
meinen Luftwaffenpullover, meine Brieftasche<br />
Meine neuen Stiefel und mein Fallschirmkappmesser.<br />
Meine Armbanduhr wickle ich mein Taschentuch<br />
und in meine Fußlappen. Zuerst habe ich mich<br />
umgebracht, dann habe ich mich so verhalten, wie<br />
jemand, der auf die Reise geht. Ich habe alles in<br />
meine Dreieckszeltplane gepackt. Die Straße zur<br />
Elbe hin, so ist es an der Pflasterung zu erkennen,<br />
mündet direkt im Fluss. Der breite Strom führt kein<br />
Hochwasser. Gott sei Dank. Er fließt zu dieser Jahreszeit<br />
außergewöhnlich ruhig und ganz lautlos dahin.<br />
In der Unterwäsche, diese stammt noch von der<br />
Entlausung vom März, schwimme ich durch die Elbe.<br />
Vor Angst spüre ich das Wasser nicht, ich spüre<br />
nur einen gewaltigen Zwang in mir, vor allem wegen<br />
der Möglichkeit und dem Risiko, den sowjetischen<br />
Truppen in die Hände zu fallen. „Nur das nicht!“ Der<br />
Gedanke an die Sowjets gibt mir die Kraft, ins Wasser<br />
zu gehen. Nur hinüberkommen und herauskommen<br />
ist wichtig. Mit der Hilfe des Schöpfers<br />
komme ich schwimmend an das rettende Ufer. Die<br />
Wassertemperatur und die Fließgeschwindigkeit<br />
haben für mich keine Bedeutung. Der große Strom
335<br />
fließt, dabei unregelmäßig aufquellende Kreise und<br />
leicht glucksende Strudel hinterlassend, friedfertig<br />
dahin. Mir mache ich keine Gedanken was ich tun<br />
muss oder kann, wenn ich eine Berührung mit einem<br />
Ertrunkenen habe. Auch keinen Gedanken,<br />
wenn mich ein noch nicht Ertrunkener als Rettungsflohs<br />
benutzt und mich unter Wasser zieht. Selbst<br />
bei einer Berührung mit anderen, schwimmfähigen<br />
Gegenständen kann ich doch noch absaufen. Weit<br />
abgetrieben, gelange ich dann an eine der Buhnen,<br />
die mir Halt bietet und an der ich mit allerletzter<br />
Kraft an Land komme. Der große Elbstrom lässt<br />
sich nicht von dem Geschehen im Geringsten beeindrucken.<br />
Ich flüchtete am 2. Mai 1945, zwischen<br />
15 und 17, °° Uhr, in die amerikanische<br />
Kriegsgefangenschaft!<br />
Warum ich an der Elbe mein Soldbuch zerrissen,<br />
meine Erkennungsmarke durchgebrochen habe,<br />
kann ich mir selbst nicht beantworten. Meine letzte<br />
Ruhe hätte ich mit den anderen „Unbekannten Soldaten“,<br />
auf dem Friedhofsteil für die gefallenen Soldaten<br />
in Havelberg gefunden. Nach meiner gelungenen<br />
Heimkehr aus dem Kriege habe ich mir später<br />
Gedanken gemacht, warum ich eine tiefe Verbundenheit<br />
zu dem Ort Havelberg entwickelt habe.<br />
Ich war weniger als 24 Stunden dort. An Bewohner<br />
der Stadt Havelberg habe ich keinerlei Erinnerung.<br />
Ich nehme an, dass sie sich vor den vielen Soldaten<br />
versteckt gehalten haben. Möglich ist auch, dass sie<br />
in den Wäldern Schutz gesucht haben, bis der Krieg<br />
vorüber war. Nur an die gesichtslosen Zivilisten erinnere<br />
ich mich, die auf dem Fabrikgelände an einer
336<br />
Rampe waren, wo sie nach Nahrungsmitteln anstanden.<br />
Jahre später fand ich eine Erklärung für<br />
meine Verbundenheit.<br />
Der Ansturm der sowjetischen Truppen in Richtung<br />
Elbe, auf Havelberg, verkleinerte schrittweise den<br />
noch verbleibenden Freiraum. Zur gleichen Zeit<br />
vergrößerte sich schrittweise die Lebensgefahr. Die<br />
wachsende Angst im Nacken, noch in den letzten<br />
Kriegsstunden Leib und Leben zu verlieren, wurde<br />
von Stunde zu Stunde stärker. Die Stadt Havelberg<br />
brachte mir letztlich meine Freiheit. An diesem Ort<br />
fand ich, allein auf mich gestellt, den richtigen Weg.<br />
Als eine einzelne Person, habe ich im Gelände für<br />
einen einzigen, gezielten Schuss ein gutes Ziel abgegeben.<br />
In Havelberg fand ich dennoch Schutz.<br />
Ich war ein guter Schwimmer. In der Oberschule<br />
habe ich als Sextaner eine Urkunde für die beste<br />
Zeit für 50 m Brustschwimmen erhalten. Ich habe<br />
den Grundschein beim DLRG als Rettungsschwimmer<br />
gemacht. 1943 habe ich mich für den Leistungsschein<br />
gemeldet. Die Prüfung fiel aus, weil<br />
der Prüfer an die Front musste. Wegen der Konzentration<br />
auf das durchschwimmen der Elbe habe ich<br />
zusätzlich Kraft benötigt, um meine Dreieckszeltplane<br />
mit dem Inhalt zu retten. Von einem Gebet<br />
kann ich daher nicht sprechen. Jedenfalls kann ich<br />
mich nicht erinnern.