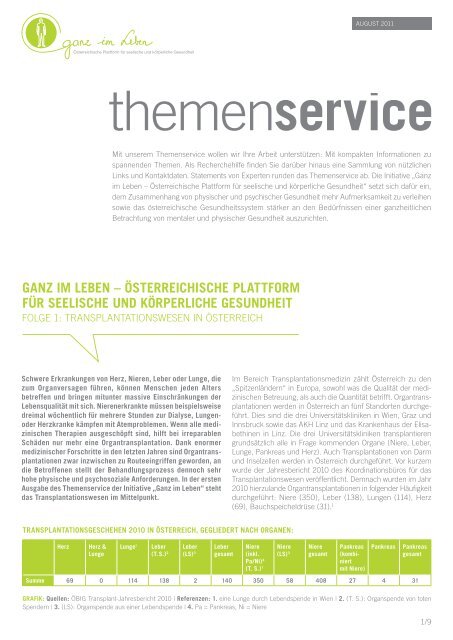themenservice
themenservice
themenservice
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
Mit unserem Themenservice wollen wir Ihre Arbeit unterstützen: Mit kompakten Informationen zu<br />
spannenden Themen. Als Recherchehilfe finden Sie darüber hinaus eine Sammlung von nützlichen<br />
Links und Kontaktdaten. Statements von Experten runden das Themenservice ab. Die Initiative „Ganz<br />
im Leben – Österreichische Plattform für seelische und körperliche Gesundheit“ setzt sich dafür ein,<br />
dem Zusammenhang von physischer und psychischer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu verleihen<br />
sowie das österreichische Gesundheitssystem stärker an den Bedürfnissen einer ganzheitlichen<br />
Betrachtung von mentaler und physischer Gesundheit auszurichten.<br />
GANZ IM LEBEN – ÖSTERREICHISCHE PLATTFORM<br />
FÜR SEELISCHE UND KÖRPERLICHE GESUNDHEIT<br />
FOLGE 1: TRANSPLANTATIONSWESEN IN ÖSTERREICH<br />
Schwere Erkrankungen von Herz, Nieren, Leber oder Lunge, die<br />
zum Organversagen führen, können Menschen jeden Alters<br />
betreffen und bringen mitunter massive Einschränkungen der<br />
Lebensqualität mit sich. Nierenerkrankte müssen beispielsweise<br />
dreimal wöchentlich für mehrere Stunden zur Dialyse, Lungen-<br />
oder Herzkranke kämpfen mit Atemproblemen. Wenn alle medizinischen<br />
Therapien ausgeschöpft sind, hilft bei irreparablen<br />
Schäden nur mehr eine Organtransplantation. Dank enormer<br />
medizinischer Forschritte in den letzten Jahren sind Organtransplantationen<br />
zwar inzwischen zu Routeeingriffen geworden, an<br />
die Betroffenen stellt der Behandlungsprozess dennoch sehr<br />
hohe physische und psychosoziale Anforderungen. In der ersten<br />
Ausgabe des Themenservice der Initiative „Ganz im Leben“ steht<br />
das Transplantationswesen im Mittelpunkt.<br />
TRANSPLANTATIONSGESCHEHEN 2010 IN ÖSTERREICH, GEGLIEDERT NACH ORGANEN:<br />
Herz Herz &<br />
Lunge<br />
Lunge 1 Leber<br />
(T. S.) 2<br />
Leber<br />
(LS) 3<br />
Leber<br />
gesamt<br />
Im Bereich Transplantationsmedizin zählt Österreich zu den<br />
„Spitzenländern“ in Europa, sowohl was die Qualität der medizinischen<br />
Betreuung, als auch die Quantität betrifft. Organtransplantationen<br />
werden in Österreich an fünf Standorten durchgeführt.<br />
Dies sind die drei Universitätskliniken in Wien, Graz und<br />
Innsbruck sowie das AKH Linz und das Krankenhaus der Elisabethinen<br />
in Linz. Die drei Universitätskliniken transplantieren<br />
grundsätzlich alle in Frage kommenden Organe (Niere, Leber,<br />
Lunge, Pankreas und Herz). Auch Transplantationen von Darm<br />
und Inselzellen werden in Österreich durchgeführt. Vor kurzem<br />
wurde der Jahresbericht 2010 des Koordinationsbüros für das<br />
Transplantationswesen veröffentlicht. Demnach wurden im Jahr<br />
2010 hierzulande Organtransplantationen in folgender Häufigkeit<br />
durchgeführt: Niere (350), Leber (138), Lungen (114), Herz<br />
(69), Bauchspeicheldrüse (31). 1<br />
Niere<br />
(inkl.<br />
Pa/Ni) 4<br />
(T. S.) 1<br />
Niere<br />
(LS) 3<br />
Niere<br />
gesamt<br />
Pankreas<br />
(kombiniert<br />
mit Niere)<br />
Pankreas Pankreas<br />
gesamt<br />
Summe 69 0 114 138 2 140 350 58 408 27 4 31<br />
GRAFIK: Quellen: ÖBIG Transplant-Jahresbericht 2010 | Referenzen: 1. eine Lunge durch Lebendspende in Wien | 2. (T. S.): Organspende von toten<br />
Spendern | 3. (LS): Organspende aus einer Lebendspende | 4. Pa = Pankreas, Ni = Niere<br />
1/9
SPENDERAUFKOMMEN: ÖSTERREICH ZÄHLT ZUR EU-SPITZE<br />
Österreich war, was das Spenderaufkommen betrifft, die letzten<br />
15 Jahre abwechselnd mit Belgien an der zweiten Stelle (durchschnittlich<br />
23 Spender pro Million Einwohner und Jahr) hinter<br />
Spanien (durchschnittlich 33 Spender pro Million Einwohner und<br />
Jahr). Inzwischen haben Portugal und Frankreich, aber auch<br />
Kroatien stark aufgeholt und sind in das Spitzenfeld vorgerückt.<br />
Im Hinblick auf die Zahl der Transplantationen pro Million Einwohner<br />
und Jahr über alle Organe hinweg ist Österreich nach<br />
wie vor Nummer eins, da hierzulande von den vorhandenen<br />
Spendern sehr viele Organe akzeptiert und auch erfolgreich<br />
transplantiert werden und zusätzlich auch Lungen aus dem<br />
benachbarten Ausland (Ungarn) zur Verfügung stehen, die die<br />
hohe Frequenz zusätzlich unterstützen. „Diese Zahlen belegen<br />
eindrucksvoll, dass die Organtransplantation als Standardtherapie<br />
von Organversagen im Endstadium akzeptiert ist. Was die<br />
Qualität betrifft, so befinden sich die Patienten- und Organtransplantat-Überlebensdaten<br />
immer im Spitzenfeld der jeweiligen<br />
Registerdaten. Man kann also mit Recht behaupten, dass Österreich<br />
eine gute Platzierung einnimmt, sowohl qualitativ als<br />
auch quantitativ“, so Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher,<br />
Vorstand der Wiener Universitätsklinik für Chirurgie und Leiter<br />
der Abteilung Transplantation der Medizinischen Universität<br />
Wien.<br />
ORGANBEDARF: NIERE UND LEBER WERDEN AM HÄUFIGSTEN<br />
GEBRAUCHT<br />
Trotz aller Fortschritte der chirurgischen Leistungen steht die<br />
Transplantationsmedizin vor dem Problem, dass der Organbedarf<br />
bei weitem nicht gedeckt werden kann. In der Europäischen<br />
Union warten derzeit fast 40.000 Menschen auf eine Organtransplantation,<br />
in Österreich sind es rund 1.100 Patienten. 2<br />
Einerseits ist die Transplantationschirurgie so weit, dass heute<br />
Personen Organtransplantationen erhalten, in deren Fällen bzw.<br />
aufgrund des Krankheitsbildes dies noch vor einigen Jahren<br />
undenkbar gewesen wäre. Diese Erfolge haben dazu geführt,<br />
dass die Wartelisten für Spenderorgane immer umfangreicher<br />
werden. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger geeignete<br />
Spenderorgane. Auf den Punkt gebracht wird dieses Dilemma<br />
durch folgenden Stehsatz: „Die Transplantation ist das Opfer<br />
ihres eigenen Erfolgs“.<br />
Ein Großteil des Bedarfs besteht bei Nieren und Leber. Die<br />
Wartezeit bei diesen Organen beträgt bis zu drei Jahren. Bei der<br />
Niere ist die Bedarfszahl relativ leicht zu eruieren, da alle transplantierbaren<br />
Patienten an der Dialysestation gezählt werden<br />
können. In Österreich werden derzeit 4.500 Patienten dialysiert,<br />
davon sind aber aufgrund der Komplexität der Erkrankungen nur<br />
etwa 800 transplantierbar. Diese Zahl ist schon seit zehn Jahren<br />
konstant (allerdings beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf<br />
eine Niere in Österreich derzeit etwa drei Jahre, abhängig auch<br />
von der Blutgruppe). In Österreich werden 52 Nierentransplantationen<br />
pro Million Einwohner und Jahr durchgeführt, inklusive<br />
aller Lebendspenden, die in Österreich zwischen zehn und<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
15 Prozent ausmachen. „Viel mehr Menschen könnte eine Leber<br />
transplantiert werden, wenn die Organe verfügbar wären, weil<br />
es auch eine sinnvolle Erweiterung in die Tumortransplantation<br />
gäbe, die aber derzeit sehr restriktiv gehandhabt wird – und das<br />
auch werden muss. Ebenso könnten Lungen- und Herztransplantationen<br />
in höherem Maße sinnvollerweise durchgeführt<br />
werden. Die Wartezeit für eine Leber ist derzeit durchschnittlich<br />
neun Monate – wiederum abhängig von der Blutgruppe – bei<br />
Lunge und Herz etwa drei bis sechs Monate, abhängig von der<br />
klinischen Dringlichkeit“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher<br />
weiter.<br />
ORGANSPENDE: MEDIZINISCHE VORAUSSETZUNG, RECHTLICHE<br />
SITUATION UND KONTRAINDIKATIONEN<br />
Medizinisch gesehen ist jeder Patient, der an einer zerebralen<br />
Pathologie verstirbt, im Alter zwischen 0 und 90 ein potenzieller<br />
Organspender. Es gibt nur zwei absolute Kontraindikationen: ein<br />
metastasierendes Malignom und eine klinisch wirksame Sepsis<br />
mit entsprechend positiver Blutkultur. Organe, die mit HIV, Hepatitis-C<br />
oder dem Hepatitis-B-Virus belastet sind, können auch<br />
an Empfänger mit ähnlicher Virusbelastung transplantiert werden.<br />
Generell können nur jene Organe transplantiert werden, die<br />
im Spenderorganismus auch eine ausreichende Funktion zeigen.<br />
Rechtlich betrachtet ist jeder Patient ein Organspender, der<br />
nicht zu Lebzeiten oder durch seinen Rechtsvertreter seinen<br />
Widerspruch kundgetan hat. Dies kann entweder durch Eintragung<br />
in das Österreichische Widerspruchregister beim Österreichischen<br />
Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) erfolgen<br />
oder durch Mitführen einer Erklärung, die belegt dass derjenige<br />
kein Organspender sein will. Formell gilt die sogenannte „harte<br />
Widerspruchslösung“. Praktiziert wird aber eine Art „Informationslösung“:<br />
Die Angehörigen, die den Sterbenden in dieser<br />
Phase begleiten und anwesend sind, werden vom Tod und von<br />
der geplanten Organentnahme informiert. Wenn hier ein unüberbrückbarer<br />
Widerstand gegen die Organspende von Seiten der<br />
Angehörigen erkennbar wird, werden die Organe nicht entnommen.<br />
In Summe werden etwa zehn Prozent der Organspender<br />
aus diesen Überlegungen nicht explantiert.<br />
Die Sicherung einer ausreichenden und zeitgerechten Verfügbarkeit<br />
von Spenderorganen ist die zentrale Herausforderung im<br />
Transplantationswesen. Das Koordinationsbüro für das Transplantationswesen,<br />
ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich<br />
GmbH, dokumentiert das österreichische Transplantationsgeschehen<br />
im Bereich „solide Organe“ (z. B. Niere, Leber, Herz).<br />
Die Zuteilung der verfügbaren Spenderorgane erfolgt in Österreich<br />
über die „Eurotransplant International Foundation“ (ET)<br />
mit Sitz in den Niederlanden. Durch diesen Zusammenschluss<br />
mehrerer Länder haben Patienten größere Chancen, ein immunologisch<br />
passendes Organ zu bekommen bzw. schneller transplantiert<br />
zu werden. Die Spenderorgane werden nach festgelegten<br />
Kriterien an die Patienten, die auf den Wartelisten für die<br />
einzelnen Organe stehen, vergeben. Die Vermittlungskriterien für<br />
2/9
die einzelnen Organe sind unterschiedlich. Im Vordergrund<br />
stehen Erfolgsaussicht und Dringlichkeit, geografische Zuteilungskriterien<br />
sowie die Wartedauer. 3 Nach getroffener Allokationsentscheidung<br />
(Zuteilung von Spenderorganen an die jeweiligen<br />
Organempfänger) erfolgen die Einberufung der Empfänger<br />
und die Transplantation selbst durch das jeweilige Transplantationszentrum.<br />
In Österreich werden in vier Transplantationszentren<br />
Organtransplantationen vorgenommen. Die drei Universitätskliniken<br />
können grundsätzlich alle in Frage kommenden<br />
Organe transplantieren. Das Transplantationszentrum in Linz<br />
(AKH Linz und KH der Elisabethinen Linz) bietet ausschließlich<br />
Nieren-Transplantationen an.<br />
Nach einer durchgeführten Organtransplantation benötigen die<br />
Patienten eine lebenslange Therapie mit so genannten immunsuppressiven<br />
Medikamenten, die das „neue“ Organ vor den Angriffen<br />
des Immunsystems schützen und eine Abstoßungsreaktion<br />
verhindern. „Medikamente, die die Transplantationsleistung im<br />
heutigen Umfang erst ermöglichen, haben leider beträchtliche<br />
Nebenwirkungen, unter anderem auch eine Toxizität für das<br />
transplantierte Organ. Eine Forschungsrichtung geht dahin, Maßnahmen<br />
während und um die Operation so zu modifizieren, dass<br />
eine Medikamentengabe in den Folgejahren nicht mehr notwendig<br />
ist und eine Toleranz entwickelt wird. Ein anderer beschrittener<br />
Weg ist, neue Substanzen zu erfinden, die immunsuppressiv<br />
wirken, aber weniger Nebenwirkungen haben. Auch solche Substanzen<br />
sind bereits in der Entwicklung, wir haben bereits zehn<br />
Jahre sehr gute Studienerfahrungen mit diesen neuen Medikamenten“,<br />
so Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher zum aktuellen<br />
Stand der medikamentösen Betreuung.<br />
PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ORGANTRANSPLANTATION:<br />
BETREUUNG IN ALLEN PHASEN HILFREICH<br />
Nach Ausschöpfung aller medikamentösen und chirurgischen<br />
Möglichkeiten stellt die Transplantation für Menschen mit schweren,<br />
chronischen und früher unheilbaren Erkrankungen eine<br />
lebensrettende und lebensqualitätsverbessernde Therapie dar.<br />
Allerdings stellen Organtransplantationen hohe psychische Anforderungen<br />
an den einzelnen Patienten und dessen Angehörigen.<br />
Von der Entscheidung zur Transplantation bis zum Leben<br />
nach der Operation und der Wiedereingliederung in das Sozial-<br />
und Berufsleben sind alle Phasen des Transplantationsprozesses<br />
mit psychischen Belastungen und Anpassungsprozessen<br />
verbunden. Neben den körperlichen Bürden, die im Rahmen<br />
des Transplantationsprozesses für die Patienten bestehen, wird<br />
also auch die Psyche enorm in Mitleidenschaft gezogen. „Im<br />
Sinne einer ganzheitlichen Behandlung muss der Patient nicht<br />
nur körperlich, sondern auch psychisch entlastet werden, und<br />
zwar im Bedarfsfall mit Unterstützung von Experten“, dafür<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
plädiert die am Transplantationszentrum am AKH Wien tätige<br />
Klinische- und Gesundheitspsychologin Mag. Edith Freundorfer.<br />
Neben Mag. Edith Freundorfer komplettieren Mag. Beate Smeritschnig<br />
und Mag. Brigitta Bunzel das Team für Klinische Psychologie<br />
in der Abteilung für Transplantation an der Medizinischen<br />
Universität Wien. Der psychologische Dienst ist in erster<br />
Linie für den betroffenen Patienten da, es ist aber auch von<br />
großer Bedeutung, die Angehörigen und das engere soziale<br />
Umfeld einzubeziehen. „Eine psychologische Intervention dient<br />
der emotionalen Entlastung, der Aussprache aller rationalen und<br />
irrationalen Ängste und letztlich der Verbesserung der Compliance.<br />
Diese Unterstützungsmöglichkeit sollte von möglichst<br />
vielen Betroffenen und deren Angehörigen angenommen werden“,<br />
so Freundorfer weiter. (siehe auch Interview auf Seite 6).<br />
ÖKONOMISCHE ASPEKTE VON ORGANTRANSPLANTATIONEN<br />
In Zeiten der immer wieder zitierten Kostenexplosion im Gesundheitswesen<br />
besteht für medizinische Spitzenleistungen, zu denen<br />
Transplantationen zählen, ein hoher Druck der Kostenrechtfertigung.<br />
Die Kosten einer Organtransplantation werden in Österreich<br />
von den Sozialversicherungsträgern übernommen. 4<br />
„Gesundheitsökonomisch betrachtet lohnt es sich eine Transplantation<br />
durchzuführen, denn die Kosten für die Behandlungen<br />
organbedürftiger Patienten sind oft wesentlich höher als die<br />
Kosten der Transplantation“, führt Univ.-Prof. Dr. Bernhard<br />
Schwarz, Zentrum Public Health der Medizinischen Universität<br />
Wien und Präsident der Karl Landsteiner Gesellschaft sowie<br />
Sprecher der Initiative „Ganz im Leben – Plattform für seelische<br />
und körperliche Gesundheit“ an.<br />
Als Anschauungsbeispiel sei die Nierentransplantation erwähnt.<br />
Die Kosten der Dialyse für ein Jahr liegen bei etwa 60.000,–<br />
Euro, die Kosten für eine Nierentransplantation belaufen sich auf<br />
durchschnittlich 50.000,– Euro. In den Folgejahren der Transplantation<br />
treten Medikamentenkosten und Kosten für Arztbesuche<br />
auf. Obwohl die notwendigen immunsuppressiven Medikamente<br />
sehr teuer sind, erspart sich das Gesundheitssystem<br />
durch die Transplantation von Nieren hohe Summen. „Die<br />
‚Rentabilitätsgrenze‘ ist bei zehn bis elf Monaten erreicht.<br />
Zusätzlich gewinnt der Patient auch an Lebensqualität und<br />
Lebenszeit“, betont Mühlbacher. Auch Kostenrechnungen bei<br />
anderen Organtransplantationen ergaben einen deutlichen<br />
Kostenvorteil für die Transplantation im Vergleich zu rezidivierend<br />
aufwändigen Krankenhausbehandlungen. Einer aktuellen, in<br />
„Nephrology Dialysis Transplantation“ veröffentlichten Erhebung<br />
zufolge sind Nierentransplantationen durch eine Lebendspende<br />
langfristig betrachtet nicht nur kosteneffizienter, sondern gehen<br />
auch mit einer verbesserten Lebensqualität der Betroffenen<br />
einher („quality-adjusted life years“). 5<br />
3/9
EXPERTENINTERVIEW<br />
Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher,<br />
Vorstand der Universitätsklinik für Chirurgie, Wien<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
Das Transplantationswesen zählt zu den medizinischen Spitzenleistungen, die auch finanziell sehr aufwändig sind. Wie<br />
nehmen Sie den Kostendruck in Ihrem Bereich wahr?<br />
Mühlbacher: Der Kostendruck in der Nierentransplantation ist relativ leicht argumentierbar: Die Alternativtherapie,<br />
die chronische Dialyse, ist wesentlich teurer und kostet pro Patient etwa 60.000,– bis 65.000,–<br />
Euro jährlich. Die Transplantation wurde betriebswirtschaftlich im AKH bereits kalkuliert, zu einem Preis<br />
von etwa 47.000,– Euro valorisiert auf derzeit etwa 50.000,– Euro. Das heißt, der finanzielle Break Even<br />
Point ist bei etwa zehn bis elf Monaten erreicht. Die immunsuppressiven Medikamente kosten zwischen<br />
10.000,– und 15.000,– Euro pro Jahr und Person, das ist aber gegenüber einer Hämodialyse noch immer<br />
eine große Ersparnis. Bei den Nichtnierenorganen ist dieser ökonomische Vergleich nicht leicht zu führen,<br />
man bedenke aber, dass Patienten im Endstadium einer Organerkrankung sehr oft und langfristig hospitalisiert<br />
werden und dadurch sehr hohe Kosten „verursachen“. Spürbar wird der Kostendruck in erster Linie<br />
durch Personaleinsparungen, sodass Organtransplantationen im eigenen Haus nicht wie bisher parallel<br />
durchgeführt werden können, sondern oft Kompromisse in der Zeitwahl gemacht werden müssen und<br />
Konsekutivtransplantationen die Folge sind. Der Kostendruck auf dem Personalsektor ist mir im Lichte der<br />
enormen Ersparnis bei den Nierentransplantationen unverständlich.<br />
Könnten Sie bitte die Aussage „Die Transplantation ist das Opfer ihres eigenen Erfolges“ genauer ausführen?<br />
Mühlbacher: Je besser die Ergebnisse werden, desto mehr Patienten entscheiden sich für die Transplantation,<br />
und auch mehr Ärzte weisen Patienten der Transplantation zu, weil Überleben und Lebensqualität nach<br />
der Transplantation um so vieles besser sind, als das Leben mit einem insuffizienten Organ. Daher wird der<br />
Druck auf den Organbedarf immer höher, die Wartezeiten immer länger und die Organverfügbarkeit kann<br />
kaum noch gesteigert werden.<br />
Wie kann das Problem des Organmangels Ihrer Ansicht nach am ehesten gelöst werden?<br />
Mühlbacher: Es müssten alle potenziellen Organspender in den österreichischen Krankenanstalten mit Intensivstationen<br />
den Transplantationszentren gemeldet werden, was derzeit nicht der Fall ist. Im Vergleich<br />
zu Spanien oder anderen Ländern mit vergleichbarer medizinischer Grundversorgung besteht diesbezüglich<br />
noch ein Defizit. Hilfreich ist hier die Bearbeitung von Krankengeschichten aus Intensivstationen durch eine<br />
Gruppe erfahrener Mediziner, die ein derartiges Defizit verbessern helfen. Zweifellos muss das Bewusstsein<br />
für die Organspende in den potenziellen Spenderkrankenanstalten erhöht werden, was derzeit österreichweit<br />
durch lokale Transplantationsreferenten in den Krankenhäusern gefördert wird. Die Aufgabe dieser Referenten<br />
ist die laufende Evidenzhaltung des tatsächlichen Spenderaufkommens und auch das Besprechen<br />
und Diskutieren der „Nichtspender“ auf Intensivstationen. Natürlich ist die öffentliche Bewusstseinslage<br />
für die Transplantation auch wesentlich. Endgültig lösen wird man den Organmangel nicht können, weil<br />
vermutlich der Bedarf immer höher sein wird als das Organaufkommen, aber eine „stabile Warteliste“ in<br />
der Nierentransplantation ist ein gewisser Erfolg.<br />
Unter welchen physischen wie psychischen Belastungen leiden Patienten vor bzw. nach einer Transplantation?<br />
Mühlbacher: Der Leidensdruck von Patienten vor der Transplantation ist sehr stark organabhängig. Die<br />
chronische Hämodialyse wird drei mal wöchentlich vier bis fünf Stunden durchgeführt, was sehr zeitaufwändig<br />
ist, aber auch mit Regulationsstörungen des Wasserhaushaltes verbunden ist, weil die Flüssigkeitsausscheidung<br />
in diesen fünf Stunden für die nächsten zwei Tage stattfinden muss. Obwohl es Patienten<br />
gibt, die trotz Dialyse arbeitsfähig sind, leidet der überwiegende Teil der Dialysepatienten unter dieser<br />
Therapieform. Vor allem psychische Belastungen wie Minderwertigkeitsgefühle gegenüber der Gesellschaft<br />
4/9
EXPERTENINTERVIEW<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
und der Familie, häufig noch Arbeitsplatzverlust und ähnliche Probleme treten auf. Leberkrankheiten führen<br />
in der Regel zu lebensbedrohenden Blutungen, Wasseransammlungen im Bauch und den Beinen und<br />
häufig auch zur Enzephalopathie (Anm: krankhafte Veränderungen des Gehirns unterschiedlicher Ursache<br />
und Ausprägung). Angst und dauernde Müdigkeit bestimmen das Leben der Betroffenen. Bei Herz- und<br />
Lungenpatienten besteht häufig eine ähnliche Symptomatik. Beide Organe sind in Serie geschaltet und<br />
haben physiologisch die Aufgabe, dem übrigen Körper gut oxygeniertes Blut zur Verfügung zu stellen. Wenn<br />
einerseits die Pumpleistung des Herzens diese Funktion nicht erfüllt und andererseits die Oxygenierung in<br />
erkrankten Lungen die Sauerstoffversorgung nicht ausreichend gewährleisten kann, entstehen Angstzustände,<br />
Erstickungsgefühl und ein extremes Leistungsdefizit bis hin zur Immobilität. Nach der Transplantation<br />
besteht die Angst vor Nebenwirkungen oder Abstoßungen. Die Abhängigkeit von medizinischer<br />
Nachkontrolle und die dauernde Einnahme von potenziell toxischen Medikamenten können auch in diesem<br />
Abschnitt die Lebensqualität beeinträchtigen. Patienten, die ein Problem mit einem „fremden Organ“ haben,<br />
sind eher in der Minderzahl.<br />
Welche Verbesserungsmöglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht im heimischen Transplantationswesen?<br />
Mühlbacher: Es gäbe Verbesserungsmöglichkeiten in der chirurgischen Versorgung der Organspende: Derzeit<br />
werden die Organspenden durch arbeitszeitgesetzbelastende Dienste der Transplantationszentren<br />
abgewickelt, was meiner Ansicht nach nicht ökonomisch ist, und etwa der Raum Oberösterreich, wo es<br />
keine Vorhalteleistung gibt, generell unbezahlt ist. Die Lösung wäre eine Übernahme der ärztlichen Leistung<br />
in diesem Bereich. Dies würde die Kosten verringern, die Qualität verbessern und die Kliniken um teure<br />
Journaldiensträder reduzieren. Eine weitere Verbesserung betrifft das Problem von Lebendspendern: Wenn<br />
jemand seinem Verwandten oder Freund eine Niere spendet, so werden die Spitalskosten in der Regel von<br />
der Spenderkrankenkasse übernommen, obwohl der Verursacher der Empfänger ist. Aber es gibt keinen<br />
Lebensversicherungsschutz, keinen Ersatz für Verdienstentgang und der Arbeitgeber kommt für die Krankenstandstage<br />
in den ersten Tagen für den Organspender auf. Diese Probleme hält vermutlich einige potenzielle<br />
Lebendspender von der Organspende ab, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben.<br />
Wichtig wäre ferner der Aufbau eines Lebendspenderegisters. Das ist in der EU-Direktive zwar gefordert,<br />
aber der Interpretationsspielraum ist relativ groß. Ein derartiges Spenderegister kann in einer Minimalvariante<br />
dazu verwendet werden, kriminelle Transplantationen zu vermeiden, was in Österreich ohnehin nicht vorkommt,<br />
kann aber in der Maximalvariante auch helfen, Nierenspender im Falle einer schwer einzustellenden<br />
Hochdruck-Krankheit oder ähnlichem zu beraten. Ein gutes Register mit Nachsorgeinformation würde auch<br />
im eigenen Bereich ermöglichen, die Risikoabschätzung für eventuelle Organspender zu verbessern. Derzeit<br />
sind wir diesbezüglich auf Studien aus der Schweiz und aus Schweden angewiesen. Auch ein von öffentlicher<br />
Hand gestütztes Transplantationsregister mit Ergebnisdaten wäre wünschenswert. In den USA<br />
existiert seit 1988 ein Transplantationsregister, das derzeit über sämtliche epidemiologische Probleme in<br />
der Organtransplantation Auskunft gibt. Da das US-Gesundheitssystem sich aber diametral von unserem<br />
unterscheidet, sind diese Daten auf uns nicht übertragbar. Ein europäisches Register – Österreich müsste<br />
hier seinen Beitrag leisten – wäre dringend vonnöten, ist aber in der EU-Direktive offensichtlich bewusst<br />
ausgeklammert worden und nur im sogenannten „Action Plan“ 6 empfohlen.<br />
5/9
EXPERTENSTATEMENT<br />
Mag. Edith Freundorfer,<br />
Klinische Psychologin der Leber- und Nierentransplantation<br />
Abteilung für Transplantation, Medizinische Universität Wien<br />
PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ORGANTRANSPLANTATION UND DIE KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE ARBEIT<br />
MIT PATIENTEN UND ANGEHÖRIGEN<br />
1. DIE PHASE DER EVALUATION<br />
Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Transplantation stehen, leiden unabhängig vom<br />
Organ unter einer wesentlichen Einschränkung ihrer Lebensqualität. Immer häufigere und längere Krankenhausaufenthalte<br />
aufgrund vermehrter Infekte, Atemnot, massive Einengung der Bewegungsfreiheit,<br />
damit verbunden geringere Sozialkontakte, der Verlust der beruflichen Identität und das Wissen um eine<br />
geringe Lebenserwartung führen den Patienten nach Absprache mit dem behandelnden Arzt zu einem<br />
Erstgespräch in die Transplantationsambulanz. Die Mitteilung, dass eine Transplantation für den Erhalt bzw.<br />
die Qualität des Lebens notwendig ist, löst zunächst Betroffenheit aus. Einen Teil der Patienten trifft diese<br />
Nachricht völlig unvorbereitet. Die Auseinandersetzung mit dem Thema bedeutet Schock, Angst und Verleugnung.<br />
Dies kann in der ersten Zeit dazu führen, den Schweregrad der Erkrankung zu bagatellisieren,<br />
sich an ein irrationales Hoffen auf Gesundwerdung zu klammern oder sich mit Hoffnungslosigkeit und<br />
Resignation dem Geschehen zu fügen. Patienten mit langer Krankheitsdauer, die ihre Identität als chronisch<br />
Kranke schon erworben haben, reagieren meist mit Dankbarkeit und Hoffnung auf diese Möglichkeit. Viele<br />
Fragen tauchen auf, Unsicherheiten, Befürchtungen und das Abwägen von Vor- und Nachteilen können<br />
im Sinne einer hohen Ambivalenz belastend für den Patienten und dessen Familie sein. Ein spezieller<br />
Bereich der klinischen Psychologie ist die Evaluation bei Lebendspenden (z.B. bei einer Nierentransplantation).<br />
Hier geht es in zeitintensiven Gesprächen mit Spender und Empfänger im Wesentlichen um Abklärung<br />
von ethischen Grundlagen (z. B. Ausschluss von Organhandel), Freiwilligkeit der Spende, Akzeptanz,<br />
Abhängigkeiten und Psychopathologie bei Spender und Empfänger.<br />
Die Aufgaben der klinischen Psychologie in der Phase der Evaluation sind vor allem:<br />
• Hilfen zur Bewältigung der Unsicherheit der Zukunft gegenüber (Umgehen mit Ambivalenz) zur Entscheidung<br />
für, aber auch gegen eine Transplantation<br />
• Hilfen zur Akzeptanz der Realität (allmähliches Ende jeglicher anderer Therapieoption)<br />
• Gespräche gegen die Angst<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
• psychosoziales Screening der Eignung als Organempfänger, vor allem in Bezug auf Compliance (die für<br />
das postoperative Überleben und die Lebensqualität von großer Bedeutung ist)<br />
• Einleitung der extramuralen Entzugstherapie bei alkoholkranken (Leber) bzw. nikotinabhängigen (Herz,<br />
Lunge) Patienten<br />
• Informationsweitergabe über den Ablauf der Transplantation, Chancen und Risiken, Rehabilitation, Lebensqualität<br />
• klinisch-psychologische Evaluation von Lebendspendern und Empfängern bei Nieren und Leberteiltransplantation.<br />
6/9
EXPERTENSTATEMENT<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
2. DIE WARTEZEIT<br />
Werden die Patienten auf die Warteliste genommen, beginnt für manche wegen der zu geringen Organverfügbarkeit<br />
ein Wettlauf mit der Zeit. Die Wartezeit bedeutet Konfrontation mit widersprüchlichen Gefühlen:<br />
Freude über die Listung und Angst, den Zeitpunkt der Transplantation nicht mehr zu erleben. Verschlechtert<br />
sich die Erkrankung, sind der Wunsch und die Hoffnung groß, so schnell wie möglich transplantiert zu<br />
werden. In einer stabileren Phase der Erkrankung treten jedoch oft Zweifel an der Entscheidung auf. Sich<br />
das Organ eines anderen (hirntoten) Menschen für das eigene Überleben zu wünschen, bedeutet eine hohe<br />
psychische Belastung, die zu massiven Gefühlen von Schuld und Scham führen kann.<br />
Zu den Aufgaben in der Wartezeit zählen u. a.:<br />
• Gespräche über die (berechtigte) Angst zu versterben, bevor das Spenderorgan eintrifft<br />
• Gespräche über Spenderproblematik<br />
• Kontakt halten, Beziehung aufbauen für eine stabile Team-Patienten-Beziehung<br />
• Vermittlung zu extramuraler psychischer Unterstützung bis zur Transplantation<br />
• Krisenintervention bei langdauernder Wartezeit und stetiger unaufhaltsamer Verschlechterung des<br />
Gesundheitszustandes<br />
• supportive Gespräche mit Angehörigen.<br />
3. DER STATIONÄRE AUFENTHALT<br />
Bei komplikationslosem Verlauf sind die ersten Tage nach der Transplantation geprägt durch große Erleichterung,<br />
Euphorie und labiler Stimmungslage. Abstoßungskrisen oder neurologische Phänomene (wie z. B.<br />
Cortisonpsychosen) beeinflussen jedoch abermals das Selbstvertrauen der betroffenen Patienten und<br />
verstören die Angehörigen. Erst die Erfahrung, dass Komplikationen in den meisten Fällen medikamentös<br />
erfolgreich behandelt werden können, stärkt das Vertrauen der Patienten in sich und das Team wesentlich.<br />
Die Auseinandersetzung mit dem Spender ist postoperativ ein wichtiges Thema, das transplantierte Organ<br />
wird jedoch relativ rasch in das eigene Körperbild integriert, v. a. wenn die Patienten schnell eine Verbesserung<br />
ihrer körperlichen Befindlichkeit spüren.<br />
Aufgaben der klinischen Psychologie beim stationären Aufenthalt sind:<br />
• Diagnostik und Therapie von psychopathologischen Auffälligkeiten<br />
• Krisenintervention bei kompliziertem und protrahiertem (verzögertem) Genesungsverlauf (bei Patienten<br />
und Angehörigen) sowie bei Defektheilungen, auch Sterbebegleitung<br />
• supportive Gespräche bei Ambivalenz vor Entlassung aus dem stationären Umfeld<br />
• psychoedukatives Abschlussgespräch vor der Entlassung gemeinsam mit Familienangehörigen, das alle<br />
Bereiche des postoperativen Geschehens beinhaltet.<br />
4. DIE ZEIT NACH DER TRANSPLANTATION<br />
Schon im Krankenhaus und anschließend auf Rehabilitation lernt der Betreffende, ein transplantierter<br />
Patient zu sein, was eine Auseinandersetzung im Umgang mit den Medikamenten, den regelmäßigen Ambulanzterminen<br />
und der alltäglichen Routine bedeutet. Es kommt zu einer psychischen Stabilisierung, die<br />
Ängste vor Rückschlägen oder vor einer Abstoßungsreaktion sind jedoch immer noch aktuell. Mit zuneh-<br />
7/9
EXPERTENSTATEMENT<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
mender Mobilität steigt auch die Freude über die neu gewonnene Lebensqualität. Das erste postoperative<br />
Jahr ist für Transplantierte eine Phase der Neuorientierung. Parallel zur wieder gewonnenen physischen<br />
und psychischen Leistungsfähigkeit werden sie nun mit den schwierigen Seiten der Transplantation konfrontiert:<br />
lebenslange Medikation, Abhängigkeit von der Klinik, Neuorientierung in der Partnerschaft, Rückkehr<br />
in die Arbeitswelt bzw. Suchen nach neuen Aufgaben oder auch Ansuchen um Pensionierung mit<br />
Auseinandersetzung mit der Rolle des chronisch Kranken. Das Streben nach Leistung, Prestige und Status<br />
wird aufgegeben, das Leben an sich wird am höchsten bewertet. Chronisch kranke Menschen, befreit von<br />
der Abhängigkeit medizinischer Geräte, Patienten, die die neu gewonnene Lebensqualität genießen, die sie<br />
lange Zeit vermissen mussten, die Urlaube planen, Partnerschaften eingehen, Kinder bekommen, Sport<br />
betreiben − all dies rechtfertigt die Organtransplantation trotz ihrer Erschwernisse und der geforderten<br />
Einschränkungen.<br />
Die Aufgaben der klinischen Psychologie ziehen sich oft über viele Jahre hin. Die Psychologen der jeweiligen<br />
Abteilung sind Ansprechpartner, Vertrauenspersonen und Anlaufstellen für vielerlei auftretende Probleme,<br />
auch solche, die nicht (mehr) unmittelbar mit der Transplantation in Verbindung stehen. Wir erfahren,<br />
auch weil wir die Patienten lang und gut kennen, oft mehr und früher von Problemen (z. B. von Complianceproblemen,<br />
also dem Eingeständnis von mangelhafter Medikamenteneinnahme, die in direkter Folge<br />
zu Organverlust fuhren kann) als die behandelnden Ärzte − ein Umstand, der zu einer gewissen „Katalysator-<br />
Funktion“ zwischen Arzt und Patient führt. Letztlich ist auch die Arbeit im „social networking“ während der<br />
gesamten Transplantationsgeschichte wichtig: Wir stellen Verbindungen her zu und zwischen sämtlichen<br />
Berufsgruppen, die mit der Transplantation zu tun haben: der OP- Leitstelle, der Ernährungsberatung, den<br />
Sozialarbeitern, den Physio- und Ergotherapeuten, der Lehrerin bei Kindern, Seelsorgern usw.<br />
ÜBER GANZ IM LEBEN – ÖSTERREICHISCHE PLATTFORM<br />
FÜR SEELISCHE UND KÖRPERLICHE GESUNDHEIT<br />
Im Jahr 2008 wurde die Initiative „Mental & Physical Health“<br />
auf europäischer Ebene gegründet. Hauptziel der Initiative ist<br />
es, Wege zu mehr Bewusstsein für den Zusammenhang von<br />
psychischer Krankheit und körperlicher Gesundheit einzuschlagen<br />
und eine ganzheitliche Betrachtung des Themas zu erwirken.<br />
Dadurch soll auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
zwischen Psychiatern, Internisten und Allgemeinmedizinern<br />
gefördert werden. In Österreich trägt die Initiative den Titel<br />
„Ganz im Leben. Österreichische Plattform für seelische und<br />
körperliche Gesundheit“. Die Initiative soll dazu beitragen, das<br />
österreichische Gesundheitssystem stärker an den Bedürfnissen<br />
einer ganzheitlichen Betrachtung von mentaler und physischer<br />
Gesundheit auszurichten und die Interdisziplinarität zu fördern.<br />
Die Forcierung der öffentlichen Diskussion des Themas sowie<br />
die Information der Ärzte, Apotheker und natürlich der Bevölkerung<br />
unter dem Motto „Gemeinsam Bewusstsein schaffen“<br />
sind wichtige Maßnahmen der Initiative. Zusätzliche Informationen<br />
stehen auf www.ganzimleben.at zur Verfügung.<br />
8/9
NÜTZLICHE LINKS<br />
> Medizinische Universität Wien<br />
(http://www.transplantation.meduniwien.ac.at)<br />
> Gesundheit Österreich GmbH<br />
(http://www.goeg.at/de/Transplant)<br />
> Österreichische Gesellschaft für Transplantation,<br />
Transfusion und Genetik<br />
(http://www.austrotransplant.at)<br />
> Eurotransplant International Foundatio<br />
(http://www.transplant.org)<br />
> BM für Gesundheit<br />
(http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Medizin/<br />
Blut_Gewebe_Organe/Organe)<br />
> Selbsthilfegruppen zum Thema Transplantationen<br />
(http://www.netdoktor.at/wegweiser/selbsthilfesuche/<br />
transplantationen)<br />
> Initiative „Ganz im Leben“<br />
(http://www.ganzimleben.at)<br />
RÜCKFRAGEN<br />
> Ganz im Leben – Österreichische Plattform für seelische<br />
und körperliche Gesundheit: office@ganzimleben.at |<br />
www.ganzimleben.at<br />
> Welldone GmbH, Werbung und PR: Mag. Elisabeth Kranawetvogel<br />
| Mag. Sabine Sommer | Public Relations | Tel.: 01/402<br />
13 41-40 bzw. 12 | E-Mail: pr@welldone.at<br />
QUELLEN: 1. BM für Gesundheit | 2. ÖBIG, Transplant-Jahresbericht 2010 |<br />
3. BM für Gesundheit | 4. BM für Gesundheit | 5. Haller, Gutjahr, Kramar,<br />
Harnoncourt, Oberbauer: „Cost-effectiveness analysis of renal replacement<br />
therapy in Austria“, Nephrology Dialysis Transplantation, Feber 2011 |<br />
6. European Commission – Action plan on Organ Donation and Transplantation<br />
(2009–2015)<br />
IMPRESSUM: Medieninhaber, Herausgeber und Gestaltung: Welldone<br />
GmbH, Lazarettgasse 19/OG 4, A-1090 Wien, Tel.: +43 1 402 13 41-0,<br />
Fotos: Privat. Für den Inhalt ist der Medieninhaber verantwortlich mit<br />
Ausnahme der namentlich gekennzeichneten Artikel. Dieses Themenservice<br />
entstand mit freundlicher Unterstützung der Bristol-Myers Squibb<br />
GesmbH.<br />
GLOSSAR<br />
FACTBOX<br />
AUGUST 2011<br />
<strong>themenservice</strong><br />
> Abstoßungsreaktion: Das Immunsystem erkennt fremde<br />
Zellen (z. B. Viren, Bakterien), aber auch fremde Organe. Nach<br />
einer Transplantation führt diese Schutzfunktion aber zur<br />
Abstoßung des Organs, welches in Folge „bekämpft“ wird. <<br />
> Immunsuppression: Um eine Abstoßungsreaktion zu verhindern,<br />
kommen immunsuppressive Medikamente zum Einsatz.<br />
Die regelmäßige und dauerhafte Einnahme der Immunsuppressiva<br />
ist für die Funktion des Transplantats lebenswichtig. <<br />
> Lebendspende: Neben der Organspende von Verstorbenen<br />
gewinnt die Lebendspende immer mehr an Bedeutung, diese<br />
ist bei Niere und Leber möglich. Voraussetzung ist die Gesundheit<br />
des Spenders, die Freiwilligkeit der Organspende sowie die<br />
nachweisbare persönliche Nahebeziehung zum Empfänger und<br />
der Ausschluss von kommerziellen Interessen. <<br />
> Rechtslage: Es ist es in Österreich zulässig, Verstorbenen<br />
einzelne Organe oder Organteile zu entnehmen, um durch<br />
Transplantation das Leben eines anderen Menschen zu retten<br />
oder dessen Gesundheit wiederherzustellen. Entsprechend der<br />
geltenden Widerspruchsregelung kommt jeder Österreicher als<br />
Organspender in Frage, so lange er nicht zu Lebzeiten einer<br />
allfälligen Organentnahme widersprochen hat. Ärzte sind nicht<br />
ausdrücklich verpflichtet, die Angehörigen zu befragen, ob sie<br />
dem Verstorbenen Organe entnehmen dürfen. <<br />
> Widerspruchsregister: Seit 1995 führt das Österreichische<br />
Institut für Gesundheit (ÖBIG) das „Widerspruchsregister gegen<br />
Organspende“. Hier kann sich jeder eintragen lassen, der<br />
sicherstellen möchte, dass bei ihm keine Organe entnommen<br />
werden. Alle Transplantationszentren Österreichs sind verpflichtet,<br />
diese Datenbank abzufragen, bevor eine Transplantation<br />
eingeleitet wird. <<br />
Laut Transplant-Jahresbericht des Koordinationsbüros für<br />
das Transplantationswesen (ÖBIG – Geschäftsbereich der<br />
Gesundheit Österreich GmbH) wurden im Jahr 2010 in<br />
Österreich 191 verstorbene Organspender gemeldet und<br />
in der Folge auch explantiert. Gegenüber dem Jahr 2009<br />
ist eine Reduktion um 8,6 Prozent zu verzeichnen. Die<br />
Nierentransplantation ist in Österreich mit Abstand die<br />
häufigste Transplantation (52 pro Million Einwohner und<br />
Jahr), gefolgt von der Leber (18 pro Million Einwohner<br />
und Jahr), gleichauf mit der Lunge und gefolgt von der<br />
Herztransplantation, die zwischen zehn und 15 Transplantationen<br />
pro Million und Jahr variiert.<br />
Die in diesem Themenservice verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten<br />
der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig<br />
auf beide Geschlechter bezogen.<br />
9/9