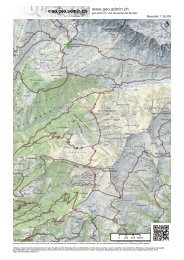Einführung_1.pdf
Einführung_1.pdf
Einführung_1.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Bedeutung von „L3T“<br />
Weil das „Lehrbuch für Lernen und Lehren mit<br />
Technologien“ ein langer und vor allem sperriger<br />
Titel ist, haben wir ihn abgekürzt zu schlicht und<br />
einfach „L3T“. Wir bezeichnen so gleichermaßen das<br />
Lehrbuch wie auch das gesamt Projekt. Beides wird<br />
im Folgenden beschrieben sowie den rund 200 Mitwirkenden<br />
ein Dank ausgesprochen.<br />
2. Zielgruppe und Themenfeld<br />
Ein Lehrbuch richtet sich an Lernende, die sich ein<br />
Forschungs- und Praxisgebiet erschließen möchten<br />
und an Lehrende in Studiengängen im jeweiligen<br />
Themenfeld, die Anregungen und Unterlagen für<br />
ihren Unterricht suchen. Das Themenfeld „Lernen<br />
und Lehren mit Technologien“ ist dabei weit gefasst:<br />
Es beinhaltet alle Lern- und Lehrprozesse<br />
sowie -handlungen, bei denen technische, vor allem<br />
elektronische (zumeist auch digitale) Geräte<br />
und/oder dafür erstellte Anwendungen eingesetzt<br />
werden. Ein besonderes, aber nicht ausschließliches,<br />
Augenmerk liegt dabei auf Anwendungen und<br />
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
(IKT). Dieses Lehrbuch für Lernen und<br />
Lehren mit Technologien wendet sich also an Studierende<br />
und Lehrende in einem interdisziplinären Themenfeld,<br />
das Aspekte von Pädagogik, Informatik,<br />
Psychologie und zahlreichen angrenzenden Wissenschaftsgebieten<br />
berührt.<br />
3. Inhalt im Überblick<br />
In fast 50 Kapiteln werden unterschiedliche Facetten<br />
und Aspekte des Fachbereichs ausgewählt. Der<br />
Bogen ist dabei weit gespannt: Von eher historischen<br />
Beiträgen, welche die Entwicklung von „Hypertext“<br />
oder des Fernunterrichts beschreiben, über<br />
eine Reihe von Beiträgen, die einzelne Theorien und<br />
Forschungsansätze aufgreifen, bis zu Beschreibungen<br />
des Einsatzes von Technologien in ausgewählten Bildungssektoren<br />
und Fachgebieten. Viele davon behandeln<br />
Themen, die derzeit in den (akademischen)<br />
Aus- und Weiterbildungsprogrammen behandelt<br />
werden. Es gibt aber auch eine Reihe von Beiträgen,<br />
die nicht zum eigentlichen Kerncurriculum des Fachbereichs<br />
gehören, aber deutlich machen, wie vielfältig<br />
und unterschiedlich der Einsatz von Technologien<br />
behandelt wird. Ein gutes Beispiel dafür sind die Beiträge<br />
zum Technologieeinsatz im Kindergarten und<br />
zur Entwicklungszusammenarbeit. Einige Kapitel<br />
sind für Studierende, die Informatik oder Pädagogik<br />
studieren weniger interessant, da sie ihnen bereits bekannte<br />
Inhalte beschreiben werden. Umgekehrt, und<br />
auch für all diejenigen, die keine Vorkenntnisse in der<br />
Informatik und Pädagogik haben, sollten diese einführenden<br />
Kapitel aber hilfreiche Unterstützung<br />
bieten.<br />
Viele der Themen, die im Lehrbuch behandelt<br />
werden, finden sich auf der nächsten Seite als Abbildung<br />
2 in der L3T-Landkarte wieder: Visualisiert<br />
als Städte, Gebirge, Seen, Inseln usw. kann man hier<br />
die Gegenden (Themengebiete) des Lehrbuchs erkunden.<br />
!<br />
4. Zugänge zum Lehrbuch<br />
Das Lehrbuch und seine Kapitel erscheinen in unterschiedlichen<br />
Formen. Zunächst einmal gibt es alle<br />
Kapitel mit freiem Zugang am Webportal von L3T:<br />
http://l3t.eu. Um das Einbinden der Kapitel, beispielsweise<br />
in Weblogs, zu ermöglichen gibt es alle<br />
Kapitel auch im L3T-Slideshare-Account (http://www.slideshare.net/L3Tslide).<br />
Alle Kapitel sind mit einer Creative-Commons-<br />
Lizenz versehen, die es erlaubt, die Beiträge im Unterricht<br />
zu nutzen, sie zu versenden oder sie auch auf<br />
anderen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Wer<br />
sicher gehen will, eine aktuelle Version eines Kapitels<br />
zu haben, sollte jedoch direkt auf die L3T-Website<br />
zugreifen. Den genauen Text der Lizenz (siehe Abbildung<br />
1) kann man im Internet nachlesen beziehungsweise<br />
bei Unsicherheit oder zu weiteren Absprachen<br />
bei uns auch erfragen (siehe http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).<br />
Abbildung 1: Die verwendete Lizenz<br />
Für Nutzer/innen von iPhone und Android Mobiltelefonen<br />
gibt es jeweils eine App, die das komfortable<br />
Lesen der Kapitel auf den entsprechenden mobilen<br />
Endgeräten möglich macht.<br />
!<br />
Das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien<br />
ist auf der Homepage hKp://l3t.eu zugänglich. Dort<br />
findet man viele weitere Möglichkeiten und InterakE-‐<br />
onsangebote, die es erlauben, zu diskuEeren oder<br />
weitere Inhalte zu erlangen.<br />
Sie können jederzeit mit den Herausgebern des<br />
Buches in Kontakt treten, entweder unter marEn.eb-‐<br />
ner@l3t.eu oder sandra.schoen@l3t.eu.
Einleitung. Zum Lehrbuch und dem etwas anderen Lehrbuchprojekt— 3
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
!<br />
Die Apps im Überblick:<br />
▸ iPhone: hKp://itunes.apple.com/de/app/iojs/-‐<br />
id396906126?mt=8<br />
▸ Android: hKp://213.173.74.11/Open%20Journal<br />
%20Systems%20for%20Android.apk<br />
Weiters gibt es auch ein Kapitel (siehe #ipad) als iPad<br />
App:<br />
▸ hKp://itunes.apple.com/at/app/l3tmedia/id41546<br />
5498?mt=8<br />
Ergänzend gibt es das Lehrbuch ab Mai 2011 auch<br />
als gedrucktes Buch. Zwei Varianten werden dabei<br />
zur Verfügung stehen: Eine hochwertige, fest gebundene<br />
und farbige Version („Bibliotheksversion“)<br />
und eine einfache, in schwarz-weiß gedruckte, kostengünstige<br />
Variante („Studierendenversion“). Das<br />
Buch ist als Service für alle gedacht, die gerne blätternd<br />
schmöken, mit dem Stift markieren, bei gleißendem<br />
Sonnenschein lesen möchten oder wenn ausnahmsweise<br />
kein digitales Endgerät vorhanden ist.<br />
5. Gliederung des Lehrbuchs<br />
Es ist nicht simpel, nahezu 50 Kapitel in eine Reihenfolge<br />
zu bringen, die für alle Leser/innen mit unterschiedlichen<br />
Voraussetzungen die richtige ist. Es ist<br />
wohl auch nicht möglich. Die Kapitel wurden zunächst<br />
drei Hauptgruppen zugeteilt: Beiträge, die als<br />
Einstiegstexte Übersichten geben, welche für viele<br />
weitere Kapitel Voraussetzungen sind, wurden dem<br />
Abschnitt „<strong>Einführung</strong>“ zugeordnet. Dann gibt es<br />
eine Reihe von Beiträgen, von denen wir annehmen,<br />
dass sie derzeit zum Kerncurriculum gehören, da sie<br />
Themen ansprechen, die in den Basismodulen aktueller<br />
Fortbildungsangebote aufgezählt werden (siehe<br />
Kapitel #telweiterbildung). Diese Beiträge finden<br />
sich im Abschnitt „Vertiefung“. Obwohl die Zahl<br />
der Beiträge groß ist, werden in dieser ersten<br />
Ausgabe von L3T noch nicht alle Grundlagenthemen<br />
abgedeckt, hier werden Ergänzungen notwendig sein.<br />
Schließlich gibt es noch – auch in großer Zahl –<br />
Kapitel, die über das (aktuelle) Kerncurriculum hinausgehen.<br />
Diese wurden schließlich dem Abschnitt<br />
„Spezial“ zugeordnet. Es sind Beiträge, die den<br />
Einsatz von Technologien zum Lernen und Lehren<br />
in bestimmten Bildungssektoren oder zu Fachgegenständen<br />
(„Schulfächern“) beschreiben. Zu diesem Bereich<br />
gehören aber auch Beiträge die den Einsatz von<br />
Werkzeugen und Methoden beschreiben oder einzelne<br />
theoretische Zugänge und Forschungsansätze<br />
beschreiben. Es kann übrigens durchaus sein, dass<br />
die Beiträge in diesem Sektor für das eigene Studium<br />
oder Lehrgebiet zentral sind!<br />
In der Online-Version des Lehrbuchs und auf der<br />
ersten Seite der Kapitel gibt es jeweils eine Reihe von<br />
weiteren Schlagworten, mit denen die Kapitel versehen<br />
wurden. Diese Schlagworte sind kleingeschrieben<br />
und beginnen mit einem Doppelkreuz,<br />
dem sogenannten „Hash“ (engl. „hashtag“). Das<br />
erste Schlagwort ist der eindeutige Begriff für dieses<br />
Kapitel, unter dem es adressierbar und damit referenzierbar<br />
ist. Die weiteren wurden mehrfach vergeben,<br />
so dass sich mit ihrer Hilfe die Kapitel auf weitere<br />
Arten auswählen und gruppieren lassen. Man kann<br />
zum Beispiel so schnell einen Überblick über Inhalte<br />
bekommen, die eher Theorien und Forschung thematisieren<br />
(versehen mit #theorieforschung).<br />
!<br />
Das Lehrbuch verwendet zur Referenzierung der ein-‐<br />
zelnen Kapitel Hashtags (#). Damit können Verweise<br />
ohne einer weiteren Nummerierung gesetzt bezie-‐<br />
hungsweise auch Verknüpfungen mit Online-‐Diensten<br />
hergestellt werden (durch die Eingabe der entspre-‐<br />
chenden Tags).<br />
Ebenso auf der ersten Seite im Kasten befinden sich<br />
drei „Doktorhüte“. Sie stellen eine Visualisierung<br />
der sprachlichen Anforderungen, die die Kapitel an<br />
die Leser/innen stellen, dar. Es ist für uns ein erster<br />
Versuch, visuell zu kennzeichnen, wie herausfordernd<br />
es für Leser/innen, ist, vor allem für solche mit wenig<br />
einschlägigem Vorwissen, das jeweilige Kapitel zu<br />
lesen: Artikel mit einem Doktorhut sind tendenziell<br />
einfacher verständlich als solche mit zwei. Die Einschätzung<br />
erfolgte dabei auf Grundlage sorgfältiger<br />
Analysen einer Studentin, die beispielsweise die Zahl<br />
der Fremdwörter, die Länge der Sätze und die Anschaulichkeit<br />
der Sprache feststellt. Ob und inwieweit<br />
diese Einschätzung und deren Visualisierung den Leserinnen<br />
und Lesern hilft, wird sich zeigen. Jedenfalls<br />
wird diese Einstufung von jener Studentin weiter evaluiert.<br />
Über Rückmeldungen freuen wir uns natürlich.<br />
6. Gestaltung der Kapitel<br />
Allen Kapiteln ist gemein, dass sie neben einer Zusammenfassung,<br />
einer kurzen Einleitung sowie einem<br />
kurzen Fazit in das Themenfeld einführen und einen<br />
Überblick geben. Die Autorinnen und Autoren<br />
wurden dabei gebeten, wichtige Aussagen oder Bemerkenswertes<br />
zu kennzeichnen; solche Aussagen<br />
wurden in Kästchen gesetzt (Kennzeichnung: Rufzeichen).<br />
Ebenso erhalten alle Kapitel eine Reihe von<br />
Aufgaben unterschiedlicher Natur, die ebenso markiert<br />
wurden (Kennzeichung: Fragezeichen). Neben<br />
Reflexions- und Wiederholungsfragen für einzelne
Lernende und Leser/innen sind dies auch oft Aufgaben,<br />
die im Rahmen von Seminaren in kleinen<br />
Gruppen bearbeitet werden können.<br />
Fast alle Kapitel haben abschließend auch eine<br />
oder mehrere graue Kästen, die mit „In der Praxis“<br />
überschrieben werden. Hier wird versucht, die konkrete<br />
Praxis zu beschreiben und Einblick in die tägliche<br />
Arbeit zu geben. In Forschungskapiteln kann<br />
dies auch als „Forschungspraxis“ zur Beschreibung<br />
von einzelnen Untersuchungen und Experimenten<br />
ausgewiesen sein.<br />
7. Weitere Materialien zu den Kapiteln<br />
Das erste Schlagwort im grauen Kasten auf der<br />
ersten Seite (bei dieser Einleitung ist es zum Beispiel<br />
#einleitung) ermöglicht es, diesem Kapitel auch noch<br />
weitere Materialien zuzuordnen, die im Internet zu<br />
finden sind. Wir nutzen dabei insbesondere, aber<br />
nicht ausschließlich, den Social-Tagging-Service<br />
Mister Wong (http://www.mister-wong.de-<br />
/user/l3t/). Mit den entsprechenden Schlagworten<br />
lassen sich hier Internetadressen zu Videos und weiteren<br />
Informationen zu den Artikeln finden, beispielsweise<br />
Anwendungsbeispiele oder auch Vertiefungsliteratur<br />
(sofern sie frei im Web zugänglich ist).<br />
!<br />
Für dieser Einleitung hat uns Harald Schmid eine<br />
Reihe von empfehlenswerten Webquellen gesammelt,<br />
die bei Mister Wong mit #l3t und #beispiel zu finden<br />
sind.<br />
8. Das etwas andere Projekt<br />
L3T ist kein klassisches Lehrbuch. Auch der Prozess<br />
der Entstehung unterscheidet sich von anderen vergleichbaren<br />
Lehrbüchern. So gab es weder ein kleines<br />
Autorenteam für das Gesamtwerk noch Einladungen<br />
an ausgewählte Wissenschaftler/innen einzelne Kapitel<br />
zu schreiben. Es gab vielmehr im April 2010<br />
einen offenen Aufruf an alle Interessierten, sich zu<br />
bewerben. Neben ausführlichen schriftlichen Informationen<br />
sorgte ein Video bei YouTube mit dem<br />
Aufruf zum Mitmachen für große Resonanz.<br />
Abbildung 3: Screenshot vom Call-‐for-‐Chapters<br />
Einleitung. Zum Lehrbuch und dem etwas anderen Lehrbuchprojekt— 5<br />
Mehr als 130 potentiellen Mitschreiber/innen<br />
wurden danach Themen zugeordnet und wurden gebeten,<br />
sich mit den ihnen teils unbekannten Personen<br />
in Autorenteams zu finden und gemeinsam Artikel<br />
zu schreiben. Das war kein leichtes Unterfangen und<br />
klappte auch nicht immer reibungslos.<br />
Es war keine Vorraussetzung oder Notwendigkeit,<br />
aber vielfach wurden Werkzeuge eingesetzt, um die<br />
die Zusammenarbeit zu unterstützen, die auch in<br />
diesem Lehrbuch vorgestellt werden: beispielsweise<br />
Videokonferenzen, Wikis und geteilte Dokumente<br />
(zum Beispiel Etherpad oder Google Docs; siehe Kapitel<br />
#kollaboration). Zu der Kooperation der Teams<br />
wurden von einer Studentin im Rahmen einer Masterarbeit<br />
Befragungen durchgeführt, die bisher noch<br />
nicht veröffentlicht wurden.<br />
Auch die Begutachtung der Kapitel erfolgte nicht<br />
auf dem üblichen Weg einer anonymen Begutachtung:<br />
Nachdem die Namen der Autorinnen und<br />
Autoren, zumindest deren erste Zusammensetzung<br />
bekannt war, wollten wir den Gutachterinnen und<br />
Gutachtern nicht den „Schutz“ der Anonymität<br />
geben, sondern vielmehr einen offenen und konstruktiven<br />
Austausch über die Verbesserungsmöglichkeiten<br />
der Kapitel initiieren und bieten. Wir<br />
hatten den Eindruck, dass die Gutachten auch durch<br />
diese Transparenz insgesamt detaillierter und konstruktiver<br />
waren, als es bei anonymen Gutachten der<br />
Fall ist, wie man sie von herkömmlichen Konferenzen<br />
kennt. Hilfreich war offensichtlich auch für<br />
viele Autorinnen und Autoren, dass sie andere Kapitel<br />
und deren Vorgehensweise lesen konnten.<br />
Um alle Beteiligten und Interessierte auf dem Laufenden<br />
zu halten, um die Aktivitäten zu koordinieren<br />
sowie, um auch potentielle Leser/innen zu gewinnen,<br />
wurde unter anderem eine Facebook-Seite angelegt<br />
(http://facebook.com/l3t.eu). Zahlreiche Socia-<br />
Media-Aktivitäten, beispielsweise ein „Dankeschön“-<br />
Film für die Gutachter/innen oder gesungene und<br />
gezeichnete Adventsgrüße, die im Adventskalender<br />
von e-teaching.org versteckt waren, sorgten für kontinuierlich<br />
wachsende Aufmerksamkeit und regelmäßigen<br />
Austausch von vielen Mitwirkenden.<br />
!<br />
Die Social-‐Media AkEvitäten von L3T im Überblick:<br />
▸ Facebook: hKp://facebook.com/l3t.eu<br />
▸ TwiKer: Verwendung des Hashtags #l3t<br />
▸ Mister Wong: hKp://www.mister-‐wong.de/user-‐<br />
/l3t/<br />
▸ Flickr-‐Gruppe: hKp://www.flickr.com/groups/l3t/<br />
▸ Vodpod: hKp://vodpod.com/l3tvideo<br />
▸ Slideshare: hKp://www.slideshare.net/L3Tslide<br />
▸ CiteULike: hKp://www.citeulike.org/group/13885
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Dankeschön!<br />
Autorinnen und Autoren<br />
Mehr als 130 wollten mitmachen, 115 Wissenschaqler/innen<br />
und PrakEker/innen haben schließlich bei den Beiträgen mit-‐<br />
geschrieben die veröffentlicht wurden (in alphabeEscher Rei-‐<br />
henfolge): Heidrun Allert, Nicolas Apostolopoulos, Ralf<br />
Appelt, Patricia Arnold, Michael E. Auer, Andreas Auwärter,<br />
Peter Babnik, Peter Baumgartner, Gabriele Bäuml-‐Westebbe,<br />
Andrea Belliger, ChrisEan Böhler, Taiga Brahm, Klaus Bredl,<br />
Gerlinde Buchberger, Ilona Buchem, Philipp Budka, Johanna<br />
Chardaloupa, Johannes Dorfinger, MarEn Ebner, Marc Egloff-‐<br />
stein, Jan Ehlers, Ulf-‐Daniel Ehlers, Andreas Eitel, Bernhard<br />
Ertl, Corinna Fink, Roland Gabriel, Claudia Gartler, MarEn<br />
Gersch, Susanne GruKmann, Andreas Hebbel-‐Seeger, Verena<br />
Heckmann, Lambert Heller, Kathrin Helling, Jacqueline<br />
Henning, Erich Herber, Ilona Herbst, Wolf Hilzensauer, An-‐<br />
dreas Holzinger, Tanja Jadin, Tobias Jenert, Susan Jolie,<br />
Sascha Kaiser, Marco Kalz, Frank Kappe, Stefan Karlhuber,<br />
Uwe Katzky, Severin Kierlinger-‐Seiberl, Dirk Krause, Rolf<br />
Kretschmann, David Krieger, Clemens Kroell, Marc Krüger,<br />
Son Le, ChrisEan Lehr, André Lenich, Volker Lichtenthäler,<br />
Conrad Lienhardt, MarEn Lindner, Markus Linten, Anja<br />
Lorenz, Mark Markus, Johannes Maurek, Klaus Meschede,<br />
Johannes Metscher, Günter Mey, Klaus Miesenberger, Katja<br />
Mruck, Ursula Mulley, Walther Nagler, Manuela Pächter, Ste-‐<br />
fanie Panke, Georgios Perperidis, Markus Peschl, Andreas<br />
Pester, Birgit Peterson, Günter Podlacha, Robert Pucher,<br />
Peter Purgathofer, Gergely Rakoczi, Klaus Reich, Gabi<br />
Reinmann, Christoph Richter, Jochen Robes, BrigiKe<br />
Römmer-‐Nossek, Detlev Roth, ChrisEan Safran, Werner<br />
Sauter, Steffen Schaal, Claudia Schallert, Elisabeth Schallhart,<br />
Mandy Schiefner, Bernhard Schmidt-‐Hertha, Sandra Schön,<br />
Rolf Schulmeister, Heike Seehagen-‐Marx, Kai Sostmann,<br />
ChrisEan Spannagel, Marcus Specht, KersEn Stöcklmayr,<br />
Maria Süß, Michael Tesar, Thorsten Trede, Claus Usener,<br />
Markus Vogel, Frank Vohle, Stephan Waba, Günter Wage-‐<br />
neder, Peter Weber, Kirsten Wessendorf, Marc Widmer,<br />
Diana Wieden-‐Bischof, Sabine Zauchner, Olaf Zawacki-‐<br />
Richter, Elisabeth Zimmermann und Isabel Zorn.<br />
Gutachterinnen und Gutachter:<br />
Etliche Autorinnen und Autoren waren auch als eine/r der<br />
über 80 Gutachter/innen akEv. Darüberhinaus waren im<br />
Einsatz: Tanja Adamus, Corinna Bath, Gerhard Bisovsky,<br />
MaKhias Bohling, Conny Christl, Kai Du, Bernhard Ertl, Rü-‐<br />
diger Fries, Gudrun Gaedke, Dörte Giebel, Ortrun Gröblinger,<br />
Wolfgang Greller, Leo Hamminger, Ralf Hauber, Kurt<br />
Hoffmann, Sandra Hovues, Veronika Hornung-‐Prähauser,<br />
Sieglinde Jakob-‐Kühn, Anja Janus, Doris Junghuber, Rene<br />
Kaiser, Inge-‐Anna Koleff, Monika Lehner, Stephanie Lipp,<br />
Bernhard Maier, Claus Rainer Michalek, Johannes Moskaliuk,<br />
Günter Nimmerfall, Annabell Preussler, Guido Rössling,<br />
Herwig E. Rehatschek, Gudrun E. Reimerth, Wolfgang Rein-‐<br />
hardt, Anita Reitz, Wolfgang Renninger, MarEn Schön, Chri-‐<br />
stoph Scheb, Harald M. Schmid, Joel Schmidt, ChrisEna<br />
Schwalbe, Anastasia Sfiri, Almut Sieber, ChrisEan SiKe, Helge<br />
Städtler, Helmut Stemmer, Behnam Taraghi, Olaf Thiemann,<br />
Ellen Trude, Frank Weber und Ulrich Weber.<br />
Illustra3onen<br />
Es konnte auch kreaEv an L3T mitgewirkt werden, viele<br />
haben speziell für L3T gezeichnet, fotografiert und illustriert.<br />
Das waren einige Autorinnen und Autoren, aber auch Wey-‐<br />
Han Tan, Miriam Krekels und Oliver Toman. Darüber hinaus<br />
auch allen ein herzliches Dankeschön, die L3T Abdruckrechte<br />
erteilten oder ihre Materialien mit entsprechend freien Li-‐<br />
zenzen zur Verfügung stellen.<br />
Und dann sind da noch:<br />
Schließlich hat L3T auch für große weitere Unterstützung ge-‐<br />
funden: Es entstanden eine Reihe von Videos mit Exper-‐<br />
Ennen und Experten, es gab auch AkEvitäten für Kapitel, die<br />
sich zerschlagen haben und dennoch mühevoll waren, auch<br />
gab es vielfälEge Unterstützung bei der Bewerbung des<br />
Aufrufs für Einreichungen und des Projektes. Wir danken –<br />
neben allen bereits genannten – hier: Josef Altmann, An-‐<br />
dreas Auinger, Theo BasEens, Markus Deimann, ChrisEan<br />
Glahn, Marion R. Gruber, Herwig Habenbacher, JeaneKe<br />
Hemmecke, Klaus Himpsl, Peter A. Henning, Nina Heinze,<br />
Kurt Hoffmann, Stefan Iske, Narayanan Kulathuramaiyer,<br />
Hermann Maurer, KersEn Mayrberger, Andre Mersch, Felix<br />
Mödritscher, Herbert Mühlburger, Joachim Niemeier, Alex-‐<br />
ander Nischelwitzer, MarEn Raske, Karin Redl, Siegfried<br />
Reich, Verena Rexeis, Heimo Sandtner und Harald Schmid.<br />
Zu guter Letzt: Der enge Kreis<br />
Ein ganz besonderen Dank gilt dem engen Kreis um L3T:<br />
Gregor Brandweiner, Michael Kopp, Clemens Kroell, Walther<br />
Nagler, Verena Rexeis, Barbara Rossegger sowie MarEn<br />
Schön und dem Verein „bims e.V.“. Weil wir jetzt in Schwung<br />
sind, bedanken wir uns auch gleich gegenseiEg: Danke<br />
MarEn, danke Sandra für die gute Laune bis zum Schluss!<br />
Und schließlich: Einen lieben Dank bei unseren großarEgen<br />
Kindern, die uns voll Tatendrang unterstützten – ob es Filme<br />
drehen, BuKons gestalten, WerbemiKel bekleben oder<br />
Cartoon zeichnen war, oder sie uns auch einfach von der<br />
vielen Arbeit ablenkten: Ihr seid großarEg und wir haben<br />
Euch sehr, sehr lieb!
In Kenntnis pädagogischer Prinzipien, nämlich,<br />
dass man gemeinsames Lernen und Arbeiten auch<br />
feiern muss, hat der Verein bims e.V. zu Sylvester<br />
2010 auch im Namen von L3T eine Flash-Party<br />
steigen lassen und wir hoffen, dass sich auch viele<br />
beim Live-Stellen der Online-Ausgabe zum Mitfeiern<br />
finden.<br />
9. Danke, danke, danke!<br />
Natürlich muss so ein Projekt, das im Verlauf ständig<br />
wuchs und größere Ausmaße als geplant annahm,<br />
von zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern<br />
mitgetragen und unterstützt werden. Wir möchten<br />
versuchen alle Beteiligten namentlich zu nennen und<br />
entschuldigen uns bei allen, die wir dann doch im<br />
Eifer des Gefechts übersehen haben. Es ist schwierig,<br />
bei ungefähr 200 Mitwirkenden den Überblick zu<br />
behalten (siehe Box „Dankeschön!“).<br />
10. Und so geht es weiter<br />
L3T war zu Beginn der ambitionierte Versuch, etwas<br />
Neues und Anderes zu schaffen: ein frei zugängliches,<br />
interdisziplinäres Lehrbuch, (auch) mit neuen<br />
Theorien und Werkzeugen, geschaffen von der<br />
„Community“. Daraus geworden ist ein großes<br />
Projekt mit einer beeindruckenden Zahl von Beteiligten,<br />
mit großem Engagement auf allen Seiten und<br />
viel Begeisterung aller Mitwirkenden.<br />
Natürlich muss es weitergehen, müssen auch die<br />
Kapitel verbessert und erneuert werden und müssen<br />
auch Artikel ergänzt werden. Trotzdem sehen wir<br />
auch nach der ersten L3T-Runde, dass hierzu nicht<br />
nur viel (private) Zeit notwendig ist, sondern, um es<br />
Einleitung. Zum Lehrbuch und dem etwas anderen Lehrbuchprojekt— 7<br />
nachhaltig gestalten zu können, auch finanzielle<br />
Grundlagen geschaffen werden müssen. Auch ist es<br />
uns ein Anliegen, den Beteiligten ein Exemplar des<br />
Buches kostenfrei oder wenigstens kostengünstiger<br />
zugänglich zu machen.<br />
In den folgenden Monaten werden wir daher versuchen,<br />
durch Patenschaften für Kapitel der<br />
Online-Ausgabe entsprechende Einnahmen zu erwirtschaften,<br />
die für laufende Ausgaben und die mittelfristige<br />
Ko-Finanzierung zukünftiger Ausgaben<br />
notwendig sind. Es wird trotzdem großes ehrenamtliches<br />
Engagement und institutioneller Unterstützung,<br />
beispielsweise durch die Arbeitgeber der<br />
Beteiligten, notwendig sein, hier Ressourcen zu<br />
sammeln um L3T in einer neuen Auflage zu veröffentlichen.<br />
Bis dahin gibt es jedoch allerhand zu tun, und zum<br />
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einleitung<br />
wissen wir selbst noch nicht im Detail, was alles im<br />
Bezug auf L3T passieren wird. Vor einem Jahr hatten<br />
wir die Idee, ein Lehrbuch zu initiieren ja noch nicht<br />
einmal ausgesprochen – wie sollen wir jetzt wissen,<br />
was in den nächsten drei Jahren passiert!<br />
11. Ach ja: Nobody is perfect<br />
… oder, auf Deutsch: Es ist noch keine Meisterin,<br />
kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist unser<br />
erstes Lehrbuch und unser bisher größtes Projekt –<br />
was die Zahl der Mitwirkenden, nicht das Budget betrifft.<br />
Fehler bitten wir zu verzeihen und uns zu<br />
melden, danke!<br />
Die Herausgeber (info@l3t.eu)
MarBn Ebner, Sandra Schön und Walther Nagler<br />
<strong>Einführung</strong><br />
Das Themenfeld „Lernen und Lehren mit Technologien“<br />
Dieser Beitrag stellt einen ersten EinsBeg in das Themengebiet des Lernens und Lehrens mit Technologien<br />
dar. Was wird eigentlich darunter verstanden? Als zentrale Begriffe werden das technologiegestützte<br />
Lernen und Lehren (engl. „technology-‐enhanced learning“), E-‐Learning sowie das Lernen mit neuen<br />
Medien erklärt. Auch wird in die pädagogischen Grundbegriffe aus dem Bereich des Lernens und Lehrens<br />
sowie in Lerntechnologien eingeführt. Weil das Themen-‐ und Forschungsfeld des technologiegestützten<br />
Lernens und Lehrens interdisziplinär ist, werden die wichBgsten Zugänge vorgestellt. Die zunehmende Zahl<br />
an Lehrstühlen, Forschungseinrichtungen und Studiengängen werden als Indizien für eine Konsolidierung<br />
des Themenfelds als Forschungsgebiet interpreBert. Die gebotene Kürze verhindert eine ausführliche Dis-‐<br />
kussion, insbesondere der Grundbegriffe. Deshalb möchten wir darauf hinweisen, dass wir hier nur ausge-‐<br />
wählte Zugänge und Meinungen präsenBeren können.<br />
Quelle: Ralf Appelt,<br />
URL: hDp://www.flickr.com/photos/adesigna/2946164861/ [2011-‐01-‐10]<br />
Jetzt Pate werden!<br />
#grundlagen<br />
#einfuehrung<br />
#forschungsfeld<br />
Version vom 1. Februar 2011<br />
Für dieses Kapitel wird noch ein Pate gesucht,<br />
mehr InformaBonen unter: hDp://l3t.eu/patenschaG
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Einleitung: Lernen und Lehren mit Technologien<br />
Es gibt einige deutschsprachige Sammelwerke und<br />
Handbücher, die sich mit technologiegestütztem<br />
Lernen und Lehren beschäftigen: Das sind teils <strong>Einführung</strong>en<br />
zum Online-Lernen (Issing & Klimsa,<br />
2008), Handbücher zum E-Learning (Hohenstein &<br />
Wilbers, 2002 mit laufenden Aktualisierungen), aber<br />
auch Bücher für Praktiker/innen mit Titeln wie zum<br />
Beispiel „Innovative Lernsysteme“ (Kuhlmann &<br />
Sauter, 2008). Für Fachfremde nicht unmittelbar als<br />
Veröffentlichung in diesem Bereich erkennbar sind<br />
Bücher mit Titeln wie zum Beispiel das „CSCL-Kompendium“<br />
(Haake et al., 2004). Allen diesen Werken<br />
gemeinsam ist, dass sie unterschiedliche Aspekte des<br />
Lernens und Lehrens mit Technologien behandeln.<br />
Dieses Lehrbuch stellt das Unterfangen dar, das<br />
Themenfeld als Lerntexte für Studierende aufzubereiten.<br />
Wir haben dazu den Titel „Lehrbuch für<br />
Lernen und Lehren mit Technologien“ gewählt.<br />
Nun fällt die Entscheidung des Titels eines<br />
solchen Werkes nicht ad hoc. Genau genommen,<br />
geht es weniger um sogenannte „Technologien“,<br />
worunter die „Wissenschaft zur Technik“ verstanden<br />
wird, sondern um Technik, also technische Geräte,<br />
vor allem um elektronische (und heute primär auch<br />
digitale) Geräte und Hilfsmittel. Wir hatten auch in<br />
Erwägung gezogen, im Lehrbuchtitel von „Technik“<br />
zu sprechen. Im Themenfeld hat sich jedoch im<br />
deutschsprachigen Raum die Bezeichnung „Technologien“<br />
durchgesetzt: Die englische Sprache dominiert<br />
hier die wissenschaftliche Kommunikation und<br />
kennt keine Unterscheidung zwischen „Technik“ und<br />
„Technologie“. In der internationalen, englischsprachigen<br />
Diskussion ist von „technologies“ die Rede.<br />
Auch im Deutschen spricht man heute selten vom –<br />
eigentlich korrekten – Lernen und Lehren mit<br />
Technik, sondern vom Lernen und Lehren mit Technologien.<br />
?<br />
Bevor Sie weiterlesen, haben wir eine BiDe an Sie:<br />
BiDe nehmen Sie sich kurz Zeit und formulieren Sie<br />
schriGlich, an welche Technologien Sie beim Lernen<br />
und Lehren mit Technologien denken.<br />
Die Liste der Technologien, die beim Lernen und<br />
Lehren eingesetzt werden, ist lang und entwickelt sich<br />
ständig weiter. Es ist nicht trivial zu definieren,<br />
welche Technologien Lerntechnologien sind und<br />
welche nicht (Dror, 2008). Unter Lerntechnologien<br />
werden oft primär digitale Geräte und Anwendungen<br />
verstanden, welche zur Unterstützung des Lernens<br />
und Lehrens eingesetzt werden (Chan et al., 2006).<br />
Dazu zählen beispielsweise:<br />
▸ Präsentationstechnologien wie der Tageslichtprojektor<br />
oder Diaprojektor,<br />
▸ Kommunikationstechnologien wie Telefone oder<br />
Faxgeräte,<br />
▸ Computertechnologien wie der Personal Computer<br />
und Laptops,<br />
▸ Internettechnologien wie E-Mail und das World<br />
Wide Web sowie auch<br />
▸ Sensortechnologien wie RFID oder GPS bei Mobiltelefonen.<br />
!<br />
Lernen und Lehren mit Technologien umfasst alle<br />
Lern-‐ und Lehrprozesse sowie -‐handlungen, bei denen<br />
technische, vor allem elektronische (zumeist auch di-‐<br />
gitale) Geräte und Anwendungen verwendet werden.<br />
Ein besonderes, aber nicht ausschließliches Au-‐<br />
genmerk liegt dabei auf Anwendungen und Geräte der<br />
InformaBons-‐ und KommunikaBonstechnologien.<br />
2. Grundbegriffe im Themenfeld<br />
Was bedeuten Begriffe wie „technologiegestütztes<br />
Lernen“, „E-Learning“ oder „Lernen mit neuen<br />
Medien“? Erwartungsgemäß werden die zahlreichen<br />
Begriffe im Themenfeld variantenreich eingesetzt,<br />
dennoch entwickelte sich hier in den letzten zwanzig<br />
Jahren ein gewisser Konsens in der Verwendung der<br />
Begriffe und welche Technologien dabei im Einsatz<br />
sind.<br />
Der Begriff „Technologiegestütztes Lernen“ bzw. „Tech-‐<br />
nology-‐Enhanced Learning“<br />
Der Begriff des „Technology-Enhanced Learning“<br />
beziehungsweise des „technologiegestützten<br />
Lernens“ (oder „technologisch gestützten Lernens“)<br />
ist der Begriff, welcher die weiteste Spanne von Technologien<br />
umfasst, mit deren Hilfe Aktivitäten des<br />
Lernens unterstützt werden. Immer, wenn in einer<br />
Lern- oder Lehrsituation Technologien zum Einsatz<br />
kommen, kann vom technologiegestützten oder technologisch<br />
gestützten Lernen gesprochen werden<br />
(Dror, 2008). Dies ist beispielsweise also auch dann<br />
der Fall, wenn im Unterricht ein Film gezeigt wird<br />
oder ein Schulkind eine Klassenkameradin anruft, um<br />
Unterstützung bei der Hausaufgabe zu erhalten.<br />
Der Begriff „E-‐Learning“<br />
Der Begriff „E-Learning“ ist im Englischen wie im<br />
Deutschen geläufig. Das „E“ steht dabei, wie auch<br />
bei der „E-Mail“ als Abkürzung des Wortes „electronic“,<br />
also „elektronisch“. Wenn Forscher/innen
und Praktiker/innen aus dem Bereich des technologiegestützten<br />
Lernens von ihrem Arbeitsfeld berichten,<br />
fällt häufig das Schlagwort „E-Learning“.<br />
Darunter wird jedoch nicht unbedingt Einheitliches<br />
verstanden.<br />
Das erste Mal fiel der Begriff „E-Learning“ vermutlich<br />
mit der <strong>Einführung</strong> von ersten Computeranwendungen<br />
die Lernende unterstützten, beispielsweise<br />
Wortschatztrainer. Diese ersten Computerlernprogramme<br />
(engl. „computer based training“, CBT)<br />
erlaubten keine Interaktion mit anderen Lernenden<br />
oder Lehrenden. Mit der <strong>Einführung</strong> des Internets<br />
und später des World Wide Webs wurden die Möglichkeiten<br />
eines weltweiten Zugangs zu solchen Angeboten<br />
genutzt sowie auch die Interaktion und der<br />
Austausch mit anderen Benutzer/innen gefördert:<br />
Während zunächst Selbstlernmaterialien im Vordergrund<br />
standen, entwickelten sich schnell interaktive<br />
Formate, wie beispielsweise virtuelle Seminare, also<br />
Lehrveranstaltungen, die im Wesentlichen auf dem<br />
textbasierten Austausch der Teilnehmer/innen beruhten.<br />
!<br />
Der Begriff des E-‐Learning wird häufig dann ver-‐<br />
wendet, wenn Computer in Netzwerken (insbe-‐<br />
sondere des Internets) zum Einsatz kommen und<br />
diese Technologien die technische Basis für die Lern-‐<br />
und Lehrhandlungen bilden.<br />
So wird der Begriff E-Learning von einigen für<br />
das weite Feld von elektronischen Anwendungen, sei<br />
es das Telefon, der Videoprojektor, bis hin zum Internet<br />
verstanden; es deckt damit weitestgehend das<br />
Feld wie der obige Begriff des technologiegestützten<br />
Lernens ab (Kerres, 2001).<br />
Häufiger wird der Begriff „E-Learning“ aber<br />
enger verwendet, nämlich für Lernsituationen bei<br />
denen mit dem Computer und dem Internet gelernt<br />
wird. Wird von „E-Learning“ gesprochen, beschränkt<br />
sich das Verständnis häufig auf Lern- und Lehrsituationen<br />
des Fernunterrichts und des verteilten Lernens<br />
im Internet oder mit anderen vernetzten Geräten wie<br />
den Mobiltelefonen.<br />
Lernen mit neuen Medien<br />
Schließlich möchten wir in unserem Zusammenhang<br />
noch auf einen dritten Begriff eingehen; auf das<br />
Lernen und Lehren mit „neuen Medien“. „Medium“,<br />
aus dem Lateinischen abgeleitet, bedeutet „in der<br />
Mitte“ oder „Mittler“. Wenn also die Medienpädagogik<br />
oder die Medieninformatik über Medien<br />
spricht, dann sind Kanäle oder Systeme gemeint,<br />
über die Daten oder Informationen gespeichert,<br />
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 3<br />
übertragen oder vermittelt werden. Beispiele für<br />
Medien sind Massenmedien wie das Fernsehen oder<br />
das Radio sowie die traditionellen Printmedien wie<br />
Zeitungen und Bücher. Diese Medien sind das traditionelle<br />
Arbeitsgebiet der Medienpädagogik (siehe<br />
Kapitel #medienpaedagogik). Wenn von „neuen“<br />
Medien die Sprache ist, wird derzeit in der Regel auf<br />
das Internet und Webtechnologien Bezug genommen.<br />
Mit den Medienwissenschaften gibt es<br />
einen eigenen Zugang mit zahlreichen unterschiedlichen<br />
theoretischen Postionen, wie diese neuen<br />
Medien Gesellschaft gestalten und wie die Gesellschaft<br />
Medien gestaltet (siehe Kapitel #medientheorie).<br />
Für die Medieninformatik ist die Sicht auf Medien<br />
übrigens nicht auf Massenmedien eingeschränkt<br />
(Malaka et al, 2009): Aus dieser Sicht sind zum Beispiel<br />
Speichermedien wie die Festplatte des PC oder<br />
der USB-Stick ebenfalls anzuführen.<br />
Vergleich der Begriffe<br />
Wir haben versucht, die jeweiligen Technologien, die<br />
bei Verwendung der drei vorgestellten Begriffe „mitgedacht“<br />
werden, in Abbildung 1 zu visualisieren.<br />
Das Verständnis der Begriffe ist jedoch nicht einheitlich.<br />
Abbildung 1: Begrifflichkeiten und von welchen<br />
Technologien dann (meistens) gesprochen wird<br />
?<br />
Deckt sich Ihr, bei der obigen Frage formuliertes, Ver-‐<br />
ständnis vom Lernen und Lehren mit Technologien mit<br />
einem der drei Begriffe und deren Bezugstechno-‐<br />
logien? Worin gibt es ÜbereinsBmmungen, wo weicht<br />
Ihre DefiniBon ab?
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Zusätzlich gibt es eine Reihe enger gefasster, also<br />
auf einige Technologien beschränkte Begriffe des<br />
technologiegestützten Lernens, wie beispielsweise das<br />
mobile Lernen mit Mobiltelefonen und anderen<br />
portablen Geräten (engl. „mobile learning“;<br />
m-Learning; siehe Kapitel #mobil) oder auch das<br />
Online-Lernen für das internet- bzw. intranetgestützte<br />
Fernlernen (siehe Kapitel #fernunterricht).<br />
Auch gibt es Begriffe technologiegestützten<br />
Lernens, die nicht auf die Nutzung ausgewählter<br />
Technologien hinweisen. Vielfach wird im Bereich<br />
des technologiegestützten Lernens auf bestimmte<br />
Methoden abgezielt. So steht CSCL für das computergestützte<br />
kooperative Lernen (engl. „computer<br />
supported collaborative learning“). Damit haben wir<br />
auch aufgeklärt, worum es sich beim einführend erwähnten<br />
„CSCL-Kompendium“ handelt. Oder hatten<br />
Sie das gewusst?<br />
3. Lernen und Lehren<br />
Wir haben es bisher gewissermaßen vorausgesetzt,<br />
aber was ist das eigentlich, das „Lernen“ und das<br />
„Lehren“? Was wird darunter aus wissenschaftlicher<br />
Perspektive verstanden?<br />
Lernen: umfassend und lebenslang<br />
Erklärungen und Theorien zum Lernen werden vor<br />
allem in der Psychologie entwickelt und überprüft.<br />
Lernen wird dabei als eine Veränderung im Verhalten<br />
beschrieben. Aus Sicht der Psychologie ist das Lernen<br />
ein Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im<br />
Verhalten oder im Verhaltenspotenzial führt und auf<br />
Erfahrung aufbaut, aber beispielsweise nicht auf Reifevorgänge<br />
oder Ermüdungen zurückzuführen ist<br />
(Zimbardo & Gerrig, 1996, 206). Was gelernt wurde,<br />
ob es eine Verbesserung oder Verschlechterung des<br />
Verhaltens gibt, spielt dabei nach diesem Verständnis<br />
keine Rolle (Schaub & Zenke, 2004, 352): Veränderung<br />
kann dabei das Erlernen aber auch Verlernen<br />
beziehungsweise die Anpassung oder Fehlanpassung<br />
bedeuten. Menschen „lernen“ in diesem Sinne zum<br />
Beispiel durch Werbung möglicherweise ein anderes<br />
Kaufverhalten.<br />
Beim technologiegestützten Lernen geht es jedoch<br />
in aller Regel nicht um „irgendein“ Lernen oder irgendeine<br />
Verhaltensänderung, sondern um konkrete<br />
Verbesserungen des Wissens, des Verhaltens und der<br />
Kompetenzen. Lernen soll hier dazu führen, sich<br />
bestmöglich zu entwickeln (Faulstich, 2005, 14). Normative<br />
Überlegungen spielen auch beim technologiegestützten<br />
Lernen eine wichtige Rolle: Was sollen<br />
die Lerner/innen, also Schüler/innen, Student/innen<br />
oder Arbeitnehmer/innen, lernen? In Bildungspro-<br />
grammen und Lehrplänen werden so konkrete Erziehungs-<br />
und Bildungsziele oder auch angestrebte<br />
„Schlüsselqualifikationen“ und Kompetenzen genannt<br />
(Tippelt & Schmidt, 2005).<br />
!<br />
Beim technologiegestützten Lernen werden AkBvi-‐<br />
täten von Lernenden unterstützt, die in einer Verbes-‐<br />
serung des Verhaltens (des Wissens, der Kompe-‐<br />
tenzen) resulBeren.<br />
In den letzten zehn Jahren wird häufig auf das sogenannte<br />
„informelle Lernen“ verwiesen. Es grenzt<br />
sich vom sogenannten „formalen Lernen“, also dem<br />
institutionell organisierten Lernen ab und wird in der<br />
Regel für den gesamten Bereich des „nicht institutionell<br />
organisierten“ Lernens verwendet (Frank et<br />
al., 2005). Es gibt dabei jedoch auch hier eine Reihe<br />
unterschiedlicher Definitionen mit feinsinnigen Unterscheidungen<br />
(Dohmen, 2001). Im englischsprachigen<br />
Raum, maßgeblich durch ein Memorandum<br />
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft<br />
(2000) bestärkt, ist sogar eine dreiteilige Unterscheidung<br />
gängig: „formal learning“, „non-formal<br />
learning“ und „informal learning“ (ebenda, S. 9).<br />
Nach diesem Verständnis wird unter „informellem<br />
Lernen“ das Lernen als „natürliche Begleiterscheinung<br />
des täglichen Lebens“ verstanden, unter<br />
„non-formalem Lernen“ vor allem selbstgesteuertes<br />
Lernen (ebenda).<br />
Ein weiterer zentraler Lernbegriff in der Diskussion<br />
des technologiegestützten Lernens ist das sogenannte<br />
lebenslange Lernen (engl. „lifelong<br />
learning“). Darunter versteht man nicht die Einsicht,<br />
dass man lebenslang lernt, sondern die Aufforderung,<br />
dass man das ganze Leben lang lernen soll (Smith,<br />
1996). Der Ausdruck „lifelong learning“ soll erstmals<br />
in dem von der so genannten „Faure-Kommission“<br />
im Auftrag der UNESCO verfasstem Buch „Learning<br />
to be“ (Faure et al., 1972) verwendet worden sein<br />
(Knapper, 2001, 130). Auch hier ist die Kommission<br />
der Europäischen Gemeinschaft ein Treiber der Diskussion.<br />
Sie betonte in ihrem Memorandum im Jahr<br />
2000, dass lebenslanges Lernen nicht nur über die<br />
zeitliche Lebensspanne der Menschen andauern,<br />
sondern gleichzeitig auch lebensumspannend sein soll<br />
(Europäische Kommission, 2000, 9) und initiierte ein<br />
gleichnamiges Forschungsprogramm („lifelong<br />
learning programme“).<br />
Lehren: Unterricht und DidakJk<br />
Bei denjenigen, die andere beim Lernen unterstützen,<br />
spricht man von Lehrenden und Unterrichtenden.
Lehrende gibt es in allen Bildungsbereichen, beispielsweise<br />
Kindergärtner/innen, Lehrer/innen, Ausbilder/innen<br />
in Betrieben und Berufsschulen sowie<br />
auch in großer Zahl in der Erwachsenenbildung. Lehrende<br />
werden dann dort auch als Coach, Trainer/in,<br />
Tutor/in, Dozent/in manchmal auch als Berater/in<br />
bezeichnet.<br />
Was gute Lehre, guten Unterricht ausmacht ist Gegenstand<br />
der Didaktik. Unterschiedliche Traditionen<br />
konkurrieren hier ebenso wie auch begriffliche Abgrenzungen.<br />
So hat Comenius im 17. Jahrhundert<br />
den Begriff „Didaktik“ in Abgrenzung zur „Mathetik“,<br />
der Lehre des Lernens verstanden (Comenius,<br />
1657). Heute wird Didaktik nach Klafki als<br />
eher theoretische Begründung des konkreten pädagogischen<br />
Handelns, des Wissens über das „wie?“, kurz<br />
zur „Methodik“ gesehen (Klafki, 1991).<br />
Was gute Lehre ist, wird von unterschiedlichen<br />
Teildisziplinen und Richtungen unterschiedlich beantwortet.<br />
So werden didaktische Empfehlungen<br />
häufig auf (einzelnen) Lerntheorien und entsprechenden<br />
Erkenntnissen der pädagogischen Psychologie<br />
aufgebaut (siehe Kapitel #lerntheorie). Aber<br />
auch aus bildungstheoretischen Überlegungen, die<br />
den Menschen „als Ganzes“ in seiner Persönlichkeit<br />
begreifen und ihn bei seiner Entwicklung seiner Persönlichkeit<br />
unterstützen wollen, werden Ableitungen<br />
für guten Unterricht erstellt.<br />
Technologien im Unterricht wirken sich auf die<br />
Methodik wie die Didaktik aus. Bei der Methode<br />
„Frontalunterricht“ konnten so, ergänzend zum Tafelbild<br />
und Kartenmaterial, beispielsweise durch Diaprojektoren<br />
Fotos im Unterricht vorgeführt werden.<br />
Mit zunehmender Integration von Technologien wie<br />
dem computer- und webgestützten Lernen, können<br />
Technologien nicht mehr nur „als Ergänzung“ betrachtet<br />
werden, sondern werden mit ihren Gestaltungs-<br />
und Einsatzmöglichkeiten ein wichtiges<br />
Element didaktischer und methodischer Überlegungen<br />
sowie Entscheidungen. Beispielsweise eröffnen<br />
sie Spielräume für differenzierten, also auf<br />
unterschiedliche Bedürfnisse der Lernenden abgestimmten,<br />
Unterricht oder auch für neue Formen der<br />
Zusammenarbeit: Das gleichzeitige gemeinsame<br />
Schreiben eines Textes ist auf herkömmliche Weise,<br />
auf dem Papier, kaum möglich.<br />
4. Szenarien des Einsatzes von Technologien<br />
Ein kurzer Rückblick<br />
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Technologien<br />
Unterrichtsmittel, die den Lehrenden im Fern- und<br />
Präsenzunterricht entlasten und ersetzen sollten. Mit<br />
dem sogenannten „programmierten Lernen“<br />
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 5<br />
wurden „Lernmaschinen“ entwickelt, die den Lehrer<br />
unterstützten sollten. In einer damaligen Darstellung<br />
heißt es dazu (Wilden, 1965, 98): „Lehrermangel und<br />
überaltete Lernformen scheinen der Forderung recht<br />
zu geben, wenigstens die Übungs- und Wiederholungsvorgänge<br />
Maschinen zu überlassen, die den didaktischen<br />
Gesamtvorgang in Einzelschritte zerlegen<br />
[…] Ein Lernprogramm führt auch bei Versagen des<br />
Schülers mit Hilfe mechanischer Vorgänge und Auslösungen<br />
zu erneuter Übung und Erfassung von Teilvorgängen,<br />
schließlich zum Lernerfolg“. In den<br />
letzten Jahrzehnten hat sich durch die Computerund<br />
Internettechnologie und die damit verbundenen<br />
Kommunikationsformen vieles getan. So gibt es weiterhin<br />
eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten, die Lehrende<br />
entlasten. Ein wesentliches Merkmal webbasierter<br />
Anwendungen sind aber nun Kommunikation<br />
und Kollaboration. Die entsprechenden Anwendungen<br />
eröffnen dadurch für Lernende und Lehrende<br />
vor allem solche neuen Kommunikationswege.<br />
?<br />
Sie haben bereits auf vielfälBge Weise gelernt und<br />
waren eventuell auch als Lehrende/r im Einsatz.<br />
Sammeln Sie für sich oder in der Gruppe einige Bei-‐<br />
spiele, wie dabei Technologien eingesetzt wurden.<br />
Online-‐Lernen und Blended Learning<br />
Heute gibt es zahlreiche unterschiedliche Formen des<br />
Einsatzes von Technologien im Unterricht. In reinen<br />
Online-Lernsituationen werden zum Beispiel Lernmaterialien<br />
im Internet zur Verfügung gestellt, in Diskussionsforen<br />
mit anderen gelernt oder E-Mails mit<br />
Tutorinnen und Tutoren ausgetauscht. Der einzelne<br />
Lernende sitzt dabei also alleine am Computer oder<br />
einem anderen „Endgerät“, lernt aber nicht notwendigerweise<br />
isoliert, sondern im intensiven Austausch<br />
mit anderen Lernenden und Lehrenden. Im Vergleich<br />
zu Präsenzveranstaltungen ermöglicht reines Online-<br />
Lernen außerhalb der üblichen Seminarzeiten und zu<br />
eigens festgelegten Zeiten zu lernen. Gleichzeitig<br />
aber fordert der, im Vergleich zum Präsenzunterricht,<br />
unverbindliche Charakter einer solchen Lernsituation<br />
große Motivation und Selbstdisziplin seitens der<br />
Lerner/innen. Manchmal werden durch das Lernen<br />
über das World Wide Web auch Szenarien möglich,<br />
die mit realen Treffen nicht zu organisieren und zu finanzieren<br />
wären: Online-Veranstaltungen mit Teilnehmenden<br />
aus der ganzen Welt, zum Beispiel Muttersprachler/innen,<br />
die auf einer Sprachlernplattform<br />
Unterstützung geben.<br />
In der Praxis werden Online-Phasen und Präsenzunterricht<br />
häufig kombiniert beziehungsweise abgewechselt.<br />
Man spricht dann vom „Blended
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Learning“ (auf deutsch „gemischtes Lernen“). Blended-Learning-Szenarien<br />
werden aus unterschiedlichen<br />
Motiven eingesetzt. Den Präsenzunterricht ergänzende<br />
Online-Phasen werden als Möglichkeit gesehen,<br />
das individuelle, selbstorganisierte und arbeitsplatznahe<br />
Lernen zu begleiten und zu unterstützen.<br />
Auch wird durch Online-Phasen das Lernen aus dem<br />
Seminarraum in die Arbeits- und Lebenswelt der Lernenden<br />
hinausgetragen; der Transfer des Gelernten<br />
gelingt unter Umständen leichter. Schlussendlich wird<br />
Online-Unterricht auch eingesetzt, um oft teureren<br />
Präsenzunterricht zu sparen.<br />
Zahlreiche Mischformen: Die Barbecue-‐Typologie<br />
Im Bildungsalltag gibt es nicht immer und ausschließlich<br />
reine Präsenzphasen ohne Technologieeinsatz<br />
oder reine Online-Phasen. Technologien,<br />
insbesondere webbasierte Werkzeuge und<br />
Systeme werden auch im Präsenzunterricht eingesetzt,<br />
zum Beispiel wenn mit dem Internet recherchiert<br />
wird. Auch werden in Schulen und insbesondere<br />
Hochschulen häufig webbasierte Lernmanagementsysteme<br />
eingesetzt (siehe Kapitel #systeme,<br />
#infosysteme #schule #hochschule). Lernende erhalten<br />
dort ergänzende Materialien, zum Beispiel Präsentationsunterlagen,<br />
führen dort unterrichtsbegleitende<br />
Diskussionen oder finden dort Lernaufgaben,<br />
deren Lösungen wiederum über das System den Lehrenden<br />
zugänglich gemacht werden.<br />
Vielfältige Lernsituationen mit Technologien sind<br />
bekannt, ohne dass sich dafür Bezeichnungen durchgesetzt<br />
haben. Wir haben versucht, ein geeignetes<br />
Bild zu finden um die unterschiedlichen Formen anschaulich<br />
zu beschreiben. Mit einem Augenzwinkern<br />
machen wir uns das Bild der Grillwurst und ihrer unterschiedlichen<br />
Zubereitungsformen zu eigen und<br />
nennen die Darstellung folglich Barbecue-Typologie<br />
des Lernen und Lehrens mit Technologien:<br />
▸ Wie in Abbildung 2 dargestellt, wird der traditionelle,<br />
„technologiefreie“ Präsenzunterricht mit<br />
einer Bratwurst verglichen. Manche mögen sie pur.<br />
▸ Präsenzunterricht kann durch den Einsatz von<br />
Technologien angereichert werden. Bildlich dargestellt<br />
durch Senf- oder Ketchup-Kleckse.<br />
▸ In Schulen und Hochschulen wird der Präsenzunterricht<br />
durch die Lernmanagementsysteme kontinuierlich<br />
begleitet sowie durch weiteren Technologieeinsatz<br />
erweitert. Im Bild wird die Bratwurst,<br />
der pure Präsenzunterricht, von einem Brötchen<br />
umgeben und in Senf beziehungsweise Ketchup<br />
gebettet. Es ergibt sich ein Hot Dog.<br />
▸ Wechseln sich Phasen des Online-Lernens mit<br />
Präsenzphasen ab (das „Blended Learning“), lässt<br />
sich das mit einem Schaschlik-Spieß visualisieren,<br />
auf den sich Wurstscheiben (Präsenzphasen) mit<br />
Gemüse (Online-Phasen) abwechseln.<br />
▸ Und weil es auch Arrangements ohne Präsenzunterricht<br />
gibt, also bildlich gesprochen, keine Wurst<br />
vorhanden ist, wird reines Online-Lernen schlussendlich<br />
mit einem Gemüsespieß dargestellt.<br />
Wie beim Grillen sind schließlich beim Einsatz von<br />
Technologien weitere zahlreiche Kombinationen<br />
möglich. Die einzelnen Möglichkeiten sind dabei<br />
ohne Wertigkeit zu sehen; die Entscheidung was gut<br />
passt und besser schmeckt, ist den Lernenden und<br />
Lehrenden zu überlassen.<br />
!<br />
Abbildung 2: Barbecue-‐Typologie<br />
Allgemein gibt es keine „guten“ oder „besseren“<br />
Formen des Technologieeinsatzes und des Wechsels<br />
von Online-‐ und Präsenzphasen. Die Entscheidung<br />
was gut passt und besser schmeckt, ist den Lernenden<br />
und Lehrenden zu überlassen.
5. Aktuell in der Diskussion: „E-‐Learning 2.0“<br />
Ein Schlagwort, um welches man zum Zeitpunkt der<br />
Veröffentlichung des Lehrbuchs nicht herumkommt,<br />
auch wenn es langsam an Resonanz verliert, ist der<br />
Begriff „Web 2.0“. Das Web 2.0 hat das Lernen und<br />
die Vorstellung darüber wie gelernt werden kann,<br />
stark beeinflusst und beflügelt.<br />
Web 2.0<br />
Der Begriff „Web 2.0“ soll auf Scott Dietzen, einem<br />
ehemaligen Mitarbeiter bei Bea Systems, zurückgehen<br />
und wurde erstmalig im Dezember 2003 in der US-<br />
Ausgabe „Fast Forward 2010 – The Fate of IT“ des<br />
CIO-Magazins von Eric Knorr in der Öffentlichkeit<br />
verwendet (Knorr, 2003). Mit der ersten Web-2.0-<br />
Konferenz im Herbst 2004 in San Francisco, veranstaltet<br />
von Tim O'Reilly (gemeinsam mit Dale<br />
Dougherty), erlangte der Begriff den internationalen<br />
Durchbruch. 2005 wird er in einem Artikel auch von<br />
O´Reilly (2005) benannt. Er definierte das Web 2.0<br />
dabei nicht als eine „neue Technologie“ sondern eine<br />
neue Art, eine neue Haltung (engl. „attitude“), wie<br />
Benutzer/innen mit dem Internet umgehen. Internetnutzer/innen<br />
sind nicht mehr bloß Leser/innen statischer<br />
Webseiten, sondern können diese oftmals modifizieren,<br />
ohne dass hierzu Kenntnisse von zusätzlichen<br />
Programmiersprachen nötig wären. Zu Beginn<br />
des World Wide Web kam man nicht herum, die<br />
dafür notwendigen HTML-Kenntnisse zu erlernen<br />
(siehe Kapitel #hypertext, #fernunterricht). Die Weiterentwicklung<br />
von Internettechnologien und entsprechend<br />
einfachen Benutzeroberflächen macht es<br />
nun vergleichsweise einfach, sich zu beteiligen: Selbsterstellte<br />
Mediendateien wie Fotografien oder Tonaufnahmen<br />
können unter anderem über gemeinsame<br />
Plattformen im Internet zur Verfügung gestellt<br />
werden; man tauscht sich mit Schulkameraden und<br />
Kolleginnen in sozialen Netzwerken aus.<br />
Die für die Entwicklung notwendigen Internettechnologien<br />
(siehe Kapitel #webtech) traten bei der<br />
Debatte über „Web 2.0“ per Definition (O'Reilly,<br />
2005) in den Hintergrund. Dies erklärt auch, dass<br />
man beim Versuch das Web 2.0 an einzelnen Entwicklungen<br />
dingfest zu machen, unweigerlich auf ein<br />
anwachsendes Sammelsurium an Möglichkeiten stößt,<br />
denen allen aber gemeinsam ist, dass der Fokus auf<br />
Interaktion (Kommunikation, Arbeiten, Teilen) der<br />
Benutzenden liegt, unabhängig von einzelnen Programmiersprachen<br />
und Plattformen.<br />
Das Web der Inhaltskonsumenten wurde zu einem<br />
Web von miteinander kommunizierenden Inhaltsproduzenten.<br />
Weil nun jede/r (relativ) einfach mitge-<br />
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 7<br />
stalten und mitmachen kann, wird es auch gerne als<br />
„Mitmach-Web“ bezeichnet. Gerade diese Vereinfachung<br />
und Potenzierung des Gemeinschaftlichen unterstreicht<br />
die Bezeichnung des Web 2.0 als „soziale“<br />
und weniger „technische Revolution“ (Downes,<br />
2005). Man spricht darüberhinaus auch von der kollektiven<br />
Intelligenz (O'Reilly, 2005), von der Weisheit<br />
der Vielen (Surowiecki, 2005) und von der Kultur der<br />
Amateure (Keen, 2007). Das „Times Magazin“ griff<br />
diese Entwicklung frühzeitig auf, indem es im Jahr<br />
2006 „You – the Internet User“ als Person des Jahres<br />
kürte (Grossman, 2006).<br />
!<br />
1989 träumt Tim Berners-‐Lee, der als der bedeutende<br />
Vordenker des World Wide Web gilt, von einem In-‐<br />
ternet, in und über welches jede/r mit jedem/r alles<br />
teilen kann (Berners Lee, 1989); mit dem „Web 2.0“ ist<br />
dieser Traum ein Stück mehr Realität geworden.<br />
Als Basis, oder vielleicht besser Wegbereiter, zur<br />
Web-2.0-Entwicklung greifen wir zwei Aspekte<br />
heraus: einerseits die bereits seit 1995 bestehende<br />
Technologie RSS (Really Simple Syndication; siehe<br />
Kapitel #webtech) und andererseits das erste erfolgreiche<br />
Großprojekt der neuen Zusammenarbeit im<br />
Internet, Wikipedia (siehe Kapitel #kollaboration).<br />
RSS ermöglicht stark simplifiziert eine weitestgehend<br />
automatisierte Verbreitung von Inhalten auf Basis<br />
einer XML-Struktur. Über einen sogenannten RSS-<br />
Feed können Veränderungen auf Webseiten einfach<br />
beobachtet werden. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia<br />
(gegründet im Jahre 2000 durch Jimmy Wales,<br />
aus dem sogenannten Nupedia-Projekt hervorgegangen)<br />
stellte den Beginn des Gesinnungswandels<br />
im Verhalten zum Internet dar; private Personen erklärten<br />
sich freiwillig dazu bereit, ihr Wissen einer<br />
Enzyklopädie zum Gemeinwohl aktiv zur Verfügung<br />
zu stellen. Dies veränderte nachhaltig die Art und<br />
Weise, wie man über das Internet dachte und es auch<br />
verwendete (Ebner et al., 2008). Heute verfügt Wikipedia<br />
zum Beispiel allein in der deutschsprachigen<br />
Version über mehr als 1,1 Millionen Einzelartikel<br />
(Stand Januar 2011) und hat alle vormals bedeutsamen<br />
gedruckten Enzyklopädien vom Markt<br />
überholt.<br />
Trotz der eher „nicht-technischen“ Grundbeschreibung<br />
des Web 2.0 gibt es Typen von Anwendungen,<br />
die als Web-2.0-Anwendungen beschrieben<br />
werden. Wir stellen sie hier kurz vor:<br />
▸ Wikis sind Content-Management-Systeme und<br />
bestehend aus Webseiten, deren Inhalte von mehreren<br />
Benutzer/innen gemeinsam (kollaborativ),<br />
aber nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Kennzeichnend für Wikis sind die integrierte Versionskontrolle<br />
und die Linkkonsistenz. Wikis<br />
werden oft als Wissenskompendien oder als einfaches<br />
Wissensmanagmentsystem eingesetzt (siehe<br />
Kapitel #kollaboration).<br />
▸ Weblogs sind Webseiten mit mehr oder weniger<br />
regelmäßig neu erscheinenden Einträgen, chronologisch<br />
mit dem neuesten beginnend sortiert. Den<br />
Strom an Artikeln eines Weblogs (engl. „stream“)<br />
können Leser/innen kommentieren und durch die<br />
zur Verfügung gestellten permanten Links mit anderen<br />
Webseiten verknüpfen. Microblogging-<br />
Systeme, die nur kurze Nachrichten mit maximal<br />
140 Zeichen unterstützen, allen voran Twitter,<br />
haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen<br />
(siehe Kapitel #blogging).<br />
▸ Podcasts sind Audiodateien und Videos (allgemein<br />
Multimediadaten) die mit Hilfe der RSS-<br />
Technologie abonniert werden können, das heißt<br />
automatisiert an Endgeräte wie dem Computer<br />
oder dem Mobiltelefon übertragen und dort abgespielt<br />
werden können (siehe Kapitel #educast).<br />
▸ Soziale Netzwerke werden Internetplattformen<br />
genannt, welche die Vernetzung der Benutzer/<br />
innen mit alten und neuen Bekannten erlauben<br />
und deren Kommunikation unterstützen, so dass<br />
zum Beispiel auch „Bekannte von Bekannten“<br />
mitlesen können. Zu den populären sozialen Netzwerken<br />
gehören zur Zeit im deutschsprachigen<br />
Raum Facebook, StudiVZ und LinkedIn.<br />
▸ Medienplattformen erlauben schließlich das Veröffentlichen<br />
eigener Multimedia-Dateien im World<br />
Wide Web. Bekannte Plattformen sind dabei für<br />
Videos YouTube.com, für Fotos Flickr.com, für<br />
Präsentationen Slideshare.com und für Links, die<br />
man sich merken möchte, Delicious.com. Auch<br />
gibt es eine Reihe von kollaborativen Anwendungen,<br />
die Benutzenden helfen, miteinander über<br />
das Internet Dateien auszutauschen, online zu bearbeiten<br />
oder einfach zu speichern (siehe Kapitel<br />
#kollaboration, #literatur).<br />
?<br />
Um die rasante Entwicklung und Bedeutung des Web<br />
und des Web 2.0 auf das persönliche Leben zu er-‐<br />
fassen, versuchen Sie eine Chronologie ihrer eigenen<br />
Erfahrungen und Verhaltensweisen in Bezug auf den<br />
Themenkomplex Internet, KommunikaBon und Mobi-‐<br />
lität auf einer Zeitachse nachzuzeichnen. Wann haben<br />
Sie Ihr erstes Mobiltelefon verwendet? Wann waren<br />
Sie das erste Mal im Internet? Seit wann sind Sie Mit-‐<br />
glied in einem sozialen Netzwerk, zum Beispiel Fa-‐<br />
cebook? Wann haben Sie sich dazu entschlossen,<br />
erstmals etwas von ihnen selbst ins Internet zu<br />
stellen?<br />
E-‐Learning 2.0<br />
Die Entwicklungen rund um Web 2.0 und den genannten<br />
Anwendungen haben auch die Diskussion<br />
im technologiegestützten Lernen entfacht: 2005 postulierte<br />
Stephen Downes im eLearn Magazine den<br />
Begriff „E-Learning 2.0“ (Downes, 2005) und beschreibt<br />
dabei, wie sich aus seiner Sicht mit den<br />
Werkzeugen des Web 2.0 das Lernen verändert. Wie<br />
beim Begriff Web 2.0 spielt auch bei E-Learning 2.0<br />
der soziale Aspekt, der aktive und kollaborative<br />
Umgang mit neuen Medien zu Lern- und Lehrzwecken<br />
eine entscheidende Rolle.<br />
E-Learning findet nach Downes (2005) nicht mehr<br />
ausschließlich auf einer eingeschränkt zugänglichen<br />
Lernplattform statt, von der Lernende von Lehrenden<br />
bereitgestellte Unterlagen herunterladen oder<br />
in einem Chat oder Diskussionsforum miteinander<br />
Inhalte diskutieren können. Beim E-Learning 2.0<br />
haben die aktive Erstellung und Nutzung von Wikis,<br />
Weblogs, Podcasts, sozialen Netzwerke und Medienplattformen<br />
Einzug gehalten. Gemeint ist hier also<br />
nicht die Recherche bei Wikipedia, sondern beispielsweise<br />
das gemeinsame Erstellen von Inhalten in<br />
einem Wiki-System (siehe Kapitel #kollaboration).<br />
„E-Learning 2.0“ bezieht sich dabei auch nicht<br />
ausschließlich auf den Einsatz von Web-2.0-Technologien<br />
beim Lernen und Lehren, sondern bezeichnet<br />
auch viele weitere beobachtbare Prozesse und Entwicklungen:<br />
In Online-Gemeinschaften, die sich beispielsweise<br />
in Sozialen-Netzwerk-Systemen wie Facebook<br />
finden, tauscht man sich mit anderen Interessierten<br />
aus, Lernende erstellen selbst Webseiten, Podcasts<br />
oder Videos. Allgemein stehen immer mehr<br />
Lernmaterialien zur freien Verfügung im Netz.<br />
Lernen findet nicht mehr in geschützten Räumen<br />
statt, sondern wird öffentlich, die Lernenden können<br />
(und müssen) größere Selbststeuerung und -organisation<br />
übernehmen und die Rolle der Lehrenden<br />
wandelt sich vom unterrichtenden Experten zur<br />
Lernbegleiterin und zum Lernbegleiter – um nur<br />
einige der genannten Aspekte zu nennen. (Kerres,<br />
2006; Ebner, 2007, Bernhardt & Kirchner, 2007)<br />
Wie vielseitig das Web 2.0 bzw. der Begriff des E-<br />
Learning 2.0 ist, zeigt sich auch an den Themen und<br />
Aspekten dieses Lehrbuchs. Dennoch ist es weiterhin<br />
nur ein Bereich des großen Felds des Einsatzes von<br />
Technologien für das Lernen und Lehren.<br />
!<br />
Der Begriff „E-‐Learning 2.0“ beschränkt sich nicht auf<br />
die Verwendung der Werkzeuge des sogenannten<br />
„Web 2.0“, sondern beinhaltet auch die veränderten<br />
Beteiligungsmöglichkeiten und Auswirkungen für das<br />
Lernen (und Lehren).
6. Ein interdisziplinäres Forschungsfeld<br />
Das technologiegestützte Lernen und Lehren ist ein<br />
junges, interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich zunehmend,<br />
durch entsprechende Forschungseinrichtungen<br />
und Aus- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten,<br />
als eigenständiges Fachgebiet konsolidiert.<br />
Bezugsdisziplinen<br />
Das Fachgebiet wird im Wesentlichen von zwei Disziplinen<br />
stark beeinflusst, der pädagogisch-psychologischen<br />
Forschung und der Informatik.<br />
Die Erziehungswissenschaften und die pädagogische<br />
Psychologie interessieren die Bedingungen<br />
und Erfolge von Lern- und Lehraktivitäten.<br />
Pädagogisch-psychologische Fragestellungen untersuchen<br />
so die Effekte der didaktischen Gestaltung<br />
oder der Voraussetzungen der Lernenden. Ursprünglich<br />
war in der Lehr-/Lern-Forschung die Beschäftigung<br />
mit Technologien und Medien ein Randthema,<br />
sie rückt aber durch die zunehmende Bedeutung der<br />
technologiegestützten Lernformen in das Zentrum<br />
(Kerres et al., 2001). Während die Psychologie<br />
Theorien zum Lernen und Lehren überprüft, in dem<br />
sie Hypothesen formuliert und in Untersuchungen<br />
und Experimenten validiert (oder eben widerlegt), hat<br />
die Pädagogik eher die konkrete Anwendung, die<br />
Nutzung und Gestaltung guter Unterrichtspraxis und<br />
Lernumgebungen sowie deren Evaluierung im Auge.<br />
Bildungstheoretische Erörterungen oder gesellschaftliche<br />
Aspekte, wie sie die allgemeine Pädagogik<br />
behandelt werden dabei im Bereich des technologiegestützten<br />
Lernens eher selten aufgegriffen.<br />
Dies liegt wohl daran, dass der Begriff „Bildung“<br />
und die entsprechende deutschsprachige bildungstheoretische<br />
Diskussion nicht direkt ins Englische zu<br />
übertragen ist: „Bildung“ ist nicht das gleiche wie das<br />
englische „education“. Der Begriff der Bildung wird<br />
in der englischsprachigen internationalen Literatur<br />
zum technologiegestützten Lernen auch nur ausnahmsweise<br />
rezipiert (zum Beispiel bei Friesen,<br />
2009). Die kritisch-emanzipatorische Pädagogik<br />
macht sich aber auch nicht widerspruchslos zum<br />
„Handlanger“ ökonomischer Bedürfnisse und Optimierungen,<br />
wie sie im Zuge der <strong>Einführung</strong> technologiegestützten<br />
Lernens oft zu hören sind (Häcker,<br />
2010). Auch gilt weiterhin: „Was ist eine Schule wert,<br />
von der schon Seneca sagte: Nicht für das Leben,<br />
leider nur für die Schule lernt ihr in der Schule (non<br />
vitae, sed scholae discimus)“ (Begemann, 1997, 152).<br />
Die Informatik, insbesondere der Zweig der Medieninformatik,<br />
entwickelt Systeme, welche die Bedürfnisse<br />
der Beteiligten beim Lernen und Lehren<br />
und den aktuellen technologischen Entwicklungen<br />
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 9<br />
entsprechen. Zuverlässigkeit und Persistenz solcher<br />
Systeme sind dabei deren Maßstab. Das Fachgebiet<br />
der Medieninformatik ist als Teilgebiet der Informatik<br />
erst Anfang der 1990er Jahre entstanden und<br />
behandelte zunächst die Digitalisierung von Texten,<br />
Bildern, Audio- sowie Videodaten, also den Bereich<br />
Multimedia. Herczeg (2007, 1) beschreibt, dass sich<br />
die Medieninformatik heute „mit der Entwicklung<br />
und Nutzung interaktiver Systeme und Medien befasst“<br />
und weist darauf hin, dass die wesentliche<br />
Aufgabe darin besteht, „die Analyse, Konzeption,<br />
Realisierung, Bewertung und Verbesserung der<br />
Schnittstellen zwischen multimedialen Computersystemen<br />
und Menschen, die diese in ihren unterschiedlichen<br />
Kontexten im Rahmen von Arbeit, Bildung<br />
oder Freizeit als Konsumenten oder Produzenten<br />
nutzen möchten“ zu untersuchen. Der Computer<br />
wird dabei nicht auf seine ursprüngliche Rolle als<br />
Symbolverarbeitungsmaschine eingeschränkt,<br />
sondern als Kommunikations- und Informationsmöglichkeit<br />
betrachtet. Malake et al. (2009) weisen<br />
darauf hin, dass sich die Medieninformatik mit digitalen<br />
Medien beschäftigt, die letztlich immer von<br />
Menschen genutzt werden und daher drei Aspekten<br />
eine wesentliche Rolle zukommt: Menschen, Technik<br />
und Gesellschaft.<br />
Darüber hinaus gibt es jedoch eine Reihe von weiteren<br />
(kleineren, auch Teil-) Fachgebieten, die erwähnt<br />
werden sollten:<br />
▸ Das Fachgebiet der Mensch-Maschine Interaktion<br />
(„Human-Computer Interaction and Usability Engineering,<br />
kurz HCI&UE; siehe Kapitel #usability)<br />
arbeitet an der Schnittstelle der Informatik<br />
zur Psychologie und etabliert sich seit einigen<br />
Jahren mehr und mehr als Fachbereich (Myers,<br />
1998; Holzinger, 2000; Holzinger, 2005). Benutzerzentriertes<br />
Design ist ein wesentlicher<br />
Aspekt technologiegestützten Lernens. Stress und<br />
Frustration beim Online-Lernen entstehen oft<br />
durch technische Probleme und Probleme des Interface-Designs<br />
(Hara & Kling, 2000). Die Computermaus<br />
als Eingabegerät sowie die grafischen<br />
Oberflächen mit der Schreibtisch- und Fensteranalogie<br />
(Shneiderman, 1997) sind die bekanntesten<br />
Errungenschaften der Disziplin.<br />
▸ Die Medienpädagogik hatte vor dem Aufkommen<br />
der Internet-Technologie vor allem Massenmedien<br />
wie Zeitschriften und Fernsehen im Fokus. In<br />
ihren Bereich fällt auch die Medienerziehung<br />
(siehe auch Kapitel #medienpaedagogik).<br />
▸ Teilgebiete der Betriebswissenschaftslehre, wie<br />
Fragen der Personalentwicklung und des Wissensmanagements<br />
in Unternehmen, haben Berüh-
10 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
rungsfelder und Schnittmengen mit technologiegestütztem<br />
Lernen (Maurer, 2004; siehe Kapitel<br />
#unternehmen).<br />
▸ Schließlich, und das zeigt sich auch in diesem<br />
Lehrbuch, unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten<br />
von Technologien bei unterschiedlichen<br />
Fachgegenständen. Die einzelnen Fachdidaktiken<br />
sind natürlich an Fragestellungen des Technologieeinsatzes<br />
interessiert (siehe Kapitel #sprache,<br />
#mathematik, #medizin oder #sport).<br />
?<br />
Falls Sie diesen Lehrtext im Rahmen eines Seminars<br />
lesen: Fragen oder überlegen Sie, mit welchen Hinter-‐<br />
gründen die anderen Lernenden sich dem Thema E-‐<br />
Learning widmen.<br />
Interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
Obwohl der Bereich des technologiegestützten<br />
Lernens und Lehrens ein interdisziplinäres Feld ist,<br />
arbeiten die entsprechenden Disziplinen häufig nicht<br />
eng zusammen. So gibt es beispielsweise in der mediendidaktischen<br />
Planung nach Kerres (2001) einen Bereich<br />
der IT-Infrastruktur, welcher wohl Fragen der<br />
technologischen Systeme berührt; es scheint aber so,<br />
als würde diese Infrastruktur als gegeben vorausgesetzt<br />
werden. Auf Seiten der Pädagogik fehlt häufig<br />
technisches Wissen, vor allem über neue Entwicklungen<br />
und Potenziale, um Innovationen mitzugestalten<br />
und anzutreiben. Umgekehrt werden von der<br />
Informatik eher rezeptähnliche Ratschläge auf Basis<br />
kognitionspsychologischer Überlegungen (siehe Kapitel<br />
#gedaechtnis) angenommen, als die aus ihrer<br />
Sicht eher vagen und uneindeutigen Methodenbeschreibungen<br />
und -empfehlungen der Lern- und<br />
Lehr-Forschung, die über eine „kleinteilige“ Realisierung<br />
in kleinen Schritten hinaus geht. Diese Beispiele<br />
für geringe und schwierige Zusammenarbeit<br />
sind subjektive Wahrnehmungen der Autoren. Dass<br />
die interdisziplinäre Zusammenarbeit aber zu verbessern<br />
ist, wird jedoch wohl allgemein Unterstützung<br />
finden. Durch die aktuelle Konsolidierung<br />
als eigenständiges, interdisziplinäres Forschungsgebiet<br />
und eine Reihe eigener Institutionen, die sich<br />
zum Themengebiet gebildet haben, ist anzunehmen,<br />
dass sich die Zusammenarbeit und das gegenseitige<br />
Verständnis zukünftig verbessert.<br />
Am Rande bemerkt: Interessant ist, dass die Disziplinen<br />
sich auch über die konkrete Zusammenarbeit<br />
hinaus befruchten, so hat die „Computermetapher“<br />
für das Gedächtnis (mit „Input“ und „Output“) die<br />
Kognitionswissenschaft und ihre Vorstellung vom<br />
menschlichen Gedächtnis beeinflusst (siehe Kapitel<br />
#kognition).<br />
Konsolidierung als Forschungs-‐ und Lehrgebiet<br />
In den letzten Jahren zeigt sich eine zunehmende<br />
Konsolidierung des technologiegestützten Lernens<br />
und Lehrens als Forschungs- und Lehrgebiet: An<br />
mehreren Universitäten werden inzwischen entsprechende<br />
Studiengänge angeboten (siehe ausführlich<br />
Kapitel #telweiterbildung). Ein weiterer Indikator für<br />
die Konsolidierung als Lehrgebiet ist die steigende<br />
Zahl von Professuren, Lehrstühlen und Departments<br />
in deren Bezeichnung das Themenfeld explizit genannt<br />
wird, beispielsweise das Institut für Medien<br />
und Bildungstechnologie der Universität Augsburg<br />
oder das Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien<br />
an der Donau-Universität Krems.<br />
An vielen deutschsprachigen Universitäten gibt es Institute<br />
oder Forschungscluster, die sich intensiv und<br />
aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven mit<br />
dem Lernen und Lehren mit Technologien beschäftigen;<br />
exemplarisch sind einige in Tabelle 1 auf der<br />
folgenden Seite genannt.<br />
Auch gibt es eine Reihe von Forschungseinrichtungen,<br />
die sich mit dem Lernen und Lehren mit<br />
Technologien beschäftigen; Beispiele aus ganz<br />
Europa finden sich in Tabelle 2.<br />
7. Ausblick: Erweiterung der Lern-‐ und Lehrmöglich-‐<br />
keiten<br />
Ob das Lernen und Lehren grundsätzlich und nachhaltig<br />
durch die oben skizzierten Technologien beeinflusst<br />
wird, wird sich zeigen. „E-Learning 2.0“ ist<br />
derzeit eher für eine kleine Zahl von Lehrenden und<br />
Lernenden Realität; und es bedarf einer großen<br />
Portion Motivation sowie Medien- und Lernkompetenz,<br />
um breitflächige und nachhaltige Veränderungen<br />
herbeizuführen. Es ist auch davon auszugehen,<br />
dass im formal organisierten Unterricht die<br />
vermeintliche Leichtigkeit, die spielerischen Ansätze<br />
und die neuen Formen der Kollaboration zu Gewöhnungseffekten<br />
führen. Die Geschichte und die Debatte<br />
um die <strong>Einführung</strong> von jeweils neuen Medien<br />
hat uns gezeigt, dass diese immer von Euphorie (zum<br />
Beispiel bei der <strong>Einführung</strong> des Schulfernsehens) wie<br />
auch von Schreckensszenarien (bei der <strong>Einführung</strong><br />
der Schultafel; siehe Kapitel #ipad) begleitet werden<br />
und sich erst (viel) später, nach einer gewissen Konsolidierungsphase,<br />
herausstellt, welche substanziellen<br />
Veränderungen sich daraus ergeben. Wir gehen
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 11<br />
Kurzbeschreibung (Homepage)<br />
IICM -‐ InsBtut für InformaBonssysteme und Computer Medien an der Technischen Universität Graz, Leitung Frank Kappe,<br />
ca. 30 wiss. Mitarbeiter/innen (hDp://www.iicm.tugraz.at)<br />
IBM -‐ Department für InterakBve Medien und Bildungstechnologien, Donau-‐Universität Krems, Leitung Peter Baumgartner,<br />
ca. 15 wiss. Mitarbeiter/innen (hDp://www.donau-‐uni.ac.at/de/department/imb)<br />
Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, Ludwig-‐Maximilians-‐Universität München, Leitung Frank Fischer, ca.<br />
30 wiss. Mitarbeiter/innen (hDp://www.psy.lmu.de/ffp)<br />
Forschungscluster E-‐EducaBon der Fernuniversität in Hagen, ForschungskooperaBv im Themenfeld, KooperaBon von 6 In-‐<br />
sBtuten (hDp://www.lgmmia.fernuni-‐hagen.de/researchcluster/educaBon)<br />
IMB – InsBtut für Medien und Bildungstechnologien, Universität Augsburg, Leitungsteam, ca. 30 wiss. Mitarbeiter/innen<br />
(hDp://www.imb-‐uni-‐augsburg.de)<br />
ZHW – Zentrum für Hochschul-‐ und Weiterbildung, Universität Hamburg, vormals Leitung Rolf Schulmeister, ca. 15 wiss.<br />
Mitarbeiter/innen (hDp://www.zhw.uni-‐hamburg.de/zhw)<br />
Duisburg Learning Lab – Lehrstuhl für MediendidakBk und Wissensmanagement, Leitung Michael Kerres, ca. 30 wiss. Mit-‐<br />
arbeiter/innen (hDp://mediendidakBk.uni-‐duisburg-‐essen.de)<br />
Tabelle 1: Ausgewählte Universitätsinstitute und Forschungscluster deutschsprachiger Universitäten mit einem Schwer-‐<br />
punkt im Themenfeld. Quellen: Angaben auf den Homepages, Stand Januar 2011<br />
Kurzname Kurzbeschreibung (Homepage)<br />
CELSTEC (NL) Das „Center for Learning Science and Technologies“ ist die Forschungseinrichtung der niederlän-‐<br />
dischen Fernuniversität, der Open Universiteit Nederland, und forscht und entwickelt zu Lern-‐<br />
technologien, ca. 80 Mitarbeiter/innen (hDp://celstec.org).<br />
KMi (UK) Das „Knowledge Media InsBtute“ ist die Forschungseinrichtung der briBschen Fernuniversität,<br />
der Open University UK und forscht und entwickelt zu Wissensmedien, ca. 70 Mitarbeiter/innen<br />
(hDp://kmi.open.ac.uk)<br />
SCIL (CH) Das „Swiss Centre for InnovaBons in Learning“ gehört zur Universität St. Gallen und entwickelt<br />
und forscht zu LerninnovaBonen im Feld von Hochschulen und Unternehmen, derzeit 12 Mitar-‐<br />
beiter/innen (hDp://www.scil.ch)<br />
IWM/KMRC (DE) Das „InsBtut für Wissensmedien“ ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit Sitz in<br />
Tübingen und forscht zu medienbasierten Lehr-‐ und Lernansätzen, mit ca. 80 Mitarbeiter/innen<br />
(hDp://www.iwm-‐kmrc.de)<br />
Know-‐Center (AT) Das „Know-‐Center“ bezeichnet sich als das österreichische Kompetenzzentrum für Wissensma-‐<br />
nagement und Wissenstechnologien und beschäGigt sich aus dieser PerspekBve mit individuel-‐<br />
len und organisaBonalen Lernprozessen und Medien, ca. 45 Mitarbeiter/innen<br />
(hDp://www.know-‐center.tugraz.at)<br />
IFeL Das „InsBtut für Fernstudien-‐ und eLearningforschung“ ist das ForschungsinsBtut der Fernfach-‐<br />
hochschule Schweiz, 10 Mitarbeiter/innen (hDp://www.ifel.ch/)<br />
ccel Das „Competence Center e-‐Learning“ forscht am Deutschen Forschungszentrum für künstliche<br />
Intelligenz zum technologiegestützten Lernen, 25 Mitarbeiter/innen (hDp://ccel.dwi.de)<br />
Tabelle 2: Ausgewählte europäische institutionalisierte Forschungseinrichtungen im Bereich des Lernens und Lehrens mit<br />
Technologien. Quellen: Beschreibung der Einrichtung auf deren Homepages bzw. Auskünfte der Einrichtungen,<br />
Stand Januar 2011
12 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
davon aus, dass die beschriebenen Möglichkeiten die<br />
Lern- und Lehrpraxis langfristig und nachhaltig verändern<br />
werden.<br />
So ist eine Konsequenz des diskutierten Web 2.0<br />
ein rasanter Anstieg der Zahl potenzieller Lernmaterialien,<br />
-anwendungen und -gelegenheiten für<br />
Nutzer/innen des Internets. Da die geltenden Regelungen<br />
des Urheberrechts im deutschsprachigen<br />
Europa die Verwendung und Modifizierung von<br />
(Lern-) Materialien einschränken, bildeten sich Initiativen<br />
und Projekte, welche freie Bildungsmaterialien<br />
unterstützen. Durch entsprechende Lizenzierungen<br />
werden die Nutzung, Veränderung und Wiederveröffentlichung<br />
ohne weitere Absprachen mit<br />
den Urheberinnen oder Urhebern möglich und legal<br />
(siehe Kapitel #openaccess).<br />
Die zunehmenden Möglichkeiten für das Lernen<br />
stellen große Anforderungen an die Lernenden, insbesondere<br />
an deren Medien- wie auch Lernkompetenz.<br />
Mit den sogenannten „persönlichen Lernumgebungen“<br />
werden Möglichkeiten geschaffen,<br />
sich „das Internet“ für die eigenen Bedürfnisse zurechtzuschneiden.<br />
Weiterhin ist es notwendig, entsprechende<br />
Auswahlentscheidungen treffen zu<br />
können (siehe „personal learning environment“ im<br />
Kapitel #systeme).<br />
Das allgegenwärtig verfügbare, ubiquitäre Internet<br />
führt zukünftig zu einer Entwicklung von<br />
neuen Geräten und Anwendungen von heute noch<br />
schwer vorstellbarem Ausmaß (siehe Kapitel #innovation).<br />
Aktuell sind dies derzeit auf den Markt drängende<br />
Technologien wie „Surface Computing“ (siehe<br />
Kapitel #ipad). Lernressourcen und -mittel sind<br />
überall und in Echtzeit abrufbar (Zhang & Adipat,<br />
2005), neue Lerngelegenheiten werden geschaffen<br />
und für viele Menschen erst verfügbar werden. Bereits<br />
jetzt ist zu sehen, dass unsere Kinder mit Leichtigkeit<br />
mobile Endgeräte, wenn auch noch in spielerischer<br />
Weise, bedienen und in ihren Alltag integrieren<br />
(siehe Kapitel #netzgeneration). „Gute“ und damit<br />
letztlich weit verbreitete Technologie verschwindet<br />
dabei zunehmend hinter ihrem Nutzen und wird<br />
somit Bestandteil unseres Lebens („pervasive computing“<br />
in Anlehnung an Weiser, 1991) – und damit<br />
unseres Lernen und Lehrens.<br />
!<br />
Durch den rasanten AnsBeg der Zahl der Lernmate-‐<br />
rialien und -‐gelegenheiten sowie des allgegenwärBgen<br />
Internets erweitern sich die Lern-‐ und Lehrmöglich-‐<br />
keiten. Medienkompetenz, Selbststeuerung und Per-‐<br />
sonalisierung der Inhalte sind dabei notwendige Vor-‐<br />
aussetzungen für zukünGiges Lernen.<br />
?<br />
Literatur<br />
Schauen Sie sich den Film von „Sixth Sense“ an:<br />
hDp://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/#V<br />
IDEOS [2011-‐01-‐30]. Halten Sie für sich persönlich fest<br />
wie das gezeigte Endgerät Ihren Alltag verändern<br />
würde! Wie könnten Lehr-‐ und LernsituaBonen damit<br />
aussehen? DiskuBeren Sie Ihre Überlegungen mit an-‐<br />
deren!<br />
▸ Begemann, E. (1997). Lebens- und Lernbegleitung konkret.<br />
Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.<br />
▸ Berners-Lee, T. (1989). Information Management: A Proposal,<br />
CERN. URL: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html<br />
[2011-01-10].<br />
▸ Bernhardt, T. & Kirchner, M. (2007). E-Learning 2.0 im<br />
Einsatz – „Du bist der Autor!“ – Vom Nutzer zum WikiBlog-<br />
Caster. URL: http://elearning2null.de/learnmedia/Bernhardt-<br />
Kirchner_E-Learning-2.0-im-Einsatz.pdf [2011-01-27].<br />
▸ Chan, T.; Roschelle, J.; His, S.; Kinshuk; Sharples, M.; Brown,<br />
T.; Patton, C.; Cherniavsky, J.; Pea, R.; Norris, C.; Soloway, E.;<br />
Balacheff, N.; Scardamalia, M.; Dillenbourg, P.; Looi, C.;<br />
Milrad, M. & Hoppe, U. (2006). One-to-one technology-enhanced<br />
learning: An opportunity for global research collaboration.<br />
In: Research and Practice in Technology Enhanced<br />
Learning, 1(1), 3-29.<br />
▸ Comenius, J.A. (1657). Didactica magna in Opera didactica<br />
omnia.<br />
▸ Dohmen, G. (2001). Das informelle Lernen. Die internationale<br />
Erschließung einer bisher vernachlässigten Grundform<br />
menschlichen Lernens für das lebenslange Lernen aller. Bonn:<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung.<br />
▸ Downes, S. (2005). e-learning 2.0. In: eLearn Magazine, URL:<br />
http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1<br />
[2011-01-27].<br />
▸ Dror, I. (2008). Technology Enhanced Learning: The good, the<br />
bad, and the ugly. In: Pragmatic & Cognition, 16 (2), 215-213.<br />
▸ Ebner, M. (2007). E-Learning 2.0 = e-Learning 1.0 + Web 2.0?,<br />
In: The Second International Conference on Availiability, Reliability<br />
and Security, ARES 2007, IEEE, 1235-1239.<br />
▸ Ebner, M.; Kickmeier-Rust, M. & Holzinger, A. (2008). Utilizing<br />
Wiki-systems in higher education classes: a chance for<br />
universal access?. In: Universal Access in the Information Society,<br />
2008, Berlin/ Heidelberg: Springer.<br />
▸ Europäische Kommission (2000). Memorandum über lebenslanges<br />
Lernen. URL:<br />
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memode.pdf<br />
[2010-12-10].<br />
▸ Faulstich, P. (2005). Lernen und Widerstände. In: P. Faulstich &<br />
M. Bayer (Hrsg.), Lernwiderstände. Anlässe für Vermittlung<br />
und Beratung., Hamburg: VSA-Verlag, 7-25.<br />
▸ Faure, E.; Herrera, F.; Kaddoura, A.-R.; Lopes, H.; Petrovski,<br />
A.V.; Rahnema, M. & Champion Ward, F. (1972). Learning to<br />
Be. Paris: UNESCO.
▸ Frank, I.; Gutschow, K. & Münchhausen, G. (2005). Informelles<br />
Lernen. Verfahren zur Dokumentation und Anerkennung<br />
im Spannungsfeld von individuellen, betrieblichen<br />
und gesellschaftlichen Anforderungen. Bielefeld: Bertelsmann.<br />
▸ Friesen, N. (2009). Re-Thinking E-Learning Research. Foundations,<br />
Methods, and Practices, New York: Lang.<br />
▸ Grossman, L. (2006). Time's Persons of the Year: You. In:<br />
TIME Magazine, 2006.<br />
▸ Haake, J.; Schwabe, G. & Wessner, M. (2004). CSCL-Kompendium:<br />
Lehr- und Handbuch zum computerunterstützten<br />
kooperativen Lernen. München: Oldenburg.<br />
▸ Häcker, T. (2010). Neoliberale Führungspraxis oder kooperative<br />
Lernprozessbestimmung? Portfolioarbeit im Spannungsfeld<br />
zwischen (Selbst-) Steuerung und Selbstbestimmung.<br />
In: T. Bohl, K. Kansteiner-Schänzlin, M. Kleinknecht, B.<br />
Kohler & A. Nolder (Hrsg.), Selbstbestimmung und<br />
Classroom-Management. Forschungsbefunde, Praxisbeispiele,<br />
Perspektiven, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 65-82.<br />
▸ Herczeg, M. (2006). <strong>Einführung</strong> in die Medieninformatik.<br />
München: Oldenbourg.<br />
▸ Hara, N. & Kling, R. (2000). Students Distress with a Webbased<br />
Distance Education Course. In: Information & Society,<br />
3(4), 557-579.<br />
▸ Hohenstein, A. & Wilbers, K. (2002). Handbuch E-Learning.<br />
Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst.<br />
▸ Holzinger, A. (2000). Basiswissen Multimedia Band 3: Design.<br />
Entwicklungstechnische Grundlagen multimedialer Informations<br />
Systeme. Würzburg: Vogel, URL: http://www.basiswissen-multimedia.at<br />
[2010-10-18].<br />
▸ Holzinger, A. (2005). Fundamentals of Human-Computer Interaction<br />
(HCI) for e-Learning. In: R.T. Mittermeir (Hrsg.), Innovative<br />
Concepts for Teaching Informatics, Wien: Carl Ueberreuter<br />
Verlag, 157-159.<br />
▸ Issing, L.J. & Klimsa, P. (2008). Online-Lernen. München: Oldenbourg.<br />
▸ Keen, A. (2007). The Cult of the Amateur: How Today's Internet<br />
Is Killing Our Culture. Crown-Business.<br />
▸ Kerres, M. (2001). Multimediale und telemediale Lernumgebungen.<br />
Konzeption und Entwicklung. München: Oldenbourg.<br />
▸ Kerres, M.; De Witt, C.; Schweer, M. (2001). Die Rolle der Medienpädagogin/innen<br />
bei der Gestaltung der Medien- und Wissensgesellschaft.<br />
In: N. Heuß (Hrsg.), Beruf Medienpädagoge.<br />
Selbstverständnis - Aufgaben - Arbeitsfelder, München:<br />
kopaed.<br />
▸ Kerres, M. (2006). Potenziale von Web 2.0 nutzen. In: A. Hohenstein<br />
& K. Wilbers (Hrsg.), Handbuch E-Learning,<br />
München: DWD-Verlag.<br />
▸ Klafki, W. (1991). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik:<br />
Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive<br />
Didaktik. Weinheim: Beltz.<br />
▸ Knapper, C. (2001). Lifelong learning in the workplace. In: A.<br />
M. Roche & J. McDonald (Hrsg.), Systems, Settings, People:<br />
Workforce Development Challenges in the Alcohol and Other<br />
<strong>Einführung</strong>. Das Lernen und Lehren mit Technologien— 13<br />
Drugs Field., Adelaide: National Centre for Education and<br />
Training on Addiction (NCETA), 129-138.<br />
▸ Knorr, E. (2003). 2004: The Year of Web Services. URL:<br />
http://www.cio.com/article/32050/2004_The_Year_of_Web_<br />
Services [2011-01-27].<br />
▸ Kuhlmann, A. & Sauter, W. (2008). Innovative Lernsysteme:<br />
Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social<br />
Software. Berlin/Heidelberg: Springer.<br />
▸ Malaka, R.; Butz, Al. & Hußmann, H. (2009). Medieninformatik.<br />
Eine <strong>Einführung</strong>. München. Pearson Studium.<br />
▸ Maurer, H. (2004). E-Learning als Teil von Wissensmanagement.<br />
In: Österreichische Zeitschrift für Berufsbildung, 4,<br />
4-6.<br />
▸ Myers, B. A. (1998). A Brief History of Human-Computer Interaction<br />
Technology. In: ACM interactions, 5(2), 44-54.<br />
▸ O'Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0 - Design Patterns and<br />
Business Models for the Next Generation of Software. URL:<br />
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [2010-<br />
07-28].<br />
▸ Rossett, A. & Sheldon, K. (2001). Beyond The Podium: Delivering<br />
Training and Performance to a Digital World. San Francisco:<br />
Jossey-Bass/Pfeiffer, 274.<br />
▸ Schaub, H. & Zenke, K.G. (2004). Wörterbuch Pädagogik.<br />
München: Deutscher Taschenbuch Verlag.<br />
▸ Shneiderman, B. (1997). The next generation of graphical user<br />
interfaces: information visualization and better window management.<br />
In: Display, 17, 125-129.<br />
▸ Smith, M.K. (1996). Lifelong learning, the encyclopedia of informal<br />
education. URL: http://www.infed.org/lifelonglearning/b-life.htm<br />
[2005-12-01].<br />
▸ Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. New York:<br />
Anchor.<br />
▸ Tippelt, R. & Schmidt, B. (2005). Was wissen wir über Lernen<br />
im Unterricht? In: Pädagogik, 57(3), 6-11.<br />
▸ Weiser, M. (1991). The computer for the twenty-first century.<br />
In: Scientific American, 265( 3), 94-104.<br />
▸ Wilden, H. (1965). Vergleichende Tabellen zur Geschichte der<br />
Pädagogik. Bad Godesberg: Dürrsche Buchhandlung.<br />
▸ Zhan, G. & Jin, Q. (2005). Research on Collaborative Service<br />
Solution in Ubiquitous Learning Environment. In: 6th International<br />
Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications<br />
and Technologies (PDCAT’05), 804-806.<br />
▸ Zimbardo, P. G. & Gerrig, R.J. (1996). Psychologie. Berlin/Heidelberg:<br />
Springer.
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Einleitung<br />
Hilfsmittel und Geräte die beim Unterricht zum<br />
Einsatz kommen gibt es schon lange, aber es gibt sie<br />
keineswegs „schon immer“. Eines der ersten Hilfsmittel<br />
waren Schulbücher. Comenius wird so zugesprochen,<br />
mit dem „Orbis Pictus“ Ende des 17. Jahrhunderts<br />
das erste Schulbuch entworfen zu haben. In<br />
diesem Kapitel haben wir versucht jene Geräte auszuwählen,<br />
die heute noch in den Ausbildungsräumen<br />
anzutreffen sind. Darunter befinden sich die Schultafel<br />
aber auch viele digitale Endgeräte. Ein Schwerpunkt<br />
liegt dabei auf Geräten, die bei der Präsentation<br />
im Unterricht eingesetzt werden, beispielsweise<br />
Kreidetafeln, Whiteboards und Projektoren. Im Ausblick<br />
stellen wir vergleichsweise aktuelle Technologien<br />
vor, die den Lernenden in die Hand gedrückt<br />
werden können, zum Beispiel Tablets. Bei der Beschreibung<br />
stehen technisch-funktionale Aspekte im<br />
Vordergrund.<br />
2. Kreidetafel<br />
Die Erfindung der heute bekannten Kreidetafel geht<br />
auf James Pillans (1778-1864) zurück und fand in<br />
dessen Geographieunterricht 1854 erste Verwendung.<br />
Bei ihrer <strong>Einführung</strong> wollte die Schulaufsicht den<br />
Einsatz von Tafeln zunächst verhindern: Im Vergleich<br />
zum damals üblichen Unterricht, dem Auswendiglernen<br />
von Grammatikregeln und des Katechismus,<br />
wurden nun „sozial-kommunikative Unterrichtsformen<br />
möglich, die […] als subversiv erlebt<br />
wurden“ (Wagner, 2004, 170; Petrat, 1979).<br />
Die früher aus Holz und dunkler Farbe gefertigten<br />
Tafeln werden heute aus Stahlemaille produziert, ein<br />
Prozess, bei dem Stahl bei 800°C emailliert (eingebrannt)<br />
wird. Durch diesen Vorgang erhält man eine<br />
sehr gute Oberflächenhärte. Schrift wird mittels<br />
Kreide auf Tafeln übertragen und ist in unterschiedlichen<br />
Farben erhältlich. Um diese zu entfernen ,<br />
Abbildung 1: Kreidetafel<br />
werden Schwämme beziehungsweise feuchte Tücher<br />
verwendet. Funktional dient die Kreidetafel vor allem<br />
bei der Kurzzeitspeicherung von visuellen Informationen.<br />
Sie unterstützt primär das gesprochene Wort<br />
des Lehrenden durch grafische Darstellungen.<br />
Ein Nachteil dieser Art von Unterrichtstechnologie<br />
besteht darin, dass sich der Lehrende vom Publikum<br />
abwenden muss und sich somit Erklärungen<br />
und Erläuterungen der Darstellung als sehr schwierig<br />
erweisen. Kreidetafeln findet man vor allem in<br />
Schulen und Universitäten, wo sie auch aus mehreren<br />
Teilen bestehen und sich individuell verschieben<br />
lassen. Als Vorteil der Kreidetafel wird zum Beispiel<br />
das Unterrichtstempo beschrieben, welches an den<br />
Vorlesungsstoff angepasst ist. Das Schreiben und<br />
gleichzeitige laut Nachdenken wird vor allem in den<br />
Naturwissenschaften als sehr positiv wahrgenommen<br />
(Rojas et. al, 2001).<br />
Die Kreidetafel wird hauptsächlich im klassischen<br />
Unterricht eingesetzt, welcher primär durch einen<br />
vortragenden Lehrenden und vielen zuhörenden Lernenden<br />
gekennzeichnet ist.<br />
!<br />
!<br />
Als Vorteil der der Kreidetafel wird das Unterricht-‐<br />
stempo beschrieben, welches an den Vorlesungsstoff<br />
angepasst ist.<br />
Weiterführende Links zum Kapitel finden Sie in der<br />
L3T Gruppe bei Mr. Wong unter Verwendung der Has-‐<br />
htags #l3t #ipad<br />
3. Whiteboards<br />
1990 eingeführt gilt die weiße Tafel, das „Whiteboard“,<br />
als Weiterentwicklung der Kreidetafel und<br />
wird anstatt mit Kreide mit sogenannten Whiteboard-Stiften,<br />
speziellen abwischbaren Filzstiften, beschrieben.<br />
Wie bei der Kreidetafel wird für die Her-<br />
Abbildung 2: Whiteboard
stellung Kunststoff oder Stahlemaille verwendet. Bei<br />
Verwendung von Stahlemaille kann ein Whiteboard<br />
auch als Magnettafel fungieren. Um Aufschriften auf<br />
einem Whiteboard zu entfernen, wird ein trockenes<br />
Tuch oder ein trockener Schwamm verwendet. Ein<br />
Vorteil gegenüber der Kreidetafel ist, dass beim Beschreiben<br />
und Löschen der Tafel kein Staub entsteht,<br />
jedoch ist das mit Stiften Geschriebene oft schwerer<br />
für das Auditorium lesbar.<br />
Nicht direkt als Weiterentwicklung, aber durch die<br />
Namensgleichheit schwer unterscheidbar, ist das „interaktive“<br />
Whiteboard. Jenes bezeichnet eine<br />
Fläche, auf der mittels Projektor ein Bild auf ein von<br />
einem Computer kontrolliertes Koordinatensystem<br />
projiziert wird. Die auf dieser Fläche befindlichen<br />
Sensoren erfassen jede Interaktion der Finger oder<br />
des Stiftes und übertragen diese auf den Computer.<br />
Solche elektronischen Tafeln sind derzeit vor allem<br />
im Schulunterricht und großen Unternehmen im<br />
Einsatz. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang<br />
die in Zusammenspiel mit der Nintendo<br />
Wii kostengünstigere „selbstgebaute“ Variante eines<br />
interaktiven Whiteboards, welche von Johnny Lee<br />
Chung entwickelt wurde. Dabei wird versucht mithilfe<br />
von Infrarot die Stiftbewegung aufzunehmen<br />
und mittels Projektor zu projizieren.<br />
4. Diaprojektoren<br />
Der zu der Familie der Durchlichtprojektoren (Diaskope)<br />
zählende Diaprojektor wurde 1926 von Leitz<br />
(Wetzlar) entwickelt. Der Diaprojektor wird verwendet,<br />
um durchsichtige, unbewegliche und meist<br />
durch Photographie gewonnene Bilder, kurz Diapositive,<br />
darzustellen. Diese Bilder haben meist eine<br />
Größe von 24 x 36 mm und liegen in einem<br />
50 x 50 mm Diarahmen. Neben den konventionellen<br />
Dias gibt es auch Diastreifen, auf denen sich mehrere<br />
Bilder nebeneinander befinden. Trotz verschiedenster<br />
Hersteller (welche sich in Konstruktion und Leistung<br />
Abbildung 3: Diaprojektor<br />
Vom Overhead-‐Projektor zum iPad. Eine technische Übersicht — 3<br />
unterscheiden), basieren alle Projektoren auf dem<br />
Prinzip: „Das von der Lichtquelle (Lampe) ausgestrahlte<br />
Lichtbündel wird durch den Kondensor gesammelt,<br />
durchstrahlt nun als Bündel annähernd paralleler<br />
Lichtstrahlen das zur Projektion bestimmte<br />
Bild - das Dia - und wird durch das Objektiv auf die<br />
Projektionsfläche geworfen” (Melezinek, 1999, 117).<br />
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen nichtautomatischen,<br />
halb- und vollautomatischen Diaprojektoren.<br />
Nichtautomatische Projektoren müssen von<br />
Hand bedient werden, während halb- und vollautomatische<br />
Projektoren mit Diamagazinen ausgestattet<br />
sind und mittels Fernbedienung bedient werden.<br />
5. Tageslichtprojektor<br />
Der Tageslichtprojektor, auch Overhead-Projektor<br />
(Österreich, Westdeutschland), Polylux (Ostdeutschland)<br />
oder Hellraumprojektor (Schweiz) genannt,<br />
wurde 1960 von der Firma 3M entwickelt. Er<br />
projiziert mittels eines Bildwerfers den Inhalt transparenter<br />
Folien auf eine Projektionsfläche ohne dass<br />
der Raum stark verdunkelt werden muss.<br />
Als Medium dient vorwiegend transparente Folie,<br />
in Form von einzelnen Blättern oder als Folienrolle,<br />
welche aus Polyacetat, Polyester und ähnlichem besteht.<br />
Auch das Bedrucken von Spezialfolien mit<br />
Bildern ist möglich. Durch Realobjekte werden Schattenprojektionen<br />
ermöglicht. Als Weiterentwicklung<br />
wird der Einsatz von LC-Displays (Liquid-Display-<br />
Displays) angesehen, bei dem ein Bildschirm auf den<br />
Tageslichtprojektor gelegt und durch dessen Licht-<br />
!<br />
Der Tageslichtprojektor bietet den Vorteil, dass der<br />
Vortragende in ständigem Blickkontakt mit dem Pu-‐<br />
blikum bleibt, Folien beliebig ausgetauscht werden<br />
können und die natürliche Schreibhaltung unterstützt<br />
wird (Blömecke, 2005).<br />
Abbildung 3: Tageslichtprojektor
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
quelle durchleuchtet wird. Durch diese Technik<br />
können Inhalte von Computern auf der Projektionsfläche<br />
großformatig dargestellt werden.<br />
Der Tageslichtprojektor projiziert mit dem<br />
gleichen Prinzip wie der Diaprojektor: Der Lichtstrom<br />
von der Lichtquelle (Lampe) leuchtet über<br />
einen Kondensor (Fresnel-Linse) gleichmäßig die Arbeitsplatte<br />
(Glasplatte) aus und wird durch den auf<br />
der Arbeitsplatte aufgelegten Informationsträger hindurch<br />
über den Projektionskopf (zum Beispiel zwei<br />
Linsen, Umlenkspiegel) zur Projektionsfläche abgestrahlt.<br />
Andere Ausführungen bieten zum Beispiel<br />
Parabolspiegel, bei dem der Objektivkopf zusätzlich<br />
die Lichtquelle beinhaltet.<br />
Tageslichtprojektoren haben auch heute noch eine<br />
sehr weite Verbreitung und sind vielerorts im Einsatz.<br />
6. Epiprojektoren (Episkop)<br />
Der episkopische Projektor kann undurchsichtige<br />
(opakes) Normalpapier projizieren. Dies ist vorteilhaft,<br />
da man aktuelle Informationen, ohne diese in<br />
ein Diapositiv oder ein Transparent umzuarbeiten,<br />
direkt projizieren kann.<br />
Das Darstellungsprinzip des Epiprojektors ist<br />
dabei die „Auflichtprojektion“. Die zu projizierende<br />
Vorlage wird auf eine Platte am Boden des Episkops<br />
gelegt und mit einer oder mehreren Lampen beleuchtet.<br />
Das von der Vorlage diffus reflektierte Licht<br />
wird über einen Spiegel zum Projektionsobjektiv geführt<br />
und weiter auf eine Projektionsfläche geworfen.<br />
Auf Grund der geringen Lichtausbeute ist es notwendig,<br />
den Unterrichtsraum zu verdunkeln.<br />
Der größte Vorteil dieser Art von Projektion ist,<br />
dass die Vorlagen ohne weitere Aufbereitung unter<br />
das Gerät gelegt werden können. Auch Objekte mit<br />
Übergröße sind möglich, da der Kopf des Epiprojektors<br />
abgenommen und über das Objekt bewegt<br />
werden kann.<br />
Abbildung 5: Epiprojektor<br />
7. Fernseher, Videorekorder, DVD-‐Player<br />
Der uns heute bekannte Fernseher geht auf ein<br />
Patent von Paul Nipkow im Jahre 1886 zurück, der<br />
den ersten mechanischen Fernsehapparat erfand.<br />
Dieser war das erste Gerät, das eine Abfolge von<br />
Bildern darstellen konnte. Die früher eingesetzte<br />
Bildröhre stellt ein Bild dar, indem in einem Vakuum<br />
je nach Bildpunkt-Helligkeit Elektronen von einer<br />
Kathode mittels Hochspannung zu einer Anode hin<br />
beschleunigt werden. Mit dem Fortschritt der<br />
Technik entwickelten sich die Flachbildschirme, die<br />
man heute in LCD-, LED- und Plasma-Flachbildfernseher<br />
einteilen kann. Diese werden von Jahr zu<br />
Jahr größer und schmäler.<br />
Um Filme aufzuzeichnen und erneut abspielen zu<br />
können, wurde der Videorekorder entwickelt. Das<br />
verwendete Medium war ein Magnetband, das<br />
mehrere Male verwendet werden konnte (Überspielen).<br />
Mit Einzug der DVD (Digital Versatile Disc)<br />
im Jahre 1996, kamen auch die DVD-Player, die<br />
durch eine höher Kapazität und des digitalen<br />
Formats Videos in höherer Qualität erlauben. Als<br />
Weiterentwicklung heutzutage gilt die Blueray- Disc.<br />
Das berühmte Zitat der 1960er-Jahre „TV is easy<br />
and book is hard“ (Salomon, 1984) ist unweigerlich<br />
mit der <strong>Einführung</strong> des Fernsehgerätes (später in<br />
Verbindung mit dem Videorekorder) verbunden.<br />
Durch die <strong>Einführung</strong> von Lehrvideos wurde fälschlicherweise<br />
angenommen, dass ein erhöhter Lernerfolg<br />
durch alleiniges Betrachten der Filme eintrete.<br />
Heute spielt diese Form des Unterrichts eine eher untergeordnete<br />
Rolle oder findet sich unter dem<br />
Schlagwort „Multimedia“ (siehe Kapitel #multimedia)<br />
wieder.<br />
8. Touchscreen<br />
Die ersten Touchscreens wurden schon 1940 entwickelt<br />
und schließlich mit Veröffentlichung der<br />
PLATO IV Lernmaschinen 1972 publik gemacht. Bei<br />
Abbildung 6: Touchscreen
Touchscreens interagiert man mit einem Computer<br />
durch Berührung des Bildschirmes. Statt der Bedienung<br />
durch einen mit der Maus bewegten Cursor,<br />
wird auf direkte Eingaben mit Finger und Zeigestift<br />
(einem sogenannten Stylus) gesetzt.<br />
Früher vorwiegend bei Info-Monitoren, Computer-Kiosks<br />
und Bankomaten verwendet, finden wir<br />
Touchscreens heutzutage in Mobiltelefonen, Tablet-<br />
PC, Laptop, MP3-Player und ähnlichem. Man unterscheidet<br />
folgende Funktionsprinzipien:<br />
▸ Resistive Touchscreens: Wenn zwei elektrisch<br />
leitfähige Schichten per Druck aneinander geraten,<br />
entsteht ein Spannungsteiler an dem der elektrische<br />
Widerstand und so die Position der Druckstelle<br />
gemessen wird. Verwendung findet diese<br />
Technologie bei Kiosksystemen, Smartphones,<br />
oder PDA.<br />
▸ Kapazitive Touchscreens: Bei kapazitiven<br />
Touchscreens werden mit Metalloxid beschichtete<br />
Glassubstrate oder zwei Ebenen aus leitfähigen<br />
Streifen verwendet. Bei der ersten Methode wird<br />
ein elektrisches Feld erzeugt, bei dem die elektrischen<br />
Ströme aus den Ecken im direkten Verhältnis<br />
zur Berührungsposition stehen. Bei der<br />
zweiten Methode bilden die zwei Ebenen Sensor<br />
und Treiber. Bei Berührung verändert sich die<br />
schwache Kapazität des Kondensators und ein<br />
größeres Signal kommt beim Sensor an. Verwendung<br />
findet diese Technologie bei den Apple-<br />
Produkten (iPhone, iPad, iPod) sowie Mobiltelefonen<br />
von HTC und Samsung.<br />
▸ Induktive Touchscreens: Diese Technologie<br />
findet vor allem bei Grafiktabletts Verwendung.<br />
Die Technik basiert auf elektromagnetischer Basis<br />
ohne direkten Bildschirmkontakt. Ein spezieller<br />
Stift (Stylus) muss eingesetzt werden um Interaktion<br />
mit dem Bildschirm zu erkennen. Die unter<br />
dem Bildschirm befindliche Sensor-Leiterplatte<br />
mit vielen Antennenspulen kommuniziert durch<br />
die Abstrahlung von hochfrequenter Energie mit<br />
dem Resonanzkreis des Eingabestiftes wodurch<br />
eine Positionsbestimmung möglich wird.<br />
▸ Optische Touchscreens: Es kommen Lampen<br />
und lichtempfindliche Sensoren zum Einsatz.<br />
Wird durch Berührung das Lichtschranken-Gitter<br />
durchbrochen, kann der Punkt der Berührung ermittelt<br />
werden. Diese Technologie ist sehr fehleranfällig,<br />
da Staub auf die Sensoren gelangen und<br />
unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann. Zum<br />
Einsatz kommen optische Touchscreens vor allem<br />
bei großen Bildschirmen. Als bekanntestes Beispiel<br />
sei auf das Produkt „Microsoft Surface“ verwiesen.<br />
Vom Overhead-‐Projektor zum iPad. Eine technische Übersicht — 5<br />
9. Videoprojektoren<br />
Bei Videoprojektoren, umgangssprachlich als Beamer<br />
bezeichnet, wird ein Videosignal von, zum Beispiel<br />
einem Computer oder DVD-Player, auf einer<br />
Leinwand projiziert. Am Beginn der Projektion stand<br />
die von Christiaan Huygens 1656 erfundene Laterna<br />
Magica (Lat. Zauberlaterne). Bis hinein in das 20.<br />
Jahrhundert galt sie als das Projektionsgerät. Es projizierte<br />
mit Hilfe einer internen Lichtquelle und spezielle<br />
Linsensysteme in schneller Reihenfolge Bilder<br />
durch das ausfallende Licht.<br />
!<br />
Abbildung 7: Videoprojektor<br />
Videoprojektoren (Beamer) sind als Vortragsmedium<br />
anzusehen, welche in Verbindung mit einem Com-‐<br />
puter die Projek]on digitaler Inhalte ermöglichen.<br />
Mittlerweile gibt es verschiedene Anzeigeverfahren.<br />
Die zwei gebräuchlichsten sind:<br />
▸ LCD-Projektoren basieren auf Flüssigkristallen<br />
und funktionieren wie Dia-Projektoren. Basierend<br />
auf drei unabhängigen Lichtstrahlen, nämlich rot<br />
grün und blau, wird das Licht auf einen dichrotischen<br />
Spiegel zu einem Bild zusammengeführt.<br />
Gegenüber anderen Anzeigeverfahren ist diese<br />
Methode sehr preiswert und gut für Text- und<br />
Grafikdarstellungen geeignet.<br />
▸ DLP-Projektoren basieren auf „Micromirrors”,<br />
kleine integrierte Schaltungen, die für jeden Bildpunkt<br />
einen kleinen Kipp-Spiegel besitzen. Wird<br />
einer dieser Spiegel mit Licht bestrahlt, wird das<br />
Licht in Richtung der Projektionsoptik geworfen.<br />
Kontrast und Helligkeit werden durch „pulsieren”<br />
dieser Spiegel, also „schnelles Ein und Aus“ verändert.<br />
Vorteile dieser Projektoren sind die hohe<br />
Geschwindigkeit der Spiegel, der hohe Kontrast
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
und dass sich keine Bilder in die Linse einbrennen<br />
können. Dem gegenüber stehen die lauten Lüfter<br />
und eine geringe Lebensdauer der Lampe.<br />
Neben diesen beiden gibt es noch LED- und LCoS-<br />
Projektoren. Ein wesentliches Merkmal ist die<br />
Leuchtkraft der im Beamer verbauten Lampe. Durchschnittlich<br />
liegt die Leuchtstärke bei 1000 bis 4500<br />
Lumen, diese kann aber durch Kontrast und Helligkeit<br />
eingestellt werden. Im Unterricht werden Videoprojektoren<br />
vor allem zur Präsentation von digitalen<br />
Unterlagen und Live-Demos verwendet,<br />
meistens in Verbindung mit einem Laptop.<br />
10. PC, Laptop und Netbook<br />
Der erste elektronische Computer wurde um 1938<br />
- 1945 von Konrad Zuse entwickelt. Damals noch so<br />
groß wie ein ganzer Raum, hat er sich in den letzten<br />
Jahren zu immer kleiner werdenden Endgeräten entwickelt.<br />
Der moderne Computer basiert auf der Von-<br />
Neumann-Architektur, welche von John von<br />
Neumann in den 1946er Jahren erfunden wurde. Die<br />
Architektur teilt einen Computer in fünf Komponenten<br />
auf: Recheneinheit, Steuereinheit, Buseinheit,<br />
Speichers sowie Eingabe- und Ausgabeeinheit. Durch<br />
mehrere am Markt vorhandenen Prozessorarchitekturen,<br />
wurden im Laufe der Jahre unterschiedlichste<br />
Betriebssysteme entwickelt. Zu den am stärksten verbreiteten<br />
gehöhren Appleʼs Mac OS, Microsoft<br />
Windows und das freie Betriebssystem Linux, das<br />
von Linus Torvalds im Jahre 1991 entwickelt wurde.<br />
Mittlerweile setzen jedoch fast alle Computer-Hersteller<br />
auf die x86-Architektur. Der erste Laptop, ein<br />
mobiler Personal Computer, wurde im Jahre 1975<br />
von IBM vorgestellt, der IBM 5100. Dieser wog circa<br />
11kg und hatte keinen integrierten Akku. Später, im<br />
Jahre 1980 kam der erste, wie uns heut bekannte,<br />
Laptop heraus (Flip-Form). Im Gegensatz zu früher,<br />
kann man Laptops heute mit Stand-PCs vergleichen,<br />
da die selbe Leistung auf immer kleineren Raum ge-<br />
bracht werden kann. Die kleinste Version eines<br />
Laptops wird heute als Netbook bezeichnet. Dieses<br />
hat oftmals nur eine geringe Leistung und wird daher<br />
eher als leichter Reisebegleiter verwendet.<br />
PCs und Laptops durchdringen immer mehr die<br />
Unterrichtsräume, die Zunahme an Netbooks kann<br />
ebenfalls immer mehr beobachtet werden (siehe Kapitel<br />
#schule). Kritische Stimmen meinten anfangs,<br />
dass man nun einen etwas besseren Taschenrechner<br />
hätte, aber die Vielfalt der Möglichkeiten die sich dadurch<br />
ergeben, ist heute noch immer eine der wesentlichen<br />
Fragestellungen des Forschungsgebietes vom<br />
technologiestützten Lehren und Lernen.<br />
11. InteracQve Pen Displays<br />
Ein Interactive Pen Display ist ein berührungsempfindlicher<br />
Bildschirm, auf dem man mit einem Stift<br />
(auch genannt Stylus) interagieren kann. Es lässt sich<br />
sehr gut mit den aufkommenden Tablet-Computer<br />
vergleichen.<br />
Im Gegensatz zur Kreidetafel, bieten Interactive<br />
Pen Displays durch den Anschluss an einen Computer<br />
digitalen Inhalt. Man kann alles speichern, bearbeiten,<br />
löschen und kopieren. Der Schreibaufwand<br />
den Lehrende und Studierende haben, ist sowohl bei<br />
der Tafel als auch bei den Interactive Pen Displays<br />
der gleiche.<br />
Ein Einsatzbeispiel ist zum Beispiel: Als Brücke<br />
zwischen Beamer und Interactive Pen Display fungiert<br />
ein Laptop, auf dem Lehrveranstaltungsfolien<br />
präsentiert werden. Mittels des Bildschirms lassen<br />
sich nun alle Folien näher beschreiben und mit Informationen<br />
(Text / Skizzen) verfeinern. Diese Infor-<br />
!<br />
Interac]ve Pen Displays erlauben die Erweiterung von<br />
herkömmlichen Laptops um einen berührungsemp-‐<br />
findlichen Bildschirm.<br />
Abbildung 9: Interactive Pen Display
In der Praxis: Einsatz eines Interactive Pen Display im Hochschulunterricht<br />
Die Abbildung 11 zeigt den Einsatz eines Interac]ve Pen<br />
Display zur Präsenta]on von Vorlesungsinhalten. Das Sym-‐<br />
podium (Interac]ve Pen Display) ist mit dem Laptop der Vor-‐<br />
tragenden verbunden und erlaubt die Interak]on micels<br />
S]d. Am Bildschirm des Computers erscheint das gleiche<br />
Bild, welches auch über den Videoprojektor (Beamer) proji-‐<br />
ziert wird. Durch eine Screen-‐Capturing-‐Sodware erfolgt die<br />
Aufzeichnung der Inhalte, welche später auf einer Lern-‐<br />
plaeorm publiziert werden. Diese Anordnung an der Techni-‐<br />
schen Universität Graz wurde im Jahre 2008 evaluiert und<br />
führte zu dem Ergebnis, dass nur eine/r von 109 Studie-‐<br />
renden zukündig die Kreidetafel bevorzugen würde (Ebner &<br />
Nagler, 2008). Als Hauptgründe für das posi]ve Urteil<br />
wurden vor allem die bessere Sichtbarkeit in großen Hör-‐<br />
sälen, die bessere Verwendung von Farben durch die Leh-‐<br />
renden (der Farbwechsel gestaltet sich einfacher als bei<br />
Kreiden) und die deutlichere Schrid (deutlich größer als auf<br />
der Tafel) genannt. Der offensichtlichste Vorteil, die Digitali-‐<br />
sierung der Vorlesungsinhalte, kam erst an fünder Stelle. Als<br />
Nachteile wurden technische Probleme und ein etwas<br />
schnellerer Vortragss]l beschrieben.<br />
mationen können danach auf eine Online-Plattform<br />
geladen und den Studenten als weiterführende Unterlagen<br />
angeboten werden (siehe Praxisbeispiel).<br />
12. Mobiltelefone<br />
Mit dem Einzug der Smartphones, also Mobiltelefonen,<br />
die mit Funktionalitäten von Personal Digital<br />
Assistents erweitert wurden, und den meist internetbasierten<br />
mobilen Inhalten, wurden Mobiltelefone<br />
auch für den Lehrbereich entdeckt. Ausgestattet mit<br />
hochauflösender Kamera, Internet, GPS-Modulen<br />
und Touch-Displays wurden Smartphones vor allem<br />
durch die zur Verfügung stehenden Anwendungen<br />
(engl. „applications“, kurz Apps) populär. Das erste<br />
Abbildung 11: Mobiltelefon<br />
Vom Overhead-‐Projektor zum iPad. Eine technische Übersicht — 7<br />
Abbildung 10: Einsatz des Interactive Pen Displays<br />
Smartphone wurde 1992 von IBM entwickelt und<br />
hörte auf den Namen Simon. Es besaß bereits Funktionen<br />
wie Terminkalender, E-Mail, Notizbuch, Fax<br />
und Taschenrechner.<br />
Neben den typischen Mobiltelefon-Herstellern mischen<br />
seit Jahren auch Apple und Google am Smartphone-Markt<br />
mit. Die drei derzeit erfolgreichsten Betriebssysteme<br />
für Mobiltelefone sind iOS (Apple),<br />
Android (Google) und Symbian (Nokia). Seit Jahren<br />
wird Forschung zum mobilen Lernen („M-Learning“,<br />
siehe Kapitel #mobil) betrieben.<br />
13. Weitere aktuelle und zukünVige Technologien<br />
Eine der wichtigsten Zukunftstechnologien unserer<br />
Zeit sind die Tablet-Computer. Als derzeitiger Vorreiter<br />
präsentiert sich das Apple iPad. Mit einer<br />
Million verkaufter Geräte binnen 28 Tagen ist es der<br />
derzeit erfolgreichste Tablet-Computer am Markt.<br />
Basierend auf einem sehr stromsparenden Prozessor<br />
(A4) hat es je nach Version auch Wifi, 3G-Internet<br />
und GPS-Anbindung. Applikationen lassen sich wie<br />
beim iPhone beim „App-Store“ herunterladen. Der<br />
1024 x 768 Pixel große Bildschirm ermöglicht das<br />
Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten. Mittels<br />
Adapter lässt sich das iPad für Präsentationen an<br />
einen Beamer anschließen.<br />
Verantwortlich für die Usability des iPad ist unter<br />
anderem die verwendete Multi-Touch-Technologie
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Abbildung 12: Tablet-‐Computer<br />
beim Touch-Display. Dies ist nichts anderes als ein<br />
für mehrere Berührungen gleichzeitig ausgelegter kapazitiver<br />
oder optischer Touchscreen. Der Name<br />
Multi-Touch wurde mit der Entwicklung des<br />
iPhones von Apple zum Patent angemeldet. Die Forschung<br />
der Multi-Touch-Technologie geht auf die<br />
frühen 1990er Jahre zurück und wurde 2005 zum<br />
ersten Mal für ein Steuerungspult von Mischpulten,<br />
noch vor dem iPhone, eingesetzt.<br />
Im Gegensatz zu früheren Tablet-Modellen, die<br />
sich meist aus einem normalen Laptop konstruieren<br />
ließen, verloren die Tablets mit den Jahren an Bedeutung,<br />
aber gewannen an Akkulaufzeit, Usability<br />
und Portabilität. So wurden sie zu den heute bekannten<br />
„Slates” (Tablet-Computer ohne externe<br />
Tastatur). Nach und nach bringen nun auch, neben<br />
Apple, andere PC-Anbieter wie HP und Dell Tablet-<br />
Geräte auf den Markt. Nachdem Microsoft die Entwicklung<br />
am hauseigenen Tablett eingestellt hat, wird<br />
vorwiegend Linux und Google Android als Betriebssystem<br />
verwendet. Viele dieser Geräte punkten mit<br />
Funktionen, die das iPad nicht implementiert hat,<br />
unter anderem eine eingebauter Frontkamera für Videotelefonie.<br />
Viele Anbieter bieten auch kleinere<br />
Bildschirme an, um das Tablet noch handlicher zu<br />
gestalten.<br />
14. Fazit<br />
Dieses Kapitel zeigt die Vielfalt an Technologien in<br />
den heutigen Unterrichtsräumen auf und auch was<br />
man von ihr erwarten kann. Gemein ist ihnen, dass<br />
jede <strong>Einführung</strong> immer mit großen Schwierigkeiten<br />
verbunden war, viel Skepsis ihrer Verwendung entgegengebracht<br />
wurde und trotzdem letztendlich nicht<br />
aufzuhalten waren.<br />
?<br />
?<br />
Literatur<br />
Erstellen Sie eine tabellarische Übersicht, in der Sie<br />
die Vor-‐ und Nachteile aller Geräte im Lehr-‐ und Ler-‐<br />
neinsatz festhalten. Beschreiben Sie dabei auch, in<br />
welchem Lehr-‐ oder Lernarrangements sie idealer-‐<br />
weise zum Einsatz kommen.<br />
Überlegen Sie darüber hinaus, wie sich die Lehre ver-‐<br />
ändern könnte, wenn man mit modernen Techno-‐<br />
logien (zum Beispiel Touch-‐Screens) arbeitet.<br />
▸ Blömeke, S. (2005). Medienpädagogische Kompetenz. Theoretische<br />
Grundlagen und erste empirische Befunde. In: A. Frey;<br />
R.S. Jäger & U. Renold, U. (Hrsg.), Kompetenzdiagnostik.<br />
Theorien und Methoden zur Erfassung und Bewertung von beruflichen<br />
Kompetenzen. Landau: Empirische Pädagogik, 5, 76-<br />
97, URL: http://zope.ewi.hu-berlin.de/institut/abteilungen/didaktik/data/aufsaetze/2005/medienpaedagogische_Kompetenz.pdf<br />
[2010-07-01].<br />
▸ Comenius (1658). Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt.<br />
▸ Ebner, M. & Nagler, W. (2008). Has the end of chalkboard<br />
come? A survey about the limits of Interactive Pen Displays in<br />
Higher Education. In: P.A. Bruck & M. Lindner (Hrsg.), Microlearning<br />
and Capacity Building, Proceeding of the 4th International<br />
Microlearning 2008 Conference, Innsbruck: Innsbruck<br />
University Press, 79-91.<br />
▸ Melezinek, A. (1977). Ingenieurpädagogik - Praxis der Vermittlung<br />
technischen Wissens. Wien: Springer.<br />
▸ Petrat, G. (1979). Schulunterricht. Seine Sozialgeschichte in<br />
Deutschland 1750-1850. München: Ehrenwirth.<br />
▸ Rojas, R.; Knipping, L.; Raffel, W-U.; Friedland, G. & Frötschl,<br />
B. (2001). Ende der Kreidezeit - Die Zukunft des Mathematikunterrichts.<br />
Berlin: DMV Mitteilungen, 2-2001, URL:<br />
http://page.mi.fu-berlin.de/rojas/2001/Kreidezeit2.pdf<br />
[2010-07-01], 32-37.<br />
▸ Salomon, G. (1984). Television is easy and print is tough. The<br />
differential investment of mental effort in learning as a<br />
function of perceptions and attributions. In: Journal of Educational<br />
Psychology, 76, 647–658.<br />
▸ Wagner, W. (2004). Medienkompetenz revisited. Medien als<br />
Werkzeuge der Weltaneignung. München: kopaed.
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Vorkommen<br />
Zum Glück müssen wir heute nicht mehr über Ideen,<br />
Visionen oder Pläne reden, wenn wir erläutern<br />
wollen, was Hypertext ist. Wir sind eigentlich ständig<br />
damit beschäftigt, einen Hypertext zu nutzen, wenn<br />
wir im World Wide Web im Internet etwas lesen,<br />
suchen oder schreiben.<br />
Die meisten Websites basieren auf Hypertext. Der<br />
bekannteste Hypertext ist vermutlich Wikipedia. Der<br />
Idee nach und historisch gesehen bestehen Hypertexte<br />
aus elektronischen Texten, die in sich markierte<br />
Textstellen (Sprungadressen) enthalten, mit deren<br />
Hilfe man von einem Begriff oder Absatz zu einem<br />
anderen Begriff oder Absatz in demselben Text oder<br />
in einer anderen Textdatei „springen“ kann. Die Verbindung<br />
zwischen den Textstellen oder Dateien, der<br />
„Sprung“, wird mit dem englischen Begriff „Link“<br />
(Verknüpfung) bezeichnet. Die technische Realisierung<br />
war vor der Verfügbarkeit der Fenstersysteme<br />
und der Maus recht unterschiedlich.<br />
2. Ein Beispiel<br />
Im Wikipedia-Artikel zum Begriff Hypertext findet<br />
sich zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis, das sieben Einträge<br />
mit Links zu sieben Knoten anbietet, die durch<br />
blaue Farbe als anklickbar herausgehoben werden:<br />
Abbildung 1: Screenshot des Wikipedia-‐Artikels<br />
„Hypertext“. Quelle: (Stand 09/2010)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext<br />
Klickt man mit der Maus auf die Zeile „3 Geschichte<br />
und Entwicklung“, so landet man bei folgendem<br />
Text im selben Wikipedia-Artikel:<br />
!<br />
Abbildung 2: Screenshot des Wikipedia-‐Artikels<br />
„Hypertext“. Quelle: (Stand 09/2010)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext<br />
Heute werden Hypertexte mit Hilfe der Auszeich-‐<br />
nungssprache HTML (HyperText Markup Language)<br />
auEereitet. Mit HTML können Texte aber nicht nur<br />
sHlisHsch auEereitet werden (Zeichensätze, SHle,<br />
Größen), sondern sie können auch Sprungmarken<br />
(„Anker“) und Sprungadressen aufnehmen, die man<br />
als Links oder Hyperlinks bezeichnet, und die zu an-‐<br />
deren Texten (als Knoten bezeichnet) führen.<br />
Solche Sprungadressen können zu anderen Stellen<br />
im selben Text, zu anderen Seiten derselben Website,<br />
zu Dateien oder gar zu anderen Websites führen.<br />
Links sind nicht auf Begriffe und Textstellen beschränkt,<br />
sondern können heute auch von Bildern<br />
und Filmen ausgehen oder zu Bildern und Filmen<br />
führen. Zuständig für die Weiterentwicklung von<br />
HTML ist heute das World Wide Web Consortium<br />
(W3C).<br />
Abbildung 3: HTML-‐Code des Kastens „Inhaltsver-‐<br />
zeichnis“ aus Abbildung 1. Quelle: (Stand 09/2010)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext
3. Geschichte<br />
Memex<br />
Die Hypertext-Idee geht auf Vannevar Bush zurück.<br />
Vannevar Bush, Berater von Präsident Roosevelt, beschrieb<br />
1945 als Memex eine Maschine zum Blättern<br />
und Anfertigen von Notizen in riesigen Textmengen,<br />
die per Microfiche Annotationen und Kommentare<br />
speichern sollte (das Konzept geht bis in die 1930er<br />
Jahre zurück; Nielsen, 1995, S. 33).<br />
!<br />
!<br />
Hinweis: Alle im Kapitel erwähnte Links und weitere<br />
sind bei Mister Wong in der L3T Gruppe mit dem<br />
Hashtag #l3t und #hypertext abgelegt.<br />
Zum VerHefen: Der berühmt gewordene Aufsatz „As<br />
We May Think“ aus dem Magazin „The AtlanHc<br />
Monthly“ vom Juli 1945 (Volume 176, No. 1; 101-‐108)<br />
wird vom Magazin im Netz angeboten (hbp://www.-‐<br />
theatlanHc. com/doc/194507/bush).<br />
Mit Memex hatte Bush eine Analogie zwischen<br />
dem „assoziativen“ Arbeiten des menschlichen Gehirns<br />
und dem assoziativen Vernetzen von Texten im<br />
Auge. Heute finden sich viele Dokumente zu Bush<br />
im Internet mit den Originalzeichnungen des Memex<br />
und Fotos des von Bush 1931 entwickelten „Differential<br />
Analyzer“, einer analog arbeitenden Maschine<br />
für die Lösung von Differentialgleichungen.<br />
Abbildung 4: Der Memex-‐Tisch von Vannevar Bush.<br />
Quelle: http://web.mit.edu/mindell/www/analyzer.htm<br />
NLS Augment<br />
Die Vision von Bush fand Nachfolger (Bush, 1986;<br />
Conklin, 1987, 20; Kuhlen, 1991, 66ff; Nielsen 1990,<br />
31ff; Nielsen, 1995, 33ff). 1962 veröffentlichte<br />
Douglas Engelbart am Stanford Research Institute<br />
den Bericht über das SRI Project No. 3578 „Aug-<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 3<br />
menting Human Intellect: A Conceptual<br />
Framework“, mit dem er das Ziel verfolgte, die<br />
Reichweite des menschlichen Denkens zu erweitern.<br />
1968 implementierte er am „Augmented Human Intellect<br />
Research Center“ das System NLS Augment<br />
(oN Line System) und erfand die Computer-Maus als<br />
Eingabegerät (Engelbart, 1988; Conklin, 1987, 22;<br />
Kuhlen 1991, 67ff; Gloor, 1990, 176ff; Nielsen, 1990,<br />
34ff; Nielsen, 1995; 36ff).<br />
!<br />
Augment kam bei der Luftfahrt-Firma McDonnel<br />
Douglas zu größerer Anwendung (Ziegfeld & Hawkins<br />
et al., 1988). Es erwies sich dort als zunehmend<br />
wichtig, umfangreiche technische Dokumentationen<br />
mit ihren internen Relationen und Verweisen elektronisch<br />
speichern zu können, zum Beispiel umfasste ein<br />
Handbuch für Düsenflugzeuge 1988 circa 300.000<br />
Blatt, wog 3.150 Pfund und nahm einen Raum von<br />
68 Kubikfuß ein. Ventura (1988) berichtet, dass das<br />
amerikanische Verteidigungsministerium allein fünf<br />
Millionen Blatt pro Jahr auswechseln musste (S. 111).<br />
Der Zugang zu Informationen, zum Beispiel zu<br />
Sammlungen von Photoagenturen, zu Dokumentationen<br />
von Zeitungsverlagen, zu Gesetzesblättern,<br />
wurde derart schwierig, dass vermehrt Datenbanken<br />
eingeführt wurden, um die Informationen effektiver<br />
verwalten und leichter auffinden zu können.<br />
Xanadu<br />
Zum VerHefen:<br />
▸ Die Stanford University veröffentlicht eine Reihe<br />
historischer Dokumente, u.a. auch 35 kleine Filme<br />
zu Doug Engelbarts Arbeit am Bildschirm<br />
(hbp://sloan.stanford.edu/mousesite/1968De-‐<br />
mo.html).<br />
▸ Die Sojware PreservaHon Site unterhält Quellen<br />
zu NLS Augment (vgl. hbp://www.sojwarepreser-‐<br />
vaHon.org/projects/nlsproject/).<br />
Fast gleichzeitig mit Engelbart entwickelte Ted<br />
Nelson (1967) das Hypertext-System Xanadu (die<br />
Xanadu Operating Company ist eine Filiale der Autodesk,<br />
Inc.). Ihm wird die Erfindung des Begriffs<br />
„Hypertext“ zugeschrieben (Nielsen, 1995, 37ff), er<br />
selbst nimmt dies für sich auf seiner Homepage auch<br />
in Anspruch (vgl. http://ted.hyperland.com/). Das<br />
im Internet eingerichtete Archiv enthält ein Dokument,<br />
in dem der Begriff Hypertext vermutlich<br />
zum ersten Mal auftrat, 1965 in einer Ankündigung<br />
am Vassar College (vgl. http://xanadu.com/).<br />
Das Projekt Xanadu, das zum Ziel hatte, sämtliche<br />
Literatur der Welt zu vernetzen, wurde nie ganz realisiert.<br />
Nelson schwebte bereits eine Client-Server-
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Konzeption mit nicht-lokalen Verknüpfungen wie<br />
heute im World Wide Web vor (Nelson, 1974;<br />
Ambron & Hooper, 1988; Conklin, 1987, 23; Kuhlen,<br />
1991, 68ff; Nielsen, 1990, 35ff).<br />
!<br />
Die Distribution von Xanadu wurde für 1990 von<br />
der „Xanadu Operating Company“ angekündigt<br />
(Kuhlen, 1991, 71; Woodhead, 1991, 190ff). Berk<br />
(1991) beschreibt das Client-Server-Modell von<br />
Xanadu näher.<br />
KMS<br />
KMS Knowledge Systems’ KMS (1983) für SUNund<br />
Apollo-Rechner (Akscyn & McCracken et al.,<br />
1988) ist eine Weiterentwicklung von dem frühen Hypertext-System<br />
ZOG (1972 und 1975; Robertson &<br />
McCracken et al. 1981) einer Entwicklung der Carnegie-Mellon<br />
University (Woodhead, 1991, 188ff).<br />
Über ZOG ist vermutlich die erste Dissertation zum<br />
Thema Hypertext geschrieben worden (Mantei. 1982)<br />
Nielsen, 1995, 44ff). Von 1980 bis 1984 wurde mit<br />
ZOG ein computerunterstütztes Managementsystem<br />
für den mit Atomkraft angetriebenen Flugzeugträger<br />
USS Carl Vinson entwickelt (Akscyn & McCracken et<br />
al., 1988, 821). KMS wurde 1981 begonnen, weil eine<br />
kommerzielle Version nachgefragt wurde. KMS ist<br />
bereits ein verteiltes Multi-User-Hypertext-System<br />
(Yoder & Akscyn et al., 1989). Es basiert auf<br />
Rahmen, die Text, Grafik und Bilder in beliebiger<br />
Kombination enthalten können, und deren Größe<br />
auf maximal 1132 x 805 Pixel festgelegt ist. In KMS<br />
sind die Modi der Autor/innen und der Leser/innen<br />
noch ungetrennt. Leser/innen können jederzeit Text<br />
editieren, neue Rahmen und Verknüpfungen anlegen,<br />
die durch kleine grafische Symbole vor dem Text signalisiert<br />
werden. KMS benutzt eine Maus mit drei<br />
Knöpfen, die neun verschiedene Funktionen generieren<br />
können.<br />
HyperTIES<br />
Zum VerHefen: Es exisHert neben der Homepage des<br />
Projekts (hbp://xanadu.com/) noch eine australische<br />
Variante (hbp://xanadu.com.au/).<br />
Mit der Entwicklung von Ben Shneidermans HyperTIES<br />
wurde bereits 1983 an HyperTIES der University<br />
of Maryland begonnen. HyperTIES wurde ab<br />
1987 von Cognetics Corporation weiterentwickelt<br />
und vertrieben (Shneiderman et al., 1991). HyperTIES<br />
erscheint unter DOS als Textsystem mit alphanumerischem<br />
Interface im typischen DOS-Zeichensatz.<br />
Die Artikel fungieren als Knoten und die<br />
Hervorhebungen im Text als Verknüpfungen. Hervorhebungen<br />
erscheinen in Fettdruck auf dem Bildschirm.<br />
Die puritanische Philosophie der Entwickler<br />
drückt sich in der sparsamen Verwendung von Verknüpfungen<br />
aus, die auf Überschriften beschränkt<br />
wurden: „We strongly believe that the use of the article<br />
titles as navigation landmarks is an important<br />
factor to limit the disorientation of the user in the<br />
database. It is only with caution that we introduced<br />
what we call 'opaque links' or 'blind links' (a link<br />
where the highlighted word is not the title of the referred<br />
article), to satisfy what should remain as<br />
special cases“ (Plaisant, 1991, 20). HyperTIES kennt<br />
nur unidirektionale Verknüpfungen, „because bidirectional<br />
links can be very confusing“ (S. 21).<br />
Abbildung 5: Ausschnitt aus HyperTIES<br />
Der untere Bildschirmrand bietet einige Befehle<br />
für die Navigation (Vor, Zurück, Zum Beginn, Index,<br />
Beenden). Repräsentativ für das System ist das<br />
sowohl als Buch als auch als elektronischer Text auf<br />
Diskette veröffentlichte „Hypertext Hands-On!“, das<br />
180 Aufsätze zum Thema umfasst (Shneiderman &<br />
Kearsley, 1989) und den Leserinnen und Lesern einen<br />
direkten Vergleich von Buch und Hypertext ermöglicht<br />
(Nielsen, 1995, 45ff). Unter grafischen Fenstersystemen<br />
entfaltet HyperTIES mehr grafische Fähigkeiten,<br />
so zum Beispiel im dort zitierten Beispiel der<br />
Encyclopedia of Jewish Heritage (S. 157), das 3.000<br />
Artikel und 10.000 Bilder auf einer Bildplatte umfassen<br />
soll, sowie in der auf einer SUN erstellten Anwendung<br />
zum Hubble Space Telescope (s. Shneiderman,<br />
1989, 120). Jedoch sind die Bilder nur als<br />
Hintergrund unterlegt und nicht mit integrierten Verknüpfungen<br />
in die Hypertext-Umgebung eingelassen<br />
(Plaisant, 1991). In der SUN-Version hat man sich<br />
mit „tiled windows“ begnügt, weil man überlappende<br />
Fenster für Neulinge als zu schwierig betrachtete. Hy-
perTIES folgt nach Aussage von Shneiderman der<br />
Metapher des Buchs oder der Enzyklopädie (S. 156),<br />
von der sich der Name TIES („The Electronic Encyclopedia<br />
System“) herleitet (Morariu & Shneiderman,<br />
1986). Einen Überblick über HyperTIES gibt Plaisant<br />
(1991).<br />
!<br />
Obwohl das Autorentool bereits einige Aspekte<br />
der automatischen Konstruktion von Hypertext erleichterte,<br />
musste Shneiderman die Buchseiten noch<br />
manuell setzen. Auch die Links im Text wurden<br />
einzeln gesetzt und mussten nach Editiervorgängen,<br />
die den Text verkürzten oder verlängerten, manuell<br />
versetzt werden. In modernen Hypertext-Systemen<br />
haften die Links am Text und müssen beim Editieren<br />
nicht mehr manuell gesetzt werden.<br />
NoteCards<br />
Zum VerHefen: Das Human Computer Lab der Uni-‐<br />
versity of Maryland, der Ursprung von HyperTIES,<br />
bietet historische InformaHonen zu seinem Produkt<br />
an (hbp://www.cs.umd.edu/hcil/hyperHes/).<br />
Xerox PARC’s NoteCards (1985) ist ein unter InterLisp<br />
geschriebenes Mehrfenster-Hypertext-System,<br />
das auf den mit hochauflösenden Bildschirmen ausgestatteten<br />
D-Maschinen von Xerox entwickelt<br />
wurde. Die kommerzielle Version von NoteCards<br />
wurde unter anderem auf Sun-Rechnern implementiert.<br />
Sie ist bereits weiter verbreitet als die vorgenannten<br />
Systeme, Xerox jedoch hat NoteCards nie<br />
vermarktet. NoteCards folgt, wie der Name sagt, der<br />
Kartenmetapher. Jeder einzelne Knoten ist eine Datenkarte,<br />
im Gegensatz zur ersten Version von HyperCard<br />
jedoch mit variablen Fenstern. Links beziehen<br />
sich auf Karten, sind aber an beliebigen<br />
Stellen eingebettet, zusätzlich gibt es Browser, die wie<br />
Standardkarten funktionieren, und Dateiboxen, spezielle<br />
Karten, auf denen mehrere Karten zusammengefasst<br />
werden können, die wie Menüs oder Listen<br />
oder Maps funktionieren (Halasz, 1988) Die<br />
Browser-Karte stellt das Netz als grafischen Überblick<br />
dar (Conklin, 1987, 27ff; Gloor, 1990, 22ff;<br />
Catlin & Smith, 1988; Woodhead, 1991, 189ff;<br />
Nielsen, 1995, 47ff). Halasz (1988) hatte noch sieben<br />
Wünsche an NoteCards: Suchen und Anfragen, zusammengesetzte<br />
Strukturen, virtuelle Strukturen für<br />
sich ändernde Informationen, Kalkulationen über<br />
Hypermedia-Netze, Versionskontrolle, Unterstützung<br />
kollaborativer Arbeit, Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit.<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 5<br />
Intermedia<br />
Intermedia (1985) von Andries van Dam und dem<br />
Institute for Research in Intermedia Information and<br />
Scholarship (IRIS) der Brown University ist bereits<br />
ein System, das im Alltag einer Universität und in<br />
mehreren Fächern (Biologie, Englische Literatur) für<br />
die kooperative Entwicklung von Unterrichtsmaterialien<br />
und zum Lernen am Bildschirm eingesetzt<br />
wird. Yankelovich et al. (1985) schildern die Entwicklung,<br />
die elektronische Dokumentensysteme an<br />
der Brown University genommen haben. Nach dem<br />
rein textorientierten System FRESS (1968; vgl.<br />
Nielsen, 1995, 40) und dem Electronic Document<br />
System, das bereits Bilder und grafische Repräsentationen<br />
der Knoten-Struktur darstellen sowie Animationssequenzen<br />
spielen konnte, und BALSA (Brown<br />
Algorithm Simulator and Animator) wurde erst mit<br />
Intermedia ein echter Durchbruch erzielt. Yankelovich<br />
et al. (1988) beschreiben das System anschaulich<br />
anhand von 12 Bildschirmabbildungen<br />
einer Sitzung. Intermedia besteht aus fünf integrierten<br />
Editoren: InterText (ähnlich MacWrite), InterPix<br />
(zum Zeigen von Bitmaps), InterDraw (ähnlich<br />
MacDraw), InterSpect (Darstellen und Rotieren dreidimensionaler<br />
Objekte) und InterVal (Editor für<br />
chronologische Zeitleisten). Zusätzlich können direkt<br />
aus Intermedia heraus „Houghton-Mifflin’s American<br />
Heritage Dictionary“ oder „Roget’s Thesaurus“ aufgerufen<br />
werden. Intermedia operiert mit variablen<br />
Fenstern als Basiseinheit. Alle Links sind bidirektionale<br />
Verknüpfungen von zwei Ankern. Intermedia<br />
arbeitet mit globalen und lokalen Maps als Ausgangspunkt<br />
für Browser, das WebView-Fenster stellt die<br />
Dokumente und die Links durch mit Linien verbundene<br />
Mini-Icons dar (Conklin, 1987, 28ff; Kuhlen<br />
1991, 198ff; Gloor, 1990, 20ff, 59ff; Nielsen, 1995,<br />
51ff).<br />
Abbildung 6: Die Anwendung „Perseus“ realisiert unter<br />
Intermedia
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Intermedia Version 3.0 wurde anfangs kommerziell<br />
vertrieben. Aber diese Version lief nur unter<br />
A/UX auf dem Macintosh (Woodhead, 1991, 181ff).<br />
Da dieses System nicht sehr häufig eingesetzt wurde,<br />
fand Intermedia leider keine große Verbreitung<br />
(Nielsen, 1995, 51). Erfolgreiche kommerzielle<br />
Systeme sind aus diesen historischen Prototypen also<br />
nicht geworden.<br />
!<br />
4. Erfolgreich verbreitete Systeme<br />
Guide<br />
Erst Guide (1986) von OWL (Office Workstations<br />
Limited) ist das erste kommerziell erfolgreiche Hypertextsystem.<br />
Peter Brown hatte es bereits 1982 in<br />
England an der University of Kent begonnen.<br />
Nielsen meinte (1990, 42; 1995, 54ff), dass Guide den<br />
Übergang von einem exotischen Forschungsprojekt<br />
zu einer „Realen-Welt“-Anwendung markiere. Guide<br />
wurde von OWL zunächst für den Macintosh, später<br />
auch für PCs entwickelt. Es orientiert sich am<br />
strengsten von allen Systemen am Dokument. Guide<br />
stellt Textseiten zur Verfügung, auf denen Textstellen<br />
als Verknüpfungen mit unterschiedlicher Bedeutung<br />
markiert werden können. Über den Textstellen<br />
nimmt der Cursor unterschiedliche Gestalt an und<br />
teilt den Benutzer/innen so die Existenz von Verknüpfungen<br />
mit. Guide kennt drei Arten von Verknüpfungen:<br />
Springen zu einer anderen Stelle im<br />
selben oder in einem anderen Dokument, Öffnen<br />
eines Notizfensters oder -dialogs über dem aktuellen<br />
Text sowie Ersetzen von Text durch kürzeren oder<br />
längeren Text (Auffalten, Einfalten). In Version 2<br />
wurde eine Skriptsprache für den Zugriff auf Bildplattenspieler<br />
eingebaut.<br />
HyperCard<br />
Zum VerHefen: Die Geschichte von Intermedia<br />
zeichnet die „Electronic Library“ (hbp://elab.eserve-‐<br />
r.org/hfl0032.html).<br />
1987 erschien Bill Atkinsons HyperCard. Schon<br />
vorher gab es gespannte Erwartungen. Conklin<br />
(1987) gab in seinem historischen Überblick über Hypertext-Systeme<br />
sogar das Gerücht weiter: „As this<br />
article goes to press, there is news that Apple will<br />
soon have its own hypertext system, called Hyper-<br />
Cards“ (S. 32). Man darf wohl mit Recht behaupten,<br />
dass keine andere Software, schon gar keine andere<br />
Programmierumgebung, einen derart bedeutsamen<br />
Einfluss auf den Einsatz von Computern gehabt hat<br />
wie HyperCard. In der Literatur speziell zu Hypertext<br />
wird die historische Bedeutung von HyperCard<br />
immer wieder betont, obwohl Landow (1992a) sicher<br />
Recht hat, wenn er HyperCard und Guide nur als<br />
„first approximations of hypertext“ bezeichnet, da<br />
die eigentlichen Merkmale von Hypertext wie die<br />
Links in Form von durchsichtigen Schaltflächen (Bedienknöpfen)<br />
über den Text gelegt werden mussten.<br />
1989 realisierte David Jonassen in HyperCard eine<br />
Hypertext-Umgebung über das Thema Hypertext.<br />
5. Das World Wide Web und die Browser<br />
Viele Informationen und vor allem aktuelle Informationen<br />
bezieht man heute aus dem Internet selbst,<br />
und dies mit Hilfe einer Software, die Hypertexte<br />
bzw. Texte, die mit HTML codiert wurden, lesen<br />
kann. Diese Software wird als Webbrowser oder<br />
kurz Browser bezeichnet. Bekannte Browser sind:<br />
Mosaic oder Netscape Navigator, Internet Explorer,<br />
Mozilla und Firefox, Safari, Opera und jüngst Google<br />
Chrome.<br />
!<br />
Abbildung 7: Hypertext realisiert unter HyperCard.<br />
Quelle: Beispiel aus Jonassen, 1989.<br />
Browser sind Sojwareprogramme, die heute in der<br />
Lage sind, den HTML-‐Code und weitere in den Text in-‐<br />
korporierte Designelemente (css, cascading styles-‐<br />
heets), Programme (QuickTime, Flash) und Skript-‐<br />
sprachen (zum Beispiel php) zu entziffern und in<br />
lesbare und grafisch gestaltete Seiten zu übersetzen.<br />
Timothy John Berners-Lee, der Ende der<br />
1980er Jahre im Kernforschungszentrum CERN in<br />
der Schweiz arbeitete, schlug 1989 dem CERN ein<br />
Projekt vor, das Computer verschiedener Netzwerke<br />
miteinander verbinden und kommunizieren lassen<br />
sollte. Das Konzept für das Metanetzwerk nutzte die<br />
Kommunikationsschnittstellen des Internet, zum Beispiel<br />
HTTP als Protokoll und URL als eindeutige<br />
Adresse, und fußte auf der Idee von Hypertext, um<br />
Links zwischen mehreren Rechnern und Seiten her-
stellen zu können. Berners-Lee entwickelte dafür die<br />
Auszeichnungssprache HTML und schuf dafür den<br />
ersten Browser, den er „WorldWideWeb“ nannte und<br />
der später dem gesamten Webserver-Netz innerhalb<br />
des Internets den Namen geben sollte. Damit begann<br />
ab etwa 1993 der Ursprung des World Wide Web<br />
(WWW).<br />
1993 entwickelte Marc Andreessen den Browser<br />
Mosaic am National Center for Supercomputing Applications.<br />
1994 gründete Andreessen die Firma<br />
Netscape die den rasch erfolgreichen Browser<br />
Netscape Navigator entwickelte.<br />
Seither wurden mehrere Browser entwickelt, und<br />
seitdem haben es alle anderen Applikationen leicht,<br />
weil sie sich dieser Grundlagen des Internets und des<br />
WWW bedienen können und den Browser als<br />
Zugang zu ihren Leistungen nutzen können. Auf<br />
derartigem Fundament bauen die Wikis auf, aber<br />
auch die Weblogs und sogar die Lernplattformen.<br />
6. Strukturmerkmale von Hypertext<br />
Zum Hypertext-Konzept gibt es ausreichend Literatur<br />
(Kuhlen, 1991; Nielsen, 1995; Schulmeister,<br />
1995), und zu allen damit im Zusammenhang stehenden<br />
Begriffen finden sich in Wikipedia Stichworte,<br />
die einen Artikel wie diesen eigentlich überflüssig<br />
machen könnten. Die Funktion dieses Textes<br />
besteht daher mehr oder minder in der Zusammenstellung<br />
der historischen Fakten und der Diskussion<br />
der Strukturmerkmale.<br />
Schoop und Glowalla (1992) unterscheiden strukturelle<br />
(nodes, links), operationale (browsing), mediale<br />
(Hypermedia) und visuelle Aspekte (Ikonizität,<br />
Effekte). Nicht-linearer Hypertext wird auch als<br />
nicht-linearer Text (Kuhlen, 1991) oder nicht-sequentieller<br />
Text (Nielsen, 1995, 1) bezeichnet. Das Lesen<br />
eines Hypertexts ähnelt dem Wechsel zwischen<br />
Buchtext, Fußnoten und Glossar: „Therefore hypertext<br />
is sometimes called the 'generalized<br />
footnote'“(S. 2).<br />
!<br />
Hypertext-‐Systeme bestehen aus Texten, deren ein-‐<br />
zelne Elemente (Begriffe, Aussagen, Sätze) mit an-‐<br />
deren Texten verknüpj sind.<br />
Die Bezeichnung Hypertext spiegelt die historische<br />
Entstehung, es war zunächst tatsächlich an<br />
reine Textsysteme gedacht. Heute können Texte aber<br />
auch mit Daten in einer Datenbank, mit Bildern,<br />
Filmen, Ton und Musik verbunden werden. Deshalb<br />
sprechen viele Autoren inzwischen von Hypermedia<br />
statt von Hypertext, um die Multimedia-Eigen-<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 7<br />
schaften des Systems zu betonen. Möglicherweise ist<br />
der Standpunkt Nielsens (1995b) vernünftig, der alle<br />
diese Systeme wegen ihres Konstruktionsprinzips als<br />
Hypertext bezeichnet, weil es keinen Sinn mache,<br />
einen speziellen Begriff für Nur-Text-Systeme übrig<br />
zu behalten (S. 5).<br />
Hypertext ist zuerst Text, ein Textobjekt, und nichts<br />
anderes. Hypertext entsteht aus Text, indem dem<br />
Text eine Struktur aus Ankern und Verknüpfungen<br />
übergelegt wird. Nun kann man diskutieren, ob bereits<br />
das Verhältnis der Textmodule ein nicht-lineares<br />
ist oder ob Nicht-Linearität erst durch die Verknüpfungen<br />
konstituiert wird. Auf jeden Fall trifft die Einschätzung<br />
von Nielsen (1995) zu , dass Hypertext ein<br />
echtes Computer-Phänomen ist, weil er nur auf<br />
einem Computer realisiert werden kann, während die<br />
meisten anderen Computer-Anwendungen ebenso<br />
gut manuell erledigt werden können (S. 16). Landow<br />
(1992b) erwähnt literarische Werke, die auf Papier<br />
ähnliche Strukturen verwirklicht haben. Ein Hypertext-System<br />
besteht aus Blöcken von Textobjekten;<br />
diese Textblöcke stellen Knoten in einem<br />
Gewebe oder Netz dar; durch rechnergesteuerte, programmierte<br />
Verknüpfungen, den Links, wird die Navigation<br />
von Knoten zu Knoten gemanagt, das sogenannte<br />
„Browsing“. Landow weist auf analoge Vorstellung<br />
en der französischen Strukturalisten<br />
Roland Barthes, Michel Foucault und Jacques Derrida<br />
hin, die sich sogar in ihrer Terminologie ähnlicher<br />
Begriffe (Knoten, Verknüpfung, Netz) bedienten, wie<br />
sie in der heutigen Hypertext-Technologie benutzt<br />
werden (S. 1ff). Für die Konstitution des Netzes ist<br />
die Größe der als Knoten gesetzten Textblöcke, die<br />
„Granularität“ oder „Korngröße“ der Informationseinheiten<br />
entscheidend. Am Beispiel einer KIOSK-<br />
Anwendung, die lediglich dem Abspielen von Film-<br />
Clips von einer Bildplatte dient, erläutert Nielsen,<br />
dass für ihn eine KIOSK-Anwendung kein Hypertext<br />
ist, weil der Benutzer mit dem Video nicht interagieren<br />
kann, sobald es läuft. In dem Fall sei die Granularität<br />
zu groß und gebe den Benutzern nicht das<br />
Gefühl, die Kontrolle über den Informationsraum zu<br />
besitzen (S. 14).<br />
Für das Netz des Hypertexts hat Landow (1992b)<br />
die Begriffe Intertextualität und Intratextualität geprägt<br />
(38). Der Begriff Intertextualität (s.a. Lemke,<br />
1992) hat nun wiederum Sager (1995) zur Schöpfung<br />
des Begriffs der Semiosphäre angeregt: „Die Semiosphäre<br />
ist ein weltumspannendes Konglomerat bestehend<br />
aus Texten, Zeichensystemen und Symbolkomplexen,<br />
die, auch wenn sie weitgehend in sich abgeschlossen<br />
sind, in ihrer Gesamtheit doch umfassend<br />
systemhaft miteinander vernetzt und damit
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
kohärent, nichtlinear und sowohl denk- wie handlungsorientierend<br />
sind“ (S. 217). Sager berichtet über<br />
multimediale Hypertexte auf kunstgeschichtlichem<br />
Gebiet, die über das Netz mit Videokameras in weit<br />
entfernten Museen verbunden sind. Die Hypertext-<br />
Benutzer/innen können von ihrem Platz aus die Kameras<br />
fernsteuern (geplant im Europäischen Museumsnetz).<br />
Sager erwähnt auch das Projekt „Piazza<br />
Virtuale“ auf der Documenta 9, in dem per Live-<br />
Schaltung Fernsehzuschauer/innen Annotationen in<br />
einen Hypertext einbringen können. Auf diese Weise<br />
entstehen weltumspannende Räume, die über die Anwendung<br />
hinausweisen und je nach Interesse der Benutzer<br />
andere Inhalte inkorporieren können (S. 224).<br />
Je nach Art der Knoten und Verknüpfungen kann der<br />
Zugriff auf Informationen in einem Hypertext frei<br />
oder beschränkt sein (Lowyck & Elen, 1992, 139). In<br />
einer offenen Umgebung treffen die Benutzer/innen<br />
alle Entscheidungen über den Zugang und die Navigation,<br />
in einer geschlossenen Umgebung werden<br />
diese Entscheidungen vorab vom Designer getroffen.<br />
In jedem Fall können sich zwischen den Vorstellungen<br />
der Benutzer/innen und denen des Designers<br />
Spannungen ergeben. Aus der Konzeption der Textblöcke,<br />
ihrer Intertextualität, können semiotische<br />
Muster resultieren (Lemke, 1992), die als Kunstformen<br />
genutzt werden könnten. Die Diskussion<br />
über semiotische oder narrative Strukturen von Hypertexten<br />
ist aber erst ganz am Anfang. Thiel (1995)<br />
unterscheidet eine monologische Organisationsform<br />
für Hypertexte von einer dialogischen Form (S. 45),<br />
die eine Art Konversationsmodus für den interaktiven<br />
Dialog des Benutzers mit dem Hypertext etablieren<br />
könne, konzipiert durch Sprechakte oder Dialogskripte.<br />
?<br />
Suchen und lesen Sie eine Hypertext-‐Erzählung im In-‐<br />
ternet und diskuHeren Sie, ob Hypertext für poeHsche<br />
Gabungen geeignet ist. Zum Beispiel hier:<br />
▸ hbp://www.netzliteratur.net/netzliteratur_theo-‐<br />
rie.php<br />
▸ hbp://www.eastgate.com/<br />
Das Buchprojekt „Null“ welches auch gedruckt wurde:<br />
▸ hbp://www.literaturkriHk.de/public/rezensi-‐<br />
on.php?rez_id=3806<br />
Bei der Segmentierung von Texten in Textblöcke<br />
stellt sich die Frage, ob es eine „natürliche“ Einteilung<br />
der Textblöcke in Informationseinheiten gibt.<br />
Dabei ist die Idee aufgetaucht, ob es gelingen könnte,<br />
Form und Größe der Textblöcke als kognitive Einheiten,<br />
sog. „Chunks of Knowledge“ zu definieren<br />
(Kuhlen, 1991, 80ff): „Zur intensionalen Definition<br />
informationeller Einheiten hilft das 'chunk'-Konzept<br />
auch nicht entscheidend weiter“ (S. 87). Kuhlen verweist<br />
auf Horn, der das Chunk-Konzept am konsequentesten<br />
umgesetzt habe und vier Prinzipien für<br />
die Unterteilung von Info-Blöcken unterscheide:<br />
„chunking principle, relevance principle, consistency<br />
principle“ und „labeling principle“. „Aus dieser<br />
knappen Diskussion kognitiver Einheiten und deren<br />
kohäsiven Geschlossenheit läßt sich die Einsicht ableiten,<br />
daß weder Umfang noch Inhalt einer informationellen<br />
Einheit zwingend festgelegt werden kann“<br />
(S. 88). Eine zu große Einteilung der Texteinheiten<br />
kann das Hypertext-Prinzip Granularität konterkarieren,<br />
d.h. der Benutzerin oder dem Benutzer wird<br />
dann gar nicht mehr deutlich, dass sie einen Hypertext<br />
vor sich hat. Lowyck und Elen (1992)<br />
schildern diese Form drastisch so: „When larger<br />
pieces of information are given the hypermedia environment<br />
is used as an integrated pageturner and<br />
audio- or videoplayer. When hypermedia would be<br />
used instructionally a highly branched version of programmed<br />
instruction is offered. This kind of instruction<br />
does not stem from a cognitive but from a<br />
behavioristic background“ (S. 142). Die Aufsplitterung<br />
in zu kleine Informationseinheiten kann ihrerseits<br />
zu einer Atomisierung der Information führen,<br />
was sich möglicherweise auf die kognitive Rezeption<br />
durch die Benutzer/innen auswirkt: Sie können keine<br />
Zusammenhänge mehr entdecken, sie können nicht<br />
„verstehen“.<br />
Die verschiedenen Hypertext-Systeme fördern die<br />
eine oder die andere Seite dieses Problems, sofern sie<br />
auf dem Datenbank-Konzept oder dem Kartenprinzip<br />
beruhen (kleine Einheiten) oder die Organisation<br />
in Dokumenten präferieren (größere Einheiten).<br />
Nicht immer ist die Basiseinheit der Knoten,<br />
es kann auch Knoten kleinerer Größe innerhalb von<br />
Rahmen oder Fenstern geben, zum Beispiel ein Wort,<br />
ein Satz, ein Absatz, ein Bild. Diese Differenzierung<br />
verweist auf eines der Grundprobleme von Hypertext,<br />
das in der Hypertext-Terminologie als<br />
Problem der Granularität bezeichnet wird. Dass die<br />
Granularität nicht leicht zu entscheiden ist (nach dem<br />
Motto „je kleiner desto besser“) zeigt eine Untersuchung<br />
von Kreitzberg und Shneiderman (1988). Sie<br />
vergleichen in einem Lernexperiment zwei Hypertext-Versionen,<br />
von denen die eine viele kleine,<br />
die andere wenige große Knoten aufweist. Zwar<br />
kommen die Autoren in ihrer Untersuchung zu der<br />
Folgerung, dass die Version mit den kleineren<br />
Knoten bessere Resultate zeitigt (gemessen durch<br />
richtige Antworten auf Fragen zum Text in Multiple-<br />
Choice-Tests), doch Nielsen (1995) macht plausibel,
dass dieses Ergebnis wahrscheinlich von einer speziellen<br />
Eigenschaft von HyperTIES abhängig ist, die<br />
nicht für andere Hypertext-Systeme gilt, denn Hyperties<br />
ist eines der Hypertextsysteme, die zum<br />
Anfang eines Artikels verlinken und nicht zu der<br />
Stelle innerhalb des Artikels, an der sich die Information<br />
befindet, auf die der Ausgangsknoten verweisen<br />
soll. Aufgrund dieser Eigenschaft ist Hyperties<br />
besonders leicht handhabbar, wenn der Text<br />
aus kleinen Knoten mit genau einem Thema besteht,<br />
so dass klar ist, worauf der Link verweist (S. 137ff.).<br />
Einer Zersplitterung kann durch intensive Kontextualisierung<br />
der Chunks entgegengewirkt werden.<br />
Dieser Weg wird bei Kuhlen (1991) an Beispielen aus<br />
Intermedia diskutiert (S. 200). Die Kontextualisierung,<br />
die der Zersplitterung vorbeugen soll, muss<br />
nicht nur wie in den Intermedia-Beispielen aus<br />
reichen Kontexten innerhalb des Systems bestehen,<br />
sondern kann auch durch den gesamten pädagogischen<br />
Kontext sichergestellt werden wie in den konstruktivistischen<br />
Experimenten zum kooperativen<br />
Lernen in sozialen Situationen (Brown & Palincsar,<br />
1989; Campione et al., 1992).<br />
Canter et al. (1985) unterscheiden fünf Navigationsmethoden:<br />
Scannen, Browsen, Suchen, Explorieren,<br />
Wandern. McAleese (1993) unterscheidet die<br />
Navigationsmethoden analog dem aus der Lernforschung<br />
bekannten Konzept des entdeckenden<br />
Lernens oder problemorientierten Lernens. Kuhlen<br />
(1991) unterscheidet, eher in Anlehnung an die strukturellen<br />
Eigenschaften von Hypertexten, folgende<br />
Formen des Browsing (128ff):<br />
▸ gerichtetes Browsing mit „Mitnahmeeffekt“,<br />
▸ gerichtetes Browsing mit „Serendipity“-Effekt,<br />
▸ ungerichtetes Browsing und<br />
▸ assoziatives Browsing.<br />
Die Klassifikation von Navigationsmethoden in Hypertexten<br />
ist abhängig von der jeweiligen Interpretationsraster<br />
der Autorinnen und Autoren. Das Augenmerk<br />
kann dabei auf der Hypertext-Struktur, den<br />
angestrebten Lernmethoden oder auf Prozessen der<br />
Arbeit liegen, die mit dem Hypertext-Werkzeug erledigt<br />
werden sollen. Zwei Fragen ergeben sich<br />
daraus:<br />
▸ Wie wirken sich die unterschiedlichen Navigationskonzepte<br />
auf die Gestaltung von Hypertext<br />
aus?<br />
▸ Wie wirken sich die unterschiedlichen Navigationsmethoden<br />
auf die Lernenden aus?<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 9<br />
Kuhlen (1991) unterscheidet die Navigationsmittel in<br />
konventionelle Metainformationen und hypertextspezifische<br />
Orientierungs- und Navigationsmittel:<br />
▸ konventionelle Metainformationen sind nicht-lineare<br />
Orientierungs- und Navigationsmittel, Inhaltsverzeichnisse,<br />
Register und Glossare (134ff);<br />
▸ hypertextspezifische Orientierungs- und Navigationsmittel<br />
sind grafische Übersichten („Browser“),<br />
vernetzte Ansichten („web views“), autorendefinierte<br />
Übersichtsmittel, Pfade („paths/trails“), geführte<br />
Unterweisungen („guided tours“), „Backtrack“-Funktionen,<br />
Dialoghistorien, retrospektive<br />
grafische (individuelle) Übersichten, leserdefinierte<br />
Fixpunkte („book marks“), autorendefinierte Wegweiser<br />
(„thumb tabs“), Markierung gelesener Bereiche<br />
(„breadcrumbs“) (S. 144ff).<br />
Zu den die Navigation unterstützenden Methoden<br />
zählen neben den von Kuhlen recht vollständig aufgeführten<br />
Mitteln noch kognitive Karten (Bieber &<br />
Wan, 1994); Edwards & Hardman, 1993, 91) und spezielle<br />
Mittel zur Verwaltung fest verdrahteter oder benutzereigener<br />
Pfade (s.a. Gay & Mazur, 1991; s.<br />
Gloor, 1990) Bieber und Wan (1994) schlagen<br />
mehrere Formen des Backtracking vor, insbesondere<br />
differenzieren sie die Rückverfolgung danach, ob die<br />
Navigation durch einen Fensterwechsel oder durch<br />
Anklicken eines Textankers durchgeführt wurde (zur<br />
Funktion des Backtracking Nielsen, 1995, 249ff;<br />
Kuhlen, 1991, 156ff).<br />
?<br />
Rand Spiro hat eine neue Homepage mit seinen Auf-‐<br />
sätzen zur sog. CogniHve Flexibility Theory einge-‐<br />
richtet (hbp://postgutenberg.typepad.com/newgu-‐<br />
tenbergrevoluHon/). Suchen Sie sich dort einen Text<br />
aus (zum Beispiel Spiro & Jehng), der die „Theorie der<br />
kogniHven Flexibilität“ erklärt und diskuHeren Sie,<br />
warum Spiro und seine Mitautoren die These auf-‐<br />
stellen, Hypertext würde sich besonders für schlecht-‐<br />
strukturierte Wissensgebiete eignen. Begründen Sie,<br />
warum Spiro meint, das Lernen mit Hypertexten sollte<br />
fortgeschribenen Lernern vorbehalten bleiben und<br />
eigne sich nicht für Anfänger. Oder widerlegen Sie<br />
diese Ansicht.<br />
Weiters diskuHeren Sie, ob es sich bei der CogniHve<br />
Flexibility Theory um eine Theorie handelt.<br />
7. Werkzeuge<br />
Man sollte die Navigation in Hypertext-Umgebungen<br />
nicht nur unter dem Aspekt ihrer Orientierungs- und<br />
Interaktionsfunktion, sondern auch als aktive Form<br />
des Lernens und Arbeitens betrachten. Diese Perspektive<br />
auf die Strukturelemente von Hypertext ist<br />
aus der Sicht des Benutzers oder Lesers möglicher-
10 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
weise die wichtigere: Für die Designer/innen stehen<br />
Nodes und Links im Vordergrund, für die Leser/innen<br />
aber benutzereigene Pfade, Notizen, Annotationen.<br />
Diese Objekte der Struktur bieten ihnen eine<br />
Chance für aktives Arbeiten und Produzieren mit Hypertext.<br />
Als Mittel, die aktives Lernen und Arbeiten in<br />
Hypertext unterstützen, gelten Notizbücher, Instrumente<br />
zum Anlegen von eigenen Links und<br />
Pfaden und für die Konstruktion von eigenen kognitiven<br />
Karten, integrierte Spreadsheets und der direkte<br />
Zugriff auf Datenbanken (zu Annotationen für Intermedia<br />
s. Catlin et al., 1989). Neuwirth et al. (1995)<br />
haben die Möglichkeit für Annotationen in ihren<br />
PREP-Editor eingebaut. Etwas Ähnliches wie Annotationen<br />
sind Pop-Up-Felder oder Pop-Up-Fenster<br />
mit nur-lesbaren Informationen, die nur solange geöffnet<br />
bleiben, wie die Maustaste gedrückt gehalten<br />
wird (Nielsen, 1995, 142ff). Annotationen, die Benutzer/innen<br />
selbst hinzufügen können, also Fenster<br />
für Notizen, können den aktiven Verarbeitungsprozess<br />
der Leser/innen unterstützen. Eine Alternative<br />
zu Annotationen sind Randnotizen oder Marginalien,<br />
die dem eigentlichen Textkorpus nichts hinzufügen,<br />
wohl aber den Benutzerinnen und Benutzern<br />
zur Verfügung stehen. Das MUCH-Programm<br />
(„Many Using and Creating Hypertext“) der<br />
Universität Liverpool (Rada et al., 1993) bietet den<br />
Lernenden sogar ein Instrument für die Anlage eigener<br />
Thesauri. Für die Verknüpfung der Einträge<br />
stehen den Studierenden Link-Typen wie „usedfor“,<br />
„narrower-than“ und „related“ zur Verfügung.<br />
Die Strukturelemente eines Hypertexts nehmen<br />
visuelle Qualitäten an, um sich vom Kontext<br />
deutlich zu unterscheiden und die Aufmerksamkeit<br />
des Lesers erringen zu können, indem sie die<br />
Struktur, zum Beispiel Verbindungen und Knoten,<br />
dem Leser transparent machen. Dabei sind visuelle<br />
Elemente der Benutzeroberfläche mit operationaler<br />
Funktion (Navigation) von funktionalen Bedienungsaspekten<br />
zu unterscheiden. Kahn et al. (1995) erheben<br />
am Beispiel einer Analyse von Intermedia und<br />
StorySpace derartige visuelle Signale zu den „drei<br />
fundamentalen Elementen der visuellen Rhetorik“<br />
von Hypertexten: „These three fundamental elements<br />
are:<br />
▸ link presence (which must include link extent),<br />
▸ link destination (which must include multiple destinations),<br />
▸ link mapping (which must display link and node<br />
relationships)“ (S. 167).<br />
Es gibt bis heute keine Konventionen für die Darstellung<br />
von Knoten und Verknüpfungen im Text.<br />
Einige Programme drucken sensible Textstellen fett,<br />
so dass man „fett“ als Stil ansonsten im Text nicht<br />
mehr verwenden kann. Andere Programme wählen<br />
Unterstreichungen. Einige Programme umrahmen<br />
Texte beim Anklicken, wieder andere invertieren ausgewählten<br />
Text.<br />
Es ist auffällig, dass Hypertext-Systeme sich mit<br />
Ikonen und Metaphern umgeben, die mehr oder<br />
minder konsistent kleine bildliche „Welten“ konstituieren.<br />
Für Hypertext-Umgebungen werden in der<br />
Regel dem jeweiligen Thema adäquate Metaphern gewählt:<br />
Das Buch, das Lexikon, die chronologische<br />
Zeitleiste, die Biographie, der Ort, das Abenteuer, die<br />
Maschine usw. Die Regeln der Benutzung durch den<br />
Lernenden, die Navigation, richten sich dann nach<br />
der jeweiligen Metapher: „Blättern“ im Buch,<br />
„Wandern“ durch eine Landschaft.<br />
An Vorschlägen zur Weiterentwicklung von Hypertext<br />
zu Hybrid-Systemen mangelt es nicht. Sie<br />
zielen auf die Mathematisierung der Navigation, die<br />
Bildung semantischer Netze (Schnupp, 1992, 189),<br />
die tutorielle Begleitung durch Expertensysteme, die<br />
Integration wissensbasierter Generierungstechniken<br />
(S. 192) und den Zugriff auf relationale Datenbanken.<br />
So schlagen Klar et al. (1992) computerlinguistische<br />
Textanalysen in Hypertext-Systemen vor;<br />
Ruge und Schwarz (1990) suchen nach linguistischsemantischen<br />
Methoden zur Relationierung von Begriffen;<br />
Irler (1992) befasst sich mit dem Einsatz von<br />
Bayesian Belief Nets zur Satzgenerierung bis hin zur<br />
automatischen „Generierung von Hypertextteilen auf<br />
der Basis einer formalen Darstellung“ (S. 115).<br />
?<br />
Das World Wide Web mit seiner Hypertext-‐Struktur<br />
hat in wenigen Jahren eine enorme Entwicklung<br />
hinter sich gebracht und großen Erfolg bei Nutzern er-‐<br />
zielt. Überlegen Sie, welche pädagogisch-‐didakHschen<br />
Faktoren möglicherweise dafür ausschlaggebend ge-‐<br />
wesen sind.<br />
Klar (1992), der Hypertext durch Expertensysteme<br />
ergänzen will, folgert, dass „die formalen<br />
Wissensdarstellungen in Expertensystemen und die<br />
informalen Präsentationen in Hypertexten sich<br />
sinnvoll ergänzen können“ (S. 44). Kibby und Mayes<br />
(1993) wollen ihr Programm StrathTutor durch Simulation<br />
des menschlichen Gedächtnisses mit Attributund<br />
Mustervergleichen anreichern und kommen zu<br />
dem Schluss, dass dafür Parallelrechnersysteme angemessener<br />
wären. Ob es sinnvoll ist, derartige Wege<br />
der Komplexitätserhöhung zu beschreiten, lässt sich
zu einem Zeitpunkt kaum entscheiden, in dem bisher<br />
nur wenige umfangreiche und inhaltlich sinnvolle Hypertext-Anwendungen<br />
überhaupt bekannt sind.<br />
8. Zur weiteren Entwicklung von Hypertext<br />
Zur Zeit der Entstehung des World Wide Web im Internet<br />
schien das Netz ein Lesemedium zu sein, in<br />
dem nur wenige Protagonisten Inhalte produzieren<br />
würden. Es gab die Befürchtung, dass alle vor 1988<br />
gedruckten Texte in Vergessenheit geraten würden.<br />
Inzwischen ist durch die Digitalisierung älterer<br />
Schriften, vor allem dank der Initiative von Google,<br />
ein großer Teil älterer Publikationen digitalisiert<br />
worden.<br />
„Die Wüste Internet“, lautete der deutsche Titel<br />
des Buches von Clifford Stoll (1996; orig. „Silicon<br />
Snake Oil“ 1995). Noch 1997 konnte Hartmut<br />
Winkler im Internet nur „ein Medium der Texte und<br />
Schrift“ entdecken und musste folglich den „Hype<br />
um digitale Bilder und Multimedia“ als „Übergangsphänomen“<br />
verkennen. Inzwischen ist das Internet<br />
ein effizienter Träger für Bilder und Animationen, für<br />
Musik, Audio, Video und Film. Die Konvergenz der<br />
Medien ist keine bloße „historische Kompromißbildung“<br />
(ebd.) mehr. Im Digitalen entsteht eine neue<br />
interaktive Gestalt aus der Synthese aller Medien.<br />
?<br />
Es gibt zwar enorm leistungsfähige Suchmaschinen,<br />
doch Ordnung und Transparenz werden<br />
durch die Masse der Angebote und den Wildwuchs<br />
der Standards zugeschüttet, Ontologien, Metadaten<br />
und Taxonomien hinken weit hinter den seit Jahrhunderten<br />
gewachsenen Thesauri der Bibliotheken her.<br />
Das Internet versteht uns nicht, es ist nicht semantisch,<br />
d.h. es kann nicht die Bedeutung von Aussagen<br />
und Sätzen verstehen. Dennoch ist es unverzichtbar<br />
geworden. Wir warten auf die nächste Entwicklungsstufe,<br />
die Tim Berners-Lee und eine Arbeitsgruppe<br />
des W3C unter dem Begriff „Semantic Web“ angekündigt<br />
haben.<br />
Literatur<br />
Denken Sie sich ein Lernexperiment mit einem wis-‐<br />
senschajlichem Inhalt oder Gegenstand aus, der in<br />
Hypertext-‐Form verfasst ist. Überlegen Sie, ob und<br />
wie Sie den Lerneffekt des Experiments nachweisen<br />
könnten.<br />
▸ Akscyn, R.; McCracken, D. & Yoder, E. (1988). KMS: A Distributed<br />
Hypermedia System for Managing Knowledge in Organizations.<br />
In: Communications of the ACM, 7, 31, 820-835.<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 11<br />
▸ Ambron, S. & Hooper, K. (1998). Interactive Multimedia: Visions<br />
of Multimedia for Developers, Educators and Information<br />
Providers, Redmond: Microsoft Press.<br />
▸ Berk, H. (1991). Xanadu. In: E. Berk & J. Devlin (Hrsg.), Hypertext/Hypermedia<br />
Handbook, New York: McGraw-Hill,<br />
524-528.<br />
▸ Berners-Lee, T. & Fischetti, M. (1999). Weaving the Web: The<br />
Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web<br />
by Its Inventor. Harper Collins. deutsch: Der Web-Report: der<br />
Schöpfer des World Wide Webs über das grenzenlose Potential<br />
des Internets. München, Econ (1999).<br />
▸ Bieber, M. & Wan, J. (1994). Backtracking in a Multiple-<br />
Window Hypertext Environment. In: Proceedings of the<br />
ECHT’94 European Conference on Hypermedia Technology,<br />
Edinburgh: 158-166.<br />
▸ Brown, A.L. & Palingscsar, A.S. (1989). Guided, Cooperative<br />
Learning and Individual Knowledge Acquisition. In: L.B.<br />
Resnick (Hrsg.), Knowing, Learning, and Instruction. Essays in<br />
Honor of Robert Glaser, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass,<br />
393-452.<br />
▸ Bush, V. (1945). As We May Think. In: Atlantic Monthly July<br />
1945, 101-108. URL:<br />
http://www.w3.org/History/1945/vbush/vbush-all.shtml<br />
[2010-11-13]<br />
▸ Campagnoni, F.R. & Ehrlich, K. (1989). Information Retrieval<br />
Using a Hypertext-based Help System. In: ACM Transactions<br />
on Information Systems, 3, 7, 271-291.<br />
▸ Canter, D.; Rivers, R. & Storrs, G. (1985). Characterizing User<br />
Navigation Through Complex Data Structures. In: Behaviour<br />
and Information Technology, 2, 4, 93-102.<br />
▸ Catlin, T.J.O. & SMITH, K.E. (1998). Anchors for Shifting<br />
Tides: Designing a ‘seaworthy’ Hypermedia System. In: Proceedings<br />
of the Online Information ’88 Conference London, 15-<br />
25.<br />
▸ Conklin, J. (1987). Hypertext: An Introduction and Survey. In:<br />
IEEE Computer, Sept. 20, 17-41.<br />
▸ Edwars, D.M. & Hardman, L. (1989). Lost in Hyperspace: Cognitive<br />
Mapping and Navigation in a Hypertext Environment.<br />
In: R. McAleese (Hrsg.), Hypertext: Theory into Practice,<br />
Oxford: Intellect Books, 105-125.<br />
▸ Engelbart, D. (1988). The Augmented Knowledge Workshop.<br />
In: A. Goldberg (Hrsg.), A History of Personal Workstations,<br />
Reading MA: Addison-Wesley, 187-236.<br />
▸ Gay, G. & Mazur, F.E. (1991). Combining and Recombining<br />
Multimedia Story Elements. In: Journal of Computing in<br />
Higher Education, 2, 2, 3-17.<br />
▸ Gloor, P.A. (1990). Hypermedia-Anwendungsentwicklung.<br />
Eine <strong>Einführung</strong> mit HyperCard-Beispielen, Stuttgart:<br />
Teubner.<br />
▸ Halasz, F.G. (1988). Reflections on NoteCards: Seven Issues<br />
for the Next Generation of Hypermedia Systems. In: Communications<br />
of the ACM, 31, 836-852.
12 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
▸ Irler, W.J. (1992). Selbsterklärendes kausales Netzwerk zur Hypothesenüberprüfung<br />
im Hypertext. In: U. Glowalla & E.<br />
Schoop (Hrsg.), Hypertext und Multimedia. Neue Wege in der<br />
computerunterstützten Aus- und Weiterbildung, Berlin/Heidelberg:<br />
Springer, 108-117.<br />
▸ Jonassen, D.H. (1989). Hypertext/Hypermedia, Englewood<br />
Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.<br />
▸ Jordan, D.S. & Russell, D.M. et. al. (1989). Facilitating the Development<br />
of Representations in Hypertext with IDE. In: Proceedings<br />
of the ACM Hypertext '89 Conference Pittsburgh,<br />
93-104.<br />
▸ Kahn, P.; Peters, R. & Landow, G.P. (1995). Three Fundamental<br />
Elements of Visual Rhetoric in Hypertext. In: W. Schuler; J.<br />
Hannemann & N.A.Streitz (Hrsg.), Designing User Interfaces<br />
for Hypermedia, Berlin/Heidelberg: Springer, 167-178.<br />
▸ Kibby, M.R. & Mayes, J.T. (1993). Towards Intelligent Hypertext.<br />
In: R. McAleese (Hrsg.), Hypertext: Theory into<br />
Practice, Oxford: Blackwell, 138-144.<br />
▸ Klar, R. (1992). Hypertext und Expertensysteme. Protokoll. In:<br />
U. Glowalla & E. Schoop (Hrsg.), Hypertext und Multimedia.<br />
Neue Wege in der computerunterstützten Aus- und Weiterbildung,<br />
Berlin/Heidelberg: Springer, 43-44.<br />
▸ Klar, R.; Schrader, U. & Zaiß, A.W. (1992). Textanalyse in medizinischer<br />
Software. In: U. Glowalla & E. Schoop (Hrsg.), Hypertext<br />
und Multimedia. Neue Wege in der computerunterstützten<br />
Aus- und Weiterbildung, Berlin/Heidelberg: Springer,<br />
98-207.<br />
▸ Kreitzberg, C.B. & Shneiderman, B. (1988). Restructuring<br />
Knowledge for an Electronic Encyclopedia. In: Proceedings of<br />
the International Ergonomics Association’s 10th Congress,<br />
Sidney, Australia.<br />
▸ Kuhlen, R. (1991). Hypertext. Ein nicht-lineares Medium zwischen<br />
Buch und Wissensbank, Berlin/Heidelberg: Springer.<br />
▸ Landow, G. P. (1992). Bootstrapping Hypertext: Studentcreated<br />
Documents, Intermedia, and the Social Construction<br />
of Knowledge. In: E. Barrett (Hrsg.), Sociomedia: Multimedia,<br />
Hypermedia, and the Social Construction of Knowledge.<br />
Technical Communication and Information Systems, Cambridge/London:<br />
M.I.T. Press, 1992a, 197-217.<br />
▸ Landow, G. P. (1992). Hypertext. The Convergence of Contemporary<br />
Critical Theory and Technology,<br />
Baltimore/London: John Hopkins University Press, 1992b.<br />
▸ Lemke, J.-L. (1992). Intertextuality and Educational Research.<br />
In: Linguistics and Education, 3-4, 4, 257-267.<br />
▸ Lowyck, J. & Elen, J. (1992). Hypermedia for Learning Cognitive<br />
Instructional Design. In: A. Oliveira (Hrsg.), Hypermedia<br />
Courseware: Structures of Communication and Intelligent<br />
Help, Berlin/Heidelberg: Springer, 131-144.<br />
▸ Mantei M. (1982). A Study of Disorientation in ZOG. University<br />
of Southern California.<br />
▸ MCaleese, R. (1993). Navigation and Browsing in Hypertext.<br />
Hypertext: Theory into Practice, Oxford: Blackwell, 5-38.<br />
▸ Morariu, J. & Shneiderman, B. (1986). Design and Research on<br />
The Interactive Encyclopedia System (TIES). In: Proceedings<br />
of the 29th Conference of the Association for the Development<br />
of Computer Based Instructional Systems, 19-21.<br />
▸ Nelson, T.H. (1967). Getting It Out of Our System. In:<br />
Schecter, G. (Hrsg.), Information Retrieval: A Critical Review,<br />
Washington DC: Thompson Books, 191-210.<br />
▸ Nelson, T. (1974). Dream Machines: New Freedoms through<br />
Computer Screens - A Minority Report, Chicago: Hugo's Book<br />
Service.<br />
▸ Neuwirth, C.M., Chandhok, R., Kaufer, D.S., Morris, J.H.,<br />
Erion, P., & Miller, D. (1995).Annotations are not “for free”:<br />
The need for runtime layer support in hypertext engines. In: W.<br />
Schuler, J. Hannemann & N. Streitz, N. (Hrsg.). Designing user<br />
interfaces for hypertexts, Berlin/Heidleberg Springer, 156-166.<br />
▸ Nielsen, J. (1990). Hypertext and Hypermedia, Boston: Academic<br />
Press.<br />
▸ Plaisant, C. (1991). An Overview of Hyperties, its User Interface<br />
and Data Model. In: H. Brown (Hrsg.), Hypermedia /<br />
Hypertext and Object Oriented Databases, London: Chapman<br />
& Hall, 17-31.<br />
▸ Rada, R.; Wang, W. & Birchall, A. (1993). Retrieval Hierarchies<br />
in Hypertext. In: Information Processing and Management, 3,<br />
29, 359-371.<br />
▸ Robertson, C.K.; MCcracken, D. & Newell, A. (1981). The<br />
ZOG Approach to Man-Machine Communication. In: International<br />
Journal of Man-Machine Studies, 14, 461-488.<br />
▸ Ruge, G. & Schwarz, C. (1990). Linguistically based term association:<br />
A new semantic component for a hypertext system. In:<br />
R. Fugmann, (Hrsg.), Tools for Knowledge Organization and<br />
the Human Interface. Proceedings of the 1st International<br />
ISKO-Conference, Frankfurt: Indeks, 88-95.<br />
▸ Russell, D.M.; Moran, T.T. & Jordan, D.S. (1988). The Instructional<br />
Design Environment. In: J. Psotka; L.D. Massey & S.A.<br />
Mutter (Hrsg.), Intelligent Tutoring Systems. Lessons Learned,<br />
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass., 203-228.<br />
▸ Sager, S.F. (1995). Hypertext und Kontext. In: E.M. Jakobs; D.<br />
Knorr & Molitor-Lübbert (Hrsg.), Wissenschaftliche Textproduktion<br />
mit und ohne Computer, Frankfurt/Berlin: Peter Lang<br />
Verlag, 210-226.<br />
▸ Schnupp, P. (1992). Hypertext, München/Oldenbourg.<br />
▸ Schulmeister, R. (2007). Grundlagen hypermedialer Lernsysteme.<br />
Theorie – Didaktik – Design, Wien: Addison-Wesley.<br />
▸ Shneiderman, B. (1989). Reflections on Authoring, Editing, and<br />
Managing Hypertext. In: E. Barrett (Hrsg.), The Society of<br />
Text: Hypertext, Hypermedia, and the Social Construction of<br />
Information, Cambridge: M.I.T. Press, 115-131.<br />
▸ Shneiderman, B. & Kearsley, G.P. (1989). Hypertext Hands-on!,<br />
Reading/MA: Addison-Wesley.<br />
▸ Shneiderman, B.; Kreitzberg, C.B. & Berk, E. (1991). Editing to<br />
Structure a Reader's Experience. In: E. Berk, & J.Devlin<br />
(Hrsg.), Hypertext/Hypermedia Handbook, New York:<br />
McGraw-Hill, 143-164.
▸ Stoll C. (1996). Die Wüste Internet, Frankfurt/Main.<br />
▸ Thiel, U. (1995). Interaction in Hypermedia Systems: From<br />
Browsing to Conversation. In: W. Schuler; J. Hannemann &<br />
N.A. Streitz (Hrsg.), Designing User Interfaces for Hypermedia,<br />
Berlin/Heidelberg: Springer, 43-54.<br />
▸ Ventura C.A. (1988). Why Switch from Paper to Electronic<br />
Manuals? In: Proceedings of the ACM Conference on Document<br />
Processing Systems, Santa Fe: 111-116.<br />
▸ Woodhead, N. (1991). Hypertext and Hypermedia. Theory and<br />
Applications, Reading/MA: Addison-Wesley.<br />
▸ Yankelovich, N.; Meyrowitz, N. & Van Dam, A. (1985).<br />
Reading and Writing the Electronic Book. In: IEEE Computer,<br />
10, 18, 15-30.<br />
Hypertext. Geschichte, Systeme, Strukturmerkmale und Werkzeuge — 13<br />
▸ Yankelovich, N.; Haan, B.J.; Meyrowitz, N.K. & Drucker, S.M.<br />
(1988). Intermedia: The Concept and the Construction of a<br />
Seamless Information Environment. In: IEEE Computer, 1,<br />
21, 81-96.<br />
▸ Ziegfeld, R.; Hawkins, R.; Judd, W. Mahany, R. (1991). Preparing<br />
for a Successful Large-Scale Courseware Development<br />
Project. In: E. Barrett (Hrsg.), Text, ConText, and Hypertext.<br />
Cambridge/London: M.I.T. Press, 211-226.Akscyn, R.; Mc-<br />
Cracken, D. & Yoder, E. (1988). KMS: A Distributed Hypermedia<br />
System for Managing Knowledge in Organizations. In:<br />
Communications of the ACM, 7, 31, 820-835.
Olaf Zawacki-‐Richter<br />
Geschichte des Fernunterrichts<br />
Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0<br />
Die Geschichte des technologiebasierten Lernens und Lehrens soll entlang der Entwicklung und Genera-‐<br />
Bonen technologischer InnovaBonen im Fernunterricht, der damit verbundenen MediencharakterisBka als<br />
eine FunkBon von InterakBon sowie räumlicher und zeitlicher Flexibilität und der ermöglichten didakB-‐<br />
schen Szenarien beschrieben werden. Bei der historischen Entwicklung des technikgestützten Lernens und<br />
Lehrens werden drei GeneraBonen unterschieden: die Korrespondenz-‐GeneraBon (ab ca. 1850), die Tele-‐<br />
kommunikaBons-‐ oder Open-‐University-‐GeneraBon (ab ca. 1960) und die Computer-‐ und Internet-‐Gene-‐<br />
raBon (ab ca. 1990). Schließlich wird die Entwicklung des Online-‐Lernens bis heute beschrieben und auf<br />
neuere Entwicklungen des mobilen und gemeinsamen Lernens im Web 2.0 eingegangen.<br />
Quelle:<br />
Niederländisches NaBonalarchiv,<br />
Spaarnestad Photo, SFA002010354<br />
NaBonaal Archief,<br />
URL: hDp://www.flickr.com/photos/naBonaalarchief/3895374225 [2011-‐01-‐01]<br />
Jetzt Pate werden!<br />
#fernunterricht<br />
#einfuehrung<br />
#geschichte<br />
Version vom 1. Februar 2011<br />
Für dieses Kapitel wird noch ein Pate gesucht,<br />
mehr InformaBonen unter: hDp://l3t.eu/patenschaG
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. <strong>Einführung</strong>: Mediengestützes Lernen und Fernlernen<br />
Technologiegestütztes Lernen ist medienvermitteltes<br />
Lernen. Medien ermöglichen die Erschließung von<br />
Inhalten, zum Beispiel über Selbstlernmaterialien in<br />
gedruckter Form oder über multimedial aufbereitete<br />
Einheiten. Lernen ist ein sozialer Prozess und kommt<br />
daher nicht aus ohne Kommunikation und Feedback<br />
zwischen Lernenden und Lehrenden und auch nicht<br />
ohne Kontakt zwischen den Lernenden. Diese Interaktion<br />
kann heute sehr effektiv durch die modernen<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
(IKT) in Unabhängigkeit von Raum und Zeit, synchron<br />
und asynchron unterstützt werden.<br />
Viele weitere Kapitel in diesem Buch handeln von<br />
dem Einsatz solcher Medien in Lehr- und Lern-Prozessen<br />
aus didaktischer, organisatorischer und technischer<br />
Perspektive. Man kann sagen, dass die Entwicklung<br />
des Internets und die sich daraus ergebenen<br />
didaktischen Möglichkeiten für das Online-Lernen<br />
einen Paradigmenwechsel ausgelöst haben (Peters,<br />
2004). Diese Veränderungen betreffen nicht nur etwa<br />
die traditionellen Fernunterrichtsanbieter oder Fernuniversitäten.<br />
Das technologiegestützte Lernen und<br />
Lehren ist im Mainstream der Bildungsangebote auf<br />
allen Niveaus angekommen. Viele Universitäten<br />
bieten zum Beispiel heute auch Online-Studiengänge<br />
für berufstätige Zielgruppen im Bereich der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung an, und auch das Präsenzstudium<br />
wird durch internetgestützte Angebote ergänzt.<br />
Es gibt E-Learning an Grundschulen, an<br />
Volkshochschulen und natürlich in der betrieblichen<br />
Qualifizierung. Das medienvermittelte Lernen muss<br />
heute keine isolierte Form des Lernens mehr sein.<br />
Die Grenzen zwischen konventionellem Fern- und<br />
Präsenzlernen verschwimmen durch den Einsatz und<br />
die weite Verbreitung der IKT: „The secret garden of<br />
open and distance learning has become public, and<br />
many institutions are moving from single conventional<br />
mode activity to dual mode activity“ (Mills &<br />
Tait, 1999). „Dual mode activity“ bedeutet hier, dass<br />
Bildungsinstitutionen sowohl Präsenzlernen als auch<br />
Fernlernen anbieten. Dies war jedoch nicht immer so.<br />
In diesem Kapitel soll so ein Überblick über die Entwicklung<br />
und Geschichte von technologischen Innovationen<br />
und ihrem Einsatz in Lehr- und Lernprozessen<br />
gegeben werden. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass Institutionen des Fernunterrichts und des Fernstudiums<br />
schon immer sehr früh neu aufkommende<br />
Kommunikationstechnologien genutzt haben. Für<br />
das Fernlernen ist charakteristisch, dass Lernende<br />
und Lehrende räumlich (und zeitlich) voneinander<br />
getrennt sind. Lernprozesse werden daher durch<br />
Medien überhaupt erst ermöglicht.<br />
!<br />
Die Entwicklung des technologiegestützen Lernens<br />
kann als Abfolge medientechnologischer InnovaBonen<br />
beschrieben werden. Eine neue GeneraBon des tech-‐<br />
nikgestützten Lernens wurde durch neue Medien ein-‐<br />
geläutet, die neue Formen der InterakBon und raum-‐<br />
zeitlichen Flexibilität ermöglicht haben.<br />
2. Genera:onen technologischer Innova:onen<br />
Viele Erfindungen und Entwicklungen im Bereich<br />
der Medientechnologie eröffneten neue Wege der<br />
Kommunikation und Betreuung zum Beispiel durch<br />
die Möglichkeit, einen Tutor anzurufen, um eine inhaltliche<br />
Frage zu klären oder die Möglichkeit, bei<br />
einer Bibliothek einen Aufsatz über die Online Fernleihe<br />
zu bestellen (Zawacki-Richter, 2004).<br />
Garrison (1985) unterscheidet drei Generationen<br />
technologischer Innovation, die einen Paradigmenwechsel<br />
des Lernens und Lehrens im Fernstudium<br />
ausgelöst und somit die Qualität des Lernprozesses<br />
nachhaltig verändert haben. Aus historischer Perspektive<br />
sind die drei Meilensteine technologischer<br />
Innovation nach Garrison die Printmedien, die Telekommunikationsmedien<br />
und der Computer. Im<br />
Fernstudium sind Medien, die eine zweikanalige<br />
Kommunikation ermöglichen, von besonderer Wichtigkeit.<br />
Unidirektionale Medien, zum Beispiel das<br />
Radio, Fernsehen oder DVD, werden von Garrison<br />
daher auch als begleitende oder ergänzende Medien<br />
(engl. „ancillary media“) bezeichnet: „[...] other media<br />
are not considered to have significantly altered the<br />
delivery of distance education. The main reason is<br />
the non-interactiveness of media such as radio and<br />
television broadcasts, audio and video cassettes, laser<br />
videodiscs, and audiographics. For this reason, these<br />
media are viewed as being in a separate category,<br />
since they are incapable of providing two-way communication“<br />
(S. 239). Garrison beschreibt die Medien<br />
als eine Funktion von Interaktion der Beteiligten<br />
sowie der räumlichen und zeitlichen Unabhängigkeit<br />
(S. 240). Auch wenn Garrison in den 1980er Jahren<br />
die enorme Entwicklung des Internets nicht vorhersehen<br />
konnte, so erscheint sein Modell trotz des<br />
frühen Entstehungsjahres noch passend, da auch das<br />
heutige technikgestützte Lernen wesentlich durch die<br />
computervermittelte Kommunikation geprägt ist. Im<br />
Folgenden wird die Abfolge medientechnologischer<br />
Innovationen in Anlehnung an Garrison (1985) beschrieben.
!<br />
Geschichte des Fernunterrichts. Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0 — 3<br />
Es lassen sich drei GeneraBonen unterscheiden: die<br />
KorrespondenzgeneraBon (ab ca. 1850), die Telekom-‐<br />
munikaBons-‐ oder FernuniversitätengeneraBon (ab<br />
ca. 1960) und die Computer-‐ und Internet-‐GeneraBon<br />
(ab ca. 1990).<br />
Die Anfänge: Korrespondenzgenera:on<br />
Die erste Generation war der printbasierte Fernunterricht,<br />
in der für das Selbststudium aufbereitete Studienbriefe<br />
verschickt wurden und die Teilnehmer per<br />
Briefwechsel von einem Tutor betreut wurden. Die<br />
Wurzeln des Fernunterrichts und des Fernstudiums<br />
gehen über 250 Jahre in die Vergangenheit zurück.<br />
Bereits 1728 inserierte Caleb Phillipps („Teacher<br />
of the New Method of Short Hand“) in der Boston<br />
Gazette Anzeigen für seine Stenographie-Fernkurse:<br />
„[Any] persons in the country desirous to learn this<br />
art, may by having the several Lessons sent weekly to<br />
them, be as perfectly instructed as those that live in<br />
Boston“ (Battenberg, 1971, 44).<br />
In Europa brachte Gustav Langenscheidt zusammen<br />
mit Charles Toussaint Selbstunterrichtsbriefe<br />
für Französisch-Sprachkurse heraus. Die<br />
beiden entwickelten die „Methode Toussaint-Langenscheidt“<br />
mit der die französische Aussprache in Studienbriefen<br />
vermittelt werden konnte. Die Lautschrift<br />
ist also eine Entwicklung des Fernunterrichts. Die<br />
Durchsetzung der Lautschrift war auch die<br />
Grundlage für die erfolgreiche Gründung des Verlages<br />
von Gustav Langenscheidt im Jahr 1856.<br />
Eine tutorielle Begleitung durch ständigen Briefwechsel<br />
war allerdings in beiden Fällen noch nicht<br />
vorgesehen. So sind diese Formen des Selbstunter-<br />
Abbildung 1: Selbstlernmaterialien um die Jahrhun-‐<br />
dertwende aus dem Archiv der Deutschen Fernstudi-‐<br />
endokumentation an der FernUniversität in Hagen<br />
(Französischkurs mit Lautschrift von Langenscheidt<br />
und Schallplatten zur "Anwendung für Sprechma-‐<br />
schinen"); http://dfsd.fernuni-‐hagen.de<br />
Abbildung 2: Tutorielle Betreuung im brieflichen<br />
Unterricht im Jahr 1901. Quelle: Delling, 1992<br />
richts streng genommen noch nicht als Fernunterricht<br />
zu bezeichnen. Bidirektionale Kommunikation<br />
ist aus dem Institut für brieflichen Unterricht von<br />
Simon Müller in Berlin (1897) überliefert (Delling,<br />
1992).<br />
Die University of London war die erste Universität,<br />
die 1858 Korrespondenzkurse für Auswanderer-<br />
/innen in den Kolonien in Australien, Kanada,<br />
Indien, Neuseeland und Südafrika in ihr Angebot<br />
aufnahm. Eine Studienbetreuung war nicht vorhanden.<br />
Mit einem Postschiff wurden Studienmaterialien<br />
zusammen mit einem Syllabus, Musterklausuren<br />
und einer Liste mit Prüfungsorten und -terminen<br />
verschickt: Eine persönliche Betreuung der<br />
Studierenden gab es nicht (Ryan, 2001). Die ersten<br />
Korrespondenzkurse wurden nicht von Fernstudienspezialisten/innen<br />
geschrieben, sondern von Lehrenden<br />
traditioneller Universitäten – sie waren also<br />
Vorlesungen in schriftlicher Form. Großbritannien<br />
gründete 1875 in Pretoria (Südafrika) die University<br />
of South Africa (UNISA) als erste dezidierte Fernuniversität<br />
der Welt. Sie ist auch heute noch, mit über<br />
200.000 Studierenden, die größte Fernuniversität<br />
Afrikas ( http://unisa.sa.za).<br />
Das Korrespondenzstudium eröffnet die Möglichkeit,<br />
unabhängig von Raum und Zeit zu lernen.<br />
Es wurde bald erkannt, dass mehr Selbstständigkeit<br />
der Studierenden nicht einfach daraus resultiert, dass
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
man sie sich selbst überlässt. So wurde die vorherrschende<br />
unidirektionale Kommunikation, das heißt<br />
der Versand von vorgefertigten Studienmaterialien<br />
von der Institution zu den Studierenden, durch bidirektionale<br />
Kommunikation ergänzt, zum Beispiel<br />
durch Präsenzveranstaltungen, briefliche Tutorien<br />
oder telefonischen Kontakt. Die Möglichkeiten waren<br />
jedoch aufgrund der geringen technischen Entwicklung<br />
sehr begrenzt. Die Antwortzeiten waren in<br />
der Regel lang, da die Kommunikation von der Post<br />
per Eisenbahn oder Schiff abhängig war. Heute<br />
werden die Studierenden allerdings durch einen Mix<br />
von Betreuungsangeboten unterstützt, die im weiteren<br />
Verlauf der Entwicklung eingeführt wurden.<br />
Das Fernstudium der ersten Generation war also<br />
gekennzeichnet durch eingeschränkte bidirektionale<br />
Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden.<br />
Der Kontakt zu anderen Lernenden war allenfalls<br />
im Rahmen von Präsenzveranstaltungen<br />
möglich und somit extrem eingeschränkt.<br />
!<br />
InsBtuBonen des Fernunterrichts und des Fernstu-‐<br />
diums haben schon sehr früh Bildungstechnologien<br />
eingesetzt, da das Lernen und Lehren hier durch<br />
Medien überhaupt erst ermöglich wird. Erste Fernun-‐<br />
terrichtsanbieter gab es im deutschsprachigen Raum<br />
MiDe des 19. Jahrhunderts (Sprachkurse von Gustav<br />
Langenscheidt), die erste Fernuniversität wurde 1875<br />
in Südafrika gegründet.<br />
Telekommunika:ons-‐ oder Fernuniversitätengenera:on<br />
Die zweite Generation in der Entwicklung des Fernstudiums<br />
ist eng mit der fortschreitenden Institutionalisierung<br />
und der Gründung der Open Universities<br />
Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre verknüpft.<br />
Eine Vorreiterrolle nahm die im Jahre 1969<br />
gegründete britische Open University (OUUK) ein.<br />
1974 wurde im deutschsprachigen Raum die Fern-<br />
Universität in Hagen gegründet, die heute nach Studierendenzahlen<br />
(ca. 70.000) die größte Universität<br />
Deutschlands ist. In den neuen Fernuniversitäten<br />
wurde ein systemischer Ansatz angewandt, das heißt<br />
die Prozesse der Kurskonzeption, der mediendidaktischen<br />
Aufbereitung, der Produktion und Distribution<br />
und schließlich die fachliche und organisatorische Betreuung<br />
der Lernenden, unterliegen einem arbeitsteiligen<br />
Prozess des didaktischen Designs (Morrison et<br />
al., 2007).<br />
Eine neue Entwicklung der zweiten Generation<br />
des Fernstudiums war die Eröffnung von Studienzentren,<br />
die ein wichtiges Element des Support-<br />
System darstellen. In Großbritannien werden die Studierenden<br />
durch ein Netz regionaler und lokaler Studienzentren<br />
betreut (Tait, 2000). Nach dem Vorbild der<br />
OUUK haben viele Fernuniversitäten Studienzentren<br />
eingerichtet. Sie eröffnen den Zugang zu Technologie<br />
(zum Beispiel Computer, Videokonferenzanlagen),<br />
Studienmaterialien und Bibliotheksdiensten, sie<br />
bieten Studienberatung durch Fachkräfte, hier<br />
können die Studierenden ihre Kommilitonen treffen<br />
und an tutoriellen Präsenzveranstaltungen teilnehmen<br />
und schließlich auch ihre Prüfungen ablegen. An der<br />
FernUniversität in Hagen werden die Studierenden<br />
über ein Netz von 13 Regionalzentren betreut.<br />
Abbildung 3: Telekolleg in den 1970er Jahren.<br />
Quelle: Eberhard Weiß im Telekolleg (Bildschirmfoto)<br />
Die Telekommunikationsmedien ermöglichen die<br />
elektronische Übertragung von Kommunikation in<br />
Form von Ton, Bild und Text über Telefon und Fax,<br />
Fernsehen, Video und Radio sowie über Audio-,<br />
Video- und auch schon Computerkonferenzen. Die<br />
Telekommunikations-Generation wird daher auch als<br />
„Multimedia Distance Teaching“ bezeichnet (Nipper,<br />
1989). Die Bildungstechnologien spielen nicht nur in<br />
den Fernuniversitäten, sondern auch bei der Betreuung<br />
von Schulkindern in großen Flächenländern<br />
wie Australien in den so genannten „Busch-Schulen“,<br />
in denen früher zum Beispiel CB-Funk in Verbindung<br />
mit Präsenzphasen und Selbstlernmaterialien<br />
eingesetzt wurden, eine wichtige Rolle (Marginson,<br />
1993).<br />
In einer Audiokonferenz können mehrere Teilnehmer/innen<br />
synchron miteinander kommunizieren.<br />
Die langsame Antwortzeit wie beim Korrespondenzstudium<br />
wird drastisch verkürzt. Gleiches<br />
gilt für Videokonferenzen mit dem Unterschied, dass<br />
hier zusätzlich Bilddaten übertragen werden. Dieses<br />
Mehr an synchroner Interaktion wird allerdings mit<br />
reduzierter Skalierbarkeit erkauft. Ein Dilemma, denn<br />
hier nehmen wir Abschied von der gleichgearteten
Geschichte des Fernunterrichts. Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0 — 5<br />
Betreuung einer sehr großen Anzahl von Lernenden,<br />
dem Prinzip der Massenhochschulbildung (Peters,<br />
1997, 24). Die Technik war aufwändig und musste<br />
von lokalen Studienzentren bereitgestellt werden, so<br />
dass die Studierenden nicht von zu Hause aus teilnehmen<br />
konnten, sondern sich zu einem festen Zeitpunkt<br />
an einem bestimmten Ort einfinden mussten.<br />
Die Synchronität der Telekonferenzmedien steht dem<br />
Gedanken, einer möglichst großen Zahl von Personen<br />
einen flexiblen Zugang zum Studium zu ermöglichen,<br />
entgegen. Dies unterstreicht Daniel<br />
( 1 9 9 8 ) i n e i n e r g l ü h e n d e n R e d e v o r<br />
Teilnehmer/innen eines Kongresses von Videokonferenzanbietern,<br />
in der er von einer Krise des Zugangs,<br />
der Kosten und der Flexibilität spricht:<br />
„Group teaching in front of remote TV screens?<br />
This is not only an awful way to undertake distance<br />
learning, but flies in the face of everything that we<br />
have learned while conducing successful open and<br />
supported learning on a massive scale for the past 27<br />
years. Our lessons are the key to addressing the triple<br />
crisis of access, cost and flexibility now facing higher<br />
education world-wide“ (Daniel, 1998, 1).<br />
Um keine Lernenden von der Betreuung mit Telekommunikationsmedien<br />
auszuschließen, muss vor<br />
dem Hintergrund der Ansprüche und Möglichkeiten<br />
der jeweiligen Zielgruppe eine entsprechende Medienauswahl<br />
getroffen werden. In der Regel sind asynchrone<br />
Technologien für die Betreuung räumlich verteilter<br />
Lernender mit unterschiedlichen zeitlichen<br />
Verpflichtungen am besten geeignet. Hier bieten<br />
asynchrone Computerkonferenzen die beste Lösung<br />
(siehe Kapitel #videokonferenz).<br />
Computer-‐ und Internet-‐Genera:on<br />
Große Bedeutung misst Garrison dem computergestützten<br />
Lernen (Computer Assisted Learning,<br />
CAL) bei. CAL-Programme sind Selbstlerneinheiten,<br />
die die Interaktion sowie räumliche und zeitliche Flexibilität<br />
maximieren sollen. Unter Interaktion wird<br />
hier die Interaktion des Lernenden mit dem Computerprogramm<br />
verstanden (Garrison, 1985, 238). Es<br />
hat sich jedoch gezeigt, dass der Programmierte<br />
Unterricht ohne soziale Interaktion und ohne<br />
Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden sowie<br />
den Lernenden untereinander wenig erfolgreich ist<br />
(Schulmeister, 1999). CAL-Programme können allenfalls<br />
eine Ergänzung sein. 1989 veröffentlichte der<br />
britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee von der<br />
„European Organization for Nuclear Research“<br />
(CERN) ein Proposal, in dem er ein dezentral verteiltes,<br />
hypermediales, netzwerkbasiertes System vorstellte<br />
(Berners-Lee, 1989). Das System, welches<br />
später als „World Wide Web“ (WWW) auch außerhalb<br />
von Forschungseinrichtungen populär wurde,<br />
basierte auf Darstellungsservern (Webservern), die<br />
Informationen speichern und verknüpfen sowie Darstellungsclients<br />
(Webbrowsern), welche die gespeicherten<br />
Informationen über das „Hypertext Transfer<br />
Protocol“ (HTTP) von Servern über das Internet abrufen<br />
und auf unterschiedlichen Endgeräten darstellen<br />
konnten. Unter „Hypertext“ versteht man<br />
nicht-linearen Text, der durch Knoten und Links<br />
netzwerkartig verknüpft ist. Erweitert man „Hypertext“<br />
mit zeitdiskreten Medientypen (Bild, Grafik,<br />
usw.) und zeitkontinuierlichen Medientypen (Video,<br />
Audio, Animation, usw.) entsteht „Hypermedia“<br />
(siehe Kapitel #hypertext).<br />
Murray Turoff vom New Jersey Institute of Technology<br />
ist der Erfinder der Computerkonferenzmethode<br />
(Computer-Mediated Communication, CMC)<br />
und Entwickler der CMC-Plattform „Virtual<br />
Classroom“ (Turoff, 1995; Harasim et al., 1995). An<br />
der Open University UK wurde bereits 1988 „CoSy“<br />
(conferencing system) für Online Tutorien mit 1300<br />
Studierenden eingeführt (Mason, 1989; Harasim et<br />
al., 1995). Aus den einfachen Computerkonferenzsystemen<br />
haben sich die heutigen Lern- und Campus-<br />
Management-Systeme entwickelt. Abbildung 5<br />
zeigt eines der ersten Systeme, mit denen die Funktionen<br />
eines virtuellen Campus abgebildet werden<br />
konnten. Unter der Leitung von Linda Harasim<br />
wurde Virtual-U 1994 bis 1995 an der Simon Fraser<br />
University in Canada entwickelt.<br />
Das isolierte Lernen wird im Fernstudium oft als<br />
ein Problem für den Studienerfolg genannt: „Distance<br />
learning can be very isolating, and inadequate<br />
attention to course design, student counselling and<br />
support can yield poor completion rates and the<br />
worst aspects of one-way knowledge transmission“<br />
Abbildung 4: Computerunterstützer Unterricht,<br />
Projekt „MUPID“, TU Graz, 1985<br />
Quelle: http://ftp.iicm.tugraz.at/much/projects/
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
(Brindley & Paul, 1996, 43). Nach Kirkwood (1998)<br />
ist der wertvollste Beitrag, den vernetzte Computer<br />
und die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
für das Fernstudium leisten können, der<br />
persönliche Dialog und Tools für gemeinsames<br />
Lernen und Arbeiten: „The availability of learners to<br />
each other and to the tutor asynchronously as well as<br />
Abbildung 5: Virtual-‐U.<br />
Quelle: Mason, 1998<br />
synchronously, has the potential to overturn the emphasis<br />
on distance education as an individualised<br />
form of learning“ (Thorpe, 2002, 114). Hierin liegt<br />
der Grund für die große Bedeutung des Online-<br />
Lernens, da es die Vorteile der Flexibilität und der<br />
Zugangsmöglichkeiten des Fernstudiums mit den interaktiven<br />
Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Präsenzgruppen<br />
verbindet.<br />
3. Zur Entwicklung des technologiegestützen Lernens<br />
heute<br />
Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich das Online-<br />
Lernen oder E-Learning rasant entwickelt. Im Jahr<br />
2007 haben in den USA 2,9 Millionen Studierende<br />
Online-Kurse belegt, was einer Steigerung zum<br />
Vorjahr von 12,9 Prozent im Vergleich zu 1,2<br />
Prozent im allgemeinen Hochschulsektor entspricht<br />
(Allen & Seaman, 2008). Die steigende Nachfrage<br />
nach technologiegestützen, räumlich und zeitlich flexiblen<br />
Bildungsangeboten, lässt sich am Beispiel des<br />
amerikanischen University of Maryland University<br />
College (UMUC) gut illustrieren, heute einer der<br />
größten Anbieter von Online Studiengängen<br />
weltweit. UMUC wurde 1947 als Weiterbildungseinheit<br />
an der University of Maryland College Park<br />
gegründet und wurde 1972 zur unabhängigen Universität<br />
(Allen, 2004). Noch 1995 waren nur 1.000<br />
von 30.000 Studierenden dieser Universität Fernstudierende,<br />
die hauptsächlich mit gedruckten Studienmaterialien<br />
lernten. Im Jahr 1997 wurde der erste<br />
Online-Kurs mit 110 Studierenden durchgeführt.<br />
Seitdem hat sich die Anzahl der Online-Kurs-Belegungen<br />
auf annähernd 200.000 im Jahr 2009 gesteigert.<br />
Die Zahl der Studierenden hat sich seitdem<br />
auf über 90.000 mehr als verdreifacht (Zawacki-<br />
Richter et al. 2010).<br />
!<br />
?<br />
Zum großen Durchbruch der computervermiDelten<br />
KommunikaBon verhalfen die massenhaGe Ver-‐<br />
breitung der Personalcomputer und die explosions-‐<br />
arBge Entwicklung des Internet mit dem World Wide<br />
Web in den 1990er Jahren. Durch die weltweite Ver-‐<br />
netzung und Verfügbarkeit der Computer sind Kon-‐<br />
takte und der Zugang zu InformaBonen unabhängig<br />
von Raum und Zeit möglich.<br />
Garrison (1985) hat die Entwicklung des medienver-‐<br />
miDelten Lernens und Lehrens entlang von Genera-‐<br />
Bonen technologischer InnovaBonen, die sich ein-‐<br />
ander ablösen, beschrieben. DiskuBeren Sie, ob der<br />
Begriff der GeneraBon hier wirklich passend ist.<br />
Hier ist eine sehr interessante Entwicklung zu beobachten:<br />
Immer mehr jüngere Personen entscheiden<br />
sich nach der Schule für ein Online-Studium. Sie gehören<br />
nicht zum traditionellen Klientel der Fernuniversitäten,<br />
deren Zielgruppe schwerpunktmäßig die<br />
sogenannten „nicht-traditionellen Studierenden“<br />
(Teichler & Wolter, 2004) sind. So schreibt Nick<br />
Allen (2004, 224), damals Präsident von UMUC:<br />
„Unsere Studierendenschaft ist recht heterogen.<br />
Die größte Gruppe ist die der 25 bis 44jährigen, aber<br />
die Gruppe der unter 25jährigen wächst immer<br />
stärker. Das sind eigentlich traditionelle Studierende,<br />
die normalerweise zu einer Präsenzuniversität gehen.<br />
In den USA werden jedoch die Universitäten immer<br />
teurer, so dass viele Studierende arbeiten müssen und<br />
in Teilzeit studieren müssen. So kommen immer<br />
mehr zu uns“ (S. 274, Übersetzung durch den Autor).<br />
Die Grenzen zwischen traditionellen Fern- und<br />
Präsenzuniversitäten verschwimmen also immer<br />
mehr: nicht nur bezüglich des Medieneinsatzes,<br />
sondern auch im Hinblick des Profils ihrer Zielgruppen<br />
(Alheit et al., 2008). Auch die medientechnische<br />
Hard- und Software entwickelt sich immer<br />
weiter. Im folgenden sollen neue Anwendungen des<br />
mobilen Lernens und Web 2.0 (Social Software) vorgestellt<br />
werden, jedoch auch eher aus historischer<br />
Perspektive. Weitere Kapitel in diesem Lehrbuch beschäftigen<br />
sich tiefer gehend mit diesen Themen.
Geschichte des Fernunterrichts. Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0 — 7<br />
Mobiles Lernen<br />
Mobile Endgeräte wie Handys und Tablet-Computer<br />
ermöglichen eine noch stärkere räumliche Flexibilität<br />
als das E-Learning am PC. Das Lernen wird mobil<br />
(„mobile Learning“, Ally, 2009; siehe Kapitel<br />
#mobil). In einer Umfrage zur Entwicklung des mobilen<br />
Lernens im Jahr 2005, auf die Experten/innen<br />
aus 27 verschiedenen Ländern geantwortet haben,<br />
glaubten 78 Prozent der Befragten, dass das Lernen<br />
mit mobilen Endgeräten innerhalb von drei bis fünf<br />
Jahren zum Standard gehören wird. Von den beteiligten<br />
Fernstudieninstitutionen waren bereits 55<br />
Prozent dabei, Inhalte für das mobile Lernen zu entwickeln<br />
beziehungsweise planten dies in Kürze umzusetzen<br />
(Zawacki-Richter et al., 2009).<br />
Die Flexibilität mobiler Technologien eröffnet insbesondere<br />
für die didaktische Gestaltung von Lernprozessen<br />
neue Möglichkeiten für forschendes<br />
Lernen und just-in-time Zugang zu Wissen und Informationen<br />
(Kukulska-Hulme & Traxler, 2005).<br />
Die weltweite Verbreitung mobiler Endgeräte ermöglicht<br />
gerade für die Menschen in Entwicklungsländern<br />
den Zugang zu Bildung. Die Entwicklungsländer<br />
sind gerade dabei, die Entwicklungsstufe des<br />
verkabelten Internets zu überspringen (Brown, 2004;<br />
siehe Kapitel #entwicklungszusammenarbeit). In<br />
einem Fernstudienprojekt an der University of Pretoria<br />
zur Fortbildung von über 20.000 Lehrern und<br />
Lehrerinnen im ländlichen Raum von Südafrika<br />
wurde festgestellt, dass nur 0,4 Prozent der Teilnehmenden<br />
Zugang zu E-Mail hatten, aber 99,4 Prozent<br />
ein Mobiltelefon besaßen. Bereits 2003 wurde daher<br />
in der Lehrerfortbildung mit mobilem Lernen begonnen<br />
(Keegan, 2005).<br />
Gemeinsames Lernen im Web 2.0<br />
Web 2.0 ist eine Bezeichnung zur Beschreibung von<br />
neuen interaktiven Anwendungen des Internet und<br />
WWW. Unter dem Begriff verstand Tim O'Reilly<br />
„design patterns and business models for the next generation<br />
of software“ (O'Reilly, 2005). Der Begriff<br />
steht insbesondere für eine geänderte Wahrnehmung<br />
des Internet. Im Laufe der Zeit entwickelten sich<br />
Content-Management-Systeme und datenbankbasierte<br />
Systeme, die dynamisch aktuelle Inhalte erzeugen.<br />
Der Hauptaspekt beim Web 2.0 ist, dass die<br />
Webseiten nicht mehr wie beim Web 1.0 aus statischen<br />
HTML-Seiten bestehen, sondern die Nutzer<br />
selbst Inhalte erstellen können. Die Philosophie des<br />
Web 2.0 befreit aus der Konsumentenrolle. Typische<br />
Beispiele hierfür sind Wikis, Weblogs, Social Tagging<br />
(gemeinschaftliches Indexieren) sowie Bild- und<br />
Video-Sharing-Portale. Die Nutzung dieser interak-<br />
tiven Technologien auch für das Online-Lernen liegt<br />
auf der Hand, denn das „Social Web“ und „Social<br />
Software“ bieten sich in besonderer Weise für das kooperative<br />
Lernen an (Erpenbeck & Sauter, 2007).<br />
Es entsteht eine Vielzahl von Web-Angeboten, die<br />
über keinen eigenen Datenbestand verfügen, sondern<br />
lediglich Daten von Dritten zu neuen Diensten kombinieren<br />
(„Mash-Up“; siehe Kapitel #webtech). Vor<br />
allem die Kreativität der Nutzer/innen ist ein tragendes<br />
Element der Web-2.0-Kultur (Surowiecki,<br />
2005). Dienste wie zum Beispiel FlickR oder Wikipedia<br />
leben von der aktiven Inhaltsgenerierung ihrer<br />
Nutzer/innen. Die Grenzen zwischen Produzenten<br />
und Konsumenten aus der Web-1.0-Phase verschwinden<br />
zunehmend. Nachdem das Internet Computer<br />
verband und das WWW Informationen verknüpft,<br />
verbindet nun das Web 2.0 Menschen miteinander.<br />
Angebote „sozialer Netzwerke“ wie Xing, Facebook,<br />
StudiVZ und YouTube aber auch neue<br />
Kommunikationsmedien wie Blogs schaffen ausdifferenzierte<br />
Räume der (teil-) öffentlichen Kommunikation<br />
im Internet, die eine zunehmende individualisierte<br />
Nutzung des Mediums Internets begünstigen<br />
(Wolling, 2009). Vor allem die intuitive Bedienung<br />
und einfache Vernetzungsmöglichkeit der verschiedenen<br />
Web-2.0-Dienste untereinander sind die wesentlichen<br />
Gründe für den Erfolg des „Mitmach-<br />
Netzes“.<br />
Zudem können verschiedene Anwendungen von<br />
Lernenden individuell zu einer personalisierten Lernumgebung<br />
kombiniert werden. „Personal<br />
Learning Environments“ (PLE) sind webbasierte<br />
Mashups, die den Lernenden als individuelle Lernumgebungen<br />
dienen (Attwell, 2007). Sie basieren auf der<br />
individuellen Selektion und Aggregation von verschiedenen<br />
Diensten aus dem Internet durch die<br />
Nutzer/innen selbst. Mit den sozialen Netzen im<br />
Web 2.0 und den PLE rückt das selbstgesteuerte und<br />
aktive Lernen der Studierenden mehr in den Fokus<br />
(Schaffert & Kalz, 2009; siehe Kapitel #systeme):<br />
„Given the amount of attention that communication<br />
features and learning from peers (not just instructors)<br />
have received even in the traditional eLearning<br />
context over the past few years, it is easy to see that<br />
this strong social streak in the Web 2.0 movement directly<br />
plays into the hands of any effort to increase<br />
knowledge sharing and transfer“ (Rollett et al.,<br />
2007, 97).<br />
!<br />
Die Nutzung mobiler Endgeräte und Anwendungen<br />
des Web 2.0 (Social SoGware) eröffnen neue Möglich-‐<br />
keiten des ubiquitären, gemeinsamen Lernens.
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
?<br />
?<br />
Betrachten Sie die Entwicklung des Fernunterrichts<br />
aus PerspekBve der Lernenden: Was waren und sind<br />
wohl ihre MoBve und Anlässe, keinen Präsenzunter-‐<br />
richt zu besuchen? Wie hat sich dies im Lauf der Zeit<br />
gewandelt?<br />
Betrachten Sie die Entwicklung des Fernunterrichts<br />
aus PerspekBve der Lehrenden: Wie wandelte sich<br />
ihre Aufgaben und unterrichtlichen Möglichkeiten im<br />
Laufe der Zeit?<br />
Literatur<br />
▸ Alheit, P.; Rheinländer, K., & Watermann, R. (2008). Zwischen<br />
Bildungsaufstieg und Karriere - Studienperspektiven "nicht-traditioneller<br />
Studierender". In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,<br />
11, 577-606.<br />
▸ Allen, E., & Seaman, J. (2008). Staying the course – Online<br />
Education in the United States, 2008. URL: http://www.sloanc.org/publications/survey/pdf/staying_the_course.pdf<br />
[2009-<br />
11-17].<br />
▸ Allen, N. H. (2004). The University of Maryland University<br />
College: Institutional models and concepts of student support.<br />
In: J. E. Brindley; C. Wälti & O. Zawacki-Richter (Hrsg.),<br />
Learner support in open, online and distance learning environments,<br />
Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der<br />
Universität Oldenburg, 273-281.<br />
▸ Ally, M. (2009). Mobile learning - Transforming the delivery of<br />
education and training, Athabasca (Kanada): Athabasca University<br />
Press.<br />
▸ Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments - the<br />
future of eLearning?. In: eLearning Papers, 2(1).<br />
▸ Battenberg, R. W. (1971). The Boston Gazette, March 20, 1728.<br />
In: Epistolodidaktika, 1, 44-45.<br />
▸ Berners-Lee, T. (1989). Information Management: A Proposal,<br />
CERN. URL: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html<br />
[2010-07-28].<br />
▸ Borchers, D. (2003). 10 Jahre Mosaic, Hamburg: Heise Zeitschriften<br />
Verlag. URL: http://www.heise.de/newsticker/10-<br />
Jahre-Mosaic--/meldung/41870 [2003-11-09].<br />
▸ Brindley, J. E., & Paul, R. (1996). Lessons from distance education<br />
for the university of the future. In: R. Mills & A. Tait<br />
(Hrsg.), Supporting the learner in open and distance learning,<br />
London: Pitman Publishing, 43-55.<br />
▸ Brown, T. (2004). The role of m-learning in the future of elearning<br />
in Africa. In: D. Murphy; R. Carr; J. Taylor & W. Tatmeng<br />
(Hrsg.), Distance education and technology: issues and<br />
practice, Hong Kong: Open University of Hong Kong Press,<br />
197-216.<br />
▸ Daniel, J. (1998). Can you get my hard nose in focus? Universities,<br />
mass education and appropriate technology. In: M. Eisenstadt<br />
& T. Vincent (Hrsg.), The Knowledge Web - Learning<br />
and Collaborating on the Net, London: Kogan Page, 21-29.<br />
▸ Delling, R. M. (1992). Zur Geschichte des Fernstudiums - Eine<br />
Ausstellung des Deutschen Instituts für Fernstudien an der<br />
Universität Tübingen vom 15. Juni bis 11. Juli 1992. Tübingen:<br />
DIFF.<br />
▸ Erpenbeck, J. & Sauter, W. (2007). Kompetenzentwicklung im<br />
Netz - New Blended Learning im Web 2.0. Köln: Luchterhand.<br />
▸ Garrison, D. R. (1985). Three generations of technological innovation<br />
in distance education. In: Distance Education, 6(2),<br />
235-241.<br />
▸ Harasim, L.; Hiltz, S. R.; Teles, L.; & Turoff, M. (1995).<br />
Learning Networks: A Field Guide to Teaching and Learning<br />
Online. Cambridge: MIT Press.<br />
▸ Keegan, D. (2005). The incorporation of mobile learning into<br />
mainstream education and training. In: World Conference on<br />
Mobile Learning, Cape Town.<br />
▸ Kirkwood, A. (1998). New media mania: Can information and<br />
communication technologies enhance the quality of open and<br />
distance learning?. In: Distance Education, 19(2), 228-241.<br />
▸ Kukulska-Hulme, A. & Traxler, J. (2005). Mobile learning - a<br />
handbook for educators and trainers. London: Routledge.<br />
▸ Marginson, S. (1993). Education and public policy in Australia.<br />
Cambridge: Cambridge University Press.<br />
▸ MMason, R. (1998). Models of online courses. In: ALN Magazine,<br />
2(2).<br />
▸ Mills, R.; & Tait, A. (1999). The convergence of distance and<br />
conventional education: Patterns of flexibility for the individual<br />
learner. London: Routledge.<br />
▸ Morrison, G. R.; Ross, S. M. & Kemp, J. E. (2007). Designing<br />
effective instruction. Hoboken (NJ): Wiley.<br />
▸ Nipper, S. (1989). Third generation distance learning and computer<br />
conferencing. In: R. Mason & A. Kaye (Hrsg.), Mindweave:<br />
Communication, Computers and Distance Education,<br />
Oxford: Pergamon Press, 63-73.<br />
▸ O'Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0 - Design Patterns and<br />
Business Models for the Next Generation of Software. URL:<br />
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [2010-<br />
07-28].<br />
▸ Peters, O. (1997). Didaktik des Fernstudiums - Erfahrungen<br />
und Diskussionsstand in nationaler und internationaler Sicht.<br />
Grundlagen der Weiterbildung. Berlin: Luchterhand.<br />
▸ Peters, O. (2004). The educational paradigm shifts. In: O. Peters<br />
(Hrsg.), Distance education in transition - new trends and challenges,<br />
Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der<br />
Universität Oldenburg, 25-35.<br />
▸ Rollett, H.; Lux, M.; Strohmaier, M.; Dosinger, G. & Tochtermann,<br />
K. (2007). The Web 2.0 way of learning with technologies.<br />
In: International Journal of Learning Technology, 3(1),<br />
87-107.<br />
▸ Ryan, Y. (2001). The provision of learner support services<br />
online. In: G. Farrel (Hrsg.), The changing faces of virtual education,<br />
Vancouver (Kanada): The Commonwealth of Learning,<br />
71-94.
Geschichte des Fernunterrichts. Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0 — 9<br />
▸ Schaffert, S. & Kalz, M. (2008). Persönliche Lernumgebungen:<br />
Grundlagen, Möglichkeiten und Herausforderungen eines<br />
neuen Konzeptes. In: K. Wilbers & A. Hohenstein (Hrsg.),<br />
Handbuch E-Learning, Cologne, Deutschland: Deutscher<br />
Wirtschaftsdienst, 1-24.<br />
▸ Schulmeister, R. (1999). Virtuelle Universitäten aus didaktischer<br />
Sicht. In: Das Hochschulwesen - Forum für Hochschulforschung,<br />
-praxis und -politik, (6), 166-174.<br />
▸ Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. New York:<br />
Anchor.<br />
▸ Tait, A. (2000). Planning student support for open and distance<br />
learning. In: Open Learning, 15(3), 287-299.<br />
▸ Teichler, U. & Wolter, A. (2004). Zugangswege und Studienangebote<br />
für nicht-traditionelle Studierende. In: Die Hochschule,<br />
2, 64-80.<br />
▸ Thorpe, M. (2002). Rethinking learner support: the challenge<br />
of collaborative online learning. In: Open Learning, 17(2), 106-<br />
119.<br />
▸ Turoff, M. (1995). Designing a Virtual Classroom [TM].<br />
Hsinchu, Taiwan.<br />
▸ Vogt, S. (2005). Das Internet - Technologien, Medienprodukte<br />
und Konvergenzen im Überblick. In: H. Krömker & P. Klimsa<br />
(Hrsg.), Handbuch Medienproduktion. Produktion von Film,<br />
Fernsehen, Hörfunk, Print, Internet, Mobilfunk und Musik,<br />
Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 437-465.<br />
▸ Wolling, J. (2009). Individualisierung der Mediennutzung : Perspektiven<br />
der Forschung. In: H. Schade; H. Walterscheid & J.<br />
Wolling (Hrsg.), Individualisierte Nutzung der Medien: Tagungsband<br />
Medienforum Ilmenau 2008 ; Technische Universität<br />
Ilmenau, 20. - 21. Juni 2008, Ilmenau: Universitäts-Verlag<br />
Ilmenau, 7-18.<br />
▸ Zawacki-Richter, O. (2004). Support im Online Studium - Die<br />
Entstehung eines neuen pädagogischen Aktivitätsfeldes. Innsbruck:<br />
StudienVerlag.<br />
▸ Zawacki-Richter, O.; Bäcker, E. M. & Bartmann, S. (2010).<br />
"Lernen in beweglichen Horizonten...": Internationalisierung<br />
und interkulturelle Aspekte des E-Learning. In: K. Wilbers &<br />
A. Hohenstein (Hrsg.), Handbuch E-Learning, 32. Ergänzungslieferung,<br />
1-20.<br />
▸ Zawacki-Richter, O.; Brown, T. & Delport, R. (2009). Mobile<br />
learning: From single project status into the mainstream?. In:<br />
European Journal of Open, Distance and E-Learning.URL:<br />
http://www.eurodl.org/index.php?article=357 [2010-07-28].
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Grundlagen<br />
In diesem Abschnitt wird der Begriff des Informationssystems<br />
erläutert und was man im Lehr-/Lernkontext<br />
darunter versteht. Anschließend erfolgt ein<br />
Überblick über die Verteilungsmöglichkeiten derartiger<br />
Systeme in Computernetzwerken.<br />
Informa1onssysteme zum Lernen und Lehren<br />
Ganz allgemein sind Informationssysteme eben jene,<br />
die Informationen verarbeiten, genauer: sie unterstützen<br />
die Nutzer bei der Erfassung, Übertragung,<br />
Transformation, Speicherung und Bereitstellung von<br />
Informationen verschiedenster Art (Ferstl & Sinz,<br />
2006, 1). Daher bestehen Informationssysteme aus<br />
der Gesamtheit aller Daten und den nötigen Verarbeitungsanweisungen.<br />
Das Wesentliche daran besteht<br />
in der Zusammenführung, Verwaltung und Bereitstellung<br />
bzw. Präsentation von Daten unter einem<br />
thematischen Gesichtspunkt. So gesehen bilden die<br />
Server des World Wide Web das weltweit größte Informationssystem.<br />
Informationssysteme, die speziell<br />
für die Organisation und Durchführung von Lehrund<br />
Lernprozessen entwickelt wurden, verarbeiten<br />
ebenfalls Informationen, nämlich die, die zur Erstellung<br />
und Verwaltung von Lernressourcen, Lehrenden<br />
und Lernenden benötigt werden.<br />
!<br />
Informa;onssysteme für das Lernen und Lehren verar-‐<br />
beiten die Informa;onen, die für die Erstellung und<br />
Verwaltung von Lernressourcen, Lehrenden und Ler-‐<br />
nenden benö;gt werden.<br />
Die Verarbeitung der Informationen kann dabei<br />
auf dem eigenem Computer stattfinden. Häufiger<br />
werden jedoch Dienste über Netzwerke in Anspruch<br />
genommen, die auf eine zentrale Datenbank zu-<br />
Funk1onen Beispiele (Musterlösungen)<br />
greifen und diese Daten für die Benutzerinnen und<br />
Benutzer grafisch sinnvoll darstellen. Dadurch wird<br />
nicht nur das Halten größerer Datenmengen, die zentrale<br />
Sicherung, die Ausfallsicherheit und die Bereitstellung<br />
höherer Rechenleistung möglich, sondern<br />
auch die Kommunikation zwischen den Benutzerinnen<br />
und Benutzern. So können neben der Verwaltung<br />
von Lernaktivitäten durch Lehrende auch die<br />
Lernenden bei Rückfragen mit den Kursleiterinnen<br />
und Kursleitern oder anderen Kursteilnehmer/innen<br />
in Kontakt treten.<br />
?<br />
BiGe ergänzen Sie zur Tabelle 1 Beispiele für die Verar-‐<br />
beitung von Informa;onen, die von Informa;onssys-‐<br />
temen zum Lehren und Lernen bereitgestellt<br />
und/oder unterstützt werden sollen.<br />
Netzwerkarchitektur für Informa1onssysteme – ein<br />
Überblick<br />
Zum selbstständigen Lernen können Lernmaterialien<br />
auf CD, USB-Stick oder einem anderen Datenträger<br />
bereitgestellt werden. Lehrende und Lernende<br />
müssen sich dann keine Gedanken über Internetverbindung<br />
und Netzwerkarchitektur machen, haben<br />
aber auch keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren<br />
oder Gruppenarbeiten durchzuführen. Soll<br />
mehr als eine Benutzerin oder ein Benutzer mit dem<br />
Informationssystem arbeiten, folgt unweigerlich die<br />
Frage, wie die Zusammenarbeit realisiert werden<br />
kann. Genauer: Wie kann man erreichen, dass alle<br />
Benutzer/innen Zugriff auf das Informationssystem<br />
und die darin befindlichen Daten haben?<br />
Ein erster und sehr einfacher Ansatz wäre es, alle<br />
Computer der Nutzer miteinander zu verbinden. In<br />
einem solchen Peer-to-Peer-Netzwerk wären alle<br />
Nutzer direkt miteinander vernetzt und tauschen Informationen<br />
untereinander aus (Stein, 2008, 489).<br />
Informa;onen erfassen Lernerdaten in Datenbank schreiben, Neue Kursdaten einstellen, Lerninhalte erstellen<br />
Informa;onen übertragen Lernerdaten bei Einschreibung im Kurs zur Verfügung stellen, Termine aus dem Kurskalen-‐<br />
der in den persönlichen Kalender des Lernenden überführen<br />
Informa;onen transformieren Reports aus Lernergebnissen erstellen, Bildgrößen für Darstellung anpassen, Vorlagen an-‐<br />
wenden<br />
Informa;onen speichern Lernergebnisse ablegen, Lerninhalte speichern...<br />
Informa;onen bereitstellen eingeschriebene Kursteilnehmer/innen, Testergebnisse<br />
Tabelle 1: Informationen, die von Informationssystemen zum Lehren und Lernen bereitgestellt werden
!<br />
Abbildung 1: Peer-‐to-‐Peer-‐Netzwerk<br />
In einem Peer-‐to-‐Peer-‐Netzwerk sind alle Computer<br />
gleichrangig miteinander verbunden und tauschen In-‐<br />
forma;onen und Dienste untereinander aus.<br />
Das Problem hierbei ist sicherzustellen, dass auch alle<br />
Informationen zu jeder Zeit verfügbar sind – auch<br />
dann, wenn die Benutzer ihren Computer ausschalten.<br />
Würde man also ein Informationssystem<br />
zum Lernen und Lehren in einem solchen Netzwerk<br />
realisieren, müsste man entweder<br />
▸ damit rechnen, dass einige Informationen und<br />
Dienste nicht immer erreichbar sind, oder<br />
▸ es müssten die gleichen Informationen auf mehreren<br />
Computern hinterlegt werden, was enorme<br />
Anforderungen an die Versionsverwaltung stellen<br />
würde, nur um sicher zu gehen, dass jeder mit den<br />
aktuellen Informationen arbeitet (Niegemann, et<br />
al., 2008, 459f).<br />
In der Praxis: Schwankungen an Hochschulen<br />
In Hochschulen gibt es erfahrungsgemäß zwei Zeiträume im<br />
Semester, an denen die Anzahl von Benutzer/innen von zen-‐<br />
tralen Informa;onssystemen besonders hoch ist: zu Beginn<br />
des Semesters zur Einschreibung in die Lehrveranstaltung<br />
und am Ende zur Einschreibung in die Klausuren. Da die Zahl<br />
der eingeschriebenen Studierenden von Semester zu<br />
Semester stark schwanken kann (zum Beispiel durch gebur-‐<br />
Informa;onssysteme. Technische Anforderungen für das Lernen und Lehren — 3<br />
Aus diesem Grund sind die meisten Informationssysteme<br />
Client-Server-Anwendungen. Durch die<br />
Installation des Informationssystems auf einem zentralen<br />
Server ermöglicht man es allen Nutzerinnen<br />
und Nutzern, gemeinsam auf die dort gespeicherten<br />
Informationen und Dienste zugreifen zu können. Da<br />
die Arbeit mit dem Informationssystem mittlerweile<br />
häufig über den Internetbrowser erfolgt und selten<br />
eine spezielle Zugriffssoftware benötigt wird, benötigen<br />
die Anwender-PC (Clients) oft lediglich einen<br />
Zugang zum (globalen) Inter- bzw. firmeneigenen Intranet<br />
(Niegemann et al. 2008, 458f).<br />
!<br />
Abbildung 2: Client-‐Server-‐Architektur<br />
In einer Client-‐Server-‐Architektur stellt ein zentraler<br />
(Groß-‐) Rechner, der sogenannte Server, Daten und<br />
Dienste für die Nutzer/innen zur Verfügung, die mit<br />
ihren Computern (Clients) über das Inter-‐ oder firme-‐<br />
neigene Intranet darauf zugreifen können.<br />
Am deutlichsten spürt man bei Client-Server-Architekturen,<br />
wenn der Server überlastet ist, das heißt zu<br />
viele Zugriffe zur selben Zeit bearbeitet werden<br />
tenschwache/-‐starke Jahrgänge), sollte immer wieder ge-‐<br />
prü] werden, ob die verfügbare Rechenleistung des Servers<br />
noch genug ist oder ob ggf. aufgestockt werden muss. Eine<br />
gute Strategie ist es auch, die Termine für die Einschrei-‐<br />
bungen nach Fakultäten, Lehrstühlen oder Fächern zu<br />
staffeln und die Zugriffe so zeitlich zu verteilen.
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Kriterien Peer-‐to-‐Peer (Musterlösungen) Client-‐Server (Musterlösungen)<br />
Dienste und Informa;onen liegen<br />
(hauptsächlich) auf<br />
den Anwender-‐PC dem Server<br />
Zum Auaau des Netzes muss zu-‐ nein (bei aktueller Grundausrüstung von Ja, der Server<br />
sätzliche Hardware angeschafft<br />
werden<br />
PC)<br />
Erweiterbarkeit Mit jedem neuen PC, wird aber zuneh-‐<br />
mend unübersichtlicher und langsamer<br />
Neue Hardware für Server<br />
Vorteile schneller Auaau<br />
Zentrale Steuerung, Datenhaltung<br />
sollen. Es muss daher stets darauf geachtet werden,<br />
dass genügend Rechenleistung zur Verfügung steht.<br />
Hierfür muss die Zahl der Benutzer/innen abgeschätzt<br />
werden, die gleichzeitig die Dienste des<br />
Servers in Anspruch nehmen möchten. Hieran<br />
sollten Hauptspeichergröße, Prozessorleistung und<br />
Festplattengeschwindigkeit des Servers angepasst<br />
werden (Niegemann et al. 2008, 160f). Des Weiteren<br />
ist zu überlegen, wie ausfallsicher der Server in Bezug<br />
auf Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sein soll.<br />
Systeme, bei denen eine hohe Verfügbarkeit wichtig<br />
ist, werden in der Regel als Cluster ausgeführt, das<br />
heißt der „Server“ besteht aus mehren, miteinander<br />
vernetzten Rechnern. Der Ausfall eines Cluster-<br />
Rechners stört den Gesamtbetrieb im Idealfall kaum.<br />
Zuverlässige Systeme verfügen außerdem über eine<br />
(hoch-) redundante Datenspeicherung, sodass der<br />
Ausfall einzelner Festplatten und damit verbunden<br />
deren Reparatur im laufenden Betrieb durchgeführt<br />
werden kann, ohne die Aufgaben des Clusters zu beeinträchtigen.<br />
Ein einzelner Server kann zudem nicht<br />
beliebig aufgerüstet werden und so von vornherein<br />
nur eine gewisse maximale Anzahl von parallelen Be-<br />
?<br />
rela;v kostengüns;g<br />
Nachteile die Verfügbarkeit aller Daten kann nicht<br />
gewährleistet werden (abhängig davon,<br />
welche Knoten gerade online sind)<br />
keine zentrale Datensicherung<br />
Versionsverwaltung schwierig<br />
Datensicherheit problema;sch<br />
Beispiele für Anwendungen Instant Messaging (zum Beispiel ICQ,<br />
Skype)<br />
File Sharing<br />
Tabelle 2: Peer-‐to-‐Peer und Client-‐Server Architekturen im Vergleich<br />
Vergleichen Sie Peer-‐to-‐Peer-‐ und Client-‐Server-‐Archi-‐<br />
tekturen miteinander. Eine mögliche Lösung finden<br />
Sie in Tabelle 2. Wie unterscheidet sich Ihre Dar-‐<br />
stellung davon?<br />
Bei Problemen oder Überlastung kein Zu-‐<br />
griff auf Daten<br />
Kosten für Server, Installa;on, Laufzeit und<br />
Wartung<br />
Social Media<br />
Lernmanagementsystem<br />
nutzerinnen und Benutzern bedienen. Bei einer<br />
Cluster-Lösung können dagegen bei Bedarf weitere<br />
Rechner hinzugefügt werden um den Betrieb bei<br />
hoher Benutzer/innen-Zahl zu gewährleisten.<br />
2. Werkzeuge zum Lernen und Lehren<br />
Bei der <strong>Einführung</strong> von Informationssystemen zum<br />
Lernen und Lehren stehen Unternehmen, Hochschulen<br />
und andere Bildungseinrichtungen stets den<br />
selben Fragen gegenüber:<br />
▸ Wie können Lehr- und Lerninhalte zu (digitalen)<br />
Lernmaterialien aufbereitet werden?<br />
▸ Und wie können Lerner, Lehrer und Lernmaterialien<br />
möglichst bedarfsgerecht zusammengeführt<br />
werden?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragen und Deckung des<br />
daraus entstehenden Bedarfs an Softwarelösungen<br />
sind besonders zwei Werkzeugklassen relevant: Autorenwerkzeuge<br />
(und Lerncontentmanagementsysteme)<br />
zum Erstellen von Lerninhalten und Lernmanagementsysteme<br />
zur Verwaltung der Lernprozesse.<br />
!<br />
Eine Liste von konkreten Werkzeugen zum Lernen und<br />
Lehren finden Sie in der Mr-‐Wong-‐Gruppe von L3T<br />
hGp://www.mister-‐wong.de/ unter #lms #infosysteme<br />
#l3t.
Andere Werkzeuge, wie kollaborative Systeme oder<br />
Weblogs können ebenfalls, vor allem in informellen<br />
Ansätzen, für das Lernen und Lehren verwendet<br />
werden, haben aber keine exklusive Ausrichtung auf<br />
Lehr- und Lernprozesse bzw. werden in anderen Kapiteln<br />
behandelt.<br />
3. Autorenwerkzeuge und Lerncontentmanagement-‐<br />
systeme: Was wird zur Erstellung von Lernmaterialien<br />
benö1gt?<br />
Materialien für das Lernen am Computer können mit<br />
einfachen HTML-Editoren und Entwicklungsumgebungen<br />
für die zum Beispiel von Adobe angebotene<br />
Anwendung Flash oder ähnlichem erstellt werden.<br />
Das Problem ist häufig, dass die Lehrenden nicht<br />
über die nötigen (Programmier-) Kenntnisse verfügen,<br />
um mit diesen einfachen und unspezialisierten<br />
Werkzeugen ansprechende Lernmaterialien zu erstellen.<br />
Autorenwerkzeuge wurden speziell für die<br />
Bedürfnisse von Anwender/innen wie zum Beispiel<br />
Lehrende entwickelt und sollen diese bei der multimedialen<br />
und didaktischen Aufbereitung der Lerninhalte<br />
unterstützen (Seufert & Mayr, 2002).<br />
Abbildung 3: In Autorenwerkzeugen werden<br />
verschiedene Medien zu Lernmaterialien au
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Schritten Fragen zu erstellen, die automatisch ausgewertet<br />
werden können. Die Verfügbarkeit verschiedener<br />
Fragetypen wie beispielsweise Multiple- und<br />
Single-Choice, Zuordnungsfragen oder Lückentexte<br />
ist dabei ebenso wichtig wie die Möglichkeit, dem<br />
Lerner je nach Ergebnis ein differenziertes Feedback<br />
geben zu können.<br />
Vorlagen erleichtern das Erstellen einheitlicher<br />
Kursabschnitte und die Einhaltung einer konsistenten<br />
Navigation.<br />
Um den fertigen Kurs schließlich verteilen zu<br />
können, müssen die Kurse so exportiert werden, dass<br />
die Lerner sie bearbeiten können. Hierfür sind zunächst<br />
Exportmöglichkeiten als selbstlaufende Anwendungen<br />
(zumeist .exe) oder als HTML-Dateien<br />
für die Darstellung im Browser geeignet. Um den<br />
Kurs über ein Lernmanagementsystem bereitzustellen,<br />
sollte er als SCORM-Paket exportiert werden.<br />
Dieser E-Learning-Standard ermöglicht es, dass beispielsweise<br />
Testergebnisse aus dem Kurs heraus an<br />
die Bewertungswerkzeuge des Lernmanagementsystems<br />
übergeben werden können.<br />
!<br />
Autorensysteme unterstützen die Erstellung von Lern-‐<br />
materialien (weitestgehend) ohne Programmierkennt-‐<br />
nisse. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen:<br />
▸ Funk;onen zur Textverarbeitung<br />
▸ Integra;on und Anpassung von Grafiken<br />
▸ EinbeGung und Steuerung gängiger Videoformate<br />
▸ Einbinden von steuerbaren oder automa;sch star-‐<br />
tenden Audiosequenzen<br />
▸ Erstellen einfacher Anima;onen<br />
▸ Einfache Erstellung von Wissenstests mit automa-‐<br />
;sierter Auswertung und differenziertem Feed-‐<br />
back<br />
▸ Unterstützung von Vorlagen und einheitlicher Na-‐<br />
viga;onsstrukturen<br />
▸ Exportmöglichkeiten als selbstlaufende An-‐<br />
wendung, als HTML-‐Dateien und SCORM-‐Paket<br />
Für Autorinnen und Autoren bieten Autorenwerkzeuge<br />
oft alle nötigen Funktionalitäten, um Lernmaterialien<br />
professionell und in relativ kurzer Zeit zu erstellen.<br />
Die Erstellung von Lernmaterialien, insbe-<br />
In der Praxis: Wann werden mehrere Autorinnen und Autoren benötigt?<br />
Beim Vorliegen einer oder mehrerer folgender Gründe ist die<br />
Zusammenarbeit mehrerer Autorinnen und Autoren not-‐<br />
wendig (Lorenz & Faßmann, 2010): (a) Die Erstellung der<br />
Lernmaterialien ist für einen Autor zu umfangreich. (b) Für<br />
Fachwissen sollen bzw. müssen die jeweiligen Experten ein-‐<br />
gebunden werden. (c) Für die Erstellung und Anbindung von<br />
sondere bei größeren Lehrveranstaltungen oder Trainingsreihen,<br />
werden aber immer öfter von Autorenteams<br />
übernommen.<br />
Bei der Zusammenarbeit mehrerer Autorinnen<br />
und Autoren und anderen steigenden Ansprüchen<br />
stößt man schnell an die Grenzen der Einzelplatzlösungen<br />
(Kuhlmann & Sauter, 2008, 78):<br />
▸ Konsistente Darstellung: Trotz genauer Vorgaben<br />
zur Gestaltung der Lernmaterialien können<br />
sich die Umsetzungen verschiedener Autorinnen<br />
und Autoren visuell voneinander unterscheiden.<br />
Um besondere Inhaltselemente wie beispielsweise<br />
Zitate, Hervorhebungen, Erläuterungen oder Beispiele<br />
einheitlich dazustellen, ist oft eine sorgfältige<br />
(gegenseitige) Begutachtung nötig.<br />
▸ Individualisierung und Überarbeitung der<br />
Kurse: Um die selben Lerninhalte an unterschiedliche<br />
Lernkontexte anzupassen, müssen einzelne<br />
Inhalte neu und zielgruppengerecht zusammengestellt<br />
werden. So entsteht eine Vielzahl von<br />
Kursen, die nicht nur umständlich erstellt werden<br />
müssen, auch die Aktualisierung und Wartung bereitet<br />
zunehmend Schwierigkeiten, da der Überblick,<br />
wo welche Inhalte eingeflossen sind, schnell<br />
verloren geht. Als Konsequenz scheuen viele Autorinnen<br />
und Autoren komplexe Individualisierungen<br />
von Kursen und entscheiden sich für Einheitslösungen,<br />
die aber oft nicht die individuellen<br />
Lernziele der Lernenden berücksichtigen können.<br />
▸ Internationalisierung: In Hochschulen und Bildungseinrichtungen<br />
mit internationaler Ausrichtung,<br />
vor allem aber in global agierenden Unternehmen<br />
werden Lernmaterialien in verschiedenen<br />
Landessprachen benötigt. Ebenso wie bei<br />
der individuellen Zusammenstellung von Lernmaterialien<br />
besteht auch hier das Problem, dass eine<br />
Vielzahl von Kursen mit gleichen Lerninhalten erstellt<br />
wird, deren Verwaltung schnell unübersichtlich<br />
wird.<br />
▸ Verteilung in verschiedenen Formaten: Je nach<br />
Zielgruppe und deren Lern- und Arbeitsgewohnheiten<br />
kann die Veröffentlichung der Kurse in verschiedenen<br />
Formaten nötig sein. Während Kurse<br />
Medien müssen Designer auf die Lernmaterialien zugreifen<br />
können. (d) Es werden Übersetzer für die Bereitstellung der<br />
Lerninhalte in andere Sprachen benö;gt. (e) Die erstellten<br />
Lerninhalte müssen zur Qualitätssicherung von Gutachtern<br />
oder Kunden eingesehen und gegebenenfalls mit Kommen-‐<br />
taren versehen werden können.
Abbildung 5: Verteilung in unterschiedlichen Formaten<br />
zur Integration auf einer Webseite (HTML) oder<br />
einem LMS (SCORM) problemlos mit einem Autorenwerkzeug<br />
erstellt werden können, erfordern<br />
andere Ausgabeformate eine völlig andere Kursgestaltung.<br />
So sollten Lernmaterialien, die für den<br />
Druck gedacht sind, beispielsweise keine Videos<br />
beinhalten, oder bei Kursen für mobile Endgeräte<br />
die kleinen Bildschirmgrößen und Einschränkungen<br />
bei der Bedienung (zum Beispiel keine<br />
oder nur kleine Tastatur) berücksichtigt werden<br />
(siehe Abbildung 5).<br />
▸ Verschiedene Ausgabeformate: Unabhängig<br />
vom Erstellungsprozess sollen die Lernmaterialien<br />
so veröffentlicht werden, dass sie den Lern- und<br />
Arbeitsgewohnheiten der Lernenden entsprechen.<br />
Neben den üblichen Formaten (EXE, HTML und<br />
SCORM) sollte beispielsweise das Ausdrucken der<br />
Lernmaterialien (PDF, Office Dokument), Präsentieren<br />
(PPT) oder auch die Betrachtung auf<br />
kleinen Bildschirmen (mobile Endgeräte) möglich<br />
sein.<br />
▸ Workflow-Unterstützung: Zur Koordination<br />
mehrerer Autorinnen und Autoren sollte die Verteilung<br />
der Aufgaben und die Festlegung der Verantwortlichkeiten<br />
unterstützt werden. Hierzu gehören<br />
ein Rollenmanagement, über das die Befugnisse<br />
für die Lerninhalte geregelt werden können<br />
und die Möglichkeit, Notizen zur fachlichen und<br />
didaktischen Qualitätssicherung zu hinterlegen.<br />
Zur Erfüllung dieser Ansprüche wurden Werkzeuge<br />
entwickelt, die ihren Fokus auf die Verwaltung von<br />
Informa;onssysteme. Technische Anforderungen für das Lernen und Lehren — 7<br />
Lerninhalten gerichtet haben: die Lerncontentmanagementsysteme<br />
(LCMS). Um die Lernmaterialien<br />
so zu organisieren, dass sie für den Einsatz in verschiedenen<br />
Kontexten und die Verteilung in verschiedenen<br />
Formaten geeignet sind, müssen die LCMS<br />
eine Reihe von Grundprinzipien umsetzen (Schluep<br />
et al., 2003, 2):<br />
▸ Zentralisierung: Um die Zusammenarbeit von<br />
mehreren Autorinnen und Autoren zu ermöglichen,<br />
müssen die Lernobjekte in einer gemeinsamen<br />
Datenbasis (ein sog. Repository) vorliegen,<br />
auf die alle Beteiligten zugreifen können. Das verhindert<br />
auch, dass durch die lokale Speicherung<br />
der Daten mehrere Versionen der Lernmaterialien<br />
entstehen, die den mehrfachen Einsatz in verschiedenen<br />
Kursen erschweren. Deshalb werden<br />
die Lernmaterialien in den Kursen nur referenziert,<br />
das heißt, sie werden nicht direkt in den<br />
Kurs eingefügt, sondern es wird eine Verbindung<br />
zum Lernmaterial gespeichert, sodass stets die aktuelle<br />
Version verwendet wird.<br />
▸ Einbettung von Multimedia: Für die multimediale<br />
Aufbereitung der Lernmaterialien sollten<br />
Standardmechanismen zur Integration verschiedener<br />
Medienformate bereitstehen.<br />
▸ Lernobjekte als kleinste verwaltbare Einheit:<br />
Um einzelne Teile von bereits erstellten Lernmaterialien<br />
in verschiedenen Kontexten wiederverwenden<br />
zu können, sollten die Lerninhalte in sinnvolle<br />
Abschnitte, so genannte Lernobjekte , untergliedert<br />
werden. Andere geläufige Bezeichnungen
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
für Lernobjekte sind Lernressourcen, Wissensbausteine<br />
oder Wissensobjekte, sowie die englischen<br />
Bezeichnungen, wie Reusable Learning Object<br />
(RLO), Instructional oder Educational Object.<br />
Wichtig ist dabei, dass jedes Lernobjekt in sich abgeschlossen<br />
und somit unabhängig von anderen<br />
Lernobjekten und deren Reihenfolge eingesetzt<br />
werden kann.<br />
▸ Unterstützung der Internationalisierung: Zu<br />
einem Lernobjekt sollten mehrere Sprachversionen<br />
angelegt werden können, ohne dass der<br />
Bezug zueinander verloren geht.<br />
▸ Trennung von Inhalt und Layout: Um bei der<br />
Veröffentlichung der Lernmaterialien zwischen<br />
verschiedenen Ausgabeformaten, Navigationstrukturen<br />
und Layouts wählen zu können, müssen<br />
diese getrennt voneinander gespeichert werden.<br />
Hierzu werden meist XML-basierte Beschreibungssprachen<br />
verwendet.<br />
4. Lernmanagementsysteme:Lerner und Kurse ver-‐<br />
walten<br />
Lernmanagementsysteme (LMS) unterstützen vor<br />
allem die Kurs- und Benutzerverwaltung. Hierzu<br />
bieten sie nicht nur einen Rahmen zur Darstellung<br />
der Kursinhalte (meist in einem Browser), sondern<br />
auch ein Rollen- und Rechtemanagement für die Zugriffskontrolle<br />
und stellen verschiedene Werkzeuge<br />
für die Kommunikation der Lernenden und Lehrenden<br />
bereit (Schulmeister, 2005, 10).<br />
Zu den Anforderungen an Lernmanagementsysteme<br />
wird immer wieder festgestellt (Schulmeister,<br />
2005, 55ff; Niegemann et al., 2008, 499), dass diese<br />
stark von der Organisationsstruktur abhängig sind, in<br />
der das Lernmanagementsystem eingesetzt werden<br />
soll. Von einfachen Systemen zur Bereitstellung und<br />
zum Austausch von Dokumenten (zum Beispiel<br />
BSCW ) bis hin zu komplexen Systemen zur lebenslangen<br />
Kompetenzentwicklung unterscheiden sich<br />
die Plattformen stark in Funktionsumfang, (Administrations-)<br />
Aufwand und Kosten.<br />
Bei der Auswahl eines Lernmanagementsystems<br />
sollten vor allem folgende Aspekte beachtet werden,<br />
(Schulmeister, 2005, 58ff):<br />
▸ Die Möglichkeiten und der Aufwand zur Administration<br />
des Lernmanagementsystems, zum Beispiel<br />
Backup-Möglichkeiten, Abrechnungssysteme<br />
für kostenpflichtige Kurse, Benutzer- und Kursverwaltung,<br />
Rechte- und Rollenmanagement,<br />
▸ Unterstützung der Didaktik von Lernszenarien,<br />
zum Beispiel Werkzeuge zur Kooperation, persönliche<br />
Werkzeuge für Lehrende und Lernende (zum<br />
Beispiel eigene Notizen, Lesezeichen, Kalender),<br />
Lehrplanverwaltung, Erstellung und Auswertung<br />
von Tests, Werkzeuge zur Rückmeldung und Bewertung,<br />
▸ Möglichkeiten zur Evaluation der Lernprozesse,<br />
zum Beispiel Verfolgung und Analyse von Lernwegen,<br />
Erstellung von Reports und Statistiken,<br />
Umfragen, Evaluierung von E-Learning-Unterlagen,<br />
▸ Werkzeuge zur synchronen und asynchronen<br />
Kommunikation, zum Beispiel Chat, Foren oder<br />
Videokonferenzsysteme<br />
▸ Technische Aspekte, zum Beispiel benötigte Serverkapazitäten,<br />
Zugriffsmöglichkeiten über den<br />
Webbrowser, Skalierbarkeit, Anbindung an externe<br />
Datenbanken und Dienste (zum Beispiel Einschreibelisten<br />
des Prüfungsamtes, Personaldatenbanken,<br />
Raumverwaltungssysteme oder Semesterapparate<br />
der Bibliothek), Unterstützung von Standardformaten<br />
wie SCORM, Darstellbarkeit auf<br />
mobilen Endgeräten und<br />
▸ Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, wie<br />
zum Beispiel Lizenzverträge und -kosten, Support.<br />
?<br />
?<br />
No;eren Sie s;chpunktar;g, wie Sie den Lerninhalt<br />
„Wie verhalte ich mich als Autofahrer/in an einer<br />
Ampel?“ als Lernmaterial mit einem Autorentool um-‐<br />
setzen würden. Dazu werden die notwendigen Infor-‐<br />
ma;onen in kleine Einheiten zerlegt. Eine mögliche<br />
Lösung finden Sie in der Abbildung 6.<br />
Können die von Ihnen konzipierten Lernmaterialien<br />
für Autofahrer/innen, sehende und blinde<br />
Fußgänger/innen, sowie Rollstuhlfahrer/innen ver-‐<br />
wendet werden? No;eren Sie s;chpunktar;g, wie Sie<br />
den Lerninhalt „Wie verhalte ich mich an einer<br />
Ampel?“ für die neue Zielgruppe als Lernmaterial mit<br />
einem Autorentool umsetzen würden.<br />
Abbildung 6: Mögliche Lösung für die Zerlegung des<br />
Lerninhaltes „Wie verhalte ich mich als Autofahrer/in<br />
an einer Ampel?“
!<br />
Aspekte, die bei der Auswahl eines Lernmanagement-‐<br />
systems beachtet werden sollten sind: Administra;on,<br />
Didak;k, Evalua;on, Kommunika;on, Technik und<br />
wirtscha]liche Gesichtspunkte.<br />
In Hinblick auf den letzten Aspekt muss oftmals eine<br />
Grundsatzentscheidung getroffen werden, ob man<br />
sich für eine Open-Source-Lösung oder für ein kommerzielles<br />
System entscheidet. Bei Open-Source-Lösungen<br />
entfallen zwar die Anschaffungskosten für die<br />
Software, jedoch entstehen zumeist höhere Personalkosten,<br />
sowie laufende Kosten zur Wartung des<br />
Systems: Es wird empfohlen, mindestens zwei Mitarbeiter/innen<br />
für die Programmiersprache des LMS<br />
Informa;onssysteme. Technische Anforderungen für das Lernen und Lehren — 9<br />
Aspekte ILIAS Moodle OLAT<br />
Betriebssystem Linux, Solaris, Mac OS, Win-‐ Linux, Windows, Solaris, Linux, Winodows, Mac OS X,<br />
dows<br />
Mac OS X, Netware 6 Solaris, FreeBSD<br />
Datenbank MySQL mit DBXML-‐Unterstützung,<br />
z. B. MySQL, PostgrSQL<br />
u.a. MySQL, PostgresSQL<br />
Skriptsprache PHP PHP Java-‐Framework mit PHP-‐ba-‐<br />
siertem Kurssystem<br />
Weitere Voraussetzungen Apache Tomcat Web-‐Contai-‐<br />
ner mit Java-‐SDK<br />
?<br />
Tabelle 3: Technische Anforderungen von gängigen Open-‐Source-‐LMS. Quelle: Dokumentationen von ILIAS (ILIAS Team,<br />
2010), Moodle (Moodle Team, 2009) und OLAT (OLAT Team, 2010)<br />
Sie arbeiten in der Personalabteilung eines Unter-‐<br />
nehmens mit 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-‐<br />
beitern aus 15 verschiedenen Abteilungen. Ihre Vorge-‐<br />
setzte hat Sie mit der Aufgabe betraut, ein Lernmana-‐<br />
gementsystem auszuwählen. Stellen Sie s;chpunkt-‐<br />
ar;g anhand der obigen Aspekte einen Kriterienka-‐<br />
talog mit K.O.-‐Kriterien auf, die unbedingt durch das<br />
LMS erfüllt werden sollen.<br />
Abbildung 7: Zusammenspiel von Autorensystemen und Lernmanagementsystem<br />
vor Ort zu haben, um Erweiterungen, Anpassungen<br />
und Updates durchführen zu können. Kommerzielle<br />
Systeme sind in der Anschaffung oft teuer, Installation<br />
und Einweisung sind aber häufig Bestandteil<br />
des Kaufvertrags. Zudem sind Supportverträge inklusive<br />
Wartungen und Updates üblich.<br />
Neben dem Kriterienkatalog von Schulmeister mit<br />
über 150 Unterkategorien (Schulmeister, 2005, 58ff)<br />
sind in der Vergangenheit für die unterschiedlichen<br />
Einsatzziele und Bedürfnisse weitere Kriterienkataloge<br />
entstanden, nach denen Lernmanagementsysteme<br />
bewertet werden können (Baumgartner et al.,<br />
2002).<br />
?<br />
Welche technischen Anforderungen benö;gen die<br />
gängigen Open-‐Source-‐LMS? Vergleichen Sie Ihre Er-‐<br />
gebnisse mit der Darstellung in Tabelle 3<br />
5. Lernen mit Informa1onssystemen: Zusammenspiel<br />
und Problempunkte<br />
Bei der Auswahl von Informationssystemen zum<br />
Lernen und Lehren müssen diese nicht nur einzeln<br />
einer Reihe von Anforderungen genügen, es sollte
10 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
In der Praxis : Überlegungen bei der Entscheidung für ein Lernmanagementsystem<br />
Die folgende Beschreibung von Lernmanagementsystemen<br />
ist fik;v, soll jedoch die Abwägung von Vor-‐ und Nachteilen<br />
in der Praxis verdeutlichen.<br />
1. LernenMitSpaß – Die Open-‐Source-‐Lösung<br />
Das LMS kann kostenlos heruntergeladen und selbst instal-‐<br />
liert werden. Das Basispaket bietet eine einfache Kurs-‐ und<br />
Nutzerverwaltung. Über eine Reihe von Plug-‐Ins, die von der<br />
Benutzer-‐Community von LernenMitSpaß entwickelt<br />
wurden, können weitere Funk;onalitäten hinzugefügt<br />
werden, wie beispielsweise ein komplexes Rollenmana-‐<br />
gement, die Integra;on von Tests oder Sta;s;ken zu Lerner-‐<br />
folgen. Darüber hinaus besteht durch die Open-‐Source-‐Lizenz<br />
die Möglichkeit, selbst Erweiterungen zu entwickeln.<br />
Vorteile: sehr kostengüns;g, erweiterbar, kann grundsätzlich<br />
an alle Bedürfnisse angepasst werden, Installa;on und Be-‐<br />
trieb durch das Unternehmen selbst<br />
Nachteile: eventuell zusätzlicher Personalbedarf, durch An-‐<br />
passungen und Neuentwicklung von Erweiterungen durch<br />
Personalkosten eventuell sehr teuer<br />
2. LernenMitSystem – Die Standardlösung<br />
Das LMS wird durch einen kommerziellen Anbieter ver-‐<br />
trieben und weiterentwickelt. Es beinhaltet ein Kurs-‐ und<br />
Nutzermanagement, erlaubt die Erstellung und Auswertung<br />
von Tests und liefert kleine Sta;s;ken zum LernfortschriG<br />
der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters (Lernzeit, Durch-‐<br />
schniG der Lernergebnisse). Für die Kommunika;on können<br />
E-‐Mails und Kursforen benutzt werden. Der Zugriff erfolgt<br />
über ein eigenes Programm, dass auf dem Rechner der Mit-‐<br />
arbeiter installiert werden muss. Der Anbieter übernimmt<br />
die Installa;on und Pflege des LMS auf einem Server Ihrer<br />
Firma, sowie kleine Anpassungen (zum Beispiel Verwendung<br />
des Firmenlogos und der Firmenfarben). Der Kaufpreis des<br />
LMS inkl. Installa;on, Einrichtung, 10 h Support und 1.000<br />
Nutzerlizenzen für die Zugriffsprogramme beträgt 15.000 €.<br />
Weitere Nutzerlizenzen, Anpassungen, Supportstunden und<br />
Schulungen für Mitarbeiter können bei Bedarf hinzugekau]<br />
werden. Hinzu kommen außerdem 1.500 € im Jahr für<br />
Wartung und Updates.<br />
auch darauf geachtet werden, dass sie problemlos zusammen<br />
eingesetzt werden können. So sollte sich das<br />
Datenformat, das mit dem Autorentool exportiert<br />
wird, problemlos in das Lernmanagementsystem integrieren<br />
lassen. Inhalte dürfen nicht verzerrt dargestellt<br />
werden, nur, weil das LMS eine bestimmte<br />
Vorteile: Einrichtung durch kompetenten Anbieter, erwartet<br />
werden kann ein ausreichender Funk;onsumfang, skalierbar,<br />
Zugriff über eigenes Programm -‐ eventuell relevant für<br />
Firmen mit eingeschränkten Internetzugriff (keine mühsame<br />
Freischaltung einzelner Seiten), Daten auf eigenem Server,<br />
einmaliger Kaufpreis<br />
Nachteile: Je nach Budget eventuell zu teuer in der An-‐<br />
schaffung , je nach Anforderungskriterien eventuell weiterer<br />
Anpassungsbedarf, eventuell Anschaffungskosten für eigenen<br />
Server, zusätzlicher Bedarf für Nutzer, Anpassungen und Sup-‐<br />
portstunden schwer abschätzbar<br />
3. LernenMitStrategie – Die Profi-‐Lösung<br />
Das LMS wird durch einen kommerziellen Anbieter ver-‐<br />
trieben und weiterentwickelt. Im Zentrum steht ein kom-‐<br />
plexes Kompetenzmanagement, dass die Planung der<br />
Weiterbildungsangebote für jeden Mitarbeiter an vorher de-‐<br />
finierten Personalentwicklungsplänen ausrichtet. Über<br />
SchniGstellen kann es an Personaldatenbanken und Doku-‐<br />
mentenmanagementsysteme angebunden werden. Der An-‐<br />
bieter übernimmt die Installa;on und Pflege des LMS auf<br />
einem seiner eigenen Server, sowie besprochene Anpas-‐<br />
sungen, die Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur auf die<br />
Nutzerverwaltung und den Import bereits bei Ihnen verfüg-‐<br />
barer Personalentwicklungspläne und Lerninhalte. Der Miet-‐<br />
preis des LMS inkl. Installa;on, Einrichtung, Support und<br />
1.000 Nutzer-‐Accounts für den Webbasierten Zugriff beträgt<br />
40.000 € im Jahr. Weitere Nutzer-‐Accounts, Anpassungen<br />
und Schulungen für Mitarbeiter können bei Bedarf hinzuge-‐<br />
kau] werden.<br />
Vorteile: Vollbetrieb durch kompetenten Anbieter, individuell<br />
angepasster Funk;onsumfang, skalierbar, hochkomplexe<br />
Nutzer-‐ und Lernprozessverwaltung<br />
Nachteile: Jahresmiete, Daten auf fremden Server, eventuell<br />
für das Unternehmen zu komplex<br />
Wie Sie gesehen haben, ist die Entscheidung zwischen Open-‐<br />
Source und kommerziellen Produkten immer eine indivi-‐<br />
duelle Antwort auf eine offene Fragestellung, und muss auf<br />
die einzelne Situa;on angepasst werden.<br />
Fenstergröße dafür vorsieht. Ebenso sollte die Bewertung<br />
von Tests, die mit einem Autorenwerkzeug<br />
erstellt und beispielsweise als SCORM-Paket exportiert<br />
wurden, auch von den Bewertungswerkzeugen<br />
des Lernmanagementsystems verarbeitet werden.
Literatur<br />
▸ Baumgartner, P.; Häfele, H. & Maier-Häfele, K. (2002). Evaluierung<br />
von Lernmanagement-Systemen (LMS): Theorie -<br />
Durchführung - Ergebnisse. In: A. Hohenstein, & K. Wilbers,<br />
Handbuch E-Learning. Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst.<br />
▸ Ebner, M. (2008). Why We Need EduPunk. Journal of social<br />
informatics, 1-9.<br />
▸ Ferstl, O. K. & Sinz, E. J. (2006). Grundlagen der Wirtschaftsinformatik.<br />
München: Oldenbourg.<br />
▸ ILIAS Team. (2010). Information Center. URL: http://www.ilias.de/docu/<br />
[2010-07-22].<br />
▸ Kuhlmann, A. & Sauter, W. (2008). Wissensvermittlung und<br />
-verarbeitung mit E-Learning. In: Innovative Lernsysteme.<br />
Berlin/Heidelberg: Springer, 71-99.<br />
▸ Lorenz, A. & Faßmann, L. (2010). Lernmaterialien effektiv aufbereiten<br />
und wiederverwenden. Wissensmanagement - Das<br />
Magazin für Führungskräfte (2).<br />
Informa;onssysteme. Technische Anforderungen für das Lernen und Lehren — 11<br />
In der Praxis : Praxisbeispiel eines laufenden Lernmanagmentsystem<br />
An der TU Graz (Ebner, 2008) wird die Open-‐Source So]ware<br />
WBT-‐Master unter dem Namen TeachCenter eingesetzt<br />
(siehe Abbildung ). Es handelt sich hier um eine Client-‐<br />
Server-‐Architektur basierend auf einer AJAX-‐Lösung, als Pro-‐<br />
grammiersprache kommt Java / Javascript zum Einsatz. AJAX<br />
(Akronym für die Worte Asynchronous Javascript and XML)<br />
wird verwendet, wenn es darum geht, selek;v („nach und<br />
nach“, „je nach Bedarf“) Daten an den Browser zu senden,<br />
was mit klassischen Technologien immer ein Neuladen der<br />
gesamten Webseite und den damit verbundenen Zeit-‐<br />
aufwand erfordern würde. Die Vorteile dieser Architektur ist<br />
die Reduzierung der Datenmenge der Serverantworten<br />
(durch die Vorselek;on) und damit zwangsläufig von Lade-‐<br />
zeiten, sowie die verstärkte Nutzung der Clients (Internet-‐<br />
browser der jeweiligen Nutzer/innen). Besonders bei einem<br />
großen System mit hohen Nutzerzahlen und deren parallele<br />
Ak;vitäten ist dies von entscheidender Bedeutung .<br />
An der TU Graz werden in etwa 15000 Nutzer verwaltet, die<br />
einen Datenverkehr von derzeit 12 GB pro Tag verursachen.<br />
Im DurchschniG sind in den Kernzeiten 200 bis 300 Nutzer<br />
parallel am System ak;v. Bei diesen Zahlen wird ersichtlich,<br />
dass die Performance ein wesentlicher Faktor eines LMS<br />
Systems ist, da die Voraussetzung von zufriedenen<br />
Nutzer/innen von E-‐Learning-‐Inhalten akzeptable Reak;ons-‐<br />
zeiten des LMS sind (< 1 Sekunde nach einem Klick).<br />
Das TeachCenter der TU Graz verwendet, wie die Mehrzahl<br />
der anderen Lernmanagementsysteme auch, eine Client-‐<br />
Server Architektur.<br />
▸ Moodle Team. (2009). Installation von Moodle. URL:<br />
http://docs.moodle.org/de/Installation_von_Moodle [2010-<br />
07-22].<br />
▸ Niegemann, H. M.; Hessel, S.; Hupfer, M.; Domagk, S.; Hein,<br />
A. & Zobel, A. (2008). Kompendium multimediales Lernen.<br />
Berlin/Heidelberg: Springer.<br />
▸ OLAT Team. (2010). Installation & Administration Documentation.<br />
URL: http://olat.org/docu/install/index.html [2010-<br />
07-22].<br />
▸ Schluep, S.; Ravasio, P. & Schär, S. G. (2003). Implementing<br />
Learning Content Management. In: M. Rauterberg; M. Menozzi<br />
& J. Wesson, (Hrsg.), Proceedings of Human-Computer<br />
Interact - INTERACT'03, 884-887.<br />
▸ Schulmeister, R. (2006). eLearning: Einsichten und Aussichten.<br />
München: Oldenbourg.<br />
▸ Schulmeister, R. (2005). Lernplattformen für das virtuelle<br />
Lernen: Evaluation und Didaktik. München: Oldenbourg.
12 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
▸ Seufert, S. & Mayr, P. (2002). Fachlexikon e-le@rning. Wegweise<br />
durch das e-Vokabular. Bonn: Management Seminare<br />
Gerhard May.<br />
▸ Stein, E. (2008). Taschenbuch Rechnernetze und Internet.<br />
München: Hanser Verlag.<br />
▸ Thome, R. (2004). Neue Medien in der Weiterbildung. In: I.<br />
Ifmo (Hrsg.), Auswirkungen der virtuellen Mobilität,<br />
Berlin/Heidelberg: Springer, 273-286.
Chris2an Safran, Anja Lorenz und Mar2n Ebner<br />
Webtechnologien<br />
Technische Anforderungen an Informationssysteme<br />
Dieses Kapitel gibt eine <strong>Einführung</strong> in die technischen Grundlagen von Webtechnologien, welche im<br />
Rahmen von LernsoHware Verwendung finden können. Basierend auf der zugrunde liegenden Infra-‐<br />
struktur des Internets hat vor allem das World Wide Web im letzten Jahrzehnt alle Arten von Informa2-‐<br />
onssystemen, auch solche für das Lernen und Lehren, nachhal2g beeinflusst. Dementsprechend ist ein<br />
Grundverständnis der entsprechenden Technologien und technischen Anforderungen von Vorteil, um<br />
Chancen und Grenzen von webbasierter LernsoHware zu erläutern. Durch die zugrunde liegenden Archi-‐<br />
tekturen und Protokollen des World Wide Web haben sich in den letzten Jahren Technologien wie Weban-‐<br />
wendungen und Webservices entwickelt, die größere und reichhal2gere Applika2onen im Web ermög-‐<br />
lichen als zu dessen Anfangszeit. Diese Möglichkeiten führten einerseits zu der Entwicklung von Rich In-‐<br />
ternet Applica2ons als „Internetanwendungen mit Desktop-‐Feeling“ und andererseits zum Aukommen<br />
von Mashups, in welchen diverse Inhalte und Funk2onalitäten anderer Applika2onen in innova2ven Sze-‐<br />
narien neu kombiniert werden. Beide Ansätze sind in der aktuellen Entwicklung von Informa2onssystemen<br />
für das Lernen und Lehren unabdingbar.<br />
Quelle:<br />
Robert Ulmer<br />
hEp://www.flickr.com/photos/46422485@N03/5335122125 [2011-‐01-‐28]<br />
Jetzt Pate werden!<br />
#webtech<br />
#einfuehrung<br />
#informa2k<br />
Version vom 1. Februar 2011<br />
Für dieses Kapitel wird noch ein Pate gesucht,<br />
mehr Informa2onen unter: hEp://l3t.eu/patenschaH
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Einleitung<br />
Das World Wide Web bzw. das Internet hat in den<br />
letzten Jahren einen großen Stellenwert in unserer<br />
heutigen „Informationsgesellschaft“ eingenommen.<br />
So verwundert es auch nicht, dass ein großer Teil der<br />
aktuellen Umsetzungen von Informationssystemen<br />
für das Lernen und Lehren auf Webtechnologien basiert.<br />
Auch Trendtechnologien wie Soziale Medien<br />
finden zunehmend Eingang in das Lernen und<br />
Lehren mit Technologien.<br />
Für das Verständnis der technischen Anforderungen<br />
an speziell für das Lernen und Lehren entwickelte<br />
Informationssysteme ist demnach auch ein zumindest<br />
grundlegendes technisches Verständnis der<br />
darunter liegenden Webtechnologien notwendig. Bedingt<br />
durch die Architektur und Geschichte des<br />
World Wide Web bieten diese Ansätze zwar ein<br />
großes Potential, stehen aber auch einigen technischen<br />
Einschränkungen gegenüber. Dieses Kapitel<br />
soll grundlegendes Wissen über diese Technologien<br />
vermitteln und bestenfalls das Interesse nach detaillierter<br />
weiterführender Information zu den angesprochenen<br />
Technologien, welche in einschlägiger Fachliteratur<br />
nachgelesen werden können, wecken.<br />
2. Grundlegende Technologien<br />
Das Internet ist eine weltweite Verknüpfung von Datennetzen,<br />
welche Ende der 1960er Jahre in den USA<br />
vom DARPA (Defense Advanced Research Projects<br />
Agency) initiiert und aus dem daraus entstandenen<br />
ARPANET (Advanced Research Projects Agency)<br />
hervorging (Vinton Cerf, 1993).<br />
!<br />
Der Begriff Internet als solcher bezeichnete hierbei ei-‐<br />
gentlich das entstehende „interconnected network“,<br />
also eine Technologie zur Kommunika2on (Austausch<br />
von Daten) zwischen verschiedenen, weltweit ver-‐<br />
teilten Computernetzen, ohne die dazu nö2ge<br />
Hardware und Netzwerktechnologie genau zu kennen.<br />
Die Kommunikation in diesem Netzwerk wird<br />
über Protokolle geregelt. Ein Protokoll ist eine Re-<br />
gelvorschrift, welche den Datenaustausch und die<br />
Kommunikation zwischen Computern detailliert beschreibt.<br />
Die verschiedenen Verantwortungen werden<br />
im Fall der Kommunikation in Rechnernetzen auf<br />
einzelne Protokolle aufgeteilt. Diese Aufteilung kann<br />
man über das OSI-Schichtenmodell (Open System<br />
Interconnection) der internationalen Standardisierungsgesellschaft<br />
ISO (International Standardization<br />
Organisation), in dem Protokolle einer Ebene nur jeweils<br />
über Protokolle der benachbarten Ebenen Bescheid<br />
wissen müssen, einheitlich beschreiben.<br />
Die Ebenen des OSI-Schichtenmodells (siehe Tabelle<br />
1) beschreiben die Kommunikation in verschiedenen<br />
Abstraktionsstufen. So beschäftigt sich die unterste<br />
Schicht (1) mit der physikalischen Übertragung,<br />
während sich die oberste Schicht (7) mit Anwendungen<br />
auseinandersetzt. Grob werden diese<br />
Schichten in anwendungs- und transportorientierte<br />
Schichten unterteilt. Im Rahmen dieses Kapitels<br />
werden wir uns nur mit anwendungsorientierten Protokollen<br />
beschäftigen.<br />
Basierend auf dem Internet, als Verbindung unterschiedlicher<br />
Computernetze, ermöglichen diverse<br />
Protokolle den Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen.<br />
Die wohl prominenteste dieser Anwendungen<br />
ist das World Wide Web.<br />
3. Das World Wide Web<br />
Seit seiner Entwicklung im Jahr 1989 durch die Forschergruppe<br />
um Sir Tim Berners-Lee (Cailliau, 1995),<br />
wurde aus dem World Wide Web (WWW) die wohl<br />
bekannteste und meist benutzte Anwendung des Internets.<br />
In vielen Fällen wird der Begriff Internet,<br />
obwohl er nur die darunterliegende Netzwerkinfrastruktur<br />
bezeichnet, inzwischen als Synonym für das<br />
World Wide Web verwendet. Beim WWW handelt es<br />
sich um eine verteilte Sammlung von Dokumenten,<br />
welche unter Verwendung von Internet-Protokollen<br />
über eine Anwendung abrufbar sind. Diese Dokumente<br />
sind untereinander mittels Hyperlinks verknüpft<br />
und bilden dadurch ein weltweites Netz an Informationen.<br />
Die Anwendung, mit der auf diese<br />
Seiten zugegriffen werden kann, wird als Browser be-<br />
7 Anwendungsschicht<br />
HTTP(S)<br />
6<br />
5<br />
Darstellungsschicht<br />
Kommunika2onsschicht<br />
Anwendungsorien2erte<br />
Schichten<br />
FTP<br />
POP, SMTP<br />
4 Transportschicht<br />
TCP UDP<br />
3 VermiElungsschicht Transportorien2erte<br />
IP<br />
2<br />
1<br />
Sicherungsschicht<br />
Physikalische Schicht<br />
Schichten<br />
Ethernet<br />
Tabelle 1: OSI-‐Schichtenmodell
zeichnet. Bekannte Browser sind der Internet Explorer<br />
von Microsoft, Firefox von Mozilla, Safari von<br />
Apple oder Opera von Opera Software.<br />
!<br />
Jedes Dokument im Web ist durch eine URL<br />
(Uniform Resource Locator) identifiziert. Diese URL<br />
besteht im Web zumeist aus drei Komponenten: Protokoll,<br />
Host und Pfad.<br />
!<br />
?<br />
HTTP<br />
Weitere Browser können Sie bspw. bei Wikipedia<br />
finden (hEp://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Web-‐<br />
browsern) oder in der L3T-‐Gruppe bei Mister Wong<br />
unter #webbrowser #l3t .<br />
Diese Komponenten der URL sind folgendermaßen an-‐<br />
geordnet: protokoll://host/pfad<br />
Die URL kann darüber hinaus einen Port („Anschluss“<br />
am Server; hEp://www.example.org:80) und Anfrage-‐<br />
string (zusätzliche Informa2onen wie die Inhalte einer<br />
Suchanfrage; hEp://www.example.org:80/demo/ex-‐<br />
ample.cgi?land=de&stadt=aa) beinhalten.<br />
Iden2fizieren Sie die drei Teile der URL<br />
hEp://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite<br />
Der Browser verständigt sich mit dem Webserver<br />
über das Hyptertext Transfer Protocol. Wie jedes<br />
Protokoll beschreibt HTTP den Aufbau der Nachrichten<br />
vom Client an den Server. Die Kommunikation<br />
erfolgt immer über Anfragen des Clients an<br />
den Server und zugehörige Antworten. Alle Nachrichten<br />
werden als Klartext, also unverschlüsselt,<br />
übermittelt.<br />
Durch diesen Aufbau der Kommunikation ist eine<br />
zentrale Problematik der Entwicklung von Webanwendungen<br />
bedingt: Der Server kann nicht von sich<br />
aus mit dem Client kommunizieren, da er immer auf<br />
eine Anfrage angewiesen ist. Wartet eine Anwendung<br />
nun auf ein bestimmtes Ereignis (zum Beispiel das<br />
Ergebnis einer aufwendigen Berechnung), kann der<br />
Server den Client nicht über dessen Eintritt verständigen,<br />
sondern der Client muss in regelmäßigen Abständen<br />
Anfragen über den Status an den Server<br />
schicken. Dies bringt natürlich einerseits zusätzlichen<br />
Netzwerkverkehr und anderseits zusätzliche Arbeitszeit<br />
des Servers mit sich.<br />
Zu beachten gilt bei HTTP, dass es sich um ein<br />
zustandsloses Protokoll handelt. Alle Anfragen sind<br />
somit voneinander unabhängig zu betrachten. Für die<br />
Webtechnologien. Technische Anforderungen an Informa2onssysteme— 3<br />
meisten Anwendungen im Web ist es aber notwendig,<br />
mehrere Anfragen in Zusammenhang zueinander zu<br />
sehen. So besteht zum Beispiel der Bestellvorgang in<br />
einem Webshop durchaus aus mehreren sequentiellen<br />
Anfragen (Auswahl der Waren, Eingabe der Adresse,<br />
Bestätigung des Kaufes). Solche Zusammenhänge<br />
können nicht durch das Protokoll selbst verwaltet<br />
werden, sondern müssen durch die Anwendungen<br />
gehandhabt werden, welche ihre Daten über HTTP<br />
übertragen. Es können hierzu Sitzungen (Sessions)<br />
verwendet werden, in denen eine eindeutige ID mit<br />
jeder Anfrage versendet wird. Eine andere Möglichkeit<br />
ist die Verwendung von Cookies, mit denen<br />
der Browser persistente Informationen (zum Beispiel<br />
Kundendaten) zu einem Webserver lokal speichern<br />
kann. Üblicherweise beginnen solche Sessions mit der<br />
Anmeldung mittels Login und Passwort und enden<br />
durch Abmeldung, oder wenn der Browser geschlossen<br />
wird.<br />
!<br />
HTTPS<br />
Die Übertragung der Daten in Klartextform bei<br />
HTTP ist nicht in jedem Fall wünschenswert. So<br />
könnten sensible Daten wie zum Beispiel Kennwörter<br />
durch beliebige „Zuhörer“ (an z.B. den für die<br />
Übertragung nötigen Servern) abgefangen werden.<br />
Aus diesem Grund wurde das Hypertext Transfer<br />
Protocol Secure (HTTPS) als Verfahren entwickelt,<br />
um Daten im Web abhörsicher zu übermitteln. Das<br />
Protokoll ist an sich identisch zu HTTP, allerdings<br />
werden die Daten mittels dem Protokoll Secure<br />
Socket Layer bzw. Transport Layer Security<br />
(SSL/TLS) verschlüsselt. Zu Beginn der verschlüsselten<br />
Verbindung muss sich bei HTTPS der Server<br />
identifizieren. Dies geschieht über ein Zertifikat,<br />
welches die Identität bestätigen soll. Bei der ersten<br />
Anfrage an einen Webserver kann es notwendig sein,<br />
dass die Authentizität dieses Zertifikates bestätigt<br />
werden muss.<br />
HTML<br />
HTTP ist ein zustandsloses Anfrage/Antwort-‐Protokoll<br />
und dient zur ÜbermiElung von Daten im WWW.<br />
Die eigentlichen Dokumente, die über HTTP vom<br />
Server an den Client übermittelt werden, sind meist<br />
HTML-Dokumente. Die Hypertext Markup Language<br />
(HTML) ist eine Auszeichnungssprache,<br />
welche in erster Linie die Struktur von Inhalten beschreibt.<br />
Der Browser zeigt anhand von HTML und<br />
der mitgelieferten Formatierungsinformation diese<br />
Dokumente am Client an.
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Eine Auszeichnungssprache dient zur Beschreibung<br />
von Daten und soll in erster Linie deren<br />
Struktur (Überschriften, Tabellen, etc.) und die Verbindungen<br />
der Dokumente (mittels Hyperlinks) beschreiben.<br />
HTML erlaubt darüber hinaus auch die<br />
Beschreibung der Formatierung des Dokumentes. Es<br />
hat sich aus vielfältigen Gründen eingebürgert, das<br />
Layout (die Formatierung) eines Dokumentes von<br />
den eigentlichen Inhalten zu trennen. Dadurch kann<br />
man Dokumente für verschiedene Schnittstellen und<br />
Anwendungen verwenden und muss nur das jeweilige<br />
Layout anpassen. Zudem ist auf diese Weise auch<br />
eine Verwendung der Dokumente für Menschen mit<br />
Beeinträchtigungen (wie Sehschwächen) effizient<br />
möglich. Üblicherweise wird also das Aussehen der<br />
HTML-Dokumente in einer separaten Datei beschrieben.<br />
Diese Cascading Style Sheets (CSS)<br />
werden ebenfalls vom Browser über HTTP angefordert.<br />
Webanwendungen<br />
Im Laufe der Zeit haben sich die Anforderungen an<br />
Informationssysteme im Web vom der bloßen Zurverfügungstellung<br />
von Dokumenten in Richtung ausgefeilter<br />
Programmlogik weiterentwickelt. Wie im<br />
Kapitel Informationssysteme aufgezeigt, erfordern<br />
natürlich auch Informationssysteme für das Lernen<br />
und Lehren solch eine Programmlogik. Diese Programme,<br />
die auf einem Webserver ausgeführt<br />
werden, werden als Webanwendungen bezeichnet.<br />
Wie bei statischen Webseiten wird clientseitig ein<br />
Browser zur Interaktion mit dem Webserver verwendet<br />
und die Daten werden mittels HTTP(S) übermittelt.<br />
Im Unterschied zu einer einfachen Webseite übermittelt<br />
der Webserver beim Aufruf der URL allerdings<br />
nicht ein bereits vorliegendes Dokument,<br />
sondern ruft ein Programm auf, welches aus einer<br />
Vorlage für Inhalt und Formatierung sowie aus variablen<br />
Daten dynamisch ein Dokument erstellt und<br />
an den Client übermittelt. Der Browser übernimmt in<br />
diesem Fall also die Rolle der Benutzerschnittstelle<br />
für ein auf dem Server ausgeführtes Programm.<br />
Mit Webanwendungen kann komplexe Software realisiert<br />
werden, welche clientseitig nur einen Webbrowser<br />
bzw. entsprechende PlugIns benötigt. Für<br />
die Entwicklerin oder den Entwickler der Software<br />
!<br />
Webanwendungen sind Computerprogramme, die auf<br />
einem Webserver laufen und den Browser des Clients<br />
als BenutzerschniEstelle verwenden.<br />
kann diese somit einfacher gewartet und erweitert<br />
werden, da Anpassungen nur am Server erfolgen<br />
müssen. Bei der Benutzung ergibt sich der Vorteil,<br />
dass die zusätzliche Installation einer Software weitestgehend<br />
entfällt.<br />
Andererseits bringt dieser Ansatz auch einige<br />
Nachteile. So ist eine ständige Internetverbindung<br />
mit ausreichender Bandbreite notwendig. Zudem<br />
kann der Server, bedingt durch die Tatsache, dass<br />
HTTP auf dem Anfrage-/Antwort-Prinzip basiert,<br />
nicht selbstständig Informationen an die Clients<br />
senden, sondern ist auf periodische Anfragen angewiesen.<br />
Zu guter Letzt bedeutet unter anderem das<br />
zustandslose Design des Protokolls, dass auf eine<br />
Vielzahl von möglichen Angriffsszenarien eingegangen<br />
werden sowie die Sicherheit der Webanwendung<br />
ein nicht zu vernachlässigender, zentraler<br />
Bestandteil der Entwicklung der Software sein muss.<br />
Webservices<br />
Webservices sind eine spezielle Art von Webanwendungen,<br />
die der Bereitstellung von Daten für andere<br />
Applikationen dienen (World Wide Web Consortium,<br />
2004). Sie sind üblicherweise Application Programming<br />
Interfaces (API) und stellen als solche eine einheitlich<br />
definierte Schnittstelle für fremde Anwendungen<br />
zur Verfügung um auf die Funktionalität des<br />
Service zuzugreifen.<br />
In Zusammenhang mit Informationssystemen für<br />
das Lernen und Lehren bietet die Integration solcher<br />
Webservices innovative Ansätze für die Einbindung<br />
externer Ressourcen und Funktionalitäten in ein derartiges<br />
Informationssystem (Vossen & Westerkamp,<br />
2003).<br />
Anders als bei Webanwendungen werden bei<br />
Webservices üblicherweise keine HTML-Dokumente<br />
vom Server geladen, da für die aufrufenden Applikationen<br />
Formatierungen sowie die Lesbarkeit für<br />
menschliche Benutzer/innen irrelevant sind und der<br />
Fokus rein auf dem Inhalt liegt.<br />
Der Grundgedanke von Webservices ist die Möglichkeit<br />
der automatischen Verarbeitung von Daten<br />
im Web durch Softwareagenten, welche lose gekoppelt<br />
Aufgaben für Benutzer/innen ausführen.<br />
Webservices stellen ihre detailliert beschriebene<br />
Funktionalität hierbei anderen Anwendungen zur<br />
Verfügung, seien dies autonome Agenten, Webanwendungen<br />
oder andere Webservices. Dadurch<br />
können Entwickler/innen bereits bestehende Funktionalitäten<br />
in ihren eigenen Anwendungen verwenden<br />
(Mashup, siehe Seite 7).
Die technologische Umsetzung erfolgt meist über<br />
eine der folgenden Möglichkeiten:<br />
▸ SOAP/WSDL: Ein flexibles System, in dem<br />
Nachrichten über das Simple Object Access<br />
Protocoll (SOAP) ausgetauscht werden. Wie diese<br />
Nachrichten für die einzelnen Webservices aussehen,<br />
wird über die Web Services Description<br />
Language (WSDL) beschrieben. Anfragen und<br />
Antworten sind in XML, einer allgemeinen Auszeichnungssprache<br />
für hierarchische Daten, geschrieben.<br />
In den Nachrichten werden die gewünschten<br />
Funktionen des Webservice aufgerufen,<br />
die Antworten werden vom Server retourniert.<br />
▸ Representational State Tranfer (REST) bezeichnet<br />
eine Technologie, in der jede einzelne<br />
Funktion des Webservice über eine individuelle<br />
URL aufgerufen wird. Die Kommunikation erfolgt<br />
zustandslos, ist also nicht von Sitzungen, Benutzerdaten<br />
oder ähnlichem abhängig.<br />
?<br />
4. XML<br />
Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Weban-‐<br />
wendungen und Webservices! Vergleichen Sie Ihre<br />
Antwort mit Tabelle 2.<br />
Webanwendung Webservice<br />
Zielgruppe: (menschliche)<br />
Benutzer<br />
Ausgabe als HTML<br />
Clientsei2ges Programm:<br />
Browser<br />
Zielgruppe: andere Ap-‐<br />
plika2onen<br />
Ausgabe als XML o.ä. für<br />
Maschinen op2mierte<br />
Formate<br />
Verarbeitung in anderen<br />
Applika2onen<br />
Tabelle 2: Unterschiede von Webanwendung und<br />
Webservice<br />
Die EXtensible Markup Language (XML) beschreibt<br />
eine sehr allgemeine, flexible und für individuelle<br />
Bedürfnisse erweiterbare Auszeichnungssprache.<br />
Wie HTML dient sie zur Darstellung strukturierter<br />
Inhalte, ist aber in erster Linie nicht für die<br />
menschenlesbare Darstellung gedacht. Sie ist von<br />
konkreten Plattformen und Implementierungen unabhängig<br />
und durch ihre Charakteristik als Metasprache<br />
vielseitig verwendbar. Letzteres bedeutet,<br />
dass sich auf Basis von XML durch Verwendung<br />
eines Schemas spezialisierte Dialekte für einzelne Anwendungsfälle<br />
definieren lassen. So ist beispielsweise<br />
Webtechnologien. Technische Anforderungen an Informa2onssysteme— 5<br />
XHTML eine auf XML basierende Auszeichnungssprache,<br />
welche zur Beschreibung von Webseiten<br />
dient.<br />
5. <strong>Einführung</strong> in die Applika8onsentwicklung für das<br />
Web<br />
Die Entwicklung von Webapplikationen und -services<br />
kann generell in zwei Gruppen von Ansätzen<br />
unterteilt werden. Bei serverseitigen Ansätzen erfolgt<br />
die Verarbeitung der Programmlogik am<br />
Webserver, der Client (und damit der Benutzer und<br />
die Benutzerin) erhält lediglich das Ergebnis. Bei clientseitigen<br />
Ansätzen erfolgt zumindest ein Teil des<br />
Programmablaufes am Rechner der Benutzer/innen.<br />
In realen Anwendungen wird meist eine Kombination<br />
von Ansätzen beider Gruppen verwendet.<br />
Seversei8ge Ansätze<br />
Der Vorteil von serverseitigen Ansätzen liegt in der<br />
Tatsache, dass der Client außer einem Browser keine<br />
weiteren Programme benötigt. Der eigentliche Programmcode<br />
wird serverseitig verarbeitet und das Ergebnis,<br />
meist ein (X)HTML-Dokument, an den<br />
Client gesandt. Der Nachteil von serverseitigen Ansätzen<br />
liegt an der Verminderung der Reaktionsgeschwindigkeit.<br />
Einerseits erfordert jede Nutzeraktion<br />
einen erneuten HTTP-Request (Anfrage) und damit<br />
einen neuen Aufruf der Seite. Andererseits benötigt<br />
das Ausführen der Programmlogik Rechenzeit am<br />
Server und vermindert somit zusätzlich dessen Reaktionszeit.<br />
PHP ist der heute wohl am meisten verbreitete<br />
serverseitige Ansatz für Webapplikationen. Die Abkürzung,<br />
ursprünglich „Personal Home Page tools“,<br />
ist ein rekursives Akronym für PHP:, „Hypertext Preprocessor“<br />
(The PHP Group, 2010). Es handelt sich<br />
bei PHP um eine Skriptsprache, das heißt der eigentliche<br />
Programmcode wird nicht zu einem Bytecode<br />
kompiliert (der direkt vom Rechner ausgeführt<br />
werden kann), sondern bei jedem Aufruf von einem<br />
Interpreter neu verarbeitet. Dieser Performance-<br />
Nachteil kann aber durch optionale Erweiterungen<br />
der Software kompensiert werden. PHP-Programmcode<br />
wird innerhalb der Dokumente durch ein<br />
vorangestelltes am Ende des Codes gekennzeichnet.<br />
Der Interpreter ignoriert Inhalte außerhalb<br />
dieser Begrenzungen und übermittelt diese<br />
unverändert an den Client. So kann Programmlogik<br />
beispielsweise direkt in HTML-Auszeichnungen eingebettet<br />
werden. Seine Verbreitung hat PHP mehreren<br />
Aspekten zu verdanken. Einerseits steht es im<br />
Rahmen vieler günstiger Webhosting-Angebote zur<br />
Verfügung (vorinstalliert auf Servern), da es einfach
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
zu installieren, zu warten und in bestehende<br />
Webserver zu integrieren ist. Andererseits ist PHP für<br />
Entwickler/innen schnell zu erlernen und sehr flexibel.<br />
Nachteile liegen in der Tatsache, dass PHP potentiell<br />
erlaubt, schlechter skalierbare und unsichere<br />
Webanwendungen zu entwickeln, auch wenn hier die<br />
konkrete Umsetzung einen deutlichen Einfluss haben<br />
kann. Speziell unerfahrenen Entwicklerinnen und<br />
Entwicklern fällt es mit anderen Technologien<br />
leichter, auf die Aspekte Skalierbarbeit und Sicherheit<br />
Rücksicht zu nehmen, da sie dort zur Einhaltung entsprechender<br />
Regeln gezwungen werden.<br />
Java Servlets basieren auf der objektorientieren<br />
Programmiersprache Java. Sie sind Java-Klassen (logisch<br />
gekapselte Teile von Programmcode), welche<br />
auf einem Server für die Abarbeitung von Anfragen<br />
der Clients zuständig sind. Als Antwort auf diese Anfragen<br />
liefern Servlets dynamisch generierte HTML-<br />
Dokumente. Anders als bei PHP werden diese Programme<br />
nicht zur Laufzeit interpretiert, sondern<br />
liegen bereits kompiliert vor, was die Abarbeitung beschleunigt.<br />
Obwohl die Entwicklung mit Java die Einarbeitung<br />
in eine komplexere Technologie bedeutet,<br />
bietet diese Technologie einige Vorteile. So kann sie<br />
durch Anwendung der richtigen Architektur große<br />
Verbesserungen in Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit<br />
bedeuten. Um abgearbeitet zu werden benötigen Java<br />
Servlets einen Servlet Container, wie Apache Tomcat,<br />
der den einfachen Webserver ersetzt. Diese technologische<br />
Einschränkung ist auch der Grund dafür, dass<br />
Java Servlets eher bei großen (Business-)Anwendungen<br />
als bei kleinen und mittleren Webanwendungen<br />
verwendet werden. Nur wenige Webhoster<br />
bieten Pakete mit einem Servlet Container an, da die<br />
Installation und die Administration aufwendiger ist.<br />
Java Server Pages (JSP) sind eine weitere auf Java<br />
basierende Technologie. Bei klassischen Servlets ist<br />
die Ausgabe der resultierenden Webseiten recht aufwendig.<br />
Syntaktisch wird bei JSP, ähnlich wie bei<br />
PHP, der Java Programmcode mit abgegrenzt.<br />
Der Rest des Dokumentes wird nicht interpretiert<br />
und enthält die HTML-Beschreibung der<br />
Webseite. Somit sind JSP Seiten ähnlich den Servlets,<br />
erlauben jedoch die Kombination von Programmund<br />
HTML-Code in einem Dokument und erleichtern<br />
so beide Technologien miteinander zu kombinieren.<br />
Active Server Pages (ASP) war ursprünglich ein<br />
PHP ähnlicher Ansatz, der auf proprietären Technologien<br />
der Firma Microsoft basiert. In der Weiterentwicklung<br />
als ASP.NET basiert die aktuelle Technologie<br />
auf dem Microsofts .NET-Framework. Die eigentlichen<br />
Anwendungen können hierbei in verschie-<br />
denen .NET-Programmiersprachen erstellt werden.<br />
Gebräuchlich sind hierbei C# (C Sharp) und<br />
VB.NET (Visual Basic.NET). Anders als bei PHP<br />
werden bei ASP.NET Programm-Code und HTML<br />
voneinander getrennt. Da der Programmcode dadurch<br />
kompiliert vorliegen kann, wird die Abarbeitung<br />
beschleunigt. Der Nachteil von ASP.NET<br />
liegt in der Tatsache, dass die Technologie sowohl<br />
proprietär als auch kostenpflichtig ist und darüber<br />
hinaus einen Microsoft Webserver erfordert.<br />
Clientsei(ge Ansätze<br />
Im Gegensatz zu serverseitigen Ansätzen wird hier<br />
die Programmlogik direkt auf dem Client abgearbeitet.<br />
Dies bietet den Vorteil, dass sowohl weniger<br />
Datenverkehr notwendig ist, als auch die Ressourcen<br />
des Webservers geschont werden. Von Nachteil ist allerdings,<br />
dass clientseitig eine komplexere Software<br />
erforderlich ist, der Client entsprechend leistungsfähig<br />
sein muss um die Programme abarbeiten zu<br />
können und potentiell sicherheitskritische Berechnungen<br />
nur auf der Serverseite durchgeführt werden<br />
sollten.<br />
Die wohl wichtigste Basistechnologie in diesem<br />
Zusammenhang ist JavaScript. Der Interpreter für<br />
diese Sprache ist bereits in den Browser integriert,<br />
wodurch keine zusätzliche Softwareinstallation notwendig<br />
ist. Allerdings sind diese Interpreter je nach<br />
Browser unterschiedlich, was für die Entwicklung der<br />
Software zusätzlichen Aufwand bedeutet, um Java-<br />
Script-Programme auf allen (bzw. möglichst vielen)<br />
Browsern lauffähig („browser-save“) zu machen. Javascript-Programme<br />
können entweder direkt in<br />
HTML-Seiten integriert sein oder in eigene Dateien<br />
ausgelagert werden. Die implementierte Funktionalität<br />
kann hierbei von einfachen Aufgaben, wie der<br />
Validierung von Formulareingaben, bis hin zu dynamischer<br />
Manipulation der vom Webserver übertragenen<br />
Webseite reichen.<br />
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) bezeichnet<br />
ein Konzept von Webanwendungen, bei<br />
denen JavaScript eingesetzt wird, um Informationen<br />
von einem Webserver anzufordern. Bei klassischen<br />
Webseiten muss wiederum für jede Aktion vom<br />
Client eine Anfrage erstellt und die Antwort des<br />
Servers vom Browser interpretiert werden. Dies erfordert<br />
ein komplettes Neuladen der Seite, auch<br />
wenn sich nur kleine Teile ändern. Mit AJAX werden<br />
vom Webserver nur mehr Teilinhalte angefordert.<br />
Diese werden als XML-Dokumente übermittelt und<br />
anhand der XML-Struktur interpretiert. AJAX manipuliert<br />
nun die bereits geladene Seite und ändert nur<br />
jene Daten, die wirklich notwendig sind. Dadurch
erhält man wesentlich performantere („schnellere“)<br />
Applikationen, mit denen ein Verhalten ähnlich zu<br />
Desktop-Anwendungen (in „Klick-Geschwindigkeit“)<br />
erreicht wird. Dies führte im nächsten Schritt<br />
zu RIA.<br />
Als „Rich Internet Application“ (RIA) bezeichnet<br />
man jene Webanwendungen, welche durch clientseitige<br />
Anwendung von JavaScript Möglichkeiten wie<br />
vergleichbare Desktop-Anwendungen bieten. So ist<br />
es zum Beispiel mit diesem Ansatz möglich, Office-<br />
Anwendungen als Webanwendungen zu implementieren.<br />
Anders als bei Desktop-Anwendungen müssen<br />
diese allerdings nicht installiert werden und<br />
bieten die Möglichkeit auf jedem Rechner, welcher<br />
über einen kompatiblen Browser verfügt, ausgeführt<br />
zu werden (sind also unabhängig vom verwendeten<br />
Betriebssystem). Die Daten werden hierbei zentral<br />
auf dem Server hinterlegt. Die Interaktion mit dem<br />
Webserver ist auf ein Minimum beschränkt, was flüssiges<br />
Arbeiten mit RIA ermöglicht.<br />
?<br />
Serversei'ger<br />
Ansatz<br />
Vorteile unabhängig von clientsei2ger SoHwareausstat-‐<br />
tung<br />
gleiches Verhalten auf allen Clients<br />
Nachteile jede Ak2on erfordert einen Aufruf serversei2ger<br />
Funk2onalität<br />
jede Ak2on erfordert kompleEes Neuladen der<br />
aktuellen Seite<br />
Tabelle 3: Vor-‐ und Nachteile des serverseitigen und des clientseitigen Ansatzes<br />
Stellen Sie die Vor-‐ und Nachteile von server-‐ und cli-‐<br />
entsei2gen Ansätzen gegenüber. Vergleichen Sie Ihre<br />
Antwort mit Tabelle 3.<br />
6. Vor Gebrauch gut schü:eln – Syndika(on und Inte-‐<br />
gra(on<br />
Moderne Webapplikationen verdanken einen großen<br />
Teil ihrer Verbreitung der Tatsache, dass deren Verknüpfung<br />
zu einem immer zentraleren Teil ihrer<br />
Funktionalität wird. Dies geht über einfache Hyperlinks<br />
weit hinaus: Inhalte und Funktionalitäten<br />
werden zur Verfügung gestellt und in andere Web-<br />
Applikationen integriert. So wird eine Kreativität bei<br />
der Erstellung von neuen Applikationen ermöglicht,<br />
wie sie ohne diese Offenheit und den daraus resultierenden<br />
Vorteil bestehende Funktionalität nicht erneut<br />
selbst implementieren zu müssen, nur schwer vorstellbar<br />
wäre. Die Syndikation mehrerer fremder<br />
Webtechnologien. Technische Anforderungen an Informa2onssysteme— 7<br />
Funktionalitäten oder Integration fremder Inhalte in<br />
eine Webapplikation werden als Mashup bezeichnet.<br />
Dieser Begriff wurde ursprünglich in der Musikbranche<br />
verwendet, um Remixes zu beschreiben. Im<br />
Zusammenhang von Webapplikationen bedeutet es<br />
eine in der Anwendung transparente Integration<br />
fremder Dienste und Inhalte.<br />
Damit sind jedoch auch Nachteile verbunden:<br />
▸ Wer haftet bei sicherheitskritischen Anwendungen,<br />
wenn Funktionen nicht korrekt funktionieren,<br />
zum Beispiel wenn bei Lernsoftware eine Applikation<br />
die Prüfungsfragen falsch auswertet?<br />
▸ Alle Server, welche die Services anbieten, müssen<br />
ständig verfügbar sein – dies liegt jedoch nicht in<br />
der Verantwortung des Betreibers.<br />
▸ Das Urheberrecht bzw. die Lizenzierung führt zu<br />
der Frage, ob man die Funktionen überhaupt integrieren<br />
darf (bei Facebook, Google Maps etc. mag<br />
dies augenscheinlich sein, bei kommerziellen Anbietern<br />
ist dies aber nicht gegeben).<br />
Programmierschni:stellen<br />
Clientsei'ger<br />
Ansatz<br />
Reak2onszeiten ähnlich zu Desktop-‐Anwendungen<br />
nur benö2gte Inhalte werden geladen und in die aktuelle<br />
Seite integriert<br />
Verhalten von Browser (JavaScript Engine) abhängig<br />
Sicherheit der Anwendungen ist aufwendiger zu gewähr-‐<br />
leisten<br />
!<br />
Ein Mashup ist die Integra2on von Inhalten und Funk-‐<br />
2onalitäten anderer Webapplika2onen in die eigene.<br />
Application Programming Interfaces (API) sind<br />
wohldefinierte Schnittstellen für die Interaktion mit<br />
Applikationen. Im Zusammenhang mit Webapplikationen<br />
werden sie üblicherweise als Webservices implementiert<br />
und liefern entweder XML-Daten oder<br />
vergleichbare strukturierte Daten wie die einfachere<br />
JavaScript Object Notation (JSON). Sowohl SOAPals<br />
auch REST-Ansätze sind möglich, auch wenn der<br />
Trend der letzten Jahre in Richtung REST-Anwendungen<br />
weist. Einerseits können API dazu verwendet<br />
werden um Funktionalität zur Verfügung zu stellen,<br />
wie zum Beispiel die Darstellung von Koordinaten in
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Karten mittels der Google-Maps-API. Abbildung 1<br />
zeigt ein Beispiel der Visualisierung von geographischen<br />
Koordinaten mittels der Google Maps API.<br />
Andererseits können solche Applikationen auch<br />
Inhalte zur Verfügung stellen. So ist es mit der Flickr-<br />
API zum Beispiel möglich, auf Fotos des Internetdienstes<br />
zuzugreifen. Andere API ermöglichen beispielsweise<br />
die Integration von Daten aus sozialen<br />
Netzwerken, wie die Facebook-API.<br />
RSS<br />
Abbildung 1: TUGeowiki: Integration von Kartenma-‐<br />
terial über die Google Maps API. Quelle: Safran und<br />
Zaka, 2008<br />
Real Simple Syndication (RSS) beschreibt eine Technologie,<br />
mit deren Hilfe Inhalte von Websites, soge-<br />
In der Praxis: Die Personal Learning Environment an der TU Graz<br />
Als Praxisbeispiel für ein Mashup kann die Personal Learning<br />
Environment (PLE) an der Technischen Universität Graz ge-‐<br />
nannt werden. In dieser persönlichen Lernumgebung sind<br />
verschiedene, zum Teil unabhängige und verteilte Dienste<br />
der TU Graz so wie andere Webanwendungen aus dem In-‐<br />
ternet integriert. Abbildung 3 stellt dieses Grundkonzept gra-‐<br />
p h i s c h d a r. U n i v e r s i t ä t s d i e n s t e w i e d a s<br />
Administra2onssystem (TUGRAZ.online), LMS (TUGTC), Blo-‐<br />
gosphere (TUGLL) und viele Lernobjekte für unterschiedliche<br />
Lehrveranstaltungen sind in der PLE kombiniert.<br />
Zusätzlich dazu können zahlreiche fremde Lernobjekte und<br />
webbasierte Dienste wie Google-‐Applika2onen, Flickr,<br />
YouTube, TwiEer, FaceBook, etc. integriert werden. Die Inte-‐<br />
gra2on dieser Dienste erfolgt miEels Widgets. Das PLE als<br />
eine Rich Internet Applica2on (RIA) bietet ein Mashup von<br />
Widgets, die an den persönlichen Nutzungsbedürfnissen an-‐<br />
passbar sind. Die Benutzer/innen sind in der Lage sich die ge-‐<br />
nannte Feeds, zur Verfügung gestellt werden. Die<br />
Daten liegen hierbei in einem XML Format vor. RSS<br />
dient hauptsächlich zur Benachrichtigung bei häufig<br />
aktualisierten Informationen, wie Weblogs oder<br />
Nachrichtenseiten. Benutzer/innen können RSS-<br />
Feeds mit einem Client abonnieren, der ihnen immer<br />
die jeweils neuesten Meldungen anzeigt. Abbildung 2<br />
zeigt das gebräuchlichste Icon für RSS-Feeds, wie es<br />
zum Beispiel im Browser Firefox Verwendung findet.<br />
In Webapplikationen bietet RSS eine gute Möglichkeit<br />
zur Syndikation von Daten aus unterschiedlichen<br />
Quellen. Da die Daten in XML vorliegen,<br />
können sie einfach maschinell weiterverarbeitet und<br />
in die eigene Webseite integriert werden.<br />
Abbildung 2: Icon für RSS Feeds<br />
Widgets<br />
Eine dritte Technologie, die bei der Integration verschiedener<br />
Webanwendungen Anwendung findet,<br />
sind Widgets. Ein Widget ist ein kleines, in sich abgeschlossenes<br />
Programm, das im Rahmen einer anderen<br />
grafischen Benutzeroberfläche abläuft. Üblicherweise<br />
ist die Funktionalität solch eines Widgets<br />
spezialisiert und eingeschränkt. Im Desktop-Bereich<br />
haben sich Widgets inzwischen bei den meisten Betriebssystemen<br />
durchgesetzt und können entweder<br />
direkt als Teil des Desktops (wie Gadgets in Microsoft<br />
Windows) oder über eine getrennte Widget-<br />
eigneten, zu ihrem Studium benö2gten Widgets auszusuchen<br />
und diese nach ihren aktuellen Bedürfnissen zu konfigu-‐<br />
rieren.<br />
Abbildung 3: PLE: Mashup von Widgets ermöglicht die Inte-‐<br />
gra2on von verschiedenen Universitätsdiensten sowie der<br />
fremden Ressourcen aus dem Internet.
Engine (wie das Dashboard bei Mac OS X) benutzt<br />
werden. Im Zusammenhang mit Webapplikationen<br />
bezeichnet der Begriff Widget genauso eine eigenständige,<br />
abgeschlossene und in eine andere Applikation<br />
integrierte Funktionalität. Diese sind meist innerhalb<br />
der Benutzerschnittstelle der eigentlichen<br />
Webapplikation mehr oder weniger frei positionierbar.<br />
So können Widgets zum Beispiel Daten über<br />
einen RSS-Feed abrufen, oder auf Funktionalitäten<br />
mittels einer API zugreifen. Ein Beispiel für Widgets<br />
sind die Apps des sozialen Netzwerks Facebook,<br />
welche nicht selbst von Facebook, sondern von anderen<br />
Entwicklerinnen und Entwicklern erstellt, aber<br />
in die Webapplikation Facebook integriert werden.<br />
Für Benutzer/innen ist kaum ein Unterschied erkennbar.<br />
Über eine API greifen diese Apps zusätzlich<br />
auf die Funktionalität von Facebook zu.<br />
7. Aktuelle Trends in der Entwicklung von Webanwen-‐<br />
dungen<br />
In den letzten Jahren haben sich drei Ansätze bei der<br />
Entwicklung von Webanwendungen durchgesetzt.<br />
Vom serverseitigen Standpunkt aus bieten viele, vor<br />
allem bekannte und große Webanwendungen, wie die<br />
verschiedenen Google-Produkte oder Facebook, parallel<br />
zu ihren Webanwendungen Webservices als API<br />
an. Dies ermöglicht und ermutigt die Verwendung<br />
ihrer Funktionalität in anderen Webanwendungen.<br />
Vom clientseitigen Standpunkt sind RIA der Stand<br />
der Technik. Hier wird bei vielen Webanwendungen<br />
darauf Wert gelegt, dass den Benutzern die An-<br />
Webtechnologien. Technische Anforderungen an Informa2onssysteme— 9<br />
mutung einer Desktop-Anwendung vermittelt wird.<br />
Durch die Anwendung von AJAX haben sich die Reaktionszeiten<br />
der Webanwendungen erheblich verbessert.<br />
Zu guter Letzt gehört Syndikation und Integration<br />
zum Stand der Technik in vielen Anwendungsbereichen.<br />
Durch die Möglichkeiten, welche Webservices<br />
und RIA bieten, kann auf Funktionalität und<br />
Inhalte anderer Anwendungen leicht zurückgegriffen<br />
werden. Diese können nahtlos in die eigene Benutzungsschnittstelle<br />
integriert werden.<br />
Literatur<br />
▸ Vinton Cerf (1993). The history of Internet. In: B. Aboba<br />
(Hrsg.), The Online User's Encyclopedia, Addison-Wesley.<br />
▸ Cailliau, R. (1995). A Little History of the World Wide Web.<br />
URL: http://www.w3.org/History.html [2010-09-08].<br />
▸ Safran, C. & Zaka, B. (2008). A Geospatial Wiki for m-<br />
Learning. In: Proceedings of the 2008 International Conference<br />
on Computer Science and Software Engineering, IEEE<br />
Computer Society, Washington, 5, 109-112.<br />
▸ The PHP Group. (2010). Hypertext Preprocessor. URL:<br />
http://www.php.net [2010-01-04].<br />
▸ Vossen, G. & Westerkamp, P. (2003). E-Learning as a Web<br />
Service. In: Proceedings of the Seventh International Database<br />
Engineering and Applications Symposium, Los Alamitos, CA,<br />
USA: IEEE Computer Society, 242.<br />
▸ World Wide Web Consortium (2004). Web Services Architecture.<br />
URL: http://www.w3.org/TR/ws-arch/#id2268743<br />
[2010-01-12].
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. Die Mischung macht’s – Überlegungen zu Beginn<br />
In den letzten Jahren wurden auf technischem<br />
Gebiet wesentliche Durchbrüche erzielt. Die Kanalkapazitäten<br />
der verfügbaren Netze in den modernen<br />
Industriestaaten erlauben es zum Beispiel Videos in<br />
nahezu beliebiger Größe zu speichern und auch<br />
mobil zur Verfügung zu stellen.<br />
Theoretische Hintergründe für die Methoden zum<br />
Lernen mit multimedialen und interaktiven Lernmaterialien<br />
werden in lerntheoretischen Abhandlungen<br />
beschrieben. In diesem Text wird vor allem auf praktische<br />
Anwendbarkeit Wert gelegt.<br />
Gleich zu Beginn also auch praktische Beispiele:<br />
Videos über Programmieren auf einem Smartphone<br />
zu betrachten ist weitestgehend sinnleer, da die Lernenden<br />
beim Erlernen der Fähigkeit „Programmieren“<br />
auf beständiges Üben angewiesen sind und<br />
dies am Smartphone nicht möglich ist. Es ist also<br />
nicht weiter überraschend, dass viele Projekte, die lediglich<br />
die technische Komponente des Lernens betrachten,<br />
nach einer anfänglichen Phase der Euphorie<br />
recht häufig scheitern und nicht weiter verfolgt<br />
werden. Ganz ähnlich sieht es mit Verfahren aus, die<br />
vorhandene Texte durch fast vollständig automatisierte<br />
Verfahren in Audiofiles umwandeln. Ganze<br />
Projekte, die auf diese Weise Gigabytes an Audiofiles<br />
für gängige portable Geräte (zum Beispiel Mobiltelefone<br />
oder MP3-Player) erstellt haben, werden von<br />
den Lernenden kaum bzw. nur zögerlich angenommen.<br />
Der Grund liegt nahe: Es ist sehr unpraktisch<br />
einen Text anzuhören, der ursprünglich für das<br />
visuelle Erfassen konzipiert wurde.<br />
!<br />
Deshalb sind online zur Verfügung gestellte Lernmate-‐<br />
rialien ausgesprochen sorgfälNg in die Richtung der<br />
Bedürfnisse der Anwender/innen zu entwickeln und<br />
zu gestalten.<br />
Lernende wollen vor allem eines: mit möglichst<br />
geringem Aufwand ein Maximum an Wirkung erzielen.<br />
Um nun die richtigen Medien auswählen zu<br />
können, müssen unserer Erfahrung nach folgende<br />
drei Fragen der Reihe nach gestellt und präzise beantwortet<br />
werden:<br />
▸ Was genau sollen die Lernenden nach Beendigung<br />
des Kurses können bzw. wissen?<br />
▸ Wie kann das gesamte Lernmaterial in überschaubare<br />
Einheiten geteilt werden und was<br />
enthält eine Einheit genau?<br />
▸ Was benötigt die/der Lernende in jeder dieser<br />
Einheiten, um das definierte Lernziel optimal zu<br />
erreichen?<br />
Entscheidend für die Auswahl der optimalen Medien<br />
zur Vermittlung des Wissens ist die Beantwortung<br />
der dritten Frage.<br />
?<br />
2. Über Bilder, Audio, Video und Anima?onen zu inter-‐<br />
ak?ven Lernmaterialien<br />
Gehen wir davon aus, dass geschriebener Text und<br />
gesprochene Sprache in Form eines Vortrages als<br />
Standardmedium und Lernmaterial dienen.<br />
Bilder<br />
Abbildung 1: Beispiel einer Strukturierung: Der Au5au dieses Kapitels<br />
!<br />
Studierende verwenden Unterlagen nur dann, wenn<br />
sie das Lernen effizient und bequem unterstützen!<br />
Lehrende verwenden ein Lernmanagementsystem<br />
(LMS) und mulNmediale / interakNve Materialien nur<br />
dann, wenn Sie Unterlagen einfach erstellen und<br />
hochladen können (siehe Kapitel #systeme #info-‐<br />
systeme).<br />
Versuchen Sie eine Mindmap für die Planung Ihres<br />
Kurses und zur Beantwortung der drei Fragen zu er-‐<br />
stellen!<br />
Als „einfachstes“ zusätzliches Medium wird seit jeher<br />
das Bild angewendet. Einzelbilder sind der Einstieg
InterakNve, mulNmediale Materialien. Gestaltung von Materialien zum Lernen und Lehren— 3<br />
in die multimediale Welt. Daher sind zu Beginn die<br />
Möglichkeiten des Einsatzes von Bildern zu betrachten:<br />
Bilder erleichtern im Prinzip das Verständnis<br />
von Inhalten. Nicht umsonst gibt es das<br />
Sprichwort: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“.<br />
Im Gegenzug bietet aber auch kein anderes Medium<br />
mehr Möglichkeiten zur (Fehl-) Interpretation. Daher<br />
muss sehr viel Augenmerk auf eine möglichst gezielte<br />
und fehlinterpretationsfreie Gestaltung gelegt<br />
werden. Oftmals benötigen Bilder und Grafiken, im<br />
Speziellen etwa Diagramme zusätzlichen Text zur Erklärung<br />
– jeder Mensch interpretiert das Gesehene in<br />
seinem eigenen Erfahrungskontext.<br />
!<br />
Als Spezialform der Bilder können die heute bereits<br />
sehr beliebten Präsentationsfolien, die via PC<br />
und Beamer präsentiert werden, betrachtet werden.<br />
Diese Folien sind meist eine Mischung aus Text und<br />
Bildern.<br />
Audio<br />
Audio kann in unterschiedlichen Formen in multimedialen<br />
Lernszenarien zum Einsatz kommen: Als Hörspiel,<br />
als Vorlese-Hilfe, als Podcast (kurzes Audiofile)<br />
für mobile Endgeräte oder auch als komplexes Hörgebilde,<br />
welches durch Musik und Sprache kombiniert<br />
Lerninhalte vermittelt (siehe Kapitel #educast).<br />
Prinzipiell kann man beim Medium Audio zwei<br />
Arten unterscheiden: Sprache und Musik. Mit<br />
Sprache können konkrete Informationen (zum Beispiel<br />
weiterführende Erläuterungen zu einem Bild<br />
oder einer Textpassage) zur Verfügung gestellt<br />
werden, die auf einer herkömmlichen Textseite<br />
keinen Platz mehr finden oder vom wesentlichen<br />
Inhalt ablenken würden. Darüber hinaus können<br />
Sprach-Podcasts genutzt werden um Inhalte gezielt<br />
für Wiederholungen zu komprimieren.<br />
!<br />
Bilder können zur Veranschaulichung (Beschreibung<br />
und Ergänzung des Textes), Strukturierung (Visuali-‐<br />
sierung einer inhaltlichen Struktur, z. B. in Form einer<br />
Mindmap) oder zur DekoraNon (zur Umrahmung und<br />
MoNvaNon der eigentlichen Inhalte) eingesetzt<br />
werden. (Hametner, 2006, 36 ff.)<br />
Musik setzt vor allem in virtuellen Lernwelten oder in<br />
E-‐Learning-‐Programmen an und dort vor allem auf der<br />
emoNonalen Ebene (Niegemann et al., 2003, 128 ff.)<br />
Inhalte, die mit Emotionen verknüpft sind,<br />
werden leichter im Gedächtnis verankert. Die Er-<br />
zeugung von Emotionen ist ein komplexer Prozess<br />
und nicht nur auf Musik beschränkt (Campbell, 1999;<br />
Vogler & Kuhnke, 2004).<br />
!<br />
Das Hören des Textes erleichtert es den Lernenden<br />
wesentlich, sich den Inhalt beim weiteren<br />
Lesen einzuprägen. Damit ist auch klar, dass diese<br />
Audiofiles immer mit einem Textfile ergänzt werden<br />
müssen. Audiofiles alleine haben unserer Meinung<br />
nach zumindest im technischen Kontext kaum Sinn.<br />
Der Grund dafür ist einfach, technische Strukturen<br />
erfordern meist vernetztes Denken, dies kann in<br />
einem linearen Format, wie es das Hören von Text<br />
ist, nur sehr schlecht trainiert werden. Eine Ergänzung<br />
durch andere Medien, wie bereits angesprochen,<br />
in Form von Text oder Bild ist daher von<br />
Nöten.<br />
Besonders effizient sind Textdateien, die einen<br />
sehr ähnlichen, aber nicht immer identen Inhalt zum<br />
Audiofile haben. Durch das Wahrnehmen der ähnlichen<br />
Inhalte über unterschiedliche Sinneskanäle<br />
wird das Einprägen gefördert und es können durch<br />
die Wiederholung mit größerer Wahrscheinlichkeit<br />
zusätzliche Querverbindungen hergestellt werden.<br />
Video<br />
Einfache Audiofiles (Texte) können sinnvoll verwendet<br />
werden, wenn es darum geht eine genügende Anzahl<br />
von Wiederholungen zu erzeugen, um etwas dau-‐<br />
erhad zu erinnern und im Gedächtnis zu fesNgen.<br />
Lehrfilme und kurze Videos sollten heute zum Unterrichtsstandard<br />
gehören. Vor allem die Entwicklung<br />
der CD-ROM machte Videos für den Einsatz in<br />
E-Learning-Umgebungen interessant, da mit deren<br />
Hilfe erstmals die entsprechenden Datenmengen in<br />
Zeiten vor dem Internet verteilt werden konnten.<br />
!<br />
Videos sprechen beim Menschen zwei Sinneskanäle<br />
an – sowohl den audiNven als auch den visuellen.<br />
Einen starken Realitätsbezug liefern Videos durch<br />
die Einbeziehung der Komponente Zeit. Eine dramaturgische<br />
Gestaltung durch den gezielten Einsatz von<br />
Musik unterstreicht die Aussage des Inhaltes zusätzlich<br />
(Niegemann u.a., 2003, 148 f.).<br />
Menschen lernen in vielen Fällen durch Nachahmung,<br />
dafür ist der Einsatz des Mediums Video<br />
für Instruktionen häufig ideal.
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
In der Informatik, zum Beispiel fallen die Bedienung<br />
einer bestimmten Softwareumgebung oder<br />
die Benutzung eines Debuggers und ähnliches in<br />
diese Kategorie.<br />
Zudem hat sich als optimal herausgestellt, derartige<br />
Videos durch Präsentationen zu ergänzen. Es<br />
ist in vielen Fällen für Lernende sehr angenehm<br />
anhand von Folien, in denen sie einfach vor- und zurückblättern<br />
können, die Kernaussagen der Videos<br />
zu wiederholen, auch für unterwegs auf mobilen<br />
Endgeräten.<br />
!<br />
Abbildung 2: Screenshot der freien Audiobearbei-‐<br />
tungssoftware Audacity<br />
Sie wollen sich bei Kolleginnen und Kollegen Anre-‐<br />
gungen holen, wie diese Ihre Vorlesungsmitschnige<br />
organisieren?<br />
Unter hgp://www-‐lehre.inf.uos.de/~ainf/2006/Auf-‐<br />
zeichnungen/index.html [24.09.2010] stehen Auf-‐<br />
zeichnungen, MP3 und Podcasts zu einer Vorlesung<br />
über Algorithmen und Datenstrukturen zur Verfügung.<br />
Interessant zum Stöbern sind auch die Angebote<br />
deutschsprachiger InsNtuNonen in Apple’s iTunesU.<br />
In solchen Fällen ist ein kurzes Video von maximal<br />
15 Minuten, besser 7 Minuten Länge empfehlenswert.<br />
Bei längeren Videos sinkt die Aufmerksamkeit<br />
der Zusehenden zunehmend und der gewünschte<br />
Lerneffekt stellt sich nicht ein, selbiges gilt<br />
auch für Audiofiles.<br />
Ein weiterer Trend ist die Aufzeichnung kompletter<br />
Vorlesungen via Video und deren Bereitstellung<br />
für die Lernenden, meist über ein Webportal.<br />
Dies bietet die Möglichkeit verpasste Einheiten zu<br />
wiederholen oder in Lerngruppen den durchgenommenen<br />
Stoff zu reflektieren und zu diskutieren.<br />
Anima?onen<br />
Eine Sonderform von Videos stellen Animationen<br />
dar, da sie nicht unmittelbar die Realität widerspiegeln.<br />
Somit können aber vor allem abstrakte und<br />
komplexe Zusammenhänge (zum Beispiel chemischer<br />
oder physikalischer Natur) veranschaulicht werden,<br />
die rein auditiv oder statisch visuell nicht oder nur<br />
schwer erfassbar gemacht werden können. Ebenso<br />
kann mit Animationen die Aufmerksamkeit der Lernenden<br />
gesteuert werden (Wendt, 2003, 199).<br />
Interak?ve Lernmaterialien<br />
Das explorative Lernen im Rahmen des konstruktivistischen<br />
Lernparadigmas (siehe Kapitel #lerntheorie)<br />
lässt sich sehr gut mit interaktiven Lernmaterialien<br />
und deren zeitlicher Steuerbarkeit des Ablaufs<br />
unterstützen. Die Interaktion kann in einfachster<br />
Weise durch die Auswahl einzelner Objekte repräsentiert<br />
werden, in komplexeren Szenarien stehen den<br />
Lernenden weitere Möglichkeiten zur Verfügung, wie<br />
Veränderung von Objekten, die Nutzung von tutoriellen<br />
Systemen oder die Möglichkeit multimediale<br />
Elemente mit Annotationen zu versehen.<br />
3. Mul?media und Datenkompression<br />
Mit Multimedia ist unweigerlich das Problem der Datenkompression<br />
verbunden. Bedenkt man, dass sämtliche<br />
Daten möglichst in Echtzeit bei den Lernenden<br />
ankommen bzw. am Bildschirm auf Knopfdruck erscheinen<br />
sollte, sah man sich besonders in den Anfängen<br />
des World Wide Web mit großen Problemen<br />
konfrontiert.<br />
Mit einem damals in Privathaushalten verfügbaren<br />
Modem, war eine Übertragungsleistung von 14.400<br />
Bit/s möglich. Ein unkomprimierte Bilddatei mit<br />
einer Größe von 1024 * 768 Pixel erreicht bei einer<br />
angenommenen Farbtiefe von 24 Bit (24 Bit = 3<br />
Bytes) je Pixel bereits 1024 * 768 * 24 Bits, also<br />
18.874.368 Bits. Dies ergäbe bei Verwendung obigem<br />
Modems im Idealfall eine Übertragungszeit von<br />
1.311s oder circa 22 Minuten. Eine Steigerung der<br />
Übertragungsleistung auf 28.800 Bit/s oder sogar<br />
56.000 Bit/s schaffte nur bedingt Abhilfe. Nachdem<br />
ein Video nur die schnelle Abfolgen von vielen Einzelbildern<br />
darstellt, wurde das Problem nur noch<br />
weiter verschärft.<br />
Datenkompression von Bildern<br />
Generell erfolgt eine Unterscheidung in eine verlustfreie<br />
Datenkompression (unnötige Informationen aus<br />
dem Datenbestand werden entfernt) und eine verlustbehaftete<br />
(Informationen werden entfernt ohne die<br />
subjektive Wahrnehmung des Menschen zu verschlechtern).<br />
Im Laufe der Jahre entstanden so unterschiedliche<br />
Kodierungsverfahren, die heute von verschiedenen<br />
Bildformaten verwendet werden. JPG,<br />
PNG, GIF, SVG, BMP, TIFF, WMF, Postscript, PDF<br />
sind die bekanntesten Formate.
InterakNve, mulNmediale Materialien. Gestaltung von Materialien zum Lernen und Lehren— 5<br />
In den Anfängen kam im Web vor allem das GIF-<br />
Format zur Anwendung, da es bei geringer Farbtiefe<br />
auch Transparenz und kleine Animationen zuließ.<br />
Weiters wurde es in die HTML-Spezifikation aufgenommen.<br />
Jedoch verwendete dieses Format die patentierte<br />
Lauflängenkodierung, wodurch viele Firmen<br />
auf die heutige gängigen JPEG- oder PNG-Formate<br />
zurückgreifen.<br />
JPEG-Kompression eignet sich sehr gut für photorealistische<br />
Bilder bei ausgezeichneten Kompressionsraten,<br />
jedoch bilden sich bei harten Übergängen<br />
Artefakte und bei mehrmaliger Kompression verändert<br />
sich stark die Qualität des Bildes. JPEG ist<br />
zwar für Darstellungen im Web geeignet, aber nicht<br />
für die Bildbearbeitung.<br />
Datenkompression von Videos<br />
Digitale Videotechnik nimmt aufgrund der verfügbaren<br />
Endgeräte einen immer höheren Stellenwert in<br />
unserem Alltag ein. Sie bleibt aber aufgrund der notwendigen<br />
Datenmenge nicht unproblematisch -<br />
selbst hochwertige Computer sind bei der Verarbeitung<br />
derartiger Daten gefordert. Um die Speichermengen<br />
zu verdeutlichen, gehen wir davon aus, dass<br />
eine digitale Videokamera mit einer Auflösung von<br />
800.000 Pixeln arbeitet. Bei voller Farbtiefe benötigt<br />
dieses Bild circa 2,3 MB. Um eine realistische Bewegtbildfolge<br />
zu erhalten, sind 24 bis 30 Bilder pro<br />
Sekunde nötig. Das führt, je nach Bildrate, zu einem<br />
Datenstrom von ca. 60MB pro Sekunde. Ein abendfüllender<br />
Film (120min) würde unkomprimiert also<br />
422 GB an Daten produzieren. Ohne Datenkompression<br />
wäre eine Übertragung im Internet undenkbar<br />
und es wurde eine große Anzahl unterschiedlicher<br />
(Komprimierungs-) Codecs entwickelt.<br />
Zur Kompression/Dekompression von Multimediadaten,<br />
in unserem Fall eben Videodaten, kommt ein<br />
sogenannter Codec (als Abkürzung für „coder“ und<br />
„decoder“) zum Einsatz. Dieser kann in Softwareoder<br />
Hardwareform vorliegen. Bei lizenzpflichtigen<br />
Verfahren sind diese beiden Teile auch manchmal getrennt:<br />
der Kompressor ist gebührenpflichtig,<br />
während der Dekompressor frei zugänglich ist. Die<br />
wichtigsten Codecs sind Cinepak, Indeo, Video-1,<br />
MS-RLE, MJPEG und Codecs nach H.261, H.263<br />
und MPEG. Ähnlich den Bildern können verschiedene<br />
Dateiformate durchaus verschiedene<br />
Codecs unterstützen, sodass man keinen direkten<br />
Schluss aus dem Dateiformat auf den verwendeten<br />
Codec ziehen kann. Bekannte Beispiele sind das von<br />
Apple's Quicktime verwendete MOV und von<br />
Windows angebotene WMF oder ASF Format.<br />
Datenkompression von Audio<br />
Audiokompression ist heute sehr stark durch das<br />
MP3 Format geprägt, welches auch auf einem sehr<br />
einfachen Prinzip beruht: Zur Kompression von<br />
Audio-Signalen speichert man unwichtige Informationen<br />
nicht ab. Basierend auf Studien über das<br />
menschliche Gehör entscheidet der so genannte Encoder,<br />
welche Informationen wichtig sind und welche<br />
nicht. Beim Menschen ist es prinzipiell nicht viel<br />
anders: Bevor ein Klang ins Bewusstsein dringt,<br />
haben Ohr und Gehirn ihn schon auf seine Kernelemente<br />
reduziert. Die psychoakustische Reduktion der<br />
Audio-Daten nimmt diesen Vorgang teilweise<br />
vorweg. Der Schlüssel zur Audio-Kompression besteht<br />
darin, auch solche Elemente zu beseitigen, die<br />
nicht redundant, aber irrelevant sind. Dabei geht es<br />
um diejenigen Teile des Signals, die die menschlichen<br />
Zuhörer/innen sowieso nicht wahrnehmen würden.<br />
Ähnlich wie bei den Bildern und Videos gibt es<br />
eine hohe Anzahl an verschiedenen Kompressionsverfahren.<br />
4. Aktuelle Programme zur Erstellung von Lernmate-‐<br />
rialien und deren Einbindung in Lernmanagement-‐<br />
systeme<br />
Um den Rahmen dieses Kapitels nicht zu sprengen,<br />
möchten wir an dieser Stelle nur ein paar Tools<br />
(Software) vorstellen, mit denen man von einfachen<br />
Lernmaterialien angefangen bis hin zu komplexen<br />
multimedialen Lerneinheiten selbst gestalterisch aktiv<br />
sein kann. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf kostenfreien<br />
Angeboten, die frei verfügbar sind. Vorweg sei<br />
aber auch angemerkt, dass eine erfolgreiche und zielführende<br />
Gestaltung nicht von heute auf morgen erreicht<br />
werden kann und es in vielen Fällen sehr viel<br />
Übung und Erfahrung bedarf, um das optimale Lernmaterial<br />
entwickeln zu können.<br />
Bilder<br />
Um Bilder anzusehen, Attribute wie Größe oder Auflösung<br />
zu ändern oder rudimentäre Bildbearbeitungen<br />
durchzuführen, kann unter Windows® das<br />
Freeware-Programm IrfanView eingesetzt werden.<br />
Für MacOS X ist zum Beispiel die interne Vorschau<br />
verfügbar und für Linux XnView. Zahlreiche plattformunabhängige<br />
Open-Source-Programme können zur<br />
Erstellung von Bildern und Grafiken genannt<br />
werden: Für Mindmaps bietet sich Freemind an, für<br />
Diagramme Dia, Vektorgrafiken können mit<br />
Inkscape erstellt werden, Desktop Publishing (DTP)<br />
gelingt mit Scribus und für professionelle Bildbearbeitung<br />
empfiehlt sich GIMP. Screenshots, auch von
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Teilen Ihres Bildschirms und die Bearbeitung derselben<br />
gelingen einfach mit der Open Source<br />
Software Greenshot.<br />
Audio<br />
Zur Aufnahme von Sprache aber auch Musik benötigt<br />
man zusätzlich zu einem geeigneten PC mit<br />
angeschlossenen Mikrofonen nur mehr eine Recording-Software.<br />
Neben den kommerziellen Anbietern<br />
wie Steinberg (mit zum Beispiel WaveLab)<br />
oder Adobe (mit Audition), erfreut sich das freie Audacity<br />
immer steigender Beliebtheit. Ebenso kann mit<br />
diesem Produkt beinahe jedes beliebige Audiofile bearbeitet,<br />
geschnitten und konvertiert werden.<br />
?<br />
Bearbeiten Sie Ihre eigenen Audio-‐Files mit Audacity,<br />
das EinsNegs-‐Tutorial unter hgp://www.lehrer-‐onli-‐<br />
ne.de/audacity-‐tutorial.php [24.09.2010] hild Ihnen<br />
dabei!<br />
Mul?mediale AuKereitung von Lerninhalten<br />
Unzählige am Markt verfügbare Videoschnittprogramme,<br />
von einfachsten und kostenlosen angefangen<br />
bis hin zu professionellen Systemen, machen<br />
es den Anwender/innen schwer, die richtige Auswahl<br />
für ihre Bedürfnisse zu treffen. Auf Grund dessen<br />
wollen wir uns der Aufzeichnung von Vorlesungen<br />
und der Audiokommentierung von Vorlesungsunterlagen<br />
widmen, sowie der Erstellung von Animationen<br />
und interaktiven Lernmaterialien, da diese in der<br />
Praxis viel häufiger zum Einsatz kommen, als ein<br />
selbstgedrehtes Video.<br />
Um sogenannte Screenrecordings (Aufzeichnen<br />
des eigenen Bildschirminhalts mit Audiokommentaren)<br />
durchzuführen, stehen kostenfrei unter<br />
Windows zum Beispiel CamStudio und Wink zur<br />
Verfügung, unter MacOS CaptureMe und unter<br />
Linux Wink wie auch RecordMyDesktop. Der Markt<br />
wird jedoch von Adobe’s Captivate, Techsmith’s<br />
Camtasia oder Lecturnity von IMC dominiert.<br />
Der Funktionsumfang der eben genannten Programme<br />
beschränkt sich nicht ausschließlich auf das<br />
Abfilmen von Bildschirminhalten, sondern bietet<br />
darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zur Erstellung<br />
von einfachen Animationen, wie animierten<br />
Schaltflächen oder kleineren Grafiken. Komplexe<br />
Animationen können mit professioneller Software,<br />
beispielhaft seien hier Blender und trueSpace genannt,<br />
erstellt werden.<br />
Autorensysteme für interak?ve Lernmaterialien<br />
Komplexe Lernmaterialien können mit sogenannten<br />
Autorensystemen erstellt werden. Diese Werkzeuge<br />
erlauben es, neben den unterschiedlichsten multimedialen<br />
Elementen auch Testfragen und Aufgabenstellungen<br />
zu integrieren, deren Antworten meist automatisiert<br />
ausgewertet bzw. der/dem Lernenden in<br />
Abhängigkeit der erzielten Punkte weitere Lernelemente<br />
frei geschalten werden. Beispielhaft seien an<br />
dieser Stelle WBTExpress oder auch EXELearning<br />
genannt, neben zahlreichen kommerziellen Lösungen,<br />
wie Lectora und ToolBook oder vielen anderen.<br />
Komplexe interaktive Lernmaterialien werden<br />
für Webseiten häufig mit Adobe’s Flash oder Silverlight<br />
von Microsoft realisiert.<br />
Integra?on in Lernmanagementsysteme<br />
Multimediale Lernmaterialien können in den meisten<br />
Lernmanagementsystemen durch Hochladen integriert<br />
werden und meist stellen die Systeme auch die<br />
passenden Player für die Lernenden zur Verfügung<br />
(siehe Kapitel #infosysteme).<br />
Wenn allerdings Testfragen in den Materialien integriert<br />
sind oder Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen<br />
Lernmodulen bestehen, so müssen die<br />
Lernmaterialien mit dem Lernmanagementsystem<br />
kommunizieren und Daten austauschen. Dazu<br />
wurden Standards entwickelt, die sicherstellen sollen,<br />
dass die Daten korrekt abgerufen und gespeichert<br />
werden können. Unter anderem können so der Name<br />
der/des Lernenden vom Lernmanagementsystem<br />
zum Lernmaterial übertragen (damit kann zum Beispiel<br />
eine persönliche Anrede gestaltet werden) oder<br />
aber auch die erzielten Punkte beim Test zentral im<br />
Lernmanagementsystem abgespeichert werden. Beispiele<br />
solcher Standards sind SCORM (siehe Kapitel<br />
#ebook) oder AICC.<br />
!<br />
Unter hgp://www.lernmodule.net/modul/<br />
[24.09.2010] finden Sie kostenlose Lernmodule zu un-‐<br />
terschiedlichsten Themengebieten, die Sie mit Hilfe<br />
der SCORM-‐Referenz in ihren Moodle-‐/Ilias-‐/Fronter-‐<br />
Kurs integrieren können – Anleitung dazu finden Sie<br />
auf der angegebenen Website. Für jedes Lernmodul<br />
exisNeren ausführlichste InformaNonen vom Schwie-‐<br />
rigkeitsgrad bis zum InterakNvitätslevel.<br />
5. Fazit und Kontrollfragen<br />
Multimediale und interaktive Lernmaterialien können<br />
ein jedes Lernszenario bereichern, sofern sie an die<br />
Bedürfnisse der Lernenden, der Zielgruppe, angepasst<br />
sind und den Anforderungen der Lernenden<br />
gerecht werden. Umfangreiche Medienkompetenzen<br />
seitens der Erstellenden sind von Nöten, um diesen<br />
Ansprüchen gerecht zu werden. Stellen Sie sich am<br />
Beginn der Entwicklungsphase Ihres multimedialen
In der Praxis: Videoannotationen<br />
InterakNve, mulNmediale Materialien. Gestaltung von Materialien zum Lernen und Lehren— 7<br />
Als konkretes und zeitgemäßes Beispiel für interakNve und<br />
mulNmediale Lernmaterialien möchten wir an dieser Stelle<br />
das Thema „VideoannotaNonen“ näher betrachten und vor-‐<br />
stellen. AnnotaNonen sind ergänzende InformaNonen im<br />
Video, die zusätzlich oder nachträglich hinzugefügt werden.<br />
Es kann sich dabei um Texte, Bilder, weiteres Videomaterial<br />
oder Links auf externe Webseiten handeln (Meixner , Siegel,<br />
Hölbling, Kosch & Lehner, 2009).<br />
Die Grenzen zwischen dem Produzieren und Konsumieren<br />
von Inhalten schwinden spätestens seit dem „Web-‐2.0-‐Zeit-‐<br />
alter” zunehmend. Spezielle Autorenwerkzeuge kommen<br />
meistens bei der ProdukNon von interakNven Lehrinhalten<br />
mit Hilfe einer Client-‐Sodware zum Einsatz. Die zusammen-‐<br />
gestellten Inhalte können veröffentlicht und den Lernenden<br />
zum rezepNven Lernen zur Verfügung gestellt werden. Dem<br />
gegenüber steht eine Variante der VideoannotaNon, die es<br />
allen Benutzern und Benutzerinnen via Webtechnologien<br />
gleichermaßen ermöglicht, Videos während dem Betrachten<br />
kollaboraNv mit AnnotaNonen zu versehen. Welche techni-‐<br />
schen Umsetzungen gibt es? Um Bildausschnige mit zeit-‐<br />
licher Erstreckung zu generieren und die MulNperspekNvität<br />
in Form von Hypervideos zu fördern, empfiehlt sich das An-‐<br />
notaNonswerkzeug WebDive (Zahn, Krauskopf & Hesse,<br />
2009). Ähnlich wie beim WebDiver können mit der Autore-‐<br />
numgebung SIVA Producer Videoszenen herausgeschnigen<br />
und mit ZusatzinformaNonen angereichert werden (Meixner<br />
u.a., 2009).<br />
Der edubreak-‐Videoplayer ermöglicht die bildgenaue, kolla-‐<br />
boraNve AnnotaNon mit Texten, Schlagwörtern, Sprachno-‐<br />
Nzen und Zeichnungen. Die professionelle Analyse und das<br />
Verwalten von Videos ermöglicht die netzwerkfähige Client-‐<br />
Anwendung DARTFISH Classroom.<br />
und interaktiven Lehrangebotes die drei Reflexionsfragen<br />
aus der Einleitung. Diese liefern Ihnen einen<br />
ersten Anhaltspunkt, welche Materialien Sie benötigen<br />
und welche Sie als zusätzliches Angebot zur<br />
Verfügung stellen können.<br />
Zum Abschluss der Lerneinheiten – egal mit<br />
welchen Medien diese gestaltet wurden – eignen sich<br />
kleine einfache Tests bestens um das Erlernte dauerhafter<br />
im Gehirn zu verankern. Daher möchten wir<br />
Ihnen nicht nur diese Empfehlung mit auf den Weg<br />
geben, sondern auch gleich mit gutem Beispiel voran<br />
gehen und Fragen zur Reflexion stellen.<br />
Abbildung 3: edubreak-‐Videoplayer im Kontext der Sporgrai-‐<br />
nerausbildung (kollaboraNve Bearbeitung)<br />
Sollen VideoannotaNonen in der Lehre eingesetzt werden, ist<br />
vor allem das didakNsche Design von Bedeutung (Krammer &<br />
Hugener, 2005; Vohle & Reinmann, in Druck). Mindestens<br />
zwei Aspekte sind zu beachten: zum einen die AnnoNerungs-‐<br />
ebene und zum anderen das Lernse|ng.<br />
Hinsichtlich der AnnoNerungsebene ergeben sich folgende<br />
Unterfragen: Geht es darum, im Videomaterial besNmmte In-‐<br />
halte / Botschaden zu suchen und zu annoNeren oder<br />
darum, besNmmte Zeitmarken aufzusuchen, um dort ge-‐<br />
stellte Fragen zu beantworten? Oder sollen die Lernenden<br />
frei Kommentare in Form von TextannotaNonen einbinden<br />
oder das Video mit Schlagwörtern anreichern (Tagging)?<br />
Für das Lernse|ng sind folgende Fragen relevant: Werden<br />
die VideoannotaNonen in einer Präsenzphase besprochen<br />
oder geschieht der Austausch auch virtuell (synchron oder<br />
asynchron)? Welche Art von VideoannotaNon ist im Rahmen<br />
eines Blended-‐Learning-‐Ansatzes sinnvoll, wie hängen die<br />
virtuelle Lernphase und die Präsenzphase zusammen?<br />
?<br />
?<br />
Warum und vor allem wann ist es sinnvoll eine ge-‐<br />
samte Vorlesung 1:1 aufzuzeichnen oder hilfreicher<br />
für die Lernenden einzelne Abschnige komprimiert<br />
zur Wiederholung bereitzustellen?<br />
In welchem didakNschen Kontext und unter welchen<br />
Bedingungen macht der Einsatz von Bildern / Audio /<br />
Video / VideoannotaNonen Sinn?
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
Literatur<br />
▸ Campell, J. & Koehne, K. (1999). Der Heros in tausend Gestalten.<br />
Frankfurt: Insel.<br />
▸ Krammer, K. & Hugener, I. (2005). Netzbasierte Reflexion von<br />
Unterrichtsvideos in der Ausbildung von Lehrpersonen - eine<br />
Explorationsstudie. In: Beiträge zur Lehrerbildung, 23(1), 51-<br />
61<br />
▸ Hametner, K.; Jarz, T.; Moriz, W.; Pauschenwein, J.; Sandtner,<br />
H.; Schinnerl, I.; Sifri, A. & Teufel, M.. (2006). Qualitätskriterien<br />
für E-Learning: Ein Leitfaden für Lehrer/innen, Lehrende<br />
und Content-Ersteller/innen. URL: http://e-teachingaustria.at/download_mat/Qualitaetskriterien.pdf<br />
[2010-09-24].<br />
▸ Holzinger, A. (2001). Basiswissen Multimedia Band 3: Design.<br />
Entwicklungstechnische Grundlagen multimedialer Informationssysteme:<br />
Das Basiswissen für die Informationsgesellschaft<br />
des 21. Jahrhunderts. Würzburg: Vogel.<br />
▸ Meixner, B.; Siegel, B.; Hölbling, G.; Kosch, H. & Lehner, F.<br />
(2009). SIVA Suite - Konzeption eines Frameworks zur Erstellung<br />
von interaktiven Videos. In: M. Eibl (Hrsg.), Workshop<br />
Audiovisuelle Medien WAM 2009. Aus der Reihe Chemnitzer<br />
Informatik-Berichte. Chemnitz: Technische Universität<br />
Chemnitz, URL: http://archiv.tuchemnitz.de/pub/2009/0095/data/wam09_monarch.pdf<br />
[2010-09-24], 13-20.<br />
▸ Niegemann, H. M.; Hessel, S.; Hochscheid-Mauel, D.; Aslanski,<br />
K. & Kreuzberger, G. (2003). Kompendium E-Learning.<br />
Berlin/Heidelberg: Springer.<br />
▸ Vogler, C. & Kuhnke, F. (2004). Die Odyssee des Drehbuchschreibers:<br />
Über die müthologischen Grundmuster des amerikanischen<br />
Erfolgskinos. Frankfurt am Main: Zweitausendeins.<br />
▸ Vohle, F. & Reinmann, G. (in Druck). Förderung professioneller<br />
Unterrichtskompetenz mit digitalen Medien: Lehren<br />
lernen durch Videoannotation. In: R. Schulz-Zander; B. Eickelmann;<br />
P. Grell; H. Moser & H. Niesyto, Jahrbuch Medienpädagogik<br />
9. Qualitätsentwicklung in der Schule und medienpädagogische<br />
Professionalisierung.<br />
▸ Wendt, M. (2003). Praxisbuch CBT und WBT: konzipieren,<br />
entwickeln, gestalten. München: Hanser Verlag.<br />
▸ Zahn, C.; Krauskopf, K. & Hesse, F. (2009). Video-Tools im<br />
Schulunterricht: Pädagogisch-psychologische Forschung zur<br />
Nutzung von audio-visuellen Medien. In: M. Eibl, J. Kürsten &<br />
M. Ritter (Hrsg.), Workshop audiovisuelle Medien, WAM 2009,<br />
Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, URL: http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2009/0095/data/wam09_monarch.pdf<br />
[2010-09-24], 59-66.
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. <strong>Einführung</strong><br />
Human-Computer Interaction (HCI) ist ein erst seit<br />
rund 30 Jahren etabliertes Teilgebiet der Informatik,<br />
das mit der Verbreitung so genannter grafischer Benutzeroberflächen<br />
(Shneiderman, 1983) entstand und<br />
seit Beginn versucht, die Brücke zwischen Informatik<br />
und Psychologie zu verbreitern.<br />
Während die klassische HCI-Forschung (Card et<br />
al., 1983; Norman, 1986) sich auf das Zusammenspiel<br />
zwischen Mensch-Aufgabe-Computer konzentrierte,<br />
widmet sich die neuere HCI-Forschung,<br />
neben der Erforschung neuer Interaktionsparadigmen,<br />
zum Beispiel intelligente, adaptive, personalisierte<br />
Benutzeroberflächen, Augmented Non-Classical<br />
Interfaces, aber auch Social Computing, vor<br />
allem der Erhöhung der Effektivität und Effizienz<br />
des Zusammenwirkens menschlicher und technischer<br />
Performanz. Und genau damit wird HCI-Wissen<br />
grundlegend zur Optimierung technologiegestützten<br />
Lehrens und Lernens (Niegemann et al., 2008), insbesondere<br />
im Bereich der Interaktion zwischen zukünftigen<br />
semantischen Technologien und menschlichen<br />
Wissensräumen (Cuhls, Ganz & Warnke,<br />
2009).<br />
2. Interak2on und Interak2vität<br />
Interaktion ist eigentlich ein psychologischer Begriff<br />
und bezeichnet einen auf der Basis gewisser Erwartungen,<br />
Einstellungen und Bewertungen beruhenden<br />
Austausch (von Information) auf sprachlicher oder<br />
nichtsprachlicher (symbolischer) Ebene. Interaktion<br />
ist also eng mit dem Begriff Kommunikation verbunden.<br />
Darum wird im Deutschen HCI auch oft als<br />
Mensch-Computer Kommunikation bezeichnet.<br />
Interaktivität hingegen ist ein technischer Begriff der<br />
Möglichkeiten und Eigenschaften des Computers bezeichnet,<br />
den Benutzern verschiedene Eingriffs-, Manipulations-<br />
und Steuerungsmöglichkeiten zu ermöglichen<br />
(Abbildung 1).<br />
Interaktivität wird zu einem didaktisch wichtigen<br />
Teil des technologiegestützten Lernens gezählt<br />
(Schulmeister, 2002), insbesondere weil Interaktivität<br />
die Möglichkeit bietet, dass die Endbenutzerinnen<br />
und Endbenutzer die Auswahl, die Art und die Präsentation<br />
von Informationen manipulieren und damit<br />
ihrem individuellen Vorwissen und Bedürfnissen anpassen<br />
können. Das war allerdings nicht immer so.<br />
Zu Beginn der Computertechnik war die Interaktivität<br />
sehr beschränkt, Computer hatten weder Bildschirm<br />
noch Tastatur: Eingabedaten wurden mit<br />
Lochkarten in Stapelverarbeitung (engl. „batch pro-<br />
cessing“) an den Rechner übergeben, die sequentiell<br />
abgearbeitet wurden und als Ergebnis Ausgabedaten<br />
auf Lochkarten erzeugten.<br />
Abbildung 1: HCI erforscht die Aspekte an der<br />
Nahtstelle zwischen Perzeption, Kognition und Infor-‐<br />
mation (vgl. Holzinger, 2000a)<br />
Character Based User Interfaces<br />
Die Verwendung von Bildschirm (vom Fernseher)<br />
und Tastatur (von der Schreibmaschine) als Computer-Interfacegeräte<br />
waren ein wichtiger Schritt:<br />
Zeichen sind nun von dem was sie darstellen unabhängig<br />
und können daher auf unterschiedlichste<br />
Weise realisiert werden. Anstatt einen Stapel von Aufträgen<br />
auf Lochkarten vorgefertigt zu liefern, und<br />
auf das Ergebnis zu warten, wird die Aufgabe nun<br />
Schritt für Schritt im Dialog erledigt. Somit wird<br />
nicht nur die Durchführung der eigentlichen<br />
Aufgabe, sondern die Entwicklung der Aufgabenstellung<br />
im Dialog mit den Computer unterstützt.<br />
Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für<br />
Lernprogramme. Allerdings, anfangs noch als Dialogsysteme<br />
mit Kommandozeileninterpreter (Command<br />
line Interpreter, Shell). Dies waren die ersten User Interfaces,<br />
die bereits Text in der Kommandozeile einlesen,<br />
diesen Text als Kommando interpretieren und<br />
ausführen konnten. So können Programme gestartet,<br />
Parameter und Dateien übergeben werden. Die Realisierung<br />
als eigenständiges Programm führte schnell<br />
zu Verbesserungen zum Beispiel durch Fehlerbehandlungsroutinen<br />
und Kommandounterstützung.<br />
Waren Computerbenutzerinnen und Computerbenutzer<br />
anfangs noch ausgewiesene Expertinnen und<br />
Experten, wird nun – gerade auf Grund der immer<br />
breiteren Gruppe von Endbenutzerinnen und Endbenutzern<br />
– die Benutzeroberfläche selbst zum Gegenstand<br />
von Forschung und Entwicklung. Damit<br />
war die Basis geschaffen, HCI an unterschiedlichste<br />
Dialogprinzipien anpassen zu können.
Human–Computer Interac?on. Usability Engineering zur Gestaltung im Bildungskontext — 3<br />
Graphical User Interfaces (GUI)<br />
Die immer breitere Anwendung von Computern in<br />
der Öffentlichkeit verlangte, dass die zeichenbasierte<br />
Unabhängigkeit der Dialogsysteme noch weiter abstrahiert<br />
wird, weil auch andere als alpha-numerische<br />
Zeichen für die Darstellung und den Dialog verwendet<br />
werden können: Grafische Elemente, die<br />
analog zum alltäglichen Arbeiten, durch zeigen,<br />
nehmen, verschieben oder ablegen manipuliert<br />
werden können, so genannte WIMP (kurz für<br />
Windows, Icons, Menus, Pointers). Diese WIMP-Interaktion,<br />
die sich als „Desktop-Metapher“ an unterschiedliche<br />
Arbeitsumgebungen anpassen kann und<br />
über „Point & Click“ und „Drag & Drop“ benutzbar<br />
ist, eröffnete dem technologiegestützten Lernen<br />
einen ungeheuren Schub. Kommt doch diese „direkte<br />
Manipulation“ virtueller Objekte den kognitiven<br />
Konzepten der Benutzerinnen und Benutzer sehr<br />
entgegen. GUI und Desktop sind Kernparadigmen<br />
der HCI, die zwar kontinuierlich erweitert und verbessert<br />
werden (zum Beispiel Toolbars, Dialogboxen,<br />
adaptive Menüs), aber vom Prinzip her konstant<br />
bleiben. Eine Konstanz, die ein wichtiges Prinzip unterstützt:<br />
Reduktion kognitiver Überlastung. Bestehen<br />
GUI zwar aus grafischen Elementen, so bleiben im<br />
Hintergrund abstrakte, zeichenbasierte Beschreibungen<br />
von Prozessen, die grundsätzlich unabhängig<br />
von der Art der Darstellung sind und daher auch<br />
über unterschiedlichste Interfaceprinzipien realisiert<br />
werden können.<br />
Erweiterte WIMP Interfaces: SILK (Speech, Image, Lan-‐<br />
guage, Knowledge)<br />
Der Desktop als Metapher ist nicht für alle Anwendungsbereiche<br />
ideal. Durch die Einbindung von Multimedia<br />
(zum Beispiel Sprache, Video, Gesten) in das<br />
GUI und der Integration mobiler und zunehmend<br />
pervasiver und ubiquitärer Technologien, also Computer,<br />
die in Alltagsgegenständen eingebettet sind<br />
und als solche gar nicht mehr erkennbar sind, werden<br />
Alternativen zu WIMP nicht nur möglich sondern<br />
auch notwendig. Hier können quasi-intelligente, semantische<br />
Funktionen integriert werden, wodurch ein<br />
weiterer wichtiger Schritt erfolgte: Wenn Interfaces<br />
unterschiedlichste Metaphern unterstützen müssen<br />
und die Metapher an unterschiedliche Benutzerinnen<br />
und Benutzer, Medien, Endgeräte und Situationen<br />
angepasst werden muss, bedarf es einer Standardisierung<br />
der Interfacemechanismen und einer entsprechenden<br />
Beschreibung (zum Beispiel durch XUL –<br />
XML User Interface Language), die über unterschiedliche<br />
Werkzeuge realisiert werden können.<br />
!<br />
Non-‐Classical Interfaces<br />
Desktop und WIMP Interfaces beruhen auf der<br />
Nutzung der klassischen Interface-Geräte (zum Beispiel<br />
Bildschirm, Tastatur und Maus), die Schritt für<br />
Schritt bei Beibehaltung ihrer Grundstruktur erweitert,<br />
zum Beispiel für SILK oder für andere Metaphern,<br />
und adaptiert werden. Die Leistungsfähigkeit<br />
der Computer und die zunehmende Unabhängigkeit<br />
der Interfaces integrieren damit Schritt für Schritt<br />
auch andere Ein- und Ausgabegeräte und Interaktionsmechanismen<br />
wie zum Beispiel Sprache und<br />
Gesten. Unsere klassischen Sinne Sehen und Hören<br />
können damit durch weitere „körperbewusste“ (engl.<br />
„proprioceptive“) Modalitäten wie Berühren/Tasten,<br />
Schmecken, Riechen, aber auch Temperatur, Gleichgewicht,<br />
Schmerz oder Aufmerksamkeit ergänzt<br />
werden. Solche „Non-Classical Interfaces“ haben<br />
sich daher zu einem wichtigen Forschungsbereich<br />
entwickelt. Damit wird der Mensch als Ganzes in die<br />
Interaktion miteinbezogen, was zu neuen Möglichkeiten<br />
des Lehrens und Lernens führt (ein aktuelles<br />
Beispiel ist die Nintendo Wii mit der Wiimote; Holzinger<br />
et al., 2010).<br />
!<br />
GUI und Desktop sind Kernparadigmen der HCI, die<br />
zwar kon?nuierlich erweitert und verbessert werden<br />
(zum Beispiel Toolbars, Dialogboxen, adap?ve Menüs),<br />
aber vom Prinzip her konstant bleiben.<br />
Moderne Interfaces erlauben nicht nur die Interak?on<br />
des Menschen mit dem Computer mit herkömmlichen<br />
Eingabegeräten, sondern versuchen hap?sche Mög-‐<br />
lichkeiten zu berücksich?gen.<br />
Intelligente Adap2ve seman2sche Interfaces<br />
Da heutige Computersysteme zunehmend alle Lebensbereiche<br />
durchdringen und sich die Interaktivität<br />
zunehmend vom klassischen Schreibtisch wegbewegt,<br />
verbreiten sich neue ubiquitäre, pervasive Möglichkeiten<br />
für das Lehren und Lernen (Safran et al.,<br />
2009). In Zukunft werden Benutzeroberflächen mit<br />
intelligenten, semantischen Mechanismen ausgestattet<br />
werden, die den Benutzerinnen und Benutzern bei<br />
der Erledigung der immer größeren Vielfalt und<br />
Komplexität von Aufgaben des täglichen Lernens<br />
und wissensintensiven Arbeitens unterstützen (zum<br />
Beispiel Suchen, Ablegen, Wiederfinden oder Vergleichen).<br />
Diese Systeme passen sich dynamisch an<br />
die Umgebung, Geräte und vor allem ihre Benutzerinnen<br />
und Benutzer und deren Präferenzen an (Holzinger<br />
& Nischelwitzer, 2005). Entsprechende Informationen<br />
werden für die Gestaltung der Interaktion<br />
in Profilen gesammelt und ausgewertet (User pro-
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
filing). Ebenso erlaubt die steigende technische Performanz<br />
die Multimedialität und Multimodalität voranzutreiben,<br />
wodurch man sich von der Desktop Metapher<br />
immer weiter entfernen kann. Damit können<br />
adaptive Systeme realisiert werden, bei denen die<br />
Systeme selbst mit der Umgebung intelligent interagieren<br />
und semantische Information verarbeiten und<br />
so die User Interfaces der jeweiligen Situation, den<br />
Bedürfnissen, dem Kontext und den vorhandenen<br />
Endgeräten anpassen (Holzinger et al., 2006).<br />
Web 2.0 als Ausgangspunkt der veränderten HCI<br />
Mit dem Aufkommen des Web 2.0 (O’Reilly, 2005,<br />
2006) veränderte sich die Interaktion – weg vom klassischen<br />
„Personal Computing“. Die Benutzerinnen<br />
und Benutzer sind nicht mehr passive Informationskonsumenten,<br />
sondern erstellen aktiv Inhalte, bearbeiten<br />
und verteilen und vernetzen sich darüber<br />
hinaus mit anderen („Social Computing“). Obwohl<br />
der Begriff Web 2.0 keine rein technische Entwicklung<br />
bezeichnet, werden einige Ansätze aus der<br />
Informatik unmittelbar damit verbunden, wie zum<br />
Beispiel RSS-Feeds (Really Simple Syndication) zum<br />
schnellen Informationsaustausch für die einfache und<br />
strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf<br />
Websites (zum Beispiel Blogs) in einem standardisierten<br />
Format (XML). Oder beispielsweise AJAX<br />
(Asynchronous JavaScript and XML) als mächtiges<br />
Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen<br />
einem Browser und einem Server. Damit hat<br />
man die Möglichkeit in einem Browser ein desktop-<br />
Mensch Computer<br />
Empfindlichkeit für Reize<br />
(visuelle, auditorische,<br />
tak?le, olfaktorische)<br />
Fähigkeit zum induk?ven<br />
Denken und komplexen<br />
Problemlösen<br />
Bildung von vernetztem<br />
Wissen und Behalten über<br />
große Zeiträume<br />
Flexibilität bei Entschei-‐<br />
dungen, auch in neuar?-‐<br />
gen Situa?onen<br />
Entdecken unscharfer Si-‐<br />
gnale, auch vor einem<br />
Rauschhintergrund<br />
Präzises Zählen und Mes-‐<br />
sen physikalischer Größen<br />
Deduk?ve Opera?onen,<br />
formale Logik, Anwenden<br />
von Regeln<br />
Speichern großer Daten-‐<br />
mengen, die nicht aufein-‐<br />
ander bezogen sind<br />
Zuverlässige Reak?on auf<br />
eindeu?g definierte Ein-‐<br />
gangssignale<br />
Zuverlässige und ermü-‐<br />
dungsfreie Performanz<br />
über langen Zeitraum<br />
Tabelle 1: Grober Vergleich Mensch-‐Computer<br />
(vgl. Holzinger, 2000b)<br />
ähnliches Verhalten zu simulieren. Damit ergeben<br />
sich vielfältige Möglichkeiten für E-Learning-Anwendungen.<br />
Ein Beispiel: Studierende lernen meistens<br />
erst kurz vor der Prüfung, dann aber meistens massiert,<br />
das heißt kurz aber nahezu Tag und Nacht. Aus<br />
der klassischen Lernforschung ist aber bekannt, dass<br />
über das Semester verteiltes Lernen wesentlich wirkungsvoller<br />
ist. In einer Studie konnte gezeigt<br />
werden, dass durch entsprechenden und gezielten<br />
Einsatz eines Blogs dieses verteilte Lernen "erzwungen"<br />
werden kann, was nicht nur zu einer besseren<br />
Prüfungsleistung führte, sondern auch nachhaltiges<br />
Lernen förderte (Holzinger, Kickmeier &<br />
Ebner, 2009). Wir wollen uns nun aber in aller Kürze<br />
einiger Grundregeln für benutzergerechte HCI zuwenden.<br />
3. Grundregeln für benutzergerechte HCI<br />
Wenn wir uns mit der Interaktion, Perzeption und<br />
Kognition von Information durch den Menschen beschäftigen,<br />
müssen wir einige wesentliche Unterschiede<br />
zwischen Mensch und Computer kennen.<br />
Während Menschen die Fähigkeit zum induktiven,<br />
flexiblen Denken und komplexen Problemlösen auszeichnet,<br />
zeigen Computer bei deduktiven Opera-<br />
!<br />
Usability ist nicht nur die – wie das Wort ins Deutsche<br />
übersetzt wird – schlichte „Gebrauchstauglichkeit“.<br />
Usability setzt sich nämlich aus Effek?vität, Effizienz<br />
und der Zufriedenheit der Endbenutzerinnen und<br />
Endbenutzer zusammen.<br />
tionen und logischen Aufgaben ermüdungsfreie Performanz<br />
(siehe Tabelle 1).<br />
HCI und Usability<br />
Zur Interaktion zwischen Mensch und Computer gibt<br />
es einige Elemente, die im Folgenden kurz vorgestellt<br />
werden. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass funktionale<br />
als auch ästhetische Elemente zusammenwirken<br />
sollten. Brauchbarkeit (usefulness), Benutzbarkeit<br />
(usability) und Ästhetik (enjoyability) sollten<br />
ausgewogen zusammenwirken.<br />
Usability – was ist das eigentlich?<br />
Effektivität wird darin gemessen, ob und in welchem<br />
Ausmaß die Endbenutzer ihre Ziele erreichen<br />
können. Effizienz misst den Aufwand, der zur Erreichung<br />
dieses Ziels nötig ist. Zufriedenheit schließlich<br />
ist gerade im E-Learning wichtig, denn es enthält<br />
subjektive Faktoren wie „joy of use“, „look and feel“<br />
und „motivation and fun“ „(enjoyability“). Usability
Human–Computer Interac?on. Usability Engineering zur Gestaltung im Bildungskontext — 5<br />
wird demnach durch optimales Zusammenspiel von<br />
Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit für einen<br />
bestimmten Benutzerinnenkontext und Benutzerkontext<br />
gemessen.<br />
In den folgenden vier Aufzählungen soll exemplarisch<br />
klar werden, worauf es in der Usability ankommt:<br />
▸ Orientierung (zum Beispiel Übersichten, Gliederungen,<br />
Aufzählungszeichen, Hervorhebungen,<br />
oder Farbbereiche) dienen dazu, sich zurechtzufinden.<br />
Die Endbenutzer müssen stets zu jeder<br />
Zeit genau erkennen, wo sie sich befinden und wo<br />
sie „hingehen“ können.<br />
▸ Navigation (zum Beispiel Buttons oder Links)<br />
helfen den Endbenutzern sich zu bewegen und gezielt<br />
bestimmte Bereiche anzuspringen, zum Beispiel<br />
über eine Navigationsleiste. Die Navigation<br />
muss logisch, übersichtlich, rasch und konsistent<br />
(immer gleichartig) erfolgen. Sprichwort: „What<br />
ever you do, be consistent“ (das gilt auch für<br />
Fehler: solange dieser konsistent ist, fällt dieser<br />
nicht so sehr auf).<br />
▸ Inhalte (zum Beispiel Texte, Bilder, Töne, Animationen<br />
oder Videos) sind die Informationen, die<br />
vermittelt werden sollen (Content). Hier gelten alle<br />
Grundregeln der menschlichen Informationsverarbeitung.<br />
Alle Inhalts-Elemente müssen entsprechend<br />
aufbereitet werden. Text muss kurz und<br />
prägnant sein. Anweisungen müssen eindeutig und<br />
unmissverständlich sein.<br />
▸ Interaktions-Elemente (zum Beispiel Auswahlmenüs,<br />
Slider oder Buttons) ermöglichen gewisse<br />
Aktionen zu erledigen. Sämtliche Interaktionen<br />
müssen den (intuitiven) Erwartungen der Endbenutzer<br />
entsprechen.<br />
Usability-‐Engineering-‐Methoden sichern den Erfolg<br />
Eine breite Palette an Usability-Engineering-Methoden<br />
(UEM) sichern erfolgreiche Entwicklungsprozesse<br />
(siehe Holzinger, 2005). Ein Beispiel dafür<br />
ist: Der Ansatz „User-Centered Design“ (UCD) ori-<br />
!<br />
Das Tool (E-‐Learning Umgebung) und der Content<br />
(Lerninhalt) müssen einen maximalen Nutzen (Ler-‐<br />
nerfolg) bringen.<br />
entiert sich an Bedürfnissen, Fähigkeiten, Aufgaben,<br />
Kontext und Umfeld der Endbenutzer, die von<br />
Anfang an in den Entwicklungsprozess mit einbezogen<br />
werden. Daraus entwickelte sich das „Learner-<br />
Centered Design“ (LCD), das sich auf den Grund-<br />
lagen des Konstruktivismus (Lernen als konstruktive<br />
Informationsverarbeitung) und des problembasierten<br />
Lernen stützt. Ähnlich wie beim UCD fokussiert sich<br />
das LCD auf das Verstehen der Lernenden im<br />
Kontext.<br />
Ähnlich wie im User-Centered Design wird bei<br />
dieser Methode ein spiralförmiger (iterativer) Entwicklungsprozess<br />
durchlaufen, der aus drei Phasen<br />
besteht. In jeder Phase kommen spezielle Usability-<br />
Methoden zum Einsatz, die Einblick in die Bedürfnisse,<br />
das Verhalten und den Kontext der Endbenutzer<br />
erlauben (zum Beispiel: Wer? Was? Wann?<br />
Wozu? Wie? Womit? Warum?). So kann eine genaue<br />
Kenntnis der Lernenden gewonnen werden: Ziele,<br />
Motivation, Zeit, Kultur, Sprache, Voraussetzungen<br />
Vorwissen und weiteres.<br />
Es wird jeweils zum nächsten Schritt übergangen,<br />
wenn kein nennenswerter Erkenntnisgewinn mehr<br />
erzielt wird. Wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
verschiedener Personen, wie zum Beispiel<br />
Fachexpertin/innen, Didaktiker/innen, Multimedia<br />
Expertin/innen und Usability-Ingenieure – und den<br />
Lernenden! Selten fallen alle Rollen in einer Person<br />
zusammen. Während der Analysen wird klar, welches<br />
didaktische Modell für den jeweiligen Kontext am<br />
besten geeignet ist und welche pädagogischen Konzepte<br />
angewandt werden können, die die Lernenden<br />
!<br />
„Thinking aloud“ beschreibt eine Methode bei dem<br />
zumeist 4-‐5 Testpersonen gebeten werden, ein Pro-‐<br />
gramm oder einen Programmablauf zu testen und<br />
dabei gebeten werden ihre Gedanken laut auszu-‐<br />
sprechen.<br />
im Zielkontext mit der jeweiligen Zieltechnologie<br />
(zum Beispiel Mobiltelefon, iPod oder iTV) bestmöglich<br />
unterstützen. Mit Hilfe eines ersten Prototypen<br />
kann Einsicht in viele Probleme gewonnen<br />
werden. Sehr bewährt hat sich so genanntes „Rapid<br />
Prototyping“, das auf papierbasierten Modellen<br />
beruht und enorme Vorteile bringt. Dabei kann das<br />
Verhalten der Endbenutzerinnen und Endbenutzer<br />
zum Beispiel mit der Lautdenken-Methode (engl.<br />
„thinking aloud“) untersucht werden.<br />
Erst wenn auf Papierebene alles „funktioniert“<br />
wird ein computerbasierter Prototyp erstellt, der<br />
dann wiederholt getestet wird. Erst wenn auch hier<br />
kein weiterer Erkenntnisgewinn erfolgt, kann die<br />
Freigabe für die Umsetzung der endgültigen Version<br />
gegeben werden. Papier in der Anfangsphase, das<br />
klingt seltsam ist aber extrem praktisch, weil wesent-
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
liche Interaktionselemente schnell erstellt und simuliert<br />
werden können, ohne dass bereits Programmierarbeit<br />
geleistet wird.<br />
Lerninhalt – Metadaten – Didak2k<br />
Damit E-Learning-Content einem lerntheoretisch adäquaten<br />
Ansatz entspricht, muss dieser nicht nur entsprechend<br />
aufbereitete Lerninhalte und Metainformation<br />
(Metadaten, das sind Informationen die zum<br />
Beispiel das Wiederfinden ermöglichen) enthalten,<br />
sondern auch noch einige weitere technische Voraussetzungen<br />
erfüllen. Ähnlich wie in der objektorientierten<br />
Programmierung (OOP), entstand die Grundidee<br />
von Lernobjekten, das heißt komplexe Lerninhalte<br />
(engl. „content“) auf Objektebene zu erstellen.<br />
Wichtige technische Eigenschaften solcher Objekte<br />
(die man sich zumindest wünscht) sind Austauschfähigkeit<br />
(engl. „interoperability“) und Wiederverwertbarkeit<br />
(engl. „reusability“). Dazu muss es aber nicht<br />
nur Lerninhalte und Metadaten enthalten, sondern<br />
auch Vorwissensfragen (engl. „prior knowledge questions“)<br />
und Selbstevaluierungsfragen (engl. „self-evaluation<br />
questions“). Vorwissensfragen haben im Lernobjekt<br />
die Funktion von Advance Organizers<br />
(Ausubel, 1960). Dabei handelt es sich um einen instruktionspsychologischen<br />
Ansatz in Form einer<br />
„Vorstrukturierung“, die dem eigentlichen Lernmaterial<br />
vorangestellt werden. Allerdings driften hier die<br />
Forschungsbefunde auseinander: die ältere Forschung<br />
betont, dass ein Advance Organizer nur dann wirksam<br />
wird, wenn dieser tatsächlich auf einem höheren<br />
Abstraktionsniveau als der Text selbst liegt, das heißt<br />
lediglich eine inhaltliche Zusammenfassung des nachfolgenden<br />
Textes ist noch keine Vorstrukturierung.<br />
Solche Vorstrukturierungen, die analog zu den Strukturen<br />
des Textes aufgebaut sind, bringen bessere Ergebnisse<br />
bei der inhaltlichen Zusammenfassung als<br />
solche, die zwar inhaltlich identisch, aber nicht in<br />
diesem Sinn analog aufgebaut sind. Andererseits hebt<br />
die jüngere Forschung hervor, dass sich konkrete, das<br />
heißt weniger abstrakt formulierte Vorstrukturierung<br />
auf das Behalten längerer Texte positiv auswirkt. Sie<br />
aktivieren demnach das vorhandene Vorwissen und<br />
verbinden sich damit zu einer „reichhaltigen Vorstellung“<br />
– einem mentalen Modell (dazu Ausubel,<br />
1968; Kralm & Blanchaer, 1986; Shapiro, 1999). Das<br />
Konzept der Advance Organizer ist verwandt mit<br />
dem Schema-Modell kognitiver Informationsverarbeitung<br />
(Bartlett, 1932). Schemata spielen eine<br />
wichtige Rolle bei der sozialen Wahrnehmung, beim<br />
Textverstehen, beim begrifflichen und schlussfolgernden<br />
Denken und beim Problemlösen.<br />
Ähnlich wie Schemata funktioniert die Theorie der<br />
Frames und Slots nach Anderson (Anderson et al.,<br />
1996). Die Wissensrepräsentation mit Hilfe von<br />
Frames stellt eine objektorientierte Wissensrepräsentation<br />
dar und zeigt Ähnlichkeiten zwischen menschlichem<br />
Gedächtnis und wissensbasierenden Informationssystemen.<br />
Objekte der realen Welt werden dabei<br />
durch so genannte Frames dargestellt. Die Eigenschaften<br />
der Objekte werden in den Frames in so genannten<br />
Slots (Leerstellen) gespeichert. Der Tatsache,<br />
dass es in der realen Welt mehrere unterschiedliche<br />
Objekte eines Objekttyps gibt, wird mit Hilfe von generischen<br />
Frames und deren Instanzen Rechnung getragen.<br />
Ein generischer Frame hält für jedes Attribut,<br />
mit dem ein Objekt beschrieben wird, einen Slot<br />
bereit. In einer Instanz des generischen Frames wird<br />
nun jedem Slot – entsprechend für das Attribut für<br />
!<br />
das er steht – ein Wert zugeordnet. Die Beziehung<br />
zwischen einem generischen Frame und einer Instanz<br />
wird mit Hilfe des „is-a“-Slot hergestellt. Im Beispiel<br />
ist im ,,is-a“-Slot gespeichert, dass es sich bei Katharina<br />
um ein Kind handelt. In den übrigen Slots<br />
sind jeweils Werte zu den Attributen gespeichert.<br />
Diese Theorien besagen, dass Lernende besser<br />
lernen, wenn die Information assoziativ organisiert<br />
ist, denn: die Lernenden bauen neue Information<br />
stets auf alten Informationen (Vorwissen) auf. Be-<br />
!<br />
Erfolgsregel: Alles was bereits in der Anfangsphase er-‐<br />
kannt wird spart Zeit und Kosten! Der Return on In-‐<br />
vestment (ROI) liegt dabei zwischen 1:10 bis 1:100.<br />
„Bedienerfreundlichkeit“ wird im englischen Sprach-‐<br />
raum nicht mit Usability bezeichnet. Der Begriff Usa-‐<br />
bility setzt sich aus zwei Worten zusammen: use (be-‐<br />
nutzen) und ability (Fähigkeit), wird im deutschen mit<br />
„Gebrauchstauglichkeit“ übersetzt und umfasst weit<br />
mehr als nur Bedienerfreundlichkeit: In der ISO Norm<br />
9241 wird Usability als das Ausmaß definiert, in dem<br />
ein Produkt durch bes?mmte Benutzer/innen in<br />
einem bes?mmten Nutzungskontext (!) genutzt<br />
werden kann, um deren Ziele effek?v und effizient zu<br />
erreichen.<br />
reits (Piaget, 1961) bezeichnete Schemata als grundlegende<br />
Bausteine zum Aufbau von Wissen.<br />
Was bringt Usability?<br />
Ein Usability-orientierter Prozess schafft Erfolgssicherheit,<br />
deckt Risiken frühzeitig auf und sichert eine<br />
endbenutzerzentrierte Entwicklung.
Human–Computer Interac?on. Usability Engineering zur Gestaltung im Bildungskontext — 7<br />
In der Praxis: Evaluation von Systemem und Software<br />
Für die Praxis ist die Evalua?on, also die Beurteilung von Sys-‐<br />
temen und Solware wich?g. Eine Evalua?on sollte stets sys-‐<br />
tema?sch, methodisch und prozessorien?ert durchgeführt<br />
werden.<br />
Es wird unterschieden zwischen forma2ver Evalua?on<br />
(während der Entwicklung) und summa2ver Evalua?on<br />
(nach Fer?gstellung). Subjek2ve Evalua?on schließt die<br />
mündliche und die schrilliche Befragung und das laute<br />
Denken ein. Objek2ve Evalua?on bedient sich der anwe-‐<br />
senden und abwesenden Beobachtung.<br />
Bei lei[adenorien2erten Evalua?onsmimeln wird das Prod-‐<br />
ukt entlang eines Prüfleioadens beurteilt, der sich aus typi-‐<br />
schen Aufgaben des Systems ergibt. Bei der Erfassung der<br />
Messwerte können verschiedene Skalen (zum Beispiel Nomi-‐<br />
Usability-Engineering-Methoden machen nicht<br />
nur Probleme sichtbar, sondern generieren in der<br />
Entwicklungsphase neue Ideen und Möglichkeiten –<br />
denn Usability Engineering stellt den Menschen in<br />
den Fokus der Entwicklung!<br />
4. Ausblick<br />
So spannend auch immer Forschung und Entwicklung<br />
neuer Technologien zur Unterstützung<br />
menschlichen Lernens ist, es muss uns stets klar sein:<br />
Lernen ist ein kognitiver Grundprozess, den jedes Individuum<br />
selbst durchlaufen muss – Technologie<br />
kann menschliches Lernen lediglich unterstützen –<br />
nicht ersetzen. Unsere großen Chancen beim Einsatz<br />
neuer Technologien liegen zusammengefasst in drei<br />
großen Bereichen (Holzinger, 1997; Holzinger &<br />
Maurer, 1999; Holzinger, 2000a):<br />
▸ Sichtbarmachung von Vorgängen, die wir mit klassischen<br />
Medien (zum Beispiel der Schultafel) nicht<br />
darstellen können (wie zum Beispiel interaktive Simulationen,<br />
Animationen, Visualisierungen);<br />
▸ intelligenter Zugriff auf Information an jedem<br />
Ort zu jeder Zeit (zum Beispiel M-Learning) und<br />
schließlich<br />
▸ motivationale Effekte (das heißt Motivation,<br />
?<br />
Überlegen Sie wie man mit zukünligen Computersys-‐<br />
temen in Dialog treten könnte? Denken Sie dabei an<br />
schon vorhandene Interfaces, zum Beispiel Wii<br />
Remote Controller, was ist dort besonders gut ge-‐<br />
lungen? Was wird unterstützt? Was könnte damit alles<br />
gemacht werden?<br />
Steuerung der Aufmerksamkeit und „Arousal“<br />
(Anregung) durch entsprechenden Medieneinsatz).<br />
nalskala, Rangskala, Verhältnisskala) verwendet werden, die<br />
unter bes?mmten Voraussetzungen durch eine Skalentrans-‐<br />
forma?on ineinander übergeführt werden können. Mes-‐<br />
sungen sollen sich stets durch hohe Reliabilität<br />
(Zuverlässigkeit), Validität (Gül?gkeit) und Objek?vität (Sach-‐<br />
lichkeit) auszeichnen. Als Beurteilungsverfahren (Zuweisung<br />
von Werten) werden Grading (Einstufung), Ranking<br />
(Reihung), Scoring (Punktevergabe) und Appor?oning (Auf-‐<br />
teilung, Zuteilung) verwendet. Eine quan?ta?ve Beurteilung<br />
(Vorteil: leichte Vergleichbarkeit von Systemen) kann durch<br />
Schulnoten erfolgen, aber ol wird es auch umgekehrt ge-‐<br />
macht: Mehr ist besser. Mul?media-‐Systeme können syste-‐<br />
ma?sch mit Checklisten beurteilt werden.<br />
?<br />
Technologiegestütztes Lehren und Lernen erfordert<br />
es, den gesamten Bildungsprozess inklusive<br />
die durch die neuen Medien entstehende Lehr-Lern-<br />
Kultur zu betrachten. Fragen der Effektivität (Ausmaß<br />
der Zielerreichung) und der Effizienz (Kosten-<br />
Nutzen Relation) sind notwendig. HCI-Forschung<br />
versucht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten und<br />
UE versucht die Erkenntnisse auf systemischer<br />
Ebene einfließen zu lassen.<br />
Literatur<br />
Gehen Sie systema?sch Ihre persönliche Arbeitsum-‐<br />
gebung durch (also jene Dinge die Sie selbst als Lern-‐<br />
unterstützung verwenden) und bewerten Sie diese<br />
mit der Schulnotenskala (1 „sehr gut“ bis 5 „nicht ge-‐<br />
nügend)“ anhand der folgenden ausgewählten Kri-‐<br />
terien<br />
▸ Technische Performanz -‐ funk?oniert alles schnell,<br />
zügig und ohne viel zu klicken?<br />
▸ Klarheit -‐ sind alle Funk?onen sofort, einfach und<br />
unmissverständlich erkennbar?<br />
▸ Konsistenz -‐ ist alles durchgängig, einheitlich und<br />
an der erwarteten Stelle?<br />
▸ Amrak?vität -‐ ist das „look and feel“ ansprechend,<br />
fühlen Sie sich wohl?<br />
▸ Fehlertoleranz -‐ werden Eingabefehler tolerant be-‐<br />
handelt, ist stets ein Zurück möglich?<br />
▸ Anderson, J. R.; Reder, L. M. & Lebiere, C. (1996). Working<br />
Memory: Activation Limitations on Retrieval. In: Cognitive<br />
Psychology, 30, 3, 221-256.<br />
▸ Ausubel, D. P. (1960). The use of advance organizers in the<br />
learning and retention of meaningful verbal material. In:<br />
Journal of Educational Psychology, 51, 267-272.<br />
▸ Bartlett, F. C. (1932). Remembering. London: Cambridge University<br />
Press.
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
▸ Card, S. K.; Moran, T. P. & Newell, A. (1983). The psychology<br />
of Human-Computer Interaction. Hillsdale: Lawrence<br />
Erlbaum Ass..<br />
▸ Cuhls, K.; Ganz, W. & Warnke, P. (2009). Foresight Prozess. Im<br />
Auftrag des BMBF. Zukunftsfelder neuen Zuschnitts. URL:<br />
http://www.bmbf.de/pub/Foresight-Prozess_BMBF_Zukunftsfelder_neuen_Zuschnitts.pdf<br />
[2010-08-08].<br />
▸ Holzinger, A. & Maurer, H. (1999). Incidental learning, motivation<br />
and the Tamagotchi Effect: VR-Friends, chances for<br />
new ways of learning with computers. Paper presented at the<br />
Computer Assisted Learning, CAL 99, London.<br />
▸ Holzinger, A. & Nischelwitzer, A. (2005). Chameleon Learning<br />
Objects: Quasi-Intelligente doppelt adaptierende Lernobjekte:<br />
Vom Technologiemodell zum Lernmodell. In: OCG Journal,<br />
30(4), 4-6.<br />
▸ Holzinger, A. (1997). A study about Motivation in Computer<br />
Aided Mathematics Instruction with Mathematica 3.0. In: Mathematica<br />
in Education and Research, 6(4), 37-40.<br />
▸ Holzinger, A. (2000a). Basiswissen Multimedia Band 2: Lernen.<br />
Kognitive Grundlagen multimedialer Informationssysteme.<br />
Das Basiswissen für die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.<br />
Würzburg: Vogel, URL: http://www.basiswissenmultimedia.at<br />
[2010-10-18].<br />
▸ Holzinger, A. (2000b). Basiswissen Multimedia Band 3: Design.<br />
Entwicklungstechnische Grundlagen multimedialer Informations<br />
Systeme. Würzburg: Vogel, URL: http://www.basiswissen-multimedia.at<br />
[2010-10-18].<br />
▸ Holzinger, A.; Nischelwitzer, A. & Kickmeier-Rust, M. D.<br />
(2006). Pervasive E-Education supports Life Long Learning:<br />
Some Examples of X-Media Learning Objects. Paper presented<br />
at the World Conference on Continuing Engineering<br />
Education. Wien, URL:<br />
http://www.wccee2006.org/papers/445.pdf [2010-10-18].<br />
▸ Holzinger, A., Kickmeier-Rust, M.D. & Ebner, M. (2009). Interactive<br />
Technology for Enhancing Distributed Learning: A<br />
Study on Weblogs. In: Proceedings of HCI 2009 The 23nd<br />
British HCI Group Annual Conference, 309–312. Cambridge<br />
University, UK, British Computer Society<br />
▸ Holzinger, A.; Softic, S.; Stickel, C.; Ebner, M.; Debevc, M. &<br />
Hu, B. (2010). Nintendo Wii Remote Controller in Higher<br />
Education: Development and Evaluation of a Demonstrator<br />
Kit for e-Teaching. In: Computing & Informatics, 29(3), 601-<br />
615.<br />
▸ Kralm, C. & Blanchaer, M. (1986). Using an advance organizer<br />
to improve knowledge application by medical students in computer-based<br />
clinical simulations. In: Journal of Computer<br />
Based Instruction, 13, 71-74.<br />
▸ Niegemann, H. M.; Domagk, S.; Hessel, S.; Hein, A.; Hupfer,<br />
M. & Zobel, A. (2008). Kompendium multimediales Lernen,<br />
Reihe: X.media.press. Berlin/Heidelberg: Springer.<br />
▸ Norman, D. A. (1986). Cognitive engineering. In: D. Norman<br />
& S. Draper (Hrsg.), User Centered System Design: New Perspectives<br />
on Human-Computer interaction). Hillsdale: Lawrence<br />
Erlbaum Ass..<br />
▸ O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0 – Design Patterns and<br />
Business Models for the Next Generation of Software. URL:<br />
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09<br />
/30/what-is-web-20.html [2010-08-08].<br />
▸ O’Reilly, T. (2006). Web 2.0: Stuck on a name or hooked on<br />
value? In: Dr Dobbs Journal, 31(7), 10-10.<br />
▸ Piaget, J. (1961). On the development of memory and identity.<br />
Worchester (MA): Clark University Press.<br />
▸ Safran, C.; Ebner, M.; Kappe, F. & Holzinger, A. (2009). m-<br />
Learning in the Field: A Mobile Geospatial Wiki as an example<br />
for Geo-Tagging in Civil Engineering Education. In: M. Ebner<br />
& M. Schiefner (Hrsg.), Looking Toward the Future of Technology-Enhanced<br />
Education: Ubiquitous Learning and the Digital<br />
Native., Hershey, PA: IGI Global, 444-454.<br />
▸ Schulmeister, R. (2002). Taxonomie der Interaktivität von Multimedia<br />
- Ein Beitrag zur aktuellen Metadaten-Diskussion. In: it<br />
+ ti - Informationstechnik und Technische Informatik, 44(4),<br />
193-199.<br />
▸ Shapiro, A. M. (1999). The relationship between prior knowledge<br />
and interactive overviews during hypermedia-aided<br />
learning. In: Journal of Educational Computing Research, 20,<br />
2, 143-167.<br />
▸ Shneiderman, B. (1983). Direct manipulation: A step beyond<br />
programming languages. In: IEEE Computer, 16(8), 57-69.
2 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
1. <strong>Einführung</strong>: Der Stellenwert von Lerntheorien<br />
Es ist eine wiederkehrende Frage, welche lerntheoretischen<br />
Hintergründe man eigentlich kennen muss,<br />
um eine technologiegestützte Lernumgebung erfolgreich<br />
gestalten zu können. Viele Novizen auf dem<br />
Gebiet des Lehrens und Lernens gehen davon aus<br />
oder hegen zumindest die Hoffnung, dass ihnen das<br />
Wissen über die wichtigsten Lerntheorien den Weg<br />
im Didaktischen Design weist: „Sag mir, welche<br />
Lerntheorie du bevorzugst, und ich sage dir, was zu<br />
tun ist.“ Diese Erwartung ist ebenso illusorisch wie<br />
die Annahme falsch ist, in der Gestaltungspraxis<br />
seien lerntheoretische Kenntnisse letztlich überflüssig.<br />
Es stellt sich also die Frage, welchen Stellenwert<br />
Lerntheorien insbesondere für Grundsatzentscheidungen<br />
im Didaktischen Design<br />
haben. Der Begriff des Didaktischen Designs wird in<br />
diesem Beitrag in einem neutral beschreibenden<br />
Sinne verwendet und schließt damit alle Ansätze ein,<br />
die gemeinhin verschiedenen Paradigmen wie zum<br />
Beispiel Kognitivismus und Konstruktivismus zugeordnet<br />
werden. Didaktisches Design steht damit auch<br />
über Begriffen wie Instruktionsdesign, das in der<br />
deutschen Fassung im Übrigen wesentlich enger definiert<br />
ist als das englische Pendant „instructional<br />
design“.<br />
Mit Grundsatzentscheidungen sind solche Entscheidungen<br />
gemeint, die den „Charakter“ einer<br />
Lernumgebung prägen, der wiederum Einfluss auf<br />
viele weitere Detailentscheidungen hat: etwa auf<br />
Auswahl und mediale Aufbereitung von Inhalten, auf<br />
Gestaltung von Aufgaben zur inhaltlichen Auseinandersetzung,<br />
auf Technologiewahl und -einsatz etc.<br />
Was aber sind Lerntheorien genau?<br />
Lerntheorien konzentrieren sich darauf, möglichst<br />
global zu beschreiben und zu erklären, wie<br />
Lernen generell „funktioniert“. Lernen wird gemeinhin<br />
als Erfahrungsprozess aufgefasst, der dazu<br />
führt, dass eine Person relativ stabile Dispositionen<br />
für direkt beobachtbares Verhalten (Können) oder<br />
nicht sichtbares „Verhalten“ (Wissen) aufbaut (vgl.<br />
Bodemann et al., 2004). Das aber kann viel heißen:<br />
(a) Lernen kann sich darauf reduzieren, sich zu informieren.<br />
Es genügt einem dann, Informationen zu<br />
gegebener Zeit wiederzuerkennen, mit denen man<br />
sich beschäftigt hat. (b) Lernen kann auch anspruchsvoller<br />
gemeint sein und darauf hinauslaufen, dass<br />
man über neues Wissen tatsächlich verfügt. Dieses<br />
möchte man dann wiedergeben und irgendwo einsetzen<br />
können. (c) Lernen kann explizit darauf ausgelegt<br />
sein, einen bestimmten Problemtyp zu lösen.<br />
Das ist mit dem Anspruch verbunden, die erworbene<br />
Kompetenz konkret anzuwenden und damit zu<br />
handeln. (d) Schließlich kann das Lernen mit dem<br />
Ziel belegt sein, langfristige Expertise in einem Feld<br />
aufzubauen. Als Experte oder Expertin strebt man<br />
umfassendes Wissen und flexibles Können auch in<br />
wenig vorhersehbaren Problemsituationen und eine<br />
bestimmte Haltung an.<br />
Alle diese Lernformen basieren auf Erfahrung<br />
und verändern die Dispositionen einer Person.<br />
Gleichzeitig sind die Art der Erfahrung und die Qualität<br />
des potenziell resultierenden Wissens und<br />
Könnens sehr unterschiedlich. Bis heute gibt es keine<br />
Lerntheorie, die alle denkbaren Lernformen zufriedenstellend<br />
beschreiben, geschweige denn erklären<br />
könnte. Es ist also geradezu notwendig, dass es<br />
mehrere Lerntheorien gibt, die jeweils Akzente<br />
setzen und nur bestimmte Formen oder Aspekte von<br />
Lernen im Blick haben und andere ausblenden. Jede<br />
Lerntheorie bewegt sich allerdings (mindestens in<br />
ihrer Entstehung) im gerade dominierenden wissenschaftlichen<br />
Zeitgeist. Lehr-/Lernforscher/innen und<br />
Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des Didaktischen<br />
Designs sind wie andere Wissenschaftler/innen<br />
„Kinder ihrer Zeit“ und nehmen eine<br />
eigene Perspektive ein, mit der Folge, dass man deren<br />
Erkenntnisse nicht als einzig gültige Wahrheit betrachten<br />
darf. Die jeweils vorherrschende oder auch<br />
präferierte Lerntheorie prägt die Lehr-/Lern-Auffassung<br />
von Entwicklerinnen und Entwicklern didaktischer<br />
Designs sowie Lehrenden wie auch die von<br />
Lerntheorien konzentrieren sich darauf, möglichst<br />
global zu beschreiben und zu erklären, wie Lernen ge-‐<br />
nerell „funk4oniert“. Sie bewegen sich (mindestens in<br />
ihrer Entstehung) im gerade dominierenden Zeitgeist<br />
und beeinflussen Lehr-‐/Lern-‐Auffassungen.<br />
Lernenden.<br />
Das ist ein wichtiger, oft übersehener Punkt, denn:<br />
Wenn Lerntheorien implizit wirken, dann sind sie<br />
nicht Ausgangspunkt einer bewussten Gestaltungsstrategie,<br />
sondern ein eher unkontrollierter Einflussfaktor,<br />
der reflektierte Gestaltungsentscheidungen<br />
möglicherweise behindert. Kenntnis über Lerntheorien<br />
kann also in einem ersten Schritt dabei<br />
helfen, mögliche implizite Wirkungen zu erkennen<br />
und offen zu legen. Ob sie einen in einem zweiten<br />
Schritt auch darin unterstützen, zu einer Gestaltungsstrategie<br />
zu kommen, gilt es zu klären. Zu diesem<br />
Zweck werden zunächst einmal die gängigsten<br />
großen Lerntheorien in aller Kürze beschrieben.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc<br />
!
2. Lerntheorien: Eine Übersicht<br />
Der Behaviorismus und das Reiz-‐ReakDons-‐Modell<br />
Wer schon etwas vom Behaviorismus gehört hat,<br />
denkt meist als erstes an speichelnde Hunde und hebeldrückende<br />
Tauben oder Ratten. Berühmte Tierversuche<br />
spielen im Behaviorismus in der Tat eine<br />
Rolle, bilden aber nur auffällige Wegmarken einer<br />
Lerntheorie, deren Prinzipien die (Lern-)Psychologie<br />
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dominiert haben.<br />
Grundlage des Behaviorismus ist das Reiz-Reaktions-Modell.<br />
An den mentalen, im Gehirn ablaufenden<br />
Prozessen zwischen Reiz und Reaktion ist der<br />
Behaviorismus dagegen nicht interessiert (Black-Box-<br />
Denken). Das Gehirn wird als ein Organ angesehen,<br />
das auf Reize mit angeborenen oder erlernten Verhaltensweisen<br />
reagiert. Nachfolgende Konsequenzen<br />
gelten als neue Reize, die das Verhalten formen.<br />
Damit sind die beiden Konditionierungsformen angesprochen,<br />
die den Behaviorismus kennzeichnen:<br />
Beim klassischen Konditionieren wird ein an sich<br />
neutraler Reiz zeitlich mit einem Reiz gekoppelt, der<br />
eine (reflexartige) Reaktion auslöst, sodass der erstere<br />
später auch allein die Reaktion bedingt. Das funktioniert<br />
besonders gut bei physiologischen, aber auch<br />
emotionalen Reaktionen wie Furcht und Stress<br />
(Watson & Rayner, 1920). Beim operanten Konditionieren<br />
wird ein spontanes Verhalten mit einem<br />
angenehmen Reiz (positiv) oder durch Entfernung<br />
eines unangenehmen Reizes (negativ) verstärkt und<br />
auf diese Weise geformt (Skinner, 1954). Dass Verhaltensweisen<br />
nicht nur durch eigenes Tun und Verstärkungen,<br />
sondern auch durch Beobachtung und<br />
Nachahmung erlernt werden können, hat Bandura<br />
(1977) mit dem Lernen am Modell gezeigt: Hier<br />
fungiert das Modellverhalten als Hinweisreiz für eine<br />
Nachahmungsreaktion. Nachgeahmt wird das Verhalten<br />
vor allem dann, wenn das Modell einem selbst<br />
ähnlich ist und erfolgreich war. Die Prinzipien des<br />
Behaviorismus werden in diesem Modell um kognitive<br />
Aspekte erweitert.<br />
Behavioristische Lerntheorien beruhen auf einer<br />
großen Anzahl von Laboruntersuchungen, in denen<br />
man sich grundsätzlich nur für beobachtbares Verhalten<br />
interessiert; innere Vorgänge kommen erst in<br />
Banduras Prinzip der Nachahmung allmählich zum<br />
Tragen. Forschungsmethodisch setzt der Behaviorismus<br />
auf experimentalpsychologische Verfahren,<br />
um Ursache-Wirkungsbeziehungen aufzudecken und<br />
Prozesse der Verhaltensänderung möglichst eindeutig<br />
beschreiben und erklären zu können. Das Menschenbild<br />
im Behaviorismus ist stark geprägt von<br />
Konditionierung auf und durch äußere Reize. Lernen<br />
Didak4sches Design. Von der Lerntheorie zur Gestaltungsstrategie) — 3<br />
gilt als Sonderform des Verhaltens und wird als eine<br />
Art Trainingsvorgang verstanden. Beim Lehren soll<br />
bezogen auf ein bestimmtes Ziel Verhalten gesteuert<br />
und verändert werden. Fast zwangsläufig resultiert<br />
aus dieser Auffassung eine eher autoritäre Rolle des<br />
Lehrenden: Er hat eine starke Machtposition und<br />
entscheidet, was wie zu lernen ist. Er gestaltet „Reizsituationen“<br />
und Konsequenzen so, dass die angestrebten<br />
Lernergebnisse eintreten und stabilisiert<br />
werden. Das Kommunikationsverhältnis zwischen<br />
Lehrenden und Lernenden ist unidirektional (Baumgartner<br />
et al., 2004). Die Lernenden sind in behavioristisch<br />
gestalteten Lernumgebungen durchaus<br />
sichtbar aktiv. Allerdings sind diese Aktivitäten für<br />
den Lehrenden nur im Hinblick auf den „Output“<br />
(Lernergebnisse) von Interesse.<br />
Lernen gilt im Behaviorismus als Sonderform des Ver-‐<br />
haltens, das sich durch geeignete Reizsitua4onen und<br />
Konsequenzen steuern und verändern lässt.<br />
Der KogniDvismus und die InformaDonsverarbeitungs-‐<br />
perspekDve<br />
Der Kognitivismus beansprucht spätestens seit<br />
Beginn der 1980er Jahre den lerntheoretischen Führungsanspruch.<br />
Seine Ursprünge liegen in technischen<br />
und mathematischen Gebieten (Kybernetik,<br />
Informationstheorie, Künstliche Intelligenz); er wird<br />
als Informationsverarbeitungsparadigma bezeichnet<br />
(vgl. Baumgartner & Payr, 1999). Anders als der Behaviorismus<br />
interessiert sich der Kognitivismus nicht<br />
für die direkte Verbindung von Reizen und Reaktionen,<br />
sondern dafür, mit welchen Methoden Menschen<br />
zu Problemlösungen kommen. Lernen gilt als<br />
ein mentaler Prozess, der sich analog zur Informationsverarbeitung<br />
im Computer modellieren lässt. Die<br />
Aufnahme und Verarbeitung von Information führt<br />
zu Wissen, das im Gehirn repräsentiert ist und gespeichert<br />
wird. Lehr-/Lern-Prozesse stellt man sich<br />
als meist sprachlich codierte Informationsübertragung<br />
vom Sender (Lehrende) zum Empfänger<br />
(Lernende) vor. Diese Vorstellungen aus der Nachrichten-<br />
und Computertechnik haben vor allem die<br />
Gedächtnisforschung in hohem Maße beflügelt. Seit<br />
einigen Jahren werden diese durch den konnektionistischen<br />
Ansatz ergänzt oder modifiziert, der mit biologischen<br />
Modellen über Gehirn und neuronale<br />
Netze arbeitet (vgl. Rey, 2009).<br />
Im Rahmen kognitivistischer Forschung sucht<br />
man in (quasi-)experimentellen Studien nach Ursache-Wirkungs-Mechanismen<br />
und Zusammenhängen<br />
von Variablen. Der Computer dient als wich-<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc<br />
!
4 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
tiges Hilfsmittel zur Simulation regelhafter Zusammenhänge.<br />
Das Menschenbild im Kognitivismus ist<br />
weniger mechanistisch als im Behaviorismus, weil<br />
man dem Menschen auch zielgerichtetes Handeln<br />
und Problemlösen und nicht nur reaktives Verhalten<br />
unterstellt. Kennzeichnend ist aber auch hier die<br />
Suche nach berechenbaren Beziehungen und Regeln<br />
innerhalb von und zwischen kognitiven Prozessen.<br />
Die Lernenden haben eine aktive Rolle, sind aber<br />
nicht selbsttätig. Die Lehrenden nämlich bereiten Inhalte<br />
und Probleme didaktisch auf, um den Informationsverarbeitungsprozess<br />
zu erleichtern; sie haben<br />
die „Problemhoheit“ und bestimmen weitgehend,<br />
was wie gelernt wird. Das Kommunikationsverhältnis<br />
ist bidirektional, ohne dass aber Lehrende und Lernende<br />
tatsächlich gleichberechtigte Rollen haben<br />
(Baumgartner et al., 2004). Anders als im Behaviorismus<br />
steuert der Lehrende den Output allerdings<br />
nicht über die Gestaltung von Reizen und Konsequenzen,<br />
sondern durch tutorielle Unterstützung.<br />
!<br />
Der Kogni4vismus betrachtet Lernen als einen men-‐<br />
talen Prozess, der ähnlich wie die Informa4onsverar-‐<br />
beitung im Computer abläu) und zu Wissensreprä-‐<br />
senta4onen im Gehirn führt.<br />
Der KonstrukDvismus und die Vorstellung vom Men-‐<br />
schen als Welterzeuger<br />
Es gibt verschiedene, alte und neuere, Varianten des<br />
Konstruktivismus mit Bezug zur Erkenntnistheorie,<br />
Evolutionstheorie, Neurobiologie, Gehirnforschung,<br />
Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Wissenssoziologie,<br />
Kognitionsforschung etc. (vgl. Pörksen,<br />
2001). Gemeinsam ist ihnen allen die Auffassung,<br />
dass sich Realität nicht objektiv wahrnehmen, beschreiben<br />
und erklären lässt und folglich weder direkt<br />
noch voraussetzungsfrei erkannt werden kann.<br />
Vielmehr beruhe jeder Wahrnehmungs-, Erkenntnisund<br />
Denkprozess auf den Konstruktionen eines Beobachters.<br />
Es interessiert daher weniger, was „wahr“<br />
ist (weil sich das gar nicht feststellen lässt), sondern<br />
eher, was sich als nützlich bzw. viabel erweist (von<br />
Glasersfeld, 1996). Für den Konstruktivismus ist der<br />
menschliche Organismus ein System, das zwar energetisch<br />
offen und mit der Umwelt strukturell gekoppelt<br />
ist. Er ist aber gleichzeitig informationell geschlossen,<br />
sodass unser Gehirn nur auf die bereits<br />
verarbeitete und interpretierte Information von<br />
außen reagiert (Autopoiesis). Lernen ist folglich<br />
ebenfalls ein aktiver, aber zudem ein autopoietischer<br />
Vorgang, der von außen nur angeregt oder gestört<br />
werden kann. Vertreter des pädagogisch-didaktischen<br />
(„neuen“) Konstruktivismus postulieren vor<br />
diesem Hintergrund Lernumgebungen, die komplexe<br />
Probleme bieten, Authentizität und Situiertheit von<br />
Inhalten und Aufgaben sicherstellen, multiple Perspektiven<br />
berücksichtigen, eigene Erfahrung und Reflexion<br />
anregen und Anlässe zum sozialen Austausch<br />
geben (Reusser, 2006). Wissen ist für den Konstruktivismus<br />
eine individuelle und soziale Konstruktionsleistung<br />
des Menschen. Forschungsmethodisch konzentriert<br />
man sich konsequenterweise auf Feldstudien<br />
mit teilnehmender Beobachtung und interpretative<br />
Verfahren, mit dem Ziel, komplexe Phänomene<br />
besser zu verstehen. Anthropologisch betrachtet gilt<br />
der Mensch im Konstruktivismus als Erschaffer<br />
seiner eigenen Realität, als „Welterzeuger“, der nicht<br />
nur reagiert oder Informationen verarbeitet, sondern<br />
gestaltend in seine Umwelt eingreift und diese verändert.<br />
Da Lehren und Lernen als unterschiedliche<br />
Systeme gelten, die allenfalls lose miteinander gekoppelt<br />
sind, erscheint Lehren als direkte Vermittlung<br />
wenig sinnvoll. Der aktive Part liegt eindeutig beim<br />
Lernenden, sodass die Rolle des Lehrenden nur mehr<br />
darin bestehen kann, Lernaktivitäten anzustoßen und<br />
Lernende bei der Identifikation und Lösung von<br />
komplexen Problemen zu unterstützen – entweder<br />
direkt durch soziale Interaktion oder indirekt durch<br />
die Gestaltung von Kontexten. Als Coach hat der<br />
Lehrende im Vergleich zum Lernenden zwar einen<br />
Erfahrungsvorsprung; die Zusammenarbeit aber wird<br />
als gleichberechtigt betrachtet. Das Kommunikationsverhältnis<br />
ist demnach nicht nur bidirektional,<br />
sondern ausgewogen (Baumgartner et al., 2004).<br />
Im Konstruk4vismus gilt Lernen als ak4ver und auto-‐<br />
poie4scher Konstruk4onsvorgang, der durch Kontexte<br />
und komplexe Probleme allenfalls angeregt oder ge-‐<br />
stört werden kann.<br />
Der KonnekDvismus und die Vision vom Leben und<br />
Lernen in Netzwerken<br />
Ob der Konnektivismus ebenfalls eine eigene Lerntheorie<br />
darstellt, ist höchst umstritten. Eine der<br />
Hauptthesen des Konnektivismus besteht darin, dass<br />
sich Lernen als ein selbstorganisierter Prozess in<br />
Netzwerken vollzieht und allem voran darin besteht,<br />
Verbindungen herzustellen. Damit verlagert sich das<br />
Interesse von den innerpsychischen Abläufen einer<br />
Person auf das, was diese in realen oder virtuellen<br />
Netzwerken, bestehend aus Personen und Artefakten<br />
bzw. Informationsquellen (verteiltes Wissen), macht<br />
(vgl. Moser, 2008). Zugrunde liegt die gegenwärtige<br />
Beobachtung, dass Menschen in einer stark technisierten<br />
und mediatisierten Welt eher neue Zusammenhänge<br />
herstellen als genuin Neues konstruieren.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc<br />
!
Eine eher normative Forderung des Konnektivismus<br />
ist, nicht mehr nur durch eigene Erfahrung zu lernen<br />
und Wissensinhalte per se zu erwerben, sondern in<br />
einer sich rasch ändernden Welt Entscheidungen zu<br />
treffen (was bereits als Lernakt gilt), Verbindungen<br />
zwischen Wissensbereichen zu erkennen und dazu in<br />
Netzwerken zu partizipieren (Bernhardt & Kirchner,<br />
2007). Während sich Behaviorismus, Kognitivismus<br />
und Konstruktivismus wissenschaftstheoretisch relativ<br />
deutlich positionieren lassen, ist dies beim Konnektivismus<br />
schwer und in der Literatur nicht explizit<br />
aufgearbeitet. Während der Mensch im Konstruktivismus<br />
als Erschaffer und Gestalter seiner eigenen<br />
Realität gilt, hat er im Konnektivismus als Teil eines<br />
Netzwerkes nur mehr Gestaltungsmacht auf Form<br />
und Ausprägung neuer Verbindungen. Die ablaufenden<br />
Prozesse gelten als emergent und können in<br />
der Folge kaum geplant oder von außen gesteuert<br />
werden. Eine wie auch immer geartete Vermittlungsdidaktik<br />
ist nicht möglich. Der aktive Part dürfte also<br />
nicht bei dem, sondern bei den Lernenden liegen,<br />
die sich im besten Fall gegenseitig unterstützen, vor<br />
allem informell und voneinander sowie von den sie<br />
umgebenden Informationsquellen lernen. Ein Lehrender<br />
scheint prinzipiell nicht nötig; allenfalls könnte<br />
ihm die Aufgabe obliegen, Netzwerke – für eine<br />
Kommunikation ohne Hierarchien – zu ermöglichen.<br />
!<br />
Nach Auffassung des Konnek4vismus ist Lernen ein<br />
selbstorganisierter Prozess in realen oder virtuellen<br />
Netzwerken, der vor allem darin besteht, Verbin-‐<br />
dungen herzustellen.<br />
Fazit: Lerntheorien und ihre Wirkung im DidakDschen<br />
Design<br />
Als Paradigmen sind Lerntheorien Orientierungsideale,<br />
mit denen man das Lernen erforschen kann.<br />
Sie bedingen die Sichtweise in der Forschung, legen<br />
Forschungsfragen nahe und blenden andere aus,<br />
lenken Strategien und Methoden der Datenerhebung<br />
und -auswertung. In ihrer jeweiligen Hochzeit prägen<br />
Lerntheorien auch die Auffassung von Lernen und<br />
Lehren in der Praxis inklusive Welt- und Menschenbild.<br />
Lerntheorien haben aus dieser Perspektive<br />
betrachtet eine große, aber diffuse Wirkung auf das<br />
Didaktische Design. Gleichzeitig sind sie keine handlungspraktischen<br />
Theorien, aus denen sich konkrete<br />
didaktische Entscheidungen systematisch ableiten<br />
lassen. Zwischen einer Lerntheorie und dem Handeln<br />
in der Praxis liegen mindestens didaktische Modelle,<br />
die sich explizit oder auch nur implizit auf eine Lerntheorie<br />
beziehen (vgl. Reinmann, 2005): Beispiels-<br />
Didak4sches Design. Von der Lerntheorie zur Gestaltungsstrategie) — 5<br />
weise ist die programmierte Instruktion eine Auskoppelung<br />
aus dem behavioristischen Paradigma und<br />
kann einen z.B. bei der Gestaltung eines Computer-<br />
Based Trainings zum Vokabellernen unterstützen.<br />
Die Elaborationstheorie stammt aus dem kognitivistischen<br />
Paradigma und liefert Vorschläge, wie man<br />
Lerninhalte in einer bestimmten Form anordnet und<br />
aufbereitet. Problemorientierte Modelle wie die Anchored<br />
Instruction o d e r Goal-based Scenarios<br />
schließlich werden gemeinhin dem konstruktivistischen<br />
Paradigma zugeordnet und geben Anregungen<br />
dafür, wie man komplexe Lernumgebungen u.a. narrativ<br />
gestalten kann. Doch selbst diese Modelle<br />
liefern in der Regel keine Anleitungen, wie man bestimmte<br />
Inhalte auswählt und aufbereitet, Instruktionen<br />
und Aufgaben gestaltet, Feedback gibt etc. Sie<br />
nehmen einem auch nicht die Grundsatzentscheidung<br />
ab, welchen Charakter eine Lernumgebung<br />
überhaupt haben sollte. Wie aber, so muss man<br />
fragen, kommt man dann zu einer Gestaltungsstrategie,<br />
wenn dies Lerntheorien nicht leisten können?<br />
Lerntheorien sind keine handlungsprak4schen<br />
Theorien, aus denen sich Regeln für didak4sche Ent-‐<br />
scheidungen ableiten lassen. Sie beeinflussen aber er-‐<br />
heblich Lehr-‐/Lern-‐Auffassungen und haben entspre-‐<br />
chend indirekte Wirkungen auf das Didak4sche<br />
Design.<br />
3. Ziele als Grundlage für didakDsche Grundsatzent-‐<br />
scheidungen<br />
Lehrziele als Ausgangspunkt im didakDschen Design<br />
Wer eine technologiebasierte Lernumgebung gestalten<br />
will, muss wissen, welchen Zweck sie erfüllen<br />
soll und welche Ziele man damit unter welchen Bedingungen<br />
erreichen will. Nur dann kann der didaktische<br />
Designer eine Idee vom Ganzen und darauf<br />
aufbauend eine Strategie entwickeln, die den Charakter<br />
der Lernumgebung prägt. Lerntheoretische<br />
Kenntnisse sind hier weder ausreichend noch praktisch<br />
besonders hilfreich. Entscheidend ist vielmehr<br />
zu klären, ob man etwa Lernende vor sich hat oder<br />
ansprechen will, die (a) sich einfach nur über bestimmte<br />
Inhalte informieren oder (b) sich Wissen aneignen<br />
oder (c) Kompetenzen zum Problemlösen erwerben<br />
oder (d) langfristig Expertise auf- oder ausbauen<br />
wollen. Der Informationssuchende möchte<br />
aufbereitete Inhalte, bringt womöglich wenig Zeit mit<br />
und will sich nicht in komplexe Dialoge verstricken.<br />
Lernende etwa in der Schule oder zu Beginn eines<br />
Studiums haben den Anspruch, verständliche Informationen<br />
und Hilfen zu erhalten, um sich Wissen anzueignen,<br />
das sie vor allem in Prüfungen brauchen.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc<br />
!
6 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
In der Praxis : Eine Analogie für den Einstieg<br />
Was ist wesentlich, um zu einer Gestaltungsstrategie zu<br />
kommen? Zum Eins4eg in eine Antwort auf diese Frage<br />
könnte ein analoger Gedanke hilfreich sein: Wer einen<br />
Garten anlegen will, braucht erst einmal eine Idee vom<br />
Ganzen. Notwendig ist außerdem ein Mindestmaß an<br />
Wissen über verschiedene Pflanzen und deren Ansprüche<br />
z.B. an Boden, Licht und Temperatur. Botanisches Wissen<br />
allein aber genügt nicht, um zu einem zufriedenstellenden<br />
Ergebnis zu kommen, denn: Ein Garten entsteht üblicher-‐<br />
weise nicht einfach so, sondern mit bes4mmten Zielen unter<br />
bes4mmten Bedingungen. Genau die muss der Gärtner<br />
Lernende, die bereits einen Beruf oder andere Aufgaben<br />
vor sich sehen, erwarten von einem Lernangebot<br />
die Möglichkeit, sich auszuprobieren, ihr<br />
Wissen anzuwenden und Probleme damit lösen zu<br />
können. Der angehende oder schon ausgebildete Experte<br />
dagegen ist an Details und Spezialwissen seiner<br />
Peers interessiert, will sich austauschen und lernen,<br />
indem er an seinem Fachgebiet mitarbeitet. Es sind<br />
genau diese Lernziele inklusive der Rahmenbedingungen<br />
(Größe und Eigenschaft der Zielgruppe,<br />
Umfang verfügbarer zeitlicher und anderer Ressourcen<br />
etc.), die man explizit machen und analysieren<br />
muss, um die ersten didaktischen Entscheidungen<br />
treffen zu können, die eine Lernumgebung<br />
für weitere Detailentscheidungen rahmen.<br />
In der Hand der Gestalter/innen des didaktischen<br />
Designs werden Lernziele zu Lehrzielen. Da das<br />
Lernen der Grund allen Lehrens ist (oder zumindest<br />
sein sollte), ist der Gedanke nicht abwegig, den Begriff<br />
der Lernziele dem der Lehrziele vorzuziehen.<br />
Allerdings kann man weder davon ausgehen, dass<br />
Lernende alle Lehrziele als eigene Lernziele übernehmen,<br />
noch kann man als Lehrender wirklich<br />
genau wissen, was die innersten Ziele der Lernenden<br />
im Einzelnen sind (Klauer & Leutner, 2007). Lehrziele<br />
mögen als Begriff „autoritärer“ klingen, bezeichnen<br />
aber besser, worum es beim Didaktischen<br />
Design tatsächlich geht. Die oben verwendeten Begriffe<br />
wie Information, Wissen, Kompetenz und Expertise,<br />
die in der Literatur allesamt umfangreich<br />
(wenn auch nicht einheitlich) präzisiert sind, können<br />
eine erste Möglichkeit sein, um verschiedene Lehrziele<br />
grob zu unterscheiden. Für konkrete Gestaltungsmaßnahmen<br />
aber ist das nicht ausreichend. Hier<br />
bieten sich stattdessen verschiedene Lehrzieltaxonomien<br />
an.<br />
kennen: Soll der Garten der Ruhe und Erholung oder Kindern<br />
zum Spielen dienen, soll er das Auge erfreuen oder Ort eines<br />
neuen Hobbys werden? Ist der Garten groß oder klein,<br />
schakg oder sonnig? Was soll er kosten und wie viel<br />
Aufwand darf er in der Pflege machen? Ist der Gärtner ein-‐<br />
fallslos, wird er machen, was der Mainstream hergibt. Ist er<br />
gedankenlos, wird er den Mainstream ebenfalls reprodu-‐<br />
zieren, ohne dass ihm das bewusst ist. Versteht er dagegen<br />
sein Handwerk, plant er bewusst und eigenständig sowie mit<br />
präzisem Blick auf Ziele und Gegebenheiten.<br />
Chancen und Grenzen von Lehrzieltaxonomien<br />
Eine Taxonomie ist ein Klassifikationsschema, mit<br />
dem man Gegenstände, Prozesse oder Phänomene<br />
systematisch nach einheitlichen Regeln oder Prinzipien<br />
ordnet. Eine Lehrzieltaxonomie ist also ein<br />
Klassifikationsschema, um Lehrziele zu ordnen. Ein<br />
mögliches Ordnungskriterium ist der Abstraktionsgrad<br />
von Lehrzielen: In dem Fall kann man z.B.<br />
konkrete von abstrakten Lehrzielen trennen. Ist das<br />
Kriterium inhaltlich, dann unterscheidet man etwa<br />
fachliche von überfachlichen Lehrzielen. Das Kriterium<br />
kann auch verschiedene Dimensionen des<br />
Lernens heranziehen und kognitive, emotional-motivationale<br />
und motorische Lehrziele postulieren. Innerhalb<br />
einer Lehrzielkategorie (z.B. der kognitiven)<br />
wird sehr häufig das Kriterium Schwierigkeits- oder<br />
Komplexitätsgrad herangezogen. Manche Lehrzieltaxonomien<br />
kombinieren zwei Ordnungskriterien<br />
und kommen auf diesem Wege zu einer Matrix. Das<br />
klassische Beispiel unter den Lehrzieltaxonomien ist<br />
die Taxonomie von Bloom und Mitarbeitern, die bereits<br />
in den 1950er Jahren entwickelt wurde und zwischen<br />
kognitiven, affektiven und psychomotorischen<br />
Lehrzielen differenziert. Am umfangreichsten ausgearbeitet<br />
wurde der Bereich der kognitiven Lehrziele:<br />
Hier werden sechs Klassen von Lehrzielen unterschieden,<br />
die hierarchisch (nach Schwierigkeitsgrad<br />
und Komplexität) aufeinander aufbauen: Kenntnisse,<br />
Verständnis, Anwendung, Analyse, Synthese, Beurteilung<br />
(Bloom & Krathwohl, 1956). Tabelle 1 gibt<br />
einen Überblick, wann diese Lehrziele als erreicht<br />
gelten können.<br />
45 Jahre später haben Anderson und Krathwohl<br />
(2001) eine Revision der Taxonomie von Bloom vorgelegt.<br />
Dabei wurde die eindimensionale Taxonomie<br />
in zwei Dimensionen, nämlich „Wissen“ und „kognitive<br />
Prozesse“, aufgegliedert und zu einer Matrix<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc
kombiniert. Diese Matrix bezieht sich ausschließlich<br />
auf den Bereich der Kognition; die ursprünglich<br />
ebenfalls aufgenommenen affektiven und motorischen<br />
Lehrziele fallen in der revidierten Fassung weg.<br />
Die kognitiven Prozesse werden in Verbform beschrieben<br />
und repräsentieren von links nach rechts<br />
wiederum eine steigende Komplexität (siehe Tabelle<br />
2). Das Wissen erhält als eigene Dimension<br />
weitere Unterkategorien, die ein Kontinuum vom<br />
Faktenwissen zum metakognitiven Wissen (Wissen<br />
über das eigene Wissen) bilden.<br />
!<br />
Lehrzieltaxonomien können eine große Hilfe für<br />
die Planung eines Lernangebots sein: Wer als didaktischer<br />
Designer eine Liste oder Matrix verschiedener<br />
Lehrziele vor sich hat, wird sich leichter bewusst, was<br />
mit einer Lernumgebung erreicht werden soll, welche<br />
Erwartungen unrealistisch sind und an welche Möglichkeiten<br />
man noch gar nicht gedacht hat. Handelt es<br />
sich um ein Lernangebot, das im Rahmen einer Bildungsinstitution<br />
durchgeführt werden soll, helfen<br />
Lehrzieltaxonomien außerdem dabei, die im institu-<br />
Didak4sches Design. Von der Lerntheorie zur Gestaltungsstrategie) — 7<br />
Lehrziel Lehrziel ist erreicht, wenn der/die Lernende<br />
Kenntnisse Sachverhalte beschreiben, definieren und erinnern kann.<br />
Verständnis in eigenen Worten Zusammenhänge beschreiben, Sachlagen interpre4eren, vergleichen kann.<br />
Anwendung Berechnungen durchführen, Regeln anwenden, Verbindungen herstellen, Schlussfolgerungen ab-‐<br />
leiten kann.<br />
Analyse die Bestandteile eines Ganzen erkennen und ihr Zusammenwirken durchschauen, Problemquellen<br />
finden und zwischen Fakten und Schlussfolgerungen unterscheiden kann.<br />
Synthese aus vorgegeben Bestandteilen etwas Neues schaffen, eine Struktur aunauen, Prozeduren entwi-‐<br />
ckeln oder Lösungen entwerfen kann.<br />
Beurteilung fundierte Bewertungen von komplexen Sachverhalten vornehmen, Urteile fällen und die effizien-‐<br />
testen Lösungswege für schwierige Probleme ermiqeln kann.<br />
Tabelle 1: Kognitive Lehrziele nach Benjamin Bloom<br />
Mit einer Lehrzieltaxonomie ordnet man Lehrziele,<br />
opera4onalisiert diese und erleichtert die Kon-‐<br />
struk4on geeigneter Assessment-‐Formen.<br />
Dimension Wissen<br />
Faktenwissen<br />
Konzeptwissen<br />
Prozesswissen<br />
Metakogni4ves Wissen<br />
tionellen Kontext kaum vermeidbaren Prüfungen<br />
(Assessment) in die didaktischen Überlegungen mit<br />
einzubeziehen. Nur wer die Ziele klar formuliert hat,<br />
kann auch valide Assessment-Formen gestalten, die<br />
zu einer Lernumgebung passen.<br />
Als Alternative zu klassischen Lehrzieltaxonomien<br />
werden mitunter Lernzieltypen empfohlen (Oser &<br />
Patry, 1990). Diese unterscheiden sich von klassischen<br />
Lehrzielen dadurch, dass sie weder hierarchisch<br />
oder nach Dimensionen des Lernens klassifiziert<br />
werden noch der Zweiteilung in eine Inhalts- und<br />
Verhaltenskomponente folgen; auch auf eine Operationalisierung<br />
wird verzichtet. Jeder Lernzieltyp ist<br />
einer bestimmten Lernform zugeordnet und bildet<br />
mit dieser ein Basismodell. Ein Beispiel für ein<br />
solches Basismodell ist das Lernen durch Eigenerfahrung<br />
und entdeckendes Lernen, bei dem sich<br />
Lernende Erfahrungswissen aneignen. Ein zweites<br />
Beispiel ist die Begriffs- und Konzeptbildung, bei der<br />
es um den Aufbau von Fakten, Sachverhalten und<br />
vernetztem Wissen geht. Ein drittes Beispiel stellen<br />
Routinebildung und Training von Fertigkeiten mit<br />
dem Ziel der Automatisierung dar.<br />
Dimension kogniDve Prozesse<br />
Erinnern Verstehen Anwenden Analysieren Bewerten Erschaffen<br />
Tabelle 2: Revision der Bloomschen Taxonomie nach Anderson und Krathwohl (2001)<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc
8 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
4. Gestaltungsstrategie: Von der Ausrichtung zum di-‐<br />
dakDschen Szenario<br />
Ausrichtungen und Formate einer Lernumgebung<br />
Ziele sind ein wichtiger Ausgangspunkt, um den Charakter<br />
bzw. die Ausrichtung einer Lernumgebung<br />
festzulegen. Mit der Ausrichtung fallen Grundsatzentscheidungen<br />
darüber, ob eine Lernumgebung<br />
zum Beispiel (a) vor allem instruktional orientiert<br />
und eher geschlossen oder (b) primär problemorientiert<br />
und eher offen konzipiert ist oder (c) beides in<br />
unterschiedlichem Ausmaß kombiniert. Diese Unterscheidung<br />
geht auf eine alte Kontroverse zwischen<br />
David Ausubel und Jerome Bruner darüber zurück,<br />
wie rezeptiv versus aktiv (oder besser: produktiv) das<br />
Lernen erfolgt bzw. erfolgen sollte (Neber, 1987). Besteht<br />
das Ziel vorrangig darin, rezeptives Lernen zu<br />
fördern, konzentrieren sich Lehraktivitäten darauf,<br />
Inhalte lerngerecht aufzubereiten und Lernende darin<br />
anzuleiten, sich diese anzueignen (darbietendes<br />
Lehren nach Ausubel oder direkte Instruktion). Besteht<br />
das Kernziel dagegen darin, produktives<br />
Lernen zu fördern, werden konstruktive Aktivitäten<br />
wie Problemlösen in eigens gestalteten Kontexten<br />
wichtig (entdecken-lassendes Lehren nach Bruner<br />
oder problemorientierte Förderung). Mitunter<br />
werden solche typischen Konzeptionen bzw. Ausrichtungen<br />
einer Lernumgebung auch als Formate bezeichnet,<br />
die sich in mehreren Dimensionen unterscheiden<br />
können: zum Beispiel im Umgang mit<br />
Wissen (Rezeption oder Anwendung), in der Steuerungsinstanz<br />
(Fremd- oder Selbststeuerung), in der<br />
Sozialform (Einzellernen oder kooperatives Lernen)<br />
etc. (Schnotz et al., 2004). Je mehr Dimensionen man<br />
annimmt, deren Ausprägung variiert, umso mehr<br />
Kombinationen sind möglich. Man kann sich also<br />
nicht nur zwei, sondern sehr viele Formate konstruieren.<br />
Dies führt letztlich zu verschiedenen didaktischen<br />
Szenarien.<br />
!<br />
Darbietendes und entdecken-‐lassendes Lehren sind<br />
zwei typische und alt bekannte Ausrichtungen bzw.<br />
Formate, die verschiedene Lernformen fördern und<br />
ebenso verschiedene Bezeichnungen tragen.<br />
DidakDsche Szenarien und deren Ordnung<br />
Unter einem didaktischen Szenario versteht man ein<br />
komplexes Bildungsarrangement, bestehend aus einer<br />
bestimmten Organisationsform (u.a. abhängig von<br />
der Institution), einer konkreten Umgebung und<br />
einer Lehr-/Lern-Situation, in der mehrere Lehrmethoden<br />
zum Tragen kommen (Schulmeister, 2006,<br />
S. 199 f.). Didaktische Szenarien liegen gewissermaßen<br />
zwischen den hoch-abstrakten didaktischen<br />
Ausrichtungen bzw. Formaten einerseits und didaktischen<br />
Methoden andererseits. Es gibt eine ganze<br />
Reihe von Versuchen, diese Szenarien (ähnlich wie<br />
Lehrziele) nach didaktischen Dimensionen zu ordnen<br />
(vgl. Baumgartner, 2006). Die resultierenden Taxonomien<br />
unterliegen im Falle des technologiegestützten<br />
Lernens in der Regel weniger stark lerntheoretischen<br />
Einflüssen wie Formate, sind dafür aber<br />
„anfälliger“ für den technologischen Wandel. Ende<br />
der 1990er Jahre schlagen Back et al. (1998) anhand<br />
von distributiven, interaktiven und kollaborativen<br />
Technologien eine relativ einfache Unterscheidung<br />
folgender Szenarien vor: (a) ein lehrerzentriertes Szenario<br />
zur Informationsvermittlung, (b) ein lernerzentriertes<br />
Szenario zum Wissens- und Fertigkeitserwerb<br />
und (c) ein teamzentriertes Szenario zur Wissensteilung<br />
und zum Problemlösen.<br />
Ein relativ neuer Ordnungsvorschlag für didaktische<br />
Szenarien postuliert folgende drei „Paar-Dimensionen“<br />
mit jeweils drei Ausprägungen (Schulmeister<br />
et al., 2008): (1) den Grad der Virtualität eines<br />
Lernangebots und die Gruppengröße, für die sich das<br />
Lernangebot eignet, (2) den Grad der Synchronizität<br />
und der (Multi-)Medialität sowie (3) den Anteil von<br />
Inhalt (Content) versus Kommunikation und den<br />
Grad der Aktivität. Die Matrix aus jedem Dimensionen-Paar<br />
ergibt jeweils neun Szenarien. Tabelle 3<br />
verdeutlicht das Vorgehen am Beispiel des ersten Dimensionen-Paars.<br />
Bildet man für jedes Dimensionen-Paar eine<br />
solche Kreuztabelle, lassen sich laut Schulmeister et<br />
al. (2008) prinzipiell alle Formen der Lehre damit erfassen.<br />
Die hohe Granularität der Taxonomie bezahlt<br />
man allerdings mit Unübersichtlichkeit, weshalb die<br />
Autoren empfehlen, sich auf den Grad der Virtualität,<br />
der Synchronizität und die Gruppengröße mit je<br />
zwei Ausprägungen zu konzentrieren, was in acht<br />
Grundtypen mediendidaktischer Szenarien mündet.<br />
Didaktische Taxonomien dieser Art wurden und<br />
werden primär dazu entwickelt, die Vielfalt, die man<br />
in der technologiegestützten Bildungspraxis vorfindet,<br />
beschreiben und einordnen zu können. Erst in<br />
zweiter Linie eignen sie sich auch dazu, didaktische<br />
Aktivitäten anzuregen, indem sie einen Überblick<br />
über Beispiele geben oder als Vorbilder wirken,<br />
sofern auch empirische Befunde oder praktische Erfahrungen<br />
zu einzelnen didaktischen Szenarien vorliegen.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc
Von der Lerntheorie zum didakDschen Handeln<br />
Der Weg von der Lerntheorie zum eigentlichen didaktischen<br />
Handeln ist weit: Lerntheorien öffnen<br />
dem Lehrenden die Augen dafür, was Lernen alles<br />
bedeuten kann, aus welchen Perspektiven sich Lernen<br />
betrachten lässt, welche vielfältigen Beschreibungssprachen<br />
sich dafür eignen und welche Erklärungen<br />
naheliegen, wenn man Lernen (wie auch das Ausbleiben<br />
von Lernen) nachvollziehen und beeinflussen<br />
will. Im besten Fall helfen lerntheoretische Kenntnisse<br />
auch dabei, eigene implizit wirkende Lernauffassungen<br />
zu entdecken und zu verhindern, dass sie<br />
didaktische Entscheidungen unkontrolliert stören.<br />
Allenfalls über Erkenntnisse aus der Forschung<br />
mögen Lerntheorien auch eine Hilfe dabei sein, zu<br />
einer didaktischen Grundsatzentscheidung über die<br />
Ausrichtung einer Lernumgebung zu gelangen. Ausschlaggebend<br />
für letztere aber sind allem voran die<br />
Ziele des jeweiligen Lehrvorhabens, weshalb deren<br />
Analyse so wichtig ist, wenn es darum geht, eine Gestaltungsstrategie<br />
zu erarbeiten. Die konkreten Ziele<br />
sind letztlich auch ausschlaggebend, welches didaktische<br />
Szenario man wählt bzw. zu welchem didaktischen<br />
Szenario man gelangt. Lehrzieltaxonomien<br />
bieten hierfür eine systematisierende Hilfe, haben allerdings<br />
auch den Nachteil, dass sie sich relativ einseitig<br />
auf kognitive Ziele konzentrieren und damit<br />
andere womöglich verdrängen. Auch Lehrzieltaxonomien<br />
sind oft lerntheoretisch geprägt. Didaktischen<br />
Szenarien sowie didaktische Taxonomien<br />
können als Vorbild oder als kreativer Impuls wirken,<br />
weshalb deren Kenntnis das didaktische Handeln erleichtern<br />
kann.<br />
?<br />
Didak4sches Design. Von der Lerntheorie zur Gestaltungsstrategie) — 9<br />
Literatur<br />
Gruppengröße<br />
Individuelles Lernen Lernen in Gruppen Lernen in Großgruppen<br />
Virtualität Präsenz z. B. Teleteaching z. B. virtuelles Klassenzimmer z. B. Podcast<br />
Integriert z. B. Aufgaben im LMS En#ällt z.B. Tutoring<br />
Virtuell z. B. Lernen mit Skript z. B. Live-‐Gruppenarbeit z. B. Webserver-‐Zugriff<br />
Tabelle 3: Kreuztabelle aus Virtualität und Gruppengröße. Quelle: Schulmeister et al., 2008<br />
Schreiben Sie die wich4gsten S4chpunkte heraus, mit<br />
denen man verschiedene Lerntheorien kennzeichnen<br />
kann, und stellen Sie diese in einer Tabelle zu-‐<br />
sammen: In welchen Dimensionen unterscheiden sie<br />
sich? Wie sind Sie auf Ihre Dimensionen gekommen?<br />
Empfehlungen zur weiteren Lektüre<br />
▸ Klauer, K.J. & Leutner, D. (2007). Lehren und<br />
Lernen. <strong>Einführung</strong> in die Instruk4onspsychologie.<br />
Weinheim: Beltz.<br />
▸ Reinmann, G. (2010). Studientext Didak4sches<br />
D e s i g n . M ü n c h e n . U R L : hqp : / / g a b i -‐<br />
reinmann.de/wp-‐content/uploads/2011/04/Stu -‐<br />
dientext_DD_April1<strong>1.pdf</strong><br />
▸ Schulmeister, R. (2006). eLearning: Einsichten und<br />
Aussichten. München: Oldenbourg.<br />
▸ Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for<br />
learning, teaching, and assessment. A revision of Bloom´s taxonomy<br />
of educational outcomes. New York: Longman.<br />
▸ Back, A.; Seufert, S. & Kramhöller, S. (1998). Technology<br />
enabled Management Education – Die Lernumgebung MBE<br />
Genius im Bereich Executive Study an der Universität St.<br />
Gallen. io Management, 21(3), 36–42.<br />
▸ Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs:<br />
Prentice Hall.<br />
▸ Baumgartner, P. & Payr, S. (1999). Lernen mit Software. Innsbruck:<br />
Studien-Verlag.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc<br />
?<br />
?<br />
?<br />
!<br />
Formulieren Sie mindestens zwei Argumente, warum<br />
es rela4v schwer ist, eine konkrete Lernumgebung<br />
einem lerntheore4schen Paradigma genau zuzu-‐<br />
ordnen. Welchen Sinn kann eine solche Zuordnung<br />
haben?<br />
Die Grenzen zwischen Formaten bzw. Ausrichtungen<br />
einer Lernumgebung und didak4schen Szenarien sind<br />
fließend: Wo ziehen Sie die Grenze und warum?<br />
Was erhoffen Sie sich von lerntheore4schen Kennt-‐<br />
nissen für didak4sche Entscheidungen in der Praxis?<br />
Hat sich Ihre Antwort darauf verändert, nachdem Sie<br />
diesen Text gelesen haben? Wenn ja, in welche<br />
Richtung?
10 — Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T)<br />
▸ Baumgartner, P. (2006). E-Learning-Szenarien. Vorarbeiten zu<br />
einer didaktischen Taxonomie. In: E. Seiler Schiedt; S. Kälin &<br />
C. Sengstag (Hrsg.), E-Learning – alltagstaugliche Innovation?,<br />
Münster: Waxmann, 238-247.<br />
▸ Baumgartner, P.; Häfele, H. & Maier-Häfele, K. (2004).<br />
Content Management Systeme in e-Education. Innsbruck: Studienverlag.<br />
▸ Bernhardt, T. & Kirchner, M. (2007). E-Learning 2.0 im<br />
Einsatz – „Du bist der Autor!“ – Vom Nutzer zum WikiBlog-<br />
Caster. Boizenburg: Hülsbusch.<br />
▸ Bloom, B.S. & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational<br />
objectives: The classification of educational goals, by a<br />
committee of college and university examiners. Handbook I:<br />
Cognitive Domain. New York: Longmans, Green.<br />
▸ Bodenmann, G.; Perrez, M.; Schär, M. & Trepp, A. (2004).<br />
Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in<br />
Erziehung und Psychotherapie. Bern: Huber.<br />
▸ Glasersfeld, von E. (1996). Radikaler Konstruktivismus. Idee,<br />
Ergebnisse, Probleme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
▸ Klauer, K.J. & Leutner, D. (2007). Lehren und Lernen. <strong>Einführung</strong><br />
in die Instruktionspsychologie. Weinheim: Beltz.<br />
▸ Moser, H. (2008). <strong>Einführung</strong> in die Netzdidaktik. Lehren und<br />
Lernen in der Wissensgesellschaft. Baltmannsweiler: Schneider<br />
Verlag Hohengehren.<br />
▸ Neber, H. (1987). Problemlösen und Instruktion. Psychologie<br />
in Erziehung und Unterricht, 34, 241-246.<br />
▸ Oser, F. & Patry, J.-L. (1990). Choreographien unterrichtlichen<br />
Lernens. Basismodelle des Unterrichts. Berichte zur Erziehungswissenschaft<br />
Nr. 89. Freiburg (Schweiz): Pädagogisches<br />
Institut der Universität Freiburg.<br />
▸ Pörksen, B. (2001). Die Gewissheit der Ungewissheit. Gespräche<br />
zum Konstruktivismus. Heidelberg: Carl-Auer-<br />
Systeme.<br />
▸ Reinmann, G. (2005). Blended Learning in der Lehrerbildung.<br />
Grundlagen für die Konzeption innovativer Lernumgebungen.<br />
Lengerich: Pabst.<br />
▸ Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen<br />
Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In: M.<br />
Baer; M. Fuchs; P. Füglister; K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), Didaktik<br />
auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer<br />
Didaktik zur modernen Lehr-Lernforschung,<br />
Bern: hep, 151-168.<br />
▸ Rey, G.D. (2009). E-Learning. Theorien, Gestaltungsempfehlungen<br />
und Forschung. Bern: Huber.<br />
▸ Schnotz, W.; Eckhardt, A.; Molz, M.; Niegemann, H.M. &<br />
Hochscheid-Mauel, D. (2004). Deconstructing instructional<br />
design models: Toward an integrative conceptual framework<br />
for instructional design research. In: H. Niegemann; D. Leutner<br />
& R. Brünken (Hrsg.), Instructional design for multimedia<br />
learning, Münster: Waxmann, 71-90.<br />
▸ Schulmeister, R. (2006). eLearning: Einsichten und Aussichten.<br />
München: Oldenbourg.<br />
▸ Schulmeister, R.; Mayrberger, K.; Breiter, A.; Fischer, A.;<br />
Hofmann, J. & Vogel, M. (2008). Didaktik und IT-Service-Management<br />
für Hochschulen. URL:<br />
http://www.mmkh.de/upload/dokumente/Referenzrahmen_<br />
Qualitaetssicherung_elearning_April09.pdf [04-07-2010].<br />
▸ Skinner, B.F. (1954). The science of learning and the art of teaching.<br />
American Psychologist, 11, 221-233.<br />
▸ Watson, J.B. & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions.<br />
Journal of Experimental Psychology, 3, 1-14.<br />
Patenscha) übernommen von Webduca4on – Content & Consul4ng | www.webduca4on.cc