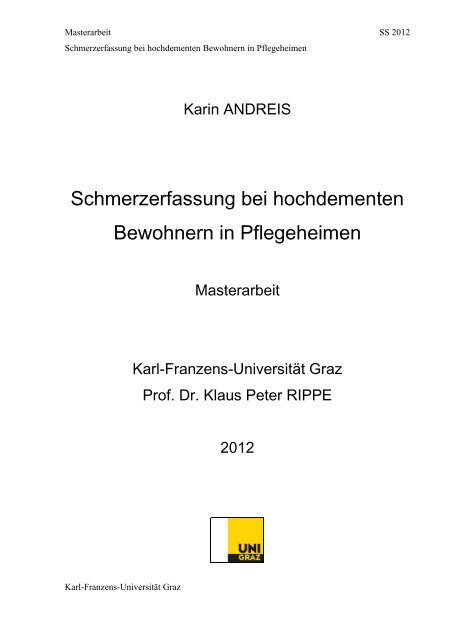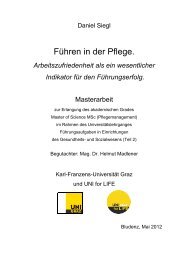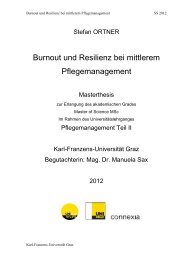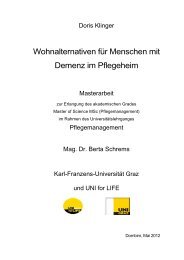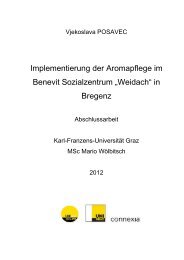Schmerzerfassung bei hochdementen Bewohnern in ... - Connexia
Schmerzerfassung bei hochdementen Bewohnern in ... - Connexia
Schmerzerfassung bei hochdementen Bewohnern in ... - Connexia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Masterar<strong>bei</strong>t SS 2012<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong> <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> <strong>Bewohnern</strong> <strong>in</strong> Pflegeheimen<br />
Karl-Franzens-Universität Graz<br />
Kar<strong>in</strong> ANDREIS<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong> <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong><br />
<strong>Bewohnern</strong> <strong>in</strong> Pflegeheimen<br />
Masterar<strong>bei</strong>t<br />
Karl-Franzens-Universität Graz<br />
Prof. Dr. Klaus Peter RIPPE<br />
2012
Masterar<strong>bei</strong>t SS 2012<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong> <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> <strong>Bewohnern</strong> <strong>in</strong> Pflegeheimen<br />
Karl-Franzens-Universität Graz<br />
Ehrenwörtliche Erklärung<br />
Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Ar<strong>bei</strong>t selbstständig und ohne fremde Hilfe<br />
verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder<br />
<strong>in</strong>haltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Ar<strong>bei</strong>t wurde bisher<br />
<strong>in</strong> gleicher oder ähnlicher Form ke<strong>in</strong>er anderen <strong>in</strong>ländischen oder ausländischen Prüfungsbe-<br />
hörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der e<strong>in</strong>ge-<br />
reichten elektronischen Version.<br />
________________________<br />
10.04.2012 Kar<strong>in</strong> Andreis
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................ 1<br />
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ 3<br />
Abstrakt ................................................................................................................................ 4<br />
Abstract ................................................................................................................................ 5<br />
Vorwort ................................................................................................................................ 6<br />
1 E<strong>in</strong>leitung ...................................................................................................................... 8<br />
2 Aufbau der Ar<strong>bei</strong>t ........................................................................................................ 9<br />
3 Demenz ........................................................................................................................ 11<br />
3.1 Epidemiologie ..................................................................................................... 12<br />
3.2 Demenz aus mediz<strong>in</strong>ischer Sicht ........................................................................ 14<br />
3.3 Alzheimer-Demenz ............................................................................................. 16<br />
3.3.1 Erste Publikation ..................................................................................... 16<br />
3.3.2 Alzheimer-Demenz heute ........................................................................ 17<br />
3.3.3 Demenz diagnostizieren .......................................................................... 19<br />
3.4 Demenz aus pflegerischer Sicht .......................................................................... 21<br />
3.4.1 Möglichkeiten der Betreuung .................................................................. 23<br />
3.4.1.1 Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten<br />
Menschen ................................................................................................ 23<br />
3.4.1.2 Erlebensorientierte Altenpflege mit Hilfe der Mäeutik .......... 25<br />
3.4.1.3 Validation ................................................................................ 27<br />
3.4.1.4 Basale Stimulation .................................................................. 29<br />
3.4.1.5 K<strong>in</strong>ästhetik .............................................................................. 29<br />
3.4.2 Zusammenfassung ................................................................................... 30<br />
4 Schmerz ....................................................................................................................... 32<br />
4.1 Epidemiologie des Schmerzes im Alter .............................................................. 33<br />
4.2 Schmerz im Alter ................................................................................................ 33<br />
4.3 Schmerz und Demenz ......................................................................................... 36<br />
4.3.1 Zusammenfassung ................................................................................... 39<br />
5 <strong>Schmerzerfassung</strong> ....................................................................................................... 40<br />
1
5.1 Verbal gestützte Verfahren ................................................................................. 41<br />
5.1.1 Experimentelle Testverfahren ................................................................. 41<br />
5.1.2 Rat<strong>in</strong>gskalen ............................................................................................ 42<br />
5.1.3 Zusammenfassung ................................................................................... 43<br />
5.2 Schmerzassessment per Fremdbeurteilung ......................................................... 44<br />
5.2.1 ECPA /BISAD ........................................................................................ 45<br />
5.2.2 BESD /PAINAD ..................................................................................... 47<br />
5.2.3 Vergleich ................................................................................................. 48<br />
6 Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t ............................................... 51<br />
6.1 Fragebogen Teil I ................................................................................................ 52<br />
6.2 Fragebogen Teil II ............................................................................................... 53<br />
6.3 Auswahl der Stichprobe ...................................................................................... 54<br />
6.4 Auswahl e<strong>in</strong>es Instruments ................................................................................. 55<br />
6.4.1 ECPA-Bogen ........................................................................................... 57<br />
6.5 Ablauf der Befragung ......................................................................................... 58<br />
6.6 Auswertung der Fragebögen ............................................................................... 59<br />
7 Diskussion der Ergebnisse ......................................................................................... 80<br />
Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 82<br />
Anhang ................................................................................................................................ 94<br />
2
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1 – Frage 1 und 2, Teil 1 ................................................................................... 59<br />
Abbildung 2 – Frage 3, Teil 1 ............................................................................................. 61<br />
Abbildung 3 – Frage 4, Teil 1 ............................................................................................. 62<br />
Abbildung 4 – Frage 5 und 6, Teil 1 ................................................................................... 63<br />
Abbildung 5 – Frage 7, 8, 9 und 10, Teil 1 ......................................................................... 65<br />
Abbildung 6 – Frage 11 und 12, Teil 1 ............................................................................... 68<br />
Abbildung 7 – Frage 1, Teil 2 ............................................................................................. 70<br />
Abbildung 8 – Frage 2, Teil 2 ............................................................................................. 71<br />
Abbildung 9 – Frage 3, Teil 2 ............................................................................................. 72<br />
Abbildung 10 – Qualifikation .............................................................................................. 73<br />
Abbildung 11 – Anzahl Dienstjahre .................................................................................... 73<br />
Abbildung 12 – Frage 1 detailliert (Dienstjahre) ................................................................ 74<br />
Abbildung 13 – Frage 2 detailliert (Dienstjahre) ................................................................ 75<br />
Abbildung 14 – Frage 3 detailliert (Dienstjahre) ................................................................ 76<br />
Abbildung 15 – Frage 1 detailliert (Qualifikation) .............................................................. 77<br />
Abbildung 16 – Frage 2 detailliert (Qualifikation) .............................................................. 78<br />
Abbildung 17 – Frage 3 detailliert (Qualifikation) .............................................................. 79<br />
Fragebogen Teil 1………………………………………………………………………….52<br />
Fragebogen Teil 2………………………………………………………………………….53<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen………………………………………………………………97-98<br />
3
Abstrakt<br />
Abstrakt<br />
Die Pflege und Betreuung hochdementer Menschen wird <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
e<strong>in</strong>e der größten sozialen Herausforderung für die Gesellschaft.<br />
Nicht zuletzt darum ist die Krankheit Demenz <strong>in</strong> den Fokus des allgeme<strong>in</strong>en Inte-<br />
resses gerückt.<br />
Es ist <strong>in</strong>zwischen h<strong>in</strong>reichend bekannt, dass demenzkranke Menschen im fortge-<br />
schrittenen Stadium die Fähigkeit verlieren, sich verbal mitzuteilen. Somit wird<br />
ihnen auch die Möglichkeit genommen, ihrem Umfeld ihre Bedürfnisse und mög-<br />
liche Schmerzen mitzuteilen. Die Pflegenden stehen hier vor e<strong>in</strong>er großen Heraus-<br />
forderung. Ihrer Sensibilität und Wahrnehmung obliegt es, den Schmerz als sol-<br />
chen zu erkennen und darauf zu reagieren.<br />
In der hier vorliegenden Ar<strong>bei</strong>t wurde untersucht, ob die Anwendung e<strong>in</strong>es<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>s<strong>in</strong>struments, die Aufmerksamkeit der Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>-<br />
blick auf die Schmerzwahrnehmung <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen verbes-<br />
sern kann.<br />
Wie mittels Fragebogen erhoben werden konnte, schätzen die Pflegenden ihre<br />
eigene Aufmerksamkeit zum Thema Schmerz überwiegend als hoch e<strong>in</strong>. Auch die<br />
Akzeptanz diesem Instrument gegenüber, ist durchaus hoch.<br />
Die Mitar<strong>bei</strong>terInnen s<strong>in</strong>d großteils der Überzeugung, durch die Anwendung e<strong>in</strong>es<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>s<strong>in</strong>struments ihre Handlungskompetenz verbessern zu können.<br />
Die aus dem Instrument gewonnenen Informationen, erhöhen die Aufmerksamkeit<br />
zum Begriff „Schmerz“ und die Pflegenden fühlen sich kompetenter und selbst-<br />
bewusster <strong>in</strong> der Argumentation der Ärzteschaft gegenüber.<br />
In Summe kann dies zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der Lebensqualität der dementen Be-<br />
wohnerInnen und zu mehr Transparenz <strong>in</strong> der Wirksamkeit der angesetzten<br />
Schmerztherapie führen.<br />
Die <strong>in</strong> dieser Ar<strong>bei</strong>t vorgestellten Instrumente, wurden von ForscherInnen auf ihre<br />
Validität geprüft und allgeme<strong>in</strong> als noch entwicklungsfähig beurteilt. Hier ist noch<br />
Forschungsbedarf gegeben.<br />
4
Abstract<br />
Abstract<br />
The care and nurs<strong>in</strong>g assistance of persons with severe dementia present one oft<br />
the greatest challenges for our society and its health system.<br />
That´s one of t he ma<strong>in</strong> reasons that the disease dementia has ga<strong>in</strong>ed <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>gly<br />
more attention and general awareness.<br />
By now, awareness exists about the fact that patients suffer<strong>in</strong>g from dementia of<br />
an advanced stage gradually lose their ability to speak and communicate verbally.<br />
With<strong>in</strong> that loss, the possibility to <strong>in</strong>form their environment about their needs and<br />
pa<strong>in</strong> is withdrawn. Nurs<strong>in</strong>g Personnel and carers are fac<strong>in</strong>g a great challenge. It<br />
falls to their perception and sensibility to recognise pa<strong>in</strong> and react upon it.<br />
The ma<strong>in</strong> task of present thesis was to exam<strong>in</strong>e whether the application of pa<strong>in</strong><br />
assessment tools could improve the alertness of nurs<strong>in</strong>g personnel regard<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong><br />
perception of nurs<strong>in</strong>g home residents suffer<strong>in</strong>g from severe dementia.<br />
By means of questionnaires, it was shown that the majority of nurs<strong>in</strong>g personnel<br />
and carers rate their alertness concern<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong> predom<strong>in</strong>ately as high. Neverthe-<br />
less, acceptance towards this <strong>in</strong>strument is pleasantly high.<br />
Nurs<strong>in</strong>g home staff shares the op<strong>in</strong>ion, that the application of a pa<strong>in</strong> assessment<br />
tool is a way to improve their competence to react. Information provided by such<br />
an <strong>in</strong>strument <strong>in</strong>creases attention regard<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong> and leads to self-confidence and<br />
more assertiveness for the nurs<strong>in</strong>g personnel <strong>in</strong> argumentation with doctors.<br />
In conclusion, it would result <strong>in</strong> an enhancement <strong>in</strong> the quality of life for residents<br />
suffer<strong>in</strong>g from severe dementia and <strong>in</strong> further transparency of effectiveness of<br />
assessed pa<strong>in</strong> therapy.<br />
Reseachers tested the choices of <strong>in</strong>troduced tools for their validity and <strong>in</strong> general,<br />
they are rated to be still <strong>in</strong> need of further development and research work.<br />
5
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Seit fast 30 Jahren ar<strong>bei</strong>te ich <strong>in</strong> der Krankenpflege. Den Großteil davon <strong>in</strong> der<br />
Altenpflege. Denke ich an me<strong>in</strong>e Anfänge zurück, so kann ich mich kaum an Di-<br />
agnosen wie Demenz vom Alzheimer-Typ, vaskuläre Demenz oder gar Lewy-<br />
Body-Demenz er<strong>in</strong>nern. Hatten demente BewohnerInnen überhaupt e<strong>in</strong>e Diagno-<br />
se, so war dies hauptsächlich Dementia praecox (<strong>bei</strong> Übernahme aus der Psychiat-<br />
rie) oder sie wurden ganz e<strong>in</strong>fach als „senil“ bezeichnet. Wir Pflegenden machten<br />
<strong>in</strong> der Betreuung ke<strong>in</strong>en Unterschied zwischen dementen und kognitiv gesunden<br />
BewohnerInnen. Es gab weder eigene Wohnbereiche, noch waren Kollegen spe-<br />
ziell ausgebildet für die Betreuung dieser Bewohnergruppe. Wurden „senile“<br />
HeimbewohnerInnen auffällig oder gar aggressiv, machte sich große Hilflosigkeit<br />
unter uns Betreuenden breit. Nur sehr selten wurde diese Veränderung im Verhal-<br />
ten mit Schmerz <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht. Die zu Hilfe gerufene Hausärzteschaft<br />
verschrieb e<strong>in</strong> Medikament aus der Gruppe der Psychopharmaka oder <strong>in</strong> beson-<br />
ders kritischen Situationen erfolgte e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>weisung <strong>in</strong> die Psychiatrie.<br />
Erst Naomi Feil sorgte Ende der 80er-Jahre für e<strong>in</strong> Aufhorchen <strong>in</strong> der Alten-<br />
betreuung. Durch die von ihr entwickelte Methode der Validation wurde mir<br />
erstmals bewusst, dass an Demenz erkrankte Menschen sich <strong>in</strong> ihren Bedürfnissen<br />
gravierend von kognitiv gesunden Heimbewohnern unterschieden. Die folgenden<br />
Jahre wurde immer mehr über die Demenz publiziert. Es folgte e<strong>in</strong>e wahre Flut an<br />
Erklärungsversuchen, E<strong>in</strong>- und Unterteilungen, Studien und Klassifikationen von<br />
Seiten der ForscherInnen. Seit jüngster Zeit ist die Demenz <strong>in</strong> aller Munde. Fast<br />
alle BürgerInnen kennen den Begriff „Alzheimer“, die Zahl der Betroffenen über-<br />
steigt jegliche Vorstellungskraft und die Prognosen für die kommenden Jahre s<strong>in</strong>d<br />
erschreckend. Auch <strong>in</strong> der Betreuung der an Demenz Erkrankten hat e<strong>in</strong>e gewisse<br />
Professionalität E<strong>in</strong>zug gehalten. Ich weiß heute viel über diese Krankheit, ich<br />
bilde mir e<strong>in</strong>, fast schon so etwas wie e<strong>in</strong> Profi <strong>in</strong> der Betreuung Demenzkranker<br />
geworden zu se<strong>in</strong>. Ich kenne die gängigsten Betreuungsmodelle und ar<strong>bei</strong>te <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Haus mit eigenem Wohnbereich für demenzkranke Menschen. Me<strong>in</strong>e Mit-<br />
ar<strong>bei</strong>terInnen s<strong>in</strong>d motiviert und erfahren im Umgang mit dieser Klientel und<br />
trotzdem fehlt immer noch das Bewusstse<strong>in</strong> für den Schmerz. Diese Sensibilität,<br />
die es selbstverständlich macht, <strong>bei</strong> e<strong>in</strong>er Veränderung im Verhalten unserer de-<br />
6
Vorwort<br />
menten HeimbewohnerInnen auch die Möglichkeit des Schmerzes <strong>in</strong> Erwägung<br />
zu ziehen! Bei all der Weiterentwicklung blieb das Thema Schmerzerkennung <strong>bei</strong><br />
<strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen zum<strong>in</strong>dest im deutschsprachigen Raum e<strong>in</strong> Stief-<br />
k<strong>in</strong>d. Ärzte wie Dr. Roland Kunz und Dr. Thomas Fischer, um nur zwei zu nen-<br />
nen, widmeten ihre Dissertationen bzw. ihre Forschungen dieser Problematik.<br />
Durch ihre Veröffentlichungen wurde der Schmerz <strong>bei</strong> demenzieller Entwicklung<br />
thematisiert.<br />
Den Betreuenden ist wohl bewusst, dass es den dementen BewohnerInnen durch<br />
ihre kognitiven E<strong>in</strong>schränkungen - und hier vor allem durch den Verlust des<br />
Sprachverständnisses - nicht mehr möglich ist, uns ihre Nöte mitzuteilen. Doch<br />
fehlt e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Vorgehensweise, e<strong>in</strong>e regelmäßige Überprüfung und das<br />
richtige Werkzeug, das es uns ermöglicht den Schmerz zu benennen – auch als<br />
Argumentationshilfe der Ärzteschaft gegenüber. Ich b<strong>in</strong> überzeugt davon, dass<br />
erst das selbstverständliche Mite<strong>in</strong>beziehen der Möglichkeit e<strong>in</strong>es vorhandenen<br />
Schmerzes e<strong>in</strong>e gute Demenzbetreuung gewährleistet und für die betroffenen Be-<br />
wohnerInnen das entscheidende „Mehr“ an Lebensqualität br<strong>in</strong>gt.<br />
7
1 E<strong>in</strong>leitung<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
Schmerzen <strong>bei</strong> älteren und alten HeimbewohnerInnen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> sehr häufiges Prob-<br />
lem. Während die Möglichkeiten e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuell angepassten Schmerztherapie<br />
<strong>bei</strong> den <strong>in</strong> der Kommunikation nicht e<strong>in</strong>geschränkten alten Menschen sehr vielfäl-<br />
tig s<strong>in</strong>d, ist die Erkennung e<strong>in</strong>es Schmerzgeschehens <strong>bei</strong> demenziell Erkrankten<br />
schwierig. Da hochdemente Menschen sehr oft <strong>in</strong> Pflegeheimen betreut werden,<br />
liegt die Wahrnehmung bzw. das Erkennen des Schmerzes meistens ausschließ-<br />
lich <strong>in</strong> der Zuständigkeit der Pflegekräfte. Ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer<br />
Aufmerksamkeit und ihrer Fähigkeit zu beobachten obliegt es, den Schmerz als<br />
solchen zu erkennen und die Betroffenen e<strong>in</strong>er wirksamen Behandlung zuzufüh-<br />
ren.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass Schmerzen <strong>bei</strong> Menschen mit Demenz <strong>in</strong> den Pflege-<br />
heimen von den Mitar<strong>bei</strong>terInnen oft subjektiv bzw. <strong>in</strong>tuitiv wahrgenommen wer-<br />
den. In der Praxis ist auch zu beobachten, dass diese Personengruppe eher Psy-<br />
chopharmaka als Analgetika erhält. (Vgl. Schwermann/Münch 2008)<br />
Demenziell erkrankte Menschen können oft nicht mehr auf ihre Schmerzen h<strong>in</strong>-<br />
weisen, wodurch e<strong>in</strong>e <strong>Schmerzerfassung</strong> im herkömmlichen S<strong>in</strong>n nicht möglich<br />
ist. Die Pflegenden s<strong>in</strong>d auf ihre Beobachtungen angewiesen und müssen daraus<br />
ihre Schlüsse ziehen. In e<strong>in</strong>er Zeit der Datensammlung, zum Zweck evidenzba-<br />
sierten Handelns, entstanden <strong>in</strong> den letzten Jahren viele Schmerze<strong>in</strong>schätzungsbö-<br />
gen. Diese standardisierten <strong>Schmerzerfassung</strong>s<strong>in</strong>strumente zur Fremdbeobachtung<br />
sollen die Verhaltensweisen erfassen, die auf das Vorliegen von Schmerzen h<strong>in</strong>-<br />
deuten könnten.<br />
Trotz dieser Hilfsmittel bleibt das Erkennen der Schmerzen <strong>bei</strong>, an fortgeschritte-<br />
ner Demenz leidenden Menschen e<strong>in</strong> komplexer und schwieriger Prozess. An den<br />
Schlüsselpositionen stehen die Pflegepersonen, die durch ihre unmittelbare Nähe<br />
zum Demenzkranken mit ihm <strong>in</strong> Beziehung treten und ihn beobachten können.<br />
Von ihrer Professionalität und ihrer Fähigkeit der Wahrnehmung hängt es ab, ob<br />
und wann Schmerzen erkannt und <strong>in</strong> Folge auch behandelt werden. Und hier zeigt<br />
sich <strong>in</strong> der täglichen Ar<strong>bei</strong>t, dass diesem Thema bereits <strong>in</strong> der Ausbildung der<br />
Mitar<strong>bei</strong>terInnen zu wenig Augenmerk geschenkt wird. Die allgeme<strong>in</strong>e „Kran-<br />
8
Aufbau der Ar<strong>bei</strong>t<br />
kenbeobachtung“ reicht wohl nicht aus, um subtile Veränderungen im Verhalten<br />
oder das Auftreten von Verhaltensstörungen (Reizbarkeit, Aggressivität, Schreien,<br />
Rückzug usw.) <strong>bei</strong> Demenzkranken mit Schmerz <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung zu br<strong>in</strong>gen. Zu<br />
untersuchen, ob e<strong>in</strong>e standardisierte Vorgehensweise mit Hilfe e<strong>in</strong>es Schmerzer-<br />
fassungsbogens hier hilfreich se<strong>in</strong> kann, ist Gegenstand dieser Ar<strong>bei</strong>t.<br />
2 Aufbau der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Nach Vorwort und E<strong>in</strong>leitung werden im Hauptteil die drei großen Themengebie-<br />
te Demenz, Schmerz und Assessment<strong>in</strong>strumente zur E<strong>in</strong>schätzung des Schmer-<br />
zes bear<strong>bei</strong>tet. Da jedes dieser Themen für sich e<strong>in</strong>e Ar<strong>bei</strong>t im vorgegebenen Um-<br />
fang füllen würde, werden nur die für die vorliegende Ar<strong>bei</strong>t relevanten Aspekte<br />
beschrieben.<br />
So schien es <strong>bei</strong> der Demenz s<strong>in</strong>nvoll, auf die Epidemiologie e<strong>in</strong>zugehen, um die<br />
wachsende Anzahl der Betroffenen und die damit verbundene Herausforderung<br />
für unser Gesundheitssystem aufzuzeigen.<br />
Weiters wird die Alzheimerdemenz näher beschrieben. Zum e<strong>in</strong>em, da es sich<br />
da<strong>bei</strong> um die häufigste Form der Demenz handelt, zum andern, um dem nicht me-<br />
diz<strong>in</strong>isch gebildeten Leser e<strong>in</strong>en tieferen E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> diese Erkrankung und die<br />
daraus resultierende Pflegeabhängigkeit zu ermöglichen.<br />
Die Kapitel „Demenz aus mediz<strong>in</strong>ischer Sicht“ und „Demenz aus pflegerischer<br />
Sicht“ sollen den hohen Anspruch h<strong>in</strong>sichtlich Professionalität nicht nur <strong>bei</strong> den<br />
Mediz<strong>in</strong>ern, sondern auch <strong>bei</strong> den Pflegefachkräften aufzeigen.<br />
Das Thema Schmerz wurde von vornhere<strong>in</strong> auf die Thematik „Schmerz im Alter“<br />
bzw. „Schmerz und Demenz“ reduziert, um auch hier den Zusammenhang mit der<br />
eigentlichen Problematik nicht aus den Augen zu verlieren.<br />
Auf die medikamentösen Therapieempfehlungen wird sowohl <strong>bei</strong> der Demenz als<br />
auch <strong>bei</strong>m Schmerz nur ansatzweise e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Im dritten Abschnitt werden die <strong>in</strong> der Literatur beschriebenen Schmerze<strong>in</strong>schät-<br />
zungsbögen, im H<strong>in</strong>blick auf ihre Anwendbarkeit bezüglich der Schmerze<strong>in</strong>schät-<br />
zung <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen <strong>in</strong> Augensche<strong>in</strong> genommen.<br />
9
Aufbau der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Der praktische Teil dieser Ar<strong>bei</strong>t stellt vier Leitfragen bezüglich Selbste<strong>in</strong>schät-<br />
zung der Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> Bezug auf ihre Sensibilität der Schmerzwahrneh-<br />
mung gegenüber und der S<strong>in</strong>nhaftigkeit der Anwendung e<strong>in</strong>es Assessment<strong>in</strong>stru-<br />
mentes aus der Sicht der Basis.<br />
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt mittels Auswertung e<strong>in</strong>es zweigeteilten<br />
Fragebogens.<br />
Die vier Forschungsfragen lauten wie folgt:<br />
1. Wie ist die Selbste<strong>in</strong>schätzung der Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
Wahrnehmung bzw. das Erkennen von Schmerz <strong>in</strong> der Betreuung hoch-<br />
dementer BewohnerInnen?<br />
2. Kann durch die Anwendung e<strong>in</strong>es geeigneten <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogens<br />
diese Wahrnehmung geschärft werden?<br />
3. Verstärkt die Anwendung e<strong>in</strong>es <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogens die Sicherheit<br />
(Kompetenz) <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung des Handlungsbedarfes?<br />
4. Gibt es Unterschiede <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung je nach Ausbildungsstand und<br />
Berufserfahrung der Mitar<strong>bei</strong>terInnen?<br />
Die Erhebung der Stichprobe, die Instrumente zur Datenerhebung, die Vorge-<br />
hensweise zur Auswertung der erhobenen Daten und die daraus abgeleiteten<br />
Hypothesen werden am Ende des Hauptteils dargestellt.<br />
Die Zusammenfassung bzw. Diskussion bildet den Abschluss der hier vorliegen-<br />
den Ar<strong>bei</strong>t.<br />
10
3 Demenz<br />
Demenz<br />
Das Wort Demenz kommt aus dem Late<strong>in</strong>ischen. Die Vorsilbe de- bedeutet: „et-<br />
was ist weg, abhanden gekommen“ und „mens“ kann übersetzt werden mit: „der<br />
Geist, der Verstand“. Folglich heißt Demenz: „Der Verstand ist weg.“<br />
Immer wieder wird „dement“ bzw. „Demenz“ auch mit „geistlos“ übersetzt, ob-<br />
wohl e<strong>in</strong>e Reihe von alternativen Bedeutungen des late<strong>in</strong>ischen Begriffs mens zur<br />
Verfügung stehen, wie z. B. Bes<strong>in</strong>nung, Bewusstse<strong>in</strong>, Denken, Ges<strong>in</strong>nung, S<strong>in</strong>n<br />
und nicht zuletzt Verstand. Die Philosophie als Geisteswissenschaft betrachtet den<br />
Begriff „Geist“ wesentlich differenzierter. Für viele Philosophen ist Geist nicht<br />
mit kortikalen Funktionen gleichzusetzen, sondern wird als etwas von diesen Ge-<br />
trenntes betrachtet. Somit ist Geist mehr als e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Nerventätigkeit. Folglich<br />
kann es im Verlauf des demenziellen Prozesses zu e<strong>in</strong>er Kognitionslosigkeit<br />
kommen, jedoch nie zu e<strong>in</strong>er Geistlosigkeit. (Vgl. Ganß 2009:10-13)<br />
Die Mediz<strong>in</strong> begreift die Demenz als organisch bed<strong>in</strong>gte Krankheit. Potentielle<br />
Risikofaktoren wurden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihe von epidemiologischen Studien erforscht.<br />
So werden unter anderem das Alter, das Geschlecht, die familiäre Disposition,<br />
neurologische oder genetisch bed<strong>in</strong>gte Erkrankungen, aber auch e<strong>in</strong> niedriges Bil-<br />
dungsniveau oder e<strong>in</strong>e ungesunde Lebensweise für die Entstehung der Krankheit<br />
Demenz verantwortlich gemacht. (Vgl. Vollmar et al., Degam Leitl<strong>in</strong>ie 2008)<br />
Wie <strong>in</strong> der Mediz<strong>in</strong> üblich, wird auch die Demenz <strong>in</strong> Stadien unterteilt. E<strong>in</strong>e häu-<br />
fige Unterteilung ist die E<strong>in</strong>teilung nach den Schweregraden leicht, mittel und<br />
schwer, bezogen auf die Kategorien Kognition/Tätigkeiten, Lebensführung und<br />
Antrieb/Affekt. (Vgl.Vollmar et al., Degam Leitl<strong>in</strong>ie 2008)<br />
Richter und Richter begründen <strong>in</strong> ihrem Buch die E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> Frühstadium, mitt-<br />
leres Stadium und Spätstadium. Sie beziehen sich da<strong>bei</strong> konkret auf die Alzhei-<br />
mer-Demenz und beschreiben die zunehmende Hilfsbedürftigkeit der Betroffenen<br />
mit E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> das jeweils folgende Stadium. (Vgl. Richter/Richter 2004)<br />
Diese E<strong>in</strong>teilungen können der Ärzteschaft und den Pflegenden e<strong>in</strong>e Hilfe se<strong>in</strong>,<br />
doch so wie die betroffenen Personen verschieden s<strong>in</strong>d, so können auch demen-<br />
zielle Prozesse verschieden verlaufen. Es ist daher immer von e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>zelfall<br />
auszugehen und die betroffene Person ist als Individuum zu sehen.<br />
11
3.1 Epidemiologie<br />
Demenz<br />
Dieses Kapitel soll e<strong>in</strong>en Überblick über die aktuelle Datenlage im deutschspra-<br />
chigen Raum - und hier vorzugsweise <strong>in</strong> Österreich - geben. Durch die Darstel-<br />
lung der Zahlen wird die Wichtigkeit der Thematik aufgezeigt.<br />
Demenzerkrankungen nehmen zu. Ihre Inzidenz und Prävalenz steigen mit dem<br />
Alter an. Etwa 90.500 Personen litten im Jahr 2000 <strong>in</strong> Österreich unter e<strong>in</strong>er<br />
demenziellen Erkrankung. Bis zum Jahr 2050 wird diese Zahl auf 233.800 ange-<br />
stiegen se<strong>in</strong>. Die jährlichen Neuerkrankungen werden sich von 23.600 auf 59.500<br />
erhöhen. Nummer e<strong>in</strong>s unter den Demenzformen ist mit 60 bis 80 Prozent die<br />
Alzheimer-Krankheit, gefolgt von der vaskulären Demenz mit 10 bis 25 Prozent<br />
und der Lewy-Körperchen-Demenz mit 7 bis 25 Prozent. (Vgl. Österreichische<br />
Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie, 2006 http)<br />
Andere Demenzformen s<strong>in</strong>d selten und machen e<strong>in</strong>en Anteil von höchstens zehn<br />
Prozent aus. Mischformen dagegen kommen sehr häufig vor.<br />
Berechnungen aufgrund e<strong>in</strong>er europäischen Metaanalyse von Jönnsön & Berr aus<br />
dem Jahre 2005 ergaben, dass <strong>in</strong> Österreich jährlich etwa 1,1 Milliarden Euro für<br />
die Versorgung Demenzkranker anfallen. Etwa drei Viertel davon machen nicht<br />
mediz<strong>in</strong>ische Kosten aus, während die mediz<strong>in</strong>ischen Kosten nur etwa e<strong>in</strong> Viertel<br />
betragen. Die Kosten, die durch die medikamentöse Behandlung entstehen, betra-<br />
gen nur sechs Prozent der Gesamtkosten für die Versorgung Demenzkranker.<br />
(Vgl. Geriatrie onl<strong>in</strong>e, http) Diesen Zahlen schließt sich auch die Österreichische<br />
Gesellschaft für Geriatrie & Gerontologie im Konsensstatement „Demenz“ der<br />
Österreichischen Alzheimer Gesellschaft <strong>in</strong> ihrem Update 2006 an. (Vgl.Alf,<br />
Bancher, Benke et al. 2006:221-231)<br />
E<strong>in</strong>en Anstieg der Anzahl an Betroffenen sieht auch Monique Weissenberger-<br />
Leduc. Für sie s<strong>in</strong>d es hauptsächlich alle<strong>in</strong>stehende Frauen, deren Betreuung re<strong>in</strong><br />
quantitativ e<strong>in</strong>e noch nie dagewesene Aufgabe und Belastung für die Gesellschaft<br />
darstellen wird. Schon jetzt leiden 60 bis 70 Prozent der HeimbewohnerInnen an<br />
Demenz. (Vgl. BMfSK 2008 pdf.) In 48 Prozent der Heimaufnahmen <strong>in</strong> Öster-<br />
reich liegt Demenz als Grund vor. Dies ist gleichbedeutend mit dem größten Zeit-<br />
aufwand und der höchsten psychischen Belastung für die Pflegenden.<br />
(Vgl.Weissenberger-Leduc 2009:10)<br />
12
Demenz<br />
Rappold et al. machen <strong>in</strong> ihrem Bericht „Hochaltrigkeit <strong>in</strong> Österreich“ auf den<br />
vielfach noch immer nicht bekannten Umstand aufmerksam, dass Demenz die<br />
Hauptursache für Pflegebedürftigkeit im Alter ist. (Vgl. Hochbetagtenbericht<br />
2009:24 pdf)<br />
270 000 demente ÖsterreicherInnen im Jahre 2050 prophezeit Claudia Gehr<strong>in</strong>g<br />
(Kl<strong>in</strong>ische Psycholog<strong>in</strong> und Gesundheitspsycholog<strong>in</strong> /Wien). Sie sieht e<strong>in</strong>en di-<br />
rekten Zusammenhang zwischen der höheren Lebenserwartung und der Zunahme<br />
an demenzerkrankten ÖstereicherInnen - oder anders ausgedrückt: Durch die ver-<br />
besserte mediz<strong>in</strong>ische Versorgung steigt die Lebenserwartung der Menschen an<br />
und l<strong>in</strong>ear dazu auch das Risiko, an e<strong>in</strong>er Demenz zu erkranken.<br />
Im Jahre 2005 betrug der Bevölkerungsanteil der 75-84-Jährigen <strong>in</strong> Österreich<br />
480.000 Personen, bis zum Jahr 2050 wird die Anzahl auf fast 900.000 Personen<br />
ansteigen. Waren im Jahre 2005 rund 133.000 Personen über 84 Jahre alt, wird<br />
diese Zahl im Jahr 2050 auf rund 524.000 ansteigen. Fr. Mag. Gehr<strong>in</strong>g beruft sich<br />
<strong>bei</strong> diesen Zahlen auf die Statistik Austria und verweist auch auf die VITA-<br />
Studie, die erstmals <strong>in</strong> Österreich konkrete bevölkerungsbezogene Daten zur De-<br />
menz liefern kann. (Vgl. Demenz /Epidemiologie 2011html und Zwischenbilanz<br />
der VITA-Studie 2005 http)<br />
Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass die zunehmende Zahl der an<br />
Demenz erkrankten Personen das Gesundheitssystem <strong>in</strong> Österreich <strong>in</strong> den nächs-<br />
ten Jahrzehnten an die Grenzen der F<strong>in</strong>anzierbarkeit br<strong>in</strong>gen wird.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf den stetig wachsenden Betreuungsbedarf sollten spätestens jetzt<br />
die notwendigen Schritte zur langfristigen Sicherung (Rekrutierung, Ausbildung,<br />
Bezahlung) der notwendigen Betreuungspersonen <strong>in</strong> Angriff genommen werden.<br />
13
3.2 Demenz aus mediz<strong>in</strong>ischer Sicht<br />
Demenz<br />
Nach der zehnten Revision der Internationalen Klassifikation psychischer Störun-<br />
gen (die Klassifikation ICD 10 – herausgegeben von der Weltgesundheitsorgani-<br />
sation WHO – bildet die Grundlage für das Verrechnungssystem der Österreichi-<br />
schen Krankenkassen) handelt es sich <strong>bei</strong> der Demenz um e<strong>in</strong> Syndrom mit fol-<br />
genden Merkmalen (Vgl. Internationale Klassifikation Psychischer Störungen<br />
2005):<br />
Kriterien für die Diagnose Demenz:<br />
1. Abnahme des Gedächtnisses und Abnahme anderer kognitiver Fähigkeiten<br />
(z.B. Urteilsfähigkeit, Denkvermögen)<br />
2. Ke<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis auf vorübergehenden Verwirrtheitszustand<br />
3. Störung von Affektkontrolle, Antrieb oder Sozialverhalten (mit emotiona-<br />
ler Labilität, Reizbarkeit, Apathie oder Vergröberung des Sozialverhal-<br />
tens) sowie<br />
4. Dauer der genannten Störungen m<strong>in</strong>destens sechs Monate<br />
Im Gegensatz zur M<strong>in</strong>derbegabung handelt es sich <strong>bei</strong>m Demenzsyndrom um e<strong>in</strong>e<br />
sekundäre Verschlechterung e<strong>in</strong>er vorher größeren geistigen Leistungsfähigkeit.<br />
(Vgl. Förstl 2009:4)<br />
Nach ICD 10 muss neben dem Gedächtnis m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e weitere <strong>in</strong>tellektuelle<br />
Funktion bee<strong>in</strong>trächtigt se<strong>in</strong> (z.B. Urteilsfähigkeit, Denkvermögen, Planen). (Vgl.<br />
Förstl 2009:4). Klaus Schmitke schließt sich dieser Def<strong>in</strong>ition im S<strong>in</strong>ne von ICD-<br />
10 an, sieht dar<strong>in</strong> aber e<strong>in</strong>ige Mängel: So steht z.B. <strong>bei</strong> manchen Demenzerkran-<br />
kungen anfangs nicht e<strong>in</strong>e kognitive Störung, sondern e<strong>in</strong>e Wesensveränderung<br />
im Vordergrund. E<strong>in</strong>e Gedächtnisstörung ist e<strong>in</strong> sehr häufiges, aber ke<strong>in</strong> unab-<br />
d<strong>in</strong>gbares Symptom e<strong>in</strong>er Demenz. Sie kann mitunter ganz im H<strong>in</strong>tergrund ste-<br />
hen. Weiters kann laut Schmitke e<strong>in</strong>e Demenz sofort nach e<strong>in</strong>maliger Schädigung<br />
auftreten und ausnahmsweise schon vor Ablauf von sechs Monaten zum Tode<br />
führen. (Vgl. Schmitke 2006:13)<br />
Für Monique Weissenberger-Leduc ist die Demenz e<strong>in</strong> Syndrom, das progressiv<br />
verläuft und durch vielfache Störungen der höheren Gehirnfunktionen, wie Rech-<br />
nen, Sprechen und Denken, gekennzeichnet ist. Das Bewusstse<strong>in</strong> ist nicht getrübt.<br />
14
Demenz<br />
Vor oder gleichzeitig mit den kognitiven Bee<strong>in</strong>trächtigungen (Gedächtnis, Den-<br />
ken, Orientierung, Verständnis, Sprache usw.) treten meist Verschlechterungen<br />
der emotionalen Steuerung, des Sozialverhaltens und der Motivation auf.<br />
Weissenberger-Leduc unterscheidet da<strong>bei</strong> zwei Hirnleistungen:<br />
Die Thymopsyche, verantwortlich für Bef<strong>in</strong>dlichkeit, Steuerung der Affekte, der<br />
Triebe und der Psychomotorik wie Mimik und Gestik. Und die Noopsyche, zu-<br />
ständig für Bewusstse<strong>in</strong>, Orientierung, Intelligenz, Gedächtnis und Denken.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Demenz dekompensieren laut Weissenberger-Leduc langsam, aber stetig<br />
die Thymo- und die Noopsyche. Im Gegensatz zur Depression und zum Delir.<br />
(Vgl. Weissenberger-Leduc 2009:12-13)<br />
Die Def<strong>in</strong>ition der Demenz nach Rab<strong>in</strong>s, Lyketson & Steel bezieht sich konkret<br />
auf die Bee<strong>in</strong>trächtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens und schließt somit<br />
e<strong>in</strong>e MCI (Abkürzung für engl. „mild cognitive impairment“ = leichte kognitive<br />
Bee<strong>in</strong>trächtigung) aus. (Vgl. Rab<strong>in</strong>s/Lyketson/Steele 2006)<br />
Allen Fachleuten geme<strong>in</strong> ist die Annahme, dass es sich <strong>bei</strong> der Demenz nicht um<br />
e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne, ätiologisch def<strong>in</strong>ierte Krankheit handelt, sondern um e<strong>in</strong> kl<strong>in</strong>isches<br />
Syndrom. (Vgl. Heun/Kölsch 2005:16)<br />
Die irreversiblen kognitiven Störungen bee<strong>in</strong>trächtigen das Alltagsleben zuse-<br />
hends und führen unweigerlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e komplette Pflegeabhängigkeit. Je nach<br />
Stadium und Krankheitsbild s<strong>in</strong>d verschiedene Diszipl<strong>in</strong>en der Mediz<strong>in</strong> an der<br />
Betreuung von Menschen mit Demenz beteiligt. Jedes mediz<strong>in</strong>ische Fach sieht<br />
andere Menschen und steht vor anderen Problemen. (Vgl. Moreau 2011)<br />
E<strong>in</strong>e gute Zusammenar<strong>bei</strong>t der e<strong>in</strong>zelnen SpezialistInnen trägt hier wesentlich<br />
zum Gel<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuellen ärztlichen Betreuung <strong>bei</strong>.<br />
15
3.3 Alzheimer-Demenz<br />
Demenz<br />
Auf die Alzheimer-Demenz wird <strong>in</strong> dieser Ar<strong>bei</strong>t gesondert e<strong>in</strong>gegangen. Zum<br />
e<strong>in</strong>en macht sie den größten Anteil <strong>in</strong> der Reihe der dementiellen Erkrankungen<br />
aus. Zum anderen zeigen der Verlauf und die daraus resultierenden kognitiven<br />
und auch körperlichen E<strong>in</strong>bußen am deutlichsten die Ansprüche an die zukünftige<br />
Gesellschaft, sprich Angehörige, mobile BetreuerInnen, ÄrztInnen, PolitikerInnen<br />
und professionelle Pflegekräfte <strong>in</strong> Pflegee<strong>in</strong>richtungen auf.<br />
3.3.1 Erste Publikation<br />
Der deutsche Arzt, Psychiater und Neuropathologe Alois Alzheimer zählt zu den<br />
populärsten Persönlichkeiten der Mediz<strong>in</strong>geschichte. Der Humanmediz<strong>in</strong>er diag-<br />
nostizierte 1901 <strong>bei</strong> der Patient<strong>in</strong> Auguste Deter erstmals das Krankheitsbild der<br />
Demenz, wodurch er nach se<strong>in</strong>em Tod als Entdecker dieser Demenzform zum<br />
Namenspaten der Krankheit „Alzheimer“ wurde. (Vgl. Alzheimer Biografie http)<br />
Die Erstbeschreibung der Alzheimer-Erkrankung wurde als Eigenbericht von<br />
Alois Alzheimer auf zwei Druckseiten <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Zeitschrift für Psychiat-<br />
rie und psychisch-gerichtliche Mediz<strong>in</strong> 1907 abgedruckt. (Vgl. Alzheimer Eigen-<br />
bericht 1907:146-148)<br />
Dar<strong>in</strong> referiert Alzheimer über e<strong>in</strong>e eigenartige Erkrankung der Hirnr<strong>in</strong>de und<br />
berichtet im Detail über den geistigen Verfall der damals erst 51-jährigen Auguste<br />
Deter. Er beschreibt die zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten, wie Gedächtnis-<br />
schwäche, Orientierungslosigkeit, paranoide Ideen usw., und berichtet von „pa-<br />
raphasischen“ Ausdrücken (z.B. Milchgießer statt Kaffeetasse) und dem erschre-<br />
ckend schnellen Verfall der Frau.<br />
Die Sektion des Gehirns von Auguste Deter ergab e<strong>in</strong> gleichmäßig atrophisches<br />
Gehirn ohne makroskopische Herde. Die größeren Hirngefäße waren arterioskle-<br />
rotisch verändert. An speziell behandelten Präparaten zeigten sich „merkwürdige“<br />
Veränderungen der Neurofibrillen.<br />
16
3.3.2 Alzheimer-Demenz heute<br />
Demenz<br />
Bei etwa zwei Dritteln aller dementen PatientInnen wird kl<strong>in</strong>isch e<strong>in</strong>e Alzheimer-<br />
Demenz (AD) diagnostiziert. (Vgl. Förstl/Kurz/Hartmann 2009:44)<br />
Die wesentlichen histopathologischen Merkmale der AD s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>trazerebrale<br />
Ablagerung von amyloiden Plaques und Neurofibrillen (Tauprote<strong>in</strong>e) sowie e<strong>in</strong>e<br />
neuronale Atrophie. (Vgl. Heun/Kölsch, 2005:16 und Fröhlich/Padberg 2005:193-<br />
233)<br />
Die AD beg<strong>in</strong>nt meist schleichend und verläuft langsam progredient. Anfangs<br />
kommt es vor allem zu Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und zu räumlichen<br />
Orientierungsstörungen. Später kommen Bee<strong>in</strong>trächtigungen der <strong>in</strong>tellektuellen<br />
Fähigkeiten sowie apraktische, aphasische und agnostische Störungen h<strong>in</strong>zu.<br />
Die eigene Persönlichkeit bleibt oft lange als Fassade erhalten, d. h. die Betroffe-<br />
nen versuchen, Gedächtnislücken usw. durch geschicktes Umgehen zu kaschieren.<br />
Oft entwickeln sie dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e wahre Kunst und so können auch engste Familien-<br />
angehörige lange getäuscht werden.<br />
Der Beg<strong>in</strong>n der Krankheit Alzheimer liegt <strong>in</strong> der Regel nach dem 60. Lebensjahr,<br />
mit e<strong>in</strong>em Krankheitsverlauf von acht bis zehn Jahren. Bei e<strong>in</strong>em frühen Beg<strong>in</strong>n<br />
vor dem 60. Lebensjahr beträgt die Krankheitsdauer bis zum Tod etwa drei bis<br />
sechs Jahre.<br />
Die Diagnosestellung erfolgt aufgrund kl<strong>in</strong>ischer Merkmale, kann aber erst post-<br />
mortem durch e<strong>in</strong>e Autopsie gesichert werden. (Vgl. Zaudig/Möller 2005:187-193<br />
und Thürauf et.al. 2005:273-295)<br />
Neue Erklärungen und Therapieansätze zeigt der Diagnoseforscher Prof. Dr. Ha-<br />
rald Hampel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vortragsreihe im Kl<strong>in</strong>ikum Frankfurt auf. Er spricht von<br />
e<strong>in</strong>er weltweiten Epidemie mit 35 Millionen PatientInnen im Jahre 2010 und 115<br />
Millionen Betroffenen im Jahre 2050. Laut Hampel macht die Forschung große<br />
Fortschritte. So können unter E<strong>in</strong>haltung der von den Fachgesellschaften vorge-<br />
gebenen Behandlungs- und Diagnosepfaden S3 Leitl<strong>in</strong>ie „Demenzen“, (Vgl. DE-<br />
DAM-Leitl<strong>in</strong>ie 2008 http) Gedächtnis und Demenzdiagnostik, Anamnese und<br />
neuropsychologische Testung, Bildgebung des Gehirns (MRT) und Blut und Li-<br />
quorentnahme zu e<strong>in</strong>er Früherkennung der AD führen. Aufbauend auf Alois Alz-<br />
heimers Beobachtung macht auch Hampel den amyloiden Stoffwechsel für die<br />
17
Demenz<br />
Plaques verantwortlich. In der Zelle wird e<strong>in</strong>e Hyperphosphorylierung des Tau-<br />
prote<strong>in</strong>s (pathologisch verändertes mikrotubuläres Transporteiweiß) für den Zell-<br />
untergang verantwortlich gemacht. Sowohl von den Amyloidbelägen wie auch<br />
von den Tauprote<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d laut Hampel fünf bis zehn Jahre vor Auftreten der ers-<br />
ten Symptome Biomarker im Liquor nachweisbar.<br />
Dies ruft wiederum die Pharmakonzerne auf den Plan, wo<strong>bei</strong> die medikamentöse<br />
Therapie laut Hampl noch <strong>in</strong> der Entwicklungsphase steckt. (Vgl. Hampel Fach-<br />
vortrag 2010 html)<br />
Die Forschergruppe um Buch untersuchte ebenfalls das TAU-Prote<strong>in</strong> als biologi-<br />
schen Indikator zur Früherkennung der AD. Mit dem Ergebnis, dass sich bereits<br />
<strong>bei</strong> Betroffenen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sehr frühen Stadium der AD (MMST 25-28 Punkte) e<strong>in</strong>e<br />
signifikante Erhöhung des TAU-Prote<strong>in</strong>s im Liquor nachweisen ließ. Die For-<br />
schergruppe <strong>in</strong>terpretiert dies als H<strong>in</strong>weis darauf, dass sich das TAU-Prote<strong>in</strong> als<br />
Indikator für die Früherkennung eignet. (Vgl. Buch et al. 2010:379-385) Unter-<br />
stützt wird diese Theorie auch von Schönknecht et al. Sie konnten ebenfalls e<strong>in</strong>en<br />
erhöhten TAU-Spiegel <strong>bei</strong> AD-PatientInnen nachweisen. Innerhalb der AD-<br />
Gruppe war allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e signifikante Korrelation zwischen TAU-Level, dem<br />
Schweregrad der Demenz, der Dauer der Erkrankung und der Art und Dosierung<br />
von Psychopharmaka nachweisbar. (Vgl. Schönknecht et al 2003:231-238)<br />
E<strong>in</strong>e weitere Studie beschäftigte sich mit der Frage, ob sich die Bestimmung der<br />
Biomarker als Goldstandard <strong>in</strong> der Diagnostik der AD eignet. Das Ergebnis un-<br />
termauert die Annahme, dass die Biomarker annähernd an die Genauigkeit e<strong>in</strong>er<br />
Autopsie herankommen. Mit dem Nutzen, dass die Diagnose bereits im präkl<strong>in</strong>i-<br />
schen Stadium gestellt und mit e<strong>in</strong>er Therapie vor E<strong>in</strong>tritt erheblicher kognitiver<br />
Störungen begonnen werden kann. Zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt also, an dem e<strong>in</strong>e Thera-<br />
pie am wirksamsten ist. (Vgl. Sperl<strong>in</strong>g/Johnson 2010)<br />
Universitätsprofessor DDr. Peter Fischer (UNI-Kl<strong>in</strong>ik Wien), Koord<strong>in</strong>ator der<br />
VITA-Studie, sieht <strong>in</strong> der Entwicklung von Azetylchol<strong>in</strong>esterasehemmern und<br />
NMDA-Rezeptorantagonisten e<strong>in</strong>e Möglichkeit, die Progression der AD zu ver-<br />
langsamen und somit die Pflegebedürftigkeit der PatientInnen h<strong>in</strong>auszuzögern.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs sollte mit der Behandlung bereits <strong>bei</strong> Vorliegen e<strong>in</strong>er milden Demenz<br />
(MCI) begonnen werden. (Vgl. Fischer VITA-Studie 2008 http)<br />
18
Demenz<br />
Trotz aller Euphorie muss kritisch h<strong>in</strong>terfragt werden, wie zuverlässig diese Er-<br />
gebnisse s<strong>in</strong>d. Schließlich hat die sogenannte Nonnenstudie (Vgl. Snowdon 2007<br />
html) e<strong>in</strong>ige Forschungsansätze <strong>in</strong> diese Richtung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Sackgasse enden las-<br />
sen. Wirft diese Studie doch die Frage auf, ob die Plaques tatsächlich die Ursache<br />
der Entstehung e<strong>in</strong>er Alzheimer-Demenz s<strong>in</strong>d.<br />
Abschließend kann gesagt werden, dass die Risikofaktoren, die e<strong>in</strong>e Demenz be-<br />
günstigen h<strong>in</strong>reichend erforscht wurden. Auch h<strong>in</strong>sichtlich Diagnostik und Früh-<br />
erkennung hat die Wissenschaft neue Erkenntnisse gewonnen. Bleibt noch die<br />
Frage nach e<strong>in</strong>er wirksamen Therapie bzw. e<strong>in</strong>em wirksamen Schutz vor der<br />
Krankheit.<br />
Allen Autoren geme<strong>in</strong> ist die Ansicht, dass der frühen Diagnose und Verlaufsbeo-<br />
bachtung <strong>bei</strong> leichter kognitiver E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> besonderes Augenmerk zu<br />
schenken ist. Die daraus resultierende frühzeitige Therapie kann die Entwicklung<br />
e<strong>in</strong>er Demenz günstig bee<strong>in</strong>flussen bzw. den E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> das Stadium der völligen<br />
Pflegebedürftigkeit h<strong>in</strong>auszögern.<br />
3.3.3 Demenz diagnostizieren<br />
In den letzten Jahren haben sich die diagnostischen Möglichkeiten zur Erkennung<br />
demenzieller Veränderungen deutlich verbessert. Dies ist besonders relevant <strong>in</strong><br />
Bezug auf die sekundären Demenzen, denen e<strong>in</strong>e behandelbare <strong>in</strong>ternistische,<br />
psychiatrische oder neurologische Ursache zugrunde liegt (z.B. Schilddrüsener-<br />
krankung, Depression, Tumore usw.). Die Diagnose der Alzheimer-Demenz ist da<br />
schon wesentlich schwieriger. Tom Kitwood sieht <strong>in</strong> der Diagnosestellung De-<br />
menz e<strong>in</strong>e der schwierigsten Aufgaben für die Ärzteschaft. Er verweist auch auf<br />
den allgeme<strong>in</strong> bekannten Umstand, dass die Me<strong>in</strong>ungen der Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>e-<br />
rInnen, der PsychologInnen, der PsychiaterInnen und der NeurologInnen stark<br />
differieren und den befundeten Gedächtnisstörungen unterschiedlich viel Gewicht<br />
<strong>bei</strong>gemessen wird. (Vgl. Kitwood 2008:49)<br />
E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fach durchführbare psychologische Methode ist die Anwendung der M<strong>in</strong>i-<br />
Mental-Status-Untersuchung (engl. M<strong>in</strong>i-Mental-State-Exam<strong>in</strong>ation). (Vgl.<br />
Folste<strong>in</strong> et al.1975:189-198) Diese Testung ermöglicht e<strong>in</strong>e grobe E<strong>in</strong>schätzung<br />
19
Demenz<br />
des kognitiven Leistungsvermögens zu e<strong>in</strong>em bestimmten Zeitpunkt. Völlig unbe-<br />
achtet bleiben <strong>bei</strong> dieser Schnelltestung biografische Marker wie Bildung, Erzie-<br />
hung, erworbene Fertigkeiten usw. Der M<strong>in</strong>i-Mental-Test setzt sich aus elf Auf-<br />
gaben zusammen, deren richtige Beantwortung/Erledigung als Maximalwert 30<br />
Punkte ergibt. Als normal gelten im MMST 27 – 30 Punkte. Liegt die im Test<br />
erreichte Punktezahl <strong>bei</strong> 26 oder darunter, sollte auf jeden Fall e<strong>in</strong>e Demenzdia-<br />
gnostik e<strong>in</strong>geleitet werden. Wenn tatsächlich e<strong>in</strong>e Alzheimer-Demenz vorliegt,<br />
wird von den Experten empfohlen, <strong>bei</strong> 26 Punkten mit e<strong>in</strong>er medikamentösen<br />
Therapie zu beg<strong>in</strong>nen. Die Diagnose der AD bleibt jedoch e<strong>in</strong>e Ausschlussdiag-<br />
nose. Wenn nach psychometrischen Tests, Labor- und neurophysiologischen Un-<br />
tersuchungen andere Diagnosen ausgeschlossen werden können, wird die Diagno-<br />
se: „Demenz vom Alzheimer Typ“ gestellt. (Vgl. Krämer/Förstl 2008)<br />
E<strong>in</strong>e völlig andere Ansicht vertritt der Demenzexperte Peter J. Whitehouse. Für<br />
ihn stellt die Bezeichnung „Alzheimerkrankheit“ den Versuch der Gesellschaft<br />
dar, e<strong>in</strong>en natürlichen Prozess (die Gehirnalterung), der nicht zu kontrollieren ist,<br />
zu verstehen und <strong>in</strong> weiterer Folge zu bee<strong>in</strong>flussen. Nach se<strong>in</strong>er Anschauung geht<br />
es <strong>bei</strong> dem Begriff Alzheimer um e<strong>in</strong>e wissenschaftlich nicht haltbare Kategorie<br />
und e<strong>in</strong>en Mythos. Laut Whitehouse wird sich die Diskussion über Alzheimer <strong>in</strong><br />
der Zukunft wohl um die Frage drehen, ob es sich hier vorrangig um e<strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>i-<br />
sches Problem oder um e<strong>in</strong>e soziale Herausforderung handelt. (Vgl. Whitehouse<br />
2009)<br />
Die Alzheimer-Demenz ist folglich e<strong>in</strong>e noch nicht gelöste mediz<strong>in</strong>isch-<br />
pharmakologische Aufgabe und e<strong>in</strong>e Herausforderung für die Gesellschaft, sich<br />
Gedanken um die Integration von Menschen mit Gehirnalterungsprozessen zu<br />
machen.<br />
20
3.4 Demenz aus pflegerischer Sicht<br />
Demenz<br />
Für die Pflegenden <strong>in</strong> den unterschiedlichsten Institutionen haben die Erkenntnis-<br />
se der Forscher (noch?) ke<strong>in</strong>e Auswirkung auf ihren Pflegealltag.<br />
Die Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> den jeweiligen Wohnbereichen für demenzkranke Men-<br />
schen werden jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt.<br />
Der Pflegealltag zeigt, dass die Aufnahme <strong>in</strong>s Pflegeheim zu e<strong>in</strong>em immer späte-<br />
ren Zeitpunkt erfolgt. Mit der Konsequenz, dass sich <strong>in</strong> den Wohnbereichen fast<br />
ausschließlich BewohnerInnen mit e<strong>in</strong>er Demenz im mittleren bzw. im fortge-<br />
schrittenen Stadium bef<strong>in</strong>den. E<strong>in</strong>e Anamnese mit der betroffenen Person ist <strong>in</strong><br />
dieser Phase bereits nicht mehr möglich. Biografische Informationen erhalten die<br />
Betreuenden ausschließlich über Dritte.<br />
Längst nicht alle aufgenommenen BewohnerInnen werden im Vorfeld von Geron-<br />
topsychiaterInnen abgeklärt. Somit fehlt sehr oft e<strong>in</strong>e Diagnose, die wiederum<br />
sehr hilfreich <strong>bei</strong> der E<strong>in</strong>schätzung der Verhaltensweisen der an Demenz erkrank-<br />
ten Personen se<strong>in</strong> könnte, da sich verschiedene Formen von Demenz unterschied-<br />
lich auf das Verhalten, den Krankheitsverlauf und die Behandlung der Betroffe-<br />
nen auswirken (z.B. gleichförmig progredienter Verlauf <strong>bei</strong> AD versus fluktuie-<br />
render Verlauf <strong>bei</strong> Vaskulärer Demenz und Affektausbrüche <strong>bei</strong> Frontotemporal-<br />
Demenzen).<br />
In fortgeschrittenen Demenzstadien treten häufig sogenannte herausfordernde<br />
Verhaltensweisen auf, die den nicht-kognitiven Symptomen der Demenz zuge-<br />
rechnet werden. Dazu zählen Agitation, Herumgehen, Herumlaufen und Rastlo-<br />
sigkeit, Aggressivität, vokale Störungen (Schreien, Rufen, Fluchen, Wort- und<br />
Satzwiederholungen), Passivität sowie Zurückweisen der Pflege und Verweige-<br />
rung der Nahrungsaufnahme. (Vgl. Halek/Bartholomeyczik 2006 http)<br />
Aber auch psychopathologische Begleitsymptome wie Depression, Apathie und<br />
Wahnbildungen können die Pflegesituation entscheidend erschweren. Seidl et al.<br />
haben <strong>in</strong> ihrer Studie die psychopathologische Begleitsymptomatik von Heimbe-<br />
wohnerInnen untersucht. Laut ihren Ergebnissen bestand <strong>bei</strong> 87 Prozent e<strong>in</strong>e psy-<br />
chopathologische Symptomatik. Während der Allgeme<strong>in</strong>-, der Ernährungs- und<br />
der Pflegezustand sowie die allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>ische Versorgung durchwegs als<br />
gut bewertet werden konnten, lag die fachärztliche Mitbehandlung im Argen. Le-<br />
21
Demenz<br />
diglich 27 Prozent der Betroffenen waren den SpezialistInnen h<strong>in</strong>sichtlich psy-<br />
chopathologischer Auffälligkeiten vorgestellt worden. 70 Prozent der Heimbe-<br />
wohnerInnen wurden psychopharmakologisch behandelt, wo<strong>bei</strong> Sedativa mit 44<br />
Prozent am häufigsten e<strong>in</strong>gesetzt wurden. (Vgl. Seidl et al. 2007:720-727)<br />
Die herausfordernden Verhaltensweisen werden <strong>in</strong> der Literatur als Ausdruck ei-<br />
nes unbefriedigten Bedürfnisses des demenzkranken Menschen gewertet.<br />
Im Zuge e<strong>in</strong>er Studie (Studienleitung Frau Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey) wurde<br />
e<strong>in</strong>e deutsche Fassung der Serial Trial Intervention (STI-D) entwickelt und getes-<br />
tet. Die STI gibt e<strong>in</strong>en strukturierten Rahmen zum Erkennen unbefriedigter Be-<br />
dürfnisse von Pflegeheimbewohnern mit Demenz und der darauf basierenden Re-<br />
duktion herausfordernder Verhaltensweisen vor, unter besonderer Berücksichti-<br />
gung von Schmerzen. (Vgl. Fischer et al. 2007:370-372) Im ersten Schritt erfolgte<br />
unter E<strong>in</strong>bezug von Fachexperten e<strong>in</strong>e Anpassung der STI-D an die deutschen<br />
Erfordernisse. Anschließend wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kl<strong>in</strong>ischen Studie mit drei Messzeit-<br />
punkten die Effektivität der STI-D getestet. Primärer Endpunkt war da<strong>bei</strong> das<br />
Auftreten herausfordernder Verhaltensweisen, sekundäre Endpunkte waren<br />
Schmerzen, Lebensqualität sowie die Gabe von Analgetika und Psychopharmaka.<br />
Erwartet wurde e<strong>in</strong>e Verm<strong>in</strong>derung der Ausprägung von Verhaltenssymptomen<br />
sowie der Psychopharmakaverschreibungen, der Hospitalisierungsrate und der<br />
subjektiven Belastung für Pflegende.<br />
Das Ergebnis war für die Praxis zwar relevant da es aufzeigte, dass die Reduktion<br />
herausfordernder Verhaltensweisen im Pflegeheim durch gezielte pflegerische<br />
Ar<strong>bei</strong>t möglich und s<strong>in</strong>nvoll ist. Allerd<strong>in</strong>gs war es der Forschergruppe nicht mög-<br />
lich, für e<strong>in</strong>e bestimmte Art des Vorgehens zu plädieren. Klare Vorteile von STI<br />
konnten auf Basis dieser Studie nicht belegt werden. (Vgl. Kuhlmey 2011 http<br />
und Fischer et al. 2007:370-372)<br />
Zusammenfassend kann also davon ausgegangen werden, dass es für die Qualität<br />
des Pflegealltags entscheidend ist, nach e<strong>in</strong>heitlichen Regeln bzw. Modellen oder<br />
Philosophien vorzugehen.<br />
E<strong>in</strong>ige der bekanntesten Pflegemodelle werden im folgenden Kapitel beschrieben.<br />
22
3.4.1 Möglichkeiten der Betreuung<br />
Demenz<br />
Zur Betreuung von Menschen mit Demenz gibt es e<strong>in</strong>e Vielzahl von Konzepten,<br />
Ansätzen und Fachbüchern. Ob sich e<strong>in</strong>e Institution für e<strong>in</strong> bestimmtes Modell<br />
entscheidet und versucht, dieses umzusetzen, oder ob, wie z.B. <strong>in</strong> der Sonnweid<br />
(CH), der Leitsatz gilt: „Jedem Bewohner se<strong>in</strong> Betreuungsmodell“, sei dah<strong>in</strong>ge-<br />
stellt. Entscheidend ist e<strong>in</strong> fundiertes Wissen über die Krankheit Demenz mit all<br />
ihren Ausprägungen (Verhaltensauffälligkeiten) und die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit<br />
den verschiedenen Betreuungsmodellen. Die Ar<strong>bei</strong>t mit dementen <strong>Bewohnern</strong><br />
stellt hohe Ansprüche an die Betreuenden. Möglichst viel zu wissen über die<br />
Krankheit Demenz fördert das Verständnis, speziell <strong>bei</strong> Verhaltensauffälligkeiten.<br />
Das Wissen um Strategien und Lösungsansätze kann das tägliche Mite<strong>in</strong>ander<br />
erleichtern.<br />
Im folgenden Kapitel sollen e<strong>in</strong>ige der bekanntesten und am häufigsten <strong>in</strong> die<br />
Praxis implementierten Betreuungsmodelle vorgestellt werden.<br />
3.4.1.1 Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen<br />
In westlichen Zivilgesellschaften wird die mediz<strong>in</strong>ische Sichtweise oft als aus-<br />
schließliche Perspektive auf die Demenz angewandt. Daraus ergeben sich für die<br />
Betroffenen Folgen wie Stigmatisierung, die ausschließliche Konzentration auf<br />
Defizite und Verluste von Fähigkeiten und nicht zuletzt die Gefahr, dass ihnen das<br />
Person-Se<strong>in</strong> abgesprochen wird. (Vgl. Frogatt 2007 http)<br />
E<strong>in</strong> Ansatz, dem entgegenzuwirken, ist der person-zentrierte Umgang mit verwirr-<br />
ten Menschen nach Tom Kitwood. Schon zu Beg<strong>in</strong>n der 90er-Jahre des 20. Jhds.<br />
reagierte der englische Sozialpädagoge Tom Kitwood auf diese von ihm benannte<br />
„maligne Sozialpsychologie“. Er stellte zwei Pflegekulturen gegenüber. Diese<br />
<strong>bei</strong>den Kulturen betrachten Demenzpflege auf gänzlich unterschiedliche Weise.<br />
Die alte Kultur leugnet im Allgeme<strong>in</strong>en das Bestehen psychischer Bedürfnisse <strong>bei</strong><br />
Menschen mit Demenz oder neutralisiert sie durch beruhigende Medikamente. Sie<br />
sieht nur m<strong>in</strong>imale Interaktion vor, und diese im Wesentlichen nur im H<strong>in</strong>blick<br />
auf grundlegende körperliche Bedürfnisse. Die neue Kultur <strong>in</strong>dessen nimmt sich<br />
dieser psychischen Bedürftigkeit an mit der Erkenntnis, dass dadurch e<strong>in</strong>e Phase<br />
relativer Entspannung erreicht werden kann. Diese neue Kultur betrachtet die In-<br />
23
Demenz<br />
teraktion mit den Betroffenen als außerordentlich positiv und sieht <strong>in</strong> ihr e<strong>in</strong>e der<br />
wichtigsten Komponenten der Pflege. Die <strong>bei</strong>den Kulturen unterscheiden sich<br />
erheblich <strong>in</strong> ihren Auffassungen von validem Wissen und echter Erfahrung.<br />
Vor 20 Jahren bedeutete Demenzforschung laut Kitwood hauptsächlich drei Arten<br />
von Aktivitäten. Die erste bestand <strong>in</strong> naturwissenschaftlichen Forschungen zur<br />
Struktur, Funktion und Pathologie des Gehirns. Die zweite <strong>in</strong> experimentellen<br />
Untersuchungen, hauptsächlich an Tieren. Die dritte befasste sich im <strong>in</strong>dividualis-<br />
tischen Studium mit den mit Demenz e<strong>in</strong>hergehenden Defiziten, hauptsächlich auf<br />
kognitivem Gebiet. Da<strong>bei</strong> kümmerte sich niemand darum, wie Demenz wirklich<br />
gelebt und erfahren wurde. Für e<strong>in</strong> Wissen, das aus persönlicher Anteilnahme<br />
herrührt, gab es ke<strong>in</strong>en Raum. Die neue Kultur ordnet laut Kitwood den traditio-<br />
nellen Formen der Forschung e<strong>in</strong>en relativ niedrigen Stellenwert zu. Bei weitem<br />
höchste Priorität hat das alltägliche Leben von Menschen mit Demenz und da<strong>bei</strong><br />
wiederum ist das zentrale Thema die Wahrung des Wohlbef<strong>in</strong>dens. (Vgl. Kitwood<br />
2008:171-173) Kitwoods erste Anforderung an die Pflegenden ist das „Präsent-<br />
Se<strong>in</strong>“. Darunter versteht er, zwanghaften Aktionismus zu vermeiden und stattdes-<br />
sen e<strong>in</strong>fach nur zu se<strong>in</strong>. Im Zentrum steht da<strong>bei</strong> die Empathie, e<strong>in</strong>e Grundhaltung<br />
die es möglich macht, zuzuhören, die Gefühle des Anderen nachzuvollziehen,<br />
ohne sie zu übernehmen. Als e<strong>in</strong>er der wichtigsten Eckpfeiler des person-<br />
zentrierten Ansatzes im Umgang mit Menschen mit Demenz gilt laut Kitwood die<br />
Erhaltung des PersonSe<strong>in</strong>s als der Status, der dem e<strong>in</strong>zelnen Menschen im Kon-<br />
text von Beziehung und sozialem Se<strong>in</strong> von anderen verliehen wird. Er impliziert<br />
Anerkennung, Respekt und Vertrauen. (Vgl. Kitwood 2008:27)<br />
Aber auch verschiedene Arten der Interaktion s<strong>in</strong>d maßgeblich <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf<br />
e<strong>in</strong>e Demenzbetreuung. E<strong>in</strong>e jede stärkt das Person-Se<strong>in</strong>, <strong>in</strong>dem sie e<strong>in</strong> positives<br />
Gefühl verstärkt, e<strong>in</strong>e Fähigkeit stärkt oder da<strong>bei</strong> hilft, e<strong>in</strong>e seelische Wunde zu<br />
heilen. (Vgl. Kitwood 2008:133-139)<br />
Um die Wirksamkeit der Interaktionen zu ermitteln, bietet sich Dementia Care<br />
Mapp<strong>in</strong>g an. DCM ist e<strong>in</strong> relativ junges Angebot der Wissenschaft. DCM ermög-<br />
licht es, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie Interventionen von Hilfe und<br />
Pflege wirken und wie sich demenziell bee<strong>in</strong>trächtigte Menschen <strong>in</strong> stationären<br />
E<strong>in</strong>richtungen subjektiv fühlen. DCM wurde von Tom Kitwood & Dawn Brooker<br />
24
Demenz<br />
et al. von der Bradford Dementia Group an der Universität Bradford entwickelt<br />
und von Christian Müller-Hergl et al. von der Universität Witten-Herdecke <strong>in</strong>s<br />
Deutsche übersetzt. (Vgl. Kitwood 2008:133 und. Brooker et al. 2007)<br />
Doch nicht nur die Betreuungspersonen, auch die jeweilige E<strong>in</strong>richtung muss ih-<br />
ren Beitrag leisten. Sowohl Kitwood wie auch Brooker fordern die Veränderung<br />
der Organisation als unabd<strong>in</strong>gbare Begleitersche<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>er person-zentrierten<br />
Demenzbetreuung e<strong>in</strong>. Während Kitwoods sozialpsychologisches Bild der Erhal-<br />
tung des Person-Se<strong>in</strong>s gerne <strong>in</strong> Leitbildern verwendet wird, fordert das Modell<br />
von Dawn Brooker viel konkreter die Entwicklung der Organisationen und er-<br />
sche<strong>in</strong>t daher etwas unbequemer. Brooker stellt e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem<br />
Ansatz personzentrierter Pflege und Dimensionen wie Ethos des Managements,<br />
Personalentwicklung oder Bezug zum Geme<strong>in</strong>wesen her. (Vgl. Wappelshammer<br />
2011:42-43) Wo<strong>bei</strong> den Verantwortlichen (Politik, Geme<strong>in</strong>de, Träger usw.) <strong>in</strong>-<br />
zwischen wohl bewusst geworden ist, dass e<strong>in</strong>e „person-zentrierte“ Betreuung nur<br />
mit den notwendigen Ressourcen (Personal, räumliche Gegebenheiten und Auf-<br />
klärung der Gesellschaft) geschaffen und erhalten werden kann.<br />
E<strong>in</strong> erster Schritt <strong>in</strong> diese Richtung ist die Aktion Demenz <strong>in</strong> Vorarlberg. Im<br />
Rahmen verschiedenster Vortragsreihen wird das Thema Demenz der Öffentlich-<br />
keit näher gebracht. Betroffene, Angehörige und Interessierte haben hier die Mög-<br />
lichkeit, sich zu <strong>in</strong>formieren und sich auszutauschen. E<strong>in</strong>gebunden s<strong>in</strong>d sämtliche<br />
Pflegee<strong>in</strong>richtungen und ambulanten Dienste (Tagesbetreuung).<br />
3.4.1.2 Erlebensorientierte Altenpflege mit Hilfe der Mäeutik<br />
E<strong>in</strong> weiterer Ansatz für e<strong>in</strong>e mögliche Betreuungsform ist das mäeutische Pflege-<br />
und Betreuungsmodell. Die niederländische Demenzexpert<strong>in</strong> Cora van der Kooij<br />
versucht dar<strong>in</strong>, den <strong>in</strong> den Pflegenden schlummernden Erfahrungsschatz, ihre Po-<br />
tenziale und ihre Professionalität für die erlebensorientierte Pflege alter und ver-<br />
wirrter Menschen zu nutzen. Die Erfahrungen, die Pflegende <strong>in</strong> ihrem Ar<strong>bei</strong>tsall-<br />
tag machen, vermischen sich mit denen ihres persönlichen Lebens. Es ist e<strong>in</strong>e<br />
ständige Wechselwirkung zwischen dem, was Pflegende <strong>bei</strong> ihrer Ar<strong>bei</strong>t, und<br />
dem, was sie <strong>in</strong> ihrem Privatleben erleben. Mal nutzen sie an ihrem Ar<strong>bei</strong>tsplatz<br />
E<strong>in</strong>sichten aus ihrem Privatleben, mal ist es umgekehrt. So entwickelt sich im<br />
25
Demenz<br />
Laufe der Jahre e<strong>in</strong> <strong>in</strong>nerer Erfahrungsschatz, der sowohl auf ihrer Berufs- als<br />
auch auf ihrer Lebenserfahrung gründet. (Vgl. Van der Kooij 2007:33)<br />
Das mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell ist aus den Erfahrungen entstan-<br />
den, die <strong>bei</strong> der E<strong>in</strong>führung der erlebensorientierten Pflege gemacht wurden. Erle-<br />
bensorientierte Pflege beg<strong>in</strong>nt mit der Frage, wer die BewohnerInnen s<strong>in</strong>d, was<br />
sie erlebt haben und was sie empf<strong>in</strong>den. Danach wird versucht den Kontakt so zu<br />
gestalten, dass sich die BewohnerInnen verstanden fühlen. (Vgl. Van der Kooij<br />
2007:36-39)<br />
Erlebensorientierte Pflege ist also e<strong>in</strong> Begriff, mit dem festgehalten werden kann,<br />
was man <strong>bei</strong>nahe verloren hätte: das Bewusstse<strong>in</strong>, dass Pflege immer voraussetzt,<br />
sich <strong>in</strong> die zu betreuende Person h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zuversetzen. Die Kunst besteht wohl dar<strong>in</strong>,<br />
so viel Vertrauen aufzubauen und so viel Autorität und Sicherheit auszustrahlen,<br />
dass sich die Bewohner den Pflegenden ohne Gesichtsverlust anvertrauen können.<br />
Um diesen kommunikativen Prozess anzuregen und <strong>in</strong> konstruktive Bahnen zu<br />
lenken, wurde der mäeutische Pflegeprozess entwickelt. Da mäeutisch mit „be-<br />
freiend“ oder „erlösend“ übersetzt werden kann, appelliert dieser Pflegeprozess an<br />
die Professionalität der Pflegenden, Situationen bzw. Verhalten e<strong>in</strong>fach zuzulas-<br />
sen. In der erlebensorientierten BewohnerInnenbesprechung erstellen die Pflegen-<br />
den e<strong>in</strong>e Charakteristik, die e<strong>in</strong> Bild des ganzen Menschen vermittelt. Vorrangig<br />
ist hier das <strong>in</strong>tuitive Wissen der Betreuenden gefordert. Nicht Beh<strong>in</strong>derungen und<br />
Defizite stehen im Mittelpunkt, sondern die Persönlichkeit des Betroffenen. Die<br />
Pflegenden formulieren e<strong>in</strong>e Umgangsempfehlung auf der Grundlage der positi-<br />
ven Erfahrungen, die bislang gemacht wurden. Bei eventuell auftretenden Prob-<br />
lemen, suchen die Pflegenden geme<strong>in</strong>sam nach e<strong>in</strong>er Lösung (z. B. durch gezielte<br />
Beobachtung und Erfahrungsaustausch). Im Gegensatz zum problemgesteuerten<br />
Pflegeprozess orientiert sich die Mäeutik ausschließlich an Pflegebedürfnissen<br />
und positiven Kontaktmomenten.<br />
Trotz viel Berufs- und Lebenserfahrung können immer wieder Situationen e<strong>in</strong>tre-<br />
ten, die die Pflegenden an ihre Grenzen br<strong>in</strong>gen. Die von ihnen erwartete emotio-<br />
nale Intelligenz und kommunikative Offenheit ist im Pflegealltag nicht immer<br />
umsetzbar. Hier legt das mäeutische Pflege-und Betreuungsmodell großen Wert<br />
auf die Unterstützung der Pflegenden <strong>bei</strong>m Verar<strong>bei</strong>ten ihrer Gefühle. Innerhalb<br />
26
Demenz<br />
des bestehenden Teams ist gegenseitiges Vertrauen unabd<strong>in</strong>gbar. Nur so lässt sich<br />
die emotionale Gesundheit der Mitar<strong>bei</strong>terInnen aufrechterhalten. Cora van der<br />
Kooij beschreibt <strong>in</strong> ihrem Buch „E<strong>in</strong> Lächeln im Vorübergehen“ sehr e<strong>in</strong>drücklich<br />
die Ausweichstrategien, die die Pflegenden entwickeln, um ihrer zeitweiligen<br />
(oder ständigen) Überforderung zu entgehen. Gleichzeitig zeigt sie jedoch auch<br />
Strategien auf, die es den Mitar<strong>bei</strong>terInnen ermöglichen an ihren Aufgaben zu<br />
wachsen, d. h. e<strong>in</strong>e gewisse Professionalität zu erlangen, sich beruflich wie auch<br />
privat weiterzuentwickeln und ihre Ar<strong>bei</strong>t als s<strong>in</strong>nvoll zu erleben. (Vgl. Van der<br />
Kooij 2007:114-119)<br />
Professionalität im mäeutischen S<strong>in</strong>n heißt: authentisch und kreativ wahrnehmen,<br />
reagieren und handeln, und dies anschließend <strong>in</strong> Worte fassen bzw. begründen<br />
können.<br />
3.4.1.3 Validation<br />
Das Konzept der Validation wurde von Naomi Feil zwischen 1963 und 1980 ent-<br />
wickelt. Sie ar<strong>bei</strong>tete als Sozialar<strong>bei</strong>ter<strong>in</strong> <strong>in</strong> den USA und gibt als Grund für die<br />
Entwicklung ihres Konzepts ihre negativen Erfahrungen mit dem Realitätsorien-<br />
tierungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g (ROT) an: „Ich gab das Ziel der Orientierung auf die Realität auf,<br />
als ich bemerkte, dass die Gruppenmitglieder sich immer dann zurückzogen oder<br />
zunehmend fe<strong>in</strong>dselig wurden, wenn ich sie mit der unerträglichen Realität der<br />
Gegenwart zu konfrontieren versuchte.“ (Feil 2000)<br />
Das Betreuungskonzept besteht im Besonderen aus Kommunikationstechniken,<br />
die <strong>in</strong> der Betreuung von dementen Menschen angewendet werden sollen.<br />
Der Schlüssel zu e<strong>in</strong>er adäquaten Kommunikation mit ihnen ist da<strong>bei</strong> die Valida-<br />
tion (lat.: validus = kräftig; englisch: valid = gültig), also das „Für-gültig-<br />
Erklären“ der Erfahrung und der subjektiven Wirklichkeit e<strong>in</strong>es anderen Men-<br />
schen.<br />
Die Kommunikation bezieht sich durch das aktive Anerkennen der Emotionen des<br />
Menschen mit Demenz stark auf die Gefühlsebene. Voraussetzung für den Ver-<br />
such, den gesamten Bezugsrahmen e<strong>in</strong>er Person zu verstehen, ist e<strong>in</strong> hohes Maß<br />
an Empathie. (Vgl. Kitwood 2008:135)<br />
27
Demenz<br />
Zur besseren Erläuterung des Konzepts sollen im Folgenden die wichtigsten<br />
Punkte zur Validation aus der Sicht von Feil dargestellt werden.<br />
Validieren bedeutet, die Gefühle e<strong>in</strong>es Menschen anzuerkennen und für wahr zu<br />
erklären. Durch e<strong>in</strong> gutes E<strong>in</strong>fühlungsvermögen soll versucht werden, <strong>in</strong> die <strong>in</strong>ne-<br />
re Erlebniswelt des desorientierten Menschen vorzudr<strong>in</strong>gen. Da<strong>bei</strong> kommt es zum<br />
Aufbau von Vertrauen, Sicherheit, Stärke und Selbstwertgefühl. Verbale und non-<br />
verbale Signale der Erkrankten sollen aufgenommen und <strong>in</strong> Worten wiedergege-<br />
ben werden.<br />
Der Validation liegen verschiedene Pr<strong>in</strong>zipien aus dem Bereich der Psychologie<br />
zugrunde. Hier s<strong>in</strong>d unter anderem Rogers und Jung zu nennen: „Akzeptieren Sie<br />
Ihren Patienten, ohne ihn zu beurteilen.“ (Rogers 1992) Oder: „Gefühle die aus-<br />
gedrückt und dann von e<strong>in</strong>em vertrauten Zuhörer bestätigt und validiert wurden,<br />
werden schwächer, ignorierte oder geleugnete Gefühle werden stärker.“ (Jung<br />
2012 http)<br />
Den theoretischen H<strong>in</strong>tergrund der Validation als Betreuungskonzept bzw. als<br />
Grundhaltung (Vgl. Kostrzewa 2008:123) bildet die von dem Psychologen Erik-<br />
son entwickelte Theorie der Lebensstadien und Aufgaben. (Vgl. Erikson 2010<br />
http)<br />
Naomi Feil fügt diesem Stadienmodell e<strong>in</strong>en weiteren Lebensabschnitt mit der<br />
Bezeichnung „hohes Alter“ h<strong>in</strong>zu, da die Lebenserwartung gestiegen ist. Dies ist<br />
das „Stadium jenseits der Integrität“, <strong>in</strong> dem die spezifische Lebensaufgabe dar<strong>in</strong><br />
besteht, die Vergangenheit aufzuar<strong>bei</strong>ten. Die Zielgruppe für die Methode der<br />
Validation s<strong>in</strong>d laut Feil desorientierte, sehr alte Menschen, die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der<br />
vier Unterstadien des Lebensabschnitts „Jenseits der Integrität“ bef<strong>in</strong>den. (Vgl.<br />
Öhl<strong>in</strong>ger/Schneider/Dorfmeister 2010:75-79)<br />
Kontrovers dazu die Ansicht von Stefan Kostrzewa, der e<strong>in</strong>en Widerspruch dar<strong>in</strong><br />
sieht, den kranken Menschen als Individuum zu sehen, um ihn dann aber <strong>in</strong><br />
„Schubladen“ zu stecken, zu denen es rezeptartige Handlungsanweisungen gibt.<br />
(Vgl. Kostrzewa 2008:43-45) Für Mart<strong>in</strong>a Schmidl h<strong>in</strong>gegen ist die Validation die<br />
Tür <strong>in</strong> das Land der dementen Menschen und sollte nicht nur von den Pflegenden,<br />
sondern auch von den ÄrztInnen erlernt und praktiziert werden. (Vgl. Schmidl<br />
2004:28)<br />
28
3.4.1.4 Basale Stimulation<br />
Demenz<br />
Das Konzept der basalen Stimulation, entwickelt vom Sonderpädagogen Andreas<br />
Fröhlich, diente zunächst der Persönlichkeitsförderung schwerst mehrfachbeh<strong>in</strong>-<br />
derter K<strong>in</strong>der. Geme<strong>in</strong>sam mit der Pflegewissenschaftler<strong>in</strong> Christel Bienste<strong>in</strong><br />
wurde es im H<strong>in</strong>blick auf die Pflege wahrnehmungsbee<strong>in</strong>trächtigter Menschen<br />
weiterentwickelt und ist <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> sämtlichen Bereichen der Pflege etabliert.<br />
Das Konzept geht von e<strong>in</strong>em Menschenbild aus, dem die Würde, Autonomie und<br />
der Respekt vor dem Menschen zugrunde liegen. Es sieht vor, Selbstheilungskräf-<br />
te zu mobilisieren, Menschen <strong>in</strong> der Kontaktaufnahme zur Umwelt zu unterstüt-<br />
zen sowie Ängste und Abspaltungstendenzen zu vermeiden. Die basal stimulie-<br />
rende, somatisch-körperliche Anregung zielt auf Erfahrungen, die sämtliche S<strong>in</strong>ne<br />
des menschlichen Körpers ansprechen. So wird <strong>bei</strong>spielsweise mit Berührung,<br />
akustischen, vibratorischen, visuellen und audiorhythmischen Erfahrungen e<strong>in</strong>e<br />
sichere, kommunikative und vertraute Atmosphäre geschaffen. E<strong>in</strong>e Atmosphäre,<br />
für die <strong>in</strong> der traditionellen Pflege bewusst und engagiert Raum geschaffen wer-<br />
den muss, um wahrnehmungsbee<strong>in</strong>trächtigte Menschen genesen, am Alltag teil-<br />
haben und Fähigkeiten wiedererlangen zu lassen. (Vgl. Bienste<strong>in</strong>/Fröhlich 2007)<br />
3.4.1.5 K<strong>in</strong>ästhetik<br />
Die Ausgangsfragen der K<strong>in</strong>ästhetik s<strong>in</strong>d: Wie „funktioniert“ der Mensch? Wie<br />
steuert er se<strong>in</strong> ganzes Verhalten? Wie kann er se<strong>in</strong>e eigenen Lernprozesse und<br />
se<strong>in</strong>e Gesundheitsentwicklung aktiv gestalten und bee<strong>in</strong>flussen? Auf dem H<strong>in</strong>ter-<br />
grund dieser Fragen <strong>in</strong>teressiert sich die K<strong>in</strong>ästhetik für die Bewegung und die<br />
Bewegungswahrnehmung des Menschen, die zwischenmenschliche Interaktion<br />
und die grundsätzliche Bedeutung der Bewegung für das Leben.<br />
Die K<strong>in</strong>ästhetik beruht im Wesentlichen auf zwei Grundlagen:<br />
Die wissenschaftlichen Grundlagen bilden die Kybernetik, die Forschungen des<br />
Verhaltenskybernetikers K.U. Smith, die von F.J. Varela und H. Maturana gepräg-<br />
te Richtung der Neurobiologie und aktuelle Forschungen aus verwandten Gebie-<br />
ten. (Vgl. Maturana/Varela 1990)<br />
29
Demenz<br />
Die zweite Grundlage der K<strong>in</strong>ästhetik ist die direkte Wahrnehmung und Erfah-<br />
rung der eigenen Bewegung. Dementsprechend beschreibt das Konzeptsystem<br />
verschiedene Blickw<strong>in</strong>kel, durch die unterschiedliche Bewegungsaspekte von<br />
menschlichen Aktivitäten im eigenen Körper systematisch erfahren, beobachtet<br />
und analysiert werden können. Man kann diese Art von Wissenserwerb mit F.J.<br />
Varela e<strong>in</strong>e „Erste Person Methode“ (First Person Method) oder e<strong>in</strong>e „Innensicht,<br />
Innenperspektive“ (View from With<strong>in</strong>) nennen. Die Begriffe bezeichnen den Zu-<br />
gang zu Wissen durch Erfahrung an der eigenen Person - gegenüber e<strong>in</strong>em re<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>tellektuellen „objektiven“ Wissenserwerb.<br />
Seit über 20 Jahren tauschen KursteilnehmerInnen und K<strong>in</strong>ästhetik-Tra<strong>in</strong>erInnen<br />
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus. Dieser Feldforschungsprozess, der mit<br />
den Begründern, F. Hatch und L. Maietta, begann und sich bis heute fortsetzt, hat<br />
die e<strong>in</strong>zelnen Inhalte und Differenzierungen des Konzeptsystems ergeben. (Vgl.<br />
Hatch/Maietta 2003)<br />
3.4.2 Zusammenfassung<br />
Wie <strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>ischer H<strong>in</strong>sicht, so gibt es auch im Bereich der Pflege bzw. der<br />
Betreuung demenziell erkrankter Menschen neue Erkenntnisse. Durch die Über-<br />
nahme verschiedener Betreuungsansätze aus dem anglo-amerikanischen bzw. nie-<br />
derländischen Raum erhielt die Demenzbetreuung e<strong>in</strong>e Fachlichkeit, die ihr bis-<br />
lang fehlte. Die Frage nach dem richtigen Handeln im beruflichen Alltag <strong>in</strong> ganz<br />
konkreten zwischenmenschlichen Situationen <strong>bei</strong>nhaltet immer auch e<strong>in</strong>e morali-<br />
sche Dimension. Dieser „Haltung“ muss <strong>bei</strong> der Entwicklung e<strong>in</strong>es Konzeptes zur<br />
Betreuung demenzkranker Menschen große Aufmerksamkeit geschenkt werden.<br />
Grundvoraussetzung s<strong>in</strong>d Fachkompetenz (fundiertes Wissen) sowie soziale und<br />
persönliche Kompetenz.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Betreuungsmodelle gehen von unterschiedlichen Ansätzen aus.<br />
Die Validation nach Naomi Feil kann als Kommunikationsmethode verstanden<br />
werden. In ihren handlungsleitenden Anforderungen und Wertvorstellungen ver-<br />
langt Feil von den Validationsanwendern, den demenziell erkrankten Menschen<br />
als e<strong>in</strong>zigartiges Individuum zu sehen, das auf der Suche nach se<strong>in</strong>em Gleichge-<br />
30
Demenz<br />
wicht ist und da<strong>bei</strong> Gefühle ausdrückt. Empathie ist laut Feil der Schlüssel, um<br />
den Zugang zu diesen Gefühlen zu f<strong>in</strong>den. Handeln im S<strong>in</strong>ne der Validation ist für<br />
Feil dann gut und richtig, wenn die von ihr vorgegebenen Grundsätze e<strong>in</strong>gehalten,<br />
die Techniken richtig umgesetzt und die beschriebenen Fehler vermieden werden.<br />
Bernd Meyer setzt sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Studie mit den philosophischen Ansätzen <strong>in</strong> der<br />
Begleitung von Menschen mit Demenz ause<strong>in</strong>ander. Er untersucht die wissen-<br />
schaftliche und <strong>in</strong>haltliche Haltbarkeit und die praktische Tauglichkeit von pflege-<br />
theoretischen Ansätzen. An der Validation nach Feil kritisiert er den absoluten<br />
Anspruch Feils auf Unfehlbarkeit - und dies, obwohl es ke<strong>in</strong>e wissenschaftlich<br />
fundierten Beweise für die Wirksamkeit der Validation nach Feil gibt. (Vgl. Mey-<br />
er 2008:70-77)<br />
Tom Kitwood´s person-zentrierter Ansatz basiert auf der Philosophie, den Men-<br />
schen mit Demenz so zu behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden<br />
möchte. Für Kitwood steht die Würde des Menschen über allem und diese gilt es<br />
wiederherzustellen und zu erhalten. Im Unterschied zu Feil fordert Kitwood diese<br />
soziale Kompetenz auch von den Organisationen e<strong>in</strong>.<br />
Cora van der Kooij erweitert die erlebensorientierte Pflege um die Mäeutik. E<strong>in</strong>e<br />
Methode, <strong>bei</strong> der durch geschicktes Fragen unbewusst richtige Antworten und<br />
E<strong>in</strong>sichten gefunden bzw. geweckt werden können. Sie geht davon aus, dass die<br />
Betreuenden e<strong>in</strong>en reichen Erfahrungsschatz mitbr<strong>in</strong>gen und <strong>in</strong>tuitiv richtig han-<br />
deln. Sie zeigt, wie Pflegende adm<strong>in</strong>istrativ und organisatorisch unterstützt wer-<br />
den müssen, um das mäeutische Pflegemodell umsetzen zu können.<br />
Alle hier beschriebenen Modelle zielen darauf ab, die Lebensqualität der an De-<br />
menz erkrankten Menschen zu verbessern und verlernte oder vergessene Fähigkei-<br />
ten wiedererlangen zu lassen (K<strong>in</strong>ästhetik und Basale Stimulation).<br />
Mit der entsprechenden Schulung wird den Betreuenden das notwendige Werk-<br />
zeug geboten, um ihre Ar<strong>bei</strong>t mit dem nötigen Selbstbewusstse<strong>in</strong> und der erwarte-<br />
ten Professionalität ausüben zu können.<br />
Wie e<strong>in</strong>gangs erwähnt, bleibt es der jeweiligen Institution überlassen, sich für e<strong>in</strong><br />
bestimmtes Betreuungskonzept zu entscheiden, oder, wie von Stephan Kostrzewa<br />
beschrieben, eigene Verhaltensmaximen im Umgang mit Demenzkranken zu<br />
erstellen.<br />
31
Schmerz<br />
E<strong>in</strong>hellig geht jedoch aus der Literatur hervor, dass durch e<strong>in</strong> strukturgebendes<br />
Pflegemodell positive Effekte nachweisbar s<strong>in</strong>d. Durch die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es sol-<br />
chen kommt es zu vermehrter Transparenz des Vorgehens. Dies führt zu e<strong>in</strong>er<br />
besseren Qualität der Demenzversorgung und <strong>in</strong> Folge zu e<strong>in</strong>er höheren Mitar<strong>bei</strong>-<br />
terzufriedenheit. E<strong>in</strong>e Grundvoraussetzung für e<strong>in</strong>e gel<strong>in</strong>gende Implementierung<br />
ist die Motivation der Mitar<strong>bei</strong>terInnen, e<strong>in</strong>e gute, überschaubare Projektplanung<br />
und die Begleitung durch e<strong>in</strong>e kompetente Fachperson.<br />
4 Schmerz<br />
„Pa<strong>in</strong> is an unpleasant sensory and emotional experience with actual or potential<br />
tissue damage or described <strong>in</strong> terms of such damage.“ So lautet die Schmerzdefi-<br />
nition der IASP (International Association for the Study of Pa<strong>in</strong>).<br />
Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes übersetzt die Def<strong>in</strong>i-<br />
tion des Schmerzes folgendermaßen: Schmerz ist e<strong>in</strong> unangenehmes S<strong>in</strong>nes- oder<br />
Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung e<strong>in</strong>her-<br />
geht oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre e<strong>in</strong>e solche<br />
Gewebeschädigung die Ursache. (Vgl. IASP http)<br />
Da diese Def<strong>in</strong>ition zwar <strong>in</strong>ternational gültig, doch relativ abstrakt ist, hat sich die<br />
Def<strong>in</strong>ition des Schmerzes nach McCaffery im Pflegealltag eher durchgesetzt:<br />
„Schmerzen s<strong>in</strong>d das, was der Betroffene über Schmerzen mitteilt, sie s<strong>in</strong>d vor-<br />
handen, wenn der Betroffene sagt, dass er Schmerzen hat.“ (dt. Übersetzung nach<br />
McCaffery/Pasero1997:17) Schmerz ist also e<strong>in</strong> subjektives Phänomen und nur<br />
die Betroffenen selbst können zuverlässige Aussagen darüber machen bzw. kön-<br />
nen die Intensität des Schmerzes beurteilen.<br />
32
4.1 Epidemiologie des Schmerzes im Alter<br />
Schmerz<br />
Die hier genannten Zahlen zu Prävalenz und Inzidenz der Schmerzen im Alter<br />
sollen die Wichtigkeit dieser Thematik aufzeigen. Laut Kamel ergeben Befunde,<br />
dass 15-30 Prozent aller Pflegeheimbewohner über Schmerzen klagen. (Vgl. Ka-<br />
mel et al. 2001:450) In e<strong>in</strong>er Stichprobe von kognitiv bee<strong>in</strong>trächtigten älteren<br />
Menschen f<strong>in</strong>den Krulewitsch et al. <strong>bei</strong> 87,5 Prozent leichte Schmerzen. (Vgl.<br />
Kruwelitsch et al 2000:1607) Leonhardt & Laekeman sehen <strong>in</strong> ihrer Übersichtsar-<br />
<strong>bei</strong>t e<strong>in</strong>e Prävalenz von 50-80 Prozent. (Vgl. Leonhardt/Laekeman 2010)<br />
Die Österreichische Schmerzgesellschaft gibt an, dass 75 Prozent der Über-75-<br />
Jährigen Schmerzen haben und laut der Internationalen Schmerzforschung (IASP)<br />
liegt der Anteil der PflegeheimbewohnerInnen mit ständigem Schmerz <strong>bei</strong> 80<br />
Prozent.<br />
Die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu Schmerzen im Alter ist zwar auf-<br />
grund von Unterschieden <strong>in</strong> den Stichproben, <strong>bei</strong> der Def<strong>in</strong>ition von Schmerz oder<br />
der Schmerzdauer kaum gegeben, dennoch weisen alle Ergebnisse darauf h<strong>in</strong>,<br />
dass Schmerz im Alter e<strong>in</strong> weitgreifendes, aktuelles Problem ist. (Vgl. Kamel et al<br />
2001:450)<br />
4.2 Schmerz im Alter<br />
Ältere bzw. alte Menschen können weder aufgrund ihres psychischen noch ihres<br />
körperlichen Bef<strong>in</strong>dens als homogene Gruppe angesehen werden. Oft wird aber<br />
e<strong>in</strong>e Unterteilung h<strong>in</strong>sichtlich des Lebensalters vorgenommen. So wird von den<br />
„jungen Alten (60+), den Alten (75+), den Hochbetagten (90+) und den Langlebi-<br />
gen (100+)“ gesprochen. Nicht alle Schmerzerkrankungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> gleicher Weise<br />
vom altersbed<strong>in</strong>gten Anstieg des Schweregrades betroffen. (Vgl. Basler 2011:209-<br />
213)<br />
Jones & Mcfarlane sprechen von vier verschiedenen Verlaufsformen: Zur ersten<br />
Gruppe gehören Schmerzen im Bereich des unteren Rückens, der Schultern und<br />
der Arme. Diese Beschwerden nehmen laut Autoren bis zur sechsten Dekade an<br />
Häufigkeit zu und werden nach Austritt aus der Erwerbsfähigkeit wieder seltener.<br />
33
Schmerz<br />
Zur zweiten Gruppe gehören Schmerzen im Bereich von Hüfte, Knie und Fuß, die<br />
mit E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> e<strong>in</strong> höheres Lebensalter deutlich zunehmen und wahrsche<strong>in</strong>lich auf<br />
degenerative Veränderungen des Skelettsystems zurückzuführen s<strong>in</strong>d.<br />
Die dritte Gruppe wird von den Autoren als altersunabhängig bezeichnet. Sie be-<br />
zieht sich auf Kopf- und Brustschmerzen und Schmerzen im oberen Rücken. Zur<br />
vierten Gruppe zählen laut Jones & Mcfarlane der Bauchschmerz und der Ge-<br />
sichtsschmerz, Erkrankungen, die mit dem Alter <strong>in</strong>sgesamt seltener auftreten.<br />
(Vgl. Jones/Mcfarlane 2005:3-22). Diese E<strong>in</strong>teilung deckt sich im Wesentlichen<br />
mit den Erfahrungswerten von Roland Kunz. Auch er sieht <strong>in</strong> der degenerativen<br />
Veränderung der Gelenke und der Wirbelsäule die Hauptursache für Schmerz im<br />
Alter. Gefolgt von Osteoporose, neuropathischen Schmerzen und Krebsschmer-<br />
zen. (Vgl. Kunz 2002). Nickel & Raspe f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> ihrer Übersichtsar<strong>bei</strong>t ebenfalls<br />
e<strong>in</strong>e deutliche Zunahme muskuloskelettaler Schmerzen im Alter. (Vgl. Ni-<br />
ckel/Raspe 2001:897-906)<br />
Im Alter ist von e<strong>in</strong>em „Underreport<strong>in</strong>g“ des Schmerzes auszugehen. Die Ursache<br />
hierfür sieht Basler <strong>in</strong> der von TherapeutInnen und Betroffenen geteilten Über-<br />
zeugung, Schmerz gehöre zum Alter. Folglich sollte der Arzt von sich aus die<br />
Frage nach Schmerz stellen und die Initiative nicht den geriatrischen PatientInnen<br />
überlassen. (Vgl. Basler 2004:201)<br />
Ferrell und Herr & Garand sehen ebenfalls <strong>in</strong> der irrtümlichen Me<strong>in</strong>ung, Schmerz<br />
sei e<strong>in</strong> normales Begleitsymptom des Alterungsprozesses, den Grund für die Un-<br />
terversorgung älterer Menschen mit Schmerzmedikamenten. (Vgl. Ferrell et al.<br />
1990:409-414 und Herr/Garand 2001:457-478) Zum selben Ergebnis kommen<br />
auch Yong et al. Mit ihrer Studie zeigen sie auf, dass ältere Menschen länger zö-<br />
gern, um Schmerzempf<strong>in</strong>dung tatsächlich als solche zu benennen. Die Autoren<br />
leiten daraus ab, wie wichtig e<strong>in</strong>e fundierte Schmerzanamnese ist, um zu verh<strong>in</strong>-<br />
dern, dass e<strong>in</strong> Schmerz unbehandelt bleibt. (Vgl. Yong et al. 2003)<br />
Laut Schmidl leidet weltweit e<strong>in</strong> Großteil der hochbetagten Menschen <strong>in</strong> Pflege-<br />
heimen an chronischen Schmerzen, nur etwa die Hälfte von ihnen wird adäquat<br />
versorgt. (Vgl. Schmidl 2004:25) Dr. Dagmar Dräger und Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hold<br />
Kreutz (Charite Berl<strong>in</strong>) starteten im Juni 2011 e<strong>in</strong>e Interventionsstudie zur Ent-<br />
wicklung und Implementierung e<strong>in</strong>er Handlungsempfehlung für e<strong>in</strong> angemessenes<br />
34
Schmerz<br />
Schmerzmanagement <strong>bei</strong> älteren Menschen <strong>in</strong> Pflegeheimen. Grund dafür war die<br />
„Unterrepräsentierung“ von Studien über Schmerzgeschehen <strong>in</strong> Pflegeheimen im<br />
deutschsprachigen Raum. Ziel dieses Projekts soll die Implementierung und Um-<br />
setzung der <strong>in</strong>terprofessionellen Handlungsempfehlung se<strong>in</strong>. Die Forschergruppe<br />
erwartet sich davon e<strong>in</strong>e Reduzierung der Schmerz<strong>in</strong>tensität von Pflegeheimbe-<br />
wohnerInnen und deren Unterstützung <strong>bei</strong> der Schmerzverar<strong>bei</strong>tung. Weiters sol-<br />
len die Selbstbestimmung gefördert und der Versorgungsprozess optimiert wer-<br />
den. Diese Studie bef<strong>in</strong>det sich derzeit im zweiten Projektjahr. Mit Ergebnissen<br />
kann frühestens 2013 gerechnet werden (Auskunft der Projektleitung nach Anfra-<br />
ge am 31. Jänner 2012). (Vgl. Charite Forschungsdatenbank 2011)<br />
Der geriatrische Patient hat dieselbe Schmerzverar<strong>bei</strong>tung wie e<strong>in</strong> junger Mensch.<br />
Zu dieser Ansicht gelangen Likar und Bernatzky. Ihrer Me<strong>in</strong>ung nach entwickeln<br />
die chronischen SchmerzpatientInnen oft nur bestimmte Strategien im Umgang<br />
mit Schmerz. Häufig s<strong>in</strong>d Schmerzangaben ungenau oder stark abgeschwächt.<br />
Erfahrene Pflegepersonen oder Verwandte haben hier <strong>in</strong> der Beobachtung e<strong>in</strong>e<br />
besonders wichtige Aufgabe. (Vgl. Likar/Bernatzky 2004:33)<br />
Kontrovers dazu stehen Chapman & Syrjala, die <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung der<br />
Schmerz<strong>in</strong>tensität durch Außenstehende e<strong>in</strong> gewisses Gefahrenpotenzial sehen, da<br />
Schmerz von Außenstehenden nicht direkt beobachtet, sondern nur <strong>in</strong>direkt über<br />
das Verhalten erschlossen werden kann. (Vgl. Chapman/Syrjala, 2001:310)<br />
Studien, <strong>in</strong> denen untersucht wurde, ob sich die Schmerzempf<strong>in</strong>dung mit steigen-<br />
dem Lebensalter verändert, bestimmen die Schmerzschwelle, das Diskrim<strong>in</strong>ati-<br />
onsvermögen (das Vermögen, e<strong>in</strong>zelne Schmerz<strong>in</strong>tensitäten zu unterscheiden) und<br />
die Schmerztoleranz. Übere<strong>in</strong>stimmend zeigten die Untersuchungen, dass die<br />
Diskrim<strong>in</strong>ationsfähigkeit für Schmerzreize <strong>bei</strong> älteren Menschen ger<strong>in</strong>ger ist als<br />
<strong>bei</strong> jüngeren und dass die Schmerztoleranz mit steigendem Lebensalter abnimmt.<br />
(Vgl. Basler 2004:194) Die Schlussfolgerungen, die aus der Datenlage gezogen<br />
wurden, waren laut Autor sehr widersprüchlich. Als gesichert gilt h<strong>in</strong>gegen das<br />
Ergebnis e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>geren Schmerztoleranz im Alter.<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Schmerztherapie ist die<br />
Compliance der Patienten. Um diese zu fördern, empfiehlt Basler e<strong>in</strong>e umfassende<br />
Information sowohl der betroffenen SchmerzpatientInnen wie auch der Pflegeper-<br />
35
Schmerz<br />
sonen über das Therapieschema sowie über die für die Erfolgskontrolle benötigte<br />
Schmerzmessung. (Vgl. Basler 2004:201)<br />
E<strong>in</strong>e weitere Ursache für die schmerztherapeutische Unterversorgung von älteren<br />
SchmerzpatientInnen könnte die Fehl<strong>in</strong>terpretation der Befunde zum Schmerz-<br />
empf<strong>in</strong>den der Betroffenen durch die Behandler se<strong>in</strong>. Auch e<strong>in</strong>e unzureichende<br />
Schmerzdiagnostik oder e<strong>in</strong>e Fehle<strong>in</strong>schätzung des Therapieerfolges wird disku-<br />
tiert. (Vgl. Basler 2004:193)<br />
E<strong>in</strong> Ziel <strong>in</strong> der Schmerztherapie sollte se<strong>in</strong>, die mögliche Eigenständigkeit des<br />
Patienten zu wahren, denn damit ist auch e<strong>in</strong>e entsprechende Lebensqualität ver-<br />
bunden. Je komplizierter die Behandlung ist, desto größer ist die Wahrsche<strong>in</strong>lich-<br />
keit, dass Complianceprobleme auftreten können. Daher ist es wichtig die Dosie-<br />
rungsschemata möglichst e<strong>in</strong>fach zu halten. E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>-bis zweimal tägliche E<strong>in</strong>-<br />
nahme von e<strong>in</strong>em Morph<strong>in</strong>-Retardpräparat wird gut akzeptiert. Bei e<strong>in</strong>er Anwen-<br />
dung des relativ neuen Buprenorph<strong>in</strong>pflasters oder des seit e<strong>in</strong>igen Jahren erhältli-<br />
chen Fentanylpflasters muss nur alle drei Tage an die neue Applikation gedacht<br />
werden. (Vgl. Likar/Bernatzky 2004:33-34)<br />
4.3 Schmerz und Demenz<br />
Kaum jemand ist den dementen <strong>Bewohnern</strong> <strong>in</strong> Pflegeheimen so nah wie die Pfle-<br />
gepersonen. Durch den täglichen Umgang mite<strong>in</strong>ander entwickelt sich e<strong>in</strong>e Ver-<br />
trautheit, die es den Pflegenden ermöglicht, Änderungen im Verhalten relativ<br />
rasch zu erkennen.<br />
Schmidl plädiert dafür, solche Verhaltensänderungen nicht sofort zu behandeln,<br />
sondern erst an mögliche Ursachen zu denken und diese dann zu bestätigen oder<br />
auszuschließen. (Vgl. Schmidl 2004:28) Auch sieht sie <strong>in</strong> der genauen Beobach-<br />
tung und Dokumentation der Verhaltensauffälligkeiten die zuverlässigste Art der<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>.<br />
Für Osterbr<strong>in</strong>k liegt genau hier die Schwierigkeit. Se<strong>in</strong>er Me<strong>in</strong>ung nach werden<br />
dokumentierte Beobachtungen nur mangelhaft an HausärztInnen weitergeleitet,<br />
obwohl nur e<strong>in</strong>e differenzierte und aussagefähige Dokumentation e<strong>in</strong>e gel<strong>in</strong>gende<br />
Schmerztherapie ermöglicht. (Vgl. Osterbr<strong>in</strong>k 2003:08-13) Die Ärzteschaft kann<br />
36
Schmerz<br />
erst e<strong>in</strong>greifen, wenn das Problem erkannt wurde und die Patienten bereit s<strong>in</strong>d, die<br />
gebotene Hilfe anzunehmen. Diese selbstverständlichen Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e<br />
gel<strong>in</strong>gende Schmerztherapie gelten laut Schmidl für jeden Menschen. Die Prob-<br />
lematik entsteht da, wo die Kommunikation e<strong>in</strong>geschränkt bzw. nicht mehr mög-<br />
lich ist. In der Begegnung mit dementen Menschen verlieren diese vertrauten<br />
Spielregeln ihre Gültigkeit. (Vgl. Schmidl 2004:25)<br />
Auch zeigen <strong>in</strong>ternationale Studien, dass dementen Menschen generell weniger<br />
Analgetika verschrieben werden als nicht-dementen. (Vgl. Berna<strong>bei</strong> 1998) Und,<br />
dass nicht-demente alte Menschen nach e<strong>in</strong>er Schenkelhalsfraktur dreimal so viel<br />
Morphiumäquivalent bekommen wie demente Menschen. (Vgl. Morisson 2000)<br />
Für die Schmerztherapie dementer Menschen haben Befunde der Studiengruppe<br />
um Benedetti große Bedeutung gewonnen. Die Wirkung e<strong>in</strong>es Analgetikums be-<br />
ruht neben dem Verum auch auf dem Placeboeffekt. Die Autoren fanden <strong>bei</strong> der<br />
analgetischen Behandlung von Alzheimer-PatientInnen e<strong>in</strong>e verr<strong>in</strong>gerte Placebo-<br />
komponente. Hierdurch wird die Wirksamkeit des Analgetikums reduziert, so-<br />
dass, um e<strong>in</strong>e Schmerzl<strong>in</strong>derung zu erreichen, die Dosis des Präparates erhöht<br />
werden müsste. Aufgrund dieser Befunde ist die analgetische Unterversorgung<br />
von dementen Personen <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Weise zu rechtfertigen. (Vgl. Benedetti et al.<br />
2006:133-144)<br />
Bisher liegen ausschließlich experimentelle Studien zum Schmerzerleben <strong>bei</strong> Alz-<br />
heimer-Patienten vor (Vgl. Kunz 2007:01). Die bisherigen Befunde weisen darauf<br />
h<strong>in</strong>, dass es im Rahmen der Alzheimer-Erkrankung zu e<strong>in</strong>er Abschwächung des<br />
Schmerzaffekts kommt. Das würde bedeuten, dass Alzheimer-Patienten im Ver-<br />
gleich zu kognitiv gesunden Menschen <strong>in</strong> derselben Altersklasse weniger<br />
Schmerzen haben. Kritisch ist da<strong>bei</strong> jedoch anzumerken, dass die Befunde primär<br />
auf subjektiven Schmerzäußerungen der Alzheimer Patienten beruhen und die<br />
Autoren auf die alzheimerbed<strong>in</strong>gten E<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong> der Kommunikationsfähigkeit<br />
nicht näher e<strong>in</strong>gehen. Ebenso ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere<br />
Demenzerkrankungen unklar. (Vgl. Kunz 2007:02) Es ist denkbar, dass sich <strong>bei</strong><br />
den an Demenz erkrankten Menschen über die normale Alterung h<strong>in</strong>aus Verände-<br />
rungen <strong>in</strong> der Schmerzverar<strong>bei</strong>tung e<strong>in</strong>stellen, die zu e<strong>in</strong>er herabgesetzten<br />
Schmerzwahrnehmung führen. Ebenso könnte aber auch die mit der Demenz e<strong>in</strong>-<br />
37
Schmerz<br />
hergehende reduzierte bis nicht mehr vorhandene Kommunikationsfähigkeit zur<br />
Folge haben, dass das Erleben von Schmerz (<strong>bei</strong> gleicher Intensität) nicht mehr<br />
mitgeteilt werden kann. Um diese für die Schmerztherapie wesentlichen Alterna-<br />
tiven zu klären, wurde 2007 <strong>in</strong> Marburg e<strong>in</strong> Forschungsprojekt mit dem Titel<br />
„Schmerzerleben <strong>bei</strong> alten Menschen mit und ohne kognitive Bee<strong>in</strong>trächtigung“<br />
durchgeführt. (Vgl. Kunz 2007) Ziel der Untersuchung war es, die Veränderung<br />
des Schmerzerlebens und auch der Schmerzkommunikation <strong>bei</strong> PatientInnen mit<br />
demenzieller Erkrankung durch den E<strong>in</strong>satz möglichst multidimensionaler Me-<br />
thoden der <strong>Schmerzerfassung</strong> zu erforschen. Die Hauptfragestellung bezog sich<br />
darauf, ob Demenzerkrankungen zu Veränderungen im Schmerzerleben und <strong>in</strong> der<br />
Schmerzkommunikation führen. Gleichzeitig wurde untersucht, ob sich diese<br />
Veränderungen bereits <strong>bei</strong> Personen mit leichter kognitiver Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
nachweisen lassen und <strong>in</strong>wieweit sich unterschiedliche Demenzformen auf das<br />
Schmerzerleben unterschiedlich auswirken. Auch wurde versucht zu klären, ob<br />
die Demenz altersassoziierte Veränderungen im Schmerz verstärkt oder ob die<br />
Demenz e<strong>in</strong>en qualitativ völlig anderen E<strong>in</strong>fluss auf den Schmerz nimmt als das<br />
Alter.<br />
Die Ergebnisse des Forscherteams stehen im Widerspruch zu bisherigen Annah-<br />
men. Auf Grund der erheblichen demenzassoziierten E<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong> der Fähigkeit,<br />
subjektive Schmerzangaben zu machen, ersche<strong>in</strong>en diese ke<strong>in</strong> geeigneter Indika-<br />
tor des Schmerzerlebens <strong>bei</strong> Demenzpatienten zu se<strong>in</strong>. Es wird vom Forschungs-<br />
team als wahrsche<strong>in</strong>lich angenommen, dass demenzbed<strong>in</strong>gte Defizite im Ar<strong>bei</strong>ts-<br />
gedächtnis (Speicherung der Schmerzempf<strong>in</strong>dung über mehrere Sekunden und<br />
Vergleich dieser Empf<strong>in</strong>dung mit Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis) der ver-<br />
m<strong>in</strong>derten Fähigkeit zur subjektiven Schmerzbewertung zugrunde liegen. E<strong>in</strong>e<br />
gesteigerte mimische Schmerzreaktion und die verm<strong>in</strong>derte Schwelle des RIII-<br />
Reflexes (elektrisch hervorgerufener Schmerzreflex) könnten als erhöhtes<br />
Schmerzerleben <strong>in</strong>terpretiert werden. Die Befunde s<strong>in</strong>d hier völlig <strong>in</strong>novativ, da<br />
bisherige Studien (basierend auf subjektiven Schmerzangaben) darauf h<strong>in</strong>wiesen,<br />
dass die Demenz eher zu e<strong>in</strong>er Dämpfung im Schmerzaffekt führt. Das For-<br />
schungsteam gibt als mögliche Ursachen für e<strong>in</strong> erhöhtes Schmerzerleben ze-<br />
rebrovaskuläre und atrophische Hirnprozesse <strong>in</strong> Strukturen an, die maßgeblich an<br />
38
Schmerz<br />
e<strong>in</strong>er endogenen schmerzhaften Nervenschädigung beteiligt s<strong>in</strong>d. (Vgl. Kunz<br />
2007:144-147)<br />
4.3.1 Zusammenfassung<br />
Trotz der hohen Anzahl schmerzrelevanter Erkrankungen im Alter wird die<br />
schmerztherapeutische Versorgung von den Experten als wenig befriedigend be-<br />
zeichnet. Die Autoren berichten im Gegenteil von e<strong>in</strong>er deutlichen Unterversor-<br />
gung älterer SchmerzpatientInnen. Als besonders gravierend wird dieser Mangel<br />
<strong>bei</strong> Menschen mit kognitiven Bee<strong>in</strong>trächtigungen gesehen.<br />
E<strong>in</strong> Teil der ForscherInnen, die sich mittels experimenteller Schmerzmessung<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über das Schmerzerleben älterer Menschen machten, kam zu dem<br />
Befund, dass ältere Personen e<strong>in</strong>e höhere Schmerzschwelle haben als jüngere. Die<br />
zunächst angenommene Erklärung, dass neurodegenerative Erkrankungen zu e<strong>in</strong>er<br />
Abschwächung des Schmerzerlebens führen, konnte von Lautenbacher und Kunz<br />
nicht bestätigt werden. Sie konnten <strong>in</strong> ihrer Studie aufzeigen, dass Menschen mit<br />
Demenz im Vergleich zu kognitiv gesunden Personen <strong>in</strong> Schmerzsituationen mi-<br />
misch stärker reagieren. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass demenzkranke<br />
Menschen sogar verstärkt auf nozizeptive Reize (Hitze- oder Kältereiz, Druck<br />
oder elektrische Reize) reagieren.<br />
Abzuwarten bleibt, wie diese Erkenntnisse <strong>in</strong> die tägliche Praxis implementiert<br />
werden. Dies ist umso spannender, da die Aussagekraft der experimentellen<br />
Schmerzmessung von den Experten immer mehr angezweifelt wird. Sie beruht<br />
primär auf subjektiven Schmerzäußerungen der Alzheimer-PatientInnen und setzt<br />
so <strong>in</strong>tellektuelle Fähigkeiten voraus, die von den demenzkranken Menschen nur<br />
bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>gebracht werden können. Somit könnte der experimentellen Schmerz-<br />
messung unterstellt werden, nicht das Schmerzerleben, sondern die <strong>in</strong>tellektuellen<br />
Fähigkeiten der Betroffenen zu messen.<br />
39
5 <strong>Schmerzerfassung</strong><br />
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
Die Def<strong>in</strong>ition des Schmerzes nach Mc. Caffery ist für die Pflege von großer Be-<br />
deutung, gibt sie doch den entscheidenden H<strong>in</strong>weis, dass Schmerzen immer sub-<br />
jektiv wahrgenommen werden und die Selbste<strong>in</strong>schätzung des Schmerzes als Ba-<br />
sis e<strong>in</strong>es professionellen Schmerzmanagements zu sehen ist. (Vgl. McCaffe-<br />
ry/Pasero1999)<br />
Die Selbste<strong>in</strong>schätzung wird <strong>in</strong> der Literatur als Goldstandard bezeichnet.<br />
(Vgl.Turk et al. 1999:1784-1788 und. Lukas 2008) Ihr sollte daher auch <strong>in</strong> der<br />
Betreuung dementer Menschen so lange wie möglich der Vorrang gegeben wer-<br />
den - oder anders ausgedrückt: Die Selbstauskunft <strong>bei</strong> h<strong>in</strong>reichend gut erhaltenen<br />
kommunikativen Fähigkeiten steht immer über allen Verfahren der Fremdaus-<br />
kunft und Verhaltensbeobachtung. (Vgl. Kaspar 2009:34)<br />
Die Schwierigkeiten beg<strong>in</strong>nen da, wo diese Selbstauskunft nicht mehr möglich ist.<br />
Das Wissen der Pflegenden im H<strong>in</strong>blick auf Schmerzassessment ist sehr oft ge-<br />
r<strong>in</strong>g. Sie neigen dazu, sich auf ihre eigenen Beobachtungen zu verlassen, und <strong>in</strong>-<br />
terpretieren diese anhand ihrer beruflichen oder persönlichen Erfahrung. Dies<br />
führt <strong>in</strong> der Folge mitunter zu Fehle<strong>in</strong>schätzungen.<br />
Die Anwendung e<strong>in</strong>es formellen Schmerz-Assessment-Instrumentes kann die E<strong>in</strong>-<br />
schätzung von Schmerz wesentlich erleichtern und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliche, vergleichbare<br />
Bahnen lenken. Die Schmerzmessung im pflegerischen Kontext verfolgt ver-<br />
schiedene Ziele. So sollten z. B. e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Schmerzüberwachung, das<br />
Planen von Maßnahmen, e<strong>in</strong>e Optimierung des Pflegehandelns und die Überprü-<br />
fung von Behandlungserfolgen möglich se<strong>in</strong>.<br />
Von den Mess<strong>in</strong>strumenten wird erwartet, dass valide Resultate dokumentiert<br />
werden können. Es gilt sicherzustellen, dass auch wirklich Schmerzen gemessen<br />
werden (Validität), unabhängige Personen sollten zum selben Ergebnis kommen<br />
(Reliabilität) und Veränderungen sollten ebenfalls erfasst werden (Responsive-<br />
ness). (Vgl. Klaschik 2006:396-397)<br />
Im folgenden Kapitel werden die bekanntesten Testverfahren vorgestellt Unter-<br />
schieden werden Schmerze<strong>in</strong>schätzungen anhand von verbal gestützten Testver-<br />
fahren und Schmerzassessments per Fremdbeurteilung.<br />
40
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
Bei Letzteren wird genauer auf die PAINAD/BESD und die ECPA/BISAD e<strong>in</strong>ge-<br />
gangen. Von diesen Assessments liegen deutsche Übersetzungen vor und es gibt<br />
für <strong>bei</strong>de Beobachtungsbögen Expertenme<strong>in</strong>ungen bzw. Aussagen zur Validität<br />
der Schmerze<strong>in</strong>schätzung. Der ECPA-<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen wurde <strong>in</strong> dieser<br />
Ar<strong>bei</strong>t auch für den empirischen Teil gewählt.<br />
5.1 Verbal gestützte Verfahren<br />
Dazu zählen Testverfahren, <strong>bei</strong> denen die Betroffenen selbst Auskunft über ihr<br />
Schmerzerleben geben können. Gemessen werden die Schmerzschwelle (nicht<br />
schmerzhaft – schmerzhaft) und die Toleranzschwelle (erträglich – nicht mehr zu<br />
ertragen), wo<strong>bei</strong> diese (unterscheidenden) Aufgaben ger<strong>in</strong>gere kognitive Anforde-<br />
rungen stellen als die verbalen Rat<strong>in</strong>gskalen mit mehreren Intensitätskategorien<br />
oder die abstrakteren Verfahren wie die visuelle Analogskala oder die Faces Pa<strong>in</strong><br />
Scale. (Vgl. Kaspar 2009:33)<br />
Voraussetzung ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>taktes Sprachverständnis; da<strong>bei</strong> kommt <strong>bei</strong> e<strong>in</strong>igen Ver-<br />
fahren erschwerend h<strong>in</strong>zu, dass schriftlich Anweisungen gegeben oder vorge-<br />
druckte Antworten gereiht werden müssen. Dies setzt auch e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Lesefähigkeit und bildnerisches Denken von Seiten der Betroffenen voraus.<br />
Unterschieden werden experimentelle Verfahren und Rat<strong>in</strong>gskalen.<br />
5.1.1 Experimentelle Testverfahren<br />
Bei Experimentellen Verfahren werden mit kontrollierter Induktion von Schmerz-<br />
reizen unterschiedlicher Intensität, Ausbreitung und Dauer die Schmerz- und To-<br />
leranzschwelle als <strong>in</strong>dividuelle Schmerzmarker per Selbstauskunft erfasst.<br />
Die häufigsten Verfahren der experimentellen Schmerz<strong>in</strong>dikation s<strong>in</strong>d da<strong>bei</strong> die<br />
Applizierung elektrischer, thermischer und mechanischer Reize. Seltener werden<br />
Schmerzen durch e<strong>in</strong>e künstlich her<strong>bei</strong>geführte Ischämie e<strong>in</strong>es Körperteils <strong>in</strong>du-<br />
ziert (Vgl. Kunz 2006). Zu h<strong>in</strong>terfragen ist hier die Bedeutung der Schmerz- und<br />
Toleranzschwellenmessung für das kl<strong>in</strong>ische Schmerzassessment. Kunz merkt<br />
41
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
hier an, dass die Bestimmung <strong>bei</strong>der qualitativer Übergänge e<strong>in</strong>er besonderen<br />
Aufmerksamkeit h<strong>in</strong>sichtlich der Beobachtung des potenziellen Schmerzreizes<br />
bedarf. Dadurch könnte den Betroffenen e<strong>in</strong>e Sensibilisierung oder e<strong>in</strong>e gewisse<br />
Erwartungshaltung unterstellt werden. Wo<strong>bei</strong> der Toleranzschwelle als Marker<br />
des Schmerzerlebens e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die medikamentöse<br />
Schmerztherapie zukommt. (Vgl. Kunz 2006) Generell sollte berücksichtigt wer-<br />
den, dass das experimentelle Sett<strong>in</strong>g als außergewöhnliche Situation zu verfälsch-<br />
ten Ergebnissen führen kann.<br />
5.1.2 Rat<strong>in</strong>gskalen<br />
Bei Rat<strong>in</strong>gskalen wird das eigene Schmerzerleben mit verbal beschriebenen Kate-<br />
gorienlabels <strong>in</strong> Beziehung gesetzt. (Vgl. Kaspar 2009:34)<br />
Die Kategorialskalen unterteilen das gedachte Merkmalkont<strong>in</strong>uum empfundenen<br />
Schmerzes <strong>in</strong> verschiedene Abschnitte, die zumeist sprachlich (VRA= Verbale<br />
Rat<strong>in</strong>gskala bzw. VDS= Verbal Discriptor Scale) oder durch Zahlen (NRS= Nu-<br />
merische Rat<strong>in</strong>gskala) bezeichnet werden. Die sprachlichen Kategorienlabels stel-<br />
len Steigerungsformen dar (leicht – mäßig – stark), die empfundene Übergänge<br />
markieren. Die Pole der numerischen Rat<strong>in</strong>gskalen s<strong>in</strong>d häufig ebenfalls mit<br />
sprachlichen Ankern (0= ke<strong>in</strong> Schmerz, 10= stärkster vorstellbarer Schmerz) ver-<br />
sehen. In der Regel werden zwischen drei und zehn Kategorien unterschieden und<br />
diesen aufsteigende Zahlenwerte für die statistische Verrechnung zugeordnet. Je<br />
stärker das gedachte Merkmalskont<strong>in</strong>uum gegliedert wird, desto eher weisen die<br />
Messwerte wünschenswerte metrische Eigenschaften auf. (Vgl. Kaspar 2009:34)<br />
Untersuchungen zur Verwendung der NRS und der VRS weisen darauf h<strong>in</strong>, dass<br />
mehr vorgegebene Antwortkategorien nicht automatisch zu e<strong>in</strong>er differenzierteren<br />
E<strong>in</strong>schätzung führen. (Vgl. Jensen et al. 1994)<br />
Bei Verwendung vieler verbaler Kategorienlabels besteht die Gefahr, dass den<br />
Betroffenen nicht alle Begriffe geläufig s<strong>in</strong>d und e<strong>in</strong>zelne Bereiche des Schmerz-<br />
kont<strong>in</strong>uums weniger detailliert unterschieden werden können als andere.<br />
42
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
Als e<strong>in</strong> Nachteil der VRS wird ihre ger<strong>in</strong>ge Änderungssensitivität <strong>bei</strong> wenigen<br />
Kategorienstufen angeführt, die es praktisch unmöglich macht, ger<strong>in</strong>ge Verände-<br />
rungen der Schmerz<strong>in</strong>tensität zu erfassen. (Vgl. DNQP 2005:50)<br />
E<strong>in</strong>e weitere Unterscheidung <strong>in</strong> den sprachgestützten Rat<strong>in</strong>gverfahren stellen die<br />
Verfahren mit direkter Skalierung dar. Hier werden proportional zur empfundenen<br />
Merkmalstärke Zahlenwerte vergeben. Die am häufigsten verwendeten Verfahren<br />
der direkten Skalierung s<strong>in</strong>d die visuelle Analogskala (VAS) und die Faces Pa<strong>in</strong><br />
Scales (FPS).<br />
Bei der VAS werden die Betroffenen gebeten, die Intensität ihrer Schmerzemp-<br />
f<strong>in</strong>dung auf e<strong>in</strong>er 100 Millimeter langen horizontalen L<strong>in</strong>ie mit den verbalen An-<br />
kern „ke<strong>in</strong> Schmerz“ und „schlimmster vorstellbarer Schmerz“ e<strong>in</strong>zuzeichnen.<br />
Der Messwert liegt damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bereich zwischen null und 100 Punkten. Die<br />
Gesichterskala (FPS) misst die Schmerz<strong>in</strong>tensität mit Hilfe von mehreren ge-<br />
zeichneten Gesichtern mit unterschiedlichem Schmerzausdruck. (Vgl. Brieri et al.<br />
1990) Die Betroffenen werden gebeten, das Gesicht zu wählen, das den erlebten<br />
Schmerz am besten repräsentiert. Daneben wurden mehrere Skalen mit abstrakten<br />
Gesichtern, sogenannten Smileys, vorgeschlagen, die stärker die affektive Kom-<br />
ponente des Schmerzerlebens abbilden sollen (Facial Affektive Scale, FAS). (Vgl.<br />
Mc Grath et al. 1996:435-443) Hier<strong>bei</strong> wird e<strong>in</strong> lachendes Gesicht als Gegenpool<br />
zum schmerzverzerrten, we<strong>in</strong>enden Gesichtsausdruck maximalen Schmerzes vor-<br />
gegeben. Da<strong>bei</strong> bleibt unklar, wie der abgebildete positive Affektbereich theore-<br />
tisch mit erlebten Schmerzen zusammenhängt, da bereits e<strong>in</strong> neutraler Ge-<br />
sichtsausdruck Schmerzfreiheit anzeigen könnte. (Vgl. Kaspar 2009:37)<br />
5.1.3 Zusammenfassung<br />
Es fällt wohl <strong>in</strong> den Aufgabenbereich der Pflege, abzuschätzen, wie lange e<strong>in</strong> de-<br />
menziell erkrankter Mensch mit Hilfe dieser Schmerzassessments verlässliche<br />
Angaben zu se<strong>in</strong>em Schmerzerleben machen kann. Die große Anzahl der Mög-<br />
lichkeiten setzt hier e<strong>in</strong> profundes Wissen um die E<strong>in</strong>setzbarkeit der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Instrumente voraus. Mehrere Autoren bestätigen, dass mit der Wahl des richtigen<br />
Instrumentes e<strong>in</strong>e Selbste<strong>in</strong>schätzung der demenzkranken Bewohner auch noch <strong>in</strong><br />
43
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
e<strong>in</strong>em fortgeschrittenen Stadium der Demenz möglich und zuverlässig ist. (Vgl.<br />
Kruwelisch et al 2000:1607-1611 und. Closs et al. 2004:196-205)<br />
In e<strong>in</strong>er veröffentlichten Konsensvere<strong>in</strong>barung zur Schmerzmessung <strong>bei</strong> älteren<br />
Menschen sprach sich auch e<strong>in</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äres Expertengremium dafür aus,<br />
selbst <strong>bei</strong> demenzbed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>geschränkten verbalen Fähigkeiten sowohl Selbst-<br />
auskünfte als auch Verhaltensbeobachtungen zu berücksichtigen. Für Menschen<br />
mit <strong>in</strong>takten bis mittelgradig bee<strong>in</strong>trächtigten kognitiven Fähigkeiten wird neben<br />
den verbalen Skalen auch die numerische Rat<strong>in</strong>gskala explizit vorgeschlagen.<br />
5.2 Schmerzassessment per Fremdbeurteilung<br />
E<strong>in</strong>e systematische Revision, durchgeführt von der Forschergruppe um Zwakha-<br />
len, zeigt auf, dass gegenwärtig immerh<strong>in</strong> zwölf Instrumente zur Beurteilung von<br />
Schmerzen auf Beobachtungsbasis vorliegen. Das Ziel ihrer Studie waren der<br />
Vergleich und die Überprüfung dieser Instrumente, basierend auf Kriterien der<br />
Qualitätsbeurteilung <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Aussagekraft, Zuverlässigkeit und Homo-<br />
genität. Die Forschergruppe konnte den Instrumenten PAINAD (BESD), PACS-<br />
LAC, DOLOPLUS 2 und ECPA (BISAD) die beste psychometrische Qualität<br />
attestieren. Dennoch konnte ke<strong>in</strong>es dieser Instrumente mehr als zwölf Punkte, <strong>bei</strong><br />
e<strong>in</strong>er Höchstzahl von 20 Punkten, erzielen. Als Schwachstelle wurde unter ande-<br />
rem die Abhängigkeit von e<strong>in</strong>er dritten Person (<strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>e Pflegeperson)<br />
identifiziert. In Ermangelung von Selbstauskünften der Betroffenen ist die Inter-<br />
pretation von Schmerz durch e<strong>in</strong>e außenstehende Person fragwürdig. Hier wird<br />
davon ausgegangen, dass die Schmerze<strong>in</strong>drücke der Pflegeperson vergleichbar<br />
s<strong>in</strong>d mit der Schmerzwahrnehmung der betroffenen Person. Wäre jedoch die<br />
Wahrnehmung des Pflegepersonals e<strong>in</strong>e gültige und verlässliche Methode, würde<br />
e<strong>in</strong>e komplexere Verhaltensskala zur Schmerzbeurteilung überflüssig werden.<br />
(Vgl. Zwakhalen et al. 2006 http) Kritisch setzt sich auch Kaspar mit der Reliabi-<br />
lität und Effizienz verschiedener Beobachtungsverfahren zur Schmerzmessung <strong>bei</strong><br />
Demenz ause<strong>in</strong>ander. Laut Kaspar s<strong>in</strong>d die Möglichkeiten verschiedene Schmer-<br />
zassessments mite<strong>in</strong>ander zu vergleichen sehr beschränkt. Um Instrumente ge-<br />
44
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
genüberstellen zu können, müssen zuerst alle E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren auf den geme<strong>in</strong>-<br />
samen Merkmalfaktor Schmerz skaliert werden. Auch die häufig beschriebenen<br />
höheren Scores für die verschiedenen Verhaltensweisen unter Bewegung und Ak-<br />
tivität s<strong>in</strong>d nur dann vergleichbar, wenn sie vollkommen ident s<strong>in</strong>d. Kaspar merkt<br />
weiters an, dass Menschen mit Demenz sich <strong>in</strong> ihrem Erleben und Verhalten<br />
durch e<strong>in</strong>en Mix von natürlichen Alters- und Krankheitsprozessen auszeichnen.<br />
Deshalb sollte sich e<strong>in</strong> demenzspezifisches Schmerzassessment nicht ausschließ-<br />
lich auf die Kernsymptome der Demenzerkrankung beschränken. (Vgl. Kaspar<br />
2009:259-262)<br />
Die gegenwärtig verfügbaren Instrumente bleiben laut Kaspar deutlich h<strong>in</strong>ter dem<br />
aktuellen Kenntnisstand zum Schmerzerleben <strong>bei</strong> Demenz zurück. (Vgl. Kaspar<br />
2009:263)<br />
Sowohl die Forschergruppe um Zwakhalen als auch Kaspar halten zusätzliche<br />
Forschungen für unerlässlich. Sie plädieren jedoch dafür, bereits vorhandene In-<br />
strumente weiterzuentwickeln und zu verfe<strong>in</strong>ern, anstatt immer wieder neue zu<br />
entwickeln.<br />
5.2.1 ECPA /BISAD<br />
Die „Echelle comportemental de la douleur pour personnes agees non<br />
communicantes“ wurde <strong>in</strong> Frankreich von 1992 an <strong>in</strong> mehreren Schritten entwi-<br />
ckelt. Im Laufe der Zeit wurde die Skala von bis zu elf Items auf acht Items ge-<br />
kürzt. E<strong>in</strong>e erste Schweizer Version <strong>in</strong> deutscher Sprache stammt von Roland<br />
Kunz. (Vgl. Kunz 2002) Sie beruht auf der ursprünglichen ECPA-Fassung mit elf<br />
Items. Die deutsche Fassung BISAD wurde im Rahmen e<strong>in</strong>er Doktorar<strong>bei</strong>t von<br />
Thomas Fischer neu übersetzt, gekürzt und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie auf Validität und Pra-<br />
xistauglichkeit getestet. (Vgl. Fischer 2007) BISAD besteht laut Fischer aus acht<br />
Items. Die ersten vier Items (Gesichtsausdruck, spontane Ruhehaltung, Bewegung<br />
und Beziehung zu anderen) werden erfasst, wenn sich die Betroffenen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
ruhigen Position bef<strong>in</strong>den. H<strong>in</strong>sichtlich der Bewegung und der Beziehung zu an-<br />
deren wird geprüft, ob es e<strong>in</strong>e Veränderung zum üblichen Verhalten gibt. Die rest-<br />
lichen vier Items (ängstliche Erwartungen <strong>bei</strong> der Pflege, Reaktionen während der<br />
45
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
Bewegung, Reaktionen während der Pflege schmerzender Bereiche und Klagen)<br />
werden <strong>bei</strong> Bewegung erhoben. Für jedes Item werden (zwischen) null bis vier<br />
Punkte vergeben, was <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>en Wert zwischen null und 32 ergibt (Punk-<br />
tewert <strong>bei</strong> der ECPA 44). Aus den Studienergebnissen kann laut Fischer abgeleitet<br />
werden, dass BISAD sich als praktisch nutzbares Instrument erwiesen hat.<br />
E<strong>in</strong>e aufwendige E<strong>in</strong>schulung der Pflegefachkräfte hält Fischer nicht für notwen-<br />
dig, da das Instrument selbsterklärend ist. Generell ist nach Ansicht von Fischer<br />
zu fordern, E<strong>in</strong>schätzungs<strong>in</strong>strumente möglichst so zu gestalten, dass sie nach<br />
e<strong>in</strong>er kompakten E<strong>in</strong>weisung zuverlässig nutzbar s<strong>in</strong>d.<br />
BISAD ermöglicht die Erfassung des Schmerzverhaltens und lässt somit Rück-<br />
schlüsse auf mögliche Schmerzen von Menschen mit schwerer Demenz zu. Der<br />
Verfasser weist darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>bei</strong> der Erhebung immer e<strong>in</strong>e Mobilitätssituation<br />
berücksichtigt werden sollte. Die ermittelte BISAD-Score ist relativ und lässt ab-<br />
solute Vergleichswerte nicht zu. Cut-Off-Werte (jener Wert, ab dem e<strong>in</strong>e Behand-<br />
lung zw<strong>in</strong>gend erforderlich ist) können nicht def<strong>in</strong>iert werden. Die Aussagekraft<br />
des BISAD ist deshalb auf die e<strong>in</strong>zelne Person begrenzt. Die ermittelte Score be-<br />
schreibt das Schmerzverhalten und nicht das Schmerzempf<strong>in</strong>den der Betroffenen.<br />
E<strong>in</strong> niedriger Wert ist nicht gleichzusetzen mit wenig oder ke<strong>in</strong>em Schmerz. Da-<br />
her sollte BISAD nur als e<strong>in</strong> Teil der Schmerze<strong>in</strong>schätzung <strong>bei</strong> Menschen mit<br />
schwerer Demenz gesehen werden und niemals als e<strong>in</strong>ziger Ansatz. (Vgl. Fischer<br />
2009:158)<br />
Während Fischer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Studie e<strong>in</strong>e überdurchschnittlich hohe Anzahl von<br />
HeimbewohnerInnen mit weit fortgeschrittener Demenz und somit unfähig zur<br />
Selbstauskunft <strong>in</strong> Bezug auf Schmerz angibt, macht Kasper kontroverse Beobach-<br />
tungen. Kasper vergleicht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Studie die BESD-Skala mit CNPI (Deutsche<br />
Adaption der Checklist of Nonverbal Pa<strong>in</strong> Inducators) und berichtet über e<strong>in</strong>e<br />
häufig noch gut erhaltene Auskunftsfähigkeit, auch <strong>bei</strong> Menschen mit fortge-<br />
schrittener Demenz. Wo<strong>bei</strong> Kasper davor warnt, Kommunikationsfähigkeit aus-<br />
schließlich mit verbaler Auskunftsfähigkeit gleichzusetzen und da<strong>bei</strong> den kom-<br />
munikativen Gehalt nonverbalen Verhaltensausdrucks zu übersehen. (Vgl. Kasper<br />
2009:30) In Übere<strong>in</strong>stimmung mit Fischer weist auch Kasper daraufh<strong>in</strong>, dass die<br />
größte Schwierigkeit <strong>in</strong> der Unterscheidung von Schmerzverhalten und nicht-<br />
46
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
kognitiven Demenzsymptomen liegt. Zu h<strong>in</strong>terfragen ist laut Kasper generell, ob<br />
e<strong>in</strong>e an der Schmerz<strong>in</strong>tensität ausgerichtete standardisierte Verhaltensbeobach-<br />
tung die beste Option für e<strong>in</strong>e Verbesserung des Schmerzmanagements <strong>bei</strong> de-<br />
menzkranken Menschen darstellt. (Vgl. Kasper 2009:30)<br />
5.2.2 BESD /PAINAD<br />
BESD wurde unter dem Namen Pa<strong>in</strong> Assessment <strong>in</strong> Advanced Dementia<br />
(PAINAD) <strong>in</strong> den USA entwickelt. (Vgl. Warden et al. 2003:09-15) Die deutsche<br />
Fassung stammt von Basler et al. und wurde vom Ar<strong>bei</strong>tskreis „Alter und<br />
Schmerz“ der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) erar-<br />
<strong>bei</strong>tet (Vgl. Basler et al. 2006:519-526). BESD besteht aus den Items Atmung,<br />
negative Lautäußerung, Gesichtsausdruck, Körpersprache und Trost (die Fähig-<br />
keit der Betroffenen sich trösten zu lassen). Je nach beobachtbarem Verhalten<br />
werden pro Item (zwischen) null bis zwei Punkte vergeben. Erreichbar s<strong>in</strong>d ma-<br />
ximal zehn Punkte. Das Instrument wird von e<strong>in</strong>er Pflegefachkraft angewandt,<br />
nachdem sie die betroffene Person e<strong>in</strong>ige M<strong>in</strong>uten beobachtet hat. E<strong>in</strong>e Vorgabe,<br />
<strong>in</strong> welcher Situation (Bewegung, Ruhe, Ausübung der Grundpflege) dies zu ge-<br />
schehen hat, gibt es laut Fischer nicht. In welchem Umfang BESD im deutsch-<br />
sprachigen Raum <strong>in</strong> den Pflegeheimen verwendet wird, ist unklar (Vgl. Fischer<br />
2007). Für die amerikanische Ursprungsversion wird laut Fischer von e<strong>in</strong>er mode-<br />
raten <strong>in</strong>ternen Konsistenz (Kriterium der Zuverlässigkeit) und guter Inter-Rater-<br />
Reliabilität (Aussage über die Übere<strong>in</strong>stimmung der ermittelten Werte, wenn das<br />
Instrument gleichzeitig von mehreren Beurteilenden angewendet wird) berichtet.<br />
Dies bestätigen auch Horgas et al. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Artikel im Journal of Nurs<strong>in</strong>g. Die<br />
praktische Handhabung wird als e<strong>in</strong>fach und wenig zeit<strong>in</strong>tensiv beschrieben. Die<br />
Autoren empfehlen zwei Messungen pro Tag, sowohl <strong>in</strong> Ruhe als auch im Rah-<br />
men e<strong>in</strong>er Mobilisierung. Um abweichende Ergebnisse möglichst zu m<strong>in</strong>imieren,<br />
sollte die E<strong>in</strong>schätzung über mehrere Tage von derselben Pflegefachkraft durch-<br />
geführt werden. Kritisch merken die Autoren an, dass Veränderungen <strong>in</strong> der zwi-<br />
schenmenschlichen Beziehung (z.B. Reduzierung der sozialen Interaktionen) so-<br />
wie Änderungen <strong>in</strong> den Tätigkeitsmustern (essen, schlafen) und nicht zuletzt Ver-<br />
47
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
änderungen im Geistesstatus (zunehmende Verwirrtheit) nicht erfasst werden.<br />
(Vgl. Horgas et al. 2008)<br />
In Bezug auf die aktuelle Studienlage berichtet Fischer von zwei Studien, die die<br />
deutsche Fassung prüften. Schuler et al. setzten sich zum Ziel, die psychometri-<br />
schen Eigenschaften der deutschen Version der BESD im Rahmen e<strong>in</strong>er Quer-<br />
schnittstudie auszuwerten. Das Ergebnis zeigte e<strong>in</strong>e gute <strong>in</strong>terne Übere<strong>in</strong>stim-<br />
mung der Skala und die Beobachtung, dass BewohnerInnen mit zunehmendem<br />
Verlust der kognitiven Fähigkeiten e<strong>in</strong>en deutlichen Anstieg im Schmerzverhalten<br />
zeigten. In der Diskussion wurde somit festgehalten, dass die PAINAD-Skala e<strong>in</strong>e<br />
gute Zuverlässigkeit zeigt, und das Resultat stützt die Annahme, dass wirklich<br />
Schmerz gemessen wird. (Vgl. Schuler et al. 2007:43 http) Die Studie von Basler<br />
et al. untersuchte die Konstruktvalidität der BESD. Als Methode wurde e<strong>in</strong>e Beo-<br />
bachtungsstudie mit verbal nicht-kommunikativen, multimorbiden Demenzpatien-<br />
tInnen gewählt. E<strong>in</strong>schlusskriterien waren schmerzassoziierte Erkrankungen so-<br />
wie beobachtbares Schmerzverhalten. Alle PatientInnen erhielten analgetische<br />
Medikation. Die Schmerzmedikation zeigte im Verlauf e<strong>in</strong>en deutlichen E<strong>in</strong>fluss<br />
auf das Schmerzverhalten. Dies wird als Beleg dafür gesehen, dass die BESD-<br />
Skala tatsächlich Schmerzen misst. Allerd<strong>in</strong>gs weisen die Autoren darauf h<strong>in</strong>,<br />
dass die Datenbasis zum Zeitpunkt der Publikation ihrer Studie noch unzurei-<br />
chend war und sie ke<strong>in</strong> abschließendes Urteil über die Qualität der Skala abgeben<br />
können. (Vgl. Basler et al. 2006:519-526)<br />
5.2.3 Vergleich<br />
Für die deutsche Version der BISAD-Skala mit acht Items berichtet der Verfasser<br />
e<strong>in</strong>e gute Reliabilität und auch Validität. Anders als die BESD-Skala berücksich-<br />
tigt die BISAD-Skala die Veränderungen von Beweglichkeit und Sozialkontakten<br />
als Schmerz<strong>in</strong>dikatoren und greift damit die AGS-Empfehlungen (Panel on Per-<br />
sistent Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> Older Adults der American Geriatrics Society / Grundlegende<br />
Empfehlungen zum Schmerzmanagement) auf. Zusätzlich wird immer e<strong>in</strong>e Be-<br />
wegungssituation beobachtet, wodurch sich die Validität noch erhöht, da Schmer-<br />
zen im Alter häufig bewegungsabhängig s<strong>in</strong>d. Sowohl <strong>in</strong> den amerikanischen Stu-<br />
48
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
dien zur Beurteilung der Assessment<strong>in</strong>strumente als auch <strong>in</strong> den deutschen Studi-<br />
en zu <strong>bei</strong>den Instrumenten berichten die Experten von Problemen <strong>in</strong> der Praxis.<br />
(Vgl. Horgas et al. 2008:62-70 und Fischer 2007 http)<br />
So lassen sich während bestimmter Pflegehandlungen, wie zum Beispiel <strong>bei</strong>m<br />
Transfer, ke<strong>in</strong>e optimalen Beobachtungen machen. Hier würde sich e<strong>in</strong>e zweite<br />
Pflegeperson anbieten. Genauso wichtig ist die personelle Kont<strong>in</strong>uität, um e<strong>in</strong>en<br />
Verlauf besser e<strong>in</strong>schätzen zu können. Der Pflegealltag zeigt e<strong>in</strong>en permanenten<br />
Wechsel <strong>in</strong> der Tagesbesetzung. Um <strong>bei</strong>de Skalen richtig anwenden und die E<strong>in</strong>-<br />
schätzung richtig <strong>in</strong>terpretieren und dokumentieren zu können, bedarf es auch auf<br />
Seiten der Mitar<strong>bei</strong>terInnen fundierter Deutschkenntnisse. Doch diese Vorausset-<br />
zung ist <strong>bei</strong> Weitem nicht immer gegeben. E<strong>in</strong>ig s<strong>in</strong>d sich die Autoren auch dar<strong>in</strong>,<br />
dass es trotz dieser Hilfsmittel schwierig ist e<strong>in</strong> bestimmtes Verhalten der demen-<br />
ten BewohnerInnen mit Schmerz zu erklären, da auch Angst, E<strong>in</strong>samkeit, Kälte<br />
und vieles mehr e<strong>in</strong>e Veränderung im Verhalten provozieren können.<br />
Kritisch angemerkt wird auch das Fehlen e<strong>in</strong>es cut-off-Punktes <strong>bei</strong> der<br />
ECPA/BISAD-Skala, der aufzeigt, ab welchem Wert e<strong>in</strong>e Schmerztherapie unbe-<br />
d<strong>in</strong>gt angezeigt ist. Der ermittelte Punktwert hat somit die Funktion e<strong>in</strong>es Fixwer-<br />
tes, an dem das Gel<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>setzenden Schmerztherapie beurteilt werden<br />
kann. Die ECPA/BISAD-Skala eignet sich nicht für e<strong>in</strong>e Schmerzersterfassung<br />
(z.B. <strong>bei</strong> Heime<strong>in</strong>zug).<br />
E<strong>in</strong> positiver Effekt, der <strong>bei</strong> der regelmäßigen Anwendung e<strong>in</strong>es Schmerzerfas-<br />
sungs<strong>in</strong>struments zum Tragen kommt, ist die Schärfung der Aufmerksamkeit der<br />
Mitar<strong>bei</strong>terInnen für Schmerzen <strong>bei</strong> den <strong>Bewohnern</strong>. Das Vorliegen e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>-<br />
schätzungsskala kann die Kommunikation im multiprofessionellen Team unter-<br />
stützen, da es e<strong>in</strong>facher wird, sich über das Verhalten der BewohnerInnen auszu-<br />
tauschen (geme<strong>in</strong>same Sprache). Trotz vieler Vorteile darf e<strong>in</strong>e kritische Reflexi-<br />
on nicht fehlen. Beobachtungs<strong>in</strong>strumente s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ihrer Validität den ermittelten<br />
Werten durch Selbstauskunft immer unterlegen. Betroffene können Schmerzen<br />
haben, obwohl sowohl auf der BESD als auch auf der BISAD-Skala null Punkte<br />
ermittelt wurden. Oder im umgekehrten Fall, auch wenn ke<strong>in</strong> Schmerzverhalten<br />
zu beobachten ist, aber trotzdem Gründe für mögliche Schmerzen vorliegen (Er-<br />
krankungen, Unfälle, pflegerische Interventionen, mediz<strong>in</strong>ische Maßnahmen)<br />
49
<strong>Schmerzerfassung</strong><br />
sollte mit e<strong>in</strong>er medikamentösen Schmerztherapie begonnen werden. (Vgl.<br />
Pasero/McCaffery 2005:50-53) Die Pflegenden bleiben die Experten. Sie haben<br />
mit diesen Erhebungs<strong>in</strong>strumenten zwar e<strong>in</strong>e wertvolle Unterstützung erhalten,<br />
diese ersetzen jedoch die eigene fachliche Überlegung nicht.<br />
50
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
6 Empirische Datenerhebung zum Thema der<br />
Ar<strong>bei</strong>t<br />
Um Antworten auf die, zu Beg<strong>in</strong>n dieser Ar<strong>bei</strong>t gestellten Forschungsfragen zu<br />
erhalten, wurden von der Autor<strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt 15 Fragen ausgear<strong>bei</strong>tet (quantitative<br />
Methode).<br />
Die Datenerhebung erfolgte mittels zweigeteilter Fragebögen. Die Befragung be-<br />
zieht sich ausschließlich auf BewohnerInnen mit fortgeschrittener Demenz und<br />
den damit verbundenen kognitiven Defiziten.<br />
Mit den ersten sechs Fragen <strong>in</strong> Teil 1 wird versucht, e<strong>in</strong>en Überblick über die ak-<br />
tuelle Situation <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen bezüglich Anwendung e<strong>in</strong>es Schmerzerfas-<br />
sungsbogens, Stand der Fortbildung zu dieser Thematik und Selbste<strong>in</strong>schätzung<br />
der Mitar<strong>bei</strong>terInnen zu erhalten.<br />
Die Fragen sieben bis zehn beziehen sich konkret auf den <strong>bei</strong>gefügten ECPA-<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen und sollen Aufschluss über die Anwendbarkeit und Ak-<br />
zeptanz sowie den daraus resultierenden (oder nicht vorhandenen) Benefit geben.<br />
Die Beantwortung dieser Fragen setzt zum<strong>in</strong>dest das Durchlesen, im Idealfall die<br />
Anwendung des ECPA-Bogens <strong>in</strong> der Praxis voraus.<br />
Mit den Fragen elf und zwölf wird die Aufmerksamkeit der Mitar<strong>bei</strong>terInnen im<br />
H<strong>in</strong>blick auf das Thema Schmerz <strong>in</strong> ihrem Pflegealltag h<strong>in</strong>terfragt.<br />
51
6.1 Fragebogen Teil I<br />
Fragebogen Teil 1<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
52
6.2 Fragebogen Teil II<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Um den Pflegenden genügend Zeit für die Anwendung des ECPA-Bogens <strong>in</strong> der<br />
Praxis zu gewährleisten, erfolgte die Ausgabe von Teil 2 der Befragung erst ca.<br />
zwei Wochen nach Rücklauf von Teil 1. Da sich Frage zehn, elf und zwölf im<br />
zweiten Teil wiederholen, wurde mit dieser Vorgehensweise auch versucht den<br />
Spill-over-Effekt zu vermeiden (Die Befragten er<strong>in</strong>nern sich an die bereits gestell-<br />
te Frage und s<strong>in</strong>d bemüht wieder die gleiche Antwort zu geben).<br />
Teil 2 <strong>bei</strong>nhaltet zusätzlich noch Fragen zur Qualifizierung der Mitar<strong>bei</strong>terInnen<br />
und zur Anzahl der Dienstjahre.<br />
Fragebogen Teil 2<br />
53
6.3 Auswahl der Stichprobe<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Im folgenden Kapitel wird die Auswahl der Stichprobe näher erläutert.<br />
Befragt wurden die Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> neun Vorarlberger Pflegee<strong>in</strong>richtungen.<br />
Die Auswahl der Heime erfolgte nach dem Zufallspr<strong>in</strong>zip. Es wurde von Seiten<br />
der Autor<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zig darauf geachtet, Heime mit unterschiedlicher Trägerschaft<br />
(Geme<strong>in</strong>de, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und private Träger) <strong>in</strong> die<br />
Befragung mit e<strong>in</strong>zuschließen, um e<strong>in</strong>e zu e<strong>in</strong>seitige E<strong>in</strong>schätzung der Situation<br />
zu vermeiden.<br />
Die Heimgröße bzw. die Anzahl der dar<strong>in</strong> betreuten BewohnerInnen variiert zwi-<br />
schen 15 und über 60 KlientInnen. Aus Gründen des Datenschutzes wird auf die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Häuser nicht näher e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Die erste Kontaktaufnahme mit den Pflegedienstleitungen der ausgewählten Hei-<br />
me erfolgte im Herbst 2011. Bei e<strong>in</strong>er persönlichen Vorsprache wurden das Vor-<br />
gehen und die dah<strong>in</strong>ter stehende Intervention erklärt und die PDL um ihre Mithil-<br />
fe gebeten. Es stellte sich im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> heraus, dass der Rücklauf <strong>in</strong> jenen Hei-<br />
men, <strong>in</strong> denen die Pflegedienstleitungen persönlich die beantworteten Fragebögen<br />
entgegennahmen und sich dafür verantwortlich fühlten, am höchsten war.<br />
Die Ausgabe des ersten Teils der Fragebögen erfolgte im November, die des<br />
zweiten Teils <strong>in</strong> der ersten Dezemberhälfte.<br />
Insgesamt wurden 195 Fragebögen (jeweils Teil 1 und Teil 2 und ECPA-Bogen)<br />
<strong>in</strong> den neun Häusern verteilt. Diese Anzahl entsprach der im Vorfeld eruierten<br />
Anzahl der <strong>in</strong> diesen E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> der Pflege Beschäftigten.<br />
Der Rücklauf lag mit 164 Fragebögen <strong>bei</strong> 84,10 %. Zwei Befragungen konnten -<br />
da unvollständig - nicht <strong>in</strong> die Auswertung aufgenommen werden, was e<strong>in</strong>er end-<br />
gültigen Größe von162 (83,08 %) entspricht. Mit n = 162 wurde e<strong>in</strong>e ausreichen-<br />
de Stichprobengröße erzielt.<br />
E<strong>in</strong>geschlossen <strong>in</strong> die Befragung wurden ausschließlich Mitar<strong>bei</strong>terInnen der<br />
Pflege mit abgeschlossener Pflegeausbildung. Dazu zählen diplomierte Fachkräfte<br />
(DGKS/DGKP), PflegehelferInnen (PH) und FachsozialbetreuerInnen mit<br />
Schwerpunkt Altenar<strong>bei</strong>t (FSA).<br />
Die Gruppe der diplomierten Fachsozialbetreuer wurde <strong>in</strong> die Befragung nicht mit<br />
aufgenommen, da sich laut PDL <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em der neun Heime Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit<br />
54
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
dieser Qualifikation bef<strong>in</strong>den. Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit der Ausbildung zur Heimhilfe<br />
(HH) konnten ebenfalls nicht mit e<strong>in</strong>bezogen werden, da sich ihr Wirkungsspekt-<br />
rum schwerpunktmäßig auf Haushaltstätigkeiten <strong>in</strong> den Wohnbereichen reduziert<br />
und Beobachtungen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong> Schmerzgeschehen <strong>bei</strong> BewohnerInnen<br />
der zuständigen Pflegefachkraft mitzuteilen s<strong>in</strong>d.<br />
Die Auswertung der Qualifikation ergab e<strong>in</strong>en Anteil der DGKS/DGKP von 60<br />
Mitar<strong>bei</strong>terInnen, das entspricht 37,04 %. Die PH s<strong>in</strong>d mit 81 Mitar<strong>bei</strong>terInnen<br />
bzw. 50 % die am stärksten vertretene Berufsgruppe und die FSA bilden mit 21<br />
Personen bzw. 12,96 % das Schlusslicht.<br />
6.4 Auswahl e<strong>in</strong>es Instruments<br />
Anhand e<strong>in</strong>er Literaturrecherche wurde im Vorfeld e<strong>in</strong> geeignetes Beobachtungs-<br />
<strong>in</strong>strument für die Schmerze<strong>in</strong>schätzung <strong>bei</strong> Menschen mit schwerer Demenz ge-<br />
sucht. Ergänzend kam die Internetrecherche mittels Google Scholar h<strong>in</strong>zu.<br />
Nach dem Ausschluss vieler nur <strong>in</strong> englischer Sprache erhältlicher Instrumente,<br />
fiel die engere Auswahl auf die ECPA und die BESD. Von <strong>bei</strong>den liegt e<strong>in</strong>e deut-<br />
sche Übersetzung vor und es gibt bereits Erfahrungswerte.<br />
Hilfreich waren da<strong>bei</strong> die Erkenntnisse von Dr. Thomas Fischer, der <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Dis-<br />
sertation die Vor- und Nachteile der <strong>bei</strong>den Erfassungs<strong>in</strong>strumente untersucht<br />
hatte und dessen Ergebnisse bereits <strong>in</strong> gedruckter Form vorliegen.<br />
Auch über die BESD konnte e<strong>in</strong>e prospektive, randomisierte Studie unter der Lei-<br />
tung von Albert Lukas gefunden werden.<br />
Die endgültige Wahl fiel schließlich auf die ECPA. Sie g<strong>in</strong>g sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en<br />
Pretest als deutlicher Favorit hervor. Dazu wurden acht Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> der<br />
eigenen E<strong>in</strong>richtung beauftragt, <strong>bei</strong>de Instrumente <strong>in</strong> der Praxis anzuwenden und<br />
anschließend ihre Me<strong>in</strong>ung zu äußern. Da<strong>bei</strong> fiel die Wahl e<strong>in</strong>stimmig auf die<br />
ECPA. Sie wurde von den ProbandInnen als verständlicher und aussagekräftiger<br />
e<strong>in</strong>gestuft. Positv bewerteten die Mitar<strong>bei</strong>terInnen die Spannbreite von null bis 44<br />
Punkten, mit der sie e<strong>in</strong>e sensiblere E<strong>in</strong>schätzung verbanden. Zusätzlich über-<br />
zeugte die Frage nach Veränderungen im Essverhalten, dies schien für die Mitar-<br />
<strong>bei</strong>terInnen e<strong>in</strong> aussagekräftiger H<strong>in</strong>weis auf e<strong>in</strong> Schmerzgeschehen zu se<strong>in</strong>.<br />
55
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Zudem ist die Schmerzskala ECPA bereits im BESA (ressourcenorientierte Diag-<br />
nosestellung und Zielvere<strong>in</strong>barung) als <strong>Schmerzerfassung</strong>s<strong>in</strong>strument h<strong>in</strong>terlegt.<br />
Aus den eben genannten Gründen wurde auch nicht auf die gekürzte und überar-<br />
<strong>bei</strong>tete Version von Dr. Fischer zurückgegriffen, sondern die bereits bekannte<br />
Ausfertigung mit drei Dimensionen und elf Items gewählt.<br />
56
6.4.1 ECPA-Bogen<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
57
<strong>Schmerzerfassung</strong>bogen 20<br />
6.5 Ablauf der Befragung<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Die anfängliche Befürchtung die Mitar<strong>bei</strong>terInnen <strong>in</strong> den befragten E<strong>in</strong>richtungen<br />
durch die Verteilung e<strong>in</strong>es zweigeteilten Fragebogens mit <strong>in</strong>tegrierter praktischer<br />
Anwendung zeitlich zu überfordern, hat sich nicht bestätigt. Mit 162 (von <strong>in</strong>sge-<br />
samt 195) auswertbaren Fragebögen konnte e<strong>in</strong> sensationeller Rücklauf verbucht<br />
werden. Dies ist hauptsächlich dem Engagement der Pflegedienstleitungen <strong>in</strong> den<br />
jeweiligen E<strong>in</strong>richtungen zu verdanken. Mit ihrem persönlichen E<strong>in</strong>satz haben sie<br />
wesentlich zu diesem Ergebnis <strong>bei</strong>getragen.<br />
Bereits <strong>in</strong> den Vorgesprächen wurde kommuniziert, dass gerade die Thematik<br />
„Schmerz erkennen <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen“ e<strong>in</strong> ständiger Begleiter<br />
im Pflegealltag ist. Den Leitungen ist sehr wohl bewusst, dass hier noch Hand-<br />
lungsbedarf gegeben ist. Durch diese Befragung wurde der Fokus wieder verstärkt<br />
auf diese Problematik gerichtet.<br />
Auch die Dr<strong>in</strong>glichkeit e<strong>in</strong>er entsprechenden Schulung bzw. Fortbildung steht für<br />
die Pflegedienstleitungen außer Zweifel und scheitert hauptsächlich an Personal-<br />
bzw. Zeitressourcen.<br />
58
6.6 Auswertung der Fragebögen<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Die Auswertung der ausschließlich geschlossenen Fragen und die graphische Dar-<br />
stellung der Ergebnisse erfolgt mittels Exeltabelle, die Darstellung <strong>in</strong> Prozenten.<br />
Schmerzfragebogen Teil I:<br />
Fragen 1 und 2:<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Abbildung 1<br />
84,6<br />
15,4<br />
Kennen Sie Hilfsmittel zur<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong> bzw. zur<br />
Bestimmung der Schmerzstärke?<br />
Interpretation Frage 1:<br />
37,6<br />
62,4<br />
Wird <strong>in</strong> Ihrem Haus e<strong>in</strong><br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen angewendet?<br />
84,6 % der befragten Mitar<strong>bei</strong>terInnen kennen e<strong>in</strong> Hilfsmittel zur Schmerzerfas-<br />
sung bzw. zur Schmerzstärke. Dieser hohe Anteil mag überraschen, doch ist die<br />
Frage sehr allgeme<strong>in</strong> gehalten, da „kennen“ mit „schon mal gehört“ gleichgesetzt<br />
werden kann. Andererseits s<strong>in</strong>d die Vorarlberger Pflegeheime verpflichtet, BESA<br />
(ressourcenorientierte Diagnosestellung und Zielvere<strong>in</strong>barung) zu implementieren<br />
und dieses „Programm“ ar<strong>bei</strong>tet mit der ECPA als <strong>Schmerzerfassung</strong>sassessment.<br />
Ja<br />
Ne<strong>in</strong><br />
59
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Dies lässt wiederum den Schluss zu, dass zum<strong>in</strong>dest alle diplomierten Mitar<strong>bei</strong>te-<br />
rInnen als Planungsverantwortliche von BESA dieses Instrument kennen bzw. es<br />
<strong>in</strong> der täglichen Praxis anwenden.<br />
Interpretation Frage 2:<br />
Hier relativiert sich das Ergebnis wieder. Mit 37,6 % stellen die Anwender e<strong>in</strong><br />
gutes Drittel der Befragten. Interessant ist hier, dass dieser Prozentsatz fast ident<br />
ist mit dem prozentualen Anteil der diplomierten Fachkräfte (37 %), was theore-<br />
tisch den Schluss zulassen würde, dass alle Fachkräfte tatsächlich mit der ECPA<br />
ar<strong>bei</strong>ten. Diese Interpretation ist jedoch nicht haltbar, da aus der Befragung nicht<br />
hervorgeht, welcher Berufsgruppe die 37,6 % angehören und welches Instrument<br />
<strong>in</strong> dem jeweiligen Haus angewendet wird. Auch liegt die Vermutung nahe, dass<br />
nicht allen Mitar<strong>bei</strong>terInnen das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Schmerzassessment<strong>in</strong>stru-<br />
ments <strong>in</strong> der eigenen E<strong>in</strong>richtung bekannt ist.<br />
60
Frage 3:<br />
Abbildung 2<br />
Interpretation Frage 3:<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Diese Frage verfolgte das Ziel, e<strong>in</strong>en Überblick über die bekanntesten Schmerzer-<br />
fassungs<strong>in</strong>strumente <strong>in</strong> Vorarlberg zu erhalten. Auch hier liegt ECPA mit 65,4 %<br />
deutlich über dem Durchschnitt, was wieder mit BESA zu erklären ist. Überra-<br />
schend unbekannt ist die BESD. Unter „Sonstige“ vermerkten die Befragten Ska-<br />
len wie VRS, das Schmerztagebuch, haus<strong>in</strong>terne Schmerzfragebogen für die Auf-<br />
nahme, die Smiley Skala und die, im jeweiligen Pflegeprogramm <strong>in</strong>tegrierten,<br />
Schmerze<strong>in</strong>schätzungsskalen.<br />
61
Frage 4:<br />
Abbildung 3<br />
Interpretation Frage 4:<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Mit 67,9 % liegt der Anteil jener Befragten, die angeben, noch nie e<strong>in</strong>e Fortbil-<br />
dung zum Thema Schmerz erhalten bzw. besucht zu haben, erschreckend hoch.<br />
Dieses Ergebnis untermauert die Ansicht e<strong>in</strong>iger ExpertInnen, dass die Schmerz-<br />
wahrnehmung <strong>bei</strong> den Pflegenden hauptsächlich subjektiv und <strong>in</strong>tuitiv passiert<br />
und weniger fachlich-professionell. (Vgl. Schwerman/Münch 2008:7)<br />
E<strong>in</strong> anderer Interpretationsansatz könnte se<strong>in</strong>, dass Fortbildungen von den ver-<br />
antwortlichen Leitungen organisiert werden, und diese Thematik nicht die erfor-<br />
derliche Priorität <strong>in</strong> der Jahresplanung aufweist. E<strong>in</strong>e Eigen<strong>in</strong>itiative von Seiten<br />
der Mitar<strong>bei</strong>terInnen h<strong>in</strong>sichtlich E<strong>in</strong>forderung e<strong>in</strong>er Schulung oder Weiterbil-<br />
dung <strong>in</strong> der Freizeit f<strong>in</strong>det offensichtlich nicht statt. Hier könnte <strong>in</strong>terpretiert wer-<br />
den, dass die Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit der Ist-Situation zufrieden s<strong>in</strong>d und ke<strong>in</strong>en<br />
akuten Handlungsbedarf <strong>bei</strong> sich selbst und <strong>in</strong> ihrem Pflegealltag erkennen.<br />
62
Fragen 5 und 6:<br />
Abbildung 4<br />
Interpretation Frage 5:<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Die Frage nach der Sicherheit <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung des persönlichen Handlungs-<br />
bedarfs <strong>bei</strong> Schmerzäußerungen der dementen BewohnerInnen beantworten 12,7<br />
% mit „ganz sicher“ und immerh<strong>in</strong> 66,7 % mit „eher ja“. Dieses Ergebnis lässt die<br />
Bemerkung zu, dass die eigene E<strong>in</strong>schätzung des Handlungsbedarfs nicht abhän-<br />
gig gemacht wird von der Vermittlung neuester Erkenntnisse <strong>in</strong> der Schmerzfor-<br />
schung bzw. Schmerzbehandlung (bezugnehmend auf Frage 3). Das Ergebnis<br />
kann jedoch auch so <strong>in</strong>terpretiert werden, dass <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen Standards<br />
existieren, die explizit die Vorgehensweise <strong>bei</strong> Schmerzäußerungen vorgeben, und<br />
die Sicherheit der Pflegenden auf die Kenntnis dieser Standards zurückzuführen<br />
ist.<br />
63
Interpretation Frage 6:<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
37 % der Mitar<strong>bei</strong>terInnen s<strong>in</strong>d überzeugt davon, dass ihnen e<strong>in</strong> Schmerzassess-<br />
ment <strong>bei</strong> der E<strong>in</strong>schätzung des Schmerzes helfen kann. 52,1 % halten dies immer-<br />
h<strong>in</strong> für wahrsche<strong>in</strong>lich, 10,3 % erwarten sich ke<strong>in</strong>e Hilfe und 0,6 % s<strong>in</strong>d der Mei-<br />
nung, ke<strong>in</strong>e Unterstützung durch e<strong>in</strong> dementsprechendes Instrument zu erhalten.<br />
Hier lässt sich e<strong>in</strong>e durchwegs positive E<strong>in</strong>stellung erkennen. Mit fast 90 % ist das<br />
Vertrauen <strong>in</strong> die Nützlichkeit e<strong>in</strong>es Assessmentbogens zur E<strong>in</strong>schätzung des<br />
Schmerzes überraschend hoch.<br />
64
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Die folgenden vier Fragen beziehen sich nur <strong>in</strong>sofern auf den ECPA-<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen da dieser für diese Befragung ausgewählt wurde. Be-<br />
wertet werden soll jedoch nicht die Tauglichkeit des Instrumentes <strong>in</strong> Bezug auf<br />
Schmerze<strong>in</strong>schätzung, sondern, ob mit Hilfe e<strong>in</strong>es solchen Instruments die Auf-<br />
merksamkeit der Pflege auf die Thematik Schmerz verstärkt werden kann.<br />
Fragen 7, 8, 9 und 10:<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
33,3<br />
Abbildung 5<br />
Wenn Sie <strong>bei</strong>gefügten ECPA-Bogen<br />
durchlesen, glauben Sie, dass die daraus<br />
gewonnenen Informationen ...<br />
58<br />
… Ihnen mehr Sicherheit <strong>in</strong><br />
der E<strong>in</strong>schätzung des<br />
Handlungsbedarfes geben<br />
können?<br />
Interpretation Frage 7:<br />
64,8<br />
… mehr Kompetenz z.B. <strong>in</strong><br />
der Argumentation dem<br />
Arzt gegenüber, geben?<br />
47,5<br />
45,1<br />
… Ihnen mehr<br />
Aufmerksamkeit zum<br />
Thema "Schmerz" geben<br />
können?<br />
50,6<br />
39,5<br />
15,8 18<br />
7,4<br />
1,3 1,4<br />
6,2<br />
1,2<br />
9,3<br />
0,6<br />
… Ihnen helfen können, die<br />
Lebensqualität der<br />
BewohnerInnen zu<br />
verbessern?<br />
ganz sicher<br />
eher ja<br />
eher ne<strong>in</strong><br />
Die Frage nach mehr Sicherheit <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung des Handlungsbedarfes <strong>bei</strong><br />
Zuhilfenahme des Assessment<strong>in</strong>strumentes beantworten 33,3 % der Befragten mit<br />
„ganz sicher“ und 58 % mit „eher ja“. 7,4 % sehen <strong>in</strong> der Anwendung e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>-<br />
schätzungsbogens ke<strong>in</strong>e persönliche Unterstützung und 1,3 % s<strong>in</strong>d überzeugt da-<br />
ne<strong>in</strong><br />
65
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
von, dass e<strong>in</strong> solches Instrument ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die eigene E<strong>in</strong>schätzung des<br />
Handlungsbedarfes hat.<br />
Dieses Ergebnis lässt die Interpretation zu, dass sich die Mitar<strong>bei</strong>terInnen durch<br />
das Vorliegen e<strong>in</strong>er bestimmten Punkteanzahl, sicherer <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung ihres<br />
persönlichen Handlungsbedarfes fühlen und die betroffenen BewohnerInnen eher<br />
e<strong>in</strong>er adäquaten Schmerztherapie zugeführt werden.<br />
Interpretation Frage 8:<br />
Bei der Frage nach mehr Kompetenz, z.B. <strong>in</strong> der Argumentation dem Arzt gegen-<br />
über, s<strong>in</strong>d 15,8 % ganz sicher und 64,8 % mit „eher ja“ ziemlich sicher, mit e<strong>in</strong>em<br />
Erfassungs<strong>in</strong>strument e<strong>in</strong>e Unterstützung zu erhalten. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die Skepti-<br />
ker („eher ne<strong>in</strong>“) mit 18 % deutlich stärker vertreten als <strong>bei</strong> der vorigen Frage<br />
nach dem Handlungsbedarf. Auch diejenigen Mitar<strong>bei</strong>terInnen, die ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>-<br />
fluss auf die eigene Kompetenz erkennen können, liegen hier mit 1,4% am höchs-<br />
ten <strong>in</strong> dieser Viererreihe. Dies mag daran liegen, dass die PflegehelferInnen bzw.<br />
die AltenfachbetreuerInnen es nicht als ihre Aufgabe sehen, Informationen dieser<br />
Art direkt an den Arzt weiterzugeben. Dies liegt vorrangig im Kompetenzbereich<br />
der Pflegefachkraft.<br />
Interpretation Frage 9:<br />
Bei der Frage nach der Förderung der Aufmerksamkeit auf den Aspekt „Schmerz“<br />
stellt <strong>bei</strong> 47,5 % der befragten Pflegenden der <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen ganz si-<br />
cher e<strong>in</strong>e Hilfe dar. Fast ebenso viele (45,1 %) beantworten die Frage mit „eher<br />
ja“. Addiert man <strong>bei</strong>de Auswertungen, so ergibt dies e<strong>in</strong>en Wert von 92,6 % was<br />
absolut für den E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogens sprechen würde. Diejeni-<br />
gen, die dem E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es Assessment<strong>in</strong>struments nichts Positives abgew<strong>in</strong>nen<br />
können, liegen mit <strong>in</strong>sgesamt 7,4 % <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em absolut bescheidenen Bereich. Inter-<br />
pretiert wird hier, dass bereits durch die Implementierung e<strong>in</strong>es Instruments <strong>in</strong> den<br />
Pflegealltag, wie z.B. <strong>bei</strong> der Ersterhebung der BewohnerInnen im BESA, die<br />
66
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Aufmerksamkeit der Mitar<strong>bei</strong>terInnen auf den Aspekt „Schmerz“ deutlich ver-<br />
stärkt werden kann.<br />
Interpretation Frage 10:<br />
Den Abschluss dieser Viererreihe bildet die Frage nach der Lebensqualität der<br />
BewohnerInnen. Kann e<strong>in</strong> <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen da<strong>bei</strong> helfen die Lebensquali-<br />
tät zu steigern bzw. zu verbessern? 50,6 % sagen (Ja,) „ganz sicher“ und 39,5%<br />
s<strong>in</strong>d mit „eher ja“ auch vom positiven E<strong>in</strong>fluss auf die Bef<strong>in</strong>dlichkeit der Bewoh-<br />
nerInnen überzeugt. 9,3 % sehen mit „eher ne<strong>in</strong>“ ke<strong>in</strong>en direkten Zusammenhang<br />
zwischen Lebensqualität und Verwendung e<strong>in</strong>es Schmerzassessments und 0,6 %<br />
gehen davon aus, dass der E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es solchen Instruments nichts zur Steigerung<br />
der Lebensqualität <strong>bei</strong>tragen kann. Mit wieder (wie bereits <strong>in</strong> Frage 7 und 9) über<br />
90 % Zustimmung lässt sich hier e<strong>in</strong> Muster erkennen das folgende Interpretation<br />
zulässt: Die Mitar<strong>bei</strong>terInnen die dem E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es Assessment<strong>in</strong>truments offen<br />
gegenüberstehen, erkennen <strong>in</strong> allen vier Fragen e<strong>in</strong>en Benefit für sich selbst und<br />
<strong>in</strong> weiterer Folge auch für die BewohnerInnen. Die Kritiker bleiben laut Prozent-<br />
anteil ihrer kritischen Haltung treu und können e<strong>in</strong>em Assessment<strong>in</strong>strument <strong>in</strong><br />
ke<strong>in</strong>em Bereich etwas Positives abgew<strong>in</strong>nen.<br />
67
Fragen 11 und 12:<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
37,6<br />
Abbildung 6<br />
14,8<br />
52,5<br />
61,7<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Wie hoch schätzen Sie ...<br />
9,3<br />
22,9<br />
0,6 0,6<br />
sehr hoch hoch wenig gar nicht<br />
Interpretation Frage 11:<br />
… Ihre Aufmerksamkeit auf<br />
den Aspekt "Schmerz" <strong>in</strong><br />
Ihrem Pflegealltag e<strong>in</strong>?<br />
… <strong>in</strong> Ihrem Ar<strong>bei</strong>tsumfeld den<br />
Anteil jener BewohnerInnen<br />
e<strong>in</strong>, die an<br />
Schmerzsymptomen leiden?<br />
Die Frage nach der E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Aufmerksamkeit auf den Aspekt<br />
„Schmerz“ beantworten 37,6 % mit „sehr hoch“ und 52,5 % mit „hoch“. Dieses<br />
Ergebnis ist e<strong>in</strong>erseits sehr erfreulich, lässt es doch vermuten, dass die Thematik<br />
Schmerz <strong>in</strong> den Heimen gegenwärtig ist und von den Pflegenden wahrgenommen<br />
wird. Andererseits lässt das Ergebnis jedoch auch den Schluss zu, dass hier – be-<br />
zugnehmend auf die fehlenden Fort- und Weiterbildungen – e<strong>in</strong>e gefährliche<br />
Selbstüberschätzung vorliegt. Dies würde auch die These e<strong>in</strong>iger ForscherInnen<br />
unterstützen, die den Pflegenden mangelnde Fachlichkeit attestieren.<br />
Interpretation Frage 12:<br />
Der Anteil jener BewohnerInnen, die an Schmerzsymptomen leiden, wird von<br />
14,8 % der Mitar<strong>bei</strong>terInnen als „sehr hoch“ e<strong>in</strong>gestuft. 61,7 % empf<strong>in</strong>den ihn als<br />
„hoch“, was <strong>in</strong>sgesamt als H<strong>in</strong>weis auf e<strong>in</strong>e gute Wahrnehmung und Sensibilität<br />
<strong>in</strong>terpretiert werden kann. Den 22,9 % der Pflegenden, die nur <strong>bei</strong> wenigen Be-<br />
68
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
wohnerInnen Schmerzsymptome vermuten, könnte hier unterstellt werden, nicht<br />
aufmerksam bzw. gleichgültig zu se<strong>in</strong>. Allerd<strong>in</strong>gs kann der H<strong>in</strong>tergrund auch der<br />
se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>e gute Schmerzabklärung mit lückenloser Schmerztherapie die<br />
Schmerzsymptomatik <strong>bei</strong> diesen HeimbewohnerInnen deutlich senkt.<br />
69
Schmerzfragebogen Teil II<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Im zweiten Teil des Fragebogens wiederholen sich die Fragen 10, 11 und 12. Da<br />
dieser Fragebogen erst nach erfolgter Anwendung des ECPA-Bogens beantwortet<br />
werden konnte, war es <strong>in</strong>teressant zu sehen, ob sich <strong>in</strong> der Beurteilung der Le-<br />
bensqualität und der E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Aufmerksamkeit wie auch des (ge-<br />
schätzten) Anteils der BewohnerInnen mit Schmerzsymptomatik Abweichungen<br />
ergeben haben.<br />
Frage 1 (Teil II):<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Abbildung 7<br />
Wie hoch schätzen Sie Ihre<br />
Aufmerksamkeit auf den Aspekt<br />
"Schmerz" <strong>in</strong> Ihrem Pflegealltag e<strong>in</strong>?<br />
22,8<br />
69,8<br />
sehr hoch hoch wenig gar nicht<br />
Interpretation Frage 1 (Teil II):<br />
22,8% der Pflegenden stufen nach Anwendung des ECPA-Bogens ihre Aufmerk-<br />
samkeit auf den Aspekt „Schmerz“ im Pflegealltag als sehr hoch e<strong>in</strong>. Dies s<strong>in</strong>d<br />
deutlich weniger als <strong>in</strong> der vorhergehenden Auswertung der identen Frage 11.<br />
Dafür nimmt der Anteil jener Mitar<strong>bei</strong>terInnen zu, die ihre Aufmerksamkeit als<br />
„hoch“ e<strong>in</strong>schätzen. In Summe ergeben die Rubriken „sehr hoch“ und „hoch“ <strong>in</strong><br />
etwa die gleiche Anzahl wie <strong>in</strong> Frage 11. Dies lässt vermuten, dass durch die An-<br />
7,4<br />
0<br />
70
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
wendung der ECPA e<strong>in</strong>ige neue Aspekte (die bisher nicht mit dem Vorhandense<strong>in</strong><br />
von Schmerz <strong>in</strong> Zusammenhang gebracht wurden) <strong>in</strong> der Beobachtung h<strong>in</strong>zuge-<br />
kommen s<strong>in</strong>d und die Pflegenden ihre Selbste<strong>in</strong>schätzung nach unten revidierten.<br />
Frage 2 (Teil II):<br />
Abbildung 8<br />
Interpretation Frage 2 (Teil II):<br />
Die Ergebnisse dieser Frage decken sich fast mit den Ergebnissen von Frage 12<br />
im I. Teil. Hier hat die praktische Anwendung des ECPA-Bogens ke<strong>in</strong>e nennens-<br />
werte Auswirkung auf die E<strong>in</strong>schätzung der Mitar<strong>bei</strong>terInnen betreffend den Be-<br />
wohnerInnenanteil mit Schmerzsymptomatik gezeigt.<br />
71
Frage 3 (Teil II):<br />
Abbildung 9<br />
Interpretation der Frage 3 (Teil II):<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Nur noch 28,4 % (<strong>in</strong> Frage 10 im ersten Teil waren es noch über 50 %) der Pfle-<br />
genden s<strong>in</strong>d nach Anwendung des ECPA Bogens ganz sicher, dass e<strong>in</strong> Schmerzer-<br />
fassungsbogen zur Verbesserung der Lebensqualität der BewohnerInnen <strong>bei</strong>tragen<br />
kann. Das s<strong>in</strong>d um 22,2 % weniger als <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung im Teil I. Dafür erhält<br />
die Rubrik „eher ja“ e<strong>in</strong>en Zuwachs von 19,8 %. Hier liegt die Vermutung nahe,<br />
dass die anfängliche, fast une<strong>in</strong>geschränkte Zustimmung diesem Instrument ge-<br />
genüber, e<strong>in</strong>er gewissen Ernüchterung gewichen ist. Die Anwendung <strong>in</strong> der Praxis<br />
zeigt die Herausforderung an die Pflegenden (genaues Beobachten, Interpretation<br />
von Verhaltensauffälligkeiten, Dokumentation usw.) und den damit verbundenen<br />
zeitlichen Aufwand.<br />
72
Grafische Darstellung der Qualifikation <strong>in</strong> Prozenten:<br />
Abbildung 10<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Grafische Darstellung der Anzahl der Dienstjahre <strong>in</strong> Prozenten:<br />
Abbildung 11<br />
73
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Detaillierte Auswertung <strong>in</strong> Bezug auf die Dienstjahre der Pflegenden:<br />
Frage 1: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
29,5<br />
52,9<br />
Abbildung 12<br />
Wie hoch schätzen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den<br />
Aspekt "Schmerz" <strong>in</strong> Ihrem Pflegealltag e<strong>in</strong>?<br />
76,9<br />
72,9<br />
33,3<br />
55,6<br />
17,6<br />
23,1<br />
20,3<br />
6,8<br />
11,1<br />
0 0 0 0 0<br />
0 - 5 Jahre 6 - 15 Jahre 16 - 25 Jahre länger<br />
Interpretation der Auswertung:<br />
Mit 33,3 % schätzen sich jene Mitar<strong>bei</strong>terInnen, die länger als 25 Jahre <strong>in</strong> der<br />
Pflege tätig s<strong>in</strong>d, am aufmerksamsten <strong>in</strong> Bezug auf den Aspekt „Schmerz“ im<br />
Pflegealltag e<strong>in</strong>. Dieses Ergebnis lässt die Interpretation zu, dass diese Mitar<strong>bei</strong>te-<br />
rInnen von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren und damit das fehlende aktu-<br />
elle Fachwissen kompensieren. Die Kategorie „Aufmerksamkeit hoch“ führen die<br />
Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit sechs bis 15 Jahren Pflegeerfahrung an. Dies entspricht ei-<br />
nem Prozentanteil von 76,9 %.<br />
Überraschend ist die Selbste<strong>in</strong>schätzung der Pflegenden mit null bis fünf Jahren<br />
Erfahrung. Sie liegen mit 17,6 % relativ hoch im Bereich der Kategorie „wenig<br />
aufmerksam“. Hier liegt wiederum die Vermutung nahe, dass die Thematik<br />
„Schmerz <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen“ ke<strong>in</strong>en besonderen Stellenwert <strong>in</strong><br />
der jeweiligen Ausbildung hat und diese Mitar<strong>bei</strong>terInnen noch ke<strong>in</strong>en „Erfah-<br />
rungsschatz“ sammeln konnten.<br />
sehr hoch<br />
hoch<br />
wenig<br />
gar nicht<br />
74
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
E<strong>in</strong> klares Bild lässt sich jedoch nicht erkennen. Es geht nicht e<strong>in</strong>deutig aus der<br />
Auswertung hervor, ob mehr Ar<strong>bei</strong>tserfahrung gleichbedeutend ist mit e<strong>in</strong>er höhe-<br />
ren Aufmerksamkeit zum Begriff Schmerz oder ob jene Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit we-<br />
niger Erfahrung von der zeitlichen Nähe ihrer Ausbildung profitieren.<br />
Frage 2: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Abbildung 13<br />
Wie hoch schätzen Sie <strong>in</strong> Ihrem Ar<strong>bei</strong>tsumfeld den Anteil<br />
jener BewohnerInnen e<strong>in</strong>, die an Schmerzsymptomen<br />
leiden?<br />
73,5<br />
70<br />
0-5 Jahre 6-15 Jahre 16-25 Jahre mehr als 25<br />
Jahre<br />
51<br />
31,8<br />
62,5<br />
37,5<br />
20,6 20<br />
15,3<br />
10<br />
5,9<br />
0 0 1,9 0 0<br />
Interpretation der Auswertung:<br />
In allen Gruppen f<strong>in</strong>det sich hier e<strong>in</strong> Trend zur E<strong>in</strong>schätzung „hoch“. Damit kann<br />
den Pflegenden – unabhängig von der Anzahl der Dienstjahre – e<strong>in</strong>e hohe Sensibi-<br />
lität <strong>in</strong> der Wahrnehmung von Schmerzsymptomen zugesprochen werden. Bei<br />
den Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit der längsten Berufserfahrung lässt das Ergebnis aller-<br />
d<strong>in</strong>gs auch die Hypothese zu, dass mit zunehmenden Dienstjahren der Glaube an<br />
das Vorhandense<strong>in</strong> von Schmerzsymptomen abnimmt oder die Pflegenden eher<br />
den Standpunkt vertreten, dass Schmerz zum Alter gehört.<br />
sehr hoch<br />
hoch<br />
wenig<br />
gar nicht<br />
75
Frage 3: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
52,9<br />
Abbildung 14<br />
41,2<br />
69<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Nachdem Sie mit dem ECPA-Bogen gear<strong>bei</strong>tet haben,<br />
glauben Sie, dass die daraus gewonnenen Informationen<br />
dazu <strong>bei</strong>tragen, die Lebensqualität der BewohnerInnen<br />
zu verbessern?<br />
20,7<br />
17,3<br />
10,3<br />
5,9<br />
7,7<br />
11,1<br />
0 0 0 0<br />
0-5 Jahre 6-15 Jahre 16-25 Jahre mehr als 25<br />
Jahre<br />
Interpretation der Auswertung:<br />
75<br />
50<br />
38,9<br />
ganz sicher<br />
sicher<br />
eher ne<strong>in</strong><br />
Mit 52,9 % bzw. 50 % stellen die jeweils am kürzesten und die am längsten Täti-<br />
gen den größten Anteil der Mitar<strong>bei</strong>terInnen, die „ganz sicher“ s<strong>in</strong>d, dass die In-<br />
formationen, die aus dem <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen gewonnen werden, zu e<strong>in</strong>er<br />
Verbesserung der Lebensqualität der BewohnerInnen <strong>bei</strong>tragen. Hier kann <strong>in</strong>ter-<br />
pretiert werden, dass die „jungen“ Pflegenden <strong>in</strong> der Anwendung des Instruments<br />
e<strong>in</strong>e Art Handlungsanleitung sehen. Damit wird e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Vorgehensweise<br />
ermöglicht und für mehr Transparenz <strong>in</strong> der Überprüfung der Maßnahmen ge-<br />
sorgt. Dies führt im Endeffekt zu weniger Zeitverlust bis zur Ansetzung e<strong>in</strong>er<br />
Schmerztherapie und <strong>in</strong> Folge zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der Lebensqualität. Die<br />
Pflegenden erhalten damit e<strong>in</strong> Instrument, das Sicherheit durch Struktur vorgibt.<br />
Ob diese Interpretation auch auf die Mitar<strong>bei</strong>terInnen mit e<strong>in</strong>er Dienstzeit von<br />
mehr als 25 Jahren angewendet werden kann bleibt fraglich. Die Erfahrung zeigt<br />
eher, dass langjährige Mitar<strong>bei</strong>terInnen Assessment<strong>in</strong>strumenten sehr kritisch<br />
gegenüberstehen und deren S<strong>in</strong>nhaftigkeit nicht selten <strong>in</strong> Frage stellen – aber<br />
eventuell kann auch hier der Faktor Sicherheit durch klare Vorgaben e<strong>in</strong>e Rolle<br />
spielen.<br />
ne<strong>in</strong><br />
76
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Detailliertere Auswertung h<strong>in</strong>sichtlich der Dienstjahre:<br />
Frage 1: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
16,7<br />
Abbildung 15<br />
Wie hoch schätzen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den<br />
Aspekt "Schmerz" <strong>in</strong> Ihrem Pflegealltag e<strong>in</strong>?<br />
25,7<br />
42,9<br />
81,7<br />
74,3<br />
57,1<br />
1,6 0 0 0 0 0<br />
sehr hoch hoch wenig gar nicht<br />
Interpretation der Auswertung:<br />
DGKS / DGKP<br />
In der Kategorie „sehr hoch“ führen die FSA mit 42,9 % das Feld an, gefolgt von<br />
den PflegehelferInnen und den Diplomierten Fachkräften. Als „hoch“ schätzen<br />
81,7 % der diplomierten Fachkräfte ihre Aufmerksamkeit auf den Aspekt<br />
„Schmerz“ e<strong>in</strong>. Generell e<strong>in</strong> sehr gutes Ergebnis, jedoch ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>deutige Tendenz<br />
im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>e bestimmte Mitar<strong>bei</strong>tergruppe. Dies lässt ke<strong>in</strong>e Bevorzugung<br />
e<strong>in</strong>er bestimmten Ausbildung zu. Auch kann mit zunehmender Verantwortung die<br />
Selbste<strong>in</strong>schätzung kritischer und somit niedriger ausfallen.<br />
PH<br />
FSA<br />
77
Frage 2: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
8,3<br />
Abbildung 16<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Wie hoch schätzen Sie <strong>in</strong> Ihrem Ar<strong>bei</strong>tsumfeld den Anteil<br />
jener BewohnerInnen e<strong>in</strong>, die an Schmerzsymptomen<br />
leiden?<br />
19,8<br />
0<br />
71,7<br />
66,7<br />
59,3<br />
20 19,7<br />
sehr hoch hoch wenig gar nicht<br />
Interpretation der Auswertung:<br />
33,3<br />
0<br />
1,2<br />
0<br />
DGKS / DGKP<br />
Auch <strong>bei</strong> dieser Frage s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e wesentlichen Unterschiede <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung<br />
erkennbar. Die FachsozialbetreuerInnen sehen den Anteil der BewohnerInnen mit<br />
Schmerzsymptomatik am wenigsten dramatisch. Dieses Ergebnis lässt die Inter-<br />
pretation zu, dass die Ausbildung der FSA, die den Schwerpunkt auf die Betreu-<br />
ung alter Menschen legt, den mediz<strong>in</strong>ischen Aspekt (Schmerzsymptomatik,<br />
Schmerzerkennung) vernachlässigt. Oder, da sie sich selbst e<strong>in</strong>e hohe Aufmerk-<br />
samkeit auf den Aspekt „Schmerz“ (Frage 1) zugestehen, der Anteil der Bewoh-<br />
nerInnen mit Schmerzsymptomen tatsächlich niedrig ist.<br />
PH<br />
FSA<br />
78
Frage 3: Auswertung <strong>in</strong> Prozenten<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Abbildung 17<br />
33,3<br />
28,3<br />
19<br />
66,7<br />
53,1<br />
Empirische Datenerhebung zum Thema der Ar<strong>bei</strong>t<br />
Nachdem Sie mit dem ECPA-Bogen gear<strong>bei</strong>tet haben,<br />
glauben Sie, dass die daraus gewonnenen Informationen<br />
dazu <strong>bei</strong>tragen, die Lebensqualität der BewohnerInnen<br />
zu verbessern?<br />
81<br />
13,6<br />
5<br />
0 0 0 0<br />
ganz sicher eher ja eher ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong><br />
Interpretation der Auswertung:<br />
DGKS / DGKP<br />
Von den diplomierten Fachkräften s<strong>in</strong>d 28,3 % „ganz sicher“ und 66,7 % „eher<br />
sicher“, dass mit den Informationen, die aus dem Schmerzassessmentbogen ge-<br />
wonnen werden, die Lebensqualität der BewohnerInnen verbessert werden kann.<br />
Ähnlich verhält es sich mit den PflegehelferInnen. Die FSA bilden mit 81 % den<br />
größten Anteil jener Mitar<strong>bei</strong>terInnen, die e<strong>in</strong>e Verbesserung der Lebensqualität<br />
aufgrund der, aus e<strong>in</strong>em Schmerzassessment gewonnenen Informationen für zu-<br />
m<strong>in</strong>dest möglich halten. Ke<strong>in</strong>e der drei Berufsgruppen beantwortete diese Frage<br />
mit Ne<strong>in</strong>. Hier spiegelt sich die hohe Akzeptanz des Instruments wieder.<br />
PH<br />
FSA<br />
79
7 Diskussion der Ergebnisse<br />
Diskussion der Ergebnisse<br />
Mit Hilfe des Schmerzfragebogens wurde versucht, e<strong>in</strong>en Überblick über den<br />
Istzustand <strong>in</strong> den Vorarlberger Pflegeheimen bezüglich der Selbste<strong>in</strong>schätzung<br />
des Pflegepersonals im H<strong>in</strong>blick auf die Wahrnehmung von Schmerz <strong>bei</strong> hochde-<br />
menten BewohnerInnen zu gew<strong>in</strong>nen. Die Auswertung zeigt, dass sich die Mitar-<br />
<strong>bei</strong>terInnen h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>schätzung ihres Handlungsbedarfes überdurch-<br />
schnittlich sicher fühlen. Dies ist umso erstaunlicher, da die Frage nach dem Zeit-<br />
punkt der letzten Fortbildung zum Thema Schmerz von fast 70 % der Befragten<br />
mit „noch nie“ beantwortet wurde.<br />
Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die eigene Aufmerksamkeit nicht gleichge-<br />
setzt wird mit fachlichem Wissen bzw. mit dem Erwerb der neuesten Erkenntnisse<br />
aus der Schmerzforschung. Dies untermauert die Ansichten jener AutorInnen die<br />
davon ausgehen, dass die Pflegenden eher dazu neigen, sich auf ihre Beobachtun-<br />
gen zu verlassen und diese dann zu <strong>in</strong>terpretieren, was nicht selten zu e<strong>in</strong>er Unter-<br />
versorgung der <strong>hochdementen</strong> BewohnerInnen mit Schmerzen <strong>bei</strong>trägt.<br />
Andererseits kann das Ergebnis auch so <strong>in</strong>terpretiert werden, dass das Thema<br />
Schmerz von <strong>hochdementen</strong> <strong>Bewohnern</strong> <strong>in</strong> den Pflegeheimen durchaus präsent ist<br />
und den Pflegealltag mitbestimmt.<br />
Hilfsmittel zur <strong>Schmerzerfassung</strong> s<strong>in</strong>d den Pflegenden bekannt, angewendet wer-<br />
den sie allerd<strong>in</strong>gs nur von 37,6 % der Befragten. Hier gibt die Befragung ke<strong>in</strong>en<br />
Aufschluss darüber, welcher Berufsgruppe dieser Prozentsatz angehört. Auch las-<br />
sen sich generell ke<strong>in</strong>e auffallenden Unterschiede bezüglich Wahrnehmung und<br />
E<strong>in</strong>schätzung des Handlungsbedarfes <strong>in</strong>nerhalb der verschiedenen Berufsgruppen<br />
bzw. der Anzahl der Dienstjahre erkennen<br />
Die Implementierung e<strong>in</strong>es Instrumentes zur <strong>Schmerzerfassung</strong> erfordert Zeit. Die<br />
richtige Anwendung muss geschult werden, die Zeitpunkte der Beobachtung s<strong>in</strong>d<br />
festzulegen und die Zuständigkeit (Kompetenz) muss geklärt se<strong>in</strong>. Mit der behan-<br />
delnden Ärzteschaft ist abzusprechen, ab welchem ermittelten Punktewert mit<br />
e<strong>in</strong>er Schmerztherapie begonnen wird.<br />
Hier empfiehlt es sich e<strong>in</strong>en haus<strong>in</strong>ternen „Schmerzstandard“ auszuar<strong>bei</strong>ten, der<br />
diese Abläufe und Kompetenzräume klärt und den Mitar<strong>bei</strong>terInnen die notwen-<br />
digen Strukturen vorgibt. Wertvolle H<strong>in</strong>weise zur Ausar<strong>bei</strong>tung e<strong>in</strong>es Schmerzas-<br />
80
Diskussion der Ergebnisse<br />
sessment <strong>bei</strong> Menschen mit Demenz <strong>in</strong> der eigenen E<strong>in</strong>richtung, geben Schwer-<br />
mann und Münch. (Vgl. Schwerman/Münch 2008:114-117)<br />
Auch die Praxis zeigt, dass valide Ergebnisse nur dann erreicht werden können,<br />
wenn die Mitar<strong>bei</strong>terInnen ausreichend <strong>in</strong>formiert und geschult s<strong>in</strong>d.<br />
Die Akzeptanz e<strong>in</strong>es Instrumentes zur <strong>Schmerzerfassung</strong> ist <strong>in</strong> der Pflegeland-<br />
schaft sehr hoch. Der überwiegende Teil der Pflegenden ist überzeugt davon, dass<br />
die Anwendung e<strong>in</strong>es solchen wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität der<br />
BewohnerInnen <strong>bei</strong>tragen kann.<br />
Außerdem wird von der Mehrheit der Mitar<strong>bei</strong>terInnen angenommen, dass die<br />
Informationen, die sie aus der Anwendung e<strong>in</strong>es Instruments zur Schmerzerfas-<br />
sung erhalten, e<strong>in</strong>e Steigerung der eigenen Sicherheit und Kompetenz zur Folge<br />
hat.<br />
Mit dem E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es <strong>Schmerzerfassung</strong>s<strong>in</strong>struments können die Pflegenden<br />
fachlich besser argumentieren und die Betroffenen werden schneller e<strong>in</strong>er adäqua-<br />
ten Schmerztherapie zugeführt. Nicht zuletzt trägt e<strong>in</strong> solches Instrument dazu<br />
<strong>bei</strong>, dass Ärzteschaft und Pflege e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Sprache sprechen und der Ver-<br />
lauf e<strong>in</strong>er Schmerztherapie besser beobachtbar wird.<br />
Die Ergebnisse dieser Ar<strong>bei</strong>t können nur als Ausgangswerte gesehen werden. Um<br />
die Zuverlässigkeit der hier ermittelten Aussagen zu überprüfen ist weiterer For-<br />
schungsbedarf gegeben. Der E<strong>in</strong>satz des Assessment<strong>in</strong>struments über e<strong>in</strong>en ge-<br />
wissen Beobachtungszeitraum könnte, mit gleichzeitiger Auswertung der spezifi-<br />
schen Schmerzmittelmengen Aufschluss darüber geben, ob die Selbste<strong>in</strong>schätzung<br />
der Pflegenden e<strong>in</strong>er objektiven Beobachtung standhält. Bei den hier vorliegenden<br />
Ergebnissen muss eher von e<strong>in</strong>er Verfälschung der Objektivität ausgegangen wer-<br />
den. Durch das Fehlen der entsprechenden Fachlichkeit und durch mangelnde<br />
Selbsterfahrung ist eher anzunehmen, dass das Bewusstse<strong>in</strong> für den Schmerz <strong>bei</strong><br />
den Mitar<strong>bei</strong>terInnen nicht ausreichend vorhanden ist, um e<strong>in</strong>e objektive<br />
Schmerze<strong>in</strong>schätzung durchführen zu können.<br />
81
Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Alf, C; Bancher, C; Benke, T; et al. (2006): Neuropsychiatrie, Band 20, Nr.4, S.<br />
221 – 231. Onl<strong>in</strong>e: URL: http://www.geriatrie-<br />
onl<strong>in</strong>e.at/dynasite.cfm?dsmid=78970&dspaid=612395 (24.11.11)<br />
Alzheimer Biografie. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=325&RID=1 (03.04.2012)<br />
Alzheimer, Alois (1907): Eigenbericht. In: Allgeme<strong>in</strong>e Zeitschrift für Psychiatrie<br />
und psychisch-gerichtliche Mediz<strong>in</strong>. Band 64, S. 146-148.<br />
Basler, H.(2004): Schmerz und Alter. In: Psychologische Schmerztherapie. 5.<br />
Aufl., Spr<strong>in</strong>ger Verlag, Berl<strong>in</strong>, Heidelberg, New York, S. 193-201.<br />
Basler, H.; Hüger, D.; Kunz, R.; Luckmann, J.; Lukas, A.; Nikolaus, T. et al.<br />
(2006): Beurteilung von Schmerz <strong>bei</strong> Demenz (BESD). In: Der Schmerz 20,<br />
S. 519-526.<br />
Basler, H.(2011): Schmerz und Alter. In: Schmerzpsychopathologie: Grundlagen,<br />
Diagnostik, Krankheitsbilder , Behandlung. Hrsg: Kröner-Herwig, B.; Kl<strong>in</strong>-<br />
ger, R.; Frettlöh, J.; Nilges, P.: 7. Aufl., Spr<strong>in</strong>ger Verlag, Berl<strong>in</strong>, Heidelberg,<br />
New York, S. 209-213.<br />
Benedetti, F.; Ardu<strong>in</strong>o, C.; Costa, S.; Vighetti, S.; Tarenzi, L.; Ra<strong>in</strong>ero, I.; Asteg-<br />
giano, G.(2006): Loss of expectation-related mechanisms <strong>in</strong> Alzheimer`s<br />
disease makes analgetic therapies less effective. In: J. Pa<strong>in</strong>: Volume 121. Is-<br />
sue1, p 133-144, Onl<strong>in</strong>e: http://www.pa<strong>in</strong>journalonl<strong>in</strong>e.com/article/S0304-<br />
3959%2805%2900638-X/abstract (02.02.2012).<br />
Berna<strong>bei</strong>, R.; Gambassi, G.;Lapane, K. (1998) : Management of pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> elderly<br />
patients with cancer. JAMA 279:1877-1882.<br />
Bienste<strong>in</strong>, Ch.; Fröhlich, A. D.(2007): Basale Stimulation <strong>in</strong> der Pflege. Die<br />
Grundlagen. 4. Aufl., Kallmeyer Verlag, Seelze Velber, o. S.<br />
82
Literaturverzeichnis<br />
Brieri, D.; Reeve, R.A.; Champion, G.D. et al. (1990): The face pa<strong>in</strong> scale for the<br />
self assessment of the severity of pa<strong>in</strong> experienced by children: develop-<br />
ment, <strong>in</strong>itial validation and prelim<strong>in</strong>ary <strong>in</strong>vestigation for the ratio scale<br />
properties. Pa<strong>in</strong>, 41, p 139-150.<br />
Brooker, Dawn (2007): Person-zentriert pflegen. Das VIPS–Modell zur Pflege<br />
und Betreuung von Menschen mit Demenz. Deutschsprachige Ausgabe hg.<br />
von Müller-Hergl, Ch.; Rüs<strong>in</strong>g, D. o.S.<br />
Buch, K.; Riemenschneider, M.; Bartenste<strong>in</strong>, P.; Willoch, F.; Müller, M.;<br />
Schmolke, M.; Nolde, T.; Ste<strong>in</strong>mann, C.; Guder W.G.; Kurz, A. (2010):<br />
TAU-Prote<strong>in</strong> – e<strong>in</strong> potenzieller biologischer Indikator zur Früherkennung<br />
der Alzheimer-Krankheit? In: Der Nervenarzt, Volume 69, Number 5, S.<br />
379-385 DOI: 10.1007/s001150050286<br />
Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales und Konsumentenschutz: Hochaltrige <strong>in</strong><br />
Österreich (2009): E<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme. Hrsg.:Wien. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.uni-graz.at/ukidabww_bmask_hochaltrigen_kle<strong>in</strong>e_datei.pdf<br />
(11.12.11)<br />
Chapman, C.; Syrjala, K. (2001): Measurement of pa<strong>in</strong>. In: Bonica´s management<br />
of pa<strong>in</strong>, p 310. Hrsg.: Loeser, JD. et al. Philadelphia, Baltimore, New York,<br />
London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Lipp<strong>in</strong>cott Williams &<br />
Wilk<strong>in</strong>s.<br />
Charite Forschungsdatenbank: PAIN Intervention. Projektleitung Dräger, Dag-<br />
mar; Kreutz, Re<strong>in</strong>hold; Budnick, Andrea. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://forschungsdatenbank.charite.de/ForschungDB/ForschungDB/?wicket:<br />
bookmarkablePage=wicket-1:forschungDB.page.SuchErgebnisListePage<br />
(08.02.2012).<br />
Closs, S.J.; Barr, B.; Briggs, M.; Cash, K.; Seers, K. (2004): A Comparison of<br />
Five Pa<strong>in</strong> Assessment Scales for Nurs<strong>in</strong>g Home Residents with Vary<strong>in</strong>g<br />
83
Literaturverzeichnis<br />
Degrees of Cognitiv Impairment. Journal of Pa<strong>in</strong> and Symptom Manage-<br />
ment, 27 (3), p 196-205.<br />
DEGAM-Leitl<strong>in</strong>ie (2008): Nr.12: Onl<strong>in</strong>e: http://www.demenz-<br />
leitl<strong>in</strong>ie.de/aerzte/degamemp.html?raw=true (12.01.2012)<br />
DNQP - Expertenstandard Schmerzmanagement <strong>in</strong> der Pflege (2005): VRS Die<br />
Begriffskala (Lehmann 1994), S. 50.<br />
Epidemiologie der Demenz <strong>in</strong> Österreich (2011) Onl<strong>in</strong>e:<br />
URL:http://www.psi.co.at/demenz/epidemiologie.html (09.01.12)<br />
Erikson, Erik: Theorie der Lebensstadien und Aufgaben. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://old.pflegenetz.at/<strong>in</strong>dex.php?option=com_content&task=view&id=57<br />
&Itemid=74&limit=1&limitstart=6 (20.01.2012) o. J.<br />
Feil, Naomi (2000): Validation. E<strong>in</strong> Weg zum Verständnis verwirrter alter Men-<br />
schen. 6. Aufl., Re<strong>in</strong>hardt-Verlag, München. o. S.<br />
Ferrell, B.A., Ferrell, B. R., Osterweil, D. (1990): Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> the nurs<strong>in</strong>g home. Jour-<br />
nal of the American Geriatrics Society 38:409-414.<br />
Fischer, Peter (2008): Aktuelle Ergebnisse der VITA-Studie. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://neurologie-psychiatrie.universimed.com/artikel/demenzerkrankungen-<br />
wien-aktuelle-ergebnisse-der-vita-studie-2008 (10.01.2012)<br />
Fischer, Thomas (2007): Pflegezeitschrift 6/2007. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://charite.de/pvf/dokumente/Fischer_Pflegezeitschrift_06_07.pdf<br />
(07.02.12).<br />
Fischer, Th.; Spahn, C.; Kovach, C. (2007): Gezielter Umgang mit herausfordern-<br />
dem Verhalten <strong>bei</strong> Menschen mit Demenz. Die „Serial Trial Intervention“<br />
(STI). In: Pflegezeitschrift Nr.07, S. 370-372.<br />
Fischer, Thomas (2009): Entwicklung e<strong>in</strong>es Instruments zum Assessment von<br />
Schmerzen <strong>bei</strong> alten Menschen mit schwerer Demenz. Dissertation, S. 158.<br />
84
Onl<strong>in</strong>e:<br />
Literaturverzeichnis<br />
http://www.diss.fuberl<strong>in</strong>.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_der<br />
ivate_000000005812/Dissertation_Abgabefassung.pdf?hosts=local<br />
(06.02.12)<br />
Fischer, Thomas (2008-2010): Ergebnisbericht. Studie: Wirksamkeit der deut-<br />
schen Version der Serial Trial Intervention zur ursachenbezogenen Redukti-<br />
on von herausforderndem Verhalten <strong>bei</strong> Menschen mit Demenz.<br />
http://medsoz.charite.de/fileadm<strong>in</strong>/user_upload/microsites/m_cc01/medsoz/<br />
STI-D_Projektbericht.pdf (20.01.2012).<br />
Fischer, Thomas: Schmerzassessment <strong>bei</strong> älteren Menschen <strong>in</strong> der stationären<br />
Altenhilfe. Onl<strong>in</strong>e: http://www.ehs-dresden.de/<strong>in</strong>dex.php?id=997<br />
(21.01.2012).<br />
Folste<strong>in</strong>, M.F; Folste<strong>in</strong>, S.E; Mc Hugh, P.R. (1975): M<strong>in</strong>i Mental State: a practical<br />
method for grad<strong>in</strong>g the cognitive state of patients for the cl<strong>in</strong>ician. In: Jour-<br />
nal of Psychiatric. Research,. 3,. p. 189-198.<br />
Fröhlich, L.; Padberg, F. (2005): In: Allgeme<strong>in</strong>e Pathophysiologie der Alzheimer-<br />
Demenz <strong>in</strong> der Gerontopsychiatrie. Hrsg.: Bergener, M.; Hampel, H.; Möl-<br />
ler, M.; Zaudig, M.; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, S. 193-<br />
233.<br />
Förstl, H; Kurz, A; Hartmann, T. (2009): Kpt.4.Alzheimer-Demenz. In: Demen-<br />
zen <strong>in</strong> Theorie und Praxis. 2. Auflage, Spr<strong>in</strong>ger Verlag Mediz<strong>in</strong>, Heidelberg,<br />
S. 4 und S. 44.<br />
Frogatt, K.A.; Downs, M.; Small, N. (2006): Person centred care for people with<br />
dementia. Onl<strong>in</strong>e: http://en.scientificcommons.org/32532154 (29.02.2012).<br />
Ganß, M. (2009): Alzheimer – die große Unbekannte. In: Demenz - DAS MA-<br />
GAZIN, Jhg. 09, Ausgabe 3, S. 10-13.<br />
85
Literaturverzeichnis<br />
Halek,M.; Bartholomeyczik, S. (2006): Verstehen und Handeln. Forschungser-<br />
gebnisse zur Pflege von Menschen mit Demenz und herausforderndem Ver-<br />
halten. Onl<strong>in</strong>e: http://www.gender-<br />
ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g.net/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-<br />
Anlagen/Demenz-aktuelle-Foschung-und-<br />
Projekte,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf#page=33<br />
(22.01.12)<br />
Hampel, Harald (2010): Neue Wege zur Früherkennung und Therapie? Fachvor-<br />
trag. Onl<strong>in</strong>e: http://elearn<strong>in</strong>g.med.uni-<br />
frankfurt.de/IZN/Hampel/IZN_Hampel.html (12.01.2012)<br />
Harrison, A. (1991): Assess<strong>in</strong>g patients´s pa<strong>in</strong>: identify<strong>in</strong>g reasons for error. Jour-<br />
nal of Advanced Nurs<strong>in</strong>g 16:1018-1025.<br />
Hatch, F.; Maietta, L. (2003): K<strong>in</strong>ästhetik. Gesundheitsentwicklung und mensch-<br />
liche Aktivitäten. Urban Fischer Verlag, München, o. S.<br />
Herr, K.; Bjoro, K.; Decker, S. (2006): Tools for Assessment of Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> Nonverbal<br />
Older Adults with Dementia: A State-of-the-Sience Review. Journal of Pa<strong>in</strong><br />
and Symptom Management 31:170-192.<br />
Herr, K.; Garand, L. (2001): Assessment and measurement of pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> older adults.<br />
Cl<strong>in</strong> Geriatr Med 17 (3):457-478.<br />
Heun, R.; Kölsch, H. (2005): Demenzen. Hrsg.: Claus-Werner Wallesch, Hans<br />
Förstl. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, S. 16.<br />
Horgas, Ann; PhD, RN, FGSA, FAAN Miller, Lois PhD, RN, FGSA. (2008):<br />
Pa<strong>in</strong> Assessment <strong>in</strong> People with Dementia: AJN, American Journal of Nurs-<br />
<strong>in</strong>g: July 2008 Volume 108 - Issue 7 - p 62–70 DOI:<br />
10.1097/01.NAJ.0000325648.01797.fc<br />
Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Def<strong>in</strong>ition des Schmer-<br />
zes durch IASP. Onl<strong>in</strong>e: http://www.pflegem<strong>in</strong>usschmerz.at (27.01.2012)<br />
86
Literaturverzeichnis<br />
Jensen, M.P.; Turner, J.A.; Romano, J.M. (1994): What is the maximum number<br />
of levels <strong>in</strong> pa<strong>in</strong> <strong>in</strong>tensity measurement? Pa<strong>in</strong>, 58 (3), p. 387-392.<br />
Jones, G. & Mcfarlane, G. (2005): Epidemiologie of Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> Older Persons. In:<br />
Gibson, S.; We<strong>in</strong>er, D.; (edts): Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> Older Persons. Progress <strong>in</strong> Pa<strong>in</strong> Re-<br />
search and Management, Vol. 35. S. 3-22.<br />
Jung, C.G.: http://ar<strong>bei</strong>tsblaetter.stangl-<br />
taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PSYCHOLOGEN/Jung.shtml<br />
(28.01.2012)<br />
Kamel, H.K.; Phlavan, M.; Malekgoudarzi, B.; Gogel, P.; Morley, J.E. (2001):<br />
Utiliz<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong> assessment scales <strong>in</strong>creases the frequency of diagnos<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong><br />
among elderly nurs<strong>in</strong>g home residents. J Pa<strong>in</strong> Symptom Manage 21:450.<br />
Kasper, Roman (2009): Psychometrische Beurteilung verhaltensgestützter<br />
Schmerzassessments für Menschen mit Demenz. Dissertation. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://archiv.ub.uniheidelberg.de/volltextserver/volltexte/2009/9946/pdf/Kas<br />
par_2009_Dissertation.pdf.<br />
Kitwood, Tom (2008): Demenz. Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit<br />
verwirrten Menschen (deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Chris-<br />
tian Müller-Hergl), 5. Aufl., Huber Verlag, Bern.<br />
Klaschik, E. (2006): In: Huseboe u. Klaschik, Palliativmediz<strong>in</strong>: Grundlagen und<br />
Praxis, 4. Aufl., Spr<strong>in</strong>ger Verlag, Heidelberg, S. 396-397.<br />
Kostrzewa, St. (2008): Palliative Pflege von Menschen mit Demenz. Hans Huber<br />
Verlag, Bern.<br />
Krämer, G.; Förstl, H. (2008): Alzheimer und andere Demenzformen. Trias Ver-<br />
lag, Stuttgart. O. S.<br />
Kruwelitsch, H.; London, M.R.; Skakel, V.J.; Lundstedt, G.; Thomason, H.;<br />
Brummel-Smith, K. (2000): Assessment of pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> cognitively impaired<br />
87
Literaturverzeichnis<br />
older adults: A comparison of pa<strong>in</strong> assessment tools and their use by non-<br />
professional caregivers. Journal of the American Geriatrics Society 48 (12):<br />
p. 1607-1611.<br />
Kruwelitsch, H.; London, M.R.; Skakel, V.J.; Lundstedt, G.; Thomason, H.;<br />
Brummel-Smith, K. (2001): Assessment of pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> cognitively impaired<br />
older adults: A comparison of pa<strong>in</strong> assessment tools and their use by non-<br />
professional caregivers Journal of the American Geriatrics Society 49:<br />
1397-1398.<br />
Kuhlmey, A. (2011): Wirksamkeit der deutschen Version der Serial Trial Inter-<br />
vention zur ursachenbezogenen Reduktion von herausforderndem Verhalten<br />
<strong>bei</strong> Menschen mit Demenz (STI-D) ISRCTN 6139 7797. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://medsoz.charite.de/fileadm<strong>in</strong>/user_upload/microsites/m_cc01/medsoz/<br />
STI-D_Projektbericht.pdf (08.02.2012)<br />
Kunz, Miriam (2006): Veränderungen <strong>in</strong> der Schmerzverar<strong>bei</strong>tung <strong>bei</strong> Demenzpa-<br />
tienten: subjektive, mimische, motorische und vegetative Indikatoren. Dis-<br />
sertationsschrift, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.<br />
Kunz, Miriam (2007): Schmerz und Demenz. Experimentelle Untersuchung<br />
multidimensionaler Schmerz<strong>in</strong>dikatoren. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrü-<br />
cken.<br />
Kunz, Roland (2002): Palliative Mediz<strong>in</strong> für ältere Menschen. In: Schweiz Med<br />
Forum Nr. 5, o. S.<br />
Leonhardt, C.; Laekeman, M. (2010): Schmerz und Bewegungsangst im Alter.<br />
E<strong>in</strong>e Übersichtsar<strong>bei</strong>t. In: Schmerz 2010. 24:561-568. DOI 10.1007/s00482-<br />
010-0976-1<br />
Likar, R., Bernatzky, G. (2004): Patientenführung, Compliance und Lebensquali-<br />
tät <strong>bei</strong> Tumorpatienten. In: Schmerzbehandlung <strong>in</strong> der Palliativmediz<strong>in</strong>.<br />
Bernatzky, Sittl, Likar (Hrsg.), Spr<strong>in</strong>ger Verlag, Wien, New York, S. 33-34.<br />
88
Literaturverzeichnis<br />
Likar, Rudolf (2011): Schmerz im Alter. In: Ärzte Woche Nr. 25. Aufl. 17144,<br />
Auftrag Nr. 1134,Wien Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://oesg.t3hoster.de/fileadm<strong>in</strong>/schmerzgesellschaft/pdf/Jahrestagung_201<br />
1/AErzte_Woche_24.6.2011_Schmerz_im_Alter.pdf (03.02.12)<br />
Lukas, A.(2008): Schmerzmessung im Alter. In: Schmerztherapie Nr.4/2008 (24.<br />
Jg.) o. S.<br />
Maturana, H.; Varela, F.(1990): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen<br />
Wurzeln des menschlichen Erkennens. Goldmann Verlag, Berl<strong>in</strong>, o. S.<br />
Mc Grath, P.A.; Seifert, C.E.; Speechley, K.N.; Booth, J.C. (1996): A new analo-<br />
gue scale for assess<strong>in</strong>g children´s pa<strong>in</strong>: An <strong>in</strong>itial validation study. Pa<strong>in</strong>, 64<br />
(3), p. 435 - 443.<br />
McCaffery, M.; Pasero, C. (1999): Pa<strong>in</strong> Cl<strong>in</strong>ical Manual. 2nd edition ed. St. Louis<br />
Mosby. S. 17.<br />
McCaffery, M.; Beebe, A.; Latham, J. (1997): Schmerz. E<strong>in</strong> Handbuch für die<br />
Pflegepraxis. Übersetzer: Villwock,U. Hrsg. Osterbr<strong>in</strong>k, J. Vol 1. Berl<strong>in</strong>,<br />
Wiesbaden: Ullste<strong>in</strong> Mosby GmbH&Co.KG<br />
Meyer, Bernd (2009): In: Philosophische Grundlagen <strong>in</strong> Konzepten zur Beglei-<br />
tung demenziell erkrankter Menschen. Wissenschaftliche Studie. GRIN<br />
Verlag, Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany, S. 70-77.<br />
Moreau, Jean-Luc (2011): Grundlagen der Demenzmediz<strong>in</strong>. Kap.2.1.1 bis 2.1.2.<br />
In: Demenz verstehen – E<strong>in</strong> Leitfaden für die Praxis. Hrsg.: Andrea<br />
Mühlegg-Weibel. o. S.<br />
Morrison, R.S.; Siu, A.L. (2000): A comparison of pa<strong>in</strong> and its treatment <strong>in</strong> ad-<br />
vanced dementia and cognitively <strong>in</strong>tact patients with hip fracture. Pa<strong>in</strong><br />
Symptom Management 19:240-248.<br />
89
Literaturverzeichnis<br />
Nickel, R.; Raspe, H.H. (2001): Chronischer Schmerz. Epidemiologie und Inan-<br />
spruchnahme. In: Nervenarzt 72, S. 897-906.<br />
Öhl<strong>in</strong>ger, R.; Schneider, R.; Dorfmeister, G. (2010): Demenzgerechte Pflege und<br />
Betreuung. Hrsg.: SeneCura Kl<strong>in</strong>iken und Heime. Neuer wissenschaftlicher<br />
Verlag, Wien Graz, S. 75-79.<br />
Osterbr<strong>in</strong>k, J. (2003): Schmerzmanagement – Aufgabe der Pflege? In: Die<br />
Schwester/Der Pfleger, Heft 9, S. 8-13.<br />
Österreichische Gesellschaft für Geriatrie & Gerontologie (2007): Mediz<strong>in</strong>, Medi-<br />
en, Austria. Onl<strong>in</strong>e: http://www.geriatrie-<br />
onl<strong>in</strong>e.at/dynasite.cfm?dsmid=78970&dspaid=612395 ((09.01.12)<br />
Pasero, C.; McCaffery, M. (2005): No Self-Report Means No Pa<strong>in</strong>-Intensity Rat-<br />
<strong>in</strong>g: Assess<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> patients who cannot provide a report. American Jour-<br />
nal of Nurs<strong>in</strong>g, 105 (10), p. 50-53.<br />
Rab<strong>in</strong>s, Peter V.; Lyketsos, Constant<strong>in</strong>e G.; Steele, Cynthia D. (2006): Practical<br />
Dementia Care. Oxford University Press. 19.01.2006, o.S.<br />
Richter, B.; Richter, R.W. (2004): Alzheimer <strong>in</strong> der Praxis. Huber Verlag, Bern,<br />
o.S.<br />
Rogers, C.: Die Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Fischer Verlag<br />
Frankfurt a. Ma<strong>in</strong>, o.J.<br />
Schmidl, Mart<strong>in</strong>a (2004): Probleme der Schmerzerkennung <strong>bei</strong> dementen alten<br />
Menschen. Aus: Schmerzbehandlung <strong>in</strong> der Palliativmediz<strong>in</strong>. Bernatzky,<br />
Sittl, Likar (Hrsg.), Spr<strong>in</strong>ger Verlag, Wien, S. 25 und S. 28<br />
Schmitke, Klaus (2006): Demenzen: Untersuchungen und Behandlungen <strong>in</strong> der<br />
Facharztpraxis. W. Kohlhammer Verlag GmbH, Stuttgart, S. 13.<br />
Schönknecht, P.; Pantel, J.; Hartmann, T.; Werle, E.; Volkmann, M.; Essig, M.;<br />
Amann, M.; Zanabili, N.; Bardenheuer, H.; Hunt, A.; Schröder, J. (2003):<br />
90
Literaturverzeichnis<br />
Cereprosp<strong>in</strong>al fluid tau levels <strong>in</strong> Alzheimer´s disease are elevated when<br />
compared with vascular dementia, but do not correlate with measures of ce-<br />
rebral atrophy. Psychiatry Research Volume 120 Issue 3 Pages 231-238 15<br />
Oct. 2003<br />
Schuler, M.; Becker, S.; Kaspar, R.; Nikolaus, T.; Kruse, A.; Basler; H.D. (2007):<br />
Psychometric properties of the German "Pa<strong>in</strong> Assessment <strong>in</strong> Advanced De-<br />
mentia Scale" (PAINAD-G) <strong>in</strong> nurs<strong>in</strong>g home residents. S.43. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619037 (07.02.2012).<br />
Schuler, Mathias (2004): Schmerz und Demenz. Vortrag. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.forum-demenz-<br />
wiesbaden.de/downloads/Dr._Matthias_Schuler_Schmerz_und_Demenz.pdf<br />
(07.02.2012)<br />
Schwermann, M.; Münch, M. (2008): Professionelles Schmerzassessment <strong>bei</strong><br />
Menschen mit Demenz. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart. S. 7 und S. 114-<br />
117.<br />
Seidl, U.; Lueken, U.; Völker, L.; Re, S.; Becker, S.; Kruse, A.; Schröder, J.<br />
(2007): Fortschr. Neurol. Psychiatr. 75 (12): 720-727. DOI: 10.1055/s-2007-<br />
959211. Thieme Verlag Stuttgart New York<br />
Snowdon, David. (2007): Nonnenstudie Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.mc.uky.edu/coa/faculty/snowdon.html (13.01.2012)<br />
Sperl<strong>in</strong>g, R.; Johnson, K. (2010): Can biomarkers be gold standards <strong>in</strong> Alzhei-<br />
mer´s disease? Alzheimer´s Research & Therapy. Volume 2 Number 3 17<br />
DOI: 10.1186/alzrt 41<br />
Thürauf, Norbert et al. (2005): Kl<strong>in</strong>ische Diagnostik der Alzheimer-Demenz <strong>in</strong><br />
der Gerontopsychiatrie. Hrsg.: Bergener, M.; Hampel H.; Möller, H.;<br />
Zaudig, M. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart. S. 273- 295.<br />
91
Literaturverzeichnis<br />
Turk, D.C.; Okifuji, A. (1999): Assessmant of patients´report<strong>in</strong>g of pa<strong>in</strong>: An <strong>in</strong>te-<br />
grated perspective. Lancet 353:1784-1788.<br />
Van der Kooij, Cora. (2007): E<strong>in</strong> Lächeln im Vorübergehen. Erlebensorientierte<br />
Altenpflege mit Hilfe der Mäeutik. Huber Verlag, Bern.<br />
Vollmar, H.; Mand, P.; Butzlaff, M.E. (2008): DEGAM- Leitl<strong>in</strong>ie Nr. 12 Demenz<br />
Onl<strong>in</strong>e: http://en.scientificcommons.org/37479838 (29.02.2012).<br />
Wappelshammer, Elisabeth (2011): Flüchtige Gewissheiten (DCM). In: Praxis<br />
Palliative Care Nr.11, Jhg.2011, S. 42-43.<br />
Warden, V.; Hurley, A.; Volicer L. (2003): Development and psychometric eval-<br />
uation of the Pa<strong>in</strong> Assessment <strong>in</strong> Advanced Dementia (PAINAD) Scale.<br />
Journal of the American Medical Directors Association. 4; p. 9-15.<br />
Weissenberger-Leduc, M. (2009): Palliativpflege <strong>bei</strong> Demenz. Spr<strong>in</strong>ger Verlag,<br />
Wien, New York. S. 10-13.<br />
Whitehouse, Peter, J. (2009): Mythos Alzheimer. Verlag Hans Huber, Bern. O. S.<br />
WHO: Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10, Kap. V (F)<br />
(2005): Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis. Hrsg.: Horst Dil-<br />
l<strong>in</strong>g Huber Verlag, Bern.<br />
Yong, H.H.; Bell, R.; Workman, B.; Gibson S.J. (2003): Psychometric properties<br />
of the Pa<strong>in</strong> Attitudes Questionnaire (revised) <strong>in</strong> adult patient with chronic<br />
pa<strong>in</strong>. o.S.<br />
Zaudig, M.; Möller, H.J. (2005): Historischer H<strong>in</strong>tergrund, Kl<strong>in</strong>ik und Verlauf der<br />
Alzheimer-Demenz <strong>in</strong> der Gerontopsychiatrie. Hrsg.: Bergener, M. Hampel;<br />
H. Möller; H., Zaudig, M. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,<br />
S. 187-193.<br />
Zwakhalen, Sandra M.G.; Hamers Jan P.H.; Abu-Saad, Huda H.; Berger, Martijn<br />
P.F. (2006): Pa<strong>in</strong> <strong>in</strong> elderly people with severe dementia: A systematic re-<br />
92
view of behavioural pa<strong>in</strong> assessment tools. Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/6/3 (20.12.2011)<br />
Zwischenbilanz der Vita Studie (2005): Onl<strong>in</strong>e: http://neurologie-<br />
Literaturverzeichnis<br />
psychiatrie.universimed.com/artikel/demenz-zwischenbilanz-der-vita-studie<br />
(09.01.12)<br />
93
Anhang<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Schmerzfragebogen Teil 1<br />
Kennen Sie Hilfsmittel zur<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong> bzw. zur<br />
Bestimmung der Schmerzstärke?<br />
Wird <strong>in</strong> Ihrem Haus e<strong>in</strong><br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen<br />
angewendet?<br />
Von welchen der folgenden<br />
<strong>Schmerzerfassung</strong>sassessments<br />
haben Sie schon gehört?<br />
Ergebnis: BESD 7, ECPA 106, Doloplus 5, Sonstige 44<br />
137 25<br />
JA NEIN<br />
61 101<br />
JA NEIN<br />
1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre noch nie<br />
Wann hatten Sie Ihre letze<br />
4<br />
Fortbildung zum Thema "Schmerz"? 16 16 20 110<br />
5<br />
6<br />
ganz sicher eher ja eher ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong><br />
Wenn e<strong>in</strong>er Ihrer Bewohner<br />
Schmerzäußerungen macht, fühlen<br />
Sie sich sicher <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>schätzung<br />
Ihres Handlungsbedarfes? 21 110 26 8<br />
Glauben Sie, dass Ihnen e<strong>in</strong><br />
Assessmentbogen <strong>bei</strong> der<br />
E<strong>in</strong>schätzung des Schmerzes hilfreich<br />
se<strong>in</strong> kann? 61 86 17 1<br />
Wenn Sie <strong>bei</strong>gefügten ECPA- Bogen<br />
durchlesen, glauben Sie, dass die<br />
daraus gewonnen Informationen<br />
7<br />
Ihnen mehr Sicherheit <strong>in</strong> der<br />
E<strong>in</strong>schätzung des Handlungsbedarfes<br />
ganz sicher eher ja eher ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong><br />
geben können? 54 94 12 2<br />
8<br />
Die Befragung bezieht sich nur auf Bewohner mit fortgeschrittener Demenz und<br />
den damit verbundenen kognitiven Defiziten<br />
BESD/PAINAD<br />
BISAD/ECPA<br />
DOLOPLUS<br />
Sonstige<br />
Wenn Sie <strong>bei</strong>gefügten ECPA- Bogen<br />
durchlesen, können Ihnen die daraus<br />
gewonnenen Informationen mehr<br />
Kompetenz z.B. <strong>in</strong> der Argumentation<br />
dem Arzt gegenüber, geben? 26 105 29 2<br />
Anhang<br />
94
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
Wenn Sie <strong>bei</strong>gefügten ECPA- Bogen<br />
durchlesen glauben Sie, dass die<br />
daraus gewonnenen Informationen<br />
Ihnen mehr Aufmerksamkeit zum<br />
Thema "Schmerz" geben können?<br />
77 73 10 2<br />
Wenn Sie <strong>bei</strong>gefügten ECPA- Bogen<br />
durchlesen glauben Sie, dass die<br />
daraus gewonnen Informationen<br />
dienlich se<strong>in</strong> können, die<br />
Lebensqualität der BewohnerInnen<br />
zu verbessern? 82 64 15 1<br />
sehr hoch hoch wenig gar nicht<br />
Wie hoch schätzen Sie Ihre<br />
Aufmerksamkeit zum Begriff<br />
"Schmerz" <strong>in</strong> ihrem Pflegealltag e<strong>in</strong>? 61 85 15 1<br />
Wie hoch schätzen Sie <strong>in</strong> Ihrem<br />
Ar<strong>bei</strong>tsumfeld den Anteil jener<br />
BewohnerInnen e<strong>in</strong>, die an<br />
Schmerzsymptomen leiden? 24 100 37 1<br />
Anhang<br />
95
Anhang<br />
96
Anhang<br />
97
Anhang<br />
98
Begleitschreiben zum Teil 1 des Fragebogens<br />
Liebe Kolleg<strong>in</strong>, lieber Kollege!<br />
Anhang<br />
Me<strong>in</strong> Name ist Kar<strong>in</strong> Andreis und ich ar<strong>bei</strong>te als PDL im Sozialzentrum Laute-<br />
rach.<br />
Im Rahmen me<strong>in</strong>es Studiums (Pflegemanagement) schreibe ich derzeit an me<strong>in</strong>er<br />
Masterar<strong>bei</strong>t zum Thema „<strong>Schmerzerfassung</strong> <strong>bei</strong> <strong>hochdementen</strong> <strong>Bewohnern</strong>“. Ich<br />
bitte Sie um Ihre Mithilfe, um e<strong>in</strong>e Situationsanalyse erstellen zu können.<br />
Die Befragung erfolgt <strong>in</strong> zwei Schritten.<br />
Schritt e<strong>in</strong>s:<br />
Sie erhalten e<strong>in</strong>en Fragebogen, dem e<strong>in</strong> <strong>Schmerzerfassung</strong>sbogen (ECPA) <strong>bei</strong>ge-<br />
legt ist.<br />
Bitte lesen Sie sich den ECPA-Bogen e<strong>in</strong>mal durch (e<strong>in</strong>ige Fragen beziehen sich<br />
darauf) und wenden Sie ihn zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> der Praxis <strong>bei</strong> e<strong>in</strong>em/e<strong>in</strong>er hoch-<br />
dementen, <strong>in</strong> der Kommunikation stark e<strong>in</strong>geschränkten BewohnerIn an.<br />
Ich bitte Sie, den ausgefüllten Fragebogen (bitte geklammert lassen) anschließend<br />
<strong>in</strong> der dafür vorgesehenen Box zu deponieren.<br />
Schritt zwei:<br />
E<strong>in</strong> weiterer (kurzer) Fragebogen wird im Anschluss an Sie verteilt. Die dar<strong>in</strong><br />
enthaltenen Fragen zu Ihrer Person dienen ausschließlich statistischen Zwecken!<br />
Die Befragung erfolgt anonym!<br />
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!<br />
Liebe Grüße<br />
Zur Erklärung :<br />
Gegenstand der Befragung ist nicht die Beurteilung des ECPA-Bogens im H<strong>in</strong>-<br />
blick auf se<strong>in</strong>e Tauglichkeit für die Schmerze<strong>in</strong>schätzung, sondern ob mittels ei-<br />
nes solchen Assessments die Aufmerksamkeit der Pflege auf die Thematik<br />
„Schmerz“ verstärkt werden kann.<br />
99
Begleitschreiben zum Teil 2<br />
Liebe Kolleg<strong>in</strong>, lieber Kollege!<br />
Mit diesem Schreiben erhalten Sie den zweiten Teil me<strong>in</strong>es Fragebogens.<br />
Bitte deponieren Sie ihn <strong>bei</strong> Ihrer Wohnbereichsleitung.<br />
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!<br />
Liebe Grüße<br />
Anhang<br />
100