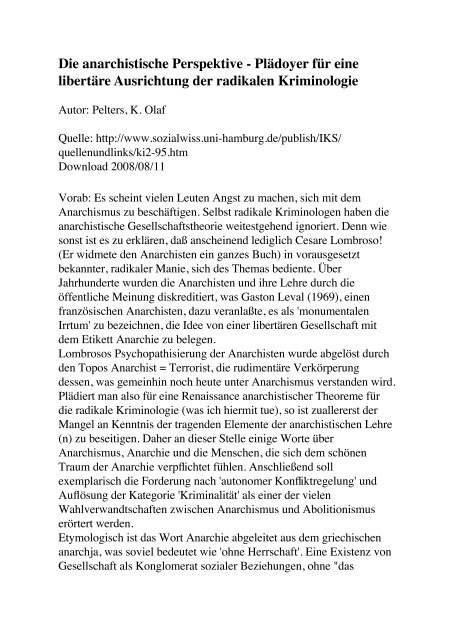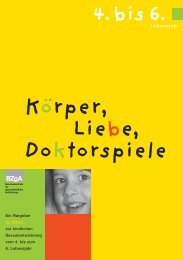Die anarchistische Perspektive - Zurück zu www.KHeck.info
Die anarchistische Perspektive - Zurück zu www.KHeck.info
Die anarchistische Perspektive - Zurück zu www.KHeck.info
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>anarchistische</strong> <strong>Perspektive</strong> - Plädoyer für eine<br />
libertäre Ausrichtung der radikalen Kriminologie<br />
Autor: Pelters, K. Olaf<br />
Quelle: http://<strong>www</strong>.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/IKS/<br />
quellenundlinks/ki2-95.htm<br />
Download 2008/08/11<br />
Vorab: Es scheint vielen Leuten Angst <strong>zu</strong> machen, sich mit dem<br />
Anarchismus <strong>zu</strong> beschäftigen. Selbst radikale Kriminologen haben die<br />
<strong>anarchistische</strong> Gesellschaftstheorie weitestgehend ignoriert. Denn wie<br />
sonst ist es <strong>zu</strong> erklären, daß anscheinend lediglich Cesare Lombroso!<br />
(Er widmete den Anarchisten ein ganzes Buch) in vorausgesetzt<br />
bekannter, radikaler Manie, sich des Themas bediente. Über<br />
Jahrhunderte wurden die Anarchisten und ihre Lehre durch die<br />
öffentliche Meinung diskreditiert, was Gaston Leval (1969), einen<br />
französischen Anarchisten, da<strong>zu</strong> veranlaßte, es als 'monumentalen<br />
Irrtum' <strong>zu</strong> bezeichnen, die Idee von einer libertären Gesellschaft mit<br />
dem Etikett Anarchie <strong>zu</strong> belegen.<br />
Lombrosos Psychopathisierung der Anarchisten wurde abgelöst durch<br />
den Topos Anarchist = Terrorist, die rudimentäre Verkörperung<br />
dessen, was gemeinhin noch heute unter Anarchismus verstanden wird.<br />
Plädiert man also für eine Renaissance <strong>anarchistische</strong>r Theoreme für<br />
die radikale Kriminologie (was ich hiermit tue), so ist <strong>zu</strong>allererst der<br />
Mangel an Kenntnis der tragenden Elemente der <strong>anarchistische</strong>n Lehre<br />
(n) <strong>zu</strong> beseitigen. Daher an dieser Stelle einige Worte über<br />
Anarchismus, Anarchie und die Menschen, die sich dem schönen<br />
Traum der Anarchie verpflichtet fühlen. Anschließend soll<br />
exemplarisch die Forderung nach 'autonomer Konfliktregelung' und<br />
Auflösung der Kategorie 'Kriminalität' als einer der vielen<br />
Wahlverwandtschaften zwischen Anarchismus und Abolitionismus<br />
erörtert werden.<br />
Etymologisch ist das Wort Anarchie abgeleitet aus dem griechischen<br />
anarchja, was soviel bedeutet wie 'ohne Herrschaft'. Eine Existenz von<br />
Gesellschaft als Konglomerat sozialer Beziehungen, ohne "das
Dazwischentreten einer Macht, die 'leitet, schulmeistert und<br />
bestraft' (R‚clus) war schon Aristoteles (384-322 v.Chr.) höchst<br />
suspekt, er hielt Anarchie schlechthin für den 'Zustand der Sklaven<br />
ohne Herrn'. Thomas Hobbes (1651) verglich die Anarchie mit dem<br />
Natur<strong>zu</strong>stand des Menschen. <strong>Die</strong>ser bedeute bekannterweise den<br />
'Krieg aller gegen alle'. Moses Mendelssohn (1729 - 1786) bezeichnete<br />
Anarchie als 'Geist des Widerspruchs', als 'positive Urform von<br />
Gemeinschaft und Gesellschaft', als 'Stütze der Freiheit'. Kant (1798)<br />
definierte Anarchie als 'Gesetz und Freiheit, ohne Gewalt'. Kant<br />
assoziierte mit dem Zustand der Herrschaftslosigkeit also nicht den<br />
völligen Zerfall einer Gesellschaft, den Krieg aller gegen alle, sondern<br />
er sah durchaus die Existenz von gesellschaftlichen Regeln unabhängig<br />
von Herrschaft. Kants und Mendelssohns Vorstellungen kommen<br />
denen der Anarchisten schon sehr nahe, sie skizzieren essentielle<br />
Wesensmerkmale der <strong>anarchistische</strong>n Theorie. Heut<strong>zu</strong>tage wird<br />
Anarchie jedoch günstigstenfalls als eine temporäre Erscheinung<br />
diskutiert, im Sinne eines Automatismus, als die Zeit des Übergangs<br />
zwischen der Auflösung überkommener Herrschaft und der<br />
Herausbildung neuer Herrschaftsformen.<br />
Anarchismus ist die Lehre von der Herrschaftslosigkeit. Man könnte<br />
den Anarchismus als Inbegriff aller Argumente und Postulate, aller<br />
Haltungen und Handlungen bezeichnen, welche die Herrschaft als<br />
solche ablehnen, sofern ihr Menschen unterworfen sind, und zwar<br />
ohne Rücksicht auf die jeweilige Form des Machtgebildes. Der<br />
Anarchismus stellt die individuelle Freiheit des Menschen in den<br />
Mittelpunkt seiner Überlegungen <strong>zu</strong>r Konzeptualisierung von<br />
Gesellschaft. Das langfristige Ziel der Anarchisten war und ist die<br />
Abschaffung des Staates, der als höchste Organisationsform von<br />
Herrschaft die freie Entfaltung von Individuum und Gesellschaft<br />
untergräbt und stattdessen die Umklammerung der Menschen 'von der<br />
Wiege bis <strong>zu</strong>r Bahre' (Kropotkin 1972) vollzieht. Darüberhinaus wird<br />
die Notwendigkeit eines positiven Rechtssystems abgelehnt.<br />
Traditionen, Sitten und Gebräuche, also naturrechtliche Essentials sind<br />
bei der Gestaltung einer pazifistisch ausgerichteten Gesellschaft, die ein<br />
maximales Quantum an Pluralismus und Individualität bereithält,<br />
effektiver als geschriebenes Recht.<br />
Heut<strong>zu</strong>tage ist unverkennbar, daß Anarchisten die Utopie einer
Nivellierung des Leviathans in den Hintergrund rücken, <strong>zu</strong>gunsten<br />
einer mehr pragmatischen Ausrichtung, die überall da sichtbar wird,<br />
wo 'die Ausdehnung des Raumes für freie Handlungen' (Paul<br />
Goodman) betrieben wird. <strong>Die</strong>s wiederum ist überall da der Fall, wo<br />
autonomes Leben nach dem <strong>anarchistische</strong>n Prinzip 'Try and Error'<br />
probiert und mehr Unabhängigkeit vom Staat erreicht wird. Staatliche<br />
Defizite, vor allem im sozialen Bereich, werden oftmals kompensiert<br />
durch die Eigeninitiative von Individuen, Gruppen (z.B. durch die<br />
Gründung von Elterninitiativen, freien Schulen, selbstverwalteten<br />
Betrieben etc). Nahe<strong>zu</strong> für jedes Anliegen gibt es heut<strong>zu</strong>tage<br />
Verbände, Vereine und Initiativen, die ihre Interessen selbst in die<br />
Hand nehmen, da sie 'die Schnauze voll haben' von staatlichen<br />
Direktiven, die all<strong>zu</strong>oft nur un<strong>zu</strong>reichend Bedürfnisbefriedigung in<br />
Aussicht stellen. <strong>Die</strong>jenigen, die initiativ werden, würden sich zwar in<br />
der Mehrzahl nie als Anarchisten bezeichnen, dieses sogar entrüstet<br />
ablehnen. Das ändert aber nichts daran, daß sie <strong>anarchistische</strong> Werte<br />
(Individualität, Spontanität, Mut <strong>zu</strong>m Risiko und vor allem die<br />
Ablehnung von Herrschaft) umsetzen.<br />
Ist der Anarchismus wohl die radikalste der existierenden<br />
Gesellschaftstheorien, da er mit dem Staat nichts am Hut hat, so stellt<br />
der Abolitionismus die radikalste Strömung innerhalb der Kriminologie<br />
dar. <strong>Die</strong> Abolitionisten sehen ihre Aufgabe nicht darin, der Utopie<br />
einer Überwindung des 'Kriminalitätsproblems' hinterher<strong>zu</strong>laufen,<br />
sondern Konstruktionsskizzen einer Gesellschaft bereit<strong>zu</strong>stellen, die<br />
gerechtere Sozialstrukturen aufweist und so in der Lage ist,<br />
Kriminalität, subsumiert unter die Kategorie 'Konflikte'(vgl.Hanak/<br />
Stehr/Steinert 1989), im Interesse der jeweiligen Konfliktparteien<br />
gewaltarm <strong>zu</strong> regeln. Der Topos 'Nullum crimen sine lege' bedeutet aus<br />
abolitionistischer Sicht die (herrschaftssichernde) Funktion des<br />
positiven (Straf-) Rechtssystems und seine oft blessurenreiche<br />
Auswirkung auf deviante Individuen/Gruppen bloß<strong>zu</strong>legen. Devianz<br />
wird somit nicht als primäres Wesensmerkmal amoralischer Subjekte<br />
gesehen, sondern ist Prüfstein für die Funktionalität von Rechtsregeln<br />
und <strong>zu</strong>gleich auch Indikator des gesellschaftlichen status quo. Es geht<br />
also nicht um Plädoyers für mehr 'Weißmacher' und Terminatoren, für<br />
eine mit allen technischen Raffinessen ausgestattete brillierende Polizei,<br />
die den Kriminalitätssumpf ein für alle mal trockenlegt, sondern um die
Erkenntnis, daß (nicht erst seit Durkheim) Abweichung - welcher Art<br />
auch immer - <strong>zu</strong>m normalen Handlungsrepertoire des Menschen gehört<br />
und eine Bereicherung (im Sinne von mehr Individualität) jeder<br />
Gesellschaft sein kann. Auf der Grundlage eines antizipierten neutralen<br />
Menschenbildes verlangt der Abolitionismus nach der Möglichkeit,<br />
Konflikte aus dem Strafrecht heraus<strong>zu</strong>katapultieren und - im Sinne von<br />
mehr Gerechtigkeit für Täter und Opfer - autonom <strong>zu</strong> regeln. Mit der<br />
Zeit können sich ungeahnte Erfahrungsschätze auftun, die helfen, in<br />
Zukunft Konflikte <strong>zu</strong> vermeiden oder aber pazifistischer <strong>zu</strong> regeln als<br />
es eine abstrakte Strafmaschinerie des Staates je tun kann. Daß<br />
verantwortliches Handeln aller Beteiligten eines Konfliktes die<br />
natürliche Grenze eindimensionaler Racheakte darstellt, belegen nicht<br />
nur ethnokriminologische Studien.<br />
Zentrales Anliegen der <strong>anarchistische</strong>n Theorie ist die Forderung nach<br />
der Autonomie des Subjektes und der Gesellschaft. Damit verbunden<br />
ist auch die Rückgabe der Konflikte und ihrer Regelung an die<br />
Individuen auf der Basis einer konfliktheoretischen Konzeption von<br />
Gesellschaft. Ebenso wie radikale Kriminologen weisen Anarchisten<br />
Kriminalität als gesellschaftsimmanentes und herrschaftsbezogenes<br />
Phänomen aus. <strong>Die</strong> gemeinsame Erkenntnis des staatlichen<br />
Mißbrauchs von Kriminalität <strong>zu</strong>r Aufrechterhaltung des status quo<br />
erlaubt es, das Phänomen Kriminalität <strong>zu</strong> funktionalisieren und in den<br />
<strong>Die</strong>nst einer anarchistisch-kriminologischen Gesellschaftstheorie <strong>zu</strong><br />
stellen. Kriminalität ist etwas 'Staatsgemachtes', ist ein Produkt von<br />
Zuschreibungsprozessen. Nimmt man das Diktum "Nullum crimen sine<br />
lege" ernst, so ist jedes Verbrechen, als ein Rechtsbruch gegen den<br />
Staat gerichtet und nicht, wie behauptet, gegen die Gesellschaft.<br />
Kriminalität hört auf, wenn zentral gesetztes positives Recht<br />
abgeschafft ist und die Legitimationsgrundlage für die Schutzmacht<br />
'Staat' nicht mehr existiert. Was bleibt, das sind problematische<br />
Situationen zwischen Individuen oder Gruppen. Als Resultante auf<br />
Kriminalität und problematische Situationen lassen sich zwei Arten des<br />
Konflikts erkennen. Der eine entspringt dem Verhältnis Individuum -<br />
Staat, der andere ist Ergebnis des Widerspruchs zwischen Individuum<br />
und Gesellschaft. Anarchistische Kriminologie untersucht die<br />
unterschiedlichen Bedingungen von Konflikten mit dem Ziel, <strong>zu</strong><br />
Aussagen und Forderungen <strong>zu</strong> kommen, die eine Befriedung der
Gesellschaft in Aussicht stellen. Hierbei geht es nicht um die<br />
Abschaffung von Konflikten, sondern um die Abschaffung von<br />
Bedingungen, die für die Ausprägung und Eskalierung der<br />
Gewaltanteile eines<br />
Konflikts verantwortlich sind. Namentlich sind dies die Existenz von<br />
Herrschaftsformen, die ein Monopol auf Definition, Sanktion und<br />
Behandlung abweichenden Verhaltens haben. Das Produkt einer<br />
gewaltsamen Befriedung der Gesellschaft kann eben nicht<br />
Gerechtigkeit sein, denn Gewalt provoziert immer Gegengewalt.<br />
Allerdings wäre es verfehlt, Gewalt an sich als einen nurmehr<br />
negativen Begriff im Rahmen einer <strong>anarchistische</strong>n Kriminologie <strong>zu</strong><br />
verwenden. Negativ und gefährlich ist allein die Monopolisierung von<br />
Gewalt. Ansonsten ist jede Veränderung ohne ein gewisses Quantum<br />
an Gewalt undenkbar. So setzt beispielsweise der Prozeß der<br />
Etablierung einer neuen gesellschaftlichen Moral voraus, daß<br />
überkommene Werte verneint und abgeschafft werden. Gesetze jedoch<br />
schreiben den status quo fest und kontrastieren jede Entwicklung.<br />
Abschaffung, Zerstörung oder Subversion hat notwendig<br />
Gewaltanteile, nur ist diese "natürliche Gewalt" im Gegensatz von<br />
herrschaftlicher Gewalt kreativ. Sie schafft etwas Neues, und solange<br />
die Aufspaltung von Macht gelingt, ist das Resultat nicht für die<br />
Ewigkeit konstruiert : "So befremdlich der Ausdruck auch klingen<br />
mag, so müssen wir doch von "natürlicher Gewalt" sprechen - ...",<br />
"<strong>Die</strong> "Gewaltlosigkeit" der dogmatischen Pazifisten ist unnatürlich und<br />
sogar irgendwie bösartig,..." "Für mich ist das, was im allgemeinen als<br />
"Gewaltlosigkeit" gilt, boshafter Vorwand für eine Verschärfung der<br />
Schuldgefühle. Zorn ist schließlich verbindend; und es scheint falsch,<br />
Zorn <strong>zu</strong> unterdrücken. Es ist interessant <strong>zu</strong> sehen, wie gewöhnlich der<br />
eine Schlag oder Schlagabtausch unter vernünftigen<br />
Menschen der letzte ist, da er die Kommunikation wiederhergestellt<br />
hat" (Goodman 1980). Unnatürliche Gewalt ist immer verbunden mit<br />
der Ausübung von Herrschaft, und im Kriegsfall erreicht sie durch<br />
institutionalisierte Tötung ihren Höhepunkt. <strong>Die</strong> Institutionalisierung<br />
von Gewalt beraubt die Individuen, indem große Bereiche natürlicher<br />
Gewalt als einem originärem Teil menschlicher Handlungsressourcen<br />
<strong>zu</strong>r Aufdeckung und Regelung von Konflikten als illegal erklärt und<br />
unter Strafe gestellt werden. <strong>Die</strong> gewaltsame Pazifizierung der Bürger
eines Staates suggeriert nicht nur Gewalt als negativ, sondern<br />
entfremdet sie darüberhinaus. In staatenlosen Gesellschaften ist der<br />
Gebrauch von Gewalt immer auch moralischen Kriterien unterworfen,<br />
die ihre Begren<strong>zu</strong>ng determinieren. <strong>Die</strong>ses Gefühl für<br />
Schadensbegren<strong>zu</strong>ng geht dort verloren, wo Konflikte geraubt und<br />
Moral institutionalisiert (in der Form kodifizierter Rechtsnormen) wird.<br />
Individuelle Moral ist ohne sozialen Kontext nicht denkbar. Derjenige<br />
freie Mensch, der gewaltsam die Befriedigung seiner Bedürfnisse <strong>zu</strong><br />
erlangen sucht, handelt zwar verantwortungslos gegen das Opfer; das<br />
entbindet ihn jedoch nicht davon, die Konsequenzen seiner Tat <strong>zu</strong><br />
tragen. Im Gegensatz <strong>zu</strong>r abstrakten Strafjustiz des Staates, sind jedoch<br />
die Beziehungen zwischen Täter, Opfer, und all denen, die ein<br />
Interesse (unter Umständen können dies auch Strafbedürfnisse sein) an<br />
dem Vorkommnis haben, nicht aufgelöst. <strong>Die</strong> Rollen der Täter, Opfer,<br />
Vermittler oder Sanktionierer sind nicht juristisch fixiert und ihr Status<br />
ist weiterhin verletzbar. <strong>Die</strong> Entfremdung, die das Gesetz leistet, betont<br />
die Gewaltanteile des Konflikts zwischen Tätern, Opfern und<br />
Regeldurchsetzern und raubt individuelle Pazifizierungsstrategien, die<br />
oftmals der "Menschlichkeit" und "Vergebung" Priorität einräumen,<br />
anstatt Vergeltung <strong>zu</strong> fordern (vgl. Christie 1986). Reziprozität läßt<br />
sich nicht durch Konformitätsdruck erzwingen, sie muß immer wieder<br />
neu erarbeitet werden. Konflikte zwischen Individuen sind Wegbereiter<br />
von Würde und Respekt. Würde und Respekt aber lassen sich nicht<br />
kodifizieren, sondern erkennen das 'Recht auf Abweichung' (Ward<br />
1978) als Ausdruck von Individualität an. Achtung vor sich selbst und<br />
vor dem Mitmenschen wird nur erreicht, indem das <strong>anarchistische</strong><br />
Prinzip, das 'principle of diversity' (Holterman 1984), maßgeblich ist.<br />
Ansonsten droht Gesichtslosigkeit und Atomisierung der Menschen:<br />
"Ein Glaube, ein Gott, eine Idee, ein Hut für alle! Würden alle unter<br />
einen Hut gebracht, so brauchte freilich keiner vor dem anderen den<br />
Hut noch ab<strong>zu</strong>nehmen" (Stirner 1986). Fest<strong>zu</strong>stellen ist, daß der<br />
Mensch den 'Hut für alle' nicht freiwillig erwirbt, denn: "Jeden Tag<br />
werden Millionen von Übereinkommen ohne die Intervention der<br />
Regierung geschlossen...." (Kropotkin 1972). Konfliktregelung<br />
zwischen Individuen geht vielfältige Wege und unterliegt<br />
Gesetzmäßigkeiten, die manchmal 'unbegreiflich erscheinen', wie<br />
Tolstoj es sagt, und doch <strong>zu</strong> durchaus befriedigenden Resultaten für
eide Parteien führen. "Legalität" hingegen ist "...in Wirklichkeit<br />
Verrat gegen unsere natürliche Gesellschaftsstruktur", ..." dann<br />
nämlich, wenn sie uns in Situationen verwickelt, in denen wir<br />
aufhören, persönliche Verantwortung für die Konsequenzen <strong>zu</strong><br />
tragen" (Goodman 1980). Einer Kriminologie, die anarchistisch sein<br />
will, geht es darum, die Konflikte, die sich notwendig aus dem<br />
Widerspruch Individuum - Gesellschaft ergeben, ernst <strong>zu</strong> nehmen. Das<br />
bedeutet, daß die kreativen Anteile eines Konflikts herausgearbeitet<br />
werden. <strong>Die</strong>s wiederum führt da<strong>zu</strong>, gängige Mythen über die Art der<br />
menschlichen Natur <strong>zu</strong> neutralisieren, ohne einen neuen Mythos <strong>zu</strong><br />
schaffen: "Unser Verständnis der Natur des Menschen oder auch der<br />
Vielfalt möglicher Gesellschaftsformen ist gewiß noch so rudimentär,<br />
daß jedes weiterreichende Theorem mit großer Skepsis <strong>zu</strong> betrachten<br />
ist, ebenso wie Skepsis auch am Platze ist, wenn wir hören, daß die<br />
'menschliche Natur' oder die 'Erfor- dernisse des Fortschritts' oder die<br />
'Komplexität des modernen Lebens' diese oder jene Form von<br />
Unterdrückung und autokratischer Herrschaft erfordern" (Chomsky<br />
1987, 11). Wenn mit statischen Definitionen, Theorien und<br />
Fragestellungen Gesellschaftsanalyse vorbereitet wird, ist das Produkt<br />
absehbar: die Genese einer Gesellschaft, die, welchem politischen<br />
System sie sich auch immer verpflich- tet fühlt, als neuerliches<br />
Korrektiv für menschliche Un<strong>zu</strong>länglichkeit herhalten muß. <strong>Die</strong>ses <strong>zu</strong><br />
verhindern ist die Aufgabe einer <strong>anarchistische</strong>n Kriminologie, deren<br />
Grundlegung ein politisches Selbstverständnis sein muß, das den<br />
zentralen Begriffen gesellschaftlicher Veränderung - Chance und<br />
Risiko - Vorrang einräumt, Hierarchie und Herrschaft aber ersatzlos<br />
streicht. Eine radikale Kriminologie, die die <strong>anarchistische</strong> <strong>Perspektive</strong><br />
nicht vernachlässigt, könnte beginnen "nach einer weniger gefährlichen<br />
Sicherheitsgarantie als ausgerechnet derjenigen durch den Gewalt-<br />
Staat" <strong>zu</strong> suchen (Scheerer 1984).<br />
Pelters, K. Olaf Der Artikel basiert auf: 'Anarchismus und<br />
Kriminologie'(wiss. Arbeit z. Erlangung d. akad. Gr. d. Diplom-<br />
Kriminologen), Hamburg 1994.