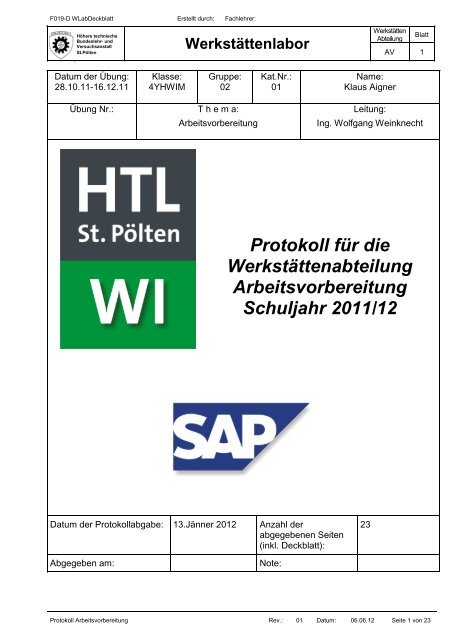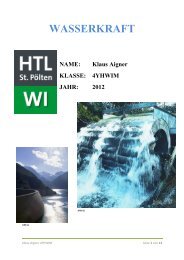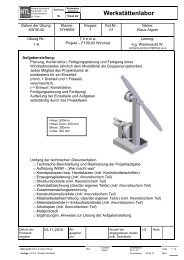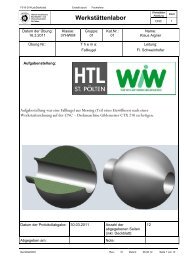Protokoll Arbeitsvorbereitung 4.Jahrgang - Klaus Aigner
Protokoll Arbeitsvorbereitung 4.Jahrgang - Klaus Aigner
Protokoll Arbeitsvorbereitung 4.Jahrgang - Klaus Aigner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Datum der Übung:<br />
28.10.11-16.12.11<br />
Übung Nr.:<br />
Klasse:<br />
4YHWIM<br />
Werkstättenlabor<br />
Gruppe:<br />
02<br />
T h e m a:<br />
<strong>Arbeitsvorbereitung</strong><br />
Kat.Nr.:<br />
01<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Name:<br />
<strong>Klaus</strong> <strong>Aigner</strong><br />
Leitung:<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Ing. Wolfgang Weinknecht<br />
<strong>Protokoll</strong> für die<br />
Werkstättenabteilung<br />
<strong>Arbeitsvorbereitung</strong><br />
Schuljahr 2011/12<br />
Datum der <strong>Protokoll</strong>abgabe: 13.Jänner 2012 Anzahl der<br />
abgegebenen Seiten<br />
(inkl. Deckblatt):<br />
Abgegeben am: Note:<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 1 von 23<br />
23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1) Aufgabenstellung AVÜ3<br />
1.1 Ermittlung der Selbstkosten und des Verkaufspreises<br />
1.2Theoretische Grundlagen Kalkulation<br />
1.2.1 Kostenstellenrechnung<br />
1.2.2 Kostenträgerrechnung<br />
1.2.3 Zuschlagskalkulationsarten<br />
2) Aufgabenstellung SAP-Ü1<br />
2.1 SAP – Begriffe<br />
eine Firma – ein Programm – die Philosophie<br />
IDES – ADES – ACME<br />
Echtzeitverarbeitung<br />
Hintergrundverarbeitung<br />
Batchverarbeitung<br />
3-Ebenenmodell<br />
Systemlandschaften<br />
Organisationseinheiten<br />
Customizing<br />
Report<br />
Jobs<br />
3) Arbeiten am System<br />
4) Mitschriften<br />
5) Arbeitsbericht<br />
6) Eigene Meinung<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 2 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
1.)AVÜ3<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 3 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
1.1.) Ermittlung der Selbstkosten und des Verkaufspreises:<br />
Die Kalkulation des Windrades wurde mit einer mehrstufigen Zuschlagskalkulation gemacht.<br />
Im ersten Schritt haben wir aus der Strukturstückliste die benötigen Materialen erfasst.<br />
Aus der Materialbedarfsermittlung wurden die Rohmassen entnommen. Anschließend wurden die Kilo-<br />
bzw. Stückpreise der benötigten Materialien aus dem Produktkatalog der Firma Ploberger bzw. aus dem<br />
Internet entnommen.<br />
Aus diesen Daten wurden die Materialeinzelkosten ermittelt. Auf die Materialeinzelkosten wird dann noch<br />
der Materialgemeinkostenzuschlagsatz von 21% aufgeschlagen und man erhält die Materialkosten.<br />
Die Arbeitszeit für die Fertigung der Einzelteile wurde aus den Arbeitsberichten entnommen bzw.<br />
geschätzt.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 4 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Der kollektivvertragliche Mindestlohn für einen Facharbeiter beträgt 9,72€/h. Dieser Wert muss allerdings<br />
verdoppelt werden, weil der Mitarbeiter dem Unternehmen circa das Doppelte kostet. Dieser Wert wird<br />
mit der Summe der Arbeitsstunden multipliziert und man erhält die Lohnkosten/Windrad die den<br />
Fertigungslohneinzelkosten entsprechen.<br />
Zu diesem Wert wird ebenfalls noch ein Gemeinkostenzuschlagsatz von 157% aufgeschlagen.<br />
Wenn man Materialkosten mit den Fertigungskosten addiert werden erhält man die Herstellkosten. Dass<br />
man die Selbstkosten erhält müssen noch die Verwaltungs- und Vertriebskosten addiert werden.<br />
Der Verwaltungs- und Vertriebskostengemeinkostenzuschlagssatz wird auf die Herstellkosten<br />
aufgeschlagen, dann erhält man die Selbstkosten.<br />
Da das Produkt auch noch verkauft werden soll wird noch ein Gewinnaufschlag von 12,5%, ein Aufschlag<br />
für mögliche Rabatte von 3% und ein Skontoaufschlag von 3% zu den Selbstkosten aufgeschlagen.<br />
Um den Bruttoverkaufspreis zu erhalten muss noch die Mehrwertsteuer von 20% berücksichtigt werden.<br />
1.2.)Theoretische Grundlagen Kalkulation<br />
1.2.1. Kostenstellenrechnung:<br />
Die Kostenstellenrechnung ist einer der drei Hauptteile der Kostenrechnung und dient der Steuerung und<br />
Kontrolle der Kostenstellenkosten sowie als Basis zur Berechnung von Kostensätzen, Zuschlags- und<br />
Verrechnungssätzen für die Kalkulation. Sie beantwortet die Frage, wo Kosten entstanden sind.<br />
Um das verursachungsgerechte Aufteilen der Kosten zu ermöglichen müssen Kostenstellen gebildet<br />
werden (z.B. Dreherei, Fräserei, Montage, …). Die entstehenden Gemeinkosten (z.B. Mietkosten) werden<br />
über einen Verteilerschlüssel (z.B. Fläche der Kostenstelle) dann auf die jeweilige Kostenstelle<br />
verrechnet. Die Aufteilung der Gemeinkosten erfolgt im Betriebsabrechnungsbogen (BAB).<br />
Die Aufgaben der Kostenstellenrechnung sind:<br />
Kosten bei der Entstehung sammeln und verursachungsgerecht auf Kostenstellen verteilen<br />
Verteilerschlüssel für die Gemeinkostenverteilung festlegen<br />
Anfallende Kosten ständig überwachen, um das Betriebsgeschehen wirtschaftlich zu steuern<br />
Quellen: http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/kostenstellenrechnung/kostenstellenrechnung.htm<br />
Produktionsorganisation S.268<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 5 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
1.2.2. Kostenträgerrechnung:<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Die Kostenträgerrechnung ist derjenige Teil der Kostenrechnung, der auf der Kostenartenrechnung und<br />
der Kostenstellenrechnung aufbaut und der Abrechnung aller betrieblichen Leistungen (Absatzleistungen<br />
und bestimmte innerbetriebliche Leistungen) dient.<br />
Mit Ihrer Hilfe kann man die Kosten den einzelnen Produkten zuordnen.<br />
Die Kostenträgerrechnung ermittelt in der Vollkostenrechnung die gesamten für einen Kostenträger<br />
angefallenen Kosten.<br />
Je nachdem, wann eine Kalkulation durchgeführt wird, spricht man von Vor, Zwischen und<br />
Nachkalkulation.<br />
Bei der Vorkalkulation wird ein Angebotspreis für ein Produkt im Vorhinein der Fertigung<br />
ermittelt. Die verwendeten Werte basieren vor allem auf Erfahrung.<br />
Die Zwischenkalkulation wird inmitten der laufenden Fertigung durchgeführt um zu schauen ob<br />
alles sowie geplant abläuft. Wenn sie bei langen Auftragszeiten nicht durchgeführt wird kann sein<br />
dass dieser Auftrag dem Unternehmen keinen Gewinn einbringt. Es werden die IST – Kosten mit<br />
den SOLL – Kosten aus der Vorkalkulation verglichen.<br />
Die Nachkalkulation wird nach Durchführung des Auftrags erstellt. So wird die Richtigkeit der<br />
Vorkalkulation überprüft. Man erhält dadurch auch neue Erfahrungswerte und weiß genau ob der<br />
Auftrag gewinnbringend war oder nicht<br />
Quellen: http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/kostentraegerrechnung/kostentraegerrechnung.htm<br />
Produktionsorganisation S.285<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 6 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
1.2.3. Zuschlagskalkulationsarten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Bei der Zuschlagskalkulation wird in einstufige-, und mehrstufige Zuschlagskalkulation unterschieden.<br />
Einstufige Zuschlagskalkulation<br />
Die einstufige Zuschlagskalkulation wird häufig bei Handwerksbetrieben angewendet. Die Gemeinkosten<br />
müssen mit einem Zuschlagssatz einer Bezugsgröße, wie den Fertigungslohneinzelkosten bei<br />
lohnintensiven oder den Materialeinzelkosten bei materialintensiven Betrieben zugerechnet werden.<br />
Dieses Verfahren ist einfach und sollte nur dann angewendet werden wenn die Gemeinkosten nicht zu<br />
hoch sind. D.h. ein geringer Fixkostenanteil vorliegt.<br />
Quelle: Produktionsorganisation, S.288<br />
Materialeinzelkosten MEK<br />
Fertigungslohneinzelkosten FLK<br />
Gemeinkosten GK<br />
Selbstkosten =SK<br />
Mehrstufige Zuschlagskalkulation<br />
Die mehrstufige Zuschlagskalkulation teilt die Gemeinkosten entsprechend ihrer Einflussgrößen in<br />
mehrere Gemeinkostenarten auf:<br />
Materialgemeinkosten (MGK)<br />
Fertigungsgemeinkosten (FGK)<br />
Verwaltung-, und Vertriebsgemeinkosten (VVGK).<br />
Quelle: Produktionsorganisation, S.288<br />
Materialeinzelkosten MEK<br />
+ Materialgemeinkosten MGK<br />
= Materialkosten MK<br />
+ Fertigungslohneinzelkosten FLK<br />
+ Fertigungsgemeinkosten FGK<br />
+ Sondereinzelkosten der Fertigung SEF<br />
= Herstellkosten HK<br />
+ Verwaltungs-, und Vertriebsgemeinkosten VVGK<br />
+ Sondereinzelkosten des Vertriebs SEK<br />
= Selbstkosten SK<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 7 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
2.) SAP-Ü1<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 8 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
2.1. SAP-Begriffe<br />
Werkstättenlabor<br />
SAP: eine Firma- ein Programm- die Philosophie<br />
Die Firma:<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
1972 gründeten die fünf früheren IBM Mitarbeiter – Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner,<br />
<strong>Klaus</strong> Tschira, und Claus Wellenreuther – ein Unternehmen mit dem Namen Systeme, Applikationen und<br />
Produkte in der Datenverarbeitung (Systems, Applications, and Products in Data Processing) in<br />
Mannheim, Deutschland.<br />
Ziel war die Entwicklung einer Standardsoftware für die Verarbeitung von betriebswirtschaftlichen<br />
Geschäftsprozessen in Echtzeit.<br />
Ein Jahr später wurde die erste Finanzwesenssoftware fertig gestellt und bildete daraufhin die Basis für<br />
weitere Entwicklungen.<br />
In den 90er Jahren startete SAP voll durch. Das Client-Server Konzept, die neue grafische<br />
Benutzeroberfläche, die relationale Datenbasis und die Möglichkeit Computer verschiedener Hersteller zu<br />
nutzen bringen SAP enorme Zuwächse.<br />
Vor allem das Drei-Schichten-Konzept Datenbank/Applikation/Benutzeroberfläche – wird zum Standard<br />
bei Businesssoftware.<br />
2005 arbeiteten weltweit mehr als 12 Millionen Benutzer mit Lösungen von SAP auf mehr als 100.000<br />
Installationen. Man arbeitet mit 1.500 Partner zusammen und hat mehr als 33.200 Kunden in 120 Ländern.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
Die Philosophie:<br />
Anfang der 70er dominierten Mainframes mit „dummen“ Terminals im Unternehmen. Jedes Unternehmen<br />
hatte mehrere Programme z. B. zur Lagerverwaltung, Finanzbuchhaltung, Personalabrechnung, etc. im<br />
Betrieb. Aktuelle Aussagen zur Unternehmenssituation waren meist nicht sofort verfügbar, da die<br />
Software im Batch Betrieb lief.<br />
IBM hatte die Entwicklung einer Standardsoftware nicht mehr gefördert, sondern beschloss nur noch<br />
Hardware zu produzieren. Die Grundüberlegung war nun, die verschiedenen Systeme wie z. B.<br />
Lagerbuchhaltung, Bestellverwaltung, Finanzmanagement, Controlling usw. in ein System zu integrieren,<br />
um die Schnittstellenproblematik zu minimieren. Die einzelnen Bereiche, in SAP Module genannt,<br />
kommunizieren untereinander und haben eine gemeinsame Datengrundlage.<br />
Also eine Standardsoftware die individuell angepasst werden kann und modular aufgebaut ist. Jederzeit<br />
sollten aktuelle Zahlen, Daten zu Unternehmenssituation abrufbar sein. Durch eine zentrale Datenhaltung<br />
in einer relationalen Datenbank sollte Datenredundanz vermieden werden.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 9 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
IDES- ADES- ACME<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
IDES steht für International Demonstration and Education System ( Internationales<br />
Vor-führungs- und Ausbildungssystem), eine Software, die ein vollständiges Referenzsystem mit<br />
allen wichtigen Ländern und allen Branchen im SAP R/3 System abbildet. Daneben steht eine<br />
umfangreiche Dokumentation der im IDES-System implementierten Fallbeispiele zur Verfügung.<br />
Für den Schulunterricht entwickelten österreichische Lehrer gemeinsam mit Beratern aus der<br />
Wirtschaft und Spezialisten von SAP Österreich eigene Musterfirmendaten inklusive aller<br />
Unterrichtsmaterialien unter dem Namen ADES (Austrian Demonstration and Education System).<br />
ADES ist ein SAP-Musterunternehmen, das auf die österreichischen Verhältnisse zugeschnitten ist.<br />
Die Schülerinnen und Schüler können anhand von praxisrelevanten Daten die betrieblichen<br />
Prozesse realitätsnahe erfassen und mit SAP abbilden. Dieses System ist weltweit einzigartig und<br />
ermöglicht eine Ausbildung auf einem System, das den nationalen Gegebenheiten (Rechtssituation,<br />
Kontenrahmen etc.) angepasst ist.<br />
ADES wird permanent weiterentwickelt und deckt unter anderem die gesamte Vorbereitung auf<br />
alle am Markt befindlichen SAP-Anwender-Zertifikate ab.<br />
Quelle: http://www.sap.com/austria/services/education/edusap/ades/index.epx<br />
Die ACME GmbH im SAP System stellt eine Modellfirma dar. Sie ist ein international tätiges,<br />
österreichisches Unternehmen mit zwei Niederlassungen. Die ACME GmbH verfügt über<br />
umfangreiche Anwendungsdaten für unterschiedliche Geschäftssituationen. Die Geschäftsprozesse<br />
sind genau wie in einem richtigen Unternehmen abgebildet. Auf diese Weise wird die<br />
anspruchsvolle Funktionalität des SAP Systems an leicht nachvollziehbaren Beispielen<br />
verdeutlicht. Der Schwerpunkt von ACME liegt jedoch nicht auf der Erklärung einzelner<br />
Funktionen (Transaktionen), sondern auf der Darstellung von durchgängigen Geschäftsprozessen<br />
und deren Integration.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
Echtzeitverarbeitung<br />
In älteren Softwaresystemen wurden die Daten im Laufe eines Arbeitstages von den Mitarbeitern<br />
eingegeben und vom System erst über Nacht verarbeitet und standen daher erst am nächsten Tag für die<br />
Weiterverarbeitung zur Verfügung. Im SAP System werden die Daten in Realtime verarbeitet und stehen<br />
daher sofort anderen Anwendungen zur Verfügung.<br />
Alle SAP-Systeme basieren auf der Philosophie, dass jeder Geschäftsvorfall nur einmal ins SAP-System<br />
eingegeben wird. Dazu müssen sie jedoch in Realtime für alle anderen SAP-Anwendungen verfügbar sein<br />
(Prinzip der maximalen Integration).<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 10 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Hintergrundverarbeitung<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
In Informationssystemen ist die Programmverarbeitung nicht immer zwingend online erforderlich. Bei der<br />
Nutzung bestimmter Funktionalitäten (z.B. periodische Berichte) oder der Verarbeitung großer<br />
Datenmengen (z.B. Statistikneuaufbau) kann dies über die Einplanung von Programmen erfolgen. Die<br />
Verwaltung der Hintergrundverarbeitung beinhaltet dabei folgende Aufgaben:<br />
Jobs definieren, einplanen und übergeben<br />
Jobs verwalten<br />
Jobs freigeben<br />
Jobstatus überprüfen<br />
Zustand des gesamten Hintergrundverarbeitungssystems überwachen<br />
Probleme mit der Hintergrundverarbeitung analysieren und beheben<br />
Jobprotokoll lesen<br />
Jobs löschen<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
Batchverarbeitung<br />
Stapelverarbeitung oder auch Batchverarbeitung ist ein Begriff aus der Datenverarbeitung und bezeichnet<br />
die sequentielle Verarbeitung von Aufgaben oder Daten.<br />
Die Bezeichnung „Batchverarbeitung“ stammt aus der Anfangszeit der Datenverarbeitung, als interaktive<br />
Verarbeitung noch nicht möglich war. Programme und Datensätze wurden damals auf Lochkarten<br />
gestanzt, die Lochkarten wurden als Kartenstapel (Batch) nacheinander abgearbeitet. Als später die<br />
Lochkarte als Eingabemedium von anderen Speichermedien, z. B. Magnetbändern und Plattenlaufwerken<br />
abgelöst wurde und (durch direkte Eingaben über ein Terminal) auch interaktives Arbeiten mit dem<br />
Dialogcomputer möglich wurde, blieb der Begriff erhalten und wird bis heute für nicht-interaktive<br />
Datenverarbeitung verwendet. Man gibt einen Auftrag vor, und der wird vom Computer erledigt, ohne<br />
dass der Benutzer weiter eingreifen muss.<br />
SAP- das 3-Ebenenmodell<br />
Technisch gesehen besteht das R/3-System aus drei Komponenten:<br />
Datenbank<br />
Applikationsserver<br />
Präsentationsserver<br />
Die Datenhaltung erfolgt in einer handelsüblichen relationalen Datenbank. Die gesamte<br />
betriebswirtschaftliche Verarbeitung erfolgt im Applikationsserver durch spezielle Programme, die vor<br />
allem in der proprietären Programmiersprache ABAP/4 geschrieben sind. Angezeigt werden die<br />
abgefraten Daten dann am PC – Frontend, dem sogenannten SAP – GUI (Graphical User Interface).<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 11 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Systemlandschaften in SAP<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Die Systemlandschaft beschreibt die benötigten Systeme und Mandanten und deren Bedeutung sowie die<br />
Transportwege für den Einführungs- und Wartungsprozess.<br />
Die Systemlandschaft kann z.B. aus einem Entwicklungssystem, einem Testsystem und einem<br />
Produktivsystem bestehen.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
3-Systemlandschaft<br />
Als Standard wird die 3-Systemlandschaft empfohlen, in der jeder der zentralen Mandanten in<br />
einem eigenen SAP-System untergebracht ist. Sie besteht aus einem Entwicklungssystem (DEV),<br />
einem Qualitätssicherungssystem (QAS) und einem Produktivsystem (PRD).<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
2-Systemlandschaft<br />
Für kleinere SAP-Implementierungen, in denen insbesondere nur geringfügige Workbench-<br />
Entwicklungen durchgeführt werden, stellt die 2-Systemlandschaft eine Alternative dar.<br />
In der 2-Systemlandschaft wird auf das separate Qualitätssicherungssystem (QAS) verzichtet. Die<br />
Nachteile einer 2-Systemlandschaft liegen darin, dass mandantenunabhängige Daten im<br />
Customizing- und Qualitätssicherungsmandanten gemeinsam genutzt werden. Änderungen an<br />
mandantenunabhängigen Daten, die im Customizing-Mandanten durchgeführt werden, können die<br />
Tests im Qualitätssicherungsmandanten behindern. Nach dem Transport in denProduktivmandanten<br />
können dort Fehler auftreten, obwohl alle Tests imQualitätssicherungsmandanten erfolgreich waren.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
1-Systemlandschaft<br />
Eine 1-Systemlandschaft, in der alle zentralen Mandanten im selben SAP-System untergebracht<br />
sind, wird nicht empfohlen. Durch die gemeinsame Nutzung von Hardwareressourcen und<br />
mandantenunabhängigen Daten ergibt sich für den Betrieb eines einzelnen Systems eine Reihe<br />
gravierender Einschränkungen. Insbesondere können nach Produktivstart keine weiteren<br />
Entwicklungen mehr vorgenommen werden, es sei denn, der Produktivbetrieb wird für die Dauer<br />
einer Entwicklungs- und anschließender Testphase gestoppt.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 12 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
SAP Organisationseinheiten<br />
Mandant:<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
In sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit innerhalb eines R/3-<br />
Systems mit getrennten Stammsätzen und einem eigenständigen Satz von Tabellen. Z.B. Konzern<br />
Buchungskreis:<br />
Kleinste organisatorische Einheit des externen Rechnungswesens, für die eine vollständige, in sich<br />
abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann. Z.B. Unternehmen<br />
Werk:<br />
Organisatorische Einheit, die ein Unternehmen aus der Sicht der Produktion, Beschaffung, Instandhaltung<br />
und Disposition gliedert.<br />
Lagerort:<br />
Organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung von Materialbeständen innerhalb eines Werks<br />
ermöglicht.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 13 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Customizing<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Unter dem Begriff Customizing werden die Aktivitäten im Rahmen der Einstellung eines SAP-Systems<br />
zusammengefasst. Das Vorgehen hat das Ziel:<br />
die unternehmensneutral und branchenspezifisch ausgelieferte Funktionalität den spezifischen<br />
betriebswirtschaftlichen Anforderungen des Unternehmens anzupassen<br />
SAP-Funktionalität im Unternehmen zu erweitern<br />
SAP-Lösungen schnell, sicher und kostengünstig im Unternehmen einzuführen<br />
Die Customizing Aktivitäten werden von Projekt-Teams zusammengestellt und systematisch abgearbeitet.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
Report<br />
Auswertungen, vorwiegend als Reports bezeichnet, folgen dem klassischen EVA-Prinzip. D.h., dass ein<br />
Programm in der Reihenfolge Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe der Ergebnisse ausgeführt wird. Die<br />
Dateneingabe erfolgt vom Benutzer am Client, die Verarbeitung am Server und die Ausgabe wiederum am<br />
Schirm des Benutzers (Client). Das Abrufen von Daten aus der Datenbank kann bei manchen Reports sehr<br />
lange dauern. Daher kann das Ausführen eines Reports auch im Hintergrund erfolgen. Folgende<br />
Auswertungsmöglichkeiten können unterschieden werden:<br />
Standardauswertungen - Unter dem Menüpunkt „Infosysteme“ befinden sich alle von SAP<br />
ausgelieferten Standardreports, welche im normalen Tagesgeschäft von Nutzen sein können.<br />
Kundenspezifische Auswertungen - Jedem Kunden steht es frei auch eigene spezifische Reports zu<br />
erstellen. Dazu stellt SAP eigene Werkzeuge zur Verfügung.<br />
Auswertung in Kombination mit anderen Systemen - Reports müssen nicht zwangsweise auf<br />
einem SAP R/3 System ausgeführt werden. Auf die Datenbasis des R/3 aufbauend können auch<br />
andere Auswertungssysteme, wie z.B. das Business Information Warehouse von SAP, verwendet<br />
werden um unternehmensspezifische Auswertungen zu erhalten.<br />
Quelle: ACME Skriptum,2.Ausgabe, 2.9.2007<br />
Jobs<br />
Jobs sind Tätigkeiten die in der Hintergrundverarbeitung abgearbeitet werden.<br />
Jobs, welche als Hintergrundprozess laufen, lassen sich auf Zeiten verlagern, an denen das System<br />
weniger belastet ist (z.B.: Nacht, Feiertag, Wochenende). Auch sperrt sich der User nicht seinen Modus<br />
und kann somit weiterarbeiten. Weiters lassen sich Jobs periodisch einplanen und benötigen daher<br />
weniger Aufwand.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 14 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
3.)Arbeiten am System<br />
Werkstättenlabor<br />
Anmeldevorgang<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Dies ist die Bildschirmansicht die man<br />
nach dem öffnen der SAP Logon<br />
Anwendung sieht. Hier ist nur ein System<br />
angezeigt. Im Normalfall sind es immer<br />
mehrere Systeme. Mit einem Doppelklick<br />
auf das gewünschte System kommt man<br />
zur eigentlichen Anmeldung an das System<br />
Dies ist die Ansicht wo die eigentliche<br />
Anmeldung erfolgt. Man muss den<br />
Mandanten, seinen Benutzernamen und<br />
sein Passwort angeben. (Achtung Passwort<br />
kann nur in drei Versuchen erfolgen,<br />
danach erfolgt die Sperre des Benutzers).<br />
Doppelanmeldungen sind nicht möglich.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 15 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Diese Bildschirmansicht wird nach der<br />
erfolgreichen Anmeldung an das SAP-<br />
System angezeigt. Sie zeigt das SAP-<br />
Easy-Access Menü. Auf der linken Seite<br />
sieht man den Menübaum. Rechts die<br />
SAP – Welle. Am oberen Bildschirmrand<br />
hat man die Menüleiste. Darunter das<br />
Eingabefeld mit den Befehlsschaltflächen.<br />
Direkt darunter die Titelleiste. Unter der<br />
Titelleiste befindet sich die<br />
Anwendungsfunktionsleiste. Am unteren<br />
Bildschirmrand befindet sich die<br />
Statusleiste.<br />
Wenn man mehrere Modi öffnen will in<br />
Kommandofeld /o eingeben (maximal 6<br />
Modi können geöffnet). Wenn man den<br />
jetzigen Modus überschreiben will /n.<br />
Material anlegen:<br />
Diese Ansicht ist die Eingabemaske zum<br />
Anlegen eines neuen Materials. Zu dieser<br />
Maske kommt man entweder durch den<br />
Menübaum oder durch das eingeben des<br />
Transaktionscodes MM01 in das<br />
Eingabefeld. Im Feld Material muss man die<br />
Benennung des Materials eingeben. Branche<br />
und Materialart kann man mit dem<br />
jeweiligen Pulldownmenü auswählen. Es<br />
kann auch ein bereits bestehendes Material<br />
als Vorlage genutzt werden. Wenn man mit<br />
Enter bestätigt kommt man zur<br />
Sichtenauswahl. Dort können die benötigten<br />
Sichten ausgewählt werden. Mit einer<br />
weiteren Bestätigung komm man zur fertig<br />
ausgefüllten Eingabemaske.<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 16 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Die bereits angelegten Materialien kann<br />
man mit dem Transaktionscode MM60<br />
einsehen. Zuerst müssen aber Daten (z.B.<br />
Benutzer, Materialname) zur Selektion<br />
angegeben werden, um die gewünschte<br />
Materialliste zu erhalten.<br />
Verschiedene Benutzerdaten können personalisiert werden. z.B. Festwerte.<br />
Man kann z.B, Für das Eingabefeld Werk einen Festwert einstellen. Dazu muss man die Parameter ID des<br />
gewünschten Feldes suchen. z.B. Im Feld Werk F1 drücken, dann auf Technische Info und ID kopieren.<br />
Und bei den Benutzerdaten im Feld Werte ID einfügen und Festwert angeben.<br />
Es können Werte auch gehalten oder gesetzt werden.<br />
Halten Daten für das Halten der Daten mit der Möglichkeit, sie ändern zu können.<br />
Setzen Daten für das Halten der Daten mit der Möglichkeit, automatisch Felder mit gehaltenen Daten<br />
überspringen zu können.<br />
Einem Benutzer des R/3-Systems wird es durch die F4-Wertehilfe ermöglicht, die zulässigen<br />
Eingabewerte zu einem bestimmten Eingabefeld anzuzeigen, und so Unterstützung in seiner<br />
Aufgabenstellung zu erhalten.<br />
Einem SAP User steht außerdem noch eine Texthilfe zur Verfügung (F1 – Hilfe). Durch drücken von F1<br />
öffnet sich die Texthilfe und beschreibt das Feld in Worten.<br />
Wertehilfe Texthilfe<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 17 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
4. ) Mitschriften<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 18 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 19 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 20 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 21 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
5.)Arbeitsbericht<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 22 von 23
F019-D WLabDeckblatt Erstellt durch: Fachlehrer:<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehr- und<br />
Versuchsanstalt<br />
St.Pölten<br />
6.) Eigene Meinung<br />
Werkstättenlabor<br />
Werkstätten<br />
Abteilung<br />
Blatt<br />
AV 1<br />
Die heuer behandelten Themen in der AV waren wieder interessant. Die Kalkulation des im Vorjahr<br />
gebauten Windrades war sehr interessant, denn man hat gesehen was die Arbeit ungefähr Wert war. Auch<br />
das selbstständige Arbeiten, alleine und in der Gruppe, ist ein großes Plus in der Abteilung. Auch das<br />
Arbeiten am SAP System war eine gute Ergänzung zur davor erlernten Theorie<br />
_________________________________________________________________________________<br />
13.01.2012 Unterschrift<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Arbeitsvorbereitung</strong> Rev.: 01 Datum: 06.06.12 Seite 23 von 23