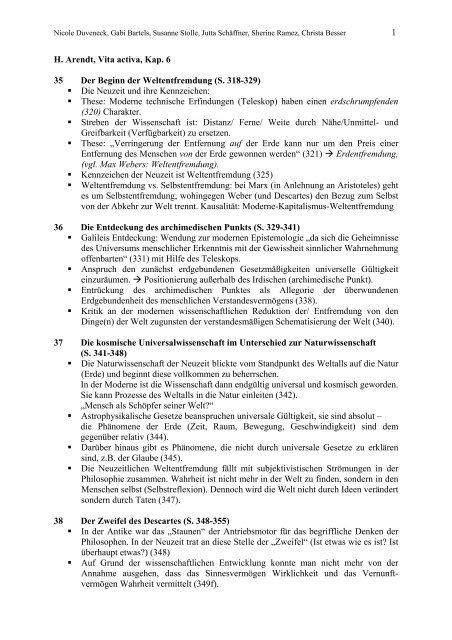Arendt 6. Kapitel
Arendt 6. Kapitel
Arendt 6. Kapitel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nicole Duveneck, Gabi Bartels, Susanne Stolle, Jutta Schäffner, Sherine Ramez, Christa Besser 1<br />
H. <strong>Arendt</strong>, Vita activa, Kap. 6<br />
35 Der Beginn der Weltentfremdung (S. 318-329)<br />
Die Neuzeit und ihre Kennzeichen:<br />
These: Moderne technische Erfindungen (Teleskop) haben einen erdschrumpfenden<br />
(320) Charakter.<br />
Streben der Wissenschaft ist: Distanz/ Ferne/ Weite durch Nähe/Unmittel- und<br />
Greifbarkeit (Verfügbarkeit) zu ersetzen.<br />
These: „Verringerung der Entfernung auf der Erde kann nur um den Preis einer<br />
Entfernung des Menschen von der Erde gewonnen werden“ (321) Erdentfremdung,<br />
(vgl. Max Webers: Weltentfremdung).<br />
Kennzeichen der Neuzeit ist Weltentfremdung (325)<br />
Weltentfremdung vs. Selbstentfremdung: bei Marx (in Anlehnung an Aristoteles) geht<br />
es um Selbstentfremdung, wohingegen Weber (und Descartes) den Bezug zum Selbst<br />
von der Abkehr zur Welt trennt. Kausalität: Moderne-Kapitalismus-Weltentfremdung<br />
36 Die Entdeckung des archimedischen Punkts (S. 329-341)<br />
Galileis Entdeckung: Wendung zur modernen Epistemologie „da sich die Geheimnisse<br />
des Universums menschlicher Erkenntnis mit der Gewissheit sinnlicher Wahrnehmung<br />
offenbarten“ (331) mit Hilfe des Teleskops.<br />
Anspruch den zunächst erdgebundenen Gesetzmäßigkeiten universelle Gültigkeit<br />
einzuräumen. Positionierung außerhalb des Irdischen (archimedische Punkt).<br />
Entrückung des archimedischen Punktes als Allegorie der überwundenen<br />
Erdgebundenheit des menschlichen Verstandesvermögens (338).<br />
Kritik an der modernen wissenschaftlichen Reduktion der/ Entfremdung von den<br />
Dinge(n) der Welt zugunsten der verstandesmäßigen Schematisierung der Welt (340).<br />
37 Die kosmische Universalwissenschaft im Unterschied zur Naturwissenschaft<br />
(S. 341-348)<br />
Die Naturwissenschaft der Neuzeit blickte vom Standpunkt des Weltalls auf die Natur<br />
(Erde) und beginnt diese vollkommen zu beherrschen.<br />
In der Moderne ist die Wissenschaft dann endgültig universal und kosmisch geworden.<br />
Sie kann Prozesse des Weltalls in die Natur einleiten (342).<br />
„Mensch als Schöpfer seiner Welt?“<br />
Astrophysikalische Gesetze beanspruchen universale Gültigkeit, sie sind absolut –<br />
die Phänomene der Erde (Zeit, Raum, Bewegung, Geschwindigkeit) sind dem<br />
gegenüber relativ (344).<br />
Darüber hinaus gibt es Phänomene, die nicht durch universale Gesetze zu erklären<br />
sind, z.B. der Glaube (345).<br />
Die Neuzeitlichen Weltentfremdung fällt mit subjektivistischen Strömungen in der<br />
Philosophie zusammen. Wahrheit ist nicht mehr in der Welt zu finden, sondern in den<br />
Menschen selbst (Selbstreflexion). Dennoch wird die Welt nicht durch Ideen verändert<br />
sondern durch Taten (347).<br />
38 Der Zweifel des Descartes (S. 348-355)<br />
In der Antike war das „Staunen“ der Antriebsmotor für das begriffliche Denken der<br />
Philosophen. In der Neuzeit trat an diese Stelle der „Zweifel“ (Ist etwas wie es ist? Ist<br />
überhaupt etwas?) (348)<br />
Auf Grund der wissenschaftlichen Entwicklung konnte man nicht mehr von der<br />
Annahme ausgehen, dass das Sinnesvermögen Wirklichkeit und das Vernunftvermögen<br />
Wahrheit vermittelt (349f).
Nicole Duveneck, Gabi Bartels, Susanne Stolle, Jutta Schäffner, Sherine Ramez, Christa Besser 2<br />
Durch das unmittelbar praktische Eingreifen in die Natur (mittels Teleskop) wurde<br />
unser Glaube erschüttert - bislang ging man von der Annahme aus, dass Wahrheit aus<br />
sich selbst heraus in Erscheinung tritt (sich uns quasi offenbart) und der Mensch in der<br />
Lage ist diese Wahrheit mit Hilfe seiner Sinne, seiner Vernunft und seines Glaubens<br />
zu erkennen (351).<br />
Sein und Erscheinen müssen endgültig getrennt werden, dies hat zur Folge:<br />
o Wirklichkeit der Außenwelt und Wirklichkeit des Menschen müssen angezweifelt<br />
werden (Ist alles nur ein Traum?).<br />
o Zweifel an der menschlichen Existenz als solche (Gott erscheint als böser Geist,<br />
der den Menschen zwar mit der Vorstellung von Wahrheit ausgestattet hat, ihn<br />
aber nicht in die Lage versetzt diese zu erlangen) (352).<br />
Nicht die Wahrheit als solche geht verloren sondern die Gewissheit<br />
Verlust der Wahrheitsgewissheit führt zu einem radikalen Wechsel moralischer<br />
Maßstäbe (352).<br />
Kardinalstugenden: Erfolg, Fleiß und Wahrhaftigkeit<br />
Bislang war die Theorie die Stätte der Wahrheit, jetzt ist es die Praxis (Bestätigung der<br />
Hypothese) (353).<br />
39 Selbstreflexion und der Verlust des Gemeinsinns (S. 355-361)<br />
Gegenstand der Selbstreflexion ist nicht der Mensch sondern nur der<br />
Bewusstseinsinhalt (355):<br />
o Sicherung durch die Gewissheit der eigenen Existenz (355f)<br />
o Wirklichkeit der Außenwelt oder Wahrheit sind durch Selbstreflexion nicht<br />
erfassbar → „weder der gesehene noch der geträumte Baum werden es je fertig<br />
bringen, wirkliche Bäume zu werden“ (356).<br />
o Güte Gottes dient als einziger Beweisgrund für Realität und damit auch als<br />
Rechtfertigung für den Menschen als Wesen in der Welt (356f).<br />
o Zweifel an der Realität der Außenwelt wurde gebannt durch die Verinnerlichung<br />
(358).<br />
o Menschen sind zwar nicht fähig gegebene Wahrheiten zu erkennen, aber fähig zu<br />
erkennen, was sie selbst gemacht haben (358).<br />
o Verstand kann nur das erkennen, was er selbst hervorgebracht hat (358f).<br />
o Erkenntnisideal ist die Mathematik (359).<br />
Resultat der kartesischen Selbstreflexion ist der Rückzug des Gemeinsinns (359):<br />
o Gemeinsinn ist gesunder Menschenverstand (359).<br />
o Nicht die Welt ist den Menschen gemeinsam, sondern eine Verstandesstruktur, die<br />
bei allen gleich funktioniert (359).<br />
o Vernunft ist die Fähigkeit des Schlussfolgerns (360).<br />
o Verstand = gesunder Menschenverstand = das Vermögen, in stimmigen Prozessen<br />
zu denken (360).<br />
Verlegung des archimedischen Punkts in den Menschen selbst (361):<br />
o Mensch kann die Welt konstruieren und dieses dann empirisch belegen (361).<br />
o Wissenschaft kann Phänomene und Prozesse produzieren, die sie zu beobachten<br />
wünscht, und ist nicht mehr auf die natürlichen und wirklichen Dinge beim<br />
Experimentieren angewiesen (361).<br />
40 Das Denk- und Erkenntnisvermögen und das neuzeitliche Weltbild (S. 361-366)<br />
Descartes: Verlegung des archimedischen Punkts in das menschliche<br />
Erkenntnisvermögen ermöglichte den Menschen den Ausgangspunkt der „neuen<br />
verkehrten Welt“ ständig bei sich zuführen (war aber nicht so überzeugend wie der<br />
universale Zweifel) (362).
Nicole Duveneck, Gabi Bartels, Susanne Stolle, Jutta Schäffner, Sherine Ramez, Christa Besser 3<br />
Konstruktion der Welt durch den mathematischen Verstand des Menschen birgt die<br />
Gefahr in sich, dass die Welt sich als eine Traumwelt erweist, wobei die Wirklichkeit<br />
nur so lange währt wie der Traum (363).<br />
Verlegung des archimedischen Punkts in das Innere des Menschen hat den Zweifel<br />
beschwichtigt, der sich erst wieder regte, als in der Mathematik und Physik auf<br />
Sinneserfahrungen zum Zweck der Erkenntnis verzichtet werden konnte (364).<br />
Wissenschaft der Neuzeit ist hypothetischer Natur (365).<br />
Wissenschaft zeigt, dass die im Experiment hypothetisch vorweggenommene Welt<br />
jederzeit zu einer wirklichen, d.h. zu einer vom Menschen verwirklichten, Welt<br />
werden kann → Vermögen des Menschen zu handeln, herzustellen, Welten zu<br />
erschaffen ist größer als in allen Zeitaltern zuvor (365) → sperrt den Menschen aber<br />
gleichzeitig in die Grenzen seiner selbst geschaffenen Systeme (366).<br />
Mensch erfährt wie das Weltall und die Natur sich ihm entziehen (366).<br />
„Mit dem Verschwinden des sinnlich Gegebenen verschwindet auch das Übersinnliche<br />
und damit die Möglichkeit, das Konkrete im Denken und Begriff zu transzendieren“<br />
(366). Das moderne physikalische Weltbild ist zugleich unvorstellbar und unfassbar<br />
für den menschlichen Verstand (366).<br />
41 Die Umstülpung von Theorie und Praxis (S. 365-375)<br />
Die schwerwiegende Konsequenz der neuzeitlichen Entdeckungen war die<br />
Umkehrung der überkommenen hierarchischen Ordnung von Vita contemplativa und<br />
Vita activa (367).<br />
Die moderne Technik ist nicht der Entwicklung von Werkzeugen zuzuschreiben,<br />
sondern einer zufällige, unbeabsichtigte Folgeerscheinung des rein „theoretischen“<br />
Interesses an Dingen, die niemandem etwas nutzen sollten, z.B. der Uhr (376).<br />
Die grundsätzliche Erfahrung, die zu der Umstülpung von Theorie und Praxis führte,<br />
war rein theoretisch: Der menschliche Wissensdurst kann nur gestillt werden, in dem<br />
der Mensch statt zuzusehen auch zugreift und es mit den Dingen versucht, die das<br />
Werk seiner Hände sind, passives Beobachten und Betrachten waren keine Mittel der<br />
Erkenntnis. Gewissheit durch: 1. Erkennntis von Dingen, die man selbst gemacht hatte<br />
2. Ergebnisse, die in einem zugreifenden Tun verifiziert<br />
werden konnten (38<strong>6.</strong>)<br />
Die Wissenschaft von der Natur und dem Universum, die der Mensch nicht geschaffen<br />
hat, kann auch nicht von ihm verstanden werden (369).<br />
Die Wende der Neuzeit bestand nicht darin, das Tun an die Stelle der Kontemplation<br />
als den höchsten Wert menschlichen Vermögens zu setzen, sondern in der<br />
Umstülpung des Denkens, das nun das gleiche Dienstverhältnis zum Tun innehat. Die<br />
Kontemplation, das Anschauen oder Betrachten eines Wahren, verschwand völlig<br />
( 370).<br />
Die Wende von Vita contemplativa zu Vita activa beinhaltet die Überzeugung, dass es<br />
keine objektive Wahrheit für dem Menschen gibt und dass er nur erkennen kann, was<br />
er selbst gemacht hat, dies führt entweder in die Verzweiflung oder wird zum Antrieb<br />
für gesteigerte Aktivität (372f)<br />
Der Philosoph zieht sich auf sein Inneres (s. Selbstreflexion) zurück, kann dabei<br />
jedoch kein beständiges Bild betrachten, sondern sieht sich mit seinen in ständiger<br />
Bewegung befindlichen Sinneswahrnehmungen und Bewusstseinsreaktionen<br />
konfrontiert (373).<br />
Das philosophische Denken hat auf die Neuzeit weniger Einfluss als je zuvor, die<br />
Philosophie ist den exakten Wissenschaft hinterher gegangen, sie bemühte sich etwas<br />
zu verstehen und mit einer Wirklichkeit zu „versöhnen“, die ohne ihre Mitwirkung<br />
zustande gekommen ist (374).
Nicole Duveneck, Gabi Bartels, Susanne Stolle, Jutta Schäffner, Sherine Ramez, Christa Besser 4<br />
42 Die Umkehrung innerhalb der Vita activa und der Sieg von Homo faber<br />
(S. 375-388)<br />
Wechsel der Hierarchie innerhalb der Vita activa<br />
Antike – Handeln steht an erster Stelle<br />
Naturwissenschaftliche Fragestellungen: Was ist etwas? Warum ist etwas `<br />
wie es ist?<br />
Neuzeit – Herstellen rückt an die erste Stelle<br />
Naturwissenschaftliche Fragestellung: Wie ist etwas entstanden? (376)<br />
Die Frage nach dem Entstehungsprozess kann nur durch das Experiment beantwortet<br />
werden. (Dies ist bereits eine Form des Herstellens, Experiment = Vereinigung von<br />
Herstellen und Erkennen).<br />
Produktivität und schöpferische Genialität als Ideale des Homo fabers<br />
Gegenstand der Forschung ist die Entstehungsgeschichte (Prozess) der Natur (377).<br />
Prozess vs. Produkt (Verabsolutierung des Prozessbegriffs) (383). Während der<br />
Wissenschaftler herstellt um Erkenntnis zu erlangen, geht es dem Hersteller um das<br />
Produkt an sich (378).<br />
Hobbes hat die Vorstellung einen Staatapparat zu entwickeln, der die menschlichen<br />
Angelegenheiten mit der gleichen Präzision regelt, wie die Uhr die Bewegungen der<br />
Zeit (380).<br />
Der Begriff des „herstellenden Kalküls“ berücksichtigt nicht das Unerwartete.<br />
Dilemma: Der Rationalismus ist irreal und der Realismus irrational (383). Dies besagt,<br />
dass die menschliche Vernunft und die Wirklichkeit nicht mehr zueinander finden.<br />
Die Werteordnung des Aristoteles:<br />
o Das praktisch planende Denken und die politische Wissenschaft gelten als die<br />
unterste Form des Erkennens.<br />
o Das Wissen, dass das Herstellen begleitet, ist übergeordnet.<br />
o Kontemplation und Handeln schließen sich gegenseitig aus.<br />
o Die höchste Form der Erkenntnis ist die Anschauung. Das Staunen ist die Quelle<br />
der Philosophie. Die Anschauung des Wahren, zu der das Philosophieren<br />
schließlich gelangt, ist das begrifflich und philosophisch geklärte Staunen, mit<br />
dem es begann (385).<br />
43 Die Niederlage von Homo faber und der Glückskalkül (S.389-399)<br />
Neuzeit: Tendenz: alle Gegebenheiten sind Mittel, Vertrauen in Werkzeuge,<br />
Hochschätzung der Produktivität (im Sinne des Hervorbringens 389,<br />
Warengesellschaft 391). Zweck-Mittel-Kategorie ist absolut, Prinzip des Nutzens kann<br />
alle Motive erklären und menschliche Probleme lösen (Interesse als Motiv).<br />
Allgemein akzeptiert: der Mensch ist das Maß aller Dinge - Prinzip der Nützlichkeit<br />
Entwertung der Werte<br />
Handeln veranlasst Prozesse, Arbeit dient dem Erhalt des Lebens und ist an<br />
Stoffwechselprozesse des Organismus gebunden, für das Herstellen ist der Prozess<br />
etwas sekundäres (Mittel zum Ziel bzw. zum Zweck).<br />
Das Seiende ist nur Funktion und Ergebnis eines Prozesses. Mensch verwandelt<br />
Seiendes in Rohstoffe und erzeugt damit neue Gegenstände. Gebrauchsgegenstände<br />
treten dem Menschen als Umwelt gegenüber, sind beliebig austauschbar und führen<br />
somit zum Wertverlust.<br />
These: Nützlichkeitsprinzip bezieht sich nicht mehr auf die Gebrauchsgegenstände<br />
sondern auf den Produktionsprozess.<br />
Neuer Maßstab ist Wohlbefinden (nicht mehr Nutzen und Brauchen), Wohlbefinden<br />
als Summe von Lust und Unlust durch Produzieren und Konsumieren.
Nicole Duveneck, Gabi Bartels, Susanne Stolle, Jutta Schäffner, Sherine Ramez, Christa Besser 5<br />
Glück ist somit Lust minus Unlust<br />
Hedonismus Vermeidung von Unlust, gründet auf Schmerzerfahrung. Schmerz ist<br />
Gegenstandslos und somit gewiss.<br />
Selbstreflexion als Lösung<br />
44 Das Leben als der Güter höchstes (S. 399-407)<br />
Sieg der Vita activa über die Vita contemplativa (Arbeit fiel größere Bedeutung über<br />
alle anderen Tätigkeiten zu)<br />
Christentum bricht in antike Welt ein, christliche Heilsbotschaft von Unsterblichkeit<br />
des Einzellebens<br />
Antiker Glauben – Unvergänglichkeit im Kosmos; es erschien nun mit christlichen<br />
Glauben ein unsterbliches menschliches Leben, und an den Platz, den die Sterblichen<br />
eingenommen hatten, rückte nun eine vergängliche Welt<br />
Christentum: Leben als der Güter höchstes, Unsterblichkeit<br />
Denken römische Antike: Das Leben des Gemeinwesens,<br />
In der Antike: Arbeit oder Tätigkeit, die den Lebensprozess in Gang halten, wurden<br />
verachtet. Arbeit nur, wenn man sich anders nicht zu helfen weiß.<br />
Durch das Christentum wurde Tätigkeiten als notwendig betrachtet, daraus ergab sich<br />
zwangsläufig eine Gleichsetzung von Herstellen, Handeln und Arbeiten.<br />
45 Der Sieg des Animal laborans (S. 407-415)<br />
Moderne Welt – Erfahrungsschwund – Denken ist zu einer Art Gehirnfunktion<br />
degradiert.<br />
Handeln wird erst mit Herstellen gleichgesetzt, sinkt auf das Niveau des Arbeitens ab.<br />
Arbeit nimmt hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein; bestimmt das Leben; wird<br />
als Lebenssinn gesehen.<br />
Arbeitsgesellschaft – automatisches Funktionieren – Leben des Einzelnen ist völlig<br />
untergetaucht; Individualität aufgeben bzw. Empfindungen betäuben, um dann völlig<br />
beruhigt und reibungslos funktionieren zu können.<br />
Die eigentlichen weltorientierten Erfahrungen entziehen sich mehr und mehr dem<br />
Erfahrungshorizont der durchschnittlichen menschlichen Existenz.<br />
Denken wurde niemals als eine Tätigkeit innerhalb der Vita activa angesehen.<br />
Dabei, so Hannah <strong>Arendt</strong>, spricht sich das Denken als die tätigste aller Tätigkeiten<br />
aus.<br />
Fragen:<br />
In der heutigen Gesellschaft stehen vor der Politik die wirtschaftlichen Interessen<br />
im Fokus. Denken wirkt dabei störend auf diese Interessen?<br />
Denken in der heutigen Gesellschaft unerwünscht, unnötig??<br />
Denken – Vorrecht von Wenigen?<br />
Wissenschaftler sind keinem mehr Rechenschaft schuldig?<br />
Forscher (Naturwissenschaft) größere Relevanz als Politiker?