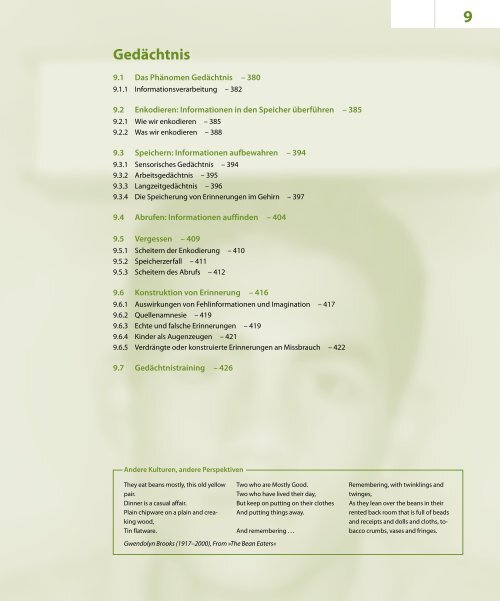Gedächtnis - Amazon Web Services
Gedächtnis - Amazon Web Services
Gedächtnis - Amazon Web Services
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gedächtnis</strong><br />
9.1 Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong> – 380<br />
9.1.1 Informationsverarbeitung – 382<br />
9.2 Enkodieren: Informationen in den Speicher überführen – 385<br />
9.2.1 Wie wir enkodieren – 385<br />
9.2.2 Was wir enkodieren – 388<br />
9.3 Speichern: Informationen aufbewahren – 394<br />
9.3.1 Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> – 394<br />
9.3.2 Arbeitsgedächtnis – 395<br />
9.3.3 Langzeitgedächtnis – 396<br />
9.3.4 Die Speicherung von Erinnerungen im Gehirn – 397<br />
9.4 Abrufen: Informationen auffinden – 404<br />
9.5 Vergessen – 409<br />
9.5.1 Scheitern der Enkodierung – 410<br />
9.5.2 Speicherzerfall – 411<br />
9.5.3 Scheitern des Abrufs – 412<br />
9.6 Konstruktion von Erinnerung – 416<br />
9.6.1 Auswirkungen von Fehlinformationen und Imagination – 417<br />
9.6.2 Quellenamnesie – 419<br />
9.6.3 Echte und falsche Erinnerungen – 419<br />
9.6.4 Kinder als Augenzeugen – 421<br />
9.6.5 Verdrängte oder konstruierte Erinnerungen an Missbrauch – 422<br />
9.7 <strong>Gedächtnis</strong>training – 426<br />
Andere Kulturen, andere Perspektiven<br />
They eat beans mostly, this old yellow<br />
pair.<br />
Dinner is a casual affair.<br />
Plain chipware on a plain and creaking<br />
wood,<br />
Tin flatware.<br />
Two who are Mostly Good.<br />
Two who have lived their day,<br />
But keep on putting on their clothes<br />
And putting things away.<br />
And remembering . . .<br />
Gwendolyn Brooks (1917–2000), From »The Bean Eaters«<br />
Remembering, with twinklings and<br />
twinges,<br />
As they lean over the beans in their<br />
rented back room that is full of beads<br />
and receipts and dolls and cloths, tobacco<br />
crumbs, vases and fringes.<br />
9
9<br />
380<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
◼ <strong>Gedächtnis</strong> (memory): dauerhaftes Fortbestehen<br />
von aufgenommenen Informationen über<br />
die Zeit; es ermöglicht die Speicherung und das<br />
Abrufen von Informationen.<br />
<strong>Gedächtnis</strong><br />
An event is such a little piece of time and space, leaving only a mindglow behind like the tail of a<br />
shooting star. For lack of a better word, we call that scintillation memory.<br />
Diane Ackerman, »An Alchemy of Mind« (2004)<br />
> Seien Sie dankbar für Ihr <strong>Gedächtnis</strong>. Wir halten es für etwas Selbstverständliches, außer<br />
wenn es nicht richtig funktioniert. Doch es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das es uns ermöglicht,<br />
Freunde, Nachbarn und Bekannte zu erkennen und sie beim Namen zu nennen, zu stricken,<br />
Schreibmaschine zu schreiben, Auto zu fahren und Klavier zu spielen, englisch, spanisch<br />
oder chinesisch zu sprechen, meint Rupp (1998). Es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das über die Zeit<br />
Rechenschaft ablegt und unser Leben bestimmt. Es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das es uns ermöglicht,<br />
unsere Nationalhymne zu singen, den Weg nach Hause und die für unser Überleben<br />
notwendige Nahrung zu finden. Es sind unsere gemeinsamen Erinnerungen, die uns<br />
zu einer zusammengehörigen Gruppe von Iren oder Australiern, Serben oder Schotten verbinden.<br />
Und es sind unsere Erinnerungen, die gelegentlich dafür sorgen, dass wir eine feindselige<br />
Haltung gegenüber Menschen einnehmen, deren Beleidigungen wir nicht vergessen<br />
können.<br />
Wir sind zum größten Teil das, woran wir uns erinnern. Ohne <strong>Gedächtnis</strong> gäbe es kein<br />
Schwelgen in Erinnerungen an glückliche Momente in der Vergangenheit, keine Schuld oder<br />
Wutgefühle, ausgelöst durch schmerzliche Erinnerungen. Stattdessen würden wir ständig in<br />
der Gegenwart leben. Jeder Moment wäre neu. Aber auch jeder Mensch wäre ein Fremder,<br />
alles Gesprochene eine unverständliche Fremdsprache, jede Aufgabe – sich anzuziehen, zu<br />
kochen, Fahrrad zu fahren – eine neue Herausforderung. Sogar Sie selbst wären sich fremd,<br />
da es Ihnen an dem durchgehenden Bewusstsein Ihrer selbst von der weit zurückliegenden<br />
Vergangenheit bis zum gegenwärtigen Augenblick fehlen würde. Der <strong>Gedächtnis</strong>forscher<br />
McGaugh (2003) vertrat die Auffassung: »Wenn Sie die Fähigkeit verlieren, Ihre frühen Erinnerungen<br />
abzurufen, dann haben Sie kein Leben mehr. Dann könnten Sie auch eine Kohlrübe<br />
oder ein Kohlkopf sein.«<br />
9.1 Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />
Ziel 1: Definieren Sie, was das <strong>Gedächtnis</strong> ist, und erklären Sie, wie sich Blitzlichterinnerungen von anderen<br />
Erinnerungen unterscheiden.<br />
Ihr <strong>Gedächtnis</strong> ist der Speicher des Mentalen, das Reservoir all dessen, was Sie im Lauf Ihres Lebens<br />
lernen. Der römische Staatsmann Cicero drückte es so aus: »Aller Dinge Hort ist das <strong>Gedächtnis</strong>.«<br />
Für den Psychologen ist das <strong>Gedächtnis</strong> – die Erinnerung – ein Hinweis darauf, dass Erlerntes<br />
die Zeit überdauert. Das <strong>Gedächtnis</strong> ermöglicht es uns, Informationen zu speichern und wieder<br />
abzurufen.<br />
Untersuchungen der Extremfälle von <strong>Gedächtnis</strong>leistungen haben Forschern zum Verständnis<br />
der Funktionsweise des <strong>Gedächtnis</strong>ses verholfen. Manche Untersuchungen haben sich auch mit<br />
den Ursachen und Auswirkungen von <strong>Gedächtnis</strong>verlust beschäftigt. Im Alter von 92 Jahren erlitt<br />
mein Vater einen kleinen Schlaganfall, der nur einen besonderen Effekt hatte. Seine geniale Persönlichkeit<br />
wurde nicht beeinträchtigt. Er war auch noch genauso beweglich wie zuvor. Er erkannte<br />
uns und konnte sich beim Durchsehen von Familienfotoalben über die kleinsten Einzelheiten<br />
aus seiner Vergangenheit stundenlang auslassen. Doch er hatte größtenteils seine Fähigkeit verloren,<br />
neue Erinnerungen über Gespräche und Alltagsereignisse zu speichern. Er konnte nicht sagen,<br />
welcher Wochentag gerade war. Obwohl ihm bereits mehrmals mitgeteilt wurde, dass sein<br />
Schwager gestorben war, überraschte ihn diese Nachricht jedes Mal wieder aufs Neue.<br />
Das andere Extrem sind Menschen, die bei einer <strong>Gedächtnis</strong>olympiade sichere Medaillengewinner<br />
wären. Ein Beispiel dafür war der russische Zeitungsreporter Schereschewski oder »S.«,<br />
wie ihn der Neuropsychologe Lurija in seiner Fallbeschreibung nannte. Dank seines <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
konnte S. einfach zuhören, während andere Reporter sich Notizen machen mussten, sein Gedächt-
9.1 · Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />
Falsche Blitzlichterinnerung<br />
Nachdem das zweite Flugzeug am 11. September 2002 gegen das World Trade Center<br />
geprallt war, flüsterte der Stabschef des Weißen Hauses dem Präsidenten George<br />
W. Bush die Neuigkeiten ins Ohr, als er gerade zu Besuch bei Schülern einer Klasse<br />
in Florida war. Doch was war mit dem ersten Flugzeug und dessen Angriff auf das<br />
Hochhaus? Als er 3 Monate später gefragt wurde, wie er vom ersten Aufprall erfahren<br />
habe, erinnerte sich der Präsident daran, »wie ich vor dem Klassenzimmer saß<br />
und darauf wartete, hineingehen zu können, und ich sah, wie ein Flugzeug gegen<br />
den Turm prallte. Der Fernseher war ja offensichtlich angeschaltet, und ich bin ja<br />
früher selbst geflogen. Da sagte ich mir: ›Was für ein schrecklicher Pilot.‹ Und dann:<br />
›Es muss ein grauenhafter Unfall gewesen sein.‹« Doch niemand hat das live im<br />
Fernsehen gesehen; auch gab es damals kein Filmmaterial vom ersten Flugzeugaufprall<br />
(Paltrow 2004). Als einige Leute die Geschichte hörten, hielten sie sie für eine<br />
unverfrorene Lüge oder gar für eine Verschwörung. Doch der Psychologe Greenberg<br />
(2004) merkte dazu später an: »Wir müssen nur die Labilität des menschlichen<br />
<strong>Gedächtnis</strong> bedenken … Präsident Bush scheint eine falsche Erinnerung gehabt zu<br />
haben, wie sie nicht besser in einem Lehrbuch der <strong>Gedächtnis</strong>psychologie beschrieben<br />
werden könnte<br />
nis verhalf ihm auch zu einem Ehrenplatz in nahezu jedem modernen Buch über <strong>Gedächtnis</strong>forschung.<br />
Menschen wie Sie und ich können aus dem <strong>Gedächtnis</strong> eine Folge von etwa 7 Ziffern<br />
wiederholen, mit ziemlicher Sicherheit jedoch nicht mehr als 9. S. konnte bis zu 70 Ziffern oder<br />
Wörter wiederholen, wenn sie mit 3 Sekunden Abstand in einem Zimmer ohne andere Geräusche<br />
vorgelesen wurden. Er konnte die Kolonnen genauso leicht rückwärts wie vorwärts hersagen.<br />
Seine Genauigkeit war zielsicher, auch wenn er gebeten wurde, sich bis zu 15 Jahre später an eine<br />
bestimmte Liste zu erinnern, nachdem er sich in der Zwischenzeit Hunderte von anderen Listen<br />
eingeprägt hatte. Er sagte dann etwa: »Ja, ja, das war eine Reihe, die Sie mir einmal dargeboten<br />
haben, als wir in Ihrer Wohnung waren. … Sie saßen am Tisch und ich im Schaukelstuhl. … Sie<br />
trugen einen grauen Anzug, und Sie schauten mich so an. …«<br />
Kommt Ihnen im Vergleich zu diesen Glanzleistungen Ihr eigenes <strong>Gedächtnis</strong> unzulänglich<br />
vor? Wenn dem so ist, dann sollten Sie sich etwas ins Bewusstsein rufen: Ihre eigene erstaunliche<br />
Fähigkeit, sich an unzählige Stimmen, Klänge und Lieder, Geschmäcker, Gerüche und Oberflächenstrukturen,<br />
Gesichter, Orte und Ereignisse zu erinnern. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mehr<br />
als 2500 Dias von Gesichtern und Orten anschauen. Für jedes Dia haben Sie jeweils nur 10 Sekunden<br />
Zeit. Später werden Ihnen nacheinander 280 von diesen Dias noch einmal vorgeführt, jeweils<br />
in Kombination mit einem zuvor nicht gezeigten Dia. Wenn es bei Ihnen ähnlich läuft wie bei den<br />
Teilnehmern an diesem von Haber (1970) durchgeführten Experiment, würden Sie in 90% der<br />
Fälle das zuvor bereits gesehene Dia wiedererkennen.<br />
Ihre <strong>Gedächtnis</strong>kapazität offenbart sich möglicherweise am deutlichsten bei Erinnerungen an<br />
einzigartige und emotional bedeutsame Augenblicke aus der Vergangenheit. Eine meiner lebhaftesten<br />
Erinnerungen ist der einzige Schlag, der mir während einer ganzen Spielsaison der Baseball-<br />
Jugendliga gelungen ist. Vielleicht erinnern Sie sich am lebhaftesten an einen Autounfall, an Ihren<br />
ersten wirklichen Kuss, Ihren ersten Tag nach dem Umzug in eine neue Stadt oder an die Umgebung,<br />
in der Sie sich befanden, als Ihnen eine tragische Nachricht mitgeteilt wurde. Die meisten<br />
Amerikaner über 55 sind überzeugt davon, sich genau daran erinnern zu können, was sie gerade<br />
taten, als sie die Nachricht von Präsident Kennedys Ermordung hörten (Brown u. Kulik 1982).<br />
Sieben Monate nach dem Tod von Prinzessin Diana und sogar 4 Jahre danach konnten sich die<br />
meisten Menschen in Großbritannien noch daran erinnern, wo genau sie sich aufhielten, als<br />
sie die Nachricht hörten (Kvavilashvili et al. 2003; Wynn u. Gilhooly 1999). Sechs Jahrzehnte nach<br />
der deutschen Invasion in Dänemark hatten nur wenige jüngere dänische Erwachsene irgendein<br />
Wissen über die Einzelheiten des Tages der Invasion. Aber Dänen über 72 erinnerten sich daran.<br />
70% erinnerten sich daran, welches Wetter an diesem Tag war (Berntsen u. Thomsen 2005). Und<br />
auch Sie werden sich vielleicht daran erinnern, wo Sie zum ersten Mal die Meldungen über den<br />
11. September 2001 gehört haben – »einer jener Momente, in denen sich die Geschichte spaltet<br />
und wir anfangen, die Welt in ›vorher‹ und ›nachher‹ zu unterteilen«, stand am nächsten Morgen<br />
in der »New York Times« zu lesen. Diese wahrgenommene Klarheit der Erinnerungen an über-<br />
381<br />
Was ist wichtiger, Ihre Erfahrungen oder Ihre<br />
Erinnerungen an sie?<br />
9<br />
Reuters/Corbis
9<br />
C. Styrsky<br />
382<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
◼ »Flashbulb memories« (Blitzlichterinnerungen):<br />
klare Erinnerung an emotional bedeutsame<br />
Momente oder Ereignisse.<br />
◼ Enkodieren (encoding): Verarbeitung von Informationen<br />
zur Eingabe in das <strong>Gedächtnis</strong>system,<br />
z. B. durch Herstellen eines Bedeutungszusammenhangs.<br />
◼ Speichern (storage): Dauerhaftes Behalten der<br />
enkodierten Informationen.<br />
◼ Abrufen (retrieval): Wiederauffinden gespeicherter<br />
Informationen im <strong>Gedächtnis</strong>speicher.<br />
raschende, einschneidende Ereignisse hat einige Psychologen dazu gebracht, in diesem Falle von<br />
»flashbulb memories« (Blitzlichterinnerungen) zu reden. Es ist, als gäbe das Gehirn den Befehl:<br />
»Halte das jetzt fest!« Doch wie andere Erinnerungen können sich unsere Blitzlichterinnerungen<br />
täuschen (Talarico et al. 2003).<br />
Wie kommt es, dass sich manchmal sogar unsere Blitzlichterinnerungen als völlig falsch herausstellen?<br />
Wie schaffen wir es, andere <strong>Gedächtnis</strong>leistungen zu vollbringen? Wie können wir uns<br />
an Dinge erinnern, über die wir jahrelang nicht nachgedacht haben, gleichzeitig aber den Namen<br />
eines Menschen vergessen, mit dem wir erst vor einer Minute gesprochen haben? Wie können die<br />
Erinnerungen zweier Menschen an das gleiche Ereignis so verschieden ausfallen? Wie werden<br />
Erinnerungen in unserem Gehirn gespeichert? Weshalb werden Sie sich wahrscheinlich weiter<br />
hinten in diesem Kapitel nicht richtig an den folgenden Satz erinnern: »Der wütende Randalierer<br />
warf den Stein gegen das Fenster«? Wie können wir unser Erinnerungsvermögen verbessern?<br />
Diesen Fragen wollen wir nachgehen, wenn wir uns im nächsten Abschnitt rückblickend mit 100<br />
Jahren <strong>Gedächtnis</strong>forschung beschäftigen werden.<br />
9.1.1 Informationsverarbeitung<br />
Ziel 2: Beschreiben Sie das klassische Drei-Stufen-Modell des <strong>Gedächtnis</strong>ses von Atkinson und Shiffrin,<br />
und erklären Sie, wie sich das aktuelle Modell des Arbeitsgedächtnisses davon unterscheidet.<br />
Wenn wir über das <strong>Gedächtnis</strong> nachdenken wollen, brauchen wir zunächst ein Modell für seine<br />
Funktionsweise. Eine Erinnerung entstehen zu lassen, ist in gewisser Hinsicht nicht anders<br />
als die Informationsverarbeitung, die ich für die Erstellung dieses Buches betrieben habe. Für<br />
jede neue Auflage werfe ich zunächst einen flüchtigen Blick auf unzählige gesammelte Informationen,<br />
zu denen auch etwa 100.000 Zeitungsartikel gehören. Das meiste davon ignoriere<br />
ich, doch manche Dinge sind es wert, zeitweilig in meiner Mappe gesammelt zu werden, um<br />
später einer eingehenderen Verarbeitung unterzogen zu werden. Nach und nach sortiere ich<br />
auch davon das meiste wieder aus. Der Rest, in der Regel etwa 3000 Artikel und Nachrichtenberichte,<br />
wird geordnet und zur Langzeitspeicherung abgelegt. Später, wenn ich die Geschichte<br />
der modernen Psychologie erzähle, hole ich diese Informationen wieder hervor und benutze<br />
sie als Quelle. Sehr wichtige Ereignisse aus der letzten Zeit kommen plötzlich in meinen geistigen<br />
Langzeitspeicher; von denen wähle ich dann aktuelle Beispiele für die Psychologie im Alltag<br />
aus. Um Erinnerungen entstehen zu lassen, müssen Sie ebenfalls Informationen auswählen,<br />
verarbeiten, speichern und abrufen. Sie verarbeiten Informationen nicht nur<br />
beim »Pauken« für eine Prüfung während des Studiums, sondern auch bei den Fertigkeiten,<br />
die Sie lernen, und bei der Verarbeitung von zahllosen alltäglichen Begebenheiten.<br />
Unser <strong>Gedächtnis</strong> gleicht in gewisser Hinsicht dem Informationsverarbeitungssystem<br />
eines Computers. Um uns an ein Ereignis zu erinnern, müssen wir zunächst Informationen<br />
in unser Gehirn hineinbekommen (sie enkodieren), diese Informationen in<br />
unserem Gehirn behalten (sie speichern) und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder<br />
auffinden (sie abrufen). Stellen wir uns nun vor, wie ein Computer Informationen enkodiert,<br />
speichert und abruft. Zunächst wird der Informationsinput (Tasteneingabe) in<br />
eine elektronische Sprache übersetzt, vergleichbar mit dem Gehirn, das sensorische Informationen<br />
so kodiert, dass sie zu einer neuronalen Sprache werden. Der Computer<br />
speichert ständig ungeheure Datenmengen auf einer Platte, von der sie später wieder<br />
abgerufen werden können.<br />
Wie alle Analogien hat auch das Computermodell seine Grenzen. Unsere Erinnerungen<br />
sind weniger genau und weitaus fragiler als die eines Computers. Darüber hinaus<br />
erfolgt beim Computer die Informationsverarbeitung schnell, aber nacheinander, auch<br />
wenn verschiedene Aufgaben abwechselnd ausgeführt werden. Das Gehirn ist zwar langsamer,<br />
macht aber viele Dinge gleichzeitig: Es verarbeitet parallel.<br />
Psychologen haben verschiedene Informationsverarbeitungsmodelle für das <strong>Gedächtnis</strong><br />
vorgestellt. Im klassischen <strong>Gedächtnis</strong>modell der Verarbeitung in 3 Stufen von
9.1 · Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />
Bob Daemmrich/The Image Works<br />
Atkinson u. Shiffrin (1968) wird die These verfolgt, dass wir Erinnerungen in 3 Stufen bilden.<br />
Atkinson u. Shiffrin vertraten die Auffassung, dass wir zunächst die Informationen, an die wir<br />
uns erinnern sollten, im flüchtigen sensorischen <strong>Gedächtnis</strong> registrieren, anschließend im Kurzzeitgedächtnis<br />
verarbeiten, wo wir sie durch Wiederholung des Erinnerten für das Langzeitgedächtnis<br />
und einen späteren Abruf enkodieren. Obwohl dieser Dreistufenprozess historisch<br />
wichtig und hilfreich, weil einfach, war, hat er seine Grenzen und birgt Fehlermöglichkeiten.<br />
Einige Informationen lassen, wie wir sehen werden, die ersten beiden Stufen aus und werden<br />
automatisch im Langzeitgedächtnis gespeichert – ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Außerdem<br />
erkennen wir heute, dass wir uns unmöglich auf alles gleichzeitig konzentrieren können, weil<br />
wir ständig sensorischen Informationen ausgesetzt sind. Stattdessen werfen wir den Scheinwerferstrahl<br />
unserer Aufmerksamkeit auf bestimmte eingehende Reize – oft neuartige oder wichtige<br />
Reize. Diese eingehenden Reize werden, zusammen mit den Informationen, die wir aus unserem<br />
Langzeitgedächtnis abrufen, zu bewussten Kurzzeiterinnerungen, sozusagen auf einer zeitweiligen<br />
Baustelle. Dieser Bereich ist ein Arbeitsbereich, in dem wir Informationen wiederholen und<br />
manipulieren (Engle 2002). Aber im Unterschied zu Baustellen, auf denen mit Ziegelstein und<br />
Mörtel hantiert wird, geht der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses schnell verloren, wenn wir ihn<br />
nicht weiter nutzen oder wiederholen. Genau hier assoziieren wir neue und alte Informationen<br />
und lösen Probleme. Die veränderte Version des <strong>Gedächtnis</strong>modells zur Verarbeitung in 3 Stufen,<br />
wie sie in diesem Kapitel dargestellt wird, enthält dieses wichtige Konzept des Arbeitsgedächtnisses<br />
(. Abb. 9.1).<br />
Zum Arbeitsgedächtnis gehören sowohl die auditiven (phonologische Schleife) als auch die<br />
visuell-räumlichen (visuell-räumlicher Notizblock) Elemente, die durch einen zentralen Exekutivprozessor<br />
koordiniert werden (. Abb. 9.2; Baddeley 1992, 2001, 2002). Diese voneinander getrennten<br />
mentalen Untersysteme gestatten es uns, Bilder und Wörter gleichzeitig zu verarbeiten.<br />
Dies ist auch eine Erklärung dafür, warum wir reden können (verbale Verarbeitung), während wir<br />
Auto fahren (visuell-räumliche Verarbeitung). Und die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses<br />
erklärt, warum es so schwierig ist, sich an die Melodie eines Lieds zu erinnern, während man<br />
ein anderes hört. Diesen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses unterliegt Hirnaktivität (Jonides<br />
et al. 2005). Schichtaufnahmen des Gehirns zeigen, dass die Frontallappen aktiv sind, wenn sich<br />
die zentrale Exekutive auf komplexes Denken konzentriert, und dass die Areale in den Parietal-<br />
und Temporallappen, die dazu beitragen, die auditiven und visuellen Informationen zu verarbeiten,<br />
auch aktiv sind, wenn sich solche Informationen in unserem Arbeitsgedächtnis befinden.<br />
Bob Daemmrich/The Image Works<br />
Bob Daemmrich/The Image Wores<br />
383<br />
. Abb. 9.1. Ein geändertes Dreistufenverarbeitungsmodell<br />
des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
Die heutigen <strong>Gedächtnis</strong>forscher haben andere<br />
Wege gefunden, auf denen sich Langzeiterinnerungen<br />
bilden. Wie wir sehen werden, schlüpfen<br />
z. B. einige Informationen sozusagen »durch die<br />
Hintertür« ins Langzeitgedächtnis, ohne dass man<br />
bewusst seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat.<br />
Und wir wissen, dass das Kurzzeitgedächtnis mehr<br />
ist als passives Wiederholen. Eine bessere Bezeichnung<br />
dafür ist Arbeitsgedächtnis; dadurch wird klar,<br />
dass dort eine aktive Verarbeitung stattfindet<br />
◼ Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> (sensory memory):<br />
unmittelbare, sehr kurze Zwischenspeicherung<br />
sensorischer Informationen im <strong>Gedächtnis</strong>system.<br />
◼ Kurzzeitgedächtnis (shortterm memory): aktiviertes<br />
<strong>Gedächtnis</strong>, das einige Informationsinhalte<br />
für kurze Zeit festhält (wie z. B. die 7 Ziffern<br />
einer Handynummer ohne Vorwahl), um sie<br />
dann entweder abzuspeichern oder zu vergessen.<br />
◼ Langzeitgedächtnis (longterm memory):<br />
relativ zeitüberdauernder und unbegrenzt aufnahmefähiger<br />
Speicher des <strong>Gedächtnis</strong>systems;<br />
dazu gehören Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen.<br />
◼ Arbeitsgedächtnis (working memory): ein<br />
neueres Verständnis des Kurzzeitgedächtnisses,<br />
zu dem die bewusste, aktive Verarbeitung von<br />
eingehenden auditiven und visuellräumlichen<br />
Informationen sowie von Informationen aus<br />
dem Langzeitgedächtnis gehört.<br />
9
9<br />
384<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Lernziele Abschnitt 9.1<br />
Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.2. Arbeitsgedächtnis<br />
Modell des Arbeitsgedächtnisses von Alan Baddeley (1998, 2001, 2002), hier vereinfacht dargestellt, enthält auditive und visuellräumliche<br />
Verarbeitungseinheiten, die von einer zentralen Exekutive geleitet werden. Die Informationen gelangen aus dem Langzeitspeicher und aus<br />
der unmittelbaren Erfahrung in das Arbeitsgedächtnis. Der episodische Puffer trägt dazu bei, dass die zentrale Exekutive Input so integrieren<br />
kann, dass wir ihn verstehen<br />
Ziel 1: Definieren Sie, was das <strong>Gedächtnis</strong> ist, und erklären Sie, wie sich Blitzlichterinnerungen<br />
von anderen Erinnerungen unterscheiden.<br />
<strong>Gedächtnis</strong> ist die Fähigkeit, Erlerntes durch die Speicherung und den<br />
Abruf von Informationen dauerhaft zu behalten. Blitzlichterinnerungen<br />
unterscheiden sich von anderen Erinnerungen durch ihre erstaunliche<br />
Klarheit.<br />
Ziel 2: Beschreiben Sie das klassische Drei-Stufen-Modell des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
von Atkinson und Shiffrin, und erklären Sie, wie sich das aktuelle Modell des<br />
Arbeitsgedächtnisses davon unterscheidet.<br />
Das klassische DreiStufenModell des <strong>Gedächtnis</strong>ses von Atkinson und<br />
Shiffrin geht davon aus, dass wir 1. flüchtige Eindrücke im sensorischen<br />
<strong>Gedächtnis</strong> aufzeichnen, von denen manche 2. im Kurzzeitgedächtnis<br />
sozusagen auf unserem geistigen Bildschirm verarbeitet werden. Ein<br />
winziger Teil davon wird dann 3. für die Abspeicherung im Langzeit<br />
gedächtnis und für den möglichen späteren Abruf enkodiert. Die heutigen<br />
<strong>Gedächtnis</strong>forscher weisen auf die Grenzen dieses Modells hin<br />
und merken an, dass wir einige Informationen automatisch registrieren,<br />
indem wir die ersten beiden Stufen überspringen. Und sie ziehen den<br />
Begriff Arbeitsgedächtnis (statt Kurzzeitgedächtnis) vor, weil er eine<br />
aktivere Rolle in dieser zweiten Stufe der Verarbeitung hervorhebt, in<br />
der wir die Informationen wiederholen und dadurch manipulieren, dass<br />
wir neue Reize mit älteren gespeicherten Erinnerungen assoziieren. Das<br />
Modell des Arbeitsgedächtnisses enthält visuellräumliche und auditive<br />
Untersysteme, die durch einen zentralen Exekutivprozessor koordiniert<br />
werden, der unsere Aufmerksamkeit, wenn erforderlich, auf etwas konzentriert.<br />
> Denken Sie weiter: Welche Blitzlichterinnerung haben Sie an ein<br />
gefühlsbetontes Erlebnis in der Vergangenheit?
9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
9.2 Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
Wie wird die registrierte sensorische Information enkodiert und anschließend in das <strong>Gedächtnis</strong>system<br />
überführt? Welche Arten von Informationen nehmen wir unbewusst auf? Welche Arten<br />
von Informationen setzen eine bewusste Verarbeitung voraus?<br />
9.2.1 Wie wir enkodieren<br />
Einige Informationen, so z. B. den Weg, den Sie das letzte Mal zum Seminarraum gegangen sind,<br />
verarbeiteten Sie mit großer Leichtigkeit, und dadurch geben Sie Ihrem <strong>Gedächtnis</strong>system die<br />
Freiheit, sich auf weniger vertraute Ereignisse zu konzentrieren. Aber um neuartige Informationen<br />
zu behalten, wie etwa die neue Handynummer einer Freundin, müssen Sie aufmerksam sein und<br />
sich große Mühe geben.<br />
Automatische Informationsverarbeitung<br />
Ziel 3: Beschreiben Sie die Arten von Informationen, die wir automatisch enkodieren.<br />
Es kostet Sie oft nur wenig oder gar keine Anstrengung, eine ungeheure Menge von Informationen<br />
aufzunehmen. Beispielsweise verarbeiten wir ohne bewusste Anstrengung automatisch Informationen<br />
über:<br />
4 Raum. Während Sie Ihr Lehrbuch lesen, enkodieren Sie oft die Stelle auf der Seite, auf der ein<br />
bestimmter Lernstoff erwähnt wird; später, wenn Sie damit ringen, die Informationen aus dem<br />
<strong>Gedächtnis</strong> abzurufen, können Sie möglicherweise seine Position auf der Seite visualisieren.<br />
4 Zeit. Während Sie Ihren Tag durchgehen, merken Sie sich unabsichtlich die Abfolge der Ereignisse<br />
des Tages. Später, wenn Sie bemerken, dass Sie Ihren Mantel irgendwo vergessen haben,<br />
stellen Sie die Abfolge dessen, was Sie an diesem Tag gemacht haben, wieder her und verfolgen<br />
die einzelnen Schritte.<br />
4 Häufigkeit. Mühelos verfolgen Sie, wie oft bestimmte Dinge geschehen; dadurch werden Sie in<br />
die Lage versetzt, Folgendes zu erkennen: »Das ist schon das dritte Mal, dass ich ihr heute<br />
begegne.«<br />
Aufgrund der Fähigkeit unseres Gehirns zur Parallelverarbeitung geht diese Verarbeitung vonstatten,<br />
ohne dass man ihr Aufmerksamkeit widmen muss. Automatische Verarbeitung funktioniert<br />
so mühelos, dass sie sich nur schwer abschalten lässt. Wenn Sie Wörter in Ihrer Muttersprache<br />
sehen, wie etwa eine Reklame seitlich auf einem Lastwagen, dann können Sie gar nicht anders, als<br />
ihre Bedeutung zu registrieren.<br />
Manche Formen der Verarbeitung erfordern Aufmerksamkeit und Anstrengung, wenn wir sie<br />
das erste Mal ausführen, mit Erfahrung und Übung erfolgen sie jedoch automatisch. Wenn man<br />
lesen lernt, erkundet man zunächst die einzelnen Buchstaben, um herauszubekommen, welche<br />
Wörter sie ergeben. Mit Mühe plackt man sich an nur 20 bis 50 Wörtern auf einer Seite ab. Heute<br />
jedoch nach Jahren der Übung kann man rasch und mühelos lesen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie<br />
müssten die folgenden umgedrehten Sätze von rechts nach links lesen lernen:<br />
.nedrew hcsitamotua nnak gnutiebrareV etssuweB<br />
Zunächst ist dazu Anstrengung erforderlich. Aber mit einiger Übung können solche Aufgaben<br />
automatisch ausgeführt werden. Wir haben viele unserer Fertigkeiten auf diese Weise entwickelt:<br />
lernen, wie man Auto fährt, wie man sich auf Rollerblades bewegt oder wie man in der Stadt seinen<br />
Weg findet.<br />
385<br />
◼ Automatische Verarbeitung (automatic processing):<br />
unbewusste Enkodierung zufällig anfallender<br />
Informationen, wie Raum, Zeit und<br />
Häufigkeit, sowie erlernter, aber inzwischen<br />
wohlbekannter Informationen (z. B. Wortbedeutungen).<br />
9
9<br />
386<br />
S. Wahl<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.3. Automatische vs. bewusste Verarbeitung<br />
Manche Informationen, wie den Ort, an dem Sie<br />
gestern Ihr Abendessen einnahmen, verarbeiten<br />
Sie automatisch. Für die Enkodierung und Erinnerung<br />
anderer Arten von Informationen, z. B. der<br />
Themen dieses Kapitels, ist bewusste Anstrengung<br />
erforderlich<br />
◼ Bewusste Verarbeitung (effortful processing):<br />
Form der Enkodierung, die Aufmerksamkeit und<br />
bewusste Anstrengung erfordert.<br />
◼ Wiederholung (rehearsal): bewusste Wiederholung<br />
von Informationen, um sie im Bewusstsein<br />
zu behalten oder für die Speicherung zu enkodieren.<br />
. Abb. 9.4. Behaltenskurve nach Ebbinghaus<br />
Ebbinghaus fand, dass er umso weniger Wiederholdurchgänge<br />
brauchte, um eine Liste von sinnlosen<br />
Silben am 2. Tag wieder zu erlernen, je häufiger er<br />
am 1. Tag geübt hatte. Oder einfach ausgedrückt: Je<br />
mehr Zeit wir mit dem Erlernen neuartiger Informationen<br />
verbringen, desto besser können wir sie<br />
behalten. (Aus Baddeley 1982)<br />
Bewusste Verarbeitung<br />
Ziel 4: Stellen Sie die bewusste Verarbeitung der automatischen Verarbeitung gegenüber,<br />
und erörtern Sie den »Next-in-Line«-Effekt, den Spacing-Effekt und den seriellen<br />
Positionseffekt.<br />
Große Mengen von Informationen enkodieren und behalten wir zwar automatisch,<br />
doch manche Arten von Informationen, wie etwa die Begriffe in diesem Kapitel,<br />
können wir uns nur durch bewusste Anstrengung und Aufmerksamkeit einprägen.<br />
Bewusste Verarbeitung (. Abb. 9.3) führt oft zu bleibenden und leicht zugänglichen<br />
Erinnerungen.<br />
Wenn wir neue Information, beispielsweise Namen, lernen, können wir unserem<br />
<strong>Gedächtnis</strong> durch Wiederholung (»rehearsal«), d. h. bewusste Wiederholung, auf die<br />
Beine helfen. Diese Tatsache wurde schon vor vielen Jahren von einem Pionier auf<br />
dem Gebiet der verbalen <strong>Gedächtnis</strong>forschung, dem deutschen Philosophen Hermann<br />
Ebbinghaus (1850–1909), nachgewiesen. Ebbinghaus war für die <strong>Gedächtnis</strong>forschung,<br />
was Iwan Pawlow für die Konditionierungsforschung war. Die philosophischen<br />
Spekulationen über das <strong>Gedächtnis</strong> ließen Ebbinghaus ungeduldig werden,<br />
und er beschloss daher, das <strong>Gedächtnis</strong> wissenschaftlich zu ergründen. Dazu beobachtete<br />
er an sich selbst die Prozesse, bei denen er neuartigen verbalen Stoff lernte und<br />
wieder vergaß.<br />
Ebbinghaus musste dazu Material finden, das ihm nicht bekannt war. Er löste das<br />
Problem durch die Zusammenstellung einer Liste aus allen möglichen sinnlosen Silben, die alle<br />
aus zwei Konsonanten und einem Vokal in der Mitte bestanden. Für ein bestimmtes Experiment<br />
wählte er dann nach dem Zufallsprinzip eine Gruppe dieser Silben aus. Lesen Sie sich nun laut und<br />
relativ schnell 8-mal hintereinander folgende Liste (aus Baddeley 1982) vor, um ein Gefühl dafür<br />
zu bekommen, wie Ebbinghaus sich selbst testete. Versuchen Sie anschließend, sich an diese Items<br />
zu erinnern:<br />
S. Wahl<br />
JIH, BAZ, FUB, YOX, SUJ, XIR, LEQ, VUM, PID, KEL, WAV, TUV, YOF, GEK, HIW.<br />
Einen Tag, nachdem Ebbinghaus eine derartige Liste gelernt hatte, konnte er sich nur an wenige<br />
dieser Silben erinnern. Aber hatte er sie völlig vergessen? Wie aus . Abb. 9.4 hervorgeht, brauchte<br />
er am 2. Tag zur erneuten fehlerfreien Wiedergabe der Liste umso weniger Durchgänge, je häufiger<br />
er sie am 1. Tag laut wiederholt hatte. Daraus ließ sich ein einfaches Grundprinzip ableiten: Die<br />
Informationsmenge, an die man sich erinnert, hängt von der Zeit ab, die dafür aufgewandt wurde,
9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
sie zu lernen. Auch wenn wir etwas bereits gelernt haben, können wir durch zusätzliche Lerndurchgänge<br />
(»overlearning«, Überlernen) das Erinnerungsvermögen an diesen Lernstoff noch<br />
steigern.<br />
! Im Hinblick auf die Speicherung neuer Informationen macht Übung, d. h. bewusste Verarbeitung,<br />
tatsächlich den Meister.<br />
Dies hilft uns auch, einige andere interessante Phänomene besser zu verstehen:<br />
4 Der »Next-in-Line«-Effekt: Wenn Menschen, die in einem Kreis stehen, nacheinander Wörter<br />
oder ihren Namen sagen und sich daran zu erinnern versuchen, was die anderen gesagt haben,<br />
erinnern sie sich am schlechtesten an das, was die Person direkt vor ihnen gesagt hat (Bond et<br />
al. 1991; Brenner 1973). Wenn wir der Nächste sind, der an die Reihe kommt, konzentrieren<br />
wir uns auf unseren eigenen Auftritt und versäumen es häufig, die Äußerungen der letzten<br />
Person vor uns zu verarbeiten.<br />
4 An Informationen, die uns in den letzten paar Sekunden vor dem Einschlafen dargeboten<br />
werden, erinnern wir uns nur selten (Wyatt u. Bootzin 1994). Wenn unser Bewusstsein dahinschwindet,<br />
bevor wir die Information verarbeitet haben, ist alles verloren. Hingegen erinnern<br />
wir uns gut an Informationen, die wir in der Stunde vor dem Einschlafen aufnehmen (auf<br />
diesen Punkt werden wir in 7 Abschn. 9.5.3 noch näher eingehen).<br />
4 Informationen von Tonbandaufnahmen, die uns während des Schlafens vorgespielt werden,<br />
werden zwar von den Ohren registriert, doch erinnern wir uns nicht daran (Wood et al. 1992).<br />
Ohne Gelegenheit zum Wiederholen funktioniert das »Lernen im Schlaf« nicht. Außerdem<br />
behalten wir Information besser, wenn die Wiederholungen über die Zeit verteilt sind (wie<br />
beim Lernen der Namen unserer Klassenkameraden). Dieses Phänomen wird auch Spacing<br />
Effekt (Bjork 1999; Dempster 1988) genannt.<br />
In einem 9 Jahre dauernden Experiment lernten Bahrick et al. (1993) in Abständen, die von 14<br />
Tagen bis zu 56 Tagen dauern konnten, eine vorher festgelegte Anzahl von Malen Wörter einer<br />
fremden Sprache und ihre Übersetzung. Das durchgängige Ergebnis: Je länger der Abstand zwischen<br />
den einzelnen Übungsdurchgängen war, desto besser wurden die Wörter behalten (bis zu 5<br />
Jahre nach dem Experiment). Als Bahrick über diesen Lerneffekt durch Wiederholen in immer<br />
größer werdenden Abständen (Spacing-Effekt) nachdachte, erkannte er dessen praktische Bedeutung:<br />
Das wiederholte Lernen des Lernmaterials für umfassende Klausuren, die Schlussprüfungen<br />
von Repetitorkursen oder Studienabschlussprüfungen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir<br />
das Gelernte ein Leben lang nicht vergessen werden. Wenn man das Lernen über ein Semester<br />
oder ein Jahr hinweg verteilt, statt in kürzeren Abständen (Tage) zu lernen, kann dies dazu beitragen,<br />
das Gelernte besser zu behalten.<br />
! Verteiltes Lernen ist besser als massiertes Pauken. Oder, um mit Ebbinghaus (1885) zu<br />
sprechen: Wer schnell lernt, vergisst auch schnell.<br />
Um sich solche Dinge wie Telefonnummern einzuprägen, funktioniert die verteilte Wiederholung<br />
in immer größeren Abständen gut. Thomas Landauer (2001) erklärt, wie es geht: »Wiederholen<br />
Sie den Namen oder die Nummer, die Sie sich merken wollen, warten Sie ein paar Sekunden,<br />
wiederholen Sie sie noch einmal, warten Sie etwas länger, wiederholen Sie sie noch einmal, warten<br />
Sie noch etwas länger, und wiederholen Sie sie noch einmal. Die Wartephasen sollten so lang sein<br />
wie irgend möglich, ohne dass die Information vergessen wird.<br />
Ein Phänomen, das Sie sicherlich von sich selbst kennen, ist eine weitere Veranschaulichung<br />
der positiven Effekte des Wiederholens: Forscher zeigten Teilnehmern an einem Experiment<br />
eine Liste mit Items (Wörter, Namen, Daten und sogar Gerüche) und baten sie anschließend,<br />
sich sofort in einer x-beliebigen Reihenfolge an diese Items zu erinnern (Reed 2000). Aus den<br />
Antworten der Teilnehmer, die versuchten, sich an die Items der Liste zu erinnern, ergab<br />
sich häufig der serielle Positionseffekt: Sie erinnerten sich besser an die ersten und letzten<br />
Items der Liste als an jene in der Mitte (. Abb. 9.5). Dieses bessere Erinnern der ersten und der<br />
letzten Information wird als Primacy- bzw. Recency-Effekt bezeichnet. Vielleicht erinnerten<br />
sich die Leute besonders schnell und gut an die letzten Items der Liste, weil diese noch im Arbeitsgedächtnis<br />
gespeichert waren. Aber nach einer Weile – nachdem ihre Aufmerksamkeit<br />
387<br />
»Er sollte sein <strong>Gedächtnis</strong> überprüfen, indem er<br />
die Verse rezitiert.«<br />
Abdur-Rahman Khaliq, »Memorizing the Quran«<br />
◼ Spacing-Effekt (spacing effect): Tendenz, dass<br />
durch zeitlich verteiltes Lernen oder Üben bessere<br />
langfristige Behaltenserfolge erzielt werden<br />
als bei massiertem Lernen oder Üben.<br />
»Der Verstand vergisst nur langsam etwas,<br />
wenn er lange dafür gebraucht hat, es zu lernen.«<br />
Der römische Philosoph Seneca<br />
(4 v. Chr. – 65 n. Chr.)<br />
◼ Serieller Positionseffekt (serial position effect):<br />
Tendenz, sich am besten an die ersten (Primacy<br />
Effekt) und letzten (RecencyEffekt) Punkte einer<br />
Liste zu erinnern.<br />
9
9<br />
388<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.5. Der serielle Positionseffekt<br />
Wenn Menschen eine Liste von Namen und Wörtern<br />
vorgetragen wird, erinnern sie sich normalerweise<br />
sofort an die letzten Punkte der Aufzählung (vielleicht<br />
weil sie noch auf unserem geistigen »Monitor«<br />
eingeblendet sind) und fast ebenso gut an die allerersten.<br />
Später jedoch erinnern sie sich am besten<br />
an die ersten Items der Liste. (Aus Craik u. Watkins<br />
1973)<br />
von den letzten Items abgelenkt wurde – erinnerten sie sich am besten an die ersten Punkte<br />
der Liste.<br />
Als Parallele aus dem Alltag stellen Sie sich vor, es sei der erste Tag auf einer neuen Arbeitsstelle,<br />
und Ihr Vorgesetzter stellt Sie Ihren Kollegen vor. Jedes Mal, wenn Sie einen Kollegen treffen,<br />
wiederholen Sie die Namen aller Kollegen, und zwar vom ersten bis zum bis dahin letzten. Wenn<br />
Sie dann auf den letzten treffen, haben Sie mehr Zeit damit verbracht, die ersten Namen zu wiederholen,<br />
als die letzten; daher werden Sie am nächsten Tag wahrscheinlich die ersten Namen<br />
leichter aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen. Zudem wird sich das Lernen der ersten Namen störend auf<br />
das Lernen der späteren auswirken.<br />
Aber manchmal reicht das reine Wiederholen von Informationen, wie etwa der neuen Telefonnummer,<br />
die wir im Begriff sind zu wählen, einfach nicht aus, um sie für den späteren Abruf<br />
zu speichern (Craik u. Watkins 1973; Greene 1987). Wie enkodieren wir also Informationen, die<br />
in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert werden sollen? Die Verarbeitung sensorischer Informationen<br />
gleicht in vieler Hinsicht dem Durchsehen der täglichen Post. Manche Sendungen<br />
sortieren wir sofort aus. Andere verarbeiten wir bedächtiger: Wir öffnen sie, lesen sie und behalten<br />
den Inhalt im <strong>Gedächtnis</strong>. Unser <strong>Gedächtnis</strong>system verarbeitet Informationen durch die Kodierung<br />
ihrer wichtigsten Merkmale.<br />
9.2.2 Was wir enkodieren<br />
Wir verarbeiten Informationen hauptsächlich auf 3 verschiedene Arten: durch Enkodierung ihrer<br />
Bedeutung, durch Enkodierung ihrer bildlichen Darstellung und durch mentales Einordnen der<br />
Informationen. Bis zu einem gewissen Grad sind das automatisch ablaufende Prozesse. Doch für<br />
jede dieser Vorgehensweisen gibt es bewusste Strategien zur Verbesserung unseres Erinnerungsvermögens.<br />
Enkodieren von Bedeutung<br />
Ziel 5: Vergleichen Sie die Vorteile der visuellen, auditiven und semantischen Enkodierung beim Erinnern<br />
verbaler Informationen, und beschreiben Sie eine Strategie zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses,<br />
die mit dem Selbstbezugseffekt in Zusammenhang steht.<br />
Wenn man verbale Informationen zur Abspeicherung verarbeitet, enkodiert man ihre Bedeutung,<br />
assoziiert sie mit dem, was man bereits weiß und sich vorstellt. Ob wir Barbara oder Rhabarber<br />
hören, wenn wir immer wieder Barbara sagen, hängt davon ab, in welche Richtung uns der Kontext<br />
und unsere Erfahrung uns bei der Interpretation und Enkodierung der Laute lenken. (Sie erinnern<br />
sich: Unser Arbeitsgedächtnis steht mit unserem Langzeitgedächtnis in Wechselwirkung.)
9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
Können Sie den Satz vom Randalierer (kurz vor dem Anfang von 7 Abschn. 9.1.1) noch einmal<br />
wiederholen: »Der wütende Randalierer warf …«)? Vielleicht geht es Ihnen wie den Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern am Experiment von Brewer (1977). Sie erinnerten sich an den Randalierersatz<br />
aufgrund der Bedeutung, die sie beim Lesen des Satzes enkodiert hatten (z. B. »Der wütende<br />
Randalierer warf den Stein durch das Fenster«), und nicht aufgrund des tatsächlichen Wortlauts<br />
(»Der wütende Randalierer warf den Stein gegen das Fenster«). Wie an diesem Beispiel leicht erkennbar<br />
ist, neigen wir dazu, uns nicht genau zu erinnern, wie etwas war. Stattdessen erinnern wir<br />
uns an das, was wir enkodiert haben. Beim Lernen für eine Prüfung erinnern Sie sich möglicherweise<br />
besser an Ihre eigenen Mitschriften aus der Vorlesung als an die Vorlesung selbst. Bower u.<br />
Morrow (1990) vergleichen unser Denken und unser <strong>Gedächtnis</strong> mit einem Theaterintendanten,<br />
dem ein Manuskript in die Hand gedrückt wird und der vor seinem geistigen Auge sofort die<br />
fertige Bühnenproduktion sieht. Wenn wir später gefragt werden, was wir gehört oder gelesen<br />
haben, erinnern wir uns nicht an den wörtlichen Text, sondern an das geistige Modell, das wir uns<br />
davon gemacht haben.<br />
Mit welcher Art von Enkodierung lässt sich Ihrer Meinung nach die beste Erinnerung an<br />
verbale Informationen erzielen? Mit der visuellen Enkodierung von Bildern? Mit der akustischen<br />
Enkodierung von Lauten und Klängen? Mit der semantischen Enkodierung von Bedeutung?<br />
Jede Form verfügt über ein eigenes Untersystem im Gehirn, das dafür zuständig ist (Poldrack<br />
u. Wagner 2004). Und jedes kann hilfreich sein. Akustisches Enkodieren steigert beispielsweise<br />
die Einprägsamkeit und den scheinbaren Wahrheitsgehalt von sich reimenden Aphorismen.<br />
»Was du versäumst im Augenblick, bringt keine Ewigkeit zurück« erscheint uns daher richtiger als<br />
»Was du versäumst im Augenblick, bringt dir keine Ewigkeit wieder« (McGlone u. Tofighbakhsh<br />
2000).<br />
Um visuelle, akustische und semantische Enkodierung miteinander zu vergleichen, ließen<br />
Craik u. Tulving (1975) vor den Augen von Versuchsteilnehmern Wörter kurz aufblitzen. Dann<br />
stellten sie den Personen eine Frage, für deren Beantwortung es nötig war, die Wörter zu verarbeiten,<br />
und zwar erstens visuell (das Aussehen der Buchstaben), zweitens akustisch (der Klang der<br />
Wörter) oder drittens semantisch (die Bedeutung der Wörter). Um selbst ein Gefühl von dieser<br />
Aufgabe zu bekommen, antworten Sie rasch auf folgende Fragen:<br />
Beispielfragen zur Auslösung von<br />
Verarbeitung<br />
1. Ist das Wort in Großbuchstaben<br />
geschrieben<br />
Gezeigtes Wort Ja Nein<br />
stuhl<br />
2. Reimt sich das Wort auf »Zug«? KLUG<br />
3. Würde das Wort in den Satz passen:<br />
Das Mädchen legte das 00 auf<br />
den Tisch.<br />
Gewehr<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
Welche Art von Verarbeitung wäre wahrscheinlich am besten dazu geeignet, Sie darauf vorzubereiten,<br />
die Wörter zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuerkennen? Bei dem Experiment von<br />
Craik und Tulving ergab die 3. Frage (das tiefe, semantische Enkodieren) deutlich bessere <strong>Gedächtnis</strong>leistungen<br />
als die »oberflächliche Verarbeitung«, die durch Frage 2 und vor allem durch<br />
Frage 1 angeregt wurde (. Abb. 9.6).<br />
Aber wenn man uns ein zu dürres Skript gibt, haben wir Schwierigkeiten, ein mentales Modell<br />
zu bilden. Versetzen Sie sich einmal in die Situation der Studierenden, die von Bradford u. Johnson<br />
(1972) gebeten wurden, sich folgende auf Band aufgenommene Textpassage einzuprägen:<br />
Die Prozedur ist in Wirklichkeit ganz einfach. Zunächst ordnen Sie die Dinge in verschiedene Gruppen.<br />
Natürlich kann, je nachdem, wie viel es zu tun gibt, ein Haufen genügen. … Nachdem die Prozedur<br />
abgeschlossen ist, ordnen Sie die Dinge wieder in verschiedene Gruppen. Anschließend können<br />
sie dann an dem für sie vorgesehenen Ort abgelegt werden. Nach einiger Zeit werden sie dann wieder<br />
verwendet, und der ganze Zyklus beginnt von vorne. Aber das ist ein Teil des Lebens.<br />
389<br />
Hier ein weiterer Satz, nach dem ich Sie später<br />
wieder fragen werde: »Der Fisch griff den<br />
Schwimmer an.«<br />
◼ Visuelle Enkodierung (visual encoding): Enkodieren<br />
von optischen Bildern.<br />
◼ Akustische Enkodierung (acoustic encoding):<br />
Enkodieren von Lauten und Klängen, insbesondere<br />
von Wortklängen.<br />
◼ Semantische Enkodierung (semantic encoding):<br />
Enkodieren von Bedeutung, einschließlich<br />
Wortbedeutungen.<br />
? Wie viele Vs befinden sich im folgenden Text:<br />
Vorwiegend auf dem Landweg vagabundierten<br />
diverse Vasen aus Hannover, bevor sie nach<br />
Varel wechselten.<br />
7 Antwort 9.1 am Ende des Kapitels<br />
9
9<br />
390<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.6. Verarbeitungsniveaus<br />
Die tiefgehende Verarbeitung eines Wortes aufgrund<br />
seiner Bedeutung (semantische Enkodierung)<br />
sorgt zu einem späteren Zeitpunkt für eine<br />
bessere Wiedererkennung als die oberflächliche<br />
Verarbeitung durch Merken des äußeren Erscheinungsbildes<br />
oder des Klanges. (Aus Craik u. Tulving<br />
1975)<br />
»Zu den Dingen, die einem beim Vorgang des Einprägens<br />
sehr helfen, gehört das Verstehen der<br />
Verse, die man sich eingeprägt hat, und das Wissen<br />
über die Zusammenhänge und Verbindungen<br />
zwischen ihnen.«<br />
Abdur-Rahman Khaliq, »Memorizing the Quran«<br />
»Denken Sie daran: Wenn jemand etwas gehört<br />
hat, wirkt sich nichts stärker auf den Verstand<br />
eines Beobachters aus, als wenn er es auch gesehen<br />
hat.«<br />
Horaz, Ars poetica (8. v. Chr.)<br />
◼ Bildliche Vorstellung (imagery, mental pictures):<br />
äußerst wirksame Hilfe für die bewusste<br />
Verarbeitung, besonders in Kombination mit<br />
semantischer Enkodierung.<br />
Als die Studierenden den Textabschnitt, den Sie eben gelesen haben, ohne sinnvollen Kontext<br />
hörten, erinnerten sie sich später nur an wenig. Als ihnen mitgeteilt wurde, dass es bei diesem Text<br />
ums Wäschewaschen ging (etwas, was dem Text eine Bedeutung gab), erinnerten sie sich an sehr<br />
viel mehr – Ihnen ginge es wahrscheinlich nach nochmaligem Lesen ähnlich. Diese Forschungsergebnisse<br />
unterstreichen die Vorteile des nochmaligen Formulierens dessen, was wir lesen und<br />
hören, in sinnvollen Bedeutungszusammenhängen. Aufgrund seiner Selbsttests kam Ebbinghaus<br />
zu dem Schluss, dass im Vergleich zum Lernen von sinnlosem das Erlernen von sinnvollem Stoff<br />
ein Zehntel der Anstrengung erforderte. Oder wie es der <strong>Gedächtnis</strong>forscher Wickelgren (1977,<br />
S. 346) ausdrückte: »Die Zeit, die Sie mit Nachdenken über das, was Sie lesen, und damit zubringen,<br />
es mit dem früher gespeicherten Material in Beziehung zu setzen, ist praktisch das Nützlichste,<br />
was Sie für das Erlernen von neuen Themen tun können.« Die Menge des Erinnerten hängt daher<br />
sowohl von der Zeit ab, die man mit dem Lernen verbringt, als auch damit, was wir tun, während<br />
wir lernen.<br />
Wir können uns besonders gut an Dinge erinnern, die einen Bezug zu uns selbst haben. Wenn<br />
wir gefragt werden, wie gut bestimmte Adjektive einen anderen Menschen beschreiben, vergessen<br />
wir anschließend diese Adjektive oft wieder. Werden wir hingegen gefragt, wie gut diese Adjektive<br />
zu uns selbst passen, erinnern wir uns später gut an diese Wörter, ein Phänomen, das auch Selbstbezugseffekt<br />
genannt wird (Symons u. Johnson 1997). Sie profitieren also davon, wenn Sie sich Zeit<br />
nehmen, eine persönliche Bedeutung in dem zu finden, was Sie gerade lernen (beispielsweise,<br />
indem Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem Abschnitt »Lernziele« am Ende jedes größeren<br />
Abschnitts dieses Buchs zu beschäftigen).<br />
! Informationen, die wir als für uns persönlich wichtig einschätzen, werden tiefer verarbeitet und<br />
bleiben damit besser zugänglich.<br />
Enkodieren von Bildern<br />
Ziel 6: Erklären Sie, wie die Enkodierung unserer Vorstellungswelt dazu beiträgt, etwas mühelos zu verarbeiten,<br />
und beschreiben Sie einige Strategien zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, bei denen die visuelle<br />
Enkodierung genutzt wird.<br />
Woran liegt es, dass wir uns sehr anstrengen müssen, um uns an Formeln, Definitionen und Daten<br />
zu erinnern, aber leicht aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen können, wo wir gestern waren, wer bei uns<br />
war, wo wir saßen und was wir anhatten? Zu unseren frühesten Erinnerungen, wahrscheinlich an<br />
ein Ereignis im Alter von 3 oder 4 Jahren, gehören bildliche Vorstellungen. Forscher haben auch<br />
dokumentiert, dass wir uns besser an konkrete Wörter erinnern, die sich dafür eignen, dass wir
9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
uns visuelle mentale Bilder vorstellen, als an abstrakte, wenig bildhafte Wörter. (An<br />
welche 3 Wörter der folgenden Reihe – Schreibmaschine, Nichts, Zigarette, innewohnend,<br />
Feuer, Prozess – erinnern Sie sich wohl am ehesten, wenn ich Sie später<br />
danach fragen werde?). Möglicherweise erinnern Sie sich auch immer noch an den<br />
Satz von dem Steine werfenden Randalierer, nicht nur wegen der Bedeutung, die<br />
Sie enkodiert haben, sondern auch, weil sich der Satz zur Vorstellung eines Bildes<br />
eignet. Die Erinnerung an konkrete Substantive wird durch doppelte Enkodierung<br />
unterstützt: einerseits semantisch, andererseits visuell (Marschark et al. 1987;<br />
Palvio 1986). Zwei Codes sind besser als einer.<br />
! Dank der Langlebigkeit eindringlicher Bilder erinnern wir uns manchmal in<br />
Form »mentaler Schnappschüsse« der schönsten oder der schlimmsten Momente,<br />
die wir erlebt haben.<br />
Deshalb prägen sich der schönste Moment eines angenehmen Erlebnisses oder einer glücklichen<br />
Begebenheit und der schlimmste Moment einer schmerzvollen oder frustrierenden Situation<br />
unseren Erinnerungen häufig gut ein (Fredrickson u. Kahneman 1993). Diese selektive Erinnerung<br />
an die Höhepunkte und das Vergessen der eher alltäglichen Momente erklären möglicherweise<br />
ein Phänomen, das Mitchell et al. (1997) als »rosigen Rückblick« bezeichnen: Die Menschen<br />
neigen dazu, sich positiver an Ereignisse (z. B. an einen Campingurlaub) zu erinnern, als sie sie<br />
zunächst tatsächlich bewerteten. Sie erinnern sich an ihren Besuch bei Disney World weniger<br />
wegen der schwülen Hitze und der langen Warteschlangen und eher wegen der ganzen Umgebung,<br />
des Essens und der Fahrten mit Achterbahnen etc. Und unsere künftigen Entscheidungen ließen<br />
sich eher aufgrund der Erfahrung vorhersagen, an die wir uns erinnern, als aufgrund der Erfahrung,<br />
die wir hatten (Wirtz et al. 2003).<br />
Bildliche Vorstellungen stellen das Herzstück vieler <strong>Gedächtnis</strong>hilfen dar. Die sog. Mnemotechniken<br />
(griech. »mneme« = <strong>Gedächtnis</strong>, Erinnerung) wurden bereits im Altertum von den<br />
griechischen Gelehrten und Rednern als Erinnerungshilfen für lange Passagen und Reden entwickelt.<br />
Häufig verwendeten sie z. B. die »Loci-Methode« (Ortsmethode), d. h. sie stellten sich vor,<br />
wie sie sich durch vertraute Räume mit einer geordneten Folge von bekannten Plätzen bewegten,<br />
und assoziierten dabei bestimmte Stellen mit einer bildlichen Vorstellung des Themas, an das sie<br />
sich erinnern wollten. Beim Sprechen lief der Redner dann im Geist entlang der einzelnen Stationen<br />
eines bekannten Weges und rief so die damit assoziierten Bilder ab. In einer neueren Studie<br />
über die Kandidaten bei der World Memory Championship zeigte sich, dass nicht alle eine außergewöhnliche<br />
Intelligenz aufwiesen, sondern dass sie besonders gut darin waren, räumliche Mnemotechniken<br />
zu nutzen (Maguire et al. 2003).<br />
Bei anderen Mnemotechniken finden sowohl auditive als auch visuelle Codes Verwendung.<br />
Beispielsweise bei einer Technik, die auf Englisch Peg Word System heißt, also ein System, bei dem<br />
Wörter als Aufhänger dienen; da muss man sich zunächst Merkverse einprägen: »One is a bun;<br />
two is a shoe; three is a tree; four is a door; five is a hive; six is sticks; seven is heaven; eight is a gate;<br />
nine is swine; ten is a hen.« Ohne viel Mühe werden Sie bald in der Lage sein, mit diesen Aufhängern<br />
statt mit Zahlen zu zählen: bun, shoe, tree ... und dann bildlich die Aufhänger mit Items, an<br />
die Sie sich erinnern sollten, zu assoziieren. Sie haben jetzt das Zeug dazu, gegen jeden anzutreten,<br />
der Ihnen eine Einkaufsliste gibt, an die Sie sich erinnern sollen. Karotten? Stellen Sie sich vor, wie<br />
Sie sie in ein Brötchen (bun) stecken. Milch? Gießen Sie sie in einen Schuh. Papiertücher? Drapieren<br />
Sie sie um die Zweige eines Baums. Wenn Sie an »bun, shoe, tree« denken, sehen Sie die Bilder,<br />
die Sie damit assoziieren: Karotten, Milch, Papiertücher. Relativ fehlerfrei (Bugelski et al. 1968)<br />
werden Sie in der Lage sein, die Artikel auf der Liste in jeder Reihenfolge zu erinnern und jeden<br />
beliebigen Artikel zu nennen. Solche Mnemotechniken werden von <strong>Gedächtnis</strong>künstlern genutzt,<br />
die lange Listen mit Namen und Gegenständen wiederholen. Und diese Techniken können auch<br />
für Sie hilfreich sein.<br />
391<br />
Das Prinzip des bildlichen Vorstellung<br />
Der Schönheitschirurgieforscher Darrick Antell hat<br />
die Erfahrung gemacht, dass man über die Gesundheitsrisiken<br />
des Bräunens und Rauchens reden<br />
kann, bis man schwarz wird. Zeigt man den Leuten<br />
aber ein Foto von eineiigen Zwillingen, von denen<br />
nur eine unter dem Einfluss von Sonnenbaden und<br />
Rauchen gealtert ist, lernen sie tatsächlich und merken<br />
sich das. Die 60jährige Gay Black (linkes Bild)<br />
war im Gegensatz zu ihrer jünger aussehenden<br />
Zwillingsschwester Gwen Sirota (rechtes Bild) eine<br />
begeisterte Sonnenanbeterin und Raucherin<br />
◼ Mnemotechniken (mnemonics): <strong>Gedächtnis</strong>hilfen,<br />
insbesondere jene Techniken, die eindringliche<br />
Bilder und Ordnungsstrukturen nutzen.<br />
»Assoziieren Sie einfach jede Zahl mit einem Wort,<br />
z. B. das Wort ›Tisch‹ mit der Zahl 3.476.029.«<br />
9<br />
Ho/AP Photo<br />
© 1994 Sidney Harris. www.ScienceCartoonsPlus.com
9<br />
392<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
◼ Chunking (chunking): Organisieren einzelner<br />
Items in handhabbare und/oder vertraute Einheiten;<br />
geschieht häufig automatisch.<br />
. Abb. 9.7. Chunking und <strong>Gedächtnis</strong><br />
Sobald Information in Form von Einheiten mit Bedeutung<br />
wie Buchstaben, Wörter oder Sätze organisiert<br />
wird, wird sie leichter abrufbar. (Aus Hintzman<br />
1978)<br />
. Abb. 9.8. Ein Beispiel für Chunking – für alle,<br />
die Chinesisch lesen können<br />
Können Sie diese Zeichen anschauen und dann<br />
reproduzieren? Wenn Sie das können, können Sie<br />
Chinesisch lesen<br />
Wie organisieren wir Informationen, die enkodiert werden sollen?<br />
Ziel 7: Erörtern Sie, wie man Chunking und Hierarchien bei der bewussten Verarbeitung nutzt.<br />
Bedeutung und bildliche Vorstellung verbessern unsere Erinnerungsleistung, weil sie uns helfen,<br />
die Informationen zu organisieren. Sobald der von Bransford und Johnson angeführte Text über<br />
das Wäschewaschen (7 oben) in einen Bedeutungszusammenhang gestellt wird, können wir die<br />
Sätze mental in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Mnemotechniken helfen uns, das Material für<br />
das spätere Wiederauffinden zu organisieren.<br />
Chunking<br />
Um eine Vorstellung von der Bedeutung des Organisierens von Informationen zu bekommen,<br />
schauen Sie sich einfach ein paar Sekunden lang die 1. Reihe von . Abb. 9.7 an. Schauen Sie dann<br />
wieder weg, und versuchen Sie, das Gesehene zu reproduzieren. Es geht nicht, sagen Sie? Aber die<br />
2. Reihe können Sie (als jemand, der deutsch spricht) ganz leicht wiedergeben, obwohl sie nicht<br />
weniger komplex ist. Und ganz ähnlich geht es Ihnen wahrscheinlich auch mit Reihe 4, die Sie sich<br />
viel leichter merken können als Reihe 3, obwohl beide dieselben Buchstaben enthalten. Und auch<br />
die Wortreihen unter Punkt 6 können Sie sich viel leichter einprägen als die Sätze unter Punkt 5,<br />
obwohl sie aus denselben Wörtern bestehen. Wie hier also gezeigt wird, können wir uns viel leichter<br />
an Informationen erinnern, wenn wir sie zu bedeutungstragenden Einheiten oder »Chunks«<br />
organisieren können. Chunking ist etwas so Natürliches, dass wir es als selbstverständlich<br />
ansehen. Wenn Sie einigermaßen gut Deutsch verstehen, können Sie die<br />
ca. 140 Linien, aus denen die Wörter in Abschnitt 6 von . Abb. 9.7. bestehen, ohne<br />
Weiteres perfekt reproduzieren. Jeden, der des Deutschen nicht mächtig ist, würde<br />
dies erstaunen.<br />
Auf ganz ähnliche Weise verwundert es mich immer wieder, wenn ich Menschen<br />
treffe, die Chinesisch beherrschen, und nach einem kurzen Blick auf . Abb.<br />
9.8 alle Striche der chinesischen Zeichen perfekt wiedergeben können. Dasselbe<br />
gilt für einen Experten im Schachspielen, der bei einem Spiel 5 Sekunden lang das<br />
Brett anschaut und sich dann an die genaue Position der meisten Schachfiguren<br />
erinnern kann (Chase u. Simon 1973). Oder denken Sie an einen Basketballspieler,<br />
der 4 Sekunden lang einem Spiel zuschaut und dann die genaue Position jedes<br />
einzelnen Spielers angeben kann (Allard u. Burnett 1985).<br />
! Wir erinnern uns dann am besten an Informationen, wenn wir ihnen eine<br />
persönliche Bedeutung geben können bzw. sie in für uns sinnvolle Einheiten<br />
gliedern.<br />
Chunking ist auch hilfreich, wenn es neues Material zu behalten gilt. So besteht<br />
z. B. eine Mnemotechnik darin, neue Begriffe in eine vertraute Form zu bringen,<br />
indem man die ersten Buchstaben der Wörter, die man sich merken will, als Wörter<br />
oder Sätze enkodiert (das Ergebnis nennt man Akronym). Sollten Sie je den<br />
Wunsch verspüren, sich die Namen der Planeten unseres Sonnensystems zu merken,<br />
dann denken Sie einfach an den Satz »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag<br />
unsere neun Planeten« (Merkur –Venus – Erde – Mars – Jupiter – Saturn – Uranus<br />
– Neptun – Pluto. Genau genommen stimmt das natürlich nicht mehr, da seit<br />
kurzem Pluto astronomisch nicht mehr zu den Planeten gezählt wird. Ein anderes<br />
Beispiel: Fällt es Ihnen schwer, die 4 fettlöslichen Vitamine zu behalten? Benutzen<br />
Sie als »Eselsbrücke« einfach EDEKA (E, D, K und A).<br />
Mit Hilfe von Chunking können Sie auch Ihre <strong>Gedächtnis</strong>leistung für Zahlenreihen<br />
verbessern. Eine schwer zu reproduzierende Reihe von 16 Zahlen ist beispielsweise<br />
die folgende: 1–4–9–2–1–7–7–6–1–8–1–2–1–9–4–1, doch lässt sich<br />
diese Reihe leicht merken, wenn man Amerikaner ist und sie folgendermaßen<br />
gruppiert: 1492–1776–1812–1941. Für die deutsche Geschichte könnte eine ähnliche<br />
Zahlenreihe lauten: 1517–1648–1933–1989 (sofern man die Daten der Reformation,<br />
des Westfälischen Friedens, der Machtergreifung der Nationalsozialisten<br />
und des Mauerfalls parat hat). Nach über 200 Übungsstunden im Labor von
9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />
Ericsson u. Chase (1982) gelang es 2 Studenten, ihre <strong>Gedächtnis</strong>spanne von den normalen 7 Ziffern<br />
auf über 80 auszuweiten. In einer anderen Untersuchung hörte der Student Dario Donatelli,<br />
wie der Versuchsleiter mit monotoner Stimme und in einem gleichmäßigen Zeitabstand von jeweils<br />
1 Ziffer pro Sekunde folgende Zahlenreihe las: 1518593765502157841665850612094885686<br />
772731418186105462974801294974965928. Donatelli bewegte sich nicht, solange er die Zahlen<br />
lernte, doch dann wurde er quicklebendig. Er flüsterte Zahlen, rieb sich das Kinn, klopfte mit den<br />
Füßen auf den Boden, rechnete mit den Fingern und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare.<br />
»Okay«, kündete er etwa 2 Minuten später an. »Die erste Gruppe ist 1518. Dann 5937 …« Er wiederholte<br />
alle 73 Ziffern und zwar jeweils in Dreier- oder Vierergruppen.<br />
Wie konnte er das schaffen? Durch erhöhte Kapazität seines Kurzzeitgedächtnisses? Nein. Als<br />
man ihn bat, Buchstaben zu erinnern, fiel Donatelli auf die normale Kapazität von 7 Items zurück.<br />
Doch für das Ziffernchunking hatte er eine raffinierte Strategie entwickelt. »Die erste Gruppe war<br />
eine 3-Meilen-Zeit«, sagte der Langstreckenläufer Donatelli, der schon durch die gesamten USA<br />
gelaufen war. »Die zweite Gruppe war eine 10-Meilen-Zeit, dann eine Meile, dann eine halbe<br />
Meile. Eine 2-Meilen-Zeit. Eine Altersangabe … 2-Meilen-Zeit. Alter. Alter. Alter. 2-Meilen-Zeit<br />
…« (Wells 1983).<br />
Hierarchien<br />
Um seine Spitzenleistung – 106 Ziffern – zu erreichen, rief Donatelli die Zahlengruppen ab, indem<br />
er sie als Hierarchie gruppierte (Waldrop 1987). Zuerst kamen »3 Gruppen mit 4«, könnte er sich<br />
vorstellen, und so weiter. Wenn jemand es auf einem bestimmten Gebiet zur Meisterschaft bringt,<br />
dann verarbeitet er Informationen nicht nur in Form von Chunks, sondern auch in Hierarchien,<br />
die aus einigen umfassenden Konzepten bestehen, die dann unterteilt und nochmals unterteilt<br />
werden, bis die Ebene der Fakten erreicht wird. Wir rufen unser Wissen effizienter ab, wenn wir<br />
es in eine hierarchische Ordnungsstruktur bringen.<br />
Es ist deshalb das Ziel dieses Kapitels, Ihnen nicht nur ein paar grundlegende Fakten über das<br />
<strong>Gedächtnis</strong> beizubringen, sondern auch Strategien aufzuzeigen, wie Sie diese Fakten um allgemeine<br />
Prinzipien herum organisieren können (z. B. das Prinzip des Enkodierens) oder um untergeordnete<br />
Prinzipien (z. B. automatisches und bewusstes Verarbeiten) oder um noch spezifischere<br />
Konzepte (z. B. Bedeutung, bildliche Vorstellung und Ordnungsstruktur) (. Abb. 9.9).<br />
Bower et al. (1969) demonstrierten den Nutzen einer hierarchischen Ordnungsstruktur. Sie<br />
boten einer Versuchsgruppe Wörter dar, und zwar entweder in zufälliger Reihenfolge oder nach<br />
Kategorien gruppiert. Bei den gruppierten Wörtern war die Erinnerungsleistung 2- bis 3-mal<br />
besser. Solche Ergebnisse zeigen Ihnen, wie sinnvoll es ist, Ordnung in Ihren Lernstoff zu bringen,<br />
indem Sie dem Kapitelvorspann, den Überschriften, den Lernzielen, und Kontrollfragen besondere<br />
Aufmerksamkeit zuwenden. Wenn Sie die Konzepte eines Kapitels beherrschen und sie in den<br />
Aufbau des Kapitels einordnen können, sollten Sie sich bei den Tests an all das gut erinnern können.<br />
Vorlesungsmitschriften und Notizen mit Überschriften zu versehen, ist gleichfalls eine Art<br />
hierarchischer Organisation und könnte sich als hilfreich erweisen.<br />
393<br />
<strong>Gedächtnis</strong>forscher sind übereinstimmend der<br />
Meinung, dass die kanadischen Postleitzahlen<br />
mit ihrem Wechsel von Zahlen und Buchstaben<br />
ganz besonders schwer zu behalten sind (Hebert<br />
2001). A1C 5S7 ließe sich leichter behalten,<br />
wenn man es in Buchstaben- und Zahlengruppen<br />
organisieren könnte, beispielsweise ACS<br />
157.<br />
Bei der Behandlung des Themas Enkodierung<br />
bildlicher Vorstellungen hatte ich Ihnen 6 Wörter<br />
vorgelegt und Ihnen angekündigt, dass ich Sie<br />
später danach fragen würde. An wie viele der<br />
6 Testwörter erinnern Sie sich jetzt noch? Welche<br />
dieser erinnerten Wörter sind sehr bildlich?<br />
Welche sind weniger bildlich?<br />
. Abb. 9.9. Ordnungsstrukturen nützen dem<br />
<strong>Gedächtnis</strong><br />
Wenn wir Wörter oder Konzepte in hierarchischen<br />
Gruppen organisieren, wie wir es mit den Konzepten<br />
in diesem Kapitel gezeigt haben, dann erinnern<br />
wir uns besser an sie, als wenn sie uns in rein<br />
zufälliger Reihenfolge vorgeführt werden<br />
9
9<br />
394<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Lernziele Abschnit 9.2<br />
Enkodieren: Informationen in den Speicher überführen<br />
Ziel 3: Beschreiben Sie die Arten von Informationen, die wir automatisch<br />
enkodieren.<br />
Wir enkodieren unbewusst und automatisch zufällig anfallende Informationen,<br />
wie etwa Raum, Zeit und Häufigkeit. Mit Hilfe dieser Form der<br />
Verarbeitung registrieren wir auch gut gelernte Informationen, wie etwa<br />
Wörter in unserer Muttersprache.<br />
Ziel 4: Stellen Sie die bewusste Verarbeitung der automatischen Verarbeitung<br />
gegenüber, und erörtern Sie den »Next-in-Line«-Effekt, den Spacing-<br />
Effekt und den seriellen Positionseffekt.<br />
Wenn wir Informationen aus unserer Umwelt (Raum, Zeit, Häufigkeit,<br />
gut gelerntes Material) aufnehmen, erfolgt die automatische Verarbeitung<br />
unbewusst. Bewusste Verarbeitung (Bedeutung, bildliche Vorstellung,<br />
Organisation) erfordert die bewusste Aufmerksamkeit und gezielte<br />
Anstrengungen (Wiederholen). Der »NextinLine«Effekt besteht darin,<br />
dass wir gewöhnlich vergessen (aufgrund einer misslungenen Enkodierung),<br />
was die Person vor uns in der Schlange gesagt hat, weil wir uns<br />
auf das konzentrieren, was wir sagen werden, wenn wir dran sind. Der<br />
SpacingEffekt besteht darin, dass man Informationen in der Regel leichter<br />
behält, wenn man sie im Laufe der Zeit mehrmals übt (eingeteiltes<br />
Lernen), als wenn man es in einer langen Sitzung übt (Pauken). Der serielle<br />
Positionseffekt ist unsere Tendenz, dass man sich bei einer langen<br />
Liste (wie etwa einer Einkaufsliste) an das erste und das letzte Element<br />
leichter erinnert als an die dazwischen liegenden Elemente.<br />
Ziel 5: Vergleichen Sie die Vorteile der visuellen, auditiven und semantischen<br />
Enkodierung beim Erinnern verbaler Informationen, und beschreiben Sie<br />
eine Strategie zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, die mit dem Selbstbezugseffekt<br />
in Zusammenhang steht.<br />
Die visuelle Enkodierung (bildlicher Darstellungen) und die auditive Enkodierung<br />
(von Lauten, vor allem Wörtern) sind oberflächlichere Formen<br />
der Verarbeitung als die semantische Enkodierung (der Bedeutung). Wir<br />
verarbeiten verbale Informationen am besten, wenn wir sie semantisch<br />
enkodieren, vor allem wenn wir uns des Selbstbezugseffekts bedienen,<br />
indem wir die Informationen für uns persönlich relevant machen.<br />
Ziel 6: Erklären Sie, wie die Enkodierung unserer Vorstellungswelt dazu beiträgt,<br />
etwas mühelos zu verarbeiten, und beschreiben Sie einige Strategien<br />
zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, bei denen die visuelle Enkodierung<br />
genutzt wird.<br />
Die Enkodierung bildlicher Vorstellungen ist hilfreich bei der bewussten<br />
Verarbeitung, weil eindringliche Bilder sehr einprägsam sind. Wir erinnern<br />
uns gewöhnlich an konkrete Substantive besser als an abstrakte,<br />
weil wir z. B. mit »Gorilla« sowohl ein Bild als auch eine Bedeutung<br />
assoziieren können, mit »Prozess« jedoch nur die Bedeutung. Viele<br />
Mnemotechniken (<strong>Gedächtnis</strong>strategien oder hilfen) beruhen auf der<br />
bildlichen Vorstellung. Bei anderen hält man Items im <strong>Gedächtnis</strong> fest,<br />
indem man die visuelle Enkodierung (die Vorstellung einer Reihe eindringlicher<br />
Bilder) mit der auditiven Enkodierung (einem einprägsamen<br />
Reim) verbindet.<br />
Ziel 7: Erörtern Sie, wie man Chunking und Hierarchien bei der bewussten<br />
Verarbeitung nutzt.<br />
An geordnete Informationen erinnern wir uns besser als an Zufallsdaten;<br />
Chunking und Hierarchienbildung sind 2 Methoden, um Informationen<br />
zu ordnen. Beim Chunking gruppieren wir Informationen in vertraute,<br />
leicht handhabbare Einheiten, wie etwa Wörter in Sätze. Bei Hierarchien<br />
verarbeiten wir Informationen, indem wir sie in logische Ebenen einteilen;<br />
dabei beginnen wir mit der allgemeinsten Ebene und schreiten zur<br />
spezifischsten fort.<br />
> Denken Sie weiter: Können Sie sich 3 Möglichkeiten vorstellen, die<br />
in diesem Abschnitt angeführten Prinzipien auf Ihre eigenen Lernund<br />
Behaltensprozesse anzuwenden?<br />
9.3 Speichern: Information aufbewahren<br />
Im Zentrum des <strong>Gedächtnis</strong>ses steht die Speicherung. Wenn Sie sich an etwas erinnern, was Sie<br />
erlebt haben, müssen Sie das Erlebte irgendwie gespeichert und dann abgerufen haben. Alles im<br />
Langzeitgedächtnis Gespeicherte liegt im Dornröschenschlaf, bis es aufgrund eines Schlüsselreizes<br />
rekonstruiert wird. Wie groß ist die Speicherkapazität unseres temporären und die unseres Langzeitgedächtnisses?<br />
Lassen Sie uns mit dem <strong>Gedächtnis</strong>speicher beginnen, der im Dreistufenmodell<br />
der Informationsverarbeitung als Erster erwähnt wird (. Abb. 9.1): das flüchtige sensorische <strong>Gedächtnis</strong>.<br />
9.3.1 Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong><br />
Ziel 8: Stellen Sie die beiden Formen des sensorischen <strong>Gedächtnis</strong>ses einander gegenüber.<br />
Im Rahmen der Forschungsarbeiten für seine Promotion zeigte Sperling (1960) seinen Versuchspersonen<br />
3 Reihen mit 3 Buchstaben, jede Reihe nur für 1/20 Sekunde (. Abb. 9.10). Unter diesen
9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />
Bedingungen war es schwieriger, die Buchstaben<br />
zu lesen, als bei Blitzlicht, und die Versuchspersonen<br />
konnten sich kaum an die Hälfte der Buchstaben<br />
erinnern.<br />
Hatten die Versuchsteilnehmer nicht genug<br />
Zeit, einen Blick auf die Buchstaben zu werfen?<br />
Nein, denn Sperling demonstrierte sehr eindrucksvoll,<br />
dass die Teilnehmer auch bei einer Darbietungsgeschwindigkeit,<br />
die kürzer war als ein Blitzlicht,<br />
die Buchstaben sehen und sich an sie erinnern<br />
konnten, allerdings nur für einen kurzen<br />
Augenblick. Statt seine Teilnehmer zu bitten, sich<br />
an alle 9 Buchstaben auf einmal zu erinnern, ließ er<br />
unmittelbar nach dem Aufscheinen der Buchstaben einen hohen, mittleren oder tiefen Ton erklingen.<br />
Dieser Schlüsselreiz brachte die Teilnehmer dazu, jeweils nur die Buchstaben der oberen,<br />
mittleren oder unteren Reihe zu reproduzieren. Nun entging ihnen kaum einmal ein Buchstabe.<br />
So konnte nachgewiesen werden, dass alle 9 Buchstaben einen Augenblick lang erinnert werden.<br />
Sperlings Experiment zeigte, dass wir über ein flüchtiges fotografisches <strong>Gedächtnis</strong> verfügen,<br />
ikonisches <strong>Gedächtnis</strong> oder visuelles Ultrakurzzeitgedächtnis genannt. Einen Augenblick lang<br />
registrieren unsere Augen das genaue Abbild einer Szene, und wir können uns an jede Einzelheit<br />
mit erstaunlicher Genauigkeit erinnern – aber nur für einige wenige Zehntelsekunden. Verzögerte<br />
Sperling das Tonsignal um mehr als eine halbe Sekunde, dann war die ikonische Erinnerung<br />
verschwunden, und die Versuchsteilnehmer konnten sich wieder nur an höchstens die Hälfte der<br />
Buchstaben erinnern. Ihr visueller Bildschirm wird sehr schnell wieder grau, damit neue Bilder<br />
die alten überlagern können.<br />
Wir haben auch ein einwandfreies, wenn auch flüchtiges sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> für auditive<br />
Reize, das Echogedächtnis oder auditive Ultrakurzzeitgedächtnis (Cowan 1988; Lu et al. 1992).<br />
Ein auditives Echo scheint 3 oder 4 Sekunden lang in der Luft zu hängen. Stellen Sie sich vor, Sie<br />
sind mitten in einer Unterhaltung, und Ihre Aufmerksamkeit schweift zum Fernseher ab. Wenn<br />
Ihr leicht verärgerter Gesprächspartner dann Ihre Aufmerksamkeit testet und fragt: »Was habe ich<br />
gerade gesagt?«, können Sie die letzten paar Wörter aus der Echokammer Ihres <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
wieder hervorholen.<br />
9.3.2 Arbeitsgedächtnis<br />
Ziel 9: Beschreiben Sie die Dauerhaftigkeit und die Arbeitskapazität des Kurzzeitgedächtnisses.<br />
Von der riesigen Datenmenge, die das sensorische <strong>Gedächtnis</strong> registriert, beleuchten wir ein<br />
paar Informationen mit dem Blitzlicht unserer Aufmerksamkeit. Wir rufen auch Informationen<br />
aus dem Langzeitspeicher ab und lassen sie direkt auf dem inneren »Bildschirm« erscheinen.<br />
Wenn wir aber diese Informationen nicht mit Bedeutung anreichern und enkodieren oder<br />
sie wiederholen, dann verschwinden sie schnell wieder. Während Ihre Finger den Weg vom<br />
Telefonbuch zum Telefon zurücklegen, kann die Erinnerung an die Nummer wieder verloren<br />
gehen.<br />
Peterson u. Peterson (1959) wollten wissen, wie schnell eine Kurzzeiterinnerung verschwindet,<br />
und baten deshalb Versuchspersonen, sich Buchstabengruppen aus 3 Konsonanten (z. B. CHJ) zu<br />
merken. Um Übungseffekte auszuschließen, forderten sie die Teilnehmer auf, in Dreiergruppen<br />
von 100 an rückwärts zu zählen. Nach 3 Sekunden erinnerten sich die Teilnehmer nur noch an die<br />
Hälfte der Buchstaben, nach 12 Sekunden gab es kaum noch eine Erinnerung (. Abb. 9.11). Ohne<br />
aktive Verarbeitung haben Kurzzeiterinnerungen nur eine begrenzte Lebensdauer. Nicht nur die<br />
Behaltenszeit des Kurzzeitgedächtnisses ist begrenzt, sondern auch seine Aufnahmekapazität. Wie<br />
bereits vorher angeführt, speichert das Kurzzeitgedächtnis üblicherweise nur 7 Informationseinheiten<br />
(2 mehr oder weniger können vorkommen). Miller (1956) erhob diese Speicherkapazität<br />
zur »magischen Zahl 7« (plus/minus 2). Als in den USA einige Telefongesellschaften verlangten,<br />
395<br />
. Abb. 9.10. Ikonisches <strong>Gedächtnis</strong><br />
Als George Sperling eine Buchstabengruppe (ähnlich<br />
der hier abgebildeten) 1/20 Sekunde lang aufblitzen<br />
ließ, konnten die Versuchsteilnehmer nur<br />
etwa die Hälfte der Buchstaben reproduzieren.<br />
Wurden sie jedoch mit einem Signal aufgefordert,<br />
sich an eine bestimmte Zeile zu erinnern, sofort<br />
nachdem die Buchstaben verschwunden waren,<br />
schafften sie die Aufgabe mit fast perfekter Präzision<br />
◼ Ikonisches <strong>Gedächtnis</strong> (iconic memory): kurzzeitiges<br />
sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> für visuelle<br />
Eindrücke, ähnlich wie ein Schnappschuss oder<br />
ein Bild, das nur wenige Zehntelsekunden lang<br />
erinnert werden kann.<br />
◼ Echogedächtnis (echoic memory): kurzzeitiges<br />
sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> für akustische Reize;<br />
wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt ist, können<br />
Wörter oder Geräusche noch in einem Zeitfenster<br />
von 3 oder 4 Sekunden erinnert werden.<br />
9
9<br />
396<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.11. Zerfall der Kurzzeiterinnerung<br />
Verbale Information kann schnell vergessen werden,<br />
wenn sie nicht wiederholt oder geübt wird.<br />
(Aus Peterson u. Peterson 1959)<br />
dass zusätzlich zur (7-stelligen) Telefonnummer des Teilnehmers eine<br />
3-stellige Vorwahlziffer für den Bereich gewählt werden müsse, durfte es<br />
deshalb nicht verwundern, dass viele Menschen berichteten, sie hätten<br />
Probleme damit, sich die eben aus dem Telefonbuch herausgesuchte<br />
Nummer zu merken.<br />
Bei Zahlen (wie bei Telefonnummern) ist unser Kurzzeitgedächtnis<br />
ein kleines bisschen besser als bei Buchstaben, die manchmal ähnlich<br />
klingen. Es ist auch ein wenig leistungsfähiger bei dem, was wir hören,<br />
als bei dem, was wir sehen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene haben eine<br />
Kurzzeitgedächtniskapazität für etwa so viele Wörter, wie sie in 2 Sekunden<br />
aussprechen können (Cowan 1994; Hulme u. Tordoff 1989).<br />
Dabei spielt das Rehearsal, die Wiederholung des Gehörten oder<br />
Gesehenen eine Rolle: Mit Informations-Chunks (also in bedeutungsvolle<br />
Gruppen organisierte Buchstaben wie ABC, BBC, FBI, BVG, ARD,<br />
SPD) und ohne Wiederholung behält der Durchschnittserwachsene nur<br />
etwa 4 Chunks im Kurzzeitgedächtnis (Cowan 2001). Auch wenn man<br />
eine Zufallsfolge von Ziffern hört und das Wiederholen dadurch verhindert<br />
wird, dass man zugleich die ganze Zeit »der der der« sagen muss,<br />
sinkt die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses auf etwa 4 Items ab.<br />
! Grundsätzlich gilt: Wir können zu jedem Zeitpunkt nur eine sehr begrenzte Informationsmenge<br />
bewusst verarbeiten.<br />
9.3.3 Langzeitgedächtnis<br />
Ziel 10: Beschreiben Sie die Kapazität und die Dauerhaftigkeit des Langzeitgedächtnisses.<br />
In Arthur Conan Doyles Erzählung »Eine Studie in Scharlachrot« vertritt Sherlock Holmes eine<br />
beliebte Theorie über die Kapazität des <strong>Gedächtnis</strong>ses:<br />
Ich schätze, das menschliche Gehirn ist ursprünglich so etwas Ähnliches wie eine kleine leere Dachkammer,<br />
die man nach eigener Wahl mit Möbeln einrichten muss. … Man sollte nicht den Irrtum<br />
begehen, zu glauben, dieser kleine Raum habe Gummiwände und ließe sich beliebig ausdehnen.<br />
Glauben Sie mir: Der Zeitpunkt kommt, wo Sie für jeden weiteren Wissensbrocken, den Sie erwerben,<br />
etwas vergessen, was Sie vorher wussten.<br />
Aber im Gegensatz zu Holmes’ Vermutung ist die Speicherkapazität für Langzeiterinnerungen<br />
quasi unbegrenzt.<br />
Nach einer vorsichtigen Schätzung enthält das <strong>Gedächtnis</strong> eines durchschnittlichen Erwachsenen<br />
etwa 1 Mrd. Informationseinheiten, und in seiner Speicherkapazität lässt sich wahrscheinlich<br />
das Tausend- oder Millionenfache oder<br />
mehr unterbringen (Landauer 1986). Bei der gegebenen<br />
Anzahl von Synapsen im Gehirn schätzt<br />
eine Gruppe von Computerentwicklern, dass »die<br />
Speicherkapazität aller Computer auf der Erde<br />
weitaus geringer ist als die eines einzelnen Gehirns«<br />
(Wang et al. 2003). Obwohl selbst ein einziger<br />
Laptop in seiner Kapazität unser Gehirn<br />
beim wörtlichen Erinnern eines Texts übertrifft<br />
Nordamerikanischer Tannenhäher<br />
(wie war das mit der Definition der negativen Ver-<br />
Bei den Tieren wäre der Anwärter auf das beste<br />
stärkung?), so ist doch eines sicher: Unser Gehirn<br />
Erinnerungsvermögen ein simples Vogelhirn: der<br />
ist nicht, wie Sherlock Holmes annahm, eine<br />
nordamerikanische Tannenhäher, der im Winter und<br />
im zeitigen Frühjahr bis zu 6000 Verstecke mit ver<br />
Dachkammer, auf der man nur noch etwas Neues<br />
grabenen Pinienkernen lokalisieren kann (Shettle<br />
unterbringen kann, wenn man vorher etwas Altes<br />
worth 1993) photos.com<br />
wegwirft.
9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />
. Tabelle 9.1. Rekorde bei der World Memory Championship (Weltmeisterschaft der <strong>Gedächtnis</strong>künstler)<br />
Wettbewerb Beschreibung Rekord<br />
Geschwindigkeit<br />
bei Spielkarten<br />
Spielkarten innerhalb<br />
einer Stunde<br />
Geschwindigkeit<br />
bei Zahlen<br />
Namen und<br />
Gesichter<br />
Kürzeste Zeit beim Einprägen eines gemischten Stapels von<br />
52 Spielkarten<br />
Die meisten Spielkarten, die man sich innerhalb einer Stunde einprägt<br />
(52 Punkte für jeden korrekten Stapel, 26 Punkte, wenn ein<br />
Fehler gemacht wurde)<br />
Die meisten Zufallsziffern, die man sich innerhalb von 5 Minuten<br />
einprägt<br />
Die meisten Vor und Nachnamen, die man sich innerhalb von<br />
15 Minuten einprägen kann, nachdem sie zusammen mit den Gesichtern<br />
dargeboten wurden (1 Punkt für jeden korrekt geschriebenen<br />
Vor oder Nachnamen; 1/2 Punkt für jeden phonetisch korrekten,<br />
aber falsch geschriebenen Namen)<br />
Binärziffern Die meisten Binärziffern (101101 etc.), die man sich in 20 Minuten<br />
einprägen kann, wenn sie in Zeilen mit 30 Ziffern präsentiert werden<br />
Aus: usamemoriad.com und worldmemorychampionship.com<br />
Diese Ansicht lässt sich anhand von Menschen, die phänomenale <strong>Gedächtnis</strong>leistungen vollbrachten,<br />
lebhaft illustrieren. Denken Sie etwa an die Tests, mit denen man in den 90er Jahren das<br />
<strong>Gedächtnis</strong> von Rajan Mahadevan überprüfte: Wenn man ihm einen Block von 10 Ziffern der<br />
ersten 30.000 Ziffern der Zahl π gab, konnte er nach ein paar Augenblicken, in denen er innerlich<br />
nach dem Ausschnitt aus der Ziffernfolge suchte, weitere Ziffern an eben dieser Stelle nennen, und<br />
die Zahlen sprudelten nur so heraus (Delaney et al. 1999; Thompson et al. 1993). Er konnte auch<br />
50 zufällig ausgewählte Zahlen wiederholen – sogar rückwärts. Nein, das sei keine genetische<br />
Gabe, sagte er, jeder könne das lernen. Doch so viele Merkmale des Menschen sind genetisch<br />
bedingt, und da bekannt war, dass Rajans Vater Shakespeares gesammelte Werke auswendig konnte,<br />
stellt man sich die Frage, ob er denn damit Recht hat. Wie macht er es also? Wie bei anderen<br />
psychologischen Phänomenen untersuchen Wissenschaftler das <strong>Gedächtnis</strong>, indem sie unterschiedliche<br />
Analyseniveaus einsetzen; und dazu gehört auch das biologische Analyseniveau.<br />
9.3.4 Die Speicherung von Erinnerungen im Gehirn<br />
33 Sek.<br />
1170 Spielkarten<br />
324 Ziffern<br />
167,5 Namen<br />
Über meine alternde Schwiegermutter konnte ich nur staunen. Sie war Pianistin und Organistin,<br />
aber im Alter von 88 Jahren wurde sie blind und konnte keine Noten mehr lesen. Doch kaum saß<br />
sie vor einem Tasteninstrument, spielte sie fehlerlos Hunderte von Kirchenliedern, darunter auch<br />
solche, an die sie 20 Jahre lang nicht gedacht hatte. Wo hatte ihr Gehirn diese Tausende von Notensequenzen<br />
gespeichert?<br />
<strong>Gedächtnis</strong>forscher glaubten eine Zeit lang, durch die Stimulierung des Gehirns während<br />
eines chirurgischen Eingriffs könne man den Nachweis liefern, dass unsere gesamte Vergangenheit<br />
– nicht nur gut eingeübte Musik – mit allen Einzelheiten »da drin« stecke und nur darauf warte,<br />
freigelassen zu werden. Um unerwünschte Effekte bei chirurgischen Eingriffen im Gehirn vorhersagen<br />
zu können, stimulierte Penfield (1969) verschiedene Bereiche im Kortex seiner Patienten,<br />
während sie hellwach waren. Wenn seine Patienten berichteten, dass sie etwas hörten, etwa »eine<br />
Mutter, die ihren kleinen Jungen ruft«, schloss Penfield daraus, dass er lange vergessene Erinnerungen<br />
aktiviert hatte, die unauslöschlich ins <strong>Gedächtnis</strong> eingraviert sind.<br />
Die <strong>Gedächtnis</strong>forscher Loftus u. Loftus (1980) werteten diese berühmten Berichte noch einmal<br />
aus und entdeckten, dass solche »Flashbacks« äußerst selten vorkommen und nur bei einer<br />
Hand voll von Penfields 1100 Patienten auftraten. Außerdem schienen die Flashbacks erfunden<br />
und nicht wiedererlebt worden zu sein. (Die Betreffenden hätten sich an Orte erinnert, die sie nie<br />
besucht hatten.)<br />
3705<br />
397<br />
Nach Berichten der International Herald Tribune<br />
soll der Japaner Akira Haraguchi die ersten<br />
100.000 Ziffern der Zahl π korrekt wiedergeben<br />
können. Haraguchi soll mit dem Aufsagen der<br />
Ziffern am 3. Oktober 2006 um 9 Uhr morgens<br />
begonnen haben und war um 1.28 Uhr des<br />
nächsten Tages damit fertig.<br />
9
9<br />
Jeff Rotman<br />
398<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
»Unser <strong>Gedächtnis</strong> ist flexibel, Erinnerungen lassen<br />
sich überschreiben. Unser <strong>Gedächtnis</strong> ist wie<br />
eine Panoramatafel mit unerschöpflichen Vorräten<br />
an Kreide und Wischlappen.«<br />
Elizabeth Loftus und Katherine Ketcham (»The Myth<br />
of Repressed Memory«, 1994)<br />
Die Elektrokrampftherapie, die man zur Behandlung<br />
von Depressionen eingesetzt hat, zerstört<br />
die Erinnerung an die jüngsten Erlebnisse, lässt<br />
jedoch den größten Teil des <strong>Gedächtnis</strong>ses intakt<br />
7 Kap. 17).<br />
Aplysia<br />
Diese kalifornische Meeresschnecke ist ein beliebtes<br />
Versuchstier. Wir verdanken ihr wichtige Erkenntnisse<br />
über die neuronale Basis von Lernprozessen<br />
»In diesem (neuen) Jahrhundert wird die Biologie<br />
des Geistes für die Wissenschaft die gleiche Bedeutung<br />
bekommen wie die Biologie der Gene im<br />
20. Jahrhundert.«<br />
Eric Kandel (Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises<br />
für Medizin 2000)<br />
◼ Langzeitpotenzierung (longterm potentiation):<br />
eine Zunahme des Potenzials einer<br />
Synapse, nach einer kurzen, schnellen Stimulierung<br />
feuern zu können. Man nimmt an,<br />
dass dies die neuronale Grundlage für Lernen<br />
und <strong>Gedächtnis</strong> ist.<br />
Der Psychologe Lashley (1950) lieferte weitere Belege dafür, dass das <strong>Gedächtnis</strong> nicht an einer<br />
einzelnen Stelle lokalisiert ist. Er trainierte Ratten darauf, den Weg durch ein Labyrinth zu finden.<br />
Dann schnitt er Teile ihres Kortex heraus und prüfte die Erinnerung der Ratten. Doch ganz gleich,<br />
welche feinen Ausschnitte er aus dem Kortex machte, die Ratten hatten immer noch zumindest<br />
teilweise eine Erinnerung daran, wie sie durch das Labyrinth laufen mussten.<br />
Könnte die physische Erinnerungsspur ihren Ursprung in der beständigen elektrischen Aktivität<br />
des Gehirns haben? Wenn das so wäre, müsste ein temporärer Zusammenbruch dieser Aktivität<br />
dazu führen, dass die Erinnerung gelöscht wird, so wie bei einer leeren Batterie die Einstellungen<br />
im Autoradio gelöscht werden. Gerard (1953) trainierte als Erster Hamster darauf, nach<br />
rechts oder nach links zu laufen, um gefüttert zu werden; dann senkte er die Körpertemperatur<br />
der Tiere so weit ab, dass die elektrische Aktivität des Gehirns aussetzte. Die Hamster wurden<br />
wiederbelebt, ihr Gehirn nahm seine Aktivität wieder auf. Würden sie sich noch daran erinnern,<br />
wohin sie laufen mussten? Ja, ihr Langzeitgedächtnis überstand den »Stromausfall«. In einem<br />
Kommentar über die Flüchtigkeit von <strong>Gedächtnis</strong>spuren sagte ein <strong>Gedächtnis</strong>forscher ironisch:<br />
»Ich muss eingestehen, dass Erinnerungen mehr zur spirituellen als zur physischen Realität gehören.<br />
Sobald man versucht, sie dingfest zu machen, verwandeln sie sich in Dunst und verschwinden«<br />
(Loftus u. Ketcham 1994). Zu wissen, wie unser Gehirn eine ganze Flut von Einzelheiten<br />
speichert, die sich mühelos wieder abrufen lassen, »geht über unser Vorstellungsvermögen hinaus«,<br />
sagte ein von Ehrfurcht ergriffener Neurowissenschaftler (Doty 1998),<br />
In letzter Zeit hat sich die Suche nach der physischen Basis des <strong>Gedächtnis</strong>ses – nach der Art,<br />
wie Informationen in Materie verwandelt werden – auf die Synapsen konzentriert.<br />
Synaptische Veränderungen<br />
Ziel 11: Erörtern Sie die Veränderungen an den Synapsen, die mit der Herausbildung des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
und der Speicherung dort einhergehen.<br />
Die Neurowissenschaftler haben die Suche nach dem Ort des <strong>Gedächtnis</strong>ses auf die<br />
Erforschung von Veränderungen innerhalb einzelner Neuronen sowie zwischen<br />
Neuronen ausgeweitet. Der Anfang einer Erinnerung ist ein Impuls, der die Stromkreise<br />
des Gehirns durchläuft und dabei auf eine geheimnisvolle Weise dauerhafte<br />
neuronale Spuren hinterlässt. An welcher Stelle findet die neuronale Veränderung<br />
statt? Was wir bisher wissen, weist auf die Synapsen hin, die Stellen, an denen Nervenzellen<br />
mit Hilfe von Neurotransmittern miteinander kommunizieren. Erinnern<br />
Sie sich an 7 Kap. 3, in dem ausgeführt wird, wie ein Erlebnis Veränderungen im<br />
Netzwerk des Gehirns bewirkt. Kommt es auf einer bestimmten Nervenbahn zu<br />
verstärkter Aktivität, bilden sich neue neuronale Verbindungsstellen oder die bisher vorhandenen<br />
werden stärker.<br />
Kandel u. Schwartz (1982) beobachteten Veränderungen an den Neuronen der kalifornischen<br />
Meeresschnecke Aplysia, einem sehr unkomplizierten Geschöpf. Sie verfügt nur über etwa 20.000<br />
Nervenzellen, doch diese sind ungewöhnlich groß und leicht zugänglich. Das macht es möglich,<br />
synaptische Veränderungen im Verlauf eines Lernprozesses zu beobachten. In 7 Kap. 8 wurde erwähnt,<br />
wie die Meeresschnecke durch Elektroschocks klassisch darauf konditioniert werden kann,<br />
ihre Kiemen zurückzuziehen, wenn sie mit Wasser bespritzt wird, so wie ein Soldat, der einen<br />
Schock durch Granateneinschlag erlitten hat, schon beim Knacken eines Astes hochspringt. Kandel<br />
u. Schwartz beschäftigten sich eingehender mit den neuronalen Verbindungen vor und nach<br />
dem Konditionierungsprozess und entdeckten Veränderungen. Im Verlauf des Lernvorgangs<br />
schüttet die Schnecke an manchen Synapsen mehr von dem Neurotransmitter Serotonin aus.<br />
Dadurch werden diese Synapsen bei der Weiterleitung der Signale effizienter.<br />
Die stärkere synaptische Aktivität bewirkt, dass die neuronalen Schaltkreise effizienter werden.<br />
Bei Experimenten zeigte sich, dass die rasche Stimulierung gewisser Verbindungen in <strong>Gedächtnis</strong>schaltkreisen<br />
zu einer erhöhten Empfindlichkeit führt, die Stunden oder sogar Wochen anhalten<br />
kann. Das präsynaptische Neuron braucht nun weniger Anreiz für die Ausschüttung seines<br />
Neurotransmitters, und die Rezeptoren an der präsynaptischen Nervenzelle können sich sogar<br />
vermehren (. Abb. 9.12). Die ständige Stärkung des Aktionspotenzials eines Neurons, Langzeitpotenzierung<br />
(LTP, »long-term potentiation«) – ein von Lynch (2002) und Kollegen geprägter
9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />
Begriff – genannt, stellt die neuronale Grundlage des Lernens<br />
und Behaltens von Assoziationen dar. Wir wissen heute, dass<br />
gewisse Medikamente, die eine blockierende Wirkung auf die<br />
LTP haben, Lernvorgänge stören (Lynch u. Stäubli 1991). Genveränderte<br />
Mäuse, denen ein bestimmtes, für die LTP unabdingbares<br />
Enzym abgezüchtet wurde, lernen nicht, den Weg<br />
aus dem Labyrinth zu finden (Silva et al. 1992). Und wenn man<br />
Ratten ein Medikament verabreicht, das die LTP verstärkt,<br />
dann lernen sie den Weg durch das Labyrinth mit nur halb so<br />
vielen Fehlern wie sonst üblich (Service 1994).<br />
Kandel, Lynch und mehrere andere, die die Biologie des <strong>Gedächtnis</strong>ses erforschten, haben<br />
dazu beigetragen, pharmazeutische Firmen zu gründen, die in Konkurrenz miteinander treten,<br />
Medikamente zu einer bedeutsamen Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses zu entwickeln und zu testen<br />
(Economist 2004; Marshall 2004). Mindestens 40 »kognitive Verbesserer« sind gegenwärtig in<br />
einer Entwicklungsphase oder werden klinisch überprüft. Ihre Zielgruppe sind Millionen von<br />
Menschen mit der Alzheimer-Krankheit und weitere Millionen, die gerne in Bezug auf den altersbedingten<br />
<strong>Gedächtnis</strong>abbau die Uhr zurückdrehen würden. Hier entsteht ein Markt, aus dem sich<br />
riesige Gewinne ergeben werden.<br />
Ein Ansatz besteht darin, Medikamente zu entwickeln, die die Produktion des Proteins CREB<br />
ansteigen lassen, mit dem man bestimmte Gene an- oder abschalten kann. Rufen Sie sich Folgendes<br />
in Erinnerung: Gene kodieren die Produktion von Proteinmolekülen. Bei wiederholtem<br />
Feuern der Neuronen produzieren die Gene einer Nervenzelle Proteine, die die Synapse stärken;<br />
dies ermöglicht es, Langzeiterinnerungen zu bilden (Fields 2005). Wenn die CREB-Produktion<br />
ansteigt, könnte dies zu einer verstärkten Produktion von Proteinen führen, die dazu beitragen, dass<br />
die Synapsen eine neue Form annehmen und eine Kurzzeiterinnerung in eine Langzeiterinnerung<br />
umwandeln. Hinterkiemerschnecken, Mäuse und Fruchtfliegen mit verstärkter CREB-Produktion<br />
wiesen ein besseres <strong>Gedächtnis</strong> auf als andere Tiere. Ein weiterer Ansatz besteht darin, Medikamente<br />
zu entwickeln, die die Glutamat-Konzentration ansteigen lassen; Glutamat ist ein Neurotransmitter<br />
des Gehirns, der die Kommunikation unter den Synapsen fördert (LTP). Ob derartige Medikamente<br />
das <strong>Gedächtnis</strong> verbessern, ohne schlimme Nebenwirkungen zu haben und ohne unser<br />
Denken mit trivialen Dingen zu überladen, die wir besser vergessen hätten, bleibt abzuwarten. In<br />
der Zwischenzeit gibt es für Studierende bereits ein wirksames, sicheres und preiswertes Mittel zur<br />
Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses: studieren und ausreichend schlafen (7 Kap. 7).<br />
Ist es erst einmal zur LTP gekommen, kann auch ein Stromstoß, der durch das Gehirn geleitet<br />
wird, alte Erinnerungen nicht auslöschen, wohl aber die vor ganz kurzer Zeit gemachten Erinnerungen.<br />
Dies sind jedenfalls die Ergebnisse, die man bei Versuchen mit Labortieren und bei Patienten<br />
mit Depression fand, die mit Elektrokrampftherapie behandelt wurden. Ein Schlag auf den<br />
Kopf kann die gleiche Wirkung haben. Wie Schlafende, die sich nicht erinnern können, was sie<br />
gehört haben, bevor sie das Bewusstsein für ihre Umgebung verloren, haben Boxer und Football-<br />
Spieler, die vorübergehend k.o. waren, im typischen Fall keine Erinnerung an Ereignisse direkt vor<br />
dem K.o. (Yarnell u. Lynch 1970). Den Informationen im Kurzzeitgedächtnis blieb vor dem Schlag<br />
nicht genug Zeit, um im Langzeitgedächtnis gefestigt zu werden.<br />
Stresshormone und <strong>Gedächtnis</strong><br />
Ziel 12: Erörtern Sie, wie Stresshormone das <strong>Gedächtnis</strong> beeinflussen.<br />
a b<br />
Die Stresshormone, die Menschen und Tiere produzieren, wenn sie erregt oder gestresst sind,<br />
führen dazu, dass mehr Glukose verfügbar ist, um die Hirnaktivität zu beschleunigen; dies signalisiert<br />
dem Gehirn, dass etwas Wichtiges geschehen ist. Gleichzeitig verstärken die Amygdalae<br />
(zwei Verarbeitungscluster im limbischen System) die Aktivität der Hirnareale, die das <strong>Gedächtnis</strong><br />
bilden (Dolcos et al. 2004; Hamann et al. 2002). Und was ist das Ergebnis? Solche Ereignisse werden<br />
möglicherweise dem Gehirn eingebrannt, während gleichzeitig die Erinnerung an neutrale<br />
Ereignisse unterbrochen wird (Birnbaum et al. 2004; Strange u. Dolan 2004).<br />
Der entscheidende Punkt besteht nach McGaugh (1994, 2003) darin, dass »stärkere emotionale<br />
Erfahrungen zu stärkeren, zuverlässigeren Erinnerungen führen«. Nach traumatischen Er-<br />
399<br />
. Abb. 9.12a,b. Verdoppelter Rezeptor<br />
Das Bild eines Elektronenmikroskops zeigt, wie sich<br />
vor der Langzeitpotenzierung nur ein Rezeptor<br />
(grau) zum aussendenden Neuron hin streckt (a),<br />
während es nach der Langzeitpotenzierung (b) zwei<br />
Rezeptoren sind. Eine Verdopplung der Rezeptoren<br />
bedeutet, dass das postsynaptische Neuron eine<br />
stärker ausgeprägte Sensibilität entwickelt hat, um<br />
das Vorhandensein der Neurotransmittermoleküle<br />
zu entdecken, die vom präsynaptischen Neuron<br />
freigesetzt werden können (Aus Toni et al. 1999)<br />
Unterbrochene Festigung der Erinnerung<br />
Nachdem er bei dem Unfall, bei dem Prinzessin<br />
Diana getötet wurde, eine Gehirnerschütterung<br />
erlitten hatte, hatte ihr Leibwächter Trevor Rees<br />
Jones keine Erinnerung mehr an den Unfall und<br />
die Minuten davor (Rico et al. 2003)<br />
9<br />
N. Toni et al., Nature, 402, Nov. 25, 1999.<br />
Eigentum von Dominique Muller<br />
Orban/Segretain/Forestier/Sygma/Corbis
9<br />
Mast Irham/epa/Corbis<br />
400<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Starker Stress prägt sich im <strong>Gedächtnis</strong> ein<br />
Ausgesprochen stressreiche Ereignisse wie der<br />
tragische Tsunami, der Ende 2004 über Südostasien<br />
hinwegfegte, kann für diejenigen, die ihn erlebten,<br />
zu einem unauslöschlichen Bestandteil der Erinnerungen<br />
werden<br />
◼ Amnesie (amnesia): <strong>Gedächtnis</strong>verlust.<br />
lebnissen – ein Angriff aus dem Hinterhalt im Krieg, ein Feuer im Haus,<br />
eine Vergewaltigung – können sich lebendige Erinnerungen an das grauenhafte<br />
Ereignis immer wieder aufdrängen. Es ist so, als hätten sie sich<br />
eingebrannt.<br />
Umgekehrt gehen schwächere Emotionen auch mit schwächeren<br />
Erinnerungen einher. Verabreicht man einem Menschen ein Medikament,<br />
das die Wirkung der Stresshormone ausschaltet, hat er anschließend<br />
Schwierigkeiten, sich an die Einzelheiten einer aufregenden Geschichte<br />
zu erinnern (Cahill et al. 1994). Dieser Zusammenhang wird<br />
von denjenigen positiv bewertet, die daran arbeiten, ein optimales Medikament<br />
zu entwickeln, das immer wieder ins Bewusstsein dringende<br />
Erinnerungen abschwächen könnte, wenn man den Betreffenden das<br />
Medikament nach einem traumatischen Erlebnis gibt.<br />
! Die hormonellen Veränderungen, die durch Emotionen hervorgerufen<br />
werden, sind eine Erklärung dafür, dass wir uns lange an aufregende<br />
oder schockierende Ereignisse erinnern.<br />
Noch 1 1/2 Jahre nach dem Erdbeben von San Francisco 1989 erinnerten sich die Menschen, die das<br />
Erdbeben erlebt hatten, deutlich, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt aufgehalten und was sie gerade<br />
gemacht hatten (so wie sie es 1–2 Tage nach dem Beben auf Band gesprochen hatten). Die Erinnerung<br />
von Menschen, die das Erdbeben nicht direkt miterlebt haben, an die Umstände, unter denen<br />
sie von dem Beben gehört hatten, enthielten dagegen durchaus Irrtümer (Neisser et al. 1991; Palmer<br />
et al. 1991). (Ein zweiter wichtiger Grund für die Unauslöschlichkeit der Erinnerung an dramatische<br />
Ereignisse ist die Tatsache, dass wir sie immer wieder neu durchleben und wiederholen, so wie die<br />
meisten Menschen, die das Erdbeben miterlebten, ihre Geschichte tausendmal erzählt haben.)<br />
Es gibt jedoch auch Grenzen für die durch Stress verbesserte Erinnerung. Wie in 7 Kap. 16 ausgeführt,<br />
kann länger anhaltender Stress – Kampfhandlungen oder Missbrauch über einen längeren<br />
Zeitraum hinweg – manchmal wie Säure wirken: Neuronale Verbindungen werden zerstört, und<br />
eine bestimmte Hirnregion, der für die Speicherung von Erinnerungen unentbehrliche Hippocampus,<br />
schrumpft. Es kann auch Folgendes geschehen: Eine plötzliche Überflutung mit Stresshormonen<br />
kann ältere Erinnerungen blockieren. Das gilt für Ratten, die versuchen, den Weg zu einem verborgenen<br />
Ziel zu finden (de Quervain et al. 1998). Und es gilt für die unter uns, die plötzlich meinen,<br />
ihr Gehirn sei ganz leer, wenn sie vor einem größeren Publikum sprechen sollen.<br />
Die Speicherung impliziter und expliziter Erinnerungen<br />
Ziel 13: Unterscheiden Sie zwischen dem impliziten und dem expliziten <strong>Gedächtnis</strong>, und geben Sie die<br />
Gehirnstruktur an, die damit hauptsächlich in Verbindung gebracht wird.<br />
Etwas, was künftig erinnert werden soll, gelangt durch die Sinne in den Kortex und wandert dann<br />
auf verschlungenen Pfaden in die Tiefe des Gehirns. Wo es dann genau landet, hängt von der Art<br />
der Information ab; dies wird vor allem an Menschen deutlich, die an einer Form von Amnesie<br />
leiden, die die Entstehung neuer Erinnerungen verhindert.<br />
Der Neurologe Sacks (1985, S. 26–27) beschreibt einen solchen Patienten: Jimmy, der eine Hirnverletzung<br />
erlitten hatte. Jimmy hatte keine Erinnerung an die Zeit nach seiner Verletzung, also auch<br />
kein Gefühl dafür, dass die Zeit vergeht. Als man ihn 1975 nach dem Namen des Präsidenten der<br />
USA fragte, antwortete er: »FDR (Franklin D. Roosevelt) ist tot, Truman ist am Steuer.«<br />
Sacks zeigte Jimmy Fotos aus dem National Geographic. »Was ist das?«, fragte er. »Der Mond«,<br />
antwortete Jimmy. »Nein«, erwiderte Sacks, »Es ist ein Foto von der Erde, das vom Mond aus<br />
aufgenommen wurde.« »Sie machen Witze! Dann müsste man doch einen Fotoapparat da raufgebracht<br />
haben.« »Klar.« »Zum Teufel, was für ein blöder Witz! Wie sollte das denn gehen!« Jimmys<br />
Staunen war das Staunen eines intelligenten jungen Mannes, der jetzt 60 Jahre alt war und voll<br />
Verwunderung auf seine Reise zurück in die Zukunft blickte.<br />
Testet man Menschen mit dieser seltenen Störung eingehend, zeigen sich noch merkwürdigere<br />
Dinge: Obgleich sie sich an Fakten aus der letzten Zeit oder an etwas, was sie vor Kurzem getan haben,<br />
nicht erinnern können, sind sie doch imstande zu lernen. Zeigt man ihnen Figuren in Bildern, die
9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />
schwer zu entdecken sind (aus der Serie »Wo ist Waldo?«), dann können sie sie später schnell wieder<br />
finden. Sie können lernen, Spiegelschrift zu lesen oder ein Puzzle zusammenzusetzen, sogar komplizierte<br />
Handgriffe im Rahmen einer Arbeit (Schacter 1992, 1996; Xu u. Corkin 2001). Sie können<br />
klassisch konditioniert werden. Doch all das tun sie ohne ein Bewusstsein dafür, etwas gelernt zu haben.<br />
In mancher Hinsicht lassen sich die Opfer dieser Amnesie mit Menschen vergleichen, die nach<br />
einer Hirnverletzung nicht mehr bewusst Gesichter erkennen können, deren physiologische Reaktionen<br />
jedoch auf ein implizites (unbewusstes) Wiedererkennen hindeuten. Ihr Verhalten stellt die Vorstellung<br />
in Frage, das <strong>Gedächtnis</strong> sei ein einzelnes, einheitliches, bewusstes System. Stattdessen scheinen<br />
wir über mehrere <strong>Gedächtnis</strong>systeme zu verfügen, die hintereinander geschaltet sind (. Abb. 9.13).<br />
Was immer bei diesen Amnestikern die bewusste Erinnerung zerstört hat, es hat ihre unbewusste Lernfähigkeit<br />
intakt gelassen. Sie können lernen, wie man etwas macht; hier handelt es sich um das implizite<br />
<strong>Gedächtnis</strong> (prozedurale <strong>Gedächtnis</strong>). Aber sie wissen vielleicht nicht und können es auch nicht<br />
erklären, dass sie wissen. Sie haben also kein explizites <strong>Gedächtnis</strong> (deklaratives <strong>Gedächtnis</strong>).<br />
Haben Amnestiker beispielsweise eine Geschichte einmal gelesen, dann lesen sie sie beim<br />
zweiten Mal schneller: ein Beleg für implizite Erinnerung. Doch eine explizite Erinnerung mag es<br />
in diesem Fall nicht geben; denn die Patienten können sich nicht daran erinnern, die Geschichte<br />
schon einmal vor Augen gehabt zu haben. Zeigt man ihnen wiederholt das Wort Parfüm, werden<br />
sie sich nicht daran erinnern, es gesehen zu haben, Wenn sie jedoch nach dem ersten Wort gefragt<br />
werden, das ihnen als Reaktion auf die Buchstaben par in den Sinn kommt, sagen sie Parfüm und<br />
zeigen so freudig, dass sie etwas gelernt haben. Mit Hilfe derartiger Aufgaben zeigen auch Alzheimer-Patienten,<br />
deren explizite Erinnerungen für Menschen und Ereignisse verloren gegangen<br />
sind, eine Fähigkeit, neue implizite Erinnerungen zu bilden (Lustig u. Buckner 2004). Sie behalten,<br />
was sie neu gelernt haben, aber sie können es nicht explizit abrufen.<br />
Hippocampus<br />
Eine Möglichkeit herauszufinden, wie das <strong>Gedächtnis</strong> arbeitet, besteht darin, Fehlfunktionen zu<br />
untersuchen. So regen uns diese bemerkenswerten Geschichten zu Fragen an: Sind an den expliziten<br />
und impliziten <strong>Gedächtnis</strong>systemen getrennte Hirnregionen beteiligt? Untersuchungen des<br />
aktiven Gehirns mit Hilfe bildgebender Verfahren (Schichtaufnahmen) und die Autopsie von<br />
Amnestikern zeigen, dass neue explizite Erinnerungen wie Namen, Bilder oder Ereignisse zur<br />
Speicherung durch den Hippocampus, ein neuronales Zentrum im limbischen System, geleitet<br />
werden (. Abb. 9.14). Wenn man anhand von Schichtaufnahmen das Gehirn dabei beobachten<br />
kann, wie es eine Erinnerung bildet, dann zeigt sich Aktivität im Hippocampus und ebenso auch<br />
in gewissen Bereichen der Frontallappen (Wagner et al. 1998). Bei einer PET-Schichtaufnahme<br />
leuchtet der Hippocampus auch auf, wenn Wörter reproduziert werden (wenn also das explizite<br />
<strong>Gedächtnis</strong> genutzt wird) (Squire 1992).<br />
Eine Schädigung des Hippocampus zerstört einige Arten von Erinnerungen. Meisen und andere<br />
Vogelarten legen Hunderte von Vorratsplätzen an und kehren Monate später zu diesen nicht<br />
markierten Verstecken zurück, allerdings tun sie das nicht, wenn ihnen der Hippocampus entfernt<br />
wurde (Sherry u. Vaccarino 1989). Wie der Kortex insgesamt, ist auch der Hippocampus laterali-<br />
401<br />
. Abb. 9.13. Subsysteme des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
Wir verarbeiten und speichern unsere expliziten<br />
und impliziten Erinnerungen getrennt. Wir können<br />
das explizite <strong>Gedächtnis</strong> einbüßen (und unter Amnesie<br />
leiden) und trotzdem implizite Erinnerungen<br />
an Dinge haben, die man nicht bewusst abrufen<br />
kann<br />
◼ Implizites <strong>Gedächtnis</strong> (implicit memory): Behalten<br />
unabhängig von bewusster Erinnerung<br />
(auch als prozedurales <strong>Gedächtnis</strong> bezeichnet).<br />
◼ Explizites <strong>Gedächtnis</strong> (explicit memory): <strong>Gedächtnis</strong><br />
für Fakten und Erfahrungen, die man<br />
bewusst wissen und »deklarieren« kann (auch<br />
als deklaratives <strong>Gedächtnis</strong> bezeichnet).<br />
◼ Hippocampus (hippocampus): neuronales Zentrum<br />
im limbischen System, das an der Verarbeitung<br />
expliziter Erinnerungen für die endgültige<br />
Speicherung beteiligt ist.]<br />
. Abb. 9.14. Hippocampus<br />
Explizite Erinnerungen an Fakten und Ereignisse<br />
werden im Hippocampus verarbeitet und zur Speicherung<br />
an andere Hirnareale weitergeleitet<br />
9
9<br />
402<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
»Die Technologien [zur Anfertigung von Schichtaufnahmen<br />
des Gehirns] sind in gleicher Weise<br />
eine Revolution für die Erforschung des Gehirns<br />
und des Mentalen, wie es das Fernrohr für die<br />
Erforschung des Himmels war.«<br />
Endel Tulving (1996)<br />
siert (d. h. es gibt 2 Hippocampi, die jeweils direkt über dem Ohr etwa 4 cm tief im Gehirn liegen).<br />
Eine Verletzung des linken oder des rechten Hippocampus scheint unterschiedliche Folgen zu<br />
haben. Patienten mit einer Verletzung des linken Hippocampus können sich schlecht an verbale<br />
Information erinnern, doch haben sie keine Probleme mit der Erinnerung an visuelle Informationen<br />
oder an Orte. Patienten mit einer Verletzung des rechten Hippocampus haben genau die<br />
umgekehrten Probleme (Schacter 1996).<br />
Die neuere Forschung beschäftigt sich auch im Einzelnen mit den Funktionen der verschiedenen<br />
Unterbereiche des Hippocampus. Ein Teil ist aktiv, wenn Menschen lernen, Namen mit<br />
Gesichtern zu assoziieren (Zeineh et al. 2003). Ein anderer Teil ist aktiv, wenn <strong>Gedächtnis</strong>künstler<br />
räumliche Mnemotechniken verwenden (Maguire et al. 2003b). Bei einem Londoner Taxifahrer<br />
wird das hintere Areal, das räumliche Erinnerungen verarbeitet, größer, je länger er durch das<br />
Labyrinth der Straßen in der Stadt gefahren ist (Maguire et al. 2003a).<br />
Affen und Menschen, die aufgrund einer Operation oder einer Krankheit keinen Hippocampus<br />
mehr haben, verlieren meist auch die Erinnerung an das, was sie in den vorangegangenen Monaten<br />
gelernt haben; doch ihre älteren Erinnerungen bleiben intakt (Bayley et al. 2005; McGaugh 2000).<br />
Je länger der Hippocampus und seine Nervenbahnen zum Kortex nach dem Lernen unversehrt<br />
blieben, desto geringer ist der <strong>Gedächtnis</strong>ausfall (Remondes u. Schuman 2004). Offenbar dient der<br />
Hippocampus als eine Art Ladestation, in der das Gehirn die Elemente einer erinnerten Episode<br />
registriert und zeitweise speichert: die damit verbundenen Gerüche, Gefühle, Geräusche und den<br />
Ort. Doch später kommen die Erinnerungen – so ähnlich wie ich ältere Ordner in den Keller bringe<br />
– zur Speicherung an eine andere Stelle. Der Hippocampus ist aktiv während des »slow-wave«-<br />
Schlafs, wenn die Erinnerungen verarbeitet und zum späteren Abruf abgelegt werden. Je größer die<br />
Aktivität des Hippocampus während des Schlafs nach einer Trainingserfahrung ist, desto besser ist<br />
am nächsten Tag die Erinnerung daran (Peigneux et al. 2004).<br />
Der »Bibliothekar« unserer »Erinnerungsbibliothek« weist verschiedene Informationen verschiedenen<br />
Bereichen zu. Bei Untersuchungen des Gehirns mit bildgebenden Verfahren zeigt sich,<br />
dass die mentalen Bilder unserer früheren Erlebnisse, sobald sie gespeichert sind, verschiedene<br />
Bereiche der Frontal- und Temporallappen aktivieren (Fink et al. 1996; Gabrieli et al. 1996; Markowitsch<br />
1995). Wenn man eine Telefonnummer heraussucht und im Arbeitsgedächtnis behält,<br />
aktiviert dies einen Bereich im linken frontalen Kortex. Doch wenn man sich einen Vorfall auf<br />
einer Party ins <strong>Gedächtnis</strong> zurückrufen würde, würde dies wahrscheinlich eher einen Bereich in<br />
der rechten Hemisphäre aktivieren.<br />
! Unser <strong>Gedächtnis</strong> ist nicht auf eine einzige Stelle im Gehirn beschränkt. Viele Hirnregionen sind<br />
beteiligt, wenn wir verschiedene Arten von Information enkodieren, speichern oder abrufen.<br />
Um sich noch einmal an der Erinnerung an die erste erfolgreiche Aufführung zu erfreuen, braucht<br />
man den Dirigenten einer mentalen Symphonie, der Erinnerungsschnipsel aus verschiedenen<br />
kortikalen Speichern abruft und sie mit den emotionalen Assoziationen verbindet, die von der<br />
Amygdala geliefert werden. Amnestiker können fragmentierte Teile einer Erinnerung behalten –<br />
den Anblick, Ton, Geruch, Objekte, Menschen, Handlungen und Emotionen. Aber die Verbindungen,<br />
die es den Patienten ermöglichen würden, die Fragmente wieder zu einer expliziten Erinnerung<br />
an ein Ereignis zusammenzusetzen, sind möglicherweise verloren gegangen.<br />
Zerebellum (Kleinhirn)<br />
Obwohl der Hippocampus an der temporären Verarbeitung expliziter Erinnerungen beteiligt ist,<br />
könnten Sie auch ohne ihn noch Erinnerungen an Fertigkeiten und konditionierte Assoziationen<br />
speichern. Implizite Erinnerungen erfordern weniger Verbindungen zwischen den kortikalen<br />
Speicherregionen; deshalb können Menschen mit einer Schädigung des Hippocampus diese Erinnerungen<br />
behalten (Paller 2004). Le Doux (1996) erzählt eine Geschichte über eine Patientin mit<br />
einer Hirnverletzung, deren Amnesie bewirkte, dass sie ihren Arzt nicht erkannte, der ihr tagtäglich<br />
die Hand schüttelte und sich vorstellte. Eines Tages griff sie nach seiner Hand, zog aber ihre<br />
eigene Hand hastig zurück, denn der Arzt hatte sie mit einer Reißzwecke gepiekst, die in seiner<br />
Handfläche verborgen war. Als er sich beim nächsten Besuch wieder vorstellen wollte, weigerte sie<br />
sich, seine Hand zu ergreifen, konnte allerdings nicht erklären, warum. Nach dieser klassischen<br />
Konditionierung konnte sie seine Hand einfach nicht mehr schütteln.
9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />
Das Kleinhirn oder Zerebellum, die Hirnregion, die sich vom hinteren Teil des Hirnstamms<br />
aus ausdehnt, spielt eine Schlüsselrolle bei der Bildung und Speicherung impliziter Erinnerungen,<br />
die durch klassische Konditionierung geschaffen wurden. Menschen mit einer Verletzung des<br />
Zerebellums sind außerstande, bestimmte konditionierte Reflexe zu entwickeln, wie etwa einen<br />
Ton mit einem bevorstehenden Luftstoß zu assoziieren, und somit in Vorwegnahme des Luftstoßes<br />
zu blinzeln (Daum u. Schugens 1996; Green u. Woodruff-Pak 2000). Indem Thompson, Krupa<br />
u. Thompson die Funktionsfähigkeit der unterschiedlichen Nervenbahnen im Kortex und im<br />
Zerebellum von Kaninchen systematisch unterbrachen, konnten sie zeigen, dass auch Kaninchen<br />
eine konditionierte Blinzelreaktion nicht lernen können, wenn das Zerebellum zeitweilig während<br />
des Trainings deaktiviert ist (Krupa et al. 1993; Steinmetz 1999). Zur Bildung einer impliziten<br />
Erinnerung braucht man das Zerebellum.<br />
Unser duales System aus expliziten und impliziten Erinnerungen liefert eine Erklärung für die<br />
kindliche Amnesie: Reaktionen und Fertigkeiten, die wir in der Kindheit erlernt haben, reichen<br />
weit in die Zukunft hinein, doch als Erwachsene erinnern wir uns (explizit) an nichts aus den<br />
ersten 3 Lebensjahren. Wir haben keine bewusste Erinnerung an diesen Zeitraum, weil wir viele<br />
Informationen in Wörtern speichern, die ein Kind in der vorsprachlichen Phase noch nicht gelernt<br />
hat, und weil zudem der Hippocampus erst als eine der letzten Hirnstrukturen voll ausgereift ist.<br />
Lernziele Abschnitt 9.3<br />
Speichern: Information aufbewahren<br />
Ziel 8: Stellen Sie die beiden Formen des sensorischen <strong>Gedächtnis</strong>ses einander<br />
gegenüber.<br />
Wenn Informationen durch die Sinne ins <strong>Gedächtnis</strong>system gelangen,<br />
registrieren wir visuelle Bilder mit dem ikonischen <strong>Gedächtnis</strong>, in<br />
dem bildliche Vorstellungen nicht länger als wenige Zehntelsekunden<br />
Bestand haben und speichern diese Information für eine kurze Zeit.<br />
Wir registrieren und speichern Geräusche mit dem Echogedächtnis, in<br />
dem Echos auditiver Reize nicht länger als 3 oder 4 Sekunden fortbestehen.<br />
Ziel 9: Beschreiben Sie die Dauerhaftigkeit und die Arbeitskapazität des<br />
Kurzzeitgedächtnisses.<br />
Zu jedem Zeitpunkt können wir uns auf nur etwa 7 Items der Informationen<br />
(entweder neue Informationen oder solche, die aus dem <strong>Gedächtnis</strong><br />
abgerufen wurden) konzentrieren. Ohne Wiederholung verschwinden<br />
die Informationen innerhalb von Sekunden aus dem Kurzzeitgedächtnis<br />
und werden vergessen.<br />
Ziel 10: Beschreiben Sie die Kapazität und die Dauerhaftigkeit des Langzeitgedächtnisses.<br />
Die Kapazität zur dauerhaften Speicherung von Informationen im Langzeitgedächtnis<br />
ist im Wesentlichen unbegrenzt.<br />
Ziel 11: Erörtern Sie die Veränderungen an den Synapsen, die mit der Herausbildung<br />
des <strong>Gedächtnis</strong>ses und der Speicherung dort einhergehen.<br />
Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf die gedächtnisbezogenen<br />
Veränderungen innerhalb eines einzelnen Neurons und zwischen den<br />
Neuronen. In dem Maße, wie durch die Erfahrung die Bahnen zwischen<br />
den Neuronen gefestigt werden, übertragen die Synapsen die Signale<br />
auf effizientere Weise. Bei einem Vorgang, den man Langzeitpotenzierung<br />
(LTP) nennt, setzen die präsynaptischen Neuronen in diesen Bahnen<br />
schneller Neurotransmitter frei, und die postsynaptischen Neuronen<br />
bilden möglicherweise zusätzliche Rezeptoren; dadurch nimmt ihre Fä<br />
higkeit zu, die eingehenden Neurotransmitter zu bemerken. LTP scheint<br />
die neuronale Grundlage für Lernen und <strong>Gedächtnis</strong> zu sein.<br />
Ziel 12: Erörtern Sie, wie Stresshormone das <strong>Gedächtnis</strong> beeinflussen.<br />
Dadurch, dass Stresshormone die Produktion zusätzlicher Glukose (die<br />
die Gehirnaktivität vorantreibt) ermöglichen, signalisieren sie dem Gehirn<br />
wichtige Ereignisse. Die Amygdala, eine Struktur im limbischen System,<br />
in der Emotionen verarbeitet werden, regt Hirnareale an, die Emotionen<br />
verarbeiten. Diese hormonalen Veränderungen, die durch Emotionen<br />
ausgelöst werden, können zu unauslöschlichen Erinnerungen<br />
führen.<br />
Ziel 13: Unterscheiden Sie zwischen dem impliziten und dem expliziten <strong>Gedächtnis</strong>,<br />
und geben Sie die Gehirnstruktur an, die hauptsächlich damit in<br />
Verbindung gebracht wird.<br />
Wir sind uns unserer impliziten (prozeduralen) Erinnerungen oft nicht<br />
bewusst – unserer Erinnerung an unsere eigenen Fertigkeiten und an<br />
operant und klassisch konditionierte Reaktionen. Diese Erinnerungen<br />
werden teilweise vom Zerebellum in der Nähe des Hirnstamms verarbeitet.<br />
Wir rufen unsere expliziten (deklarativen) Erinnerungen – unser Allgemeinwissen,<br />
spezielle Fakten und persönlich erlebte Ereignisse – bewusst<br />
aus dem <strong>Gedächtnis</strong> ab. Explizite Erinnerungen werden in diversen<br />
Unterregionen des Hippocampus (einem neuronalen Zentrum im Gehirn)<br />
verarbeitet und zur Abspeicherung in andere Areale des Gehirns<br />
weitergeleitet. Das implizite und das explizite <strong>Gedächtnis</strong>system sind<br />
voneinander unabhängig. Eine Schädigung des Hippocampus kann die<br />
Fähigkeit zerstören, bewusst Erinnerungen abzurufen, ohne dass Fertigkeiten<br />
oder klassisch konditionierte Reaktionen zerstört werden.<br />
> Denken Sie weiter: Können Sie ein Beispiel dafür nennen, dass<br />
Stress Ihnen geholfen hat, sich an etwas zu erinnern? Und ein weiteres<br />
Beispiel dafür, dass es Ihnen aufgrund von Stress misslang, eine<br />
Erinnerung dauerhaft abzuspeichern?<br />
403<br />
9
9<br />
Seth Poppel/Yearbook archives<br />
404<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
◼ Abruf oder aktive, freie Reproduktion (recall):<br />
Maß für die Erinnerungsfähigkeit, bei dem die<br />
Versuchsperson vorher gelernte Informationen<br />
aktiv abrufen muss, etwa beim Ausfüllen eines<br />
Lückentexts.<br />
◼ Wiedererkennen (recognition): Maß für die Erinnerungsfähigkeit.<br />
Wie bei einem Multiple<br />
ChoiceTest muss die Versuchsperson lediglich<br />
Items identifizieren, die sie vorher erlernt hat.<br />
Sich an Vergangenes erinnern<br />
Auch wenn Madonna und Brad Pitt nicht berühmt<br />
geworden wären, hätten ihre Klassenkameraden<br />
aus der High School sie doch mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
auf den Fotos des Jahrbuchs wiedererkannt<br />
◼ Erneutes Lernen (relearning): Maß für die Erinnerungsfähigkeit,<br />
mit dem erfasst wird, wie viel<br />
schneller bereits erlerntes Material beim zweiten<br />
Mal gelernt wird.<br />
Unter der Lupe<br />
Abrufen von Passwörtern aus dem <strong>Gedächtnis</strong><br />
Es gibt etwas, womit Sie häufig zu tun haben und womit Ihre Großeltern<br />
nichts zu tun hatten: Passwörter. Um sich in Ihre EMail einzuloggen, um<br />
Ihre Mailbox abzuhören, um Bargeld aus einem Geldautomaten zu ziehen,<br />
um Zugang zu Ihrem OnlineKonto zu bekommen, um den Kopierer<br />
zu benutzen oder um die kleineTastatur am Hauseingang davon zu überzeugen,<br />
dass sich die Haustür öffnen soll, müssen Sie sich an Ihr Passwort<br />
erinnern. Ein typischer Erstsemester in Psychologie ist mit 8 Anforderungen<br />
für Passwörter konfrontiert, berichten Brown et al. (2004).<br />
Wenn man so viele Passwörter braucht, wie soll man damit umgehen?<br />
Der <strong>Gedächtnis</strong>forscher Roediger verfolgt einen einfachen Ansatz,<br />
um alle wichtigen Telefonnummern, PINNummern und CodeNummern<br />
seines Lebens zu speichern: »Ich habe einen Zettel in meiner<br />
Hemdtasche mit allen Nummern, die ich benötige«, sagt Roediger<br />
(2001). Er fügt hinzu, dass er sich nicht alle merken kann, warum soll er<br />
sich da groß abmühen? Mit anderen Strategien könnte man denjenigen<br />
Spanky’s Yearbook Archive<br />
9.4 Abrufen: Informationen auffinden<br />
Ziel 14: Stellen Sie den Abruf, das Wiedererkennen und Maßnahmen zum erneuten Lernen von Erinnerungen<br />
einander gegenüber.<br />
Beim Erinnern geht es nicht nur darum, etwas ins <strong>Gedächtnis</strong> hineinzubringen (enkodieren) und<br />
zu behalten (speichern), sondern auch darum, es wieder abzurufen.<br />
Für die meisten Menschen bedeutet Erinnern das Gleiche wie Abruf, nämlich die Fähigkeit,<br />
eine Information wiederzufinden, die nicht im aktuellen Bewusstsein vorhanden ist. Für den<br />
Psychologen bedeutet Erinnern, dass etwas Gelerntes behalten wurde. Wird also etwas wiedererkannt<br />
oder beim zweiten Lerndurchgang schneller gelernt, dann gilt das als Hinweis auf Erinnerung.<br />
Die Namen der meisten Ihrer Klassenkameraden aus der Abschlussklasse werden Sie nicht frei<br />
reproduzieren können, doch Sie könnten die Fotos im Jahrbuch wiedererkennen und die Namen<br />
aus einer Liste den Bildern zuordnen. Bahrick et al. (1975) berichteten, dass Leute, die 25 Jahre<br />
zuvor das College abgeschlossen hatten, sich nur an wenige ihrer damaligen Kameraden erinnern<br />
(d. h. sie ohne Hinweise nennen) konnten; doch konnten sie 90% der Fotos und der Namen wiedererkennen.<br />
Wenn es sich bei Ihnen so verhält wie bei den meisten Studierenden, dann könnte es<br />
sein, dass Sie von den 7 Zwergen mehr Namen wiedererkennen, als dass Sie sich durch freie Reproduktion<br />
an sie erinnern könnten (Miserandino 1991).<br />
Das Tempo, in dem etwas wieder gelernt wird, ist ein Hinweis auf <strong>Gedächtnis</strong> und Erinnerung.<br />
Unsere Geschwindigkeit beim erneuten Lernen kann auch etwas über das <strong>Gedächtnis</strong> aussagen.<br />
Wenn Sie einmal etwas gelernt und es dann vergessen haben, werden Sie es wahrscheinlich in<br />
kürzerer Zeit wieder lernen, als Sie ursprünglich zum Lernen benötigt haben. Beim Lernen auf<br />
eine Abschlussprüfung oder bei der Wiederbelebung einer Sprache, die Sie in Ihrer Kindheit gesprochen<br />
haben, geht das erneute Erlernen müheloser vonstatten. Tests, die das Wiedererkennen<br />
oder die für erneutes Lernen benötigte Zeit erfassen, zeigen, dass wir mehr »gespeichert« haben,<br />
als wir direkt abrufen können.<br />
Beim Wiedererkennen ist unser <strong>Gedächtnis</strong> erstaunlich flink und umfassend. »Trägt Ihr<br />
Freund alte oder neue Sachen?« »Alte.« »Stammt dieser 5-Sekunden-Clip aus einem Film, den<br />
Sie gesehen haben?« »Ja.« »Haben Sie diesen Menschen – diese einzigartige Anordnung der Gesichtszüge<br />
– schon einmal gesehen?« »Nein.« Ehe der Mund die Antwort auf diese und Tausende<br />
ähnlicher Fragen formulieren kann, weiß das Gehirn bereits Bescheid und weiß, dass es etwas<br />
weiß.<br />
helfen, die ihre PINNummern nicht im Wäschekorb verlieren wollen.<br />
Erstens: Nutzen Sie Passwörter mehrfach. Der Durchschnittsstudent verwendet<br />
4 unterschiedliche Passwörter für diese 8 Bedürfnisse. Zweitens:<br />
Nutzen Sie Abrufhilfen. Umfragen in Großbritannien und in den USA<br />
haben gezeigt, dass etwa die Hälfte unserer Passwörter mit Hilfe eines<br />
vertrauten Namens oder eines bekannten Datums gebildet werden. Bei<br />
anderen handelt es sich um geläufige Telefon oder Identifikationsnummern.<br />
Beim OnlineBanking oder anderen Situationen, in denen Sicherheit<br />
ein wesentlicher Faktor ist, sollten Sie eine Mischung aus Buchstaben und<br />
Ziffern verwenden, raten Brown et al. Wenn Sie ein solches Passwort zusammenstellen,<br />
wiederholen Sie es, dann wiederholen Sie es einen Tag<br />
später und immer wieder mit zunehmenden Zeitintervallen dazwischen.<br />
Auf dieseWeise werden sich langfristige Erinnerungen herausbilden, und<br />
sie werden am Geldautomaten und am Kopierer abrufbar sein.
9.4 · Abrufen: Informationen auffinden<br />
Abrufhilfen (»retrieval cues«)<br />
Ziel 15: Erklären Sie, wie Abrufhilfen dazu beitragen, dass wir Zugang zu gespeicherten Erinnerungen<br />
bekommen, und beschreiben Sie den Vorgang des Priming.<br />
Stellen Sie sich eine Spinne vor, die in der Mitte ihres Netzes sitzt; es wird gehalten von den vielen<br />
Fäden, die nach außen in alle Richtungen zu unterschiedlichen Punkten gespannt sind (vielleicht<br />
zu einer Fensterbank, dem Zweig eines Baums, einem Blatt an einem Busch). Wenn Sie einen Pfad<br />
zur Spinne verfolgen müssten, wäre es zunächst notwendig, dass Sie einen Pfad von einem dieser<br />
Ankerpunkte erzeugen und dann dem Faden folgen, der von diesem Punkt nach unten in das Netz<br />
führt.<br />
Der Vorgang, bei dem wir eine Erinnerung aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen, folgt einem ähnlichen<br />
Prinzip. Denn Erinnerungen werden durch ein Spinnennetz von Assoziationen im Speicher gehalten,<br />
jedes Stückchen Information ist über Zwischenverbindungen mit vielen anderen verbunden.<br />
Wenn Sie ein Stückchen Zielinformation im <strong>Gedächtnis</strong> enkodieren, wie etwa den Namen<br />
der Person, die im Seminarraum neben Ihnen sitzt, assoziieren Sie damit andere Stückchen Informationen<br />
über die Umgebung, die Stimmung, die Sitzposition usw. Diese anderen Stückchen Information<br />
sind wie Etiketten, Hinweise, Kennzeichen zur Identifizierung einer Zielinformation.<br />
Sie wirken wie Abrufhilfen, Ankerpunkte, die man, wenn man sie später abrufen will, nutzen kann,<br />
um Zugang zur Zielinformation zu bekommen. Je mehr Abrufhilfen man hat, desto besser sind<br />
die Chancen, dass man eine Route zu der Erinnerung findet, die da im Netz aufgehängt ist<br />
(7 Unter der Lupe: Abrufen von Passwörtern aus dem <strong>Gedächtnis</strong>).<br />
Erinnern Sie sich an das Wesentliche im zweiten Satz, den ich Sie bat, sich zu merken<br />
(7 Abschn. 9.2.2)? Falls nicht: Hilft Ihnen das Wort »Hai« weiter? Experimente haben gezeigt,<br />
dass durch das Wort »Hai« leichter das von Ihnen gespeicherte Bild abgerufen wird als durch das<br />
Wort »Fisch«, das tatsächlich im Satz vorkam (Anderson et al. 1976).<br />
Mnemotechniken können uns solche Erinnerungshilfen liefern: »Mein Vater erklärt mir jeden<br />
Sonntag …« oder EDEKA etc. Doch die besten Abrufhilfen sind die Assoziationen, die wir zu dem<br />
Zeitpunkt bilden, wenn wir eine Erinnerung enkodieren. Bei solchen Assoziationen kann es sich<br />
um Wörter oder um eine Erfahrung handeln. Ein Geschmack, ein Geruch oder ein Anblick sind<br />
häufig der Auslöser dafür, dass wir eine damit assoziierte Episode abrufen können. Um einen visuellen<br />
Abrufreiz beim Versuch der Reproduktion einer Erinnerung einzusetzen, können wir uns<br />
innerlich in den ursprünglichen Kontext versetzen. Für den britischen Theologen<br />
Hull (1990) wurde das schwierig, als er sein Augenlicht verlor. Einmal fragte ihn seine<br />
Frau, was er den Tag über getan habe, und es fiel ihm schwer, sich den Tag ins <strong>Gedächtnis</strong><br />
zurückzurufen. »Ich weiß, ich war irgendwo und habe irgendwas mit irgendwelchen<br />
Leuten gemacht, aber wo war das? Ich konnte die Gespräche, die ich geführt<br />
hatte, nicht in einen Kontext stellen. Es gab keinen Hintergrund, keine besonderen<br />
Merkmale, nichts, wodurch ich den Ort hätte identifizieren können.« Normalerweise<br />
wird die Erinnerung an die Menschen, mit denen man im Lauf des Tages gesprochen<br />
hat, in Rahmenvorstellungen gespeichert, zu denen auch der Hintergrund gehört.<br />
Um eine bestimmte Information aus dem Netz von Assoziationen abzurufen,<br />
muss man zunächst einen der Fäden aktivieren, die dorthin führen, ein Vorgang, den<br />
man als Priming bezeichnet. Der Philosoph und Psychologe William James nannte<br />
Priming das »Wecken von Assoziationen«. Oft werden unsere Assoziationen aktiviert<br />
oder einem Prime ausgesetzt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wie<br />
. Abb. 9.15 zeigt, werden Assoziationen mit einem Hasen aktiviert, wenn wir das<br />
Wort Kaninchen sehen oder hören, auch wenn wir uns gar nicht daran erinnern<br />
können, Kaninchen gesehen oder gehört zu haben.<br />
Priming ist oft »eine erinnerungslose Erinnerung« – eine Erinnerung, ohne sich explizit zu<br />
erinnern, eine unsichtbare Erinnerung. Wenn Sie einen Gang entlang gehen und sehen ein Poster<br />
mit einem Kind, das vermisst wird, werden Sie unbewusst dem Prime ausgesetzt, eine mehrdeutige<br />
Interaktion zwischen einem Erwachsenen und einem Kind als mögliche Entführung zu interpretieren<br />
(James 1986). Obwohl Sie sich nicht bewusst an das Poster erinnern, prädisponiert es<br />
Ihre Interpretation. (Wie wir in 7 Kap. 5 gesehen haben, können subliminale Reize kurzzeitig die<br />
Reaktionen auf spätere Reize primen.)<br />
405<br />
? Multiple-Choice-Tests prüfen unsere<br />
a Fähigkeit zur Reproduktion<br />
b Fähigkeit zum Wiedererkennen<br />
c Fähigkeit zum erneuten Erlernen<br />
Lückentexte testen unser ____.<br />
(→ beide Antworten unter 9.2 am Ende<br />
des Kapitels)<br />
»Das <strong>Gedächtnis</strong> ist nicht so etwas wie ein Behälter,<br />
der sich allmählich auffüllt; es ist eher so etwas<br />
wie ein Baum, an dem Haken wachsen, an<br />
denen wiederum die Erinnerungen aufgehängt<br />
werden.«<br />
Peter Russell, »The Brain Book« (1979)<br />
Stellen Sie einem Freund ein paar Kreuzfeuerfragen:<br />
a) Wie nennt man die Verbindung zwischen<br />
Stecker und Radio? b) Wer in der Bibel wurde<br />
von seinem Bruder Kain erschlagen? c) Womit<br />
isst man Suppe? Wenn Ihr Freund dann auf die<br />
3. Frage antwortet: Gabel!, dann haben Sie den<br />
Priming-Effekt demonstriert.<br />
◼ Priming (priming): häufig unbewusst erfolgende<br />
Aktivierung spezieller Assoziationen im<br />
<strong>Gedächtnis</strong> aufgrund von Vorerfahrungen mit<br />
den betreffenden Informationen.<br />
. Abb. 9.15. Priming: Assoziationen wecken<br />
Wenn Sie das Wort »rabbit« (Kaninchen) hören oder<br />
lesen, werden Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit<br />
ein gesprochenes Wort als »hare« (Hase) und nicht<br />
als »hair« (Haar) buchstabieren. Die unbewusste Ausbreitung<br />
der Assoziationen aktiviert andere, damit<br />
zusammenhängende Assoziationen. Dieses Phänomen<br />
wird Priming genannt (Nach Bower 1986)<br />
9
9<br />
M. Barton<br />
406<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.16. <strong>Gedächtnis</strong> und Kontexteffekte<br />
Wörter, die unter Wasser vorgelesen wurden, wurden<br />
auch unter Wasser am besten reproduziert;<br />
Wörter, die am Strand vorgelesen wurden, wurden<br />
am Strand am besten reproduziert. (Nach Godden<br />
u. Baddeley 1975)<br />
. Abb. 9.17. Vertrauter Kontext aktiviert das<br />
<strong>Gedächtnis</strong><br />
Kleinkinder, die gelernt haben, ein Mobile mit<br />
einem Tritt in Bewegung zu setzen, aktivieren die<br />
Erinnerung daran am schnellsten, wenn ein nochmaliger<br />
Test im gleichen Kontext erfolgt. In einem<br />
anderen Kontext dauert die Aktivierung länger.<br />
(Aus Butler u. RoveeCollier 1989)<br />
Kontexteffekte<br />
Ziel 16: Geben Sie an, wie der Kontext den Abruf beeinflussen kann.<br />
Wenn Sie sich in den Kontext zurückzuversetzen, in dem Sie etwas erlebt haben, kann dies den<br />
Abruf aus dem <strong>Gedächtnis</strong> als Prime beeinflussen. Godden u. Baddely (1975) entdeckten diesen<br />
Effekt der sog. Enkodierspezifität, als sie Tauchern an 2 verschiedenen Orten jeweils eine Liste mit<br />
Wörtern vorlasen: entweder in 8 m Tiefe oder am Strand. Wie . Abb. 9.16 zeigt, erinnerten sich<br />
die Taucher an mehr Wörter, wenn ihnen an einem Ort etwas vorgelesen und sie dort auch getestet<br />
wurden.<br />
Stellen Sie sich einmal das folgende Szenario vor: Während Sie sich zu diesem Buch Notizen<br />
machen, bemerken Sie, dass Sie Ihren Bleistift spitzen müssen. Sie stehen auf und laufen ins untere<br />
Stockwerk. Aber als Sie unten ankommen, können Sie sich nicht mehr erinnern, warum Sie dorthin<br />
gegangen sind. Nachdem Sie versucht hatten, sich daran zu erinnern, was sie überhaupt wollten,<br />
geben Sie auf und kehren zu Ihrem Schreibtisch zurück. Sobald Sie sich hingesetzt haben, um<br />
weiterzuarbeiten, fällt es Ihnen ein: »Ich wollte doch den Bleistift spitzen!« Was war geschehen,<br />
dass es zu dieser frustrierenden Situation kam? In einem Kontext (am Schreibtisch, bei der Lektüre<br />
eines Psychologiebuchs) kommt es dazu, dass Sie den Bleistift spitzen wollen. Wenn Sie aufstehen<br />
und eine Treppe tiefer gehen, bewegen Sie sich in einen anderen Kontext, in dem Ihnen nur wenige<br />
Hinweisreize zur Verfügung stehen, um Sie auf den Gedanken zu bringen, der Sie dorthin<br />
geführt hat. Wenn Sie aufgeben und zu Ihrem Schreibtisch zurückgehen, sind Sie wieder in dem<br />
Kontext, in dem Sie den Gedanken enkodiert haben (»Mit diesem Bleistift kann man nicht mehr<br />
schreiben«).<br />
Wahrscheinlich haben Sie selbst auch schon ähnliche Kontexteffekte erlebt. Sie kehren an<br />
einen Ort zurück, an dem Sie früher einmal gewohnt haben, oder Sie sehen die Schule, in die<br />
Sie einmal gegangen sind, und schon werden Sie von Erinnerungen und Hinweisreizen förmlich<br />
überflutet. Es kann auch hilfreich sein, wenn eine Prüfung in dem Raum abgehalten wird, in<br />
dem Sie unterrichtet wurden. Rovee-Collier (1993) machte mehrere Versuche und fand dabei<br />
heraus, dass ein vertrauter Kontext sogar bei 3 Monate alten Kindern Erinnerung aktivieren<br />
kann. Die Kinder hatten gelernt, dass sie ein Mobile mit einem Fußtritt in Bewegung versetzen<br />
konnten (mit Hilfe einer Verbindungsschnur zwischen dem Mobile und ihrem Knöchel). Die<br />
Kinder traten häufiger zu, wenn sie im selben Kinderbett lagen und dasselbe Mobile vor sich<br />
hatten. In einem fremden Kontext und mit einem unbekannten Mobile kickten sie weniger oft<br />
(. Abb. 9.17).
9.4 · Abrufen: Informationen auffinden<br />
Manchmal befindet man sich in einer Umgebung, die einem so vertraut vorkommt, als sei man<br />
dort schon gewesen. Das kann eine DéjàvuErfahrung (franz. » déjà vu « = schon einmal gesehen)<br />
auslösen, die eigenartige Vorstellung, man sei schon einmal genau in dieser Situation gewesen.<br />
Diese flüchtige Erfahrung machen am ehesten gebildete, fantasievolle junge Erwachsene, besonders<br />
wenn sie müde oder gestresst sind (Brown 2003, 2004). Zwei Drittel der Befragten, die in der<br />
Studie von McAneny (1996) angaben, eine Déjà-vu-Erfahrung gemacht zu haben, fragen sich oft:<br />
»Wie kann ich eine Situation wiedererkennen, die ich zum ersten Mal erlebe?« Die, die eine paranormale<br />
Erklärung akzeptieren, denken an Reinkarnation (»Das ist sicher eine Erfahrung aus einem<br />
früheren Leben«), oder sie glauben an Präkognition (»Ich habe diese Szene vor meinem inneren<br />
Auge gesehen, ehe ich sie tatsächlich erlebte«).<br />
Man kann die Frage auch anders stellen (»Warum habe ich den Eindruck, diese Situation<br />
wiederzuerkennen?«), und dann können wir herausfinden, wie unser <strong>Gedächtnis</strong>system möglicherweise<br />
solche Déjà-vu-Erfahrungen produziert (Alcock 1981). Wenn wir schon einmal in einer<br />
vergleichbaren Situation waren, dann mag die aktuelle Situation mit Hinweisreizen, die unbewusst<br />
die frühere Erfahrung aktivieren, förmlich gespickt sein. (Wir nehmen riesige Mengen an Informationen<br />
auf und behalten sie, wobei wir gleichzeitig kaum bemerken und oft vergessen, woher<br />
sie gekommen sind.) Wenn Sie also in einem ähnlichen Kontext einen Fremden bemerken, der so<br />
aussieht und läuft wie einer Ihrer Freunde, dann kann diese Ähnlichkeit den unheimlichen Eindruck<br />
des Wiedererkennens hervorrufen. Nachdem Sie einen Schatten dieser früheren Erinnerung<br />
geweckt haben, könnten Sie vielleicht denken: »Ich habe diesen Menschen schon einmal in<br />
ebendieser Situation gesehen.«<br />
Oder vielleicht kommt Ihnen die Situation vertraut vor, wenn sie mehreren anderen Ereignissen<br />
leicht ähnelt, merkt Lampinen (2002) an. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen kurz meinem Vater,<br />
meinen Brüdern, meiner Schwester und meinen Kindern; und ein paar Wochen danach treffen<br />
Sie mich. Sie könnten vielleicht der Meinung sein: »Ich war schon einmal mit diesem Typen zusammen.«<br />
Obwohl keiner in meiner Familie so aussieht oder sich so verhält wie ich (das ist auch<br />
gut für sie), ist ihr Aussehen und sind ihre Gesten ein wenig so wie bei mir. Und »in einem globalen<br />
Sinne« könnte ich dem entsprechen, was Sie zuvor erlebt haben.<br />
Stimmung und <strong>Gedächtnis</strong><br />
Ziel 17: Beschreiben Sie die Auswirkungen innerer Zustände auf den Abruf aus dem <strong>Gedächtnis</strong>.<br />
Assoziationen mit Wörtern, Ereignissen oder Situationen sind nicht die einzigen Abrufhilfen. Etwas,<br />
was in der Vergangenheit geschehen ist, ging vielleicht mit einer bestimmten Emotion einher, die<br />
zum Zeitpunkt der Reproduktion als Vorbereitung bzw. Prägung, als Priming auf die damit assoziierten<br />
Ereignisse dienen kann. Der Kognitionspsychologe Bower (1983) erklärt das folgendermaßen:<br />
»Eine Emotion ist wie der Raum einer Bibliothek, in dem wir Erinnerungen ablegen. Am leichtesten<br />
finden wir die abgelegten Erinnerungen, wenn wir in den Raum mit der entsprechenden Emotion<br />
zurückkehren.« Was wir in einem bestimmten Zustand innerer Befindlichkeit – fröhlich oder traurig,<br />
betrunken oder nüchtern – lernen, wird manchmal leichter erinnert, wenn wir wieder in diesem<br />
Zustand sind. Dieses subtile Phänomen wird zustandsabhängiges <strong>Gedächtnis</strong> genannt. Allerdings<br />
wird das, was eine Person im Zustand der Depression oder der Trunkenheit lernt, in keinem Zustand<br />
gut reproduziert werden (Depression wirkt sich störend auf die Enkodierung aus, und Trunkenheit<br />
auf die Speicherung). Es wird jedoch ein kleines bisschen besser erinnert, wenn man bei der Reproduktion<br />
wieder im Zustand der Depression oder der Trunkenheit ist. Jemand, der betrunken Geld<br />
versteckt, findet es vielleicht erst wieder, wenn er wieder betrunken ist.<br />
In ähnlicher Weise verfälschen Stimmungen unsere Erinnerungen. Offenbar assoziieren wir<br />
positive und negative Ereignisse mit der Stimmung, die mit ihnen einhergeht und die dann zur<br />
Abrufhilfe wird (Fiedler et al. 2001). Demnach sind unsere Erinnerungen in gewisser Weise stimmungskongruent.<br />
Wenn man niedergeschlagen ist, wirken die Erinnerungen als Prime auf negative<br />
Assoziationen, die wir dann wiederum als Erklärung für unsere momentane – niedergeschlagene<br />
– Stimmung heranziehen. Bringt man Menschen in eine überschwängliche Stimmung, sei es<br />
durch Hypnose oder durch die Ereignisse des Tages (in einer Studie mit deutschen Teilnehmern<br />
war das der Gewinn einer Fußballweltmeisterschaft), dann erinnern sie die Welt in rosaroten<br />
Farben (DeSteno et al. 2000; Forgas et al. 1984; Schwarz et al. 1987). Sie halten sich für kompetent<br />
407<br />
◼ Déjà-vu-Erfahrung (déjà vu): der unheimliche<br />
Eindruck, etwas schon mal genau so erlebt zu<br />
haben. Hinweisreize aus der aktuellen Situation<br />
mögen unbewusst die Erinnerung an eine frühere<br />
Situation auslösen.<br />
»Haben Sie je dieses seltsame Gefühl des vujà dé<br />
gehabt? Nicht déjà vu; vujà dé. Es handelt sich um<br />
das eindeutige Gefühl, dass in bestimmter Weise<br />
etwas, was gerade geschehen ist, nie zuvor geschehen<br />
ist. Nichts kommt einem vertraut vor.<br />
Und dann verschwindet dieses Gefühl plötzlich.<br />
Vujà dé.«<br />
George Carlin, »Funny Times« (2001)<br />
◼ Stimmungskongruente Erinnerung (moodcongruent<br />
memory): Tendenz, sich an Erfahrungen<br />
zu erinnern, die mit der aktuellen guten<br />
oder schlechten Stimmung übereinstimmen.<br />
»Wenn ein Gefühl da war, glaubten sie, es würde<br />
nie vergehen; war es dann vergangen, meinten<br />
sie, es sei nie da gewesen, und wenn es zurückkehrte,<br />
glaubten sie, es sei ihnen nie abhanden<br />
gekommen.«<br />
George MacDonald (»What’s Mine’s Mine«, 1886)<br />
9
9<br />
S. Kröning<br />
408<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Stimmung und <strong>Gedächtnis</strong><br />
Wenn wir in Hochstimmung sind, erinnern wir uns<br />
an andere glückliche Zeiten und erwarten noch<br />
weitere Zeiten des Glücks. Stimmungen sind ein<br />
Abrufreiz, denn sie aktivieren andere Erinnerungen,<br />
die mit demselben Gefühl assoziiert sind. Mit Hilfe<br />
dieser Erinnerungen lässt sich die aktuelle Stimmung<br />
aufrechterhalten<br />
Lernziele Abschnitt 9.4<br />
Abrufen: Informationen auffinden<br />
Ziel 14: Stellen Sie den Abruf, das Wiedererkennen und Maßnahmen zum<br />
erneuten Lernen von Erinnerungen einander gegenüber.<br />
Abruf ist die Fähigkeit, Informationen aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abzufragen,<br />
ohne sich dessen vollständig bewusst zu sein; es handelt sich um eine<br />
Abfrage wie bei einem Lückentext. Wiedererkennen ist die Fähigkeit, Items<br />
zu identifizieren, die man zuvor gelernt hat; wie ein Wiedererkennen bei<br />
einem Test mit MultipleChoiceFragen. Erneutes Lernen ist die Fähigkeit,<br />
die früher abgespeicherten Informationen schneller zu beherrschen, als<br />
man sie ursprünglich gelernt hat.<br />
Ziel 15: Erklären Sie, wie Abrufhilfen dazu beitragen, dass wir Zugang zu<br />
gespeicherten Erinnerungen bekommen, und beschreiben Sie den Vorgang<br />
des Priming.<br />
Abrufhilfen sind kleine Stücke zusammenhängender Informationen, die<br />
wir enkodieren, während wir einen Teil einer Zielinformation verarbeiten.<br />
In gewisser Weise sind diese Stückchen mit dem Kontext des Ziels verbunden;<br />
und sie werden zum Teil eines Netzes abgespeicherter Assoziationen.<br />
Wenn eines dieser miteinander assoziierten Stückchen unsere<br />
Aufmerksamkeit weckt, ist es so, als zögen wir an einem Faden im Spinnennetz<br />
der Assoziationen und riefen die Zielinformation in unser Bewusstsein.<br />
Dieser Vorgang, bei dem (oft unbewusst) Assoziationen aktiviert<br />
werden, heißt Priming.<br />
und tüchtig, stehen anderen Menschen wohlwollend gegenüber und erwarten mit größerer Wahrscheinlichkeit,<br />
dass schöne Ereignisse eintreten.<br />
Angesichts dieses Zusammenhangs sollte es uns nicht verwundern, dass in manchen Studien<br />
akut depressive Menschen ihre Eltern als Personen in Erinnerung haben, die ablehnend und strafend<br />
sind und Schuldgefühle provozieren, während Menschen, die ihre Depression überwunden<br />
haben, ihre Eltern mehr oder weniger so beschreiben wie Menschen, die nie unter einer Depression<br />
gelitten haben (Lewinsohn u. Rosenbaum 1987; Lewis 1992). Vor diesem Hintergrund ist es<br />
auch nicht erstaunlich, wenn Bornstein et al. (1991) berichten, dass in der Art und Weise, wie<br />
Jugendliche die von ihren Eltern gezeigte Zuneigung bewerten, kaum Hinweise darauf zu finden<br />
sind, wie ihre Bewertungen 6 Wochen später ausfallen werden. Wenn Teenager niedergeschlagen<br />
sind, kommen ihnen die Eltern unmenschlich vor. Sobald sie wieder etwas aufleben, findet die<br />
große Metamorphose statt: Die Eltern verwandeln sich von Teufeln in Engel. Vielleicht veranlasst<br />
Sie das zu einem wissenden Nicken. Und doch, ob gut oder schlecht gelaunt, wir nehmen in jeder<br />
Stimmung an, dass unsere sich tatsächlich verändernden Urteile und Erinnerungen exakt den<br />
Tatsachen entsprechen.<br />
Unsere jeweilige Stimmung hat auch Einfluss darauf, wie wir das Verhalten anderer Menschen<br />
interpretieren. Wenn man aufmerksam auf seine Gefühle achtet, kann das dazu beitragen, dass man<br />
die Verfälschung durch die Stimmung rückgängig machen kann (McFarland et al. 2003). Doch es<br />
ist auf jeden Fall schwer, sich dagegen zu wehren. Sind wir schlecht gelaunt, bewerten wir einen<br />
Blick, den man uns zuwirft, als wütendes Anstarren. Wenn wir jedoch gut gelaunt sind, interpretieren<br />
wir den gleichen Blick als Interesse. Wie wir die Welt wahrnehmen, hängt von unserer jeweiligen<br />
Stimmung ab. Leidenschaftliche Begeisterung macht z. B. jede Empfindung noch intensiver.<br />
Die Art, wie sich die Stimmung auf den Abruf von Erinnerungen auswirkt, erklärt auch, warum<br />
unsere jeweilige Stimmung andauert. Wenn Sie glücklich sind, erinnern Sie sich an glückliche<br />
Augenblicke und nehmen deshalb die Welt als einen glücklichen Ort wahr, was wiederum die<br />
gute Stimmung intensiviert. Sind Sie niedergeschlagen, dann erinnern Sie sich an traurige Vorfälle,<br />
was wiederum Ihre Interpretation aktueller Ereignisse überschattet. In 7 Kap. 17 werden wir<br />
sehen, wie dieser Prozess den Teufelskreis der Depression aufrechterhält.<br />
Ziel 16: Geben Sie an, wie der Kontext den Abruf beeinflussen kann.<br />
Der Kontext, in dem wir ursprünglich ein Ereignis erlebt oder einen Gedanken<br />
enkodiert haben, kann unsere Erinnerungen mit Abrufhilfen<br />
überfluten, die uns zur Zielerinnerung führen. Wenn wir uns in einem<br />
anderen Kontext befinden, der dem ursprünglichen sehr ähnlich ist, können<br />
wir in dem Maße ein Déjà vu erleben, in dem viele dieser Hinweisreize<br />
zurückkommen und uns dazu verleiten, unbewusst die Zielerinnerung<br />
abzurufen.<br />
Ziel 17: Beschreiben Sie die Auswirkungen innerer Zustände auf den Abruf<br />
aus dem <strong>Gedächtnis</strong>.<br />
Bestimmte Zustände oder Emotionen können sich bei uns insofern als<br />
Prime auswirken, als wir Ereignisse abrufen, die mit diesen Zuständen<br />
oder Emotionen assoziiert werden. Sind wir in guter Stimmung, rufen wir<br />
gewöhnlich Erinnerungen ab, die konsistent – oder kongruent – mit dem<br />
glücklichen Zustand sind. Sind wir deprimiert, rufen wir eher negative<br />
Erinnerungen ab. Stimmungen wirken bei uns auch insofern als Prime, als<br />
wir das Verhalten anderer in einer mit unseren Emotionen konsistenten<br />
Weise interpretieren.<br />
> Denken Sie weiter: In welcher Stimmung waren Sie in letzter Zeit?<br />
Auf welche Weise hat Ihre Stimmung Ihre Erinnerungen, Wahrnehmungen<br />
und Erwartungen gefärbt?
9.5 · Vergessen<br />
9.5 Vergessen<br />
Ziel 18: Erklären Sie, warum wir unsere Fähigkeit zu vergessen positiv bewerten sollten, und unterscheiden<br />
Sie 3 allgemeine Arten, wie unser <strong>Gedächtnis</strong> scheitern kann.<br />
Bei all dem Beifall für das <strong>Gedächtnis</strong>, all den Versuchen, es zu verstehen, all den Büchern mit<br />
Methoden zur <strong>Gedächtnis</strong>verbesserung: Wer hätte je das Vergessen gepriesen? James (1890) hat<br />
es einmal getan: »Wenn wir uns an alles erinnerten, wären wir meistens genauso übel dran, wie<br />
wenn wir uns an gar nichts erinnerten.« Den Haufen unnötiger oder überholter Informationen<br />
– wo wir gestern geparkt haben, die alte Telefonnummer eines Freundes, ein im Restaurant bestelltes<br />
Essen, das schon lange serviert und verzehrt wurde – entsorgen zu können, ist zweifellos<br />
ein wahrer Segen. Der russische <strong>Gedächtnis</strong>künstler S., dem wir am Anfang dieses Kapitels begegnet<br />
sind, fühlte sich regelrecht verfolgt von dem Haufen sinnloser Erinnerungen in seinem <strong>Gedächtnis</strong>.<br />
Sie beherrschten sein Bewusstsein. Er konnte nur mit Schwierigkeiten abstrakt denken,<br />
also Inhalte generalisieren, ordnen und evaluieren. Ein gutes <strong>Gedächtnis</strong> ist ein wertvoller Helfer,<br />
doch das gilt auch für die Fähigkeit zu vergessen. Wenn eine Pille auf den Markt kommen sollte,<br />
mit der wir unser <strong>Gedächtnis</strong> verbessern können, sollte sie am besten nicht allzu wirksam sein.<br />
Häufiger ist allerdings der Fall, dass uns das <strong>Gedächtnis</strong> erschreckt und frustriert. Erinnerungen<br />
sind launisch. Mein eigenes <strong>Gedächtnis</strong> liefert mir problemlos Erinnerungen an so schöne Episoden<br />
wie jenen wunderbaren ersten Kuss mit der Frau, die ich liebe, oder so banale Fakten wie die Entfernung<br />
von London nach Detroit mit dem Flugzeug. Aber es lässt mich glatt im Stich, wenn ich versuche,<br />
den Namen des neuen Kollegen zu reproduzieren oder mich zu erinnern, wo ich meine Sonnenbrille<br />
hingelegt habe, und entdecke, dass ich es nicht geschafft habe, die Informationen zu enkodieren, zu<br />
speichern oder abzurufen. Der <strong>Gedächtnis</strong>forscher Schacter (1999) zählt 7 Gründe auf, warum uns<br />
unser <strong>Gedächtnis</strong> manchmal im Stich lässt; er nennt sie die 7 Sünden des <strong>Gedächtnis</strong>ses:<br />
Die 3 Sünden des Vergessens<br />
1. Geistesabwesenheit: Mangelnde Aufmerksamkeit für Einzelheiten führt zu fehlerhafter<br />
Enkodierung. (Wenn wir den Autoschlüssel aus der Hand legen, ist unser Denken gerade<br />
mit etwas anderem beschäftigt.)<br />
2. Vergänglichkeit: Im Laufe der Zeit zerfällt der Speicher. (Wenn sich die Wege der früheren<br />
Klassenkameraden getrennt haben, verblassen oder verflüchtigen sich nicht benutzte Informationen.)<br />
3. Abblocken: Die gespeicherte Information ist nicht zugänglich. (Das erinnerte Wort liegt uns<br />
auf der Zunge, aber da gibt es einen Abruffehler: Wir bringen es nicht heraus.)<br />
Die 3 Sünden der Verzerrung<br />
4. Fehlattribution: Informationsquellen werden verwechselt. (Jemandem werden die Worte<br />
eines anderen in den Mund gelegt oder eine Filmszene als etwas tatsächlich Geschehenes<br />
erinnert.)<br />
5. Beeinflussbarkeit: Fehlinformationen bleiben im <strong>Gedächtnis</strong>. (Die Suggestivfrage – »Hat<br />
der Angeklagte 50 Euro aus der Kasse genommen?« – wird möglicherweise später zur<br />
falschen Erinnerung eines Zeugen.)<br />
6. Systematischer Fehler: Erinnerungen sind durch aktuelle Überzeugungen und Annahmen<br />
gefärbt. (Die derzeitigen Gefühle einer Freundin gegenüber ihrem Partner können möglicherweise<br />
die Erinnerung an ihre ursprünglichen Gefühle beeinflussen.)<br />
Die Sünde des Sich-Aufdrängens<br />
7. Persistenz: Unangenehme Erinnerungen lassen sich nicht ausschalten. (Es ist möglich,<br />
dass Betroffene von den Erinnerungsbildern an einen sexuellen Übergriff regelrecht verfolgt<br />
werden.)<br />
Schauen wir uns zunächst die Sünden des Vergessens an und wenden uns dann den Sünden der<br />
Verzerrung und des Sich-Aufdrängens zu.<br />
409<br />
»Glück ist nichts weiter als Gesundheit und ein<br />
schlechtes <strong>Gedächtnis</strong>.«<br />
Der Arzt Albert Schweitzer (1875–1965)<br />
Yo-Yo Ma vergaß sein 266 Jahre altes Cello mit<br />
einem Wert von 2,5 Mio. Dollar in einem New<br />
Yorker Taxi. (Später bekam er es wieder.)<br />
»Amnesie sickert in die Ritzen unseres Gehirns,<br />
und Amnesie heilt.«<br />
Joyce Carol Oates, »Words Fail, Memory Blurs,<br />
Life Wins« (2001)<br />
9
9<br />
410<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.18. Vergessen als Scheitern der Enkodierung<br />
Was nicht enkodiert wurde, kann nicht erinnert<br />
werden<br />
. Abb. 9.19. Testen Sie Ihr Erinnerungsvermögen<br />
? Welche dieser europäischen Centmünzen ist<br />
die richtige? (7 Antwort 9.3 am Ende des Kapitels)<br />
9.5.1 Scheitern der Enkodierung<br />
Ziel 19: Erörtern Sie, welche Rolle das Scheitern der Enkodierung beim Vergessen spielt.<br />
Wir können uns nicht daran erinnern, was wir nicht enkodieren konnten, weil die Informationen<br />
nie ins Langzeitgedächtnis gelangen (. Abb. 9.18). Und wie das Beispiel der »Veränderungsblindheit«<br />
anschaulich zeigt, bemerken wir vieles von dem nicht, was auf unsere Sinne trifft (7 Abschn.<br />
6.1.1). Die Effizienz der Enkodierung kann auch vom Alter beeinflusst werden. Die Hirnareale, die<br />
sofort anspringen, wenn junge Erwachsene eine neue Information enkodieren, arbeiten bei älteren<br />
Erwachsenen deutlich langsamer. Dieses langsamere Enkodieren erklärt das mit zunehmendem<br />
Alter nachlassende <strong>Gedächtnis</strong> (Grady et al. 1995). (In 7 Kap. 4 haben wir gesehen, dass ältere<br />
Menschen tendenziell weniger reproduzieren können als jüngere, dass sie jedoch bei einem Wiedererkennungstest<br />
genau so gut abschneiden wie junge Erwachsene.)<br />
Doch ganz unabhängig vom Alter richten wir unsere Aufmerksamkeit selektiv auf die überwältigende<br />
Fülle dessen, was es in unserer Umwelt ununterbrochen zu sehen und zu hören gibt.<br />
Denken Sie nur an irgendetwas, was Sie schon unendlich oft nachgeschaut haben: Welche Buchstaben<br />
auf den Tasten Ihres Handys gehören zu der Zahl 5? Für die meisten Menschen ist eine<br />
solche Frage überraschend schwierig.<br />
Noch ein Beispiel für fehlerhafte Enkodierung: Wenn Sie in Europa leben, haben Sie im Laufe<br />
der letzten Jahre wohl schon Hunderte von europäischen Centmünzen in der Hand gehabt, und<br />
Sie können sich sicher an ihre Größe und Farbe erinnern. Aber können Sie sich erinnern, wie die<br />
Seite aussieht, auf der die Zahl abgebildet ist? Wenn nicht, dann machen wir den Test leichter:<br />
Können Sie in . Abb. 9.19 die richtige Münze herausfinden? In demselben Test mit amerikanischen<br />
Pennystücken stellten Nickerson u. Adams (1979) fest, dass die wenigsten Menschen dazu in der<br />
Lage sind. Von den 8 entscheidenden Merkmalen (Lincolns Kopf, Datum, »In God we trust« etc.)<br />
kann sich der Durchschnittsbürger spontan nur an 3 erinnern. Auch bei den Briten können nur<br />
wenige die 1-Pence-Münze aus dem <strong>Gedächtnis</strong> zeichnen (Richardson 1993). Die Details einzelner<br />
Münzen haben nicht viel Bedeutung, und man braucht sie auch nicht, um sie von anderen<br />
Münzen zu unterscheiden – und nur wenige von uns machen sich die Mühe, diese Details zu enkodieren.<br />
K. Niebank
9.5 · Vergessen<br />
! Manche Informationen – wo wir gestern zu Abend gegessen haben – enkodieren wir zwar<br />
automatisch, doch andere Arten von Informationen – wie die Begriffe in diesem Kapitel – erfordern<br />
eine bewusste Verarbeitung. Ohne diese bewusste Anstrengung werden viele Erinnerungen<br />
gar nicht erst gebildet.<br />
9.5.2 Speicherzerfall<br />
Ziel 20: Erörtern Sie den Begriff des Speicherzerfalls, und beschreiben Sie die Vergessenskurve von<br />
Ebbinghaus.<br />
Selbst wenn eine Information gut enkodiert wurde, wird sie manchmal später vergessen. Ebbinghaus<br />
(1885) wollte die Beständigkeit der gespeicherten Erinnerungen untersuchen und lernte<br />
deshalb noch weitere Listen mit sinnlosen Silben auswendig. Beginnend mit 20 Minuten bis hin<br />
zu 30 Tagen nach dem Erlernen erfasste er, wie viel er behalten hatte, wenn er jede Liste noch<br />
einmal lernte. Seine berühmte Vergessenskurve (. Abb. 9.20) weist darauf hin, dass wir tatsächlich<br />
vieles von dem, was wir lernen, schnell wieder vergessen. Durch spätere Versuche erhielt die<br />
Vergessenskurve den Rang eines psychologischen Gesetzes. Vergessen erfolgt zu Beginn schnell<br />
und pendelt sich dann auf einem bestimmten Niveau ein, das mit der Zeit immer weiter absinkt<br />
(Wixted u. Ebbesen 1991).<br />
Bahrick (1984) erweiterte die Befunde von Ebbinghaus. Er prüfte die Vergessenskurve für<br />
spanische Vokabeln, die in der Schule gelernt worden waren. Bei einem Vergleich zwischen den<br />
Schülern, die gerade einen High-School- oder Collegekurs für Spanisch abgeschlossen hatten, mit<br />
ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die die Schule bereits 3 Jahre zuvor verlassen hatten,<br />
hatten letztere vieles von dem vergessen, was sie einmal gelernt hatten (. Abb. 9.21). Doch nach<br />
ungefähr 3 Jahren pendelte sich ein bestimmtes Vergessensniveau ein: Was die Befragten zu diesem<br />
Zeitpunkt noch behalten hatten, daran konnten sie sich auch noch 25 oder mehr Jahre später erinnern,<br />
selbst wenn sie ihre Spanischkenntnisse nie angewendet hatten.<br />
Eine Erklärung für diese Vergessenskurven ist das graduelle Verblassen der physischen Erinnerungsspur.<br />
Wenn wir mehr über die physische Speicherung der <strong>Gedächtnis</strong>inhalte wissen, verstehen<br />
wir sicher besser, wie es kommt, dass ein <strong>Gedächtnis</strong>speicher zerfallen kann. Doch Erinnerungen<br />
verblassen auch aufgrund der Anhäufung anderer Lerninhalte, die sich störend auf den<br />
Abruf auswirken.<br />
411<br />
. Abb. 9.20. Vergessenskurve nach Ebbinghaus<br />
Ebbinghaus lernte Listen mit sinnlosen Silben auswendig<br />
und untersuchte dann, wie viele er bis zu<br />
30 Tage später davon noch behalten hatte. Er fand<br />
heraus, dass die Erinnerung an neuartige, bisher<br />
unbekannte Informationen schnell verblasst und<br />
dann verschwindet. (Nach Ebbinghaus 1885)<br />
9
9<br />
412<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.21. Vergessenskurve für in der Schule<br />
erlerntes Spanisch<br />
Studenten, die vor 3 Jahren an einem Spanischkurs<br />
teilgenommen haben, erinnern sich an viel weniger<br />
als die, die ihren Kurs gerade beendet haben. Die<br />
Studenten, deren Spanischkurs noch länger zurückliegt,<br />
haben nicht sehr viel mehr vergessen als die,<br />
die vor 3 Jahren Spanisch gelernt haben. (Nach<br />
Bahrick 1984)<br />
Gehörlose, die Gebärdensprache gut beherrschen,<br />
erleben ein ähnliches Phänomen: Es liegt<br />
ihnen nicht auf der Zunge, sondern »auf den<br />
Fingerspitzen« (Thompson et al. 2005)<br />
. Abb. 9.22. Scheitern des<br />
Abrufens<br />
Was für uns von Bedeutung<br />
ist oder was wir mit Wiederholungen<br />
gelernt haben,<br />
wird im Langzeitgedächtnis<br />
gespeichert. Doch manchmal<br />
gibt es keinen Zugang zu der<br />
gespeicherten Information,<br />
dann wird sie vergessen<br />
9.5.3 Scheitern des Abrufs<br />
Sie haben bereits gelernt, dass vergessene Ereignisse wie Bücher sind, die Sie nicht in der Bibliothek<br />
finden können, sei es, weil sie nie angeschafft (nicht enkodiert) wurden oder weil sie ausgemustert<br />
wurden (Zerfall der gespeicherten Erinnerungen).<br />
Es gibt allerdings auch eine dritte Möglichkeit: Selbst wenn das Buch vorhanden und ausleihbar<br />
ist, ist es möglicherweise nicht zugänglich. Vielleicht verfügen Sie nicht über die Informationen,<br />
die Sie brauchen, um es zu finden und abzurufen. Manchmal kommen Informationen in<br />
unser Gehirn, und wir wissen, dass sie da sind, wir können sie aber nicht herausholen (. Abb. 9.22).<br />
Der Titel des Buches oder der Name des Verfassers liegt Ihnen vielleicht auf der Zunge und wartet<br />
nur darauf, abgerufen zu werden. Wenn man uns eine Abrufhilfe gibt (der Autorenname fängt mit<br />
M an), können wir leicht eine schwer fassbare Erinnerung abrufen. Abrufprobleme können die<br />
Ursache für die gelegentlichen <strong>Gedächtnis</strong>ausfälle älterer Menschen sein.<br />
! Oft genug bedeutet Vergessen weniger, dass Erinnerungen gelöscht wurden, sondern eher,<br />
dass sie nicht abgerufen werden können.<br />
Interferenz<br />
Ziel 21: Stellen Sie die proaktive und die retroaktive Interferenz einander gegenüber, und erklären Sie,<br />
auf welche Weise sie ein Scheitern des Abrufs verursachen können.<br />
Das Lernen mancher Items kann den Abruf anderer stören, insbesondere wenn es sich um ähnliche<br />
Items handelt. Wenn Ihnen jemand seine Telefonnummer sagt, sind Sie wahrscheinlich imstande,
9.5 · Vergessen<br />
sie später zu erinnern. Doch wenn Ihnen noch 2 weitere Menschen ihre Telefonnummern geben,<br />
wird jede weitere Nummer schwieriger zu reproduzieren sein. Wenn Sie ein neues Kombinationsschloss<br />
für Ihr Fahrrad kaufen oder eine neue Telefonnummer bekommen, kann Ihre Erinnerung<br />
an das Alte damit interferieren. Zu dieser proaktiven (vorwärts gerichteten) Interferenz kommt es,<br />
wenn etwas, was Sie früher gelernt haben, die Reproduktion von etwas unterbricht, was Sie später<br />
erleben. In dem Maße, wie Sie immer mehr Informationen sammeln, füllt sich Ihr mentaler Dachboden<br />
immer weiter auf. Er wird zwar nie ganz vollgestellt sein, doch es wird zweifellos etwas eng.<br />
Underwood (1957) fand, dass diejenigen, die verschiedene Wörterlisten an aufeinander folgenden<br />
Tagen lernten, sich am folgenden Tag schlechter an jede der neuen Listen erinnern konnten.<br />
Mit dem Konzept der proaktiven Interferenz lässt sich auch erklären, warum sich Ebbinghaus,<br />
nachdem er in seiner beruflichen Laufbahn unzählige Listen mit sinnlosen Silben auswendig gelernt<br />
hatte, am folgenden Tag nur noch an etwa ein Viertel der Silben erinnern konnte, die er am<br />
Vortag auswendig gelernt hatte – das ist weit weniger, als Sie als Anfänger erinnern könnten, wenn<br />
Sie nur eine einzige Liste auswendig gelernt hätten.<br />
Von retroaktiver (nach rückwärts gerichteter) Interferenz sprechen wir, wenn neue Informationen<br />
die Reproduktion von früher Gelerntem erschweren (. Abb. 9.23). Ein typisches Beispiel<br />
dafür sind die Probleme eines Lehrers, der sich die Namen seiner neuen Schüler einprägt und dann<br />
aufgrund von retroaktiver Interferenz Probleme bei der Reproduktion der Namen seiner früheren<br />
Schüler hat. Es ist so, als würde man einen zweiten Stein in einen Teich werfen; er bringt die kreisförmigen<br />
Wellen durcheinander, die der erste hervorgerufen hat.<br />
413<br />
◼ Proaktive Interferenz oder proaktive Hemmung<br />
(proactive interference): Störeffekt von<br />
früher Gelerntem auf die Reproduktion neuer<br />
Informationen.<br />
◼ Retroaktive Interferenz oder retroaktive Hemmung<br />
(retroactive interference): Störeffekt neu<br />
gelernter Informationen auf die Reproduktion<br />
alter Informationen.<br />
. Abb. 9.23. Proaktive und retroaktive Interferenz<br />
9
9<br />
C. Styrsky<br />
414<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.24. Retroaktive Interferenz<br />
Versuchspersonen vergaßen mehr, wenn sie<br />
wach blieben und neues Material aufnahmen.<br />
(Aus Jenkins u. Dallenbach 1924)<br />
„Schatz, ich unterstelle dir ja keine Absicht – aber<br />
dass du unseren Hochzeitstag wieder vergessen<br />
hast, nehme ich langsam persönlich!“<br />
Man kann die retroaktive Interferenz dadurch vermindern, dass man die Zahl der interferierenden<br />
Ereignisse verringert, indem man beispielsweise einen kurzen Spaziergang macht oder<br />
eine kleine Schlafpause einlegt, sobald man neue Informationen aufgenommen hat. In einem<br />
heute klassischen Experiment entdeckten die Forscher Jenkins u. Dallenbach (1924), welchen Nutzen<br />
der Schlaf hat. Tag für Tag lernten 2 Teilnehmer an einem Experiment einige sinnlose Silben<br />
auswendig und versuchten, sie zu reproduzieren. Der eine Teilnehmer schlief eine Nacht lang<br />
(8 Stunden), während der andere wach blieb. . Abb. 9.24 zeigt, dass das Vergessen schneller einsetzte,<br />
wenn man wach blieb und mit anderen Aktivitäten beschäftigt war. Das führte die Forscher<br />
zu der Vermutung, dass es sich beim »Vergessen weniger um den Zerfall alter Eindrücke und<br />
Assoziationen handelt, sondern vielmehr um Interferenz, Hemmung oder Überlagerung des Alten<br />
durch Neues« (1924, S. 612). Spätere Experimente haben den Nutzen des Schlafs bestätigt und<br />
zeigten, dass die Stunde vor Beginn des Nachtschlafs (aber nicht die Minuten vor dem Einschlafen)<br />
ein guter Zeitpunkt sind, um dem <strong>Gedächtnis</strong> Informationen anzuvertrauen (Benson u. Feinberg<br />
1977; Fowler et al. 1973; Nesca u. Koulack 1994).<br />
Interferenz ist eine wichtige Ursache für das Vergessen. Doch sollten wir die Interferenz auch<br />
nicht überbewerten. Manchmal können alte Informationen das Erlernen neuer Informationen<br />
sogar leichter machen. Wer Latein kann, lernt vielleicht leichter Französisch – ein Phänomen, das<br />
positiver Transfer genannt wird.<br />
! Zur Interferenz kommt es nur, wenn alte und neue Information miteinander im Wettstreit<br />
liegen.<br />
Absichtsvolles Vergessen<br />
Ziel 22: Fassen Sie Freuds Begriff der Verdrängung zusammen, und machen Sie eine Aussage darüber,<br />
ob diese Auffassung durch die aktuelle <strong>Gedächtnis</strong>forschung bestätigt wird.<br />
Der große Topf mit Plätzchen in unserer Küche war randvoll mit Schokoladenplätzchen, und eine<br />
weitere Ladung kühlte auf dem Küchentisch ab. 24 Stunden später war kein Krümel mehr davon<br />
zu finden. Wer hatte die Schokoladenplätzchen geklaut? Nur meine Frau, unsere 3 Kinder und ich<br />
waren im Haus gewesen. Deshalb führte ich, solange die Erinnerungen noch frisch waren, einen<br />
kleinen <strong>Gedächtnis</strong>test durch. Andy gab zu, 20 Plätzchen verschlungen zu haben, Peter gestand<br />
15, und die 6-jährige Laura glaubte, sie habe sich so ungefähr mit 15 Plätzchen vollgestopft. Meine<br />
Frau Carol erinnerte sich, 6 Plätzchen gegessen zu haben, und ich selbst erinnerte mich an den<br />
Verzehr von 15 Plätzchen, wobei ich noch weitere 18 mit ins Büro genommen hatte. Für 89 Plätzchen<br />
mussten wir demnach gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Aber so ganz war das<br />
Rätsel damit noch nicht gelöst, denn es waren ursprünglich 160 gewesen.
9.5 · Vergessen<br />
In Experimenten, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Phänomen der<br />
erinnerten Plätzchen hatten, wiesen Ross et al. (1981) nach, dass Menschen<br />
unwissentlich ihre eigene Geschichte überarbeiten. Ross überzeugte seine Versuchsteilnehmer<br />
davon, dass häufiges Zähneputzen wünschenswert ist. Daraufhin<br />
erinnerten sie sich, sich in den letzten beiden Wochen häufig die Zähne<br />
geputzt zu haben, und zwar häufiger als andere Menschen. Studierende, die an<br />
einem Seminar über Methoden zum erfolgreichen Lernen teilgenommen hatten,<br />
das in der Werbung stark angepriesen wurde, kamen anschließend zu einer<br />
übertriebenen Einschätzung dessen, wie viel besser ihre Lernfähigkeit tatsächlich<br />
geworden war. Weil sie ihre Lerngewohnheiten aus der Zeit vor dem<br />
Seminar geringer einschätzten, kamen sie selbst zu der Überzeugung, dass sie<br />
wirklich von dem Seminar profitiert hatten (Conway u. Ross 1984). Sich an die<br />
eigene Vergangenheit erinnern bedeutet häufig, sie gleichzeitig zu überarbeiten.<br />
Warum lässt unser <strong>Gedächtnis</strong> uns im Stich? Warum haben wir, meine Familie<br />
und ich, nicht enkodiert, gespeichert und abgerufen, wie viele Plätzchen<br />
jeder von uns tatsächlich gegessen hatte? . Abb. 9.25 zeigt, dass wir sensorische<br />
Informationen automatisch und mit erstaunlicher Genauigkeit enkodieren. Wäre<br />
es möglich, dass unsere Erinnerung an die Plätzchen – so ähnlich wie Ebbinghaus’<br />
Erinnerung an seine sinnlosen Silben – genau so schnell dahinschwand wie<br />
die Plätzchen selbst? Oder ist die Information vielleicht noch vorhanden, aber<br />
nicht abrufbar, weil es uns so peinlich wäre, uns zu erinnern?<br />
Sigmund Freud wies mit seinem Konzept der Verdrängung darauf hin, dass<br />
unser <strong>Gedächtnis</strong>system tatsächlich schmerzliche Erinnerungen einer Zensur<br />
unterzieht. Vermutlich verdrängen wir schmerzliche Erinnerungen, um unser<br />
Selbstkonzept zu schützen und unsere Angst zu vermindern. Doch die unterdrückte<br />
Erinnerung bleibt erhalten, sagte Freud, und kann vielleicht mit Geduld und Anstrengung<br />
bzw. im Rahmen einer Therapie in späterer Zeit durch einen bestimmten Hinweisreiz wieder abgerufen<br />
werden.<br />
Es gab den Fall einer Frau, die eine heftige und unerklärliche Angst vor fließendem Wasser<br />
hatte. Das Rätsel löste sich eines Tages durch eine Tante, die flüsterte: »Ich habe das nie erzählt.«<br />
Es war, als hätten diese Worte eine erloschene Kerze wieder angezündet: Sie lösten bei der Frau die<br />
Erinnerung an eine bestimmte Situation aus. Als kleines Kind war sie ungehorsam gewesen, war<br />
bei einem Picknick mit der Familie weggelaufen und unter einen Wasserfall geraten, und sie konnte<br />
sich nicht aus eigener Kraft aus dieser Lage befreien. Die Tante hatte sie gerettet und hatte versprochen,<br />
den Eltern nichts davon zu sagen (Kihlstrom 1990).<br />
Derartige Geschichten sind der Nährboden für die heute weit verbreitete Ansicht (9 von 10<br />
Studierenden glauben daran), dass »die Erinnerung an schmerzliche Erfahrungen manchmal ins<br />
Unbewusste verschoben wird« (Brown et al. 1996). Für Freuds Psychologie war Verdrängung ein<br />
zentrales Thema und wurde Bestandteil der Legenden, die sich um die Psychoanalyse ranken. Fast<br />
jeder Mensch glaubt daran. Therapeuten arbeiten häufig mit dieser Annahme. Doch eine steigende<br />
Zahl von <strong>Gedächtnis</strong>forschern glaubt, dass Verdrängung selten oder gar nicht stattfindet. Weiter<br />
oben haben wir angemerkt, dass Emotionen und die damit verbundenen Stresshormone Erinnerungen<br />
festigen. Aber wie ist es mit schrecklichen Geschehnissen? Ist es normal, dass sich Menschen<br />
nur schlecht an traumatische Erfahrungen erinnern können oder sie nur mit Mühe vergessen<br />
können? Wir werden darauf zurückkommen.<br />
415<br />
. Abb. 9.25. Wann wird vergessen?<br />
Zum Vergessen kann es in jeder Phase des Erinnerungsprozesses<br />
kommen. Bei der Verarbeitung<br />
werden die Informationen gefiltert und verändert,<br />
und manchmal geht ein Teil davon verloren<br />
»Man muss sich an die Ereignisse so erinnern, wie<br />
es gewünscht wird. Und wenn zu diesem Zweck<br />
die eigenen Erinnerungen geändert werden müssen<br />
. . ., dann muss man vergessen, dass man sie<br />
geändert hat. Das ist ein Trick, den man lernen<br />
kann, genau wie andere Denktechniken. . . . Wir<br />
nennen es Doppeldenk.«<br />
George Orwell (»Neunzehnhundertvierundachtzig«,<br />
1948)<br />
◼ Verdrängung (repression): In der psychoanalytischen<br />
Theorie gilt Verdrängung als wichtigster<br />
Abwehrmechanismus, mit dessen Hilfe Gedanken,<br />
Gefühle und Erinnerungen, die Angst auslösen,<br />
aus dem Bewusstsein gedrängt werden.<br />
9
9<br />
416<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Lernziele Abschnitt 9.5<br />
Vergessen<br />
Ziel 18: Erklären Sie, warum wir unsere Fähigkeit zu vergessen positiv bewerten<br />
sollten, und unterscheiden Sie 3 allgemeine Arten, wie unser <strong>Gedächtnis</strong><br />
scheitern kann.<br />
Ohne die Fähigkeit, vergessen zu können, würden wir von nicht mehr<br />
aktuellen und irrelevanten Informationen überwältigt. Unser <strong>Gedächtnis</strong><br />
kann uns scheitern lassen durch Vergessen (geistige Abwesenheit,<br />
Vergänglichkeit und Abblocken), durch Verzerrung (Fehlattribution, Beeinflussbarkeit<br />
und systematische Fehler) und durch SichAufdrängen<br />
(Persistenz ungewollter Erinnerungen).<br />
Ziel 19: Erörtern Sie, welche Rolle das Scheitern der Enkodierung beim Vergessen<br />
spielt.<br />
Was wir (durch bewusste oder durch automatische Verarbeitung) enkodieren,<br />
ist nur ein sehr begrenzterTeil der sensorischen Reize aus unserer<br />
Umgebung. Und in dem Maße, in dem wir altern, wird unsere Enkodierung<br />
langsamer und weniger effizient. Ohne Enkodierung gelangen die<br />
Informationen nicht in unseren Langzeitspeicher und können nicht abgerufen<br />
werden.<br />
Ziel 20: Erörtern Sie den Begriff des Speicherzerfalls, und beschreiben Sie die<br />
Vergessenskurve von Ebbinghaus.<br />
Enkodierte Erinnerungen können nach der Speicherung verblassen.<br />
Aufgrund seiner Forschungsarbeiten zum Lernen und Behalten konnte<br />
Ebbinghaus feststellen, dass das Vergessen im zeitlichen Verlauf zu Beginn<br />
rasch erfolgt und dann mit der Zeit langsamer wird; dieses Prinzip<br />
ist als Vergessenskurve bekannt.<br />
9.6 Konstruktion von Erinnerung<br />
Ziel 21: Stellen Sie die proaktive und die retroaktive Interferenz einander<br />
gegenüber, und erklären Sie, wie sie ein Scheitern des Abrufs verursachen<br />
können.<br />
Ein Grund, warum es zum Scheitern des Abrufs kommt, ist, dass alte und<br />
neue Informationen beim Abruf miteinander konkurrieren. Bei der proaktiven<br />
Interferenz behindert etwas, was wir in der Vergangenheit gelernt<br />
haben (die alte Telefonnummer eines Freundes), unsere Fähigkeit,<br />
etwas abzurufen, was wir kürzlich gelernt haben (die neue Nummer<br />
eines Freundes). Bei der retroaktiven Interferenz behindert etwas, was<br />
wir kürzlich gelernt haben (der Wortschatz für den Spanischkurs in diesem<br />
Semester), etwas, was wir in der Vergangenheit gelernt haben (den<br />
Wortschatz aus dem Französischkurs im letzten Jahr).<br />
Ziel 22: Fassen Sie Freuds Begriff der Verdrängung zusammen, und machen<br />
Sie eine Aussage darüber, ob diese Auffassung durch die aktuelle <strong>Gedächtnis</strong>forschung<br />
bestätigt wird.<br />
Freud war der Meinung, dass wir Angst auslösende peinliche Gedanken,<br />
Gefühle und Erinnerungen aus unseren bewussten Gedanken verbannen<br />
– das ist etwas, was er als Verdrängung bezeichnete. Nach seiner<br />
Auffassung unterdrückt dieses motivierte Vergessen Erinnerungen, lässt<br />
sie jedoch unter den richtigen Bedingungen für den späteren Abruf<br />
wieder verfügbar werden. Die <strong>Gedächtnis</strong>forscher neigen zu der Auffassung,<br />
dass es nur selten zur Verdrängung kommt.<br />
> Denken Sie weiter: Die meisten Menschen wünschen sich ein besseres<br />
<strong>Gedächtnis</strong>, vor allem, wenn sie älter werden. Trifft das auch<br />
auf Sie zu? Oder wünschen Sie sich eher, Sie könnten alte Erinnerungen<br />
aus Ihrem <strong>Gedächtnis</strong> entfernen?<br />
Stellen Sie sich vor, dass Sie an folgendem Experiment teilnehmen:<br />
Sie gehen zum Abendessen in ein wirklich schönes Restaurant. Man gibt Ihnen einen Platz an einem<br />
Tisch mit einer weißen Tischdecke. Sie lesen die Speisekarte. Sie sagen dem Kellner, dass Sie gern ein<br />
halb durchgebratenes Rippenstück hätten, dazu eine gebackene Kartoffel mit saurer Sahne und<br />
Salat mit einem Dressing aus Blauschimmelkäse. Sie bestellen auch Rotwein von der Weinkarte.<br />
Einige Minuten danach bringt der Kellner Ihren Salat, etwas später kommt dann das übrige Essen.<br />
Alles schmeckt Ihnen, außer dass das Rippenstück etwas zu sehr durchgebraten ist.<br />
Sollte ich Ihnen just in diesem Moment die folgenden Fragen stellen (nach Hyde 1983), könnten<br />
Sie sicher mit vielen Einzelheiten aufwarten. Beantworten Sie mir doch bitte folgende Fragen,<br />
ohne den obigen Absatz noch einmal anzuschauen:<br />
4 Welches Dressing sollte Ihr Salat haben?<br />
4 War das Tischtuch rotkariert?<br />
4 Was haben Sie zum Trinken bestellt?<br />
4 Hat Ihnen der Kellner die Speisekarte gegeben?
9.6 · Konstruktion von Erinnerung<br />
Vermutlich konnten Sie genau wiederholen, was Sie bestellt haben, vielleicht konnten Sie sich<br />
sogar an die Farbe des Tischtuchs erinnern. Wir haben tatsächlich eine riesige Kapazität zum<br />
Speichern und Abrufen selbst kleinster Details unseres täglichen Lebens. Doch hat Ihnen der<br />
Kellner die Speisekarte gegeben? In dem Absatz oben steht nichts davon. Trotzdem beantworten<br />
viele Menschen diese Frage mit ja. Wir konstruieren unsere Erinnerungen häufig, während wir<br />
sie enkodieren, und wir verändern unsere Erinnerungen auch, wenn wir sie aus dem <strong>Gedächtnis</strong><br />
hervorholen. Wie ein Wissenschaftler, der aus den Überresten eines Dinosauriers auf sein<br />
äußeres Erscheinungsbild schließt, schließen wir aus unseren gespeicherten Informationen und<br />
aus dem, was wir heute dazu annehmen, auf unsere Vergangenheit. Sie haben ein Schema für<br />
Restaurantbesuche entwickelt, und dieses Schema sorgt dafür, dass Sie Information filtern und<br />
fehlende Teile ergänzen und auf diese Weise Ihre Erinnerung konstruieren (zum Schemabegriff<br />
7 Abschn. 4.2.2).<br />
9.6.1 Auswirkungen von Fehlinformationen und Imagination<br />
Ziel 23: Erklären Sie, wie Fehlinformationen und Imagination unsere Erinnerung an ein Ereignis verzerren<br />
können.<br />
Elizabeth Loftus hat in über 200 Experimenten mit mehr als 20.000 Teilnehmern nachgewiesen,<br />
wie Augenzeugen in ähnlicher Weise ihre Erinnerungen rekonstruieren,<br />
sobald sie befragt werden. In einem heute als klassisch geltenden Experiment (Loftus<br />
u. Palmer 1974) sahen die Teilnehmer einen Film, in dem ein Verkehrsunfall gezeigt<br />
wurde, anschließend wurden sie danach gefragt, was sie gesehen hatten. Die Teilnehmer,<br />
deren Fragestellung lautete: »Wie schnell fuhren die Autos, als sie aufeinander<br />
krachten?« schätzten die Geschwindigkeit höher ein als die, deren Frage lautete: »Wie<br />
schnell fuhren die Autos, als sie zusammenstießen?« (im Orig.: »smashed into each<br />
other« versus »hit each other«). Eine Woche später fragten die Interviewer, ob die<br />
Teilnehmer sich erinnerten, Glassplitter gesehen zu haben. Die Teilnehmer, die die<br />
Worte »aufeinander krachten« gehört hatten, bejahten die Frage mit mehr als doppelt<br />
so hoher Wahrscheinlichkeit als die Teilnehmer, die das Wort »zusammenstießen«<br />
gehört hatten (. Abb. 9.26). Tatsächlich waren im Film keine Glassplitter zu sehen<br />
gewesen.<br />
In vielen Folgeexperimenten überall auf der Welt wurde den Teilnehmern ein<br />
Vorfall gezeigt, sie erhielten dazu irreführende Informationen bzw. erhielten sie nicht<br />
und wurden dann einem <strong>Gedächtnis</strong>test unterzogen. Das Ergebnis dieser Experimente<br />
war immer gleich: Es gibt einen Fehlinformationseffekt. Wird den Versuchspersonen<br />
eine subtile Fehlinformation geliefert, dann erinnern sie sich falsch. Sie erinnerten<br />
sich an ein Stoppschild, obwohl es sich um das Schild »Vorfahrt gewähren« handelte, sie sahen<br />
einen Hammer an Stelle eines Schraubenziehers, Coladosen gingen als Erdnussdosen durch, aus<br />
der Zeitschrift »Vogue« wurde »Mademoiselle«, »Dr. Henderson« wurde als »Dr. Davidson«<br />
417<br />
◼ Fehlinformationseffekt (misinformation<br />
effect): irreführende Informationen, die in die<br />
Erinnerung an ein Ereignis eingebaut werden.<br />
. Abb. 9.26. Konstruktion von Erinnerung<br />
Versuchspersonen sahen einen Film über einen<br />
Autounfall, dann stellte man ihnen eine Frage, die<br />
ihre Erinnerung in eine bestimmte Richtung lenkte.<br />
Daraufhin sah der Unfall in ihrer Erinnerung ernster<br />
aus als der, den sie gesehen hatten. (Aus Loftus<br />
1979)<br />
9<br />
Sipress, 1988
9<br />
418<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
»Eine Erinnerung hat keine Substanz. Sie kann<br />
überlagert werden. Ihre Fotosammlung kann<br />
Ihrem <strong>Gedächtnis</strong> nachhelfen, kann aber auch die<br />
Erinnerungen zerstören. . . . Die einzige Erinnerung,<br />
die Ihnen von Ihrer Reise bleibt, ist diese<br />
verflixte Ansammlung von Schnappschüssen.«<br />
Annie Dillard (»To Fashion a Text«, 1988)<br />
»Nicht die Anzahl der Dinge, an die ich mich erinnere,<br />
ist erstaunlich, sondern die Anzahl der Dinge,<br />
die gar nicht so waren, wie ich sie erinnere.«<br />
Mark Twain (1835–1910)<br />
erinnert, Frühstücksflocken als Eier, und ein glatt rasierter Mann hatte in der Erinnerung ein<br />
Lippenbärtchen (Loftus et al. 1992).<br />
! In dem Maße, wie die Erinnerung in der Zeit nach dem Vorfall verblasst, wird es leichter, eine<br />
Fehlinformation einfließen zu lassen (Loftus 1992).<br />
Der Fehlinformationseffekt ist dem Betroffenen so wenig bewusst, dass es schwer fällt, später zwischen<br />
der Erinnerung an ein tatsächliches Ereignis und einem suggerierten Ereignis zu unterscheiden<br />
(Schooler et al. 1986). Wenn wir von etwas berichten, was wir erlebt haben, dann füllen wir die<br />
Lücken in der Erinnerung mit plausiblen Vermutungen und Annahmen. Und wenn wir den Bericht<br />
ein paar Mal wiederholen, dann erinnern wir uns an die vermuteten Einzelheiten in einer Weise,<br />
als hätten wir sie tatsächlich so erlebt; denn diese Einzelheiten wurden in der Zwischenzeit vom<br />
<strong>Gedächtnis</strong> aufgenommen (Roediger et al. 1993). Auch wenn wir den lebhaften Bericht eines anderen<br />
Menschen hören, kann dies falsche Erinnerungen in unserem <strong>Gedächtnis</strong> verankern.<br />
Eine falsche Erinnerung kann auch dadurch entstehen, dass man sich immer wieder Handlungen<br />
und Ereignisse vorstellt, die es gar nicht gibt. In einem Versuch sollten sich Studierende<br />
immer wieder einfache Handlungen vorstellen, beispielsweise dass man einen Zahnstocher zerbricht<br />
oder einen Tacker hochhebt. Diese Studierenden erlebten danach eine »Vorstellungsinflation«,<br />
denn sie glaubten mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass sie in der ersten Phase des Experiments<br />
diese Dinge tatsächlich getan hatten (Goff u. Roediger 1998). Bei 2 weiteren Experimenten<br />
wurden amerikanische und britische Studierende gebeten, sich bestimmte Erfahrungen aus der<br />
Kindheit vorzustellen, etwa dass sie ein Fenster mit der Hand zerbrochen hätten oder dass eine<br />
Krankenschwester eine Probe von der Haut ihres kleinen Fingers genommen hätte. In beiden<br />
Fällen war es so: Ein Viertel erinnerte sich später daran, dass das vorgestellte Ereignis wirklich<br />
passiert sei (Garry et al. 1996; Mazzoni u. Memon 2003). Zur Vorstellungsinflation kommt es<br />
teilweise, weil ähnliche Hirnbereiche aktiviert werden, wenn man etwas visualisiert und wenn man<br />
tatsächlich etwas wahrnimmt (Gonsalves et al. 2004).<br />
! Etwas, was man sich einbildet, kommt einem nach einiger Zeit vertraut vor, und Vertrautes<br />
kommt einem realer vor. Je lebhafter sich also ein Mensch etwas vorstellen kann, desto wahrscheinlicher<br />
ist es, dass er seine Vorstellung in eine Erinnerung verwandelt (Loftus 2001; Porter<br />
et al. 2000).<br />
Leute, die glauben, sie seien von Außerirdischen entführt und in einem Raumschiff medizinisch<br />
untersucht worden, haben tendenziell eine lebhaftere Phantasie und sind bei <strong>Gedächtnis</strong>tests anfälliger<br />
für falsche Erinnerungen (Clancy et al. 2002). Diejenigen, die glauben, sie hätten Erinnerungen<br />
an einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit aufgedeckt, neigen ebenfalls dazu, eine<br />
lebendige Vorstellungswelt und hohe Werte in Tests für falsche Erinnerungen zu haben (Clancy<br />
et al. 2000; McNally 2003).<br />
Um herauszufinden, wie weit das menschliche Denken geht, wenn es auf der Suche nach Fakten<br />
Fiktionen erschafft, hielten Wiseman et al. (1999) 8 Séancen ab, an denen jeweils 25 neugierige<br />
Menschen teilnahmen. Geleitet wurden diese »Séancen« von einem »Medium«, das in Wirklichkeit<br />
ein Schauspieler und Magier war. Während der Sitzung bat das Medium die Teilnehmer, sich<br />
darauf zu konzentrieren, den Tisch in Bewegung zu setzen. Zwar bewegte sich der Tisch nicht,<br />
doch das Medium behauptete, er bewege sich. »Gut so. Hebt ihn hoch. Das ist sehr gut. Weiter<br />
konzentrieren! Haltet den Tisch in der Luft!« Bei einer Befragung 2 Wochen nach der Séance erinnerten<br />
sich 34% der Teilnehmer daran, dass sie den Tisch tatsächlich frei schweben gesehen<br />
hätten.<br />
Auch Psychologen sind nicht gegen die Konstruktion von Erinnerungen gefeit: Zu seiner<br />
großen Verblüffung erfuhr der Psychologe Jean Piaget als Erwachsener, dass seine lebhafte und<br />
detailreiche Erinnerung daran, wie sein Kindermädchen verhindert hatte, dass er entführt wurde,<br />
völlig falsch war. Offensichtlich hatte er die Erinnerung konstruiert, weil die Geschichte immer<br />
wieder erzählt wurde (sein Kindermädchen gestand später, nachdem es einen anderen Glauben<br />
angenommen hatte, dass die ganze Geschichte frei erfunden sei).
9.6 · Konstruktion von Erinnerung<br />
9.6.2 Quellenamnesie<br />
Ziel 24: Stellen Sie dar, welche Rolle die Quellenamnesie bei falschen Erinnerungen spielt.<br />
Piaget erinnerte sich, doch schrieb er seine Erinnerung einer falschen Quelle zu (und zwar mehr<br />
seiner eigenen Erfahrung als den Geschichten seines Kindermädchens). Beim Enkodieren von<br />
Erinnerungen verteilen wir verschiedene Aspekte einer Erinnerung auf verschiedene Bereiche<br />
des Gehirns. Die Quelle gehört zu den empfindlichsten Teilen einer Erinnerung. So kann es<br />
passieren, dass wir einen Menschen wiedererkennen, jedoch keine Ahnung haben, wo wir ihm<br />
schon einmal begegnet sind. Es kommt auch vor, dass wir uns etwas vorstellen oder von etwas<br />
träumen und später nicht sicher sind, ob das Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Manchmal<br />
hören wir etwas, und unsere Erinnerung sagt uns, wir hätten etwas gesehen (Henkel et al. 2000).<br />
In all diesen Fällen behalten wir das Bild, allerdings ohne den Kontext, in dem wir die Erinnerung<br />
enkodiert haben.<br />
Poole u. Lindsay (1995, 2001, 2002) wiederholten Piagets Erfahrung mit der Quellenamnesie<br />
(auch Quellen-Fehlattribution genannt). Sie inszenierten eine Begegnung von Vorschulkindern<br />
mit »Mr. Science«, der den Kindern allerlei Dinge demonstrierte, beispielsweise, wie man einen<br />
Luftballon mit Hilfe von Backpulver und Essig aufbläst. Drei Monate später lasen die Eltern den<br />
Kindern an 3 aufeinander folgenden Tagen eine Geschichte vor, in der sie selbst und Mr. Science<br />
vorkamen. In den Geschichten wurden manche der Dinge beschrieben, die sie selbst erlebt hatten,<br />
aber auch Dinge, die sie nicht erlebt hatten. Dann kam ein anderer Interviewer und fragte sie, was<br />
Mr. Science ihnen vorgeführt hatte. »Hatte Mr. Science eine Maschine, die an Seilen gezogen<br />
wurde?« Vier von 10 Kindern erinnerten sich spontan, dass Mr. Science Sachen gemacht hatte, die<br />
nur in der Geschichte vorgekommen waren.<br />
9.6.3 Echte und falsche Erinnerungen<br />
Ziel 25: Listen Sie einige Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen echten und falschen Erinnerungen<br />
auf.<br />
Erinnerung kann also ebenso gut eine Reproduktion wie eine Rekonstruktion sein, und wir<br />
können nicht sicher sein, ob eine Erinnerung wirklich eine Erinnerung ist, nur weil wir den<br />
Eindruck haben, es könne eine echte Erinnerung sein. So wie uns eine Wahrnehmungstäuschung<br />
sehr real vorkommen kann, erscheint uns vielleicht auch eine nicht reale Erinnerung als<br />
sehr real.<br />
Die heutigen Wissenschaftler sind sich darin einig, dass es eine Verwandtschaft zwischen Erinnerung<br />
und Wahrnehmung gibt: Erinnerungen sind Wahrnehmungen aus der Vergangenheit<br />
(Koriat et al. 2000). Und Halberstadt u. Niedenthal (2001) konnten zeigen, auf welche Weise die<br />
ursprüngliche Interpretation Einfluss auf die Erinnerung an die Wahrnehmung hat. Sie forderten<br />
Studierende auf, gemorphte Gesichter zu betrachten, die so gestaltet waren, dass sie Gefühlsmischungen<br />
wie Glück und Wut gleichzeitig ausdrückten (. Abb. 9.27a). Die Studierenden sollten<br />
sich vorstellen und erklären, warum diese Frau wütend (oder glücklich) aussieht. Eine halbe Stunde<br />
später baten die Forscher die Studierenden, sich ein Videoband anzusehen, auf dem ein künstlich<br />
erzeugter Übergang vom glücklichen zum wütenden Gesicht zu erkennen war. Die Studierenden<br />
sollten dann einen Schieberegler, der den Gesichtsausdruck veränderte, so lange bedienen, bis<br />
der Eindruck, den sie als ersten gesehen hatten, wiederhergestellt war (. Abb. 9.27b). Die Studierenden,<br />
die zuerst die Wut bemerkt hatten (»Diese Frau ist wütend, weil ihre beste Freundin sie<br />
mit ihrem Freund betrogen hat«) schufen ein Gesicht, das wütender war als das Gesicht, das von<br />
jenen Teilnehmern erzeugt wurde, die den Gesichtsausdruck zunächst glücklich gefunden hatten<br />
(»Diese Frau ist sehr glücklich, weil jeder an ihren Geburtstag gedacht hat«).<br />
Auch die Beständigkeit einer Erinnerung sagt nichts darüber aus, ob sie real ist oder nicht. Die<br />
<strong>Gedächtnis</strong>forscher Brainerd u. Reyna (1998, 2002; Brainerd et al. 1995) verweisen darauf, dass<br />
Erinnerungen, die aus unserer eigenen Erfahrung stammen, mehr Einzelheiten aufweisen als<br />
Erinnerungen, die ihren Ursprung in unserer Fantasie haben. Erinnerungen an etwas, was wir nur<br />
419<br />
◼ Quellenamnesie oder QuellenFehlattribution<br />
(source amnesia): Man ordnet ein Ereignis oder<br />
etwas, was man erlebt, gehört, gelesen oder<br />
sich vorgestellt hat, nicht der richtigen Quelle<br />
zu. Zusammen mit dem Fehlinformationseffekt<br />
ist die Quellenamnesie der Ursprung vieler<br />
falscher Erinnerungen.<br />
Manchmal werden auch Schriftsteller und Liedermacher<br />
Opfer einer Quellenamnesie. Sie<br />
glauben, ein Gedanke käme aus ihrem eigenen<br />
kreativen Gehirn, während sie sich in Wirklichkeit<br />
eines unbeabsichtigten Plagiats schuldig<br />
machen – denn sie reproduzieren etwas, was sie<br />
früher einmal gehört oder gelesen haben.<br />
9
9<br />
420<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
. Abb. 9.27a,b. Unsere Annahmen ändern unsere<br />
Erinnerungen an die eigene Wahrnehmung<br />
Wissenschaftler zeigten Versuchspersonen vom<br />
Computer veränderte Gesichter, die zwei einander<br />
widersprechende Gefühle ausdrücken, z. B. wütend/<br />
glücklich (a). Die Versuchspersonen wurden gebeten,<br />
zu erklären, warum die Frau wütend bzw.<br />
glücklich aussieht. Diejenigen, die später gebeten<br />
worden waren, einen »wütenden« Gesichtsausdruck<br />
zu erklären (dabei mussten sie auf dem Bildschirm<br />
einen Schalter so lange verschieben, bis das<br />
dort gezeigte und simultan veränderte Bild dem<br />
entsprach, was sie zuvor gesehen hatte) erinnerten<br />
sich an ein wütenderes Gesicht, wie z. B. das in b<br />
abgebildete<br />
»Sich an etwas erinnern ist etwas anderes, als das<br />
Lesen eines Buches, es ist eher so etwas wie das<br />
Schreiben eines Buches mit Hilfe einzelner bruchstückhafter<br />
Notizen.«<br />
Der Psychologe John F. Kihlstrom (1994)<br />
a b<br />
in der Fantasie erlebt haben, beschränken sich mehr auf den eigentlichen Inhalt des Ereignisses<br />
bzw. die Bedeutung und die Gefühle, die wir damit assoziieren. Weil solche auf den reinen Inhalt<br />
beschränkten Erinnerungen stabil sind, bleiben die falschen Erinnerungen von Kindern manchmal<br />
länger bestehen als ihre echten Erinnerungen, vor allem wenn Kinder heranreifen und eher<br />
in der Lage sind, das Wesentliche zu verarbeiten (Brainerd u. Poole 1997). Und wenn Therapeuten<br />
oder Ermittlungsbeamte mehr nach dem allgemeinen Geschehen als nach Einzelheiten fragen, ist<br />
die Gefahr größer, falsche Erinnerungen zutage zu fördern.<br />
Falsche Erinnerungen, die durch die Suggestion von Fehlinformation oder durch die Fehlattribution<br />
der Quelle entstehen, mögen dem Betreffenden genau so real erscheinen wie echte Erinnerungen<br />
und auch sehr hartnäckig sein. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor: Ich lese Ihnen eine<br />
Liste mit Wörtern wie »Bonbon«, »Zucker«, »Honig« und »Geschmack« vor. Etwas später fordere<br />
ich Sie auf, die dargebotenen Wörter auf einer längeren Liste wiederzuerkennen. Wenn Sie so reagieren<br />
wie die Versuchsteilnehmer von Roediger u. McDermott (1995), dann unterlaufen Ihnen<br />
3–4 Irrtümer: Sie erinnern sich fälschlicherweise an ein ähnliches Wort, das nicht vorgelesen<br />
wurde, vielleicht das Wort »süß«. Wir erinnern uns leichter an das Wesentliche als an die Wörter<br />
selbst.<br />
Bei Experimenten mit den Aussagen von Augenzeugen fanden die Forscher des öfteren, dass<br />
jene Augenzeugen am überzeugendsten wirkten, die sich ihrer Aussage am sichersten waren und<br />
deren Antworten in sich konsistent waren; häufig sind gerade diese Zeugen jedoch nicht die präzisesten.<br />
Augenzeugen, ganz gleich, ob sie Recht oder Unrecht haben, weisen mehr oder weniger<br />
den gleichen Grad an Selbstsicherheit auf (Bothwell et al. 1987; Cutler u. Penrod 1989; Wells u.<br />
Murray 1984).<br />
Die Konstruktion von Erinnerung erklärt auch, weshalb »hypnotisch aufgefrischte« Erinnerungen<br />
an Verbrechen so häufig Fehler enthalten, von denen einige durchaus ihren Ursprung in<br />
den Fragen haben, mit denen der Hypnotiseur arbeitet (»Haben Sie laute Geräusche gehört?«). Das<br />
Phänomen der Konstruktion von Erinnerung ist auch eine Erklärung dafür, warum zwei Menschen,<br />
die sich ineinander verlieben, ihren ersten Eindruck vom anderen überschätzen (»Es war<br />
Liebe auf den ersten Blick«), während Paare, deren Beziehung zerbricht, ihre frühere Liebe eher<br />
unterschätzen (»Wir haben eigentlich nie richtig zusammengepasst«) (McFarland u. Ross 1987).<br />
Die konstruierte Erinnerung erklärt auch, warum sich Menschen auf die Frage, welche Haltung<br />
sie vor 10 Jahren gegenüber Marihuana oder bei der Diskussion über Geschlechterrollen einnahmen,<br />
an Einstellungen erinnern, die mehr Ähnlichkeit mit ihrer aktuellen Meinung aufweisen als<br />
mit der Meinung, die sie ein Jahrzehnt früher vertreten haben (Markus 1986).<br />
Ein Forscherteam befragte 73 Jungen im Alter von etwa 15 Jahren und wiederholte die Befragung<br />
35 Jahre später. Die Teilnehmer wurden gebeten, sich daran zu erinnern, was sie damals über<br />
ihre Einstellungen, Aktivitäten und Erfahrungen berichtet hatten. Die meisten reproduzierten<br />
Aussagen, deren Übereinstimmung mit ihren früheren Aussagen sich bestenfalls im Zufallsbereich<br />
bewegte. Nur ein Drittel der Männer erinnerte sich als Erwachsene an körperliche Bestrafung in<br />
Kindheit und Jugend; bei der Befragung der Jugendlichen hatten 82% von körperlicher Bestrafung<br />
gesprochen (Offer et al. 2000). Vaillant (1977, S. 197) verfolgte das Leben von Erwachsenen über<br />
© Simon Niedenthal
9.6 · Konstruktion von Erinnerung<br />
einen gewissen Zeitraum hinweg und merkte dann an: »Aus jeder Raupe wird einmal ein Schmetterling,<br />
der dann behauptet, schon in der Kindheit ein kleiner Schmetterling gewesen zu sein. Der<br />
Reifungsprozess macht uns alle zu Lügnern.«<br />
Der australische Psychologe Donald Thompson wurde auf höchst seltsame Weise mit seiner<br />
eigenen Forschung über verzerrte Erinnerungen konfrontiert: Er wurde als potenzieller Vergewaltiger<br />
verhört. Zwar entsprach sein Aussehen fast hundertprozentig der Erinnerung des Opfers an<br />
den Vergewaltiger, doch Thompson hatte ein fast wasserdichtes Alibi für die Zeit unmittelbar vor<br />
der Vergewaltigung: Er wurde im Fernsehen live interviewt. Es wäre ihm kaum möglich gewesen,<br />
rechtzeitig an den Schauplatz des Verbrechens zu gelangen. Es stellte sich dann heraus, dass die<br />
vergewaltigte Frau das Interview – Gipfel der Ironie: über das Wiedererkennen von Gesichtern –<br />
im Fernsehen gesehen hatte und Opfer einer Quellenamnesie geworden war: Sie hatte ihre Erinnerung<br />
an Thompson mit der Erinnerung an den Vergewaltiger vermischt (Schacter 1996).<br />
Fisher et al. (1987; Fisher u. Geiselman 1992) erkannten, dass es bei der Befragung von Zeugen<br />
durch Polizeibeamte und Staatsanwälte zu Fehlinformationseffekten kommt, wenn die Fragen so<br />
gestellt werden, dass sie Hinweise auf die Meinung der Polizei zu dem Vorfall enthalten. Fisher und<br />
seine Kollegen trainierten Polizeibeamte in einer Technik, die sie »kognitives Interview« nannten:<br />
weniger Suggestivfragen, dafür mehr echte Fragen. Um Abrufreize zu aktivieren, sollte der Ermittlungsbeamte<br />
den Zeugen bitten, sich die Szene noch einmal vorzustellen: Zunächst wird nach dem<br />
Wetter, der Uhrzeit, den Lichtverhältnissen, Geräuschen, Gerüchen, der Anordnung von Gegenständen<br />
und nach der Stimmung des Zeugen gefragt. Danach erzählt der Zeuge alles, woran er sich<br />
erinnert, auch scheinbar triviale Details, dabei sollte er nicht unterbrochen werden. Erst dann stellt<br />
der Ermittlungsbeamte Fragen, die in eine bestimmte Richtung gehen: »Gab es etwas Ungewöhnliches<br />
im Aussehen oder an der Bekleidung der Person?« Fisher u. Geiselman berichten, dass die<br />
Präzision der Erinnerung um etwa 50% höher ist, wenn man die Technik der kognitiven Befragung<br />
einsetzt.<br />
9.6.4 Kinder als Augenzeugen<br />
Ziel 26: Nennen Sie Argumente für und gegen die Position, dass die Berichte sehr junger Kinder über<br />
einen Missbrauch zuverlässig sind.<br />
Wir wissen, dass Erinnerungen, auch wenn sie ganz ehrlich berichtet werden, manchmal dennoch<br />
zutiefst falsch sein können. Wäre es auch denkbar, dass die Erinnerung von Kindern an sexuellen<br />
Missbrauch gleichfalls ein Irrtum sein könnte? Vielleicht müssen wir uns fragen, wer häufiger in<br />
die Rolle des Opfers gerät: missbrauchte Kinder, denen nicht geglaubt wird, oder fälschlich beschuldigte<br />
Erwachsene, deren Ruf ruiniert wird?<br />
Wie zuverlässig sind Berichte, die von Kindern abgegeben werden? Wie wir bereits gesehen<br />
haben, können Fragen, die in eine bestimmte Richtung weisen, bewirken, dass man sich falsche<br />
Erinnerungen einprägt. Wir wissen, dass Kinder, obwohl sie bei Kriminalfällen präzise Augenzeugen<br />
sein können, tendenziell leicht zu beeinflussen sind. Viele kleine Kinder haben fälschlich<br />
berichtet, dass eine Betreuerin ihr Knie abgeleckt hat, dass ein Mann ihnen »etwas Ekliges« in den<br />
Mund gesteckt hat, dass der Arzt ihnen einen Stock in die Genitalien geschoben hat und dass jemand<br />
ihre Geschlechtsteile berührt hat. Mit suggestiven Befragungstechniken können die meisten<br />
Vorschulkinder und viele ältere Kinder dazu gebracht werden, Vorfälle zu berichten, die nicht den<br />
Tatsachen entsprechen, etwa dass ein Dieb in ihrem Kindergarten Nahrungsmittel gestohlen hat<br />
(Bruck u. Ceci 1999, 2004). Befragt man jedoch Kinder in neutralen Worten, die sie verstehen,<br />
dann können sie genau berichten, was geschehen ist und wer es getan hat (Goodman et al. 1990;<br />
Howe 1997; Pipe 1996). Wenn das zuvor beschriebene kognitive Interview verwendet wird, geben<br />
selbst 4- bis 5-Jährige genauere Erinnerungen an (Holliday u. Albon 2004; Pipe et al. 2004).<br />
! Kinder sind dann besonders präzise, wenn vor dem Interview kein Erwachsener mit ihnen<br />
spricht, der in die Sache involviert ist, und wenn sie ihre Aussage in einem ersten Interview mit<br />
einem neutralen Erwachsenen machen können, dessen Fragen nicht in eine bestimmte Richtung<br />
weisen.<br />
421<br />
Erinnerungen eines Augenzeugen<br />
Erinnerungen an Vorfälle, die wir selbst miterlebt<br />
haben, sind fehleranfällig, vor allem dann, wenn die<br />
Erinnerungen durch die Art der Fragestellung in<br />
eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Auch<br />
unser relativ gutes <strong>Gedächtnis</strong> für Gesichter funktioniert<br />
nicht wie ein Fotoapparat. Das zeigt sich<br />
deutlich beim Vergleich des Fotos mit der Skizze,<br />
die die Polizei nach Zeugenaussagen von dem Mörder<br />
Theodore Kaczynski, dem »Unabomber«, anfertigte.<br />
Reuters/Rick Wilking/Archive Photos/Corbis<br />
9
9<br />
422<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
»Die Forschung bereitet mir Sorgen wegen der<br />
Möglichkeiten falscher Anschuldigungen. Man erweist<br />
der wissenschaftlichen Integrität keine Ehre,<br />
wenn man keine eindeutige Aussage trifft,<br />
obwohl die Befunde in eine Richtung deuten.«<br />
Stephen Ceci (1993)<br />
Studien über die Erinnerungen von Kindern an körperliche Untersuchungen belegen sowohl<br />
ihre Genauigkeit als auch ihre gelegentlichen Ausrutscher. Baker-Ward et al. (1993) überprüfte<br />
die Erinnerungen von Kindern mit allgemeinen Fragen (»Sag mir, was der Arzt bei der Untersuchung<br />
gemacht hat«) und spezifischen Fragen (»Hat der Arzt mit einem Licht in dein Auge<br />
geleuchtet?«). Drei bis 6 Wochen nach der Untersuchung erinnerten sich etwa 60% der 3-Jährigen<br />
und 90% der 7-Jährigen daran, was der Arzt gemacht hatte. Wenn man sie nach Dingen<br />
fragte, die nicht geschehen waren (»Hat dir der Arzt die Haare geschnitten?« und »Saß die<br />
Krankenschwester auf dir drauf?«), gaben fast 30% der 3-Jährigen und 15% der 7-Jährigen<br />
falsche Antworten.<br />
Ceci (1993) stellt fest, »dass es verheerend wäre, wenn wir die ungeheure Verbreitung des sexuellen<br />
Missbrauchs von Kindern aus den Augen verlieren würden«. Doch die Studien, die Ceci<br />
u. Bruck (1993a, 1995) durchführten, sensibilisierten sie auch dafür, wie leicht es ist, die Erinnerungen<br />
von Kindern zu beeinflussen. In einer ihrer Studien forderten sie 3-jährige Kinder auf, an<br />
einer anatomisch korrekten Puppe zu zeigen, wo der Kinderarzt sie angefasst hatte. 55% der Kinder,<br />
deren Genitalien nicht untersucht worden waren, zeigten entweder auf den Genital- oder den<br />
Analbereich.<br />
In einer anderen Studie ließen Ceci et al. (1994) ein Kind aus einem Kartenspiel, auf dessen<br />
Karten bestimmte Ereignisse beschrieben waren, eine Karte auswählen, die dem Kind dann von<br />
einem Erwachsenen vorgelesen wurde. Die Einleitung lautete: »Denk mal gut nach und sag mir,<br />
ob dir das schon mal passiert ist. Kannst du dich daran erinnern, dass du mit einer Mausefalle am<br />
Finger ins Krankenhaus gegangen bist?« Nach 10 im Wochenrythmus stattfindenden Befragungen,<br />
bei denen immer der gleiche Erwachsene die Kinder aufforderte, über verschiedene tatsächliche<br />
und fiktive Ereignisse nachzudenken, kam ein neuer Erwachsener und stellte den Kindern dieselben<br />
Fragen. Das verblüffende Ergebnis: 58% der Vorschulkinder produzierten falsch (oft lebhafte)<br />
Geschichten von einem oder mehreren Ereignissen, die sie nie erlebt hatten, wie z. B. bei diesen<br />
kleinen Jungen (Ceci et al. 1994):<br />
Mein Bruder Colin wollte mir Blowtorch (eine Spielzeugfigur) wegnehmen. Ich wollte Blowtorch aber<br />
nicht loslassen, deshalb schubste er mich in den Holzstapel, in dem die Mausefalle war. Und da kam<br />
mein Finger in die Falle. Und dann fuhren wir zum Krankenhaus, meine Mama, mein Papa, Colin und<br />
ich, wir fuhren mit unserem Kleinbus zum Krankenhaus, denn das war weit. Und der Doktor hat dann<br />
den Finger verbunden.<br />
Von Geschichten, die so viele Einzelheiten enthalten, ließen sich auch professionelle Psychologen,<br />
die sich auf die Befragung von Kindern spezialisiert haben, häufig täuschen. Sie konnten echte<br />
Erinnerungen nicht mit Sicherheit von falschen Erinnerungen unterscheiden. Die Kinder konnten<br />
das auch nicht. Als man das Kind aus dem oben angeführten Bericht darauf hinwies, dass seine<br />
Eltern ihm mehrfach gesagt hatten, diese Mausefallengeschichte sei doch gar nie passiert, sondern<br />
er hätte sie sich ausgedacht, protestierte er: »Aber es ist wirklich passiert. Ich kann mich daran<br />
erinnern.«<br />
9.6.5 Verdrängte oder konstruierte Erinnerungen an Missbrauch<br />
Ziel 27: Skizzieren Sie die Kontroverse, die durch Berichte über verdrängte und wieder aufgedeckte<br />
Erinnerungen an sexuellen Missbrauch in der Kindheit ausgelöst wurde.<br />
In der heftigen Kontroverse um das <strong>Gedächtnis</strong> unter den Psychologen in den 90er Jahren ging es<br />
um die Behauptung, dass Erinnerungen an sexuellen Missbrauch in der Kindheit verdrängt würden,<br />
später aber wieder aufgedeckt werden könnten. Im Jahre 2002 kamen solche Behauptungen<br />
bei anscheinend glaubwürdigeren Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs durch einige<br />
Priester erneut auf. Wenn ein klinischer Psychologe einen Menschen dazu verleitet, Erinnerungen<br />
an eine Missbrauchserfahrung in der Kindheit »aufzudecken«, arbeitet er dann im Dienste der<br />
Wahrheit, oder ist es möglich, dass er eine falsche Erinnerung auslöst, die einem schuldlosen Erwachsenen<br />
erheblichen Schaden zufügt?
9.6 · Konstruktion von Erinnerung<br />
Einige Therapeuten haben bei ihren Patienten folgendes Argument vorgebracht: »Menschen,<br />
die missbraucht worden sind, haben häufig die Symptome, die Sie haben. Deshalb sind Sie wahrscheinlich<br />
missbraucht worden. Wir wollen sehen, ob Sie das mit Hilfe von Hypnose oder von<br />
Medikamenten, durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit und durch die Visualisierung<br />
Ihres Traumas aufdecken können.« In einer landesweiten Umfrage in den USA schätzte der<br />
durchschnittliche Therapeut, dass etwa 11% der Bevölkerung – also etwa 34 Mio. Menschen –<br />
verdrängte Erinnerungen an sexuellen Missbrauch in sich tragen (Kamena 1998). Poole et al.<br />
(1995) berichten über britische und amerikanische Therapeuten, von denen 70% sagten, sie<br />
hätten Techniken wie Hypnose oder Drogen eingesetzt, um ihre Klienten dabei zu unterstützen,<br />
verdrängte Erinnerungen an einen möglichen sexuellen Missbrauch in der Kindheit ans Licht zu<br />
bringen.<br />
Dank der Forschung über Quellenamnesie und Fehlinformationseffekte wissen wir, dass solche<br />
Techniken bei vielen Patienten bewirken, dass sie tatsächlich das Bild einer Person sehen, von<br />
der sie bedroht werden. Bei fortgesetzter Visualisierung wird dieses Bild immer deutlicher und<br />
versetzt den Patienten in einen Zustand der Betäubung und der Wut, in dem er bereit ist, die betreffende<br />
Person, häufig ein Elternteil, ein Verwandter oder ein Mitglied des Klerus, damit zu<br />
konfrontieren oder vor Gericht zu bringen. Dort weist dann der angebliche Missetäter, wie der<br />
Therapeut vorhergesagt hat, die Beschuldigung aufs Heftigste zurück. Eine Frau erinnerte sich in<br />
ihrer 32. Therapiesitzung daran, dass ihr Vater sie im Alter von 15 Monaten missbraucht hätte.<br />
Nach einem solchen von außen gestützten Abruf aus dem <strong>Gedächtnis</strong> behauptete die Schauspielerin<br />
Roseanne Barr (1991), sie habe Erinnerungen an sexuellen Missbrauch zu Beginn der Säuglingszeit<br />
aufgedeckt.<br />
Ohne die professionelle Vorgehensweise der meisten Therapeuten in Frage zu stellen, vergleichen<br />
Skeptiker die nicht bestätigten Beschuldigungen, die von einigen Therapeuten in den 90er<br />
Jahren vorgebracht wurden, mit einem Neuaufleben der Hexenprozesse. Klinische Psychologen,<br />
die Techniken zur »<strong>Gedächtnis</strong>arbeit« wie »geführte Imagination«, Hypnose oder Traumdeutung<br />
einsetzen, um Erinnerungen aufzudecken, fügen nach Loftus et al. (1995) dem gesamten Bereich<br />
der Psychologie großen Schaden zu. Aufgebrachte klinische Psychologen entgegnen darauf, dass<br />
die, die wiedergefundene Erinnerungen an Missbrauch in Frage stellen, ihrerseits das Trauma der<br />
Missbrauchten verstärken und das Spiel der Täter mitmachen.<br />
In dem Bemühen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, von dem aus diese ideologische<br />
Schlacht zu einem Ende gebracht werden könnte, wurden Untersuchungsausschüsse eingerichtet.<br />
Und eine Reihe psychologischer und psychiatrischer Berufsverbände, darunter auch die American<br />
Psychological Association, veröffentlichten eine gemeinsame Verlautbarung. Die, die mit dem<br />
Schutz der missbrauchten Kinder betraut sind, und die, die mit der Verteidigung der fälschlich<br />
angeklagten Erwachsenen betraut sind, stimmen in folgenden Punkten überein:<br />
4 Ungerechtigkeit ist eine Realität. Schuldlose Menschen wurden zu Unrecht verurteilt. Schuldige<br />
entzogen sich der Verantwortung, indem sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Ankläger<br />
säten.<br />
4 Inzest und andere Fälle sexuellen Missbrauchs sind eine Realität. Inzest kommt häufiger<br />
vor, als wir früher angenommen haben. Es gibt kein typisches Syndrom bei dem, der so etwas<br />
durchgemacht hat (Kendall-Tacket et al. 1993). Sexueller Missbrauch kann jedoch bei den<br />
Opfern eine Prädisposition für Probleme schaffen, die von sexueller Dysfunktion bis zur Depression<br />
reichen.<br />
4 Vergessen ist eine Realität. Viele der Missbrauchten waren entweder sehr jung, als sie missbraucht<br />
wurden, oder sie haben vielleicht die Bedeutung dessen, was sie erlebt haben, nicht<br />
verstanden: Unter solchen Umständen ist Vergessen »sehr verbreitet«. Es gehört zur Normalität<br />
unseres Alltags, ein einmaliges Ereignis zu vergessen, ganz gleich, ob es negativ oder positiv<br />
war.<br />
4 Wieder aufgedeckte Erinnerungen sind nicht ungewöhnlich. Mit einer Bemerkung oder<br />
einem Ereignis, die als Auslöser dienen, wecken wir Erinnerungen an längst vergessene Ereignisse,<br />
ganz gleich, ob diese angenehm oder unangenehm waren. Worüber man streiten kann,<br />
ist die Frage, ob das Unbewusste manchmal schmerzhafte Erfahrungen gewaltsam verdrängt,<br />
und falls das stimmt, ob solche Erfahrungen dann durch bestimmte therapeutische Techniken<br />
der Erinnerung wieder zugänglich gemacht werden können.<br />
423<br />
9
9<br />
424<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
»Wenn Erinnerungen nach einer langen Zeit der<br />
Amnesie ›aufgedeckt‹ werden, vor allem wenn<br />
außergewöhnliche Mittel eingesetzt werden, um<br />
die Aufdeckung der Erinnerung sicherzustellen,<br />
dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die<br />
Erinnerungen falsch sind.«<br />
Royal College of Psychiatrists Working Group<br />
on Reported Recovery of Child Sexual Abuse<br />
(Brandon et al. 1998)<br />
Obwohl sich einige Traumatherapeuten über<br />
Elizabeth Loftus lustig gemacht hatten, wurde<br />
sie zur Präsidentin der American Psychological<br />
Society gewählt, bekam den höchst dotierten<br />
Preis in der Psychologie (200.000 Dollar) und<br />
wurde Mitglied der U.S. National Academy of<br />
Sciences und der Royal Society of Edinburgh.<br />
4 Erinnerungen, die unter Hypnose oder unter Drogeneinfluss »wieder aufgedeckt« werden,<br />
sind besonders wenig verlässlich. Versuchsteilnehmer, die in eine Altersregression hypnotisiert<br />
werden, nehmen Suggestionen in ihre Erinnerungen auf, sogar Erinnerungen an »frühere<br />
Leben.«<br />
4 Erinnerungen aus den ersten 3 Lebensjahren sind ebenfalls nicht verlässlich. Die Menschen<br />
erinnern sich eigentlich nicht an Geschehnisse aus den ersten 3 Lebensjahren. Es handelt sich<br />
hier um ein Phänomen, das infantile Amnesie genannt wird. Deshalb sind die meisten Psychologen<br />
skeptisch gegenüber »wieder aufgedeckten« Erinnerungen an einen Missbrauch in der<br />
frühen Kindheit (Gore-Felton et al. 2000; Knapp u. Vande Creek 2000). Je älter ein Kind ist,<br />
wenn es Opfer von sexuellem Missbrauch wird, und je schwerwiegender der Missbrauch war,<br />
desto wahrscheinlicher ist es, dass er erinnert wird (Goldman et al. 2003).<br />
4 Erinnerungen, ob richtig oder falsch, können emotional aufwühlen. Wird eine falsche Erinnerung<br />
an einen Missbrauch zu einem realen Bestandteil der persönlichen Geschichte eines<br />
Menschen, dann leiden beide, der Ankläger und der Angeklagte. Was sich ursprünglich aus<br />
einer reinen Suggestion entwickelte, kann wie ein echtes Trauma zu einer schmerzenden Erinnerung<br />
werden, die zu körperlichem Stress führen kann (McNally 2003). Menschen, die bei<br />
einem Unfall, an dessen Hergang sie sich nicht erinnern können, bewusstlos werden, entwickeln<br />
manchmal später eine Posttraumatische Belastungsstörung, wenn sie von Erinnerungen<br />
verfolgt werden, die aus Fotos, Zeitungsberichten und den Aussagen von Freunden konstruiert<br />
werden (Bryant 2001).<br />
Um dem Phänomen der mit therapeutischer Hilfe geweckten Erinnerungen näher zu kommen,<br />
führten Loftus et al. (1996) Experimente durch, bei denen dem <strong>Gedächtnis</strong> falsche Erinnerungen<br />
an Kindheitstraumata »eingepflanzt« wurden. In einer dieser Studien ließen sie ein Familienmitglied,<br />
das sie ins Vertrauen gezogen hatten, einem Teenager Erinnerungen an drei echte und einen<br />
erfundenen Vorfall erzählen, nämlich einen sehr lebendigen Bericht darüber, wie das Kind im<br />
Alter von 5 Jahren relativ lange in einem Einkaufszentrum verloren gegangen und von einer älteren<br />
Person gerettet worden war. Einige Tage später konnten sich einige Teilnehmer sehr lebhaft und<br />
mit zahlreichen Einzelheiten an das »Erlebnis« erinnern und konnten es kaum glauben, als man<br />
sie darüber aufklärte, dass der Vorfall nie stattgefunden hatte. In anderen Experimenten kam ein<br />
Drittel der Versuchsteilnehmer fälschlicherweise zu der Überzeugung, dass sie als Kind fast ertrunken<br />
wären; und die Hälfte war zu der falschen Erinnerung an eine schreckliche Erfahrung<br />
verleitet worden, wie etwa an einen brutalen Angriff durch ein Tier (Heaps u. Nash, 2001; Porter<br />
et al. 1999).<br />
Und so verhält es sich mit dem Prozess der <strong>Gedächtnis</strong>konstruktion, durch den Menschen sich<br />
daran erinnern können, von einem UFO entführt worden zu sein, Opfer eines satanischen Kults<br />
gewesen zu sein, in der Wiege belästigt worden zu sein oder in einem vergangenen Leben gelebt<br />
zu haben. Tausende von ganz normalen Menschen, merkt Loftus an, »reden in einer von Schrecken<br />
ergriffenen Stimme über ihre Erfahrung an Bord von fliegenden Untertassen. Sie erinnern sich<br />
klar und deutlich daran, von Aliens entführt worden zu sein.« (Loftus u. Ketcham 1994, S. 66).<br />
Elizabeth Loftus kennt das Phänomen, das sie untersucht, aus persönlicher Erfahrung. Bei<br />
einem Familientreffen erzählte ihr ein Onkel, sie hätte mit 14 Jahren die Leiche ihrer ertrunkenen<br />
Mutter gefunden. Schockiert wies sie diese Vorstellung zurück. Doch der Onkel blieb bei seiner<br />
Behauptung, und in den folgenden 3 Tagen begann sie, sich zu fragen, ob sie vielleicht die Erinnerung<br />
verdrängt hätte: »Vielleicht bin ich deshalb so besessen von diesem Thema.« Als die nun sehr<br />
verstörte Elizabeth über das nachdachte, was ihr Onkel da gesagt hatte, »entdeckte« sie in ihrem<br />
<strong>Gedächtnis</strong> ein Bild, auf dem ihre Mutter mit dem Gesicht nach unten im Swimmingpool lag, und<br />
sie sah, wie sie selbst die Leiche fand. »Ich begann, jedes Teilchen an die richtige Stelle zu rücken.<br />
Vielleicht, dachte ich, bin ich deshalb so ein Workaholic. Vielleicht reagiere ich deshalb immer so<br />
emotional, wenn ich an meine Mutter denke, obwohl sie 1959 starb.«<br />
Dann rief ihr Bruder an und sagte, das sei alles falsch. Ihr Onkel erinnerte sich nun – und<br />
andere Verwandte bestätigten es –, dass nicht sie, sondern ihre Tante die Leiche gefunden hatte<br />
(Loftus u. Ketcham 1994; Monaghan 1992).<br />
Aber Elizabeth Loftus kennt auch die Realität von sexuellem Missbrauch aus eigener Erfahrung:<br />
Als 6-Jährige wurde sie von einem männlichen Babysitter belästigt, und sie hat dies nicht
9.6 · Konstruktion von Erinnerung<br />
vergessen. Und das macht sie argwöhnisch gegenüber denjenigen, bei denen sie sieht, wie echter<br />
Missbrauch dadurch trivialisiert wird, dass nach unbestätigten traumatischen Erfahrungen gesucht<br />
wird, die dann kritiklos als Tatsache akzeptiert werden. Loftus ist deshalb der Meinung, dass<br />
die eigentlichen Feinde der echten Opfer nicht nur die sind, die das Opfer sexuell ausbeuten und<br />
das dann leugnen, sondern die, deren Veröffentlichungen und unbewiesene Beschuldigungen<br />
»zwangsläufig dazu führen, dass die Gesellschaft mit immer größerer Wahrscheinlichkeit den<br />
tatsächlichen Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Unglauben begegnet, obwohl<br />
diese Opfer doch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdient haben« (Loftus 1993).<br />
Finden Verdrängung oder bedrohliche Erinnerungen also tatsächlich statt, oder ist dieses<br />
Konzept, das den Eckstein von Freuds Theorie darstellt und in der Populärpsychologie so beliebt<br />
ist, ein Weg, der in die Irre führt? In 7 Kap. 18 werden wir uns noch einmal mit diesem stark umstrittenen<br />
Thema beschäftigen und werden Folgendes erkennen: Die meistverbreitete Reaktion auf<br />
eine traumatische Erfahrung (Zeuge für den Mord an den Eltern zu sein, die Schrecken eines KZs<br />
zu erleben, von einem Flugzeugentführer oder von einem Vergewaltiger terrorisiert zu werden,<br />
einem der in sich zusammenfallenden Türme des World Trade Center zu entkommen, einen Tsunami<br />
in Asien zu überleben) ist nicht die Verbannung der Erfahrung ins Unbewusste. Vielmehr<br />
werden die Erfahrungen typischerweise ins Bewusstsein geätzt als lebendige, dauerhafte, ergreifende<br />
Erinnerungen. Der Dramatiker Eugene O’Neill verstand dies. Einer seiner Charaktere in<br />
seinem »Seltsamen Zwischenspiel« (1928) rief aus: »Der Teufel! ... Was sind das für bestialische<br />
Vorfälle, bei denen unsere Erinnerungen darauf bestehen, dass wir sie festhalten!«<br />
Lernziele Abschnitt 9.6<br />
Konstruktion von Erinnerung<br />
Ziel 23: Erklären Sie, wie Fehlinformationen und Imagination unsere Erinnerung<br />
an ein Ereignis verzerren können.<br />
Erinnerungen werden nicht als exakte Kopien unserer Erfahrungen gespeichert<br />
und abgerufen. Es ist eher so, dass wir unsere Erinnerungen<br />
konstruieren und dabei sowohl die gespeicherten Informationen als<br />
auch neue Informationen verwenden. Liefert man Kinder oder Erwachsene<br />
subtilen Fehlinformationen aus, stellen sie sich wiederholt ein Ereignis<br />
vor, das nie stattgefunden hat. Sie können dann diese irreführenden<br />
Einzelheiten in ihre Erinnerung dessen, was tatsächlich vorgefallen<br />
ist, aufnehmen. Die Erinnerung lässt sich am besten verstehen, wenn<br />
man sie nicht nur als kognitives und biologisches Phänomen begreift,<br />
sondern auch als soziokulturelles (. Abb. 9.28).<br />
Ziel 24: Stellen Sie dar, welche Rolle die Quellenamnesie bei falschen Erinnerungen<br />
spielt.<br />
Wenn wir Erinnerungen verarbeiten, enkodieren und speichern wir diverse<br />
ihrer Aspekte an unterschiedlichen Orten im Gehirn. Während wir<br />
eine Erinnerung beim Abruf wieder zusammensetzen, können wir mit<br />
Erfolg etwas abrufen, was wir gehört, gelesen oder uns vorgestellt haben,<br />
es aber der falschen Quelle zuordnen. Quellenamnesie ist eine der<br />
beiden Hauptkomponenten falscher Erinnerungen (der andere ist der<br />
Fehlinformationseffekt).<br />
Ziel 25: Listen Sie einige Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen echten<br />
und falschen Erinnerungen auf.<br />
Subjektiv ähneln falsche Erinnerungen wahren Erinnerungen und sind<br />
ebenso dauerhaft; deswegen sind weder Aufrichtigkeit noch Langlebigkeit<br />
einer Erinnerung ein Hinweis darauf, ob sie der Wirklichkeit ent<br />
6<br />
425<br />
»Der Schrecken durchzuckt das <strong>Gedächtnis</strong> und<br />
hinterlässt zehrende Erinnerungen an Gräueltaten.«<br />
Robert Kraft, »Memory Perceived: Recalling the<br />
Holocaust« (2002)<br />
. Abb. 9.28. Analyseniveaus bei der Untersuchung des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />
Wie andere psychologische Phänomene lässt sich das <strong>Gedächtnis</strong> am besten<br />
auf einem biologischen, einem psychologischen und auf einem soziokulturellen<br />
Niveau untersuchen<br />
9
9<br />
426<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
spricht. Echte Erinnerungen enthalten mehr Einzelheiten als die, die lediglich<br />
in unserer Vorstellung existieren. Letztere beschränken sich in<br />
der Regel nur auf den Kern eines Ereignisses – die Bedeutung und die<br />
Gefühle, die damit assoziiert werden.<br />
Ziel 26: Nennen Sie Argumente für und gegen die Position, dass die Berichte<br />
sehr junger Kinder über einen Missbrauch zuverlässig sind.<br />
Ein Argument dafür: Selbst sehr junge Kinder können sich genau an Ereignisse<br />
(und die Menschen, die damit zu tun hatten) erinnern, wenn<br />
eine neutrale Person mit ihnen in Worten redet, die sie verstehen können,<br />
keine Suggestivfragen stellt und die kognitive Interviewmethode<br />
einsetzt. Ein Argument dagegen: Vorschulkinder sind anfälliger für Suggestionen<br />
als ältere Kinder und Erwachsene; und man kann bei ihnen<br />
durch Suggestivfragen Einfluss darauf nehmen, dass sie über Ereignisse<br />
berichten, die gar nicht stattgefunden haben.<br />
Ziel 27: Skizzieren Sie die Kontroverse, die durch Berichte über verdrängte<br />
und wieder aufgedeckte Erinnerungen an sexuellen Missbrauch in der Kindheit<br />
ausgelöst wurde.<br />
Psychologen, die missbrauchte Kinder und falsch beschuldigte Erwachsene<br />
schützen wollen, stimmen gewöhnlich in 7 Punkten überein:<br />
1. Unschuldige Menschen sind fälschlicherweise für einen Missbrauch,<br />
der nie stattgefunden hat, verurteilt worden, und Personen, die wirklich<br />
9.7 <strong>Gedächtnis</strong>training<br />
einen Missbrauch begangen haben, haben die Kontroverse über aufgedeckte<br />
Erinnerungen dazu genutzt, einer Bestrafung zu entgehen.<br />
2. Inzest und Missbrauch kommen vor, und sie können bleibende Verletzungen<br />
hinterlassen. 3. Es kommt im Alltag bei uns allen vor, dass wir<br />
isolierte Ereignisse aus der Vergangenheit vergessen, ob sie nun gut<br />
oder schlecht sind. 4. Wir alle decken gute und schlechte Erinnerungen<br />
auf, die durch irgendeinen Hinweisreiz aus dem <strong>Gedächtnis</strong> ausgelöst<br />
werden, aber die <strong>Gedächtnis</strong>forscher zweifeln daran, ob wir in Freuds<br />
Sinn gewaltsam Erinnerungen verdrängen, um Angst oder Schmerzen<br />
zu vermeiden. 5. Erinnerungen, die unter dem Einfluss von Hypnose<br />
oder Medikamenten hochkommen, sind unzuverlässig. 6. Die infantile<br />
Amnesie – die Unfähigkeit, Erinnerungen an die ersten 3 Lebensjahre<br />
abzurufen – lässt die Aufdeckung von Erinnerungen an die sehr frühe<br />
Kindheit unwahrscheinlich werden. 7. Sowohl wirklichkeitsgetreue als<br />
auch falsche Erinnerungen verursachen Leiden und können zu Belastungsstörungen<br />
führen.<br />
> Denken Sie weiter: Könnten Sie als unparteiischer Geschworener<br />
an einer Gerichtsverhandlung in einem Fall teilnehmen, bei dem ein<br />
Elternteil wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt ist, wenn sich die<br />
Anklage auf eine aufgedeckte Erinnerung stützt oder wenn gegen<br />
einen Therapeuten verhandelt wird, der vor Gericht steht, weil er<br />
falsche Erinnerungen erzeugt hat?<br />
Ziel 28: Erklären Sie, wie Sie zu einer effektiveren Lerntechnik kommen können, wenn Sie das <strong>Gedächtnis</strong><br />
besser verstehen.<br />
Wir wollen dieses Kapitel rekapitulieren und dabei darauf achten, wie wir die <strong>Gedächtnis</strong>prinzipien<br />
anwenden könnten. Was können wir tun, damit wir uns in alltäglichen Situationen besser<br />
an Namen erinnern? Wie könnten wir uns die Lerninhalte dieses Kapitels besser merken?<br />
Immer wieder einmal erschrecken wir über unsere Vergesslichkeit, die peinliche Situation,<br />
wenn wir uns nicht an den Namen unseres Gesprächspartners erinnern können, wenn wir vergessen,<br />
was wir in einem Gespräch sagen wollten, wenn wir uns in einem Raum wiederfinden<br />
und nicht mehr wissen, was wir da wollten (Herrmann 1982). Können wir etwas tun, um derartige<br />
<strong>Gedächtnis</strong>ausfälle seltener werden zu lassen? Wie die Biologie der Medizin nützt und die<br />
Botanik der Landwirtschaft, so kann auch die <strong>Gedächtnis</strong>psychologie bei Bildung und Lernen von<br />
Nutzen sein. Über das ganze Kapitel verstreut – und hier zur leichteren Verwendung zusammengefasst<br />
– finden Sie Vorschläge, wie Sie Ihre <strong>Gedächtnis</strong>leistung verbessern können. Die im Abschnitt<br />
»Erfolgreich lernen« (7 S. XIII) vorgestellte Lerntechnik mit dem Kürzel SQ3R (Survey,<br />
Question, Read, Rehearse) – Überblick verschaffen, Fragen stellen, lesen, wiederholen – beinhaltet<br />
mehrere dieser Strategien.<br />
4 Wiederholtes Lernen verankert den Lernstoff besser. Neuen Stoff sollten Sie mehrmals<br />
lernen. Um sich einen Namen zu merken, sprechen Sie ihn innerlich nach, nachdem Sie vorgestellt<br />
wurden. Warten Sie ein paar Sekunden und wiederholen Sie ihn für sich selbst; warten<br />
Sie etwas länger, und wiederholen Sie ihn noch einmal. Um einen Begriff zu lernen, sollten Sie<br />
sich viele einzelne Lernsitzungen gönnen: Nutzen Sie dazu die kleinen Intervalle, die das Leben<br />
Ihnen bietet, eine Fahrt mit dem Bus, ein Gang über das Universitätsgelände oder die Wartezeit<br />
bis zur nächsten Vorlesung.<br />
4 Wenden Sie mehr Zeit für die Wiederholung des Gelernten auf oder denken Sie darüber<br />
nach. Neue Erinnerungen sind schwach: Wenn Sie sie einüben, werden Sie sie festigen.
9.7 · <strong>Gedächtnis</strong>training<br />
Rasches Durchlesen (Überfliegen) von komplexem Material führt zu geringer Behaltensleistung.<br />
Wiederholen und kritisches Nachdenken sind eher hilfreich. Es zahlt sich aus,<br />
aktiv zu lernen!<br />
4 Stellen Sie einen persönlichen Bezug zum Gelernten her. Um ein Assoziationsnetz aufzubauen,<br />
sollten Sie mit eigenen Worten eine Rohfassung des Textes und Ihrer Vorlesungsnotizen<br />
erstellen. Beantworten Sie die Fragen im Abschnitt »Denken Sie weiter«. Automatisches Wiederholen<br />
der Wörter eines anderen ist relativ wirkungslos. Besser ist es, ein Bild zu entwickeln,<br />
eine Information zu verstehen und einzuordnen, sie in Bezug zu bereits Gelerntem oder zu<br />
einer eigenen Erfahrung zu setzen und sie dann in eigene Worte zu fassen.<br />
4 Benutzen Sie Mnemotechniken, um sich an Listen mit unbekannten Begriffen zu erinnern.<br />
Assoziieren Sie die Begriffe mit »Aufhängern«. Machen Sie aus den Wörtern eine Geschichte,<br />
in der sie lebendig werden. Verwenden Sie Chunks aus Akronymen.<br />
4 Frischen Sie Ihr <strong>Gedächtnis</strong> auf, indem Sie Abrufhilfen aktivieren. Stellen Sie sich vor, wie<br />
die Situation und Ihre Stimmung waren, als Sie den Lernstoff durchgearbeitet haben. Gehen<br />
Sie wieder in den gleichen Raum. Betreiben Sie Gehirnjogging, indem Sie jeden Gedanken<br />
zum Auslöser für einen weiteren werden lassen.<br />
4 Reproduzieren Sie die Erinnerung an ein Ereignis, ehe Sie möglicherweise in Kontakt mit<br />
Fehlinformationen kommen. Sollten Sie Zeuge eines wichtigen Ereignisses oder Vorfalls<br />
werden, dann speichern Sie Ihre Erinnerung, bevor andere Menschen Ihnen etwa erklären,<br />
was da passiert ist.<br />
4 Achten Sie darauf, Interferenzen nach Möglichkeit zu vermeiden. Lernen Sie vor dem ins<br />
Bettgehen. Lernen Sie nicht direkt nacheinander zwei Dinge, die miteinander interferieren<br />
könnten, etwa spanische und französische Vokabeln.<br />
4 Testen Sie Ihr Wissen. Erstens ist ein Test eine gute Wiederholung dessen, was Sie gelernt<br />
haben, zweitens zeigt er Ihnen, was Sie noch nicht wissen. Wenn Sie zu einem späteren<br />
Zeitpunkt Informationen reproduzieren müssen, sollten Sie sich nicht von übergroßem<br />
Vertrauen in Ihre Fähigkeit, die Information wiederzuerkennen, beruhigen lassen. Testen<br />
Sie lieber mit Hilfe der Lernziele, woran Sie sich erinnern. Definieren Sie Fachbegriffe und<br />
Konzepte auf einem leeren Blatt Papier. Denken Sie über die Konzepte nach, die in den<br />
einzelnen Kapiteln dieses Buches eingeführt werden, und geben Sie eine kurze Definition,<br />
ehe Sie zum Text zurückgehen und die Definition nachlesen. Machen Sie auch die Tests auf<br />
der <strong>Web</strong>site, die begleitend zu diesem Lehrbuch unter www.lehrbuch-psychologie.de angeboten<br />
wird.<br />
Ohne Selbsttest könnten Sie leicht in die Gefahr geraten, zu sehr auf Ihre Fähigkeiten zu setzen.<br />
Shaughnessy u. Zechmeister (1992) stellten das in einem Experiment mit 2 Gruppen von Studierenden<br />
fest. Die Mitglieder der »Mehrfachleser-Gruppe« lasen mehrmals Dutzende von<br />
faktischen Aussagen, sollten dann die Wahrscheinlichkeit beurteilen, mit der sie jede Aussage<br />
erinnern würden und mussten am Ende in einem Test nachweisen, woran sie sich tatsächlich<br />
erinnerten. Die Studierenden dieser Gruppe waren sich ihres Wissens ziemlich sicher, sogar bei<br />
den Fragen, die sie dann nicht beantworten konnten. Die Mitglieder der »Praxistest-Gruppe«<br />
lasen gleichfalls die Aussagen, doch verbrachten sie die restliche Zeit damit, Tests zu beantworten,<br />
bei denen sie die Fakten aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen mussten. Beim Abschlusstest schnitt<br />
die »Praxistest-Gruppe« genauso gut ab wie die »Mehrfachleser-Gruppe«, doch konnten die<br />
Studierenden der »Praxistest-Gruppe« deutlicher unterscheiden, was sie wussten und was nicht.<br />
Es ist offensichtlich, dass ein Selbsttest das Erinnerungsvermögen fördert und aufzeigt, was man<br />
weiß und wo die Wissenslücken liegen. Das kann Ihnen helfen, sich während Ihrer Lernsitzungen<br />
auf diese Lücken zu konzentrieren. Der frühere britische Premierminister Benjamin Disraeli<br />
sagte einmal: »Die Erkenntnis, dass man nichts weiß, ist ein großer Schritt auf dem Weg zum<br />
Wissen.«<br />
427<br />
»Ich habe herausgefunden, dass es einigen Nutzen<br />
bringt, nachts im Bett zu liegen und in die<br />
Dunkelheit zu blicken und dabei im Geist das zu<br />
wiederholen, womit man sich beschäftigt hat.<br />
Dann versteht man die Dinge nicht nur besser,<br />
sondern erinnert sich auch leichter daran.«<br />
Leonardo da Vinci (1452–1519)<br />
»Verwebe alles Neue mit bereits Erworbenem.«<br />
William James (»Principles of Psychology«, 1890)<br />
Denken und <strong>Gedächtnis</strong><br />
Das meiste, was wir wissen, ist nicht das Ergebnis<br />
der Mühen, sich etwas einzuprägen. Wir lernen, weil<br />
wir neugierig sind und weil wir Zeit damit verbringen,<br />
über unsere Erfahrungen nachzudenken. Die<br />
besten Behaltenseffekte erzielt man, wenn man<br />
aktiv beim Lesen nachdenkt, wenn man wiederholt<br />
und die Gedanken zueinander in Bezug setzt<br />
9<br />
M. Barton
9<br />
428<br />
Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />
Lernziel Abschnitt 9.7<br />
<strong>Gedächtnis</strong>training<br />
Ziel 28: Erklären Sie, wie Sie zu einer effektiveren Lerntechnik kommen können,<br />
wenn Sie das <strong>Gedächtnis</strong> besser verstehen.<br />
Die <strong>Gedächtnis</strong>psychologie bietet konkrete Strategien zur Verbesserung<br />
des <strong>Gedächtnis</strong>ses an. Dazu gehören die Einplanung zeitlicher<br />
Abstände zwischen den einzelnen Arbeitssitzungen, aktives Wiederholen<br />
des Lernstoffs, Hilfe beim Enkodieren von geordneten, bildlichen<br />
Assoziationen mit persönlicher Bedeutung, Verwendung von Mnemotechniken,<br />
Einbeziehen des ursprünglichen Lernkontexts und der Stim<br />
Antworten zu den Fragen im Text<br />
mung – beides reich an Assoziationen –, Speicherung von Erinnerungen,<br />
ehe sie durch Fehlinformationen verändert werden können, nach Möglichkeit<br />
Ausschalten von Interferenzen, Durchführung von Selbsttests<br />
zur Wiederholung der Informationen und Auffinden von <strong>Gedächtnis</strong>lücken.<br />
> Denken Sie weiter: Welche der hier vorgeschlagenen Lern und<br />
<strong>Gedächtnis</strong>strategien wäre bei Ihnen am effektivsten?<br />
9.1 Vielleicht haben Sie ein paar von den 7 Vs nicht gefunden. Das lag möglicherweise daran, dass Sie den Satz zunächst eher<br />
akustisch als visuell verarbeitet und dabei einige Vs übersehen haben, die eher wie ein F klingen.<br />
9.2 Ein MultipleChoiceTest erfasst die Fähigkeit zum Wiedererkennen, Lückentexte testen die Fähigkeit zur Reproduktion.<br />
9.3 Die letzte Centmünze in der zweiten Zeile ist die richtige.<br />
Prüfen Sie Ihr Wissen<br />
1. Zum <strong>Gedächtnis</strong> gehören in alphabetischer Reihenfolge Arbeits/Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis und<br />
sensorisches <strong>Gedächtnis</strong>. Welches ist die korrekte Reihenfolge dieser 3 <strong>Gedächtnis</strong>speicher?<br />
2. Was wäre die effektivste Strategie, um eine Liste von Namen mit den wichtigsten historischen Personen innerhalb<br />
einer Woche zu lernen? Und innerhalb eines Jahres?<br />
3. Ihre Freundin erzählt Ihnen, dass ihr Vater bei einem Unfall eine Hirnschädigung erlitten hat. Sie fragt sich, ob die<br />
Psychologie eine Erklärung dafür hat, dass er sehr gut Dame spielen kann, es ihm aber schwer fällt, eine vernünftige<br />
Unterhaltung zu führen.<br />
4. Was ist Priming?<br />
5. Können Sie ein Beispiel für proaktive Interferenz anführen?<br />
6. Wie könnte das Leben aussehen, wenn wir all unsere Erlebnisse im Wachzustand und all unsere Träume erinnerten<br />
(Denken Sie dabei auch an das häufige Auftreten der Quellenamnesie)?<br />
7. Welche der <strong>Gedächtnis</strong>strategie, über die Sie gerade gelesen haben, könnten Sie anderen empfehlen? (Eine bestand<br />
in dem Rat, die Lerninhalte, an die man sich erinnern soll, zu wiederholen. Wie lauteten die anderen?)<br />
L Deutsche Literatur zum Thema<br />
Markowitsch, H. J. (1999). <strong>Gedächtnis</strong>störungen. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Roth, G. (1996). Das Gehirn und seine Wirklichkeit, 2. Aufl. Frankfurt: Suhrkamp.<br />
Sacks, O. (1990). Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Reinbek: Rowohlt.<br />
Schacter, D. L. (2002). Wir sind Erinnerung, <strong>Gedächtnis</strong> und Persönlichkeit. Reinbek: Rowohlt.<br />
Schermer, F. J. (2002). Lernen und <strong>Gedächtnis</strong>. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Solso, R. L. (2005). Kognitive Psychologie. Heidelberg: Springer.