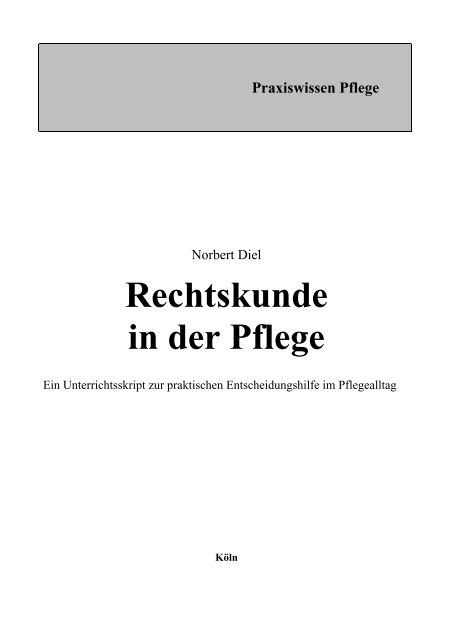Norbert Diel Rechtskunde in der Pflege - Herzlich Willkommen zur ...
Norbert Diel Rechtskunde in der Pflege - Herzlich Willkommen zur ...
Norbert Diel Rechtskunde in der Pflege - Herzlich Willkommen zur ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong><br />
Praxiswissen <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Rechtskunde</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong><br />
E<strong>in</strong> Unterrichtsskript <strong>zur</strong> praktischen Entscheidungshilfe im <strong>Pflege</strong>alltag<br />
_<br />
Köln
<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong><br />
- praktische Entscheidungshilfe im <strong>Pflege</strong>alltag -<br />
von<br />
<strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong><br />
Rechtsanwalt<br />
14. Auflage 2011<br />
Köln
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 3 von 180<br />
Vorwort<br />
Das vorliegende Skript stellt die gängigen rechtlichen Probleme <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong> dar und zeigt dem Leser<br />
konkrete Lösungsmöglichkeiten auf.<br />
Es dient mehreren Zwecken. Zum e<strong>in</strong>en richtet es sich an die Praktiker <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege, <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>krankenpflege und <strong>der</strong> Altenpflege, an<strong>der</strong>erseits an die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler <strong>in</strong> diesen<br />
Berufen. In diesem S<strong>in</strong>ne behandelt es die wichtigsten Rechtsprobleme im <strong>Pflege</strong>alltag ebenso wie<br />
den klassischen Prüfungsstoff <strong>in</strong> diesen Bereichen. Den Schülern soll es Leitfaden bei <strong>der</strong> Examensvorbereitung<br />
se<strong>in</strong>, dem Praktiker e<strong>in</strong> Nachschlagewerk für den Alltag. Was auf den ersten<br />
Blick wie e<strong>in</strong> Spagat kl<strong>in</strong>gt, liegt <strong>in</strong> Wirklichkeit eng beie<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Denn die Rechtsfragen stellen<br />
sich e<strong>in</strong>heitlich dem Schüler genauso wie dem Berufserfahrenen. Insoweit ist es angezeigt, diese<br />
e<strong>in</strong>heitlich zu erörtern.<br />
Um die Übersichtlichkeit zu wahren und die Darstellung möglichst e<strong>in</strong>fach halten zu können, habe<br />
ich mich für e<strong>in</strong>e Skriptdarstellung entschieden, die sowohl Prüfungsschema, als auch ausformulierten<br />
Text be<strong>in</strong>haltet. Wer dieses Skript durcharbeitet, braucht se<strong>in</strong>e Inhalte nicht auswendig zu lernen.<br />
Son<strong>der</strong>n er kann sich darauf beschränken, die dargestellten Rechtsprobleme durch bloßes logisches<br />
Denken zu lösen. Dazu wird es angehalten und es s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e ausgefeilten juristischen Kenntnisse<br />
erfor<strong>der</strong>lich, son<strong>der</strong>n es genügt e<strong>in</strong> ausgeprägtes Judiz, wie es jedem Menschen <strong>in</strong>ne wohnt.<br />
Der <strong>Pflege</strong>beruf ist längst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wissensgesellschaft angekommen. E<strong>in</strong>er Gesellschaft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> laufend<br />
und <strong>in</strong> immer kürzerer Zeit neues Wissen produziert werden muss, weil vorhandenes so<br />
schnell verfällt. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das mit <strong>der</strong> Ausbildung Erlernte im Gegensatz<br />
zu früheren Zeiten nicht mehr e<strong>in</strong> ganzes Berufsleben lang reicht und auch nicht mehr<br />
durch die im Verlaufe <strong>der</strong> Zeit erworbene Berufspraxis auf dem aktuellen Stand gehalten werden<br />
kann. Zukünftig müssen Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe über e<strong>in</strong>e fachliche und persönliche Kompetenz<br />
verfügen, die es ihnen ermöglicht, aufbauend auf ihren fachlichen Qualifikationen mit e<strong>in</strong>em<br />
generalistischen Verständnis an die verschiedenen Lebenssituationen ihres beruflichen Alltags heranzugehen.<br />
Der Berufsalltag for<strong>der</strong>t demgemäß e<strong>in</strong>e Persönlichkeitsstruktur, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, alle<br />
Situationen mit dem Erlernten zu beherrschen und bestehende Wissenslücken mit fachlichmethodischer<br />
Herangehensweise zu schließen. Dies setzt den aktiven und permanent Lernwilligen<br />
Mitarbeiter voraus, <strong>der</strong> stets bemüht ist, se<strong>in</strong>e Handlungskompetenzen zu erweitern. Auch die Mentalität<br />
<strong>der</strong> Auszubildenden wird sich verän<strong>der</strong>n. Der Arbeitnehmer, <strong>der</strong> pflichtbewusst und rout<strong>in</strong>iert<br />
se<strong>in</strong>en Geschäften nachgeht, wird ersetzt durch den mitdenkenden Manager, <strong>der</strong> sich auf allen Ebenen<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>praxis <strong>zur</strong>echt f<strong>in</strong>det. Es kann von daher nicht schaden, schon früh mit dem „Denkenden<br />
Lernen“ zu beg<strong>in</strong>nen.<br />
Was bedeutet dies für die juristische Ausbildung und Schulung von Angehörigen <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe ?<br />
Sicher ist jedenfalls, dass <strong>der</strong> bisherige Unterrichtstypus <strong>der</strong> Gesetzeskunde, <strong>der</strong> auf das Auswendiglernen<br />
von Gesetzes<strong>in</strong>halten und rechtlichen Dogmen fixiert war und damit eher S<strong>in</strong>gulärwissen<br />
produzierte, als überholt gilt.<br />
Denn dies hatte dazu geführt, dass die (angehende) <strong>Pflege</strong>kraft nur mit wenig S<strong>in</strong>n und Verstand für<br />
das Ganze e<strong>in</strong>fach nur auswendig gelernt hatte, was erlaubt und was verboten ist. Sie war <strong>in</strong>folge<br />
dessen häufig nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage, die rechtlichen Gegebenheiten <strong>der</strong> verschiedenen Lebenssituationen<br />
ihres beruflichen Alltags zu erkennen, zu beurteilen und selbständig zu entscheiden, wie sie<br />
sich richtig zu verhalten hatten. Sie konnten dies auch nicht, weil sie das rechtskundige Denken<br />
nicht gelernt hatten.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 4 von 180<br />
Das heutige Verständnis geht daher folgerichtig dazu über, juristische Zusammenhänge als Denkprozesse<br />
zu vermitteln, die Hilfe <strong>in</strong> allen Entscheidungssituationen geben und dadurch Handlungssicherheit<br />
vermitteln. Insoweit wird die <strong>Rechtskunde</strong>, wie die juristische Ausbildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege<br />
zutreffen<strong>der</strong> genannt werden sollte, die Eigenverantwortlichkeit und Selbstreflektion <strong>der</strong><br />
Krankenpflegeschüler klarer schulen.<br />
Dazu soll das Skript e<strong>in</strong>e Hilfe se<strong>in</strong>. Viel Freude beim Lesen!<br />
Anregungen s<strong>in</strong>d je<strong>der</strong>zeit willkommen: ra@norbert-diel.de<br />
Köln, den 20. März 2011
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 5 von 180<br />
Inhaltsübersicht<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.14: Zivil- und strafrechtliche Aspekte für Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe................................................. 13<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.17: Als Ersthelfer<strong>in</strong> <strong>in</strong> Notfall- und Katastrophensituation handeln (Teilsequenz) .................................. 27<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.29: Die <strong>Pflege</strong>bedürftigen aufnehmen, verlegen und entlassen................................................................. 35<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.34: Psychisch bee<strong>in</strong>trächtigte und verwirrte Menschen pflegen ............................................................... 51<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.38: Sterbehilfe und Strafrecht (e<strong>in</strong>schl. Patientenverfügung / Behandlungsabbruch) ............................... 59<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.15: Die zivilrechtliche Haftung des <strong>Pflege</strong>personals ............................................................................. 107<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.16: Arbeitsrechtliche Grundlagen .......................................................................................................... 124<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.26: Sexualdelikte und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ................................................................ 152<br />
Lerne<strong>in</strong>heit IV.b 11: Infektionsschutz .......................................................................................................................... 168
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 6 von 180<br />
Gesamtcurriculum <strong>Rechtskunde</strong><br />
- geglie<strong>der</strong>t nach den Gesamt<strong>in</strong>halten -<br />
Quelle: Ausbildungsrichtl<strong>in</strong>ie für die staatlich anerkannten Kranken- und K<strong>in</strong><strong>der</strong>krankenpflegeschulen <strong>in</strong> NRW<br />
Herausgeber: M<strong>in</strong>isterium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Lernbereich I: <strong>Pflege</strong>rische Kernaufgaben Juristische Inhalte:<br />
Nr. Inhalt Std. Inhalt<br />
2 Std. Grundlagen des Rechts, Vermittlung methodischer Kenntnisse,<br />
Unterschied zwischen Rechtsquellen, Rechtsgebieten, Zivilrecht, Strafrecht, Verschulden<br />
und Tatbestand<br />
I.1 Haut und Körper pflegen (mit I.23), (mit II.6)<br />
I.2 Mund und Zähne pflegen (mit I.23)<br />
I.3 Sich bewegen (mitI.23), (mit II.6)<br />
I.4 Sehen und Hören<br />
I.5 Essen und Tr<strong>in</strong>ken 2 Std. Ziele des deutschen Lebensmittelrechts und dessen Überwachung,<br />
Verordnungen zu/r Kennzeichnung von Lebensmitteln, Zualssung von Zusatzstoffen,<br />
diätischen Lebensmitteln, Nährwertangaben, Schadstoffbelastung<br />
I.6 Ausscheiden<br />
I.7 Atmen<br />
I.8 Wach se<strong>in</strong> und Schlafen<br />
I.9 Hygienisch arbeiten (Teilsequenz)<br />
I.10 Vitalzeichen kontrollieren<br />
I.11 Medikamente verabreichen 2 Std. Das Arzneimittelgesetz <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Bedeutung für den Umgang mit Medikamenten:<br />
Begriffsbestimmung „Arzneimittel“, E<strong>in</strong>teilung <strong>der</strong> Arzneimittel, Grundsätze zum<br />
Herstellen und Inverkehrbr<strong>in</strong>gen von Arzneimitteln, Informationen zu Arzneimitteln<br />
I.12 Injizieren<br />
I.13 Bei <strong>der</strong> Wundbehandlung assistieren<br />
I.14 Bei <strong>der</strong> Infusionstherapie assistieren<br />
I.15 Bei <strong>der</strong> Transfusionstherapie assistieren 0,5 Std. Grundlagen des Transfusionsrechts<br />
I.16 Bei Diagnose- und Therapieverfahren assistieren<br />
I.17 Als Ersthelfer<strong>in</strong> <strong>in</strong> Notfall- und Katastrophensituation handeln (Teilsequenz) 4 Std. Rechtliche (und Ethische) Aspekte <strong>zur</strong> Ersten Hilfe: Verpflichtung <strong>zur</strong> Hilfeleistung,<br />
rechtliche Konsequenten bei unterlassener o<strong>der</strong> fehlerhafter Hilfeleistung<br />
I.18 Beim Schock handeln
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 7 von 180<br />
I.19 Gespräche führen<br />
I.20 Beraten und anleiten<br />
I.21 Gespräche mit <strong>Pflege</strong>bedürftigen und Angehörigen führen<br />
I.22 Gespräche mit KollegInnen und Vorgesetzten führen<br />
I.23 Zu pflege<strong>in</strong>haltlichen Fragen beraten und anleiten<br />
I.24 <strong>Pflege</strong> planen und dokumentieren (Teilsequenz) 2 Std. S<strong>in</strong>n und Zweck <strong>der</strong> Dokumentation bzw. juristische Konsequenzen bei unterlassener<br />
o<strong>der</strong> fehlerhafter Dokumentation<br />
I.25 <strong>Pflege</strong> nach e<strong>in</strong>em System organisieren<br />
I.26 <strong>Pflege</strong> nach e<strong>in</strong>em Standard planen<br />
I.27 Mit an<strong>der</strong>en Berufsgruppen zusammenarbeiten<br />
I.28 Besprechungen und Visiten durchführen<br />
I.29 Die <strong>Pflege</strong>bedürftigen aufnehmen, verlegen und entlassen 2 Std. Vertragsrecht: Abschluss des Krankenhausaufnahmevertrages, des ärztlichen und<br />
pflegerischen Vertrages,<br />
Beendigung <strong>der</strong> Verträge<br />
I.30 Schwangere und Wöchner<strong>in</strong>nen pflegen<br />
I.31 Neugeborene K<strong>in</strong><strong>der</strong> und kranke K<strong>in</strong><strong>der</strong> pflegen 1 Std. K<strong>in</strong>desmisshandlung und rechtliche Bestimmungen bei K<strong>in</strong>desmissbrauch<br />
Rechtsfolgen <strong>der</strong> Geburt und des Todes,<br />
Meldepflichten<br />
I.32 Fieberkranken Menschen pflegen<br />
I.33 Schmerzbelastete Menschen pflegen 2 Std. Zentrale Aussagen des Betäubungsmittelgesetzes,<br />
Überwachung <strong>der</strong> gesetzlichen Bestimmungen,<br />
Konsequenzen für pflegerisches Handeln<br />
I.34 Psychisch bee<strong>in</strong>trächtigte und verwirrte Menschen pflegen 2 Std. Bundesrechtliche Bestimmungen <strong>zur</strong> Betreuung psychisch Kranker,<br />
Landesrechtliche Bestimmungen zum Schutz psychisch Kranker,<br />
Beendigung <strong>der</strong> Behandlung bei Sterbenden, die unter Betreuung stehen<br />
I.35 Chronisch kranke Menschen pflegen<br />
I.36 Tumorkranke Menschen pflegen<br />
I.37 Menschen nach Unfällen pflegen<br />
I.38 Sterbende Menschen pflegen 6 Std. Begriffsbestimmung(en) „Tod“ aus rechtlicher Sicht,<br />
Sterbehilfe, Sterbehilfe durch Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe,<br />
Zur beson<strong>der</strong>en Problematik <strong>der</strong> Tötung auf Verlangen, <strong>der</strong> Tötung Kranker gegen<br />
ihren Willen sowie <strong>der</strong> Tötung Kranker, von denen ke<strong>in</strong>e Willensäußerung vorliegt,<br />
PatientInnenverfügungen,<br />
Rechtliche Regelungen zum Thema „Testament“
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 8 von 180<br />
Lernbereich II: Ausbildungs- und Berufssituation von <strong>Pflege</strong>nden Juristische Inhalte:<br />
Nr. Inhalt Std. Inhalt<br />
II.1 Rechtliche Regelung <strong>der</strong> Ausbildung Rechtliche Vorgaben zu Ausbildungszielen, -<strong>in</strong>halten und -struktur,<br />
Ausbildungsvertrag, Rechte und Pflichten <strong>der</strong> Auszubildenden bzw. Ausbildenden,<br />
Rechtsgrundlagen zum Examen und Prüfungsmodalitäten seitens <strong>der</strong> Ausbildungsstätte<br />
II.2 Lernen und Lerntechniken<br />
II.3 Soziales Lernen<br />
II.4 E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die praktischen Ausbildungse<strong>in</strong>sätze<br />
II.5 Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> praktischen Ausbildung<br />
II.6 Persönliche Grun<strong>der</strong>haltung<br />
II.7 Grundfragen und Modelle beruflichen <strong>Pflege</strong>ns<br />
II.8 Geschichte <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe<br />
II.9 <strong>Pflege</strong>n als Beruf<br />
II.10 <strong>Pflege</strong> als Wissenschaft<br />
II.11 Ethische Herausfor<strong>der</strong>ungen für Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe<br />
II.12 EDV <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong><br />
II.13 Qualitätssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong><br />
II.14 Zivil- und strafrechtliche Aspekte für Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe 6 Std. (Grundlagen des Rechts werden als eigenständiger Block zu Beg<strong>in</strong>n des Blocks<br />
behandelt [Begriffsbestimmungen, Rechtsquellen, Rechtsgebiete, Zivilrecht, Strafrecht,<br />
Verschulden, Tatbestand]),<br />
Welche <strong>Pflege</strong>handlungen können zivil-/strafrechtliche Konsequenzen haben ? (u.a.<br />
Körperverletzung),<br />
Schweigepflicht: Bedeutung des § 203 StGB für die Angehörigen <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe,<br />
Freiheitsentziehung: Bedeutung des Grundrechts auf „Unverletzlichkeit <strong>der</strong> Freiheit<br />
<strong>der</strong> Person“ e<strong>in</strong>erseits und <strong>der</strong> Freiheitsentziehung im S<strong>in</strong>ne des Betreuungsrechts<br />
an<strong>der</strong>erseits für das pflegerische Handeln<br />
II.15 Haftungsrechtliche Aspekte für Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe 8 Std. Die auf Vertrag o<strong>der</strong> Delikt beruhende Schadensersatzhaftung des <strong>Pflege</strong>personals,<br />
Beson<strong>der</strong>heiten <strong>zur</strong> strafrechtlichen Haftung: Straftatbestände, Rechtswidrigkeit und<br />
Rechtfertigung, Schuld, Schuldfähigkeit und Strafmündigkeit<br />
Haftungs- und arbeitsrechtliche Zusammenhänge: Haftung wegen Nichterfüllung<br />
o<strong>der</strong> Schlechtleistung, Haftungse<strong>in</strong>schränkungen, arbeitsrechtliche Konsequenzen,<br />
die sich aus Straftatbeständen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schadensersatzhaftung ergeben können,<br />
Die beson<strong>der</strong>e rechtliche Problematik <strong>der</strong> „Delegation“<br />
II.16 Arbeitsrechtliche Grundlagen 8 Std. Der Arbeitsvertrag,<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen (z.B. allgeme<strong>in</strong>e Pflichten, Schweigepflicht, Geschenke),<br />
Die Arbeitszeit,<br />
Die Vergütung,
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 9 von 180<br />
Urlaub, Arbeitsbefreiung,<br />
Beendigung des Arbeitsverhältnisses,<br />
Geltungsbereich e<strong>in</strong>es Tarifvertrages<br />
II.17 Betriebliche ArbeitnehmerInnenvertretung Wahl und Zusammensetzung <strong>der</strong> ArbeitnehmerInnenvertretung, Mitbestimmung und<br />
Mitwirkung <strong>der</strong> ArbeitnehmerInnenvertretung im Betrieb, Vertretung von Auszubildenden,<br />
Aktivitäten <strong>der</strong> ArbeitnehmerInnenvertretung an <strong>der</strong> Ausbildungsstätte<br />
II.18 Betrieblicher Arbeitsschutz - Betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung Bereiche, die durch Arbeitsschutzgesetze geregelt werden,<br />
Institutionen und rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzsystems <strong>in</strong> Deutschland,<br />
Arbeitsschutz und Berufskrankheiten,<br />
gesetzliche Grundlagen <strong>der</strong> betrieblichen Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
II.19 Unfallverhütung 1 Std. Allgeme<strong>in</strong>e Unfallverhütungsvorschriften,<br />
Umgang mit gefährlichen Stoffen: Rechtsgrundlagen und Handlungsanleitungen<br />
II.20 Dienstplangestaltung 1 Std. Die Arbeitszeitverordnung<br />
Arbeitszeitregelungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong><br />
II.21 Macht und Hierarchie<br />
II.22 Gewalt<br />
II.23 Helfen und Hilflos se<strong>in</strong><br />
II.24 Angst und Wut<br />
II.25 Ekel und Scham<br />
II.26 Sexuelle Belästigung 2 Std. Sexualdelikte<br />
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und rechtliche Möglichkeiten, sich <strong>zur</strong> Wehr<br />
zu setzen
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 10 von 180<br />
Lernbereich III: Zielgruppen, Institutionen und Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
pflegerischer Arbeit Juristische Inhalte:<br />
Nr. Inhalt Std. Inhalt<br />
III.1 K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche<br />
III.2 Alte Menschen<br />
III.3 Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen<br />
III.4 Menschen aus fremden Kulturen<br />
III.5 „Arme“ und „reiche“ Menschen 0,5 Std. Grundlagen des Bundessozialhilfegesetzes<br />
III.6 PatientInnen und „BewohnerInnen“ stationärer E<strong>in</strong>richtungen<br />
III.7 <strong>Pflege</strong>bedürftige und ihre Angehörigen im ambulanten Bereich<br />
III.8 Institutionen des Gesundheitswesens<br />
III.9 Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Prävention<br />
III.10 Das deutsche Sozial- und Gesundheitssystem<br />
III.11 Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat („Staatsbürgerkunde“)<br />
III.12 Ökologische Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
III.13 Wirtschaftliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 11 von 180<br />
Lernbereich IVa: Gesundheits- und Krankenpflege bei bestimmten PatientInnengruppen<br />
Juristische Inhalte:<br />
Nr. Inhalt Std. Inhalt<br />
IVa.1 <strong>Pflege</strong> psychisch kranker und/o<strong>der</strong> abhängiger PatientInnen 2 Std. rechtliche Grundlagen <strong>der</strong> Fixierung und Zwangsmaßnahmen<br />
IVa.2 <strong>Pflege</strong> herzkranker PatientInnen<br />
IVa.3 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen o<strong>der</strong> Erkrankungen des Kreislaufs<br />
IVa.4 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen o<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkungen <strong>der</strong> Beweglichkeit<br />
IVa.5 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen des zentralen Nervensystems<br />
IVa.6 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Atemstörungen o<strong>der</strong> Erkrankungen <strong>der</strong> Atemorgane 2 Std. Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Bundesseuchengesetzes<br />
IVa.7 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen o<strong>der</strong> Erkrankungen des Ernährungs- und Verdauungssystems<br />
IVa.8 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Leber-, Gallen-, Pankreas- sowie Stoffwechselerkrankungen<br />
IVa.9 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen <strong>der</strong> hormonellen Regulationsfunktion<br />
IVa.10 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Ur<strong>in</strong>ausscheidungsstörungen<br />
IVa.11 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen <strong>der</strong> Sexualfunktionen o<strong>der</strong> Erkrankungen <strong>der</strong> Genitalorgane<br />
IVa.12 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen <strong>der</strong> Immunreaktion<br />
IVa.13 <strong>Pflege</strong> von PatientInnen mit Störungen <strong>der</strong> Blutbildung und -ger<strong>in</strong>nung<br />
IVa.14 <strong>Pflege</strong> hautkranker PatientInnen<br />
IVa.15 <strong>Pflege</strong> seh- und hörerkrankter PatientInnen<br />
2 Std. Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Gesetzes <strong>zur</strong> Bekämpfung<br />
<strong>der</strong> Geschlechtskrankheiten
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 12 von 180<br />
Lernbereich IVb: Gesundheits- und K<strong>in</strong><strong>der</strong>krankenpflege bei bestimmten<br />
PatientInnengruppen Juristische Inhalte:<br />
Nr. Inhalt Std. Inhalt<br />
IVb.1 <strong>Pflege</strong> von Neu- und Frühgeborenen 0,5 Std. Meldepflichten bei Neugeborenen<br />
IVb.2 <strong>Pflege</strong> herzkranker K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
IVb.3 <strong>Pflege</strong> psychisch kranker und/o<strong>der</strong> abhängiger K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlicher 2 Std. rechtliche Grundlagen <strong>zur</strong> Fixierung und Zwangsmaßnahmen,<br />
IVb.4 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Störungen o<strong>der</strong> Erkrankungen des zentralen Nervensystems<br />
IVb.5 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Störungen o<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkungen <strong>der</strong> Beweglichkeit<br />
IVb.6 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Atemstörungen o<strong>der</strong> Erkrankungen <strong>der</strong> Atemorgane 2 Std. Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Bundesseuchengesetzes,<br />
IVb.7 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Ernährungs-, Verdauungs- und Stoffwechselstörungen bzw. -<br />
erkrankungen<br />
IVb.8 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Leber-, Gallen-, Pankreaserkrankungen<br />
IVb.9 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Störungen <strong>der</strong> hormonellen Regulationsfunktion<br />
IVb.10 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Ur<strong>in</strong>ausscheidungsstörungen<br />
IVb.11 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Störungen <strong>der</strong> Geschlechtsentwicklung o<strong>der</strong> Erkrankungen im Urigenitalbereich<br />
IVb.12 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen mit Störungen <strong>der</strong> Immunreaktion<br />
IVb.13 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Störungen <strong>der</strong> Blutbildung und -ger<strong>in</strong>nung<br />
IVb.14 <strong>Pflege</strong> hautkranker K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
IVb.15 <strong>Pflege</strong> seh- und hörerkrankter K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
IVb.16 <strong>Pflege</strong> <strong>in</strong>fektionskranker K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
IVb.17 <strong>Pflege</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Verbrennungen und Verbrühungen<br />
2 Std. Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Gesetzes <strong>zur</strong> Bekämpfung<br />
<strong>der</strong> Geschlechtskrankheiten,
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 13 von 180<br />
Lernziele:<br />
II. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.14:<br />
Zivil- und strafrechtliche Aspekte für Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe<br />
- Zeitdauer: 6 Std. -<br />
Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden:<br />
Grundlagen des Rechts: Begriffsbestimmungen, Rechtsquellen, Rechtsgebiete, Zivilrecht, Strafrecht, Verschulden,<br />
Tatbestand,<br />
Welche <strong>Pflege</strong>handlungen können zivil-/strafrechtliche Konsequenzen haben ? (u.a. Körperverletzung),<br />
Schweigepflicht: Bedeutung des § 203 StGB für die Angehörigen <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe,<br />
Freiheitsentziehung: Bedeutung des Grundrechts auf „Unverletzlichkeit <strong>der</strong> Freiheit <strong>der</strong> Person“ e<strong>in</strong>erseits und <strong>der</strong><br />
Freiheitsentziehung im S<strong>in</strong>ne des Betreuungsrechts an<strong>der</strong>erseits für das pflegerische Handeln<br />
A. Allgeme<strong>in</strong>e Grundlagen des Rechts<br />
Fallbeispiel Sie werden entwe<strong>der</strong> im Fernsehen o<strong>der</strong> bei Bekannten folgende Situation so o<strong>der</strong><br />
ähnlich e<strong>in</strong>mal erlebt haben:<br />
A. Unterrichtsziel<br />
<strong>der</strong> <strong>Rechtskunde</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Altenpflege<br />
Der klägerische Anwalt befragt im Zivilprozeß e<strong>in</strong>en Zeugen. Er<br />
läßt ihn e<strong>in</strong>e bestimmte Situation schil<strong>der</strong>n. Am Ende bedankt sich<br />
<strong>der</strong> Anwalt beim Zeugen und erklärt dem Gericht, <strong>der</strong> Zeuge haben<br />
mit se<strong>in</strong>er Aussage die klägerische Position vollumfänglich gestützt.<br />
Der Klage sei damit stattzugeben und <strong>der</strong> Prozeß gewonnen. Der<br />
Richter nickt wohlwollend. Daraufh<strong>in</strong> erwi<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Gegenanwalt<br />
unter Bezugnahme auf e<strong>in</strong>e bis dah<strong>in</strong> völlig unbekannte Vorschrift,<br />
die er für alle Beteiligten und auch für das Gericht überraschend<br />
aus dem „Hut“ zaubert, dass <strong>der</strong> Zeuge mit se<strong>in</strong>er Aussage nolens<br />
volens die Klage <strong>in</strong> Grund und Bogen geredet habe.<br />
Nach kurzer Beratung weist das Gericht die Klage tatsächlich ab.<br />
Der Anwalt <strong>der</strong> Gegenseite und <strong>der</strong> Beklagte frohlocken. Der Kläger<br />
versteht die Welt nicht mehr. Denn <strong>der</strong> Zeuge hat alles wahrheitsgemäß<br />
geschil<strong>der</strong>t und es sah doch so gut aus. Er protestiert und<br />
wirft dem Richter Parte<strong>in</strong>ahme vor.<br />
Fälle wie dieser ereignen sich <strong>in</strong> Deutschland täglich zu Hun<strong>der</strong>ten. Nicht ohne<br />
Grund gilt im Volksmund: „Vor Gericht und auf hoher See ist man <strong>in</strong> Gottes<br />
Hand“. Sche<strong>in</strong>bar klare Fälle kippen <strong>in</strong> letzter M<strong>in</strong>ute und ausgekochte Anwälte<br />
argumentieren mit überraschenden gesetzlichen Regelungen und übervorteilen<br />
sche<strong>in</strong>bar jeden - den Gegner, das Gericht und manchmal auch den Mandanten.<br />
Nicht zuletzt deswegen wird dem Juristischen vielfach mangelnde Berechenbarkeit<br />
nachgesagt. Es ist nicht selten, daß sich die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Prozeß unterlegene Partei ungerecht<br />
behandelt fühlt. Beson<strong>der</strong>s deutlich wird dies <strong>in</strong> Strafprozessen, wenn Täter<br />
freigesprochen o<strong>der</strong> milde bestraft werden. Auch hier hört man häufig den<br />
Spruch: „Recht haben und Recht bekommen s<strong>in</strong>d zweierlei.<br />
Was bedeutet dies für den „<strong>Rechtskunde</strong>unterricht ?<br />
Der Unterricht soll verdeutlichen, daß die Jurisprudenz ke<strong>in</strong>e Geheimwissenschaft<br />
ist, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> Denkvorgang, <strong>der</strong> streng logischen und klaren Strukturen<br />
folgt, die für je<strong>der</strong>mann nachvollziehbar s<strong>in</strong>d.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 14 von 180<br />
B. Unterrichtsmethode<br />
C. Juristische<br />
Unterrichts<strong>in</strong>halte<br />
D. Was ist<br />
<strong>Rechtskunde</strong> ?<br />
Denn das juristische Denken befähigt den Anwen<strong>der</strong> zu erkennen, unter welchen<br />
Voraussetzungen menschliches Verhalten <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em jeweiligen sozialen Kontext<br />
(Lebensbereich) rechtlich zulässig bzw. verboten ist.<br />
Dazu muß man wissen, wie man sich <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Alltagssituationen zu verhalten<br />
hat. Die <strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altenpflege greift hierzu die wichtigsten Lebensbereiche<br />
im <strong>Pflege</strong>alltag heraus und analysiert anhand von Gesetz und Rechtsprechung<br />
typische Verhaltensmuster, denen das <strong>Pflege</strong>personal täglich ausgesetzt<br />
ist. Diese Verhaltensmuster folgen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel aus typischen Konfliktsituationen<br />
im Umgang mit dem ärztlichen Personal sowie den Patienten.<br />
Mittelfristiges Ziel des <strong>Rechtskunde</strong>unterrichtes ist die Vermittlung<br />
e<strong>in</strong>es juristischen Verhaltens- und Entscheidungsmusters, mit dessen<br />
Hilfe sich Konflikte im pflegerischen Berufsalltag entschärfen<br />
und im Idealfall vermeiden lassen.<br />
Die Verhaltensmuster werden <strong>in</strong> Form juristischer Prüfungsschemata dargestellt.<br />
Sie sollen dem <strong>Pflege</strong>personal als argumentative Entscheidungshilfe dienen,<br />
um mit konkreten Konfliktsituationen <strong>zur</strong>echt zu kommen.<br />
Aus pädagogischen Gründen werden die Lehrgangsteilnehmer h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong><br />
bei den Prüfschemata zu verwendenden Argumente aus <strong>der</strong> anwaltlichen Sichtweise<br />
an die <strong>Rechtskunde</strong> herangeführt. Dadurch läßt sich die trockene Materie lebendiger<br />
vermitteln. Soweit erfor<strong>der</strong>lich, wird auf die Methoden richterlicher<br />
Entscheidungs-/ Urteilsf<strong>in</strong>dung <strong>zur</strong>ückgegriffen.<br />
In <strong>der</strong> Krankenpflege bestimmen folgende Rechtsgebiete das Entscheidungsverhalten<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> täglichen Berufspraxis und damit auch die Unterrichts<strong>in</strong>halte:<br />
- das allgeme<strong>in</strong>e Vertragsrecht (bei <strong>der</strong> Aufnahme und Entlassung des Patienten),<br />
- das (ärztliche und pflegerische) Haftungsrecht (hierbei ist die Frage entscheidend,<br />
wer für se<strong>in</strong>e eigenen und die Fehler an<strong>der</strong>er aufkommen muß),<br />
- das Schadensersatzrecht (dies wird relevant bei Schmerzensgeldansprüchen<br />
des Patienten gegenüber dem Krankenhaus und dem Arzt),<br />
- das Arbeitsrecht (bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung und Entlassung des <strong>Pflege</strong>personals),<br />
- das Strafrecht (bei <strong>der</strong> Behandlung und <strong>Pflege</strong> <strong>der</strong> Patienten),<br />
- die sog. juristischen Nebengebiete (wie etwa das Arzneimittel- o<strong>der</strong> Lebensmittelrecht),<br />
Die Unterrichtsziele und -<strong>in</strong>halte def<strong>in</strong>ieren im Weiteren den <strong>Rechtskunde</strong>unterricht<br />
wie folgt:<br />
Def<strong>in</strong>ition: <strong>Rechtskunde</strong> vermittelt den Inbegriff <strong>der</strong> Regeln (= Gebote, Verbote,<br />
Gewährungen), nach denen das <strong>Pflege</strong>personal se<strong>in</strong> Verhalten<br />
ausrichtet und an denen es sich verb<strong>in</strong>dlich messen lässt.<br />
Def<strong>in</strong>ition: Im vorstehenden S<strong>in</strong>ne kann juristische Verhaltenslehre als Summe<br />
von Prüfschemata (= Verhaltensschemata) verstanden werden,<br />
mit denen man Lebenssituationen <strong>in</strong> ihrem sozialen Kontext<br />
beurteilen und feststellen kann, ob man sich richtig verhalten hat.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 15 von 180<br />
E. Praktischer<br />
Ansatz:<br />
Wie muß man sich das praktisch vorstellen ?<br />
Die sozialen Lebenssituationen werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> juristischen Sprache <strong>der</strong> Lebenssachverhalt<br />
genannt. E<strong>in</strong> typischer Lebenssachverhalt ist etwa <strong>der</strong>, dass e<strong>in</strong> Arzt e<strong>in</strong>e OP macht<br />
und dabei vergisst, dem Patienten die Schere aus dem Bauch zu entnehmen. O<strong>der</strong>: Die<br />
Krankenschwester schließt e<strong>in</strong>en ihr missliebigen Patienten auf <strong>der</strong> Toilette e<strong>in</strong>, um ihn<br />
zu bestrafen. O<strong>der</strong>: Dem Oberarzt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gynäkologie soll gekündigt werden, weil er im<br />
Krankenhaus e<strong>in</strong>es katholischen Trägers e<strong>in</strong>e gutgehende Abtreibungspraxis führt.<br />
Hieran schließt sich stets die Frage an, ob das Verhalten erlaubt war und welche<br />
rechtlichen Konsequenzen (= Rechtsfolgen) sich daraus ergeben. Etwa:<br />
- Gegen welche Vorschriften hat <strong>der</strong> Arzt möglicherweise verstoßen, als er die<br />
Schere im Bauch vergaß und welche Ansprüche kann <strong>der</strong> Patient gegen Arzt<br />
geltend machen ?<br />
- Muß die Krankenschwester möglicherweise mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen<br />
(etwa mit e<strong>in</strong>er Abmahnung o<strong>der</strong> gar mit <strong>der</strong> fristlosen Kündigung) rechnen,<br />
weil sie den missliebigen Patienten auf <strong>der</strong> Toilette e<strong>in</strong>geschlossen hatte ?<br />
- Wie kann <strong>der</strong> katholische Krankenhausträger dem Oberarzt möglichst schnell<br />
se<strong>in</strong>e Abtreibungspraxis untersagen und ihn ggf. fristlos kündigen ?<br />
Alle vorstehenden Fragen resultieren immer aus e<strong>in</strong>er bestimmten Interessenlage<br />
<strong>der</strong> Betroffenen. Beispielsweise werden Ihnen im ersten Fall (Schere im Bauch)<br />
möglicherweise die an <strong>der</strong> OP beteiligten Kollegen den Sachverhalt schil<strong>der</strong>n, weil<br />
sie das Verhalten des Arztes bemängeln und möglicherweise gerichtliche Schritte<br />
des Patienten gegen den Arzt o<strong>der</strong> sich selbst fürchten.<br />
Es geht also im Zivilrecht schlicht um die Frage: Wer will was von wem woraus ?<br />
Ihre Vorgehensweise:<br />
Was macht<br />
das Prüfungsschema:<br />
Damit s<strong>in</strong>d wir mitten im juristischen Denken. Ihre Aufgabe sollte<br />
es nunmehr se<strong>in</strong>, sich das entsprechende Prüfungsschema herauszusuchen,<br />
das die mit <strong>der</strong> konkreten Frage angesprochene Lebenssituation<br />
(= den Sachverhalt) treffsicher erfasst und regelt.<br />
In unserem Fall werden Sie sich die Prüfungsschemata <strong>zur</strong> ärztlichen/pflegerischen<br />
Haftung und zum Schadensersatz heraussuchen.<br />
=> Das Prüfungsschema ist also Ihre Entscheidungshilfe und<br />
zwar nichts an<strong>der</strong>es als e<strong>in</strong>e Checkliste, mit <strong>der</strong> Sie beurteilen<br />
können, ob <strong>der</strong> Patient gegen den Arzt o<strong>der</strong> die OP-Hilfe<br />
Schadensersatzansprüche geltend machen kann.<br />
Im Weiteren stellt sich nunmehr die Frage, wie das Prüfungsschema<br />
(die Checkliste) den entsprechenden Lebenssachverhalt regelt ?<br />
Das Prüfungsschema greift sich hierzu aus den für den Sachverhalt<br />
e<strong>in</strong>schlägigen Gesetzen verschiedenste Paragraphen heraus und<br />
ordnet sie nach e<strong>in</strong>er bestimmten gedanklichen Reihenfolge. Hierdurch<br />
werden die <strong>in</strong> den Paragraphen enthaltenen Ge- und Verbote<br />
also nach e<strong>in</strong>em bestimmten Ordnungs- und Gerechtigkeitsmuster<br />
ane<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gereiht. In <strong>der</strong> Zusammenschau ergibt sich daraus<br />
e<strong>in</strong>e Verhaltensanleitung für den Lebenssachverhalt.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 16 von 180<br />
Problem:<br />
Unübersichtliche<br />
Gesetze<br />
und abstrakteFormulierungen<br />
Die Prüfschemata (Checklisten) greifen aber noch weitere Probleme<br />
auf:<br />
Problem:<br />
Häufig wird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von juristischen Laien bemängelt, dass<br />
die Gesetze und ihre Paragraphen trotz e<strong>in</strong>er gewissen thematischen<br />
Glie<strong>der</strong>ung unübersichtlich seien. Insbeson<strong>der</strong>e zeichne es<br />
pfiffige Rechtsanwälte aus, dass sie - wie im E<strong>in</strong>gangs geschil<strong>der</strong>ten<br />
Fall - aus „irgende<strong>in</strong>er Ecke“ e<strong>in</strong>e Regelung hervorzitierten,<br />
die e<strong>in</strong>en Fall „urplötzlich zum Kippen“ brächten.<br />
Lösung:<br />
Hierzu ist zu bemerken, dass Gesetze und Paragraphen e<strong>in</strong>e Unzahl<br />
von Lebenssachverhalten erfassen und regeln müssen. Sie<br />
würden schlicht zu unübersichtlich, wenn man die Gesetze gezielt<br />
auf bestimmte Lebenssachverhalte ausrichten würde. Es ist e<strong>in</strong>facher,<br />
Gesetze thematisch zu strukturieren (z.B. geordnet nach e<strong>in</strong>em<br />
Allgeme<strong>in</strong>en Teil o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em sachenrechtlichen Teil) und den<br />
Prüfungsschemata die Aufgabe zu überlassen, sich zu je<strong>der</strong> juristisch<br />
streitbaren Situation die richtigen Paragraphen problemlösungsorientiert<br />
aus allen Ecken des Gesetzes „zusammen zu suchen“<br />
und dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e klare Reihenfolge zu br<strong>in</strong>gen. Nur wer diese<br />
Reihenfolge nicht kennt, für den sche<strong>in</strong>en Gesetze e<strong>in</strong> unübersichtlicher<br />
Dschungel zu se<strong>in</strong>.<br />
________________________________________________<br />
Problem:<br />
Zum an<strong>der</strong>en seien die Paragraphen viel zu abstrakt und allgeme<strong>in</strong><br />
formuliert, so dass diese kaum zu verstehen seien.<br />
Lösung:<br />
Der Grund, weshalb Paragraphen abstrakt formuliert s<strong>in</strong>d, liegt dar<strong>in</strong>,<br />
dass man nur so gewährleisten kann, möglichst viele Fälle aus<br />
dem Leben mit e<strong>in</strong>er Vorschrift zu erfassen (= <strong>der</strong> Regelungs<strong>in</strong>halt<br />
bed<strong>in</strong>gt also die sprachliche Formulierung). Würde man gesetzliche<br />
Regelungen allzu konkret formulieren, so würden diese immer<br />
nur bestimmte E<strong>in</strong>zelfälle regeln können. Dies ist jedoch verfassungsrechtlich<br />
unzulässig.<br />
________________________________________________<br />
Problem:<br />
Wie versteht man die abstrakte Sprache <strong>in</strong> Gesetzen ?<br />
Lösung:<br />
Um Gesetze und ihre e<strong>in</strong>zelnen Regelungen zu verstehen, muß<br />
man sie auslegen. Dies heißt, dass man ihren Text deuten muß.<br />
Man kann nach dem Wortlaut, <strong>der</strong> Historie, dem S<strong>in</strong>n und Zweck<br />
(Teleologie), und <strong>der</strong> Systematik auslegen.<br />
Merke: Eigentlich machen Juristen nichts an<strong>der</strong>es, als diese Prüfschemata<br />
(Checklisten) auswendig zu lernen, wobei die Kunst dar<strong>in</strong> besteht,<br />
für die jeweils juristisch zu beurteilende Situation das richtige<br />
Schema zu f<strong>in</strong>den und sicher anzuwenden.<br />
Beispielfall: Das sechsjährige K<strong>in</strong>d K wird <strong>in</strong> das Krankenhaus e<strong>in</strong>geliefert. Es hat<br />
e<strong>in</strong>e klaffende Wunde. Um K behandeln zu können, müssen Sie zuvor<br />
mit ihm e<strong>in</strong>en Behandlungsvertrag schließen. Können Sie mit K e<strong>in</strong>en<br />
Behandlungsvertrag schließen ? (Die Eltern s<strong>in</strong>d nicht erreichbar).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 17 von 180<br />
Grundüberlegung:<br />
Um zu prüfen, ob man mit K überhaupt e<strong>in</strong>en Vertrag schließen kann,<br />
muß man sich zuvor vergewissern, ob K geschäftsfähig ist. Die Geschäftsfähigkeit<br />
ist <strong>in</strong> §§ 104 ff. BGB geregelt. Wenn Sie § 104 BGB<br />
befragen, werden Sie feststellen, dass Sie mit K ke<strong>in</strong>en Behandlungsvertrag<br />
schließen können. Denn K ist nicht geschäftsfähig.<br />
Problem:<br />
Diese Regelung ersche<strong>in</strong>t wi<strong>der</strong>s<strong>in</strong>nig. Denn mit <strong>der</strong> Regelung <strong>in</strong> §<br />
104 BGB verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t <strong>der</strong> Gesetzgeber ja eigentlich die Behandlung,<br />
weil er bereits verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t, dass das K<strong>in</strong>d mit dem Krankenhaus<br />
e<strong>in</strong>en Behandlungsvertrag schließen kann.<br />
Lösungsansatz:<br />
Die vorbezeichnete Lösung ist - wie auch <strong>der</strong> gesunde Menschenverstand<br />
nahe legt - nur vor<strong>der</strong>gründig richtig.<br />
Denn <strong>der</strong> Gesetzgeber möchte nicht verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass das K<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>en<br />
Behandlungsvertrag schließt bzw. dass zugunsten des K<strong>in</strong>des<br />
e<strong>in</strong> solcher Vertrag geschlossen wird. Vielmehr möchte <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
kle<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong> schützen, weil diese bis zu e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
Alter die Konsequenzen ihres Handelns nicht überblicken<br />
und daher vor Schaden bewahrt werden sollen.<br />
Diesem Gesichtspunkt trägt e<strong>in</strong> Prüfungsschema <strong>in</strong> unserem Beispielsfall<br />
Rechnung.<br />
Prüfungsschema:<br />
Demgemäß besteht folgendes Prüfungsschema:<br />
Ausgangsfrage: Ist e<strong>in</strong> Behandlungsvertrag zustande gekommen ?<br />
Mit dem K<strong>in</strong>d K ?<br />
Ne<strong>in</strong>. Wegen <strong>der</strong> Regelung <strong>in</strong> § 104 BGB.<br />
Möglicherweise mit den Eltern für das K<strong>in</strong>d ?<br />
Ja. Und zwar nach den Regelungen <strong>der</strong> GoA<br />
(Geschäftsführung ohne Auftrag).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 18 von 180<br />
F. Zusammenfassung<br />
A. Das „Abprüfen“<br />
von Prüfungsschemata<br />
Diese <strong>in</strong> § 677 BGB geregelte Konstruktion<br />
geht von <strong>der</strong> regelmäßigen Vermutung aus,<br />
dass die Eltern (die <strong>in</strong> unserem Fall nicht<br />
erreichbar waren) wünschen, dass ihr K<strong>in</strong>d<br />
behandelt wird.<br />
__________________________________________________<br />
Diesem Prüfungsschema liegt <strong>der</strong> Ordnungsgedanke zugrunde,<br />
dass man mit kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ke<strong>in</strong>e Verträge schließen darf, weil<br />
diese die Tragweite ihres Handelns nicht überblicken können. Daher<br />
werden Verträge mit <strong>der</strong>en Eltern geschlossen, wie <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
dies u.a. über § 1629 BGB geregelt hat. S<strong>in</strong>d die Eltern<br />
also nicht anwesend und ist die Behandlung dr<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich,<br />
so kann <strong>der</strong> Vertrag auch nach den Regeln <strong>der</strong> GoA mit diesen geschlossen<br />
werden.<br />
Juristische Methodik kann im weiteren S<strong>in</strong>ne (!) auch mit juristischer Verhaltenslehre<br />
umschrieben werden.<br />
Diese geht immer von konkreten Lebenssituationen aus, die Lebenssachverhalt<br />
genannt werden; <strong>der</strong> Lebenssachverhalt hat immer e<strong>in</strong>e bestimmte Situation<br />
zum Gegenstand, <strong>in</strong> <strong>der</strong> etwas „schief“ gelaufen ist o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> zukünftig etwas<br />
„schief“ laufen könnte.<br />
Aufgabe des <strong>Rechtskunde</strong>unterrichtes ist es, die Schüler zu befähigen, gängige<br />
Lebenssachverhalte aus ihrem beruflichen Umfeld juristisch zu bewerten und<br />
ihnen e<strong>in</strong>e Entscheidungsgrundlage für ihr Verhalten zu geben.<br />
Hierzu wird auf e<strong>in</strong>schlägige Prüfungsschemata <strong>zur</strong>ückgegriffen.<br />
B. Beson<strong>der</strong>e Grundlagen des Rechts<br />
Es geht nunmehr darum, wie man e<strong>in</strong> juristisches Prüfungsschema „abprüft“.<br />
Hierbei wird zunächst vorausgesetzt, daß Sie sich bereits das zu Ihrem Fall passende<br />
Prüfungsschema herausgesucht habe. Wir er<strong>in</strong>nern und: Jedes Prüfungsschema<br />
steht thematisch unter e<strong>in</strong>er bestimmten Fallfrage. Die Fallfrage ist - bezogen<br />
auf den Lebenssachverhalt - problemorientiert. Dies bedeutet, daß das Prüfungsschema<br />
genau diejenige Frage aufgreift, die sich mit dem juristischen Kernproblem<br />
Ihrer Lebenssituation ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzt.<br />
Das Prüfungsschema filtert also für den Anwen<strong>der</strong> den Kern se<strong>in</strong>es Problems<br />
heraus und bietet ihm hierzu e<strong>in</strong>e gedankliche Entscheidungshilfe an.<br />
Die zu prüfenden<br />
Merkmale:<br />
Diese gedankliche Entscheidungshilfe ist <strong>der</strong> zentrale Punkt des<br />
Prüfungsschemas. Sie besteht aus e<strong>in</strong>em Kanon an Merkmalen, die<br />
aus den verschiedenen gesetzlichen Regelungen zusammengetragen<br />
wurden und für die juristische Regelung Ihres Problems von<br />
Bedeutung s<strong>in</strong>d (Checkliste).<br />
Es muß stets untersucht werden, ob alle (!) im Prüfschema genannten<br />
Merkmale erfüllt s<strong>in</strong>d. Der Anwen<strong>der</strong> prüft dabei, ob die<br />
im Prüfschema genannten Voraussetzungen (= die Merkmale) erfüllt<br />
s<strong>in</strong>d. Ist dies <strong>der</strong> Fall, so gibt das Prüfungsschema e<strong>in</strong>e bestimmte<br />
Rechtsfolge an, die unbed<strong>in</strong>gt beachtet werden muß. Im<br />
E<strong>in</strong>zelnen gilt:
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 19 von 180<br />
Die Subsumtionstechnik:<br />
Bei den im Prüfschema aufgelisteten Voraussetzungen handelt<br />
es sich um die Auflistung von bestimmten Merkmalen. Sie werden<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> juristischen Sprache „Tatbestandsmerkmale“ genannt.<br />
Die Tatbestandsmerkmale ergeben sich aus gesetzlichen<br />
Regelungen, die für Ihr Problem e<strong>in</strong>schlägig s<strong>in</strong>d und vom Prüfungsschema<br />
zusammengetragen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Abfolge<br />
aufgelistet werden.<br />
S<strong>in</strong>d die Merkmale erfüllt, so schreibt das Gesetz e<strong>in</strong>e bestimmte<br />
zw<strong>in</strong>gende Handlungsweise, die Rechtsfolge vor.<br />
D.h., daß <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> zunächst untersuchen muß, ob die im<br />
Schema genannten Merkmale erfüllt s<strong>in</strong>d. Dabei bedient man sich<br />
<strong>der</strong> sog. Subsumtionstechnik.<br />
Hierzu fragt man zu jedem Merkmal aus dem Prüfungsschema,<br />
ob dieses erfüllt se<strong>in</strong> könnte. Diese Fragetechnik heißt juristisch<br />
„Bildung e<strong>in</strong>es Obersatzes“. Der Obersatz wird im Konjunktiv<br />
formuliert und <strong>in</strong> die Frageform gekleidet. Beispiel:<br />
„Könnte es se<strong>in</strong>, daß das (Tatbestands-)Merkmal (...) erfüllt ist ?“.<br />
Sodann vergleicht man die tatsächliche Situation mit dem Merkmal<br />
und prüft, ob beide übere<strong>in</strong>stimmen (sog. „Untersuchungsprogramm“;<br />
jur.: Subsumtion). Ist dies <strong>der</strong> Fall, so geht man zum<br />
nächsten Merkmal über und fragt wie<strong>der</strong>um, ob es von <strong>der</strong> sog.<br />
„Lebenswirklichkeit“ erfüllt wird, also mit ihr übere<strong>in</strong>stimmt.<br />
Die Methode des Vergleichs ist vergleichbar mit dem Grundrechnen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mathematik (4. Schuljahr [Grundschule]):<br />
B. Beispielfall Mathematik-Unterricht Jura<br />
1. Ich frage:<br />
↓<br />
„Wieviel ist 'c' ?“<br />
2. Ich rechne:<br />
↓<br />
„c = a + b “<br />
(= Anwendung <strong>der</strong><br />
mathematischen Formel)<br />
1. Ich frage:<br />
↓<br />
„RU könnte e<strong>in</strong>e Körperverletzung<br />
nach § 223 Abs. 1 StGB begangen<br />
haben“ (= Obersatz/E<strong>in</strong>leitungssatz)<br />
2. Ich subsumiere:<br />
↓<br />
Nennung des Tatbestandsmerkmals (=<br />
Anwendung <strong>der</strong> juristischen<br />
Formel):<br />
„Dann müßte RU den H vorsätzlich<br />
körperlich mißhandelt haben, ohne<br />
dazu berechtigt gewesen zu se<strong>in</strong>.“<br />
Def<strong>in</strong>ition (steht im Prüfungsschema):<br />
Körperverletzung ist jede körperliche<br />
Mißhandlung, die das körperliche<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den nicht nur unerheblich<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt.<br />
Lebenssachverhalt (das ist Ihr Fall):<br />
Der heftige Schlag <strong>in</strong> das Gesicht von<br />
H hat dessen Wohlbef<strong>in</strong>den, weil er e<strong>in</strong>en<br />
nicht unerheblichen Schmerz verursacht<br />
hat. Das wollte RU auch und er<br />
war hierzu nicht berechtigt (beispielsweise<br />
lag ke<strong>in</strong>e Notwehr vor).<br />
Schlußfolgerung: „Der Schlag von RU<br />
ist folglich e<strong>in</strong>e körperliche Mißhandlung.“<br />
(= Ihr Prüfungsergebnis).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 20 von 180<br />
C. Wichtige<br />
Prüfungsschemata<br />
3. Ich antworte:<br />
↓<br />
„Also ist: 'a + b' = c “<br />
3. Ich antworte:<br />
↓<br />
Also hat RU mit dem Schlag e<strong>in</strong>e<br />
Körperverletzung nach § 223 I StGB<br />
begangen (= er ist strafbar).<br />
Diese Technik wird bei jedem Prüfungsschema angewendet. Sie ist immer die<br />
gleiche. Es handelt sich um e<strong>in</strong>e Vorgehensweise, bei <strong>der</strong> streng logisch gefragt,<br />
gedacht (Vergleich mehrere möglicher Anworten) und geschlußfolgert wird.<br />
Nachfolgend werden die für die Krankenpflegepraxis wichtigsten juristischen Prüfungsschemata<br />
dargestellt. Es handelt sich hierbei um die des Zivilrechts und des<br />
Strafrechts. Dies s<strong>in</strong>d die Grundschemata. Sie werden auf alle zivilrechtlichen und<br />
strafrechtlichen Fälle angewandt und dabei immer an die praktische Lebenssituation<br />
angepaßt.<br />
H<strong>in</strong>weis: Die Rechtswissenschaften glie<strong>der</strong>n sich <strong>in</strong> drei große Rechtsgebiete. Diese s<strong>in</strong>d das Zivilrecht,<br />
das Strafrecht und das Öffentliche Recht. Hiervon ausgehend differenzieren sich die Rechtsgebiete<br />
weiter aus. So werden beispielsweise das Arbeitsrecht, das Zivilprozeßrecht, das Handelsrecht<br />
und das Gesellschaftsrecht unter das Zivilrecht (mit e<strong>in</strong>em Verfahrensteil) gefaßt. Auch das Strafrecht<br />
umfaßt das sog. materielle Strafrecht und das Verfahrensrecht. Im Öffentlichen Recht gibt es die Bereiche<br />
Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Auslän<strong>der</strong>recht und die Verwaltungsgerichtsordnung<br />
als öffentlich-rechtliches Verfahrensrecht, um nur e<strong>in</strong>ige Beispiele zu nennen.<br />
Das strafrechtliche und das zivilrechtliche Prüfungsschema<br />
(Anm.: Dies ist ke<strong>in</strong>e synoptische Gegenüberstellung)<br />
Strafrecht:<br />
Der Ausgangssatz lautet immer:<br />
„Der (Arzt) könnte sich gemäß<br />
§ 223 StGB strafbar gemacht<br />
haben, <strong>in</strong>dem er (den Patienten)<br />
<strong>in</strong> den Bauch geschlagen hat.“<br />
Zivilrecht:<br />
Der Ausgangssatz lautet immer:<br />
„Der (Patient) hat e<strong>in</strong>en Anspruch<br />
gegen (den Arzt) auf Behandlung,<br />
wenn e<strong>in</strong> wirksamer Vertrag<br />
zustande gekommen ist.“<br />
Allgeme<strong>in</strong>er Deliktaufbau Allgeme<strong>in</strong>er Anspruchsaufbau<br />
A. Vorprüfung A. Entstehung des Anspruchs<br />
I. Abgrenzung Tun / Unterlassen<br />
(es muß e<strong>in</strong> menschliches Verhalten<br />
vorliegen, das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Tun<br />
o<strong>der</strong> Unterlassen besteht)<br />
II. Handlungsqualität des Verhaltens<br />
(bei dem Tun / Unterlassen handelt<br />
es sich um menschl. Verhalten, das<br />
willensbeherrscht ist und e<strong>in</strong>e soziale<br />
Relevanz hat)<br />
I. Voraussetzungen <strong>der</strong> Anspruchsnorm<br />
(Vorliegen zweier übere<strong>in</strong>stimmen<strong>der</strong><br />
Willenserklärungen [= Angebot<br />
und Annahme])<br />
II. Es liegen ke<strong>in</strong>e Nichtigkeitsgründe vor<br />
(§§ 104; 106-118; 125; [126; 126a;<br />
126b]; 134; 138 I, II BGB)<br />
B. Tatbestand (=wor<strong>in</strong> bestand die Tat ?) B. Ke<strong>in</strong> Untergang des Anspruchs
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 21 von 180<br />
I. Objektiver Tatbestand<br />
das s<strong>in</strong>d äußerlich sichtbare Unrechtsmerkmale:<br />
- E<strong>in</strong>tritt des tatbestandlichen Erfolges<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Norm (=<br />
z.B. Schlag <strong>in</strong>s Gesicht; wird von<br />
<strong>der</strong> Regelung des § 223 StGB erfasst)<br />
durch die Handlung -> zugleich<br />
darf ke<strong>in</strong> tatbestandsausschließendes<br />
E<strong>in</strong>verständnis des<br />
Verletzten vorliegen,<br />
- Kausalität (die Handlung muß<br />
den tatbestandlichen Erfolg herbeigeführt<br />
haben),<br />
- objektive Zurechnung (die durch<br />
die Handlung gesetzte Gefahr hat<br />
sich im Erfolg verwirklicht)<br />
II. Subjektiver Tatbestand<br />
das ist <strong>der</strong> Wille <strong>zur</strong> Verwirklichung<br />
des objektiven Tatbestandes<br />
und das Wissen darum (= Vorsatz)<br />
- Tatbestandsverwirklichung war<br />
Ziel <strong>der</strong> Handlung (= Absicht),<br />
- Handeln mit dem sicheren Wissen,<br />
daß <strong>der</strong> Erfolg e<strong>in</strong>tritt,<br />
- sog. Eventualvorsatz (Erfolg<br />
wird ernstlich für möglich gehalten,<br />
aber Täter f<strong>in</strong>det sich damit<br />
ab und handelt),<br />
- ggf. beson<strong>der</strong>e Merkmale: Bereicherungsabsicht,<br />
etc.)<br />
Es dürfen ke<strong>in</strong>e Erlöschensgründe<br />
vorliegen (=man verliert se<strong>in</strong>en<br />
Anspruch wie<strong>der</strong>)<br />
(= Fälle <strong>der</strong> rechtsvernichtenden<br />
E<strong>in</strong>reden)<br />
- <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e erfüllt nun doch: §§ 362,<br />
364, 378 BGB,<br />
- Anfechtung (§ 142, 119 ff. BGB),<br />
Rücktritt (§ 346 BGB), Aufrechnung<br />
(§§ 387 ff. BGB), Kündigung,<br />
Wi<strong>der</strong>ruf o<strong>der</strong> Rückgabe des<br />
Verbrauchers (§§ 355, 356, 357<br />
BGB)<br />
- Unmöglichkeit (§ 275, 326 BGB),<br />
Bed<strong>in</strong>gungse<strong>in</strong>tritt (§ 158 II BGB),<br />
- Wegfall <strong>der</strong> Geschäftsgrundlage (§<br />
242 BGB)<br />
C. Rechtswidrigkeit C. Durchsetzbarkeit des Anspruchs<br />
I. Ist grundsätzlich durch die Tatbestandsverwirklichung<br />
<strong>in</strong>diziert<br />
(es genügt i.d.R. die Feststellung, daß<br />
<strong>der</strong> Tatbestand verwirklicht ist; damit<br />
ist die Tat zunächst rechtswidrig.<br />
Ausnahme: § 240 II StGB: Hier ist<br />
die RW erst gegeben, wenn die Verwerflichkeitsprüfung<br />
positiv ausgefallen<br />
ist).<br />
II. Ausnahme: e<strong>in</strong> Rechtfertigungsgrund<br />
liegt vor<br />
- Notwehr (§§ 227 BGB, 32 BGB),<br />
Selbsthilfe (§§ 229, 562b, 859<br />
BGB), zivilrechtlicher Notstand (§§<br />
228, 589 BGB), strafrechtl. Notstand<br />
(§ 34 StGB), rechtfertigende E<strong>in</strong>willigung<br />
d. Verletzten, Festnahmerecht<br />
(§ 127 StPO),<br />
- Voraussetzungen <strong>der</strong> Rechtfertigung:<br />
Vorl. d. Rechtfertigungsgrundes<br />
+ Kenntnis u. Wille zum Handeln<br />
aufgrund Rechtfertigungsgrund<br />
D. Schuld (= war Täter <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage, Unrecht<br />
e<strong>in</strong>zusehen ?)<br />
I. Schuldfähigkeit<br />
- §§ 19, 20, 21 StGB,<br />
- Grundsätze <strong>der</strong> actio libera <strong>in</strong> causa<br />
(Achtung: nach BGH nicht anwendbar<br />
bei Straßenverkehrsdelikten u. bei<br />
bloßen Tätigkeitsdelikten),<br />
I. Es liegen ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>reden vor (=<br />
Fälle <strong>der</strong> rechtshemmenden E<strong>in</strong>reden)<br />
- sog. vorübergehende (Stundung<br />
[§ 202 I BGB], Bürgschaft),<br />
- sog. dauernde (z.B. Verjährung [§<br />
214 BGB], Kaufpreisverweigerung<br />
[§ 438 Abs. 4 S. 2 BGB], Mängele<strong>in</strong>rede<br />
des Bestellers [§ 634a Abs.<br />
4 S. 2 BGB], fakt. u. prakt. Unmöglichkeit<br />
[§ 275 BGB])<br />
II. Der Durchsetzung des Anspruchs<br />
steht nicht § 242 BGB entgegen<br />
(= es wäre treuwidrig, den Anspruch<br />
gerade jetzt e<strong>in</strong>zufor<strong>der</strong>n), z.B.:<br />
- den Anspruch jetzt e<strong>in</strong>zufor<strong>der</strong>n<br />
steht im Wi<strong>der</strong>spr. zum bish. Verhalten<br />
(„Verwirkung“: Zeit-/Umstandsmoment<br />
+ Vertrauen darauf),<br />
- Anspruchsausübung würde S<strong>in</strong>n u.<br />
Zweck des Rechts wi<strong>der</strong>sprechen,<br />
- die verlangte Leistung müßte aus<br />
and. Rechtsgrund alsbald wie<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ückerstattet<br />
werden.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 22 von 180<br />
D. Das zivilrechtlichePrüfungsschema<br />
geordnet nach<br />
<strong>der</strong> gewünschten<br />
Rechtsfolge<br />
II. Persönliche Vorwerfbarkeit, z.B.:<br />
- ke<strong>in</strong> Unrechtsbewußtse<strong>in</strong> (Verbots-<br />
o<strong>der</strong> Erlaubnisirrtum [§ 17 StGB]),<br />
- Vorliegen v. Entschuldigungsgründen<br />
( § 33 StGB [<strong>in</strong>tensiver Notwehrexzess],<br />
§ 35 StGB [entschuldigen<strong>der</strong><br />
Notstand], übergesetzlicher<br />
entschuldigen<strong>der</strong> Notstand)<br />
E. Strafausschließungsgründe (= es<br />
darf nicht bestraft werden)<br />
z.B.:<br />
- Indemnität v. Abgeordneten<br />
Ergebnis Strafrecht:<br />
Der Schlußsatz lautet:<br />
„Der X hat sich gemäß § (...) StGB<br />
strafbar gemacht.“<br />
Ergebnis Zivilrecht:<br />
Der Schlußsatz lautet:<br />
„Der X hat e<strong>in</strong>en Anspruch gegen (...)<br />
auf (...die Leistung...), weil e<strong>in</strong> wirksamer<br />
Vertrag vorliegt.“<br />
H<strong>in</strong>weis: Bei den vorstehenden Prüfschemata handelt es sich um Grundschemata.<br />
Sie begegnen Ihnen im Verlaufe des Unterrichts <strong>in</strong> verschiedenen Ausgestaltungen<br />
wie<strong>der</strong>. Hierbei ist zumeist e<strong>in</strong>e Anpassung an spezifische Alltagssituationen erfolgt,<br />
die e<strong>in</strong>er juristischen Bewertung unterzogen s<strong>in</strong>d.<br />
Bei <strong>der</strong> Prüfung <strong>der</strong> zweckmäßigen zivilrechtlichen Rechtsverfolgung se<strong>in</strong>er Ansprüche<br />
wird zielgerichtet vorgegangen. Dies bedeutet, daß zuerst zu überlegen ist,<br />
was man von <strong>der</strong> Gegenseite haben möchte (Anspruchsziel) und sich dann das dazu<br />
passende Prüfungsschema aussucht, das die entsprechende Rechtsfolge für den<br />
Gegner herbeiführt.<br />
Die wichtigsten Anspruchsziele s<strong>in</strong>d: <strong>der</strong> Vertrag (hier: die Erfüllung des Vertrages,<br />
Ansprüche wegen e<strong>in</strong>er Leistungsstörung und Surrogate), sachenrechtliche<br />
Ansprüche (meist: Herausgabe e<strong>in</strong>er Sache o<strong>der</strong> Beseitigung e<strong>in</strong>er Sache), Bereicherungsansprüche<br />
und Schadensersatzansprüche.<br />
Anspruchsaufbau nach <strong>der</strong> begehrten Rechtsfolge<br />
A. Vertragliche Ansprüche<br />
I. Primäranspruch<br />
Dieser richtet sich auf die Erfüllung des Vertrages -> man möchte unbed<strong>in</strong>gt<br />
am Vertrag festhalten, daher klagt man zuerst auf Erfüllung.<br />
II. Sekundäranspruch<br />
Dieser Anspruch kommt bei Leistungsstörungen (= e<strong>in</strong>e Partei liefert<br />
später, gar nicht o<strong>der</strong> schlecht) <strong>in</strong> Betracht. Meist wird auf Schadensersatz<br />
o<strong>der</strong> Rücktritt gegangen.<br />
Mängelhaftung <br />
Unmöglichkeit<br />
Verzug Schlechterfüllung<br />
(pVV, §<br />
280 I BGB)<br />
Wegfall <strong>der</strong><br />
Geschäftsgrundlage
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 23 von 180<br />
E. Die Denkweise<br />
<strong>der</strong> Prüfschemata<br />
III. Tertiäranspruch<br />
Dieser Anspruch geht bei Untergang <strong>der</strong> Sache auf die Herausgabe des<br />
Surrogats. Man möchte vom Gegner das durch den Vertrag Erlangte, also<br />
das, was er für die Sache (etwa durch Weiterverkauf) bekommen hat<br />
(i.e. den Kaufpreis).<br />
B. Quasivertragliche Ansprüche<br />
Geschäftsführung ohne Auftrag<br />
(§ 677 ff. BGB)<br />
C. D<strong>in</strong>gliche Ansprüche<br />
Herausgabe und Sekundäransprüche<br />
1. §§ 985; 1007 I, II;<br />
861 I BGB,<br />
2. §§ 987 ff. BGB<br />
D. Bereicherungsrechtliche Ansprüche<br />
Beseitigung / Unterlassung<br />
1. § 894 BGB<br />
2. §§ 1004 I, 862 BGB<br />
Culpa <strong>in</strong> Contrahendo<br />
(§§ 280 I,311 II, 241 III BGB)<br />
Duldung <strong>der</strong><br />
Zwangsvollstreckung<br />
2. § 1147 BGB<br />
Leistungs- und Nichtleistungskondiktion<br />
Diese Ansprüche (vgl. §§ 812 ff. BGB) richten sich auf die Herausgabe<br />
e<strong>in</strong>er Sache / Leistung, die e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er ohne Grund erhalten hat.<br />
E. Deliktische Ansprüche<br />
Haftung für die Beschädigung frem<strong>der</strong> Rechtsgüter durch eigenes<br />
Verhalten o<strong>der</strong> das se<strong>in</strong>er Erfüllungsgehilfen<br />
Diese Ansprüche beziehen sich auf Rechtsgutsverletzungen außerhalb<br />
von Verträgen. Erfaßt werden hiervon etwa die Fälle mutwilliger o<strong>der</strong><br />
fahrlässiger Zerstörung frem<strong>der</strong> Rechtsgüter (Eigentum, Leib, Leben).<br />
Aus den Prüfungsschemata geht zugleich hervor, daß jedem Rechtsgebiet e<strong>in</strong>e<br />
jeweils eigene Denkweise (= je eigenes Prüfschema) zugrunde liegt. Diese Strukturen<br />
sollen nachfolgend erörtert werden.<br />
Hierbei wird auf die drei elementaren Rechtsgebiete (i.e. das Zivil, Straf- und Öffentliche<br />
Recht) Bezug genommen.<br />
Zivilrecht Wie zuvor dargelegt, denkt <strong>der</strong> „Zivilrechtler“ nach den Kategorien<br />
„Anspruch entstanden“, „Anspruch untergegangen“, „Anspruch<br />
durchsetzbar“. Dem Zivilrecht liegt das Denken auf <strong>der</strong><br />
Gleichordnungsebene zugrunde (= regelt die Rechtsbeziehungen<br />
<strong>der</strong> Bürger untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>). Dies bedeutet, daß es bei <strong>der</strong>
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 24 von 180<br />
Koord<strong>in</strong>ation <strong>der</strong> Interessen aller natürlichen und juristischen Personen<br />
(also alle Privatpersonen und Firmen) ke<strong>in</strong>e Hierarchie gibt.<br />
Klassisches Ausdrucksmittel dieser Interessenkoord<strong>in</strong>ation ist<br />
<strong>der</strong> Vertrag. Der Vertrag, <strong>der</strong> üblicherweise dem Austausch von<br />
Wirtschaftsgütern dient („Ware gegen Geld“), verpflichtet und berechtigt<br />
die an ihm beteiligten Parteien zu e<strong>in</strong>em Tun o<strong>der</strong> Unterlassen<br />
(= je nachdem, was man von dem an<strong>der</strong>en haben möchte).<br />
Beim Vertrag unterwerfen sich die Parteien freiwillig <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Verpflichtung. Diese wird wegen <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Privatautonomie<br />
(= je<strong>der</strong> kann selbst e<strong>in</strong>e Regelung se<strong>in</strong>er Lebensverhältnisse<br />
treffen) resultierenden Vertragsfreiheit (= je<strong>der</strong> ist frei <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Entscheidung, ob, mit wem und welchen Inhalts er Verträge<br />
schließen möchte) zuvor von ihnen frei ausgehandelt und rechtsverb<strong>in</strong>dlich<br />
vere<strong>in</strong>bart. Das Zivilrecht weist <strong>in</strong>soweit e<strong>in</strong> liberalistische<br />
und <strong>in</strong>dividualistische Grundhaltung auf; es basiert auf<br />
dem wirtschaftlichen Liberalismus.<br />
Diese Grundhaltung f<strong>in</strong>det sich im Bürgerlichen Gesetzbuch<br />
(BGB) wie<strong>der</strong>, mit dem das Privatrecht <strong>in</strong> die gesetzliche Gussform<br />
gebracht hat. Allerd<strong>in</strong>gs ist das BGB auf sozialen Ausgleich<br />
bedacht („...mit e<strong>in</strong>em Tropfen sozialen Öls gesalbt...“; [Brox,<br />
BGB AT, 26. Aufl. 2002, S. 19]) und mil<strong>der</strong>t damit allzu wirtschaftsliberale<br />
Tendenzen ab. Der Grund hierfür liegt dar<strong>in</strong>, die<br />
Vertragsfreiheit nur bei etwa gleichstarken Partnern zu gerechten<br />
Ergebnissen führt. Häufig stehen sich zwar formal gleichberechtigte,<br />
faktisch h<strong>in</strong>gegen jedoch ungleiche Parteien gegenüber, bei<br />
denen e<strong>in</strong>er unerfahren ist o<strong>der</strong> sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zwangslage bef<strong>in</strong>det.<br />
Daher enthält das BGB <strong>in</strong> vielen se<strong>in</strong>er Normen gezielte Ausgleichsregelungen,<br />
wie etwa im Kauf-, Arbeits- o<strong>der</strong> Mietrecht<br />
(Stichwort: „Verbraucherschutz“, „Arbeitnehmerschutz“, „Mieterschutz“).<br />
Die Prüfungsschemata zum Zivilrecht rekurrieren auf unzählige<br />
solcher Lebenssachverhalte (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e das Prüfungsschema<br />
„Arbeitsrecht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege“), <strong>in</strong> denen es wegen faktischer<br />
Ungleichgewichte zwischen den Parteien zu groben Interessenschieflagen<br />
und damit Rechtsverlusten für e<strong>in</strong>en von beiden<br />
kommen kann.<br />
Strafrecht Beim Strafrecht h<strong>in</strong>gegen fehlt die Gleichordnungsebene. Hier<br />
gibt es zunächst e<strong>in</strong>en starken „Partner“. Dies ist die Gesellschaft<br />
<strong>in</strong> Gestalt <strong>der</strong> staatlichen Strafverfolgungsbehörden (daher ergehen<br />
Urteile stets „Im Namen des Volkes“). Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite<br />
stehen die Straftäter. Sie werden, nachdem sie gegen rechtliche<br />
Normen, die strafbewehrt s<strong>in</strong>d, verstoßen haben, entsprechend verfolgt<br />
und <strong>zur</strong> Verantwortung gezogen.<br />
Das Strafrecht, d.h. das Strafgesetzbuch enthält Normen, ohne <strong>der</strong>en<br />
E<strong>in</strong>haltung es zu Chaos und Anarchie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft käme.<br />
Mit Hilfe des Strafrechts wacht <strong>der</strong> Staat also über das<br />
friedvolle (o<strong>der</strong> auch nicht) Verhalten se<strong>in</strong>er Bürger. Dies ist<br />
ihm möglich, weil <strong>der</strong> Staat Inhaber des Gewaltmonopols 1 ist.<br />
Daher kann er das von gesetzlichen Normen abweichende Verhalten<br />
se<strong>in</strong>er Bürger zudem sanktionieren. Und zwar mit Gewalt-<br />
bzw. Zwangsmitteln. Für den Juristen bedeutet das: Wer von den<br />
Gesetzen abweicht, wird bestraft, weil er sich mit dieser Abweichung<br />
„strafbar“ gemacht hat.<br />
1 Die Befugnis, Gewalt auszuüben, hat <strong>der</strong> Staat von se<strong>in</strong>en souveränen Bürgern übertragen bekommen. Er ist <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zige<br />
und hat damit das Monopol. Der Staat übt das Gewaltmonopol nur aus, um die Bürger <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Gesetze zu<br />
bewegen. In diesem S<strong>in</strong>ne wachen die Bürger selbst über die Wahrung ihrer Regeln, weil das Staatsganze die Sache <strong>der</strong><br />
Bürger ist. Sie haben dies lediglich auf den Staat „delegiert“. Zur Vertiefung: Siehe: „Staatsbürgerkunde“.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 25 von 180<br />
F. Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Unterscheidung<br />
von<br />
Rechtsgebieten<br />
Öffentliches<br />
Recht<br />
Die Prüfungsschemata zum Strafrecht befassen sich demgemäß<br />
mit allen e<strong>in</strong>schlägigen Lebenssachverhalten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege,<br />
bei denen sich das <strong>Pflege</strong>personal strafbar machen kann. Hier<br />
wird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf die Delikte <strong>zur</strong> Körperverletzung und <strong>zur</strong><br />
Freiheitsentziehung h<strong>in</strong>gewiesen. E<strong>in</strong>gegangen wird auch auf die<br />
E<strong>in</strong>willigung des Patienten, Fragen <strong>der</strong> Transplantation und des<br />
Behandlungsabbruchs bei unheilbar Kranken.<br />
Beim Öffentlichen Recht tritt uns <strong>der</strong> Staat nicht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Funktionen<br />
als strafrechtlicher „Sanktionierer“ menschlichen Verhaltens<br />
gegenüber, son<strong>der</strong>n als Handeln<strong>der</strong>. Aber - von wenigen Ausnahmen<br />
abgesehen - er tritt nicht wie im BGB als gleichberechtigter<br />
Partner <strong>der</strong> Bürger auf, son<strong>der</strong>n - wie im Strafrecht - im Über-<br />
/Unterordnungsverhältnis. Auch im öffentlichen Recht kann <strong>der</strong><br />
Staat Zwang ausüben. Im Unterschied zum Strafrecht macht er das<br />
aber nicht, um Menschen zu bestrafen. Son<strong>der</strong>n er möchte ihr<br />
Verhalten so zu lenken, daß es direkt dem Allgeme<strong>in</strong>wohl dient.<br />
Die Bürger haben e<strong>in</strong> Interesse daran, daß das allgeme<strong>in</strong>e Wohl<br />
verwirklicht wird. Der Staat dient daher diesem öffentlichen Interesse.<br />
Das im öffentlichen Interesse stehende Allgeme<strong>in</strong>wohl wird<br />
auf <strong>der</strong> kommunalen Ebene, also <strong>der</strong> untersten staatlichen Ebene<br />
durch die Dase<strong>in</strong>svorsorge erreicht. Das öffentliche Recht bündelt<br />
also die Interessen <strong>der</strong> Bürger, damit sie ihr „irdisches Dase<strong>in</strong>“<br />
möglichst geordnet leben und es sich quasi „schön e<strong>in</strong>richten“.<br />
Das Geme<strong>in</strong>wohl läßt sich allerd<strong>in</strong>gs nicht ohne gewissen äußeren<br />
Zwang erreichen. Aus diesem Gedanken folgt e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e wichtige<br />
Funktion des öffentlichen Rechts: Die Aufrechterhaltung <strong>der</strong><br />
öffentlichen Sicherheit und Ordnung.<br />
Der Staat handelt durch se<strong>in</strong>e Organe. Dazu zählen u.a. se<strong>in</strong>e Behörden.<br />
Die Prüfungsschemata zum Öffentlichen Recht befassen sich<br />
vorrangig mit den öffentlich-rechtlich strukturierten Fragen <strong>der</strong><br />
Gesundheitsvorsorge, zu denen auch die Arzneimittelsicherheit<br />
und das Seuchenwesen gehören. Hier werden für das <strong>Pflege</strong>personal<br />
typische Situationen aufgegriffen und e<strong>in</strong>er juristischen Lösung<br />
zugeführt.<br />
Die Unterscheidung <strong>in</strong> die verschiedenen Rechtsgebiete hat u.a. die Bedeutung:<br />
- Zum e<strong>in</strong>en hilft sie zu entscheiden, welche Rechtsnormen im E<strong>in</strong>zelfall anzuwenden<br />
s<strong>in</strong>d (zahlt <strong>der</strong> Hauseigentümer für die Re<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> Straße e<strong>in</strong>e [privatrechtliche]<br />
Vergütung an den von ihm beauftragten Unternehmer o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
öffentlich-rechtliche Gebühr an die Stadt, wenn diese die Arbeiten ausführt ?)<br />
- Zum an<strong>der</strong>en gilt: Wer klagen will, muss das richtige Gericht anrufen. Die Zulässigkeit<br />
des e<strong>in</strong>zuschlagenden Rechtsweges richtet sich danach, welchem<br />
Rechtsgebiet e<strong>in</strong>e Streitigkeit zuzuordnen ist (Arbeits-, Straf-, Zivilrecht, Öffentliches<br />
Recht).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 26 von 180<br />
C. Zusammenhang: zivil-, arbeits- und strafrechtliche Haftung<br />
A. Nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
von zivil-<br />
und strafrechtlicher<br />
Haftung<br />
In vielen Fällen zieht das Verhalten im <strong>Pflege</strong>bereich sowohl zivil-, arbeits- wie<br />
auch strafrechtliche Implikationen nach sich.<br />
Dies bedeutet, dass e<strong>in</strong>e Krankenschwester etwa <strong>in</strong> dem Fall, wo Sie e<strong>in</strong>em Patienten<br />
zwar auf ärztliche Anweisung, jedoch gegen den erklärten Willen des Patienten<br />
e<strong>in</strong>e Injektion gibt, von diesem wegen Körperverletzung nach § 223 I StGB e<strong>in</strong>erseits<br />
strafrechtlich, wegen Schadensersatz und Schmerzensgeld zum an<strong>der</strong>en zivilrechtlich<br />
und arbeitsrechtlich wegen Verstoß gegen ihre arbeitsvertraglichen Sorgfaltspflichten<br />
<strong>zur</strong> Verantwortung gezogen werden kann.<br />
Folgende Übersicht soll dies verdeutlichen:<br />
.<br />
Injektion gegen den Willen des Patienten (ärztl. Anordnung)<br />
Zivilrechtliche<br />
Haftung<br />
Falschbehandlung:<br />
Schadensersatz,<br />
Schmerzensgeld<br />
Strafrechte<br />
Haftung<br />
Straftat: § 223 I<br />
StGB<br />
Freiheitsstrafe,<br />
Geldstrafe<br />
Arbeitsrechtliche<br />
Haftung<br />
Verletzung arbeitsvertraglicher<br />
Pflichten (trotz<br />
[unwirksamer]<br />
Anordnung):<br />
Abmahnung,<br />
Kündigung
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 27 von 180<br />
I. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.17:<br />
Als Ersthelfer<strong>in</strong> <strong>in</strong> Notfall- und Katastrophensituation handeln (Teilsequenz)<br />
Lernziele:<br />
- Zeitdauer: 4 Std. -<br />
Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden:<br />
Rechtliche (und Ethische) Aspekte <strong>zur</strong> Ersten Hilfe: Verpflichtung <strong>zur</strong> Hilfeleistung, rechtliche Konsequenten bei unterlassener<br />
o<strong>der</strong> fehlerhafter Hilfeleistung<br />
A. Geme<strong>in</strong>ge- Geme<strong>in</strong>gefährliche Straftaten<br />
fährliche<br />
Straftaten<br />
Im <strong>Pflege</strong>alltag stellt sich schnell die Frage, <strong>in</strong>wieweit das <strong>Pflege</strong>personal<br />
wegen unterlassenen Hilfeleistung gemäß § 323 c StGB strafrechtlich <strong>zur</strong><br />
Verantwortung gezogen werden kann, etwa wenn e<strong>in</strong>em auf <strong>der</strong> Station verunglückten<br />
Patient aus diversen Gründen nicht (rechtzeitig) geholfen wird<br />
(z.B. wegen Bestehens persönlicher Animositäten).<br />
Die unterlassene Hilfeleistung gehört nach <strong>der</strong> Legaldef<strong>in</strong>ition des Gesetzgebers übrigens zu den<br />
geme<strong>in</strong>gefährlichen Straftaten.<br />
I. Unterlassene Prüfungskarte Unterlassene Hilfeleistung<br />
Hilfeleistung<br />
1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Der objektive Tatbestand <strong>der</strong> unterlassenen Hilfeleistung setzt voraus, daß <strong>der</strong> Täter bei<br />
Unglücksfällen o<strong>der</strong> geme<strong>in</strong>er Gefahr o<strong>der</strong> Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erfor<strong>der</strong>lich<br />
und ihm den Umständen nach auch zumutbar war.<br />
aa. Unglücksfall<br />
Def.: Unglücksfall ist jedes plötzlich e<strong>in</strong>tretende Ereignis, das erhebliche Personen-<br />
o<strong>der</strong> Sachschäden anrichtet o<strong>der</strong> an<strong>zur</strong>ichten droht.<br />
(Dazu zählt e<strong>in</strong> vom Gefährdeten selbst verursachter Unglücksfall, wenn dieser<br />
nicht absichtlich herbeigeführt wurde [= Patient stürzt aus Unachtsamkeit]).<br />
bb. Unterlassen <strong>der</strong> möglichen Hilfeleistung<br />
cc. Erfor<strong>der</strong>lichkeit und Zumutbarkeit <strong>der</strong> möglichen hilfe<br />
Die vom Täter unterlaß. Hilfe muß erfor<strong>der</strong>lich und diesem zumutbar gewesen se<strong>in</strong>.<br />
Def.: Die Hilfe ist erfor<strong>der</strong>lich, wenn <strong>der</strong> Betroffene sich nicht selbst helfen kann<br />
und an<strong>der</strong>weitig ist ke<strong>in</strong>e ausreichende Hilfe verfügbar.<br />
Def.: Die Hilfe ist zumutbar, wenn sie nach allgeme<strong>in</strong>en sittlichen Maßstäben aufgebürdet<br />
werden kann, ohne daß sich <strong>der</strong> Täter dabei e<strong>in</strong>er erheblichen Eigengefahr<br />
aussetzt.<br />
a. subjektiver Tatbestand
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 28 von 180<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
3. Schuld<br />
II. E<strong>in</strong>zelfragen<br />
<strong>zur</strong> unterlasse- Ausgewählte E<strong>in</strong>zelfragen <strong>zur</strong> unterlassenen Hilfeleistung<br />
nen Hilfelei-<br />
stung<br />
1. objektiver Tatbestand<br />
a. Unglücksfall<br />
E<strong>in</strong>e schwere Krankheit ist ke<strong>in</strong> Unglücksfall. Der Nichtbesuch e<strong>in</strong>es<br />
Schwerkranken ist für den Arzt und das Krankenpflegepersonal<br />
jedenfalls dann ke<strong>in</strong>e unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht gerade<br />
e<strong>in</strong> akuter Notfall vorliegt (Bsp.: Schwerkranker Patient stirbt ohne<br />
Vorwarnung nach Visite. -> Ke<strong>in</strong> § 323 c StGB für den Arzt).<br />
Aber: die plötzliche Wendung e<strong>in</strong>er Krankheit sehr wohl e<strong>in</strong>en<br />
Unglücksfall darstellt, <strong>der</strong> die Pflicht <strong>zur</strong> sofortigen Operation begründet.<br />
Als plötzliche Wendung gilt:<br />
schwere, andauernde Atemnot (OLG D'dorf, NJW 1995, 799),<br />
sich steigernde und nahezu unerträglich gewordene Schmerzen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauchhöhle (OLG Hamm, NJW 1975, 605),<br />
schlimme Atembeschwerden und Schmerzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Brust,<br />
Eileiterschwangerschaft mit <strong>der</strong> Gefahr <strong>der</strong> Ruptur des Eileiters<br />
und <strong>der</strong> Folge des alsbaldigen Verblutens (BGH, NJW 1983, 350),<br />
b. Abgrenzung Tun / Unterlassen<br />
Zur Abgrenzung fragt man immer, wo <strong>der</strong> Schwerpunkt des strafrechtlich<br />
relevanten Verhaltens liegt: auf dem Tun o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nichtvornahme.<br />
Bsp.: Abschalten Herz-Lungen-Masch<strong>in</strong>e ist Unterlassen <strong>der</strong> Weiterbehandlung.<br />
c. Zumutbarkeit und Erfor<strong>der</strong>lichkeit <strong>der</strong> Hilfe<br />
Bei <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> Erfor<strong>der</strong>lichkeit kommt es darauf an, ob die<br />
Krankenschwester nach dem vorausschauenden Urteil e<strong>in</strong>es objektiven<br />
Beobachters e<strong>in</strong>e Chance <strong>zur</strong> Abwehr <strong>der</strong> Gefahr vertan hat.<br />
Voraussetzung für jede Hilfspflicht ist, daß die Möglichkeit <strong>zur</strong> Hilfe<br />
besteht und auch e<strong>in</strong>e gewisse räumliche Nähe zum Unglücksfall<br />
gegeben ist.<br />
Beachte: § 323 c StGB schafft ke<strong>in</strong>e absolute Son<strong>der</strong>pflicht für das<br />
<strong>Pflege</strong>personal <strong>zur</strong> Hilfeleistung. Jedoch s<strong>in</strong>d sie am ehesten <strong>zur</strong><br />
Hilfeleistung geeignet und verpflichtet.<br />
In beson<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>zelfällen kann die Hilfeleistung dann unzumutbar<br />
se<strong>in</strong>, wenn es sich bei dem Betroffenen um e<strong>in</strong>en Aids-Infizierten<br />
handelt und e<strong>in</strong> akutes Infektionsrisiko mit direkter Lebensgefahr<br />
für den Hilfeleistenden bestünde.<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
Entfallen <strong>der</strong> Rechtswidrigkeit<br />
Der durch den Unglücksfall Betroffene verzichtet auf Hilfe und er<br />
bef<strong>in</strong>det sich nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er psychischen Ausnahmeverfassung von<br />
Krankheitswert.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 29 von 180<br />
III. Das Verlassen<br />
<strong>in</strong> hilfloser<br />
Lage<br />
1. Schutzrichtung<br />
2. Krankheitsbegriff<br />
des § 221<br />
StGB<br />
3. Begehungsweisen<br />
des §<br />
221 StGB<br />
4. Obhutspflicht<br />
i.s.d. § 221<br />
StGB<br />
Hier spielt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten e<strong>in</strong>e maßgebliche<br />
Rolle. Es ist - an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong> Wille <strong>zur</strong> Selbsttötung - stets zu achten.<br />
Bleibt <strong>der</strong> Arzt o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Krankenschwester gegenüber e<strong>in</strong>em Behandlungsunwilligen<br />
untätig, dann liegt ke<strong>in</strong>e rechtswidrige Tat i.S.d. § 323 c StGB vor.<br />
Geme<strong>in</strong>gefährliche Straftaten (Fortsetzung)<br />
Das Verlassen <strong>in</strong> hilfsloser Lage<br />
Die Vorschrift des § 221 StGB schützt vor <strong>der</strong> Gefährdung<br />
hilfloser Personen an Leib und Leben.<br />
Hilflos ist je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> <strong>zur</strong> Tatzeit verschuldet o<strong>der</strong> unverschuldet<br />
außerstande ist, sich ohne Hilfe an<strong>der</strong>er gegen e<strong>in</strong>e se<strong>in</strong> Leben<br />
o<strong>der</strong> se<strong>in</strong>e Gesundheit bedrohende Gefahr zu wehren.<br />
Die Hilflosigkeit bezieht sich daher auf unterschiedliche Ursachen<br />
wie Jugendlichkeit (Neugeborene o<strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>),<br />
Gebrechlichkeit (alte Menschen) o<strong>der</strong> auch Krankheit. Vor<br />
allem aus letztem Grund ist die Aussetzung, genauer gesagt die<br />
2. Alternative des Abs. 1 <strong>der</strong> Vorschrift, also das "Verlassen <strong>in</strong><br />
hilfloser Lage" für die Krankenpflege von Bedeutung.<br />
Krankheit wird nicht im engen mediz<strong>in</strong>ischen S<strong>in</strong>ne als pathologischer<br />
Zustand verstanden. Auch die schwere Angetrunkenheit<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zustand während <strong>der</strong> Geburt fallen darunter.<br />
Die bloße Schwangerschaft an sich kann nicht als hilflose Lage<br />
verstanden werden, weil die Schwangere durchaus <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage<br />
ist, sich gegen Angriffe auf ihr Leben o<strong>der</strong> ihre Gesundheit zu<br />
wehren. Das än<strong>der</strong>t sich erst mit dem Geburtsvorgang selbst.<br />
Die Vorschrift kennt zwei Arten <strong>der</strong> Tatbegehung:<br />
das Versetzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e hilflose Lage<br />
das Verlassen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er hilflosen Lage trotz bestehen<strong>der</strong> Obhuts-<br />
bzw. Beistandspflicht.<br />
E<strong>in</strong> Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage wird erst dann strafbar, wenn e<strong>in</strong>e<br />
Obhutspflicht vorliegt, die verletzt wurde. E<strong>in</strong>e Obhutspflicht<br />
kann sich ergeben aus:<br />
berufsständischen Regeln (z.B. Arzt),<br />
aus Arbeitsvertrag (Arzt, Krankenschwester),<br />
aus tatsächlicher Übernahme (Nachbar<strong>in</strong> verspricht, auf den<br />
Säugl<strong>in</strong>g aufzupassen).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 30 von 180<br />
1. Tatbestand<br />
Prüfungskarte Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Täter des § 221 StGB kann nur se<strong>in</strong>, wer obhutspflichtig ist o<strong>der</strong> sonstwie für die Unterbr<strong>in</strong>gung<br />
o<strong>der</strong> Aufnahme des Hilfsbedürftigen (= Patienten) zu sorgen hat. Entscheidend<br />
ist, daß <strong>der</strong> Täter e<strong>in</strong>e Garantenstellung <strong>in</strong>ne hat. Damit kann auch die Krankenschwester<br />
mögliche Täter<strong>in</strong> des § 221 I 1.Alt. StGB se<strong>in</strong>.<br />
Tathandlung ist das Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage. Charakteristisch ist, daß <strong>der</strong> Aufenthalt<br />
des Patienten unverän<strong>der</strong>t bleibt, statt dessen sich jedoch <strong>der</strong> Täter entfernt ! Nach Auffassung<br />
des BGH ist dazu unbed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e örtliche Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beziehung zwischen Obhutspflichtigem<br />
und <strong>der</strong> hilflosen Person erfor<strong>der</strong>lich. Teile <strong>der</strong> Rechtsliteratur h<strong>in</strong>gegen lassen<br />
ausreichen, wenn <strong>der</strong> Täter den Schutzbefohlenen schon "im Stich" läßt.<br />
Bsp.: Die Krankenschwester, die am Bett des Patienten verbleibt und<br />
nichts unternimmt, obwohl dieser e<strong>in</strong>en Kollaps erleidet. Der BGH bestraft<br />
hier ggf. nach § 323 c StGB, die Literatur bereits nach § 221 I 2.<br />
Alt. StGB. Sie folgen jedoch <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>ung des BGH.<br />
Taterfolg ist, daß <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge des Verlassens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e vorher nicht vorhandene konkrete<br />
Gefahr gebracht worden ist. Das ist e<strong>in</strong>e Gefahr, <strong>in</strong> <strong>der</strong> ihn nur e<strong>in</strong> retten<strong>der</strong> Zufall<br />
vor Tod o<strong>der</strong> schwerem Gesundheitsschaden bewahren kann.<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit und Schuld<br />
Abgrenzung<br />
zwischen §<br />
221 und §<br />
323c StGB<br />
Das Verlassen Hilfloser liegt tatbestandlich nicht schon vor, wenn<br />
die Krankenschwester den Patienten, <strong>der</strong> sich <strong>in</strong> ihrer Obhut bef<strong>in</strong>det,<br />
vernachlässigt. Dann greift § 323 c StGB. Erst wenn die Vernachlässigung<br />
e<strong>in</strong> Verlassen ist, ist § 221 I 2. Alt. StGB erfüllt.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 31 von 180<br />
Aktuelle Fälle <strong>zur</strong> Unterlassenen Hilfeleistung und zum Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage<br />
Fall 1: Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage<br />
Altenpfleger Gerd hat die Betreuung <strong>der</strong> 95-jährigen, l<strong>in</strong>ksseitig gelähmten, bettlägerigen Margret<br />
übernommen. Wegen <strong>der</strong>en kritischen Gesundheitszustandes war je<strong>der</strong>zeit mit e<strong>in</strong>em plötzlichen<br />
Herzversagen zu rechnen. Ohne sofortige Hilfe würde Margret sterben. Dennoch verließ er am<br />
07.04.2006 gegen 20.30 Uhr die Station und kehrte erst nach 14 Stunden wie<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ück. Zwischenzeitlich<br />
hatte die Enkel<strong>in</strong> von Margret die <strong>Pflege</strong> übernommen, nachdem sie die Abwesenheit<br />
von Gerd bemerkt hatte.<br />
Fall nach: OLG Zweibrücken, Beschluß vom 18.08.1997 - 1 Ss 159/97<br />
Fall 2: Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage<br />
Variante: Wie wäre <strong>der</strong> Fall 1 zu beurteilen, wenn es sich bei Margret um e<strong>in</strong>e 30-jährige Patient<strong>in</strong><br />
auf <strong>der</strong> Intensivstation gehandelt hätte ?<br />
Fall 3: Unterlassene Hilfeleistung<br />
Der 1942 geborene Angekl. war vom 1. 10. 1973 bis zum 31. 1. 1980 als planmäßiger Assistenzarzt<br />
auf <strong>der</strong> chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses G beschäftigt. 1979 wurde er als<br />
Funktions-Oberarzt im Bereitschaftsdienst e<strong>in</strong>gesetzt. Am frühen Nachmittag des 12. 12. 1979<br />
wurde die Patient<strong>in</strong> W im Kreiskrankenhaus G operiert. Ihr wurde die Milz entfernt, die krankhaft<br />
vergrößert e<strong>in</strong> Gewicht von ca. 2 kg aufwies. Die Patient<strong>in</strong> litt weiter an e<strong>in</strong>er Leberzirrhose. Das<br />
Blut <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> hatte nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Ger<strong>in</strong>nungsfähigkeit, weshalb <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> Blutfarbstoff<br />
zugeführt wurde. Aufgrund des Krankheitsbildes war mit Sickerungsblutungen zu rechnen. Deswegen<br />
wurden Dra<strong>in</strong>agen gelegt, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Sickerungsbeutel e<strong>in</strong>mündeten. Nach <strong>der</strong> Operation<br />
wurde die Patient<strong>in</strong> W <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Krankenzimmer <strong>der</strong> chirurgischen Abteilung verlegt, <strong>der</strong>en zuständiger<br />
Arzt nach Dienstende um 16.30 Uhr <strong>der</strong> Angekl. <strong>in</strong>folge Bereitschaftsdienstes war. Bevor <strong>der</strong><br />
Angekl. zwischen 19.00 und 19.30 Uhr das Krankenhaus verließ und sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e damals nahe<br />
dem Krankenhaus gelegene Wohnung begab, <strong>in</strong>formierte sich <strong>der</strong> Angekl. über den Krankheitszustand<br />
<strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W. Er überzeugte sich davon, daß die Infusionen liefen und die Kreislaufverhältnisse<br />
<strong>in</strong>takt waren. In dem Auffangbeutel <strong>der</strong> Blutungsdra<strong>in</strong>age befanden sich zu diesem Zeitpunkt<br />
ca. 600 Milliliter. Die Infusionen hatte <strong>der</strong> zuständige Anaesthesiearzt angeordnet. Um 20.00<br />
Uhr übernahm die Nachtschwester, die Zeug<strong>in</strong> A, den Dienst auf <strong>der</strong> chirurgischen Station. Die<br />
Zeug<strong>in</strong> <strong>in</strong>formierte sich anhand <strong>der</strong> Krankenunterlagen über den Gesundheitszustand <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong><br />
W. Ebenfalls um 20.00 Uhr begann <strong>der</strong> Zeuge B se<strong>in</strong>enDienst als Sitzwache am Krankenbett <strong>der</strong><br />
Patient<strong>in</strong> W. Der Zeuge B, <strong>der</strong> ausgebildeter Rettungssanitäter ist, wurde je nach Bedarf seit ca. 2<br />
Jahren im Durchschnitt drei- bis viermal im Monat zu Sitzwachen im Kreiskrankenhaus G e<strong>in</strong>geteilt.<br />
Er hatte die Aufgabe, Blutdruck und Puls <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W jede halbe Stunde zu messen und
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 32 von 180<br />
darüber h<strong>in</strong>aus allgeme<strong>in</strong> ihr Bef<strong>in</strong>den zu beobachten. Der Zeuge B teilte gegen 2.30 Uhr <strong>der</strong> Zeug<strong>in</strong><br />
A mit, daß <strong>der</strong> Blutdruck <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W unter 100 mm Hg gesunken sei. Die Zeug<strong>in</strong> A rief<br />
den Angekl. zu Hause an und teilte ihm das Abs<strong>in</strong>ken des Blutdrucks mit. Der Angekl. ordnete<br />
dann telefonisch an, die Lage <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> zu verän<strong>der</strong>n, so daß Oberkörper und Kopf tiefer liegen<br />
und e<strong>in</strong>en schnelleren E<strong>in</strong>lauf <strong>der</strong> Infusion gewährleisten. Gegen 3.20 Uhr klagte die Patient<strong>in</strong> W<br />
über Schmerzen, worauf die Zeug<strong>in</strong> A den Angekl. wie<strong>der</strong> zu Hause anrief. Der Angekl. reagierte<br />
auf diesen Anruf wegen <strong>der</strong> Schmerzen etwas ungehalten, da postoperative Schmerzen e<strong>in</strong>e Rout<strong>in</strong>eangelegenheit<br />
darstellten und jede Krankenschwester gerade dafür ausgebildet sei, e<strong>in</strong>e solche<br />
Situation zu bewältigen. Der Angekl. ordnete an, daß <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W das Schmerzmittel Fortral<br />
gespritzt werden soll. Gegen 3.45 Uhr sank <strong>der</strong> Blutdruck bei <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W auf 50 mm Hg ab.<br />
Die Nachtschwester K rief den Angekl. dann zu Hause an. Der Angekl. ordnete an, die noch laufenden,<br />
von dem zuständigen Anaesthesiearzt angeordneten Infusionen schneller e<strong>in</strong>fließen zu lassen,<br />
bis <strong>der</strong> Blutdruck wie<strong>der</strong> konstant auf 100 angehoben sei. Kurz vor 5.00 Uhr verschlechterte<br />
sich <strong>der</strong> Zustand <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> W erneut. Die Patient<strong>in</strong> hatte blaue Lippen, <strong>der</strong> Blutdruck war nach<br />
den Messungen des Zeugen B bis auf 40 mm Hg abgesunken. Die blutige Wundflüssigkeit im Auffangbeutel<br />
hatte zugenommen. Die Zeug<strong>in</strong> A rief den Angekl. erneut zu Hause an. Nach wenigenM<strong>in</strong>uten<br />
kam <strong>der</strong> Angekl. ans Krankenbett <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> und untersuchte sie. Er ordnete e<strong>in</strong>e<br />
sofortige Infusion e<strong>in</strong>er Blutersatzflüssigkeit an, bis zwei Blutkonserven so angewärmt waren, daß<br />
diese e<strong>in</strong>geführt werden konnten. Der Angekl. verabreichte <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> erneut Fortral und ließ die<br />
Dopam<strong>in</strong><strong>in</strong>fusion vollständig e<strong>in</strong>laufen. Um 6.00 Uhr übernahm die Zeug<strong>in</strong> R als zuständige Krankenschwester<br />
die Patient<strong>in</strong> W. Die Zeug<strong>in</strong> R sah nach <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> und stellte fest, daß <strong>der</strong> Bauch<br />
prall und schmerzempf<strong>in</strong>dlich war. Die Patient<strong>in</strong> war nicht voll ansprechbar. Die Zeug<strong>in</strong> R rief<br />
dann e<strong>in</strong>en Arzt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Intensivstation an, <strong>der</strong> sagte, daß er kommen werde, sobald die Dienstbesprechung<br />
zu Ende sei. Als nach 10 M<strong>in</strong>uten aber ke<strong>in</strong> Arzt erschien, g<strong>in</strong>g die Zeug<strong>in</strong> R zum Operationssaal,<br />
da dort fast immer e<strong>in</strong> Arzt zu dieser Zeit anzutreffen ist. Aus dem OP-Trakt kam zunächst<br />
Dr. A, <strong>der</strong> sich die Patient<strong>in</strong> ansah. Kurz danach erschienen Dr. H und <strong>der</strong> Angekl., <strong>der</strong><br />
wie<strong>der</strong> von zu Hause <strong>in</strong> den Normaldienst <strong>zur</strong>ückkehrte. Kurz danach erschien auch <strong>der</strong> Chefarzt<br />
<strong>der</strong> Anaesthesie Dr. S, <strong>der</strong> die Patient<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kollapszustand antraf und die sofortige Verlegung<br />
<strong>in</strong> die Intensivstation anordnete. Dort wurde <strong>der</strong> Kreislauf <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> mittels Blutkonserven<br />
aufgefüllt und die Patient<strong>in</strong> für e<strong>in</strong>e Nachoperation vorbereitet. Diese Operation wurde vom Chefarzt<br />
des Krankenhauses, dem Zugen Dr. G, gegen 11.00 Uhr selbst vorgenommen. Bei <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong><br />
W war es zu erheblichen <strong>in</strong>neren Blutungen gekommen. 4 Liter Blut wurden abgesaugt. Zwischen<br />
7.00 und 7.30 Uhr waren die erheblichen <strong>in</strong>neren Blutungen für die behandelnden Ärzte erkennbar<br />
und die schnellstmögliche Nachoperation <strong>zur</strong> Stillung <strong>der</strong> Blutungen zw<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich<br />
geworden. Die Patient<strong>in</strong> W verstarb am 18. 12. 1979 im Kreiskrankenhaus G.<br />
Fall nach: AG Groß-Gerau, Urteil vom 30.07.1981 - 14 Js 37.888/79 - 3 Ls<br />
Fall 4: Unterlassene Hilfeleistung<br />
Frau B war seit Jahren auf Grund e<strong>in</strong>er Blutgefäßsklerose schwer herzkrank. Im Jahr 1979 erlitt sie<br />
e<strong>in</strong>en Herz<strong>in</strong>farkt. Seitdem bestand e<strong>in</strong>e Herz<strong>in</strong>suffizienz mit Herzrhythmusstörungen. Im Oktober<br />
1980 verstärkten sich die Beschwerden. Am Abend des 8. November 1980 (Samstag) verschlechterte<br />
sich ihr Bef<strong>in</strong>den. Sie klagte über Herzschmerzen, Schmerzen im l<strong>in</strong>ken Arm sowie allgeme<strong>in</strong>es<br />
Unwohlse<strong>in</strong>. Ihre Tochter, die Zeug<strong>in</strong> 0, rief gegen 0.30 Uhr den Angeklagten an, <strong>der</strong> während<br />
jenes Wochenendes Bereitschaftsdienst hatte. Sie unterrichtete ihn über den Zustand ihrer Mutter<br />
und bat um se<strong>in</strong>en sofortigen Hausbesuch. Nachdem er von ihr erfahren hatte, daß die Patient<strong>in</strong> seit<br />
längerem herzkrank war und aus diesem Grund Medikamente nahm, erklärte er ihr, es sei besser,<br />
wenn sie ke<strong>in</strong>e neuen Arzneimittel nehme. Als die Zeug<strong>in</strong> 0 ihre Bitte um e<strong>in</strong>en Hausbesuch wie-
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 33 von 180<br />
<strong>der</strong>holte, erwi<strong>der</strong>te <strong>der</strong> Angeklagte, sie solle ihre Mutter <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Praxis fahren. Auf die Äußerung<br />
<strong>der</strong> Zeug<strong>in</strong>, daß dies nicht möglich sei, entgegnete er, dann solle sie die Patient<strong>in</strong> - nötigenfalls mit<br />
e<strong>in</strong>em Taxi - <strong>in</strong>s Krankenhaus br<strong>in</strong>gen. Das Landgericht hat nicht klären können, ob er die Zeug<strong>in</strong><br />
auf die Möglichkeit h<strong>in</strong>wies, den Notarzt zu verständigen. Weitere Anweisungen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
über die dr<strong>in</strong>gende Notwendigkeit e<strong>in</strong>er sofortigen Überführung ihrer Mutter <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Krankenhaus,<br />
erteilte er nicht. Nach diesem Telefongespräch war die Zeug<strong>in</strong> ratlos. Die sich im Wohnzimmer<br />
aufhaltende Patient<strong>in</strong> geriet wegen <strong>der</strong> Ablehnung des Hausbesuchs <strong>in</strong> große Unruhe. Sie wurde<br />
<strong>in</strong>s Schlafzimmer gebracht. Dabei erlitt sie e<strong>in</strong>en Schwächeanfall. Als sie schließlich im Bett lag,<br />
kam es zu e<strong>in</strong>em weiteren Herz<strong>in</strong>farkt. Der Schwiegersohn verständigte den Malteser-Hilfsdienst.<br />
Kurz darauf traf <strong>der</strong> Notarzt e<strong>in</strong> und veranlaßte die sofortige Überführung von Frau B <strong>in</strong>s Krankenhaus.<br />
Dort verbesserte sich zwar anfangs ihr Bef<strong>in</strong>den. Am Nachmittag des Sonntag kam es jedoch<br />
zu e<strong>in</strong>em Bewußtlosigkeitsanfall mit Atemstillstand. Die Patient<strong>in</strong> verstarb dann. Ihr Tod wäre<br />
zu diesem Zeitpunkt wahrsche<strong>in</strong>lich auch e<strong>in</strong>getreten, wenn die Zeug<strong>in</strong> 0 unmittelbar nach dem<br />
Telefongespräch mit dem Angeklagten den Notarzt verständigt hätte. Bei e<strong>in</strong>em Hausbesuch hätte<br />
<strong>der</strong> Angeklagte we<strong>der</strong> s<strong>in</strong>nvolle therapeutische Maßnahmen ergreifen, noch die Schmerzen <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong><br />
l<strong>in</strong><strong>der</strong>n können; <strong>in</strong> Betracht kam allenfalls die Verabreichung e<strong>in</strong>es Beruhigungsmittels. Da<br />
es sich bei Frau B um e<strong>in</strong>e Risikopatient<strong>in</strong> handelte und sich bei ihr die Symptome e<strong>in</strong>es Re<strong>in</strong>farkts<br />
zeigten, war es geboten, sie auf schnellstem Wege mit e<strong>in</strong>em für solche Fälle beson<strong>der</strong>s ausgerüsteten<br />
Rettungstransportwagen, <strong>der</strong> von e<strong>in</strong>em Notarzt begleitet wird, <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Krankenhaus e<strong>in</strong>zuliefern.<br />
Die Gefahr, e<strong>in</strong>em Herz<strong>in</strong>farkt zu erliegen, ist am größten <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> ersten Stunde nach<br />
dem Infarkt. Sie kann nur durch ärztliche Sofortmaßnahmen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Krankenhaus wesentlich verr<strong>in</strong>gert<br />
werden. Dieser Zusammenhänge war sich <strong>der</strong> Angeklagte beim Telefongespräch mit <strong>der</strong><br />
Zeug<strong>in</strong> 0 bewußt.<br />
Fall nach BGH 2. Strafsenat, Urteil vom 3. April 1985, Az: 2 StR 63/85<br />
Fall 5: Unterlassene Hilfeleistung<br />
Die Ehefrau E. hat am 21. August 1992 im M <strong>in</strong> Düsseldorf e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d tot <strong>zur</strong> Welt gebracht. Sie<br />
und ihr Ehemann bezichtigen die verantwortlichen Ärzte und <strong>Pflege</strong>kräfte <strong>der</strong> Geburts-<br />
Gynäkologischen Abteilung dieses Krankenhauses, durch un<strong>zur</strong>eichende mediz<strong>in</strong>ische Betreuung<br />
den <strong>in</strong>trauter<strong>in</strong> Tod ihres voll entwickelten K<strong>in</strong>des verursacht und verschuldet zu haben. Gegen die<br />
verantwortlichen Personen haben sie aus allen <strong>in</strong> Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten<br />
Strafanzeige erstattet.<br />
Fall nach OLG Düsseldorf 1. Strafsenat, Beschluß vom 13. Januar 1995, Az: 1 Ws 1041/94<br />
Fall 6: Unterlassene Hilfeleistung<br />
Auf <strong>der</strong> He<strong>in</strong>fahrt von se<strong>in</strong>em Schichtdienst kommt <strong>der</strong> Krankenpfleger Kurt an e<strong>in</strong>em frischen<br />
Verkehrsunfall vorbei, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Er gibt sich als Krankenpfleger<br />
zu erkennen und bittet e<strong>in</strong>en nicht am Unfall beteiligten Autofahrer, ärztliche Hilfe über dessen<br />
Handy zu holen. Der Gebetene weist dies <strong>zur</strong>ück, <strong>in</strong>dem er me<strong>in</strong>t, Kurt solle sich nicht so aufspielen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 34 von 180<br />
Fall 7:<br />
Krankenpfleger Rudi hat se<strong>in</strong>en verdienten Feierabend erreicht. Gerade als er nach Hause gehen<br />
will, kommt <strong>der</strong> Rettungswagen vorbei und liefert e<strong>in</strong>en Notfallpatienten e<strong>in</strong>. Dieser blutet stark, es<br />
muß etwas geschehen. Der Dienst habende Arzt bittet Rudi, länger zu bleiben, da starker Personalmangel<br />
herrscht und ke<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er <strong>Pflege</strong>r <strong>zur</strong> Verfügung steht. Rudi me<strong>in</strong>t jedoch, e<strong>in</strong> Recht auf<br />
Feierabend zu haben. Weiterer Dienst sei ihm nicht zumutbar, weil er bereits neun Stunden<br />
Schichtdienst h<strong>in</strong>ter sich habe. Ale er zudem erfährt, dass <strong>der</strong> Patient an AIDS erkrankt ist, hält er<br />
jede Hilfe - auch wegen <strong>der</strong> Ansteckungsgefahr - für unzumutbar.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 35 von 180<br />
Lernziele:<br />
I. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.29:<br />
Die <strong>Pflege</strong>bedürftigen aufnehmen, verlegen und entlassen<br />
- Vertragsrecht -<br />
- Zeitdauer: 3 Std. -<br />
Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden:<br />
Grundlagen des Vertragsrechts,<br />
Abschluss des Krankenhausaufnahmevertrages, des ärztlichen und pflegerischen Vertrages,<br />
Beendigung <strong>der</strong> Verträge<br />
A. Grundlagen des Vertragsschlusses: Rechts- und Parteifähigkeit<br />
A. Rechts- und<br />
Parteifähigkeit<br />
I. Beg<strong>in</strong>n, Inhalt<br />
und Ende <strong>der</strong><br />
Rechtsfähigkeit<br />
Bereits im Kreissaal verän<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong> rechtliche Status des Neugeborenen. Denn<br />
es wird unmittelbar nach <strong>der</strong> Geburt zu e<strong>in</strong>er eigenen Rechtspersönlichkeit.<br />
E<strong>in</strong>e von mehreren Rechtsfolgen <strong>der</strong> Geburt ist die Fähigkeit des Neugeborenen,<br />
am Rechtsverkehr teilnehmen zu können.<br />
Def<strong>in</strong>ition: Unter <strong>der</strong> Rechtsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, Träger<br />
von Rechten und Pflichten se<strong>in</strong> zu können. Träger von Rechten<br />
können natürliche Personen und juristische Personen se<strong>in</strong>.<br />
Natürliche Personen s<strong>in</strong>d alle Menschen; zu juristischen Personen<br />
zählen Firmen und Vere<strong>in</strong>e.<br />
Beg<strong>in</strong>n: Nach § 1 BGB beg<strong>in</strong>nt die Rechtsfähigkeit mit <strong>der</strong> Vollendung<br />
<strong>der</strong> Geburt. Dies ist <strong>der</strong> Fall, wenn das lebende K<strong>in</strong>d (Nachweis<br />
<strong>der</strong> sicheren Lebensfunktion) den Mutterleib vollständig verlassen<br />
hat. Die Nabelschnur muß aber noch nicht durchtrennt se<strong>in</strong>.<br />
Inhalt: Das Neugeboren ist somit rechtsfähig, wenn es sich entwe<strong>der</strong> um<br />
e<strong>in</strong>e Lebendgeburt o<strong>der</strong> um e<strong>in</strong>e (lebende) Frühgeburt handelt.<br />
Lebendgeburt: Sie liegt vor, wenn bei dem Neugeborenen nach<br />
<strong>der</strong> Scheidung <strong>der</strong> Nabelschnur vom Mutterleib<br />
entwe<strong>der</strong> das Herz geschlagen o<strong>der</strong> die Nabelschnur<br />
pulsiert o<strong>der</strong> die natürliche Lungenatmung<br />
e<strong>in</strong>gesetzt hat. Die Lebensfähigkeit ist dabei nicht<br />
entscheidend.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 36 von 180<br />
II. Parteifähigkeit<br />
III. Meldepflichten<br />
Frühgeburt: Sie liegt vor, wenn das K<strong>in</strong>d vor dem Ende <strong>der</strong> 37.<br />
bzw. 38 Schwangerschaftswoche mit e<strong>in</strong>em Lebendgewicht<br />
von 2500 g und weniger geboren<br />
wird. (Nach <strong>der</strong> Rspr. des BAG: Auch die Frühgeburt<br />
ist e<strong>in</strong>e Entb<strong>in</strong>dung i.S.d. MuSchG).<br />
Beachte: Auch wenn das K<strong>in</strong>d nach <strong>der</strong> Geburt wie<strong>der</strong> gestorben ist, hat<br />
es die Rechtsfähigkeit erworben und war sogar erbberechtigt.<br />
Auch Mißgeburten s<strong>in</strong>d voll rechtsfähig.<br />
Son<strong>der</strong>fälle:Rechtsschutz<br />
bereits<br />
im Mutterleib:<br />
Von dem Grundsatz, daß das K<strong>in</strong>d nach vor <strong>der</strong> vollendeten Geburt<br />
rechtsfähig ist, gibt es zwei Abweichungen:<br />
Nach § 1923 II BGB kann auch e<strong>in</strong> Fötus schon Erbe se<strong>in</strong>es Vaters<br />
se<strong>in</strong>, wenn er im Zeitpunkt des Todes des Elternteils schon<br />
gezeugt, aber noch nicht geboren war und lebend <strong>zur</strong> Welt<br />
kommt. Dann wird die Rechtsfähigkeit vorverlegt.<br />
Wird e<strong>in</strong> Fötus im Mutterleib durch die unerlaubte Handlung e<strong>in</strong>es<br />
an<strong>der</strong>en geschädigt (z.B. Verkehrsunfall), so steht ihm gegen<br />
den Verursacher e<strong>in</strong> Schadensersatzanspruch wegen vorgeburtlicher<br />
Schädigung zu, wenn er lebend <strong>zur</strong> Welt kommt.<br />
Daß die schädigende Handlung vor <strong>der</strong> Geburt liegt, ist <strong>in</strong>soweit<br />
unbeachtlich.<br />
Ende: Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod. Damit enden auch die<br />
rechtlichen Beziehungen e<strong>in</strong>es Patienten aus dem Behandlungsvertrag.<br />
Aber: Die Beendigung <strong>der</strong> Rechtsfähigkeit ist Voraussetzung für<br />
die Organentnahme zu Transplantationszwecken.<br />
Die Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Rechtsstreit vor Gericht Partei zu<br />
se<strong>in</strong>, also Kläger o<strong>der</strong> Beklagter.<br />
Nachdem Sie als Hebamme o<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Geburt (passiv) teilnehmendes <strong>Pflege</strong>personal<br />
die grundsätzliche Rechtsfähigkeit des Neugeborenen ermittelt haben, leiten<br />
sich hieraus für Sie weitere Rechte und Pflichten ab.<br />
In erster L<strong>in</strong>ie s<strong>in</strong>d die Meldepflichten zu nennen. Der staatlichen Rechtsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
ist Kenntnis zu geben, daß e<strong>in</strong> neuer Teilnehmer da ist, <strong>der</strong> nunmehr auch<br />
formell als voll rechtsfähiger Bürger <strong>in</strong> die Rechtsgeme<strong>in</strong>schaft aufzunehmen ist.<br />
Dies geschieht durch die Anmeldung <strong>der</strong> Geburt bei dem Standesamt, <strong>in</strong> dessen<br />
Bezirk das K<strong>in</strong>d geboren wurde.<br />
Lebendgeburt:<br />
E<strong>in</strong>e - anmeldepflichtige - Lebendgeburt liegt vor, wenn<br />
bei dem K<strong>in</strong>d nach Scheidung vom Mutterleib m<strong>in</strong>destens für<br />
wenige Sekunden,<br />
entwe<strong>der</strong> das Herz geschlagen hat und,<br />
die Nabelschnur pulsiert hat o<strong>der</strong>,<br />
die natürliche Lungenatmung e<strong>in</strong>gesetzt hat.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 37 von 180<br />
1. Die Anmeldung<br />
e<strong>in</strong>es neuen<br />
Bürgers<br />
2. Die Abmeldung<br />
e<strong>in</strong>es alten<br />
Bürgers<br />
Wer meldet<br />
wann?<br />
Was wird<br />
gemeldet ?<br />
Son<strong>der</strong>fälle:<br />
<strong>der</strong> eheliche Vater,<br />
die Hebamme, die bei <strong>der</strong> Geburt zugegen war,<br />
<strong>der</strong> Arzt, <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Geburt zugegen war,<br />
an<strong>der</strong>e Personen, die zugegen waren (z.B.: <strong>Pflege</strong>personal),<br />
die Mutter.<br />
Innerhalb e<strong>in</strong>er Woche nach <strong>der</strong> Geburt !<br />
Vor- und Familiennamen <strong>der</strong> Eltern.<br />
Beruf und Wohnort.<br />
Religionszugehörigkeit.<br />
Ort, Tag und Stunde <strong>der</strong> Geburt.<br />
Geschlecht des K<strong>in</strong>des u. Vornamen.<br />
Name, Wohnort, Beruf des die Geburt Anmeldenden.<br />
We<strong>der</strong> die Totgeburt, noch die Fehlgeburt s<strong>in</strong>d meldepflichtig.<br />
Def. Totgeburt: Nach <strong>der</strong> Trennung vom Mutterleib schlägt<br />
we<strong>der</strong> das Herz noch setzt die Lungenatmung e<strong>in</strong> und das Gewicht<br />
<strong>der</strong> Leibesfrucht beträgt m<strong>in</strong>destens 500 g.<br />
Def. Fehlgeburt: Die Totgeburt wiegt weniger als 500 g. Sie<br />
braucht nicht beim Standesamt gemeldet zu werden.<br />
Nach dem E<strong>in</strong>tritt des Todesfalles erfolgt die formelle Abmeldung des nicht mehr<br />
rechtsfähigen Menschen aus <strong>der</strong> Rechtsgütergeme<strong>in</strong>schaft. Dies geschieht:<br />
Am nächsten (Werk-)tag nach E<strong>in</strong>tritt des Todesfalls beim Standesamt.<br />
durch das Familienoberhaupt od. jede Person, die beim Tod zugegen war (also<br />
auch durch das <strong>Pflege</strong>personal, wenn <strong>der</strong> Patient im Krankenhaus gestorben ist).<br />
B. Grundlagen des Vertragsschlusses: Geschäftsfähigkeit<br />
I. Geschäftsfähigkeit<br />
Neben <strong>der</strong> Rechts- und Parteifähigkeit ist für den Vertragsschluss entscheidend, ob<br />
<strong>der</strong> Patient überhaupt e<strong>in</strong>e rechtswirksame Willenserklärung abgeben kann, die ihn<br />
und se<strong>in</strong>en Vertragspartner rechtlich b<strong>in</strong>det.<br />
Die Frage, ob jemand e<strong>in</strong>e Willenserklärung abgeben und damit e<strong>in</strong>en Arztvertrag<br />
o<strong>der</strong> Krankenhausaufnahmevertrag abschließen kann, bemisst sich nach <strong>der</strong> Geschäftsfähigkeit.<br />
Die Geschäftsfähigkeit hängt von <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichts- und Willensfähigkeit<br />
des Patienten ab.<br />
Def<strong>in</strong>ition: Unter Geschäftsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, durch eigene<br />
Willenserklärungen Rechte und Pflichten e<strong>in</strong>gehen zu können.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 38 von 180<br />
I. E<strong>in</strong>schränkungen<br />
Arten: Geschäftsunfähigkeit: Sie besteht vom 1.-7. Lebensjahr. Willenserklärungen<br />
s<strong>in</strong>d immer unwirksam (§ 104 BGB). Folge: E<strong>in</strong><br />
Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>d kann ke<strong>in</strong>en Krankenhausaufnahmevertrag schließen.<br />
E<strong>in</strong>schränkung:<br />
Beschränkte Geschäftsfähigkeit: Sie besteht vom 7.-18. Lebensjahr<br />
(§ 106 BGB). Nicht jede Willenserklärung ist wirksam. Folge:<br />
Nur rechtlich vorteilhafte Willenserklärungen o<strong>der</strong> solche gem.<br />
Taschengeldparagrafen s<strong>in</strong>d wirksam (§§ 107-113 BGB). Ansonsten<br />
s<strong>in</strong>d sie schwebend unwirksam und bedürfen <strong>der</strong> (nachträgl.) Genehmigung<br />
durch den gesetzl. Vertreter (z.B.: Eltern).<br />
Volle Geschäftsfähigkeit: Sie besteht ab dem 18. Lebensjahr.<br />
Folge: Jede Willenserklärung ist wirksam.<br />
Sog. geschäftsunfähige Erwachsene: Wer dement ist und unter Betreuung<br />
steht, kann unter den Voraussetzungen des § 105a BGB<br />
Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens im Bagatellbereich schließen.<br />
Die Geschäftsfähigkeit kann auch vorübergehend e<strong>in</strong>geschränkt<br />
se<strong>in</strong>. Dann kann man entwe<strong>der</strong> ke<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> nur bed<strong>in</strong>gt Verträge (=<br />
vorläufig) schließen. Wichtige E<strong>in</strong>schränkungsgründe s<strong>in</strong>d:<br />
Trunkenheit (dann: bis <strong>zur</strong> Ausnüchterung warten).<br />
Bewußtlosigkeit (Unfallpatient: ist vorübergehend aufzunehmen).<br />
Bei bewußtlosen Unfallpatienten besteht e<strong>in</strong>e vorübergehende Geschäftsunfähigkeit.<br />
Der Vertrag kommt über die GoA zustande.<br />
C. Annex: Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit für rechtliches<br />
Fehlverhalten - Deliktfähigkeit / Strafmündigkeit<br />
Deliktfähigkeit,<br />
Strafmündigkeit<br />
I. Deliktfähigkeit<br />
Die Frage, ob man Patienten, die vorsätzlich Eigentum des Krankenhauses beschädigen<br />
o<strong>der</strong> das Personal tätlich angreifen, stellt sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis häufiger.<br />
Dabei ist schon im Vorfeld juristischer Schritte zu klären, ob sich e<strong>in</strong>e zivilrechtliche<br />
Schadensersatzklage lohnt bzw. wann e<strong>in</strong>e Strafanzeige bei <strong>der</strong> Polizei<br />
wegen Körperverletzung möglicherweise <strong>in</strong>s Leere läuft. Hier stellt sich für Sie die<br />
Frage, ob die Patienten deliktfähig, bzw. strafmündig s<strong>in</strong>d.<br />
Def<strong>in</strong>ition: Unter <strong>der</strong> Deliktfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, wegen<br />
unerlaubter Handlungen zivilrechtlich verpflichtet (= <strong>zur</strong> Verantwortung<br />
gezogen) zu werden.<br />
Abstufungen:<br />
Deliktunfähigkeit: Vom 1.-7. Lebensjahr ist <strong>der</strong> Mensch deliktunfähig.<br />
Folge: Er kann nicht <strong>zur</strong> Verantwortung gezogen werden.<br />
Beschränkte Deliktfähigkeit: Vom 7.-18. Lebensjahr ist <strong>der</strong><br />
Mensch beschränkt deliktfähig. Folge: Er kann nur dann <strong>zur</strong> Verantwortung<br />
gezogen werden, wenn er bei Begehung <strong>der</strong> Tat <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage war, das Unrecht se<strong>in</strong>er Handlung e<strong>in</strong>zusehen (§ 828 BGB).<br />
U.U. können die Eltern belangt werden (Aufsichtspflichtverletzung).<br />
Volle Deliktfähigkeit: Sie tritt ab dem 18. Lebensjahr e<strong>in</strong>.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 39 von 180<br />
II. Strafmündigkeit<br />
Annex:<br />
Def<strong>in</strong>ition: Strafmündigkeit bedeutet die Fähigkeit, wegen <strong>der</strong> Verletzung von<br />
Strafgesetzen <strong>zur</strong> Verantwortung gezogen zu werden.<br />
Abstufungen:<br />
Strafunmündigkeit: Bis zum 14. Lebensjahr ist <strong>der</strong> Mensch strafunmündig.<br />
Folge: Er kann strafrechtlich nicht <strong>zur</strong> Verantwortung<br />
gezogen werden („Zigeunerk<strong>in</strong><strong>der</strong> von Köln“).<br />
Bed<strong>in</strong>gte Strafmündigkeit: Vom 7.-18. Lebensjahr ist <strong>der</strong><br />
Mensch beschränkt deliktfähig. Folge: Er kann nur <strong>zur</strong> Verantwortung<br />
gezogen werden, wenn er bei Tatbegehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage<br />
war, das Unrecht <strong>der</strong> Handlung e<strong>in</strong>zusehen (§ 828 Abs. 2 BGB).<br />
U.U. können die Eltern belangt werden (Aufsichtspflichtverletzung).<br />
Volle Strafmündigkeit: Ab dem 18. Lebensjahr ist <strong>der</strong> Mensch<br />
voll strafmündig nach dem Jugendstrafrecht; ab dem 21. Lebensjahr<br />
nach dem Erwachsenenstrafrecht.<br />
Es werden im Zivil- und Strafrecht verschiedene Arten von rechtlichen Verantwortlichkeiten<br />
unterschieden.<br />
I. Zivilrecht:<br />
II. Strafrecht:<br />
III. Übersicht:<br />
Rechtsfähigkeit (= Träger von Rechten und Pflichten [= grundsätzliche<br />
Fähigkeit, überhaupt rechtliche Verantwortung zu tragen/übernehmen]),<br />
Parteifähigkeit (= Fähigkeit, vor Gericht zu klagen und verklagt<br />
zu werden),<br />
Handlungsfähigkeit (= Fähigkeit, se<strong>in</strong> Handeln <strong>in</strong>tellektuell und<br />
voluntativ zu erkennen und zu bee<strong>in</strong>flussen),<br />
Geschäftsfähigkeit (= Fähigkeit, rechtlich verb<strong>in</strong>dlich zu handeln<br />
[= Verantwortlichkeit für Willenserklärungen]; Achtung:<br />
verschiedene Stufen !),<br />
Deliktfähigkeit (= „Fähigkeit“, für se<strong>in</strong> Verschulden an<strong>der</strong>en<br />
gegenüber zu haften/e<strong>in</strong>zustehen).<br />
Strafmündigkeit (= „Fähigkeit“, wegen <strong>der</strong> Verletzung von Strafgesetzen<br />
zu haften; Achtung: verschiedene Stufen !).<br />
6 Jahre: Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Schulpflicht.<br />
7 Jahre: beschränkte Geschäfts- (§§ 106 BGB) und Deliktfähigkeit<br />
(§ 828 BGB).<br />
14 Jahre: bed<strong>in</strong>gte Straffähigkeit, volle Religionsmündigkeit.<br />
16 Jahre: Personalausweispflicht, Fähigkeit Ablegung Zeugeneid,<br />
beschr. Testierfähigkeit, Ehefähigkeit<br />
18 Jahre: aktives u. passives Wahlrecht, volle Geschäfts- und<br />
Testierfähigkeit, Ehemündigkeit, volle Deliktfähigkeit, Jugendstrafrecht,<br />
Wehrpflicht<br />
21 Jahre: Strafmündigkeit als Erwachsener<br />
40 Jahre: Befähigung <strong>zur</strong> Wahl des Bundespräsidenten<br />
Senilität: Ausübung <strong>der</strong> Geschäftsfähigkeit durch e<strong>in</strong>en Vertreter<br />
(Betreuer).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 40 von 180<br />
D. Der Vertrag: Zustandekommen und Beendigung Krankenhausaufnahme-<br />
und ärztlichen Behandlungsverträgen<br />
1. Wesen e<strong>in</strong>es<br />
Vertrages<br />
I. Der Vertragsschluss im Allgeme<strong>in</strong>en<br />
Dem Patienten muss erklärt werden, dass e<strong>in</strong> regulärer Vertrag geschlossen wird.<br />
Meist erfolgt dies - wie vorliegend - dadurch, daß man e<strong>in</strong>en solchen Vertrag im<br />
Wortlaut aufsetzt und unterschreibt (ausdrücklicher Vertragsschluß). O<strong>der</strong><br />
dadurch, daß man sich stillschweigend über die genauen Modalitäten e<strong>in</strong>igt (konkludenter<br />
Vertragsschluß [= durch schlüssiges Verhalten = den Parteien ist<br />
durch die allgeme<strong>in</strong>en Umstände „klar“, daß e<strong>in</strong> Vertrag geschlossen wird.<br />
Def<strong>in</strong>ition: Der Vertrag ist e<strong>in</strong>e Willense<strong>in</strong>igung. Es handelt sich um e<strong>in</strong> Geschäft<br />
aus <strong>in</strong>haltlich übere<strong>in</strong>stimmenden, mit Bezug aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
abgegebenen Willenserklärungen von m<strong>in</strong>d. zwei Personen.<br />
Voraussetzungen:<br />
Es müssen zwei Willenserklärungen vorliegen. Die zeitlich zuerst<br />
erfolgte Willenserklärung heißt Angebot (§ 145 BGB) und<br />
die zeitlich spätere heißt Annahme (§ 146 BGB).<br />
Angebot und Annahme müssen sich <strong>in</strong>haltlich die gleiche<br />
Kaufsache und den Kaufpreis beziehen.<br />
Neben <strong>der</strong> <strong>in</strong>haltlichen Verknüpfung müssen die Willenserklärungen<br />
auch mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verzweckt se<strong>in</strong> (Synallagma). D.h., daß<br />
jede Partei das von <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en haben möchte, was sie nicht hat.<br />
E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Form (Schriftform) ist nur dann erfor<strong>der</strong>lich,<br />
wenn es vom Gesetz so verlangt wird.<br />
Folgen: Die Parteien berechtigen und verpflichten sich gegenseitig. Damit<br />
gewähren sie sich gegenseitige Ansprüche, die je<strong>der</strong> beim an<strong>der</strong>en<br />
geltend machen kann (= e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>n).<br />
Die Ansprüche ist meist sowohl schuldrechtlich (= Wille, die Sache<br />
zu verkaufen/kaufen) als auch d<strong>in</strong>glich (= die Verpflichtung<br />
<strong>zur</strong> Übertragung des Eigentums an <strong>der</strong> Sache)<br />
2. Grafische Vertragsschluß zwischen zwei Parteien, §§ 145 ff. BGB<br />
Übersicht:<br />
1. Angebot<br />
a. Vorliegen e<strong>in</strong>es Angebots<br />
b. Wirksamwerden des Angebots<br />
Das Angebot ist wirksam, wenn es <strong>in</strong> den Machtbereich des Empfängers<br />
gelangt ist; wenn er es also tatsächlich <strong>zur</strong> Kenntnis genommen hat.<br />
2. Annahme<br />
a. Vorliegen e<strong>in</strong>er Annahmeerklärung<br />
b. Wirksamwerden <strong>der</strong> Annahmeerklärung
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 41 von 180<br />
1. Krankenhausaufnahmevertrag<br />
Beson<strong>der</strong>heiten<br />
des Vertragsschlusses<br />
2. Arten von<br />
Krankenhausverträgen(<strong>in</strong>haltlicheAusgestaltung)<br />
3. Inhaltliche Übere<strong>in</strong>stimmung zwischen verzwecktem Angebot u. Annahme<br />
Ist <strong>der</strong> Vertrag geschlossen, ist <strong>der</strong> Anspruch des e<strong>in</strong>en gegen den an<strong>der</strong>en entstanden.<br />
Der vertragliche Anspruch ist e<strong>in</strong>klagbar. Er kann nur durch Kündigung,<br />
Rücktritt o.ä. wie<strong>der</strong> untergehen. Vgl. auch die Darlegungen <strong>zur</strong> Rechtsmethodik.<br />
II. Der Krankenhausaufnahmevertrag<br />
Mit Abschluß des Krankenhausaufnahmevertrages erlangt <strong>der</strong> Patient e<strong>in</strong>en Anspruch<br />
gegen den Krankenhausträger auf sämtliche ärztliche und pflegerische Leistungen<br />
sowie auf mediz<strong>in</strong>isch-technische Leistungen wie Unterkunft, Verpflegung<br />
und Befriedigung persönlicher Ansprüche wie Aufklärung und Beachtung <strong>der</strong><br />
Schweigepflicht.<br />
Vertragsschluß:<br />
a. Totaler<br />
Krankenhausaufnahmevertrag:<br />
Es gelten die Bed<strong>in</strong>gungen, die zuvor dargelegt wurden. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
ist zu beachten:<br />
Der Vertrag ist e<strong>in</strong> privatrechtlicher Dienstvertrag gemäß §<br />
611 BGB. Teilweise enthält er aber auch werkvertragliche (=<br />
Beköstigung) und mietvertragliche (= Raumüberlassung) Elemente.<br />
Fast alle Krankenhäuser verwenden beim Vertragsschluß<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Vertragsbed<strong>in</strong>gungen. Diese unterliegen nach <strong>der</strong><br />
Rechtsprechung <strong>der</strong> AGB-Kontrolle.<br />
Wie auch beim Behandlungsvertrag zwischen Patient und nie<strong>der</strong>gelassener<br />
Arzt kontrahieren auch Patient und Krankenhaus<br />
entwe<strong>der</strong> ausdrücklich o<strong>der</strong> konkludent.<br />
Br<strong>in</strong>gen die Eltern ihr K<strong>in</strong>d selbst <strong>in</strong>s Krankenhaus, kommt <strong>der</strong> Aufnahmevertrag<br />
als Vertrag zugunsten Dritter zustande, § 328 I BGB.<br />
Bei Notfällen, bei Bewußtlosen und bei M<strong>in</strong><strong>der</strong>jährigen, die<br />
nicht von ihren Eltern gebracht werden, kommt <strong>der</strong> Aufnahmevertrag<br />
über die Grundsätze <strong>der</strong> Geschäftsführung ohne Auftrag<br />
§ 677 BGB) zustande.<br />
Wie beim Arztvertrag gilt auch beim Krankenhausaufnahmevertrag<br />
<strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Vertragsfreiheit. Ausnahme: Es liegt e<strong>in</strong><br />
Notfall für das Leben d. Patienten vor.<br />
Dies ist <strong>der</strong> Regelvertragstypus. Er umfaßt alle für die stationäre<br />
Behandlung erfor<strong>der</strong>lichen Leistungen e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> ärztlichen<br />
Behandlung. Es liegt e<strong>in</strong> Vertrag vor.<br />
Der Kassenpatient erhält eigene vertragliche Ansprüche gegen<br />
das Krankenhaus. Dieses ist verpflichtet, ihm alle Leistungen zu<br />
verschaffen, die e<strong>in</strong>e stationäre Aufnahme erfor<strong>der</strong>t. Neben Unterkunft<br />
und Verpflegung s<strong>in</strong>d das <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die ärztliche<br />
Versorgung e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> Operationen.<br />
Der angestellte Arzt und das nichtärztliche Personal s<strong>in</strong>d Erfüllungsgehilfen<br />
des Krankenhausträgers nach § 278 BGB. (Ausnahme: Leiten<strong>der</strong><br />
Oberarzt ist Organ, § 31 BGB). Mit dem Krankenhausarzt<br />
kommen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel ke<strong>in</strong>e vertraglichen Beziehungen zustande.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 42 von 180<br />
b. GespaltenerKrankenhausaufnahmevertrag:<br />
c. Totaler<br />
Krankenhausaufnahmevertrag<br />
mit<br />
Arztzusatzvertrag:<br />
Der Patient erhält alle Regelleistungen des Krankenhauses (Regelbehandlung).<br />
Er kann mit dem Krankenhausträger Zusatzvere<strong>in</strong>barungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Unterkunft (= Komfortunterkunft)<br />
o<strong>der</strong> Bereitstellung <strong>in</strong>dividueller Verpflegung treffen (=<br />
sog. nichtärztliche Wahlleistungen).<br />
Der Patient hat beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag ke<strong>in</strong>en<br />
Anspruch auf die Behandlung durch e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Arzt o<strong>der</strong> bestimmtes <strong>Pflege</strong>personal. Aber: wenn <strong>der</strong> Patient<br />
se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung zum E<strong>in</strong>griff ausdrücklich auf e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Arzt beschränkt, kann er nur durch diesen behandelt<br />
werden. Aber: Er riskiert, weil er ke<strong>in</strong>en vertraglichen Anspruch<br />
auf Behandlung durch e<strong>in</strong>en bestimmten Arzt hat, dass<br />
er ggf. unbehandelt bleibt, wenn se<strong>in</strong> Wunscharzt aus welchen<br />
Gründen auch immer verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t ist (BGH, MedR 2010, 788),<br />
Die weiteren Leistungsrechte und -pflichten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> formularmäßigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen festgelegt (AGB´s).<br />
Hier werden zwei Verträge abgeschlossen. E<strong>in</strong>er mit dem Krankenhaus<br />
und e<strong>in</strong>er mit dem Arzt. Der Krankenhausträger schuldet<br />
dann nur die Unterbr<strong>in</strong>gung und allgeme<strong>in</strong>e Versorgung<br />
und <strong>der</strong> Arzt ausschließlich die ärztliche Behandlung.<br />
Der Kassenpatient erhält eigene vertragliche Ansprüche sowohl<br />
gegen das Krankenhaus, als auch gegen den Arzt.<br />
Das nichtärztliche und ärztliche Personal (Ausnahme: Leiten<strong>der</strong><br />
Oberarzt) ist Erfüllungsgehilfe des Krankenhausträgers nach §<br />
278 BGB. Es haftet <strong>der</strong> Krankenhausträger für se<strong>in</strong> <strong>Pflege</strong>personal.<br />
Der Belegarzt h<strong>in</strong>gegen haftet für sich selbst und se<strong>in</strong> eigenes<br />
Verschulden. Problematisch ist die Schnittmenge. Sie<br />
liegt vor, wenn <strong>Pflege</strong>personal des Krankenhausträgers dem Belegarzt<br />
zugewiesen wird und e<strong>in</strong>en <strong>Pflege</strong>fehler begeht. Fraglich<br />
ist dann, als wessen Erfüllungsgehilfe das <strong>Pflege</strong>personal dann<br />
gehandelt hat. (Zu diesem Problem wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Übersicht „Schadensersatzrecht“<br />
ausführlicher Stellung bezogen).<br />
Der Patient erhält alle Regelleistungen des Krankenhauses (Regelbehandlung).<br />
Er kann mit dem Krankenhausträger auch Zusatzvere<strong>in</strong>barungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Unterkunft (= Komfortunterkunft)<br />
o<strong>der</strong> Bereitstellung <strong>in</strong>dividueller Verpflegung treffen<br />
(= sog. nichtärztliche Wahlleistungen).<br />
Die weiteren Leistungsrechte und -pflichten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> formularmäßigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen festgelegt (AGB´s).<br />
Bei diesem Typ schließt <strong>der</strong> Patient e<strong>in</strong>en totalen Krankenhausvertrag<br />
und e<strong>in</strong>en Behandlungsvertrag mit dem Arzt über zusätzliche<br />
Behandlungen. Der Arzt hat dabei e<strong>in</strong> eig. Liquidationsrecht.<br />
Typischerweise s<strong>in</strong>d dies die Krankenhausaufnahmeverträge,<br />
die mit Privatpatienten geschlossen werden.<br />
Das Krankenhaus ist <strong>zur</strong> Bereitstellung aller Leistungen <strong>der</strong> vollstationären<br />
Aufnahme verpflichtet. Obwohl e<strong>in</strong> Arztzusatzvertrag mit e<strong>in</strong>em<br />
liquidationsberechtigten Arzt vorliegt, ist das Krankenhaus aber<br />
auch verpflichtet die ärztliche Versorgung <strong>zur</strong> gewährleisten. Es liegt<br />
also ke<strong>in</strong> gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag vor.<br />
Arzt und nichtärztliches Personal s<strong>in</strong>d Erfüllungsgehilfen des<br />
Krankenhausträgers nach § 278 BGB. Ausnahme: Leiten<strong>der</strong><br />
Oberarzt ist Organ, § 31 BGB.<br />
Auch bei diesem Typ kann <strong>der</strong> Patient wie<strong>der</strong> wählen zwischen den<br />
Regelleistungen des Krankenhauses (Regelbehandlung) und den<br />
zusätzlich zu vere<strong>in</strong>barenden nichtärztlichen Wahlleistungen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 43 von 180<br />
3. Pflichten aus<br />
Krankenhausaufnahmeverträgen<br />
4. Beendigung<br />
des Vertrages<br />
1. Vertragsschluß<br />
Die Leistungsrechte und -pflichten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> formularmäßigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen festgelegt (siehe oben : AGB-Kontrolle).<br />
Anm.: Beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag<br />
tritt oft die Variante auf, daß Krankenhäuser bei Zusatzverträgen<br />
mit liquidationsberechtigten Ärzten statt dessen den<br />
Vertragstypus des gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages<br />
vere<strong>in</strong>baren wollen, um sich von <strong>der</strong> Haftung für Fehler des liquidationsberechtigten<br />
Arztes freizuhalten (vgl.: Kramer, NJW<br />
1996, 2398 ff.). Dies ist grundsätzlich möglich; an die Wirksamkeit<br />
solcher Vere<strong>in</strong>barungen stellt <strong>der</strong> BGH <strong>in</strong>des hohe Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
(Zu den rechtlichen Voraussetzungen: BGH, NJW<br />
1993, 779 ff.; bes. OLG Koblenz, NJW 1998, 3425).<br />
Schließlich hat <strong>der</strong> Patient ke<strong>in</strong>en Anspruch auf die Behandlung<br />
durch e<strong>in</strong>en bestimmten Arzt.<br />
Aus den Krankenhausaufnahmevertrag ergeben sich unabhängig von dessen Typus<br />
folgende weitere vertragliche Verpflichtungen des Krankenhauses:<br />
Sicherstellung und Beachtung <strong>der</strong> organisatorischen und pflegerischen Sorgfaltspflichten<br />
(dazu mehr im Kapitel „Haftungsrecht“)<br />
Durchführung <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen und pflegerischen Dokumentation,<br />
Es muß dem Patienten E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Behandlungsunterlagen gewähren:<br />
Aber nur <strong>in</strong> die objektiven physischen Befunde und Berichte über Behandlungsmaßnahmen<br />
(Medikation, Operation),<br />
die Pflicht <strong>zur</strong> Gewährung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme kann aus therapeutischen Gründen e<strong>in</strong>geschränkt<br />
se<strong>in</strong>, um e<strong>in</strong>en gesundheitlichen Schaden beim Patienten zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
(BVerfG, MedR 1993, 232 ff.). Möglich ist jedoch, daß <strong>der</strong> Patient die Unterlagen im<br />
Beise<strong>in</strong> des Arztes e<strong>in</strong>sieht (sog. kontrollierte Beschäftigung mit <strong>der</strong> Krankheit),<br />
praktisch kann die E<strong>in</strong>sichtnahme vor Ort im Krankenhaus vorgenommen werden,<br />
Verwahrung und Sicherung <strong>der</strong> Wertgegenstände des Patienten,<br />
jedwede Unterstützung des Patienten bei <strong>der</strong> Errichtung e<strong>in</strong>es Nottestamentes.<br />
Das Krankenhaus muß ke<strong>in</strong>en Rechtsrat erteilen, allerd<strong>in</strong>gs muß es wissen, wie<br />
fachkundige Personen zu erreichen s<strong>in</strong>d, um die Errichtung vorzunehmen.<br />
Die Beendigung des Krankenhausaufnahmevertrages ist durch beide Parteien möglich;<br />
dies darf die Gesundheit o<strong>der</strong> das Leben des Patienten nicht gefährden.<br />
1. Durch den Krankenhausträger:<br />
- wenn die ärztliche Behandlung abgeschlossen ist,<br />
- wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, <strong>Pflege</strong>person und Patient bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
ist (z.B. Patient bezweifelt sorgfältige <strong>Pflege</strong>behandlung),<br />
- wenn sich <strong>der</strong> Patient nicht an die Anordnungen des Arztes hält,<br />
- Patient verstößt wie<strong>der</strong>holt und grob gegen die Hausordnung.<br />
2. Durch den Patienten:<br />
- <strong>in</strong>dem dieser die Kündigung erklärt und die Entlassung verlangt,<br />
- wenn er die weitere Behandlung verweigert und so die E<strong>in</strong>willigung <strong>zur</strong>ücknimmt<br />
(meist lassen sich die Ärzte aus haftungsrechtlichen Gründen auf e<strong>in</strong>em<br />
Formular bestätigen, daß sie den Patienten über die mediz<strong>in</strong>ischen Folgen<br />
des Behandlungsabbruchs aufgeklärt haben).<br />
III. Der ärztliche Behandlungsvertrag<br />
Der Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Hausarzt kommt nach den vorgenannten<br />
Grundsätzen von Angebot, Annahme und <strong>in</strong>haltlicher Übere<strong>in</strong>stimmung von Angebot<br />
und Annahme zustande.<br />
Es gilt <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Vertragsfreiheit (Patient kann den Arzt frei wählen).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 44 von 180<br />
2. Vertrags<strong>in</strong>halt<br />
Für den Arzt gilt aber § 95 Abs. 3 SGB V, wonach <strong>der</strong> Arzt <strong>zur</strong> Teilnahme an<br />
<strong>der</strong> vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist und wonach<br />
<strong>der</strong> Arzt grundsätzlich <strong>zur</strong> Behandlung verpflichtet (sog. Kontrahierungszwang,<br />
weil <strong>der</strong> Arzt e<strong>in</strong>en Behandlungsvertrag schließen muß) ist. Er kann die<br />
Behandlung nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen ablehnen.<br />
Beson<strong>der</strong>heiten: <br />
Behandlungsvertrag<br />
mit Aids-<br />
Patienten ?<br />
Meist werden die Arztverträge konkludent, d.h. durch schlüssiges<br />
Verhalten, geschlossen. Also dadurch, daß <strong>der</strong> Patient zum<br />
Arzt geht und dieser mit <strong>der</strong> Behandlung beg<strong>in</strong>nt.<br />
Bei M<strong>in</strong><strong>der</strong>jährigen und Bewußtlosen kommt <strong>der</strong> Arztvertrag<br />
nach den Grundsätzen <strong>der</strong> GoA zustande.<br />
Der Vertrag wird als Dienstvertrag nach § 611 BGB geschlossen.<br />
Nur etwa bei Zahnprothesen o<strong>der</strong> Schuhe<strong>in</strong>lagen kommt<br />
e<strong>in</strong> Werkvertrag nach § 631 BGB zustande.<br />
Folge: Beim Dienstvertrag schuldet <strong>der</strong> Arzt nur die Behandlung<br />
selbst, also lediglich das Bemühen um den Heilungserfolg,<br />
nicht aber den Behandlungserfolg an sich.<br />
Zwar schließt <strong>der</strong> Arzt beim Kassenpatient mit <strong>der</strong> Krankenkasse<br />
e<strong>in</strong>en öffentlich-rechtlichen Vertrag. Dabei gelangt aber<br />
Dienstvertragsrecht <strong>zur</strong> Anwendung, weil die Übernahme <strong>der</strong><br />
Behandlung e<strong>in</strong>es Kassenpatienten den Arzt <strong>zur</strong> Sorgfalt nach<br />
den Vorschriften des BGB verpflichtet, § 76 Abs. 4 SGB V (vgl.<br />
Müller-Glöge, <strong>in</strong>: MüKo, Bd. 4, 3. Aufl. 1997, § 611 Rdnr. 48).<br />
Nur e<strong>in</strong> triftiger Grund erlaubt es dem nie<strong>der</strong>gelassenen Kassenarzt,<br />
e<strong>in</strong>en Aids-Patienten abzuweisen.<br />
Wirtschaftliche Gründe berechtigen nicht <strong>zur</strong> Ablehnung von<br />
HIV-Patienten: Der Arzt kann sich nicht darauf berufen, daß<br />
ggf. die Gefahr bestünde, daß Patienten se<strong>in</strong>er Praxis fernblieben,<br />
wenn er e<strong>in</strong>en Virusträger behandelt.<br />
Es zählen nur solche Gründe, die das Verhältnis Arzt - Patient<br />
betreffen und e<strong>in</strong> gestörtes Vertrauensverhältnis verursachen.<br />
Auch die (berufsbed<strong>in</strong>gte) Infektionsgefahr wiegt ke<strong>in</strong>esfalls so<br />
schwer, daß die Behandlung dieses Patienten unzumutbar wäre.<br />
(Man kann durch Schutzhandschuhe und gesteigerte Aufmerksamkeit<br />
das Risiko weith<strong>in</strong> beherrschen).<br />
Der Arzt schuldet dem Patienten als Hauptpflichten:<br />
die Behandlungspflicht (Pflicht <strong>zur</strong> fachgerechten Bemühung um Heilerfolg<br />
und mediz<strong>in</strong>ische Fürsorge für das Wohl des Patienten [= qualifizierte und sorgfältige<br />
mediz<strong>in</strong>ische Behandlung nach den anerkannten Regeln ärztlicher<br />
Kunst]; auch Betreuung und <strong>Pflege</strong>, dabei hat <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
zu behandeln),<br />
die Aufklärungspflicht (<strong>der</strong> Patient muß die Chancen und Risiken <strong>der</strong> Behandlung<br />
genau kennen),<br />
Dokumentationspflicht (die Krankenunterlagen s<strong>in</strong>d sorgfältig und vollständig<br />
zu führen; <strong>der</strong> Patient hat e<strong>in</strong> Recht auf E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> diese Unterlagen),<br />
Verschwiegenheitspflicht (Der Arzt muß über die Krankheit und alles, was<br />
ihm während <strong>der</strong> Behandlung bekannt geworden ist, schweigen),<br />
Besuchspflicht (<strong>der</strong> frei praktizierende Arzt ist verpflichtet, se<strong>in</strong>e Patienten ggf.<br />
zu Hause zu besuchen),<br />
Pflicht <strong>zur</strong> Gewährung von E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die Krankenunterlagen (vgl. hierzu auch<br />
die Ausführungen zum Krankenhausaufnahmevertrag und <strong>der</strong> Dokumentation).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 45 von 180<br />
3. Beendigung<br />
des Arztvertrages<br />
Der Patient schuldet dem Arzt:<br />
die Mitwirkungspflicht (Pflicht, an <strong>der</strong> Behandlung mitzuwirken; dies umfasst<br />
auch die Duldung <strong>der</strong> Untersuchung und Behandlung),<br />
die Honorarzahlung (bei Kassenpatienten ist <strong>der</strong> Honoraranspruch gegenüber<br />
<strong>der</strong> kassenärztlichen Vere<strong>in</strong>igung entstanden; bei Privatpatienten ist <strong>der</strong> Anspruch<br />
gegenüber dem Patienten selbst entstanden - hier wird nach <strong>der</strong> GOÄ<br />
abgerechnet).<br />
Beson<strong>der</strong>e<br />
vertraglichePflichten:<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus werden dem Patienten gegenüber aus dem ärztlichen<br />
Behandlungsvertrag folgende Leistungen geschuldet:<br />
sämtliche Handlungen, die geeignet s<strong>in</strong>d <strong>zur</strong> Ermittlung, Behandlung<br />
o<strong>der</strong> L<strong>in</strong><strong>der</strong>ung von Krankheiten,<br />
E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen aller ärztlichen und heilkundlichen Kenntnisse<br />
<strong>zur</strong> Behandlung von Krankheiten, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e:<br />
Stellen <strong>der</strong> Heilanzeige (Indikation), mit <strong>der</strong> e<strong>in</strong> bestimmtes<br />
Heilverfahren <strong>zur</strong> Anwendung gelangt,<br />
Stellen <strong>der</strong> Prognose über den möglichen Behandlungserfolg,<br />
E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen aller Maßnahmen, die <strong>zur</strong> Erkennung von Krankheiten<br />
(Diagnose) u. <strong>zur</strong> L<strong>in</strong><strong>der</strong>ung (Therapie) geeignet s<strong>in</strong>d,<br />
Aufklärung des Patienten über Umfang <strong>der</strong> Behandlung und<br />
Beachtung <strong>der</strong> Schweigepflicht,<br />
E<strong>in</strong>halten <strong>der</strong> aktuellen mediz<strong>in</strong>ischen Standards,<br />
kann <strong>der</strong> Arzt nicht die erfor<strong>der</strong>lichen<br />
organisatorischen, personellen und sachlichen<br />
Voraussetzungen für die Behandlung sicherstellen, ist <strong>der</strong> Patient<br />
an e<strong>in</strong>en geeigneten Arzt o<strong>der</strong> Krankenhaus zu überweisen.<br />
alle Arzneimittel und Mediz<strong>in</strong>produkte, die <strong>zur</strong> Behandlung<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden, müssen die gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Qualitäts- und Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen erfüllen (dafür tragen<br />
neben dem Arzt auch die pharmazeutischen Hersteller Verantwortung).<br />
Vertrauliche Behandlung <strong>der</strong> Patientendaten und -unterlagen;<br />
Weitergabe nur mit E<strong>in</strong>verständnis des Patienten,<br />
alle <strong>in</strong> Datenbanken gespeicherten Angaben s<strong>in</strong>d technisch und<br />
organisatorisch gegen Zerstörung, Än<strong>der</strong>ung und unbefugten<br />
Zugriff zu schützen.<br />
Der Arztvertrag endet entwe<strong>der</strong> durch den Abschluß <strong>der</strong> Behandlung nach erfolgter<br />
Heilung o<strong>der</strong> durch Kündigung.<br />
Kündigung<br />
durch den<br />
Arzt<br />
Kündigung<br />
durch den<br />
Patienten<br />
Der Arzt hat - da die ordentliche Kündigung ausscheidet (§ 621<br />
BGB) - e<strong>in</strong> Recht <strong>zur</strong> fristlosen Kündigung nach § 626 BGB wegen<br />
Unzumutbarkeit <strong>der</strong> Fortsetzung <strong>der</strong> Behandlung:<br />
wenn er überlastet ist,<br />
<strong>der</strong> Patient sich nicht an die ärztlichen Maßnahmen hält o<strong>der</strong><br />
querulativ ist (Schlechtmachen des Arztes bei Patienten).<br />
Bei Kündigung durch den Arzt darf ke<strong>in</strong>e Gefahr für Leib, Leben<br />
o<strong>der</strong> Gesundheit des Patienten entstehen, ggf. muß <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> diesem<br />
Fall die Behandlung fortsetzen, bis e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er Arzt den Patienten<br />
weiter behandelt.<br />
Dem Patient steht das Recht <strong>zur</strong> fristlosen Kündigung nach § 627<br />
BGB wegen Störung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses<br />
zu. Dazu entzieht er dem Arzt se<strong>in</strong> Vertrauen. E<strong>in</strong> alternativer
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 46 von 180<br />
Kündigungsgrund besteht auch im Zurückziehen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung<br />
<strong>in</strong> die Behandlung. Der Patient ist jedoch verpflichtet, dem<br />
Arzt die diesem bis zum Vertragsende zustehende Vergütung zu<br />
zahlen.<br />
E. Vertragliche Nebenpflichten des Arztvertrages: Die Patientenaufklärung<br />
I. Das Aufklärungsgespräch<br />
Der Arzt führt die Aufklärung des Patienten <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es normalen Patientengesprächs<br />
durch. Die Aufklärung soll durch umfassende Information über die Krankheit,<br />
den E<strong>in</strong>griff und die Folgen die E<strong>in</strong>sicht des Patienten <strong>in</strong> die Erfor<strong>der</strong>lichkeit<br />
des mediz<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>griffs bewirken. Der Arzt ist <strong>zur</strong> Aufklärung verpflichtet.<br />
Kritik an <strong>der</strong> Aufklärung hat es immer gegeben. Dies verdeutlicht e<strong>in</strong> Satz aus<br />
dem Westöstlichen Diwan, Hikmet Nameh, Buch <strong>der</strong> Sprüche: „Wofür ich Allah<br />
höchlich dank ? Daß er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müßte je<strong>der</strong> Kranke,<br />
das Übel kennend, wie es <strong>der</strong> Arzt kennt“. (zitiert nach Laufs, Arztrecht, S. 92).<br />
1. S<strong>in</strong>n und<br />
Zweck <strong>der</strong><br />
Aufklärung<br />
2. Rechtsgrundlagen<br />
<strong>der</strong> Aufklärung<br />
3. Abgrenzung<br />
<strong>zur</strong><br />
Beratung<br />
4. Folgen<br />
<strong>der</strong> Aufklärung<br />
Je<strong>der</strong> Patient hat das Recht, Art und Umfang <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Behandlung selbst zu bestimmen und dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zuwilligen.<br />
Der Patient kann nur dann <strong>in</strong> die Behandlung e<strong>in</strong>willigen, wenn<br />
er weiß, worum es geht, d.h. er muß wissen, wor<strong>in</strong> er e<strong>in</strong>willigt.<br />
Bei mediz<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>griffen ist daher e<strong>in</strong>e umfassende Aufklärung<br />
vor <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung und dem E<strong>in</strong>griff erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Die Aufklärung resultiert aus dem allgeme<strong>in</strong>en Persönlichkeitsrecht<br />
aus Art. 2 GG und <strong>der</strong> Menschenwürde aus Art. 1 GG.<br />
Nur die Information kann die Entscheidungsfreiheit des Patienten,<br />
die Ausfluß se<strong>in</strong>es Persönlichkeitsrechts ist, gewährleisten.<br />
Die Aufklärungspflicht ist Hauptpflicht des Behandlungsvertrages<br />
und auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Musterberufsordnung <strong>der</strong> Ärzte geregelt<br />
Die Aufklärung führt die Entscheidungsfreiheit des Patienten<br />
vor e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>griff herbei. Er muß nach <strong>der</strong> Aufklärung <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage se<strong>in</strong>, das Für und Wi<strong>der</strong> des E<strong>in</strong>griffs abzuwägen.<br />
Die Beratung leitet den Patienten zu gesundheitsgerechtem<br />
Verhalten an und vermittelt ihm mediz<strong>in</strong>isches Wissen für e<strong>in</strong>e<br />
verantwortliche und gesunde Lebensführung.<br />
Die Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflicht ist e<strong>in</strong><br />
ärztlicher Behandlungsfehler.<br />
Erst die Aufklärung versetzt den Patienten <strong>in</strong> rechtswirksamer<br />
Weise <strong>in</strong> die Lage zu entscheiden, ob er e<strong>in</strong>e Behandlung ablehnt<br />
o<strong>der</strong> abbricht, auch wenn diese mediz<strong>in</strong>isch geboten ist.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 47 von 180<br />
II. Rechtmäßig- Die Aufklärung ist ordnungsgemäß und damit rechtswirksam, wenn sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> richkeitsvoraussetzungen<br />
<strong>der</strong> Auftigen<br />
Weise, im gebotenen Umfang und rechtzeitig erfolgt.<br />
klärung 1. E<strong>in</strong>willigungsfähiger Patient<br />
Voraussetzung <strong>der</strong> Aufklärung ist <strong>der</strong> e<strong>in</strong>willigungsfähige und e<strong>in</strong>willigungsbereite<br />
Patient.<br />
Der Patient kann nur dann wirksam <strong>in</strong> die Behandlung e<strong>in</strong>willigen, wenn er die<br />
<strong>zur</strong> Aufklärung erfor<strong>der</strong>liche E<strong>in</strong>sichtsfähigkeit besitzt (dazu mehr im strafrechtlichen<br />
Teil dieses Skriptes).<br />
2. Richtige Weise<br />
Die Aufklärung ist richtig, wenn sie mündlich u. zus. durch Formblatt erfolgt.<br />
a. Allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze beachtet ?<br />
Die Aufklärung ist nicht an e<strong>in</strong>e bestimmte Form - auch nicht an die<br />
Patientenunterschrift - gebunden.<br />
Die Unterschrift begründet aber die Urkundenechtheit <strong>der</strong> Aufklärung<br />
und erleichtert dem Arzt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Prozeß die Beweisführung<br />
ihrer Durchführung.<br />
Das Aufklärungsgespräch muß mündlich durch den behandelnden<br />
Arzt durchgeführt werden.<br />
b. E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> M<strong>in</strong>destanfor<strong>der</strong>ungen durch das Formblatt ?<br />
Das Formblatt darf nicht zu allgeme<strong>in</strong> se<strong>in</strong>. Es ergänzt die Aufklärung<br />
nur (!!) und kann sie nicht ersetzen (sog. „Protokollfunktion“).<br />
Es muß detailliert auf die speziellen, dem E<strong>in</strong>griff anhaftenden Risiken<br />
h<strong>in</strong>weisen (BGH, NJW 1994, 793) und den späteren E<strong>in</strong>griff genau abdecken<br />
(sog. „Individualisierungsfunktion“). Sonst ist das Formblatt<br />
nur e<strong>in</strong> Indiz dafür, dass e<strong>in</strong>e Aufklärung (mit dem Inhalt <strong>der</strong> formularmäßigen<br />
Bestätigung ) wohl stattgefunden hat (OLG Oldenburg,<br />
MedR 2010, 570 [571]).<br />
Es muß Angaben enthalten, ob <strong>der</strong> Patient den Arzt befragt hat o<strong>der</strong><br />
auf die Möglichkeit <strong>zur</strong> Befragung h<strong>in</strong>gewiesen wurde. Der Arzt muß<br />
sich hiervon überzeugt haben (sog. „Kontrollfunktion“).<br />
Das Formblatt muß ausgefüllt und unterschrieben se<strong>in</strong>! E<strong>in</strong> nicht<br />
ausgefülltes und unterschriebenes Aufklärungsformular <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenakte<br />
bildet e<strong>in</strong> Indiz nicht für, son<strong>der</strong>n gegen die Durchführung<br />
e<strong>in</strong>es Aufklärungsgesprächs (OLG München, MedR 2006, 431 [432]).<br />
Es hält <strong>der</strong> AGB-Kontrolle stand (=ke<strong>in</strong>e unangemessene Benachteiligung).<br />
c. Formblatt und Aufklärung s<strong>in</strong>d allgeme<strong>in</strong>verständlich?<br />
Sowohl die Aufklärung wie auch das Formblatt müssen verständlich<br />
se<strong>in</strong> und auf die psychische Ausnahmesituation des Patienten Rücksicht<br />
nehmen. Der Patient muß alles verstanden haben. Hierbei kommt<br />
es entscheidend auf den Empfängerhorizont des Patienten an.<br />
3. Gebotener Umfang<br />
Der Aufklärungsumfang ist ordnungsgemäß, wenn alle E<strong>in</strong>griffsrichtungen<br />
und -folgen je nach Art <strong>der</strong> Intensität <strong>in</strong>haltlich erfaßt s<strong>in</strong>d.<br />
Hierbei gilt aber, daß die Aufklärung nicht pauschal erfolgen kann, son<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Umfang vom konkreten E<strong>in</strong>griff abhängt. Erst im Gespräch kann man merken,<br />
ob <strong>der</strong> Patient alles verstanden hat und ob er ausreichend aufgeklärt ist.<br />
a. Diagnoseaufklärung (Grund- o<strong>der</strong> Befundaufklärung)<br />
Die ist die Aufklärung über den ärztlichen Befund. In Anlehnung an<br />
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten hat sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Form rationaler<br />
Kommunikation stattzuf<strong>in</strong>den mit <strong>der</strong> Folge, daß <strong>der</strong> Patient<br />
sachlich und schonen vollständig aufzuklären ist.<br />
Die Diagnoseaufklärung hat u.a. für den Arzt <strong>zur</strong> Folge, daß er verpflichtet<br />
ist, alle mediz<strong>in</strong>isch gebotenen Befunde zu erheben und zu sichern.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 48 von 180<br />
Verletzt er diese Pflicht, erschwert er dem Patienten wegen Fehlens des<br />
sonst als Beweismittel <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Untersuchungsergebnisses<br />
die Beweisführung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Haftpflichtprozess. Daher führt e<strong>in</strong>e<br />
fehlerhafte Unterlassung <strong>der</strong> Befun<strong>der</strong>hebung zu e<strong>in</strong>er Beweislastumkehr<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Kausalität für Behandlungsfehler, wenn <strong>der</strong> Befund<br />
zu e<strong>in</strong>em positiven, unübersehbar reaktionspflichtigen Ergebnis geführt hätte<br />
(BGH, MDR 2004, 1056 [1057]).<br />
b. Verlaufsaufklärung<br />
Der Patient ist über Art, Umfang und Durchführung des E<strong>in</strong>griffs zu<br />
<strong>in</strong>formieren. Aber auch über die Folgen des E<strong>in</strong>griffs wie Operationsnarben,<br />
Unfruchtbarkeit o<strong>der</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen von Organen.<br />
c. Heilungsaufklärung<br />
Es s<strong>in</strong>d die Möglichkeiten und Chancen <strong>der</strong> Heilung zu erörtern.<br />
d. Behandlungsaufklärung<br />
Sie <strong>in</strong>formiert über die grundsätzliche Notwendigkeit des E<strong>in</strong>griffs.<br />
Es müssen auch Behandlungsalternativen u. <strong>der</strong>en Risiken dargestellt<br />
werden, wobei <strong>der</strong> Arzt die bevorzugte Methode empfehlen<br />
muss (OLG Koblenz, MedR 2010, 108).<br />
Der Arzt sollte versuchen, den Wi<strong>der</strong>stand e<strong>in</strong>es une<strong>in</strong>sichtigen Patienten<br />
mit Argumenten zu überw<strong>in</strong>den, wenn es <strong>der</strong> Gesundheit dient.<br />
Der Arzt darf aber nicht drängen, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich über die Folgen<br />
<strong>der</strong> Weigerung <strong>in</strong>formieren.<br />
Bricht <strong>der</strong> Patient die Behandlung ab, ist <strong>der</strong> Hausarzt zu <strong>in</strong>formieren.<br />
e. Risikoaufklärung<br />
Sie <strong>in</strong>formiert über nahe und entferntere Gefahren und Komplikationen,<br />
die dem E<strong>in</strong>griff spezifisch anhaften und mit denen bei Beachtung<br />
<strong>der</strong> ärztlichen und pflegerischen Aufklärung zu rechnen ist<br />
(BGH, NJW 2001, 2798).<br />
f. Dr<strong>in</strong>glichkeitsaufklärung<br />
Der Patient soll erfahren, ob e<strong>in</strong>e sofortige Operation/E<strong>in</strong>griff geboten<br />
ersche<strong>in</strong>t o<strong>der</strong> ob er noch Zeit hat, sich zu überlegen.<br />
g. Intensitätsumfang e<strong>in</strong>gehalten<br />
Der Patient soll behutsam über Chancen und Risiken des E<strong>in</strong>griffs<br />
unterrichtet werden. Aber:<br />
bei dr<strong>in</strong>genden E<strong>in</strong>griffen (Lähmung, Todesgefahr) braucht weniger<br />
<strong>in</strong>tensiv und detailliert aufgeklärt zu werden; <strong>der</strong> Patient ist <strong>in</strong><br />
diesen Situationen ehedem nicht geson<strong>der</strong>t aufnahmefähig. Zur<br />
Schonung des Patienten kann auch e<strong>in</strong>e Nichtaufklärung geboten<br />
se<strong>in</strong> (sog. therapeutisches Privileg).<br />
umgekehrt ist bei diagnostischen E<strong>in</strong>griffen ohne therapeutischen<br />
Zweck und drohende Komplikationen am <strong>in</strong>tensivsten aufzuklären.<br />
Der Patient entscheidet selbst, wie detailliert die Aufklärung se<strong>in</strong> soll.<br />
4. Richtiger Zeitpunkt<br />
Der Aufklärungszeitpunkt ist richtig gewählt, wenn <strong>der</strong> Patient ausreichend<br />
Gelegenheit hatte zu entscheiden, entwe<strong>der</strong> im krankhaften Zustand weiterzuleben<br />
o<strong>der</strong> sich <strong>der</strong> Fachkunde des Arztes anzuvertrauen (Hoppe, NJW 1998,<br />
782 ff.).<br />
a. Zeitpunkt im Allgeme<strong>in</strong>en<br />
Bei e<strong>in</strong>fachen ambulanten E<strong>in</strong>griffen reicht e<strong>in</strong>e Aufklärung am Tag<br />
selbst; bei komplizierten ambulanten E<strong>in</strong>griffen e<strong>in</strong>e Frist e<strong>in</strong>en Tag<br />
vor dem E<strong>in</strong>griff (BGH, Urt. v. 25.02.2003, Az.: VI ZR 131/02 ).<br />
Bei operativen E<strong>in</strong>griffen ist schon aufzuklären, wenn <strong>der</strong> Arzt dazu<br />
rät und e<strong>in</strong>en Operationsterm<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>bart.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 49 von 180<br />
III. Folgen fehlerhafterAufklärung<br />
IV. Entlastungsmöglichkeit<br />
des<br />
Arztes bei fehlerhafterAufklärung<br />
V. Delegation<br />
<strong>der</strong> Aufklärung<br />
Bei Notfalloperationen reicht e<strong>in</strong>e Aufklärung kurz vor dem E<strong>in</strong>griff<br />
aus (OLG München, MedR 2007, 601 [604]),<br />
Bei narkotischen Maßnahmen erfolgt die Aufklärung am Vorabend.<br />
b. Zeitpunkt <strong>der</strong> Aufklärung bei <strong>in</strong>traoperativer E<strong>in</strong>griffserweiterung<br />
Zeitpunkt vor dem E<strong>in</strong>griff: Zeichnet sich schon vor <strong>der</strong> OP ab, daß<br />
es zu Ereiterungen kommen kann, ist <strong>der</strong> Patient hierüber bereits aufzuklären.<br />
Zeitpunkt während des E<strong>in</strong>griffs: Entdeckt <strong>der</strong> Arzt während <strong>der</strong><br />
OP, daß e<strong>in</strong>e Erweiterung vorzunehmen ist, dann ist die OP zu beenden<br />
und <strong>der</strong> Patient nachher erneut aufzuklären.<br />
Kann die OP aus mediz<strong>in</strong>ischen Gründen nicht unterbrochen werden,<br />
kann <strong>der</strong> E<strong>in</strong>griff nur dann fortgesetzt werden, wenn er von <strong>der</strong> mutmaßlichen<br />
E<strong>in</strong>willigung des Patienten gedeckt ist.<br />
Schlussfolgerung: Es empfiehlt sich die E<strong>in</strong>holung e<strong>in</strong>er vorsorglichen<br />
E<strong>in</strong>willigung, die nicht vorhersehbare OP-Erweiterungen abdeckt.<br />
Formulierungsvorschlag: „Mit Erweiterungen des E<strong>in</strong>griffs, die<br />
sich während <strong>der</strong> OP ergeben, b<strong>in</strong> ich e<strong>in</strong>verstanden, soweit sich diese<br />
als mediz<strong>in</strong>isch erfor<strong>der</strong>lich erweisen“.<br />
c. Zeitpunkt <strong>der</strong> Aufklärung bei bewußtlosem Patienten<br />
Hier ist die (vorherige) Aufklärung entbehrlich, wenn nur e<strong>in</strong>e sofortige<br />
Behandlung den Patienten vor dem sicheren Tod bewahren kann.<br />
Es gelten dann die Grundsätze <strong>der</strong> mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung.<br />
E<strong>in</strong>e fehlerhafte Aufklärung stellt e<strong>in</strong>en Behandlungsfehler dar.<br />
Zivilrechtlich ist <strong>der</strong> Arzt Schadensersatzansprüchen ausgesetzt, wenn dem Patienten<br />
<strong>in</strong> Folge des E<strong>in</strong>griffs e<strong>in</strong> Personen- o<strong>der</strong> Sachschaden entsteht. Anspruchsgrundlage<br />
ist § 823 BGB (Delikt) o<strong>der</strong> § 280 BGB (Vertrag): Verletzung<br />
des Persönlichkeitsrechts (= Selbstbestimmungsrecht), über das sich <strong>der</strong><br />
Arzt h<strong>in</strong>weggesetzt hat, als er ohne E<strong>in</strong>willigung operierte.<br />
Strafrechtlich führt die mangelnde Aufklärung <strong>zur</strong> Unwirksamkeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung<br />
<strong>in</strong> den E<strong>in</strong>griff. Dieser ist damit e<strong>in</strong>e strafbare Körperverletzung.<br />
Fazit:<br />
Die Aufklärung hat zwei Stoßrichtungen: E<strong>in</strong>mal schützt sie die körperliche<br />
Unversehrtheit des Patienten (über strafrechtliche Schiene) und zum an<strong>der</strong>en<br />
schützt sie das Selbstbestimmungsrecht des Patienten (über zivilrechtliche<br />
Schiene).<br />
Der Arzt trägt die Beweislast dafür, daß <strong>der</strong> Patient ordnungsgemäß aufgeklärt<br />
wurde. An<strong>der</strong>nfalls wird vermutet, daß ke<strong>in</strong>e wirksame E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> den<br />
E<strong>in</strong>griff vorliegt.<br />
In e<strong>in</strong>em zivilrechtlichen Schadensersatzprozess kann sich <strong>der</strong> Arzt allerd<strong>in</strong>gs<br />
dadurch entlasten, daß er beweist, daß sich <strong>der</strong> Patient auch bei ordnungsgemäßer<br />
Aufklärung für den E<strong>in</strong>griff entschieden hätte (BGH, MedR 1990, 331).<br />
Grundsätzlich obliegt die Aufklärung immer demjenigen Arzt, <strong>der</strong> den E<strong>in</strong>griff<br />
durchführt. Gleichwohl ist anerkannt, dass die Durchführung <strong>der</strong> Aufklärung<br />
delegiert werden kann. Damit trägt die Rechtsprechung dem hoch arbeitsteiligen<br />
Vorgehen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em komplexen Krankenhaus Rechnung.<br />
Soweit e<strong>in</strong> Arzt die Aufklärung, etwa die Risikoaufklärung e<strong>in</strong>es Patienten e<strong>in</strong>em<br />
nachgeordneten Arzt überträgt, muss er darlegen, welche organisatorischen
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 50 von 180<br />
VI. Beteiligung<br />
<strong>Pflege</strong>personal<br />
VII. Schadenersatzansprüche<br />
des Patienten<br />
bei vorsätzlich<br />
falscher Aufklärung<br />
nach OEG<br />
Maßnahmen er ergriffen hat, um e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße Aufklärung sicherzustellen<br />
und zu kontrollieren (BGH, MedR 2006, 169).<br />
Im E<strong>in</strong>zelnen muss er z.B. darlegen, dass:<br />
er sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em persönlichen Gespräch mit dem Patienten nochmals von <strong>der</strong><br />
ordnungsgemäßen Aufklärung durch den beauftragten Kollegen überzeugt<br />
hat, und<br />
er sich durch e<strong>in</strong>en Blick <strong>in</strong> die Krankenakte vom Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er von<br />
Patient und aufklärendem Arzt unterzeichneten E<strong>in</strong>verständniserklärung<br />
vergewissert hat, und<br />
dass e<strong>in</strong>e für e<strong>in</strong>en mediz<strong>in</strong>ischen Laien verständliche Aufklärung unter H<strong>in</strong>weis<br />
auf die spezifischen Risiken des vorgesehenen E<strong>in</strong>griffs erfolgt ist“ (vgl.<br />
dazu auch Ben<strong>der</strong>, MedR 2007, 171).<br />
Denn obgleich die Übertragung <strong>der</strong> Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufklärungspflicht auf e<strong>in</strong>en<br />
an<strong>der</strong>en Arzt dazu führt, dass Aufklärungsversäumnisse zu Lasten dieses an<strong>der</strong>en<br />
Arztes gehen, entlastet das den behandelnden Arzt nicht von <strong>der</strong> vertraglichen (§<br />
278 BGB) und deliktischen (§ 831 Abs. 1 s. 2 BGB) Haftung. Bei fehlerhafter<br />
Überwachung <strong>der</strong> delegierten Aufklärungsarbeit kann dann auch <strong>der</strong> delegierende<br />
Arzt haftbar gemacht werden.<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal darf ke<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>ische o<strong>der</strong> ärztliche Patientenaufklärung<br />
durchführen. Es ist dann <strong>der</strong> Arzt zu rufen. Aber: Es darf ggf. die Aufklärung verdeutlichen.<br />
Wohl aber darf erfahrenes <strong>Pflege</strong>personal die pflegerische Patientenaufklärung<br />
durchführen. Diese muß aber mit dem behandelnden Arzt abgestimmt se<strong>in</strong> und<br />
dieser ist über den Umstand, wann und <strong>in</strong> welchem Umfang pflegerisch aufgeklärt<br />
wird, zu <strong>in</strong>formieren.<br />
Kann <strong>der</strong> Patient se<strong>in</strong>e zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche gegen den Arzt<br />
o<strong>der</strong> das Krankenhaus nicht durchsetzen, ist zu prüfen, ob ihm eventuell Ansprüche<br />
nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) zustehen könnten.<br />
E<strong>in</strong> solcher Anspruch setzt nach § 1 OEG voraus,<br />
das Vorliegen e<strong>in</strong>es vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs,<br />
durch den das Opfer e<strong>in</strong>e gesundheitliche Schädigung erlitten haben muss.<br />
Nach jüngerer Rechtsprechung s<strong>in</strong>d diese Voraussetzungen auch erfüllt, wenn e<strong>in</strong><br />
Arzt sich die E<strong>in</strong>willigung des Patienten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e kosmetische Operation durch<br />
e<strong>in</strong>e vorsätzlich un<strong>zur</strong>eichende und falsche Aufklärung erschlichen hat - etwa<br />
weil er fürchtet, <strong>der</strong> Patient würde bei ordnungsgemäßer Aufklärung von <strong>der</strong> Operation<br />
absehen o<strong>der</strong> weil er schlichtweg aus Profitstreben heraus handelt - und <strong>der</strong><br />
Patient durch die Operation e<strong>in</strong>en dauerhaften Gesundheitsschaden erlitten hat<br />
(LSG NRW, MedR 2009, 433 ff.).<br />
Bedenken, die Entscheidung bewirkt, dass nahezu alle ärztlichen Behandlungsfehler<br />
zu Ansprüchen nach dem OEG führten, bestehen nicht, weil im Regelfall e<strong>in</strong>e<br />
ordnungsgemäße Patientenaufklärung durch den Arzt erfolgt und es sich bei ärztlichen<br />
Behandlungsfehlern fast immer um fahrlässige Delikte handelt.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 51 von 180<br />
Lernziele:<br />
I. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.34:<br />
Psychisch bee<strong>in</strong>trächtigte und verwirrte Menschen pflegen<br />
- Zeitdauer: 2 Std. -<br />
Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden:<br />
die Grundlagen <strong>der</strong> bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen zum Betreuungsrecht<br />
A. E<strong>in</strong>führung Das Betreuungsrecht<br />
B. Im E<strong>in</strong>zelnen:<br />
I. Voraussetzungen<br />
<strong>der</strong> Betreuung<br />
S<strong>in</strong>n und Zweck des Betreuungsrechts ist es, dem Kranken o<strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten<br />
unter weitestgehen<strong>der</strong> Aufrechterhaltung se<strong>in</strong>er Rechte e<strong>in</strong>en Betreuer<br />
<strong>zur</strong> Seite zu stellen, wenn er se<strong>in</strong>e eigenen Angelegenheiten ganz o<strong>der</strong> teilweise<br />
nicht mehr besorgen kann und konkreter Handlungsbedarf besteht.<br />
1. Betreuungsvoraussetzungen<br />
2. Krankheit<br />
o<strong>der</strong><br />
Die Betreuung wird für e<strong>in</strong>en Volljährigen gem. § 1896 BGB<br />
angeordnet, wenn:<br />
er aufgrund e<strong>in</strong>e psychischen Krankheit o<strong>der</strong> körperlichen, geistigen o<strong>der</strong><br />
seelischen Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung vorübergehend o<strong>der</strong> auf Dauer nicht mehr <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage ist, se<strong>in</strong>e Angelegenheiten ganz o<strong>der</strong> teilweise zu besorgen.<br />
Der Betreuer weist sich im Rechtsverkehr gegenüber dem Arzt<br />
o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>personal durch Orig<strong>in</strong>alvorlage se<strong>in</strong>er Bestellungsurkunde<br />
i.S.v. § 290 FamFG aus (bzw. notariell beurkundeter Vollmacht),<br />
die auch se<strong>in</strong>en Aufgabenkreis angibt (Diehn/Rebhan,<br />
NJW 2010, 329).<br />
Krankheit<br />
o<strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
psychische Krankheit,<br />
körperliche Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung,<br />
geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung,<br />
seelische Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung.<br />
Anordnung e<strong>in</strong>er Betreuung<br />
Bestellung e<strong>in</strong>es Betreuers<br />
Unfähigkeit <strong>zur</strong> Besorgung<br />
eigener Angelegenheiten<br />
nicht jede „Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung“<br />
reicht aus, um e<strong>in</strong>e Betreuung<br />
anzuordnen.<br />
Zwischen Krankheit o<strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> Unfähigkeit <strong>zur</strong><br />
Besorgung eigener Angelegenheiten muss e<strong>in</strong> ursächlicher Zusammenhang<br />
bestehen. D.h., dass e<strong>in</strong>e Krankheit alle<strong>in</strong>e noch<br />
nicht ausreicht, um e<strong>in</strong>e Betreuung anzuordnen, son<strong>der</strong>n gerade ihretwegen<br />
muss die Unfähigkeit bestehen.<br />
Als typische psychische Krankheiten i.S.d. Gesetzes gelten:<br />
endogene und exogene Psychosen (z.B. Schizophrenien, zyklotische<br />
Psychosen, Wahnvorstellungen, schizoaffektive Psychosen),
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 52 von 180<br />
3. Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
4. Unfähigkeit<br />
<strong>zur</strong><br />
Besorgung<br />
eigener<br />
Angelegenheiten<br />
5. Erfor<strong>der</strong>lichkeit<br />
<strong>der</strong> Betreuung<br />
hirnorganische Erkrankungen (z.B. senile Demenz, Alzheimer<br />
Krankheit, Hirngefäßerkrankungen),<br />
Abhängigkeitskrankheiten (z.B. Alkohol-, Medikamenten- und<br />
Drogenabhängigkeit, wenn sie als psychische Krankheit e<strong>in</strong>zuordnen<br />
ist),<br />
Psychoterapien (z.B. Psychosen).<br />
Als typische Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen i.S.d. Gesetzes gelten:<br />
geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung: Bei den geistigen Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen handelt<br />
es sich um angeborene o<strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlich erworbene Intelligenzdefekte<br />
verschiedener Schweregrade,<br />
seelische Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung: Seelische Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen leigen vor bei<br />
bleibenden psychischen Bee<strong>in</strong>trächtigungen <strong>in</strong>folge von psychischen<br />
Erkrankungen.<br />
Körperliche Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung: Für e<strong>in</strong>en körperlich Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten<br />
darf e<strong>in</strong>e Betreuung nur angeordnet werden, wenn er dies selbst<br />
beantragt.<br />
Entscheidend ist, ob <strong>der</strong> Betroffene se<strong>in</strong>e Angelegenheiten noch<br />
erledigen kann. Das Vormundschaftsgericht hat daher von Amts<br />
wegen o<strong>der</strong> auf Antrag genau zu prüfen, welche Angelegenheiten<br />
aus Sicht des Betroffenen für ihn überhaupt im E<strong>in</strong>zelfall regelungsbedürftig<br />
s<strong>in</strong>d und ob dann diese aufgrund <strong>der</strong> Krankheit<br />
o<strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung nicht mehr vom Betroffenen erledigt werden<br />
können.<br />
In Betracht kommen alle denkbaren Angelegenheiten, Rechtsgeschäfte<br />
ebenso wie geschäftsähnliche Handlungen (praktisch<br />
bedeutsam v. a. E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> ärztliche Behandlung) o<strong>der</strong> Realakte<br />
(Nahrungsaufnahme, Versorgung <strong>der</strong> Wohnung etc.), Angelegenheiten<br />
<strong>der</strong> Vermögenssorge ebenso wie <strong>der</strong> Personensorge.<br />
Es ist auch unerheblich, ob <strong>der</strong> Volljährige <strong>zur</strong> Besorgung se<strong>in</strong>er<br />
Angelegenheiten aus rechtlichen (etwa wegen Geschäftsunfähigkeit,<br />
§ 104 Nr. 2 BGB) o<strong>der</strong> tatsächlichen Gründen (Handlungsunfähigkeit<br />
bei schwerwiegenden Körperbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen, Antriebsarmut,<br />
Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch freiheitsentziehende Unterbr<strong>in</strong>gung)<br />
nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist.<br />
E<strong>in</strong>e Betreuung ist darüber h<strong>in</strong>aus nur zulässig, wenn sie für den Betroffenen<br />
erfor<strong>der</strong>lich ist und ke<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>en Hilfen <strong>zur</strong> Verfügung<br />
stehen (Grundsatz <strong>der</strong> Erfor<strong>der</strong>lichkeit und Nachrangigkeit).<br />
An<strong>der</strong>e Hilfen s<strong>in</strong>d z.B.<br />
private Hilfen (= Angehörige, Freunde, Nachbarn, Wohlfahrtsverbände,<br />
Sozilastationen),<br />
Öffentliche Hilfen (= s<strong>in</strong>d meist bei den Kommunen o<strong>der</strong> Landkreisen<br />
angesiedelt).<br />
Erfor<strong>der</strong>lichkeit:<br />
E<strong>in</strong> Betreuer darf nur bestellt werden für Aufgabenkreise, <strong>in</strong> denen<br />
e<strong>in</strong>e Betreuung erfor<strong>der</strong>lich ist. Dieser Grundsatz hat Verfassungsrang<br />
und ist für jeden e<strong>in</strong>zelnen Aufgabenkreis, <strong>der</strong> dem Betreuer<br />
übertragen werden soll, zu prüfen.<br />
Die nicht immer ausreichende Beachtung des Erfor<strong>der</strong>lichkeitsgrundsatzes<br />
durch die Vormundschaftsgerichte wird als e<strong>in</strong>e<br />
<strong>der</strong> Hauptursachen für den ständigen Anstieg von Betreuerbestellungen<br />
angesehen (Bienwald BtPrax 2002, 3).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 53 von 180<br />
6. Aufgabenkreis<br />
=<br />
Umfang<br />
<strong>der</strong> Betreuung<br />
Nicht erfor<strong>der</strong>lich ist e<strong>in</strong>e Betreuung jedenfalls für Aufgaben,<br />
die ohne Schaden für den Betreuten auch unerledigt bleiben<br />
können o<strong>der</strong> wenn e<strong>in</strong> Betreuer die Aufgaben nicht wirksam<br />
wahrnehmen kann (BayObLG BtPrax 1994, 209), z. B. weil <strong>der</strong><br />
Betreute jeden Kontakt mit e<strong>in</strong>em Betreuer verweigert.<br />
E<strong>in</strong>e Betreuung gegen den Willen des Betroffenen (Zwangsbetreuung)<br />
kommt nur <strong>in</strong> Betracht, wenn se<strong>in</strong> Wohl es erfor<strong>der</strong>t (=<br />
Abwägungsvorgang !). Die Abwägung, wann die Wahrnehmung e<strong>in</strong>er<br />
bestimmten Aufgabe auch gegen den Willen des Betroffenen<br />
se<strong>in</strong>em Wohl entspricht, kann nicht statisch beurteilt werden son<strong>der</strong>n<br />
nur <strong>in</strong> Abwägung <strong>der</strong> jeweiligen Rechtsgüter des Betroffenen,<br />
<strong>der</strong> Vor- und Nachteile e<strong>in</strong>er jeden Entscheidung und unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Wertung des Betreuungsrechts grundsätzlich<br />
Vorrang genießenden Wünsche des Betroffenen.<br />
Beispiele aus <strong>der</strong> Rechtsprechung <strong>zur</strong> Erfor<strong>der</strong>lichkeit:<br />
Nicht erfor<strong>der</strong>lich:<br />
für die Vermögenssorge, wenn alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Taschengeld <strong>zur</strong><br />
Verfügung steht und <strong>der</strong> Betroffene zu dessen Verwendung<br />
selbst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist (LG Regensburg FamRZ 1993, 477);<br />
für die Entscheidung Organspen<strong>der</strong> zu werden (AG Mölln,<br />
FamRZ 1995, 118);<br />
wenn von vornhere<strong>in</strong> ke<strong>in</strong> Vertrauensverhältnis entstehen<br />
kann, weil <strong>der</strong> Betroffene die Bestellung des Betreuers als<br />
erniedrigend empf<strong>in</strong>det und dieser dadurch an e<strong>in</strong>er wirksamen<br />
Hilfe geh<strong>in</strong><strong>der</strong>t ist (BayObLG BtPrax 1994, 209);<br />
Erfor<strong>der</strong>lich:<br />
die Bestellung e<strong>in</strong>es Betreuers mit dem Aufgabenkreis Vermögenssorge<br />
kann auch erfor<strong>der</strong>lich se<strong>in</strong>, um e<strong>in</strong>e weitere<br />
Verschuldung e<strong>in</strong>es an sich bereits vermögenslosen Betreuten<br />
zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n (FamRZ 2001, 1245);<br />
kann e<strong>in</strong> Betreuer bestellt werden für die Gesundheitsfürsorge<br />
bei fehlen<strong>der</strong> Krankheitse<strong>in</strong>sicht (LG Regensburg FamRZ<br />
1993, 477);<br />
bei Gefahr künftiger erneuter Schübe e<strong>in</strong>er Psychose mit<br />
Notwendigkeit nervenärztlicher Behandlung (BayObLG<br />
BtPrax 2003, 177).<br />
Der Aufgabenkreis des Betreuers ist vom Vormundschaftsgericht<br />
im Beschluss <strong>zur</strong> Betreuerbestellung ausdrücklich festzulegen.<br />
Dabei kann das Gericht lediglich e<strong>in</strong>zelne Aufgaben beschreiben,<br />
z.B.:<br />
Geltendmachung e<strong>in</strong>es Rentenanspruchs,<br />
Verteidigung gegen e<strong>in</strong>e Gläubigerfor<strong>der</strong>ung,<br />
Auflösen e<strong>in</strong>es Mietverhältnisses,<br />
o<strong>der</strong> aber auch umfassen<strong>der</strong>e Bereiche festlegen, die verschiedene<br />
Tätigkeiten des Betreuers umfassen, wie z.B.:<br />
Wohnungsangelegenheiten,<br />
Aufenthaltsbestimmungen,<br />
Zustimmung <strong>zur</strong> Heilbehandlung,<br />
Verwaltung größerer Vermögenswerte wie z. B. e<strong>in</strong> Geschäft<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> größeres Mietshaus,<br />
Vertretung <strong>in</strong> Erbause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen,<br />
bis h<strong>in</strong> zu allen Aufgaben <strong>der</strong> Personensorge o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Vermögenssorge.<br />
Auch die Übertragung aller Angelegenheiten ist denkbar.<br />
Dabei darf das Vormundschaftsgericht bei <strong>der</strong> Bestimmung<br />
des Aufgabenkreises über das erfor<strong>der</strong>liche Maß nicht h<strong>in</strong>ausgehen.<br />
Für jeden e<strong>in</strong>zelnen Aufgabenkreis, <strong>der</strong> dem Betreuer zuge-
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 54 von 180<br />
7. E<strong>in</strong>schränkungen<br />
<strong>der</strong><br />
Vertretungsmacht<br />
des<br />
Betreuers<br />
8. Beispiele<br />
für Aufgabenkreise<br />
wiesen werden soll, muss e<strong>in</strong>e Betreuung erfor<strong>der</strong>lich se<strong>in</strong><br />
(BayObLG BtPrax 2002, 216).<br />
Die gesetzliche Vertretungsmacht des Betreuers wird durch e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von vormundschaftsgerichtlichen Genehmigungsvorbehalten<br />
beschränkt.<br />
Zum e<strong>in</strong>en gelten <strong>in</strong>soweit die meisten Vorschriften des Vormundschaftsrechts<br />
entsprechend (§ 1908i Abs. 1 S. 1), auch was die<br />
Vermögensverwaltung im allgeme<strong>in</strong>en betrifft (§§ 1803, 1805 ff.).<br />
Genehmigungspflichtig s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e´:<br />
Rechtsgeschäfte nach §§ 1812, 1821, 1822 (ohne Nr. 5, dafür aber § 1907),<br />
speziell für die Betreuung genehmigungspflichtige Handlungen<br />
(E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Untersuchung des Gesundheitszustandes,<br />
e<strong>in</strong>e Heilbehandlung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en ärztlichen E<strong>in</strong>griff unter bestimmten<br />
Voraussetzungen, § 1904; E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Sterilisation,<br />
§ 1905; Unterbr<strong>in</strong>gung und unterbr<strong>in</strong>gungsähnliche<br />
Maßnahmen, § 1906; Kündigung e<strong>in</strong>er vom Betreuten gemieteten<br />
Wohnung, § 1907 u.a.m.).<br />
In den neuen Genehmigungsvorbehalten kommt zum Ausdruck,<br />
wie wichtig <strong>der</strong> Gesetzgeber die Aufgabe <strong>der</strong> Personensorge<br />
e<strong>in</strong>schätzt, während das bisherige Vormundschaftsrecht <strong>der</strong> Vermögensverwaltung<br />
das hauptsächliche Augenmerk widmete. Zugleich<br />
verstärkt sich durch Vermehrung <strong>der</strong> genehmigungspflichtigen<br />
Vorgänge die vormundschaftsgerichtliche Kontrolle.<br />
E<strong>in</strong>zelne Beispiele für Aufgabenkreise (nach Jürgens/Kröger/Marschner/W<strong>in</strong>terste<strong>in</strong><br />
Rz 88 ff.):<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Vermögenssorge ist die konkrete Lebenssituation<br />
des Betreuten beson<strong>der</strong>s zu beachten, häufig hat <strong>der</strong> Betreute<br />
ke<strong>in</strong> eigenes Vermögen, son<strong>der</strong>n lediglich e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges E<strong>in</strong>kommen.<br />
Als mögliche Aufgabenkreise kommen hier <strong>in</strong> Betracht:<br />
– Beantragung/Entgegennahme/E<strong>in</strong>teilung von Rente/Sozialhilfe/Arbeitslosengeld/Krankengeld/Versicherungsleistungen,<br />
– Geltendmachung/Entgegennahme/E<strong>in</strong>teilung von Arbeitslohn,<br />
– Geltendmachung von For<strong>der</strong>ungen gegen/Prüfung von Rechnungen/Abwehr<br />
von Ansprüchen von o<strong>der</strong> gegenüber Behörden/Banken/Krankenkassen/Versicherungsunternehmen/Versorgungse<strong>in</strong>richtungen<br />
– Antragstellung auf <strong>Pflege</strong>leistungen bei d. zuständigen <strong>Pflege</strong>kasse<br />
– Vertretung gegenüber Gläubigern/Schuldentilgung/Schuldenregulierung<br />
– Prüfung und Regelung von Unterhaltspflichten<br />
– Verwaltung/Verwertung von Grundvermögen und beweglichen<br />
Sachwerten,<br />
– Vermögenssorge mit Ausnahme von … (z. B. Verwaltung des<br />
Taschengeldes)<br />
Auch bei Wohnungsangelegenheiten gibt es verschiedene speziell<br />
zu prüfende Aufgabenkreise:<br />
Abwehr e<strong>in</strong>er Wohnungskündigung,<br />
Vertretung bei Kündigungs- und Räumungsverfahren,<br />
Regelung von Miet- und Wohnungsangelegenheiten<br />
Auflösung des Mietverhältnisses<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Wohnung, Auflösung des Haushalts, Entrümpelung,<br />
Beschaffung e<strong>in</strong>er Wohnung und Regelung <strong>der</strong> Kosten/Mietvertragsabschluss.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 55 von 180<br />
II. Der Betreuer 1. Die Person<br />
des Betreuers<br />
Im Zusammenhang mit Erbfällen s<strong>in</strong>d ebenfalls e<strong>in</strong>zelne Aufgaben<br />
denkbar:<br />
Vertretung bei <strong>der</strong> Erbause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung,<br />
Regelung <strong>der</strong> Nachlassangelegenheiten nach dem …<br />
Geltendmachung <strong>der</strong> Rechte am Nachlass des …<br />
Klärung <strong>der</strong> Nachlassmasse/Ausschlagung <strong>der</strong> Erbschaft.<br />
Auch bei <strong>der</strong> häufig notwendigen Übersiedlung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Alten-<br />
o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>heim kommen verschiedene Aufgaben <strong>in</strong> Betracht:<br />
Abschluss des Heimvertrages,<br />
Regelung <strong>der</strong> Heimkosten (aus dem eigenen Vermögen o<strong>der</strong><br />
durch Inanspruchnahme Unterhaltspflichtiger, <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>kasse<br />
o<strong>der</strong> Sozialhilfeträger)<br />
Vertretung gegenüber <strong>der</strong> Heimleitung,<br />
Überwachung <strong>der</strong> Taschengeldverwendung,<br />
Unterbr<strong>in</strong>gung mit Freiheitsentziehung.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Heilbehandlung darf e<strong>in</strong> Betreuer nur bestellt<br />
werden, soweit <strong>der</strong> Betroffene selbst e<strong>in</strong>willigungsunfähig ist,<br />
also Art, Bedeutung und Tragweite <strong>der</strong> jeweiligen Maßnahme<br />
auch nach entsprechen<strong>der</strong> ärztlicher Aufklärung und Beratung<br />
nicht zu erfassen und se<strong>in</strong>en Willen hiernach zu bestimmen<br />
vermag (BayObLG FamRZ 1994, 1060).<br />
Die E<strong>in</strong>willigungsfähigkeit <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne kann für e<strong>in</strong>fache<br />
Behandlungen e<strong>in</strong>er konkret nachvollziehbaren Krankheit<br />
(Erkältung, Knochenbruch, Zahnbehandlung) noch vorliegen,<br />
wo sie für kompliziertere E<strong>in</strong>griffe bei komplexeren Krankheitsbil<strong>der</strong>n<br />
(schwierige Operationen, Chemo- o<strong>der</strong> Strahlentherapie)<br />
fehlt. So kann auch etwa <strong>der</strong> Aufgabenkreis des Betreuers<br />
im Bereich <strong>der</strong> Gesundheitsfürsorge auf die nervenärztliche<br />
Behandlung beschränkt werden (BayObLG FamRZ<br />
1994, 1059 und 1060). In Betracht kommen etwa:<br />
Entscheidung über E<strong>in</strong>willigung <strong>zur</strong> Amputation des …,<br />
Zustimmung zu riskanten Untersuchungen, wie …,<br />
Zustimmung <strong>zur</strong> Heilbehandlung wegen <strong>der</strong> … Erkrankung,<br />
Sicherstellung <strong>der</strong> ärztlichen Heilbehandlung/stationär/ambulant/Nachsorge<br />
nach Operation,<br />
Geltendmachung von Rechten gegenüber Ärzten/Kl<strong>in</strong>ikleitung,<br />
Zustimmung <strong>zur</strong> Heilbehandlung, außer …,<br />
Entscheidung über (Zwangs-) Medikation,<br />
Organisation und Regelung <strong>der</strong> Kosten von Rehabilitationsmaßnahmen.<br />
Oberster Grundsatz bei <strong>der</strong> Bestimmung des Betreuers ist für das<br />
Gericht das Wohl des Betroffenen. Die Person des Betreuers<br />
muss geeignet se<strong>in</strong>, die Angelegenheiten des Betroffenen zu besorgen<br />
und ihn hierbei im erfor<strong>der</strong>lichen Umfang zu betreuen.<br />
Deshalb hat <strong>der</strong> Betreuer den Wünschen des Betreuten zu entsprechen,<br />
soweit dies dessen Wohl nicht zuwi<strong>der</strong>läuft und dem Betreuer<br />
zuzumuten ist (§ 1901 Abs. 3 S. 1); auch die vor Bestellung<br />
des Betreuers <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Betreuungsverfügung geäußerten Wünsche<br />
können hier noch relevant se<strong>in</strong> (§ 1901 Abs. 3 S. 2). Dem Betreuer<br />
ist die E<strong>in</strong>beziehung des Betreuten <strong>in</strong> wichtige Entscheidungen im<br />
Wege des Gesprächs auferlegt (§ 1901 Abs. 3 S. 3).<br />
a. fachlich<br />
Fachlich muss <strong>der</strong> Betreuer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage se<strong>in</strong>, die ihm zugewiesenen<br />
Aufgabenbereiche des Betroffenen, zu organisieren bzw. zu erledi-
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 56 von 180<br />
III. Das Betreuungsverfahren<br />
2. Pflichten<br />
des Betreuers<br />
3. Aufhebung<br />
<strong>der</strong><br />
Bestellung<br />
des Betreuers<br />
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
gen. Er kann sich hierzu <strong>der</strong> Hilfe an<strong>der</strong>er bedienen, weil er nur <strong>zur</strong><br />
Organisation, nicht aber <strong>zur</strong> persönlichen Hilfe verpflichtet ist.<br />
b. persönlich<br />
Persönlich bedeutet, dass <strong>der</strong> Betreuer Zeit für den Betreuten haben<br />
muss. Zwischen beiden sollte <strong>in</strong> jedem Fall e<strong>in</strong> Vertrauensverhältnis<br />
bestehen.<br />
Der Betreuer ist mit <strong>der</strong> Bestellung durch das Vormundschaftsgericht<br />
diversen Pflichten unterworfen, die allesamt dem Wohl des<br />
Betreuten Rechnung tragen sollen.<br />
Im Allgeme<strong>in</strong>en wird von drei Kard<strong>in</strong>alpflichten gesprochen. Dies<br />
s<strong>in</strong>d die persönliche Betreuung, die Wünsche des Betreuten und<br />
die Besprechungspflicht.<br />
Persönliche Betreuung:<br />
Der Betreuer hat den persönlichen Kontakt zu se<strong>in</strong>em Betreuten zu<br />
suchen und zu pflegen, da nur dadurch gewährleistet ist, dass er<br />
se<strong>in</strong>e Bedürfnisse erkennt und e<strong>in</strong>e erfor<strong>der</strong>liche Vertrauensbasis<br />
geschaffen werden kann.<br />
Wünsche des Betreuten:<br />
Den Wünschen des Betreuten muss entsprochen werden, soweit<br />
sie dessen wohl nicht zuwi<strong>der</strong> laufen und dem Betreuer zuzumuten<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Besprechungspflicht:<br />
Wichtige Angelegenheiten hat <strong>der</strong> Betreuer mit diesem zu besprechen,<br />
bevor er sie erledigt o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Entscheidung trifft.<br />
Die Bestellung e<strong>in</strong>es Betreuers ist aufzuheben, wenn:<br />
die Voraussetzungen <strong>der</strong> Betreuung nicht mehr vorliegen,<br />
<strong>der</strong> Betreute dies beantragt, soweit er nur körperlich beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t<br />
ist,<br />
die Eignung des Betreuers nicht mehr gegeben ist,<br />
<strong>der</strong> Betreute e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e, gleich geeignete, bereitwillige Person<br />
vorschlägt,<br />
nach <strong>der</strong> Bestellung des Betreuers Umstände e<strong>in</strong>treten, die e<strong>in</strong>e<br />
Betreuung unzumutbar machen und <strong>der</strong> Betreuer se<strong>in</strong>e Entlassung<br />
verlangt,<br />
e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er wichtiger Grund vorliegt.<br />
Auf die Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Verfahrens <strong>in</strong> Betreuungssachen, das<br />
die optimale Erfüllung rechtsstaatlicher Postulate anstrebt, ist beson<strong>der</strong>er<br />
Wert gelegt worden. Die ausführlichen Verfahrensvorschriften<br />
sollen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Wahrung <strong>der</strong> Selbstbestimmungs<strong>in</strong>teressen<br />
des Betroffenen und den E<strong>in</strong>satz fachlicher<br />
Kompetenz gewährleisten.<br />
Merkposten Betreuungsverfahren
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 57 von 180<br />
1. Voraussetzungen<br />
a. E<strong>in</strong>leitung des Betreuungsverfahrens<br />
Das Betreuungsverfahren wird entwe<strong>der</strong> von Amts wegen o<strong>der</strong> auf Antrag e<strong>in</strong>geleitet. Zuständig<br />
für das Betreuungsverfahren ist das Amtsgericht, <strong>in</strong> dessen Bezirk <strong>der</strong> Betroffene<br />
se<strong>in</strong>en gewöhnlichen Aufenthalt hat.<br />
aa. Persönliche Anhörung<br />
Vor <strong>der</strong> Bestellung sieht das Gesetz zw<strong>in</strong>gend die persönliche Anhörung<br />
des Betroffenen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er üblichen Umgebung durch den Vormundschaftsrichter<br />
vor.<br />
Der Richter soll sich e<strong>in</strong>en unmittelbaren E<strong>in</strong>druck vom Betroffenen machen.<br />
Hierbei darf e<strong>in</strong>e Person des Vertrauens des Betroffenen anwesend se<strong>in</strong>.<br />
bb. Absehen von <strong>der</strong> persönlichen Anhörung<br />
Von e<strong>in</strong>er persönlichen Anhörung kann nur abgesehen werden,<br />
wenn durch die Anhörung erhebliche Nachteile für die Gesundheit<br />
des Betroffenen zu befürchten s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Betroffene nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage ist, se<strong>in</strong>en Willen kund zu tun. Ob solche Nachteile zu erwarten<br />
s<strong>in</strong>d, muss sich aus e<strong>in</strong>em ärztlichen Gutachten ergeben.<br />
cc. Gutachten e<strong>in</strong>es Sachverständigen<br />
E<strong>in</strong> Betreuer darf erst bestellt werden, wenn das Gutachten e<strong>in</strong>es<br />
Sachverständigen über die Notwendigkeit <strong>der</strong> Bestellung e<strong>in</strong>es Betreuers<br />
e<strong>in</strong>geholt ist.<br />
Das Gutachten soll nicht nur über die Krankheit/Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung Aufschluss<br />
geben, son<strong>der</strong>n auch zu <strong>der</strong> Frage Stellung nehmen, <strong>in</strong>wieweit<br />
dadurch die Fähigkeit des Betroffenen, se<strong>in</strong>e eigenen Angelegenheiten<br />
zu besorgen, aufgehoben ist.<br />
dd. Schlussgespräch<br />
Nach Vorliegen des Gutachtens f<strong>in</strong>det die mündliche Erörterung<br />
mit dem Betroffenen statt. Hier soll mit ihm das Ergebnis des Gutachtens,<br />
<strong>der</strong> umfang des Aufgabenbereiches und die Person des<br />
Betreuers besprochen werden.<br />
ee. Verfahrenspfleger<br />
Soweit:<br />
von e<strong>in</strong>er persönlichen Anhörung abgesehen wurde,<br />
e<strong>in</strong> Betreuer <strong>zur</strong> Besorgung aller (!) Angelegenheiten bestellt<br />
werden soll o<strong>der</strong><br />
Gegenstand des Verfahrens die E<strong>in</strong>willigung <strong>zur</strong> Sterilisation ist,<br />
kann das Gericht e<strong>in</strong>en eigenen Verfahrenspfleger für das gesamte<br />
Verfahren bestellen, soweit dies <strong>zur</strong> Wahrung se<strong>in</strong>er eigenen Interessen<br />
erfor<strong>der</strong>lich ist.<br />
a. Weitere Verfahrensspezifika<br />
Mit <strong>der</strong> Anordnung des Betreuung wird zugleich festgelegt, zu welchem<br />
Zeitpunkt spätestens das Gericht über die Aufhebung o<strong>der</strong> Verlängerung<br />
<strong>der</strong> Anordnung zu entscheiden hat (spätestens nach fünf<br />
Jahren !),<br />
Bis <strong>zur</strong> endgültigen Entscheidung über die Anordnung e<strong>in</strong>er Betreuung<br />
vergeht i.d.R. e<strong>in</strong> erheblicher Zeitraum, so dass die Gerichte e<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>stweilige Anordnung treffen, um vorläufig e<strong>in</strong>en Betreuer zu bestellen.<br />
Die Anordnung gilt für längstens sechs Monate.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 58 von 180<br />
2. Rechtsfolgen<br />
Im Gegensatz <strong>zur</strong> Entmündigung alten Rechts hat die Bestellung e<strong>in</strong>es Betreuers<br />
ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten, dieser kann<br />
jedoch nach § 104 Nr. 2 geschäftsunfähig se<strong>in</strong>. Nur im Prozess steht e<strong>in</strong><br />
durch den Betreuer vertretener Betreuter e<strong>in</strong>er nicht prozessfähigen Person<br />
gleich (§ 53 ZPO). In jedem Falle ist <strong>der</strong> Betreuer im Rahmen se<strong>in</strong>es Aufgabenkreises<br />
gesetzlicher Vertreter des Betreuten (§ 1902).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 59 von 180<br />
Situation:<br />
I. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit I.38:<br />
Sterbehilfe und Strafrecht (e<strong>in</strong>schl. Patientenverfügung / Behandlungsabbruch)<br />
I. Das vorsätzli-<br />
che Begehungsdelikt<br />
- Zeitdauer: 6 Std. -<br />
Die Strafbarkeit <strong>der</strong> Behandlung selbst<br />
Der Unfallpatient (volles Bewusstse<strong>in</strong>) lehnt die lebensrettende Behandlung<br />
ab. Der Arzt operiert trotzdem. Muss er mit strafrechtlichen Folgen rechnen?<br />
Der ärztliche E<strong>in</strong>griff ist strafrechtlich gesehen e<strong>in</strong>e Körperverletzung nach § 223 StGB.<br />
Dennoch werden Ärzte nie verurteilt, weil die Patienten <strong>in</strong> die Behandlung e<strong>in</strong>willigen.<br />
1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Hier werden die objektiven, d.h. äußerlich sichtbaren Merkmale, nach denen<br />
beurteilt werden kann, ob e<strong>in</strong>e Straftat vorliegt, überprüft. Dies s<strong>in</strong>d:<br />
E<strong>in</strong>tritt des tatbestandlichen Erfolges (z.B. Tod, Körperverletzung),<br />
durch e<strong>in</strong>e Handlung (z.B. Messerstich, Injektion, Operation),<br />
Kausalität (die Handlung ist ursächlich für E<strong>in</strong>tritt d. tatbestandlichen Erfolges),<br />
objektive Zurechnung (die kausale Handlung hat e<strong>in</strong> spezifisches Risiko gesetzt,<br />
das sich im Tatbestandlichen Erfolg realisiert hat [= typische Gefahr])<br />
Ausnahme: tatbestandsausschließendes E<strong>in</strong>verständnis<br />
a. subjektiver Tatbestand<br />
Es ist zu untersuchen, ob <strong>der</strong> Täter Vorsatz hatte (= Wissen + Wollen <strong>der</strong> Tatbestandsverwirklichung),<br />
als er die Tat beg<strong>in</strong>g:<br />
Absicht (= Täter kam es gerade auf Erfolg an),<br />
direkter Vorsatz (= Täter handelt u. weiß, dass er tatbest. Erfolg verwirklicht),<br />
bed<strong>in</strong>gter Vorsatz (= Täter hat billigend <strong>in</strong> Kauf genommen, dass tatbestandlicher<br />
Erfolg e<strong>in</strong>tritt).<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
Die Tatbestandsverwirklichung <strong>in</strong>diziert die Rechtswidrigkeit <strong>der</strong> Straftat. Ausnahme:<br />
Der Täter handelte gerechtfertigt. Rechtfertigungsgründe s<strong>in</strong>d:<br />
Notwehr (§ 227 BGB, § 32 StGB),<br />
Selbsthilfe (§§ 229, 561, 859 BGB),<br />
Notstand (§ 228 BGB, § 34 StGB),<br />
rechtfertigende E<strong>in</strong>willigung des Verletzten/Patienten,<br />
Wahrnehmung berechtigter Interessen (§ 193 StGB),<br />
Festnahmerecht (§ 127 StPO).<br />
3. Schuld/Strafausschließungsgrund/Strafverfolgungsh<strong>in</strong><strong>der</strong>nis
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 60 von 180<br />
Schuld ist die Fähigkeit d. Täters, das von ihm begangene Unrecht d. Tat e<strong>in</strong>zusehen<br />
(kann durch Alkohol o<strong>der</strong> Drogen e<strong>in</strong>geschränkt se<strong>in</strong>).<br />
Strafausschließungsgründe greifen z.B. bei Abgeordneten (Indemnität, Art.<br />
46 I GG [Abg.: „Herr M<strong>in</strong>ister, Sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Esel“ = straffrei]).<br />
Strafverfolgungsh<strong>in</strong><strong>der</strong>nisse (z.B. Verjährung d. Tat, §§ 78 ff. StGB)<br />
§ 35 StGB Entschuldigen<strong>der</strong> Notstand.<br />
II. Notwehr/ Prüfungskarte § 32 StGB - Notwehr/Nothilfe<br />
Nothilfe<br />
Die Notwehr kommt im pflegerischen/ärztlichen Bereich so gut wie nicht vor. Sie erlangt<br />
aber im privaten Bereich große Bedeutung.<br />
1. Notwehrlage = gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff (auf e<strong>in</strong>en selbst)<br />
a. Vorliegen e<strong>in</strong>es Angriffs<br />
Angriff ist jede Bedrohung rechtlich geschützter Interessen durch menschliches Verhalten.<br />
Angriff: kann sich gegen e<strong>in</strong>en selbst wie auch e<strong>in</strong>en Dritten richten (Nothilfe).<br />
b. <strong>der</strong> gegenwärtig<br />
gegenwärtig ist je<strong>der</strong> Angriff, <strong>der</strong> unmittelbar bevorsteht o<strong>der</strong> gerade stattf<strong>in</strong>det<br />
o<strong>der</strong> noch fortdauert.<br />
beendet ist <strong>der</strong> Angriff, wenn <strong>der</strong> Täter z.B. die Beute gesichert hat.<br />
c. und rechtswidrig ist<br />
<strong>der</strong> Angriff ist rechtswidrig, wenn er im Wi<strong>der</strong>spruch <strong>zur</strong> Rechtsordnung<br />
steht, bzw. den <strong>der</strong> Angegriffene nicht zu dulden braucht.<br />
2. Notwehrhandlung<br />
Notwehrhandlung ist diejenige Handlung, die erfor<strong>der</strong>lich und geboten ist, um<br />
den Angriff sofort zu beenden.<br />
sie ist erfor<strong>der</strong>lich, wenn sie objektiv geeignet ist und das mildeste Mittel<br />
darstellt, den Angriff zu beenden.<br />
die Notwehrhandlung darf sich nur gegen Rechtsgüter des Angreifers richten.<br />
3. E<strong>in</strong>schränkung des Notwehrrechts<br />
Die Notwehrhandlung ist aus diversen Gründen e<strong>in</strong>geschränkt. <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
hat man e<strong>in</strong>e primäre Ausweichpflicht. Im e<strong>in</strong>zelnen:<br />
wenn <strong>der</strong> Angreifer erkennbar schuldlos war (Betrunkener),<br />
wenn die Notwehrlage erkennbar durch den die Notwehr ausübenden zuvor<br />
provoziert war,<br />
es sich um die sog. Unfugabwehr handelt (= Bagtellangriffe knapp unterhalb<br />
<strong>der</strong> Provokationsgrenze),<br />
es sich um Personen mit enger persönlicher Beziehung handelt (Lebenspartner,<br />
Ehegatte),<br />
wenn e<strong>in</strong> unerträgliches Missverhältnis zwischen verletztem und verteidigtem<br />
Rechtsgut besteht („K<strong>in</strong>d wegen Kirschenklau erschießen“).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 61 von 180<br />
4. Verteidigungswille<br />
Schließlich muss <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> von se<strong>in</strong>em Notwehrrecht o<strong>der</strong> Nothilferecht Gebrauch<br />
macht, mit Verteidigungswillen handeln wollen. D.h., er muß Kenntnis von <strong>der</strong> Notwehrlage<br />
haben und se<strong>in</strong> Handeln von <strong>der</strong> Notwehrbefugnis getragen se<strong>in</strong>.<br />
III. Notstand Prüfungskarte § 34 StGB - (rechtfertigen<strong>der</strong>) Notstand<br />
Dem rechtfertigenden Notstand kommt <strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e entscheidende praktische Bedeutung<br />
zu. Nicht wenige ärztliche o<strong>der</strong> pflegerische Maßnahmen werden als Notstandshandlungen<br />
vorgenommen. Der häufigste Fall ist die Fixierung e<strong>in</strong>es Patienten<br />
nach <strong>der</strong> OP, weil sich dieser die Kanülen droht heraus<strong>zur</strong>eißen.<br />
Nachfolgend werden die allgeme<strong>in</strong>en Voraussetzungen des Notstandes erläutert. E<strong>in</strong>e Vertiefung<br />
erfolgt im Rahmen <strong>der</strong> Freiheitsberaubung.<br />
1. Vorprüfung: ke<strong>in</strong> Vorliegen e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>willigung o<strong>der</strong> des zivilrechtlichen<br />
Notstands (§ 228 BGB bezogen auf Sachen)<br />
2. Notstandslage = gegenwärtige Gefahr für e<strong>in</strong> beliebiges Rechtsgut (sowohl für<br />
e<strong>in</strong>en selbst als auch für an<strong>der</strong>e)<br />
Gefahr: bedeutet die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>es Schadense<strong>in</strong>tritts,<br />
gegenwärtig: ist die Gefahr, wenn sie je<strong>der</strong>zeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Schaden umschlagen<br />
kann,<br />
Rechtsgüter des Notstandes s<strong>in</strong>d: Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum<br />
sowie sonstige schutzwürdige und schutzbedürftige Rechtsgüter.<br />
3. Notstandshandlung<br />
Notstandshandlung = wenn jemand e<strong>in</strong>e (Straf-)Tat begeht, die erfor<strong>der</strong>lich<br />
ist, um die Gefahr abzuwenden.<br />
sie ist erfor<strong>der</strong>lich, wenn sie objektiv geeignet ist und das sicherste und mildeste<br />
Mittel darstellt, die Gefahr abzuwenden.<br />
4. Gefahrabwendungswille (= Kenntnis <strong>der</strong> rechtfertigenden Sachlage und<br />
Handeln aufgrund dieser Befugnis)<br />
5. Interessenabwägung<br />
Das geschützte (bedrohte) Interesse muß das bee<strong>in</strong>trächtigte wesentlich überwiegen.<br />
Kriterien s<strong>in</strong>d:<br />
e<strong>in</strong> eventuelles Rangverhältnis <strong>der</strong> Rechtsgüter (nicht bei Leben gegen Leben;<br />
sonst gilt, daß das höherwertige Rechtsgut zugunsten des nie<strong>der</strong>en geschützt<br />
werden muß),<br />
die Schutzwürdigkeit des betroffenen Rechtsgutes <strong>in</strong> <strong>der</strong> konkreten Lebenssituation,<br />
Grad <strong>der</strong> drohenden Gefahr,<br />
Intensität <strong>der</strong> Rechtsgutsverletzung.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 62 von 180<br />
6. sozialethische Angemessenheit <strong>der</strong> Tat<br />
u.a.:<br />
Die Bee<strong>in</strong>trächtigung des nie<strong>der</strong>rangigen Rechtsgutes muß im überwiegenden<br />
Interesse des Staates und <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>heit liegen.<br />
H<strong>in</strong>weis: Der Notstand f<strong>in</strong>det ke<strong>in</strong>e Anwendung, wenn <strong>der</strong> Patient zwar im Vollbesitz se<strong>in</strong>er Kräfte, aber une<strong>in</strong>sichtig ist. Der Arzt darf e<strong>in</strong>e lebensnotwendige<br />
Behandlung dann nicht gegen den Willen des Patienten durchführen, er kann sich hierbei nicht auf den Notstand berufen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 63 von 180<br />
IV. Überblick Übersichtskarte E<strong>in</strong>willigung/E<strong>in</strong>verständnis<br />
über das System<br />
von E<strong>in</strong>willigung<br />
und E<strong>in</strong>verständnis<br />
Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> ärztlichen wie pflegerischen Praxis wichtigsten Rechtfertigungsgründe s<strong>in</strong>d die<br />
ausdrückliche und die mutmaßliche E<strong>in</strong>willigung. Aus rechtspolitischen Gründen scheidet<br />
das tatbestandsausschließende E<strong>in</strong>verständnis (etwa bei <strong>der</strong> Körperverletzung) aus.<br />
tatbestandsausschließendes<br />
E<strong>in</strong>verständnis<br />
Bei Handlungen, die ihren deliktischen<br />
Charakter dadurch erfahren, dass sie<br />
gegen den Willen des Betroffenen erfolgen,<br />
entfällt <strong>der</strong> obj. Tatbestand,<br />
wenn <strong>der</strong> Betroffene damit e<strong>in</strong>verstanden<br />
ist (= <strong>in</strong>nere E<strong>in</strong>stellung reicht<br />
aus). D.h.: es kommt erst gar nicht zu<br />
e<strong>in</strong>er Rechtsgutsverletzung.<br />
E<strong>in</strong> tatbestandsausschließendes E<strong>in</strong>verständnis<br />
kommt dann <strong>in</strong> Betracht,<br />
wenn sich <strong>der</strong> Tatbestand nicht ohne<br />
Rücksicht auf den Willen des Rechtsgutträgers<br />
feststellen läßt.<br />
Bsp.: §§ 239, 240, 249, 242 StGB (=<br />
ke<strong>in</strong> Diebstahl, wenn Betroffener mit Wegnahme<br />
Sache aus freien Stücken e<strong>in</strong>verstanden ist !).<br />
H<strong>in</strong>weis: Bei <strong>der</strong> Körperverletzung kann <strong>der</strong> Patient<br />
aus rechtlichen Gründen ke<strong>in</strong> tatbestandsausschließendes<br />
E<strong>in</strong>verständnis erteilen. Der Arzt<br />
ist also gezwungen, immer e<strong>in</strong>e Körperverletzung<br />
zu begehen, die grundsätzlich strafbar ist, wenn<br />
<strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge mangeln<strong>der</strong> Aufklärung ke<strong>in</strong>e<br />
wirksame E<strong>in</strong>willigung erteilt hat.<br />
Grund: Der Patientenschutz soll stärker betont<br />
werden, <strong>in</strong>dem <strong>der</strong> Arzt immer unter dem Damoklesschwert<br />
<strong>der</strong> strafbaren Handlung steht<br />
und daher gezwungen wird, den Patienten sorgfältig<br />
aufzuklären, um e<strong>in</strong>e wirksame E<strong>in</strong>willigung<br />
zu erhalten; beim E<strong>in</strong>verständnis wären<br />
die Aufklärungserfor<strong>der</strong>nisse sehr viel niedriger.<br />
Zeitpunkt <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungserklärung<br />
rechtfertigende<br />
E<strong>in</strong>willigung<br />
Bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung handelt es sich<br />
um e<strong>in</strong>en Verzicht auf Rechtsschutz,<br />
obwohl die Rechtsgutsverletzung bereits<br />
e<strong>in</strong>getreten ist.<br />
Die E<strong>in</strong>willigung setzt voraus, dass<br />
man von se<strong>in</strong>em Selbstbestimmungsrecht<br />
Gebrauch macht.<br />
Bsp.: (-), weil gesetzlich nicht geregelt.<br />
Die E<strong>in</strong>willigung teilt sich <strong>in</strong> die ausdrücklich<br />
erklärte und die mutmaßliche<br />
E<strong>in</strong>willigung.<br />
Die beiden Arten <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung unterscheiden<br />
sich dadurch, dass bei <strong>der</strong><br />
mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung ke<strong>in</strong>e tatsächliche<br />
E<strong>in</strong>willigung des Patienten<br />
vorliegt.<br />
die E<strong>in</strong>willigung muß immer vor dem Heile<strong>in</strong>griff erklärt werden.<br />
Ist <strong>der</strong> Patient geh<strong>in</strong><strong>der</strong>t, gelangen automatisch die Grundsätze <strong>der</strong> mutmaßlichen<br />
E<strong>in</strong>willigung <strong>zur</strong> Anwendung.<br />
Hauptanwendungsfälle <strong>der</strong> mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> bewußtlos<br />
e<strong>in</strong>gelieferte Unfallpatient und die <strong>in</strong>traoperative E<strong>in</strong>griffserweiterung.<br />
Der Arzt muß dann entscheiden, ob ggf. die OP abzubrechen und die Aufklärung nachzuholen<br />
ist o<strong>der</strong> ob die Voraussetzungen <strong>der</strong> mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung im Zeitpunkt <strong>der</strong> OP vorliegen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 64 von 180<br />
V. ausdrückli- Prüfungskarte ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung des Patienten<br />
che E<strong>in</strong>willi-<br />
gung<br />
1. objektive Voraussetzungen<br />
a. Zulässigkeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung<br />
E<strong>in</strong>willigen<strong>der</strong> muß Inhaber des betreffenden Rechtsgutes se<strong>in</strong> (unproblematisch,<br />
weil Patienten allesamt Träger des Rechtsgutes <strong>der</strong> körperlichen <strong>in</strong>tegrität s<strong>in</strong>d).<br />
Das Rechtsgut muß <strong>der</strong> Dispositionsbefugnis des E<strong>in</strong>willigenden unterliegen<br />
(ist beim Rechtsgut „körperliche Integrität“ <strong>der</strong> Fall, nicht aber beim Rechtsgut „Leben“).<br />
b. Wirksamkeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung<br />
E<strong>in</strong>willigen<strong>der</strong> war e<strong>in</strong>willigungsfähig<br />
Patient muß e<strong>in</strong>willigungsfähig se<strong>in</strong>. er muß nach se<strong>in</strong>er sittlichen und<br />
geistigen Reife <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage se<strong>in</strong>, die Bedeutung des ärztlichen E<strong>in</strong>griffs<br />
und des Verzichts auf den Schutz des Rechtsgutes zu erkennen und<br />
sachgerecht zu beurteilen.<br />
Bsp.: Patient beharrt mit laienhaftem Unverstand auf selbstgestellter Diagnose und<br />
verlangt demgemäße Behandlung. Mangelnde Belehrbarkeit beruht sowohl auf Unkenntnis,<br />
als auch auf seelischer Verfassung, die e<strong>in</strong> verstandesgemäßes Abwägen <strong>der</strong><br />
Argumente verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t (= Patient hat sich „h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gesteigert“). Wenn es dem Arzt nicht<br />
gel<strong>in</strong>gt, das Vorstellungsbild des Patienten mit realistischen mediz<strong>in</strong>ischen Beurteilungen<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen, ist jede trotzdem erteilte E<strong>in</strong>willigung unwirksam.<br />
ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigungsmängel liegen vor<br />
Die E<strong>in</strong>willigung muß frei von Willensmängeln se<strong>in</strong>. Sie darf nicht durch<br />
Zwang, Täuschung, Irrtum o<strong>der</strong> mangelnde Information zustande gekommen<br />
se<strong>in</strong> (= die Fehlvorstellung muß sich auf den E<strong>in</strong>griff selbst beziehen<br />
und nicht auf dessen Begleitumstände). D.h., daß <strong>der</strong> Patient umfassend<br />
vom Arzt aufgeklärt wurde; diese Aufklärung ist zu dokumentieren.<br />
Konkretisierung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung<br />
Der Arzt muss sichergehen, dass <strong>der</strong> Patient se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> die Behandlung<br />
nicht auf e<strong>in</strong>en bestimmten Arzt konkretisiert hat mit <strong>der</strong> Folge,<br />
dass ggf. <strong>der</strong> behandelnde Arzt ohne E<strong>in</strong>willigung ist. Zwar hat e<strong>in</strong> Patient<br />
ke<strong>in</strong>en Anspruch auf Behandlung durch e<strong>in</strong>en bestimmten Arzt (OLG Köln,<br />
MedR 2009, 478 [479]). Er kann se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung aber ausdrücklich o<strong>der</strong><br />
konkludent beschränken/konkretisieren mit <strong>der</strong> Folge, u.U. nicht behandelt zu<br />
werden, weil <strong>der</strong> bestimmte Arzt nicht verfügbar ist (OLG Köln, a.a.O., ebd.).<br />
E<strong>in</strong>e konkretisierte E<strong>in</strong>willigung kann nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e allg. umgedeutet werden!<br />
Vorliegen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungserklärung selbst<br />
Die E<strong>in</strong>willigungserklärung muß nach außen vernehmbar abgegeben worden<br />
se<strong>in</strong>.<br />
ke<strong>in</strong>e Sittenwidrigkeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungserklärung<br />
Maßstab <strong>der</strong> Sittenwidrigkeit ist § 226a StGB, i.d.R. verstößt <strong>der</strong> ärztliche<br />
E<strong>in</strong>griff nicht gegen die guten Sitten.<br />
Zeitpunkt <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungserklärung<br />
Die E<strong>in</strong>willigungserklärung muß vor <strong>der</strong> Tat (= Operation) erteilt worden<br />
se<strong>in</strong> und zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Tat (= Operation) noch andauern. E<strong>in</strong>e nachträglich<br />
erteilte Zustimmung rechtfertigt die Operation nicht.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 65 von 180<br />
2. subjektive Voraussetzungen<br />
Der Täter (= Arzt) muß <strong>in</strong> Kenntnis <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung handeln. Dies ist <strong>in</strong><br />
aller Regel <strong>der</strong> Fall. Operiert <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> Unkenntnis dessen, begeht er e<strong>in</strong>e<br />
versuchte Körperverletzung.<br />
VI. mutmaßliche Prüfungskarte mutmaßliche E<strong>in</strong>willigung des Patienten<br />
E<strong>in</strong>willigung<br />
1. objektive Voraussetzungen<br />
a. Vorprüfung<br />
es liegt aus tatsächlichen Gründen (= bewußtloser Unfallpatient) ke<strong>in</strong>e ausdrückliche<br />
E<strong>in</strong>willigung vor.<br />
es liegen ke<strong>in</strong>e Anhaltspunkte vor, die den Schluß zulassen, daß <strong>der</strong> Patient<br />
gegen die Vornahme des ärztlichen E<strong>in</strong>griffs ist.<br />
b. die ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung wäre zulässig gewesen<br />
s.o. (hypothetische Prüfung).<br />
c. die ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung wäre wirksam gewesen<br />
s.o. (hypothetische Prüfung).<br />
c. Annahme e<strong>in</strong>er mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigungserklärung<br />
Ermittlung des hypothetischen Willens anhand persönlicher Umstände<br />
Der Arzt muß die persönlichen Umstände des Patienten nach Möglichkeit<br />
untersuchen und prüfen, welche<br />
- <strong>in</strong>dividuellen Wünsche,<br />
- Interessen,<br />
- Bedürfnisse,<br />
- Wertvorstellungen,<br />
- religiöse Überzeugungen<br />
<strong>der</strong> Patient hat, die Rückschlüsse auf die hypothetische Willensbildung<br />
zulassen. Die Willensbildung geht also aus von <strong>der</strong> Umfeldanalyse des<br />
Patienten und entwickelt darauf aufbauend den mutmaßlichen Willen.<br />
Ermittlung des hypothetischen Willens anhand sonstiger Umstände<br />
Ist die Umfeldanalyse nicht möglich, dann muß gefragt werden, wie sich e<strong>in</strong><br />
durchschnittlicher, normaler Bürger <strong>in</strong> <strong>der</strong> Situation verhalten hätte.<br />
Es ist also zu fragen, was geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> <strong>in</strong> dieser Situation als normal und<br />
vernünftig angesehen wird (BGH, NJW 1988, 2311).<br />
2. subjektive Voraussetzungen<br />
Der Täter (= Arzt) muß subjektiv die Absicht haben, im S<strong>in</strong>ne des Patienten<br />
zu handeln, und zwar nach dem GoA-Pr<strong>in</strong>zip:<br />
Zustimmung des Betroffenen konnte nicht mehr rechtzeitig e<strong>in</strong>geholt<br />
werden.<br />
Tat ist objektiv im Interesse des Patienten.<br />
Arzt ist gemäß vorstehen<strong>der</strong> Prüfung überzeugt, daß E<strong>in</strong>griff dem mutmaßlichen<br />
Willen des Patienten entsprach und dieser e<strong>in</strong>gewilligt hätte.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 66 von 180<br />
Stellt sich heraus, daß <strong>der</strong> E<strong>in</strong>griff nicht dem Willen des Patienten entsprach,<br />
dann ist <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Handeln dennoch gerechtfertigt, wenn<br />
er e<strong>in</strong>e gewissenhafte Prüfung nachweisen kann.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 67 von 180<br />
VII. Überblick Übersichtskarte <strong>zur</strong> strafrechtlichen Schuld<br />
über die Schuld<br />
Zweck Die Schuld des Täters muß festgestellt werden, weil die Schwere<br />
<strong>der</strong> Schuld das Strafmaß bestimmt: „ohne Schuld ke<strong>in</strong>e Strafe“.<br />
Anknüpfungspunkt <br />
Schuldfähigkeit <br />
E<strong>in</strong>schränkung <br />
Schuldausschließung <br />
Strafaufhebungsgründe<br />
Anknüpfung für die Schuld ist immer die E<strong>in</strong>zeltat und nicht<br />
die Eigenschaften <strong>der</strong> Täterpersönlichkeit o<strong>der</strong> die Art und Weise<br />
<strong>der</strong> Lebensführung des Täters.<br />
Gegenstand des Schuldvorwurfs ist die fehlerhafte E<strong>in</strong>stellung<br />
des Täters <strong>zur</strong> Rechtsordnung, die dar<strong>in</strong> besteht, daß er sich<br />
nicht zu e<strong>in</strong>em rechtmäßigen Handeln hat motivieren lassen,<br />
obwohl er sich für das Recht hätte entscheiden können (sog.<br />
An<strong>der</strong>shandeln-können“). Schuld impliziert Willensfreiheit.<br />
Schuld ist die Vorwerfbarkeit <strong>der</strong> Tat im H<strong>in</strong>blick auf die ihr<br />
zugrunde liegende, dem Recht wi<strong>der</strong>sprechende Haltung des Täters,<br />
die auf e<strong>in</strong>er fehlerhaften Willensbildung des Täters beruht<br />
(= die fehlerhafte Willensbildung ist also bewertet).<br />
Sie bezeichnet das M<strong>in</strong>destmaß an Selbstbestimmung, das vom<br />
Gesetz für die strafrechtliche Verantwortlichkeit verlangt wird.<br />
Wichtig ist hier § 19 StGB. Danach gilt:<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> s<strong>in</strong>d schuldunfähig.<br />
Jugendliche von 14-18 Jahre s<strong>in</strong>d nach § 1 II JGG nicht automatisch<br />
schuldfähig. Diese muß nach § 3 JGG ausdrücklich<br />
festgestellt werden.<br />
für Heranwachsende von 18-21 Jahre gilt nach § 105 JGG dasselbe,<br />
denn er verweist auf § 3 JGG,<br />
Erwachsene s<strong>in</strong>d grundsätzlich schuldfähig.<br />
Nach §§ 20, 21 StGB ist die Schuldfähigkeit auf zweierlei Art<br />
e<strong>in</strong>geschränkt:<br />
durch mangelnde Fähigkeit <strong>zur</strong> Unrechtse<strong>in</strong>sicht (= <strong>in</strong>tellektueller<br />
o<strong>der</strong> biologischer Defekt [= Schwachs<strong>in</strong>n, Bewußtse<strong>in</strong>sstörung,<br />
seelische Störung] nach §§ 20, 21 StGB),<br />
durch den Ausschluß <strong>der</strong> Steuerungsfähigkeit (= übermäßiger<br />
Alkoholkonsum),<br />
Damit s<strong>in</strong>d die Entschuldigungsgründe geme<strong>in</strong>t. Zu nennen s<strong>in</strong>d<br />
§ 33 StGB, § 35 StGB, <strong>der</strong> sog. übergesetzliche Notstand und <strong>der</strong><br />
Verbotsirrtum.<br />
Daneben gibt es noch die Strafaufhebungsgründe. Sie beseitigen<br />
e<strong>in</strong>e bereits e<strong>in</strong>getretene Strafbarkeit rückwirkend, wie etwa <strong>der</strong><br />
Rücktritt vom Versuch nach § 24 StGB.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 68 von 180<br />
Situation:<br />
Sachverhalt: Strafbarkeiten im Behandlungsumfeld<br />
Die Krankenschwester K. geht am Ende ihrer Nachtschicht nach Hause, obwohl<br />
e<strong>in</strong> Patient kurz zuvor den Notruf betätigt hat.<br />
A. Geme<strong>in</strong>ge- Geme<strong>in</strong>gefährliche Straftaten<br />
fährliche<br />
Straftaten<br />
Im <strong>Pflege</strong>alltag stellt sich schnell die Frage, <strong>in</strong>wieweit das <strong>Pflege</strong>personal<br />
wegen unterlassenen Hilfeleistung gemäß § 323 c StGB strafrechtlich <strong>zur</strong><br />
Verantwortung gezogen werden kann, etwa wenn e<strong>in</strong>em auf <strong>der</strong> Station verunglückten<br />
Patient aus diversen Gründen nicht (rechtzeitig) geholfen wird<br />
(z.B. wegen Bestehens persönlicher Animositäten).<br />
Die unterlassene Hilfeleistung gehört nach <strong>der</strong> Legaldef<strong>in</strong>ition des Gesetzgebers übrigens zu den<br />
geme<strong>in</strong>gefährlichen Straftaten.<br />
I. Unterlassene Prüfungskarte Unterlassene Hilfeleistung<br />
Hilfeleistung<br />
1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Der objektive Tatbestand <strong>der</strong> unterlassenen Hilfeleistung setzt voraus, daß <strong>der</strong> Täter bei<br />
Unglücksfällen o<strong>der</strong> geme<strong>in</strong>er Gefahr o<strong>der</strong> Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erfor<strong>der</strong>lich<br />
und ihm den Umständen nach auch zumutbar war.<br />
aa. Unglücksfall<br />
Def.: Unglücksfall ist jedes plötzlich e<strong>in</strong>tretende Ereignis, das erhebliche Personen-<br />
o<strong>der</strong> Sachschäden anrichtet o<strong>der</strong> an<strong>zur</strong>ichten droht.<br />
(Dazu zählt e<strong>in</strong> vom Gefährdeten selbst verursachter Unglücksfall, wenn dieser<br />
nicht absichtlich herbeigeführt wurde [= Patient stürzt aus Unachtsamkeit]).<br />
bb. Unterlassen <strong>der</strong> möglichen Hilfeleistung<br />
cc. Erfor<strong>der</strong>lichkeit und Zumutbarkeit <strong>der</strong> möglichen hilfe<br />
Die vom Täter unterlaß. Hilfe muß erfor<strong>der</strong>lich und diesem zumutbar gewesen se<strong>in</strong>.<br />
Def.: Die Hilfe ist erfor<strong>der</strong>lich, wenn <strong>der</strong> Betroffene sich nicht selbst helfen kann<br />
und an<strong>der</strong>weitig ist ke<strong>in</strong>e ausreichende Hilfe verfügbar.<br />
Def.: Die Hilfe ist zumutbar, wenn sie nach allgeme<strong>in</strong>en sittlichen Maßstäben aufgebürdet<br />
werden kann, ohne daß sich <strong>der</strong> Täter dabei e<strong>in</strong>er erheblichen Eigengefahr<br />
aussetzt.<br />
a. subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
3. Schuld
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 69 von 180<br />
II. E<strong>in</strong>zelfragen<br />
<strong>zur</strong> unterlasse- Ausgewählte E<strong>in</strong>zelfragen <strong>zur</strong> unterlassenen Hilfeleistung<br />
nen Hilfelei-<br />
stung<br />
1. objektiver Tatbestand<br />
a. Unglücksfall<br />
E<strong>in</strong>e schwere Krankheit ist ke<strong>in</strong> Unglücksfall. Der Nichtbesuch e<strong>in</strong>es<br />
Schwerkranken ist für den Arzt und das Krankenpflegepersonal<br />
jedenfalls dann ke<strong>in</strong>e unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht gerade<br />
e<strong>in</strong> akuter Notfall vorliegt (Bsp.: Schwerkranker Patient stirbt ohne<br />
Vorwarnung nach Visite. -> Ke<strong>in</strong> § 323 c StGB für den Arzt).<br />
Aber: die plötzliche Wendung e<strong>in</strong>er Krankheit sehr wohl e<strong>in</strong>en<br />
Unglücksfall darstellt, <strong>der</strong> die Pflicht <strong>zur</strong> sofortigen Operation begründet.<br />
Als plötzliche Wendung gilt:<br />
schwere, andauernde Atemnot (OLG D'dorf, NJW 1995, 799),<br />
sich steigernde und nahezu unerträglich gewordene Schmerzen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauchhöhle (OLG Hamm, NJW 1975, 605),<br />
schlimme Atembeschwerden und Schmerzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Brust.<br />
b. Abgrenzung Tun / Unterlassen<br />
Zur Abgrenzung fragt man immer, wo <strong>der</strong> Schwerpunkt des strafrechtlich<br />
relevanten Verhaltens liegt: auf dem Tun o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nichtvornahme.<br />
Bsp.: Abschalten Herz-Lungen-Masch<strong>in</strong>e ist Unterlassen <strong>der</strong> Weiterbehandlung.<br />
c. Zumutbarkeit und Erfor<strong>der</strong>lichkeit <strong>der</strong> Hilfe<br />
Bei <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> Erfor<strong>der</strong>lichkeit kommt es darauf an, ob die<br />
Krankenschwester nach dem vorausschauenden Urteil e<strong>in</strong>es objektiven<br />
Beobachters e<strong>in</strong>e Chance <strong>zur</strong> Abwehr <strong>der</strong> Gefahr vertan hat.<br />
Voraussetzung für jede Hilfspflicht ist, daß die Möglichkeit <strong>zur</strong> Hilfe<br />
besteht und auch e<strong>in</strong>e gewisse räumliche Nähe zum Unglücksfall<br />
gegeben ist.<br />
Beachte: § 323 c StGB schafft ke<strong>in</strong>e absolute Son<strong>der</strong>pflicht für das<br />
<strong>Pflege</strong>personal <strong>zur</strong> Hilfeleistung. Jedoch s<strong>in</strong>d sie am ehesten <strong>zur</strong><br />
Hilfeleistung geeignet und verpflichtet.<br />
In beson<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>zelfällen kann die Hilfeleistung dann unzumutbar<br />
se<strong>in</strong>, wenn es sich bei dem Betroffenen um e<strong>in</strong>en Aids-Infizierten<br />
handelt und e<strong>in</strong> akutes Infektionsrisiko mit direkter Lebensgefahr<br />
für den Hilfeleistenden bestünde.<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
Entfallen <strong>der</strong> Rechtswidrigkeit<br />
Der durch den Unglücksfall Betroffene verzichtet auf Hilfe und er<br />
bef<strong>in</strong>det sich nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er psychischen Ausnahmeverfassung von<br />
Krankheitswert.<br />
Hier spielt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten e<strong>in</strong>e maßgebliche<br />
Rolle. Es ist - an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong> Wille <strong>zur</strong> Selbsttötung - stets zu achten.<br />
Bleibt <strong>der</strong> Arzt o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Krankenschwester gegenüber e<strong>in</strong>em Behandlungsunwilligen<br />
untätig, dann liegt ke<strong>in</strong>e rechtswidrige Tat i.S.d. § 323 c StGB vor.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 70 von 180<br />
B. Straftaten Straftaten gegen das menschliche Leben<br />
gegen das Leben<br />
I. E<strong>in</strong>leitung Im <strong>Pflege</strong>bereich s<strong>in</strong>d aus dem Bereich <strong>der</strong> vorsätzlichen Straftaten unmittelbar<br />
gegen das menschliche Leben hauptsächlich die Aussetzung (§ 221 StGB), <strong>der</strong><br />
Mord (§ 211 StGB), <strong>der</strong> Totschlag (§ 212 StGB), <strong>der</strong> Schwangerschaftsabbruch<br />
(§§ 218 ff. StGB) und die Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) e<strong>in</strong>schlägig.<br />
Im Fahrlässigkeitsbereich dom<strong>in</strong>iert die fahrlässige Tötung (§ 222 StGB), die<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> ärztlichen Behandlungspraxis mit weitem Abstand an <strong>der</strong><br />
Spitze steht.<br />
1. Grundlagen<br />
und<br />
Grenzen<br />
des strafrechtlichenLebensschutzes<br />
2. Schutzrichtung<br />
3. Todeszeitpunkt<br />
und Symptome<br />
Rechtstechnisch gesehen verwandelt sich mit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Geburt<br />
die Leibesfrucht zum Menschen und untersteht dem absoluten<br />
Lebensschutz (<strong>in</strong> Abgrenzung vom allgeme<strong>in</strong>en Rechtsschutz,<br />
den bereits <strong>der</strong> Fötus genießt).<br />
Der strafrechtliche Lebensschutz verbietet jegliche Differenzierung<br />
und Bewertung menschlichen Lebens nach qualitativen<br />
o<strong>der</strong> quantitativen Kriterien. Es kommt daher nicht auf die Lebensfähigkeit<br />
o<strong>der</strong> den Lebenswert an.<br />
Frühgeburten, mißgebildete K<strong>in</strong><strong>der</strong> und sogar hirnlose K<strong>in</strong><strong>der</strong> s<strong>in</strong>d<br />
ebenso Menschen i.S.d. Strafrechts und damit strafrechtlichem<br />
Schutz zugänglich wie todkranke o<strong>der</strong> schwer hirngeschädigte<br />
Unfallopfer, die nur noch mit Hilfe <strong>der</strong> sog. Apparatemediz<strong>in</strong> am<br />
Leben erhalten werden.<br />
Strafrechtlich relevantes Verhalten muß sich immer gegen den lebenden<br />
Menschen richten, so daß aktive Handlungen nach dessen<br />
Tod ke<strong>in</strong>en Tötungstatbestand mehr erfüllen können.<br />
Jede <strong>zur</strong>echenbare Verursachung des Todes erfüllt die Tathandlung<br />
des Tötens, so daß auch Sterbende durch die Beschleunigung<br />
des Sterbevorganges getötet werden können.<br />
Nach herrschen<strong>der</strong> Auffassung von Mediz<strong>in</strong>ern und Juristen fixiert<br />
<strong>der</strong> Todeszeitpunkt auf den Funktionsausfall des Gesamthirns,<br />
d.h. des Großhirns und Stammhirns (vgl. dazu: Heun, JZ 1996,<br />
213 ff.).<br />
Symptome für e<strong>in</strong>e Hirntod-Diagnose (nach e<strong>in</strong>er Zusammenstellung<br />
<strong>der</strong> Bundesärztekammer):<br />
Bewußtlosigkeit,<br />
reaktionslose Pupillenerweiterung,<br />
Fehlen von Schmerzreizreaktionen und bestimmter Reflexe,<br />
Ausfall <strong>der</strong> Spontanatmung und bei weiterer kl<strong>in</strong>ischer Beobachtung<br />
ersatzweise Feststellung <strong>der</strong> Null<strong>in</strong>ie im Elektroenzephalogramm<br />
und/o<strong>der</strong> des Kreislaufstillstands im Hirn.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 71 von 180<br />
II. Die fahrlässige<br />
Tötung<br />
1. Rechtsgutsschutz<br />
2. Prozessuale<br />
Probleme<br />
bei den<br />
Sorgfaltsanfor<strong>der</strong>ungen<br />
1. Tatbestand<br />
a. Erfolgse<strong>in</strong>tritt<br />
Die Fahrlässige Tötung<br />
Rechtsgut und Gegenstand <strong>der</strong> Tat ist <strong>der</strong> lebende Mensch und damit<br />
auch e<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>toter Patient sowie e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> o<strong>der</strong> gleich nach <strong>der</strong> Geburt<br />
(m<strong>in</strong>destens muß <strong>der</strong> Geburtsvorgang e<strong>in</strong>gesetzt haben).<br />
Fahrlässig handelt, wer trotz Voraussehbarkeit e<strong>in</strong>er Rechtsverletzung<br />
e<strong>in</strong>en gesetzlichen Straftatbestand <strong>in</strong> pflichtwidriger Weise verwirklicht.<br />
In <strong>der</strong> Rechtsliteratur ist - zutreffend - immer wie<strong>der</strong> angemahnt worden, daß die Sorgfaltsanfor<strong>der</strong>ungen<br />
an den Arzt und das <strong>Pflege</strong>personal von Strafgerichten nicht überspannt werden<br />
dürfen.<br />
Begründet wird dies damit, daß Gerichte und Sachverständige Anfor<strong>der</strong>ungen an die Sorgfalt<br />
stellen, die häufig unbesehen <strong>der</strong> tatsächlichen Möglichkeiten normaler Krankenhäuser an<br />
den überdurchschnittlichen Standards von Spezialkl<strong>in</strong>iken festgemacht werden, wobei unberücksichtigt<br />
bleibt, daß <strong>der</strong>en optimaler Standard von solchen herkömmlichen Krankenhäusern<br />
nur selten erreicht werden kann, so daß "lediglich" <strong>der</strong> reguläre, aber mediz<strong>in</strong>isch völlig<br />
ausreichende Standard (auch <strong>in</strong> organisatorischer und personeller H<strong>in</strong>sicht) erreicht wird.<br />
Urteile gründen meist auf solchen "Idealausstattungen", die an <strong>der</strong> Realität <strong>der</strong> meisten Häuser<br />
vorbeigehen (Vgl. dazu: Ulsenheimer, S. 30 f.).<br />
Prüfungskarte fahrlässige Tötung<br />
Ursache des Todes des Patienten ist die kausale Handlung des Täters (Arzt/<strong>Pflege</strong>r).<br />
Der Patient ist Bluter o<strong>der</strong> er hat e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s dünne Schädeldecke,<br />
E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>er Epidemie <strong>in</strong> dem Krankenhaus, <strong>in</strong> das <strong>der</strong> Verletzte e<strong>in</strong>geliefert wurde.<br />
b. Kausalität zwischen Täterverhalten und Tatbestandserfolg<br />
c. objektive Sorgfaltspflichtverletzung<br />
Die Sorgfaltspflichten ergeben sich für den Arzt und die Krankenschwester aus <strong>der</strong> Gesamtheit<br />
<strong>der</strong> beruflichen Ausbildung, woraus im e<strong>in</strong>zelnen beson<strong>der</strong>e Verhaltenspflichten<br />
folgen. E<strong>in</strong> Verstoß gegen Sorgfaltspflichten liegt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e vor, wenn<br />
<strong>der</strong> Arzt e<strong>in</strong>en Behandlungsfehler begeht, dessen (Geschehens-)ablauf vorhersehbar<br />
war, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e wenn<br />
<strong>der</strong> Arzt entgegen anerkannter Regeln <strong>der</strong> ärztlichen Kunst operiert, weil er Anhänger<br />
an<strong>der</strong>er Heilverfahren ist,<br />
<strong>der</strong> Arzt E<strong>in</strong>griffe ohne vorherige Diagnose vornimmt,<br />
die Krankenschwester nicht über die im Beruf erfor<strong>der</strong>lichen M<strong>in</strong>destkenntnisse verfügt<br />
und <strong>in</strong>folgedessen Fehler <strong>in</strong> <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en <strong>Pflege</strong> begeht<br />
und <strong>in</strong> diesen Fällen <strong>der</strong> Patient zu Tode kommt.<br />
d. Pflichtwidrigkeitszusammenhang<br />
Der tatbestandliche Erfolg, also <strong>der</strong> Tod des Patienten muß gerade auf dem pflichtwidrigen<br />
Verhalten <strong>der</strong> Krankenschwester o<strong>der</strong> des Arztes beruhen.<br />
e. Schutzzweckzusammenhang<br />
§ 222 StGB will von se<strong>in</strong>er Schutzrichtung gerade den e<strong>in</strong>getretenen Erfolg verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.<br />
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 72 von 180<br />
III. Das Verlassen<br />
<strong>in</strong> hilfloser<br />
Lage<br />
1. Schutzrichtung<br />
2. Krankheitsbegriff<br />
des § 221<br />
StGB<br />
1. Tatbestand<br />
Das Verlassen <strong>in</strong> hilfsloser Lage (Aussetzung)<br />
Die Vorschrift des § 221 StGB schützt vor <strong>der</strong> Gefährdung<br />
hilfloser Personen an Leib und Leben dadurch, daß sich das<br />
<strong>Pflege</strong>personal unerlaubt von den Patienten entfernt, etwa <strong>in</strong>dem<br />
es die Station verlässt.<br />
Hilflos ist je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> <strong>zur</strong> Tatzeit verschuldet o<strong>der</strong> unverschuldet<br />
außerstande ist, sich ohne Hilfe an<strong>der</strong>er gegen e<strong>in</strong>e se<strong>in</strong> Leben<br />
o<strong>der</strong> se<strong>in</strong>e Gesundheit bedrohende Gefahr zu wehren.<br />
Die Hilflosigkeit bezieht sich daher auf unterschiedliche Ursachen<br />
wie Jugendlichkeit (Neugeborene o<strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>),<br />
Gebrechlichkeit (alte Menschen) o<strong>der</strong> auch Krankheit.<br />
Krankheit wird nicht im engen mediz<strong>in</strong>ischen S<strong>in</strong>ne als pathologischer<br />
Zustand verstanden. Auch die schwere Angetrunkenheit<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zustand während <strong>der</strong> Geburt fallen darunter.<br />
Die bloße Schwangerschaft an sich kann nicht als hilflose Lage<br />
verstanden werden, weil die Schwangere durchaus <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage<br />
ist, sich gegen Angriffe auf ihr Leben o<strong>der</strong> ihre Gesundheit zu<br />
wehren. Das än<strong>der</strong>t sich erst mit dem Geburtsvorgang selbst.<br />
Prüfungskarte Verlassen <strong>in</strong> hilfloser Lage<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Tatobjekt ist <strong>der</strong> Patient, <strong>der</strong> sich nicht alle<strong>in</strong>e helfen o<strong>der</strong> selbst schützen kann. Es<br />
kommt nicht darauf an, ob die Hilflosigkeit verschuldet o<strong>der</strong> unverschuldet ist. Fast immer<br />
s<strong>in</strong>d Patienten hilflos i.s.d. Vorschrift des § 221 StGB.<br />
Täter des § 221 StGB kann nur se<strong>in</strong>, wer obhutspflichtig ist o<strong>der</strong> sonstwie für die Unterbr<strong>in</strong>gung<br />
o<strong>der</strong> Aufnahme des Hilfsbedürftigen (= Patienten) zu sorgen hat (Garantenpflicht).<br />
Entscheidend ist, daß <strong>der</strong> Täter e<strong>in</strong>e Garantenstellung <strong>in</strong>ne hat. Damit ist auch das<br />
<strong>Pflege</strong>personal Täter des § 221 I 1.Alt. StGB.<br />
Tathandlung ist das Verlassen des Patienten <strong>in</strong> hilfloser Lage. Charakteristisch ist, daß<br />
<strong>der</strong> Aufenthalt des Patienten unverän<strong>der</strong>t bleibt, stattdessen sich jedoch <strong>der</strong> Täter entfernt<br />
und dadurch die räumliche Nähe zum Patienten aufhebt.<br />
Taterfolg ist, daß <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge des Verlassens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e vorher nicht vorhandene konkrete<br />
Gefahr gebracht worden ist. E<strong>in</strong>e solche Gefahr besteht dann, wenn es nur vom Zufall<br />
abhängt, ob <strong>der</strong> Patient gerettet wird o<strong>der</strong> nicht.<br />
Dies ist auch dann <strong>der</strong> Fall, wenn sich die hilflose Person ohneh<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er latenten Gefahrenlage<br />
bef<strong>in</strong>det und ihr durch die Abwesenheit des Betreuenden Rettungschancen<br />
entzogen o<strong>der</strong> verr<strong>in</strong>gert werden (OLG Zweibrücken, NStZ 1997, 601 [602]).<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
Zum Vorsatz reicht dolus eventualis aus:<br />
Es genügt, daß die <strong>Pflege</strong>person e<strong>in</strong>e Verschlechterung des Gesundheitszustandes und die<br />
Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung von Rettungschancen für den Fall ihrer Abwesenheit für möglich hält und<br />
diese Folgen billigend <strong>in</strong> Kauf nimmt.<br />
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 73 von 180<br />
IV. Der<br />
Schwangerschaftsabbruch<br />
Abgrenzung<br />
zwischen §<br />
221 und §<br />
323c StGB<br />
1. Entstehungsgeschichte<br />
2. Grundsatzentscheidung<br />
BVerfG<br />
3. Zeitweise<br />
doppelte<br />
Regelung<br />
Die Rechtswidrigkeit entfällt nicht etwa dadurch, daß z.B. e<strong>in</strong> Angehöriger des Patienten<br />
während <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> unerlaubten Abwesenheit des <strong>Pflege</strong>personals vom Patienten auf<br />
diesen aufpasst. Entscheidend ist, daß <strong>der</strong> Täter durch das Verlassen des Patienten se<strong>in</strong>e<br />
Garantenpflicht verletzt hat und dadurch e<strong>in</strong> erhöhtes Risiko herbeigeführt hat.<br />
Das Verlassen Hilfloser liegt tatbestandlich nicht schon vor, wenn<br />
die Krankenschwester den Patienten, <strong>der</strong> sich <strong>in</strong> ihrer Obhut bef<strong>in</strong>det,<br />
vernachlässigt. Dann greift § 323 c StGB. Erst wenn die Vernachlässigung<br />
e<strong>in</strong> Verlassen ist, ist § 221 I 2. Alt. StGB erfüllt.<br />
Der Schwangerschaftsabbruch<br />
Das geltende Recht zum Schwangerschaftsabbruch beruht auf<br />
Art. 14 SFHG (Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom<br />
27.7.1992, BGBl. I S. 1398) <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fassung des 8. SFHÄndG<br />
(Schwangeren- und Familienhilfeän<strong>der</strong>ungsgesetz vom 21.8.1995,<br />
BGBl. I, S. 1050).<br />
Mit den gesetzlichen Neuregelungen <strong>in</strong> den Jahren 1992 und 1995<br />
wurde das vorläufige Ende e<strong>in</strong>er leidenschaftlichen, mehr als zwei<br />
Jahrzehnte währenden Diskussion erreicht, die zu e<strong>in</strong>er Fülle juristischer,<br />
politischer, philosophischer, theologischer und mediz<strong>in</strong>isch-ethischer<br />
Beiträge über dieses (Endlos-)thema geführt hatte.<br />
Den Ausgangspunkt bildete die Grundsatzentscheidung des<br />
BVerfG im Bd. 39, S. 1 ff.<br />
Danach ist das werdende Leben als selbständiges, höchstpersönliches<br />
Rechtsgut durch Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG<br />
verfassungsrechtlich anerkannt und geschützt, mit <strong>der</strong> Folge,<br />
daß <strong>der</strong> Staat verpflichtet ist, das Lebensrecht des Embryos<br />
nach <strong>der</strong> Nidation bis zum Ende <strong>der</strong> Schwangerschaft effektiv,<br />
d.h. notfalls auch mit Hilfe strafrechtlicher Sanktionen, gegenüber<br />
je<strong>der</strong>mann, also auch gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht<br />
<strong>der</strong> Mutter, zu schützen.<br />
Aus diesem Grunde verwarf das BVerfG zunächst auch die Fristenlösung<br />
(Straffreiheit <strong>der</strong> Abtreibung <strong>in</strong> den ersten drei Monaten <strong>der</strong> Schwangerschaft)<br />
als grundgesetzwidrig, zeigte aber zugleich den Weg zu e<strong>in</strong>er verfassungskonformen<br />
Lösung durch das sog. Indikationenmodell auf, das<br />
<strong>der</strong> Gesetzgeber mit dem 15. Strafrechtsän<strong>der</strong>ungsgesetz vom 18.5.11976<br />
verwirklichte.<br />
Dennoch verstummte die Diskussion um die entscheidende Frage: "Vorrang<br />
des Schutzes des ungeborenen Lebens o<strong>der</strong> weitere Liberalisierung<br />
bzw. völlige Straffreiheit <strong>der</strong> Abtreibung" nicht.<br />
Brisant wurde das Abtreibungsstrafrecht erst wie<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Deutschen<br />
Wie<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>igung, weil <strong>in</strong> <strong>der</strong> damaligen DDR die Fristenregelung galt<br />
und sich damit die Frage stellte, wie <strong>der</strong> Schwangerschaftsabbruch im<br />
ganzen Bundesgebiet e<strong>in</strong>heitlich geregelt werden sollte.<br />
Der E<strong>in</strong>igungsvertrag ließ diese Frage offen, verpflichtete den Gesetzgeber<br />
aber bis spätestens zum 31.12.1992 dazu, e<strong>in</strong>e Regelung zu treffen,
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 74 von 180<br />
4. Die Bedeutung<br />
des<br />
Schwangerschaftsabbruchs<br />
<strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Praxis<br />
5. WesentlicheRegelungen<br />
§§<br />
218 ff.<br />
StGB<br />
welche den Schutz des ungeborenen Lebens e<strong>in</strong>erseits und die Konfliktsituationen<br />
für Frauen an<strong>der</strong>erseits, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e das Recht auf Beratung<br />
und soziale Hilfe, zu e<strong>in</strong>em besseren Ausgleich br<strong>in</strong>gen sollte, als bislang.<br />
Dies stellt das Schwangeren- und Familienhilfegesetz (SFHG) vom<br />
27.7.1992 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fassung des 8. SFHÄndG (Schwangeren- und Familienhilfeän<strong>der</strong>ungsgesetz)<br />
vom 21.8.1995 auch sicher. Verfassungsrechtliche<br />
Bedenken gegen das nunmehr geltende Abtreibungsrecht s<strong>in</strong>d bislang<br />
nicht rechtswirksam erhoben worden. Das SFHG entspricht vor allem<br />
den vom BVerfG im 2. Fristenlösungsurteil (= BVerfGE 88, 203 ff.) gemachten<br />
Vorgaben und vollendet die durch die Wie<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>igung notwendig<br />
gewordene Vere<strong>in</strong>heitlichung des Abtreibungsstrafrechts.<br />
(Zu den verfassungsrechtlichen Problemen des Abtreibungsstrafrechts<br />
siehe die Thematik: "Grundrechte" <strong>in</strong> <strong>der</strong> Staatsbürgerkunde).<br />
Die im Folgenden zu behandelnden e<strong>in</strong>schlägigen Strafvorschriften<br />
gegen den illegalen Schwangerschaftsabbruch spielen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
heutigen Justizpraxis nur e<strong>in</strong>e sehr untergeordnete Rolle.<br />
Trotz e<strong>in</strong>er geschätzten Zahl von jährlich ca. 120.000 Abtreibungen gibt<br />
es nur verschw<strong>in</strong>dend ger<strong>in</strong>ge strafrechtliche Verurteilungen: 1972:<br />
154; 1980: 30; 1985: 10; 1989: 8; 1990: 8; 1991: 3.<br />
Der strafrechtliche Schutz wird daher nicht umsonst als plakativ<br />
beschrieben (Ulsenheimer, S. 242). Die den Arzt betreffenden<br />
Strafbestimmungen <strong>der</strong> §§ 218 ff. StGB haben eher e<strong>in</strong>e Appell-<br />
und Warnfunktion als e<strong>in</strong>e praktische Bedeutung. Aus diesem<br />
Grunde ist aus Sicht <strong>der</strong> <strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege e<strong>in</strong>e<br />
Diskussion mit den zahlreichen Streitfragen und Stellungnahmen<br />
von untergeordneter Bedeutung. Sie gehört - wie bereits angesprochen<br />
- <strong>in</strong> den Bereich <strong>der</strong> Staatsbürgerkunde.<br />
Aus rechtlicher Sicht <strong>in</strong>teressanter ist <strong>der</strong> nahezu vollständige<br />
Ausschluß von mediz<strong>in</strong>ischen o<strong>der</strong> chemischen Abtreibungspraktiken<br />
<strong>in</strong> den sog. Tendenzbetrieben <strong>der</strong> Katholischen Kirche,<br />
die als e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wenigen auf <strong>der</strong> Basis des über Art. 140 GG,<br />
137 WRV auch im staatlichen Rechtskreis geschützten und dort<br />
wirksamen <strong>in</strong>nerkirchlichen Rechts e<strong>in</strong>en effektiven und wirksamen<br />
Schutz des ungeborenen Lebens garantieren und sicherstellen,<br />
ohne dabei die Rechtsposition <strong>der</strong> Mutter zu vernachlässigen.<br />
a. Fristenlösung mit Beratungspflicht<br />
Nach § 218 a Abs. 1 StGB ist <strong>der</strong> Tatbestand des § 218 StGB<br />
nicht verwirklicht, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen<br />
vorliegen:<br />
aa. § 218 a Abs. 1 Nr. 1 StGB<br />
Die Schwangere muß den Abbruch verlangen und dem Arzt<br />
e<strong>in</strong>e Besche<strong>in</strong>igung über e<strong>in</strong>e dem § 219 und dem Schwangerenkonfliktgesetz<br />
(SchwKG) gemäße Beratung vorlegen, die<br />
m<strong>in</strong>destens drei Tage vor dem E<strong>in</strong>griff erfolgt se<strong>in</strong> muß.<br />
(Anm.: Die Beratungsstellen müssen staatlich anerkannt se<strong>in</strong> sowie wirtschaftlich<br />
und organisatorisch von den E<strong>in</strong>richtungen getrennt se<strong>in</strong>, die die E<strong>in</strong>griffe vornehmen,<br />
§ 219 Abs. 2 Satz 3, § 9 Nr. 4 SchwKG. Die Beratung muß ergebnisoffen<br />
se<strong>in</strong>. Der Beratungssche<strong>in</strong> kann daher letztlich nicht verweigert werden).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 75 von 180<br />
bb. § 218 a Abs. 1 Nr. 2 StGB<br />
Der Abbruch muß von e<strong>in</strong>em Arzt vorgenommen werden.<br />
cc. § 218 a Abs. 1 Nr. 3 StGB<br />
Seit <strong>der</strong> Empfängnis dürfen nicht mehr als 12 Wochen vergangen<br />
se<strong>in</strong>.<br />
b. Indikationen als strafrechtliche Rechtfertigungsgründe<br />
In § 218 a StGB geregelt s<strong>in</strong>d die Indikationen, welche die<br />
Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs entfallen lassen.<br />
Im e<strong>in</strong>zelnen s<strong>in</strong>d die mediz<strong>in</strong>ische und die krim<strong>in</strong>ologische<br />
Indikation neu geregelt worden.<br />
aa. § 218 a Abs. 2 StGB - mediz<strong>in</strong>isch-soziale Indikation<br />
Der § 218 a Abs. 2 StGB enthält die "mediz<strong>in</strong>isch-soziale Indikation".<br />
Erfaßt werden dadurch nur Schwangerschaftsunterbrechungen<br />
wegen für die Schwangere als unzumutbar angesehener<br />
psychischer Belastungen durch e<strong>in</strong> beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tes K<strong>in</strong>d:<br />
Die Schwangere muß <strong>in</strong> den Abbruch e<strong>in</strong>willigen. (Hier<br />
wird das Vorliegen e<strong>in</strong>er wirksamen E<strong>in</strong>willigung <strong>der</strong><br />
Schwangeren geprüft, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e muß sie <strong>der</strong> Arzt über<br />
die Maßnahme aufklären und beraten (= H<strong>in</strong>weis auf vertiefende<br />
psychosoziale Beratung). Grund: Die Abtreibung<br />
ist e<strong>in</strong>e eigene Straftat mit eigenen E<strong>in</strong>willigungsgründen:<br />
Es kann nur <strong>in</strong> § 218 Abs. 2 und 3 StGB e<strong>in</strong>gewilligt werden!<br />
E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> an<strong>der</strong>e Abtreibungsgründe ist<br />
unwirksam!).<br />
Es muß festgestellt werden, daß <strong>der</strong> Abbruch unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse<br />
<strong>der</strong> Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis<br />
(das heißt nicht: ärztliche Notwendigkeit !) angezeigt<br />
ist, um e<strong>in</strong>e wegen <strong>der</strong> Geburt e<strong>in</strong>es schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten<br />
K<strong>in</strong>des drohenden Gefahr für den körperlichen<br />
o<strong>der</strong> seelischen Gesundheitszustand <strong>der</strong> Schwangeren o<strong>der</strong><br />
um e<strong>in</strong>e Gefahr für ihr Leben abzuwenden und die Gefahr<br />
nicht auf an<strong>der</strong>e für die Schwangere zumutbare Weise<br />
abgewendet werden kann.<br />
Auch bei e<strong>in</strong>er Spätabtreibung (20. Woche) muss <strong>der</strong> Arzt<br />
die Schwangere über ihren Anspruch auf weitere, vertiefende<br />
Beratung h<strong>in</strong>weisen und ggf. e<strong>in</strong>en Kontakt zu e<strong>in</strong>er<br />
solchen Beratungsstelle herstellen.<br />
Wenn die Bee<strong>in</strong>trächtigung des seelischen Gesundheitszustandes<br />
<strong>der</strong> Mutter durch die Geburt des schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten<br />
K<strong>in</strong>des so groß ist, dass sie ihre Konstitution überfor<strong>der</strong>n,<br />
tritt das Lebensrecht des Ungeborenen <strong>zur</strong>ück.<br />
Zwischen <strong>der</strong> Beratung und dem Abbruch müssen drei<br />
Tage Abstand zwischen liegen.<br />
Erst dann kann <strong>der</strong> Abbruch durch e<strong>in</strong>en Arzt vorgenommen<br />
werden (aber an<strong>der</strong>er als <strong>der</strong>, <strong>der</strong> die Indikation<br />
ausgestellt hat). Dies kann bis zum Geburtsbeg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>.<br />
bb. § 218 a Abs. 1 Nr. 2 StGB - krim<strong>in</strong>ologische Indikation<br />
Es dürfen noch nicht mehr als 12 Wochen Schwangerschaft<br />
vergangen se<strong>in</strong>.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 76 von 180<br />
6. E<strong>in</strong>zelprobleme<br />
bei den §§<br />
218 ff.<br />
StGB<br />
Die Schwangere muß <strong>in</strong> den vom Arzt durchgeführten<br />
E<strong>in</strong>griff e<strong>in</strong>willigen (Zur E<strong>in</strong>willigung siehe oben).<br />
nach ärztlicher Erkenntnis (auch hier: nicht ärztliche Notwendigkeit<br />
!) ist an <strong>der</strong> Schwangeren e<strong>in</strong>e Straftat i.S.d.<br />
§§ 176-179 (= sexueller Mißbrauch, Vergewaltigung, sexuelle<br />
Nötigung, sexueller Mißbrauch Wi<strong>der</strong>standsunfähiger)<br />
begangen worden und es bestehen dr<strong>in</strong>gende Gründe,<br />
daß die Schwangerschaft auf dieser Tat beruht.<br />
Der Abbruch muß durch e<strong>in</strong>en Arzt vorgenommen werden<br />
(aber an<strong>der</strong>er als <strong>der</strong>, <strong>der</strong> die Indikation ausgestellt hat).<br />
Es besteht bei § 218 a Abs. 3 StGB ke<strong>in</strong>e Beratungspflicht.<br />
c. Flankierende Maßnahmen<br />
Ebenso gibt es noch weitere Delikte, die jedoch gegen über § 218 StGB<br />
subsidiär s<strong>in</strong>d:<br />
Der § 218 b StGB schützt darüber h<strong>in</strong>aus die ordnungsgemäße Feststellung<br />
<strong>der</strong> rechtfertigenden Indikationen. Danach darf e<strong>in</strong> Arzt den<br />
Schwangerschaftsabbruch nur dann vornehmen, wenn er sich vergewissert<br />
hat, daß die schriftliche Feststellung über das Vorliegen e<strong>in</strong>er<br />
Indikation (mediz<strong>in</strong>isch/krim<strong>in</strong>ologisch) vorgelegen hat.<br />
Zu erwähnen ist auch noch § 218 c StGB, <strong>der</strong> e<strong>in</strong> Bündel ärztlicher<br />
Pflichtverletzungen beim Schwangerschaftsabbruch<br />
selbst erfaßt. So wird hierüber die ärztlichen Verstöße gegen Darlegungs-,<br />
Beratungs- und Vergewisserungspflichten im Rahmen<br />
des Beratungskonzepts poenalisiert.<br />
§ 219 a StGB verbietet das Werben für Schwangerschaftsabbrüche<br />
(öffentlich o<strong>der</strong> auf Versammlung o<strong>der</strong> durch Aushänge).<br />
Erfaßt werden durch die Vorschrift aber auch Werbemaßnahmen<br />
für Präparate, die e<strong>in</strong>e Abtreibung ermöglichen (Pille RU 486).<br />
§ 219 b StGB setzt das Inverkehrbr<strong>in</strong>gen von Abtreibungsmitteln<br />
unter Strafe, soweit dadurch e<strong>in</strong> Schwangerschaftsabbruch<br />
nach § 218 StGB geför<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> erleichtert werden soll (Medikamentenhersteller<br />
s<strong>in</strong>d ausgenommen, wenn sie das allgeme<strong>in</strong>e<br />
Zulassungsverfahren e<strong>in</strong>halten).<br />
a. Abgrenzung zu den Tötungsdelikten<br />
Die rechtliche Bedeutung des Beg<strong>in</strong>ns <strong>der</strong> Geburt für die<br />
Krankenpflege<br />
Nach <strong>der</strong> gesetzlichen Regelung <strong>der</strong> §§ 218 ff. StGB ist e<strong>in</strong>e Tötung nach Beg<strong>in</strong>n<br />
<strong>der</strong> Geburt ke<strong>in</strong> Schwangerschaftsabbruch mehr, son<strong>der</strong>n die Tötung e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des,<br />
also e<strong>in</strong>es Menschen. Mit dem Zeitpunkt <strong>der</strong> Geburt wird demzufolge e<strong>in</strong>e<br />
neue strafrechtliche Verantwortlichkeit markiert. Es ist jedoch zu beachten :<br />
nach § 8 StGB ist für die Begehung e<strong>in</strong>er Tat <strong>der</strong> Handlungszeitpunkt<br />
entscheidend und nicht <strong>der</strong> Zeitpunkt des Erfolgse<strong>in</strong>tritts. Ob e<strong>in</strong>e Tat<br />
Schwangerschaftsabbruch ist o<strong>der</strong> Tötung hängt davon ab, welche<br />
Rechtsqualität das Tatobjekt zum Zeitpunkt hat, <strong>in</strong> dem sich die Handlung<br />
auszuwirken beg<strong>in</strong>nt. Kommt das vorzeitig geborene Embryo<br />
unmittelbar nach <strong>der</strong> Geburt durch die E<strong>in</strong>wirkung selbst zu Tode,<br />
die vorgenommen wurde, als es noch e<strong>in</strong>e Leibesfrucht war (=<br />
ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>setzen von Wehen), liegt e<strong>in</strong> Schwangerschaftsabbruch<br />
vor. Wird allerd<strong>in</strong>gs noch e<strong>in</strong>e weitere Handlung durch den Täter vorgenommen,<br />
durch die <strong>der</strong> Tod des Geborenen während o<strong>der</strong> nach <strong>der</strong><br />
Geburt e<strong>in</strong>tritt, liegt Tötung nach § 212 StGB vor.<br />
bei fahrlässiger Verletzung <strong>der</strong> Berufspflichten durch das Krankenpflegepersonal<br />
im o<strong>der</strong> nach dem Geburtsvorgang kommen daher die<br />
fahrlässige Körperverletzung (§ 230 StGB) o<strong>der</strong> die fahrlässige Tötung<br />
(§ 222 StGB) als Delikte <strong>in</strong> Betracht, nicht aber die Abtreibung.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 77 von 180<br />
b. Der Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Geburt<br />
Der Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Geburt ist von <strong>der</strong> Rechtsprechung <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmung mit <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Wissenschaft festgelegt als <strong>der</strong> Zeitpunkt des E<strong>in</strong>setzens <strong>der</strong> Eröffnungswehen.<br />
Entscheidend ist das tatsächliche E<strong>in</strong>setzen <strong>der</strong> Geburtswehen ohne<br />
Rücksicht darauf, ob sie spontan e<strong>in</strong>treten o<strong>der</strong> künstlich hervorgerufen<br />
werden.<br />
(Der Gesetzgeber sche<strong>in</strong>t damit e<strong>in</strong>en gewissen Manipulationsspielraum<br />
<strong>in</strong> Kauf zu nehmen, beispielsweise wenn e<strong>in</strong><br />
Arzt bei e<strong>in</strong>er Schwangeren, bei <strong>der</strong> die mediz<strong>in</strong>ische Indikation<br />
vorliegt und auch sonst alle Anfor<strong>der</strong>ungen nach § 218 a<br />
Abs. 2 StGB erfüllt s<strong>in</strong>d, die Wehen herauszögert, um noch<br />
e<strong>in</strong>e straffreie Abtreibung durchführen zu können, die sich<br />
sonst als strafbarer Totschlag nach § 212 StGB darstellen<br />
würde).<br />
Problematisch ist die Bestimmung des Geburtsbeg<strong>in</strong>ns, wenn an<strong>der</strong>e Vorgängen<br />
als Wehen den Auftakt <strong>der</strong> Geburt bilden (Kaiserschnitt). Dies ist<br />
noch nicht ganz geklärt:<br />
- teils wird auf den Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> operativen ärztlichen Maßnahme<br />
abgestellt (Öffnen <strong>der</strong> Bauchdecke),<br />
- teils auf die Öffnung des Uterus,<br />
- teils auf die E<strong>in</strong>leitung <strong>der</strong> Narkose (m.w.N. bei Ulsenheimer, S.<br />
246).<br />
c. Die Tathandlungen des § 218 StGB<br />
aa. Def<strong>in</strong>ition Schwangerschaftsabbruch<br />
Abbruch <strong>der</strong> Schwangerschaft ist je<strong>der</strong> Vorgang, <strong>der</strong> zum Absterben <strong>der</strong> Leibesfrucht<br />
führt. (Beachte: Die Anwendung nidationshemmer Mittel [Spirale]<br />
ist ke<strong>in</strong>e Abtreibung, wohl aber die Anwendung fruchtabstoßen<strong>der</strong> Mittel ).<br />
bb. Vornahme <strong>der</strong> Abtreibungshandlung<br />
Die Abtreibungshandlung kann durch e<strong>in</strong>e Vornahme o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Unterlassen<br />
erfolgen, wobei dies für den Tod des Feten ursächlich se<strong>in</strong> muß.<br />
Probleme bei <strong>der</strong> Abtreibungshandlung für den Arzt<br />
Welche Maßnahmen muß e<strong>in</strong> Arzt als Garant <strong>zur</strong> Rettung <strong>der</strong> noch lebenden<br />
Leibesfrucht e<strong>in</strong>er hirntoten Mutter vornehmen ?<br />
=> Er muß dem mutmaßlichen Willen <strong>der</strong> toten Mutter folgen. Bei mutmaßlicher<br />
E<strong>in</strong>willigung muß er alles tun, um die bedrohte Leibesfrucht zu<br />
erhalten. An<strong>der</strong>erseits darf er im umgekehrten Fall ke<strong>in</strong>e Maßnahmen <strong>zur</strong><br />
Rettung des Embryos ergreifen.<br />
d. Das K<strong>in</strong>d als Schaden ?<br />
E<strong>in</strong>e weitere Fragestellung ist die, ob e<strong>in</strong> Arzt <strong>zur</strong> Zahlung von K<strong>in</strong>desunterhalt<br />
an die Eltern verpflichtet ist, wenn die Mutter e<strong>in</strong>e rechtmäßige<br />
Abtreibung (med.-soziale Indikation !) deshalb nicht hat vornehmen<br />
lassen, weil <strong>der</strong> Arzt aufgrund e<strong>in</strong>es Behandlungsfehlers<br />
nicht erkannt hat, daß das K<strong>in</strong>d mit schweren Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen <strong>zur</strong><br />
Welt kommen wird (BGH, NJW 2002, 2636 ff.).<br />
Problem: Die Frau ließ sich beim Gynäkologen behandeln, um<br />
feststellen zu lassen, ob das K<strong>in</strong>d gesund sei. Die<br />
Frau hätte die Geburt e<strong>in</strong>es beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten K<strong>in</strong>des psychisch<br />
nicht bewältigt. Der Arzt erkannte bei <strong>der</strong> Untersuchung<br />
die Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung des Fötus wegen<br />
mangeln<strong>der</strong> Sorgfalt (=Behandlungsfehler) nicht.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 78 von 180<br />
Rechtlicher<br />
Ansatz:<br />
Als Anspruchsgrundlage kommt pVV des ärztlichen<br />
Behandlungsvertrages <strong>in</strong> Betracht.<br />
Lösung: Es handelt sich um e<strong>in</strong>e vertragliche Schadenshaftung,<br />
<strong>der</strong> ärztliche Fehler lag <strong>in</strong> <strong>der</strong> unzulänglichen Untersuchung<br />
bzw. <strong>der</strong> unterlassenen Mitteilung des<br />
Untersuchungsergebnisses (= K<strong>in</strong>d beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t) an<br />
die Mutter,<br />
es deutete sich zu dem Zeitpunkt aber schon die<br />
Prognose an, dass die Mutter bei Geburt e<strong>in</strong>es<br />
schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten K<strong>in</strong>des schwerwiegende<br />
Bee<strong>in</strong>trächtigungen ihres seelischen Zustandes<br />
erleiden würde (u.a. Suizidgefahr)<br />
damit lag die mediz<strong>in</strong>isch-soziale Indikation objektiv<br />
vor, ohne daß die Mutter dies wußte,<br />
die Mutter konnte wegen <strong>der</strong> Unkenntnis über das<br />
Vorliegen <strong>der</strong> Indikation nicht frei entscheiden,<br />
ob sie das schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te K<strong>in</strong>d austragen wollte,<br />
die Haftung beruht also auf dem Unterlassen<br />
<strong>der</strong> Erteilung e<strong>in</strong>er notwendigen Information,<br />
über den Gesundheitszustand des K<strong>in</strong>des, die<br />
bei pflichtgemäßer Untersuchung hätte erteilt<br />
werden können (und auch müssen !),<br />
da die Eltern bei Bekannt werden <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
das K<strong>in</strong>d hätten abtreiben lassen (med.-soziale<br />
Indikation) lag e<strong>in</strong> Unterhaltsschaden vor,<br />
d.h. daß nicht das K<strong>in</strong>d selbst, son<strong>der</strong>n se<strong>in</strong> Unterhaltsbedarf<br />
<strong>der</strong> Schaden ist,<br />
zu ersetzen ist <strong>der</strong> Aufwand an Unterhalt, den<br />
die Eltern wegen des K<strong>in</strong>des haben,<br />
die Schadenshöhe umfasst den normalen Regelunterhalt<br />
für das K<strong>in</strong>d, <strong>der</strong> vom Arzt zu ersetzen<br />
ist,<br />
wichtig: Bei Feststellung e<strong>in</strong>er Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung ist<br />
e<strong>in</strong> Arzt nach Auffassung des BGH nicht verpflichtet,<br />
die Patient<strong>in</strong> auf die Möglichkeit e<strong>in</strong>er<br />
Abtreibung h<strong>in</strong>zuweisen (Spickhoff, NJW<br />
2003, 1701 [1706]).<br />
H<strong>in</strong>weis: Bei <strong>der</strong> Entscheidung des BGH g<strong>in</strong>g es nicht um<br />
die Frage, ob <strong>der</strong> Arzt haften muß, weil er wegen<br />
<strong>der</strong> mangelhaften Untersuchung e<strong>in</strong>e höchstwahrsche<strong>in</strong>lich<br />
von <strong>der</strong> Schwangeren veranlasste Abtreibung<br />
vereitelt hat.<br />
Unterhaltsproblematik:<br />
Der BGH hat <strong>in</strong> dem Urteil überdies festgestellt,<br />
daß <strong>der</strong> ärztliche Behandlungsvertrag wegen <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Behandlung (Untersuchung auf<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung des K<strong>in</strong>des) von se<strong>in</strong>em Schutzumfang<br />
auch Unterhaltsaufwendungen umfasst,<br />
wenn<br />
sich gerade die Belastung durch den späteren<br />
Unterhalt für das K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> entscheiden<strong>der</strong> Weise<br />
negativ auf den Gesundheitszustand <strong>der</strong> Mutter<br />
auszuwirken droht.<br />
Die Schadensersatzpflicht des Arztes erstreckt sich<br />
dann - neben dem regulären Schmerzensgeldanspruch<br />
- auch auf den Unterhaltsbedarf des K<strong>in</strong>des.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 79 von 180<br />
Parallelproblematik: <br />
Son<strong>der</strong>problem:<br />
Die K<strong>in</strong>d-als-Schaden Diskussion tritt auch bei<br />
sog. Teenagerschwangerschaften auf (ca. 13.000<br />
Mädchen unter 18 Jahre werden jedes Jahr<br />
schwanger). Hier werden an das Vorliegen <strong>der</strong><br />
mediz<strong>in</strong>isch-sozialen Indikation des Teenagers<br />
jedoch hohe Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt, z.B. drohende<br />
E<strong>in</strong>lieferung wegen <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Schwangerschaft<br />
e<strong>in</strong>hergehenden psychischen Probleme <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e psychiatrische Kl<strong>in</strong>ik, OLG Köln, MedR<br />
2010, 43).<br />
Kann auch e<strong>in</strong> nichtehelicher Vater gegen den Arzt<br />
e<strong>in</strong>en Schadensersatzanspruch wegen <strong>der</strong> Unterhaltslast<br />
für e<strong>in</strong> ungewolltes K<strong>in</strong>d haben ?<br />
(OLG Karlsruhe, Urt. v. 01.02.2006, Az.: 13 U 134/04,<br />
rechtskräftig durch BGH, Az. VI ZR 48/06)<br />
Sachverhalt: Die 21-jährige Kläger<strong>in</strong> ließ sich vom Gynäkologen e<strong>in</strong><br />
langwirkendes Kontrazeptivum mit e<strong>in</strong>em Plastikröhrchen<br />
oberhalb <strong>der</strong> Ellenbeuge <strong>in</strong> die Haut e<strong>in</strong>pflanzen. Sie<br />
wollte damit e<strong>in</strong>e Schwangerschaft verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Tatsächlich<br />
wurde sie schwanger, weil das Implantat fehlerhaft<br />
e<strong>in</strong>gesetzt worden war. Die Kläger<strong>in</strong> war mit dem Vater<br />
des K<strong>in</strong>des nur wenige Monate befreundet und lebte nicht<br />
mit ihm zusammen. Beide argumentieren, dass sie we<strong>der</strong><br />
jetzt noch später e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d haben wollten. Die Kläger<strong>in</strong><br />
klagte aus abgetretenem Recht des unehelichen Vaters.<br />
Lösung: In Betracht kommt pVV des Arztvertrages, <strong>der</strong> auf die<br />
Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schwangerschaft gerichtet war.<br />
Zentral ist hierbei die Frage, ob die Familienplanung<br />
auch bei e<strong>in</strong>er jungen Mutter schon abgeschlossen se<strong>in</strong><br />
kann, so dass sich die Unterhaltsbelastung <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er<br />
ungewollten Schwangerschaft als Schaden erweist.<br />
Ansatz des Gerichts:<br />
E<strong>in</strong>e fehlgeschlagene Familienplanung liegt schon<br />
dann vor, wenn die gegenwärtige Familienplanung<br />
aufgrund e<strong>in</strong>es unvorhergesehenen Ereignisses<br />
durchkreuzt wird und die zukünftige Planung noch<br />
nicht absehbar ist.<br />
Für den Fall bedeutet dies:<br />
Die Familienplanung <strong>der</strong> jungen Mutter bestand dar<strong>in</strong>,<br />
noch ke<strong>in</strong>e Ehe e<strong>in</strong>zugehen und ke<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d mit ihrem<br />
geme<strong>in</strong>samen Partner haben zu wollen. Diese Planung<br />
ist durch die fehlgeschlagene Verhütung gestört worden.<br />
Es spielt ke<strong>in</strong>e Rolle, ob die Mutter irgendwann<br />
e<strong>in</strong>mal K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben will. Durch die aufgrund des Behandlungsfehlers<br />
verursachte fehlgeschlagene Verhütung<br />
ist für die Frau e<strong>in</strong>e unerwünschte Unterhaltsbelastung<br />
e<strong>in</strong>getreten (= unerwünscht, weil Familienplanung<br />
fehlgeschlagen), diese ist e<strong>in</strong> Schaden.<br />
Rechtsposition des nichtehelichen Vaters:<br />
Bislang war nur <strong>der</strong> Ehegatte <strong>der</strong> Mutter <strong>in</strong> den<br />
Schutzbereich des ärztlichen Vertrages <strong>zur</strong> Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Schwangerschaft e<strong>in</strong>bezogen.<br />
In diesem Fall jedoch hatte das Gericht e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bezie-
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 80 von 180<br />
hung des nichtehelichen Vaters angenommen, weil<br />
auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ungefestigten, nur vorübergehenden<br />
Partnerschaft <strong>der</strong> übere<strong>in</strong>stimmende Wille gegeben<br />
se<strong>in</strong> könnte, ke<strong>in</strong>e Familie zu gründen und die Mutter<br />
<strong>in</strong> diesem Fall das Interesse habe, durch den Arztvertrag<br />
den nichtehelichen Vater vor ungewollten<br />
Unterhaltslasten zu schützen wie sich selbst. Denn:<br />
geme<strong>in</strong>sam geplante Empfängnisverhütung sei ke<strong>in</strong><br />
Privileg ehelicher Lebensgeme<strong>in</strong>schaft.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 81 von 180<br />
V. Prüfung Prüfungskarte Schwangerschaftsabbruch<br />
Schwanger-<br />
schaftsabbruch 1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand des § 218 StGB<br />
(aa) Tatobjekt: Ist die noch nicht abgestorbene, aber e<strong>in</strong>genistete Leibesfrucht.<br />
(bb) Tathandlung/Taterfolg: Abbrechen <strong>der</strong> Schwangerschaft durch jede Handlung, die sich<br />
auf die Leibesfrucht auszuwirken beg<strong>in</strong>nt und <strong>zur</strong>echenbar <strong>der</strong>en Absterben bewirkt.<br />
(cc) ke<strong>in</strong> Tatbestandsausschluß: Fristenregelung nach Pflichtberatung. Voraussetzungen<br />
des Tatbestandsausschlusses nach § 218 a Abs. 1 StGB:<br />
12.Schwangerschaftswoche noch nicht überschritten,<br />
Verlangen des Abbruchs durch die Schwangere,<br />
Nachweis Schwangerschaftskonfliktberatung (§ 219, §§ 5, 6 SchwKG) -> Beratungssche<strong>in</strong>,<br />
Abbruch durch e<strong>in</strong>en dritten Arzt, <strong>der</strong> noch nicht <strong>in</strong> Situation e<strong>in</strong>gebunden.<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
Vorsatz bezüglich des Vorliegens <strong>der</strong> objektiven Tatumstände des § 218 StGB und m<strong>in</strong>d.<br />
Eventualvorsatz bezüglich des Nichtvorliegens des Tatbestandsausschlusses.<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
Die Rechtswidrigkeit entfällt nur bei den speziellen Rechtfertigungsgründen des § 218 a Abs. 2, 3.<br />
a. Voraussetzungen <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>isch-sozialen Indikation, § 218a IV StGB<br />
(1) anwendbar bis zum Geburtsbeg<strong>in</strong>n,<br />
(2) Wirksame E<strong>in</strong>willigung <strong>der</strong> Schwangeren (ke<strong>in</strong> Zwang od. Täuschung; Aufklär.),<br />
(3) unzumutbare und nicht an<strong>der</strong>s überw<strong>in</strong>dbare Gefahr für Leben o<strong>der</strong> schwerwiegende<br />
Bee<strong>in</strong>trächtigung des körperlichen, psychischen Gesundheitszustands <strong>der</strong> Schwangeren<br />
gegenwärtig o<strong>der</strong> zukünftig durch Geburt e<strong>in</strong>es schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten K<strong>in</strong>des,<br />
(4) Abbruch durch e<strong>in</strong>en Arzt (bislang nicht <strong>in</strong>volviert),<br />
(5) subjektives Rechtfertigungselement.<br />
b. Voraussetzungen <strong>der</strong> krim<strong>in</strong>ologischen Indikation, § 218a IV StGB<br />
3. Schuld<br />
(1) Die 12. Schwangerschaftswoche ist noch nicht überschritten,<br />
(2) Wirksame E<strong>in</strong>willigung <strong>der</strong> Schwangeren (ke<strong>in</strong> Zwang od. Täuschung; Aufklär.),<br />
(3) Schwangere nach ärztlicher Erkenntnis Opfer e<strong>in</strong>er Straftat gem. §§ 176-179 StGB<br />
und Schwangerschaft beruht darauf,<br />
(4) Abbruch durch e<strong>in</strong>en Arzt (bislang nicht <strong>in</strong>volviert),<br />
(5) subjektives Rechtfertigungselement.<br />
4. Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgrund nach § 218 a Abs. 4 StGB<br />
a. Die Strafe ist für die Schwangere ausgeschlossen, wenn<br />
die 22. Schwangerschaftswoche ist noch nicht überschritten,<br />
die Beratung nach § 219 StGB ist durchgeführt,<br />
Abbruch durch e<strong>in</strong>en Arzt.<br />
b. Es kann von <strong>der</strong> Strafe abgesehen werden, wenn<br />
sich die Schwangere <strong>zur</strong> Zeit des E<strong>in</strong>griffs <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Bedrängnis befunden hat.<br />
5. Beson<strong>der</strong>s schwerer Fall des Schwangerschaftsabbruchs, § 218 Abs. 2 StGB<br />
<strong>der</strong> Arzt gegen den Willen <strong>der</strong> Schwangeren handelt,<br />
o<strong>der</strong> wenn <strong>der</strong> Arzt leichtfertig die Gefahr des Todes o<strong>der</strong> <strong>der</strong> schweren Gesundheitsverletzung<br />
für die Schwangere verursacht hat.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 82 von 180<br />
VI. Gegenüberstellungstaatlichen<br />
und kirchlichenRechtsgrundsätze„Schwangerschaftsabbruch“<br />
Grafische Gegenüberstellung <strong>der</strong> staatlichen und kirchlichen (röm.-kath.)<br />
Rechtskreise betreffend den Schwangerschaftsabbruch<br />
Mutter Fötus<br />
Geschöpf Gottes;<br />
Gott = „Lebenswächter“ u.<br />
Letztentscheidungs<strong>in</strong>stanz<br />
ke<strong>in</strong>e Verfügbarkeit<br />
des Menschen<br />
über Leben<br />
-> ist absolut,<br />
darf nur Gott<br />
Rechtsauffassung <strong>der</strong><br />
röm. Amtskirche<br />
ke<strong>in</strong>e Verfügbarkeit<br />
des Menschen<br />
über Leben<br />
-> ist absolut,<br />
darf nur Gott<br />
ergo: ke<strong>in</strong>e Abwägung<br />
<strong>der</strong> Rechtsgüter:<br />
Selbstbest. Frau Leben K<strong>in</strong>d<br />
ke<strong>in</strong>e Abtreibung (außer:<br />
Leben <strong>der</strong> Frau <strong>in</strong> Gefahr)<br />
Staatliche<br />
Rechtsauffassung<br />
Geschöpf Gottes;<br />
Gott = „Lebenswächter“ u.<br />
Letztentscheidungs<strong>in</strong>stanz<br />
Mutter Fötus<br />
Staat = Lebensgarantie u.<br />
Letztentscheidungs<strong>in</strong>stanz<br />
aller „irdischen“ Fragen<br />
Staat regelt selbst Frage v.<br />
Leben u. Tod im Rahmen<br />
RechtsO gem. humanen/sittlichen<br />
Maßstäben<br />
zwar staatl. Lebensschutz,<br />
aber ke<strong>in</strong>e abs. Lebensgarantie;<br />
Abwägung Lebensrecht<br />
Fötus Selbstbestimmung<br />
Frau möglich<br />
Staat = Lebensgarantie u.<br />
Letztentscheidungs<strong>in</strong>stanz<br />
aller „irdischen“ Fragen<br />
Staat regelt selbst Frage v.<br />
Leben u. Tod im Rahmen<br />
RechtsO gem. humanen/sittlichen<br />
Maßstäben<br />
zwar staatl. Lebensschutz,<br />
aber ke<strong>in</strong>e abs. Lebensgarantie;<br />
Abwägung Lebensrecht<br />
Fötus Selbstbestimmung<br />
Frau möglich<br />
Abtreibung = Kollision Rechtsgüter Frau K<strong>in</strong>d;<br />
Lösung: Fristenregelung
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 83 von 180<br />
C. Sonstige Sonstige berufsrelevante Straftatbestände<br />
Straftatbe-<br />
stände<br />
I. Verletzung Die Verletzung von Patientengeheimnissen<br />
von Patienten-<br />
geheimnissen<br />
Die mit den Vorschriften <strong>der</strong> §§ 203, 204 StGB unter Strafe gestellte Verletzung<br />
und Verwertung von Privatgeheimnissen garantiert speziell im Krankenhausbereich<br />
den verschwiegenen Umgang mit Patientendaten.<br />
Die Schweigepflicht geht als Kernstück ärztlicher Berufsethik vom Hippokratischen<br />
Eid aus und hat sich ursprünglich aus den Beziehungen zwischen Arzt und<br />
Patient entwickelt. Sie erfaßt mittlerweile jedoch alle Bereiche <strong>der</strong> ärztlichen<br />
und nachgeordneten nichtärztlichen Berufe. Die ärztliche wie nichtärztliche<br />
Schweigepflicht wird von <strong>der</strong> Rechtsordnung unter umfassenden zivil-, berufs-<br />
und strafrechtlichen Schutz gestellt, um das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt<br />
und Patient zu gewährleisten.<br />
1. Herleitung<br />
2. Bedeutung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Justizpraxis<br />
3. Bedeutung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
ärztlichen<br />
Praxis<br />
Die Wahrung von Patientengeheimnissen wurzelt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Menschenwürde<br />
und dem allgeme<strong>in</strong>en Persönlichkeitsrecht aus<br />
Art. 1 Abs. 1; 2 Abs. 1 GG. Daher steht <strong>der</strong> Wille des e<strong>in</strong>zelnen,<br />
so höchstpersönliche D<strong>in</strong>ge wie die Beurteilung se<strong>in</strong>es Gesundheitszustandes<br />
durch e<strong>in</strong>en Arzt vor fremdem E<strong>in</strong>blick zu bewahren,<br />
auch unter dem Schutz <strong>der</strong> Verfassung.<br />
Im Justizalltag s<strong>in</strong>d Strafverfahren wegen <strong>der</strong> Verletzung <strong>der</strong> ärztlichen<br />
Schweigepflicht außerordentlich selten. Dies hat vor allem<br />
zwei Gründe:<br />
Die Verletzung von Privatgeheimnissen nach § 203 StGB ist<br />
e<strong>in</strong> sog. absolutes Antragsdelikt, § 205 StGB. Die Tat wird<br />
von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft nur dann verfolgt, wenn <strong>der</strong> Patient<br />
tätig wird. Dies verlangt von ihm Aktivität, Mühe und Kosten,<br />
um die Strafverfolgung <strong>in</strong> Gang zu setzen.<br />
Zum an<strong>der</strong>en ist § 203 StGB e<strong>in</strong> Vorsatztatbestand und setzt<br />
den bewußten und gewollten Geheimnisbruch voraus. Dieser<br />
ist jedoch regelmäßig kaum nachweisbar.<br />
Die Wirkung <strong>der</strong> Strafnorm beruht daher weniger auf ihrer<br />
Sanktion (Freiheitsstrafe/Geldstrafe), son<strong>der</strong>n ist als Appell an<br />
den Arzt psychologischer Natur. (Der Arzt würde se<strong>in</strong>e ethische<br />
Berufsbasis zerstören, wenn bekannt wäre, daß er mit Patientengeheimnissen<br />
nicht sorgsam umgeht).<br />
Die Schweigepflicht gehört anerkanntermaßen zu den unentbehrlichen<br />
Berufspflichten des Arztes und dient nicht nur dem Interesse<br />
des E<strong>in</strong>zelnen an se<strong>in</strong>er Geheimnissphäre, son<strong>der</strong>n auch dem<br />
Schutz <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>heit.<br />
Ebenso hat die Öffentlichkeit e<strong>in</strong> Interesse daran, daß das Vertrauen<br />
zwischen Arzt und Patient als Grundvoraussetzung ärzt-
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 84 von 180<br />
lichen Wirkens nicht bee<strong>in</strong>trächtigt wird und sich Kranke nicht<br />
aus Zweifeln an <strong>der</strong> Verschwiegenheit des Arztes davon abhalten<br />
lassen, ärztliche Hilfe <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen.<br />
Es muß klar ausgeschlossen se<strong>in</strong>, daß dem Patienten aus <strong>der</strong> ärztlichen<br />
Konsultation o<strong>der</strong> <strong>der</strong> ärztlichen wie auch beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> pflegerischen Behandlung<br />
wegen <strong>der</strong> Schwatzhaftigkeit <strong>der</strong> Vertrauenspersonen irgendwelche<br />
persönlichen Nachteile, Schwierigkeiten o<strong>der</strong> Pe<strong>in</strong>lichkeiten erwachsen.<br />
II. Prüfungs- Prüfungskarte Verletzung von Patientengeheimnissen<br />
schema Ver-<br />
letzung von<br />
Patientenge- 1. Tatbestand<br />
heimnissen<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Die Person aus dem Täterkreis des § 203 StGB muß e<strong>in</strong> fremdes Geheimnis, das ihr <strong>in</strong> ihrer beruflichen<br />
Eigenschaft anvertraut wurde o<strong>der</strong> bekannt gemacht wurde, unbefugt offenbart.<br />
aa. Täterkreis<br />
Schweigepflichtige Person nach § 203 Abs. 1 Nr. 1-6 StGB, beson<strong>der</strong>s:<br />
Ärzte, Krankenschwestern, K<strong>in</strong><strong>der</strong>krankenschwestern, Krankenpflegehelfer,<br />
Hebammen, Entb<strong>in</strong>dungspfleger, Rettungsassistenten.<br />
gemäß § 203 Abs. 3 StGB auch die Gehilfen <strong>der</strong> oben genannten Personenkreise:<br />
Sprechstundenhilfen, Sekretär<strong>in</strong>nen, Pförtner im Krankenhaus, auch<br />
dessen Verwaltungsdirektor (NJW 1992, 2615) u. Mitarbeiter Krankenhausverwaltung<br />
(OVG NW [unveröff.]).<br />
bb. Tatobjekt<br />
anvertrautes Geheimnis<br />
Def. Geheimnis: Dies ist jede Tatsache, <strong>der</strong>en Kenntnis nicht allgeme<strong>in</strong>, son<strong>der</strong>n<br />
nur für e<strong>in</strong>en bestimmten, begrenzten Personenkreis gegeben ist und an <strong>der</strong>en<br />
Geheimhaltung <strong>der</strong> Patient e<strong>in</strong> verständliches, d.h. sachlich begründetes und<br />
damit schutzwürdiges Interesse hat.<br />
Def. anvertraut: Anvertrauen ist das E<strong>in</strong>weihen <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Geheimnis unter solchen<br />
Umständen, aus denen sich e<strong>in</strong>e Pflicht <strong>zur</strong> Verschwiegenheit ergibt.<br />
cc. Tathandlung<br />
unbefugte Offenbarung an e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en bzw. Verwertung<br />
Def. Offenbaren: Das Geheimnis ist offenbart, wenn sowohl die geheime Tatsache<br />
wie auch die Person des Geheimnisgeschützten e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en mitgeteilt<br />
worden s<strong>in</strong>d (= die Person des Betroffenen muß ersichtlich se<strong>in</strong>).<br />
Def. Verwerten: Verwerten bedeutet die eigene wirtschaftliche Nutzung des <strong>in</strong><br />
dem Geheimnis verkörperten Wert zum Zweck <strong>der</strong> Gew<strong>in</strong>nerzielung.<br />
Def. unbefugt: Die Offenbarung geschieht unbefugt, wenn die Geheimnismitteilung<br />
ohne Zustimmung des Verfügungsberechtigten und ohne e<strong>in</strong> Recht <strong>zur</strong><br />
Mitteilung erfolgt.<br />
a. subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
Die Rechtswidrigkeit kann entfallen, wenn <strong>der</strong> Geheimnisträger ausnahmsweise befugt handelt.<br />
Dies kann durch erfolgen:<br />
- mittels ausdrücklicher o<strong>der</strong> mutmaßlicher E<strong>in</strong>willigung des Patienten<br />
z.B. ist von e<strong>in</strong>er mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung des Patienten auszugehen, wenn er vom Hausarzt<br />
<strong>in</strong>s Krankenhaus e<strong>in</strong>gewiesen wird, so daß dieser den Krankenhausarzt ggf. über den<br />
Krankheitsverlauf unterrichten darf;
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 85 von 180<br />
- durch den rechtfertigenden Notstandes nach § 34 StGB, wobei die Offenbarung dem<br />
Schutz höherrangiger Interessen dient:<br />
z.B. wenn <strong>der</strong> Arzt <strong>der</strong> Ehefrau se<strong>in</strong>es Aids-Patienten dieser die Krankheit ihres Mannes offenbart,<br />
<strong>der</strong> das bislang aus Une<strong>in</strong>sichtigkeit unterlassen hat.<br />
3. Schuld<br />
4. Strafantrag<br />
Das Opfer muß nach § 205 StGB Strafantrag stellen, dem <strong>in</strong> jedem Fall nachgegangen wird.<br />
III. E<strong>in</strong>zelpro- E<strong>in</strong>zelprobleme bei den §§ 203, 204 StGB<br />
bleme bei den<br />
§§ 203, 204 StGB 1. objekti- a. Täterkreis<br />
ver Tatbe-<br />
stand Der Täterkreis umfaßt zusätzlich zu den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Prüfungskarte genannten<br />
Personen auch:<br />
Krankengymnasten, mediz<strong>in</strong>ische Bademeister, Physiotherapeuten,<br />
technische Assistenten <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>, Diätassistenten, pharmazeutischtechnische<br />
Assistenten, Arbeits- und Beschäftigungstherapeuten,<br />
Arzthelfer/Zahnarzthelfer, nicht aber den Heilpraktiker, weil für diese<br />
Berufsgruppe noch ke<strong>in</strong>e staatliche Ausbildung gefor<strong>der</strong>t ist.<br />
b. Geheimnis<br />
Der Geheimnisbegriff ist angesichts se<strong>in</strong>er em<strong>in</strong>enten Bedeutung<br />
weit auszulegen. Erfaßt werden von ihm:<br />
mediz<strong>in</strong>ische Tatsachen (z.B.: Name des Patienten ebenso wie<br />
die Identität [= Name] von Mitpatienten, Art <strong>der</strong> Krankheit,<br />
Anamnese, Diagnose, Therapiemaßnahmen, Prognose, psychische<br />
Auffälligkeiten, körperliche Mängel o<strong>der</strong> Beson<strong>der</strong>heiten, Patientenakten,<br />
Röntgenaufnahmen, Untersuchungsmaterial, Untersuchungsergebnisse).<br />
private Tatsachen (sämtliche Angaben über persönliche, familiäre,<br />
berufliche, wirtschaftliche o<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anzielle Umstände).<br />
Tatsachen aus <strong>der</strong> Anbahnung des Beratungs- und Behandlungsverhältnisses<br />
(Arzt und Krankenschwestern s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />
über die näheren Umstände bei <strong>der</strong> Aufnahme von Prom<strong>in</strong>enten<br />
o<strong>der</strong> Straftätern zu schweigen, aber auch über Tatsachen wie<br />
Defloration, Geschlechtskrankheiten, Sterilisation, Drogenkonsum,<br />
Ergebnis e<strong>in</strong>es Aids-Testes).<br />
Das Geheimhaltungs<strong>in</strong>teresse:<br />
bestimmt sich nicht nach objektiven Kriterien, son<strong>der</strong>n ausschließlich<br />
nach <strong>der</strong> persönlichen Sicht des Patienten, wobei jedoch<br />
Willkür o<strong>der</strong> Launen des Patienten rechtlich unbeachtlich s<strong>in</strong>d.<br />
Was <strong>der</strong> Patient beliebigen Dritten mitteilt o<strong>der</strong> was offenkundig<br />
ist (Be<strong>in</strong>amputation, Querschnittslähmung), ist nicht geheim.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 86 von 180<br />
Die Verschwiegenheitspflicht gilt deshalb:<br />
auch postmortal, sofern sie nicht durch e<strong>in</strong>e Willenserklärung<br />
des Verstorbenen zu Lebzeiten aufgehoben wurde,<br />
auch gegenüber Kollegen und übergeordneten Personen, die<br />
nicht <strong>in</strong> die Behandlung <strong>in</strong>volviert s<strong>in</strong>d (beispielsweise ist die<br />
Krankenschwester gegenüber dem Verwaltungsdirektor<br />
schweigepflichtig).<br />
c. Kenntnis<br />
§ 203 StGB schützt nur solche Informationen, die <strong>der</strong> Geheimnisträger<br />
durch e<strong>in</strong>en Vertrauensakt o<strong>der</strong> im Rahmen e<strong>in</strong>es typischerweise<br />
auf Vertrauen beruhenden Son<strong>der</strong>verhältnisses (= <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er Eigenschaft als Arzt/Krankenschwester bei se<strong>in</strong>er Berufsausübung)<br />
erhalten hat.<br />
Die Art und Weise sowie die Örtlichkeit ist dabei egal. Die Information<br />
kann er also mündlich, schriftlich, durch Zeichen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sprechstunde,<br />
auf <strong>der</strong> Straße o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Behandlung erhalten haben.<br />
2. Recht- a. ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung<br />
fertigung<br />
Die ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> das Offenbaren kann sowohl<br />
durch klare Artikulation, als auch durch schlüssiges Verhalten<br />
(stillschweigend/konkludent) des Patienten erteilt werden. (Es gelten:<br />
allgeme<strong>in</strong>e Rechtmäßigkeitsanfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigung.)<br />
Die konkludent erteilte, jedoch ausdrücklich gewollte E<strong>in</strong>willigung<br />
bildet den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis häufigsten Fall:<br />
Aufgrund des technischen Fortschritts und <strong>der</strong> Arbeitsteilung<br />
im Krankenhaus wird häufig nur noch <strong>in</strong> Teams unterschiedlicher<br />
Fachrichtungen (Orthopäde, Chirurg) und Qualifikationen<br />
(Oberarzt, Facharzt, Krankenschwester) gearbeitet, die alle <strong>in</strong><br />
die Behandlung des Patienten e<strong>in</strong>gebunden s<strong>in</strong>d. Sie gehören<br />
sämtlich zum Kreis <strong>der</strong> "Wissenden", <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong>er Mitteilungen<br />
über den Patienten von dessen konkludenter E<strong>in</strong>willigung<br />
<strong>in</strong> die Weitergabe se<strong>in</strong>er Geheimnisse gedeckt ist (VG<br />
Münster, MedR 1984, 118 f.; Langkeit, NStZ 1994, 7).<br />
Ke<strong>in</strong>e stillschweigend erteilte E<strong>in</strong>willigung ist gegenüber an<strong>der</strong>en<br />
Abteilungen im Krankenhaus anzunehmen, die nicht <strong>in</strong> den<br />
Behandlungsprozeß e<strong>in</strong>gebunden s<strong>in</strong>d.<br />
Die stillschweigend erteilte ausdrückliche E<strong>in</strong>willigung ist nicht<br />
bei Patienten <strong>in</strong> Mehrbettzimmern anzunehmen. Zuvor ist die<br />
e<strong>in</strong>deutige Erklärung des Patienten e<strong>in</strong>zuholen.<br />
b. mutmaßliche E<strong>in</strong>willigung<br />
Die mutmaßliche E<strong>in</strong>willigung ist überall dort von Bedeutung, wo<br />
<strong>der</strong> Patient sich nicht mehr selbst äußern kann. Beispielsweise <strong>in</strong>folge<br />
Tod, Bewußtlosigkeit o<strong>der</strong> Geistesschwäche. Hier gilt: Se<strong>in</strong><br />
mangelndes Interesse an <strong>der</strong> Geheimhaltung muß deutlich zum<br />
Ausdruck kommen.<br />
c. rechtfertigen<strong>der</strong> Notstand (§ 34 StGB)<br />
Die unbefugte Offenbarung ist des weiteren durch den Rechtfertigungsgrund<br />
aus § 34 StGB gedeckt, wenn diese zum Schutz e<strong>in</strong>es<br />
höherrangigen Rechtsgutes erfor<strong>der</strong>lich und als angemessenes Mittel<br />
<strong>der</strong> Gefahrenabwehr anzusehen ist. Wichtig ist, daß das geschützte<br />
Rechtsgut das bee<strong>in</strong>trächtigte wesentlich überwiegt. Diese<br />
Abwägung müssen Sie sehr sorgfältig (!) treffen und durchprüfen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 87 von 180<br />
Wichtige Fälle s<strong>in</strong>d:<br />
Mitteilung an die Polizei bei K<strong>in</strong>desmissbrauch,<br />
Mitteilung <strong>der</strong> Aids-Erkrankung des Patienten an die unwissende<br />
Ehefrau, wenn Patient une<strong>in</strong>sichtig ist (Interesse Gesundheit<br />
Ehefrau wiegt höher als Geheimhaltungs<strong>in</strong>teresse des Patienten),<br />
allerd<strong>in</strong>gs: ke<strong>in</strong>e Mitteilung <strong>der</strong> Personenidentität von Mitpatienten,<br />
wenn e<strong>in</strong> verletzter Patient den Namen wissen möchte,<br />
um e<strong>in</strong>en zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch durchsetzen<br />
zu können (ärztliche und pflegerische Schweigepflicht wiegt<br />
höher als Informations<strong>in</strong>teresse, OLG Karlsruhe, Urt. vom<br />
11.08.2006, Az 14 U 45/04).<br />
Begründung: Ärztliche Schweigepflicht ist für Verhältnis zu<br />
Patienten von substantieller Bedeutung, ist überdies vertragliche<br />
Hauptpflicht. Dass <strong>der</strong> Arzt o<strong>der</strong> se<strong>in</strong>e berufsmäßigen<br />
Gehilfen e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en Patienten bei <strong>der</strong> Geltendmachung<br />
von gegen diesen Patienten gerichteten, etwaigen<br />
Schadensersatzansprüchen hilft, ist dagegen nachvertragliche<br />
Nebenpflicht (OLG Karlsruhe, Urt. v. 11.08.2006).<br />
d. beson<strong>der</strong>e Rechtfertigungsgründe<br />
Schließlich ist die unbefugte Offenbarung durch Rechtfertigungsgründe<br />
gedeckt, die durch Gesetz bestehen. Die Offenbarung<br />
schlägt dabei um <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Offenbarungs- bzw. Anzeigepflicht. Dies<br />
gilt beispielsweise bei:<br />
Verbrechen wie Mord, Totschlag, Raub, räuberische Erpressung<br />
und ähnliche Delikte bei zuverlässiger Kenntnis von <strong>der</strong>en geplanter<br />
Ausführung.<br />
§§ 12, 13 Geschlechtskrankheitengesetz,<br />
§§ 3 ff., 6, 9 Bundesseuchengesetz.<br />
IV. Übersicht Die Freiheitsberaubung (Fixierung)<br />
Freiheitsberaubung<br />
(Fixierung)<br />
Fallgestaltung<br />
E<strong>in</strong> Patient steht nach e<strong>in</strong>er OP unter den Wirkungen <strong>der</strong> Narkose. Er erhält<br />
e<strong>in</strong>e lebensnotwendige Infusion, die er sich aber immer wie<strong>der</strong> heraus<strong>zur</strong>eißen<br />
versucht. Daraufh<strong>in</strong> wird er fixiert. Als die Angehörigen dies erfahren,<br />
drängen sie das <strong>Pflege</strong>personal, die Fixierung zu beenden, weil sie die Maßnahme<br />
für rechtswidrig halten.<br />
Zweck <strong>der</strong><br />
Vorschrift<br />
Zweck <strong>der</strong> Vorschrift ist <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> persönlichen Fortbewegungsfreiheit<br />
des Menschen. Geschützt ist <strong>der</strong> freie,<br />
natürliche Willen des Patienten se<strong>in</strong>en Aufenthaltsort zu<br />
verän<strong>der</strong>n, wobei das Alter ebenso unerheblich ist wie die<br />
Frage se<strong>in</strong>er Zurechnungsfähigkeit.<br />
Aber: Wenn Patienten ihren Aufenthaltsort nur mit Hilfe von<br />
Fortbewegungsmitteln verän<strong>der</strong>n können, liegt Freiheitsberaubung<br />
vor, wenn ihnen diese Hilfsmittel weggenommen<br />
werden.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 88 von 180<br />
Freiheit auf<br />
Fortbewegung<br />
Lösungsansatz<br />
Den Fortbewegungswillen haben nicht:<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Alter, <strong>in</strong> dem sie noch nicht laufen können,<br />
Schlafende o<strong>der</strong> Bewußtlose (h.M., aber streitig).<br />
Es kommt immer wie<strong>der</strong> vor, daß Patienten kurzzeitig festgehalten werden<br />
müssen, da von ihnen e<strong>in</strong>e Gefahr ausgeht und sie an<strong>der</strong>nfalls sich selbst o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en (ungewollt) Schaden zufügen würden.<br />
V. Strafbarkeit Strafbarkeit <strong>der</strong> Fixierung (Freiheitsberaubung)<br />
Fixierung<br />
1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
aa. Tatobjekt<br />
Je<strong>der</strong> Mensch, <strong>der</strong> im natürlichen S<strong>in</strong>ne (= also pr<strong>in</strong>zipiell) die<br />
Fähigkeit besitzt, e<strong>in</strong>en solchen Fortbewegungswillen zu fassen<br />
und zu realisieren.<br />
Auch <strong>der</strong> Schlafende ist taugliches Tatobjekt, obwohl er <strong>zur</strong> Tatzeit<br />
gar ke<strong>in</strong>en Fortbewegungswillen hat.<br />
Begründung: Die gesetzliche Vorschrift schützt bereits die potentielle Fortbewegungsfreiheit<br />
unabhängig davon, ob das Opfer aktuell <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, se<strong>in</strong>en<br />
Fortbewegungswillen zu bilden; es kann ja je<strong>der</strong>zeit aufwachen und den Willen bilden.<br />
Für diese strenge Auffassung spricht nach herrschen<strong>der</strong> Auffassung, daß die<br />
Freiheit <strong>der</strong> Person e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>s wichtiges Rechtsgut ist, was durch die Erhebung<br />
zum Grundrecht zum Ausdruck kommt.<br />
bb. Tathandlung<br />
E<strong>in</strong>sperren o<strong>der</strong> sonstige Beraubung <strong>der</strong> Fortbewegungsmöglichkeit<br />
gegen den Willen des Opfers:<br />
Def. E<strong>in</strong>sperren: Festhalten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umschlossenen Raum, so<br />
daß das Opfer objektiv geh<strong>in</strong><strong>der</strong>t wird, sich von <strong>der</strong> Stelle zu<br />
bewegen, wenn es das wollte (z.B. Fixierung).<br />
Def. Berauben <strong>der</strong> Fortbewegung: H<strong>in</strong><strong>der</strong>ung des Ortswechsels<br />
beim Opfer, die m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e kurze Zeit dauern muß<br />
(RGSt 7, 259 [260]: „Die Dauer e<strong>in</strong>es Vaterunser genügt“; OLG<br />
Hamm, 1964: „E<strong>in</strong>ige Sekunden reichen aus“).<br />
Folgende Handlungen stellen e<strong>in</strong>e Freiheitsberaubung dar:<br />
Jedes Fixieren o<strong>der</strong> Festb<strong>in</strong>den von Patienten (auch dann,<br />
wenn die Patienten nur so vor e<strong>in</strong>er Selbstschädigung bewahrt<br />
werden können),<br />
das Anbr<strong>in</strong>gen von Bettgittern am Bett alter Menschen, wenn<br />
diese das Gitter nicht selbst überw<strong>in</strong>den können,<br />
Narkose,<br />
Anb<strong>in</strong>den des Armes beim Anlegen e<strong>in</strong>er Infusion,<br />
Festb<strong>in</strong>den des Arms während <strong>der</strong> Operation.<br />
cc. Tatbestandsausschließendes E<strong>in</strong>verständnis<br />
Der Tatbestandsausschluß kommt <strong>in</strong> Betracht durch das vom Patienten<br />
- ohne List zustande gekommene und - erteilte E<strong>in</strong>verständnis.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 89 von 180<br />
Fallgestaltungen <strong>der</strong> „erlaubten Freiheitsberaubung“:<br />
Während e<strong>in</strong>er Behandlung wird e<strong>in</strong> Körperteil des Patienten<br />
fixiert und dieser wi<strong>der</strong>spricht trotz voller E<strong>in</strong>sichtsfähigkeit<br />
nicht (z.B. Festschnallen Arm vor Injektion).<br />
Patient willigt <strong>in</strong> Narkose e<strong>in</strong>, nachdem er zuvor aufgeklärt<br />
wurde.<br />
e<strong>in</strong> Patient, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>willigungsunfähig ist und unter Betreuung<br />
steht, darf fixiert werden, wenn zuvor das E<strong>in</strong>verständnis des<br />
Betreuers und bei lebensgefährlichen Behandlungen die Genehmigung<br />
des Vormundschaftsgerichts e<strong>in</strong>geholt wurde<br />
H<strong>in</strong>weis: Ist die Betreuung noch nicht angeordnet, obwohl <strong>der</strong> Patient geisteskrank<br />
ist, darf er aufgrund <strong>der</strong> mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung solange fixiert werden,<br />
bis er formal unter Betreuung gestellt wurde und hiernach die E<strong>in</strong>willigung<br />
des Betreuers o<strong>der</strong> des Vormundschaftsgerichts erteilt wurde.<br />
Fallgestaltungen rechtswidriger Freiheitsberaubung:<br />
Patient ist im Vollbesitz se<strong>in</strong>er Kräfte und willigt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e notwendige<br />
Behandlung nicht e<strong>in</strong>; er darf nicht gegen se<strong>in</strong>en Willen<br />
festgehalten werden, auch wenn dies zu se<strong>in</strong>em Schaden ist.<br />
Patient wird vom <strong>Pflege</strong>personal mit sedierenden Medikamenten<br />
behandelt, die e<strong>in</strong>e starke Ruhigstellung bezwecken<br />
(E<strong>in</strong>schränkung <strong>der</strong> Mobilität). Das gilt auch für Psychopharmaka,<br />
die neben ihrer sedierenden Wirkung e<strong>in</strong>e Wesensverän<strong>der</strong>ung<br />
o<strong>der</strong> langfristige gesundheitliche Risiken mit sich<br />
br<strong>in</strong>gen.<br />
In beiden Fällen liegt e<strong>in</strong>e Freiheitsberaubung vor, wenn die<br />
Maßnahmen ohne e<strong>in</strong>e richterliche Genehmigung durchgeführt<br />
werden.<br />
Patient wacht nach OP aus Narkose auf, steht aber erkennbar<br />
nicht mehr unter <strong>der</strong>en Nachwirkungen und möchte das<br />
Krankenhaus verlassen, obwohl die Wunden wie<strong>der</strong> aufreißen<br />
könnten und er hierüber e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich aufgeklärt wurde; er<br />
darf nicht gegen se<strong>in</strong>en Willen festgehalten werden.<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
a. E<strong>in</strong>willigung<br />
In manchen Lehrbüchern wird das tatbestandsausschließende E<strong>in</strong>verständnis des Patienten<br />
als rechtfertigende E<strong>in</strong>willigung behandelt. Dies ist <strong>in</strong> dieser Form nicht zutreffend.<br />
b. Notwehr<br />
E<strong>in</strong> Patient kann auch dann fixiert werden, wenn er aggressiv ist<br />
und das <strong>Pflege</strong>personal, Mitpatienten und Besucher angreift. Er geht<br />
dann e<strong>in</strong> gegenwärtiger rechtswidriger Angriff von ihm aus <strong>der</strong> durch<br />
die Fixierung beendet wird.<br />
c. Notstand (§ 34 StGB)<br />
Der Notstand liegt vor, wenn von dem Patienten zwar ke<strong>in</strong> gegenwärtiger<br />
Angriff zu befürchten ist, aber von ihm e<strong>in</strong>e unmittelbare<br />
und gegenwärtige Gefahr ausgeht.<br />
Fallgestaltung (s.o.):<br />
Patient wacht nach OP aus Narkose auf, steht erkennbar noch unter<br />
den Nachwirkungen <strong>der</strong> Narkose und versucht immer wie<strong>der</strong>, sich<br />
den lebenswichtigen Infusionsschlauch heraus<strong>zur</strong>eißen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 90 von 180<br />
VI. ZivilrechtlicheImplikationen<br />
d. Fixierung<br />
Lösung:<br />
Hier muß man erkennen, daß die Nachwirkungen <strong>der</strong> Narkose zum<br />
vorübergehenden Ausschluß <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungsfähigkeit führen.<br />
Von dem Patient, <strong>der</strong> sich den Infusionsschlauch herausreißen möchte,<br />
geht dann e<strong>in</strong>e Gefahr für sich selbst aus, weil er ohne die Infusion<br />
stirbt. Damit liegt e<strong>in</strong>e Notstandslage vor.<br />
Notstandshandlung ist das Fixieren, weil es das Herausreißen <strong>der</strong><br />
Infusion sofort unterb<strong>in</strong>det.<br />
Der Rettungswille liegt vor, weil <strong>der</strong> Arzt dem Patienten helfen möchte.<br />
Bei <strong>der</strong> Interessenabwägung steht das Recht des Patienten auf Leben<br />
(!) und Gesundheit gegen das auf (Fortbewegungs-)freiheit.<br />
Beide Rechtsgüter s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Rangverhältnis zu br<strong>in</strong>gen. Maßstab<br />
ist die Frage, welches Rechtsgut schutzwürdiger ist.<br />
Sodann s<strong>in</strong>d sie gegene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abzuwägen. Hier ist dem Recht auf<br />
Gesundheit <strong>der</strong> Vorzug vor <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkung <strong>der</strong> Fortbewegungsfreiheit<br />
zu geben. Denn die OP und <strong>der</strong> Krankenhausaufenthalt<br />
dienen <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong> Gesundheit. Das Recht auf<br />
Fortbewegung kann hierh<strong>in</strong>ter vorläufig <strong>zur</strong>ückstehen.<br />
Bei <strong>der</strong> sozialethischen Angemessenheit ist zu berücksichtigen, daß<br />
die Fixierung nur vorübergehen<strong>der</strong> Zustand vorgenommen wird,<br />
also ke<strong>in</strong> Dauerzustand ist und letztlich dem Schutz des Patienten<br />
vor sich selbst dient. Das ist auch im Interesse des Staates und <strong>der</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong>heit.<br />
d. gesetzliche Erlaubnisse (Auswahl)<br />
Die Freiheitsberaubung kann auch gesetzlich gerechtfertigt se<strong>in</strong>:<br />
Verhaftung und vorläufige Festnahme (§§ 112, 127 StPO),<br />
e<strong>in</strong>stweilige Unterbr<strong>in</strong>gung (§ 126a StPO),<br />
zwangsweise Blutentnahme (§ 81a StPO).<br />
Fallgestaltung<br />
Die zivilrechtlichen Implikationen<br />
<strong>der</strong> Freiheitsberaubung (Fixierung)<br />
E<strong>in</strong> Patient steht nach e<strong>in</strong>er OP unter den Wirkungen <strong>der</strong> Narkose. Er erhält e<strong>in</strong>e lebensnotwendige<br />
Infusion, die er sich aber immer wie<strong>der</strong> heraus<strong>zur</strong>eißen versucht. Daraufh<strong>in</strong><br />
wird er kurzfristig fixiert. Als die Angehörigen dies erfahren, drängen sie das <strong>Pflege</strong>personal,<br />
die Fixierung zu beenden, weil sie die Maßnahme für rechtswidrig halten.<br />
1. Anlass<br />
<strong>der</strong> Fixierung<br />
Die Fixierung wird nur bei e<strong>in</strong>willigungsunfähigen Patienten<br />
o<strong>der</strong> bei e<strong>in</strong>willigungsfähigen Patienten, bei denen aus<br />
sonstigen Gründen die E<strong>in</strong>willigung fehlt, vorgenommen.<br />
Hierbei s<strong>in</strong>d folgende Anlässe Auslöser für die Maßnahme:<br />
Abwehr e<strong>in</strong>er Gefährdung Dritter durch den Patienten<br />
(Fremdgefährdung),<br />
Abwehr e<strong>in</strong>er erheblichen Eigengefährdung (z.B. Selbstverletzung;<br />
aber: allgeme<strong>in</strong>es Sturzrisiko reicht nicht aus,<br />
weil Lebensrisiko, son<strong>der</strong>n nur i.V.m. Medikation),<br />
Durchführung e<strong>in</strong>er mediz<strong>in</strong>ischen Untersuchung o<strong>der</strong><br />
Behandlung (z.B. Verabreichung e<strong>in</strong>er Infusion bzw.<br />
Spritze [OLG München, NJW-RR 2005, 1531]),
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 91 von 180<br />
2. Anordnung<br />
<strong>der</strong><br />
Fixierung,<br />
Verfahren<br />
und Fristen<br />
Die Fixierung darf nur von e<strong>in</strong>em Arzt, und nur schriftlich<br />
angeordnet werden. Die anschließende Durchführung <strong>der</strong><br />
Fixierung obliegt dem <strong>Pflege</strong>personal. Das <strong>Pflege</strong>personal<br />
darf die Fixierung nur dann auf eigenen Antrieb ohne ärztliche<br />
Weisung durchführen, wenn Gefahr im Verzug besteht (z.B.<br />
Patient ist gewalttätig) und e<strong>in</strong> Arzt nicht greifbar ist. Aber: Es<br />
muss sich die Maßnahme sofort nach Durchführung vom Arzt<br />
(schriftlich, dokumentieren) genehmigen lassen.<br />
a. Fixationsarten<br />
Es werden zwei Arten <strong>der</strong> Fixierung unterschieden:<br />
Akutfixierung,<br />
Langzeitfixierung.<br />
Die Akutfixierung ist maßnahme- und e<strong>in</strong>zelfallbezogen,<br />
d.h., sie wird punktuell <strong>zur</strong> Sicherung und Durchführung<br />
e<strong>in</strong>er mediz<strong>in</strong>ischen Untersuchung o<strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />
/ pflegerischen Behandlung vorgenommen und<br />
dauert auch nur solange an, bis die Maßnahme beendet ist.<br />
Hierbei wird vorausgesetzt, daß die Maßnahme immer nur<br />
kurze Zeit dauert (maximal stundenweise).<br />
Beispiele:<br />
- Bettgitter nur für die Nacht,<br />
- Fixation, um e<strong>in</strong>e Injektion zu verabreichen.<br />
Die Langzeitfixierung ist begleiten<strong>der</strong> und fester Teil e<strong>in</strong>er<br />
allgeme<strong>in</strong>en Behandlungsmaßnahme und wird angeordnet,<br />
wenn bei dem Patient je<strong>der</strong>zeit die Gefahr e<strong>in</strong>er Eigen-<br />
und Fremdgefährdung besteht, welche die Behandlung<br />
<strong>in</strong>sgesamt bee<strong>in</strong>trächtigen kann. Auslöser kann auch e<strong>in</strong>e<br />
plötzliche, akut auftretende Gefährdungssituation se<strong>in</strong>.<br />
Beispiele:<br />
- Tablettbrett am Rollstuhl (wegen Dauerhaftigkeit),<br />
- Klettriemen am Rollstuhl (wegen Dauerhaftigkeit),<br />
- Bettgitter, das Tag und Nacht angebracht ist,<br />
- medikamentöse Sedierung des Patienten.<br />
b. Genehmigungserfor<strong>der</strong>nis<br />
Die Akutfixierung bedarf ke<strong>in</strong>er vormundschaftsgerichtlichen<br />
Genehmigung. Auch dann nicht, wenn die<br />
Behandlung und damit die Fixation <strong>in</strong> regelmäßigen Abständen<br />
durchgeführt wird (arg. ex. BGH, NJW 2001, 888;<br />
OLG München, NJW-RR 2005, 1530 [1531]).<br />
Die Langzeitfixierung bedarf stets <strong>der</strong> vormundschaftsgerichtlichen<br />
Genehmigung, weil sie bereits unterbr<strong>in</strong>gungsähnlichen<br />
Charakter hat. Die Genehmigung ist bis spätestens<br />
24 Stunden nach E<strong>in</strong>leitung <strong>der</strong> Fixierung beim zuständigen<br />
Gericht schriftlich (vorab auch per Telefax) zu<br />
beantragen. Dazu ist e<strong>in</strong> ärztliches Zeugnis erfor<strong>der</strong>lich,<br />
das die mediz<strong>in</strong>ischen und pflegerischen Notwendigkeiten<br />
<strong>der</strong> Fixierung darlegt. Die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung<br />
ist maximal e<strong>in</strong> Jahr gültig und muss dann erneuert<br />
werden (BGH, FGPrax 1995, 130).<br />
Ergänzen<strong>der</strong> H<strong>in</strong>weis:<br />
Bei <strong>der</strong> Unterbr<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong>es Patienten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geschlossenen<br />
Anstalt (Psychiatrie, sog. öffentlich-rechtliche Unterbr<strong>in</strong>gung)<br />
ist <strong>in</strong> jedem Fall <strong>in</strong>nerhalb von 24 Stunden e<strong>in</strong>e vormundschaftsgerichtliche<br />
Genehmigung, ggf. im Wege des<br />
e<strong>in</strong>stweiligen Verfahrens, zu beantragen. Auch dann, wenn<br />
<strong>der</strong> Patient nur vorübergehend e<strong>in</strong>gewiesen werden soll.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 92 von 180<br />
3. Zusammenfassung:<br />
a. Haftung wegen rechtswidriger Fixierung<br />
strafrechtlicheImplikationen <br />
Freiheitsberaubung<br />
Geldstrafe,<br />
Freiheitsstrafe<br />
rechtswidrige Fixierung<br />
b. Wann muss die Fixierung gerichtlich genehmigt werden?<br />
bei Akutfixierung<br />
nicht - auch nicht<br />
wenn Behandlung<br />
und Fixierung<br />
immer wie<strong>der</strong>holt<br />
werden<br />
zivilrechtlicheImplikationen<br />
Verletzung<br />
Rechtsgut,<br />
z.B. aus §<br />
823 BGB<br />
Schadensersatz,Schmerzensgeld<br />
Gerichtliche Genehmigung<br />
bei Langzeitfixierung<br />
immer -<br />
spätestens nach<br />
24 Stunden<br />
c. Strafbarkeit <strong>der</strong> Fixierung im Überblick<br />
Tatbestand<br />
Rechtswidrigkeit<br />
Rechtfertigung<br />
arbeitsrechtlicheImplikationen <br />
arbeitsvertraglicherPflichtenverstoß<br />
Abmahnung,<br />
Kündigung,<br />
Schadensersatz<br />
- auch <strong>der</strong> schlafende Patient,<br />
- alle Maßnahmen, die die<br />
natürliche Fortbewegung d.<br />
Patienten verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
- E<strong>in</strong>willigung d. Patienten ausdrücklich<br />
o<strong>der</strong> konkludent<br />
- nach vorheriger Aufklärung<br />
- § 34 StGB (enge Voraussetzungen!)
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 93 von 180<br />
VII. Son<strong>der</strong>problem:<br />
Die<br />
Voraussetzungen<br />
und Grenzen<br />
<strong>der</strong> ärztlichenZwangsbehandlung<br />
4. Dokumentation<br />
<strong>der</strong> Fixierung<br />
5. Durchführung<br />
<strong>der</strong> Fixierung<br />
Die Fixierung - sowohl die Akut- wie auch die Langzeitfixation<br />
- ist genauestens, vor allem im H<strong>in</strong>blick auf den auslösenden<br />
Vorfall und die Dauer, zu dokumentieren. Es empfiehlt<br />
sich, e<strong>in</strong>en sog. Fixierbogen anzufertigen und auszufüllen,<br />
<strong>der</strong> m<strong>in</strong>d. folgende Angaben enthalten soll:<br />
Name, Geburtsdatum und Unterbr<strong>in</strong>gungsart des Patienten,<br />
Grund des Fixierung (dabei Erwähnung, daß Alternativen <strong>zur</strong><br />
Fixierung erörtert und für nicht ausreichend erachtet wurden),<br />
Art <strong>der</strong> Fixierung,<br />
Ort <strong>der</strong> Fixierung (Bett o<strong>der</strong> Stuhl),<br />
Name und Berufsbezeichnung des Fixierenden (m<strong>in</strong>d. 2 Personen),<br />
wobei sichergestellt se<strong>in</strong> muß, daß die Fixierenden im<br />
Umgang mit Fixiergurten und -techniken erprobt s<strong>in</strong>d,<br />
Art, Inhalt und Umfang <strong>der</strong> Kontrollüberwachungen des<br />
Fixierten e<strong>in</strong>schl. <strong>der</strong> Sitzwachen (ggf. geson<strong>der</strong>ter Kontrollbogen<br />
<strong>der</strong> Dokumentation h<strong>in</strong>zufügen),<br />
Datum und Unterschrift des zuständigen Arztes.<br />
H<strong>in</strong>weis: Die vorstehende Aufzählung ist nicht abschließend,<br />
son<strong>der</strong>n stellt nur den M<strong>in</strong>destkanon an Angaben dar, <strong>der</strong> bei<br />
Fixierungen zu beachten ist.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Fixierung gegen den Willen des Patienten (nonkompliante<br />
Fixierung) s<strong>in</strong>d folgende Aspekte zu beachten:<br />
die Fixierung sollte nur <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Bettgittern<br />
vorgenommen werden,<br />
<strong>der</strong> Patient ist regelmäßig zu überwachen, je nach Gefährdungslage<br />
halb- o<strong>der</strong> ganzstündlich (am besten ist<br />
jedoch Sitzwache sowie alle zwei Stunden ärztliche Überwachung<br />
<strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>der</strong> Fixierung),<br />
es sollte m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e Drei-Punkt-Fixierung, besser<br />
aber e<strong>in</strong>e Fünf-Punkt-Fixierung vorgenommen werden,<br />
Patienten mit Epilepsien sollten <strong>in</strong> jedem Fall unter Daueraufsicht<br />
(Sitzwache) gestellt werden, weil es bei Krampfanfällen<br />
<strong>in</strong> Fixiergurten zu Frakturen kommen kann,<br />
Son<strong>der</strong>problem:<br />
Ärztliche Zwangsbehandlung sog. une<strong>in</strong>sichtiger Patienten<br />
Obwohl Patienten vor jedem E<strong>in</strong>griff bzw. vor je<strong>der</strong> Behandlung umfassend<br />
aufgeklärt werden, kommt es vor, dass diese e<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>isch s<strong>in</strong>nvolle o<strong>der</strong><br />
gar gebotene Maßnahme ablehnen.<br />
Problematisch kann diese Situation werden, wenn <strong>der</strong> Arzt die Behandlung<br />
auch gegen den erklärten Willen des Patienten fortsetzen o<strong>der</strong> gar aufnehmen<br />
möchte, weil er dies aus mediz<strong>in</strong>ischen Gründen für zw<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich<br />
hält.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 94 von 180<br />
1. Fallgestaltungen<br />
2. Rechtsgrundsätze<br />
Für die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen <strong>der</strong><br />
sog. une<strong>in</strong>sichtige Patient vom Arzt zwangsbehandelt werden<br />
darf, müssen drei Fallgestaltungen unterschieden werden:<br />
Patient steht unter Betreuung,<br />
Patient ist m<strong>in</strong><strong>der</strong>jährig,<br />
Patient steht nicht unter Betreuung.<br />
Jede mediz<strong>in</strong>ische (und pflegerische) Behandlung muss sich <strong>der</strong><br />
freien Willensbildung und <strong>der</strong> damit e<strong>in</strong>hergehenden Selbstbestimmung<br />
des Patienten unterordnen (arg. ex BVerfGE 32, 98<br />
ff.). Denn Selbstbestimmung und freie Willensbildung gewährleisten<br />
erst die Freiheit des Patienten, sich für o<strong>der</strong> gegen e<strong>in</strong>e<br />
Behandlung zu entscheiden. Ob <strong>der</strong> Patient also e<strong>in</strong>e Behandlung<br />
will o<strong>der</strong> sie ablehnt setzt - neben se<strong>in</strong>er Aufklärung -<br />
voraus, dass er auch bei klarem Verstand ist und die ihm vorliegenden<br />
Informationen über die Behandlung nach se<strong>in</strong>er sittlichen<br />
wie geistigen Reife verarbeiten kann. Verkürzt gesagt:<br />
Der Patient muss e<strong>in</strong>willigungsfähig se<strong>in</strong>.<br />
3. Lösung Für die Beurteilung <strong>der</strong> Zulässigkeit und Grenzen ärztlicher<br />
Zwangsbehandlung bedeutet dies:<br />
a. Patient steht unter Betreuung<br />
Steht <strong>der</strong> Patient unter Betreuung, ist se<strong>in</strong> Wille grundsätzlich<br />
unbeachtlich. D.h., dass sowohl <strong>der</strong> Behandlungsabbruch<br />
wie auch die Aufnahme/Fortführung <strong>der</strong> Behandlung<br />
nur dann erfolgen können, wenn <strong>der</strong> Betreuer dem vorher zugestimmt<br />
hat. Auf dessen Willen kommt es an.<br />
aa) rechtskonforme Ausübung <strong>der</strong> Betreuung<br />
Übt <strong>der</strong> Betreuer die Personensorge für den Betreuten rechtskonform<br />
aus, scheidet e<strong>in</strong>e Zwangsbehandlung des Betreuten<br />
gegen den erklärten Willen des Betreuers aus. Die Behandlung<br />
darf nicht fortgesetzt werden, bzw. sie ist abzubrechen.<br />
An<strong>der</strong>nfalls macht sich <strong>der</strong> Behandelnde mangels<br />
wirksamer E<strong>in</strong>willigung wegen Körperverletzung gem. §<br />
223 StGB strafbar. Der Patient ist zu entlassen, nachdem er<br />
zuvor vom ärztlichen und pflegerischen Personal über die<br />
beson<strong>der</strong>en Konsequenzen des Behandlungsabbruchs aufgeklärt<br />
wurde und dies schriftlich o<strong>der</strong> vor Zeugen bestätigt<br />
hat. Der Abbruch ist (ggf. mit Benennung <strong>der</strong> Zeugen)<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte zu dokumentieren. We<strong>der</strong> Arzt noch<br />
<strong>Pflege</strong>personal haften für eventuelle gesundheitliche Folgen,<br />
die <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge des von ihm verursachten Behandlungsabbruchs<br />
erleidet.<br />
bb) rechtsmissbräuchliche Ausübung <strong>der</strong> Betreuung<br />
Gibt es jedoch offenkundige Anzeichen dafür, dass <strong>der</strong> Betreuer<br />
se<strong>in</strong>e Entscheidungsgewalt rechtsmissbräuchlich zu<br />
Lasten des Betreuten ausübt, gibt es folgende Handlungsmöglichkeiten<br />
für den Arzt:
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 95 von 180<br />
(1) Ke<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>ische Eilbedürftigkeit <strong>der</strong> Behandlung<br />
Besteht bei <strong>der</strong> Behandlung des Betreuten ke<strong>in</strong>e hohe Dr<strong>in</strong>glichkeit<br />
und duldet diese Aufschub, so hat <strong>der</strong> Arzt e<strong>in</strong>e Entscheidung<br />
des Vormundschaftsgerichts über die Durchführung<br />
<strong>der</strong> Behandlung e<strong>in</strong>zuholen.<br />
(2) Mediz<strong>in</strong>ische Eilbedürftigkeit <strong>der</strong> Behandlung<br />
Bef<strong>in</strong>det sich <strong>der</strong> Betreute jedoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er akuten Gefahrensituation<br />
für Leib o<strong>der</strong> Leben und kann diese akute Gefahrensituation<br />
nicht an<strong>der</strong>s, als durch die sofortige mediz<strong>in</strong>ische<br />
Behandlung abgewehrt werden und handelt <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong><br />
dem Bewusstse<strong>in</strong>, dem Patienten helfen zu wollen, darf er<br />
den Betreuten ausnahmsweise mediz<strong>in</strong>isch zwangsbehandeln.<br />
Er ist über den rechtfertigenden Notstand aus § 34<br />
StGB <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Handeln legitimiert. Das Vormundschaftsgericht<br />
ist über die Maßnahme im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> zu unterrichten.<br />
b. Patient ist m<strong>in</strong><strong>der</strong>jährig<br />
Bei m<strong>in</strong><strong>der</strong>jährigen Patienten entscheiden die Eltern als Erziehungsberechtigten<br />
, da sie für das Wohl und Wehe ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
verantwortlich s<strong>in</strong>d. Da die K<strong>in</strong><strong>der</strong> i.d.R. die Behandlungssituation<br />
nicht umfänglich erfassen können, obliegt den Eltern die<br />
Beurteilung, ob ihr K<strong>in</strong>d behandelt wird o<strong>der</strong> nicht (Anm.: Dies<br />
gilt auch für den Fall, dass das K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Behandlungssituation<br />
e<strong>in</strong>willigungsfähig ist, denn ihm fehlt die<br />
volle Geschäftsfähigkeit).<br />
aa) rechtskonforme Ausübung <strong>der</strong> elterlichen Personensorge<br />
Üben die Eltern ihre Personensorge für das K<strong>in</strong>d rechtskonform<br />
aus, scheidet e<strong>in</strong>e Zwangsbehandlung des K<strong>in</strong>des gegen<br />
den erklärten Willen <strong>der</strong> Eltern aus.<br />
Die Behandlung darf nicht fortgesetzt werden, bzw. sie ist<br />
abzubrechen. An<strong>der</strong>nfalls macht sich <strong>der</strong> Behandelnde<br />
mangels wirksamer E<strong>in</strong>willigung wegen Körperverletzung<br />
gem. § 223 StGB strafbar. Der Patient ist zu entlassen,<br />
nachdem er zuvor vom ärztlichen und pflegerischen Personal<br />
über die beson<strong>der</strong>en Konsequenzen des Behandlungsabbruchs<br />
aufgeklärt wurde und dies schriftlich o<strong>der</strong> vor Zeugen<br />
bestätigt hat. Der Abbruch ist (ggf. mit Benennung <strong>der</strong><br />
Zeugen) <strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte zu dokumentieren. We<strong>der</strong><br />
Arzt noch <strong>Pflege</strong>personal haften für eventuelle gesundheitliche<br />
Folgen, die <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge des von ihm verursachten<br />
Behandlungsabbruchs erleidet.<br />
bb) rechtsmissbräuchliche Ausübung <strong>der</strong> Personensorge<br />
Gibt es jedoch offenkundige Anzeichen dafür, dass die Eltern<br />
ihre Entscheidungsgewalt rechtsmissbräuchlich zu<br />
Lasten des K<strong>in</strong>deswohls ausüben, gibt es folgende Handlungsmöglichkeiten<br />
für den Arzt:<br />
(1) Ke<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>ische Eilbedürftigkeit <strong>der</strong> Behandlung<br />
Besteht bei <strong>der</strong> Behandlung des K<strong>in</strong>des ke<strong>in</strong>e hohe Dr<strong>in</strong>glichkeit<br />
und duldet diese Aufschub, so kann <strong>der</strong> Arzt über das<br />
Vormundschaftsgericht die Entscheidung <strong>der</strong> Eltern ersetzen<br />
lassen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 96 von 180<br />
(2) Mediz<strong>in</strong>ische Eilbedürftigkeit <strong>der</strong> Behandlung<br />
Bef<strong>in</strong>det sich das K<strong>in</strong>d jedoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er akuten Gefahrensituation<br />
für Leib o<strong>der</strong> Leben und kann diese akute Gefahrensituation<br />
nicht an<strong>der</strong>s, als durch die sofortige mediz<strong>in</strong>ische Behandlung<br />
abgewehrt werden und handelt <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> dem<br />
Bewusstse<strong>in</strong>, dem Patienten helfen zu wollen, darf er das<br />
K<strong>in</strong>d ausnahmsweise mediz<strong>in</strong>isch zwangsbehandeln. Der<br />
Arzt ist über den rechtfertigenden Notstand aus § 34 StGB<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Handeln legitimiert (<strong>in</strong>struktiv dazu auch <strong>der</strong> Fall<br />
AG Nordenham, MedR 2008, 225 f.).<br />
Beachte: Die Frage, wann Eltern/Betreuer ihre Personensorge<br />
für das K<strong>in</strong>d/den Betreuten rechtsmissbräuchlich ausüben<br />
ist ke<strong>in</strong>e juristische, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e tatsächliche und bedarf<br />
sorgsamer Feststellung im konkreten E<strong>in</strong>zelfall.<br />
c. Patient steht nicht unter Betreuung<br />
Beim Patient, <strong>der</strong> nicht unter Betreuung steht, darf die mediz<strong>in</strong>ische<br />
Zwangsbehandlung nur dann erfolgen, wenn<br />
dem Patienten trotz Aufklärung aufgrund außergewöhnlicher<br />
Umstände die <strong>in</strong>tellektuelle E<strong>in</strong>sichtsfähigkeit<br />
vorübergehend fehlt („Patient ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Situation nicht<br />
bei ‚klarem‘ Sachverstand“ = vorübergehend e<strong>in</strong>willigungsunfähig)<br />
UND<br />
<strong>der</strong> Patient im Zustand <strong>der</strong> E<strong>in</strong>willigungsunfähigkeit e<strong>in</strong>e<br />
mediz<strong>in</strong>isch gebotene Behandlung hartnäckig ablehnt<br />
(äußert sich Patient nicht, gelangen Grundsätze <strong>der</strong> mutmaßlichen E<strong>in</strong>willigung<br />
<strong>zur</strong> Anwendung)<br />
UND<br />
sich <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er akuten Gefahrensituation für<br />
Leib o<strong>der</strong> Leben bef<strong>in</strong>det<br />
UND<br />
diese akute Gefahrensituation nicht an<strong>der</strong>s, als durch die<br />
sofortige mediz<strong>in</strong>ische Behandlung abgewehrt werden kann<br />
UND<br />
<strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> dem Bewusstse<strong>in</strong> handelt, dem Patienten helfen<br />
zu wollen.<br />
Liegen die vorgenannten Kriterien kumulativ vor, erfolgt die<br />
ärztliche Zwangsbehandlung aus dem Gesichtspunkt des<br />
rechtfertigenden Notstandes gem. § 34 StGB.<br />
Liegen die vorgenannten Kriterien h<strong>in</strong>gegen nicht vor, darf<br />
die Behandlung nicht fortgesetzt werden, bzw. ist sie abzubrechen.<br />
An<strong>der</strong>nfalls macht sich <strong>der</strong> Behandelnde mangels<br />
wirksamer E<strong>in</strong>willigung wegen Körperverletzung gem. §<br />
223 StGB strafbar. Der Patient ist zu entlassen, nachdem er<br />
zuvor vom ärztlichen und pflegerischen Personal über die<br />
beson<strong>der</strong>en Konsequenzen des Behandlungsabbruchs aufgeklärt<br />
wurde und dies schriftlich o<strong>der</strong> vor Zeugen bestätigt<br />
hat. Der Abbruch ist (ggf. mit Benennung <strong>der</strong> Zeugen)<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte zu dokumentieren. We<strong>der</strong> Arzt noch<br />
<strong>Pflege</strong>personal haften für eventuelle gesundheitliche Folgen,<br />
die <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong>folge des von ihm verursachten Behandlungsabbruchs<br />
erleidet.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 97 von 180<br />
Abgrenzung:<br />
Beispiele vorübergehend e<strong>in</strong>sichtsunfähiger Patienten:<br />
Der Patient gerät <strong>in</strong> totale Panik, er weiß nicht, was er tut,<br />
er ist nicht mehr ansprechbar und kann nicht mehr beruhigt<br />
werden,<br />
Patient steht erkennbar unter Folgen e<strong>in</strong>er Anästhesie,<br />
Patient ist volltrunken und lehnt die Behandlung ab (ist er<br />
volltrunken und äußert sich nicht [ähnlich dem bewusstlosen<br />
Patient], gelangen die Grundsätze <strong>der</strong> mutmaßlichen<br />
E<strong>in</strong>willigung <strong>zur</strong> Anwendung, für § 34 StGB ist dann ke<strong>in</strong><br />
Raum!)<br />
Um Missverständnissen vorzubeugen, ist die hier beschriebene<br />
E<strong>in</strong>willigungsunfähigkeit des Patienten gegen die Geschäftsunfähigkeit<br />
abzugrenzen:<br />
Geschäftsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, durch eigene<br />
Willenserklärungen Rechte und Pflichten e<strong>in</strong>gehen zu<br />
können (altersabhängig, kann aber beschränkt werden)<br />
E<strong>in</strong>willigungsfähigkeit ist die natürliche E<strong>in</strong>sichts- und<br />
Urteilsfähigkeit des Patienten. Er muss fähig se<strong>in</strong>, Bedeutung<br />
und Tragweite <strong>der</strong> beabsichtigten ärztlichen Maßnahme<br />
zu erfassen und nach se<strong>in</strong>em Willen zu bestimmen.<br />
Die E<strong>in</strong>willigungsfähigkeit hängt von <strong>der</strong> aktuellen psychischen<br />
Leistungsfähigkeit des Patienten <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
zu entscheidenden Frage ab.<br />
Merke:<br />
Auch nicht voll geschäftsfähige heranwachsende M<strong>in</strong><strong>der</strong>jährige<br />
und psychisch Kranke können e<strong>in</strong>willigungsfähig se<strong>in</strong>.<br />
Umgekehrt kann e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>willigungsunfähiger nicht auch geschäftsfähig<br />
se<strong>in</strong>.<br />
VIII. Organ- Die Transplantation von Organen<br />
transplantation<br />
1. E<strong>in</strong>führung Das am 1.12.1997 <strong>in</strong> Kraft getretene Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung<br />
von Organen - Transplantationsgesetz (TPG) (BGBl. I 1997, S. 2631 ff.)<br />
beendete se<strong>in</strong>erzeit e<strong>in</strong>e lang und zäh geführte Diskussion um die Regelung e<strong>in</strong>es<br />
seit mehr als 30 Jahren offenen Themas.<br />
Das Gesetz glie<strong>der</strong>t sich <strong>in</strong> acht Abschnitte, von denen <strong>der</strong> sechste e<strong>in</strong>e Verbotsnorm<br />
und <strong>der</strong> siebte mit den §§ 18 und 19 TPG Straf- und Bußgeldvorschriften<br />
zum Organhandel enthält. Insoweit ist das TPG für den strafrechtlichen Teil <strong>der</strong><br />
Krankenpflegeausbildung relevant.<br />
a. Regelung<br />
des §<br />
18 TPG<br />
b. Def. Organhandel<br />
Nach dieser Vorschrift kann <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> mit Organen, die e<strong>in</strong>er<br />
Heilbehandlung zu dienen bestimmt s<strong>in</strong>d, handelt, mit Freiheitsstrafe<br />
bis zu 5 Jahren o<strong>der</strong> mit Geldstrafe bestraft werden.<br />
Organhandel ist <strong>der</strong> gew<strong>in</strong>norientierte Umgang mit menschlichen<br />
Organen.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 98 von 180<br />
c. S<strong>in</strong>n und<br />
Zweck des<br />
Verbots des<br />
Organhandels<br />
d. Schutzrichtung<br />
des § 18<br />
TPG<br />
e. Täterkreis<br />
f. Tathandlung<br />
H<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Vorschrift des § 18 TPG steht die Tatsache, daß sich<br />
<strong>der</strong> Organhandel bzw. dessen Auswüchse mit normalen Mitteln<br />
nicht verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n läßt. Der Transplantationsschwarzmarkt - angetrieben<br />
durch den deutlichen Mangel an Spen<strong>der</strong>organen und<br />
den sog. Organtourismus vornehmlich <strong>in</strong> Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Dritten<br />
Welt - drohte wegen <strong>der</strong> enormen Gew<strong>in</strong>nspannen auch <strong>in</strong> Europa<br />
an Bedeutung zugew<strong>in</strong>nen. Dabei wurden vornehmlich sozialschwache<br />
Menschen als "Materiallager" mißbraucht.<br />
Transplantationsmediz<strong>in</strong>er, die Weltgesundheitsorganisation und<br />
<strong>der</strong> Europarat <strong>in</strong>itiierten daher <strong>in</strong> Mitteleuropa e<strong>in</strong>e Gesetzgebungswelle,<br />
die das Ziel hatte, die Kommerzialisierung des Organhandels<br />
auszuschließen und auch den ökonomisch diskutierten<br />
Modellen e<strong>in</strong>er marktgerechten Organgew<strong>in</strong>nung ("kontrollierter<br />
Organhandel") e<strong>in</strong>e klare Absage zu erteilen.<br />
Der Gesetzgeber ahndet das Verbot des Organhandels aus § 17<br />
TPG über § 18 TPG mit den Mitteln des Strafrechts.<br />
Begründung:<br />
Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausnutzung gesundheitlicher Notlagen von<br />
potentiellen Organempfängern wie auch die Vermeidung <strong>der</strong><br />
Ausnutzung wirtschaftlicher Notlagen von potentiellen Spen<strong>der</strong>n.<br />
Schutz <strong>der</strong> körperlichen Integrität des Lebenden, <strong>der</strong> Menschenwürde<br />
und des Pietätsgefühls <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>heit.<br />
Täter s<strong>in</strong>d alle Personen, die <strong>in</strong> irgende<strong>in</strong>er Weise an e<strong>in</strong>er Transplantation<br />
beteiligt s<strong>in</strong>d, <strong>der</strong> e<strong>in</strong> Organhandel zugrunde liegt (§§ 17, 18 TPG):<br />
Also je<strong>der</strong> - auch <strong>der</strong> Arzt -, <strong>der</strong> e<strong>in</strong> Organ entnimmt/überträgt,<br />
das Gegenstand e<strong>in</strong>es Organhandels ist/war/se<strong>in</strong> soll.<br />
Auch <strong>der</strong> Organspen<strong>der</strong>, soweit er sich e<strong>in</strong> Organ entnehmen<br />
läßt, das Gegenstand verbotenen Handeltreibens ist.<br />
Sowie <strong>der</strong> Organempfänger, wenn er sich e<strong>in</strong> Organ übertragen<br />
läß, das Gegenstand verbotenen Handeltreibens war.<br />
Die strafrechtlich relevante Handlung erfaßt mehrere Täter und<br />
be<strong>in</strong>haltet unterschiedliche Tathandlungen. Diese bestehen im<br />
Wesentlichen dar<strong>in</strong>, daß:<br />
e<strong>in</strong>e Person Organhandel betreibt (§ 18 Abs. 1 TPG), o<strong>der</strong><br />
die Person gewerblichen Organhandel betreibt (§ 18 Abs. 2<br />
TPG), o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Arzt wissentlich e<strong>in</strong>e Transplantation vornimmt bei Organen,<br />
die Gegenstand e<strong>in</strong>es Organhandels waren, o<strong>der</strong><br />
Organspen<strong>der</strong> und Organempfänger wissen, daß die transplantierten<br />
Organe Gegenstand verbotenen Organhandels s<strong>in</strong>d<br />
(§ 18 Abs. 1 TPG), o<strong>der</strong><br />
Organe entnommen werden, ohne daß folgende Voraussetzungen<br />
e<strong>in</strong>gehalten werden (§ 19 Abs. 1 und 2 TPG):
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 99 von 180<br />
g. Organübertragung<br />
- beim Toten:<br />
(1) <strong>der</strong> Spen<strong>der</strong> ist wirklich tot (= nicht behebbarer Ausfall<br />
von Großhirn, Kle<strong>in</strong>hirn, Hirnstamm),<br />
(2) zwei Ärzte haben unabhängig vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> den Hirntod<br />
festgestellt,<br />
(3) <strong>der</strong> Herz- und Kreislaufstillstand liegt drei Stunden <strong>zur</strong>ück,<br />
(4) Spen<strong>der</strong> hatte (zu Lebzeiten) ausdrücklich <strong>in</strong> die Organentnahme<br />
e<strong>in</strong>gewilligt,<br />
(5) alternativ: er hat zu Lebzeiten <strong>der</strong> Organentnahme jedenfalls<br />
nicht wi<strong>der</strong>sprochen,<br />
(6) hilfsweise: <strong>der</strong> nächste Angehörige ist zu fragen, ob ihm<br />
e<strong>in</strong>e entsprechende Erklärung des Toten bekannt ist. Wenn<br />
nicht, dann kann das Organ entnommen werden, wenn <strong>der</strong><br />
Angehörige <strong>der</strong> Organentnahme zustimmt und dabei den<br />
mutmaßlichen Willen des Spen<strong>der</strong>s berücksichtigt hat,<br />
(7) e<strong>in</strong> Arzt nimmt den E<strong>in</strong>griff vor,<br />
- beim lebenden Mensch:<br />
(1) <strong>der</strong> Spen<strong>der</strong> ist volljährig und e<strong>in</strong>willigungsfähig,<br />
(2) er ist über Umfang und Folgen <strong>der</strong> Organentnahme umfassend<br />
und im Beise<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Arztes und Sachverständigen<br />
aufgeklärt worden,<br />
(3) das Aufklärungsgespräch ist protokolliert und von allen<br />
drei (Spen<strong>der</strong>, Arzt, Sachverständiger) unterschrieben,<br />
(4) e<strong>in</strong> Gutachten (= Kommission mit Arzt, Jurist, Psychologe)<br />
über die Freiwilligkeit <strong>der</strong> Spende vorliegt,<br />
(5) nach ärztlicher Beurteilung <strong>der</strong> Spen<strong>der</strong> als solcher geeignet ist,<br />
(6) das zu spendende Organ nicht alternativ von e<strong>in</strong>em toten<br />
Spen<strong>der</strong> verfügbar ist,<br />
(7) bei nicht regenerierbaren Organen: die Spende nur zum<br />
Zwecke <strong>der</strong> Übertragung auf Ehegatte, Verwandter 1./2.<br />
Grades, Verlobter, beson<strong>der</strong>s nahestehende Person vorgenommen<br />
wird,<br />
(8) e<strong>in</strong> Arzt nimmt den E<strong>in</strong>griff vor,<br />
(9) die Organspende <strong>zur</strong> Lebenserhaltung o<strong>der</strong> Heilung e<strong>in</strong>er<br />
schweren Krankheit dient,<br />
(10) sich Spen<strong>der</strong> und Empfänger <strong>zur</strong> Nachbetreuung verpflichtet<br />
haben.<br />
o<strong>der</strong> jemand vorsätzlich o<strong>der</strong> fahrlässig e<strong>in</strong>er nicht empfangsberechtigten<br />
Person Informationen aus dem Organspen<strong>der</strong>egister<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Koord<strong>in</strong>ierungsstelle für Transplantationsstellen<br />
erteilt, weitergibt o<strong>der</strong> nutzt, (= Verbot <strong>der</strong> Kenntniserlangung<br />
Dritter darüber, wer Organspen<strong>der</strong> ist), § 19 Abs. 3 TPG.<br />
Der Kranke, <strong>der</strong> jedoch selbst e<strong>in</strong> Organ erwirbt, das er bei<br />
sich e<strong>in</strong>gepflanzt wissen möchte, begeht ke<strong>in</strong>en Handel mit<br />
Organen (BT-Drs 13/4355, S. 31).<br />
Die Organübertragung von Herz, Niere, Leber, Lunge, Darm und<br />
Bauchspeicheldrüse (= sog. vermittlungspflichtige Organe) muß<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Transplantationszentrum vorgenommen werden (an<strong>der</strong>e<br />
Organe können auch auch außerhalb des Transplantationszentrums<br />
übertragen werden); bei toten Spen<strong>der</strong>n muß die Vermittlungsstelle<br />
zuvor das vermittlungspflichtige Organ vermittelt haben.<br />
Dazu wird anhand e<strong>in</strong>er Warteliste vorgegangen.<br />
h. Tatobjekt Taugliches Tatobjekt s<strong>in</strong>d menschliche Organe, Organteile und Gewebe,<br />
soweit sie e<strong>in</strong>er Heilbehandlung zu dienen bestimmt s<strong>in</strong>d.<br />
i. Konsequenzen<br />
Das TPG hat Auswirkungen auf die Organentnahme im Krankenhaus,<br />
da auch dort die Regelungen des TPG gelten.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 100 von 180<br />
2. Prüfungs-<br />
schema Straf-<br />
barkeit Organ-<br />
handel<br />
Prüfungskarte Strafbarkeit des Organhandels sowie Weitergabe<br />
von Daten des Organspen<strong>der</strong>s (§§ 18, 19 TPG)<br />
1. Tatbestand<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Strafbar ist, wer Organhandel betreibt o<strong>der</strong> Transplantationen vornimmt, denen e<strong>in</strong> Organhandel<br />
zugrunde liegt.<br />
aa. Täter<br />
Je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> mit Organen handelt o<strong>der</strong> solche Organe transplantiert o<strong>der</strong> weiß, daß mit<br />
den eigenen o<strong>der</strong> verpflanzten Organen gehandelt wird.<br />
bb. Tatobjekt<br />
S<strong>in</strong>d menschliche Organe, Organteile und Gewebe, soweit sie e<strong>in</strong>er Heilbehandlung<br />
zu dienen bestimmt s<strong>in</strong>d.<br />
cc. Tathandlung<br />
Die Tathandlung manifestiert sich <strong>in</strong> diversen Handlungen, <strong>in</strong>sb., wenn e<strong>in</strong>e Person:<br />
mit Organen handelt o<strong>der</strong> gewerblich mit Organen handelt,<br />
wissentlich gehandelte Organe transplantiert,<br />
weiß, daß die ihr entnommenen o<strong>der</strong> verpflanzten Organe gehandelt werden/wurden,<br />
vorsätzlich o<strong>der</strong> fahrlässig nicht empfangsberechtigten Personen Informationen<br />
aus dem Organspen<strong>der</strong>egister o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Koord<strong>in</strong>ierungsstelle für Transplantationsstellen<br />
erteilt, weitergibt o<strong>der</strong> nutzt,<br />
Organe entnimmt, ohne daß folgende zivilrechtlichen Grundsätze beachtet wurden:<br />
- Toter:<br />
(1) <strong>der</strong> Hirntod ist e<strong>in</strong>deutig festgestellt,<br />
(2) von zwei Ärzten unabhängig vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong>,<br />
(3) <strong>der</strong> Herz- und Kreislaufstillstand liegt mehr als drei Stunden <strong>zur</strong>ück,<br />
(4) Spen<strong>der</strong> hatte zu Lebzeiten ausdrücklich e<strong>in</strong>gewilligt,<br />
(5) alternativ: er hatte nicht ausdrücklich wi<strong>der</strong>sprochen<br />
(6) hilfsweise: nächster Angehöriger wird gefragt, ob ihm entsprechende Erklärung<br />
d. Toten bekannt ist: Wenn nicht, kann Totem Organ entnommen<br />
werden, wenn Angehöriger Organentnahme zustimmt und dabei<br />
mutmaßlichen Willen des Spen<strong>der</strong>s berücksichtigt hat,<br />
(7) e<strong>in</strong> Arzt nimmt den E<strong>in</strong>griff vor.<br />
- Leben<strong>der</strong>:<br />
(1) Spen<strong>der</strong> ist volljährig und e<strong>in</strong>willigungsfähig,<br />
(2) er ist umfassend u. im Beise<strong>in</strong> v. Arzt und Sachverständigem über E<strong>in</strong>griff<br />
und Folgen aufgeklärt worden,<br />
(3) die Aufklärung ist protokolliert u. von allen drei unterzeichnet worden,<br />
(4) Kommissionsgutachten (Arzt, Jurist, Psychologe) hat Freiwilligkeit Organspende besche<strong>in</strong>igt,<br />
(5) nach ärztlicher Beurteilung <strong>der</strong> Spen<strong>der</strong> als solcher geeignet ist,<br />
(6) das zu spendende Organ nicht alternativ von e<strong>in</strong>em toten Spen<strong>der</strong> verfügbar ist,<br />
(7) bei nicht regenerierbaren Organen: die Spende, nur zum Zwecke <strong>der</strong><br />
Übertragung auf Ehegatten, Verlobten, Verwandten 1./2. Grades, beson<strong>der</strong>s<br />
nahestehende Person vorgenommen wird,<br />
(8) e<strong>in</strong> Arzt den E<strong>in</strong>griff vornimmt,<br />
(9) die Organspende <strong>zur</strong> Lebenserhaltung o<strong>der</strong> Heilung e<strong>in</strong>er schweren Krankheit dient,<br />
(10) Spen<strong>der</strong> und Empfänger haben sich <strong>zur</strong> Nachuntersuchung verpflichtet.<br />
dd. Tatbestandsausschluß<br />
Kranker hat das Organ selbst u. zu Zwecken d. Eigentransplantation erworben.<br />
a. subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
3. Schuld<br />
4. Strafausschließungs-/Strafaufhebungsgründe/Strafverfolgungsh<strong>in</strong><strong>der</strong>nisse<br />
Bei <strong>der</strong> Strafzumessung können die Gerichte bestimmte mil<strong>der</strong>nde o<strong>der</strong> strafschärfende Umstände<br />
berücksichtigen, so ist z.B. <strong>der</strong> Organhandel aus re<strong>in</strong>em Gew<strong>in</strong>nstreben stärker zu bestrafen, als die<br />
lediglich eigennützige („nur“ verzweckte) o<strong>der</strong> gar uneigennützige Organvermittlung.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 101 von 180<br />
Situation:<br />
I. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong><br />
die Problematik<br />
II. Juristischer<br />
Kontext<br />
Sachverhalt: Am Sterbebett<br />
Der Patient Günther Grabrucker bef<strong>in</strong>det sich aufgrund vorangegangener<br />
Komplikationen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em irreversiblen Zustand <strong>der</strong> Bewusstlosigkeit und<br />
schwerster Dauerschäden es Gehirns. Er wird künstlich ernährt, damit er<br />
nicht stirbt. Se<strong>in</strong> Sohn, <strong>der</strong> als Betreuer e<strong>in</strong>gesetzt ist, legt dem Arzt e<strong>in</strong>e Patientenverfügung<br />
vor, die genau für diesen Fall die E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Behandlung<br />
anordnet. Der Arzt stellt daraufh<strong>in</strong> die Geräte ab und <strong>der</strong> Patient stirbt. Wie<br />
ist dies strafrechtlich zu werten ?<br />
A. Die Sterbehilfe<br />
Tod und Sterbehilfe s<strong>in</strong>d seit je her e<strong>in</strong> Thema, das die Gemüter erhitzt. Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Ursache hierfür s<strong>in</strong>d die mo<strong>der</strong>nen mediz<strong>in</strong>ischen Methoden (z.B. PEG-<br />
Sonden, Katheterisierung), die e<strong>in</strong>e Lebensverlängerung um Monate o<strong>der</strong> gar Jahre<br />
ermöglichen.<br />
Bei <strong>der</strong> Diskussion um die Sterbehilfe drängt sich die Frage auf, wo die Grenzen <strong>der</strong><br />
Manipulierbarkeit des Todes liegen. E<strong>in</strong>e Antwort hierauf gibt das verfassungsrechtlich<br />
verankerte Selbstbestimmungsrecht des Patienten.<br />
Im engeren S<strong>in</strong>ne geht es stets um das Spannungsfeld zwischen <strong>der</strong> Menschenwürde<br />
(= ke<strong>in</strong>e Lebenserhaltung gegen den Willen des Patienten = Recht auf<br />
menschenwürdigen Tod) und dem Recht auf Leben (= ke<strong>in</strong>e gezielte Lebensverkürzung<br />
gegen den Willen des Patienten).<br />
Dieses Spannungsfeld wird rechtsdogmatisch überwiegend im Verfassungsrecht<br />
über die Grundrechtsdiskussionen behandelt. Für die ärztliche Behandlungspraxis<br />
h<strong>in</strong>gegen stellt sich h<strong>in</strong>gegen die Frage nach dem richtigen Verhalten. Der Arzt<br />
muss wissen, was er darf und was nicht und wie er sich konkret zu verhalten hat.<br />
Juristisch wie praktisch wird die Sterbehilfeproblematik daher fast ausschließlich<br />
beim Strafrecht relevant. Konkret stellt sich die Frage, wann Sterbehilfe strafbar ist<br />
und unter welchen Voraussetzungen nicht.<br />
1. Voraussetzungen<br />
v.<br />
Sterbehilfe<br />
2. Def<strong>in</strong>ition<br />
von Sterbehilfe<br />
Sterbehilfe setzt voraus, dass das Grundleiden des Patienten unumkehrbar<br />
(irreversibel) ist, die Krankheit e<strong>in</strong>en tödlichen Verlauf<br />
genommen hat und <strong>der</strong> Tod <strong>in</strong> kurzer Zeit e<strong>in</strong>tritt.<br />
Sterbehilfe erfasst hiernach alle Maßnahmen gegenüber dem Sterbenden,<br />
die ihm das Sterben erleichtern, <strong>in</strong>dem entwe<strong>der</strong><br />
Schmerzen gel<strong>in</strong><strong>der</strong>t o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> qualvolles Leben verkürzt wird.<br />
Die Maßnahmen können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em aktiven Tun (Vornahme bestimmter<br />
Maßnahmen) o<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Unterlassen (Abbruch von<br />
Rettungsmaßnahmen).
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 102 von 180<br />
III. Fallgestaltungen<br />
<strong>der</strong> Sterbehilfe<br />
3. Arten <strong>der</strong><br />
Sterbehilfe Sterbehilfe<br />
(Auswahl)<br />
4. Behandlungsabbruch<br />
5. Formen des<br />
Behandlungsabbruchs<br />
Hilfe im Sterben Hilfe zum Sterben<br />
Patient liegt unmittelbar im<br />
Sterben; er erhält schmerzl<strong>in</strong><strong>der</strong>nde<br />
Mittel, ohne Lebensverkürzung.,<br />
wobei<br />
aber vorzeitiger Tod <strong>in</strong><br />
Kauf genommen wird<br />
Sterbevorgang beim Patienten<br />
hat e<strong>in</strong>gesetzt, er liegt aber<br />
nicht unmittelbar im Sterben.<br />
aktive Sterbehilfe passive Sterbehilfe<br />
aktives Tun, um das Leben<br />
zu verkürzen.<br />
Totschlag (§ 212 StGB), ggf.<br />
Mord (§ 211 StGB); wenn<br />
Patient aktive Hilfe wünscht,<br />
liegt Tötung auf Verlangen<br />
vor (§ 216 StGB).<br />
Unterlassen von Weiterbehandlungsmaßnahmen.<br />
straflos, wenn Behandlungsabbruch<br />
vom Patientenwillen<br />
gedeckt; sonst<br />
Mord o<strong>der</strong> Totschlag (§§<br />
211, 212 StGB).<br />
Wer e<strong>in</strong>em Todkranken <strong>in</strong>des e<strong>in</strong> Mittel beschafft, dass dieser<br />
anschließend e<strong>in</strong>nimmt und daran stirbt, macht sich nicht strafbar<br />
(Beihilfe <strong>zur</strong> Selbsttötung, wo es an rw Haupttat fehlt).<br />
Der Behandlungsabbruch stellt sich unabhängig davon, ob er<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Nichtaufnahme e<strong>in</strong>er gebotenen Behandlung o<strong>der</strong><br />
dem Unterlassen e<strong>in</strong>er bereits begonnenen Behandlung besteht<br />
immer als Fall <strong>der</strong> passiven Sterbehilfe (= durch Unterlassen) dar.<br />
Der Behandlungsabbruch stellt sich <strong>in</strong> unterschiedlichen Formen<br />
dar. Die gängigsten Fallgestaltungen s<strong>in</strong>d:<br />
E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Verabreichung lebenserhalten<strong>der</strong> Medikamente,<br />
Abstellen <strong>der</strong> künstlichen Ernährung,<br />
Abschalten technischer, das Leben aufrechterhalten<strong>der</strong> Geräte,<br />
Aber: Alle Fallgestaltungen setzen voraus, dass Arzt und <strong>Pflege</strong>kräfte<br />
zuvor alles Erdenkliche unternommen haben, um den<br />
Krankheitszustand des Patienten zu verbessern.<br />
Sterbehilfe wird dann relevant, wenn es nur noch darum geht, den Tod des Patienten<br />
h<strong>in</strong>auszuschieben. Es stellt sich dann regelmäßig die Frage, wann die weitere<br />
Behandlung durchgeführt werden muß bzw. wann sie abgebrochen werden darf:<br />
1. ausdrücklicher<br />
Wille<br />
Wenn <strong>der</strong> Patient trotz Aufklärung die Behandlung ausdrücklich<br />
ablehnt und e<strong>in</strong>willigungsfähig ist, muss sie abgebrochen<br />
werden. E<strong>in</strong> Behandlungszwang ist rechtlich nicht geregelt.<br />
Grund: Die Rechtsordnung stuft das Selbstbestimmungsrecht des Patienten höher e<strong>in</strong> als<br />
se<strong>in</strong> Wohl. Es wird befürchtet, dass <strong>der</strong> Patient an<strong>der</strong>nfalls zum Objekt ärztlichen Paternalismus<br />
degradiert werden könnte. Er soll immer eigenverantwortlich handeln können.<br />
Will <strong>der</strong> Patient h<strong>in</strong>gegen ausdrücklich weiterbehandelt werden,<br />
darf diese <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Fall abgebrochen werden.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 103 von 180<br />
2. mutmaßlicher<br />
Wille<br />
Kann <strong>der</strong> Patient se<strong>in</strong>en Willen nicht mehr äußern, ist se<strong>in</strong> mutmaßlicher<br />
Wille zu erforschen. Die Entscheidung wird dann daran<br />
ausgelegt. Wichtige Indizien <strong>zur</strong> Erforschung des Patientenwillens<br />
s<strong>in</strong>d die Patientenverfügung und die Befragung naher<br />
Angehöriger.<br />
Patientenverfügung:<br />
Problematisch bei e<strong>in</strong>er Patientenverfügung ist <strong>der</strong> Umstand Ihrer<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit. Dies bedeutet, daß e<strong>in</strong>e vor vielen Jahren<br />
ausgestellte Verfügung nicht mehr unbed<strong>in</strong>gt dem aktuellen Willen<br />
des Patienten entsprechen muß, weil er es sich zwischen zeitlich<br />
auch an<strong>der</strong>s überlegt haben könnte.<br />
Lösungsansatz:<br />
Es kommt <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e Patientenverfügung bereits<br />
mehrere Jahre alt ist darauf an, dass erforscht wird, ob diese noch<br />
dem gegenwärtigen Willen des Patienten entspricht. D.h., daß konkrete<br />
Anhaltspunkte vorliegen müssen, die besagen, daß <strong>der</strong> Patient<br />
se<strong>in</strong>e se<strong>in</strong>erzeitige Auffassung geän<strong>der</strong>t hat, § 1901a I BGB).<br />
3. Betreuer Liegt ke<strong>in</strong>e ausdrückliche schriftliche o<strong>der</strong> mündliche E<strong>in</strong>willigung<br />
vor, ist aber e<strong>in</strong> Betreuer bestellt, so muss dieser den aktuellen<br />
mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln, § 1901a II BGB.<br />
Verweigert e<strong>in</strong> Betreuer rechtswidrig se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
offensichtlich vom Patienten gewünschten Behandlungsabbruch,<br />
so besteht für das Vormundschaftsgericht die Möglichkeit, ihn<br />
gemäß § 1908 BGB zu entlassen.<br />
B. Son<strong>der</strong>problem:<br />
Beendigung des Krankenhausaufnahmevertrages durch Behandlungsabbruch nach Vorlage<br />
e<strong>in</strong>er Patientenverfügung bei komatösen Patienten durch nahe Angehörige o<strong>der</strong> Betreuer<br />
I. Fallgestaltung E<strong>in</strong> Krankenhausaufnahmevertrag kann unproblematisch durch den Patienten<br />
selbst gekündigt werden, <strong>in</strong>dem er die weitere Behandlung ablehnt. Fraglich ist,<br />
wie die Fälle zu behandeln s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> denen <strong>der</strong> Patient unter Betreuung steht und <strong>der</strong><br />
Betreuer aufgrund e<strong>in</strong>er wirksamen Patientenverfügung die Entscheidung trifft,<br />
die Behandlung e<strong>in</strong>zustellen und den Krankenhausvertrag zu kündigen.<br />
Fall (BGH,<br />
NJW 2003,<br />
1588 ff.)<br />
Dazu hatte <strong>der</strong> BGH folgenden Fall zu entscheiden:<br />
Der Patient hatte im Jahre 2000 e<strong>in</strong>en Herz<strong>in</strong>farkt erlitten. Un<strong>zur</strong>eichende<br />
Sauerstoffzufuhr im Gehirn hatte e<strong>in</strong>en Ausfall <strong>der</strong> Hirnr<strong>in</strong>de<br />
<strong>zur</strong> Folge. Das Stammhirn blieb jedoch <strong>in</strong>takt. Der Patient war<br />
völlig entscheidungs- und handlungsunfähig. Jede Kontaktaufnahme<br />
mit ihm war unmöglich. Die Ernährung erfolgte über e<strong>in</strong>e sog. PEG-<br />
Sonde direkt <strong>in</strong> den Magen. Der Zustand war irrevisibel, wenngleich<br />
<strong>der</strong> Sterbevorgang noch nicht e<strong>in</strong>gesetzt hatte.<br />
Im Jahre 2001 legte <strong>der</strong> Betreuer des Patienten - se<strong>in</strong> Sohn (Aufgabenkreis:<br />
Sorge für die Gesundheit des Betroffenen) - e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße<br />
Patientenverfügung vor („...im Falle ... schwerster Dauerschäden<br />
me<strong>in</strong>es Gehirns ... E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Ernährung ...“) und beantragte beim<br />
Vormundschaftsgericht gem. § 1904 BGB die E<strong>in</strong>stellung <strong>der</strong> Ernährung.<br />
Das Gericht war <strong>in</strong>des <strong>der</strong> Auffassung, dass se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung<br />
nicht erfor<strong>der</strong>lich sei. Der Fall gelangte schließlich zum BGH.
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 104 von 180<br />
II. Problemaufriss<br />
III. Die Falllösung<br />
nach <strong>der</strong><br />
neuen gesetzlichen<br />
Regelung<br />
Rechtsproblem<br />
In dem Fall geht es um die Frage, ob e<strong>in</strong>e Patientenverfügung<br />
ausreicht, e<strong>in</strong>en Behandlungsabbruch durch den Betreuer herbeizuführen<br />
o<strong>der</strong> ob dazu e<strong>in</strong>e (wie auch immer geartete) Entscheidung<br />
des Betreuungsgerichts herbeizuführen ist.<br />
Entschei-<br />
dungsan-<br />
satz des<br />
BGH<br />
Der BGH räumt dem Persönlichkeitsrecht und damit das<br />
Selbstbestimmungsrecht des Patienten absoluten Vorrang<br />
e<strong>in</strong>. Der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er wirksamen Patientenverfügung manifestierte<br />
Patientenwille ist für Arzt und Betreuer b<strong>in</strong>dend.<br />
Kernlösung: Sechs Jahre nach dem Urteil des BGH hat <strong>der</strong> Gesetzgeber 2009<br />
durch das Dritte Gesetz <strong>zur</strong> Än<strong>der</strong>ung des Betreuungsrechts die<br />
Rechtslage erstmals verb<strong>in</strong>dlich geregelt. Dies bedeutet für den Fall:<br />
- <strong>der</strong> Krankheitsverlauf muss e<strong>in</strong>en irreparabel tödlichen Verlauf genommen<br />
haben,<br />
- es ist dann die Aufgabe des Betreuers, den tatsächlich geäußerten<br />
bzw. mutmaßlichen Willen des Patienten anhand <strong>der</strong> Patientenverfügung<br />
ausf<strong>in</strong>dig zu machen und danach die sich hieraus abzuleitende<br />
Entscheidung über den Behandlungsabbruch umzusetzen:<br />
- Nach § 1901a BGB muss <strong>der</strong> Betreuer dazu zunächst prüfen, ob<br />
die Patientenverfügung noch auf die gegenwärtige Lebens- und<br />
Behandlungssituation zutrifft, also dem aktuellen Willen des Patienten<br />
entspricht<br />
- Hat <strong>der</strong> Betreuer den Willen des Betreuten h<strong>in</strong>sichtlich des Behandlungsabbruchs<br />
festgestellt, dann muß er den Arzt hierüber<br />
<strong>in</strong>formieren;<br />
- <strong>der</strong> Arzt muß sodann die Weiterbehandlung e<strong>in</strong>stellen, wenn<br />
dies aus <strong>der</strong> Patientenverfügung hervorgeht und er sich dar<strong>in</strong><br />
mit dem Betreuer e<strong>in</strong>ig ist, bei dieser Fallkonstellation ist<br />
ke<strong>in</strong>e Zustimmung o<strong>der</strong> Überprüfung des Vormundschaftsgerichts<br />
erfor<strong>der</strong>lich! (§ 1094 IV, V BGB),<br />
- Hat <strong>der</strong> Betreuer den Willen des betreuten Patienten dah<strong>in</strong>gehend<br />
ausgelegt, dass die Behandlung fortgesetzt werden soll<br />
ohne dass <strong>der</strong> Patient im E<strong>in</strong>zelnen festgelegt hat, wie die behandelt<br />
werden soll, so muss <strong>der</strong> Arzt die angemessene Behandlung<br />
gem. dem mutmaßlichen Willen des Patienten bestimmen<br />
(§1901b I BGB; das ist e<strong>in</strong> Novum, dass <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong><br />
diesen Fällen die Entscheidungsbefugnis für die Indikation hat,<br />
vgl. dazu auch Kurtze, MedR 2011, 531 [532]); soweit noch Zeit<br />
verbleibt, sollen auch die Angehörigen e<strong>in</strong>bezogen werden (§<br />
1901b II BGB),<br />
- wenn die Behandlungsmaßnahme allerd<strong>in</strong>gs geeignet se<strong>in</strong><br />
könnte (begründete Gefahr!), das Leben des Patienten zu gefährden<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en schweren o<strong>der</strong> dauerhaften Schaden an<strong>zur</strong>ichten,<br />
so muss <strong>der</strong> Betreuer für se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> die<br />
Behandlung zuvor die Genehmigung des Betreuungsgerichts<br />
e<strong>in</strong>holen (§ 1904 I BGB),<br />
- dies gilt auch für den Fall, dass er se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>willigung <strong>in</strong> die<br />
Behandlung nicht erteilt bzw. wi<strong>der</strong>ruft (= Behandlungsabbruch)<br />
und dadurch das Leben des Patienten gefährdet o<strong>der</strong><br />
dieser dauerhaften Schaden nimmt (§ 1904 II BGB),<br />
- <strong>in</strong> beiden Fällen muss das Betreuungsgericht die Genehmigung<br />
erteilen, wenn die E<strong>in</strong>willigung dem Patientenwillen entspricht,<br />
- auch wenn <strong>der</strong> Arzt ungeachtet und entgegen <strong>der</strong> Patientenverfügung<br />
noch mediz<strong>in</strong>ische Maßnahmen anbietet, um den<br />
Patienten künstlich am Leben zu halten, kann <strong>der</strong> Betreuer das<br />
Betreuungsgericht anrufen, das die Feststellung des Betreuers<br />
(also meist: Abbruch <strong>der</strong> Behandlung) kontrolliert und dem<br />
Betreuer bei <strong>der</strong> Umsetzung des Patientenwillens hilft,
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 105 von 180<br />
IV. Folgen <strong>der</strong><br />
gesetzlichen Regelung<br />
V. H<strong>in</strong>weis <strong>zur</strong><br />
Patientenverfügung: <br />
Konsequenzen<br />
für die<br />
Praxis:<br />
- das Vormundschaftsgericht trifft hierbei ke<strong>in</strong>e eigene Entscheidung<br />
über den Behandlungsabbruch, son<strong>der</strong>n es überprüft<br />
die Feststellung des Betreuers auf se<strong>in</strong>e Rechtmäßigkeit und<br />
stimmt <strong>der</strong> Entscheidung dann zu o<strong>der</strong> nicht,<br />
- ggf. kann es den Betroffenen und die nächsten Angehörigen anhören<br />
- dies kann u.U. zu dem Ergebnis führen, daß wenn <strong>der</strong> Betreuer<br />
<strong>der</strong> lebensverlängernden mediz<strong>in</strong>ischen Maßnahme entgegen dem<br />
feststellbaren Willen des Patienten zugestimmt hat, das Vormundschaftsgericht<br />
diese Zustimmung wie<strong>der</strong> aufheben (und durch<br />
se<strong>in</strong>e eigene ersetzen) kann, wenn es <strong>der</strong> Auffassung ist, dass <strong>der</strong><br />
Patient nicht weiter behandelt werden möchte,<br />
Die Entscheidung des BGH bedeutet für Krankenpflegepraxis, dass<br />
e<strong>in</strong>e bloße Patientenverfügung bereits unmittelbar zum Behandlungsabbruch<br />
berechtigt,<br />
<strong>der</strong> Arzt den Patienten nicht an Geräte anschließen darf, die ihn<br />
künstlich am Leben halten, wenn dieser <strong>in</strong> Würde sterben möchte,<br />
<strong>in</strong> Streitfällen mit dem trotzdem behandlungswilligen Arzt<br />
vielmehr vormundschaftsgerichtlich festgestellt werden muss,<br />
daß <strong>der</strong> Wille des Patienten auf Behandlungsabbruch vom Betreuer<br />
richtig ermittelt wurde,<br />
Um sicher zu gehen, sollte/kann <strong>der</strong> Betreuer <strong>in</strong> jedem Fall<br />
se<strong>in</strong>e Entscheidung vom Vormundschaftsgericht prüfen lassen.<br />
Für die Wirksamkeit e<strong>in</strong>er Patientenverfügung kommt es nicht darauf an, wie<br />
alt e<strong>in</strong>e Patientenverfügung se<strong>in</strong> darf, um noch wirksam se<strong>in</strong> zu können:<br />
Der re<strong>in</strong>e Zeitablauf macht e<strong>in</strong>e Patientenverfügung nicht unbeachtlicher. Sie wirkt<br />
als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts fort und macht e<strong>in</strong>e wie<strong>der</strong>holte Erneuerung<br />
entbehrlich. Auch die zwischenzeitlich e<strong>in</strong>getretene E<strong>in</strong>willigungsunfähigkeit (z.B. bei<br />
komatösen Patienten) än<strong>der</strong>t nach dem Rechtsgedanken des § 130 Abs. 2 BGB an <strong>der</strong><br />
fortdauernden Maßgeblichkeit des früher erklärten Willens nichts (BGH, NJW 2003, 1589 ff.).<br />
Entscheidend ist, dass die Patientenverfügung dem aktuellen Willen des Patienten<br />
entspricht – dies ist auch bei „alten“ Verfügungen immer zu prüfen.<br />
Etwas an<strong>der</strong>s gilt nur, wenn zwischenzeitlich klare Anhaltspunkte für e<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ung<br />
des Patientenwillens ersichtlich o<strong>der</strong> bekannt werden.<br />
Übersicht: Entscheidungswese Patientenverfügung. Quelle und Autor: Beckmann, <strong>in</strong>: MedR 2009, 582 (585)
©RA <strong>Norbert</strong> <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 106 von 180<br />
Lösung:<br />
Der Arzt hat sich nicht strafbar gemacht.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 107 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
II. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.15:<br />
Die zivilrechtliche Haftung des <strong>Pflege</strong>personals<br />
- Zeitdauer: 8 Std. -<br />
Übersicht:<br />
Die zivilrechtliche Schadensersatzhaftung<br />
Vertraglich:<br />
Haftung für Schäden, die<br />
bei <strong>der</strong> Erfüllung von<br />
Verträgen e<strong>in</strong>em Dritten<br />
zugefügt wurden.<br />
Bsp.: Arzt macht bei Patienten<br />
im Rahmen des Behandlungsverhältnisses<br />
(Vertrag!) e<strong>in</strong>en Behandlungsfehler,<br />
<strong>der</strong> <strong>zur</strong> Amputation<br />
e<strong>in</strong>es F<strong>in</strong>gers führt.<br />
System <strong>der</strong> zivilrechtlichen Haftung<br />
Die zivilrechtliche Haftung<br />
glie<strong>der</strong>t sich <strong>in</strong>:<br />
Deliktisch:<br />
Haftung für alle Schäden,<br />
die Dritten zugefügt werden,<br />
ohne dass man mit<br />
ihnen <strong>in</strong> vertraglichen<br />
Beziehungen steht.<br />
Bsp: Fred Müller schlägt<br />
e<strong>in</strong>en Passanten auf <strong>der</strong><br />
Strasse nie<strong>der</strong> und bricht<br />
ihm die Nase, weil ihm danach<br />
zu Mute war.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 108 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Das zivilrechtliche Haftungssystem (Anspruchsgrundlagen)<br />
A. Das Haftungs- Der Schadensersatz unterscheidet <strong>in</strong> die Haftung aus Vertrag und aus unerlaubter (deliktischer) Handlung.<br />
system im Über-<br />
blick Der zivilrechtliche Schadensersatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflege<br />
(Beide Ansprüche nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> möglich)<br />
Praxistip: E<strong>in</strong>er Prüfung<br />
<strong>der</strong> deliktischen<br />
Haftung bedarf es<br />
nicht mehr, soweit<br />
bereits die Voraussetzungen<br />
<strong>der</strong> vertraglichenGefährdungshaftung<br />
vorliegen;<br />
denn <strong>der</strong> Geschädigte<br />
gew<strong>in</strong>nt nichts h<strong>in</strong>zu<br />
Vertragshaftung Deliktische Haftung<br />
1. Anspruchsgrundlage: Schlechterfüllung<br />
KrkhausaufnVrtrg (§§ 280 I, III, 281 BGB)<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen:<br />
Vorliegen ärztl. Behandlungsvertrag<br />
od. <strong>Pflege</strong>vertrag (Leistungspflicht)<br />
Nicht-/Schlechterfüllung v. vertraglichen<br />
Pflichten: Verletzung von vertragl./organisator.<br />
Haupt-<br />
/Nebenleistungspflichten (eig./Personal)<br />
-> Patient muß beweisen<br />
Schadense<strong>in</strong>tritt bei Patient an<br />
Körper, Gesundheit, Freiheit, sexueller<br />
Selbstbestimmung (§ 253 II).<br />
Kausalität Schaden - Pflichtverletzung.;<br />
Problem: hypothetische<br />
E<strong>in</strong>willigung<br />
Rechtswidrigkeit<br />
Verschulden nach § 276 (Vors./Fahrl.) o<strong>der</strong><br />
Nicht-Vertreten-Müssen Verschulden<br />
wird wg. Verl. äuß. + <strong>in</strong>n. Sorgfalt vermutet<br />
§ 280 I 2 i.V.m. §§ 276, 278 BGB); Arzt /<br />
<strong>Pflege</strong>r muß sich entlasten (§ 280 I 2 BGB);<br />
z.B.: äußere + <strong>in</strong>nere Sorgfalt bzw. Höchstmaß<br />
an Sorgfalt beachtet; schuldloser Irrtum;<br />
Sorgfaltsanfor<strong>der</strong>ungen haben sich<br />
kurz zuvor verschärft (Beweislastumkehr)<br />
ke<strong>in</strong> Entlbeweis bei Verrichtungs-/Erfüllungsgehilfe,<br />
wenn Schmerzensgeld gefor<strong>der</strong>t,<br />
Geltendmachung Anspruch:<br />
erfolglose Nachfristsetzung (§<br />
280 III i.V.m. § 281 I 1, wenn<br />
nicht nach § 281 I 3 entbehrlich)<br />
3. Anspruchsumfang und -folge:<br />
Schadensersatzleistung durch Schädiger<br />
an Verletzten (auch an Dritte, die<br />
im Schutzbereich d.er Norm s<strong>in</strong>d =<br />
Fälle <strong>der</strong> GoA = K<strong>in</strong><strong>der</strong> u. [vorübergehend]<br />
E<strong>in</strong>willigungsunfähige).<br />
Umfang: § 249 BGB: unmittelb.<br />
Personen-, Sach-, Vermögens-, Gefährdungsschaden.<br />
Auch: Schmerzensgeld<br />
(§ 253 II BGB), wenn Verletzung<br />
vorsätzlich od. fahrlässig verursacht<br />
wurde o<strong>der</strong> Schaden unter<br />
Berücksichtigung s. Art und Dauer<br />
nicht unerheblich (dann ke<strong>in</strong> Verschulden nötig).<br />
4. Untergang des Anspruchs:<br />
durch Verjährung und Verwirkung.<br />
Verjährungsfrist: 3 Jahre ab Kenntniserlangung,<br />
man hat bei Verletzung v. Leib, Leben, Körper,<br />
Gesundheit, Freiheit 30 Jahre Zeit <strong>zur</strong> Kenntniserlangung<br />
(§ 199 II BGB). 10 Jahre bei Verletzung<br />
Selbstbestimmungsrecht (§ 199 III Nr. 1 BGB).<br />
1. Anspruchsgrundlage: § 823 BGB<br />
(bei eig. Verschulden).<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen:<br />
Verletzung e<strong>in</strong>es <strong>in</strong> § 823 BGB<br />
genannten Rechtsgutes des Patienten:<br />
Leib, Leben, Körper, Gesundheit,<br />
Freiheit, Selbstbestimmungsrecht,<br />
Eigentum.<br />
Durch Schädiger.<br />
Durch Handlung (Tun/Unterlassen).<br />
Schadense<strong>in</strong>tritt bei Patient (§ 253 II).<br />
Kausalität/obj. Zurechnung;<br />
Problem: hypothetische E<strong>in</strong>willigung<br />
Rechtswidrigkeit<br />
Vorsätzliches o<strong>der</strong> fahrlässiges<br />
Handeln (§ 280 I 2, §§ 276 I, II;<br />
278 BGB).<br />
Bei Verrichtungsgehilfe: Haftung<br />
nach<br />
§ 831 BGB (an<strong>der</strong>er Aufbau, dezentraler<br />
Entl.bew.), wenn regulärer<br />
Schadensersatz angestrebt ist<br />
§ 278 BGB, wenn Schemrzensgeld<br />
verlangt werden soll; Folge: <strong>der</strong><br />
über § 831 BGB mögliche dezentrale<br />
Entlastungsbeweis kann nicht<br />
geführt werden wegen § 253 II.<br />
3. Anspruchsumfang und -folge:<br />
Schadensersatzleistung durch<br />
Schädiger.<br />
Grds.: Personen-, Sach-, Vermögens-,<br />
Gefährdungsschaden,<br />
Schmerzensgeld.<br />
Umfang: § 249 BGB: unmittelb.<br />
Personenschaden, Sachschaden, Vermögensschaden.<br />
Auch: Schmerzensgeld<br />
(§ 253 II BGB), wenn Verletzung<br />
vorsätzlich od. fahrlässig verursacht<br />
wurde o<strong>der</strong> Schaden unter<br />
Berücksichtigung s. Art und Dauer<br />
nicht unerheblich (dann ke<strong>in</strong> Verschulden nötig).<br />
4. Untergang des Anspruchs:<br />
durch Verjährung und Verwirkung.<br />
Verjährungsfrist: 3 Jahre ab Kenntniserlangung,<br />
man hat bei Verletzung v. Leib, Leben, Körper,<br />
Gesundheit, Freiheit 30 Jahre Zeit <strong>zur</strong> Kenntniserlangung<br />
(§ 199 II BGB). 10 Jahre bei Verletzung<br />
Selbstbestimmungsrecht (§ 199 III Nr. 1 BGB).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 109 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Krankenhausvertrag <br />
Schlechterfüllung<br />
von Leistungen <br />
Schadense<strong>in</strong>tritt<br />
Kausalität<br />
Pflichtverletzung-<br />
Schaden<br />
Verschulden<br />
Rechtswidrigkeit<br />
<strong>der</strong><br />
Pflichtverletzung <br />
Schadensersatz/Schmerzensgeld<br />
Die vertragliche Haftung des Krankenhauses<br />
gegenüber dem Patienten<br />
- Überblick -<br />
Verletzung vertraglicher<br />
Hauptleistungspflichten, u.a.:<br />
weil ke<strong>in</strong>e bestmögliche ärztliche<br />
o<strong>der</strong> pflegerische Behandlung erfolgt<br />
ist,<br />
weil e<strong>in</strong> ärztlicher o<strong>der</strong> pflegerischer<br />
Behandlungsfehler begangen<br />
wurde,<br />
weil Patient rechtswidrig zwangsbehandelt<br />
wird<br />
Verletzung vertraglicher Nebenleistungspflichten.<br />
u.a.:<br />
weil ke<strong>in</strong> kompetentes, sorgfältiges<br />
und wachsames Personal vorhanden<br />
ist,<br />
weil zu wenig Personal vorgehalten<br />
wird und es deshalb zu Engpässen<br />
bei <strong>der</strong> Versorgung<br />
kommt,<br />
weil die pflegerischen o<strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Standards nicht e<strong>in</strong>gehalten<br />
wurden<br />
weil nicht die ärztlichen Regeln<br />
<strong>der</strong> Kunst (=Schulmediz<strong>in</strong>) angewendet<br />
wurden,<br />
weil Patient nicht ordnungsgemäß<br />
überwacht wird (Monitorpatient!),<br />
weil Patient <strong>in</strong> rechtswidriger<br />
Weise fixiert wird,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 110 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
B. Schadensersatz<br />
des Patienten<br />
ggü. dem<br />
Anspruch des Patienten gegen das Krankenhaus wegen <strong>der</strong> Verletzung vertraglicher<br />
Hauptleistungspflichten durch eig. Verhalten o<strong>der</strong> das des <strong>Pflege</strong>personals<br />
(Erfüllungsgehilfe) während <strong>der</strong> stationären Behandlung.<br />
Krankenhaus<br />
aus Vertrag<br />
(Hauptleistungs-<br />
pflichten 1. Anspruchsgrundlage<br />
Schlechterfüllung des Krankenhausaufnahmevertrages (§§ 280 I, III, 281 BGB)<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen<br />
a. Vorliegen e<strong>in</strong>es Krankenhausaufnahmevertrages<br />
Meist totaler Krankenhausaufnahmevertrag. Folge: Vorliegen e<strong>in</strong>es<br />
Arzt- und <strong>Pflege</strong>vertrages <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em.<br />
b. Schlechterfüllung von Pflichten aus dem Krankenhausaufnahmevertrag<br />
Das Krankenhaus verletzt aus dem Vertrag resultierende Hauptleistungspflichten<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> ärztlichen o<strong>der</strong> pflegerischen Behandlung<br />
(= Vorliegen e<strong>in</strong>es ärztlichen o<strong>der</strong> pflegerischen Behandlungsfehlers):<br />
In Betracht kommt die Verletzung für eigenes Verhalten wie auch<br />
für dasjenige von Erfüllungsgehilfen.<br />
Der Patient muß das Vorliegen <strong>der</strong> Hauptpflichtverletzung nachweisen<br />
(Näheres zu den Beweisfragen vgl. unten E.). Erst dann wird<br />
das Vertretenmüssen des Arztes/<strong>Pflege</strong>personals vermutet.<br />
Die Verletzung sonstiger Pflichten, die ke<strong>in</strong>e Hauptleistungspflichten<br />
s<strong>in</strong>d, also etwa re<strong>in</strong>e Verhaltenspflichten, bei denen etwa mediz<strong>in</strong>ische<br />
und pflegerische Qualitätsstandards e<strong>in</strong>zuhalten s<strong>in</strong>d,<br />
richtet sich nach etwas an<strong>der</strong>en Kriterien.<br />
c. Vorliegen <strong>der</strong> sonstigen Haftungsvoraussetzungen<br />
Schadense<strong>in</strong>tritt<br />
Kausalität Sorgfaltspflichtverletzung - Schaden (Patient = Mitursächlichkeit beweisen).<br />
Rechtswidrigkeit <strong>der</strong> Hauptleistungspflichtverletzung (wird <strong>in</strong>diziert).<br />
Vorsatz/Fahrlässigkeit (§ 276 BGB) und Nicht-Vertreten-müssen (§ 280 BGB)<br />
Liegt die Pflichtverletzung vor, dann müssen <strong>der</strong> Arzt o<strong>der</strong> das <strong>Pflege</strong>personal<br />
darlegen, daß diese nicht von ihm zu vertreten s<strong>in</strong>d. Zu Vertreten s<strong>in</strong>d<br />
nach § 276 BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit (Pat. muß beweisen).<br />
Aber: Verschuldens<strong>zur</strong>echnung kann auch entfallen bei Nicht-Vertreten-<br />
Müssen nach § 280 BGB; dann muss Arzt Verschuldensvermutung wi<strong>der</strong>legen<br />
(Beweislastumkehr ! zug. Patient): Anhaltspunkte können u.a. se<strong>in</strong>:<br />
Beachtung <strong>der</strong> <strong>in</strong>neren und äußeren Sorgfalt:<br />
Die äußere Sorgfalt stellt auf das sichtbare sachgemäße Verhalten<br />
ab. Die Nichte<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Sorgfalt im Äußeren <strong>in</strong>diziert auch die<br />
Nichte<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> <strong>in</strong>neren Sorgfalt, welche <strong>zur</strong> Durchsetzung des<br />
Normbefehls und <strong>zur</strong> Durchsetzung <strong>der</strong> Befolgung e<strong>in</strong>gesetzt wird.<br />
Höchstmaß und Normalmaß an Sorgfalt<br />
Die Außerachtlassung des Höchstmaßes an Sorgfalt begründet die<br />
handlungsbezogene Rechtswidrigkeit.<br />
Entschuldbarer Irrtum<br />
Dies umfaßt den schuldlosen Irrtum.<br />
Verwirklichung von eigentlich beherrschbaren Risiken<br />
E<strong>in</strong>e Beweislastumkehr ist auch dann gegeben, wenn es sich um Risiken<br />
handelt, die nicht aus den Eigenheiten des menschlichen Körpers<br />
erwachsen, son<strong>der</strong>n durch den Kl<strong>in</strong>ikbetrieb o<strong>der</strong> die Arztpraxis gesetzt<br />
und eigentlich durch sachgerechte Organisation und Koord<strong>in</strong>ation des<br />
Behandlungsgeschehens obj. voll beherrscht werden können, z.B.<br />
Verwendung von nicht sterilem OP-Gerät (BGH, MedR 2010, 30).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 111 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
C. Schadensersatz<br />
des Patienten<br />
ggü. dem<br />
3. Anspruchsfolge<br />
Patient erhält Personen-, Sach- u. Vermögensschäden ersetzt, sowie Schmerzensgeld.<br />
Anspruch des Patienten gegen das Krankenhaus wegen <strong>der</strong> Verletzung von<br />
Nebenpflichten (meist: Verhaltenspflichten) durch eig. Verhalten o<strong>der</strong> das des<br />
<strong>Pflege</strong>personals während <strong>der</strong> stationären Behandlung.<br />
Krankenhaus<br />
aus Vertrag<br />
(Nebenpflichten) 1. Anspruchsgrundlage<br />
Schlechterfüllung des Krankenhausaufnahmevertrages (§§ 280 I, III, 281 BGB)<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen<br />
a. Vorliegen e<strong>in</strong>es Krankenhausaufnahmevertrages<br />
b. Schlechterfüllung von Pflichten aus dem Krankenhausaufnahmevertrag<br />
Das Krankenhaus verletzt aus dem Vertrag resultierendeNebenpflichten.<br />
dies können se<strong>in</strong>: Verhaltenspflichten o<strong>der</strong> auch organisatorische Sorgfaltspflichten<br />
h<strong>in</strong>sichtl. Unterkunft und Betreuung d. Patienten:<br />
Verhaltenspflichten, Pflicht, ärztliche Regeln <strong>der</strong> Kunst anzuwenden,<br />
m<strong>in</strong>destens aber die gesicherten Erkenntnisse <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Wissenschaft,<br />
ohne den mediz<strong>in</strong>ischen (Fach-)Arzt Standard zu unterschreiten<br />
(Vogeler, MedR 2009, 697 [700]; Merke: Aufklärung = vertragl. Nebenpflicht<br />
des Arzt, trotzdem muß Arzt Durchführung Aufklärung beweisen<br />
u. nicht <strong>der</strong> Patient (Sp<strong>in</strong>dler, JuS 2004, 272 [275]).<br />
Personelle Organisationspflichten, es muß das für die Behandlung erfor<strong>der</strong>liche<br />
und qualifizierte Personal (= Berufsanfänger kontrollieren und überwachen)<br />
bereitstellen, um die bestmögliche mediz<strong>in</strong>ische Betreuung des Patienten<br />
sicherzustellen (Patient darf deswegen ke<strong>in</strong>en Schaden erleiden).<br />
1. Son<strong>der</strong>problem: das Krankenhaus muss das ärztliche und pflegerische<br />
Personal so vorhalten, dass e<strong>in</strong>e zeitnahe Versorgung <strong>der</strong> Patienten<br />
sichergestellt ist; überdies müssen Anweisungen, Pläne und Rout<strong>in</strong>en<br />
vorliegen, ob und wann e<strong>in</strong>e Aufnahmeschwester e<strong>in</strong>en erfahrenen<br />
Arzt h<strong>in</strong>zuziehen muss, wenn e<strong>in</strong> solcher gerade nicht vor Ort ist - man<br />
darf sich nicht darauf verlassen, dass das <strong>Pflege</strong>personal von sich aus<br />
die mediz<strong>in</strong>ischen Notwendigkeiten e<strong>in</strong>er Behandlung erkennt (OLG<br />
Bremen, MedR 2007, 660 [661]).<br />
2. Son<strong>der</strong>problem: e<strong>in</strong> Krankenhaus verletzt nicht von vorne here<strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>e personellen und pflegerischen Organisationspflichten, wenn e<strong>in</strong>e<br />
Nachtschwester für vier Stationen mit durchschnittlich 15-20 Betten<br />
zuständig ist und während ihrer Schicht m<strong>in</strong>d. drei Rundgänge<br />
macht (OLG Schleswig, NJW-RR 2004, 237).<br />
Organisationspflichten des mediz<strong>in</strong>ischen Standards, wenn es<br />
ke<strong>in</strong>e Geräte vorhält und e<strong>in</strong>setzt, die geeignet s<strong>in</strong>d, den mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Erfolg herbeizuführen. Aber: Muß nicht neuestes Gerät vorhalten.<br />
Überwachung sedierter Patient nach ambulanter OP vor Selbstschädigung;<br />
darf nicht unkontrolliert entlassen werden (BGH, NJW 2003, 2309).<br />
Sonstige Organisationspflichten s<strong>in</strong>d verletzt, wenn vermeidbare<br />
Engpässe auftreten und Patienten dadurch zu Schaden kommen.<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal verletzt u.a. pflegerische Sorgfaltspflichten, wenn:<br />
<strong>der</strong> Patient nicht auf Aufbewahrung Schmuck im Safe h<strong>in</strong>gewiesen ist,<br />
es den Patienten entgegen <strong>der</strong> ärztlichen Weisung fixiert,<br />
es den Patienten nicht regelmäßig gemäß <strong>der</strong> ärztlichen Anweisung<br />
überwacht,<br />
Son<strong>der</strong>problem: Haftung wegen nicht durchgängiger Beobachtung von<br />
monitorüberwachten Patienten<br />
E<strong>in</strong> grobes pflegerisches Versäumnis liegt bei e<strong>in</strong>em monitorüberwachten Patienten<br />
auch dann vor, wenn <strong>der</strong>en Zustand unauffällig ist und die Vitalparameter<br />
(arterieller Blutdruck, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung des Blutes) über Sen-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 112 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
D. Schadensersatz<br />
des Patienten<br />
ggü. dem<br />
Krankenhaus<br />
aus Delikt<br />
soren und Monitore, die bei unruhigen Bewegungen des Patienten e<strong>in</strong> Alarmsignal<br />
auslösen, überwacht werden und dann über e<strong>in</strong>en gewissen Zeitraum (hier: 15-20<br />
M<strong>in</strong>.) unbeobachtet gelassen werden, ohne daß die Beobachtung an e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es<br />
Mitglied des pflegerischen Personals übergeben wurde (OLG Düsseldorf, NJOZ<br />
2004, 2187 f.).<br />
Aber: E<strong>in</strong>e Haftung kommt <strong>in</strong> diesen Fällen nur dann <strong>in</strong> Betracht:<br />
- bei Patienten mit unkritischem Zustand (dann besteht nämlich<br />
ke<strong>in</strong>e Pflicht, den Patienten im Krankenzimmer an dessen<br />
Bett zu überwachen, son<strong>der</strong>n es genügt die Überwachung vom<br />
Dienstzimmer aus), wenn e<strong>in</strong> Unfall dann hätte verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden<br />
können, wenn sich die <strong>Pflege</strong>cxkraft im Dienstzimmer aufgehalten<br />
hätte (OLG Düsseldorf, a.a.O., ebd.),<br />
- bei Patienten mit kritischem Zustand (dann besteht nämlich<br />
i.d.R. die Pflicht, den Patienten im Krankenzimmer an se<strong>in</strong>em<br />
Bett zu überwachen), wenn e<strong>in</strong> Unfall dann hätte verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden<br />
können, wenn sich die <strong>Pflege</strong>kraft im Krankenzimmer am Patientenbett<br />
aufgehalten hätte (OLG Düsseldorf, a.a.O., ebd.).<br />
die Nachtschwester den Arzt vor E<strong>in</strong>setzen <strong>der</strong> Wehen nicht <strong>in</strong>formiert<br />
und sich selbst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Therapie versucht,<br />
die <strong>Pflege</strong>kraft die Thrombosegefährdung des Patienten nicht beachtet<br />
und ke<strong>in</strong>en Arzt verständigt,<br />
auf <strong>der</strong> Intensivstation bei Risikopatienten nicht auf eig. Antrieb<br />
häufigere Kontrollen durchgeführt werden,<br />
die <strong>Pflege</strong>kraft nicht die Instrumente für die OP bereitstellt und entsorgt,<br />
die OP-Geräte nicht steril, son<strong>der</strong>n sogar verunre<strong>in</strong>igt s<strong>in</strong>d (BGH, MedR<br />
2010, 30).<br />
Patient muß Vorliegen Pflichtverletzung beweisen.<br />
H<strong>in</strong>weis: Das Krankenhauses haftet beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag<br />
für Sorgfaltspflichtverletzungen des <strong>Pflege</strong>personals (= Erfüllungsgehilfe).<br />
Beim gespaltenen Krankenhausvertrag haften Belegarzt und Krankenhaus<br />
gesamtschuldnerisch für Fehler des <strong>Pflege</strong>personals, weil e<strong>in</strong>e<br />
Gemengelage an pflegerischen Pflichten und Aufgaben besteht.<br />
Die Haftung für Fehler <strong>der</strong> Ambulanz kommt nur dann <strong>in</strong> Betracht,<br />
wenn das Krankenhaus als Institution die Haftung übernimmt.<br />
b. Vorliegen <strong>der</strong> sonstigen Haftungsvoraussetzungen<br />
Schadense<strong>in</strong>tritt<br />
Kausalität Sorgfaltspflichtverletzung - Schaden (Patient = Mitursächlichkeit beweisen).<br />
Rechtswidrigkeit <strong>der</strong> Sorgfaltspflichtverletzung (wird <strong>in</strong>diziert).<br />
Vorsatz/Fahrlässigkeit (Vertreten-müssen/Nicht-Vertreten-müssen).<br />
3. Anspruchsfolge<br />
Patient erhält Personen-, Sach- u. Vermögensschäden ersetzt sowie Schmerzensgeld.<br />
Anspruch des Patienten gegen das Krankenhaus wegen <strong>der</strong> deliktischen Verletzung<br />
von Rechtsgütern durch eig. Verhalten o<strong>der</strong> das des <strong>Pflege</strong>personals während<br />
<strong>der</strong> stationären Behandlung.<br />
1. Anspruchsgrundlage(n)<br />
§ 823 BGB bei eigenen und § 831 BGB bei Handlungen <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>personals.<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen<br />
a. Verletzung Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Selbstbestimmung<br />
Verletzung des Lebens liegt vor, wenn <strong>der</strong> Tod e<strong>in</strong>getreten ist.<br />
Körperverletzung (= Misshandlung, die körperl. Wohlbef<strong>in</strong>den nicht unerheblich<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt; od.: Hervorrufen od. Steigern patholog. Zustand).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 113 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Freiheitse<strong>in</strong>griffe s<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> die Bewegungsfreiheit (Fixierung).<br />
Eigentumsverletzungen (= Sachen d. Patienten gestohlen od. zerstört).<br />
das Selbstbestimmungsrecht ist verletzt, wenn <strong>der</strong> Arzt trotz un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong>/unwirksamer<br />
Aufklärung e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>griff vornimmt.<br />
b. durch Krankenhaus / Arzt o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>personal (Verrichtungsgehilfe)<br />
Das Krankenhaus verletzt se<strong>in</strong>e organisatorischen Sorgfaltspflichten<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> allg., nichtmediz<strong>in</strong>ischen/nichtpatientenbezogenen<br />
Betriebsabläufe (sog. deliktisches Organisationsverschulden), § 823:<br />
Betriebsabläufe h<strong>in</strong>sichtlich Toiletten, Strom und Wasser, Feuerlöscher<br />
und Aschenbecher auf Stationen funktionieren nicht,<br />
Patienten können Wertsachen nicht verschließen,<br />
Infusionslösungen werden durch unsaubere Räume verseucht.<br />
E<strong>in</strong> angestellter Arzt kann bei totalem Krankenhausvertrag gegenüber<br />
dem Patienten auch selbst deliktischer Verursacher se<strong>in</strong>, weil<br />
er für die aufgrund <strong>der</strong> organisatorischen Weisung übernommene Behandlungsaufgabe<br />
e<strong>in</strong>e Garantenstellung erlangt hat, die er bei unsorgfältigem<br />
Verhalten verletzen kann. Das Krankenhaus haftet <strong>in</strong><br />
diesem Fall nicht selbst deliktisch (BGH, NJW 2000, 2741 [2742]).<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal verletzt als Verrichtungsgehilfe (= Krankenschwester<br />
wird mit Wissen und Wollen des. Krankenhauses von diesem<br />
mit typischer Tätigkeit beauftragt und ist dabei weisungsabhängig) <strong>in</strong><br />
Ausführung dieser Verrichtung Rechtsgüter (s.o.) von Patienten, § 831<br />
c. durch kausale und <strong>zur</strong>echenbare Handlung/Unterlassen<br />
d. Vertreten müssen: Vorsatz/Fahrlässigkeit<br />
das Krankenhaus hat se<strong>in</strong> eigenes schädigendes Verhalten zu vertreten,<br />
wenn vorsätzlich o<strong>der</strong> fahrlässig gehandelt wurde, § 823er Haftung<br />
bei Haftung für Verrichtungsgehilfen wird vermutet, daß das Krankenhaus<br />
Gehilfen unsorgfältig ausgesucht o<strong>der</strong> mangelhaft überwacht<br />
und daher zu vertreten hat, § 831er Haftung<br />
e. ggf. dezentraler Entlastungsbeweis des Krankenhauses<br />
bei Haftung für Verrichtungsgehilfen kann sich Krankenhaus durch<br />
Führen des dezentralen Entlastungsbeweises von Haftung befreien,<br />
es muß darlegen, daß Krankenschwester sorgfältig ausgesucht (gute<br />
Zeugnisse, nie etwas passiert <strong>in</strong> Vergangenheit) u. überwacht hat.<br />
Aber: Wenn Schmerzensgeld verlangt wird, greift <strong>der</strong> dezentrale Entlastungsbeweis<br />
wegen <strong>der</strong> Regelung <strong>in</strong> § 278 BGB nicht (Wagner, NJW 2002, 2056).<br />
f. Rechtswidrigkeit und Schadense<strong>in</strong>tritt<br />
3. Anspruchsfolge<br />
Patient erhält Personen-, Sach- u. Vermögensschäden ersetzt und Schmerzensgeld.<br />
E. Beweisfragen Die erfolgreiche Geltendmachung e<strong>in</strong>es schadensersatzrelevanten Behandlungsfehlers<br />
setzt voraus, daß dies bewiesen werden kann.<br />
1. Ärztlicher Behandlungsfehler<br />
Bei e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>fachen Behandlungsfehler muß <strong>der</strong> Patient sowohl Fehler,<br />
Schaden und Kausalität beweisen. Ausnahme: Vorliegen e<strong>in</strong>es Dokumentationsfehlers<br />
(vgl. dazu unten VI.) o<strong>der</strong> z.B. Unterlassen <strong>der</strong> Befun<strong>der</strong>hebung.<br />
Wird e<strong>in</strong> grober Behandlungsfehler festgestellt, kommt es <strong>zur</strong> Beweis-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 114 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
F. Schmerzensgeld<br />
G. Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong><br />
Verjährungsfrist<br />
ab Kenntnisnahme<br />
vom<br />
Schaden<br />
lastumkehr h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Kausalität. Folge: Der Arzt muß beweisen, daß<br />
<strong>der</strong> vom Patienten geltend gemachte Schaden nicht typischerweise durch den<br />
Behandlungsfehler hervorgerufen wurde (Sp<strong>in</strong>dler, JuS 2004, 272 [275]).<br />
Def. grober<br />
Behandlungsfehler:<br />
Feststellung grober Behandlungsfehler:<br />
Es liegt e<strong>in</strong> Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregelungen<br />
o<strong>der</strong> gesicherte mediz<strong>in</strong>ische Erkenntnisse vor und darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong><br />
Fehler, <strong>der</strong> aus objektiver ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich ersche<strong>in</strong>t,<br />
weil e<strong>in</strong>em Arzt dies schlechterd<strong>in</strong>gs nicht unterlaufen darf.<br />
Die Beurteilung dessen, ob e<strong>in</strong> grober Behandlungsfehler vorliegt, obliegt<br />
dem Tatrichter, <strong>der</strong> hierzu meist auf die (gerichtliche) E<strong>in</strong>holung mediz<strong>in</strong>ischer<br />
Sachverständigengutachten angewiesen ist.<br />
Merke: Inhaltliche reichen allgeme<strong>in</strong>e Erwägungen des Sachverständigen o<strong>der</strong> Darlegungen<br />
über die Kumulation von Fehlern nicht aus; er muß konkret darlegen, daß<br />
<strong>der</strong> festgestellte Fehler e<strong>in</strong>em Arzt schlechterd<strong>in</strong>gs nicht unterlaufen darf. Der bloße<br />
H<strong>in</strong>weis auf e<strong>in</strong> ärztliches Vorgehen, das nach <strong>der</strong> Ansicht des Gutachters nicht den<br />
anerkannten mediz<strong>in</strong>ischen Standards entspricht, reicht nicht aus für die Annahme e<strong>in</strong>es<br />
groben Behandlungsfehlers.<br />
2. <strong>Pflege</strong>fehler<br />
Bei <strong>Pflege</strong>fehlern gilt das zuvor zum ärztlichen Behandlungsfehler Gesagte.<br />
Der geschädigte Patient kann gegenüber Arzt, <strong>Pflege</strong>personal und Krankenhaus -<br />
auch <strong>in</strong> Bagatellfällen - Schmerzensgeld wegen des erlittenen Schadens e<strong>in</strong>klagen.<br />
1. Dogmatische E<strong>in</strong>ordnung<br />
Der Schmerzensgeldanspruch ist gemäß § 253 II BGB auf die Fälle <strong>der</strong> Verletzung<br />
von Körper, Gesundheit, Freiheit sexuelle Selbstbestimmung erstreckt.<br />
2. Entlastungsbeweis<br />
Der dezentrale Entlastungsbeweis des Arztes/Krankenhaus ist bei Hilfspersonen<br />
wegen § 278 S. 1 BGB im Rahmen des Schmerzensgeldanspruchs<br />
nicht mehr möglich (sonst schon, arg. ex. Sp<strong>in</strong>dler, JuS 2003, 272 [276]).<br />
Die Verjährungsfrist für die Haftung bei Arzt- o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>fehlern beg<strong>in</strong>nt mit <strong>der</strong><br />
positiven Kenntnis des Patienten von dem Fehler bzw. <strong>der</strong> grob fahrlässigen Unkenntnis<br />
(= es hätte sich ihm aufdrängen müssen).<br />
Das Problem:<br />
Regelmäßig stellt sich hier die Frage, wann für den Patienten konkrete Anhaltspunkte<br />
für das Bestehen se<strong>in</strong>es Anspruchs ersichtlich s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> se<strong>in</strong> müssen,<br />
also wann sich ihm <strong>der</strong> Verdacht e<strong>in</strong>er möglichen Schädigung hätte aufdrängen<br />
müssen, so dass er konkrete Schritte zu se<strong>in</strong>er Aufdeckung und Verfolgung<br />
hätte e<strong>in</strong>leiten müssen.<br />
Die Lösung des BGH (MedR 2010, 258 f.)<br />
Der Bundesgerichtshof stellt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Urteil fest, dass alle<strong>in</strong>e <strong>der</strong> negative<br />
Ausgang e<strong>in</strong>er Behandlung noch nicht dazu führen muss, dass <strong>der</strong> Patient<br />
konkret tätig werden muss, um die drohende Verjährung zu vermeiden. Denn
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 115 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
G. Ärztliche<br />
und pflegerische<br />
Dokumentation<br />
im haftungsrechtlichen<br />
Be-<br />
weisverfahren<br />
das Ausbleiben des ärztlichen Erfolgs muss nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Unzulänglichkeit<br />
ärztlicher Bemühungen liegen.<br />
Vielmehr muss <strong>der</strong> Patient<br />
– aus se<strong>in</strong>er Laiensicht<br />
– ohne dass er dazu beson<strong>der</strong>e Recherchen durchführen müßte<br />
– und ohne dass er „die Augen verschließt“<br />
– allerd<strong>in</strong>gs aufgrund verständlich ersche<strong>in</strong>en<strong>der</strong> Nachfragen an den Arzt<br />
konkrete Tatsachen kennen, aus denen sich ergibt, dass <strong>der</strong> Arzt schuldhaft<br />
von dem üblichen mediz<strong>in</strong>ischen Vorgehen abgerückt ist o<strong>der</strong> nicht die<br />
Maßnahmen ergriffen hat, die den Behandlungserfolg herbeiführen können<br />
(= schuldhaftes Fehlverhalten).<br />
Vorher beg<strong>in</strong>nt die (dreijährige) Verjährungsfrist nicht zu laufen (= patientenfreundliche<br />
Sicht des BGH).<br />
Ärztliche und pflegerische<br />
Dokumentationspflicht (im Beweisverfahren)<br />
Soweit die Patienten ihre Schadensersatzansprüche nach den allgeme<strong>in</strong>en<br />
Haftungsgrundsätzen geltend machen wollen, müssen sie beweisen, daß <strong>der</strong><br />
Arzt o<strong>der</strong> das Krankenhaus ihnen durch fehlerhaftes Verhalten e<strong>in</strong>en Schaden<br />
zugefügt haben.<br />
Um den Beweis überhaupt führen zu können, müssen die Patienten E<strong>in</strong>sicht<br />
<strong>in</strong> ihre Patientenakte, beson<strong>der</strong>s <strong>in</strong> die Dokumentationsunterlagen nehmen.<br />
Denn <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e über die Dokumentation kann <strong>der</strong> Patient Beweiserleichterungen<br />
(bis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Beweislastumkehr) <strong>in</strong> Anspruch nehmen, wenn <strong>Pflege</strong>personal<br />
und Arzt die Dokumentationspflicht verstoßen haben (Feststellung erfolgt über<br />
E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> Patientenakte!).<br />
S<strong>in</strong>n u.<br />
Zweck <strong>der</strong><br />
Dokumentation:<br />
Ärztliches und pflegerisches Personal unterliegen <strong>der</strong> Pflicht <strong>zur</strong><br />
Dokumentation ihrer Maßnahmen.<br />
Die Dokumentationspflicht ist Nebenpflicht des ärztlichen Behandlungsvertrages<br />
u. d. Krankenhausbehandlungsvertrages.<br />
Durch die Dokumentation soll die Behandlung transparent und ihr<br />
therapeutischer Nutzen sichtbar werden, die Dokumentation<br />
dient nicht <strong>der</strong> Beweissicherung für den Patienten (vgl. OLG<br />
Oldenburg, MedR 2008, 375 [376],<br />
dabei reichen e<strong>in</strong>e schlagwortartige Abkürzung o<strong>der</strong> zeichnerische<br />
Darstellungen völlig aus, wenn sie von e<strong>in</strong>em Fachmann<br />
verstanden werden können.<br />
1. Inhalt und Umfang <strong>der</strong> Dokumentationspflicht<br />
a. Die ärztliche Dokumentation muss enthalten<br />
Die ärztliche Dokumentation soll <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die wesentlichen mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Daten und Fakten für den Behandlungsverlauf sicherstellen.<br />
Sie muss demgemäß enthalten:
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 116 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen,<br />
alle wichtigen Punkte <strong>der</strong> Anamnese, Diagnose und Therapie,<br />
alle Untersuchungsbefunde und Berichte über Behandlungsmaßnahmen,<br />
chronologisch aufbereitete Krankengeschichte (Verlaufsbericht),<br />
Verlaufskurven mit E<strong>in</strong>tragungen von Körpertemperatur, Blutdruck-<br />
und Pulswerten,<br />
die ärztliche Aufklärung,<br />
Nicht <strong>der</strong> ärztlichen Dokumentationspflicht unterliegen:<br />
Rout<strong>in</strong>emaßnahmen (Des<strong>in</strong>fektion vor OP [OLG Hamburg, MDR 2002, 1315]), nebensächliche<br />
Sachverhalte (u.a. Weigerung Patient, e<strong>in</strong>en AIDS-Test zu machen),<br />
Bagatelleuntersuchungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Notfallambulanz,<br />
b. Die <strong>Pflege</strong>dokumentation muss enthalten<br />
Grundsätzlich umfasst die <strong>Pflege</strong>dokumentation den lückenlosen<br />
Nachweis aller Maßnahmen, die <strong>der</strong> unmittelbaren körperlichen <strong>Pflege</strong><br />
und Versorgung des Patienten dienen. Dazu zählen auch die<br />
menschlich-psychologische Betreuung sowie die damit verbundene Patientenbeobachtung<br />
und -überwachung.<br />
Medikation u. <strong>der</strong>en Wirkung, Fieber-, Puls-, Blutdruck- u. sonst. Kontrollen<br />
o<strong>der</strong> die Durchführung beson<strong>der</strong>er Hygienemaßnahmen (lückenlos !),<br />
beson<strong>der</strong>e <strong>Pflege</strong>bedürfnisse, Ermahnungen an die Patienten o<strong>der</strong><br />
ärztliche Anweisungen (Bettruhe, Diät),<br />
bes. Vorkommnisse (Sturz aus Bett und Gegenmaßnahmen [Bettgitter]),<br />
bei Fehlen konkreter ärztlicher Maßnahmen <strong>zur</strong> <strong>Pflege</strong> müssen im<br />
Krankenblatt dokumentiert se<strong>in</strong>: Medikation, Injektionen, Infusionen,<br />
Anlegen von Verbänden, mediz<strong>in</strong>ische Bä<strong>der</strong>, Bedarfsmedikation.<br />
2. Organisation und zeitliche Abfolge <strong>der</strong> Dokumentation<br />
Für die ärztliche Dokumentation ist <strong>der</strong> behandelnde Arzt zuständig. Die<br />
Organisation <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dokumentation obliegt <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dienstleitung<br />
nach Abstimmung mit dem ärztlichen Dienst.<br />
Beachte: Nach herrschen<strong>der</strong> Auffassung ist die <strong>Pflege</strong>dokumentation<br />
Teil <strong>der</strong> ärztlichen Dokumentationspflicht. Juristisch gesehen wird die<br />
Durchführungsverantwortung dieser Pflicht auf das <strong>Pflege</strong>personal delegiert<br />
u. <strong>in</strong> Form d. Grund- und Behandlungspflege ausgestaltet. Daß die<br />
<strong>Pflege</strong>dokumentation von <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dienstleitung organisiert wird, än<strong>der</strong>t<br />
also nichts an <strong>der</strong> grundsätzlichen Verantwortung des Arztes für e<strong>in</strong>e<br />
ordnungsgemäße Gesamtdokumentation.<br />
Bei Verstößen gegen die <strong>Pflege</strong>dokumentationspflicht kann sich <strong>der</strong> Arzt<br />
nur dadurch exkulpieren, dass er nachweist, daß die mit <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dokumentation<br />
betrauten Kräfte sorgfältig ausgewählt wurden.<br />
Daneben trifft auch den Krankenhausträger e<strong>in</strong>e Haftung, wenn er nicht<br />
nachweisen kann, daß die mit <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dokumentation<br />
betraute <strong>Pflege</strong>dienstleitung die Abläufe <strong>der</strong> Dokumentation nicht sorgfältig<br />
strukturiert und überwacht hat (bei Verstoß: Haftung wegen Organisationsverschulden).<br />
Die Dokumentation soll unmittelbar nach <strong>der</strong> Behandlung erfolgen, wobei<br />
e<strong>in</strong> kurzer handschriftlicher Vermerk ausreicht.<br />
Die Re<strong>in</strong>schrift muss jedoch spätestens aber <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Woche erfolgen.<br />
3. Folgen <strong>der</strong> Dokumentation bzw. <strong>der</strong> fehlerhaften o<strong>der</strong> unterbliebenen<br />
Dokumentation<br />
a. Folgen <strong>der</strong> Dokumentationspflicht<br />
Aus <strong>der</strong> Dokumentationspflicht resultiert die Notwendigkeit <strong>der</strong> Aufbewahrung<br />
von Patientendaten und Dokumentationen.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 117 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Wegen etwaiger Schadensersatzprozesse empfiehlt sich für den Arzt<br />
o<strong>der</strong> Krankenhausträger e<strong>in</strong>e Aufbewahrungszeit <strong>der</strong> Patientenunterlagen<br />
und Dokumentationen von 30 Jahren.<br />
Die Unterlagen s<strong>in</strong>d vertraulich zu behandeln<br />
b. Folgen <strong>der</strong> fehlerhaften Dokumentation<br />
E<strong>in</strong>e mangelhafte o<strong>der</strong> fehlende Dokumentation kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schadensersatzprozess<br />
gegen den Arzt o<strong>der</strong> das Krankenhaus wegen e<strong>in</strong>es<br />
ärztlichen o<strong>der</strong> pflegerischen Behandlungsfehlers entwe<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Beweiserleichterung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Beweislastumkehr <strong>zur</strong> Folge haben.<br />
Begründung: Es besteht die Vermutung, dass <strong>der</strong> Arzt/<strong>Pflege</strong>personal<br />
alle Maßnahmen, die nicht o<strong>der</strong> nicht h<strong>in</strong>reichend klar dokumentiert<br />
s<strong>in</strong>d, nicht getroffen wurden. Dies geht zu se<strong>in</strong>en Lasten.<br />
E<strong>in</strong>schub: Beweiserleichterungen und Beweislastumkehr<br />
wegen ärztlicher Behandlungsfehler<br />
Beweiserleichterung: Sie betrifft ärztliche Behandlungsfehler.<br />
Es wird bei Vorliegen bestimmter Tatsachen auf<br />
e<strong>in</strong>en Behandlungsfehler geschlossen, wobei letzte Details<br />
als vorliegend angenommen werden.<br />
Beweislastumkehr: Sie betrifft grobe Behandlungsfehler.<br />
Nicht <strong>der</strong> Patient muß beweisen, daß <strong>der</strong> Arzt e<strong>in</strong>en<br />
Behandlungsfehler begangen hat, son<strong>der</strong>n Arzt o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>person<br />
müssen beweisen, daß ihr Verhalten nicht ursächlich<br />
war für beim Patienten e<strong>in</strong>getretenen Schaden.<br />
Die Beweislastumkehr greift auch, wenn:<br />
Patient kann grob. <strong>Pflege</strong>fehler nachweisen (= pfleger. Verhalten<br />
obj. nicht nachvollziehbar = Fehler darf so nicht unterlaufen),<br />
<strong>der</strong> Patient vom Arzt unvollständig aufgeklärt wurde.<br />
c. Strafrechtliche Folgen <strong>der</strong> nachträglichen Verän<strong>der</strong>ung von Dokumentation<br />
und sonstigen E<strong>in</strong>tragungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte<br />
bei <strong>der</strong> Patientenakte handelt es sich um e<strong>in</strong>e Urkunde im strafrechtlichen<br />
S<strong>in</strong>ne,<br />
sobald e<strong>in</strong>e Dokumentation von <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>kraft (bzw. dem Arzt) beendet<br />
und <strong>der</strong> Vorgang abgeschlossen ist, dürfen die Dokumentation<br />
o<strong>der</strong> auch an<strong>der</strong>e E<strong>in</strong>träge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte nur dann verän<strong>der</strong>t<br />
werden, wenn die Än<strong>der</strong>ungen als solche kennzeichlich gemacht<br />
werden, <strong>in</strong>dem:<br />
<strong>der</strong> ursprüngliche Text durchgestrichen wird,<br />
<strong>der</strong> daneben gesetzte und ergänzte Text als solcher gekennzeichnet wird,<br />
die Än<strong>der</strong>ung datiert und paraphiert wird, so daß erkennbar wird,<br />
wer diese vorgenommen hat.<br />
an<strong>der</strong>nfalls handelt es sich um e<strong>in</strong>e strafbare Urkundenfälschung<br />
i.S.d. § 267 StGB,<br />
E<strong>in</strong>e strafbare Urkundenfälschung i.S.d. § 267 StGB liegt <strong>in</strong> jedem<br />
Falle vor, wenn jemand:<br />
e<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ung an den von ihm vorgenommenen Daten <strong>der</strong> Patientenakte<br />
vornimmt und nicht deutlich macht, daß es sich um e<strong>in</strong>e<br />
nachträgliche Än<strong>der</strong>ung handelt,<br />
Daten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Patientenakte verän<strong>der</strong>t, die nicht von ihm verfasst wurden<br />
und er nicht kenntlich macht, daß die Än<strong>der</strong>ungen von ihm s<strong>in</strong>d.<br />
4. Allgeme<strong>in</strong>e Checkliste Dokumentation<br />
Zusammenfassend kann man die wichtigsten praktischen Tips <strong>zur</strong> Durchführung<br />
e<strong>in</strong>er ordnungsgemäßen Dokumentation wir folgt zusammenfassen:
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 118 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Benutzen Sie pflegerische/mediz<strong>in</strong>ische Fachbegriffe, die alle kennen,<br />
Benutzen Sie dokumentenechte Kugelschreiber,<br />
Dokumentieren Sie pr<strong>in</strong>zipiell alles,<br />
Dokumentationsfehler werden mit e<strong>in</strong>em waagerechten Strich markiert,<br />
<strong>der</strong> alte Text muss dabei lesbar bleiben, Radierungen, Überklebungen und<br />
Tip-Ex s<strong>in</strong>d verboten,<br />
Lassen Sie mediz<strong>in</strong>ische Anordnungen vom Arzt e<strong>in</strong>tragen und abzeichnen,<br />
bei telefonischen Anordnungen ist die Unterschrift zeitnah nachzuholen,<br />
je<strong>der</strong> im <strong>Pflege</strong>- und Behandlungsteam trägt se<strong>in</strong>e eigene Dokumentation<br />
<strong>in</strong> die Patientenakte e<strong>in</strong>,<br />
Formulieren Sie kurz und knapp, stichwortartige Beschreibungen o<strong>der</strong><br />
Zeichnungen genügen, Abkürzungen s<strong>in</strong>d erlaubt, wenn sie verständlich<br />
bleiben,<br />
ke<strong>in</strong>e eigenen Wertungen o<strong>der</strong> Interpretationen dokumentieren, gleichwohl<br />
aber eigene Beobachtungen, ggf. mit Zitaten arbeiten,<br />
immer lückenlos und für an<strong>der</strong>e verständlich und logisch dokumentieren,<br />
paraphieren Sie Ihre eigenen Dokumentationen,<br />
dokumentieren Sie zeitnah<br />
5. Son<strong>der</strong>problem: E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> die Patientenakte zu Beweiszwecken<br />
a. Rechtliche Grundlagen des E<strong>in</strong>sichtnahmeanspruchs:<br />
Soweit <strong>der</strong> Patient o<strong>der</strong> se<strong>in</strong> Prozessvertreter e<strong>in</strong>e Schadensersatzklage<br />
vorbereiten, kommt es häufig dazu, dass <strong>der</strong> Wunsch geäußert wird,<br />
die Patientenakte e<strong>in</strong>zusehen.<br />
E<strong>in</strong>e Herausgabe <strong>der</strong> Patientenakten ist nicht möglich, da diese im Eigentum<br />
des Arztes stehen.<br />
Begründung: Mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme erhofft <strong>der</strong> Patient, die erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Informationen zu erhalten, mit denen er ggf.<br />
e<strong>in</strong>en Behandlungsfehler o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> sonstiges schuldhaftes<br />
und vertragswidriges Verhalten des Arztes o<strong>der</strong><br />
des <strong>Pflege</strong>personals leichter nachweisen zu können.<br />
Die E<strong>in</strong>sichtnahme dient also Beweissicherungszwecken.<br />
Je<strong>der</strong> Patient hat das Recht, die ihn betreffenden ärztlichen und pflegerischen<br />
Behandlungsunterlagen e<strong>in</strong>zusehen und auf se<strong>in</strong>e Kosten<br />
Kopien o<strong>der</strong> Ausdrucke von den Unterlagen fertigen zu lassen. Er muss<br />
se<strong>in</strong> rechtliches Interesse an <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme nicht begründen (vgl.<br />
MedR 2007, 663, zuletzt BGH, MedR 2010, 851 unter ausdrücklicher<br />
E<strong>in</strong>beziehung auch <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>akten).<br />
Merke:<br />
Auch nahe Angehörige haben nach dem Tod des Patienten e<strong>in</strong> Recht auf<br />
E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> dessen Akte, wenn dies dem mutmaßlichen Willen<br />
des Verstorbenen entspricht und wenn sie e<strong>in</strong>e Schadensersatzklage<br />
vorbereiten möchten (OlG München, MedR 2009, 49 f. [50]).<br />
Aber:<br />
Möchte h<strong>in</strong>gegen hat <strong>der</strong> Krankenversicherer bei Heimbewohnern (!)<br />
nach E<strong>in</strong>willigung des Patienten <strong>in</strong> die ärztlichen und pflegerischen Behandlungsunterlagen<br />
E<strong>in</strong>sicht nehmen, so kann er das bei den ärztlichen<br />
ohne Weiteres nach Vorlage <strong>der</strong> Patientene<strong>in</strong>willigung, bei den<br />
pflegerischen Unterlagen muss er e<strong>in</strong> konkretes rechtliches Interesse<br />
geltend machen, weil diese Akten beson<strong>der</strong>s höchstpersönliche Angaben<br />
über den Patienten enthalten, die <strong>in</strong> starker Weise se<strong>in</strong> Selbstbestimmungsrecht<br />
berühren (BGH, MedR 2010, 851)
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 119 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Rechtliche<br />
Verankerung:<br />
b. Ort <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme:<br />
Das Recht <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> die Behandlungsunterlagen<br />
bzw. Patientenakten ist Nebenpflicht des<br />
ärztlichen Behandlungsvertrages sowie des Krankenhausaufnahmevertrages.<br />
Es dient <strong>der</strong> Stärkung des Persönlichkeitsrechts des<br />
Patienten (Recht auf <strong>in</strong>formationelle Selbstbestimmung).<br />
Das E<strong>in</strong>sichtnahmerecht erfährt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rechtsprechung<br />
e<strong>in</strong>e zunehmende Gewichtung und Ausweitung<br />
zugunsten des Patienten (vgl. LG Bremen, MedR<br />
2009, 480 ff. mit H<strong>in</strong>weisen von Raschorn).<br />
Der Patient darf se<strong>in</strong>e Akte <strong>in</strong> den Räumlichkeiten des Arztes bzw.<br />
Krankenhauses e<strong>in</strong>sehen. An<strong>der</strong>e Örtlichkeiten als diese kommen nicht<br />
<strong>in</strong> Betracht.<br />
Jedoch ist für den Fall von Röntgenbil<strong>der</strong>n entschieden, dass <strong>der</strong> Patient<br />
e<strong>in</strong>en Anspruch auf Übersendung <strong>in</strong> die Kanzleiräume se<strong>in</strong>es Rechtsanwaltes<br />
hat. E<strong>in</strong>e Übersendung auf dem Postwege ist unproblematisch<br />
(LG Kiel, MedR 2007, 733 [734]).<br />
c. Umfang und E<strong>in</strong>schränkung des E<strong>in</strong>sichtnahmeanspruchs:<br />
Der Anspruch auf E<strong>in</strong>sichtnahme erstreckt sich auf alle objektiven Feststellungen<br />
über den Gesundheitszustand des Patienten, d.h.<br />
alle naturwissenschaftlich objektivierbaren physischen Befunde,<br />
Ergebnisse von Laboruntersuchungen sowie von Untersuchungen am<br />
Patienten wie EKG und Röntgenbil<strong>der</strong>,<br />
Aufzeichnungen über die Umstände und den Verlauf <strong>der</strong> Behandlung,<br />
wie Angaben über verabreichte o<strong>der</strong> verordnete Arzneimittel,<br />
Operationsberichte, Arztbriefe<br />
nicht aber erstreckt sich das E<strong>in</strong>sichtsrecht auf Aufzeichnungen, die<br />
subjektive E<strong>in</strong>schätzungen und E<strong>in</strong>drücke des Arztes betreffen o<strong>der</strong><br />
die im Rahmen e<strong>in</strong>er psychiatrischen Behandlung die Rechte an<strong>der</strong>er,<br />
<strong>in</strong> die Behandlung e<strong>in</strong>bezogenen Personen betreffen<br />
die Pflicht <strong>zur</strong> Gewährung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme kann aus therapeutischen<br />
Gründen e<strong>in</strong>geschränkt se<strong>in</strong>, um e<strong>in</strong>en gesundheitlichen Schaden<br />
beim Patienten zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n (BVerfG, MedR 1993, 232 ff.).<br />
Möglich ist jedoch, daß <strong>der</strong> Patient die Unterlagen im Beise<strong>in</strong> des Arztes<br />
e<strong>in</strong>sieht (sog. kontrollierte Beschäftigung mit <strong>der</strong> Krankheit),<br />
d. Eidesstattliche Versicherung <strong>der</strong> Richtigkeit o<strong>der</strong> Vollständigkeit<br />
von Patientenakten:<br />
Der Arzt ist über die Pflicht <strong>zur</strong> Gewährung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> die<br />
Patientenakte nicht verpflichtet, dem Patienten an Eides statt zu versichern,<br />
dass die dem Patienten zugänglich gemachten Kopien <strong>der</strong><br />
Behandlungsunterlagen diese vollständig abbilden (OLG München,<br />
MedR 2007, 47 [48]).<br />
Es ist auch ke<strong>in</strong>e Rechtsgrundlage für e<strong>in</strong> Verlangen des Patienten<br />
ersichtlich, <strong>der</strong> Arzt möge eidesstattlich versichern o<strong>der</strong> schriftlich<br />
bestätigen, dass die dem Patienten vorgelegten Orig<strong>in</strong>albehandlungsunterlagen<br />
authentisch und vollständig (OLG München,<br />
MedR 2007, 47 [48]) o<strong>der</strong> richtig (LG Düsseldorf, MedR 2007, 663<br />
[664]) s<strong>in</strong>d.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 120 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Son<strong>der</strong>problem: Die Haftung bei <strong>der</strong> Delegation ärztlicher Aufgaben<br />
A. Problemaufriss<br />
E<strong>in</strong> häufiges Problem ist die Haftung des <strong>Pflege</strong>personals für die fehlerhafte<br />
Ausführung delegierter ärztlicher Aufgaben wie <strong>in</strong>travenöse Injektionen<br />
1. Systematik<br />
<strong>der</strong> Aufgabendelegation:<br />
2. Rechtslage:<br />
Quelle: Bundesärztekammer<br />
.<br />
Arztvorbehalt<br />
höchstpersönliche<br />
Leistungen (nicht delegierbar)<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e:<br />
– Untersuchung,<br />
– Anästhesie,<br />
– Verschreibung von verschreibungspflichtigenArzneien<br />
– künstliche Befruchtung<br />
– Anamnese<br />
– Stellen v. Diagnose u. Befund<br />
– Aufklärung Patient und Beratung<br />
– Entscheidung über Therapie<br />
– Kernleistung operativer E<strong>in</strong>griffe<br />
an<strong>der</strong>e Ärzte<br />
Ausübung <strong>der</strong> Heilkunde<br />
zu begrenzt selbständigemHeilkundeausübenbefugte<br />
Fachberufe<br />
(z.B. Hebammen)<br />
delegierbare Leistungen<br />
z.B:<br />
– Durchführung technischer<br />
Untersuchungen,<br />
– Blutentnahmen/Infusionen,<br />
– Blasenkatheter,<br />
– Wundversorgung,<br />
– Abgabe von Medikamenten,<br />
– subkutane Injektion,<br />
– Anlegen e<strong>in</strong>facher Verbände<br />
Angehörige<br />
nichtärztlicher<br />
Fachberufe<br />
(qualifiziertes <strong>Pflege</strong>personal)<br />
angelernte<br />
Kräfte (<strong>Pflege</strong>helfer)<br />
E<strong>in</strong>e gesetzliche Rechtsgrundlage, welche die Delegation ärztlicher<br />
Aufgaben an das <strong>Pflege</strong>personal explizit regelt, besteht <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
überwiegenden Zahl <strong>der</strong> Fälle nicht.<br />
Folglich hängt es meist von <strong>der</strong> Rechtsprechung ab, ob die Delegation<br />
von ärztlichen Aufgaben im E<strong>in</strong>zelfall erlaubt ist o<strong>der</strong> nicht.<br />
Für die Delegation von Injektionen auf Angehörige des <strong>Pflege</strong>personals<br />
bedeutet dies:<br />
Grundsätzlich gilt, daß e<strong>in</strong> ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt,<br />
wenn e<strong>in</strong>e ärztliche Aufgabe - und dazu gehören <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
die <strong>in</strong>tramuskuläre und die subkutane Injektion - auf dafür nicht<br />
ausreichend ausgebildetes Hilfspersonal übertragen wird (OLG<br />
Köln, VersR 1988, 44 [45]).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 121 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
B. Delegation <strong>in</strong><br />
Son<strong>der</strong>situationen<br />
3. Voraussetzungen<br />
<strong>der</strong> Delegation:<br />
4. Folgen<br />
bei fehlerhafterDelegation:<br />
Delegation<br />
auf Krankenpflegeschüler<br />
?<br />
C. Rechtsfolgen 1. Haftungsgrundsätze:<br />
In <strong>der</strong> Rechtsprechung (vgl. LG Berl<strong>in</strong>, NJW-RR 1994, 801 f.) ist<br />
jedoch anerkannt, dass die Übertragung <strong>in</strong>tramuskulärer und subkutaner<br />
Injektionen auf das <strong>Pflege</strong>personal grundsätzlich zulässig<br />
ist, soweit folgende Voraussetzungen erfüllt s<strong>in</strong>d:<br />
bei <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Erkrankung und <strong>der</strong> Lokalisation <strong>der</strong> Spritze drohen<br />
ke<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>en Komplikationen,<br />
das <strong>Pflege</strong>personal wurde sorgfältig ausgewählt und hat se<strong>in</strong>e<br />
Qualifikation unter beson<strong>der</strong>er fachlicher Anleitung e<strong>in</strong>es Arztes<br />
erworben und aktualisiert,<br />
es hat zuvor bereits mehrfach unter kompetenter Überwachung<br />
<strong>der</strong>artige Injektionen gegeben, wovon sich <strong>der</strong> Arzt überzeugt<br />
hat,<br />
<strong>der</strong> Arzt hält sich während <strong>der</strong> Maßnahme <strong>in</strong> Rufweite auf,<br />
und <strong>der</strong> Patient <strong>in</strong> die Maßnahme e<strong>in</strong>gewilligt hat.<br />
Es wird bei <strong>der</strong> Delegation nicht zwischen Berufsgruppen wie <strong>Pflege</strong>kräften,<br />
Arzthelfern, technischen Assistenten etc. unterschieden.<br />
Erfüllt e<strong>in</strong> Krankenpfleger die vorstehenden Voraussetzungen<br />
nicht, wenn er e<strong>in</strong>en Patienten spritzt und kommt es wegen unsachgemäßer<br />
Behandlung zu Komplikationen, so muß <strong>der</strong> Arzt bzw. das<br />
Krankenhaus nachweisen, daß<br />
die fehlende Qualifikation nicht kausal für den Schaden war,<br />
und sich <strong>der</strong> Arzt <strong>in</strong> regelmäßigen Abständen durch Kontrollen von<br />
<strong>der</strong> fachgerechten Injektionstechnik se<strong>in</strong>er Mitarbeiter überzeugt hat.<br />
E<strong>in</strong> Son<strong>der</strong>problem ist die Frage, ob die Übertragung <strong>der</strong> Injektion auch<br />
auf Krankenpflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr zulässig ist ?<br />
die selbständige Erteilung von <strong>in</strong>tramuskulären, subkutanen Injektionen<br />
von Krankenpflegeschülern im ersten und zweiten<br />
Ausbildungsjahr ohne Anleitung und Überwachung ist unzulässig.<br />
Begründung: Das Geben e<strong>in</strong>er Injektion erfor<strong>der</strong>t mediz<strong>in</strong>ische<br />
Umfeldkenntnisse und -fertigkeiten. Diese werden erst mit dem<br />
Abschluß des <strong>Pflege</strong>examens abschließend erworben und nachgewiesen.<br />
Würde man die Injektion auch nicht exam<strong>in</strong>ierten<br />
Kräften gestatten, liefen die Vorschriften des KrPflG leer, weil<br />
man solche Aufgaben dann auch ohne jegliche Fachausbildung<br />
erledigen dürfte. Das KrPflG will aber genau dies verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.<br />
die Erteilung von Injektionen von Krankenpflegeschülern im letzten<br />
Ausbildungsjahr unter ärztlicher Anleitung und Überwachung ist<br />
h<strong>in</strong>gegen zulässig, wenn <strong>der</strong> Schüler nachweislich beson<strong>der</strong>s qualifiziert<br />
und über das Ausbildungsziel h<strong>in</strong>aus geübt ist.<br />
Bei <strong>der</strong> Übertragung ärztlicher Aufgaben s<strong>in</strong>d stets auch die Haftungsfragen<br />
zu beachten. Sie stellen sich, wenn e<strong>in</strong> Patient durch e<strong>in</strong>e<br />
fehlerhafte Injektion des <strong>Pflege</strong>personals e<strong>in</strong>en Schaden erleidet.<br />
Der Patient kann zunächst aus deliktischer Haftung nach § 823<br />
BGB gegen das <strong>Pflege</strong>personal vorgehen, das ihm die fehlerhafte<br />
Injektion erteilte, die dann auch zum Schaden geführt hat.<br />
Ebenso kann er gegen den diese Maßnahme anordnenden Arzt<br />
vorgehen. Der Arzt haftet dann wegen <strong>der</strong> Verletzung von Sorgfaltspflichten,<br />
die als Nebenpflichten aus dem Behandlungsvertrag<br />
folgen.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 122 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
2. Haftungsverteilung<br />
3. Son<strong>der</strong>fall:Spritzensche<strong>in</strong><br />
Schließlich kann er gegen das Krankenhaus vorgehen, wenn<br />
sich ergibt, daß das <strong>Pflege</strong>personal wegen organisatorischer Mängel<br />
auf Seiten <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>dienstleitung bei <strong>der</strong> Injektion dem Patienten<br />
e<strong>in</strong>en Schaden zugefügt hat (etwa: das <strong>Pflege</strong>personal kam<br />
von e<strong>in</strong>er beendeten Nachtschicht und wurde durch die <strong>Pflege</strong>dienstleitung<br />
angewiesen, e<strong>in</strong>em Patienten im übermüdeten Zustand<br />
e<strong>in</strong>e Spritze setzen, weil aufgrund von Dienstplanversäumnissen<br />
ke<strong>in</strong>e ausgeruhte Fachkraft <strong>zur</strong> Verfügung stand).<br />
Bei <strong>der</strong> Übertragung ärztlicher Aufgaben s<strong>in</strong>d stets auch die Haftungsfragen<br />
zu beachten. Sie stellen sich, wenn e<strong>in</strong> Patient durch e<strong>in</strong>e<br />
fehlerhafte Injektion des <strong>Pflege</strong>personals e<strong>in</strong>en Schaden erleidet.<br />
Den Arzt, <strong>der</strong> die ärztliche Aufgabe an das <strong>Pflege</strong>personal delegiert,<br />
trifft die sog. Anordnungsverantwortung.<br />
die Delegation muss NICHT schriftlich erfolgen, son<strong>der</strong>n<br />
kann mündlich erteilt werden; hierbei muss sie aber klar<br />
und e<strong>in</strong>deutig se<strong>in</strong> und die zu erbr<strong>in</strong>gende Leistung zulässig;<br />
außerdem ist die Delegation genau zu dokumentieren<br />
(Bergmann, MedR 2009, 7)<br />
dies umfasst die fehlerfreie Auswahl des <strong>Pflege</strong>personals<br />
sowie die Richtigkeit des Anordnungs<strong>in</strong>halts<br />
<strong>der</strong> Arzt muss - während die delegierte Aufgabe durchgeführt<br />
wird -, <strong>in</strong> Rufweite des Ausführenden bleiben (OLG Dresden,<br />
MedR 2009, 411 f.)<br />
bei telefonischen Anweisungen durch den diensthabenden<br />
Arzt an die Nachtschwester gelten erhöhte Anfor<strong>der</strong>ungen;<br />
so ist etwa die Anordnung e<strong>in</strong>er Bedarfsmedikation am Telefon<br />
unzulässig. In jedem Fall muß die telefonische Anweisung<br />
genau dokumentiert werden.<br />
Mit <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong> angeordneten ärztlichen Maßnahme unterliegt<br />
das <strong>Pflege</strong>personal <strong>der</strong> Übernahme- und Durchführungsverantwortung.<br />
dies ist die Verantwortung für die sachgerechte Ausführung<br />
<strong>der</strong> Anordnung.<br />
Überschätzt jedoch das die Aufgabe übernehmende <strong>Pflege</strong>personal<br />
se<strong>in</strong>e Fähigkeiten, so kommt es zum Übernahmeverschulden.<br />
Dieser Haftung kann man dadurch entgehen, daß<br />
man gegenüber dem Arzt darlegt, <strong>zur</strong> Durchführung <strong>der</strong> angewiesenen<br />
Tätigkeit subjektiv nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage zu se<strong>in</strong>. Bei e<strong>in</strong>er<br />
berechtigten Weigerung s<strong>in</strong>d arbeitsrechtliche Konsequenzen<br />
ausgeschlossen.<br />
H<strong>in</strong>weis:<br />
Der Patient muss i.d.R nicht darüber aufgeklärt werden, wenn<br />
e<strong>in</strong>e ärztliche Leistung delegiert wurde; er ist über die allgeme<strong>in</strong>en<br />
Haftungsregelungen (vor allem Sorgfaltspflicht) h<strong>in</strong>reichend<br />
geschützt (Bergmann, MedR 2009, 8).<br />
Häufig versuchen Ärzte und Krankenhäuser, durch die Erteilung<br />
sog. Spritzensche<strong>in</strong>e die Aufgabenbereiche des <strong>Pflege</strong>personals<br />
pauschal zu erweitern („...bei uns dürfen dies exam<strong>in</strong>ierte Kräfte<br />
mit drei Berufsjahren Erfahrung...“) und dadurch die Haftung wegen<br />
<strong>der</strong> Delegation ärztlicher Aufgaben auf den Arzt bzw. das<br />
Krankenhaus zu übertragen.<br />
Dies ist rechtlich problematisch, weil es bei <strong>der</strong> Übertragung<br />
ärztlicher Aufgaben immer auf die Qualifikation im E<strong>in</strong>zelfall<br />
ankommt.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 123 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Folge:<br />
E<strong>in</strong> formularmäßig erteilter Spritzensche<strong>in</strong> ist daher unwirksam,<br />
wenn sich <strong>der</strong> Arzt nicht zuvor geson<strong>der</strong>t von den Kenntnissen,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>person überzeugt<br />
hat (arg. ex. VGH Kassel, NJW 2000, 2760 [2761]).<br />
Dies geschieht dadurch, daß <strong>der</strong> Arzt zusätzlich zum Spritzensche<strong>in</strong>:<br />
auf qualifizierte Arbeitszeugnisse <strong>zur</strong>ückgreift,<br />
zu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit dem betreffenden Mitarbeiter<br />
e<strong>in</strong>en Test durchführt, um sich so e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die praktischen und theoretischen Kenntnisse <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>person<br />
verschaffen<br />
S<strong>in</strong>d dem Arzt Unerfahrenheit, Unsicherheit o<strong>der</strong> Unzuverlässigkeit<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>person bekannt, liegt e<strong>in</strong>e fehlerhafte<br />
Ausübung se<strong>in</strong>es Auswahlermessens vor, wenn er die E<strong>in</strong>griffsdurchführung<br />
gleichwohl überträgt.<br />
Unterschreitet <strong>der</strong> nichtärztliche Mitarbeiter e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Qualifikationslevel, verbietet sich grundsätzlich die Übertragung<br />
(z. B. die Betrauung <strong>der</strong> Krankenpflegehelfer<strong>in</strong> mit<br />
<strong>der</strong> Verabfolgung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tramuskulären Spritze [Hahn, NJW<br />
1981, 1977 {1983 f.}).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 124 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Der rechtliche Zyklus des Arbeitslebens<br />
II. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.16:<br />
Arbeitsrechtliche Grundlagen<br />
- Zeitdauer: 8 Std. -<br />
„Arbeitsleben“<br />
Stellenaus- Vorstellungs- Arbeitsver- Beendi-<br />
schreibung gespräch trag (AV) gung AV<br />
I. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong><br />
das Arbeitsvertragsrecht<br />
Das Arbeitsverhältnis zwischen Krankenschwester und Krankenhaus setzt den Abschluß<br />
des Arbeitsvertrages voraus. Dieser ist i.d.R. e<strong>in</strong> Dienstvertrag gem. § 611<br />
BGB. Bei Vertragsschluss können die Parteien se<strong>in</strong>en Inhalt selbst bestimmen und<br />
aushandeln (Vertragsfreiheit). Die Vertragsfreiheit ist im Arbeitsrecht jedoch durch<br />
zahlreiche Arbeitsschutzbestimmungen, gesetzliche Regelungen, Tarifverträge<br />
und Betriebsvere<strong>in</strong>barungen, betriebliche Übungen und das Direktionsrecht zugunsten<br />
des Arbeitnehmers sowie durch die Anwendung <strong>der</strong> AGB-Kontrolle bei standardisierten<br />
Arbeitsverträgen e<strong>in</strong>geschränkt.<br />
1. Bewerbungs-<br />
und<br />
E<strong>in</strong>stellungsverfahren(Diskrim<strong>in</strong>ierungsverbot)<br />
Bereits im Vorfeld des Abschlusses e<strong>in</strong>es Arbeitsvertrages kann<br />
es zu arbeitsrechtlichen Implikationen kommen - und zwar dann,<br />
wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber e<strong>in</strong>en potentiellen Bewerber etwa durch Formulierungen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Stellenausschreibung, durch das Führen des<br />
Vorstellungsgesprächs o<strong>der</strong> aber auch durch die E<strong>in</strong>stellungsentscheidung<br />
selbst diskrim<strong>in</strong>iert und damit gegen die Bestimmungen<br />
des Allgeme<strong>in</strong>en Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verstößt.<br />
a. Stellenausschreibung<br />
Die Stellenausschreibung, mit denen etwa e<strong>in</strong> Krankenhaus<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Pflege</strong>kraft sucht, darf ke<strong>in</strong>e diskrim<strong>in</strong>ierenden Formulierungen<br />
o<strong>der</strong> sonstige Tatbestände enthalten. An<strong>der</strong>nfalls<br />
kann es von e<strong>in</strong>em Bewerber, <strong>der</strong> nicht e<strong>in</strong>gestellt wurde,<br />
auf Schadensersatz verklagt werden.<br />
Es s<strong>in</strong>d daher alle Formulierungen zu vermeiden, die Indizien<br />
für e<strong>in</strong>e Diskrim<strong>in</strong>ierung schaffen. Als solche gelten z.B.:<br />
beim Schalten <strong>der</strong> Anzeige:<br />
- ausschließlich im Internet (= diskrim<strong>in</strong>iert ältere Bewerber),<br />
- ausschließlich <strong>in</strong> Frauenzeitschriften (diskrim<strong>in</strong>iert<br />
Männer),<br />
- ausschließlich <strong>in</strong> Fachzeitschriften für Krankenpflegepersonal<br />
(Tageszeitung sollte zusätzlich genommen werden),<br />
bei <strong>der</strong> Eigendarstellung des Arbeitgebers <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stellenanzeige:
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 125 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
- Formulierungen wie „junges, aufstrebendes Team“ (=<br />
mittelbar altersdiskrim<strong>in</strong>ierend),<br />
- Fotos, bei denen nur Männer o<strong>der</strong> Frauen bzw. nur jüngere<br />
o<strong>der</strong> nur ältere Personen abgebildet s<strong>in</strong>d,<br />
bei Darstellung <strong>der</strong> ausgeschriebenen Tätigkeit selbst:<br />
- immer geschlechtsneutral (also für bei<strong>der</strong>lei Geschlecht)<br />
formulieren,<br />
- ke<strong>in</strong>e Alters(ober)grenzen für die Stelle benennen,<br />
bei <strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung, Bewerbungsunterlagen zu übersenden:<br />
- e<strong>in</strong> Lichtbild e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>n (= nährt den Verdacht, daß unzulässige<br />
Motive e<strong>in</strong> Rolle spielen könnten),<br />
- Angaben zum Alter (Achtung: Ausnahmen <strong>in</strong> engen<br />
Grenzen zulässig), Geburts- o<strong>der</strong> Wohnort (= Diskrim<strong>in</strong>ierung<br />
von Pendlern) zu verlangen,<br />
- e<strong>in</strong>e Frist <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>sendung <strong>der</strong> Bewerbungsunterlagen<br />
zu benennen (= Diskrim<strong>in</strong>ierung bei Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung wegen<br />
Krankheit o<strong>der</strong> Urlaub)<br />
- idealerweise sollte daher die Formulierung verwendet<br />
werden: „Ihre ausführlichen/aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen<br />
senden Sie bitte an ...“.<br />
b. Bewerbungs- und E<strong>in</strong>stellungsverfahren<br />
Nach Schaltung <strong>der</strong> Anzeige und Durchführung <strong>der</strong> Vorauswahl<br />
<strong>der</strong> Bewerber werden die Kandidaten zum Vorstellungsgespräch<br />
geladen, damit <strong>der</strong> Arbeitgeber diese<br />
näher kennen lernen kann. Regelmäßig werden Fragen gestellt.<br />
Auch diese müssen den Vorgaben des AGG entsprechen.<br />
Hierbei besteht die Beson<strong>der</strong>heit, daß <strong>der</strong> Bewerber<br />
unzulässige Fragen nicht beantworten muss. Lügt er bei<br />
e<strong>in</strong>er unzulässigen Frage, so dürfen ihm hieraus ke<strong>in</strong>e<br />
Nachteile entstehen.<br />
Zulässig s<strong>in</strong>d Fragen nach:<br />
beruflichem Werdegang (Leistungen, Zeugnisse),<br />
Krankheiten, die E<strong>in</strong>fluß auf die Arbeitsleistung haben<br />
können (akute Aidserkrankung, die Infektion nur bei <strong>in</strong>fektionsgefährdenen<br />
Tätigkeiten (etwa Chirurg, Krankenschwester),<br />
Religions-/Parteizugehörigkeit, e<strong>in</strong>getragene Lebenspartnerschaft<br />
und nichteheliche Lebensgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber e<strong>in</strong> Tendenzbetrieb ist,<br />
Vorstrafen, wenn die Stellenbesetzung (Kassierer) dies erfor<strong>der</strong>t,<br />
Unzulässig s<strong>in</strong>d Fragen nach:<br />
Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung,<br />
Gewerkschaftszugehörigkeit o<strong>der</strong> Heirat,<br />
Religionszugehörigkeit, wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber ke<strong>in</strong> Tendenzbetrieb<br />
ist,<br />
Schwangerschaft, wenn allgeme<strong>in</strong> danach gefragt wird<br />
und die Schwangerschaft die Ausübung des Berufes nicht<br />
dauerhaft bee<strong>in</strong>trächtigt; auch dann, wenn im betreffenden<br />
Krankenpflegebereich etwa aus Gründen des Mutterschutzes<br />
für Schwangere e<strong>in</strong> Beschäftigungsverbot besteht.<br />
Begründung: das schwangerschaftsbed<strong>in</strong>gte Beschäftigungsh<strong>in</strong><strong>der</strong>nis<br />
ist nur vorübergehen<strong>der</strong> Natur und führt<br />
nicht zu e<strong>in</strong>er dauerhaften Störung des Vertragsverhältnisses,<br />
BAG, Urt. v. 6.2.2003, Az. 2 AZR 621/01 (e<strong>in</strong>e deswegen<br />
verweigerte E<strong>in</strong>stellung verstößt gegen das <strong>in</strong> § 611a BGB geregelte<br />
geschlechtsbezogene Diskrim<strong>in</strong>ierungsverbot), also:<br />
ke<strong>in</strong>e Anfechtung wg. arglistiger Täuschung nach § 123 BGB,<br />
es besteht „Recht <strong>zur</strong> Lüge“,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 126 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
alle sonstigen Fragen, die <strong>in</strong> die Intim- o<strong>der</strong> Privatsphäre<br />
des Arbeitnehmers e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen und die für die<br />
Erbr<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> Arbeitsleistung ohne Relevanz s<strong>in</strong>d,<br />
den Rauchgewohnheiten des Mitarbeiters. Rauchen ist<br />
e<strong>in</strong> gesundheitsgefährdendes Hobby, das den Arbeitgeber<br />
nichts angeht (= auch hier Recht <strong>zur</strong> Lüge). Allerd<strong>in</strong>gs darf<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber auf e<strong>in</strong> allg. Rauchverbot h<strong>in</strong>weisen.<br />
c. E<strong>in</strong>stellungsentscheidung<br />
Grundsätzlich ist <strong>der</strong> Arbeitgeber frei zu entscheiden, welchen<br />
Bewerber als Arbeitnehmer e<strong>in</strong>stellt. Das AGG sanktioniert<br />
lediglich die Ablehnung von Bewerbern, wenn diese<br />
e<strong>in</strong> Diskrim<strong>in</strong>ierungsmerkmal erfüllt.<br />
Als Beweis für e<strong>in</strong>e diskrim<strong>in</strong>ierungsfreie Ablehnung kann<br />
das Anfor<strong>der</strong>ungsprofil aus <strong>der</strong> Stellenbeschreibung herangezogen<br />
werden:<br />
- alle Bewerber, die nicht <strong>in</strong> das Profil passen, können<br />
von vorne here<strong>in</strong> abgelehnt werden,<br />
- die an<strong>der</strong>en, die nach dem Vorstellungsgespräch für ungeeignet<br />
befunden werden (ggf. auch weil ihre Ablehnung<br />
auf e<strong>in</strong>e Maßnahmediskrim<strong>in</strong>ierung o<strong>der</strong> Legalausnahme<br />
gestützt werden kann), können nach re<strong>in</strong> sachlichen Kriterien<br />
abgelehnt werden,<br />
- H<strong>in</strong>weis: Es sollte auf e<strong>in</strong>e geson<strong>der</strong>te Begründung<br />
<strong>der</strong> Ablehnung verzichtet werden. Das Ablehnungsschreiben<br />
sollte wie folgt formuliert werden:<br />
„... vielen Dank für Ihre Bewerbung und Ihr dadurch<br />
zum Ausdruck gebrachte Interesse an unserem Unternehmen.<br />
Wir müssen Ihnen lei<strong>der</strong> mitteilen, dass wir<br />
uns zwischenzeitlich an<strong>der</strong>weitig entschieden haben.<br />
Anliegend überreichen wir Ihre Bewerbungsunterlagen<br />
zu unserer Entlastung mit Dank <strong>zur</strong>ück.“<br />
d. Diskrim<strong>in</strong>ierungsausnahmen:<br />
Nicht jede Benachteiligung - sei es im Bewerbungsverfahren<br />
o<strong>der</strong> auch während <strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit selbst - ist auch<br />
e<strong>in</strong>e verbotene Diskrim<strong>in</strong>ierung. Das AGG lässt <strong>in</strong>soweit<br />
Ausnahmen zu.<br />
E<strong>in</strong>e gezielte unterschiedliche Behandlung (sog. „Maßnahmediskrim<strong>in</strong>ierung“)<br />
von Bewerbern ist zulässig, wenn:<br />
dadurch bestehende Nachteile für e<strong>in</strong>e Personengruppe<br />
verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t o<strong>der</strong> ausgeglichen werden sollen (z.B. vermehrtes<br />
E<strong>in</strong>stellen von Frauen, um e<strong>in</strong>e Unterrepräsentierung<br />
im Betrieb abzubauen und e<strong>in</strong>e ausgewogene Personalstruktur<br />
zu erreichen)<br />
die benachteiligende Maßnahme nach §§ 8-10, 20 AGG<br />
gerechtfertigt ist (Legalausnahme).<br />
Die Legalausnahmen <strong>der</strong> §§ 8-10, 20 AGG im E<strong>in</strong>zelnen:<br />
aa. Tätigkeitsbezogene „Diskrim<strong>in</strong>ierung“ (§ 8 AGG)<br />
E<strong>in</strong>e benachteiligende Diskrim<strong>in</strong>ierung (z.B. Alter o<strong>der</strong><br />
Geschlecht) ist zulässig, wenn:<br />
- die Art <strong>der</strong> auszuübenden Tätigkeit o<strong>der</strong><br />
- die Bed<strong>in</strong>gungen ihrer Ausübung<br />
e<strong>in</strong>e wesentliche und entscheidende berufliche Anfor<strong>der</strong>ung<br />
darstellt.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 127 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Beispiele:<br />
- Frauenzeitschrift sucht weibliche Redakteur<strong>in</strong>,<br />
- Zeitschrift für Schwule sucht homosexuellen Redakteur,<br />
Aber:<br />
Die Erwartungshaltung <strong>der</strong> Kunden h<strong>in</strong>sichtlich bei<br />
berufsbezogenen Tätigkeiten ke<strong>in</strong>e Rolle (BAG, NJW<br />
1990, 67), so dass es weiterh<strong>in</strong> unzulässig ist, ausschließlich<br />
weibliche Sekretariatskräfte o<strong>der</strong> männliche<br />
Kfz-Mechaniker zu suchen.<br />
bb. sog. „Kirchenklausel“ (§ 9 AGG)<br />
Hiernach ist es den als korporierte Körperschaften anerkannten<br />
Kirchen und Religionsgeme<strong>in</strong>schaften<br />
unter H<strong>in</strong>weis auf <strong>der</strong>en Selbstbestimmungsrecht erlaubt,<br />
Benachteiligungen vorzunehmen, wenn diese<br />
aus <strong>der</strong>en Innenrecht folgen und die Art <strong>der</strong> Tätigkeit<br />
dies erfor<strong>der</strong>t.<br />
Beispiele:<br />
Ist die Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er Religionsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
nach <strong>in</strong>nerkirchlichen Bestimmungen nicht wesentliche<br />
Voraussetzung für die Tätigkeit, so darf beispielsweise<br />
vom Re<strong>in</strong>igungspersonal nicht verlangt<br />
werden, Mitglied <strong>der</strong> Religionsgeme<strong>in</strong>schaft zu se<strong>in</strong><br />
(dagegen vom Chefarzt e<strong>in</strong>es katholischen Krankenhauses<br />
schon).<br />
In NRW untersagt § 57 Abs. 4 SchulG NW Lehrkörpern,<br />
religiöse Bekundungen abzugeben. Dies bedeutet,<br />
dass Lehrer we<strong>der</strong> e<strong>in</strong> islamisches Kopftuch, noch<br />
ähnliche Bekleidungen, die dem nahe kommen, tragen<br />
dürfen. Entsprechende Abmahnungen s<strong>in</strong>d rechtmäßig<br />
(ArbG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.06.2007 - 12<br />
Ca 175/07).<br />
cc. Unterschiedliche Behandlungen wegen des Alters<br />
(§ 10 AGG)<br />
Der § 10 AGG gestattet e<strong>in</strong>e unterschiedliche Behandlung<br />
von Bewerbern und Arbeitnehmern, wenn<br />
diese objektiv und angemessen sowie durch e<strong>in</strong> legitimes<br />
Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel müssen allerd<strong>in</strong>gs<br />
<strong>zur</strong> Erreichung dieses Ziels angemessen und erfor<strong>der</strong>lich<br />
se<strong>in</strong>. Also solche gelten:<br />
- Berufszulassungsregeln (z.B. Ausbildung, Studium),<br />
- Beschäftigungs- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen,<br />
- Bed<strong>in</strong>gungen für Entlohnung und Beendigung<br />
von Beschäftigungsverhältnissen,<br />
- berufliche E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsmaßnahmen für Jugendliche<br />
und Ältere bzw. „Bedürftige“ (z.B. Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te),<br />
- M<strong>in</strong>destanfor<strong>der</strong>ungen an Alter, Berufserfahrung<br />
und Dienstalter im H<strong>in</strong>blick auf Zugang zu<br />
dieser Tätigkeit (z.B. Berufserfahrung bei Stellenausschreibung<br />
für Geschäftsführer) o<strong>der</strong> mit <strong>der</strong><br />
Tätigkeit verbundene Vorteile (z.B. Bonus bei<br />
Erreichen von Umsatzzielen)<br />
- Festsetzung von Höchstaltersgrenzen für die E<strong>in</strong>stellung<br />
(z.B. Höchstaltersgrenze für E<strong>in</strong>stellung<br />
als Beamter),
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 128 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
2. SchadensersatzwegenDiskrim<strong>in</strong>ierung<br />
im Bewerbungs-<br />
und<br />
E<strong>in</strong>stellungsverfahren<br />
- Festlegung von Altersgrenzen für Leistungen aus<br />
sozialen Sicherungssystemen,<br />
- Vere<strong>in</strong>barungen für Vorruhestandsregelungen,<br />
- Vere<strong>in</strong>barungen für altersgestaffelte Abf<strong>in</strong>dungen<br />
bei Entlassungen.<br />
dd. Weitere Differenzierungskriterien (§ 20 AGG)<br />
Die Vorschrift des § 20 AGG präzisiert die Kriterien<br />
für e<strong>in</strong>e unterschiedliche Behandlung wegen <strong>der</strong> Religion,<br />
des Alters, <strong>der</strong> sexuellen Identität o<strong>der</strong> des Geschlechts.<br />
Diese s<strong>in</strong>d u.a. zulässig, wenn<br />
- dadurch Gefahren o<strong>der</strong> Schäden vermieden bzw.<br />
verhütet werden o<strong>der</strong> das Interesse nach Schutz <strong>der</strong><br />
Intimsphäre bzw. <strong>der</strong> persönlichen Sicherheit befriedigt<br />
werden,<br />
- versicherungsmathematische und statistische Daten<br />
e<strong>in</strong>e Risikobewertung zulassen, die zu e<strong>in</strong>er unterschiedlichen<br />
Kalkulation führen.<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Arbeitnehmervergütung:<br />
Unterschiedliche Vergütung gleichrangiger Mitarbeiter:<br />
Soweit <strong>der</strong> Arbeitgeber die Vergütung se<strong>in</strong>er Mitarbeiter<br />
nicht nach e<strong>in</strong>em festen Tarifsystem vergibt, ist e<strong>in</strong> differenziertes<br />
Vergütungssystem, bei dem auch Zulagen, Tantiemen,<br />
Ergebnisbeteiligungen, etc. zulässig, wenn es Gründe<br />
für e<strong>in</strong>e jeweils unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern<br />
gibt. Die pr<strong>in</strong>zipiell zulässigen Unterschiede bei <strong>der</strong><br />
Vergütung außertariflicher Angestellter („Grundsatz <strong>der</strong> Vertragsfreiheit“)<br />
dürfen aber ausschließlich leistungsbed<strong>in</strong>gt<br />
se<strong>in</strong>. Es empfiehlt sich daher, Unterschiede bei den Tätigkeiten<br />
zu dokumentieren.<br />
Ist e<strong>in</strong> Bewerber unter Verstoß gegen das Diskrim<strong>in</strong>ierungsverbot<br />
abgelehnt worden, so kann er Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche<br />
gegen den Arbeitgeber geltend machen. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus kann er sich auch an die Beschwerdestelle beim Arbeitgeber<br />
bzw. beim Bund wenden.<br />
Beachte:<br />
E<strong>in</strong> Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot begründet ke<strong>in</strong>en<br />
Anspruch des Betroffenen auf Begründung e<strong>in</strong>es Beschäftigungsverhältnisses<br />
bzw. des beruflichen Aufstiegs.<br />
a. Schadensersatz nach § 15 I AGG<br />
Anspruchs<strong>in</strong>haber ist <strong>der</strong>jenige Bewerber, <strong>der</strong> ohne die<br />
Benachteiligung e<strong>in</strong>gestellt worden wäre bzw. e<strong>in</strong>en beruflichen<br />
Vorteil erlangt hätte.<br />
Anspruchsvoraussetzung ist eigenes Verschulden des Arbeitgebers.<br />
Haftungsmaßstab ist § 276 BGB: Vorsatz und<br />
grobe Fahrlässigkeit. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit,<br />
sich nach § 15 I 2 AGG zu exculpieren.<br />
Anspruchsziel ist e<strong>in</strong> (fiktiver) Verdienstausfall, welcher<br />
<strong>der</strong> Höhe nach über die Differenzhypothese bemessen wird.<br />
Anspruchsobergrenze ist <strong>der</strong> frühestmögliche Zeitpunkt ei-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 129 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
II. Arbeitsvertrag<br />
und arbeitsvertraglicheBeson<strong>der</strong>heiten <br />
Arbeitsverhältnis <br />
M<strong>in</strong>dest<strong>in</strong>haltArbeitsvertrag <br />
Auswirkungen<br />
des<br />
AGG auf<br />
die Arbeits-<br />
ner hypothetischen Kündigung durch den Arbeitgeber. Den<br />
Diskrim<strong>in</strong>ierten trifft e<strong>in</strong>e Pflicht <strong>zur</strong> Schadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
(§ 254 II BGB): er ist mith<strong>in</strong> gehalten, e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e zumutbare<br />
Beschäftigung aufzunehmen und dadurch den (fiktiven)<br />
Kündigungszeitpunkt nach vorne zu verschieben.<br />
Die Geltendmachung des Anspruchs hat gegenüber dem<br />
Arbeitgeber und <strong>in</strong>nerhalb von zwei Monaten nach Zugang<br />
<strong>der</strong> Ablehnung <strong>der</strong> Bewerbung bzw. <strong>in</strong> allen sonstigen Fällen<br />
<strong>der</strong> Benachteiligung mit Erlangung <strong>der</strong> Kenntnisnahme<br />
von <strong>der</strong> Benachteiligung zu erfolgen.<br />
Die Frist kann durch Tarifvertrag verlängert werden.<br />
Zurechnung von Fremdverschulden gem. § 278 BGB, wenn<br />
sich <strong>der</strong> Arbeitgeber e<strong>in</strong>er Agentur („Headhunter“) bedient.<br />
b. Entschädigung nach § 15 II AGG<br />
Anspruchs<strong>in</strong>haber ist <strong>der</strong>jenige Bewerber, <strong>der</strong> ohne die<br />
Benachteiligung e<strong>in</strong>gestellt worden wäre bzw. e<strong>in</strong>en beruflichen<br />
Vorteil erlangt hätte.<br />
Der Anspruch ist zwar verschuldensunabhängig, jedoch<br />
gelangen die Grundsätze <strong>der</strong> „Sphärenhaftung“ <strong>zur</strong> Anwendung.<br />
Danach haftet <strong>der</strong> Arbeitgeber für jegliches Verhalten<br />
se<strong>in</strong>er Mitarbeiter am Arbeitsplatz bzw. für die von ihm<br />
veranlassten Dienstreisen/Außendiensttätigkeiten (z.B. <strong>in</strong>dem<br />
e<strong>in</strong> Mitarbeiter pflichtwidrig die E<strong>in</strong>stellung e<strong>in</strong>es<br />
neuen Kollegen „verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t“). Für außerdienstliche Benachteiligungen<br />
haftet er h<strong>in</strong>gegen nicht.<br />
Die Anspruchshöhe ist bei e<strong>in</strong>er Nichte<strong>in</strong>stellung begrenzt<br />
auf drei Monatsgehälter.<br />
Das Arbeitsverhältnis wird nicht erst durch die tatsächliche E<strong>in</strong>stellung<br />
des Arbeitnehmers, son<strong>der</strong>n bereits durch den Abschluß<br />
des Arbeitsvertrages begründet (Vertragstheorie).<br />
E<strong>in</strong> Arbeitsvertrag enthält als <strong>in</strong>haltliche M<strong>in</strong>destanfor<strong>der</strong>ungen:<br />
Name und Anschrift <strong>der</strong> Vertragsparteien,<br />
Zeitpunkt des Beg<strong>in</strong>ns und <strong>der</strong> Dauer des Arbeitsverhältnisses,<br />
<strong>der</strong> Arbeitsort,<br />
Bezeichnung <strong>der</strong> vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,<br />
Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgeltes <strong>in</strong>cl. Zuschläge,<br />
vere<strong>in</strong>barte Arbeitszeit,<br />
Dauer des jährlichen Erholungsurlaubes,<br />
Kündigungsfristen,<br />
H<strong>in</strong>weis auf Tarifverträge, Betriebs- o<strong>der</strong> Dienstvere<strong>in</strong>barungen.<br />
Die umfangreichen Diskrim<strong>in</strong>ierungsverbote des AGG wirken sich<br />
auch auf die Gestaltung von Arbeitsverträgen aus. Im E<strong>in</strong>zelnen<br />
s<strong>in</strong>d folgende vertragliche Regelungen problematisch (Auswahl):
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 130 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
vertragsgestaltung <br />
Betriebliche<br />
Übung<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz<br />
Altersabhängige Vergütung: Vielfach sehen Verträge vor, dass<br />
Löhne und Entgelte <strong>in</strong> Abhängigkeit zum Lebensalter gestaffelt<br />
s<strong>in</strong>d („wer mehr Lebenserfahrung hat, bekommt mehr“). Dies ist<br />
altersdiskrim<strong>in</strong>ierend i.S.v. § 10 AGG. Besser ist e<strong>in</strong>e Regelung,<br />
die nach Berufserfahrung o<strong>der</strong> auch Betriebszugehörigkeit des<br />
Arbeitnehmers differenziert,<br />
Verbot <strong>der</strong> geschlechtsspezifischen Diskrim<strong>in</strong>ierung: Das Verbot<br />
<strong>der</strong> Geschlechterdiskrim<strong>in</strong>ierung ist im deutschen Recht seit<br />
Langem verankert und <strong>in</strong> den arbeitsvertraglichen Klauseln meist<br />
schon berücksichtigt. Sie erfahren durch das AGG ke<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ungen.<br />
Rasse und ethnische Herkunft: Maßgeblich wird bei diesen<br />
Klauseln darauf abgestellt, dass Angehörige <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe über<br />
ausreichende Deutschkenntnisse verfügen und dies <strong>in</strong> Sprachtests<br />
nachgewiesen haben. Dies ist zulässig, wenn gute Deutschkenntnisse<br />
für die berufliche Tätigkeit als <strong>Pflege</strong>r etc. unablässig s<strong>in</strong>d.<br />
(Insoweit s<strong>in</strong>d mangelnde Deutschkenntnisse e<strong>in</strong>es britischen<br />
Staatsbürgers ke<strong>in</strong>e Diskrim<strong>in</strong>ierung i.S.d. AGG, wenn diese<br />
vom Stellenprofil gefor<strong>der</strong>t s<strong>in</strong>d, weil Sprachkenntnisse nicht<br />
<strong>der</strong> Ethnie zu<strong>zur</strong>echnen s<strong>in</strong>d und daher ke<strong>in</strong>e Benachteiligung<br />
wegen <strong>der</strong> ethnischen Herkunft darstellen).<br />
Bekleidungsvorschriften und Gebetspausen: Soweit die Arbeitsstätte<br />
nicht <strong>in</strong> den Zuordnungsbereich e<strong>in</strong>es kirchlichen Tendenzbetriebes<br />
fällt (hier gibt es Ausnahmevorschriften des AGG)<br />
kann etwa das Verbot des Tragens e<strong>in</strong>es Kopftuches diskrim<strong>in</strong>ierend<br />
se<strong>in</strong> dann, wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber das Verbot alle<strong>in</strong>e (!) auf<br />
die Befürchtung stützt, die Bekleidung könnte abschreckend auf<br />
Kunden wirken. Es sollte daher auf solche arbeitsvertraglichen<br />
Bekleidungsverbote verzichtet werden.<br />
Bei Gebetspausen sollte <strong>der</strong> Arbeitgeber auf diese Belange des<br />
Arbeitnehmers Rücksicht nehmen. Dieser darf im E<strong>in</strong>zelfall nach<br />
Rücksprache mit dem Vorgesetzten den Arbeitsplatz kurzfristig<br />
<strong>zur</strong> Abhaltung von Gebeten verlassen. Soweit die Pausen zu erheblichen<br />
betrieblichen Störungen führen (OP, Intensivbetreuung<br />
von Patienten), kann e<strong>in</strong> ausdrückliches Verbot von Gebetspausen<br />
arbeitsvertraglich vere<strong>in</strong>bart werden.<br />
Der Inhalt des Arbeitsvertrages kann durch e<strong>in</strong> hiervon abweichendes<br />
Verhalten <strong>der</strong> Parteien modifiziert, bzw. erweitert werden.<br />
Und zwar durch die betriebliche Übung. Hierunter versteht man<br />
e<strong>in</strong> Verhalten, das aufgrund ständiger Übung - also durch praktische<br />
Gewohnheiten und Bräuche - Ansprüche des Arbeitnehmers<br />
auf freiwillige Leistungen (Weihnachtsgeld, Gratifikationen<br />
bei Urlaub, Geschäfts-/Dienstjubiläum) des Arbeitgebers entstehen<br />
lassen kann (sog. schuldrechtlicher Verpflichtungstatbestand, <strong>der</strong><br />
durch Vertrag [BAG, NZA 2000, 49/50] geschaffen wird).<br />
Voraussetzungen: Der Arbeitgeber wie<strong>der</strong>holt se<strong>in</strong> freiwilliges<br />
Verhalten m<strong>in</strong>destens dreimal h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ohne Vorbehalt.<br />
Ke<strong>in</strong>e betriebliche Übung: Arbeitgeber trifft mit Son<strong>der</strong>leistung<br />
erkennbar nur e<strong>in</strong>e auf das jeweilige Jahr bezogene Entscheidung,<br />
Folge: Son<strong>der</strong>leistung ist Bestandteil des Arbeitsvertrages,<br />
Beendigung <strong>der</strong> Übung: Dies geht nicht unter H<strong>in</strong>weis auf die<br />
schlechte Geschäftsentwicklung, son<strong>der</strong>n nur durch: Aufhebungsvertrag,<br />
Än<strong>der</strong>ungskündigung o<strong>der</strong> - wie<strong>der</strong>um - betriebliche<br />
Übung (= 3x h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ohne Vorbehalt ke<strong>in</strong> Zahlung Weihnachtsgeld<br />
und ohne daß Arbeitnehmer sich dagegen wehren).<br />
Inhalt:<br />
er verpflichtet den Arbeitgeber, alle Arbeitnehmer gleich zu<br />
behandeln, d.h., Differenzierungen nur aus sachlichen Gründen<br />
vorzunehmen und nicht willkürlich,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 131 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Direktionsrecht<br />
(im<br />
Allgeme<strong>in</strong>en) <br />
Direktionsrecht<br />
(im<br />
Beson<strong>der</strong>en) <br />
Direktionsrecht(E<strong>in</strong>schränkungen)<br />
<strong>der</strong> Gleichbehandlungsgrundsatz ist anwendbar bei allen Maßnahmen,<br />
die <strong>der</strong> e<strong>in</strong>seitigen Gestaltungsmacht des Arbeitgebers<br />
unterliegen (= Versorgungszulagen, Leistungszulagen, allg.<br />
Zulagen, sonstige soziale (Zusatz-)leistungen,<br />
nicht dagegen bei <strong>in</strong>dividuell ausgehandelten Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen,<br />
Die Gleichbehandlung gilt auch nicht bei E<strong>in</strong>stellungen und<br />
Lohnvere<strong>in</strong>barungen, wenn <strong>der</strong> Lohn <strong>in</strong>dividuell vere<strong>in</strong>bart ist.<br />
Wird bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung die Tätigkeit als Krankenschwester nur fachlich<br />
umschrieben, kann ihr <strong>der</strong> Arbeitgeber (Vorgesetzte) aufgrund<br />
des ihm zustehenden Direktionsrechts jede Tätigkeit zuweisen, die<br />
sich <strong>in</strong>nerhalb des Berufsbildes „Krankenschwester“ bewegt.<br />
Rechtsgrundlage: § 106 GewO,<br />
Inhalt: Die Direktionsbefugnis des Arbeitgebers ist das Recht,<br />
die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers nach Zeit, Art und Ort zu<br />
konkretisieren und diesem bestimmte Aufgaben zuzuweisen.<br />
Folge: Der Arbeitgeber kann anordnen, was zu tun ist und wie<br />
es zu tun ist. Aber er darf ke<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gwertigere Arbeit außerhalb<br />
des arbeitsvertraglichen Berufsfeldes zuweisen.<br />
Das Direktionsrecht (Weisungsrecht) des Arbeitgebers ist e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>seitiges<br />
Leistungsbestimmungsrecht. Die Vorschrift lautet:<br />
§ 106 GewO Weisungsrecht des Arbeitgebers<br />
1 Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit <strong>der</strong> Arbeitsleistung nach billigem<br />
Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen nicht<br />
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen e<strong>in</strong>er Betriebsvere<strong>in</strong>barung, e<strong>in</strong>es<br />
anwendbaren Tarifvertrages o<strong>der</strong> gesetzliche Vorschriften festgelegt<br />
s<strong>in</strong>d. 2 Dies gilt auch h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Ordnung und des Verhaltens <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
im Betrieb. 3 Bei <strong>der</strong> Ausübung des Ermessens hat <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
auch auf Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.<br />
Die Ausgestaltung <strong>der</strong> Arbeitspflichten h<strong>in</strong>sichtlich Ort, Zeit<br />
(Arbeitgeber kann Anzahl Nachtschichten festlegen !) und Inhalt<br />
<strong>der</strong> Arbeitsleistung obliegt grundsätzlich den Arbeitsvertragsparteien;<br />
<strong>in</strong>nerhalb dieses Rahmens kann <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
über die Aufgabenverteilung im konkreten Fall entscheiden<br />
(ggf. ist Umsetzung und Versetzung möglich).<br />
Dabei ist er allerd<strong>in</strong>gs an die Grundsätze des billigen Ermessens<br />
gebunden, § 106 GewO. Arbeitgeber muß dies beweisen.<br />
Aber: Soweit die Parteien detaillierte Regelungen über Ort, Zeit und den konkreten<br />
Inhalt <strong>der</strong> Leistungspflicht getroffen haben, ist die Zuteilung <strong>der</strong> arbeitsvertraglichen<br />
Leistungspflichten lediglich <strong>der</strong> Vollzug dieser vertraglichen Vere<strong>in</strong>barung,<br />
ohne dass die Bezugnahme auf e<strong>in</strong> billiges Ermessen erfor<strong>der</strong>lich ist.<br />
H<strong>in</strong>gegen gilt nach § 106 S. 3 GewO, daß - wegen <strong>der</strong> nicht abschließenden<br />
Bezugnahme auf Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen (§ 2 I SGB IX) des<br />
Arbeitnehmers - i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB den Arbeitgeber bei<br />
<strong>der</strong> Ausübung des Weisungsrechts beson<strong>der</strong>e Rücksichtnahmepflichten<br />
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Arbeitnehmers<br />
treffen (= auch Rücksichtnahme auf beson<strong>der</strong>e Umstände).<br />
Das Direktionsrecht kann gerichtlich überprüft werden.<br />
Die Vergütungs- u. Arbeitspflicht unterliegen nicht dem DirektionsR.<br />
Se<strong>in</strong>e Grenzen f<strong>in</strong>det das Direktionsrecht <strong>in</strong> den Vorschriften <strong>der</strong><br />
Gesetze, des Kollektiv- und E<strong>in</strong>zelarbeitsvertragsrechts.<br />
E<strong>in</strong>schränkungen des Direktionsrechts ergeben sich z.B.:<br />
zum e<strong>in</strong>en dadurch, daß die E<strong>in</strong>zelheiten <strong>der</strong> Beschäftigung<br />
des Arbeitnehmers, <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satzort, Umfang und Lage <strong>der</strong> Arbeitszeit<br />
im Arbeits-/Tarifvertrag festgeschrieben s<strong>in</strong>d,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 132 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Fall zum<br />
Direktionsrecht<br />
durch gebotene Rücksichtnahme auf familiäre Pflichten (§ 8<br />
TzBfG und §§ 15 V ff. BErzGG),<br />
durch Rücksichtnahme auf die Gewissensfreiheit,<br />
durch e<strong>in</strong>getretene Konkretisierung, wenn sich das ursprünglich<br />
verän<strong>der</strong>ungsoffene Arbeitsverhältnis durch mehrjährige<br />
praktische Übung und das H<strong>in</strong>zutreten weiterer Umstände o<strong>der</strong><br />
Erklärungen auf bestimmte Inhalte verengt (= Zustandekommen<br />
e<strong>in</strong>er schlüssigen, konkludenten Vertragsän<strong>der</strong>ung), so dass e<strong>in</strong>e<br />
nicht e<strong>in</strong>vernehmliche Umsetzung nur noch durch Än<strong>der</strong>ungsvertrag<br />
o<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungskündigung zu bewirken ist.<br />
Denn Folge ist dann e<strong>in</strong> Anspruch <strong>der</strong> Krankenschwester auf<br />
die konkretisierte Tätigkeit (LAG Hessen, Az. 5 SaGa 1623/02)<br />
Beispiel: Bei mehrjähriger Beschäftigung am selben Arbeitsplatz und zu bestimmten<br />
Arbeitszeiten kann die Konkretisierung <strong>der</strong> Arbeitspflicht dar<strong>in</strong> liegen,<br />
daß <strong>der</strong> Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorbehaltlos über längere Zeit e<strong>in</strong>e bestimmte<br />
Tätigkeit o<strong>der</strong> Arbeitszeit zuweist, so daß <strong>der</strong> Arbeitnehmer <strong>in</strong> diesem<br />
Fall aus dem fehlenden Vorbehalt darauf schließen und darauf vertrauen darf,<br />
auch künftig nur für die ihm über längere Zeit vorbehaltlos zugewiesene Tätigkeit<br />
o<strong>der</strong> Arbeitszeit e<strong>in</strong>gesetzt zu werden (vgl. Hunold, NZA-RR 2001, S. 340),<br />
viele Fälle des Weisungsrechts s<strong>in</strong>d mitbestimmungspflichtig,<br />
nicht aber: Weisungen zum Arbeitsverhalten (§ 87 I 1 BetrVG).<br />
ABER: In Notfällen, <strong>zur</strong> Schadensabwehr, kann kurzfristig und<br />
auch gegen den Willen des Arbeitnehmers umgesetzt werden<br />
Wegen personeller Engpässe werden <strong>Pflege</strong>helfer von <strong>der</strong> Stationsleitung<br />
zum Nachtdienst e<strong>in</strong>geteilt. Krankenpflegehelfer<br />
Gustav Gerne ist dazu nicht bereit, weil dies im Arbeitsvertrag<br />
nicht geregelt ist, wie er zutreffend ausführt. (Beispiel nach Hell,<br />
Alles Wissenswerte über Staat, Bürger, Recht, 3. Aufl. 2000, S. 317).<br />
Lösung:<br />
Die Weisung <strong>der</strong> Stationsleitung ist rechtswirksam, wenn die Durchführung<br />
des Nachtdienstes zu den Aufgaben des Krankenpflegehelfers gehört.<br />
Hier hilft e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> das Krankenpflegegesetz weiter.<br />
§ 4 Abs. 2 regelt: Die Ausbildung für Krankenpflegehelfer<strong>in</strong>nen und Krankenpflegehelfer<br />
soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Versorgung <strong>der</strong><br />
Kranken, sowie die damit verbundenen hauswirtschaftlichen und sonstigen Assistenzaufgaben<br />
<strong>in</strong> Stations-, Funktion und sonstigen Bereichen des Gesundheitswesens<br />
vermitteln (Ausbildungsziel).<br />
Daraus folgt, daß <strong>der</strong> Krankenpflegehelfer nur Assistenzaufgaben<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Grundpflege zu leisten hat. Im Nachtdienst stehen aber die<br />
Behandlungspflege und die Krankenbeobachtung im Vor<strong>der</strong>grund,<br />
die zum Aufgabengebiet <strong>der</strong> Krankenpflege gehören (§ 3 Abs. 2<br />
Nr. 1, 2, 3 KrPflG) so daß die Weisung nicht rechtswirksam ist.<br />
Ausnahme: Im Arbeitsvertrag ist geregelt, daß Krankenpflegehelfer <strong>in</strong><br />
Ausnahmefällen zum Nachtdienst herangezogen werden können.<br />
Umgekehrt gilt:<br />
Es ist unzulässig, wegen Personalmangels e<strong>in</strong>en Intensivpfleger<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Küche aushelfen zu lassen, wenn ke<strong>in</strong> Notfall besteht.<br />
Unzulässig ist auch, e<strong>in</strong>e OP-Schwester anzuweisen, e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>travenöse<br />
Injektion zu geben, wenn sie sich das nicht zutraut.<br />
Es ist unzulässig, die Schwester anzuweisen assistenzärztliche<br />
Aufgaben zu übernehmen, wenn ke<strong>in</strong> Notfall vorliegt.<br />
Dies wi<strong>der</strong>spricht dem Berufsbild und ist meist im AV nicht geregelt.<br />
Zulässig ist aber, daß Krankenschwestern den Dienst gegenseitig<br />
tauschen, wenn die <strong>Pflege</strong>dienstleitung damit e<strong>in</strong>verstanden ist. Es<br />
besteht Erlaubnispflicht, weil die Schwester nämlich ihre Arbeitsleistung<br />
entgegen Arbeitsvertrag nicht höchstpersönlich erbr<strong>in</strong>gt.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 133 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
III. Wesentliche<br />
arbeitsvertragliche<br />
Pflichten<br />
IV. Verletzung<br />
arbeitsvertraglicher<br />
Pflichten<br />
Pflichten<br />
aus Arbeitsvertrag<br />
1. Arten <strong>der</strong><br />
Pflichtverletzung<br />
2. Nichtleistung<br />
Der Arbeitsvertrag verpflichtet beide Parteien <strong>zur</strong> Erfüllung ihrer<br />
jeweiligen Pflichten.<br />
1. Hauptpflichten des Arbeitnehmers (Krankenschwester)<br />
Erbr<strong>in</strong>gung se<strong>in</strong>er Arbeitsleistung,<br />
höchstpersönlich (Problem: Diensttausch bei Schichten),<br />
gemäß Stellenbeschreibung Arbeitsvertrag,<br />
Ausnahme: im Notfall auch berufsfremde Tätigkeit erbr<strong>in</strong>gen,<br />
Umfang: Höchstzeit gemäß ArbzV und gem. Tarifvertrag,<br />
Verweigerung Arbeitsleistung löst SE-Ansprüche des Arbeitgebers<br />
aus, weil Arbeitsleistung e<strong>in</strong>klagbar, aber nicht vollstreckbar.<br />
2. Hauptpflichten des Arbeitgebers (Krankenhaus)<br />
Vergütungspflicht (Lohnzahlung),<br />
ggf. auch im Krankheitsfall („Lohn ohne Arbeit“),<br />
Fürsorgepflicht (Gefahrenabwehr, Entwicklung Persönlichkeit),<br />
Arbeitnehmer zu beschäftigen, ihm angemessene Arbeit zu geben,<br />
Arbeitnehmer Urlaub zu gewähren,<br />
3. Nebenpflichten des Arbeitnehmers (Krankenschwester)<br />
Treue-, Gehorsams-, Schweigepflicht.<br />
Bei <strong>der</strong> Erbr<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> arbeitsvertraglichen Hauptpflicht des<br />
<strong>Pflege</strong>personals, <strong>der</strong> Arbeitsleistung, kommt es immer wie<strong>der</strong> zu<br />
vertragswidrigen Abweichungen. Geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d hiermit die Fälle<br />
<strong>der</strong> Verletzung von Arbeitspflichten.<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal kann se<strong>in</strong>e hauptsächlichen Arbeitspflichten<br />
dadurch verletzen, dass es die ihm zugewiesene Arbeit:<br />
überhaupt nicht leistet,<br />
verspätet leistet,<br />
mangelhaft erfüllt (sog. Schlechtleistung).<br />
Die Pflicht <strong>zur</strong> Ableistung <strong>der</strong> Arbeit ist höchstpersönlich (§ 613<br />
BGB) und sie darf nicht durch e<strong>in</strong>e Ersatzperson erfüllt werden, die<br />
für den ursprünglich vorgesehenen Arbeitnehmer e<strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gt und ihn<br />
vertritt. Die wichtigsten Fälle <strong>der</strong> Nichtleistung s<strong>in</strong>d:<br />
a. Nichtleistung wegen Schichttausch<br />
E<strong>in</strong>e Stationsschwester, die <strong>zur</strong> Nachtschicht e<strong>in</strong>geteilt ist,<br />
kann nicht ohne Weiteres mit e<strong>in</strong>er Kolleg<strong>in</strong>, die <strong>zur</strong> Spätschicht<br />
e<strong>in</strong>geteilt ist, die Schicht tauschen.<br />
Begründung: Die Höchstpersönlichkeit <strong>der</strong> Arbeitsleistung<br />
impliziert die Pflicht, diese <strong>zur</strong> e<strong>in</strong>geteilten<br />
Zeit zu erbr<strong>in</strong>gen.<br />
Folge: Gegen o<strong>der</strong> ohne den Willen des Arbeitgebers kann<br />
das <strong>Pflege</strong>personal die Schicht nicht tauschen.<br />
Auch <strong>der</strong> H<strong>in</strong>weis, daß e<strong>in</strong> Ersatz „da“ war, greift<br />
nicht. Es besteht <strong>in</strong> diesen Fällen ke<strong>in</strong> Lohnanspruch<br />
<strong>der</strong> tauschenden <strong>Pflege</strong>kräfte (eventuell bestehen<br />
aber Bereicherungsansprüche <strong>der</strong> gearbeitet<br />
habenden <strong>Pflege</strong>kraft).<br />
Ausnahme: Der Arbeitgeber (i.e. die <strong>Pflege</strong>dienstleitung)<br />
ist mit dem Diensttausch e<strong>in</strong>verstanden.<br />
b. Nichtleistung wegen Krankheit o<strong>der</strong> Urlaub<br />
Die Pflicht <strong>zur</strong> höchstpersönlichen Erbr<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> Arbeits-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 134 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
3. Spätleistung<br />
4. Schlechtleistung<br />
leistung entfällt gemäß <strong>der</strong> Regelungen im Lohnfortzahlungsgesetz<br />
und dem Bundesurlaubsgesetz bei Krankheit<br />
und im Urlaub. In diesen Fällen hat <strong>der</strong> Arbeitnehmer die<br />
Nichtleistung nicht zu vertreten, d.h., nicht schuldhaft und<br />
<strong>in</strong> vorwerfbarer Weise herbeigeführt. Es bleibt folglich<br />
auch <strong>der</strong> Lohnanspruch <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>kraft bestehen. Achtung:<br />
Bei häuf. Kurzerkrank. auch schon Vorlage Attest am ersten Tag zulässig.<br />
c. Nichtleistung wegen berechtigter Arbeitsverweigerung<br />
E<strong>in</strong> weiterer Fall <strong>der</strong> Nichtleistung ist <strong>der</strong> aufgrund berechtigter<br />
Arbeitsverweigerung. Damit ist die unzulässige Delegation<br />
ärztlicher Aufgaben an das <strong>Pflege</strong>personal geme<strong>in</strong>t.<br />
Hiervon erfaßt ist die Situation, wonach das <strong>Pflege</strong>personal<br />
e<strong>in</strong>em Patienten aufgrund ärztlicher Anordnung e<strong>in</strong>e<br />
Injektion geben soll, ohne zuvor jemals dar<strong>in</strong> ausgebildet<br />
worden zu se<strong>in</strong>. Wenn das <strong>Pflege</strong>personal den Arzt hierauf<br />
aufmerksam gemacht hat und dieser trotzdem die Anweisung<br />
erteilt, darf die Injektion nicht vorgenommen werden. Da es<br />
sich erkennbar um e<strong>in</strong>en Fall <strong>der</strong> Nichtvertretbarkeit handelt,<br />
bleibt <strong>der</strong> Anspruch auf Lohn erhalten.<br />
Der Fall <strong>der</strong> Spätleistung ist das nicht pünktliche Ersche<strong>in</strong>en am<br />
Arbeitsplatz.<br />
„Zuspätkommen“<br />
Wer aus Unachtsamkeit o<strong>der</strong> Nachlässigkeit o<strong>der</strong> wegen e<strong>in</strong>es<br />
Unfalls auf dem Weg <strong>zur</strong> Arbeit zu spät kommt, hat<br />
die Nichtleistung zu vertreten und damit se<strong>in</strong>en Anspruch<br />
auf Lohn verwirkt (bei Unfällen gilt, daß <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
das sog. Wegerisiko trägt und deshalb bei Unfällen zu Arbeit<br />
währenddessen auf se<strong>in</strong>en Lohn verzichten muß).<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal erbr<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e Schlechtleistung, wenn es für<br />
se<strong>in</strong>e Verhältnisse zu langsam o<strong>der</strong> zu flüchtig arbeitet und ihm<br />
das Arbeitsergebnis nicht gel<strong>in</strong>gt.<br />
a. Mangelndes Arbeitsergebnis<br />
Bei Fehlleistungen - e<strong>in</strong> Patient fällt beim Umbetten auf<br />
den Boden - ist zu prüfen, ob das <strong>Pflege</strong>personal diesen<br />
Fehler zu vertreten hat (= Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit).<br />
Ist dies <strong>der</strong> Fall, entfällt <strong>der</strong> Lohnanspruch für die<br />
Dauer <strong>der</strong> Zeit, <strong>in</strong> welchem die fehlerhafte Leistung erbracht<br />
wurde. Bei ständigen Fehlleistungen steht dem Arbeitgeber<br />
überdies e<strong>in</strong> Recht <strong>zur</strong> Kündigung zu.<br />
b. Haftungsgrundsätze bei betrieblich veranlaßter Arbeit<br />
In <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>praxis hat sich <strong>in</strong>des herausgestellt, daß sich Fehler<br />
und daraus resultierende arbeitsbed<strong>in</strong>gte Schäden nie ganz<br />
vermeiden lassen. Dies passiert selbst den sorgfältigsten Arbeitnehmern.<br />
Weil kle<strong>in</strong>e Fehler des <strong>Pflege</strong>personals große<br />
Schäden verursachen können, die <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Verhältnis<br />
zum Arbeitslohn stehen (und daher auch vom Arbeitnehmer<br />
nicht ohne Weiteres kompensiert werden können), hat die<br />
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eigene Grundsätze<br />
entwickelt, wie das Haftungsrisiko gerecht zwischen Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmer verteilt werden kann.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 135 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
V. Die Kündigung<br />
des Arbeitsverhältnisses<br />
bei ordentlicherKündigung<br />
Vorsatz<br />
Verursacht das <strong>Pflege</strong>personal vorsätzlich e<strong>in</strong>en<br />
Schaden, haftet es voll und une<strong>in</strong>geschränkt.<br />
Grobe Fahrlässigkeit<br />
Handelt das <strong>Pflege</strong>personal grob fahrlässig, haftet es<br />
grundsätzlich unbeschränkt (= nicht immer) für<br />
den entstandenen Schaden.<br />
Ausnahme: Der Verdienst steht <strong>in</strong> deutlichem Mißverhältnis<br />
zum Schadensrisiko <strong>der</strong> Arbeit (= ke<strong>in</strong>e<br />
angemessene Bezahlung bei hochriskanter Tätigkeit).<br />
Mittlere/Leichte Fahrlässigkeit<br />
In diesen fällen teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer<br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelfallumstände<br />
die Schadensbegleichung.<br />
Leichteste Fahrlässigkeit<br />
In diesem Fall haftet das <strong>Pflege</strong>personal nicht.<br />
Gegen die ordentliche Kündigung durch das Krankenhaus kann sich das betroffene<br />
<strong>Pflege</strong>personal mit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage wehren.<br />
Obersatz: „Die Kündigungsschutzklage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist“.<br />
1. Zulässigkeit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage<br />
a. Zuständigkeit des Arbeitsgerichts<br />
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 b ArbGG sachlich; § 46 II ArbGG i.V.m. §§ 13-37 ZPO örtlich,<br />
Entscheidungsform gem. § 2 Abs. 5, 46 Abs. 1, 8 Abs. 1 ArbGG: Urteil,<br />
b. Klageart und Klage<strong>in</strong>teresse<br />
Feststellungsklage gem. § 256 ZPO,<br />
Feststellungs<strong>in</strong>teresse: (+), weil Klage e<strong>in</strong>zige Möglichkeit, die nach §§ 4, 7, 13<br />
I KSchG drohende Heilung <strong>der</strong> Sozialwidrigkeit zu beseitigen,<br />
c. Klagefrist (= 3 Wochen, § 13 I 2, 4 S. 1, 5 KSchG, auch wenn KSchG unanwendbar;<br />
wenn Kündigung nicht schriftlich bekannt gegeben, kann Klage auch nach Ablauf <strong>der</strong> Dreiwochenfrist<br />
erhoben werden, weil die Kündigung wegen § 125 BGB nichtig ist [Richardi, BB 2004, 486 {489}])<br />
2. Begründetheit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage<br />
Die Klage ist begründet, wenn die Kündigung sozial nicht gerechtfertigt ist.<br />
a. Wirksames Arbeitsverhältnis, das gekündigt wurde<br />
Arbeitsvertrag bestand im Zeitpunkt Kündigung,<br />
Vorliegen schriftlicher ordnungsgemäßer Kündigungserklärung sowie<br />
Kündigungsbegründung, daß und weshalb fristgemäß gekündigt wurde<br />
(Textform [Email] reicht nicht aus [§ 623 BGB]).<br />
c. Wirksamkeit <strong>der</strong> Kündigung<br />
ke<strong>in</strong> Ausschluß Kündigung durch Arbeitsvertrag, Mutterschutzgesetz (§ 9),<br />
Tarifvertrag od. Betriebsvere<strong>in</strong>barung, Betriebsratszugehörigkeit<br />
ke<strong>in</strong>e Nichtigkeit nach § 134, 138, 242 BGB,<br />
ordnungsgem. Anhörung Betriebsrat, § 102 BetrVG (sonst Künd. unwirksam; man<br />
kann vere<strong>in</strong>baren, daß Wi<strong>der</strong>spruch d. Betriebsrates gegen Kündigung diese zunächst nicht<br />
wirksam werden läßt u. dann von <strong>der</strong> Schiedsstelle entschieden wird; im Regelfall hat Wi<strong>der</strong>-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 136 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
spruch ke<strong>in</strong>e Rechtswirkung, Arbeitnehmer erhält aber Abschrift des Wi<strong>der</strong>spruchs),<br />
d. E<strong>in</strong>greifen des Kündigungsschutzes nach KSchG<br />
KSchG anwendbar: § 23 I 2, 1 I KSchG (m<strong>in</strong>d. 6 Arbeitnehmer beschäftigt, Arbverhältnis<br />
besteht länger als 6 Monate ununterbrochen; ist Arbverhältnis nach dem<br />
31.12.2003 e<strong>in</strong>gegangen, ist KSchG für diesen betreffenden Arbeitnehmer erst anwendbar,<br />
wenn er m<strong>in</strong>d. <strong>der</strong> 11 beschäftigte Arbeitnehmer ist [teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer<br />
mit e<strong>in</strong>er regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20<br />
Stunden zählen mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75]), diese Regelung gilt<br />
NICHT für bereits angestellte Mitarbeiter <strong>in</strong> Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten.<br />
E<strong>in</strong>haltung Klagefrist 3 Wochen (§ 4 S. 1, 5 I KSchG), Versäumung Frist heilt<br />
alle Unwirksamkeitsgründe mit Ausnahme <strong>der</strong> Schriftform !, Klagefrist gilt auch<br />
für Kle<strong>in</strong>betriebe; und auch <strong>in</strong> den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses,<br />
Merke: 3 Wochenfrist gilt bei ordentlicher und außerordentlicher Kündigung,<br />
(ordentliche) Kündigung muß sozial gerechtfertigt se<strong>in</strong>:<br />
personenbed<strong>in</strong>gte Kündigung:<br />
langanhaltende Krankheit, bei <strong>der</strong> Ende nicht absehbar ist (neg. Prognose) und die<br />
wg. Ungewißheit erhebliche und unzumutbare Bee<strong>in</strong>trächtigungen betrieblicher<br />
Interessen (Kosten wg. Überbrückung, Planungsprobleme !) verursacht,<br />
häufige Kurzerkrankungen, die betriebl. Interessen unzumutbar be<strong>in</strong>trächtigen (n.P.),<br />
krankheitsbed<strong>in</strong>gte M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung Leistungsfähigkeit, die quantitativ und qualitativ<br />
erheblich ist, u. betriebl. Interessen unzumutbar bee<strong>in</strong>trächtigt (+ neg. Prognose),<br />
immer: Abwägung Interessen Betrieb gegen Arbeitnehmer vornehmen !<br />
verhaltensbed<strong>in</strong>gte Kündigung:<br />
Fälle: schwere Pflichtverletzungen (Pünktlichkeit); Störung Vertrauensbereich; Verletzung<br />
arbvertragl. Nebenpflicht; außerdienstl. Verhalten belastet Arbverhältnis,<br />
verschuldet und wie<strong>der</strong>holt,<br />
erfolglose Abmahnung, die zwecklos geblieben ist,<br />
betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung:<br />
außerbetriebliche Faktoren (Auftragsrückgang, Rohstoffmangel),<br />
<strong>in</strong>nerbetriebliche Faktoren (Stillegung, Rationalisierung als Unternehmerentscheidung),<br />
Faktoren machen Weiterbeschäftigung Krankenschwester (ArbN) unmöglich<br />
Verhältnismäßigkeit (Weiterbeschäftigung unzumutbar, ultima ratio, Int.abwägng),<br />
hier wird - wenn es sich um e<strong>in</strong>e betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung hält - die sog. Umsetzung<br />
des Mitarbeiter geprüft: Der Arbeitgeber muß dem Arbeitnehmer dabei jeden (!)<br />
freien Arbeitsplatz anbieten, auch e<strong>in</strong>en solchen, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Qualifizierung erfor<strong>der</strong>t,<br />
als die bisherige Stelle (Ausnahme: Personalchef soll Pförtner werden); <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
muß dem Arbeitnehmer dazu e<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ungskündigung aussprechen; <strong>der</strong><br />
Arbeitnehmer muß dann wählen und entscheiden, ob er e<strong>in</strong>e Weiterbeschäftigung unter<br />
den verän<strong>der</strong>ten Bed<strong>in</strong>gunen für zumutbar hält o<strong>der</strong> nicht (dann muß er aber im Zweifel<br />
gehen) (BAG, Urt. v. 21.04.2005, Az. 2 AZR 244/04)<br />
Sozialauswahl (nur betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung !): nur Entlassung v. Arbeitnehmer,<br />
<strong>der</strong> am wenigsten auf Arbeitsplatz angewiesen ist; Kriterien (abschließend):<br />
Lebensalter, Dauer Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten, Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
(§ 1 II, III KSchG); Kriterien haben gleiches Gewicht; weitere soziale Kriterien (alle<strong>in</strong><br />
erziehen<strong>der</strong> Elternteil, <strong>Pflege</strong> v. Angehörigen) s<strong>in</strong>d nur noch bei vor dem 31.12.2003 geschlossenen<br />
Arbeitsverträgen zu berücksichtigen (Ba<strong>der</strong>, NZA 2004, 65 [66]);<br />
Ausnahme: e<strong>in</strong> Arbeitnehmer wurde wegen se<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>en Kenntnisse, Fähigkeiten,<br />
Leistungen o<strong>der</strong> <strong>zur</strong> Sicherung e<strong>in</strong>er ausgewogenen Personalstruktur des Betriebs<br />
(sog. Leistungsträgerklausel) aus <strong>der</strong> sozialen Auswahl ausgenommen, weil<br />
se<strong>in</strong>e Weiterbeschäftigung im betrieblichen Interesse liegt,<br />
Grundkündigungsfrist (vier Wochen, § 622 Abs. 1 BGB) e<strong>in</strong>gehalten<br />
e. Beifügen <strong>der</strong> Stellungnahme des Betriebsrates<br />
Hat <strong>der</strong> Arbeitnehmer gegen die betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung E<strong>in</strong>spruch beim Betriebsrat<br />
e<strong>in</strong>gelegt, soll er dessen Stellungnahme <strong>der</strong> Klage anbei fügen (§§ 3,4 KSchG),<br />
f. ke<strong>in</strong> gesetzlicher Abf<strong>in</strong>dungsanspruch bei Kündigungsschutzklage<br />
hat <strong>der</strong> Arbeitnehmer gegen die ordentliche Kündigung die Kündigungsschutzklage erhoben,<br />
steht ihm nach § 1a KSchG ke<strong>in</strong> gesetzlicher Anspruch auf Abf<strong>in</strong>dung i.H.v.<br />
0,5 Monatsgehältern (brutto) für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses zu,<br />
trotzdem verbleibt Möglichkeit e<strong>in</strong>er gerichtlich verfügten Abf<strong>in</strong>dung,<br />
wenn Richter Kündigung für unwirksam erklärt (dazu vgl. unten Punkt VI.)
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 137 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
VI. Die Kündigung<br />
des Arbeitsverhältnis- <br />
Gegen die außerordentliche Kündigung durch das Krankenhaus kann sich<br />
das betroffene <strong>Pflege</strong>personal mit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage wehren.<br />
Obersatz: „Die Kündigungsschutzklage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist“.<br />
ses bei außeror-<br />
dentlicher Kün-<br />
digung 1. Zulässigkeit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage<br />
a. Zuständigkeit des Arbeitsgerichts<br />
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 b ArbGG sachlich; § 46 II ArbGG i.V.m. §§ 13-37 ZPO örtlich,<br />
Entscheidungsform gem. § 2 Abs. 5, 46 Abs. 1, 8 Abs. 1 ArbGG: Urteil,<br />
b. Klageart und Klage<strong>in</strong>teresse<br />
Feststellungsklage gem. § 256 ZPO,<br />
Feststellungs<strong>in</strong>teresse: (+), weil Klage e<strong>in</strong>zige Möglichkeit, die nach §§ 4, 7, 13 I KSchG<br />
drohende Heilung <strong>der</strong> Sozialwidrigkeit zu beseitigen,<br />
c. Klagefrist (= 3 Wochen, § 13 I 2, 4 S. 1, 5 KSchG, auch wenn KSchG unanwendbar;<br />
wenn Kündigung nicht schriftlich bekannt gegeben, kann Klage auch nach Ablauf <strong>der</strong> Dreiwochenfrist<br />
erhoben werden, weil die Kündigung wegen § 125 BGB nichtig ist [Richardi, BB 2004, 486 {489}])<br />
2. Begründetheit <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage<br />
Klage begründet (+), wenn die Kündigung nicht durch wichtigen Grund gerechtfertigt ist.<br />
a. Wirksames Arbeitsverhältnis, das außerordentlich gekündigt wurde<br />
Arbeitsvertrag bestand im Zeitpunkt Kündigung,<br />
Vorliegen schriftlicher ordnungsgemäßer Kündigungserklärung sowie Kündigungsbegründung,<br />
daß und weshalb fristlos gekündigt wurde<br />
E<strong>in</strong>haltung Kündigungsfrist: Kündigungserklärung erfolgt <strong>in</strong>nerhalb von zwei Wochen<br />
nach Bekanntwerden <strong>der</strong> außerordentlichen Kündigungsgründe (§ 626 II BGB).<br />
c. Wirksamkeit <strong>der</strong> Kündigung<br />
ke<strong>in</strong> Ausschluß Kündigung durch § 9 MuSchG, § 18 BErzGG, §§ 20, 21 SchwbG, BetrVG.<br />
ke<strong>in</strong>e Nichtigkeit nach § 134, 138, 242 BGB,<br />
ordnungsgem. Anhörung Betriebsrat, § 102 BetrVG (sonst Künd. unwirksam; man kann vere<strong>in</strong>baren,<br />
daß Wi<strong>der</strong>spruch d. Betriebsrates gegen Kündigung diese zunächst nicht wirksam werden läßt und dann von<br />
<strong>der</strong> Schiedsstelle entschieden wird; im Regelfall hat Wi<strong>der</strong>spruch ke<strong>in</strong>e Rechtswirkung; Arbeitnehmer erhält<br />
dann aber Abschrift des Wi<strong>der</strong>spruchs),<br />
d. Vorliegen e<strong>in</strong>es wichtigen Kündigungsgrundes<br />
Vorliegen von Tatsachen, die gegen die Fortdauer des Arbeitsverhältnisses sprechen (Beleidigung<br />
Vorgesetzter [„Arschloch“], eigenmächtiger Urlaubsantritt, Vortäuschen Arbeitsunfähigkeit,<br />
geschäftsschädigende Äußerungen, Nebentätigkeit während attestierter<br />
Krankheit, Konkurrenztätigkeit, anzügl. sex. Bemerkung mit Wdhgl. „Ausraster“),<br />
od. Vorliegen dr<strong>in</strong>gen<strong>der</strong> Verdachtsmomente bzgl. schweren Fehlverhaltens (= Straftaten<br />
zu Lasten des Betriebes [Achtung: Arbeitgeber darf bei klaren Verdachtsmomenten dem Arbeitnehmer<br />
mit Kündigung und Strafanzeige drohen, um ihn zum Geständnis e<strong>in</strong>es Diebstahls<br />
zu br<strong>in</strong>gen], Arbeitskollegen o<strong>der</strong> schwere arbeitsvertragliche Verfehlungen [Verstoß<br />
gegen Verschwiegenheitspflicht]), die durch obj. Tatsachen gestützt werden und nicht aus<strong>zur</strong>äumen<br />
s<strong>in</strong>d; Arbeitgeber hat alles <strong>zur</strong> Sachverhaltsaufklärung Erfor<strong>der</strong>liche getan<br />
so daß <strong>in</strong>sgesamt das <strong>zur</strong> Fortdauer des Arbeitsverhältnisses notwendige Vertrauen irreparabel<br />
zerstört ist (z.B. Annahme v. Schmiergel<strong>der</strong>n, Tätlichkeiten im Betrieb,<br />
Diebstahl)<br />
Achtung: Beim Diebstahl genügt bereits die Entwendung von Gegenständen mit<br />
ger<strong>in</strong>gem Wert (Pfandbons, Stück Kuchen, das weggeworfen werden soll), ohne<br />
dass dem Arbeitgeber e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Schaden entstanden ist und dies auch als Ersttat,<br />
um e<strong>in</strong>e fristlose Kündigung zu begründen, wenn durch diese Tat das Vertrauen<br />
des Arbeitsgebers <strong>in</strong> den Mitarbeiter irreparabel zerstört ist (BAG, Urt.v.<br />
10.06.2010 – 2 AZR 541/09 – „Emmely“); <strong>in</strong> diesem Fall braucht <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
ke<strong>in</strong>e zweite Tat abzuwarten (LAG Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, Az 8 Sa 361/07), Wichtig:<br />
Schutz des Eigentums des Arbeitgebers ist vorrangig geschützt, so dass Diebstahl<br />
immer e<strong>in</strong>e schwerwiegende Pflichtverletzung ist und es hier ke<strong>in</strong>e Bagatellgrenze<br />
gibt (Walker, NZA 2011, 1 [2]),<br />
ke<strong>in</strong>e Heilung d. Fehlens d. wichtigen Grundes nach § 7 KSchG durch Versäumen 3wöchiger<br />
Kündigungsfrist<br />
e. Interessenabwägung<br />
Außerordentliche Kündigung (E<strong>in</strong>zelfallabwägung) darf nur ultima ratio se<strong>in</strong>, weil mil<strong>der</strong>e<br />
Mittel (Versetzung, Abmahnung) unzumutbar wären (Abwägung Int. ArbG/ArbN).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 138 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
VII. Prozessuale<br />
Folgen e<strong>in</strong>er erfolgreichen<br />
Kün-<br />
digungsschutzklage<br />
VIII. Gesetzlicher<br />
Anspruch<br />
auf Abf<strong>in</strong>dung<br />
bei betriebsbed<strong>in</strong>gterKündigung<br />
Bei <strong>der</strong> Abwägung Kündigung als ultimatives – Abmahnung/Versetzung als mil<strong>der</strong>es Mittel<br />
s<strong>in</strong>d zu berücksichtigen:<br />
Gewicht und Auswirkungen <strong>der</strong> Vertragspflichtverletzung,<br />
Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers,<br />
mögliche Wie<strong>der</strong>holungsgefahr, „Ist Arbeitnehmer zukünftig vertragstreu?“,<br />
Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie dessen störungsfreier Verlauf<br />
Beachte: bei <strong>der</strong> Abwägung, ob das Vertrauen durch den Diebstahl ger<strong>in</strong>gwertiger<br />
Sachen irreparabel zerstört wurde, muss <strong>der</strong> Arbeitgeber bei langjährigen Arbeitsverhältnissen,<br />
die bislang störungsfrei waren, e<strong>in</strong> gewisses „Vertrauenskapitals“ zugrunde<br />
legen und prüfen, ob dieses durch diese e<strong>in</strong>malige Tat schon vollständig aufgezehrt<br />
wurde (BAG, aaO – „Emmely“),<br />
E<strong>in</strong>er Abmahnung bedarf es jedenfalls dann nicht, wenn e<strong>in</strong>e zukünftige Verhaltensän<strong>der</strong>ung<br />
selbst durch Abmahnung nicht zu erwarten ist bzw. die Pflichtverletzung so gravierend<br />
ist, dass man schlichtweg nicht mit e<strong>in</strong>er H<strong>in</strong>nahme durch den Arbeitgeber rechnen<br />
kann (absolutes „no go“),<br />
f. erfolglose Fristsetzung und vorherige Abmahnung<br />
die Abmahnung muß i.d.R. erfolgt se<strong>in</strong>. Ausnahme: irreparable Zerstörung des Vertrauensverhältnisses<br />
(wird bei Diebstahl angenommen), ernsthafte Leistungsverweigerung.<br />
Vor <strong>der</strong> Abmahnung sollte gemäß § 314 II 1 BGB zuvor erst e<strong>in</strong>e (erfolglose) Frist <strong>zur</strong><br />
Abhilfe gesetzt werden.<br />
g. Unzumutbarkeit <strong>der</strong> Kündigung bis zum regulären Kündigungsterm<strong>in</strong><br />
auch hierbei ist nochmals abzuwägen, ob das Arbeitsverhältnis nicht doch fortgesetzt werden<br />
kann. Wenn (-), dann kann sofort gekündigt werden.<br />
Stellt das Gericht fest, daß die ordentliche/außerordentliche Kündigung nicht gerechtfertigt ist<br />
(= Klage begründet), wird es die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu dem Zeitpunkt feststellen,<br />
zu dem es bei sozialer Rechtfertigung (für die ordentliche Kündigung) bzw. bei E<strong>in</strong>tritt<br />
des wichtigen Kündigungsgrundes (für die Außerordentliche Kündigung) geendet hätte. Es<br />
kann den Arbeitgeber dann bei Unzumutbarkeit <strong>der</strong> Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses <strong>zur</strong><br />
Zahlung e<strong>in</strong>er angemessenen Abf<strong>in</strong>dung verurteilen.<br />
Annex zum Abf<strong>in</strong>dungsanspruch des Arbeitnehmers bei betriebsbed<strong>in</strong>gter<br />
Kündigung<br />
Nach § 1a KSchG hat <strong>der</strong> Arbeitnehmer e<strong>in</strong>en gesetzlichen Anspruch auf Abf<strong>in</strong>dung,<br />
wenn ihm <strong>der</strong> Arbeitgeber betriebsbed<strong>in</strong>gt kündigt.<br />
1. Grund<br />
<strong>der</strong> Regelung<br />
2. Rechtscharakter<br />
Der <strong>in</strong> § 1a KSchG nie<strong>der</strong>gelegte gesetzliche Anspruch auf Abf<strong>in</strong>dung<br />
des ordentlich gekündigten Arbeitnehmers bei Nichterhebung<br />
<strong>der</strong> Kündigungsschutzklage trägt dem Umstand Rechnung,<br />
das die meisten Kündigungsschutzprozesse nur geführt<br />
werden, um e<strong>in</strong>e Abf<strong>in</strong>dung zu erhalten. Diese Abf<strong>in</strong>dung kann<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber nur bereits bei Ausspruch <strong>der</strong> Kündigung versprechen,<br />
um den Prozess zu vermeiden.<br />
Rechtstechnisch handelt es sich bei dem Anspruch des Arbeitnehmers<br />
um die bloße Möglichkeit, e<strong>in</strong> Angebot des Arbeitgebers<br />
nach § 1a KSchG anzunehmen.<br />
Der Arbeitgeber ist daher nicht verpflichtet, den H<strong>in</strong>weis<br />
auf die Abf<strong>in</strong>dungssumme zu erteilen und er muß auch nicht<br />
die Höhe dessen beziffern.<br />
Auch bleibt es ihm unbenommen, weiterh<strong>in</strong> bei personen- und verhaltensbed<strong>in</strong>gter<br />
bzw. außerordentlicher Kündigung e<strong>in</strong>e Abf<strong>in</strong>dung<br />
zu zahlen. Dies ist dann aber ke<strong>in</strong> Angebot nach § 1a KSchG.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 139 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
3. Voraussetzungen<br />
4. Inhalt d.<br />
Angebots<br />
5. Folgen<br />
fehlen<strong>der</strong><br />
o<strong>der</strong> fehlerhafter<br />
Erklärung<br />
6. Verwirkung<br />
/ E<strong>in</strong>klagung<br />
/<br />
Besteuerung<br />
Voraussetzung für den Anspruch ist, dass <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
ke<strong>in</strong>e Kündigungsschutzklage erhebt (3-Wochen-Frist),<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber auf die dr<strong>in</strong>genden betrieblichen Gründe<br />
<strong>der</strong> Kündigung<br />
und im Kündigungsschrieben auf den gesetzlichen Anspruch<br />
auf Abf<strong>in</strong>dung nach Verstreichen lassen <strong>der</strong> Kündigungsfrist<br />
h<strong>in</strong>gewiesen hat (Arbnehmer: Annahmefiktion nach § 151 BGB),<br />
für das Angebot des Arbeitgebers gilt nach § 623 BGB das<br />
Schriftformerfor<strong>der</strong>nis; d.h., daß Textform (elektronisch per<br />
Email) unzulässig ist.<br />
Hierbei sollte <strong>der</strong> Arbeitgeber auch die Abf<strong>in</strong>dungssumme (0,5 Monatsgehälter<br />
brutto pro Jahr <strong>der</strong> Betriebszugehörigkeit) konkret ausweisen.<br />
Das Unterlassen des H<strong>in</strong>weises auf den Abf<strong>in</strong>dungsanspruch,<br />
das falsche Berechnen (auch bei offenkundigem Rechenfehler)<br />
o<strong>der</strong> Nichtbenennen <strong>der</strong> Abf<strong>in</strong>dungssumme ist für den Arbeitgeber<br />
ungünstig, weil dann <strong>der</strong> Abf<strong>in</strong>dungsanspruch nicht<br />
wirksam entstanden ist und<br />
sich <strong>der</strong> Arbeitnehmer dann aus Klarstellungsgründen meist<br />
noch vor Ablauf <strong>der</strong> 3-Wochen-Frist <strong>zur</strong> Erhebung <strong>der</strong> Kündigungsschutzklage<br />
veranlasst sieht, sowie<br />
<strong>der</strong> Arbeitnehmer im E<strong>in</strong>zelfall durch das Gericht doch noch<br />
e<strong>in</strong>e höhere Abf<strong>in</strong>dung als die gesetzlich vorgeschriebene zu<br />
erzielen versucht (Bauer/Krieger, NZA 2004, 77).<br />
Merke: Trotz <strong>der</strong> gesetzlichen Fiktion des § 269 III 1 ZPO,<br />
wonach e<strong>in</strong>e <strong>zur</strong>ückgenommene Klage wie e<strong>in</strong>e nicht anhängig<br />
gewordene behandelt wird, entsteht <strong>der</strong> Abf<strong>in</strong>dungsanspruch<br />
bei erhobener und später <strong>zur</strong>ückgenommener Kündigungsschutzklage<br />
nicht (Ba<strong>der</strong>, NZA 2004, 65 [71]),<br />
<strong>der</strong> Abf<strong>in</strong>dungsanspruch muß vom ehemaligen Arbeitnehmer<br />
e<strong>in</strong>geklagt werden, falls <strong>der</strong> Arbeitgeber nicht freiwillig erfüllt,<br />
nach § 3 Nr. 9 EstG liegen die Steuerfreibeträge für Abf<strong>in</strong>dungen<br />
bei € 7.200,- bis € 9.000,-.<br />
IX. Nachschieben<br />
von Gründen<br />
im Klageverfah-<br />
Annex zum Klageverfahren<br />
ren Dem klagenden Arbeitnehmer bleibt es unbenommen, auch während des arbeitsgerichtlichen<br />
Klageverfahrens noch bis zum Schluß <strong>der</strong> mündlichen Verhandlung erster Instanz<br />
(Tatsachen<strong>in</strong>stanz) Gründe für die Unzulässigkeit <strong>der</strong> Kündigung vorzubr<strong>in</strong>gen, die<br />
er nicht <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Klagefrist vorgetragen hat (sog. Nachschieben von Gründen).<br />
X. Übersicht<br />
über sonstige<br />
Beendigungsgründe<br />
des Arbeitsverhätnisses<br />
Sonstige Beendigungsgründe<br />
Das Arbeitsverhältnis kann entwe<strong>der</strong> e<strong>in</strong>vernehmlich o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>seitig gestaltend (gegen<br />
den Willen des an<strong>der</strong>en Vertragspartners) gekündigt werden. Im e<strong>in</strong>zelnen:<br />
Aufhebungsvertrag<br />
Anfechtung und e<strong>in</strong>seitige Lossagung vom faktischen Arbeitsverhältnis,<br />
Tod des Arbeitnehmers,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 140 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XI. Arbeitszeit<br />
exam<strong>in</strong>ierter<br />
Arbeitskräfte<br />
außerordentliche/ordentliche Kündigung,<br />
Auflösung durch Gerichtsurteil, §§ 9, 10 KSchG,<br />
Befristungsablauf,<br />
E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>er auflösenden Bed<strong>in</strong>gung.<br />
Normale<br />
Arbeitszeit<br />
Schichtdienst<br />
Arbeitszeit exam<strong>in</strong>ierter <strong>Pflege</strong>kräfte<br />
1. Dauer <strong>der</strong> Arbeitszeit<br />
a. gesetzliche Regelung<br />
die tägliche Arbeitszeit soll nicht mehr als 8 Stunden und darf<br />
höchstens 10 Std. betragen (§ 3 S. 2 ArbZG),<br />
die Arbeitszeit kann auch mehr als zehn Stunden betragen, wenn<br />
dar<strong>in</strong> auch Bereitschaftszeit fällt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 a ArbZG),<br />
bei 6-9 Std. Arbeit gibt es 30 m<strong>in</strong>. Pause (§ 4 S. 1 ArbZG),<br />
ab 9 Std. Arbeit gibt es 45 m<strong>in</strong>. Pause (§ 4 S. 1 ArbZG),<br />
nicht länger als 6 Std. ohne Pause (§ 4 S. 3 ArbZG),<br />
die wöchentliche Arbeitszeit darf höchstens 48 Stunden durchschnittlich<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ausgleichszeitraum von höchstens 6 Kalen<strong>der</strong>monaten o<strong>der</strong><br />
24 Wochen betragen (§ 3 S. 2 ArbZG),<br />
Wegefahrt zählt nicht <strong>zur</strong> Arbeitszeit.<br />
nach Ende <strong>der</strong> Arbeit: m<strong>in</strong>d. 11 Std. Ruhe (§ 5 Abs. 1 ArbZG),<br />
Bereitschaftsdienst <strong>in</strong> Diensträumen ist Arbeitszeit (!) -> VG<br />
M<strong>in</strong>den – Az.: 4 K 3162/00 (Urt. v. Nov. 2001).<br />
b. tarifliche Regelung<br />
wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 38, 5 Std., gemessen an e<strong>in</strong>em<br />
52-Wochen-Zeitraum als Regelfall (§ 15 Abs. 1 BAT bzw. § 8<br />
KrPflSchülerInnenTV i.V.m. § 15 Abs. 1 BAT),<br />
Überstunden nur <strong>in</strong> dr<strong>in</strong>genden Fällen, dafür Ersatzfreizeiten o<strong>der</strong>,<br />
wenn das betrieblich nicht geht, f<strong>in</strong>anzielle Überstundenabgeltung (SR<br />
2 a Nr. 6 A zu § 15 Abs. 6 a und b und zu § 17 BAT); für Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schüler <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankenpflegeausbildung ist die Überstundenanordnung<br />
nur ausnahmsweise zulässig (§ 8 Abs. 2 Ende KrPflSchülerInnenTV).<br />
Son<strong>der</strong>problem: Anspruch auf Raucherpausen?<br />
Rauchen ist Privatsache und nicht Teil <strong>der</strong> Berufsausübung.<br />
Es gibt also ke<strong>in</strong> Recht auf Rauchen im Betrieb und auch<br />
ke<strong>in</strong> Recht, dafür e<strong>in</strong>e Auszeit zu nehmen - auch nicht<br />
aus Gewohnheitsrecht. Wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber es nicht toleriert,<br />
dass man h<strong>in</strong> und wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Raucherpause e<strong>in</strong>legt<br />
o<strong>der</strong> er gar die verlorene Arbeitszeit vom Gehalt abzieht,<br />
müssen die Mitarbeiter ihre Sucht <strong>in</strong> den regulären Pausen<br />
stillen<br />
2. Schichtarbeitszeit<br />
a. gesetzliche Regelung<br />
Nachtzeit ist von 23.00 - 06.00 Uhr.<br />
Nachtarbeitszeit beträgt 8 Std. (§ 6 Abs. 2 ArbZG),<br />
sie kann um bis zu 2 Std. überschritten werden, wenn <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es Monats o<strong>der</strong> 4 Wochen tagsüber nicht mehr als 8 Std. gearbeitet<br />
wird (§ 6 Abs. 2 ArbZG),<br />
bei Nacht- und Schichtarbeit Berücksichtigung <strong>der</strong> gesicherten<br />
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte<br />
Gestaltung <strong>der</strong> Arbeit (§ 6 Abs. 1 ArbZG),<br />
Sicherstellung <strong>der</strong> 48-Stunden-Woche <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Kalen<strong>der</strong>monats<br />
o<strong>der</strong> von vier Wochen (§ 6 Abs. 2 S. 2 ArbZG),<br />
regelmäßige arbeitsmediz<strong>in</strong>ische Untersuchungen und Anspruch auf
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 141 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Sonn-<br />
/Feiertage<br />
Versetzung auf e<strong>in</strong>en geeigneten Tagesarbeitsplatz unter bestimmten<br />
Voraussetzungen (§ 6 S. 3 und 4 ArbZG),<br />
angemessene Zahl bezahlter freier Tage o<strong>der</strong> Nachtarbeitszeitzuschlag<br />
(§ 6 Abs. 5 ArbZG).<br />
b. tarifliche Regelung<br />
Nachtarbeit darf im Jahresdurchschnitt nur e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Arbeitszeit betragen; Nachtarbeit darf nicht mehr als 4 zusammenhängende<br />
Wochen betragen, es sei denn <strong>der</strong> Arbeitnehmer will<br />
auf eigenen Wunsch diese Dauer überschreiten (SR 2 a Nr. 5 Abs. 2<br />
zu § 15 BAT bzw. § 8 Abs. 2 KrPflSchülerInnenTV i.V.m. diesen<br />
Vorschriften),<br />
3. Sonn- und Feiertage<br />
Freizeiten 4. Freizeiten<br />
a. gesetzliche Regelung<br />
für Sonn- und Feiertagsarbeit je e<strong>in</strong> Ersatzruhetag bei Sonntagsarbeit<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es den Beschäftigungstag e<strong>in</strong>schließenden Zeitraums von<br />
2 Wochen o<strong>der</strong> bei Wochenfeiertagen 8 Wochen; m<strong>in</strong>destens 15 Sonntage<br />
im Jahr müssen beschäftigungsfrei se<strong>in</strong> (§ 11 ArbZG),<br />
b. tarifliche Regelung<br />
Arbeitnehmer, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten<br />
müssen, erhalten <strong>in</strong>nerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage,<br />
wovon e<strong>in</strong> freier Tag aus e<strong>in</strong>en Sonntag fallen soll (SR 2 a Nr.<br />
5 Abs. 1 zu § 15 BAT bzw. § 8 Abs. 2 KrPflSchülerInnenTV<br />
i.V.m. diesen Vorschriften),<br />
bei Überstunden entsprechende Ersatzfreizeiten möglichst <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es Monats; wenn <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten ke<strong>in</strong>e Ersatzfreizeit<br />
möglich, Überstundenvergütung (SR 2 a Nr. 6 A zu § 15<br />
Abs. 6 a und zu § 17 BAT bzw. § 8 Abs. 2 KrPflSchülerInnenTV<br />
i.V.m. diesen Vorschriften).<br />
a. angemessene Ruhepausen s<strong>in</strong>d zu gewähren bei e<strong>in</strong>er Arbeitszeit<br />
von mehr als 6 Stunden, und zwar e<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> mehrere Arbeitsunterbrechungen<br />
von m<strong>in</strong>d. ¼ Std. mit folgen<strong>der</strong> Staffelung:<br />
bei mehr als 6-9 Std.: 30M<strong>in</strong>.<br />
bei mehr als 9 Std.: 45 M<strong>in</strong>. (§ 4 ArbZG).<br />
b. tägliche ununterbrochene Freizeit:<br />
i.d.R. 11 Std. (§ 5 ArbZG),<br />
<strong>in</strong> Krankenhäusern u. and. E<strong>in</strong>richtungen <strong>zur</strong> Behandlung, Betreuung<br />
u. <strong>Pflege</strong> von Personen m<strong>in</strong>d. 10 Std., wenn <strong>in</strong>nerh. v. e<strong>in</strong>em Kalen<strong>der</strong>monat<br />
od. vier Wochen e<strong>in</strong> Ausgleich durch Verlängerung e<strong>in</strong>er<br />
and. Ruhezeit auf m<strong>in</strong>d. 12 Wochen erfolgt (§ 5 Abs. 2 ArbZG), abweich.<br />
v. <strong>der</strong> 11-stündigen Ruhezeit können <strong>in</strong> Krankenhäusern u.<br />
and. E<strong>in</strong>richtungen <strong>zur</strong> Behandlung, Betreuung u. <strong>Pflege</strong> von Personen<br />
Kürzungen <strong>der</strong> Ruhezeiten, die durch Rufdienst (nicht Bereitschaftsdienst<br />
[!], weil dieser <strong>zur</strong> Arbeitszeit zählt) entstehen zu and. Zeiten<br />
ausgeglichen werden, wobei m<strong>in</strong>d. die Hälfte <strong>der</strong> Ruhezeit (= 5,5 Std.)<br />
im Zusammenhang erfolgen muß (§ 5 Abs. 3 ArbZG).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 142 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XII. Annex <strong>zur</strong><br />
Sozialauswahl bei<br />
<strong>der</strong> Kündigung<br />
Annex <strong>zur</strong> sozialen Rechtfertigung <strong>der</strong> Kündigung<br />
Kommt das Kündigungsschutzgesetz <strong>zur</strong> Anwendung, ist e<strong>in</strong>e Arbeitgeberkündigung nur<br />
im Falle ihrer sozialen Rechtfertigung wirksam. Diese ist gegeben, wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
dr<strong>in</strong>gende personen-, verhaltens- o<strong>der</strong> betriebsbed<strong>in</strong>gte Gründe für die Kündigung geltend<br />
machen kann.<br />
Bei <strong>der</strong> ordentlichen Kündigung gemäß dem KSchG kann <strong>der</strong> Arbeitgeber aber nur dann<br />
aus personen-, verhaltens- o<strong>der</strong> betriebsbed<strong>in</strong>gten Gründe kündigen, wenn er zuvor die wi<strong>der</strong>streitenden<br />
Interessen gegene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abgewogen hat.<br />
1. personenbed<strong>in</strong>gte Kündigung<br />
Personenbed<strong>in</strong>gte Gründe beruhen auf persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des<br />
Arbeitnehmers. Dazu gehören <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e:<br />
mangelnde körperliche o<strong>der</strong> geistige Eignung (Fälle <strong>der</strong> sog. M<strong>in</strong><strong>der</strong>- o<strong>der</strong> Schlechtleistung<br />
des Arbeitnehmers)<br />
Erkrankungen, die die Verwendbarkeit des Arbeitnehmers erheblich herabsetzen und<br />
wenn es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit erheblichen Fehlzeiten gekommen ist (sechs Wochen <strong>in</strong><br />
den letzten drei Jahren [BAG, Urt. v. 16.2.1989, AP Nr. 10 zu § 1 KSchG 1969<br />
Krankheit]). Bei den Krankheiten wird unterschieden <strong>in</strong>: lang andauernde Erkrankungen,<br />
Kurzerkrankungen und krankheitsbed<strong>in</strong>gte Leistungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen.<br />
=> Bei lang andauernden Erkrankungen, bei denen die Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong> Gesundheit<br />
objektiv nicht absehbar ist und <strong>der</strong> Arbeitsplatz aus betrieblichen Gründen<br />
wie<strong>der</strong> neu besetzt werden muß, kommt es auf die Umstände des E<strong>in</strong>zelfalles an.<br />
Hier kann e<strong>in</strong>e Kündigung ausnahmsweise gerechtfertigt se<strong>in</strong>.<br />
=> Bei häufigen Kurzerkrankungen gilt: nicht jede Erkrankung führt <strong>zur</strong> Arbeitsunfähigkeit;<br />
zudem muß diese ausdrücklich vom Arzt festgestellt werden.<br />
H<strong>in</strong>weis: Bei häufigen Kurzerkrankungen des Arbeitnehmers kann <strong>der</strong> Arbeitgeber unabhängig<br />
von e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>weitigen Regelung im Tarifvertrag die sofortige Vorlage e<strong>in</strong>es Attests<br />
verlangen, ohne an die Drei-Tages-Frist gebunden zu se<strong>in</strong>, weil e<strong>in</strong> wichtiger Grund<br />
(= häufige Kurzerkrankungen) vorliegt; die wegen verspäteter Vorlage des Attests ausgesprochene<br />
Abmahnung ist rechtmäßig (ArbG Frankfurt, Az.: 6 Sa 463/03). Dazu ist <strong>in</strong><br />
diesem Fall auch nicht die Mitbestimmung des Betriebsrates erfor<strong>der</strong>lich.<br />
=> Bei krankheitsbed<strong>in</strong>gter Leistungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung kommt es darauf an, ob e<strong>in</strong>e erhebliche<br />
Absenkung des Leistungsniveaus unter den Durchschnitt gegeben ist und ob <strong>der</strong><br />
betriebliche Ablauf durch die Leistungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung konkret gefährdet ist.<br />
=> Prozessualer H<strong>in</strong>weis: Krankheitsbed<strong>in</strong>gte Kündigungen müssen <strong>in</strong> drei Stufen vorgenommen<br />
werden (wird vom zuständigen Richter überprüft):<br />
1. Stufe: Es muß e<strong>in</strong>e negative Prognose h<strong>in</strong>sichtlich des voraussichtlichen Gesundheitszustandes<br />
vorliegen. D.h., daß im Zeitpunkt <strong>der</strong> Kündigung objektive<br />
Tatschen vorliegen, nach denen e<strong>in</strong>e ernste Besorgnis zu weiteren Krankheiten<br />
im bisherigen Umfang besteht. Häufige Kurzerkrankungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Vergangenheit (meist geht man drei Jahre <strong>zur</strong>ück) können e<strong>in</strong> Indiz für die<br />
entsprechende Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft se<strong>in</strong>.<br />
Der Arbeitnehmer kann aber den Gegenbeweis führen. Dazu reicht aber<br />
nicht darzulegen, daß die Krankheiten ausgeheilt s<strong>in</strong>d (Kock, BB 2006, 1907).<br />
2. Stufe: Aus den bisherigen und nach <strong>der</strong> Prognose zu erwartenden betrieblichen<br />
Auswirkungen des Gesundheitszustandes müssen sich erhebliche Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
betrieblicher Interessen ergeben (= Betriebsablaufstörungen<br />
[ständige Neuorganisation, Überstunden, etc.] o<strong>der</strong> wirtschaftliche<br />
Belastungen [hohe Entgeltfortzahlungskosten für den betreffenden<br />
Arbeitnehmer, wenn dieser mehr als sechs Wochen im Jahr fehlt; es<br />
kommt hierbei nicht darauf an, ob das Unternehmen selbst die Lohnfortzahlung<br />
leisten muß, son<strong>der</strong>n welche Kosten das konkrete Arbeitsverhältnis<br />
<strong>in</strong>sgesamt verursacht - egal ob für Krankenkasse o<strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
{Kock, BB 2006, 1907}]).<br />
3. Stufe: Sodann ist im Rahmen <strong>der</strong> Interessenabwägung zu prüfen, ob betriebliche<br />
Bee<strong>in</strong>trächtigungen zu e<strong>in</strong>er nicht h<strong>in</strong>nehmbaren Belastung führen, die<br />
das Bestandsschutz<strong>in</strong>teresse des Arbeitnehmers überwiegen<br />
Grundsätzlich gilt, daß die Kündigung e<strong>in</strong>e sorgfältige Interessenabwägung voraussetzt.<br />
Der Arbeitgeber hat alle Maßnahmen darauf zu prüfen, durch die das Arbeitsverhältnis<br />
auch erhalten werden kann (z.B. Umsetzung, Umschulung).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 143 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Es gilt: bei e<strong>in</strong>em kurzen Arbeitsverhältnis kann sich <strong>der</strong> Arbeitgeber eher auf krankheitsbed<strong>in</strong>gte<br />
Ausfallzeiten bei <strong>der</strong> Kündigung berufen; bei e<strong>in</strong>em längeren h<strong>in</strong>gegen<br />
muß er solche Fehlzeiten h<strong>in</strong>nehmen. Ist die Erkrankung auf betriebliche Gründe rückführbar<br />
(z.B. Mobb<strong>in</strong>g), geht dies zu Lasten des Arbeitgebers. Bei Alkoholerkrankungen<br />
müssen diese zunächst ärztlich festgestellt werden. Danach ist dem Arbeitnehmer erst die<br />
Gelegenheit <strong>zur</strong> Entziehungskur zu geben. Wird er rückfällig, kann ihm gekündigt werden.<br />
Ausnahme: Rückfall beruht auf persönlichen Gründen (z.B. Scheidungsverfahren).<br />
2. verhaltensbed<strong>in</strong>gte Kündigung<br />
Diese stützt sich auf folgende Gründe:<br />
Vertragsverletzungen,<br />
außerdienstliches Verhalten, das das Arbeitsverhältnis konkret bee<strong>in</strong>trächtigt,<br />
Pflichtverletzung d. Arbeitn. im Leistungsbereich (z.B. Arbeitsverweigerung, Arbeitsversäumnis),<br />
Vorspiegeln nicht vorhandener Eigenschaften o<strong>der</strong> Fähigkeiten bei E<strong>in</strong>stellungsverhandlungen,<br />
Verletzung von Verhaltenspflichten, die die betriebliche Ordnung betreffen,<br />
den persönlichen Vertrauensbeweis (z.B. Bestechlichkeit).<br />
Es muß für den Arbeitgeber unzumutbar se<strong>in</strong>, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Auch<br />
hier s<strong>in</strong>d die Interessen sorgfältig abzuwägen. Bei verhaltensbed<strong>in</strong>gten Kündigungen<br />
muß <strong>der</strong> Arbeitnehmer vorher abgemahnt werden.<br />
3. betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung<br />
Sie ist gerechtfertigt, wenn dr<strong>in</strong>gende betriebliche Erfor<strong>der</strong>nisse e<strong>in</strong>er Weiterbeschäftigung<br />
entgegenstehen. Die betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung ist im Krankenpflegebereich sehr<br />
selten. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt se<strong>in</strong>:<br />
a. dr<strong>in</strong>gende betriebliche Erfor<strong>der</strong>nisse<br />
Zunächst müssen <strong>in</strong>nerbetriebliche Gründe (= Umstellung, E<strong>in</strong>schränkung <strong>der</strong> Produktion,<br />
Rationalisierungsmaßnahmen mit <strong>der</strong> Folge e<strong>in</strong>er Organisationsän<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> Fremdvergabe<br />
bestimmter Arbeiten) o<strong>der</strong> außerbetriebliche Gründe (= Auftrags- o<strong>der</strong> Absatzrückgang; Arbeitgeber<br />
muß dazu konkrete Zahlen vorlegen [LAG Ma<strong>in</strong>z – Az.: 9 Sa 11/03]) vorliegen,<br />
die e<strong>in</strong>en unmittelbaren Arbeitsplatzbezug (= Auswirkung auf die E<strong>in</strong>satzmöglichkeit des<br />
gekündigten Arbeitnehmers mit <strong>der</strong> Folge, daß <strong>der</strong> Arbeitsplatz wegfällt) haben.<br />
b. freie Unternehmerentscheidung<br />
Ursache des Wegfalls von Arbeitsplätzen muß e<strong>in</strong>e Unternehmerentscheidung se<strong>in</strong>. Also<br />
die Entscheidung des Arbeitgebers (= Unternehmers), die technischen o<strong>der</strong> organisatorischen<br />
Maßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten, die zum Wegfall des Arbeitsplatzes führen. Hierbei<br />
sollte <strong>der</strong> Arbeitgeber prüfen, Arbeitsplätze nur <strong>in</strong> dem Umfang abzubauen, wie dies<br />
durch die geltend gemachten Umstände (z.B. Auftragsmangel) gerechtfertigt ist (Schiefer,<br />
DB 2007, 54 [es besteht aber ke<strong>in</strong>e Verpflichtung]). H<strong>in</strong>weis: Die unternehmerischen<br />
Entscheidungen s<strong>in</strong>d von Arbeitsgerichten nur e<strong>in</strong>geschränkt überprüfbar („nur“<br />
Mißbrauchskontrolle).<br />
c. Dr<strong>in</strong>glichkeit<br />
Die betrieblichen Gründe müssen dr<strong>in</strong>gend se<strong>in</strong>. D.h., daß für den Arbeitgeber e<strong>in</strong>e<br />
Zwangslage bestand, die e<strong>in</strong>e Kündigung unvermeidbar machte; die Kündigung muß<br />
notwendige Folge <strong>der</strong> betrieblichen Erfor<strong>der</strong>nisse se<strong>in</strong>:<br />
<strong>in</strong>nerbetriebliche Versetzung: <strong>der</strong> Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer nicht auf e<strong>in</strong>en<br />
an<strong>der</strong>en freien, vergleichbaren und gleichwertigen (= Umsetzung möglich) Arbeitsplatz<br />
im Unternehmen versetzen:
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 144 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Hier gelten beson<strong>der</strong>e rechtliche Voraussetzungen:<br />
- wenn nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gwertigerer Arbeitsplatz frei ist, dann kann es trotzdem zulässig<br />
se<strong>in</strong>, den Mitarbeiter dorth<strong>in</strong> zu versetzen, wenn folgende Voraussetzungen<br />
erfüllt s<strong>in</strong>d:<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für<br />
diese Tätigkeit,<br />
es kommt darauf an, ob die ger<strong>in</strong>gwertigere Stelle dem Mitarbeiter subjektiv<br />
zumutbar ist, wobei er gewisse Verschlechterungen h<strong>in</strong>nehmen muß, wie etwa<br />
die Reduzierung des Jahresgehalts von € 140.000,- auf 70.000,-; die Reduzierung<br />
des monatlichen E<strong>in</strong>kommens von € 2.800,- auf € 1.400,-, wobei ernsthafte<br />
Zweifel, ob das verbliebene E<strong>in</strong>kommen die Familie ernähren kann, unbeachtlich<br />
s<strong>in</strong>d (Nachweise bei Bauer/W<strong>in</strong>zer, BB 2006, 266 [267]).<br />
ebenso kommt es darauf an, ob die Besetzung <strong>der</strong> freien ger<strong>in</strong>gwertigeren Stelle<br />
durch den Arbeitnehmer auch dem Arbeitgeber zumutbar ist, dies wird aber<br />
i.d.R. dadurch angenommen, wenn er diesem die Stelle anbietet.<br />
- wenn mehrere gleichwertige Arbeitsplätze - auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Standorten - frei<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
hier stellt sich die Frage, welchen freien Arbeitsplatz <strong>der</strong> Arbeitgeber anbieten<br />
muß: das ist <strong>der</strong>, <strong>der</strong> die ger<strong>in</strong>gsten Nachteile für den Arbeitnehmer nach sich<br />
zieht, was anhand objektiver Kriterien zu bemessen ist,<br />
haben beide <strong>der</strong> angebotenen Stellen <strong>in</strong> etwa die gleichen Nachteile, so ist<br />
nach billigem Ermessen zu entscheiden<br />
- wenn mehrere Arbeitnehmer um die gleiche freie Stelle konkurrieren:<br />
<strong>in</strong> diesen Fällen wird e<strong>in</strong>e Sozialauswahl unter den konkurrierenden Arbeitnehmern<br />
vorgenommen und gefragt, welchem Arbeitnehmer am ehesten die<br />
Än<strong>der</strong>ung se<strong>in</strong>er Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen zumutbar ist.<br />
an<strong>der</strong>weitige Versetzungsmöglichkeiten: dem Arbeitgeber dürfen an<strong>der</strong>weitige<br />
Versetzungsmöglichkeiten (<strong>in</strong>nerhalb des Konzerns) nicht möglich se<strong>in</strong>,<br />
Än<strong>der</strong>ungskündigung: ebenso muß <strong>der</strong> Arbeitgeber prüfen, ob er den Arbeitnehmer<br />
nach e<strong>in</strong>er Än<strong>der</strong>ungskündigung etwa unter verän<strong>der</strong>ten Bed<strong>in</strong>gungen weiterbeschäftigen<br />
kann (e<strong>in</strong>e Woche Bedenkzeit),<br />
zumutbare Fortbildung: zu prüfen ist, ob <strong>der</strong> Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach<br />
e<strong>in</strong>er eventuellen Fortbildung an e<strong>in</strong>em freien Arbeitsplatz weiter beschäftigen kann,<br />
absolute Sozialwidrigkeit: die betriebsbed<strong>in</strong>gte Kündigung ist <strong>in</strong> jedem Fall absolut<br />
sozialwidrig, wenn <strong>der</strong> Betriebsrat aus e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> <strong>in</strong> § 1 Abs. 2 Satz 2, 3 KSchG genannten<br />
Gründe form- und fristgerecht gekündigt hat,<br />
Beurteilungszeitpunkt: Die soziale Rechtfertigung <strong>der</strong> Kündigung ist im Zeitpunkt<br />
des Kündigungszuganges zu beurteilen; än<strong>der</strong>n sich die tatsächlichen Umstände nach<br />
Zugang <strong>der</strong> Kündigung, kann e<strong>in</strong>e Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>stellung bzw. Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses<br />
geboten se<strong>in</strong>.<br />
4. Interessenabwägung bei personen- u. verhaltensbed<strong>in</strong>gten Kündigungen<br />
Auf Seiten des Arbeitnehmers (spricht gegen Kündigung):<br />
Art, Häufigkeit u. Schwere <strong>der</strong> vorgeworfenen Pflichtwidrigkeit,<br />
früheres Verhalten des Arbeitnehmers,<br />
Dauer <strong>der</strong> Betriebszugehörigkeit und Lebensalter,<br />
soziale Lage des Arbeitsnehmers,<br />
Lage auf dem Arbeitsmarkt und Umsetzungsmöglichkeiten.<br />
Auf Seiten des Arbeitgebers (spricht für Kündigung):<br />
Funktionsfähigkeit des Betriebes,<br />
Arbeitsdiszipl<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitarbeiter,<br />
E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>es konkreten Schadens,<br />
Wie<strong>der</strong>holungsgefahr,<br />
e<strong>in</strong>schneidende Schädigung des Ansehens des Arbeitgebers.<br />
4a. Interessenabwägung bei betriebsbed<strong>in</strong>gten Kündigungen:<br />
die Interessenabwägung ist bei <strong>der</strong> betriebsbed<strong>in</strong>gten Kündigung e<strong>in</strong>geschränkt, weil<br />
die unternehmerische Entscheidung nicht „über die H<strong>in</strong>tertüre“ überprüft werden soll.<br />
die Interessenabwägung kann also nur noch <strong>in</strong> seltenen Fällen zu e<strong>in</strong>er für den Arbeitnehmer<br />
günstigen Entscheidung führen,<br />
mögliche Interessen s<strong>in</strong>d etwa die nur vorübergehende Weiterbeschäftigung, weil <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter aufgrund schwerwiegen<strong>der</strong> persönlicher Umstände beson<strong>der</strong>s schutzwürdig<br />
ist (etwa: Todesfall allernächster Angehöriger).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 145 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XIII. Umgang<br />
mit sog. „Low-<br />
Performern“<br />
5. Sozialauswahl (=Schutzbedürftigkeit Arbeitnehmer)<br />
Die Sozialauswahl wird nur bei <strong>der</strong> betriebsbed<strong>in</strong>gten Kündigung geprüft ! Hierbei wird gefragt,<br />
wie bzw. wer zu kündigen ist. Wird fehlerhaft sozial ausgewählt, ist die Kündigung<br />
sozialwidrig und damit nichtig.<br />
Die Sozialauswahl vollzieht sich <strong>in</strong> drei Schritten:<br />
Ermittlung vergleichbarer Arbeitnehmer,<br />
Auswahl <strong>der</strong> zu kündigenden Arbeitnehmer nach den <strong>in</strong> § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG genannten<br />
sozialen Gesichtspunkten (abschließende Kriterien: Lebensalter, Dauer <strong>der</strong> Betriebszugehörigkeit,<br />
Unterhaltspflichten, Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung),<br />
H<strong>in</strong>weis: Die Kriterien <strong>der</strong> Sozialauswahl s<strong>in</strong>d lediglich „ausreichend“ zu berücksichtigen;<br />
d.h., dass die Kriterien nur „vertretbar“ ersche<strong>in</strong>en müssen und nicht <strong>der</strong><br />
Entscheidung entsprechen müssen, die auch e<strong>in</strong> Gericht getroffen hätte, wenn es eigenverantwortlich<br />
soziale Erwägungen hätte anstellen müssen,<br />
Ausschluss <strong>der</strong> Weiterbeschäftigung wegen berechtigter betrieblicher Bedürfnisse<br />
(wirtschaftliche Bedürfnisse, wichtige Kundenkontakte),<br />
Ausnahme: e<strong>in</strong> Arbeitnehmer wurde wegen se<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>en Kenntnisse, Fähigkeiten,<br />
Leistungen o<strong>der</strong> <strong>zur</strong> Sicherung e<strong>in</strong>er ausgewogenen Personalstruktur des Betriebs<br />
(sog. Leistungsträgerklausel) aus <strong>der</strong> sozialen Auswahl ausgenommen, weil se<strong>in</strong>e<br />
Weiterbeschäftigung im betrieblichen Interesse liegt, § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG. Nach<br />
<strong>der</strong> Rechtsprechung ist allerd<strong>in</strong>gs auch immer das Interesse des sozial schwächeren<br />
Arbeitnehmers gegen das betriebliche Interesse auf Herausnahme des Leistungsträgers<br />
abzuwägen. Da meist (aber nicht immer) jüngere Arbeitnehmer zu den Leistungsträgern<br />
gehören, ist bei <strong>der</strong>en Herausnahme zu prüfen, <strong>in</strong>wieweit dar<strong>in</strong> nicht zugleich<br />
e<strong>in</strong>e Diskrim<strong>in</strong>ierung i.S.d. AGG liegen könnte (bei guter Begründung aber<br />
unproblematisch).<br />
Auswahlrichtl<strong>in</strong>ien (nach § 95 BetrVG können Betriebsrat und Arbeitgeber festlegen,<br />
wie die Auswahlrichtl<strong>in</strong>ien nach § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG zu berücksichtigen und im<br />
Verhältnis zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu bewerten s<strong>in</strong>d).<br />
Daher gibt es bei <strong>der</strong> Sozialauswahl e<strong>in</strong> sog. Punkteschema, nach dem bestimmt werden<br />
soll, wie die e<strong>in</strong>zelnen Sozialkriterien zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu gewichten s<strong>in</strong>d. Dieses Punkteschema<br />
ist zulässig und empfiehlt sich <strong>in</strong> gewissen Fällen, weil das Gericht im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Prüfung <strong>der</strong> richtigen Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers diese nur noch<br />
auf grobe Fehlerhaftigkeit bei <strong>der</strong> Anwendung des Punkteschemas prüfen kann.<br />
6. Darlegungs- und Beweislast<br />
Wenn das KSchG Anwendung f<strong>in</strong>det, so muß <strong>der</strong> Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess<br />
alle Tatsachen vortragen und beweisen, die die ausgesprochene Kündigung rechtfertigen.<br />
Aber: Bei <strong>der</strong> betriebsbed<strong>in</strong>gten Kündigung reicht nicht aus, sich pauschal auf<br />
die „schlechte Auftragslage“ o<strong>der</strong> „Rationalisierungsmaßnahmen“ zu berufen.<br />
Vielmehr gelten die Grundsätze <strong>der</strong> abgestuften Darlegungslast:<br />
Der Arbeitgeber muß zunächst darlegen, daß und wie die Maßnahme durchgeführt<br />
werden soll und daß sie durchführbar ist,<br />
Der Arbeitnehmer muß sodann darlegen, daß die Maßnahme unvernünftig, unsachlich<br />
o<strong>der</strong> willkürlich ist,<br />
schließlich legt <strong>der</strong> Arbeitgeber dar, wie die gleiche o<strong>der</strong> verm<strong>in</strong><strong>der</strong>te Arbeitsmenge<br />
nach se<strong>in</strong>en Vorstellungen <strong>in</strong> Zukunft von wem bewältigt werden soll.<br />
Son<strong>der</strong>problem: Umgang mit sog.<br />
„Low-Performern<br />
Obgleich <strong>der</strong> Arbeitsvertrag wie <strong>der</strong> Dienstvertrag nur vorsieht, daß <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
dem Arbeitgeber se<strong>in</strong>e Arbeitskraft für e<strong>in</strong>ige Zeit <strong>zur</strong> Verfügung zu<br />
stellen hat und dar<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e bestimmte Quantität o<strong>der</strong> Qualität geschuldet ist, muß<br />
die Arbeit dennoch gewissen Maßstäben genügen, die durchaus als Erfolgskriterien<br />
bezeichnet werden können.<br />
Problematisch ist daher, wie e<strong>in</strong> Arbeitgeber mit sog. leistungsschwachen Mitarbeitern,<br />
den „low-performern“ umgeht. Insbeson<strong>der</strong>e ist zu fragen, wie er diese
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 146 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
kündigen kann. Dies ist <strong>der</strong> Fall, wenn e<strong>in</strong>e erhebliche Schlechtleistung <strong>der</strong> Arbeit<br />
durch den Arbeitnehmer vorliegt.<br />
1. Festellung, ob <strong>der</strong> Mitarbeiter e<strong>in</strong> sog. Low-Performer ist, also e<strong>in</strong>e erhebliche<br />
Schlechtleistung erbr<strong>in</strong>gt<br />
E<strong>in</strong> Mitarbeiter ist e<strong>in</strong> Low-Performer, wenn er<br />
über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum Leistungen erbr<strong>in</strong>gt, die unter dem Durchschnitt<br />
liegen,<br />
wenn er deutlich schlechtere Leistungen erbr<strong>in</strong>gt, als früher,<br />
wenn er Weisungen des Vorgesetzten ungenügend ausführt,<br />
wenn er die Vorgaben aus Zielvere<strong>in</strong>barungen nicht erreicht,<br />
wenn er über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum ohne Erfolg bleibt.<br />
Unterdurchschnittliche Leistung über längeren Zeitraum<br />
Zur Ermittlung <strong>der</strong> Durchschnittsleistung zieht die Rechtsprechung des BAG<br />
die vergleichbare Leistung an<strong>der</strong>er Mitarbeiter heran, wobei auch überdurchschnittliche<br />
Leistungen herangezogen werden.<br />
Diese werden anschließend <strong>in</strong> Relation zu denen des betreffenden Arbeitnehmers<br />
gesetzt. Von diesen muß se<strong>in</strong>e Leistung über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum um<br />
m<strong>in</strong>destens 1 /3 abweichen. Dieser Zeitraum kann Wochen o<strong>der</strong> Monate umfassen.<br />
Abweichen von <strong>der</strong> früheren Leistung<br />
Das Abweichen von <strong>der</strong> eigenen Leistung ist leichter messbar für den Arbeitgeber,<br />
als e<strong>in</strong> Abweichen von <strong>der</strong> Vergleichsgruppe. Dafür muß <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
die 30%-Quote nicht e<strong>in</strong>gehalten werden. Es genügt auch schon e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres<br />
Nachlassen.<br />
Abweichen von Vorgaben für die Leistungserbr<strong>in</strong>gung<br />
Soweit <strong>der</strong> Arbeitnehmer von den realistischen Vorgaben des Arbeitgebers<br />
abweicht bzw. diese nicht ausreichend beachtet, liegt ebenfalls e<strong>in</strong>e Schlechtleistung<br />
vor.<br />
Mehrmaliges Nichterreichen des vere<strong>in</strong>barten Jahresziels<br />
Mehrmaliges Nichterreichen e<strong>in</strong>es vere<strong>in</strong>barten Jahresziels ist nicht zweifelsfrei<br />
e<strong>in</strong>e Schlechtleistung. Die e<strong>in</strong>seitige Vorgabe von Zielen o<strong>der</strong> die e<strong>in</strong>vernehmliche<br />
Festlegung von Prämien reichen jedenfalls nicht aus. Wenn jedoch<br />
<strong>der</strong> Arbeitnehmer bei Vorliegen e<strong>in</strong>er Zielvere<strong>in</strong>barung darlegt, daß er diese für<br />
erreichbar hält und dann mehrfach unterschreitet, liegt e<strong>in</strong>e Schlechtleistung<br />
vor.<br />
Vollkommene Erfolglosigkeit<br />
In Ausnahmefällen erkennt die Rechtsprechung an, dass das völlig Ausbleiben<br />
des vom Arbeitgeber vorausgesetzten Erfolges gleichwohl e<strong>in</strong>e kündigungsrelevante<br />
Schlechtleistung se<strong>in</strong> kann. Hierbei kommt es jedoch auf den E<strong>in</strong>zelfall<br />
an.<br />
Beispiel:<br />
E<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartenleiter<strong>in</strong>, die ihre Mitarbeiter schikaniert, auf die zu betreuenden<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht e<strong>in</strong>geht und zu ke<strong>in</strong>er sachlichen Kommunikation mit den Eltern<br />
imstande ist, kann wegen Erfolglosigkeit (Führungsschwäche) gekündigt<br />
werden.<br />
2. Konsequenzen: Kündigung von sog. Low-Performern<br />
Leistet <strong>der</strong> Arbeitnehmer - wie gesagt - über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum schlecht,<br />
so kommt e<strong>in</strong>e Kündigung <strong>in</strong> Betracht. Meist e<strong>in</strong>e solche aus verhaltens- o<strong>der</strong><br />
personenbed<strong>in</strong>gten Gründen.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 147 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XIV. Zugang <strong>der</strong><br />
Kündigungserklärung<br />
Verhaltensbed<strong>in</strong>gte Kündigung<br />
Die Schlechtleistung rechtfertigt e<strong>in</strong>e verhaltensbed<strong>in</strong>gte Kündigung, wenn sie<br />
vorwerfbar ist. Vorwerfbar s<strong>in</strong>d Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Konkret<br />
geht es darum, daß <strong>der</strong> Arbeitnehmer schlecht arbeitet, obwohl er es besser<br />
könnte.<br />
Erfor<strong>der</strong>lich ist e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>schlägige und vorherige Abmahnung des Arbeitnehmers.<br />
Die Zeit zwischen Abmahnung und Kündigung darf nicht zu kurz bemessen<br />
se<strong>in</strong>, um dem Arbeitnehmer die Gelegenheit zu geben, se<strong>in</strong>e Leistung<br />
zu bessern. Die noch vorzunehmende Interessenabwägung dürfte <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
zugunsten des Arbeitgebers ausgehen, weil das Verschulden dann e<strong>in</strong>deutig<br />
beim Arbeitnehmer liegt. Meist kommt es dann <strong>zur</strong> außerordentlichen Kündigung.<br />
Personenbed<strong>in</strong>gte Kündigung<br />
Auch wenn dem Arbeitnehmer die Schlechtleistung nicht vorwerfbar ist, kann<br />
sie e<strong>in</strong>e Kündigung rechtfertigen. Etwa dann, wenn die Schlechtleistung auf<br />
fortgeschrittenem Alter, auf Krankheit o<strong>der</strong> fehlenden Softskills (z.B. „mangelnde<br />
Führungsfähigkeit“) <strong>zur</strong>ückzuführen ist.<br />
In solchen Fällen bedarf es ke<strong>in</strong>er Abmahnung, weil <strong>der</strong> Arbeitnehmer von<br />
vorne here<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Leistungen nicht verbessern kann. Bei <strong>der</strong> Interessenabwägung<br />
ist allerd<strong>in</strong>gs dem Schutz älterer, langjähriger Arbeitnehmer Rechnung zu<br />
tragen. Regelmäßig wird es eher <strong>zur</strong> ordentlichen Kündigung kommen.<br />
3. Praktische Vorgehensweise des Arbeitgebers<br />
Meistens ist es schwierig zu eruieren, worauf die Schlechtleistung des Arbeitnehmers<br />
beruht. Dem trägt das BAG durch die sog. abgestufte Darlegungslast<br />
des Arbeitgebers Rechnung.<br />
Zunächst muß <strong>der</strong> Arbeitgeber die Schlechtleistung konkret darlegen. Dann<br />
muß <strong>der</strong> Arbeitnehmer dazu dezidiert Stellung beziehen. Schließlich muß <strong>der</strong><br />
Arbeitgeber diese en detail wi<strong>der</strong>legen.<br />
In <strong>der</strong> Praxis haben sich daher folgende Vorgehensweisen als zweckmäßig erwiesen:<br />
Geme<strong>in</strong>sames Gespräch im Beise<strong>in</strong> des Betriebsrates<br />
Ist <strong>der</strong> Arbeitgeber <strong>der</strong> Auffassung, <strong>der</strong> Arbeitnehmer arbeite schlecht, so sollte<br />
er zunächst e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Gespräch mit ihm führen, um vielleicht die möglichen<br />
Gründe zu erfahren - ggf. unter Beiziehung des Betriebsrates. So kann er<br />
sich auf die Situation besser e<strong>in</strong>stellen. Das Gespräch sollte protokolliert se<strong>in</strong><br />
und vom Arbeitnehmer nach Möglichkeit unterzeichnet werden.<br />
Arbeitskontrolle<br />
Der Arbeitgeber sollte zugleich die Leistungen des Arbeitnehmers regelmäßig<br />
kontrollieren und alle Mängel möglichst präzise und umfassend dokumentieren.<br />
Es s<strong>in</strong>d nach Möglichkeit alle greifbaren Schlechtleistungen abzumahnen.<br />
Erst nach mehrmaliger Abmahnung ist an e<strong>in</strong>e Kündigung zu denken.<br />
Annex zum Zugang <strong>der</strong> Kündigungserklärung<br />
Die Kündigung des Arbeitnehmers ist erst wirksam, wenn sie ihm zugegangen ist<br />
und er Kenntnis ihr erlangt hat. Es wird differenziert zwischen <strong>der</strong> dem Zugang<br />
<strong>der</strong> Kündigungserklärung unter Anwesenden und unter Abwesenden.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 148 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XV. Das Arbeitszeugnis<br />
1. Zugang <strong>der</strong> Kündigungserklärung unter Anwesenden<br />
Die Kündigungserklärung ist zugegangen, wenn das Schreiben an den Gekündigten<br />
persönlich ausgehändigt wurde.<br />
2. Zugang <strong>der</strong> Kündigungserklärung unter Abwesenden<br />
Die Kündigungserklärung ist zugegangen, wenn sie so <strong>in</strong> den Machtbereich<br />
des Empfängers gelangt ist, daß <strong>der</strong> Absen<strong>der</strong> damit rechnen kann, daß <strong>der</strong><br />
Gekündigte unter regelmäßigen Umständen Kenntnis von dem Inhalt nimmt.<br />
Das Schreiben gelangt <strong>in</strong> den Machtbereich des Empfängers (Gekündigten),<br />
wenn es:<br />
durch den Postboten, e<strong>in</strong>en sonstigen Boten o<strong>der</strong> den Kündigenden selbst<br />
<strong>in</strong> den Hausbriefkasten des Gekündigten geworfen wird,<br />
e<strong>in</strong>em erwachsenen Hausgenossen (Ehegatte, älteres K<strong>in</strong>d) o<strong>der</strong> ihm selbst<br />
ausgehändigt wird,<br />
als E<strong>in</strong>schreiben aufgegeben wurde und <strong>in</strong> den Hausbriefkasten geworfen<br />
wurde (bei Übergabee<strong>in</strong>schreiben erst bei Aushändigung an den Empfänger<br />
selbst; zuvor kann ihm nicht schon <strong>der</strong> Vorwurf <strong>der</strong> Zugangsvereitelung<br />
gemacht werden, wenn er das zunächst bei <strong>der</strong> Post aufbewahrte<br />
Übergabee<strong>in</strong>schreiben nicht abgeholt hat [ArbG Frankfurt, Az. 5 Ca<br />
6077/02]),<br />
Nach <strong>der</strong> Kündigung: Das Arbeitszeugnis<br />
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat das <strong>Pflege</strong>personal e<strong>in</strong>en Anspruch<br />
auf e<strong>in</strong> schriftliches Zeugnis. Dies folgt aus § 630 BGB, §§ 109, 113 GewO.<br />
1. Entstehung des Anspruchs<br />
Der Zeugnisanspruch entsteht schon angemessen Zeit vor Ablauf <strong>der</strong> tatsächlichen<br />
Arbeitszeit, damit sich <strong>der</strong> Arbeitnehmer bei e<strong>in</strong>em neuen Arbeitgeber<br />
leichter bewerben kann. Er verjährt nach drei Jahren. Um e<strong>in</strong>er möglichen<br />
Verwirkung des Anspruchs vor Ablauf <strong>der</strong> Verjährung entgegenzutreten ist<br />
an<strong>zur</strong>aten, dass <strong>der</strong> Arbeitnehmer se<strong>in</strong>en Zeugnisanspruch bereits kurze Zeit<br />
vor o<strong>der</strong> nach dem Ausscheiden bei se<strong>in</strong>em alten Arbeitgeber den Anspruch<br />
geltend macht.<br />
Schon nach Ausspruch <strong>der</strong> Kündigung, Abschluss des Aufhebungsvertrages<br />
o<strong>der</strong> <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es angemessenen Zeitraumes vor Ablauf e<strong>in</strong>es befristeten<br />
Arbeitsverhältnisses kann das Zeugnis bereits begehrt werden.<br />
Wird das Zeugnis durch Verschulden des Arbeitgebers zu spät ausgestellt,<br />
kann dies Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers auslösen, weil<br />
sich dieser dann nicht rechtzeitig bei an<strong>der</strong>en Firmen bewerben kann.<br />
2. Inhalt des Anspruchs<br />
Der Arbeitgeber muss nur dann e<strong>in</strong> Zeugnis erstellen, wenn <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
dies verlangt. Der Arbeitgeber muß hierbei:<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber kann die Ausstellung des Arbeitszeugnisses zwar delegieren<br />
auf e<strong>in</strong>e nachgelagerte E<strong>in</strong>heit - jedoch muß das Zeugnis stets von e<strong>in</strong>em<br />
ranghöheren Vorgesetzten des Arbeitnehmers unterschrieben
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 149 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
se<strong>in</strong>, dessen Stellung muß sich aus dem Zeugnis ergeben (BAG, Urt. v.<br />
04.10.2005, Az.: 9 AZR 507/04),<br />
die Formalitäten e<strong>in</strong>halten (ungefalteter Geschäftsbogen DIN A 4 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher<br />
Masch<strong>in</strong>enschrift [Zeugnis kann aber gefaltet an Arbeitnehmer<br />
gesandt werden, das er meist Kopien hiervon anfertigt, bei denen die Falte<br />
nicht zu sehen ist]; Orig<strong>in</strong>alunterschrift; mit PC geschrieben; Überschrift<br />
[„Zeugnis“]; Text muß ohne Merkmale se<strong>in</strong> [ke<strong>in</strong> Fett, Kursiv, Un<strong>der</strong>l<strong>in</strong>e<br />
o<strong>der</strong> Ausrufezeichen]; ke<strong>in</strong>e Schreibfehler, Verbesserungen, Flecken,<br />
Streichungen [BAG, Az.: 5 AZR 182/92]),<br />
das Zeugnis rechtzeitig <strong>zur</strong> Abholung bereithalten,<br />
das Zeugnis muß <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em sachlichen Gehalt vollständig se<strong>in</strong>, den Tatsachen<br />
entsprechen und darf nichts Unwahres enthalten,<br />
es muß auch den allg. <strong>in</strong>haltlichen Anfor<strong>der</strong>ungen entsprechen (Personenangaben<br />
Arbeitnehmer [Name, Titel etc., ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nerbetrieblichen Bezeichnungen<br />
{„Ober<strong>in</strong>genieur“}]; E<strong>in</strong>- / Austrittsdatum [ohne Fehlzeiten,<br />
etc.]; Tätigkeitsbeschreibung [Beschreibung des Aufgabengebietes u. bei<br />
leitenden Angestellten die Stellung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Hierarchie]; Betriebsratszugehörigkeit<br />
/ Gewerkschaftstätigkeit [nur bei freigestellten Betriebs- u.<br />
Gewerkschaftsräten]),<br />
die Schlussformulierung (Beendigungsgründe müssen nicht zw<strong>in</strong>gend<br />
aufgenommen werden, auch nicht die „Dankes-Bedauerns-Formel“ sowie<br />
die guten Zukunftswünsche); fehlt die Schlussformel, ist <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
froh, den Mitarbeiter los zu se<strong>in</strong>.<br />
Bei unrichtigem Zeugnis (sachlich, <strong>in</strong>haltlich und grammatikalisch) hat <strong>der</strong><br />
Arbeitnehmer e<strong>in</strong>en Zeugnisberichtigungsanspruch (BAG, Betrieb 2005,<br />
2360). Dies gilt erst recht für die Fälle, wo <strong>der</strong> Arbeitgeber den grammatikalisch<br />
motivierten Berichtigungswunsch des Arbeitnehmers nutzt, um<br />
nachträglich auch <strong>in</strong>haltliche Verän<strong>der</strong>ungen vorzunehmen (BAG, a.a.O.,<br />
ebd.).<br />
3. Art und Umfang des Anspruchs<br />
a. Zwischenzeugnis<br />
Das Zwischenzeugnis wird nur bei Vorliegen triftiger Gründe erteilt.<br />
Diese s<strong>in</strong>d:<br />
beträchtliche betriebliche Verän<strong>der</strong>ungen (z.B. Betriebsübernahme,<br />
Insolvenz, Wechsel des Vorgesetzten),<br />
persönliche Verän<strong>der</strong>ungen des Mitarbeiters (z.B. Umsetzung,<br />
Fortbildung, längere Arbeitsunterbrechung ab e<strong>in</strong>em Jahr [Erziehungsurlaub]),<br />
zwecks Vorlage bei Behörden und Gerichten, für e<strong>in</strong>en Kreditantrag<br />
o<strong>der</strong> auch für e<strong>in</strong>e Bewerbung.<br />
b. e<strong>in</strong>faches Zeugnis<br />
Das e<strong>in</strong>fache Zeugnis bestätigt Art und Dauer des Dienstverhältnisses.<br />
Es ist e<strong>in</strong> bloßer Beschäftigungsnachweis und Wertungen werden<br />
dar<strong>in</strong> nicht vorgenommen. Inhaltlich erstreckt es sich nur auf obj.<br />
Tatbestände, die je<strong>der</strong>zeit nachprüfbar s<strong>in</strong>d.<br />
c. qualifiziertes Zeugnis<br />
Das qualifizierte Arbeitszeugnis muß <strong>der</strong> Arbeitgeber nur auf Verlangen<br />
ausstellen. Es handelt sich um e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Zeugnis, das um e<strong>in</strong>e<br />
Beschreibung und Beurteilung <strong>der</strong> Leistung und Führung des Arbeitnehmers<br />
erteilt wird. Es soll:<br />
die Gesamtpersönlichkeit des Arbeitnehmers wie<strong>der</strong>geben und<br />
würdigen,<br />
das körperliche und geistige Arbeitsvermögen erfassen,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 150 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
das Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen wie<strong>der</strong>geben,<br />
die Fachkenntnisse, Verhandlungsgeschick, Ausdrucksvermögen,<br />
Integrationsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Entscheidungsbereitschaft<br />
würdigen,<br />
bei alledem sollen die Formulierungen zwischen Wahrheit und<br />
Wohlwollen balancieren (Folge: es werden ke<strong>in</strong>e negativen gewählt,<br />
son<strong>der</strong>n abgestuft positive Formulierungen),<br />
die Bewertung erfolgt meist <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er umschriebenen Benotung.<br />
4. Ausgestaltung des Zeugnis<strong>in</strong>halts<br />
Das qualifizierte Zeugnis muss Aussagen treffen über die Leistungsfähigkeit<br />
und Sozialverhalten des Mitarbeiters. Dennoch s<strong>in</strong>d auch gewisse Tabus zu<br />
beachten, die nachstehend dargelegt werden.<br />
a. Leistungsbeurteilung<br />
Die Leistungsbeurteilung enthält Aussagen über die Arbeitsmenge<br />
und -güte sowie die Arbeitsbereitschaft des Zeugnisempfängers. Es<br />
werden folgende Faktoren bewertet:<br />
Fachwissen,<br />
Auffassungsgabe und Problemlösungsfähigkeit,<br />
Leistungsbereitschaft und Eigen<strong>in</strong>itiative,<br />
Belastbarkeit,<br />
Denk- und Urteilsvermögen,<br />
Zuverlässigkeit,<br />
Fachkönnen und ggf. Führungsfähigkeit.<br />
b. Verhaltensbeurteilung<br />
Bei <strong>der</strong> Bewertung des Verhaltens geht es vornehmlich um das Sozialverhalten<br />
(Vorgesetzten, Kollegen und Dritten gegenüber) bzw. die<br />
Menschenführung. Im E<strong>in</strong>zelnen:<br />
Teamfähigkeit,<br />
Kontaktvermögen,<br />
Kommunikations- und Hilfsbereitschaft,<br />
Aufgeschlossenheit,<br />
Loyalität.<br />
c. Tabus<br />
Negative Beobachtungen und Bemerkungen s<strong>in</strong>d im Arbeitszeugnis<br />
unzulässig. Vorgänge vor Dienstbeg<strong>in</strong>n und außerdienstliches Verhalten<br />
gehören nicht hierh<strong>in</strong>. Dazu gehören etwa:<br />
Gehalt,<br />
Kündigungsgründe,<br />
Vorstrafen,<br />
Abmahnungen,<br />
Krankheiten / Fehlzeiten,<br />
Leistungsabfall,<br />
Alkoholabhängigkeit,<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen.<br />
5. Zeugnisformulierungen<br />
a. Gesamtleistungsbeurteilung<br />
sehr gut: „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 151 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Obwohl das Adjektiv „voll“ nicht steigerbar ist, hat sich <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Praxis die vorstehende Formulierung e<strong>in</strong>gebürgert - <strong>zur</strong> Vermeidung<br />
<strong>der</strong> grammatikalischen Unrichtigkeit kann auch wie folgt<br />
formuliert werden: „waren wir stets außerordentlich zufrieden“:<br />
gut: „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“.<br />
befriedigend: „zu unserer vollen Zufriedenheit“.<br />
ausreichend: „zu unserer Zufriedenheit“.<br />
mangelhaft: „im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit“.<br />
b. Allgeme<strong>in</strong>e Formulierungsbeispiele<br />
Er/Sie bewies für die Belange <strong>der</strong> Belegschaft stets E<strong>in</strong>fühlungsvermögen:<br />
Er/Sie suchte Sexualkontakte im Betrieb.<br />
Er/Sie hat <strong>zur</strong> Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen: Er/Sie<br />
hatte gegen e<strong>in</strong>en Schluck Alkohol im Dienst nichts e<strong>in</strong>zuwenden.<br />
Er/Sie trat engagiert für die Interessen <strong>der</strong> Arbeitnehmer/Kollegen<br />
auf: Er/Sie war als Betriebsrat tätig.<br />
Se<strong>in</strong>e/Ihre Auffassung wusste er/sie <strong>in</strong>tensiv zu vertreten: Der Mitarbeiter<br />
war vorlaut.<br />
Se<strong>in</strong>/Ihr Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten war<br />
stets e<strong>in</strong>wandfrei: Die Kollegen werden zuerst genannt. Der Arbeitnehmer<br />
hatte also zu se<strong>in</strong>en Kollegen e<strong>in</strong> besseres Verhältnis<br />
als zu se<strong>in</strong>em Vorgesetzten.<br />
Er/Sie war e<strong>in</strong> gutes Vorbild durch se<strong>in</strong>e/ihre Pünktlichkeit: Er/Sie<br />
war nur pünktlich und hat schlechte Arbeitsleistungen erbracht.<br />
Er/Sie hat alle Arbeiten ordnungsgemäß erledigt: Er/Sie zeigte ke<strong>in</strong>erlei<br />
Eigen<strong>in</strong>itiative.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 152 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Fallgeschehen<br />
II. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit II.26:<br />
Sexualdelikte und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz<br />
- Zeitdauer: 2 Std. -<br />
Lerne<strong>in</strong>heit: Strafrechtliche Folgen sexueller Belästigung<br />
Der Angeklagte, e<strong>in</strong> Oberarzt, nahm an Patient<strong>in</strong>nen, die stationär <strong>in</strong> <strong>der</strong> neurologischen<br />
Universitätskl<strong>in</strong>ik aufgenommen waren, im Rahmen von neurologischen Untersuchungen<br />
und von Therapien sexuelle Handlungen vor, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e täuschte<br />
er Untersuchungshandlungen an den Brüsten und im Genitalbereich vor, die zum<br />
Teil mit e<strong>in</strong>er Stimmgabel, zum Teil mit den F<strong>in</strong>gern durchgeführt wurden. E<strong>in</strong>er<br />
Patient<strong>in</strong> griff er sogar während e<strong>in</strong>er Therapiesitzung <strong>in</strong> die Schamhaare.<br />
II. Ansatz Der vorliegende Fall war vom Bundesgerichtshof zu entscheiden (BGH, NStZ 2004,<br />
631). Es stellt sich die Frage nach <strong>der</strong> Strafbarkeit sexueller Handlungen unter dem<br />
Deckmantel mediz<strong>in</strong>ischer Behandlung. E<strong>in</strong>schlägig ist § 174a Abs. 2 StGB.<br />
III. Prüfung Prüfungskarte Sexueller Missbrauch von Kranken (§ 174a II StGB)<br />
1. Vorbemerkung<br />
a. Geschütztes Rechtsgut<br />
Der § 174a Abs. 2 StGB schützt ausschließlich die Freiheit des Kranken o<strong>der</strong><br />
Hilfsbedürftigen. Denn se<strong>in</strong> Zustand erschwert e<strong>in</strong>en normalen Wi<strong>der</strong>stand und<br />
se<strong>in</strong>e Abhängigkeit von Hilfe und Betreuung kann als Druckmittel <strong>zur</strong> Überw<strong>in</strong>dung<br />
von Wi<strong>der</strong>stand ausgenutzt werden.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund ist für die Strafbarkeit entscheidend, dass <strong>der</strong> Täter das<br />
Opfer gerade unter Ausnutzung von dessen Krankheit missbraucht.<br />
b. Tatobjekt<br />
2. Tatbestand<br />
Die Vorschrift erfasst den sexuellen Missbrauch von Personen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>richtung<br />
für Kranke o<strong>der</strong> Hilfsbedürftige aufgenommen s<strong>in</strong>d, wobei auch hier nur<br />
mit körperlicher Berührung verbundene sexuelle Kontakte strafbar s<strong>in</strong>d.<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Tathandlung ist die aktive wie passive Vornahme sexueller Handlungen am<br />
Kranken o<strong>der</strong> durch den Kranken.<br />
E<strong>in</strong>richtung: Hierunter fallen vor allem Kl<strong>in</strong>iken, Kurheime, Rehazentren,<br />
Nervenheilanstalten, Heime, Wohnstätten für Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te und Altenheime,<br />
soweit sie <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong> Hilfebedürftiger und Kranker dienen,<br />
Anvertrauen <strong>zur</strong> Beaufsichtigung o<strong>der</strong> Betreuung: In diesem Verhältnis<br />
stehen Ärzte, das Stationspflegepersonal, Masseure und mediz<strong>in</strong>ische Bademeister,<br />
wenn sie generell o<strong>der</strong> im E<strong>in</strong>zelfall für die Beaufsichtigung zu sorgen<br />
haben (= nicht <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>r auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Station),
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 153 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Ausnutzen <strong>der</strong> Krankheit: Täter weiß, dass Opfer physisch und psychisch<br />
geschwächt ist und Hilfe benötigt; er spiegelt ihm die sexuelle Handlung als<br />
mediz<strong>in</strong>isch notwendige Maßnahme vor (nicht: Ausnutzen des Vertrauens,<br />
das Patienten dem Arzt gewöhnlich entgegenbr<strong>in</strong>gen),<br />
das Opfer muss die Handlung an sich dulden, weil es sich dadurch Hilfe erhofft<br />
(BGH, NStZ 2004, 353),<br />
Sexuelle Handlungen: Dies s<strong>in</strong>d alle solchen Handlungen, die <strong>in</strong> ihrem Gesamtvorgang<br />
e<strong>in</strong>en Sexualbezug aufweisen, nicht dagegen äußerlich völlig<br />
neutrale Handlungen, die ke<strong>in</strong>erlei H<strong>in</strong>weis auf das Geschlechtliche enthalten<br />
(auch wenn sie e<strong>in</strong>em sexuellen Motiv entspr<strong>in</strong>gen).<br />
Merke: Auf den Ort des sexuellen Kontaktes kommt es ebenso wenig an<br />
(auch: Spaziergang im Kl<strong>in</strong>ikpark) , wie auf die Dauer <strong>der</strong> Unterbr<strong>in</strong>gung.<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
3. Rechtswidrigkeit<br />
4. Schuld<br />
In gewissen Fällen kann es wegen <strong>der</strong> Anwendung des § 21 StGB <strong>zur</strong> M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
des Schuldvorwurfes kommen, wenn <strong>der</strong> Sexualstraftäter an e<strong>in</strong>er<br />
Persönlichkeitsstörung (Triebstörung) leidet, die zu e<strong>in</strong>em Steuerungsverlust<br />
führen kann.<br />
5. Beispielsfall aus <strong>der</strong> Tagespresse:<br />
Quelle: Focus Onl<strong>in</strong>e vom 23.06.2008, 18.04 Uhr<br />
Narkosearzt unter Missbrauchsverdacht<br />
In e<strong>in</strong>em bayerischen Kl<strong>in</strong>ikum soll e<strong>in</strong> Oberarzt mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben. Offenbar<br />
täuschte er se<strong>in</strong>en Opfern e<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>ische Studie vor.<br />
Nach Angaben <strong>der</strong> Krim<strong>in</strong>alpolizei im oberpfälzischen Amberg soll <strong>der</strong> 49-Jährige die zehn bis<br />
zwölf Jahre alten K<strong>in</strong><strong>der</strong> ohne die Eltern <strong>in</strong> se<strong>in</strong> Zimmer bestellt haben. So soll <strong>der</strong> Arzt die Mädchen<br />
dazu gebracht haben, sich vor ihm auszuziehen. Dann soll er sich an den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n vergangen<br />
haben.<br />
Die genaue Zahl <strong>der</strong> Opfer stehe noch nicht fest, sagte e<strong>in</strong> Polizeisprecher. Die Ermittler gehen von<br />
fünf bis zehn Schüler<strong>in</strong>nen aus. Bislang ist unklar, ob es neben unsittlichen Berührungen auch zu<br />
schwereren Missbrauchsfällen kam. Der Anästhesist macht zu den Vorwürfen ke<strong>in</strong>e Angaben.<br />
Die Taten sollen sich bereits Ende 2007 ereignet haben. Die Ermittlungen kamen <strong>in</strong>s Rollen, als die<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> dann später ihren Eltern davon erzählten. Nach Angaben des Krankenhauses hatte zudem<br />
e<strong>in</strong>e Bekannte des 49-Jährigen den Kl<strong>in</strong>ikvorstand kürzlich über sexuelle Übergriffe des Arztes auf<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> im privaten Bereich <strong>in</strong>formiert.<br />
Vor zwei Wochen wurde <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Büro vorübergehend festgenommen, e<strong>in</strong> Haftbefehl<br />
wurde allerd<strong>in</strong>gs nicht beantragt. Nach den Vernehmungen kam er wie<strong>der</strong> auf freien Fuß. Die<br />
Krim<strong>in</strong>albeamten beschlagnahmten die Festplatte des Dienstcomputers des Arztes sowie e<strong>in</strong>en privaten<br />
tragbaren Rechner. Die Daten würden <strong>der</strong>zeit ausgewertet, sagte <strong>der</strong> Polizeisprecher.<br />
Das städtische Krankenhaus teilte mit, dass <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>er sofort suspendiert worden sei und Hausverbot<br />
erhalten habe. Zudem sei <strong>der</strong> Arbeitsvertrag e<strong>in</strong>e Woche nach Bekanntwerden <strong>der</strong> Vorwürfe<br />
von <strong>der</strong> Kl<strong>in</strong>ik gekündigt worden. Der Anästhesist hatte 17 Jahre <strong>in</strong> dem Oberpfälzer Kl<strong>in</strong>ikum gearbeitet<br />
und <strong>in</strong> dieser Zeit auch e<strong>in</strong> regionales Rettungszentrum mit aufgebaut. Nach bisherigen Ermittlungen<br />
hat <strong>der</strong> Mann über se<strong>in</strong>e Rettungstätigkeit Kontakt zu den betroffenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n gehabt.<br />
Der Vorgesetzte des entlassenen Arztes sagte, dass <strong>der</strong> Kollege <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit e<strong>in</strong>e gute Arbeit<br />
gemacht habe. Die Kl<strong>in</strong>ikleitung erklärte, dass sich die möglichen Taten außerhalb <strong>der</strong> Dienstzeit<br />
des Mediz<strong>in</strong>ers ereignet hätten und daher nicht direkt Patienten betroffen gewesen seien. Die<br />
Polizei wollte dies so nicht bestätigen. Die Kl<strong>in</strong>ik hat <strong>in</strong>sgesamt rund 1300 Mitarbeiter.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 154 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Fallgeschehen<br />
5. Annex: DNA-Analyse<br />
Nach § 81g StPO können e<strong>in</strong>em Sexualstraftäter zum Zwecke <strong>der</strong> Identitätsfeststellung<br />
<strong>in</strong> künftigen Strafverfahren Körperzellen entnommen werden, um<br />
Beweise für zukünftige Strafverfahren zu gew<strong>in</strong>nen (sog. DNA-Analyse).<br />
Voraussetzungen:<br />
es besteht <strong>der</strong> Verdacht e<strong>in</strong>er Straftat von erheblichem Gewicht,<br />
Verbrechen o<strong>der</strong> Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung<br />
(NICHT: Exhibitionismus [§ 183 StGB], Erregung öffentlichen Ärgernisses<br />
[§ 183a StGB] und Ausübung <strong>der</strong> verbotenen Prostitution [§ 184a<br />
StGB]),<br />
gefährliche Körperverletzung,<br />
beson<strong>der</strong>s schwerer Diebstahl,<br />
durch diese Maßnahme muß <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em künftigen Strafverfahren e<strong>in</strong> Aufklärungserfolg<br />
zu erwarten se<strong>in</strong> (dies wird immer angenommen bei Straftaten,<br />
bei denen <strong>der</strong> Täter im Rahmen <strong>der</strong> Tatausführung Körperzellen ausson<strong>der</strong>t<br />
[= vor allem bei Sexualstraftaten]),<br />
es ist die Prognose zu stellen, ob <strong>der</strong> Täter auch künftig erneut Straftaten<br />
von erheblichem Gewicht (= Sexualstraftaten) begehen wird. Anhaltspunkte<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
Anlasstat (= Tat, weswegen DNA-Probe angeordnet werden soll),<br />
Vorstrafen (ggf. Haftstrafen),<br />
Rückfallgeschw<strong>in</strong>digkeit (etwa wegen Betäubungsmittelabhängigkeit),<br />
Prägung <strong>in</strong> Richtung bestimmte Delikte,<br />
Motivationslage bei früheren Delikten,<br />
<strong>der</strong>zeitige Lebensumstände.<br />
die Maßnahme wurde von e<strong>in</strong>em Ermittlungsrichter angeordnet,<br />
Merke: die Entnahme <strong>der</strong> Speichelprobe bedarf ke<strong>in</strong>er richterlichen Anordnung,<br />
wohl aber <strong>der</strong>en Sicherung und Speicherung !<br />
es liegt bislang ke<strong>in</strong> DNA-Identifizierungsmuster vor.<br />
Liegen die vorbezeichneten Voraussetzungen nicht vor und wird dennoch e<strong>in</strong>e<br />
Speichelprobe entnommen, darf sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Strafverfahren nicht<br />
verwertet werden (= sog. Verwertungsverbot).<br />
Die gewonnenen DNA-Identifizierungsmuster dürfen gemäß § 2 DNA-IFG<br />
beim BKA zentral gespeichert und genutzt werden.<br />
Der Angeklagte, e<strong>in</strong> Oberarzt, nahm an Patient<strong>in</strong>nen, die aufgrund ihrer geistigen<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung im Landeskrankenhaus aufgenommen waren, sexuelle<br />
Handlungen vor.<br />
II. Prüfung Prüfungskarte Sexueller Missbrauch von geistig und seelisch<br />
Kranken (§ 174c StGB)<br />
1. Vorbemerkung<br />
a. Geschütztes Rechtsgut<br />
Der § 174c StGB schützt die sexuelle Selbstbestimmung von Personen, die aufgrund<br />
e<strong>in</strong>er psychischen Bee<strong>in</strong>trächtigung o<strong>der</strong> Suchtkrankheit <strong>in</strong> Abhängigkeit zu den sie<br />
beratenden, behandelnden o<strong>der</strong> betreuenden Personen geraten können und diesen<br />
gegenüber deshalb e<strong>in</strong>es beson<strong>der</strong>en Schutzes vor sexuellen Übergriffen bedürfen.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 155 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Fallgeschehen<br />
b. Geschützter Personenkreis<br />
Zum geschützten Personenkreis gehört jede Person <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er psychotherapeutischen<br />
Behandlung. Also e<strong>in</strong>er Behandlung, die <strong>der</strong> Feststellung, Behebung o<strong>der</strong> L<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
e<strong>in</strong>es konkreten psychischen Leidens dient.<br />
Nicht dagegen seelsorgerische Gespräche o<strong>der</strong> Beratung <strong>in</strong> Lebenslagen.<br />
c. Berufsrechtliche Auswirkungen<br />
2. Tatbestand<br />
Die Vorschrift schützt darüber h<strong>in</strong>aus auch die Integrität und Lauterkeit <strong>der</strong> betreffenden<br />
Behandlungs- und Betreuungsverhältnisse sowie das Vertrauen <strong>der</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> diese.<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Tathandlung ist die aktive wie passive Vornahme sexueller Handlungen am<br />
Kranken o<strong>der</strong> durch den Kranken.<br />
geistige o<strong>der</strong> seelische Krankheiten: Dies s<strong>in</strong>d alle krankhaften seelischen<br />
Störungen, die sich als bleibend o<strong>der</strong> lang anhaltend herausstellen. Als geistige<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung gelten alle angeborenen o<strong>der</strong> erworbenen Intelligenzdefekte.<br />
das Opfer ist dem Täter <strong>zur</strong> Behandlung/Betreuung anvertraut.<br />
Tathandlung:<br />
<strong>der</strong> Täter nimmt an <strong>der</strong> ihm anvertrauten Person sexuelle Handlungen vor<br />
o<strong>der</strong> lässt diese an sich vornehmen unter Missbrauch des Behandlungs-<br />
o<strong>der</strong> Betreuungsverhältnisses,<br />
entscheidend ist nicht das Ausnutzen von Behandlungsabhängigkeiten,<br />
son<strong>der</strong>n dass sexuelle Kontakte zu den Anvertrauten generell unterbunden<br />
werden,<br />
dies gilt auch für psychotherapeutische Behandlungsverhältnisse, weil die<br />
Patienten oft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e tiefgreifende Abhängigkeit zum Therapeuten geraten,<br />
beson<strong>der</strong>es Augenmerk gilt den sog. körperbetonten Therapieformen, bei<br />
denen geprüft werden muß, ob die Erheblichkeitsschwelle überschritten ist.<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
3. Rechtswidrigkeit und Schuld<br />
Der 77-jährige Patient Walter B. ist bettlägerig. Als die junge und attraktive<br />
Krankenschwester Berta H. ihn umbetten möchte, macht er ihr gegenüber anzügliche<br />
Bemerkungen und fasst ihr leicht an das Gesäß.<br />
Auf e<strong>in</strong>mal holt er e<strong>in</strong> Messer hervor und for<strong>der</strong>t Berta auf, ihn gegen ihren<br />
Willen oral zu befriedigen. Sie sieht ke<strong>in</strong>e Chance und fügt sich.<br />
II. Prüfung Prüfungskarte Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung<br />
(§ 177 StGB)
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 156 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
1. Vorbemerkung<br />
2. Tatbestand<br />
Geschütztes Rechtsgut<br />
Der § 177 StGB schützt die sexuelle Selbstbestimmung von Personen, gleich welchen<br />
Geschlechts o<strong>der</strong> Alters.<br />
a. objektiver Tatbestand <strong>der</strong> sexuellen Nötigung<br />
Die sexuelle Nötigung setzt voraus, dass e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Person mit Gewalt, durch<br />
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib o<strong>der</strong> Leben o<strong>der</strong> unter Ausnutzung<br />
e<strong>in</strong>er Lage, <strong>in</strong> <strong>der</strong> das Opfer <strong>der</strong> E<strong>in</strong>wirkung des Täters schutzlos ausgeliefert<br />
ist, genötigt wird, sexuelle Handlungen des Täters an sich zu dulden o<strong>der</strong> an<br />
dem Täter vorzunehmen.<br />
Die sexuelle Nötigung besteht aus zwei Akten: Der Nötigung und <strong>der</strong> damit <strong>in</strong> Zusammenhang<br />
stehenden sexuellen Handlung.<br />
aa. Nötigungskomponente<br />
Die Nötigung muß durch Gewalt, Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für<br />
Leib und Leben o<strong>der</strong> unter Ausnutzung e<strong>in</strong>er Lage, <strong>in</strong> <strong>der</strong> das Opfer dem Täter<br />
schutzlos ausgeliefert ist, erfolgen.<br />
Merke: Schutzlos ausgeliefert ist das Opfer schon dann, wenn es sich aufgrund physischer<br />
Unterlegenheit o<strong>der</strong> psychischer Hemmung nicht selbst zu verteidigen weiß und<br />
auch ke<strong>in</strong>e Hilfe Dritter erlangen kann.<br />
bb. sexuelle Komponente<br />
Die Nötigung muß das f<strong>in</strong>ale (= ziel- und zweckgerichtete) Mittel <strong>zur</strong> Erzw<strong>in</strong>gung<br />
<strong>der</strong> sexuellen Handlung se<strong>in</strong>.<br />
Das Abgenötigte Verhalten (= auch die Duldung e<strong>in</strong>es sexuellen Verhaltens )<br />
besteht dar<strong>in</strong>, dass das Opfer sexuelle Handlungen des Täters an sich duldet<br />
o<strong>der</strong> am Täter vornimmt. Auch muss die Kausalität zwischen <strong>der</strong> sexuellen<br />
Handlung und <strong>der</strong> Nötigungshandlung bestehen.<br />
b. objektiver Tatbestand <strong>der</strong> Vergewaltigung<br />
Die Vergewaltigung ist e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>s schwerer Fall <strong>der</strong> sexuellen Nötigung.<br />
Tathandlung ist:<br />
dass <strong>der</strong> Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht o<strong>der</strong><br />
ähnliche Handlungen am Opfer vornimmt o<strong>der</strong> an sich vornehmen lässt, die dieses<br />
beson<strong>der</strong>s erniedrigen<br />
Analverkehr,<br />
Oralverkehr (BGH, Beschl. v. 28.07.2004, Az. 2 StR 207/04),<br />
E<strong>in</strong>führen des F<strong>in</strong>gers <strong>in</strong> den After (BGH, NStZ 1999, 325)<br />
Qualifikationshandlung:<br />
<strong>der</strong> Täter führt e<strong>in</strong> Messer o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e sonstige Waffe mit sich, um den Wi<strong>der</strong>stand<br />
des Opfers zu brechen.<br />
c. subjektiver Tatbestand<br />
Der Vorsatz entfällt aber etwa, wenn <strong>der</strong> Täter nicht weiß, das die anfangs bestehende<br />
Bereitschaft des Opfers nicht mehr gegeben ist.<br />
3. Rechtswidrigkeit<br />
4. Schuld
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 157 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Fallgeschehen<br />
Der <strong>Pflege</strong>direktor Manfred M. des Kölner Universitätskl<strong>in</strong>ikums stellt <strong>der</strong><br />
Krankenschwester Berta B. im Treppenhaus nach, packt sie an den Armen,<br />
zeigt <strong>der</strong> verdutzten Frau se<strong>in</strong> entblößtes und erigiertes Geschlechtsteil und<br />
beg<strong>in</strong>nt zu masturbieren.<br />
II. Prüfung Prüfungskarte Strafbarkeit Exhibitionismus<br />
(§ 183 StGB)<br />
1. Vorbemerkung<br />
2. Tatbestand<br />
Geschütztes Rechtsgut<br />
Der § 183 StGB soll den E<strong>in</strong>zelnen vor ungewollter Konfrontation mit möglicherweise<br />
schockierenden sexuellen Handlungen an<strong>der</strong>er schützen, nicht aber primär das<br />
Interesse <strong>der</strong> Bevölkerung, dass sich niemand <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit entblößt.<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Def. Exhibitionistische Handlung:<br />
E<strong>in</strong>e exhibitionistische Handlung liegt vor, wenn <strong>der</strong> Täter e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en (regelmäßig<br />
e<strong>in</strong>er Frau o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d) ohne dessen E<strong>in</strong>verständnis und vielfach<br />
überraschend se<strong>in</strong>en entblößten Geschlechtsteil vorzeigt, um sich entwe<strong>der</strong><br />
alle<strong>in</strong> dadurch o<strong>der</strong> durch die Beobachtung <strong>der</strong> Reaktion des an<strong>der</strong>en sexuell<br />
zu erregen, se<strong>in</strong>e sexuelle Erregung zu steigern o<strong>der</strong> (ggf. durch Masturbation)<br />
zu befriedigen (H<strong>in</strong>weis: Das Opfer muß die sexuelle Handlung auch als solche<br />
erkennen können).<br />
Ke<strong>in</strong>e exhibitionistische Handlung ist das Entblößen des Geschlechtsteils:<br />
zu Provokation,<br />
<strong>zur</strong> Demonstration <strong>der</strong> Nacktheit,<br />
beim Ur<strong>in</strong>ieren.<br />
Durch die Handlung muß das Opfer belästigt worden se<strong>in</strong>, wozu jede negative Gefühlsempf<strong>in</strong>dung<br />
von e<strong>in</strong>igem Gewicht ausreicht.<br />
Ke<strong>in</strong>e Belästigung liegt vor, wenn<br />
<strong>der</strong> Betroffene lediglich Mitleid mit dem Täter empf<strong>in</strong>det,<br />
über die Tat verwun<strong>der</strong>t ist,<br />
die Handlung nicht versteht (K<strong>in</strong>d).<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
3. Rechtswidrigkeit<br />
4. Schuld
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 158 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Fallgeschehen<br />
5. Sicherungsverwahrung<br />
Stellen sich exhibitionistische Handlungen vor K<strong>in</strong><strong>der</strong>n als Symptomtaten<br />
von e<strong>in</strong>igem Gewicht heraus, so kann die Sicherungsverwahrung nach § 66<br />
StGB bei Vorliegen <strong>der</strong> dort genannten Voraussetzungen angeordnet werden<br />
(BGH, Beschl. v. 06.02.2004, Az. 2 StR 266/03):<br />
<strong>der</strong> Täter wurde wegen vorsätzlicher Straftaten schon zweimal jeweils zu<br />
e<strong>in</strong>er Freiheitsstrafe von (m<strong>in</strong>destens) 1 Jahr verurteilt,<br />
<strong>der</strong> Täter hat durch diese Straftaten von e<strong>in</strong>em gewissen Gewicht gezeigt,<br />
dass er für die Allgeme<strong>in</strong>heit gefährlich ist,<br />
se<strong>in</strong>e Vortaten müssen symptomatisch für den Hang des Täters zu erheblichen<br />
Straftaten se<strong>in</strong>; sie müssen als Indiz für e<strong>in</strong>en solchen Hang gewertet<br />
werden können.<br />
Der <strong>Pflege</strong>direktor Manfred M. des Kölner Universitätskl<strong>in</strong>ikums geht auf dem Neumarkt<br />
<strong>in</strong> Köln spazieren und lässt se<strong>in</strong> entblößtes und erigiertes Geschlechtsteil aus<br />
<strong>der</strong> Hose ragen, so dass dies von an<strong>der</strong>en Passanten problemlos wahrgenommen<br />
werden kann.<br />
II. Prüfung Prüfungskarte Strafbarkeit Erregung öffentlichen Ärgernisses<br />
(§ 183a StGB)<br />
1. Vorbemerkung<br />
2. Tatbestand<br />
Geschütztes Rechtsgut<br />
Der § 183a StGB schützt den E<strong>in</strong>zelnen vor ungewollter Konfrontation mit dem sexuellen<br />
Verhalten des Täters und nicht primär das Interesse <strong>der</strong> Bevölkerung, dass<br />
sexuelle Handlungen nicht <strong>in</strong> die Öffentlichkeit gehören.<br />
a. objektiver Tatbestand<br />
Voraussetzung für die Erregung öffentlichen Ärgernisses ist:<br />
die Vornahme e<strong>in</strong>er sexuellen Handlung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit,<br />
welche von e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en beobachtet wird,<br />
<strong>der</strong> daran Anstoß nimmt,<br />
Die sexuelle Handlung muß öffentlich vorgenommen werden. Dazu muß sie:<br />
von e<strong>in</strong>em nach Zahl und Zusammensetzung unbestimmten Personenkreis o<strong>der</strong><br />
von e<strong>in</strong>em nach Zahl und Zusammensetzung bestimmten Personenkreis, <strong>der</strong> aber<br />
nicht untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> durch persönliche Beziehungen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verbunden ist<br />
wahrgenommen werden.<br />
Merke:<br />
Auf die Öffentlichkeit des Ortes kommt es nicht an,<br />
Ist Tatort e<strong>in</strong>e Straße, so fehlt es an <strong>der</strong> Öffentlichkeit, wenn <strong>der</strong> Täter nicht von<br />
jedem Passanten beobachtet werden kann (BGH, NJW 1969, 853),<br />
f<strong>in</strong>det die Handlung am Fenster e<strong>in</strong>es Privathauses statt, so ist die Öffentlichkeit<br />
gegeben, wenn sie von e<strong>in</strong>er gegenüberliegenden Fabrik (o<strong>der</strong> Haus) beobachtet<br />
werden kann,<br />
<strong>der</strong> Täter erregt e<strong>in</strong> Ärgernis, wenn e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er den sexuellen Vorgang wahrgenommen,<br />
den sexuellen Gehalt erfasst hat und hierdurch se<strong>in</strong> Scham- und Anstandsgefühl<br />
verletzt sieht.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 159 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
b. subjektiver Tatbestand<br />
3. Rechtswidrigkeit<br />
4. Schuld
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 160 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Lerne<strong>in</strong>heit: Arbeitsrechtliche und zivilrechtliche Folgen und Schutz<br />
vor sexueller Belästigung<br />
II. Das Allgeme<strong>in</strong>eGleichbehandlungsgesetz<br />
Seit dem 18.08.2006 ist das Allgeme<strong>in</strong>e Gleichbehandlungsgesetz (AGG, früher<br />
auch Antidiskrim<strong>in</strong>ierungsgesetz genannt) <strong>in</strong> Kraft. Es richtet sich grundsätzlich an alle<br />
Arbeitgeber. Mit se<strong>in</strong>em Ziel, Benachteiligungen vielfacher Art zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n und<br />
zu beseitigen, greift es tief <strong>in</strong> die allgeme<strong>in</strong>e Personalarbeit e<strong>in</strong>es jeden Betriebes e<strong>in</strong>.<br />
Es gilt Begriffe wie "Rasse", ethnische Herkunft, Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, sexuelle Belästigung<br />
o<strong>der</strong> sexuelle Identität zu klären.<br />
Gründe für die Benachteiligung, die es zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n gilt, s<strong>in</strong>d<br />
Rasse<br />
ethnische Herkunft<br />
Geschlecht<br />
Religion o<strong>der</strong> Weltanschauung<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
Alter<br />
sexuelle Identität<br />
Soweit e<strong>in</strong> Angehöriger <strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufe sexueller Belästigung ausgesetzt ist, kann er<br />
neben den Schutzmöglichkeiten des Beschäftigungsschutzgesetzes auch zivilrechtlich<br />
gegen se<strong>in</strong>en Pe<strong>in</strong>iger vorgehen und auf Schmerzensgeld klagen. (Dazu mehr unter II.)<br />
Schutzzweck<br />
<strong>der</strong> beiden<br />
Gesetze<br />
geschützter<br />
Personenkreis<br />
Zeitpunkt<br />
<strong>der</strong> Schutz-<br />
Schutzpflicht <br />
Schutzpflichtiger<br />
Das AGG soll die Würde von Frauen und Männern durch den<br />
Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz wahren.<br />
Der Arbeitgeber soll immer dann e<strong>in</strong>schreiten, wenn<br />
E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> das berufsbezogenen Persönlichkeitsrecht <strong>der</strong><br />
Betroffenen drohen/stattf<strong>in</strong>den,<br />
und dadurch die ungeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Entfaltung <strong>der</strong> beruflichen Fähigkeiten<br />
beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t wird,<br />
bzw. e<strong>in</strong> fe<strong>in</strong>dliches Arbeitsumfeld die Leistungsfähigkeit<br />
e<strong>in</strong>schränkt,<br />
bestehende Belästigungen bereits die Gesundheit <strong>der</strong> Betroffenen<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt haben,<br />
In den Schutzbereich <strong>der</strong> Gesetze fallen alle Beschäftigten. Beispielsweise:<br />
alle Arbeitnehmer und Auszubildende,<br />
Beamte,<br />
Richter und Soldaten,<br />
Heimarbeiter,<br />
arbeitnehmerähnliche Mitarbeiter.<br />
Die Schutzpflicht des Arbeitgebers gegenüber dem verfolgten<br />
Beschäftigten setzt bereits mit Bestehen <strong>der</strong> Gefahr e<strong>in</strong>er künftigen<br />
Belästigung e<strong>in</strong>, nicht erst nach E<strong>in</strong>tritt <strong>der</strong> Rechtsverletzung.<br />
Schutzpflichtiger ist <strong>der</strong> Arbeitgeber o<strong>der</strong> Dienstvorgesetzte. Der<br />
Arbeitgeber kann se<strong>in</strong>e Schutzpflicht übrigens nicht durch die<br />
Übertragung von Führungsaufgaben und damit e<strong>in</strong>hergehen<strong>der</strong><br />
Weisungsbefugnis auf e<strong>in</strong>en Beschäftigten mit Vorgesetztenfunktion<br />
verlagern. Er kann sich zwar e<strong>in</strong>es solchen Mitarbeiters be-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 161 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Begriff <strong>der</strong><br />
sexuellen<br />
Belästigung<br />
Beispiele<br />
sexueller<br />
Belästigung<br />
Inhalt <strong>der</strong><br />
Pflicht<br />
dienen, bleibt dadurch aber immer noch Adressat dieser Pflicht.<br />
E<strong>in</strong>e sexuelle Belästigung (am Arbeitsplatz) ist e<strong>in</strong>e unerwünschte,<br />
sexuell bestimmte Verhaltensweise, die bezweckt o<strong>der</strong> bewirkt,<br />
dass die Würde <strong>der</strong> betroffenen Person verletzt wird.<br />
Das ist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dann <strong>der</strong> Fall, wenn e<strong>in</strong> fe<strong>in</strong>dliches Umfeld<br />
geschaffen wird. Maßstab für das Vorliegen e<strong>in</strong>er sexuellen Belästigung<br />
ist – wie bei <strong>der</strong> Belästigung – die Sicht e<strong>in</strong>es objektiven<br />
Beobachters.<br />
Dazu gehören sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen,<br />
die nach den strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt s<strong>in</strong>d,<br />
sonstige sexuelle Handlungen und Auffor<strong>der</strong>ungen zu diesen,<br />
sexuell bestimmte körperliche Berührungen,<br />
Bemerkungen sexuellen Inhalts,<br />
Zeigen und sichtbares Anbr<strong>in</strong>gen von pornographischen Darstellungen,<br />
die von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden.<br />
Als sexuelle Belästigung wird verstanden (vgl. dazu Schlachter,<br />
Erfurter Kommentar, 5. Aufl. 2005, § 2 BeschSchG, Rdnr. 5):<br />
Erzw<strong>in</strong>gen sexueller Handlungen und tätliche Bedrohung,<br />
Zurschaustellung des Genitales,<br />
aufgedrängte Küsse,<br />
Auffor<strong>der</strong>ung zu sexuellem Verkehr,<br />
Versprechen beruflicher Vorteile für sexuelle Gefälligkeiten,<br />
Androhen beruflicher Nachteile bei Verweigerung <strong>der</strong>artiger<br />
Gefälligkeiten,<br />
Berührung <strong>der</strong> Brust/Genitalien (egal wie schwer o<strong>der</strong> kurz),<br />
Gespräche/Briefe mit sexuellen Anspielungen,<br />
Kneifen o<strong>der</strong> Klapsen des Gesäßes,<br />
E<strong>in</strong>ladungen mit e<strong>in</strong>deutiger Absicht,<br />
anzügliche Bemerkungen über die Figur o<strong>der</strong> das sexuelle Verhalten<br />
im Privatleben,<br />
pornographische Bil<strong>der</strong> am Arbeitsplatz.<br />
Der Arbeitgeber hat den Arbeitsplatz des Betroffenen zu schützen.<br />
Arbeitsplatz wird hierbei funktional verstanden und me<strong>in</strong>t<br />
jedwede berufliche Sphäre, auf <strong>der</strong>en Organisation <strong>der</strong> Arbeitgeber<br />
E<strong>in</strong>fluss nehmen kann (z.B. Betriebausflüge, Dienstreisen,<br />
Sem<strong>in</strong>are, Lehrgänge).<br />
Der Arbeitgeber hat sofort nach Bekannt werden von Belästigungsfällen<br />
Gegenmaßnahmen zu ergreifen bzw. im Vorfeld<br />
von Rechtsverletzungen vorbeugende Maßnahmen zu treffen.<br />
In jedem Fall hat er<br />
e<strong>in</strong>e betriebliche Anlaufstelle für Beschwerden zu schaffen,<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber ist verpflichtet, die dort e<strong>in</strong>gegangenen Beschwerden<br />
zu bearbeiten,<br />
er muß dazu den Sachverhalt mit se<strong>in</strong>em ihm <strong>zur</strong> Verfügung<br />
stehenden Mitteln aufklären,<br />
er muß gewährleisten, dass das Opfer wegen <strong>der</strong> Beschwerde<br />
vor Repressalien geschützt ist,<br />
es besteht ke<strong>in</strong> Anspruch auf vollständig vertrauliche Behandlung<br />
<strong>der</strong> Beschwerde (wegen Aufklärungspflicht geht das<br />
auch nicht),<br />
geeignete Maßnahmen im E<strong>in</strong>zelfall zu treffen, um die Fort-
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 162 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Reaktionen<br />
des Betroffenen <br />
ProblemfallaußerdienstlicheBelästigung<br />
setzung <strong>der</strong> Belästigung zu unterb<strong>in</strong>den:<br />
dazu zählen alle angemessenen arbeitsrechtlichen Maßnahmen<br />
gegen den „Belästiger“, von <strong>der</strong> Abmahnung, über die<br />
Umsetzung bis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Kündigung,<br />
Grund: E<strong>in</strong>e Belästigung durch den Arbeitgeber verletzt dessen<br />
Fürsorgepflichten gegenüber dem Betroffenen; e<strong>in</strong>e Belästigung<br />
unter Mitarbeitern verletzt die dem Arbeitgeber gegenüber<br />
bestehende Pflicht <strong>zur</strong> Wahrung des Betriebsfriedens<br />
und des betrieblichen Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>s,<br />
daher ist die Befürchtung, durch die Maßnahmen e<strong>in</strong>en wichtigen<br />
Mitarbeiter zu verlieren, ke<strong>in</strong> Grund, untätig zu bleiben,<br />
alle arbeitsrechtlichen Maßnahmen s<strong>in</strong>d im Wege des verhältnismäßigen<br />
Ausgleichs <strong>der</strong> Interessen bei<strong>der</strong> Konfliktparteien<br />
und <strong>der</strong> des Arbeitsgebers zu treffen,<br />
<strong>der</strong> belästigende Mitarbeiter kann sich daher se<strong>in</strong>erseits auf<br />
se<strong>in</strong> berechtigtes Interesse nach verhältnismäßiger Herstellung<br />
<strong>der</strong> verletzten Rechtspositionen berufen,<br />
arbeitsrechtliche Maßnahmen kann <strong>der</strong> Arbeitgeber allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur gegenüber denen ergreifen, zu denen er arbeitsvertragliche<br />
Beziehungen unterhält,<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber braucht ke<strong>in</strong>en optimalen Schutz vor sexueller<br />
Belästigung zu bieten, son<strong>der</strong>n „nur“ effektiven Schutz.<br />
Ergreift <strong>der</strong> Arbeitgeber trotz Belästigung ke<strong>in</strong>e Maßnahmen,<br />
kann <strong>der</strong> Betroffene<br />
die Umsetzung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Abteilung for<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>klagen,<br />
von se<strong>in</strong>em Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen<br />
(er darf zu Hause bleiben und erhält se<strong>in</strong>en vollen Lohn weiter),<br />
die allgeme<strong>in</strong>en zivilrechtlichen Rechtsbehelfe geltend machen,<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Schadensersatz und Schmerzensgeld.<br />
Problematisch ist, wie zu verfahren ist, wenn Belästigungen zwischen<br />
Arbeitskollegen bzw. zwischen Vorgesetztem und Untergebenem<br />
außerdienstlich stattf<strong>in</strong>den, aber die Bekanntschaft <strong>der</strong><br />
beiden auf <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Tätigkeit im Betrieb beruht.<br />
Lösungsansatz:<br />
Im Ergebnis wird <strong>der</strong> Anwendungsbereich des Beschäftigtenschutzgesetzes<br />
verne<strong>in</strong>t, weil <strong>der</strong> Bezug zum Arbeitsverhältnis<br />
bei außerdienstlicher Belästigung nicht stark genug ist. Zudem - so<br />
wird weiter angeführt - ist das Arbeitsrecht nicht zum Schutz <strong>der</strong><br />
Privatsphäre bestimmt, son<strong>der</strong>n dies übernehmen die allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rechtsnormen (Schlachter, NZA 2001, 121 [125]).<br />
Aber:<br />
E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s schwerwiegende sexuelle außerdienstliche Belästigung<br />
e<strong>in</strong>es Mitarbeiters berechtigt sehr wohl <strong>zur</strong> Kündigung,<br />
Ebenso kann <strong>der</strong> Arbeitgeber trotz außerdienstlicher Belästigung<br />
dann arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreifen, wenn Belästigte<br />
von ihren „Belästigern“ wegen ihrer Reaktion auf den Vorfall<br />
im Betrieb von diesen ausgegrenzt, von Informationen abgeschnitten<br />
o<strong>der</strong> schikaniert werden,<br />
Kündigung E<strong>in</strong>e (ordentliche/außerordentliche) Kündigung ohne vorhergehende<br />
Abmahnung wurde <strong>in</strong> folgenden Fällen <strong>der</strong> sexuellen Belästigung<br />
als adäquate Maßnahme des Arbeitgebers anerkannt:<br />
<strong>in</strong>time Berührung e<strong>in</strong>er Auszubildenden durch den Ausbil<strong>der</strong>,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 163 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
II. Allg. zivilrechtlicher<br />
Schadensersatz<br />
ZivilR<br />
Schadensersatz<br />
Saunabesuch bei Arbeitsplatzbewerber<strong>in</strong>nen,<br />
<strong>in</strong>time Berührung e<strong>in</strong>er Patient<strong>in</strong> durch den Therapeuten,<br />
Berührung e<strong>in</strong>er Kolleg<strong>in</strong> an <strong>der</strong> Brust nach vorangegangenen<br />
verbalen Belästigungen,<br />
Gewaltandrohung bei <strong>der</strong> Ablehnung sexueller Kontakte,<br />
Tätlichkeiten gegenüber e<strong>in</strong>er Untergebenen.<br />
Neben den arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, die das Beschäftigtenschutzgesetz<br />
bietet, kann das Opfer se<strong>in</strong>en Pe<strong>in</strong>iger auch zivilrechtlich<br />
auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagen.<br />
1. Anspruchsgrundlage<br />
§ 825 BGB: Wer e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en durch H<strong>in</strong>terlist, Drohung o<strong>der</strong> Missbrauch e<strong>in</strong>es Abhängigkeitsverhältnisses<br />
<strong>zur</strong> Vornahme o<strong>der</strong> Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz<br />
des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.<br />
H<strong>in</strong>weis: § 825 BGB (punktuelle Norm) schließt daneben die Anwendung von §<br />
823 BGB wegen Verletzung des allg. Persönlichkeitsrechts nicht aus.<br />
2. Anspruchsvoraussetzungen<br />
a. Bestimmung zu sexuellen Handlungen<br />
Sexuelle Handlungen: hier kann die Begriffsdef<strong>in</strong>ition aus § 184c StGB<br />
herangezogen werden (Wagner, <strong>in</strong> MüKo, 4. Aufl. 2004, § 825, Rdnr. 5 f.),<br />
Bestimmungsmittel:<br />
H<strong>in</strong>terlist (vorbedachtes, die wahre Absicht verdeckendes Handeln<br />
zu dem Zweck, den unvorbereiteten Zustand <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Person für<br />
die Verwirklichung <strong>der</strong> eigenen Ziele auszunutzen [= Verabreichung<br />
berauschen<strong>der</strong> Getränke, Vorspiegelung/Unterdrückung von<br />
Tatsachen, um das Opfer gefügig zu machen]),<br />
Drohung (Inaussichtstellen e<strong>in</strong>es Übels, durch das <strong>der</strong> Adressat <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Zwangslage versetzt wird),<br />
Missbrauch e<strong>in</strong>es Abhängigkeitsverhältnisses (Kennzeichen des<br />
Abhängigkeitsverhältnisses ist die Überlegenheit des e<strong>in</strong>en Teils über den<br />
an<strong>der</strong>en, die ihrerseits auf wirtschaftlichen, rechtlichen o<strong>der</strong> sonstigen<br />
Gründen beruht [Erziehungs-, Ausbildungs-, Arbeitsverhältnisse]),<br />
Gewalt (die Gewaltanwendung ist zwar <strong>in</strong> § 825 BGB nicht explizit genannt,<br />
wird aber nach allg. Auffassung <strong>in</strong> die Vorschrift h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gelesen).<br />
b. Bestimmung <strong>zur</strong> Vornahme/Duldung <strong>der</strong> Handlungen<br />
c. durch kausale und <strong>zur</strong>echenbare Handlung<br />
d. Vertreten müssen: Vorsatz<br />
die Tathandlung muß vorsätzlich erbracht worden se<strong>in</strong>, wobei sich<br />
<strong>der</strong> Vorsatz auf die Tathandlung beziehen muß,<br />
bei dem durch die Tathandlung e<strong>in</strong>getretenen Schaden genügt Fahrlässigkeit.<br />
e. Rechtswidrigkeit und Schadense<strong>in</strong>tritt<br />
Schäden s<strong>in</strong>d beispielsweise die Kosten e<strong>in</strong>er Schwangerschaft und Entb<strong>in</strong>dung<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verlust des Arbeitsplatzes. Daneben kann die geschädigte Person<br />
Gel<strong>der</strong>satz für die erlittenen immateriellen Bee<strong>in</strong>trächtigungen verlangen.<br />
3. Anspruchsfolge<br />
Der Schädiger schuldet Schadensersatz nach §§ 249 ff. BGB.Patient erhält<br />
Personen-, Sach- u. Vermögensschäden ersetzt und Schmerzensgeld.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 164 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
III. ArbeitsrechtlicheVertragshaftung<br />
Verjährung:<br />
Für die Verjährung des Schadensersatzanspruchs aus § 825 BGB ist § 208 BGB zu beachten,<br />
wonach <strong>der</strong> Lauf <strong>der</strong> Verjährung solange gehemmt ist, bis das Opfer das e<strong>in</strong>undzwanzigste<br />
Lebensjahr vollendet UND die häusliche Geme<strong>in</strong>schaft mit dem Pe<strong>in</strong>iger beendet hat.<br />
E<strong>in</strong> Arbeitsgeber ist bereits auf <strong>der</strong> Grundlage des Arbeitsvertrages mit dem e<strong>in</strong>zelnen<br />
Arbeitnehmer gehalten, diesen vor sexuell motivierten E<strong>in</strong>griffen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e<br />
physischen und immateriellen Persönlichkeitsrechte zu schützen.<br />
Verletzt er diese Pflicht und verübt e<strong>in</strong> Arbeitskollege e<strong>in</strong> Sexualdelikt gegenüber dem<br />
Beschäftigten, haftet <strong>der</strong> Arbeitgeber auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> §§ 280, 241 Abs. 2 BGB.<br />
Aber:<br />
Die Arbeitgeberhaftung kann nach §§ 104 ff. SGB VII ausgeschlossen se<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong> Mitarbeiter e<strong>in</strong>em<br />
Arbeitskollegen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er -kolleg<strong>in</strong> während <strong>der</strong> Arbeitszeit o<strong>der</strong> auf dem Arbeitsweg e<strong>in</strong>e Gesundheitsverletzung<br />
zufügt. Das kann auch für e<strong>in</strong>e Vergewaltigung durch den Vorgesetzten gelten. Voraussetzung<br />
ist jedoch, dass das Delikt während <strong>der</strong> Arbeitszeit begangen wird bzw. e<strong>in</strong> <strong>in</strong>nerer Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> versicherten Tätigkeit besteht, die es rechtfertigt, das betreffende Verhalten <strong>der</strong> versicherten<br />
Tätigkeit zu<strong>zur</strong>echnen (BSG, NJW 2002, 388 ff.). In diesem Fall würde die Vergewaltigung als Arbeitsunfall<br />
gelten mit <strong>der</strong> Folge, dass die gesetzliche Unfallversicherung e<strong>in</strong>tritt.<br />
Klage gegen<br />
den<br />
Arbeitgeber <br />
Klagemuster<br />
Ergreift <strong>der</strong> Arbeitgeber trotz Belästigung ke<strong>in</strong>e Maßnahmen,<br />
kann <strong>der</strong> Betroffene - wie vorh<strong>in</strong> bereits dargelegt - gegen den Arbeitgeber<br />
auf Ergreifung von Maßnahmen klagen, die geeignet<br />
s<strong>in</strong>d, die sexuelle Belästigung abzustellen.<br />
An das<br />
Arbeitsgericht<br />
. . . . . . . . . . .<br />
Klage<br />
<strong>der</strong> kaufmännischen Angestellten . . . . . . . . . . .<br />
- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt . . . . . . . . . . .<br />
Kläger<strong>in</strong><br />
gegen<br />
die Firma . . . . . . . . . . .<br />
Beklagte<br />
wegen sexueller Belästigung<br />
Namens und mit Vollmacht <strong>der</strong> Kläger<strong>in</strong> erhebe ich Klage und beantrage<br />
zu erkennen:<br />
I. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Angestellten<br />
. . . . . . . . . . . . (= Belästiger) aus <strong>der</strong> Buchhaltung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
an<strong>der</strong>e Abteilung zu versetzen:<br />
II. Die Beklagte zu verurteilen, <strong>der</strong> Kläger<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Entschädigung<br />
<strong>in</strong> Höhe von . . . . . . . . . . . . EUR zu zahlen<br />
III. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 165 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
Begründung<br />
Die am . . . . . . . . . . . . geborene, ledige Kläger<strong>in</strong> hat bei <strong>der</strong> Beklagten<br />
e<strong>in</strong>e Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. Nach <strong>der</strong><br />
Ausbildung ist sie am . . . . . . . . . . . . als kaufmännische Angestellte<br />
e<strong>in</strong>gestellt worden. Sie arbeitet <strong>in</strong> <strong>der</strong> Buchhaltung. Abteilungsleiter<br />
<strong>der</strong> Buchhaltung ist <strong>der</strong> Angestellte . . . . . . . . . . .<br />
Das Verhältnis zwischen <strong>der</strong> Kläger<strong>in</strong> und dem Abteilungsleiter<br />
war nie gut. Der Abteilungsleiter hatte stets etwas an <strong>der</strong> Kläger<strong>in</strong><br />
auszusetzen. Am . . . . . . . . . . . . ist es zu e<strong>in</strong>er heftigen Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung<br />
gekommen. Der Abteilungsleiter hat <strong>der</strong> Kläger<strong>in</strong> dabei<br />
erklärt, ihr Verhältnis werde sich schlagartig än<strong>der</strong>n, wenn sie<br />
nicht so prüde wäre. Dabei hat er ihr an die Brust gegriffen und <strong>in</strong>s<br />
Gesäß gekniffen . . . . . . . . . . .<br />
Die Kläger<strong>in</strong> hat sich darauf bei <strong>der</strong> Geschäftsleitung beschwert.<br />
Dort ist ihr alsdann gesagt worden, sie solle sich nicht so anstellen<br />
. . . . . . . . . . . . Wenn sie Gruppenleiter<strong>in</strong> werden wolle, müsse sie<br />
sich mit dem Abteilungsleiter gut stellen . . . . . . . . . . .<br />
Sowohl <strong>der</strong> Abteilungsleiter wie die Geschäftsleitung haben die<br />
Kläger<strong>in</strong> wegen ihres Geschlechts diskrim<strong>in</strong>iert. Die Geschäftsleitung<br />
hätte e<strong>in</strong>e Maßnahme gegen den Abteilungsleiter ergreifen<br />
müssen. Dies hat sie unterlassen, obwohl sie dazu verpflichtet war.<br />
Sie hätte den Abteilungsleiter wegen se<strong>in</strong>es untragbaren Verhaltens<br />
versetzen müssen . . . . . . . . . . .<br />
Die Beklagte schuldet aber auch e<strong>in</strong>e Entschädigung nach § 611 a<br />
Abs. 2, 4 BGB . . . . . . . . . . .<br />
Der Anspruch ist am . . . . . . . . . . . . geltend gemacht worden (§<br />
611 a Abs. 4 BGB).<br />
Rechtsanwalt<br />
(Quelle: Schaub, Prozessformularbuch, 9. Aufl., IV.A.18)
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 166 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
I. Die elterliche<br />
Sorge<br />
Lerne<strong>in</strong>heit: Sorgerechtliche Folgen<br />
und Schutz vor sexuellen Straftaten<br />
Grundsätzlich wird die elterliche Sorge als Folge des sog. Elternrechts aus Art. 6 I<br />
und II GG beiden Eltern geme<strong>in</strong>sam zuerkannt. Unter Umständen kann die elterliche<br />
Sorge aber auch nur e<strong>in</strong>em Elternteil obliegen.<br />
1. Inhaber<br />
des Sorgerechts<br />
2. Ausübung<br />
des<br />
Sorgerechts<br />
bei<br />
Me<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten<br />
3. Inhalt<br />
und Folgen<br />
des Sorgerechts<br />
Es werden folgende Ausgestaltungen (Fälle) <strong>der</strong> elterlichen Sorge<br />
unterschieden:<br />
geme<strong>in</strong>sames Sorgerecht <strong>der</strong> Eltern: beide s<strong>in</strong>d verheiratet<br />
o<strong>der</strong> haben e<strong>in</strong>e entsprechende Sorgerechtserklärung abgegeben<br />
(z.B. bei sog. „wil<strong>der</strong> Ehe“),<br />
Sorgerecht nur e<strong>in</strong>es Elternteils: die Mutter ist ledig (wegen<br />
„wil<strong>der</strong> Ehe“), das Gericht hat das Sorgerecht nur e<strong>in</strong>em übertragen<br />
(und dem an<strong>der</strong>en entzogen), e<strong>in</strong> Elternteil ist verstorben,<br />
nach e<strong>in</strong>er Trennung o<strong>der</strong> Scheidung: die Eltern können weiterh<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sam das Sorgerecht ausüben, das Gericht hat das<br />
Sorgerecht nur e<strong>in</strong>em übertragen (und dem an<strong>der</strong>en entzogen).<br />
Üben beide Eltern das Sorgerecht geme<strong>in</strong>sam aus und kommt es<br />
zu Me<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten, so müssen sich beide grundsätzlich<br />
e<strong>in</strong>igen. Kommt es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Frage, die für das K<strong>in</strong>d von erheblicher<br />
Bedeutung ist, zu gravierenden Me<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten,<br />
die nicht lösbar ersche<strong>in</strong>en, so kann das Gericht auf Antrag<br />
e<strong>in</strong>es Elternteils die Entscheidung über diese Frage auf e<strong>in</strong> Elternteil<br />
übertragen. Hierbei trifft das Gericht die Entscheidung<br />
also nicht selbst.<br />
Beispiele: Religionsbekenntnis, Art <strong>der</strong> Ausbildung, Durchführung<br />
e<strong>in</strong>er Impfung.<br />
Die Eltern müssen nach § 1631 II BGB ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> gewaltfrei erziehen<br />
und es s<strong>in</strong>d körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen<br />
und an<strong>der</strong>e entwürdigende Erziehungsmaßnahmen zu<br />
unterlassen.<br />
Was den Erziehungsstil <strong>der</strong> Eltern anbelangt, so wird im Gesetz<br />
lediglich ansatzweise beschrieben, dass den Eltern auferlegt wird,<br />
bei Ausübung von <strong>Pflege</strong> und Erziehung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>der</strong>en wachsende<br />
Fähigkeit und wachsendes Bedürfnis zu selbstständigem<br />
und verantwortungsbewusstem Handeln zu respektieren.<br />
Das geme<strong>in</strong>same Sorgerecht bewirkt, dass die Eltern das K<strong>in</strong>d<br />
nur geme<strong>in</strong>schaftlich vertreten können. Daher muss etwa die<br />
E<strong>in</strong>willigung zu e<strong>in</strong>em ärztlichen E<strong>in</strong>griff (Behandlung) immer<br />
von beiden Eltern erteilt werden.<br />
Die elterliche Sorge umfasst zwei Arten. Dies s<strong>in</strong>d die Personensorge<br />
und die Vermögenssorge.<br />
Personensorge<br />
Sorge für das leibliche Wohl (Verpflegung, Bekleidung, Behandlung<br />
im Krankheitsfall)<br />
Erziehung
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 167 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
II. Verletzung<br />
von Elternpflichten<br />
III. Folgen <strong>der</strong><br />
Verletzung von<br />
Elternpflichten<br />
Aufsicht<br />
Bestimmung des Aufenthalts<br />
Regelung des Umgangs<br />
Vermögenssorge<br />
Vermögensverwaltung<br />
Verletzen die Eltern e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> ihnen auferlegten Pflichten <strong>in</strong> gravieren<strong>der</strong> Weise,<br />
so kann das Gericht <strong>in</strong> die elterliche Sorge e<strong>in</strong>greifen (§ 1666 I BGB). Hierfür<br />
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt se<strong>in</strong>:<br />
Das körperliche, geistige o<strong>der</strong> seelische Wohl des K<strong>in</strong>des muss gefährdet se<strong>in</strong>,<br />
e<strong>in</strong> elterliches Fehlverhalten o<strong>der</strong> das Verhalten e<strong>in</strong>es Dritten muss vorliegen,<br />
dieses muss für die Gefährdung ursächlich se<strong>in</strong> („durch“) und<br />
die Eltern müssen unfähig o<strong>der</strong> unwillig se<strong>in</strong>, die Gefahr abzuwenden.<br />
Maßnahmenkatalog<br />
Liegen alle vier Voraussetzungen des § 1666 I BGB vor, so hat<br />
das Familiengericht die „erfor<strong>der</strong>liche Maßnahme“ zu ergreifen.<br />
Dies ist die Anordnung des Gesetzes, nach dem Grundsatz <strong>der</strong><br />
Verhältnismäßigkeit zu verfahren. Für die Sanktion <strong>der</strong> Trennung<br />
des K<strong>in</strong>des von den Eltern und den Entzug <strong>der</strong> gesamten Personensorge<br />
spricht das Gesetz dies <strong>in</strong> § 1666a BGB noch e<strong>in</strong>mal<br />
ausdrücklich aus.<br />
Welches die „erfor<strong>der</strong>liche Maßnahme“ ist, kann nur aus <strong>der</strong> jeweiligen<br />
<strong>in</strong>dividuellen Situation heraus gesagt werden.<br />
Das Gesetz selber zählt beispielhaft e<strong>in</strong> paar Möglichkeiten staatlicher<br />
Reaktionen auf, was aber nicht bedeutet, dass es nicht an<strong>der</strong>e<br />
s<strong>in</strong>nvolle Maßnahmen gibt:<br />
Das Gericht kann e<strong>in</strong>e rechtsgeschäftliche E<strong>in</strong>willigung ersetzen<br />
(§ 1666 III BGB). Wenn die Eltern sich z.B. weigern, ihre<br />
Zustimmung <strong>zur</strong> Unterbr<strong>in</strong>gung ihres K<strong>in</strong>des bei Onkel und<br />
Tante zu geben, dann kann das Gericht selber diese E<strong>in</strong>willigungserklärung<br />
abgeben.<br />
Das Gericht kann Maßnahmen gegen e<strong>in</strong>en Dritten verhängen<br />
(§ 1666 IV BGB). Es kann also dem Drogenhändler aufgeben,<br />
sich dem Mädchen nicht mehr zu nähern, dem Zuhälter<br />
verbieten, dem Mädchen vor <strong>der</strong> Schule aufzulauern. Diese<br />
Maßnahmen können aber auch schon - ohne Gefährdung des<br />
K<strong>in</strong>des - auf <strong>der</strong> Basis des § 1632 II , III BGB getroffen werden,<br />
was allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>en Antrag <strong>der</strong> Eltern voraussetzt.<br />
Das Gericht kann den Eltern die Vermögenssorge entziehen,<br />
wenn sie ihre Unterhaltspflicht verletzen o<strong>der</strong> Anordnungen,<br />
die das Gericht h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Vermögenssorge für das K<strong>in</strong>d<br />
trifft, missachten (§ 1666 II BGB).<br />
Das Gericht kann den Eltern auch Teile ihres Sorgerechts<br />
(Umkehrschluss aus § 1666a II BGB) o<strong>der</strong> das gesamte Sorgerecht<br />
entziehen. Bei e<strong>in</strong>em Teilentzug kommen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
die Teile <strong>in</strong> Betracht, <strong>in</strong> denen die Eltern versagt haben. Wenn<br />
sie z.B. auf Grund ihres Alkoholmissbrauchs ihren Sohn nicht<br />
mehr <strong>in</strong> die Schule geschickt haben o<strong>der</strong> nichts dagegen unternommen<br />
haben, dass er die Schule immer wie<strong>der</strong> geschwänzt<br />
hat, dann könnten ihnen alle Recht im Zusammenhang mit dem<br />
Schulbesuch entzogen werden. - Die völlige Entziehung des<br />
Sorgerechts kommt nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen <strong>in</strong> Betracht. Die Eltern<br />
müssen dann praktisch auf <strong>der</strong> ganzen L<strong>in</strong>ie versagt haben.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 168 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
IV. Teil<br />
Lerne<strong>in</strong>heit IV.b 11:<br />
Infektionsschutz<br />
- Zeitdauer: 2 Std. -<br />
Lerne<strong>in</strong>heit: Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des<br />
Infektionsschutzgesetzes<br />
I. Entstehungsgeschichte<br />
des<br />
IfSG<br />
Das Gesetz <strong>zur</strong> Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen<br />
(Infektionsschutzgesetz [IfSG]) ist seit dem 01.01.2001 <strong>in</strong> Kraft und hat<br />
u.a. das bis dah<strong>in</strong> geltende Bundesseuchengesetz sowie das Gesetz <strong>zur</strong> Bekämpfung<br />
von Geschlechtskrankheiten abgelöst.<br />
1. NationalerRahmen<br />
des<br />
IfSG: Anlass<br />
des<br />
Gesetzgebers<br />
zum<br />
Handeln<br />
2. Europarechtlicher<br />
Rahmen<br />
des IfSG:<br />
Pflicht <strong>zur</strong><br />
Umsetzung<br />
von EG-<br />
Richtl<strong>in</strong>ien<br />
Seit Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurden erhebliche Fortschritte<br />
bei <strong>der</strong> Bekämpfung von Infektionskrankheiten erzielt. Die Verbesserung<br />
des allgeme<strong>in</strong>en Lebensstandards, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> hygienischen<br />
Verhältnisse, <strong>der</strong> flächendeckende E<strong>in</strong>satz von Schutzimpfungen<br />
und <strong>der</strong> Ausbau des staatlichen Gesundheitswesen<br />
hattn zunävhst dazu beigetragen, dass viele sog. Volksseuchen<br />
(z.B. Cholera, Pocken, Typhus, Ruhr, K<strong>in</strong><strong>der</strong>lähmung) nahezu<br />
ausgerottet wurden bzw. als besiegbar gelten.<br />
Die Zunahme <strong>der</strong> Globalisierung, <strong>der</strong> hohen Mobilität <strong>der</strong> Menschen<br />
und <strong>der</strong> Migration großer Bevölkerungsgruppen vor allem <strong>in</strong><br />
den Industrienationen haben das Risiko <strong>der</strong> Ausbreitung von Infektionskrankheiten<br />
(AIDS, BSE) wie<strong>der</strong> rasant steigen lassen und<br />
auch die zunehmende Resistenz von Krankheitserregern gegen<br />
Antibiotika, vor allem jedoch das Entstehen neuer, zum Teil mutierter<br />
Krankheitserreger haben es nötig gemacht, die Kontrolle<br />
und Therapie dieser Krankheiten neu zu organisieren und zu strukturieren.<br />
Denn das bis dato geltende Seuchenrecht stammte noch<br />
aus den 50er und 60er Jahren und wurde nicht mehr für ausreichend<br />
erachtet, den mo<strong>der</strong>nen gesundheitspolitischen Erfo<strong>der</strong>nissen<br />
zu genügen.<br />
Das Infektionsschutzgesetz trägt den neuen Erkenntnissen und<br />
Entwicklungen Rechnung. Es stellt e<strong>in</strong>e umfassende Reform <strong>der</strong><br />
bisherigen gesetzlichen Regelungen zum Schutz <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
vor übertragbaren Krankheiten dar.<br />
Mit dem IfSG erfüllt <strong>der</strong> Bundestag zugleich Vorgaben des europäischen<br />
Normgebers, <strong>der</strong> die Vere<strong>in</strong>heitlichung <strong>der</strong> nationalen<br />
Infektionsschutzgesetze vorschreibt.<br />
Denn Deutschland ist verpflichtet, die Richtl<strong>in</strong>ie des Rates <strong>der</strong> Europäischen<br />
Geme<strong>in</strong>schaft vom 3. November 1998 (98/83/EG) über<br />
die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch bis Ende<br />
des Jahres 2000 und die bereits am 3. Januar 1999 <strong>in</strong> Kraft getretene<br />
Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 24. September 1998 über die Schaffung e<strong>in</strong>es<br />
Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle<br />
übertragbarer Krankheiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaft<br />
umzusetzen.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 169 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
II. Schutzelemente<br />
des IfSG<br />
3. Zweck<br />
des IfSG<br />
Leitgedanke des IfSG ist neben dem Erkennen und Bekämpfen<br />
von Infektionskrankheiten die Prävention übertragbarer Krankheiten<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e durch die Verbesserung <strong>der</strong> Infektionsepidemiologie.<br />
Als Schutzelemente des IfSG def<strong>in</strong>iert <strong>der</strong> Gesetzgeber:<br />
- Vorbeugung,<br />
- frühzeitige Erkennung von Infektionen<br />
- Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Weiterverbreitung.<br />
1. Vorbeugung<br />
2. FrühzeitigeErkennung<br />
3. Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong><br />
Weiterverbreitung<br />
Die Vorbeugung e<strong>in</strong>er Infektion ist die wirksamste, kostengünstigste<br />
und damit wichtigste Maßnahme zum Schutz vor übertragbaren<br />
Krankheiten.<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> Vorbeugung s<strong>in</strong>d:<br />
- Aufklärung und Information <strong>der</strong> Bevölkerung,<br />
- persönliche Hygiene,<br />
- <strong>der</strong> Aufbau und Erhalt e<strong>in</strong>es ausreichenden Impfschutzes<br />
- Präventionsmaßnahmen <strong>in</strong> Lebensmittel- und an<strong>der</strong>en Bereichen<br />
e<strong>in</strong>schließlich Geme<strong>in</strong>schaftse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Vorbeugen bedeutet, dass je<strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne aufgerufen ist, sich selbst<br />
vor Krankheiten zu schützen. Denn wer sich schützt, wirkt auch<br />
<strong>der</strong> Weiterverbreitung von Krankheiten entgegen. Je mehr sich<br />
schützen, desto effektiver werden Krankheitsherde abgeriegelt.<br />
Ohne e<strong>in</strong> frühzeitiges Erkennen des Auftretens und <strong>der</strong> Ausbreitung<br />
übertragbarer Krankheiten können Maßnahmen <strong>der</strong> Vorbeugung<br />
nicht ausreichend und gezielt geplant und die Weiterverbreitung<br />
<strong>der</strong> Krankheitserreger nicht wirksam verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden.<br />
Erkennen umfasst:<br />
- die ärztliche o<strong>der</strong> labormediz<strong>in</strong>ische Diagnose,<br />
- die Veranlassung antiepidemischer Maßnahmen im E<strong>in</strong>zelfall,<br />
- die Übermittlung <strong>der</strong> diagnostischen Beobachtungen an koord<strong>in</strong>ierende<br />
Stellen<br />
- die Analyse und Bewertung dieser Meldungen.<br />
Alle verfügbaren Erkenntnisse über Auftreten und Ausbreitung<br />
übertragbarer Krankheiten sowie über Eigenschaften <strong>der</strong> Krankheitserreger<br />
müssen für gesundheitspolitische Konzepte <strong>der</strong> Prävention<br />
und effektive Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz <strong>der</strong><br />
Bevölkerung genutzt werden.<br />
Die Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten<br />
hängt davon ab, dass<br />
- die staatlichen Gesundheitsämter<br />
- die nie<strong>der</strong>gelassenen Ärzte aller Fachrichtungen,<br />
- die Krankenhäuser,<br />
- die wissenschaftlichen E<strong>in</strong>richtungen<br />
nach bestimmten Regeln des IfSG<br />
- organisiert,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 170 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
III. Struktur<br />
und Aufbau des<br />
IfSG (Quelle: Hell, 4.<br />
Aufl., S. 431)<br />
IV. Begriffsbestimmungen<br />
des<br />
IfSG<br />
Begriffsbestimmungen<br />
Bekämpfung<br />
übertragbarer<br />
Krankheiten<br />
Tätigkeit mit Krankheitserregern <br />
Def<strong>in</strong>itionen<br />
des<br />
IfSG<br />
- effektiv und<br />
- vertrauensvoll zusammenarbeiten.<br />
Aufbau und Inhalt des Infektionsschutzgesetzes<br />
Koord<strong>in</strong>ierung<br />
und Früherkennung<br />
Vorschriften für<br />
Schulen etc.<br />
Entschädigung<br />
Meldewesen<br />
Beschaffenheit<br />
von Wasser<br />
Verhütung<br />
übertragbarer<br />
Krankheiten<br />
Beschäftigung<br />
im Lebensmittelbereich<br />
Straf- und Bußgeldvorschriften<br />
Um das IfSG sicher und zweifelsfrei anwenden zu können, def<strong>in</strong>iert<br />
das Gesetz, was es unter bestimmten Begriffen versteht. Dies<br />
s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelnen:<br />
1. Krankheitserreger<br />
e<strong>in</strong> vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) o<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong> sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen<br />
e<strong>in</strong>e Infektion o<strong>der</strong> übertragbare Krankheit verursachen kann.<br />
2. Infektion<br />
die Aufnahme e<strong>in</strong>es Krankheitserregers und se<strong>in</strong>e nachfolgende<br />
Entwicklung o<strong>der</strong> Vermehrung im menschlichen Organismus.<br />
3. übertragbare Krankheit<br />
e<strong>in</strong>e durch Krankheitserreger o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en toxische Produkte, die<br />
unmittelbar o<strong>der</strong> mittelbar auf den Menschen übertragen werden,<br />
verursachte Krankheit.<br />
4. Kranker<br />
e<strong>in</strong>e Person, die an e<strong>in</strong>er übertragbaren Krankheit erkrankt ist.<br />
5. Krankheitsverdächtiger<br />
e<strong>in</strong>e Person, bei <strong>der</strong> Symptome bestehen, welche das Vorliegen<br />
e<strong>in</strong>er bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen.<br />
6. Ausschei<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>e Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch e<strong>in</strong>e<br />
Ansteckungsquelle für die Allgeme<strong>in</strong>heit se<strong>in</strong> kann, ohne krank<br />
o<strong>der</strong> krankheitsverdächtig zu se<strong>in</strong>.<br />
7. Ansteckungsverdächtiger<br />
e<strong>in</strong>e Person, von <strong>der</strong> anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger<br />
aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig o<strong>der</strong> Ausschei<strong>der</strong><br />
zu se<strong>in</strong>.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 171 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
8. nosokomiale Infektion<br />
e<strong>in</strong>e Infektion mit lokalen o<strong>der</strong> systemischen Infektionszeichen als<br />
Reaktion auf das Vorhandense<strong>in</strong> von Erregern o<strong>der</strong> ihrer Tox<strong>in</strong>e,<br />
die im zeitlichen Zusammenhang mit e<strong>in</strong>em Krankenhausaufenthalt<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er ambulanten mediz<strong>in</strong>ischen Maßnahme steht, soweit<br />
die Infektion nicht bereits vorher bestand.<br />
9. Schutzimpfung<br />
die Gabe e<strong>in</strong>es Impfstoffes mit dem Ziel, vor e<strong>in</strong>er übertragbaren<br />
Krankheit zu schützen.<br />
10. an<strong>der</strong>e Maßnahme <strong>der</strong> spezifischen Prophylaxe<br />
die Gabe von Antikörpern (passive Immunprophylaxe) o<strong>der</strong> die<br />
Gabe von Medikamenten (Chemoprophylaxe) zum Schutz vor<br />
Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer Krankheiten.<br />
11. Impfschaden<br />
die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge e<strong>in</strong>er über das übliche<br />
Ausmaß e<strong>in</strong>er Impfreaktion h<strong>in</strong>ausgehenden gesundheitlichen<br />
Schädigung durch die Schutzimpfung; e<strong>in</strong> Impfschaden liegt auch<br />
vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und<br />
e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e als die geimpfte Person geschädigt wurde.<br />
12. Gesundheitsschädl<strong>in</strong>g<br />
e<strong>in</strong> Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen<br />
werden können.<br />
13. Sent<strong>in</strong>el-Erhebung<br />
e<strong>in</strong>e epidemiologische Methode <strong>zur</strong> stichprobenartigen Erfassung<br />
<strong>der</strong> Verbreitung bestimmter übertragbarer Krankheiten und <strong>der</strong><br />
Immunität gegen bestimmte übertragbare Krankheiten <strong>in</strong> ausgewählten<br />
Bevölkerungsgruppen.<br />
V. Meldewesen Das Meldewesen ist das Kerntück des IfSG. Wesentlich für die Verhütung und<br />
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist, dass die staatlichen Behörden möglichst<br />
früh Kenntnis von übertragbaren Krankheiten erlangen.<br />
Erkenntnisquelle s<strong>in</strong>d vor allem den Ärzte und Krankenhäuser sowie Labore. Insoweit<br />
regelt das Gesetz, wer was an wen zu melden hat.<br />
1. Organisation<br />
des<br />
Meldewesens<br />
Meldepflichtige<br />
Krankheiten<br />
Namentliche Meldung<br />
Meldepflichtige Personen<br />
Quelle: Hell, 4. Aufl. 2001, S. 434<br />
Meldewesen des IfSG<br />
Meldepflichtige<br />
Nachweise von<br />
Krankheitserregern<br />
Nichtnamentliche<br />
Meldung<br />
Meldungsempfänger
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 172 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
2. MeldepflichtigeKrankheiten<br />
3. Meldepflichtige<br />
Nachweise<br />
Wesentliche Neuerung gegenüber den alten gesetzlichen Regelungen<br />
ist, dass das IfSG nicht mehr zwischen Seuchen o<strong>der</strong> Geschlechtskrankheiten<br />
unterscheidet, son<strong>der</strong>n nur noch zwischen<br />
namentlich meldepflichtigen o<strong>der</strong> namentlich nicht meldepflichtigen<br />
Krankheiten.<br />
a. Namentlich dem Gesundheitsamt meldepflichtig s<strong>in</strong>d:<br />
Erkrankung, <strong>der</strong> Verdacht <strong>der</strong> Erkrankung und <strong>der</strong> Tod an:<br />
Botulismus,<br />
Cholera<br />
Diphterie<br />
humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-<br />
hereditärer Formen<br />
akuter Virushepatitis<br />
enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)<br />
virusbed<strong>in</strong>gtem hämorrhagischem Fieber<br />
Masern<br />
Men<strong>in</strong>gokokken-Men<strong>in</strong>gitis o<strong>der</strong> -Sepsis<br />
Milzbrand<br />
Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer<br />
wenn traumatisch bed<strong>in</strong>gt)<br />
Pest<br />
Tollwut<br />
Typhus/Paratyphus<br />
sowie die Erkrankung und <strong>der</strong> Tod an e<strong>in</strong>er behandlungsbedürftigen Tuberkulose,<br />
auch wenn e<strong>in</strong> bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,<br />
die Erkrankung und <strong>der</strong> Verdacht <strong>der</strong> Erkrankung an:<br />
e<strong>in</strong>er mikrobiell bed<strong>in</strong>gten Lebensmittelvergiftung o<strong>der</strong> an e<strong>in</strong>er akuten<br />
<strong>in</strong>fektiösen Gastroenteritis, wenn<br />
e<strong>in</strong>e Person betroffen ist, die e<strong>in</strong>e Tätigkeit im S<strong>in</strong>ne des § 42 Abs. 1<br />
ausübt,<br />
zwei o<strong>der</strong> mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen e<strong>in</strong><br />
epidemischer Zusammenhang wahrsche<strong>in</strong>lich ist o<strong>der</strong> vermutet wird,<br />
<strong>der</strong> Verdacht:<br />
e<strong>in</strong>er über das übliche Ausmaß e<strong>in</strong>er Impfreaktion h<strong>in</strong>ausgehenden gesundheitlichen<br />
Schädigung,<br />
die Verletzung:<br />
e<strong>in</strong>es Menschen durch e<strong>in</strong> tollwutkrankes o<strong>der</strong> -verdächtiges Tier sowie<br />
die Berührung e<strong>in</strong>es solchen Tieres o<strong>der</strong> Tierkörpers<br />
das Auftreten:<br />
e<strong>in</strong>er bedrohlichen Krankheit o<strong>der</strong><br />
von zwei o<strong>der</strong> mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen e<strong>in</strong> epidemischer<br />
Zusammenhang wahrsche<strong>in</strong>lich ist o<strong>der</strong> vermutet wird,<br />
wenn dies auf e<strong>in</strong>e schwerwiegende Gefahr für die Allgeme<strong>in</strong>heit h<strong>in</strong>weist<br />
und Krankheitserreger als Ursache <strong>in</strong> Betracht kommen, die nicht <strong>in</strong> § 7 genannt<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
die Verweigerung <strong>der</strong> bzw. <strong>der</strong> Abbruch <strong>der</strong> Behandlung:<br />
e<strong>in</strong>er behandl<strong>in</strong>gsbedürftigen Lungentuberkolose,<br />
b. Nichtnamentlich dem Gesundheitsamt meldepflichtig ist:<br />
das gehäufte Auftreten:<br />
nosokomialer Infektionen, bei denen e<strong>in</strong> epidemischer Zusammenhang<br />
wahrsche<strong>in</strong>lich ist o<strong>der</strong> vermutet wird,<br />
Des weiteren unterscheidet das Gesetz zwischen namentlich und<br />
nichtnamentlich meldepflichtigen Nachweisen von Krankheitserregern.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 173 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
von Krank-<br />
Krankheitserregern<br />
a. Namentlich dem Gesundheitsamt meldepflichtig s<strong>in</strong>d:<br />
<strong>der</strong> direkte o<strong>der</strong> <strong>in</strong>direkte Nachweis bei folgenden Krankheitserregern,<br />
soweit die Nachweise auf e<strong>in</strong>e akute, d.h. frische<br />
Infektion h<strong>in</strong>weisen:<br />
Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktivalabstrich<br />
Bacillus anthracis<br />
Borrelia recurrentis<br />
Brucella sp.<br />
Campylobacter jejuni<br />
Chlamydia psittaci<br />
Clostridium botul<strong>in</strong>um o<strong>der</strong> Tox<strong>in</strong>nachweis<br />
Corynebacterium diphteriae, Tox<strong>in</strong> bildend<br />
Coxiella burnetii<br />
Cryptosporidium parvum<br />
Ebolavirus<br />
Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC)<br />
Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme<br />
Francisella tularensis<br />
FSME-Virus<br />
Gelbfiebervirus<br />
Giardia lamblia<br />
Haemophilus <strong>in</strong>fluenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis<br />
aus Liquor o<strong>der</strong> Blut<br />
Hantaviren<br />
Hepatitis-A-Virus<br />
Hepatitis-B-Virus<br />
Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt<br />
ist, dass e<strong>in</strong>e chronische Infektion vorliegt<br />
Hepatitis-D-Virus<br />
Hepatitis-E-Virus<br />
Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis<br />
Lassavirus<br />
Legionella sp.<br />
Leptospira <strong>in</strong>terrogans<br />
Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis<br />
aus Blut, Liquor o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en normalerweise sterilen Substraten sowie<br />
aus Abstrichen von Neugeborenen<br />
Marburgvirus<br />
Masernvirus<br />
Mycobacterium leprae<br />
Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht<br />
für den direkten Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis<br />
<strong>der</strong> Resistenzbestimmung; vorab auch für den Nachweis säurefester<br />
Stäbchen im Sputum<br />
Neisseria men<strong>in</strong>gitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus<br />
Liquor, Blut, hämorrhagischen Haut<strong>in</strong>filtraten o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en normalerweise<br />
sterilen Substraten<br />
Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis<br />
aus Stuhl<br />
Poliovirus<br />
Rabiesvirus<br />
Rickettsia prowazekii<br />
Rotavirus<br />
Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise<br />
Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise<br />
Salmonella, sonstige<br />
Shigella sp.<br />
Trich<strong>in</strong>ella spiralis<br />
Vibrio cholerae O 1 und O 139<br />
Yers<strong>in</strong>ia enterocolitica, darmpathogen<br />
Yers<strong>in</strong>ia pestis<br />
an<strong>der</strong>e Erreger hämorrhagischer Fieber.,<br />
Krankheitserreger, soweit <strong>der</strong>en örtliche und zeitliche Häufung<br />
auf e<strong>in</strong>e schwerwiegende Gefahr für die Allgeme<strong>in</strong>heit<br />
h<strong>in</strong>weist,
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 174 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
4. Meldepflichtige<br />
Personen<br />
b. Nichtnamentlich dem Gesundheitsamt meldepflichtig s<strong>in</strong>d<br />
folgende Krankheitserreger:<br />
<strong>der</strong> direkte o<strong>der</strong> <strong>in</strong>direkte Nachweis:<br />
Treponema pallidum<br />
HIV<br />
Ech<strong>in</strong>ococcus sp.<br />
Plasmodium sp.<br />
Rubellavirus; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen<br />
Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen.<br />
Zur Meldung o<strong>der</strong> Mitteilung s<strong>in</strong>d verpflichtet:<br />
<strong>der</strong> feststellende Arzt; <strong>in</strong> Krankenhäusern o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>der</strong> stationären <strong>Pflege</strong> ist für die E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Meldepflicht<br />
neben dem feststellenden Arzt auch <strong>der</strong> leitende Arzt, <strong>in</strong><br />
Krankenhäusern mit mehreren selbständigen Abteilungen <strong>der</strong><br />
leitende Abteilungsarzt, <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen ohne leitenden Arzt<br />
<strong>der</strong> behandelnde Arzt verantwortlich,<br />
die Leiter von Mediz<strong>in</strong>aluntersuchungsämtern und sonstigen<br />
privaten o<strong>der</strong> öffentlichen Untersuchungsstellen e<strong>in</strong>schließlich<br />
<strong>der</strong> Krankenhauslaboratorien,<br />
die Leiter von E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> pathologisch-anatomischen<br />
Diagnostik, wenn e<strong>in</strong> Befund erhoben wird, <strong>der</strong> sicher o<strong>der</strong> mit<br />
hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit auf das Vorliegen e<strong>in</strong>er meldepflichtigen<br />
Erkrankung o<strong>der</strong> Infektion durch e<strong>in</strong>en meldepflichtigen<br />
Krankheitserreger schließen lässt,<br />
bei Tieren, mit denen Menschen Kontakt gehabt haben, <strong>der</strong><br />
Tierarzt,<br />
Angehörige e<strong>in</strong>es an<strong>der</strong>en Heil- o<strong>der</strong> <strong>Pflege</strong>berufs, <strong>der</strong> für die<br />
Berufsausübung o<strong>der</strong> die Führung <strong>der</strong> Berufsbezeichnung e<strong>in</strong>e<br />
staatlich geregelte Ausbildung o<strong>der</strong> Anerkennung erfor<strong>der</strong>t,<br />
<strong>der</strong> verantwortliche Luftfahrzeugführer o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kapitän e<strong>in</strong>es<br />
Seeschiffes,<br />
die Leiter von <strong>Pflege</strong>e<strong>in</strong>richtungen, Justizvollzugsanstalten,<br />
Heimen, Lagern o<strong>der</strong> ähnlichen E<strong>in</strong>richtungen,<br />
<strong>der</strong> Heilpraktiker.<br />
Ke<strong>in</strong>e Meldepflicht besteht<br />
für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn <strong>der</strong> Patient unverzüglich<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e ärztlich geleitete E<strong>in</strong>richtung gebracht wurde.<br />
wenn dem Meldepflichtigen e<strong>in</strong> Nachweis vorliegt, dass die<br />
Meldung bereits erfolgte und an<strong>der</strong>e als die bereits gemeldeten<br />
Angaben nicht erhoben wurden.<br />
für Personen, die die Untersuchung zum Nachweis von Krankheitserregern<br />
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes<br />
durchführen lassen.<br />
Merke: Der Meldepflichtige hat dem Gesundheitsamt unverzüglich<br />
mitzuteilen, wenn sich e<strong>in</strong>e Verdachtsmeldung nicht bestätigt hat.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 175 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
5. Inhalt<br />
<strong>der</strong> namentlichen<br />
Meldung<br />
und Frist<br />
6. Inhalt<br />
<strong>der</strong> nichtnamentlichenMeldung<br />
und<br />
Frist<br />
7. Meldeweg<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e namentliche Meldung vorgeschrieben<br />
ist, muss diese folgende Angaben enthalten:<br />
Name, Vorname des Patienten<br />
Geschlecht<br />
Tag, Monat und Jahr <strong>der</strong> Geburt<br />
Anschrift <strong>der</strong> Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift<br />
des <strong>der</strong>zeitigen Aufenthaltsortes<br />
Tätigkeit des Patienten <strong>in</strong> bestimmten E<strong>in</strong>richtungen (z.B. K<strong>in</strong><strong>der</strong>kripeen,<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten, Schulen, Heimen, Krankenhäusern)<br />
Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose<br />
Tag <strong>der</strong> Erkrankung o<strong>der</strong> Tag <strong>der</strong> Diagnose, gegebenenfalls<br />
Tag des Todes<br />
wahrsche<strong>in</strong>liche Infektionsquelle<br />
Land, <strong>in</strong> dem die Infektion wahrsche<strong>in</strong>lich erworben wurde; bei<br />
Tuberkulose Geburtsland und Staatsangehörigkeit<br />
Name, Anschrift und Telefonnummer <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Erregerdiagnostik<br />
beauftragten Untersuchungsstelle<br />
Überweisung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Krankenhaus beziehungsweise Aufnahme<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Krankenhaus o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>richtung <strong>der</strong> stationären<br />
<strong>Pflege</strong> und Entlassung aus <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung, soweit dem<br />
Meldepflichtigen bekannt<br />
Blut-, Organ- o<strong>der</strong> Gewebespende <strong>in</strong> den letzten sechs Monaten<br />
Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden<br />
Die namentliche Meldung muss bis spätestens <strong>in</strong>nerhalb von 24<br />
Stunden nach erlangter Kenntnis gegenüber dem für den Betroffenen<br />
zuständigen Gesundheitsamt erfolgen.<br />
Die nichtnamentlichen Meldungen dienen re<strong>in</strong> epidemologischen<br />
Zwecken. Die liefern Daten für die gezielte Aufklärungsmaßnahmen<br />
und für gesundheitspolitische Entscheidungen; sie<br />
haben spätestens am dritten Arbeitstag <strong>der</strong> folgenden Woche, an<br />
die zuständige Landesbehörde sowie von dort <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Woche<br />
an das Robert Koch-Institut ausschließlich mit folgenden Angaben<br />
übermittelt zu werden:<br />
Geschlecht<br />
Monat und Jahr <strong>der</strong> Geburt<br />
erste drei Ziffern <strong>der</strong> Postleitzahl <strong>der</strong> Hauptwohnung<br />
Untersuchungsbefund<br />
Monat und Jahr <strong>der</strong> Diagnose<br />
Art des Untersuchungsmaterials<br />
Nachweismethode<br />
wahrsche<strong>in</strong>licher Infektionsweg, wahrsche<strong>in</strong>liches Infektionsrisiko<br />
Land, <strong>in</strong> dem die Infektion wahrsche<strong>in</strong>lich erworben wurde<br />
Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden<br />
bei Malaria: Angaben <strong>zur</strong> Expositions- und Chemoprophylaxe.<br />
Für die namentlichen Meldungen ist e<strong>in</strong> dreistufiger Meldeweg<br />
vorgeschrieben:<br />
1. Stufe:<br />
Die meldepflichtige Person meldet unverzüglich an das Gesundheitsamt.<br />
2. Stufe:
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 176 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
VI. Verhütung<br />
übertragbarer<br />
Krankheiten<br />
Das Gesundheitsamt übermittelt an die zuständige Landesbehörde<br />
wöchentlich <strong>in</strong> anonymisierter Form<br />
3. Stufe:<br />
Die Landesbehörde übermittelt <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Woche an das Robert-Koch-Institut.<br />
Die Verhütung übertragbarer Krankheiten hat Vorrang vor <strong>der</strong> Bekämpfung.<br />
Verhütungsmaßnahmen sollen im Vorfeld dafür sorgen, dass Krankheitserreger<br />
den Menschen nicht erreichen.<br />
1. Befugnisse<br />
<strong>der</strong><br />
Behörden<br />
2. Maßnahmen<br />
bei sexuell<br />
übertragbarenKrankheiten <br />
Schutzimpfungen<br />
als<br />
Maßnahmen<br />
Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten e<strong>in</strong>er übertragbaren<br />
Krankheit führen können, o<strong>der</strong> ist anzunehmen, dass solche<br />
Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen<br />
Maßnahmen <strong>zur</strong> Abwendung <strong>der</strong> dem E<strong>in</strong>zelnen o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong>heit hierdurch drohenden Gefahren.<br />
In diesen Fällen s<strong>in</strong>d die Beauftragten <strong>der</strong> zuständigen Behörde<br />
und des Gesundheitsamtes <strong>zur</strong> Durchführung von Ermittlungen<br />
<strong>zur</strong> Überwachung <strong>der</strong> angeordneten Maßnahmen berechtigt,<br />
Grundstücke, Räume, Anlagen und E<strong>in</strong>richtungen sowie Verkehrsmittel<br />
aller Art zu betreten<br />
Bücher o<strong>der</strong> sonstige Unterlagen e<strong>in</strong>zusehen und hieraus Abschriften,<br />
Ablichtungen o<strong>der</strong> Auszüge anzufertigen<br />
sonstige Gegenstände zu untersuchen o<strong>der</strong> Proben <strong>zur</strong> Untersuchung<br />
zu for<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> zu entnehmen.<br />
Der Inhaber <strong>der</strong> tatsächlichen Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten<br />
<strong>der</strong> zuständigen Behörde und des Gesundheitsamtes<br />
Grundstücke, Räume, Anlagen, E<strong>in</strong>richtungen und Verkehrsmittel<br />
sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu machen.<br />
Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten<br />
und Tuberkulose Beratung und Untersuchung an o<strong>der</strong> stellt<br />
diese <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit an<strong>der</strong>en mediz<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>richtungen<br />
sicher.<br />
Diese sollen für Personen, <strong>der</strong>en Lebensumstände e<strong>in</strong>e erhöhte<br />
Ansteckungsgefahr für sich o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e mit sich br<strong>in</strong>gen, auch<br />
aufsuchend angeboten werden und können im E<strong>in</strong>zelfall die ambulante<br />
Behandlung durch e<strong>in</strong>en Arzt des Gesundheitsamtes umfassen,<br />
soweit dies <strong>zur</strong> Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Weiterverbreitung <strong>der</strong> sexuell<br />
übertragbaren Krankheiten und <strong>der</strong> Tuberkulose erfor<strong>der</strong>lich<br />
ist.<br />
Die Angebote können bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten<br />
anonym <strong>in</strong> Anspruch genommen werden.<br />
Da ke<strong>in</strong>e Impfpflicht <strong>in</strong> Deutschland besteht, <strong>in</strong>formieren die<br />
zuständige obere Bundesbehörde, die obersten Landesgesundheitsbehörden<br />
und die von ihnen beauftragten Stellen sowie die<br />
Gesundheitsämter die Bevölkerung über die Bedeutung von<br />
Schutzimpfungen und an<strong>der</strong>en Maßnahmen <strong>der</strong> spezifischen Prophylaxe<br />
übertragbarer Krankheiten.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 177 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
VII. BekämpfungübertragbarerKrankheiten<br />
VIII. Zusätzliche<br />
Regelungen<br />
für Schulen und<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten<br />
Ggf. ist die Bevölkerung gezielt zu öffentlichen Schutzimpfungen<br />
auf<strong>zur</strong>ufen bzw. sollen diese empfohlen werden.<br />
Ergibt sich o<strong>der</strong> ist anzunehmen, dass jemand<br />
an e<strong>in</strong>er meldepflichtigen Krankheit erkrankt<br />
mit e<strong>in</strong>em meldepflichtigen Krankheitserreger <strong>in</strong>fiziert ist<br />
dass e<strong>in</strong> Verstorbener, <strong>der</strong> an e<strong>in</strong>er meldepflichtigen Krankheit erkrankt o<strong>der</strong><br />
mit e<strong>in</strong>em meldepflichtigen Krankheitserreger <strong>in</strong>fiziert war, nach dem vermuteten<br />
Zeitpunkt <strong>der</strong> Infektion Blut-, Organ- o<strong>der</strong> Gewerbespen<strong>der</strong> war,<br />
so hat das Gesundheitsamt die zuständigen Behörden von Bund und Län<strong>der</strong>n unverzüglich<br />
über den Befund o<strong>der</strong> Verdacht zu unterrichten.<br />
Schutzmaßnahmen<br />
Personen,<br />
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige<br />
o<strong>der</strong> Ausschei<strong>der</strong> festgestellt o<strong>der</strong> ergibt sich, dass e<strong>in</strong> Verstorbener<br />
krank, krankheitsverdächtig o<strong>der</strong> Ausschei<strong>der</strong> war, so trifft die<br />
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen.<br />
Diese s<strong>in</strong>d:<br />
Beobachtung. Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige<br />
und Ausschei<strong>der</strong> können e<strong>in</strong>er Beobachtung unterworfen<br />
werden.<br />
Quarantäne. Personen, die an Lungenpest o<strong>der</strong> an von Mensch<br />
zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt<br />
o<strong>der</strong> dessen verdächtig s<strong>in</strong>d, können unverzüglich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Krankenhaus o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er für diese Krankheiten geeigneten E<strong>in</strong>richtung<br />
abgeson<strong>der</strong>t werden.<br />
Berufliches Tätigkeitsverbot. Die zuständige Behörde kann<br />
Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen<br />
und Ausschei<strong>der</strong>n die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten<br />
ganz o<strong>der</strong> teilweise untersagen.<br />
die <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>schaftse<strong>in</strong>richtungen arbeiten, also <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> denen<br />
überwiegend Säugl<strong>in</strong>ge, K<strong>in</strong><strong>der</strong> o<strong>der</strong> Jugendliche betreut werden (= K<strong>in</strong><strong>der</strong>krippen,<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten, K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesstätten, K<strong>in</strong><strong>der</strong>horte, Schulen o<strong>der</strong> sonstige<br />
Ausbildungse<strong>in</strong>richtungen, Heime, Ferienlager und ähnliche E<strong>in</strong>richtungen)<br />
und die erkrankt s<strong>in</strong>d an<br />
Cholera, Diptherie, Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC), virusbed<strong>in</strong>gtem<br />
hämorrhagischem Fieber, Haemophilus <strong>in</strong>fluenzae Typ b-<br />
Men<strong>in</strong>gitis, Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte), Keuchhusten,<br />
ansteckungsfähiger Lungentuberkulose, Masern, Men<strong>in</strong>gokokken-Infektion,<br />
Mumps, Paratyphus, Pest, Poliomyelitis, Scabies (Krätze), Scharlach o<strong>der</strong> sonstigen<br />
Streptococcus pyogenes-Infektionen, Shigellose, Typhus abdom<strong>in</strong>alis, Virushepatitis<br />
A o<strong>der</strong> E, W<strong>in</strong>dpocken,<br />
dürfen <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>schaftse<strong>in</strong>richtungen ke<strong>in</strong>e Lehr-, Erziehungs-, <strong>Pflege</strong>-,<br />
Aufsichts- o<strong>der</strong> sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort<br />
Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil e<strong>in</strong>e Weiterverbreitung <strong>der</strong><br />
Krankheit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist (z.B.<br />
Schulverbot bei eigener Masernerkrankung [VG München, Beschl. v. 24.03.2009,<br />
Az. M 18 E 09.1208]).
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 178 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
IX. Beschaffenheit<br />
von Wasser<br />
X. Beschäftigung<br />
im Lebensmittelbereich<br />
XI. Straf- und<br />
Bußgeldvorschriften<br />
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen se<strong>in</strong>, dass durch se<strong>in</strong>en<br />
Genuss o<strong>der</strong> Gebrauch e<strong>in</strong>e Schädigung <strong>der</strong> menschlichen Gesundheit, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.<br />
Schwimm- o<strong>der</strong> Badebeckenwasser <strong>in</strong> Gewerbebetrieben, öffentlichen Bä<strong>der</strong>n sowie<br />
<strong>in</strong> sonstigen nicht ausschließlich privat genutzten E<strong>in</strong>richtungen muss so beschaffen<br />
se<strong>in</strong>, dass durch se<strong>in</strong>en Gebrauch e<strong>in</strong>e Schädigung <strong>der</strong> menschlichen Gesundheit,<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.<br />
Personen, die<br />
an Typhus, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en <strong>in</strong>fektiösen<br />
Gastroenteritis o<strong>der</strong> Virushepatitis A o<strong>der</strong> E erkrankt o<strong>der</strong> dessen verdächtig<br />
s<strong>in</strong>d,<br />
an <strong>in</strong>fizierten Wunden o<strong>der</strong> an Hautkrankheiten erkrankt s<strong>in</strong>d, bei denen die<br />
Möglichkeit besteht, dass <strong>der</strong>en Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen<br />
werden können,<br />
die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia<br />
coli o<strong>der</strong> Choleravibrionen ausscheiden<br />
dürfen nicht tätig se<strong>in</strong> o<strong>der</strong> beschäftigt werden<br />
beim Herstellen, Behandeln o<strong>der</strong> Inverkehrbr<strong>in</strong>gen von Lebensmittel, wenn sie<br />
dabei mit diesen <strong>in</strong> Berührung kommen, o<strong>der</strong><br />
<strong>in</strong> Küchen von Gaststätten und sonstigen E<strong>in</strong>richtungen mit o<strong>der</strong> <strong>zur</strong> Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung.<br />
Lebensmittel im S<strong>in</strong>ne des IfSG s<strong>in</strong>d:<br />
Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus<br />
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis<br />
Fische, Krebse o<strong>der</strong> Weichtiere und Erzeugnisse daraus<br />
Eiprodukte<br />
Säugl<strong>in</strong>gs- und Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>nahrung<br />
Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse<br />
Backwaren mit nicht durchgebackener o<strong>der</strong> durcherhitzter Füllung o<strong>der</strong> Auflage,<br />
ausgenommen Dauerbackwaren<br />
Fe<strong>in</strong>kost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Mar<strong>in</strong>aden, Mayonnaisen, an<strong>der</strong>e<br />
emulgierte Soßen, Nahrungshefen.<br />
Durch beson<strong>der</strong>e Straf- und Bußgeldvorschriften sollen die Ge- und Verbote des<br />
IfSG durchgesetzt werden. Insoweit begehrt <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> gegen Melde-, Anzeige-,<br />
Mitteilungs-, Auskunfts- und Duldungsvorschriften verstößt, angeordnete Untersuchungen<br />
nicht duldet o<strong>der</strong> sonstige, im IfSG genannte Pflichten verletzt, kann mit e<strong>in</strong>er<br />
Geldbuße i.H.v. bis zu € 25.000,- geanhdet werden.
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 179 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de<br />
XI. Muster
Rechtsanwalt <strong>Diel</strong>/<strong>Rechtskunde</strong> Krankenpflege/Stand: 20. März 2011/ Seite 180 von 180/Ke<strong>in</strong>e Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/www.krankenpflegeausbildung.de