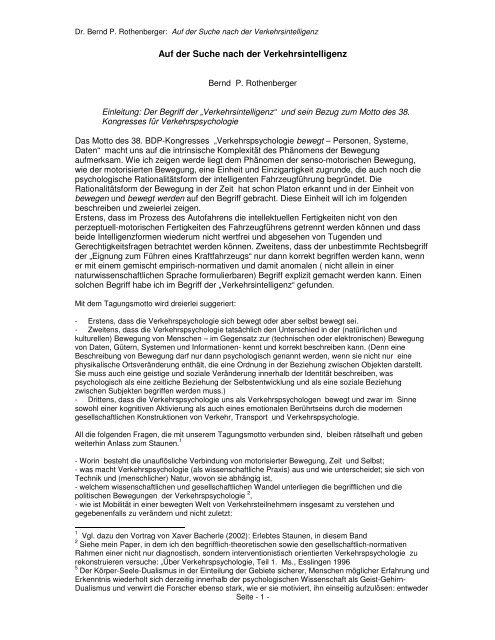Begriff der „Verkehrsintelligenz“ - auto-Mobil
Begriff der „Verkehrsintelligenz“ - auto-Mobil
Begriff der „Verkehrsintelligenz“ - auto-Mobil
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Bernd P. Rothenberger<br />
Einleitung: Der <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> und sein Bezug zum Motto des 38.<br />
Kongresses für Verkehrspsychologie<br />
Das Motto des 38. BDP-Kongresses „Verkehrspsychologie bewegt – Personen, Systeme,<br />
Daten“ macht uns auf die intrinsische Komplexität des Phänomens <strong>der</strong> Bewegung<br />
aufmerksam. Wie ich zeigen werde liegt dem Phänomen <strong>der</strong> senso-motorischen Bewegung,<br />
wie <strong>der</strong> motorisierten Bewegung, eine Einheit und Einzigartigkeit zugrunde, die auch noch die<br />
psychologische Rationalitätsform <strong>der</strong> intelligenten Fahrzeugführung begründet. Die<br />
Rationalitätsform <strong>der</strong> Bewegung in <strong>der</strong> Zeit hat schon Platon erkannt und in <strong>der</strong> Einheit von<br />
bewegen und bewegt werden auf den <strong>Begriff</strong> gebracht. Diese Einheit will ich im folgenden<br />
beschreiben und zweierlei zeigen.<br />
Erstens, dass im Prozess des Autofahrens die intellektuellen Fertigkeiten nicht von den<br />
perzeptuell-motorischen Fertigkeiten des Fahrzeugführens getrennt werden können und dass<br />
beide Intelligenzformen wie<strong>der</strong>um nicht wertfrei und abgesehen von Tugenden und<br />
Gerechtigkeitsfragen betrachtet werden können. Zweitens, dass <strong>der</strong> unbestimmte Rechtsbegriff<br />
<strong>der</strong> „Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs“ nur dann korrekt begriffen werden kann, wenn<br />
er mit einem gemischt empirisch-normativen und damit anomalen ( nicht allein in einer<br />
naturwissenschaftlichen Sprache formulierbaren) <strong>Begriff</strong> explizit gemacht werden kann. Einen<br />
solchen <strong>Begriff</strong> habe ich im <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> gefunden.<br />
Mit dem Tagungsmotto wird dreierlei suggeriert:<br />
- Erstens, dass die Verkehrspsychologie sich bewegt o<strong>der</strong> aber selbst bewegt sei.<br />
- Zweitens, dass die Verkehrspsychologie tatsächlich den Unterschied in <strong>der</strong> (natürlichen und<br />
kulturellen) Bewegung von Menschen – im Gegensatz zur (technischen o<strong>der</strong> elektronischen) Bewegung<br />
von Daten, Gütern, Systemen und Informationen- kennt und korrekt beschreiben kann. (Denn eine<br />
Beschreibung von Bewegung darf nur dann psychologisch genannt werden, wenn sie nicht nur eine<br />
physikalische Ortsverän<strong>der</strong>ung enthält, die eine Ordnung in <strong>der</strong> Beziehung zwischen Objekten darstellt.<br />
Sie muss auch eine geistige und soziale Verän<strong>der</strong>ung innerhalb <strong>der</strong> Identität beschreiben, was<br />
psychologisch als eine zeitliche Beziehung <strong>der</strong> Selbstentwicklung und als eine soziale Beziehung<br />
zwischen Subjekten begriffen werden muss.)<br />
- Drittens, dass die Verkehrspsychologie uns als Verkehrspsychologen bewegt und zwar im Sinne<br />
sowohl einer kognitiven Aktivierung als auch eines emotionalen Berührtseins durch die mo<strong>der</strong>nen<br />
gesellschaftlichen Konstruktionen von Verkehr, Transport und Verkehrspsychologie.<br />
All die folgenden Fragen, die mit unserem Tagungsmotto verbunden sind, bleiben rätselhaft und geben<br />
weiterhin Anlass zum Staunen. 1<br />
- Worin besteht die unauflösliche Verbindung von motorisierter Bewegung, Zeit und Selbst;<br />
- was macht Verkehrspsychologie (als wissenschaftliche Praxis) aus und wie unterscheidet; sie sich von<br />
Technik und (menschlicher) Natur, wovon sie abhängig ist,<br />
- welchem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel unterliegen die begrifflichen und die<br />
politischen Bewegungen <strong>der</strong> Verkehrspsychologie 2 ,<br />
- wie ist <strong>Mobil</strong>ität in einer bewegten Welt von Verkehrsteilnehmern insgesamt zu verstehen und<br />
gegebenenfalls zu verän<strong>der</strong>n und nicht zuletzt:<br />
1<br />
Vgl. dazu den Vortrag von Xaver Bacherle (2002): Erlebtes Staunen, in diesem Band<br />
2<br />
Siehe mein Paper, in dem ich den begrifflich-theoretischen sowie den gesellschaftlich-normativen<br />
Rahmen einer nicht nur diagnostisch, son<strong>der</strong>n interventionistisch orientierten Verkehrspsychologie zu<br />
rekonstruieren versuche: „Über Verkehrspsychologie, Teil 1. Ms., Esslingen 1996<br />
5<br />
Der Körper-Seele-Dualismus in <strong>der</strong> Einteilung <strong>der</strong> Gebiete sicherer, Menschen möglicher Erfahrung und<br />
Erkenntnis wie<strong>der</strong>holt sich <strong>der</strong>zeitig innerhalb <strong>der</strong> psychologischen Wissenschaft als Geist-Gehirn-<br />
Dualismus und verwirrt die Forscher ebenso stark, wie er sie motiviert, ihn einseitig aufzulösen: entwe<strong>der</strong><br />
Seite - 1 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
aus.<br />
- welche Denk- und Gemütsbewegung löst die Verkehrspsychologie in uns Verkehrspsychologen<br />
Schwierigkeiten im Verständnis psychomotorischer Bewegungen<br />
Wir verstehen spontan, was jemand tut, wenn er Auto fährt und bemüht ist, sich im<br />
Straßenverkehr rücksichtsvoll gegenüber an<strong>der</strong>en Verkehrsteilnehmern zu verhalten. Wenn wir<br />
aber wissen wollen, was jemand tut, <strong>der</strong> Auto fährt, dann verstehen wir das nicht von selbst.<br />
Unser Verständnis <strong>der</strong> psychologischen Grundlagen des Erwerbs und des Aufbaus von<br />
psychomotorischen Operationen ist verglichen mit dem Verständnis von kognitiven Operationen<br />
immer noch sehr unterentwickelt. Wenn wir miteinan<strong>der</strong> über das Gebiet von „Kognition,<br />
Handeln, Sprache, Gedächtnis, und Wissen“ kommunizieren, dann können wir leicht feststellen,<br />
ob wir über das Selbe reden und ob <strong>der</strong> jeweils Zuhörende schon begriffen hat, was <strong>der</strong> jeweilig<br />
Sprechende gerade gemeint hat. Wenn wir aber miteinan<strong>der</strong> über das Gebiet von „Bewegen<br />
und Bewegt-werden“ kommunizieren, wie z.B. auf Bäume klettern, rote Beeren vor grünem<br />
Hintergrund pflücken, Auto o<strong>der</strong> Motorrad fahren, Tanzen, Fechten, Fußball spielen, dann<br />
verirren wir uns leicht in den Worten und <strong>Begriff</strong>en, die wir benutzen. Wie wird das Denken<br />
damit fertig? Wir vollziehen im Denken und Sprechen – gedankenlos und wie<br />
selbstverständlich - die die Mo<strong>der</strong>ne kennzeichnende Körper-Seele-Spaltung, die auch bei <strong>der</strong><br />
Einteilung <strong>der</strong> Wissens- und Forschungsgebiete in Psychologie, Soziologie, Politik und<br />
Geschichte einerseits und in Physiologie, Neurobiologie, Neurochemie und Genetik an<strong>der</strong>seits<br />
Pate stand. 5<br />
Wie ich später (im Abschnitt: „Von <strong>der</strong> Kraftfahreignung zur <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong>) genauer<br />
zeigen werde, handelt es sich um das gleiche Phänomen <strong>der</strong> Spaltung in Körper (Bewegung<br />
und Handeln) und Geist (Selbstgefühl und Denken): in <strong>der</strong> Praxis bemühen wir uns, und in <strong>der</strong><br />
Regel gelingt es uns auch, elegant und sicher Motorrad zu fahren, wissen aber nicht, dass es<br />
sich hierbei um hochkomplexe und hochintelligente Leistungen handelt. Im Denken<br />
überbewerten wir den Unterschied zwischen psychomotorischen und kognitiven Leistungen,<br />
statt unseren psychomotorischen Bewegungen die Intelligenz zurückzugeben, die sie in sich<br />
haben und die in unserem Leib "verkörpert" sind. Damit sind wir beim <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> angekommen, dessen wahre Bedeutung mir erst nach und nach klar<br />
geworden ist.<br />
Verkehrsintelligenz als die zentrale Frage <strong>der</strong> Verkehrspsychologie<br />
Es geht es um die wissenschaftlich spannende Frage: Wie konnte es dem mo<strong>der</strong>nen Mensch<br />
gelingen, nicht nur diejenigen kognitiven o<strong>der</strong> intelligenten, son<strong>der</strong>n auch diejenigen<br />
personalen und sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, die den so komplexen psychomotorischen<br />
Prozessen wie dem Bewegen von Kraftfahrzeugen sowie dem motorisierten Bewegtwerden im<br />
heutigen Straßenverkehr zugrunde liegen. Wir Verkehrspsychologen, so meine ich, sollten<br />
in einem naturalistischen Monismus (die neurobiologischen Kognitionswissenschaften) o<strong>der</strong> in einem<br />
existenziellen Dualismus (Geistes- und Sozial- versus Naturwissenschaften). Die weitere Entwicklung<br />
wird mit guten Gründen auf einen nicht-naturalistischen Monismus (eine Art „objektiven Idealismus“ wie<br />
ihn Jean Piaget in seinem Forschungsprogramm verfolgt hat) hinauslaufen. Siehe mein Papier: Darwin,<br />
Piaget und Entwicklung, Ms.: Esslingen, 2001<br />
Seite - 2 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
darauf eine (Kopf und Hand) umfassende psychologische und nicht bloß eine kognitive Antwort<br />
parat haben. 6 Dies schon deshalb, weil es bei dem Phänomen <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz um mehr<br />
geht als um die bloß naturalisierte Beschreibung und Verän<strong>der</strong>ung psychomotorischer und<br />
kognitiver Fähigkeiten. Es handelt sich zusätzlich auch um das praktisch normative Problem<br />
<strong>der</strong> Fahreignung, um das, was man mit dem Charakter, mit den praktischen Prinzipien o<strong>der</strong> mit<br />
den Tugenden des guten Kraftfahrers meint. 7<br />
Statisch betrachtet geht es bei dem Phänomen <strong>der</strong> motorisierten Bewegung im Straßenverkehr<br />
um eine doppelte Verwandlung im Prozess <strong>der</strong> zunehmenden Distanzierung von Mensch und<br />
Natur mit Hilfe <strong>der</strong> Technik. Der Mensch verwandelt sich in eine Naturkraft, die <strong>der</strong> Fahrer<br />
immer dann an sich selbst erfährt, wenn er sich in seinem Fahrzeug im Straßenverkehr<br />
bewegt: das Subjekt „Mensch“ wird in <strong>der</strong> Verkehrsteilnahme zu dem technisch bewegten<br />
Objekt „Autofahrer“, das seine Subjektivität dabei jedoch nicht verliert. Gleichzeitig wird auch<br />
das Objekt „Fahrzeug“ in ein geliebtes Objekt 8 <strong>der</strong> technischen Beherrschung von Natur<br />
verwandelt, insofern es von Technikern hergestellt wurde und von Menschen benutzt wird.<br />
Damit ist die Naturkraft <strong>der</strong> Bewegung durch den Menschen technisiert, humanisiert und<br />
sozialisiert geworden. An<strong>der</strong>s ausgedrückt: während <strong>der</strong> Verkehrsteilnahme wird das technisch<br />
hergestellte „Kraftfahrzeug“ - als ein den Gesetzen <strong>der</strong> empirischen Natur folgendes Objekt „<br />
motorisiertes Fahrzeug“ - in das humanisierte und sozialisierte, den normativen Gesetzen <strong>der</strong><br />
Politik und des Rechts folgende Objekt „mein Auto“ verwandelt.<br />
Genetisch betrachtet ereignet sich diese technisch hergestellte Verwandlung im Verlauf <strong>der</strong><br />
Entwicklung von Subjekt und Objekt immer als eine sensomotorische und zugleich intelligente<br />
Bewegung in <strong>der</strong> Zeit. 9<br />
Einheit von <strong>Mobil</strong>ität, Emotion und Zeit in <strong>der</strong> Geschichte<br />
Im Folgenden gehe ich nur die Frage nach <strong>der</strong> unauflöslichen Verbindung von motorisierter<br />
Bewegung, Selbstbewegung und Zeit ein. Ich konzeptualisiere die Verbindung von Bewegung<br />
und Zeit als eine (einer Entwicklungslogik folgende) Einheit von natürlicher und zugleich<br />
technisch hergestellter Bewegung von Kraftfahrzeugen einerseits und von Verän<strong>der</strong>ung des<br />
Fahrers im lebensumspannenden Verlauf seiner Verkehrsteilnahme an<strong>der</strong>erseits. Dafür bringe<br />
ich die Einheit <strong>der</strong> Bewegung von (technisch hergestelltem) Automobil und (<strong>auto</strong>mobil<br />
gemachtem) Autofahrer in <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz auf den <strong>Begriff</strong>.<br />
In <strong>der</strong> Erfahrung von Bewegung verbergen sich so große kognitive Dissonanzen und grundbegriffliche<br />
Verwirrungen, dass es 2000 und mehr Jahre gedauert hat, bevor diese Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
im Rahmen einer Theorie gefasst und damit begreifbar gemacht werden konnten.<br />
6 Die Sicht <strong>der</strong> kognitiven Psychologie wird umfassend dargestellt von: Groeger, J.A.: Un<strong>der</strong>standing<br />
driving. Applying cognitive psychology to a complex everyday task. East Sussex: Psychology Press,<br />
2000<br />
Die handlungstheoretische Sicht, wonach psychomotorische und kognitive Fertigkeiten ( Akte des<br />
Wahrnehmens, Bewegens und Denkens) sich psychologisch eher gleichen als unterscheiden, insofern<br />
alle Formen <strong>der</strong> Erfahrungsbildung und des Wissenserwerbs performatorisch sind, wird als Überblick<br />
brillant dargestellt von D.A. Rosenbaum, R.A. Carlson, Rick O. Gilmore: Acquisition of Intellectual an<br />
Perceptual-Motor-Skills, in: Ann. Rev. Psychol., 2001, 52; 453-70.<br />
7 Damit ist zunächst nur das Problem einer wissenschaftlich anschlussfähigen und praktischen<br />
Verkehrspsychologie unverzerrt und theoretisch unverkürzt benannt. Dennoch ist praktisch viel erreicht,<br />
denn das Problem einer Verkehrssicherheitsarbeit muss als solches begriffen sein, bevor man das<br />
gesellschaftliche Problem <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit in <strong>der</strong> Praxis erfolgreich bewältigen<br />
kann.<br />
8 Siehe dazu die umfassende Darstellung geliebter Objekt von Tilman Habermas, 1996<br />
9 Bruno Latour (1998) beschreibt nicht nur eine Verwandlung, son<strong>der</strong>n eine vollkommen neue<br />
Erschaffung von bislang unbekannten Wesen, die aus einer Vermischung von Natur und Kultur, sowie<br />
aus <strong>der</strong> Trennung des Menschen und <strong>der</strong> Gesellschaft von <strong>der</strong> Natur entstanden sind. Es handelt sich<br />
dabei um "Hybriden o<strong>der</strong> "Quasi-Objekte"", die damit sowohl natürlich, als auch sozial determiniert sind.<br />
Das Automobil ist ein gutes Beispiel für solch einen geliebten Hybriden.<br />
Seite - 3 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Zenon hebt mit seiner argumentativen Kraft die Bewegung auf, indem er auf die Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
<strong>der</strong> Bewegung im Sinne einer Ortsverän<strong>der</strong>ung hinweist. In seinem berühmten Beispiel läuft <strong>der</strong><br />
schnellfüßige Achill vergeblich <strong>der</strong> ungleich langsameren Schildkröte nach. Indem er sich<br />
bewegt ist er nicht mehr am ersten Ort, aber noch nicht am zweiten. Das gleiche gilt für die<br />
Bewegungen <strong>der</strong> Schildkröte. Achill wird mithin die Schildkröte niemals einholen können. Gibt<br />
es also keine Bewegung und wenn doch, was setzt sie voraus?<br />
Platon begreift die Seele als eine Selbst-Bewegte o<strong>der</strong> eine Selbstbewegliche. Im Deutschen<br />
haben wir für diese Selbstbewegung das gemischt griechisch-lateinische Wort „Automobil“.<br />
Noch heute bezeichnen die Griechen das mechanisierte Fahrzeug, das wir „Automobil“ nennen<br />
mit dem Wort „Autokineton“. Platons Konzept von Seele als geordneter Selbstbewegung meint,<br />
dass es die Zeit ist, die die Seele konstituiert und dass die Zeit die Seele zu einer Ordnung von<br />
Bewegung macht. Sich aus sich heraus bewegen zu können, genauer: von sich aus immer<br />
wie<strong>der</strong> neu anfangen zu können, das ist für Platon <strong>der</strong> nicht-mechanistische, auf dem Prinzip<br />
<strong>der</strong> Lebendigkeit beruhen<strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> von Seele. Ein auf solche Weise selbstbewegtes, wie wir<br />
heute sagen, psychologisch strukturiertes Konzept <strong>der</strong> Ordnungs- und Bedeutungsfunktion von<br />
„Seele“ resultiert weniger aus direkter, subjektiver Erfahrung im Umgang mit Bewegung, als<br />
vielmehr aus einer reflexiven Vertrautheit mit sich selbst als einem intentional handelnden,<br />
denkenden und fühlenden (e-motionalen) 10 Wesen. Nach Platon resultiert das nichtmechanistische<br />
Konzept von Psyche auf einer Selbstbezüglichkeit, in <strong>der</strong> das Bewegende und<br />
das Bewegte dasselbe sind. Ist es aber nicht ein hölzernes Eisen, wenn von einer Bewegung<br />
gesprochen wird, die sich selbst bewegt? O<strong>der</strong> haben wir Menschen ein angeborenes<br />
Gewissen, das uns ermöglicht, im Verlauf unserer Entwicklung die Fähigkeit zu erwerben uns<br />
untereinan<strong>der</strong> moralisch zu verantworten und uns und die an<strong>der</strong>en als selbstbewegte und damit<br />
als freie und frei bewegliche Wesen zu verstehen, die unserem Selbst ähnlich sind?<br />
Leibniz und Newton lösen das Rätsel von Zenon auf, wie Ortsverän<strong>der</strong>ung durch Bewegung<br />
möglich sind und können als erste erklären, warum sich die Geschwindigkeiten von Objekten im<br />
freien Fall erhöhen.<br />
Darwin und die Anthropologie des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts konnten die aristotelische Bestimmung des<br />
Menschen als politisches Wesen verständlich machen, wonach Tiere im Gegensatz zu Pflanzen<br />
im Raum wohl Pfade haben, aber nur Menschen die Technik entwickeln konnten, Wege und<br />
Straßen herzustellen. 11<br />
Und erst Piaget gelang es begreifbar zu machen, dass und warum Tiere und Kleinkin<strong>der</strong> mit<br />
dem Bewegungsvermögen ihres Leibes (in Weiterentwicklung ihres Systems sensomotorischer<br />
Operationen) präoperative Denkbewegungen ausführen können, in keinem Fall aber konkrete<br />
und abstrakte Sprechbewegungen o<strong>der</strong> kritisch-reflexive Denkbewegungen.<br />
In meinem Vortrag will ich mich, wie gesagt, auf die erste Frage nach <strong>der</strong> verzeitlichten<br />
Beziehung von Bewegung (Intelligenz) und Emotion (Selbst) beschränken. Die Antwort, die ich<br />
im <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz gebe, ist eine platonische. Sie geht von <strong>der</strong> im Menschen sich<br />
zeigen<strong>der</strong> Einheit von Zeit und Selbst aus. Die begriffliche Brüche und die psychophysischen<br />
Ungereimtheiten einer technisch bewegten intelligenten Bewegung werden in ihrer<br />
Konzeptualisierung aufgelöst, indem die erkannten Wi<strong>der</strong>sprüche in einer Theorie <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz begrifflich erfasst und damit begreifbar gemacht werden.<br />
Noch eine letzte Vorbemerkung: Beim Thema „Begreifen von Verkehrsintelligenz“ geht es mir<br />
weniger um ein philosophisches Glasperlenspiel mit <strong>Begriff</strong>en, als darum, dem Mangel an<br />
10<br />
Im "Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Lateinisch-Deutsch" werden die Wörter motus und<br />
moveo folgen<strong>der</strong>maßen übersetzt: motus, us m (moveo) 1. a) Bewegung meist als Zustand = das<br />
Sichbewegen od. Bewegtwerden; b) Lauf, Gang, Wendung; c) Erschütterung d) Aufbruch, Abreise; e)<br />
Körperbewegung, taktmäßige Bewegung, Tanz; f) mil. Schwenkung; 2. a) Gemütsbewegung, Erregung,<br />
Leidenschaft; b) geistige Tätigkeit; c) Trieb, Antrieb, Begeisterung; 3. politische Bewegung, Aufstand,<br />
Aufruhr, auch politische Umwälzung 4. (bei Quintilian) (rhet. t.t.) bildlicher Ausdruck, Tropus – motu<br />
proprio (aus eigenem Antrieb) Formel in Reskripten <strong>der</strong> Päpste, die auf <strong>der</strong>en eigene Anregung<br />
zurückgehen.<br />
11<br />
: Maxwell G. Lay: Die Geschichte <strong>der</strong> Straße. Vom Trampelpfad zur Autobahn. Frankfurt: Campus,<br />
1994, beschreibt in <strong>der</strong> Kultur- und Technikgeschichte <strong>der</strong> <strong>Mobil</strong>ität, wie im Prozess <strong>der</strong> Zivilisierung <strong>der</strong><br />
Bewegung die Tierpfade vom Mensch in ein einheitliches System gebracht wurden.<br />
Seite - 4 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
wissenschaftlichen und politischen Begreifen in <strong>der</strong> Praxis entgegenzuwirken, einem Mangel,<br />
<strong>der</strong> auf ein frühes Entwicklungsstadium einer gering entwickelten theoretischen Kultur hinweist<br />
- nicht nur in <strong>der</strong> Verkehrspsychologie, son<strong>der</strong>n auch in <strong>der</strong> psychologischen Wissenschaft<br />
insgesamt.<br />
Entwicklung von <strong>Mobil</strong>ität: zunehmende Distanz von Mensch und Umwelt<br />
Erst <strong>der</strong> erwachsene Mensch kann die Distanz zwischen sich selbst und seiner Mit- und Umwelt<br />
so weit vergrößern, dass er zu einer bewussten Lebensführung, sowie zu sozialen und<br />
politischen Denkbewegungen fähig wird. Das abstrakt o<strong>der</strong> reflexiv operatorisch denkende<br />
Individuum kann sich selbst als Teil einer Pluralität von Welten begreifen und nicht nur als Teil<br />
einer konkret sichtbare, fühlbare o<strong>der</strong> hörbare Welt. Es allein ist fähig diese seine Bil<strong>der</strong>,<br />
Befindlichkeiten und inneren Stimmen zu seinem eigenen Verhalten, innerem Erleben und<br />
Wollen in Beziehung zu setzen. Es wird fähig sich nach selbst gegebenen Maßstäben glücklich<br />
o<strong>der</strong> verzweifelt zu fühlen, indem es in <strong>der</strong> Zeit in eine Distanz zu seinem bewussten Handeln,<br />
Wollen und Erleben geht. Diese Leistungen sind immer an den Leib, den wir Menschen haben,<br />
gebunden o<strong>der</strong> genauer ausgedrückt: sie sind in dem Leib, <strong>der</strong> wir sind „verkörpert“.<br />
Dies kann zu <strong>der</strong> Einsicht führen, dass die perzeptuell-motorischen Fertigkeiten zum Führen<br />
eines Fahrzeugs nicht weniger intelligent sind als die kognitiven und sozialen Fertigkeiten.<br />
Bedenken wir dazu folgendes: im Jahre 1997 hat man ein Computerprogramm entwickelt, das<br />
den amtierenden Weltmeister im Schach besiegen konnte, aber immer noch nicht einen<br />
Roboter, <strong>der</strong> so erfolgreich auf einen Baum klettern kann wie ein fünfjähriger Junge,<br />
geschweige denn einen Roboter, <strong>der</strong> ein Auto so intelligent auf unseren Straßen und Plätzen zu<br />
bewegen weiß, wie ein 18-jähriger Fahranfänger. Dies bedenkend erkennen wir leicht, dass<br />
unser psychologisches Verständnis <strong>der</strong> psychologischen Grundlagen perzeptuell-motorischer<br />
Fertigkeiten und raum-zeitlicher Orientierung noch sehr gering entwickelt ist verglichen mit dem<br />
Verständnis, das wir in <strong>der</strong> Psychologie über die kognitiven und sozialen Fertigkeiten des<br />
Handelns, Entscheiden und Nachdenkens entwickelt haben.<br />
Im Gegensatz zum Mensch kann ein Affe Kognitionen und Emotionen, z.B. Angst nur direkt und<br />
ohne Distanz zu seinem Verhalten fühlen und infolge davon nur Fluchtbewegungen ausführen.<br />
Ein Affe ist wohl ein fühlendes und auch intentional handelndes Wesen, aber erst <strong>der</strong> Mensch<br />
kann sich als fühlendes und denkendes Wesen begreifen. Aus dieser Differenz, welche die<br />
Intelligenz und die Einheit von Bewegen (Nachdenken) und Bewegtwerden (Wahrnehmen,<br />
Fühlen) im menschlichen Handeln betont, wird die zentrale theoretische Frage <strong>der</strong><br />
Verkehrspsychologie verständlich: Wie ist <strong>der</strong> Zusammenhang in <strong>der</strong> Einheit von motorisierter<br />
Bewegung, intelligenten Kognitionen und reflexivem Selbst zu denken?<br />
Wenn nun die durch technisch hergestellte <strong>Mobil</strong>ität bedingte zunehmende Distanzierung von<br />
Mensch und Natur im Nachdenken bewusst wird, können diese immer noch unbegriffenen<br />
Distanzerfahrungen in <strong>der</strong> verkehrspsychologischen Therapie an den auffälligen<br />
Verkehrsteilnehmer weitergegeben werden. Auf diese Weise trägt die verkehrspsychologische<br />
Theorie und Therapie sowohl zur individuellen Bewältigung <strong>der</strong> durch die motorisierte <strong>Mobil</strong>ität<br />
bewirkten Distanz von Mensch und Natur bei, als auch zur För<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> Kompensation <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz <strong>der</strong>jenigen, die mit <strong>der</strong> Vergrößerung dieser Distanz von Mensch und Natur<br />
im Straßenverkehr noch nicht zurechtgekommen sind. Und diese verkehrspsychologische<br />
Leistung gelingt in <strong>der</strong> Praxis auch. Sie darf aber erst dann als wirksam gelten, wenn auch<br />
theoretisch begriffen wurde, warum es die von Natur aus bedingte Mittelbarkeit von Mensch und<br />
Natur ist, die durch technisch hergestellte <strong>Mobil</strong>ität noch mehr vergrößert wurde. Und wenn<br />
auch begriffen wurde, dass es diese Distanz selbst ist, die dem Entwicklungsprozess <strong>der</strong><br />
Seite - 5 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Vergrößerung des Abstands zwischen <strong>auto</strong>mobil gewordenem Subjekt „Fahrer“ und <strong>auto</strong>mobil<br />
gemachten Objekt „Fahrzeug“ zugrunde liegt. 12<br />
Das Phänomen <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Beginnen wir mit einer naiv-psychologischen Beschreibung des Phänomens <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz und erinnern uns staunend an die folgenden drei Themen:<br />
1 Der Wunsch nach <strong>Mobil</strong>ität in Raum und Zeit ist ein uralter Traum <strong>der</strong> Menschheit.<br />
Bewegen und Sehen sind biologische Grundbedürfnisse des Menschen. Die<br />
Koordination von Motorik und Sensorik stellen den Beginn menschlicher Tätigkeit wie<br />
Wahrnehmen, Wollen, Fühlen und Nachdenken dar. Ein breiter Sektor <strong>der</strong> Technik gilt <strong>der</strong><br />
Motivation, die auf die Koordination von Bewegung und Sehen ausgerichtet ist. Die technische<br />
Herstellung von Geschirr, Sattel und Steigbügel haben es dem Menschen ermöglicht,<br />
bequemer zu reiten und tierische Zug- und Tragkräfte optimaler zu nutzen.<br />
Die Erfindung des Rades machte es geradezu zum Symbol <strong>der</strong> Technik. Ohne Rad gäbe es<br />
keine Drehbank, keine Spinnfabrik, we<strong>der</strong> Schiff, Flugzug, Auto, noch Eisenbahn, aber auch<br />
keine Globalisierung, kein Tourismus und keine mo<strong>der</strong>ne Wirtschaft.<br />
Die Bewegung von Fahrzeugen ohne Pferde hat die menschliche Phantasie seit dem Altertum<br />
beschäftigt. Vorbil<strong>der</strong> fand <strong>der</strong> Mensch in <strong>der</strong> tierischen Muskelkraft, im Wind und im Dampf,<br />
mithin in <strong>der</strong> Natur. Noch die Bewegungen des Fliegens hatte Natur, nämlich den Vogelflug<br />
zum Vorbild. Erst die Raketen hatten keine Vorläufer mehr in <strong>der</strong> Natur. Die Raumfahrt<br />
entwickelte sich ganz aus dem menschlichen Geist, aus <strong>der</strong> Einheit von menschlicher<br />
Phantasie, technischem Können, sozialer Organisation und wissenschaftlichem<br />
Erkenntnisdrang. Diese Einheit von Technik, Wissenschaft und Phantasie wie<strong>der</strong>um<br />
verweist auf eine Vision von Verkehrsintelligenz. 13<br />
2 Vielleicht kann uns die Erfahrung <strong>der</strong> Unterschiede in <strong>der</strong> Bewegung und in <strong>der</strong> ihr zugrundeliegenden<br />
räumlichen Intelligenz von Tier und Mensch lehren das Wesentliche und<br />
Beson<strong>der</strong>e des menschlichen Verkehrsverhalten genauer zu verstehen.<br />
Bei einem Besuch in einem Zoo können wir uns fragen, welche Unterschiede und<br />
Gemeinsamkeiten es in <strong>der</strong> spezifischen Beweglichkeit von Tier und Mensch gibt und ob wir in<br />
den Unterschieden <strong>der</strong> Tiere untereinan<strong>der</strong> und in dem Unterschied und <strong>der</strong> Gemeinsamkeit<br />
zwischen Tier und Mensch eine Entwicklungslogik von Bewegung und Leiberfahrung erkennen<br />
können. Stellen die Hilfsmittel im Zoo, die den einzelnen Tierarten zur Verfügung gestellt<br />
werden, damit sie sich auch in ihrer neuen Umgebung wohl fühlen und möglichst frei und<br />
artgemäß bewegen können, nicht biologisch sensible Techniken dar, die den Besuchern die<br />
unterschiedlichen Intelligenzformen in <strong>der</strong> Bewegung und räumlichen Orientierung von Tier und<br />
Mensch verständlich machen können?<br />
In <strong>der</strong> folgenden Reihe <strong>der</strong> Übergänge vom Fisch zum Mensch können wir erste Umrisse einer<br />
Entwicklungslogik <strong>der</strong> Bewegung in den speziesspezifischen Raumfel<strong>der</strong>n erkennen:<br />
• Für die spezifische Bewegungsfähigkeit von Fischen braucht es nur Wasser, um ihre<br />
Bewegungsintelligenz zu zeigen und zu för<strong>der</strong>n.<br />
12<br />
Jean Piaget hat fast sein gesamtes wissenschaftliches Werk <strong>der</strong> Beschreibung dieses<br />
Äqulibrationsprozesses gewidmet und in seinem Buch „Biologie <strong>der</strong> Erkenntnis“ (1970) diesen Prozess<br />
dadurch auf den <strong>Begriff</strong> gebracht, dass er einen Parallelismus zwischen sensomotorischen<br />
<strong>Mobil</strong>itätsformen und den entsprechenden psychologischen Formationsprozessen annimmt.<br />
13<br />
Die Freiheit zur Verän<strong>der</strong>ung des uns sinnlich Gegebenen mit Hilfe von selbstkonstruierten<br />
motorischen Bil<strong>der</strong>n weist auf eine spezifische menschliche Freiheit des Denkens hin. Diese Freiheit ist<br />
im technischen Bereich zukunftsoffen und hat bislang zu den uns heute bekannten Fahr- und Flugzeugen<br />
geführt. Im psychologischen Bereich ist diese Freiheit jedoch grundsätzlich, insoweit sie den Übergang<br />
von den sensomotorischen zu den kognitiven Operationen bewirkt.<br />
Seite - 6 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
• Vögel benötigen Plätze zum Starten und Landen, um mit ihrem Körper ihre<br />
Flugbewegungen zu gestalten und zu optimieren.<br />
• Säugetiere bekommen Balken zum balancieren, tischartige Plätze zum Ausruhen, Rutschen<br />
zum Erproben ihrer Geschicklichkeit und auch Bälle und große Reifen, um ihren Körper im<br />
Erfassen dieser Rauminstallationen zu erfahren.<br />
• Menschenaffen werden Schaukeln, Leitern, Kisten, Stäbe, Stühle, ja ganze Zimmereinrichtungen<br />
zur Verfügung gestellt, um ihre auf Erfolg ausgerichtete räumliche Intelligenz<br />
erproben und vertiefen zu können.<br />
• Wer einen mo<strong>der</strong>nen Zoo o<strong>der</strong> ein Museum für Kin<strong>der</strong> besucht, kann dort die unterschiedlichsten<br />
Spielzeuge für Menschenkin<strong>der</strong> betrachten, mit denen versucht wird sie<br />
anzuregen, ihre räumliche <strong>Mobil</strong>ität und ihre präoperative Intelligenz zu beweisen und sie<br />
unter kalkuliertem Risiko zu erproben: bewegliche Treppen, enge Röhren, Hin<strong>der</strong>nisse mit<br />
Stricken, sowie künstliche Kletterwände simulieren eine <strong>der</strong> den Tieren ähnliche natürliche<br />
Wildnis für das Menschenkind, die es zu erkunden und zu bewältigen gilt.<br />
• Im Auto und noch mehr im Flugzeug hat <strong>der</strong> erwachsene Mensch den Abstand zwischen<br />
seinem Körper, seinen Kognitionen und Emotionen einerseits und seiner natürlichen wie<br />
sozial determinierten Umwelt an<strong>der</strong>erseits technisch so weit vergrößert, dass es ihm<br />
möglich wurde neue Raum- und Kausalitätsvorstellungen zu entwickeln, und auch völlig<br />
neue und zunächst kontraevidente Vorstellungen über sein selbstbewegtes Selbst und<br />
dessen unauflösliche Verbindung mit <strong>der</strong> Zeit. 14 Mit <strong>der</strong> technischen Konstruktion von Autos,<br />
Flugzeugen und Raketen hat <strong>der</strong> Mensch eine Technisierung seiner eigenen Natur<br />
vorgenommen, die Folgen hat für das Begreifen und Bewältigen des Zusammenspiels von<br />
Naturkraft, technologisch bestimmten und geliebten Objekten und menschlichem Geist.<br />
3 Der technisch hergestellten Distanz von <strong>auto</strong>mobilem Mensch und motorisierter Umwelt<br />
entsprechen die sozial konstruierten und gesellschaftlich hergestellten Risiken und in eins damit<br />
auch die Freiheiten einer bewegten Welt, die im Anschluss an Ulrich Beck als Risikogesell-<br />
schaft mit zunehmen<strong>der</strong> Individualisierung beschriebenen werden können. Wir werden später<br />
(in Abschnitt 5.3) darauf zurückkommen.<br />
14 Siehe dazu vertiefend Norbert Elias: Über die Zeit. Suhrkamp: Frankfurt 1989, sowie Hans Jonas:<br />
Bewegung und Gefühl. Über die Tierseele, in: Hans Jonas: Das Prinzip Leben, Suhrkamp: Frankfurt<br />
1997.<br />
Mit <strong>der</strong> technischen Erfindung des Automobils löst sich <strong>der</strong> Mensch von den Fesseln seiner<br />
Wahrnehmung und seiner Bewegung, aber nur um neue, technikspezifische perzeptuell-motorische<br />
Fertigkeiten zum Lenken eines Fahrzeugs unter den bestehenden Verkehrsverhältnissen zu erwerben.<br />
In <strong>der</strong> theoretischen Reflexion und technischen Realisation auf das reflexiv gewordene Selbst erreicht<br />
die Distanz zwischen Subjekt und Objekt, die in <strong>der</strong> tierischen Evolution begann, ihre bislang höchste und<br />
riskanteste Gestalt: das Automobil und noch mehr das Flugzeug und die Rakete ermöglichen es dem<br />
Menschen sich von seiner Bewegung, seiner Wahrnehmung und schließlich auch seinem Denken zu<br />
lösen und gänzlich neue Raumvorstellungen und Zeitempfindungen zu entwickeln. In <strong>der</strong>selben Weise, in<br />
welcher <strong>der</strong> Blick vom Mond zurück auf die Erde die Wahrnehmung <strong>der</strong> Erde verän<strong>der</strong>te, verän<strong>der</strong>te<br />
beinahe hun<strong>der</strong>t Jahre zuvor die Erfindung des Verbrennungsmotors unsere <strong>auto</strong>-mobilen, d.h. durch das<br />
Automobil in Beschleunigung geratene Raum-Zeit-Wahrnehmungsformen von Orten, Plätzen und<br />
Straßen.<br />
Nähe und Ferne, Bewegung und Stillstand, Sein und Zeit, Werden und Raum haben sich in diesem<br />
Prozess <strong>der</strong> zunehmenden Mittelbarkeit durch motorisierte <strong>Mobil</strong>ität mit verän<strong>der</strong>t. Mit Einsicht in die<br />
Interaktion dieser <strong>Begriff</strong>e hat sich die Distanz zwischen Mensch und Umwelt um einen weiteren Schritt in<br />
eben diese Mittelbarkeit durch <strong>Mobil</strong>ität vergrößert. Die Anfor<strong>der</strong>ungen an eine <strong>Mobil</strong>ität ohne Grenzen<br />
erhöhen sich damit zwangsläufig. Und das Erstaunlichste an diesem auf zunehmende Freiheit und<br />
Verwirklichung von Subjektivität gerichteten Prozess ist: er ist immer noch unabgeschlossen und<br />
unvollständig. Und er ist nicht korrekt zu beschrieben ohne Rücksicht auf die Evolution <strong>der</strong> Intelligenz in<br />
den menschlichen Bewegungen und Wahrnehmungen, einer Intelligenz, die auch noch in ihrer höchsten<br />
Entwicklung Teil des Organischen und des Materiellen <strong>der</strong> Natur ist.<br />
17<br />
Vgl. dazu Eysenck, H.J. (1993): Personality, stress and disease. The Grossarth-Maticek contribution,<br />
in: Zeitschrift für Gesundheitspsychologie 1, 183-190.<br />
Seite - 7 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Vier allgemeinpsychologische Zugänge zu Verkehrsintelligenz<br />
Am Beispiel <strong>der</strong> psychologischen Theorie (1.) <strong>der</strong> multiplen Intelligenz, (2.) <strong>der</strong> Persönlichkeitseigenschaften,<br />
(3.) <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Intelligenz und (4.) <strong>der</strong> naiv-psychologischen<br />
Konzepte von Intelligenz und Verstand soll <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz exemplarisch<br />
erklärt werden.<br />
Der <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz kann einfach und klar strukturiert dargestellt werden, sobald<br />
man die Interaktion wissenschaftshistorischer mit sachlogischer Dimensionen in den<br />
differenten Forschungstraditionen <strong>der</strong> angewandten und <strong>der</strong> allgemeinen Psychologie<br />
berücksichtigt. Wie bekannt, entstammen die Theorien <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Persönlichkeit und<br />
<strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Intelligenz aus <strong>der</strong> Forschungstradition <strong>der</strong> experimentellen Psychologie.<br />
Die Entwicklung von Persönlichkeitstests und die Intelligenzmessung hatte sich dagegen nicht<br />
an theoretischen Interessen, son<strong>der</strong>n an den Zwängen und den Wünschen <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Praxis zu orientieren. Und so blieb die Psychodiagnostik und die differentielle Psychologie viele<br />
Jahrzehnte ohne Kontakt zu den Grundlagen <strong>der</strong> forschenden Wissenschaft <strong>der</strong> Allgemeinen-<br />
und <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie.<br />
Ich will mit <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> vier Zugänge zeigen, dass alle in diesen Zugängen enthaltenen<br />
vier Forschungstraditionen <strong>der</strong> Psychologie zu kurz greifen, wenn wir sie vor dem Hintergrund<br />
eines platonischen Verständnisses von Intelligenz und Bewegung betrachten. Damit glaube ich<br />
auch zeigen zu können, warum allein ein Verständnis von Verkehrsintelligenz als Fähigkeit und<br />
als Tugend sowohl dem Problem <strong>der</strong> Bewältigung <strong>der</strong> Risiken und Chancen <strong>der</strong> motorisierten<br />
Verkehrsteilnahme, als auch dem Problem <strong>der</strong> Beschreibung und Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Kraftfahreignung gerecht werden kann.<br />
1 Der intelligenztheoretische Zugang zur Verkehrsintelligenz<br />
Es mussten seit Beginn <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Psychodiagnostik (Binet und Simon 1905) ungefähr 70<br />
Jahre vergehen, bevor eine Verbindung zwischen dem Gebiet <strong>der</strong> Denkpsychologie und <strong>der</strong><br />
Praxis <strong>der</strong> Psychodiagnostik hergestellt werden konnte. Dann konnte in <strong>der</strong> allgemeinen<br />
Psychologie die Frage aufgeworfen werden, was ein Intelligenztest überhaupt testet (kognitive<br />
Leistungen, affektive Zustände und Eigenschaften o<strong>der</strong> doch eher die Länge <strong>der</strong> Schulkarriere<br />
und Höhe des soziokulturellen Status <strong>der</strong> Eltern) und ob die Ergebnisse von Intelligenzmessungen<br />
mit den Ergebnissen <strong>der</strong> denkpsychologischen Erforschung intelligenter Leistungen<br />
übereinstimmen. Für die Verkehrspsychologie relevant wurden diese und ähnliche Fragen, weil<br />
in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Begutachtung schon in den 60er Jahren erkannt wurde, dass die Höhe des<br />
Intelligenzquotienten verkehrsauffälliger Kraftfahrer nicht mit <strong>der</strong>en Fähigkeit zum sichern<br />
Fahren zusammenhängt. Eine theoretische Fundierung von Intelligenz erscheint m.E. für die<br />
Verkehrspsychologie nützlicher zu sein, als die psychodiagnostische Bestimmung <strong>der</strong> Höhe des<br />
Intelligenzquotienten. Warum?<br />
Die Grundlagenforschung hat mit <strong>der</strong> Analyse des <strong>Begriff</strong>s <strong>der</strong> Intelligenz einen Durchbruch<br />
erzielt. Die Theorie <strong>der</strong> triarchischen Intelligenz von Sternberg und die Theorie <strong>der</strong> vielfachen<br />
Intelligenz von Gardner sind theoretisch fruchtbare Versuche „jenseits von IQ und emotionaler<br />
Intelligenz“ diejenigen Formen von Intelligenz zu bestimmen, die <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong><br />
Kompetenz zum Lösen realer Probleme in alltäglichen Situationen zugrunde liegt.<br />
Howard Gardner ( 2002) geht von einem Verständnis von Intelligenzen aus, das seiner Meinung<br />
nach wissenschaftlich am besten fundiert, weil es <strong>der</strong> Vielfalt des menschlichen Geistes<br />
und <strong>der</strong> Einzigartigkeit des individuellen Intelligenzprofils am ehesten gerecht wird und weil es<br />
für das 21. Jahrhun<strong>der</strong>t den maximalen gesellschaftlichen Nutzen zu versprechen scheint:<br />
seine eigene Theorie <strong>der</strong> vielfachen Intelligenz. Gardner (1991) postuliert ursprünglich sieben<br />
Intelligenzen: zwei theoretische Intelligenzen: die sprachliche und die logisch-mathematische;<br />
Seite - 8 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
drei technisch-künstlerische Intelligenzen: die musikalische, die körperlich-kinästhetische und<br />
die räumliche; sowie zwei personale Intelligenzen: die interpersonelle und die intrapersonale.<br />
Es scheint aus verkehrspsychologischer Sicht einleuchtend, dass es sich beim intelligenten<br />
Verkehrsverhalten eines guten Autofahrers um eine Kombination <strong>der</strong> Intelligenzform des<br />
Sehens und Raumdenkens mit <strong>der</strong> Raum- und Körperintelligenz und <strong>der</strong> psychosozialen<br />
Intelligenz handelt. Unser virtueller Besuch in einem mo<strong>der</strong>nen Zoo hat ebenfalls zu <strong>der</strong>selben<br />
Einsicht geführt, wonach es im motorisierten Verkehrsverhalten vor allem darum geht, das<br />
Raum-Zeit-Problem zu bewältigen, das sich aus <strong>der</strong> Vergrößerung des Abstands zwischen<br />
unserem Körper und unserer inneren Natur sowie unserer äußeren Verkehrsumwelt ergibt.<br />
Verkehrspsychologisch fruchtbar könnte die von Gardner(1983, 2002) postulierte Form <strong>der</strong><br />
Raum- und Körperintelligenz werden, wenn allgemein anerkannt wird, dass sich in <strong>der</strong> <strong>Mobil</strong>ität<br />
des motorisierten Verkehrsverhaltens eine Intelligenzform zeigt, die die intelligente<br />
Kombination <strong>der</strong> Bewegung des Körpers mit <strong>der</strong> Orientierung im Raum bestimmt.<br />
Eine von Gardner inspirierte These könnte lauten: Es gibt eine räumliche und/o<strong>der</strong> eine<br />
personale Intelligenz, die für das intelligente Führen eines Fahrzeugs bedeutsam ist.<br />
Verkehrsauffällig gewordene Kraftfahrer verfügen über eine gering entwickelte räumliche und<br />
personale Intelligenz. Sie kommen mit <strong>der</strong> verkehrstechnisch hergestellten Distanz zwischen<br />
sich als Verkehrsteilnehmer und ihrer inneren Natur sowie zwischen sich und den äußern<br />
Verkehrs- verhältnissen nicht mehr ausreichend gut zurecht. These 1: Es mangelt an <strong>der</strong><br />
körperlich-kinästhetischen Intelligenz in den perzeptuell-motorischen Strategien, die für das<br />
Führen eines Fahrzeugs notwendig sind. These 2: Das für das intelligente Führen eines<br />
Fahrzeugs notwendige Gleichgewicht von räumlicher und personaler Intelligenz ist gestört.<br />
These 3: Es mangelt an <strong>der</strong> personalen Intelligenz, die für das intelligente Führen eines<br />
Fahrzeugs notwendig ist.<br />
Diskussion und Kritik des intelligenztheoretischen Ansatzes:<br />
Eine grundlegende Definitionsproblematik jeglichen <strong>Begriff</strong>s von Intelligenz seit Binet und<br />
Simon (1905), und nicht erst desjenigen Intelligenzbegriffs, den Gardner (2002) benutzt, besteht<br />
darin, dass in <strong>der</strong> akademischen Psychologie die Frage nach dem Wesen <strong>der</strong> Intelligenz von<br />
<strong>der</strong> Frage nach <strong>der</strong> richtigen Anwendung von Intelligenz getrennt wird. Die Durchführung einer<br />
intelligenten Leistung "im Leben draußen" wird als ein normatives Problem begriffen und als<br />
eine Frage <strong>der</strong> Werte behandelt, von <strong>der</strong> die Akademie glaubt, sie müsse und dürfe sich, <strong>der</strong><br />
Wertfreiheit <strong>der</strong> Wissenschaft folgend, damit überhaupt nicht befassen.<br />
In <strong>der</strong> Neuzeit hat <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Intelligenz nur noch mit <strong>der</strong> Psychologie und den Kognitionswissenschaften<br />
zu tun und nichts mehr mit Moral, mehr mit Berechnung und Informationsverarbeitung,<br />
als mit Pflichten und Tugenden. Das war in <strong>der</strong> Antike und im Mittelalter nicht so.<br />
Bekanntlich geht <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Intelligenz auf den philosophischen <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Klugheit (lat.<br />
prudentia, griech. phronesis) zurück. Für Kant war Klugheit schon keine <strong>der</strong> vier<br />
Kardinaltugenden mehr. Prudentia hat man im Deutschen mit Klugheit übersetzt, so wie Cicero<br />
den griechischen <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> phronesis mit prudentia übersetzt hat. Bei Hans-Georg Gadamer<br />
(1985, Griechische Philosophie I) können wir lernen was mit phronesis gemeint ist, nämlich eine<br />
intellektuelle Tugend, die auch mit Besonnenheit verbunden ist, insofern sie als das Gegenteil<br />
von Sorglosigkeit die Disposition darstellt, in einer konkreten Situation urteilsfähig und<br />
handlungsfähig zu bleiben. 11<br />
Psychologisch weiterführend ist das triarchische Modell <strong>der</strong> Intelligenz von Sternberg (1999,<br />
Teil II), in <strong>der</strong> er die folgenden Facetten intelligenten Verhaltens beschreibt: Erstens die<br />
kognitiven Mechanismen, die intelligentem Verhalten zugrunde liegen, zweitens <strong>der</strong> freie<br />
Gebrauch <strong>der</strong> mentalen Anpassung an die Anfor<strong>der</strong>ungen und die Anregungen aus <strong>der</strong> Umwelt<br />
und drittens die repräsentative o<strong>der</strong> explikative Funktion <strong>der</strong> Intelligenz ( Geist als passive<br />
Wi<strong>der</strong>spiegelung <strong>der</strong> Natur: „Spiegel“ o<strong>der</strong> Geist als aktive Offenbarung <strong>der</strong> Natur: „Lampe“),<br />
um den Abstand zwischen <strong>der</strong> inneren und <strong>der</strong> äußern Welt zu managen. Um die drei Facetten<br />
Seite - 9 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
intelligenter Leistungen in ihrem Zusammenspiel zu begreifen entwickelt Sternberg drei<br />
Subtheorien: eine Subtheorie <strong>der</strong> Komponenten, <strong>der</strong> Kontexte und <strong>der</strong> Erfahrungsbildung in <strong>der</strong><br />
Intelligenz.<br />
Sternbergs Kritik an <strong>der</strong> herkömmlichen Intelligenztheorie und <strong>der</strong> psychometrischen Praxis<br />
Intelligenzmessung geht von dem Verständnis von Intelligenz als Erfolgsintelligenz aus<br />
(Sternberg 1999, Teil I und III.) Dazu schil<strong>der</strong>t er die böse Geschichte von den zwei Jungs, die<br />
in <strong>der</strong> Wildnis wan<strong>der</strong>n gingen. Den ersten Jungen hielten seine Eltern und Lehrer für klug und<br />
intelligent. Er verfügte über einen hohen IQ, gute Zensuren und hervorragende Zeugnisse. Den<br />
zweiten Jungen hielten bislang nur wenige für intelligent. Beide begegneten in <strong>der</strong> Wildnis<br />
einem Problem in <strong>der</strong> Gestalt eines Grizzlybären. Was passiert? Der erste Junge rechnet sich<br />
korrekt und extrem schnell aus, dass ihn <strong>der</strong> Bär in 17,4 Sekunden wird eingeholt haben und<br />
gerät in eine klinisch relevante Panik. Der zweite Junge zeigt sich emotional stabiler. Er zieht<br />
sich seelenruhig seine Wan<strong>der</strong>schuhe aus und seine Joggingschuhe an. Der erste Junge: „Bist<br />
du wahnsinnig? Meinst du wir könnten schneller laufen als <strong>der</strong> Grizzly?“ Der zweite Junge:<br />
„Nicht wirklich, aber ich muss ja nur schneller laufen als du!“ Sternberg kommentiert (1999, S.<br />
136), ohne auf die egoistische Ungeselligkeit des Zweiten einzugehen: Beide Knaben sind<br />
intelligent. Der erste hat das Problem brillant analysiert, aber nur <strong>der</strong> zweite hat<br />
Erfolgsintelligenz bewiesen, weil er nicht nur eine angemessene Problemanalyse, son<strong>der</strong>n auch<br />
eine kreative und praktische Problemlösung gefunden hat.<br />
2 Der persönlichkeitspsychologische Zugang zur Verkehrsintelligenz<br />
Die Hoffnung, durch verkehrspsychologische Maßnahmen einen Einfluss auf die Verkehrsintelligenz<br />
auffällig gewordener Kraftfahrer nehmen zu können, ist in <strong>der</strong> Praxis immer mit <strong>der</strong><br />
Einsicht in die folgende therapeutische Notwendigkeit verbunden gewesen. Man muss auf den<br />
Charakter und die normativ begründeten Einstellungen <strong>der</strong> Kraftfahrer verän<strong>der</strong>nd einwirken<br />
und nicht nur auf ihr Verhalten o<strong>der</strong> ihre Wahrnehmungs- und Steuerungsfähigkeit, um<br />
langfristig stabile Verän<strong>der</strong>ungen in ihrer Persönlichkeit und in ihren Motiven bewirken zu<br />
können.<br />
Ein persönlichkeitspsychologisch informierter Kliniker geht in <strong>der</strong> Regel davon aus: Die Gruppe<br />
<strong>der</strong> auffällig gewordenen Kraftfahrer weist eine Reihe charakteristischer personenbezogener<br />
Eigenschaften (traits) und Zustände (states) auf, die schon vor <strong>der</strong> Alkoholkarriere und vor dem<br />
Begehen ihrer Straftaten bestanden haben. Sie haben sich nicht erst in Folge des süchtigen<br />
und/o<strong>der</strong> abweichenden Verhaltens entwickelt. Solche prädispositionellen Merkmale von<br />
auffällig gewordenen Kraftfahrern lassen sich mit dem Fünf-Faktoren-Modell <strong>der</strong> Persönlichkeit<br />
(„big five“) beschreiben (McCrae, Costa, 1999). Für die Klinische Verkehrspsychologie scheinen<br />
die folgenden drei Faktoren in engem Zusammenhang mit Verkehrsverhalten zu stehen:<br />
Erstens <strong>der</strong> Faktor Extraversion versus Introversion, zweitens <strong>der</strong> Faktor Neurotizismus:<br />
„emotionale Stabilität versus emotionale Labilität“ und drittens <strong>der</strong> Faktor Gewissenhaftigkeit:<br />
„Besonnenheit versus Sorglosigkeit“.<br />
Hans Jürgen Eysenck hat einen Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitseigenschaften Extraversion,<br />
Neurotizismus und Psychotizismus einerseits und riskantem Gesundheitsverhalten an<strong>der</strong>erseits<br />
postuliert 17 . Bei aller gebotenen Vorsicht und mit ironischer Distanz zum Beschriebenen lassen sich diese<br />
drei Faktoren im Modell <strong>der</strong> big five zur Beschreibung verkehrsauffälliger Kraftfahrer kombinieren, um den<br />
Idealtypus des alkoholauffälligen Kraftfahrers, des BTM-Konsumenten, des Punkte-Täters und des guten<br />
Autofahrers zu konstruieren.<br />
- Der typische Lenker im alkoholbezogenen Trink-Fahr-Konflikt ist <strong>der</strong> impulsive und sorglose Autofahrer:<br />
extravertiert, emotional instabil ( leicht ängstlich o<strong>der</strong> depressiv) und wenig gewissenhaft. Er sucht in und<br />
mit seinem Auto nach neuen Reizen und Vergnügungen, er liebt schnelle Autos mit hell-aktiven Farben,<br />
ist dabei stressanfällig und passiv in seinem Bewältigungsverhalten in komplexen Verkehrssituationen. Er<br />
dissoziiert während seines Alkoholkonsums und gerät in diesem dissoziativen Zustand in eine „kognitive<br />
Blockade“, in <strong>der</strong> ihm seine Vorsätze kognitiv unbewusst bleiben. Deshalb ist er auch unfähig Alkohol und<br />
Seite - 10 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Autofahren streng zu trennen. Er ist oftmals auch nikotinabhängig und weist immer auch ein riskantes<br />
Verkehrsverhalten auf. Sein riskanter Fahrstil ist Ausdruck seiner Erregungssuche und einer erhöhten<br />
Risikobereitschaft, als einer Furcht vor Langsamkeit, Langeweile und eintönigen Bewegungsabläufen.<br />
Ein gutes Beispiel ist Marian Faithfull, die ehemalige Freundin von Mick Jagger. Viele junge Fahranfänger<br />
und die sog. Stressreduktionstrinker sind typische Sorglose, die nicht gut mit Sorgen und negativen<br />
Gefühlen umgehen können.<br />
- Der typische Lenker mit BTM-Konsum während <strong>der</strong> Verkehrsteilnahme ist <strong>der</strong> naiv-hedonistische<br />
Autofahrer, gekennzeichnet durch Extraversion, emotionale Stabilität und Mangel an Gewissenhaftigkeit.<br />
Er zeigt sich sozial zugewandt, emotional und körperlich stabil, spaßorientiert an fun und action, no risk<br />
no fun, ein eher jugendlicher Vertreter unsere Spaßgesellschaft, <strong>der</strong> gut mit Stress und Sorgen umgehen<br />
kann. Idealtypische und in diesem Sinne gute Beispiele sind die Figur des Fieslings aus <strong>der</strong> Dallas-Serie<br />
„J.R. Ewing“, <strong>der</strong> heutige Boris Becker, <strong>der</strong> späte Helmut Kohl, <strong>der</strong> Entertainer Thomas Gottschalk o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Musiker Willy deVille.<br />
- Der typische Punktetäter ist ein riskanter und gefährlicher Autofahrer, <strong>der</strong> sich im Straßenverkehr<br />
introvertiert, emotional instabil und wenig gewissenhaft zeigt. Er verhält sich im Umgang mit an<strong>der</strong>en eher<br />
schüchtern und scheu, ist hoch empfindlich gegenüber Stress und Belastung, mit einem deutlichen<br />
Mangel an Emotionskontrolle, wobei eher negative Gefühle (Sorgen, Ärger, Unzufriedenheit,<br />
Ressentiments) vorherrschen, bei Fehlen positiver Gefühle. Sein riskanter Fahrstil und seine Spielernatur<br />
sind ihm nicht bewusst. Er ist <strong>der</strong> innerlich angepasste Verkehrsstraftäter mit dem guten Gewissen, denn<br />
er fühlt sich als guter Autofahrer und „neutralisiert“ die negativen Folgen seines wenig intelligenten<br />
Verkehrsver-haltens. Es wäre aber eine psychologische Fehleinschätzung, wenn sein riskanter Fahrstil<br />
als bloßer Ausdruck einer egozentrischen Unfähigkeit zur Rücksichtnahme o<strong>der</strong> zur Ablehnung <strong>der</strong><br />
Straßenverkehrsgesetze gewertet würde. Das Gegenteil trifft in den allermeisten Fällen zu: er fährt im<br />
Straßenverkehr gefährlich, obwohl er Rasen in seinem moralischen Bewusstsein generell verurteilt, dabei<br />
die bestehenden sozialen Normen übernimmt und die herrschenden Gesetze gut heißt. Der gefährliche<br />
Fahrer rast, weil er glaubt, damit seine inneren Spannungen managen sowie seine negativen Gefühle<br />
reduzieren zu können. Sein riskanter Fahrstil ist Selbstausdruck seines Bedürfnisses nach<br />
Spannungsreduktion, entstanden aus seiner Furcht vor zu starken und zu vielen negativen Gefühlen.<br />
Gute Beispiele sind das Rumpelstilzchen, Oskar Matzerath in <strong>der</strong> „Blechtrommel“ von Günther Grass<br />
und Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles.<br />
- Kraftfahrer mit den folgenden Eigenschaften haben bei einer Begutachtung ihre Kraftfahreignung gute<br />
Chancen. Denn Verkehrspsychologen stellen sich den Typus des guten Autofahrers als einen Politiker,<br />
Unternehmer o<strong>der</strong> Helden vor: extravertiert, emotional stabil, und gewissenhaft. Im Straßenverkehr<br />
zeigen die guten Fahrer hohe soziale und emotionale Fähigkeiten in bezug auf ihre Selbstwahrnehmung<br />
eigener Gefühle und auf ihre Wahrnehmung <strong>der</strong> Auswirkung frem<strong>der</strong> Handlungen und Gefühle. Sie sind<br />
in <strong>der</strong> Regel selbstbeherrscht und zeigen ein mittleres Maß an Risikobereitschaft, gepaart mit <strong>der</strong><br />
Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, sowie zur Ausübung von rücksichtsvollem Handeln und<br />
vorausschauendem Denken auch und gerade in belastenden Situationen wie Verkehrsteilnahme. Der<br />
gute Autofahrer zeigt sich besonnen, stressresistent, selbstbeherrscht, verfügt über wirksame<br />
Bewältigungsstrategien und neigt we<strong>der</strong> zu Angst- o<strong>der</strong> Ärger-Exzessen noch zu ängstlich-besorgter<br />
Vorsicht. Gute Beispiele finden sich im Wissenschaftsmanagement, in <strong>der</strong> Wirtschaft, in Kultur und<br />
Politik, wie z.B. Max Planck, Hans-Martin Schleier, <strong>der</strong> Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld und Hans-<br />
Dietrich Genscher.<br />
Seite - 11 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Für den N-Faktor sind nach meinen klinischen Erfahrungen die folgenden <strong>der</strong> sechs<br />
Neurotizismusfassetten 18 für die Beschreibung des Verkehrsverhaltens beson<strong>der</strong>s relevant:<br />
N1: Angst (stark ausgeprägt)<br />
- Erhöhte emotionale Labilität o<strong>der</strong> Sensibilität für aversive Reize, d.h. für unangenehme und<br />
negativ getönte Gefühle<br />
- tägliche und belastende Distresserfahrungen.<br />
N2: Ärgerliche Feindseligkeit<br />
- erhöhte Aggressivität, Ärger-out-Reaktionen und hohe Ärgerkontrolle bei einem Mangel an<br />
Emotionskontrolle.<br />
N5: Impulsivität<br />
- Geringe Motivation Kontrollverhalten zu entwickeln, speziell Impulskontrolle auszuüben, in<br />
Verbindung mit dem gefühlten Verlangen und dem körperlich oftmals stark erlebtem Drang<br />
Alkohol trinken zu müssen um innere Spannungen abbauen zu können.<br />
- Unfähigkeit Impulsen, Gefühlsstürmen und augenblicklichen Versuchungen, die <strong>der</strong> Alltag<br />
hervorruft, zu wi<strong>der</strong>stehen, sowie Bedürfnisbefriedigungen aufzuschieben.<br />
N6: Vulnerabilität gegenüber Stress<br />
- Unfähigkeit aus Erfahrung zu lernen in Verbindung mit dysfunktionalen Kontrolltechniken,<br />
geringen Streßbewältigungsfähigkeiten und zu hohen Willenshemmungen, auch wenn die<br />
Personen motiviert sind, Selbstkontrolle einzusetzen und den eigen Willen bei fehlen<strong>der</strong><br />
(intrinsischer) Motivation einzuschalten.<br />
- geringe Frustrationstoleranz den normalen ultradianen Stimmungsschwankungen gegenüber.<br />
Für den E-Faktor erscheinen die folgenden <strong>der</strong> sechs Extraversionsfassetten für die<br />
Beschreibung des Verkehrsverhaltens relevant:<br />
E4: Aktivität<br />
- Erhöhte Aktivität ausgewiesen in schnellen Bewegungsabläufen, in dem Wunsch dauernd mit<br />
irgend etwas beschäftigt sein zu wollen, sowie in dem rasanten Tempo einer raumgreifenden,<br />
expansiven Lebensführung<br />
- Schwierigkeit sich zu entspannen und z.B. die Langsamkeit <strong>der</strong> <strong>Mobil</strong>ität zu genießen<br />
- Furcht vor Langeweile und Nichtstun<br />
E5: Erregungssuche (excitement seeking)<br />
- Erhöhtes Verlangen nach Erregung, Stimulation und thrill. Verkehrsauffällig gewordene<br />
Kraftfahrer lieben schnelle Autos, laute Umgebung und hell-aktive Farben.<br />
- erhöhte Risikobereitschaft und "Gladiatorenmentalität" (Falko Rheinberg)<br />
Für den C-Faktor erscheinen die folgenden <strong>der</strong> sechs Gewissenhaftigkeitsfassetten für die<br />
Beschreibung des Verkehrsverhaltens relevant:<br />
C3: Gewissensorientierung (dutifulness) (gering ausgeprägt)<br />
- Mangel an Regelbewusstsein, geringe Bereitschaft sozialen Normen und bestehenden<br />
Gesetzen zu folgen<br />
- Mangel an Schuldbewusstsein, Schamgefühlen und an<strong>der</strong>en positiven „sozialen Gefühlen“ wie<br />
Bedauern, Mitgefühl, Verständnis für die Sorgen und Nöte an<strong>der</strong>er<br />
C5: Selbstdisziplin und Wille<br />
- Unfähigkeit eine begonnene Aufgabe zu Ende zu führen, vor allem bei aufkommen<strong>der</strong><br />
Langeweile, fehlen<strong>der</strong> Motivation o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>n Ablenkungen<br />
C6: Besonnenheit (deliberation)<br />
- Mangel an <strong>der</strong> Fähigkeit vor <strong>der</strong> Handlungsausführung ausreichend genau und lang<br />
nachzudenken<br />
- Hastiges und undeutliches Sprechen<br />
18 Ich folge frei den Beschreibungen <strong>der</strong> einzelnen Fassetten <strong>der</strong> big five in: T. Costa and Th. Widiger<br />
(1993): Personality disor<strong>der</strong>s and the five-factor model of personality APA: Washington, Anhang<br />
Seite - 12 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
- Mangel an Bedürfnisaufschub<br />
Im Anschluss an R.J. Smith (1978,1995) Kritik einer psychologischen Theorie <strong>der</strong><br />
Psychopathie, an Gray`s behaviorales Inhibitionssystem (BIS) (Gray, 1976, 1982, 1987) sowie<br />
an Kuhls 2. Modulationshypothese (1998, 2001, sowie Kuhl&Kazen, 1997) lässt sich eine<br />
dynamischere Beschreibung des auffällig gewordenen Verkehrsteilnehmers gewinnen, die ich<br />
hier jedoch nicht näher ausführen kann. Idealtypisch zeigt ein Verkehrsteilnehmer mit einem<br />
deutlichen Mangel an Verkehrsintelligenz eine nie<strong>der</strong>e zentralnervöse Reaktionsfähigkeit (ein<br />
hypoaktives BIS). Das Vorhandensein negativer Stimmungen, mithin auch das Fehlen positiver<br />
Gefühle, sowie eine Erhöhung seines Bestrafungssystems führen zu einer Inkongruenz<br />
(mismatch) von Erwartung und Wahrnehmung und erhöhen die Auftretenswahrscheinlichkeit<br />
für Phänomene wie sensation-seeking, erhöhter Risikobereitschaft, Intensivierung aversiver<br />
Einzelempfindungen, unkontrollierbares Grübeln, Entfremdung von eigenen Gefühlen,<br />
Dissoziation o<strong>der</strong> gar Desintegration <strong>der</strong> Persönlichkeit sowie antisoziales o<strong>der</strong><br />
psychopathisches Verhalten (DSM-IV 301.7) (Kuhl, J. 2001)<br />
Bedeutsam für die Verkehrspsychologie erscheinen die big five nicht nur deshalb, weil sie die<br />
Komplexität <strong>der</strong> Persönlichkeit vor dem Auftreten einer Verkehrsauffälligkeit und/o<strong>der</strong> einer<br />
psychischen Störung mit Krankheitswert zu ordnen helfen. Aus klinischer Sicht sind die big five<br />
vor allem in <strong>der</strong> differentiellen Ursachenforschung des Mangels an verkehrsintelligenten<br />
Verhalten nützlich, weil sie eine direkte Beziehung (1) zur seelischen Gesundheit und zu einer<br />
Therapietheorie (Peter Becker, 1995, 1999), (2) zur Theorie und Therapie <strong>der</strong><br />
Persönlichkeitsstörungen (Costa&Widiger, 1993, L.S. Benjamin, 1993, Peter Fiedler 2001) und<br />
(3) vor allem zu den Grundlagen einer empiriegeleiteten Psychotherapie (Grawe, 1998,1999)<br />
aufweisen.<br />
3 Der entwicklungspsychologische Zugang zur Verkehrsintelligenz<br />
Verkehrsintelligenz kann grundsätzlich und entwicklungspsychologisch mit <strong>der</strong> vom Kind her<br />
bekannten Form <strong>der</strong> Intelligenz begriffen werden, die auf das Praktische ausgerichtet ist, um<br />
Erfolge zu erzielen. Das ist die sensomotorische Intelligenz. Seit Piaget (1936) wissen wir, dass<br />
die kognitiven und affektiven Strukturen sich aus Handeln, genauer aus sensomotorischen<br />
Operationen entwickeln, die dem Neugeborenen die ersten auf seinen Leib bezogenen<br />
Orientierungen in seiner neuen Umwelt ermöglichen. Das System <strong>der</strong> sensomotorischen<br />
Operationen darf damit als die theoretische Grundlage zum Verständnis <strong>der</strong> Entwicklung von<br />
Verkehrsintelligenz betrachtet werden. Sie bestimmt auch noch das motorisierte<br />
<strong>Mobil</strong>itätsverhalten des Erwachsenen mit. Die perzeptuell-motorischen Kompetenzen mögen<br />
sich in ihren Ausdrucksformen von den kognitiven Kompetenzen wesentlich unterscheiden,<br />
insofern die ersten nichtsymbolisch und aktional, die zweiten symbolisch repräsentiert sind. Die<br />
psychologischen Mechanismen des Erwerbs <strong>der</strong> beiden Kompetenzen sind jedoch<br />
überraschend ähnlich. (Rosenzweig, Carlson, Gilmore, 2001).<br />
Offensichtlich verän<strong>der</strong>t sich das <strong>Mobil</strong>itätsverhalten im Laufe des Lebens. So muss es<br />
verkehrspsychologisch möglich werden eine Entwicklung zu verstehen, die die gesamte<br />
Lebensspanne übergreift. Sie kann jedoch nicht begriffen werden kann ohne die selbstreflexiven<br />
und selbstregulatorischen Kreisprozesse von Wissen und Handeln zu verstehen.<br />
Dies führt aus verkehrspsychologischer Sicht dazu, dass die auf den individuellen<br />
Lebensverlauf einwirkenden historischen, kulturellen und technischen Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong><br />
Distanz von Mensch und Natur mit zu berücksichtigen sind. Es handelt sich um<br />
gesellschaftliche Prozesse des juristischen, kulturellen und technologischen Wandels in den<br />
Machtbalancen zwischen Menschen, die mit den Prozessen individueller Entwicklung<br />
(Ontogenese) so verbunden sind, dass <strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer die Entwicklung seiner<br />
Verkehrsintelligenz aktiv beeinflussen kann, und zwar dadurch, dass er mit seinem<br />
Verkehrsverhalten und mit seinen Erfahrungen über die Konsequenzen seines<br />
Seite - 13 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Verkehrsverhaltens seine Verkehrsintelligenz direkt beeinflusst und durch die sozialen<br />
Prozesse direkt beeinflusst wird (siehe Abbildung 1, Seite 16)<br />
Baltes (1997, 1998) hat einen auf <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> Lebensspanne beruhenden genetischen<br />
Ansatz vorgeschlagen, um die Entwicklung <strong>der</strong> Intelligenz mit zwei eigenständigen<br />
Komponenten des kognitiven Funktionierens erklären zu können: die flüssige Mechanik sowie<br />
die kristallisierte Pragmatik <strong>der</strong> Intelligenz. Im Gegensatz zur Entwicklung <strong>der</strong> Mechanik nimmt<br />
die Entwicklung <strong>der</strong> Pragmatik, die den Einfluss des individuellen Wissens, Handelns und <strong>der</strong><br />
Kultur offen legt, auch im höheren Alter nicht ab. Sein Zwei-Komponenten Modell, das die<br />
Lebensspanne <strong>der</strong> kognitiven Entwicklung umfasst, kann erklären, warum die Zahl <strong>der</strong><br />
Verkehrsunfälle mit dem Alter kontinuierlich abnimmt und nicht etwa zunimmt. Baltes (1998)<br />
unterschiedet ein soziales, normatives und kontextuelles Wissen von einem<br />
personenspezifischen Wissen, in dem die individuellen Erfahrungen als entwicklungsfähiges<br />
Expertenwissen gespeichert ist. Die Verkehrsintelligenz entwickelt sich im Sinne eines solchen<br />
personenspezifischen Expertenwissens, dessen Unterschiede extrem groß sein können.<br />
Speziell in <strong>der</strong> Weisheit, ein personenspezifisches Expertenwissen über die Bedeutung und<br />
Führung eines (bewussten) Lebens, steckt ein Potenzial für positive und individuell extrem<br />
unterschiedliche Verän<strong>der</strong>ungen, die auch noch im hohen Alter möglich sind. Das auf Weisheit<br />
bezogene Expertenwissen gilt als ein gut erforschter Prototyp für diese Form des<br />
personenspezifischen Wissens.(Staudinger&Baltes, 1996 und Baltes, P.B. 1998)<br />
Eine Entwicklungslogik <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz und <strong>der</strong> Verkehrspsychotherapie<br />
Ich favorisiere eine allgemein- und entwicklungspsychologische Rekonstruktion von<br />
Verkehrsintelligenz, weil sie m. E. erlaubt eine Entwicklungslogik <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz und<br />
<strong>der</strong> Psychotherapie des Mangels an Verkehrsintelligenz zu rekonstruieren:<br />
Die Intelligenz stellt sich am Ende <strong>der</strong> sensomotorischen Periode mit eineinhalb o<strong>der</strong> zwei<br />
Jahren als ein System sensomotorischer Schemata dar, das zu einer Logik des Handelns sowie<br />
zu einer Strukturierung <strong>der</strong> Subjektivität des Handelnden führt. Diese grundlegende<br />
entwicklungspsychologische Fragestellung will ich hier nicht näher ausführen. Vielmehr möchte<br />
ich sie zugunsten <strong>der</strong> Darstellung des verkehrspsychologischen Anwendungspotenzials dieser<br />
psychomotorischen Entwicklungslogik zurückstellen. Es geht uns Verkehrspsychologie ja auch<br />
nicht nur um Kin<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n auch um Erwachsene. Und zwar um Erwachsene, die Mängel in<br />
ihrem technisch hergestellten <strong>Mobil</strong>itätsverhalten aufweisen, dem eine doppelte Intelligenz<br />
zugrunde liegt: im technisch hergestellten <strong>Mobil</strong>itätsverhalten des motorisierten Kraftfahrers<br />
zeigt sich sowohl die psychologisch beschreibbare Logik seines <strong>Mobil</strong>itätsverhaltens und seiner<br />
„<strong>auto</strong>mobil“ gewordenen Subjektivität und Verantwortlichkeit im Umgang mit den an<strong>der</strong>en<br />
Verkehrsteilnehmern, als auch die naturwissenschaftlich beschreibbare Logik, die in <strong>der</strong><br />
Technik <strong>der</strong> Kraftfahrzeuge und in <strong>der</strong> motorisierten Beweglichkeit des Autofahrers steckt.<br />
Metaphorisch gesprochen begegnet <strong>der</strong> Autofahrer im Fahren seines Kraftfahrzeugs sich selbst<br />
als Objekt und als Subjekt im Straßenverkehr.<br />
Auf Grund <strong>der</strong> Entwicklungsoffenheit des Lebens, das sich auf <strong>der</strong> höchsten Stufe<br />
menschlichen Verhaltens als Dialog und Dialektik konstituiert, vergrößert sich <strong>der</strong> Abstand des<br />
Kraftfahrers zu seiner Umwelt im Verlauf <strong>der</strong> Entwicklung immer mehr:<br />
1 Mit seinem Verbildlichen und Versprachlichen hört <strong>der</strong> Fahrer im Straßenverkehr auf, die<br />
immer schon geliebten Objekte in seiner Welt direkt und unmittelbar wahrzunehmen: er sieht<br />
sie durch die immer affektiv geladenen Schemata seiner Vorstellungen, Grundüberzeugungen<br />
und Gedanken. (Fahrer und Fahrzeuge zeigen sich als Formen des Bewusstseins)<br />
2 Ein höherer Grad von Distanz ist erreicht, wenn <strong>der</strong> Fahrer als Subjekt allen Objektivierens<br />
in <strong>der</strong> theoretischen Reflexion sich selbst als Objekt begreift und damit seinerseits Objekt wird<br />
für immer neue reflexive Formen des Verhältnisses von Fahrer (Subjekt) und Fahrzeug<br />
Seite - 14 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
(Objekt). (Das Bewusstsein des Fahrers zeigt sich als Reflexion und Selbstgefühl beim<br />
Autofahren)<br />
3 Mit <strong>der</strong> technischen Erfindung des Automobils löst sich <strong>der</strong> Mensch noch mehr von den<br />
Fesseln seiner Wahrnehmung und seiner Bewegung. In <strong>der</strong> theoretischen Reflexion und<br />
technischen Realisation auf das reflexiv gewordene Selbst erreicht die Subjekt-Objekt-Spaltung,<br />
die in <strong>der</strong> tierischen Evolution begann, ihre bislang höchste und riskanteste Gestalt: das<br />
Automobil und noch mehr das Flugzeug und die Rakete ermöglichen es dem Menschen sich<br />
von seiner Bewegung, seiner Wahrnehmung und schließlich auch seinem Denken zu lösen und<br />
gänzlich neue Raumvorstellungen und Zeitempfindungen zu entwickeln. (Das Bewusstsein<br />
zeigt sich als spekulative Einheit von theoretischer Reflexion und technischer Realisation)<br />
Auch die Psychotherapie im allgemeinen und die Verkehrspsychotherapie im speziellen 19<br />
lassen sich entwicklungslogisch rekonstruieren:<br />
Die Psychotherapie entfaltet sich beziehungslogisch in einer Entwicklung über drei Stadien<br />
hinweg. Sie entwickelt sich ausgehend von einer (vormo<strong>der</strong>nen) als eine personenbezogene<br />
soziale Dienstleistung begriffene Ein-Personen-Therapie, im zweiten Stadium als eine<br />
(mo<strong>der</strong>ne) systemisch begriffene, verrechtlichte und bürokratisch organisierte Institutionen-<br />
Psychologie (Psychologie <strong>der</strong> Politik, des Gesundheitswesen, <strong>der</strong> Wirtschaft, des Transports<br />
und Verkehrs, <strong>der</strong> Kunst, <strong>der</strong> Religion, <strong>der</strong> Wissenschaft) zum dritten Stadium einer<br />
(utopischen) sozialen Psychotherapie, die es dem Patienten ermöglichen würde ein sich seiner<br />
Individualität bewusstes Selbstdenken und den Selbstausdruck freier Selbstentwicklung und<br />
Willensbildung innerhalb <strong>der</strong> bestehenden Institutionen zu praktizieren. Damit kann es für den<br />
Einzelnen keine Freiheit ohne die Gerechtigkeit <strong>der</strong> Institutionen (auch <strong>der</strong> Institutionen-<br />
Psychologie) geben. Personenbezogene und institutionenbezogene Dienstleistungen ergänzen<br />
sich: die Verwirklichung <strong>der</strong> Gerechtigkeit <strong>der</strong> Institutionen und <strong>der</strong> Freiheit des Einzelnen wird<br />
als politischer Auftrag verstanden und geht als konkrete Aufgabe an die "Verwalter" und<br />
Betroffenen <strong>der</strong> Institutionen gemeinsam.<br />
Entwicklungslogisch betrachtet erfüllt sich die Beziehung zwischen Patient und Therapeut<br />
zunächst in <strong>der</strong> individuellen Verantwortung für den sozial isoliert gedachten Patienten, dann in<br />
<strong>der</strong> sozialen Verantwortung für die öffentliche Gesundheit und schließlich über die Lebenden<br />
hinausreicht in die solidarische Verantwortung mit den gewesenen und den kommenden<br />
Generationen. 20<br />
4 Der naiv-psychologische Zugang zur Verkehrsintelligenz<br />
Die Erinnerung an Intelligenz als einer Rationalitätsform <strong>der</strong> räumlichen und <strong>der</strong> zeitlichen<br />
Orientierung erscheint intuitiv und spontan einleuchtend. In naiv-psychologischer Sicht steht<br />
Verkehrsintelligenz im Nachdenken unserer Klienten vor allem im Dienste des Erwerbs ihrer<br />
motorisierten <strong>Mobil</strong>ität. In <strong>der</strong> täglichen Arbeit haben wir 22 erfahren:<br />
19 Zu einer an den vorkonventionellen und konventionellen Stufen <strong>der</strong> Entwicklung des moralischen<br />
Urteilens orientierten Rekonstruktion einer reflexiv gewordenen Verkehrspsychologie siehe B. P.<br />
Rothenberger (Esslingen: Ms. 1996)<br />
20 Diese Entwicklungslogik verkehrspsychotherapeutisch zu rekonstruieren bleibt spannend, kann aber<br />
als eine zukünftige Aufgabe nicht mehr Ziel dieses Referates sein. Siehe dazu exemplarisch: Hans<br />
Jonas: Ärztliche Kunst und menschliche Verantwortung, In: Ders: Technik, Medizin und Ethik Frankfurt:<br />
Insel 1985. sowie Fußnote 23.<br />
22 Wir erproben z.Z. in unserer Partnerschaftsgesellschaft „<strong>auto</strong>-MOBIL“ einen vom Referenten<br />
konstruierten Satzergänzungstest zur Bestimmung des kognitiv-affektiven Handlungsfelds unserer<br />
Klienten von <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong>, <strong>der</strong> im Anschluss an Loevinger (1970) aufgebaut und auswertet wird,<br />
mit Items wie: “Wenn ich ein Kraftfahrzeug fahre...“. „Mein Auto und ich....“,<br />
Seite - 15 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
1 Die naiv verstandene Verkehrsintelligenz umfaßt erstens die Lizenz zur Teilnahme am<br />
Straßenverkehr und zur Partizipation an <strong>der</strong> immer als ungerecht erlebten Verteilung einer<br />
administrativ geregelten Freiheit <strong>der</strong> Individualmobilität.<br />
2 Verkehrsintelligenz erscheint zweitens als Selbstausdruck eines "<strong>auto</strong>mobilen" Lebensstils,<br />
des Erwachsenseins, als etwas, das Unabhängigkeit und soziale Anerkennung garantiert.<br />
3 Sie ist drittens ein Mittel zur Selbstdarstellung, zur Inszenierung demonstrativer Sorglosigkeit<br />
und zum Genießen des symbolischen Gehalts und <strong>der</strong> öffentlichen Folgeerscheinungen eines<br />
oftmals prestigeträchtigen, immer aber geliebten Automobilbesitzes.<br />
4 Sie kann viertens in den Dienst <strong>der</strong> emotionalen Regulierung erlebter persönlicher Defizite,<br />
alltäglicher Distresserfahrungen und gefühlter Ungerechtigkeiten gestellt werden.<br />
5 Sie eröffnet fünftens die Freude an ungewöhnlichen Bewegungserlebnissen und<br />
Grenzerfahrungen, die über den Alltag hinausweisen<br />
6 Sie hat sechstens die Funktion riskantes Verkehrsverhalten als Quelle <strong>der</strong> Stimulierung o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Dämpfung von Emotionen und Stimmungen zu benutzen, o<strong>der</strong> aber auch als Mittel <strong>der</strong><br />
sozialen Abgrenzung, um seine Erfahrungen, seinen Affekthaushalt und seine Zufriedenheit mit<br />
dem eigenen Verkehrsverhalten auf ein persönlich angenehmes Niveau zu bringen.<br />
7 Für Verkehrspsychologen steht siebtens die Verkehrsintelligenz zusätzlich und immer schon<br />
im Dienste <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit.<br />
Im Bewegungsfeld <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz unserer Klienten lassen sich bislang die folgenden<br />
sechs Dimensionen naiv-psychologischer Verkehrsintelligenz unterscheiden:<br />
(1) Die Verkehrsintelligenz allgemein: Fertigkeiten, die Fahrfehler eher verhin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> eher<br />
begünstigen.<br />
(2) Die Konflikträume Alkohol, Aggression (Mangel an Impulskontrolle) und Sorglosigkeit im<br />
Straßenverkehr. Der Problemraum „Überidentifikation mit dem eigenen Fahrzeug“.<br />
(3) Selbst- und Fremdbild des guten, verkehrsintelligenten Autofahrers.<br />
(4) Regeln und Normbewusstsein eines guten, verkehrsintelligenten Autofahrers.<br />
(5) Das naiv-psychologische Konzept von Verkehrspsychotherapie und Kraftfahreignung<br />
(6) Die naiv-psychologischen Erklärungsmuster für das Begehen o<strong>der</strong> Vermeiden eigener und<br />
frem<strong>der</strong> Verkehrsstraftaten sowie für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines<br />
persönlichen Mangels an Verkehrsintelligenz.<br />
5 Diskussion und Ergebnis<br />
Das Wesentliche und Beson<strong>der</strong>e des menschlichen <strong>Mobil</strong>itätsverhaltens ist eng mit einem<br />
wissenschaftlich angemessenen Problemverständnis von Bewegung und Verkehrspsychologie<br />
verbunden. Es gilt die unauflöslichen Zusammenhänge von Selbst und Zeit, von Intelligenz und<br />
Bewegung, von Natur, Technik und Geist, von perzeptuell-motorischen und kognitiven<br />
Fertigkeiten, von Denken und Wahrnehmen einfach und sachgerecht zu beschreiben. Einem<br />
solchen Verständnis <strong>der</strong> Zusammenhänge nähern wir uns immer mehr an.<br />
Die psychologischen Prozesse im individuellen Verkehrsverhalten lassen sich mit theoretischen<br />
Ansätzen <strong>der</strong> Intelligenz, <strong>der</strong> Persönlichkeit und <strong>der</strong> Motivation, sowie <strong>der</strong> Entwicklung<br />
beschreiben. Sie sind auch den Betroffenen intuitiv zugänglich.<br />
Die Ebene 1: KRAFTFAHREIGNUNG<br />
Macht- und Rechts-<br />
verhältnisse<br />
Funktionales Soziale Kontrolle dysfunktionalen<br />
Seite - 16 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Verkehrsverhalten Verkehrsverhaltens<br />
Die Ebene 2:<br />
Verkehrspsychologische VERKEHRSINTELLIGENZ ( VI)<br />
Wissensformen<br />
Verkehrsintelligente Das verkehrsintelligente Selbst:<br />
Verhaltensgewohnheiten Moralische und rechtliche<br />
Verantwortungsübernahme für<br />
Verkehrsintelligenz<br />
Die Ebene 3:<br />
Individuelle<br />
Subjektivitätsprozesse,<br />
Rechtsbewußtsein und Verhalten<br />
im Straßenverkehr<br />
VERKEHRSSITUATION<br />
Abbildung 1: Die wechselseitige Konstitution von Gesellschaft, Institution und Individuum sowie die<br />
komplexe Einheit von Machtverhältnissen, psychologischen Wissensformen und<br />
Verhaltensgewohnheiten am Beispiel einer verrechtlichten und bürokratisch organisierten<br />
Verkehrspsychologie<br />
Der <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz erklärt die zentrale These, dass die<br />
psychologischen Mechanismen mit <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung des individuellen Verkehrsverhaltens<br />
verbunden sind<br />
(1.) auf gesellschaftlicher Ebene mit Verän<strong>der</strong>ungen durch die Rechts- und Machtverhältnisse<br />
in den Machtbalancen <strong>der</strong> Menschen untereinan<strong>der</strong>, sowie durch den sozialen und<br />
technologischen Wandel des <strong>Mobil</strong>itätsverhaltens, von Transport und Verkehrsformen<br />
(2.) auf institutioneller Ebene mit Verän<strong>der</strong>ungen durch das Rechtssystem (auf Ebene 1)<br />
legitimierten verkehrspsychologischen Wissensformen und schließlich<br />
(3.) auf individueller Ebene mit Verän<strong>der</strong>ungen durch die spezifischen Selbstregulierungs- und<br />
Selbsterziehungsprozessen im Aufbau perzeptuell-motorischer Fertigkeiten zum<br />
intelligenten Lenken eines Fahrzeugs sowie im Aufbau <strong>der</strong> dafür notwendigen sozialen und<br />
moralischen Fähigkeiten eines intelligenten Autofahrers.<br />
Kurz: Im Konzept <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz konkretisiert sich die aus <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nitätstheorie<br />
abgeleitete These von <strong>der</strong> wechselseitigen Konstitution und Einheit von (1.) Macht- und<br />
Rechtsverhältnissen, (2.) verkehrspsychologischen Wissensformen und (3.) individuellen<br />
Subjektivitätsprozessen, Verhaltensgewohnheiten und Tugenden des intelligenten Autofahrers.<br />
Ergebnis<br />
Verkehrsintelligenz kann systematisch unter <strong>der</strong> integrativen Perspektive <strong>der</strong> Verkehrspsychologie<br />
als Gleichgewichtsverhältnis zwischen drei Hauptfaktoren <strong>der</strong> Entwicklung beschrieben<br />
werden. Die Entwicklung <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz ist Resultat aus (1) den personalen und<br />
motivationalen Bedingungen des Verkehrsverhalten, (2) dem situativen Einfluss <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Verkehrssituation im Zusammenhang mit den verstandenen Verkehrsregeln und (3) den<br />
Äquilibrationsfaktoren <strong>der</strong> Selbstregulierung und Selbsterziehung. Dieser dritte Faktor in <strong>der</strong><br />
Entwicklung von Verkehrsintelligenz ist <strong>der</strong> therapeutisch interessanteste. Verstanden als Hilfe<br />
Seite - 17 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
zur Selbsthilfe, Selbsterziehung und Selbstwirksamkeit (im Sinne von Bandura) beschreibt er<br />
den Prozess, an dem die therapeutische Intervention ansetzen muss, und <strong>der</strong> die Stabilität<br />
des Verkehrsverhaltens durch Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> personalen (bis hin zu den<br />
verhaltensgenetischen) Bedingungen bewirkt. Xaver Bacherle wir heute nachmittag ein<br />
verkehrspsychotherapeutisches Beispiel geben, das von <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung des „<strong>auto</strong>-mobilen“<br />
Selbstkonzepts und damit des Äquilibrationsfaktor <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz erzählt.<br />
- Davon ausgehend kann Verkehrsintelligenz als das Passungsverhältnis (Äquilibration) von<br />
intelligentem Verkehrsverhalten einerseits und den permanenten und aktuellen Risiken und<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Teilnahme am Straßenverkehr an<strong>der</strong>seits beschrieben werden.<br />
Derjenige verfügt praktisch über seine Verkehrsintelligenz, <strong>der</strong> seine Intelligenz im Umgang mit<br />
sich selbst, seinem Fahrzeug und den an<strong>der</strong>en Verkehrsteilnehmern so zu gebrauchen weiß,<br />
dass daraus ein erfolgsintelligentes Verkehrsverhalten, eine rationales Gefahren- und<br />
Risikobewusstsein sowie eine verantwortungsbewusste Teilnahme am motorisierten<br />
Straßenverkehr erfolgt.<br />
- Der Mangel an Verkehrsintelligenz verweist entsprechend auf die Nicht-Passung von<br />
Verkehrsintelligenz einerseits und dem Verkehrsteilnahmerisiko an<strong>der</strong>erseits.<br />
- Verkehrsauffälligkeit kann als ein Mangel an Verkehrsintelligenz beschrieben werden, sein<br />
Verhalten im Straßenverkehr mit Geist, Intelligenz und Verantwortung steuern zu können, d.h.<br />
mit an<strong>der</strong>en Worten sein Verkehrsverhalten als mental verursacht begreifen, mit<br />
verteidigbaren Argumenten rational begründen und es sozial und rechtlich verantworten zu<br />
können.<br />
Man beachte: in den beiden Fällen von <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> und „Verkehrsauffälligkeit“ musste<br />
ich nicht auf <strong>Begriff</strong>e wie „Fahruntauglichkeit“, „körperlich-seelische Behin<strong>der</strong>ung“ o<strong>der</strong><br />
„Störung“ zurückgreifen. Gemäß <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz sind Fahreignung,<br />
Fahruntauglichkeit und dysfunktionales Verkehrsverhalten weniger durch rechtlich definierte<br />
Straftaten, weniger durch medizinisch beschreibbare und gruppenspezifisch bestimmte<br />
Krankheiten und weniger durch sozioökonomisch interpretierte Klassen- und<br />
Schichtzugehörigkeit bedingt. Fahreignung und Fahruntauglichkeit sind vielmehr durch das<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger intelligente Verhalten und die entsprechenden mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
rationalen Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften des einzelnen Verkehrsteilnehmers<br />
bedingt. 23<br />
Deshalb ist begrifflich daran festzuhalten: Es ist bei jugendlichen Fahranfängern nicht <strong>der</strong><br />
Mangel an Erfahrung als solcher, es ist bei dem älteren Verkehrsteilnehmer nicht das<br />
Nachlassen ihrer Konzentrationsfähigkeit, und es ist bei dem betrunkenen Verkehrsteilnehmer<br />
nicht die absolute Fahruntauglichkeit mit einer BAK von mehr als 1,1 Promille, die zu einem<br />
gering entwickelten verkehrsintelligenten Verhalten führen.<br />
Es ist, wie schon gesagt, primär <strong>der</strong> Mangel an ausreichend entwickelten psychologischen<br />
Kompetenzen wie „Erwerb intelligenter perzeptuell-motorischen Fertigkeiten im Lenken eines<br />
Fahrzeugs“, verbunden mit dem Mangel an <strong>der</strong> Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, <strong>der</strong><br />
eine gering entwickelte Verkehrsintelligenz zur Folge hat. Es ist oft das Fehlen einer<br />
emotionalen und moralischen Selbstkontrolle auf Grund einer nur egozentrisch ausgebildeten<br />
Fähigkeit zur Rollenübernahme mit dem zu antizipierenden Verhalten und Erleben <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Verkehrsteilnehmer, es sind mithin Kompetenzmängel und/o<strong>der</strong> Performanzdefizite an<br />
gesellschaftlich wertvollen Eigenschaften (Tugenden, Verantwortungsübernahme) und<br />
Zuständen (Besonnenheit), die die geringe Höhe <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz bedingen.<br />
Verkehrspsychologische Interpretationen<br />
23<br />
Siehe dazu die im persönlichkeitspsychologischen Zugang zur Verkehrsintelligenz beschriebenen<br />
Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Verkehrsverhalten (S. 10 - 12 im Referat)<br />
Seite - 18 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Diese Ergebnisse möchte ich Ihnen dadurch verständlich machen, dass ich auf die verkehrspsychologische<br />
Realität zurückgehe, die dadurch gekennzeichnet ist, dass unsere Arbeit mit<br />
Verkehrsteilnehmern, sei es Begutachtung o<strong>der</strong> sei es Therapie, verrechtlicht und bürokratisch<br />
organisiert ist, d.h. immer unter Berücksichtigung <strong>der</strong> juristischen Vorgaben des<br />
Straßenverkehrsrechts und <strong>der</strong> entsprechen Verwaltungsvorschriften zu erfolgen hat. Diese<br />
Realität verkehrspsychologischer Praxis muß aber vom Psychologen und teilweise auch von<br />
seinem Klienten begriffen werden, um erfolgreich arbeiten und mitarbeiten zu können. Deshalb<br />
kann, wie schon gesagt, etwas begriffliche Arbeit und terminologische Klärungen helfen, die<br />
immer auch psychologische Arbeit an den jeweils eigenen Einstellungen und Überzeugungen<br />
sind<br />
Exkurs Anfang<br />
Hier folgt ein Text unseres Jüngsten, gerade 16 Jahre alt geworden, <strong>der</strong> mich, während ich<br />
gerade meinen Vortag am Laptop überarbeite, gefragt hat ob er auch etwas zu meinem Referat<br />
beitragen darf. Ich habe gesagt, natürlich darfst du das, wenn du etwas zu sagen hast. Und hier<br />
lesen Sie seinen ersten Beitrag zur Verkehrspsychologie:<br />
Hallöle Bandy Tandy, wie geht’s? Wie mir es geht ist ja nicht schwer zu erraten.<br />
Mein Grund für mein gutes Befinden heißt “YAMAHA DT 125“<br />
Noch Fragen?????<br />
Gut!!!!!<br />
Viel Spaß noch beim Schreiben an deinem Text!!!<br />
Christoph<br />
Exkurs Ende<br />
Terminologisches zu Verkehrsverhalten und Verkehrsintelligenz - und die Folgen<br />
Um im Dickicht <strong>der</strong> verkehrspsychologischen und verkehrsrechtlichen Diskussion beweglich zu<br />
bleiben, schlage ich vor, zwischen <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> und „Verkehrsverhalten“ zu<br />
unterscheiden, sowie zwischen dem normativen Problem <strong>der</strong> Eignung zum Führen eines<br />
Fahrzeugs und dem empirischen Phänomen <strong>der</strong> sozialen Kontrolle des dysfunktionalen<br />
Verkehrsverhaltens. (Siehe dazu die Abbildung 1)<br />
1 Verkehrsverhalten kann entwe<strong>der</strong> funktional o<strong>der</strong> dysfunktional sein. Verkehrsverhalten ist<br />
funktional, wenn es zuvor festgelegten Standards o<strong>der</strong> Normen intelligenter Verkehrsteilnahme<br />
genügt, z.B <strong>der</strong> Aufrechterhaltung o<strong>der</strong> Erhöhung des Verkehrsflusses ohne Risiken.<br />
In <strong>der</strong> Bestimmung rationaler Standards folgt die gesetzliche Kontrolle des<br />
Straßenverkehrsverhaltens (lei<strong>der</strong> immer noch) nicht den psychologischen Gesetzen des<br />
Lernens und <strong>der</strong> Entwicklung. Straßenverkehrsgesetze definieren keine Pflichten intelligenten<br />
Verkehrsverhaltens. In Folge davon helfen sie nicht einen positiven Punktekatalog o<strong>der</strong> eine<br />
öffentliche Beurkundung (Stichwort „goldenes Verkehrsabzeichen“) zu bestimmen. Wer als<br />
Verkehrsteilnehmer sich funktional - o<strong>der</strong> wie ich jetzt sagen will - verkehrsintelligent im<br />
Straßenverkehr verhält, wird nicht öffentlich belohnt. Die Verstärkung, die öffentliche<br />
Belohnung o<strong>der</strong> Beurkundung verkehrsintelligenten Verhaltens jedoch würde aus<br />
lerntheoretischer und neurobiologischer Sicht <strong>der</strong> Verkehrssicherheit mehr dienen, als die<br />
öffentliche Bestrafung dysfunktionalen Verkehrsverhaltens.<br />
Soziologisch betrachtet steht <strong>der</strong> Mangel an verkehrsintelligentem Verhalten unter sozialer<br />
Kontrolle. Das von <strong>der</strong> Norm abweichende und dysfunktionale Verhalten kann rechtlich bestraft,<br />
zumindest aber mit einer Ordnungswidrigkeit belegt werden. Als Verhalten än<strong>der</strong>t sich auch<br />
das Verkehrsverhalten in Abhängigkeit von personalen und situativen Bedingungen. Dies gilt<br />
(lei<strong>der</strong>) auch dann, wenn keine neuen Erfahrungen gemacht wurden und keine Verän<strong>der</strong>ungen<br />
in den psychomotorischen, den kognitiven o<strong>der</strong> den personalen Kompetenzen zu beobachten<br />
sind.<br />
Seite - 19 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
2 Intelligentes Verkehrsverhalten wie<strong>der</strong>um kann nicht als unter sozialen Kontrolle stehend<br />
gedacht werden. Es kann als intelligent und selbstkontrolliert bezeichnet werden, wenn es nicht<br />
heteronom, son<strong>der</strong>n <strong>auto</strong>nom bestimmt ist, d.h. wenn es im Dienste einer <strong>Mobil</strong>ität steht, die<br />
durch ein verkehrsintelligent gemachtes Selbst kontrolliert wird und damit als selbstreguliert<br />
o<strong>der</strong> selbstkontrolliert gilt.<br />
Im Gegensatz zum beobachtbaren Verkehrsverhalten meint die immer mental verursachte und<br />
nie beobachtbare Verkehrsintelligenz die Selbstwirksamkeit, die Selbsterziehung und die<br />
entwickelte Selbstkompetenz zu intelligentem Verkehrsverhalten.<br />
Daraus folgt: Verkehrsintelligenz verhält sich zu Verkehrsverhalten, wie das Ei zum Wasser, in<br />
dem es gekocht wird. Während das Ei sich nach dem Kochen in seiner Eigenschaft/ Substanz<br />
verän<strong>der</strong>t hat, kehrt das Wasser in seinen Ausgangszustand zurück. Zeigt <strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer<br />
ein geän<strong>der</strong>tes Verkehrsverhalten, müssen sich seine Einstellungen zum<br />
Straßenverkehr, sein Bild von sich als Autofahrer und seine verkehrsrelevanten<br />
Persönlichkeitseigenschaften nicht notwendigerweise auch verän<strong>der</strong>t haben: seine<br />
Verkehrsintelligenz bleibt durch Erfahrung unverän<strong>der</strong>t.<br />
Von <strong>der</strong> Kraftfahreignung zum <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Die genaue theoretische und praktisch durchschlagende Bedeutung meiner These von <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz ist mir erst spät im meinem beruflichen Leben klar geworden. Was<br />
Verkehrsintelligenz nicht ist und vor allem, dass sie kein Wissensproblem ist, son<strong>der</strong>n ein<br />
psychomotorisches und ein normatives Handlungsproblem enthält, wurde mir erst nach und<br />
nach in beruflichen Diskussionen deutlich, in denen ich therapeutisch und gutachterlich tätige<br />
Kollegen fragte, was - psychologisch betrachtet - Fahreignung ist: Was hat <strong>der</strong><br />
Verkehrspsychotherapeut, was <strong>der</strong> (normale, nicht doppelt qualifizierte) Psychotherapeut nicht<br />
hat? Wenn ich ihren Mangel an Sprachlosigkeit auf den <strong>Begriff</strong> bringen will, so meint er eine<br />
Verwirrung in ihrem Denken und eine Gedankenlosigkeit gegenüber dem, was sie in <strong>der</strong> Praxis<br />
so und nicht an<strong>der</strong>s tun, ohne schon zu wissen warum.<br />
Was in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Begutachtung und För<strong>der</strong>ung von Kraftfahrern problemlos gelingt, muss<br />
im Bewusstsein und im Nachdenken nicht ebenso unproblematisch sein. Meine innovative<br />
Einsicht, die von Rosenzweig, Carlson und Gilmore (2001) bestätigt wird, lautet, dass wir nur<br />
ein gering entwickeltes psychologisches Verständnis von den verkehrsintelligenten<br />
Bewegungen und den psychomotorischen Lenkungen eines Kraftfahrzeugs haben. Dem<br />
Descartschen Irrtum einer Körper-Seele-Spaltung folgend, haben die Forschungen <strong>der</strong><br />
akademischen Psychologen mehr zum Verständnis von kognitiven und psychosozialen als von<br />
psychomotorischen Operationen beigetragen. Und so können auch klinisch tätige<br />
Verkehrspsychologen oftmals nicht sagen, was sie in ihrer Therapie spezifisch an<strong>der</strong>s machen<br />
als approbierte Psychotherapeuten mit ihrem Suchtklientel.<br />
Im theoretischen Prozess des Begreifens helfen Definitionen und juristische Klärungen. Wenn<br />
aber im Theoretisieren <strong>der</strong> Leib-Seele-Dualismus wie<strong>der</strong>holt wird, dann kann die Beschäftigung<br />
mit <strong>Begriff</strong>en und Normen zu völlig unangemessenen theoretischen Lösungen führen, falls sie<br />
nicht von Anfang an gänzlich in die Irre führt, ohne dass <strong>der</strong> theoretische Irrtum aufgedeckt<br />
werden kann.<br />
In <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Begutachtung und <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung helfen Fertigkeiten und Motivationen. Einige<br />
Praktiker sind zu <strong>der</strong> Meinung gelangt, es sei besser ganz den Kontakt zur wissenschaftlichen<br />
Psychologie abzubrechen, weil die Forschungsergebnisse praktisch irrelevant seien, wenn sie<br />
nicht sogar demotivierend o<strong>der</strong> praxisdestabilisierend wirken würden. An<strong>der</strong>e wie<strong>der</strong>um<br />
glauben zentrale praktische Probleme mit Hilfe <strong>der</strong> rechtlichen Systematik und mit juristischem<br />
Sachverstand o<strong>der</strong> mit wissenschaftstheoretischen Reflexionen und terminologischen<br />
Differenzierungen auflösen zu können. Und so weiß <strong>der</strong> theoretisch gut informierte Praktiker,<br />
dass er ein Sollen nicht aus einem Sein, eine Regel nicht aus einem deskriptiven Datum, eine<br />
Seite - 20 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Vorschrift nicht aus einer Tatsachenfeststellung und ein Normenbewußtsein nicht aus einem<br />
empirisch beobachtbaren Verhalten ableiten darf.<br />
Aber sowohl in unserem Alltag als auch in <strong>der</strong> professionellen Praxis <strong>der</strong> Begutachtung und<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Fahreignung ist <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong> Norm zur Wirklichkeit, vom Sollen zum<br />
Sein, vom Bewusstsein zum Verhalten - und auch umgekehrt von <strong>der</strong> Wirklichkeit zur Norm -<br />
gänzlich unproblematisch: Im Schließen vom Sein auf ein Sollen steckt tatsächlich nur ein<br />
theoretisches und kein praktisches Problem – und dieses praktische Problem habe ich mit dem<br />
<strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz gelöst. Worin besteht die Lösung? Sie besteht darin, dass<br />
ich auf die Synthese <strong>der</strong> Gegensätze von Sein und Sollen in einem einheitlichen<br />
Selbstbegriff vom Menschen verweise.<br />
Allein schon in <strong>der</strong> Natur personaler Eigenschaften zeigt sich die Einheit von empirischen<br />
Eigenschaften und sozialer Wertschätzung dieser Eigenschaften. Verkehrsintelligenz meint<br />
damit immer auch die Übernahme <strong>der</strong> Verantwortung für seine Fahrfähigkeit und sein aktuelles<br />
Verkehrsverhalten. Man muss sich seiner Verantwortung für die Weiterentwicklung seiner<br />
Verkehrsintelligenz bewusst sein und prüfen, ob man ihr in seinem Verkehrsverhalten gerecht<br />
geworden ist. Die Präsenz von Verantwortlichkeit nur naiv zu unterstellen, um sich das gute<br />
Gefühl zu verschaffen, schon ein guter Fahrer zu sein und es nicht erst werden zu müssen,<br />
setzt an die Stelle <strong>der</strong> notwendigen Prüfung <strong>der</strong> Intelligenz und Rationalität seines Verhalten<br />
im Straßenverkehr die Zufriedenheit mit seinem guten Gewissen und dem daraus<br />
entspringenden komfortablen Gefühl. Das selbsterzeugte gute Gefühl eines selbstgewissen<br />
guten Gewissens unterläuft jedoch das gemeinsame verantwortungsbezogene Gespräch<br />
darüber, welche Werte aus einer Analyse <strong>der</strong> eigenen Fahrfehler bewusst werden können und<br />
welche Normen für ein intelligentes Fahren vorausgesetzt werden müssen. Hört eine solche<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> eigenen Person als Verkehrsteilnehmer auf und werden die<br />
Verantwortlichkeiten und Folgen des eigenen Verkehrsverhaltens aus dem Nachdenken<br />
ausgeblendet, dann wird die Persönlichkeit ärmer, das Gewissen verkümmert und es entsteht<br />
jene gefährliche und verantwortungslose Welt, in <strong>der</strong> wir an einem chaotischen und<br />
rücksichtslosen Straßenverkehr teilnehmen, den wir uns nicht wünschen und vor dem wir uns<br />
fürchten.<br />
Ergebnis<br />
Heute erkenne ich, dass ich im <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz einen anomalen, d.h. einen<br />
gemischten normativen und empirischen <strong>Begriff</strong> gefunden habe, <strong>der</strong> normativ-juristische und<br />
empirisch-verkehrspsychologische <strong>Begriff</strong>santeile umfasst. Der <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong><br />
enthält in seinem <strong>Begriff</strong>sumfang (seiner Extension) sowohl den normativen und<br />
kontrafaktischen <strong>Begriff</strong>santeil <strong>der</strong> Kraftfahreignung, <strong>der</strong> das Sollen und das allgemein<br />
Wünschenswerte meint, als auch den empirischen und faktische <strong>Begriff</strong>santeil <strong>der</strong> sozialen<br />
Kontrolle des Verkehrsverhaltens, <strong>der</strong> das Sein (states und traits) und das Können<br />
(Kompetenzen und skills) meint, sowie auch die soziale Kontrolle des Verkehrsverhaltens. Was<br />
die öffentliche Kontrolle intelligenten Verkehrsverhaltens betrifft, so verstehe ich nach und nach<br />
die Asymmetrie besser, die sich in <strong>der</strong> sozialen Kontrolle und öffentlichen Aufmerksamkeit von<br />
funktionalem und dysfunktionalen Verkehrsverhaltens zeigt. Diese Asymmetrie besteht darin,<br />
dass Gesetzestreue nicht belohnt, Gesetzesübertretung dagegen bestraft wird. Damit ist ein<br />
wichtiges Thema im Rahmen von Verkehrsintelligenz angesprochen. Es kann aber hier nicht<br />
weiter verfolgt werden.<br />
Der unbestimmte Rechtsbegriff <strong>der</strong> Kraftfahreignung und <strong>der</strong> naturalistische Fehlschluss<br />
Zunächst gilt es diskursiv anzuerkennen: Kraftfahreignung ist ein normativer <strong>Begriff</strong>.<br />
Intelligentes, verantwortungsbewusstes, sicheres o<strong>der</strong> mit ähnlichen Adjektiven<br />
gekennzeichnetes Verkehrsverhalten und die es strukturierende Verkehrsintelligenz sind<br />
anomale <strong>Begriff</strong>e, die nicht unter das im Bereich <strong>der</strong> Naturwissenschaften gültige Prinzip <strong>der</strong><br />
Seite - 21 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
kausalen Verursachung fallen. Sie können nicht im nomologischen Netz <strong>der</strong> physikalischen<br />
Theorie eingefangen werden, um die berühmte Formulierung von Donald Davidson (1980) zu<br />
zitieren.<br />
Warum ist das so?<br />
1. Niemals wird ein Psychologe allein mit empirischen Mitteln den normativen Gehalt eines<br />
ethischen <strong>Begriff</strong>s (z.B. <strong>der</strong> Tugend) o<strong>der</strong> eines Rechtsbegriffs (hier die Angemessenheit <strong>der</strong><br />
charakterlichen o<strong>der</strong> personalen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs) angemessen<br />
beschreiben können, geschweige denn begründen können. Wer so vorgeht begeht den<br />
„naturalistischen Fehlschluss“ des unbegründeten Übergangs vom Sein auf ein Sollen, von<br />
einer Tatsachenfeststellung auf eine Regelbegründung.<br />
2. Allein schon <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> „Intelligenz“, und nicht erst <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> einer auf <strong>Mobil</strong>ität und<br />
räumliche Orientierung bezogenen Intelligenz, stellt eine Verknüpfung von gemischt<br />
normativen und empirischen <strong>Begriff</strong>en dar. Aufbau und Anwendung von Intelligenz meint eine<br />
psychologische Einheit von Sein und Sollen, als die vom Individuum herzustellende<br />
Verbindung von Können und sozial Erwünschten, meint die in <strong>der</strong> Person realisierte Einheit von<br />
wünschenswerten Intelligenzleistungen und einer in den Ansprüchen <strong>der</strong> Person verankerten<br />
dauerhaften Anwendung seiner Intelligenz: Verkehrsintelligenz ist in ihrer höchst entwickeltsten<br />
Form eine Moral <strong>der</strong> Verkehrseinstellungen, so wie die Verkehrsmoral für die Person des<br />
Verkehrsteilnehmers eine Logik seines Verkehrsverhaltens darstellt.<br />
3. Im <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> "Verkehrsintelligenz" habe ich die psychologische Einheit von Sein und<br />
Sollen auch in <strong>der</strong> biographischen Einheit <strong>der</strong> Person des Verkehrsteilnehmers auf den <strong>Begriff</strong><br />
gebracht. Allein schon mit dem <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> „Person“ ist die gemischte Einheit von<br />
Persönlichkeitseigenschaften und sozialer Wertschätzung und Verpflichtung zur Anwendung<br />
dieser Eigenschaften gemeint.<br />
Man beachte, dass zur Entwicklung <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz in naiv-psychologischer Sicht nicht<br />
nur <strong>der</strong> Erwerb entsprechen<strong>der</strong> perzeptuell-motorischer und kognitiver Fertigkeiten zum Führen<br />
eines Fahrzeugs gehört. Es bedarf auch des Aufbaus personaler Eigenschaften und<br />
Grundüberzeugungen eines Fahrers, die –auf individuell unterschiedliche Art und Weise – die<br />
konkreten Erwartungen, die Ansprüche an sich selbst und an<strong>der</strong>e, sowie die<br />
Selbstverpflichtungen bedingen, ein guter Autofahrer zu sein. Wie wir aus empirischer<br />
Forschung wissen, bedecken viele Autofahrer die faktischen Schwächen in ihrem<br />
Verkehrsverhalten mit normativen For<strong>der</strong>ungen an sich selbst. In ihrem idealen Selbstbild<br />
wünschen sie sich sie ein guter Autofahrer zu sein, <strong>der</strong> davon überzeugt sein darf, und zwar<br />
allein Kraft seiner Wünsche, besser als <strong>der</strong> Durchschnitt <strong>der</strong> Autofahrer fahren zu können. Sie<br />
fühlen, dass sie sich augenblicklich fair und rücksichtsvoll verhalten, sobald sie hinter dem<br />
Steuer ihres Wagens sitzen. So begehen sie den naturalistischen Fehlschluß <strong>der</strong> Verwechslung<br />
von Wunsch und Wirklichkeit, von Denken/Fühlen und Handeln.<br />
Der unbestimmte Rechtsbegriff <strong>der</strong> Kraftfahreignung und die soziale Kontrolle des<br />
dysfunktionalen Verkehrsverhaltens<br />
Fassen wir zusammen:<br />
- Im <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> konkretisiert sich teilweise <strong>der</strong> unbestimmte Rechtsbegriff<br />
<strong>der</strong> "Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen".<br />
- Der unbestimmte Rechtsbegriff kann in zwei empirische <strong>Begriff</strong> aufgeteilt werden und mit dem<br />
einen empirischen <strong>Begriff</strong> des faktischen Verkehrsverhaltens und mit dem an<strong>der</strong>en empirischen<br />
<strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> „sozialen Kontrolle“ des Verkehrsverhaltens näher bestimmt werden. Mit dieser<br />
Zweiteilung ist jedoch die juristische Dimension von Recht und Gesetz und das moralische<br />
Problem <strong>der</strong> Verantwortungsübernahme für sein Verkehrsverhalten und die Folgen seines<br />
Verkehrsverhaltens noch nicht beschrieben!<br />
Seite - 22 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
- Der anomale <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz muss deutlich von dem rein normativen <strong>Begriff</strong><br />
<strong>der</strong> juristischen und moralischen Verantwortung für sein Verkehrsverhalten und die Folgen<br />
getrennt werden. Der normative <strong>Begriff</strong> setzt einen gesellschaftlichen Standpunkt voraus und<br />
wird im nächsten Abschnitt (Verkehrsintelligenz und reflexive Mo<strong>der</strong>ne) weiter ausgeführt.<br />
Die Ebene <strong>der</strong><br />
NORM<br />
KRAFT-<br />
FAHR-<br />
EIGNUNG<br />
Die Ebene <strong>der</strong><br />
ÄQUILIBRATION<br />
Die Ebene <strong>der</strong><br />
WIRKLICHKEIT<br />
KLIENT<br />
und seine<br />
Verantwortung<br />
für sein<br />
Verkehrsverhalt<br />
en<br />
RECHT und GESETZ<br />
( RuG)<br />
VERKEHRS-<br />
INTELLIGENZ (VI)<br />
VERKEHRS-<br />
SITUATION<br />
Abbildung 2: Eine Rekonstruktion <strong>der</strong> systemischen Beziehungen <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz in den drei<br />
Hauptfaktoren (1.) <strong>der</strong> Subjektivität und <strong>der</strong> Verhaltensgewohnheiten: Patient und Therapeut (Ebene <strong>der</strong><br />
Wirklichkeit), (2.) des Wissensformen: Verkehrspsychologie und Verkehrsintelligenz (Ebene <strong>der</strong><br />
Äquilibration), (3.) <strong>der</strong> Rechts- und Machtverhältnisse: Recht und Gesetz, sowie die daraus abgeleitete<br />
Kraftfahreignung (Ebene <strong>der</strong> Norm)<br />
In Abbildung 2 kann die empirische Beschreibung <strong>der</strong> sozialen Kontrolle von<br />
<strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> bildhaft angeschaut werden. Es geht um die folgenden drei Elemente, die<br />
zusammen aus „Recht und Gesetz“, „Kraftfahreignung“ und „soziale Kontrolle“ das „Dreieck <strong>der</strong><br />
sozialen Kontrolle dysfunktionalen Verkehrsverhaltens“ bilden, das von dem übergeordneten<br />
Element „Recht und Gesetzt“ bestimmt wird.<br />
Seite - 23 -<br />
SOZIALE<br />
KONTROLLE<br />
dysfunktionalen<br />
Verkehrsverhaltens<br />
VERKEHRS-<br />
PSYCHOLOGE<br />
als Repräsentant<br />
<strong>der</strong> Verkehrs-<br />
intelligenz
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Mit <strong>der</strong> Zweiteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs <strong>der</strong> „Kraftfahreignung“ in die zwei<br />
empirischen <strong>Begriff</strong>e des funktionalen Verkehrsverhaltens und des dysfunktionalen<br />
Verkehrsverhaltens eröffnet sich das weite Problemfeld sozialer Kontrolle. Von diesem weiten<br />
Feld weiß ich, dass es für Verkehrspsychologen schwer zu verstehen ist, gleichgültig ob es sich<br />
um Gutachter o<strong>der</strong> um Therapeuten handelt. 24<br />
Es ist das Problemfeld, das Robert Castel (2000) mit dem <strong>Begriff</strong> "negativer Individualismus"<br />
benennt und John Galtung mit dem <strong>Begriff</strong> „strukturelle Gewalt“. Die negative Form des<br />
Individualismus kann von dem davon Betroffenen mehr nicht als Unabhängigkeit und<br />
Eigenständigkeit erlebt und als Autonomie begriffen werden, son<strong>der</strong>n nur noch in <strong>Begriff</strong>en von<br />
zugeschriebenen Defiziten und erlebten Mängeln. Der auffällig gewordene Verkehrsteilnehmer,<br />
dessen Handeln in <strong>der</strong> Tat einen Mangel an Verkehrsintelligenz ausdrückt, erlebt seine eigene<br />
Individualität nicht länger aus eigener Wirksamkeit, son<strong>der</strong>n allein noch im Prozess <strong>der</strong><br />
Teilnahme an einem rechtlich definierten System ungleicher Verteilung <strong>der</strong> Teilnahmechancen<br />
am Straßenverkehr. Er muss es als ein ihm feindlich gesonnenes und unpersönliches System<br />
<strong>der</strong> Aufrechterhaltung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit verstehen, insofern es ihn in eine neue Art <strong>der</strong><br />
Abhängigkeit von Instanzen und Experten sozialer Kontrolle führt. Diesen Prozess, <strong>der</strong> auf die<br />
Bestimmung des Einzelnen gerichtet ist und sozial negativ über Ausgrenzung und<br />
Stigmatisierung erfolgt, nennt Robert Castel (2000) „negative Individualisierung“. Darin zeigt<br />
sich eine Form struktureller Gewalt: die einen können den Individualisierungsschub <strong>der</strong><br />
Mo<strong>der</strong>ne im positiven Sinne als Unabhängigkeit erleben, die an<strong>der</strong>n tragen ihn als Stigma <strong>der</strong><br />
Abhängigkeit, weil ihre Form <strong>der</strong> Individualität für einen Mangel an Verantwortung und an<br />
personalen Eigenschaften wie Ich-Stärke o<strong>der</strong> Sorgfalt steht und das Fehlen von Kompetenz<br />
und Macht, sowie von sozialer Anerkennung anzeigt.<br />
Begutachtung als soziale Kontrolle<br />
Für Gutachter ist <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> sozialen Kontrolle weniger kritischer als für Therapeuten.<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz lässt sich eine Kritik an dem gruppenstatistisch<br />
erfassten <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Fahrfähigkeit formulieren. Weil <strong>der</strong> Gutachter von Gruppennormen und<br />
nicht vom Individuum ausgeht sowie von den statistischen Risikofaktoren im Straßenverkehr<br />
auffällig zu werden, kann er <strong>der</strong> moralischen o<strong>der</strong> charakterlichen Individualität des einzelnen<br />
Verkehrsteilnehmers nur wenig Beachtung schenken. So exploriert er seinen Probanden relativ<br />
dekontextualisiert, wobei er dessen Fahrfähigkeit vor allem mit sprachlichen und empirischen<br />
Mitteln festzustellen beansprucht, ohne Berücksichtigung des normativen Kontextes, in dem<br />
<strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> „juristischen o<strong>der</strong> sozialen Verantwortung für das eigene Verkehrsverhalten“<br />
steht. Und genau hier liegt die Stärke des individualisierenden <strong>Begriff</strong>s <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong>.<br />
Er ermöglicht es, Fähigkeit und Verantwortung, Kompetenz und Tugend in <strong>der</strong> Person des<br />
Fahrers zusammenzudenken.<br />
Zu fragen wäre: Können Kurse, die nur gruppenstatistisch ermittelte und rein psychologisch<br />
informierte Kurswirkungen beschreiben, überhaupt mit Rechtsfolgen versehen werden, ohne<br />
dass man dadurch den naturalistischen Fehlschluss begeht? Müsste <strong>der</strong> Gutachter mit seinem<br />
Probanden nicht auch in einen Verantwortungsdiskurs über dessen Verkehrsverhalten und<br />
dessen Verkehrseinstellungen eintreten?<br />
Die Theorie <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz erlaubt es darüber hinaus eine kritische Frage an die<br />
expertenorientiert konstruierte Situation <strong>der</strong> Begutachtung <strong>der</strong> Fahrereignung zu stellen. Wenn<br />
allein nur <strong>der</strong> Gutachter definieren darf, wer die Fahreignung „hat“, dann sind diejenigen, die<br />
sie nicht haben Opfer von Etikettierung und Stigmatisierungen, was– wie oben gezeigt - einer<br />
Ungleichbehandlung gleichkommt. Hier stellt sich die kritische Frage: Das affirmative Ziel jedes<br />
24 Siehe dazu meine Ausführungen über „Kraftfahreignungsmodifikation als soziale Kontrolle, in: B. P.<br />
Rothenberger, 1996<br />
Seite - 24 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
auffällig gewordenen Kraftfahrers ist <strong>der</strong> Erwerb des Führerscheins. Je<strong>der</strong> möchte seinen<br />
Führerschein wie<strong>der</strong> bekommen o<strong>der</strong> behalten. Weil dies das Ziel aller Autofahrer ist und nicht<br />
nur <strong>der</strong> jungen Fahranfänger, kann gefragt werden: Brauchen verkehrsauffällig gewordene<br />
Kraftfahrer ihre Verkehrsintelligenz um die Fragen <strong>der</strong> Gutachter erfolgreich zu beantworten<br />
o<strong>der</strong> ist die Verkehrsintelligenz tatsächlich ein prognostisch valides Kriterium dafür, wie intelligent<br />
<strong>der</strong> Betroffene am Straßenverkehr wird teilnehmen können? Solange <strong>der</strong> Gutachter nicht<br />
in <strong>der</strong> Lage ist theoretisch zu beschreiben was Kraftfahreignung ist, kann er im Einzelfall nicht<br />
nachweisen, ob er nur zur Verbesserung des Verkehrssicherheitsdiskurses in <strong>der</strong> Begutacht-<br />
ungsstelle beitragen hat, o<strong>der</strong> aber tatsächlich zur Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit auf<br />
unseren Straßen. Ich gebe zu Bedenken: ein Gutachter kann nicht wissen, was er tut, solange<br />
er sich nicht seinen <strong>Begriff</strong> von „Kraftfahreignung“ explizit gemacht hat.<br />
Therapie als soziale Kontrolle<br />
Für den Therapeuten meint <strong>der</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> sozialen Kontrolle die radikale Kritik an <strong>der</strong><br />
Heteronomie und <strong>der</strong> Unwissenschaftlichkeit seines beruflichen Handelns, wonach <strong>der</strong><br />
Therapeut sich seiner eigenen Freiheit des Nachdenkens beraubt und seine Klienten<br />
entmündigt, indem er sich selbst und seinen Klienten moralischen Gefühle und moralische<br />
Urteilsfähigkeit im Rahmen von Psychotherapie abspricht.<br />
Insofern <strong>der</strong> nie<strong>der</strong>gelassene Verkehrspsychotherapeut sich den juristischen Vorgaben<br />
unterordnet, erlaubt er, dass die Verkehrspsychotherapie verrechtlicht und bürokratisiert<br />
organisiert angewandt wird. Damit verliert er den Status eines freien Berufs. Darüber hinaus<br />
bedeutet soziale Kontrolle durch Psychotherapie eine Festlegung <strong>der</strong> Therapieziele auf<br />
Anpassung an bestehende Gesetze und gesellschaftliche Normen. Das zentrale Problem, dass<br />
sich Therapeuten in ihrer Zielbestimmung zunehmend an <strong>der</strong> Anpassung ihres Klienten an den<br />
bestehenden Gesetzen und Umständen orientieren, besteht im Kern darin, dass sie die<br />
normative Dimension des moralischen Urteilens und <strong>der</strong> juristisch-moralischen Verantwortung<br />
ausblenden und zwar auf Seiten des Klienten wie des Therapeuten. Was <strong>der</strong> Therapeut an<br />
moralischen und Gerechtigkeitsproblem im Handeln und Erleben seines Klienten nicht erkennt<br />
und anerkennt, kann er auch nicht an seinen Klienten weitergeben. Eine naturalisierte<br />
Psychotherapie ist wohl wertfrei, aber auch richtungs- und orientierungslos. Der normativ zu<br />
begreifende Wunsch seinen Führerschein wie<strong>der</strong> zu bekommen wird zum empirisch begriffenen<br />
Auslöser für therapeutische Interventionen an <strong>der</strong> Person dessen, <strong>der</strong> keinen Führerschein<br />
mehr besitzt. Insofern ist ein naturalistischer Fehlschluß zu diagnostizieren. Die Idee, dass <strong>der</strong><br />
Wunsch nach Wie<strong>der</strong>erlangung seines Führerscheins eine eigene, nämlich einen normative<br />
o<strong>der</strong> Gerechtigkeitsdimension hat, die darüber hinaus eng mit <strong>der</strong> Verkehrssicherheit aller<br />
verbunden ist, wird vom rein therapeutisch orientierten Psychologen ausgeblendet. Wir<br />
erkennen hier ein Dilemma verrechtlicht organisierter Psychotherapie. Sie muss ihren eigenen<br />
und moralischen Weg zwischen <strong>der</strong> Scylla <strong>der</strong> direkten Übernahme normativer Vorgaben durch<br />
das Justizsystem und <strong>der</strong> Charybdis <strong>der</strong> Leugnung jeglicher normativer Dimension<br />
therapeutischen Handelns finden. Nur so kann sie einen Zugang zur Moral und zum<br />
Rechtsverständnis ihres Klientels finden und es för<strong>der</strong>n und weiterentwickeln.<br />
Wenn nun <strong>der</strong> Verkehrspsychologe sich an die bestehenden Normen und Vorschriften des<br />
Straßenverkehrsrechts orientiert und sich als Magd <strong>der</strong> Justiz begreift, dann kann ich darin mit<br />
Einschränkungen nichts unmoralisches und unwissenschaftliches erkennen. Solange eine<br />
Einsicht in die Begrenztheit einer law-and-or<strong>der</strong>-Konzeption von Verkehrspsychotherapie<br />
vorhanden ist, kann <strong>der</strong> Verkehrspsychotherapeut begreifen, dass Institutionen und Normen<br />
nicht unabhängig von Personen untersucht und verän<strong>der</strong>t werden dürfen. Diese Einsicht kann<br />
handlungspraktisch werden, sobald er als Therapeut über ein entwicklungsfähiges und damit<br />
zukunftsoffenes Konzept seines Handelns verfügt und die darin vorhandenen moralischen und<br />
ethischen Probleme nicht naturalisiert o<strong>der</strong> paternalistisch anwendet. Dann weiß er auch, wie<br />
und in welche Richtung er seine therapeutische Konzeption weiterentwickeln kann und soll. Und<br />
er begreift, wie seine therapeutischen Interventionen Fortsetzungen finden können, sowohl im<br />
therapeutischen setting für ihn selbst, wie auch im „Leben draußen“ für seinen Klienten.<br />
Seite - 25 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Solange er zukunftsfähig bleibt, kann er auch fair mit <strong>der</strong> in <strong>der</strong> verrechtlichten<br />
Verkehrspsychotherapie verborgenen „negativen Individualität“ und „strukturellen Gewalt“<br />
umgehen. Wer jedoch seine Psychotherapie von Verkehrsteilnehmern verkehrspsychologisch<br />
blind organisiert und sie moralisch minimalistisch bis privatistisch umsetzt, kann die Gefahr<br />
einer rein technischen, entwe<strong>der</strong> naturalisierten o<strong>der</strong> aber paternalistischen Anwendung von<br />
Psychotherapie gar nicht erkennen. Er wird deshalb im Einzelfall mehr schaden als nützen,<br />
insofern er seinem Patienten einen „therapeutischen Bückling“ antrainiert, den dieser dann, was<br />
nur konsequent erscheint, in <strong>der</strong> Begutachtungssituation vor dem Gutachter wie<strong>der</strong>holt.<br />
Falls nun <strong>der</strong> Gutachter auf dieses pseudotherapeutisch strukturierte Angebot ebenfalls mit<br />
einer therapeutisch informierten Haltung antwortet, entsteht eine Interaktionsstruktur<br />
professionell hergestellter Unsicherheit: <strong>der</strong> Gutachter verschleiert seinen diagnostischen<br />
Auftrag und kann damit seinem Probanden nicht mehr als Gutachter gerecht werden. Damit<br />
begeht er nicht nur einen Stilbruch, son<strong>der</strong>n labilisiert den gesellschaftlichen Wert <strong>der</strong><br />
Begutachtung <strong>der</strong> Fahreignung. Zugleich wie<strong>der</strong>holt er das Risiko, dass die im therapeutischen<br />
setting induzierten Verän<strong>der</strong>ungen nicht intrinsisch in den Handlungs- und kognitiven Strukturen<br />
seiner Klienten verankert werden und damit auch nicht resistent gegen Verän<strong>der</strong>ung sind.<br />
Falls <strong>der</strong> Therapeut die im System <strong>der</strong> Erteilung einer Fahrerlaubnis organisierten strukturellen<br />
Zwänge nicht durchschauen kann, in denen <strong>der</strong> Betroffene sich gezwungen fühlt irrationale<br />
Begründungsmuster für seinen Mangel an Verkehrsintelligenz zu entwickeln, wie<strong>der</strong>holt <strong>der</strong><br />
Therapeut nur die strukturellen Zwänge. Damit bewirkt er genau die negative<br />
Individualisierung, die seinen therapeutischen Intentionen im Kern zuwi<strong>der</strong>läuft und baut im<br />
professionellen Umgang mit seinem Patienten – auch gegen seinen erklärten Willen - das auf,<br />
was ich eine gewaltstrukturierte therapeutische Beziehung nennen würde.<br />
Verkehrsintelligenz und reflexive Mo<strong>der</strong>ne<br />
Der <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> "Verkehrsintelligenz" erlaubt <strong>der</strong> Verkehrspsychologie den Anschluss an die<br />
soziologische Theorie <strong>der</strong> reflexiven Mo<strong>der</strong>nisierung, und nicht nur - wie wir schon gesehen<br />
haben - an die Rechtswissenschaft und an die allgemeine Psychologie.<br />
Die soziologische These <strong>der</strong> reflexiven Mo<strong>der</strong>nisierung, aufgestellt von Ulrich Beck (1986,<br />
1996) und auf den Bereich von Transport und Verkehr übertragen, könnte lauten: In nicht mehr<br />
traditionellen Gesellschaftsformen werden auch die Risiken und Chancen des Transports und<br />
Verkehrs von Personen, Gütern und Informationen in die umfassend gewordene reflexive<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung (Ulrich Beck 1996) einbezogen.<br />
Der soziale Mangel an Verkehrsintelligenz, das daraus resultierende Verkehrschaos auf<br />
unseren Straßen sowie die daraus resultierenden individuellen Einstellungen in den Köpfen <strong>der</strong><br />
Verkehrsteilnehmer können auch als Folge von Prozessen sozialen und technologischen<br />
Wandels in den Teilnahmebedingungen am Straßenverkehr begriffen werden 25<br />
In einer als Einheit begriffenen und dadurch wissenschaftlich gewordenen<br />
verkehrspsychologischen Praxis können die einzelnen Elemente dieser Praxis zunächst einmal<br />
als die verschiedenen Spektralfarben verstanden werden, die sich in den verschiedenen<br />
Formen <strong>der</strong> Beziehungen zwischen den Elementen brechen, die zusammen wie<strong>der</strong>um die<br />
Einheit <strong>der</strong> Verkehrspsychologie bilden: die Beziehung von Klient und Therapeut, die<br />
Beziehung von Klient und dem System sozialer Kontrolle, die Beziehung von<br />
Verkehrspsychologie und Recht und Gesetz, aber auch <strong>der</strong> Brechungsfaktor auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />
Beziehung von Norm und Wirklichkeit, nämlich die Beziehung von Recht und Gesetz und<br />
(vermittelt über die Verkehrsintelligenz <strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer) die Teilnahmebedingungen am<br />
Straßenverkehr, usw.<br />
25<br />
Ich kann mich an dieser Stelle beschränken. Näheres zum Konzept <strong>der</strong> reflexiven Mo<strong>der</strong>nisierung und<br />
zum Projekt einer reflexiv gewordenen Verkehrspsychologie siehe: Rothenberger, B. 1996, Teil 1)<br />
Seite - 26 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Wenn wir nun den Fahrstil und das Verkehrsverhalten des Autofahrers vor diesem einheitlich<br />
beschriebenen Hintergrund beobachten, wie er in Abbildung 2 zu sehen ist, dann können wir<br />
folgendes entdecken:<br />
- Die Struktur <strong>der</strong> therapeutischen Beziehung von Klient und Verkehrspsychologe wird nicht<br />
nur als eine Zwei-Personen-Beziehung beschrieben, was im Selmanschen Ansatz <strong>der</strong><br />
Struktur <strong>der</strong> Rollenübernahme einer Stufe-2-Konzeption von Verkehrspsychologie<br />
entsprechen würde. Kann in Abgrenzung von einer Fixierung auf die reziproke Beziehung<br />
zwischen Therapeut und Klient diese therapeutische Beziehung auch in <strong>der</strong> Perspektive des<br />
nicht-anwesenden Dritten, z.B. des Gesetzgebers betrachtet werden, entsteht eine Stufe-3-<br />
Rekonstruktion <strong>der</strong> Struktur <strong>der</strong> verkehrspsychotherapeutischen Interaktion. 26<br />
- Der unbestimmte Rechtsbegriff <strong>der</strong> Kraftfahreignung zweiteilt sich nicht nur - wie wir schon<br />
gesehen haben – in die beiden empirischen <strong>Begriff</strong>e von „Klient und sein Fahrverhalten“<br />
und „soziale Kontrolle des Klienten und seiner Kraftfahreignung“. Vielmehr wird <strong>der</strong><br />
Rechtsbegriff <strong>der</strong> Kraftfahreignung in den anomalen <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz und in<br />
den rein normativen <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong> "Verantwortung des Verkehrsteilnehmers für sein<br />
Verkehrsverhalten" - und damit auch für die "För<strong>der</strong>ung eigener wie frem<strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz" - ausdifferenziert. Hier geht es um das rein normative Dreieck, das die<br />
Elemente „RuG“, „Klient“ und „Verkehrspsychologe“ bilden, mit <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> als<br />
Element personaler Selbstorganisation in <strong>der</strong> Mitte des Dreiecks.<br />
- Die Ebene <strong>der</strong> Norm wird von <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Wirklichkeit we<strong>der</strong> begrifflich noch praktisch<br />
getrennt. Vielmehr erscheinen die beiden Ebenen von Verkehrsgesetzen und<br />
Verkehrssituation über den vermittelnden Prozess <strong>der</strong> „Äquilibration“ so miteinan<strong>der</strong><br />
verbunden, dass in den Institutionen von „Recht und Gesetz“ die sozialen Wirklichkeiten<br />
des Verkehrsteilnehmers, des Verkehrspsychologen, <strong>der</strong> Instanzen sozialer Kontrolle und<br />
<strong>der</strong> Bestimmung <strong>der</strong> Kraftfahreignung von oben nach unten, top down reguliert werden.<br />
Dies entspricht im Kohlbergschen Ansatz <strong>der</strong> Stufen des moralischen Urteilens einer Stufe-<br />
4-Konzeption von <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong>. Es wird redundant sein anzumerken, dass eine<br />
solche Konzeption nicht <strong>der</strong> psychologischen Erkenntnis letztes Wort sein muss. 27<br />
- Betrachten wir die Abbildung 2 als Einheit von Zusammenhängen, dann können wir leicht<br />
den zentralen Problemstand <strong>der</strong> gegenwärtigen Verkehrspsychologie <strong>der</strong> Kraftfahreignung<br />
erkennen und nachvollziehen: Statt sich nur auf einen einzigen Aspekt von<br />
Kraftfahreignung von Verkehrsteilnehmern zu beschränken und die bestehende Praxis <strong>der</strong><br />
Begutachtung und Therapie <strong>der</strong> Kraftfahreignung zu thematisieren, beschäftigt sich die in<br />
26 Siehe dazu mein Papier „Über Verkehrspsychologie, Teil 1. Kap. IV: Reflexive Verkehrspsychologie",<br />
1996<br />
27 Da eine solche „systemische“ Stufe-4 Konzeption <strong>der</strong> bestehenden Praxis <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz immer noch meilenweit entfernt ist, habe ich auf die Ausarbeitung einer (immer<br />
schon kontrafaktischen) postkonventionellen Konzeption von Verkehrspsychotherapie bislang verzichtet.<br />
Sie hätte m.E. in <strong>der</strong> Praxis nur dann „Bodenkontakt“, wäre mithin nur dann praktisch in einer diesseitigen<br />
Welt, die vor unser aller Augen liegt und die nicht auf eine Welt des Sollens und des Rechts verweist,<br />
wenn , wie in Abbildung 1 angedeutet, von <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Realität von Institutionen und<br />
Wissensformen <strong>der</strong> Verkehrspsychologie auf die Beschreibung <strong>der</strong> Realität von Personen und<br />
Bewusstsein umgestellt wird. Es gilt (mit Hegel und gegen Kant und Kohlberg) zu erkennen und<br />
anzuerkennen: Gänzlich verwirklicht sich ein System <strong>der</strong> Verkehrssicherheit nur im individuellen<br />
Verhalten und Erleben und im individuellen Selbstbewusstsein <strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer. Daher sind die<br />
Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit, die z.B. in den Institutionen <strong>der</strong> Begutachtung und<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kraftfahreignung die Sicherheit <strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer zum Ausdruck bringen, erst dann<br />
rational, wirksam o<strong>der</strong> wirklich, wenn nicht nur die betroffenen Verkehrsteilnehmer verstehen und<br />
begreifen lernen, warum und wie alle Verkehrsteilnehmer in diesen Institutionen und Wissensformen<br />
gerecht, frei und verkehrssicher sein können. Es wäre Aufgabe und Vision einer wissenschaftlich und<br />
praktisch gewordenen rationalen und objektiven Verkehrspsychotherapie bei den Betroffenen die<br />
Entwicklung eines solchen Verständnis zu för<strong>der</strong>n.<br />
28 Siehe dazu den Sammelband Edelstein, u.a.: "Moral und Person". Frankfurt: Suhrkamp 1993<br />
Seite - 27 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
<strong>der</strong> Abbildung rekonstruierte Verkehrspsychologie mit <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> motorisierten<br />
Bewegung und den Teilnahmebedingungen von Verkehr insgesamt.<br />
Es darf wohl als theoretischer Skandal gelten, dass in <strong>der</strong> bestehenden Praxis <strong>der</strong><br />
Verkehrspsychologie seit Jahren <strong>der</strong> Rechtsbegriff <strong>der</strong> Kraftfahreignung und das Grundrecht<br />
auf <strong>Mobil</strong>ität selbst schon für eine Theorie <strong>der</strong> Verkehrspsychologie gehalten wird. Anstatt<br />
eine theoretisch befriedigende Antwort auf das zu geben, was <strong>Mobil</strong>ität ist und was<br />
Verkehrs- psychologie bewegt und zu fragen, wie sie sich von dem, was sich ihr anschließt<br />
(Soziologie, Medizin, Pädagogik, Politikwissenschaft) und von dem, wovon sie abhängig ist<br />
unterscheidet, nämlich Recht (und Moral), Technik, Natur, Ökonomie und Politik, wird in <strong>der</strong><br />
gegenwärtigen Praxis intensiv erörtert, z.B. was „Verkehrstherapie“ ist, welche<br />
Legalbewährungsdaten sie liefert o<strong>der</strong> was die angemessenen Grundsätze für eine faire<br />
und sachgerechte Begutachtung <strong>der</strong> Kraftfahreignung sind.<br />
Naiv ist schon die Annahme, allein mit fairen Beurteilungsgrundsätzen den Gutachtern eine<br />
Entscheidungshilfe für den Einzelfall geben zu können. So wenig eine Theorie <strong>der</strong><br />
Gerechtigkeit eine Theorie <strong>der</strong> Politik o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft ersetzt, so wenig erlauben<br />
Beurteilungsgrundsätze eine Praxis <strong>der</strong> Begutachtung zu fundieren.<br />
Mit <strong>der</strong> Unterscheidung in sieben Elemente kann erstmals die gesamte verkehrspsychologische<br />
Praxis, mithin alles, was Verkehrspsychologie bewegt und diese Bewegung ausmacht, nämlich,<br />
wie wir erfahren haben, ihr gesellschaftlicher Vollzug o<strong>der</strong>, besser vielleicht, ihr Selbstausdruck<br />
von „Verkehrs- und Bewegungsintelligenz“ zum Problembestand <strong>der</strong> verkehrspsychologischen<br />
Theorie werden. In einer „systemischen“ Rekonstruktion von Verkehrspsychologie drücken sich<br />
mithin die folgenden sieben Konstitutionsbedingungen einer an Recht und Gesetz orientierten<br />
verkehrspsychologischer Praxis aus, in denen sich die Verkehrsintelligenz ausdrückt:<br />
1. Die Frage <strong>der</strong> Macht, als die Frage nach dem Recht und den Gesetzen und Vorschriften<br />
2. Die Prozesse <strong>der</strong> Verrechtlichung, Bürokratisierung und Ökonomisierung <strong>der</strong><br />
Beziehungen zwischen den beteiligten und betroffenen Personen und Institutionen<br />
3. Die Instanzen und Organisationen <strong>der</strong> sozialen Kontrolle des dysfunktionalen<br />
Verkehrsverhaltens<br />
4. Die zentrale selbstregulatorische Rolle <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> als Entwicklungs-,<br />
genauer Äquilibrationsfaktor in den Teilnahmebedingungen am Straßenverkehr<br />
5. Die Bedürfnisse, Defizite und Störungen des einzelnen Verkehrsteilnehmers, speziell<br />
sein Verkehrsverhalten und seine darin sich ausdrückenden<br />
Verkehrsverhaltenseinstellungen<br />
6. Die verkehrspsychologischen Wissensformen und <strong>der</strong> Status des Verkehrspsychologen<br />
7. Die faktische, crossnationale „europäische“ Situation von Verkehr und Transport<br />
Die Verkehrsintelligenz als Tugend<br />
Wenn wir den naturwissenschaftlichen Suggestionen wi<strong>der</strong>stehen, den <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz zu naturalisieren und dadurch fähig werden zu begreifen, dass die Frage<br />
nach <strong>der</strong> Entwicklung und den Voraussetzungen für verkehrsintelligentes Verhalten nicht durch<br />
die Entdeckung von Naturgesetzen allen lösbar ist, dann lehrt uns <strong>der</strong> anomale <strong>Begriff</strong> <strong>der</strong><br />
Verkehrsintelligenz, dass Verkehrspolitik und Verkehrspsychologie nicht nur eine Frage <strong>der</strong><br />
(theoretischen) Vernunft ist, son<strong>der</strong>n auch eine ethische Frage. Die Lösung dieser Frage<br />
erfor<strong>der</strong>t nicht nur die theoretische Fähigkeit Beweise zu führen und Wissen zu erkennen,<br />
son<strong>der</strong>n auch den praktischen Willen zum Entscheiden aus Glauben und Überzeugungen.<br />
Als Verkehrspsychologen sind wir wohl eher als an<strong>der</strong>e fähig die volitionale Tatsache<br />
anzuerkennen, das Menschen nicht dadurch zu intelligenten und rücksichtsvollen Autofahrern<br />
werden, dass sie wissen, was vernünftig und rücksichtsvoll ist. Wir wissen, dass sie motiviert<br />
sein o<strong>der</strong> von uns o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en motiviert werden müssen, intelligent und sozial zu handeln. In<br />
Seite - 28 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
<strong>der</strong> altmodischen Sprache <strong>der</strong> Antike ausgedrückt: Sie beginnen die Intelligenz und die<br />
Rücksichtnahme zu lieben und damit wissen sie, was ihnen ihre Intelligenz und ihre<br />
Rücksichtnahme „bedeuten“. In diesem Sinne unterstützen wir unseren Klienten, ein moralisch<br />
begriffenes Verständnis von sich selbst zu entwickeln: ein moralisches Selbst 28 das, kantisch<br />
gesprochen , nicht nur Rechtspflichten, son<strong>der</strong>n auch Tugendpflichten kennt.<br />
Die theoretische Fähigkeit zum Erkennen und Wissen darf nicht mit <strong>der</strong> praktischen Fähigkeit<br />
zum Entscheiden und Handeln verwechselt werden. In <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Begutachtung wie in <strong>der</strong><br />
Praxis <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung vertreten die Klienten oft Meinungen und Überzeugungen, die aus einem<br />
undifferenzierten Gesamt aus nachvollziehbaren Gründen und privaten Glauben bestehen. Mit<br />
solchen Unterscheidungen zurechtzukommen ist auch für die Verkehrspsychologen nicht leicht,<br />
worauf wir im Abschnitt über soziale Kontrolle schon hingewiesen haben<br />
Die auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Subjektivität angesiedelte zentrale Einsicht im Hinblick auf das<br />
Explizitmachen des <strong>Begriff</strong>s <strong>der</strong> <strong>„Verkehrsintelligenz“</strong> kann die sein:<br />
• In <strong>der</strong> therapeutischen Praxis kommt es zentral darauf an mit dem Klienten in einen<br />
moralischen Verantwortungsdiskurs beginnen zu können. Seine affektive Empörung, seinen<br />
Führerschein verloren zu haben, muss gemeinsam mit ihm nicht nur als Tatsache begriffen<br />
werden, die eine Ursachenforschung notwendig macht, son<strong>der</strong>n auch auf dem normativen<br />
Hintergrund seiner eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen diskutiert werden können. Dass es<br />
dabei nicht nur um ein Durcharbeiten <strong>der</strong> Kränkung, seinen Führerschein aktiv verloren zu<br />
haben, gehen kann, dürfte spontan einsichtig sein. Wie ich weiter unten im letzten Punkt<br />
ausführen werde zielt <strong>der</strong> juristische Verantwortungsdiskurs auf die Bewusstmachung <strong>der</strong><br />
öffentlichen Zumutung, mit Alkohol am Steuer selbst zur Gefährdung im Straßenverkehr<br />
beigetragen zu haben.<br />
• Bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz geht es im Kern nicht um ein auf Lerngesetzen<br />
beruhendes Intelligenztraining, son<strong>der</strong>n vielmehr um einen die gesamte Lebenspanne<br />
umgreifenden Entwicklungsprozess <strong>der</strong> Selbstentwicklung. Zwar können<br />
Interventionsformen, wie z.B. Alkohol trinken und Auto fahren zu trennen, für diejenigen<br />
Verkehrsteilnehmer sinnvoll sein, die das Stadium des Nachdenkens bereits verlassen und<br />
schon im Stadium des Handelns (Prochaska, Norcross, DiClemente 1999) und damit<br />
ohnehin schon bereit sind, ihr Trink- und Fahrverhalten zu än<strong>der</strong>n. Es bleibt aber eine<br />
Illusion, beruhend auf dem naturalistischen Fehlschluss, zu glauben, man könne<br />
Verkehrsintelligenz als Technik wie eine bloße Fertigkeit erlernen. Verkehrsintelligenz ist<br />
vielmehr eine Tugend, die wie an<strong>der</strong>e Tugenden auch und wie alle gesellschaftlich<br />
wünschenswerten Personeneigenschaften sich in einem lebenslangen Entwicklungsprozess<br />
entfalten, <strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um die Gesetze des Lernens bestimmt und nicht umgekehrt.<br />
• Mit <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> Therapieziele entwe<strong>der</strong> auf das Ziel <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Entwicklung<br />
einer Verkehrsintelligenz, statt auf das Ziel <strong>der</strong> Anpassung an die bestehenden<br />
Verkehrsregeln und an die vorhandenen sozialen Normen o<strong>der</strong> aber auf das auf das Ziel<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des guten Autofahrers, was nicht als den Paternalismus eines<br />
expertenkonstruierten Persönlichkeitsmodells darstellt, lassen sich komplizierte moralische<br />
Probleme <strong>der</strong> Rechtfertigung von Therapiezielen lösen. Es ist klar, dass wir diese<br />
Ansprüche in diesem Rahmen hier nicht einlösen können. 30<br />
• Die doppelte Verantwortungsübernahme des Verkehrspsychotherapeuten für ein<br />
angemessenes Verständnis von Recht und Gesetz einerseits und für ein<br />
bedürfnisgerechtes Verstehen und Verän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> individuellen Problemlagen und Mängel in<br />
<strong>der</strong> Verkehrsintelligenz seiner Klienten an<strong>der</strong>erseits kann deutlich gemacht werden. Denn<br />
Eines steht fest: Mit psychotherapeutischen Mitteln allein können die Verkehrssicherheit<br />
und die Verkehrsintelligenz we<strong>der</strong> analysiert noch geför<strong>der</strong>t werden. Der sensible<br />
Verkehrspsychotherapeut zeichnet sich durch eine Doppelkompetenz aus: er muss<br />
zugleich Verkehrspsychologe und Psychotherapeut sein, dessen verkehrspsychologisches<br />
30 Siehe dazu Kohlberg, 1971 (From Is to Ought) und Kohlberg und Turiel, 1978.<br />
Seite - 29 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Selbstverständnis und dessen therapeutische Entscheidungen für die zu erreichenden<br />
Therapieziele ethisch begrenzt sind. Den Doppelzwang eines sensiblen Moralgefühls und<br />
Rechtsverständnis sowie eines sensiblen therapeutischen Gewissens als professionellen<br />
Selbstzwang übernehmend, hat <strong>der</strong> Klinische Verkehrspsychologe als Therapeut von den<br />
juristischen Vorgaben auszugehen und die Entwicklung eines verkehrsintelligenten Selbst<br />
zu för<strong>der</strong>n. Wie er das macht, ist nicht mehr Inhalt dieses Referates. 31<br />
• Auch die zentrale Bedeutung des juristischen Verantwortungsdiskurses im Rahmen einer<br />
verkehrspsychologischen Begutachtung o<strong>der</strong> Therapie und - in Wechselbeziehung damit<br />
stehend - die individuellen und sozialen Anfor<strong>der</strong>ungen an die intelligente Teilnahme am<br />
Straßenverkehr können in <strong>der</strong> Graphik klar und deutlich gemacht werden. Während es sich<br />
bei <strong>der</strong> sozialen Kontrolle dysfunktionalen Verkehrsverhaltens um gruppenstatistisch<br />
abgesicherte Normen handelt, die als wertfrei gelten, geht es in <strong>der</strong><br />
verkehrspsychotherapeutischen Kontrolle des Verkehrsverhaltens um individuelle<br />
Problemlagen vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz. Sie drückt sich in einem<br />
anomalen Modell <strong>der</strong> Bedingungen intelligenter Teilnahme am Straßenverkehr aus, in die<br />
explizit juristische und moralische, bzw. moralpsychologische Bestandteile aufgenommen<br />
werden, die eine risikoarme Verkehrsteilnahme garantieren.<br />
Literatur<br />
Bacherle, X. 2002: Erlebtes Staunen - als wesentliche Voraussetzung für die subjektiv<br />
intendierte Neuorientierung und Selbstverpflichtung bzgl. bisheriger Verkehrsteilnahme unter<br />
Alkohol. In diesem Band<br />
Baltes, P.B. 1997: Die unvollendete Architektur <strong>der</strong> menschlichen Ontogenese: Implikationen<br />
für die Zukunft des vierten Lebensalters, in: Psychol. Rundschau, 48, 191-210<br />
Baltes, P.B. u.a. 1998: Life-span theory in developmental psycholoy, in: Damon, W. (ed.):<br />
Handbook of Child Psychology, New York: Wiley&Sons, Chapter 18, 1029-1143.<br />
Beck, U. 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine an<strong>der</strong>e Mo<strong>der</strong>ne.<br />
Frankfurt: Suhrkamp es<br />
Beck, U., Giddens, A., Lash, S.1996: Reflexive Mo<strong>der</strong>nisierung. Eine Kontroverse.<br />
Frankfurt: Suhrkamp es<br />
Becker, P. 1995: Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle. Göttingen: Hogrefe<br />
Becker, P. 1999: Allgemeine und Differentielle Psychotherapie auf systemischer Grundlage,<br />
in: Wagner, R. Becker, P.: Allgemeine Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe<br />
Benjamin, L.S. 1993: Interpersonal diagnosis and treatment of DSM personality disor<strong>der</strong>s.<br />
New York: Guilford<br />
Costa, P.T. Widiger, Th. A.(Eds.) Personality disor<strong>der</strong>s an the five-factor model of personality.<br />
Washington: APA 1993, Appendix D, 341-345.<br />
Castel, R. 2000: Die Metamorphosen <strong>der</strong> sozialen Frage. Eine Chronik <strong>der</strong> Lohnarbeit.<br />
Konstanz: Universitätsverlag édition discours<br />
Davidson, D. 1980: „Geistige Ereignisse“, in: Ders: Handlung und Ereignis.<br />
Frankfurt: Suhrkamp, 291-316.<br />
Edelstein, W., Nunner-Winkler, G., Noam, G. 1993: Moral und Person. Frankfurt: Suhrkamp<br />
Elias, N.1984: Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II. Frankfurt: Suhrkamp, 1984<br />
Fiedler, P. 2001: Integrative Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen. Göttingen: Hogrefe<br />
Gadamer, H.G.(1930) Praktisches Wissen, in: Ders. : Griechische Philosophie I,<br />
Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1985, S.230 -248<br />
Gardner, H. 1991: Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie <strong>der</strong> vielfachen Intelligenzen.<br />
Stuttgart: Klett<br />
Gardner, H. 2002: Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes. Stuttgart: Klett<br />
31 Dazu Rothenberger, 1997: Über Verkehrspsychologie Teil 2: Die Praxis <strong>der</strong> verkehrspsychologischen<br />
Therapie<br />
Seite - 30 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Grawe, K. 1998: Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe<br />
Grawe, K. 1999: Allgemeine Psychotherapie: Leitbild für eine empiriegeleitete psychologische<br />
Therapie, in: Wagner, R., Becker, P. 1999<br />
Gray, J.A.: The psychology of fear and stress. Cambridge: University Press, 1987<br />
Groeger, J.A.: Un<strong>der</strong>standing driving. Applying cognitive psychology to a complex everday task.<br />
East Sussex: Psychology Press, 2000<br />
Galtung, J. 1975: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung.<br />
Reinbek: Rowohlt.<br />
Habermas, T. 1996: Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente <strong>der</strong> Identitätsbildung.<br />
Frankfurt: Suhrkamp stw 1999<br />
Jonas, H. 1973: Bewegung und Gefühle. Über die Tierseele, in: Jonas, 1994<br />
Jonas, H. 1994: Das Prinzip Leben. Frankfurt: Insel<br />
Jonas, H. 1985: Technik, Medizin und Ethik. Frankfurt: Insel<br />
Kohlberg, L. 1971: From Is to Ought: How to commit the naturalistic fallacy and get away with<br />
it in the study of moral development, in: Mischel, Th. (Ed.): Cognitive development and<br />
epistemology. London, New York: Academic Press (auch in Kohlberg, 1981)<br />
Kohlberg, L. 1981: Essays on moral development: Vol. I. The philosophy of moral development.<br />
Moral stages and the idea of justice. San Fransisco: Harper&Row<br />
Kohlberg, L. 1995: Die Psychologie <strong>der</strong> Moralentwicklung. Frankfurt: Suhrkamp<br />
Kohlberg, L., Turiel, E. 1978: Moralische Entwicklung und moralische Erziehung, in:<br />
Portele, G. (Hrsg.) Sozialisation und Moral. Weinheim, Basel: Beltz<br />
Kuhl, J. 1998: Wille und Persönlichkeit: Von <strong>der</strong> Funktionsanalyse zur Aktivierungsdynamik<br />
psychischer Systeme, in: Psychologische Rundschau, 49, 61-77.<br />
Kuhl, J. 2001: Motivation und Persönlichkeit. Interaktion psychischer Systeme.<br />
Göttingen: Hogrefe: Bern, Toronto, Seattle, 2001<br />
Kuhl, J., Kazen, M. 1997: Das Persönlichkeits-Stil-und-Störungsinventar (PSSI): Manual,<br />
Göttingen: Hogrefe<br />
Latour, B. 1998: Wir waren nie mo<strong>der</strong>n. Versuch einer symmetrischen Anthropologie.<br />
Frankfurt: Fischer<br />
Lay, M. G.: Die Geschichte <strong>der</strong> Straße. Vom Trampelpfad zur Autobahn.<br />
Frankfurt: Campus, 1994<br />
McCrae RR, Costa PP Jr. 1999: A five-factor theory of personality, in Pervin, LA & John, OP<br />
(Eds.) 1999: Handbook of Personality. Theory and research. New-York: Guilford, 2 nd . Ed.<br />
Loevinger, J., Wessler, R. 1970: Measuring ego development. Construcction and use of a<br />
sentence completion test. San Fransisco: Jossey-Bass.<br />
Prochaska, J., Norcross, J., DiClemente, C. 1997: Jetzt fange ich neu an. Das revolutionäre<br />
Sechs-Schritte-Programm für ein dauerhaftes suchtfreies Leben. München: Knaur<br />
Piaget, J. (1936) Das Erwachen <strong>der</strong> Intelligenz beim Kinde. Stuttgart: Klett, 1969<br />
Piaget, J.:(1970) Biologie und Erkenntnis. Über die Beziehung zwischen organischen<br />
Regulationen und kognitiven Prozessen. Frankfurt: Fischer 1974.<br />
Rosenbaum, D. A., Carlson, R.A., Gilmore, R.O.: Acquisition of Intellectuell an Perceptual-<br />
Motor-Skills, in: Ann. Rev. Psychol. , 2001, 52; 453 – 70.<br />
Rothenberger, B.P. 1996: “Über Verkehrspsychologie Teil 1“: Zwei Kontroversen in <strong>der</strong> Praxis<br />
und ihre mögliche Auflösung. Esslingen: Manuskript.<br />
Rothenberger, B.P. 1997 „Über Verkehrspsychologie Teil 2 “: Die Praxis <strong>der</strong><br />
verkehrspsychologischen Therapie. Esslingen: Manuskript<br />
Rothenberger, B.P. 1998: Theorie und Therapie gelernter Sorglosigkeit. Das Beispiel<br />
„intelligente Teilnahme am Straßenverkehr. Esslingen: unvollst. Manuskript.<br />
Rothenberger, B.P. 1999: Entwicklungstheorie und kognitiv-volitionale Therapie des<br />
Verkehrsverhaltens auffälliger Kraftfahrer. Esslingen: Manuskript<br />
Rothenberger, B.P. 2001: Darwin, Piaget und Entwicklung. Zur Biologie des Geistes und des<br />
freien Willens. Kapitel 3 des Ms. „Zu einer naturphilosophisch informierten<br />
Psychotherapie: Die Natur <strong>der</strong> Psychotherapie und die Psychotherapie <strong>der</strong> Natur“<br />
Selman, R.L. 1984: Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und<br />
klinische Untersuchungen. Frankfurt: Suhrkamp.<br />
Smith, R.J. 1978: The Psychopath in Society New York: Academic Press<br />
Seite - 31 -
Dr. Bernd P. Rothenberger: Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong> Verkehrsintelligenz<br />
Smith, R.J. 1995: Psychopathy one more time: Comment to Levenson, in: Theory and<br />
Psychology, 1995, Vol. 5(1): 131 -137<br />
Staudinger, U.M., Baltes, P.B. 1996: Weisheit als Gegenstand psychologischer Forschung,<br />
in: Psychologische Rundschau, 1996, 47, 57 - 77.<br />
Sternberg, R. 1999: Erfolgsintelligenz. Warum wir mehr brauchen als EQ und IQ.<br />
München: Lichtenberg<br />
Seite - 32 -