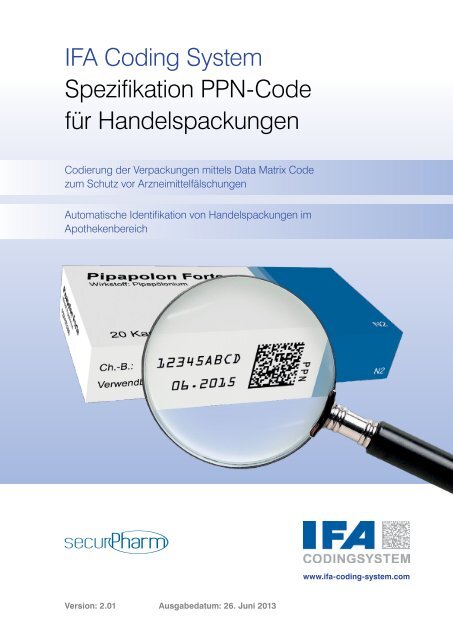IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code
IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code
IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong><br />
<strong>Spezifikation</strong> <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong><br />
für Handelspackungen<br />
Codierung der Verpackungen mittels Data Matrix <strong>Code</strong><br />
zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />
Automatische Identifikation von Handelspackungen im<br />
Apothekenbereich<br />
Version: 2.01 Ausgabedatum: 26. Juni 2013<br />
www.ifa-coding-system.com
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Vorwort und Einleitung 4<br />
2 Anwendungsbereich 4<br />
3 Vereinbarungen zur Codierung 5<br />
3.1 Allgemeines 5<br />
3.2 Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>) – Anwendung in Deutschland 5<br />
3.3 Weitere weltweite Anwendungen der <strong>PPN</strong> 6<br />
3.4 <strong>Code</strong>s und Dateninhalte auf Handelspackungen 6<br />
3.5 Multi Country Packs 7<br />
4 Dateninhalte und Anforderungen 7<br />
4.1 Datenstruktur 7<br />
4.2 Datenidentifikatoren und Daten 8<br />
5 Beschriftung mit <strong>Code</strong> und Klartext 10<br />
5.1 Symbologie 10<br />
5.2 Matrixgröße 11<br />
5.3 <strong>Code</strong>größe und Ruhezone 11<br />
5.4 Positionierung des Data Matrix <strong>Code</strong>s 11<br />
5.5 Emblem zum Data Matrix <strong>Code</strong> 12<br />
5.6 Klartextinformation 12<br />
5.7 <strong>Code</strong>beispiele 12<br />
5.8 Druckqualität 13<br />
6 Drucksysteme 14<br />
7 Lesetechnik 14<br />
8 Interoperabilität bei unterschiedlichen Datenstrukturen<br />
und Datenidentifikatoren 14<br />
8.1 Interoperabilität auf Basis bestehender Auto-ID 14<br />
8.2 Interoperabilität auf Basis von XML-Standards 15<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />
Seite 2
Anhang A Übersicht Datenelemente und Data Identifier 16<br />
Anhang B Algorithmus zur Prüfzifferberechnung der <strong>PPN</strong> 17<br />
Anhang C Emblem zum <strong>Code</strong> 18<br />
Anhang D Interoperabilität auf der Basis von XMLBeschreibungen 19<br />
D.1 Allgemeines 19<br />
D.2 Data Format Identifier (DFI) 19<br />
D.3 XML-Knoten für Daten 19<br />
D.4 Anwendung 20<br />
D.5 Beispiele 21<br />
Anhang E Qualität und Kontrolle des <strong>Code</strong>inhalts 22<br />
E.1 Data Matrix <strong>Code</strong> als Punktcodes 22<br />
E.2 Qualifizierungs-und Validierungsmaßnahmen 22<br />
E.3 Kontrolle der <strong>Code</strong>s auf Dateninhalt und Druckqualität 22<br />
E.4 Varianten der Bedruckung 23<br />
E.5 Statistik in der Qualitätskontrolle 23<br />
E.6 Prüfgeräte 24<br />
E.7 Farben und Materialien 25<br />
E.8 Qualitätskriterien nach ISO/IEC 15415 mit Bezug auf ISO/IEC 16022 25<br />
Anhang F Typische Fehler 26<br />
F.1 Fehler in den Datenstrukturen 26<br />
F.2 Fehler in den Dateninhalten 29<br />
F.3 Fehler im Druck 30<br />
F.4 Materialbedingte Fehler 34<br />
Anhang G Layout – Best Practice 35<br />
Anhang H Bubble-Jet – Best Practice 35<br />
Anhang I Data Matrix <strong>Code</strong> – Symbologiebeschreibung 36<br />
I.1 Modulgrößen 36<br />
I.2 Matrixgröße 36<br />
I.3 Feste Muster 37<br />
I.4 Datenbereich 37<br />
I.5 Füllzeichen 37<br />
I.6 Fehlerkorrektur 38<br />
Anhang J Glossar 39<br />
Anhang K Bibliography 42<br />
K.1 Normen: 42<br />
K.2 Weiterführende Literatur 42<br />
K.3 Links 42<br />
Anhang L Dokumenthistorie 43<br />
Anhang M Impressum 44<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />
Seite 3
1 Vorwort und Einleitung<br />
Im Rahmen des Projekts „securPharm“, bei dem die<br />
deutschen Verbände der Arzneimittelhersteller, des<br />
Großhandels und der Apotheker (Stakeholder) ein <strong>System</strong><br />
zur Umsetzung der Vorgaben aus der europäischen<br />
Richtlinie 2011/62/EU zur Abwehr von Arzneimittelfälschungen<br />
entwickelt haben und in einem Feldversuch<br />
testen, entstand die Notwendigkeit, die sozialrechtlich<br />
für jedes Arzneimittel geforderte Pharmazentralnummer<br />
(PZN) in eine weltweit eindeutige Produktnummer<br />
zu transformieren.<br />
In diesem Zusammenhang hat die Informationsstelle<br />
für Arzneispezialitäten GmbH (<strong>IFA</strong>) [http://www.ifaffm.<br />
de], die die Vergabe der PZN verwaltet, den Status einer<br />
Issuing Agency erworben und ein <strong>Coding</strong>-<strong>System</strong><br />
geschaffen (<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong>).<br />
Während das securPharm-<strong>System</strong> auf die Arzneimittel-<br />
verpackung zur Erfüllung der entsprechenden rechtli-<br />
chen Anforderungen fokussiert, erweitert das <strong>IFA</strong> Co-<br />
ding <strong>System</strong> das securPharm-<strong>System</strong> zum einen auf<br />
alle apothekenüblichen Waren (z.B. auf Nahrungsergänzungsmittel).<br />
Zum anderen deckt es die Kennzeichnung<br />
von<br />
- Handelspackungen und<br />
- Transporteinheiten<br />
ab.<br />
Die vorliegende <strong>Spezifikation</strong> ist im Auftrag der die <strong>IFA</strong><br />
repräsentierenden Verbände erstellt worden:<br />
• ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-verbände<br />
(German Federal Association of<br />
Pharmacists)<br />
• Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller<br />
e.V. (BAH) (German Medicines Manufacturers`<br />
Association)<br />
• Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie<br />
e.V. (BPI) (German Pharmaceutical Industry<br />
Association)<br />
• Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels<br />
– PHAGRO e.V. (Association of Pharmaceutical<br />
Wholesalers)<br />
• Pro Generika e.V. (Association of Generic Medical<br />
Manufacturers)<br />
• Verband Forschender Arzneimittelhersteller<br />
e.V. (vfa) (Association of Research-Based Pharmaceutical<br />
Companies)<br />
Abb. 1 veranschaulicht eine typische Verpackungskaskade,<br />
beginnend mit der Einzelkomponente (z.B. ein<br />
Durchdrückblister oder eine Flasche) bis hin zur Transportpalette.<br />
Für die beiden Stufen Handelspackungen<br />
und Transporteinheiten existieren bei der <strong>IFA</strong> entsprechende<br />
Codierspezifikationen, die als <strong>IFA</strong>-<strong>Coding</strong> <strong>System</strong><br />
bezeichnet werden.<br />
2 Anwendungsbereich<br />
Das vorliegende Dokument ist die <strong>Spezifikation</strong> für die<br />
Kennzeichnung der Handelspackungen (s. Pfeil in Abb. 1).<br />
Abbildung 1: Verpackungskaskade<br />
(Bildquelle: Nach ISO / DTS 16791)<br />
Die <strong>Spezifikation</strong>en zu den Transporteinheiten sind über<br />
www.ifa-coding-system.org oder auch direkt unter:<br />
http://www.ifaffm.de/mandanten/1/documents/04_ifa_<br />
coding_system/<strong>IFA</strong>_Spec_Transport_Logistik_DE.pdf<br />
verfügbar.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 4
Im einzelnen beschreibt die vorliegende <strong>Spezifikation</strong><br />
auf Basis der von securPharm e.V. herausgegebenen<br />
„Regeln zur Codierung verifizierungspflichtiger Arzneimittel<br />
im deutschen Markt zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />
(Codierregeln securPharm)“ die<br />
Überführung der PZN in die weltweit eindeutige<br />
„Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)“. Näheres dazu ist<br />
in Kapitel 3.2 beschrieben.<br />
Wesentlicher Bestandteil dieser <strong>Spezifikation</strong> ist die<br />
Beschreibung des Data Matrix <strong>Code</strong>s, der die notwendigen<br />
Datenelemente zur maschinellen Lesung bereit<br />
stellt. Es werden auf Basis der <strong>PPN</strong> als Produktnummer<br />
die Codierung und die damit verbundene Kennzeichnung<br />
der Arzneimittelpackungen, die Datenstrukturen<br />
und die Ausprägungen der Datenelemente sowie<br />
die Codierung mit <strong>Code</strong>größe und Druckqualität<br />
beschrieben.<br />
Alle wesentlichen und verbindlichen Teile zur Codierung<br />
wurden aus den „Codierregeln securPharm“ in diese<br />
<strong>Spezifikation</strong> übernommen. Bezüglich Generierung<br />
der Seriennummern siehe jedoch Kapitel 3.1 der oben<br />
genannten Regeln.<br />
Somit ist sichergestellt, dass bei Anwendung dieser<br />
<strong>Spezifikation</strong> alle Vorgaben von securPharm<br />
berücksichtigt sind.<br />
Darüber hinaus enthält diese <strong>Spezifikation</strong> die detaillierte<br />
Beschreibung typischer Fehler (siehe Anhang F).<br />
3 Vereinbarungen zur Codierung<br />
3.1 Allgemeines<br />
Zur Produktidentifikation von Arzneimitteln ist im Fünf-<br />
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) die Pharmazentral-<br />
nummer (PZN) –codiert im <strong>Code</strong> 39 – verankert.<br />
Ergänzend dazu legten die Stakeholder im deutschen<br />
Arzneimittelmarkt in ihren „Codierregeln securPharm“<br />
die maschinenlesbare Kennzeichnung von Handelspackungen<br />
mit den folgenden Datenelementen fest:<br />
• Produktnummer<br />
• Chargenbezeichnung<br />
• Verfalldatum und<br />
• Seriennummer<br />
Die „Codierregeln securPharm“ erlauben die Codierung<br />
im Data Matrix <strong>Code</strong> nach ISO/ IEC 16022 (siehe<br />
vorliegende <strong>Spezifikation</strong> Kapitel 5.1) und der Datenstruktur<br />
und Syntax gemäß ISO/IEC 15418 sowie ISO/<br />
IEC 15434 (siehe Kapitel 4).<br />
Damit ist die Maschinenlesbarkeit dieser Datenelemente<br />
gegeben und die technische Voraussetzung für die<br />
Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />
sowie der weiteren zu erwartenden<br />
gesetzlichen Auflagen zur Verifizierung von Arzneimittelpackungen<br />
geschaffen.<br />
Diese Codierung wird in ihrer Gesamtheit als<br />
<strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> bezeichnet.<br />
3.2 Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)<br />
– Anwendung in Deutschland<br />
Viele Vorgänge, wie z.B. zur Erstattung und zur Identifikation<br />
von Arzneimitteln, beziehen sich auf die PZN als<br />
Produktnummer.<br />
Zur Verifizierung im Sinne der EU-Richtlinie wird eine<br />
europaweit eindeutige Produktnummer benötigt.<br />
Um auch dieser Anforderung zu genügen, wurde die<br />
Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>) geschaffen und ihr<br />
der Data Identifier „9N“ zugeordnet.<br />
Aus der PZN wird, wie folgt dargestellt, die weltweit<br />
eindeutige <strong>PPN</strong> generiert:<br />
Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)<br />
11 12345678 42<br />
Product Registration PZN Check-Digits <strong>PPN</strong><br />
Agency <strong>Code</strong> for PZN<br />
Abbildung 2: Generierung der <strong>PPN</strong><br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 5
Die <strong>PPN</strong> besteht aus drei Teilen, die farblich rot, blau<br />
und grün hervorgehoben sind. Die 11 steht für den<br />
Product Registration Agency <strong>Code</strong> (PRA-<strong>Code</strong> oder<br />
PRAC). Dieser <strong>Code</strong> wird von der <strong>IFA</strong> verwaltet und<br />
vergeben. Die 11 ist für die PZN reserviert. Nach der 11<br />
folgt, in blau dargestellt, die nationale Produktnummer.<br />
Dabei handelt es sich um die unveränderte PZN<br />
(PZN8). Die darauf folgenden Ziffern (im Bild grün<br />
dargestellt) bilden die zweistellige, errechnete Prüfziffer<br />
über das komplette Datenfeld.Der Algorithmus zur Prüfziffernberechnung<br />
ist in Anhang B beschrieben. Mit der<br />
im Beispiel dargestellten PZN ergibt sich der Wert „42“.<br />
In der <strong>PPN</strong> werden PRA-<strong>Code</strong>, PZN und die <strong>PPN</strong>-<br />
Prüfziffer ohne Trennungen abgebildet. Da die einge-<br />
bettete PZN durch den Data Identifier„9N“ für die <strong>PPN</strong><br />
und den PRA-<strong>Code</strong> eindeutig identifiziert ist, entfällt<br />
der bei der PZN-Darstellung sonst übliche, vorangestellte<br />
Bindestrich als Identifikator.<br />
Existierende Datenbanken und Softwaresysteme können<br />
algorithmisch aus der <strong>PPN</strong> eine PZN generieren und<br />
umgekehrt. Die Datenbanken können somit unverän-<br />
dert mit der PZN weiterarbeiten. Alternativ können auch<br />
neue Tabellen (Übersetzungstabellen) problemlos<br />
generiert werden. In den Diensten der <strong>IFA</strong> wird die <strong>PPN</strong><br />
als ergänzendes Attribut zur PZN ausgegeben.<br />
3.4 <strong>Code</strong>s und Dateninhalte auf Handelspackungen<br />
Die Interoperabilität mit anderen Nummernsystemen,<br />
z.B. GTIN (GS1 als zuständige IA) oder HIBC (EHIBCC<br />
als zuständige IA), ist durch die gemeinsame Basis der<br />
internationalen Normen zuverlässig gewährleistet<br />
Die Nutzung der <strong>PPN</strong> ist lizenzkostenfrei!<br />
3.3 Weitere weltweite Anwendungen<br />
der <strong>PPN</strong><br />
Mit diesen Festlegungen zur <strong>PPN</strong> können auch weitere<br />
Teilnehmer im Gesundheitswesen ihre nationalen und<br />
proprietären Nummerkreise international eindeutig<br />
abbilden. Wie z.B. der Eurocode IBLS der Blutbanken,<br />
die nationalen Nummernkreise in Belgien (CNKnumber),<br />
Italien (AIC-number), Griechenland (EOFnumber),<br />
Österreich (PZN) etc. Die <strong>IFA</strong> als Issuing<br />
Agency stellt durch die Vergabe und Registrierung<br />
des PRA-<strong>Code</strong> die konfliktfreie Zuordnung<br />
und Verwendung der <strong>PPN</strong> sicher.<br />
Weitere Informationen können abgerufen werden unter:<br />
www.<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong>.org. Die Applikationen in Ver-<br />
bindung mit der <strong>PPN</strong> sind im Kapitel 3.4 beschrieben.<br />
Je nach Produkt setzt sich der <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> unterschiedlich zusammen, entweder nur die <strong>PPN</strong> allein oder die <strong>PPN</strong><br />
zusammen mit anderen Datenelementen. Im Folgenden sind die grundsätzlichen Varianten beschrieben:<br />
PZN-<strong>Code</strong> 1)<br />
Symbologie: <strong>Code</strong> 39<br />
<strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> 2)<br />
Symbologie: Data Matrix <strong>Code</strong><br />
PZN <strong>PPN</strong> SN LOT EXP GTIN<br />
Verifizierungspflichtiges Arzneimittel √ √ √ √ √ optional 3)<br />
Nicht verifizierungspflichtiges<br />
Arzneimittel<br />
√ √ optional optional optional optional 3)<br />
Sonstige apothekenübliche Ware √ √ optional optional optional optional<br />
Abbildung 3: Applikationsvarianten in der Codierung<br />
1) Nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) ist die Angabe der PZN im PZN-<strong>Code</strong> zunächst weiterhin obligatorisch.<br />
2) Der <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> ist für nicht verifizierungspflichtige Arzneimittel und sonstige apothekenübliche Waren optional und<br />
besonders dann anzuwenden, wenn neben der PZN weitere Datenelemente im <strong>Code</strong> ausgegeben werden sollen.<br />
3) Für interne Zwecke optional verwendbar.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 6
3.5 Multi Country Packs<br />
Multi Country Packs sind Handelspackungen, die in<br />
einer bestimmten Aufmachung in mehreren Ländern<br />
abgabefähig sind. Sie tragen in der „Blue Box“ mehrere<br />
nationale Produktnummern für Erstattungszwecke und<br />
warenwirtschaftlichen Belange und weitere verschiedene<br />
länderspezifische Informationen. Bei der Kennzeichnung<br />
mittels <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> können die unterschiedlichen<br />
Produktnummern ebenfalls im Data Matrix <strong>Code</strong> enthalten<br />
sein.<br />
Für verifizierungspflichtige Produkte ist es zwin-<br />
gend, die Produktnummern aller Länder, in denen<br />
verifiziert wird, in den <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> mit aufzunehmen.<br />
Im <strong>Code</strong> ist nur eine Seriennummer enthalten, sie<br />
bezieht sich bei der Verifizierung jeweils auf die<br />
Produktnummer des betreffenden Landes.<br />
Die Details zum Dateninhalt sind in Kapitel 4.2.8. und<br />
die zur Klartextinformation in Kapitel 5.6 beschrieben.<br />
Abbildung 4: Multi Country Pack<br />
4 Dateninhalte und Anforderungen<br />
4.1 Datenstruktur<br />
Damit Datenelemente aneinandergereiht eindeutig im<br />
Datenstring identifizierbar sind, werden diese gem. der<br />
Syntax ISO/IEC 15434 eingebettet (siehe Abbildung 5).<br />
Die Startsequenz verweist als „<strong>System</strong>identifikator (SI)“<br />
eindeutig auf die verwendete Struktur.<br />
Formal besteht der Datenstring aus:<br />
• Message Header<br />
• Format Header<br />
• Datenfelder 1 bis n<br />
• Format Trailer<br />
• Message Trailer<br />
Message Header<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 7<br />
Message Envelope<br />
Envelope<br />
Format<br />
Envelope<br />
Format<br />
Message Trailer<br />
Format Header<br />
Formatted Data<br />
Format Trailer<br />
Format Header<br />
Formatted Data<br />
Format Trailer<br />
Abbildung 5: Envelope-Struktur nach<br />
ISO/IEC 15434<br />
[ ) > R S<br />
R S<br />
R S<br />
E OT<br />
In dieser hier beschriebenen Applikation wird auf die<br />
Gruppierung von Datenelementen verzichtet und somit<br />
alle Daten in ein einziges Envelope-Format eingebettet. Für<br />
die Kennung der Datenelemente werden Datenidentifikatoren<br />
benutzt. Die Anwendung der Datenidentifikatoren ist<br />
zwingend. Ein komplettes Datenelement besteht immer aus<br />
einem Datenidentifikator und dem Datenfeld. Mehrerer<br />
Datenelemente werden in einem <strong>Code</strong> zusammengefasst,<br />
indem die Datenelemente jeweils durch ein Trennzeichen<br />
abgeschlossen werden (siehe Abbildung 7).<br />
Das Trennzeichen (Field Separator) am Ende der<br />
Datenfelder ist zwingend erforderlich (ASCII29 siehe<br />
Abbildung 6).<br />
Zeichensatztabelle<br />
Character Decimal HEX Purpose<br />
[ 91 5B Message Header<br />
) 41 29 Message Header<br />
> 62 3E Message Header<br />
RS 30 1E Record Separator<br />
GS 29 1D Field Separator<br />
EOT 04 04 Message Trailer<br />
Abbildung 6: Zeichensatztabelle der ISO/IEC 15434<br />
Envelope Steuerzeichen
Abbildung 5: Zeichensatztabelle der ISO/IEC 15434<br />
Envelope Steuerzeichen<br />
Datenstring:<br />
Datenstring<br />
Messageheader [)> R S<br />
Formatheader 06 G S<br />
Interpretation <strong>Code</strong>inhalt<br />
Datenfeld 1 DI 9N<br />
<strong>Code</strong>wort 237<br />
Datenfeld 1 Inhalt 111234567842<br />
Field-Separator<br />
G S<br />
Datenfeld 2 DI 1T<br />
Datenfeld 2 Inhalt 1234567<br />
Field-Separator<br />
Datenfeld 3 DI D<br />
G S<br />
Datenfeld 3 Inhalt 151200<br />
Field-Separator<br />
Datenfeld 4 DI S<br />
Datenfeld 4 Inhalt 123456789012<br />
Field-Separator<br />
Formattrailer R S<br />
Messagetrailer<br />
EOT<br />
G S<br />
G S (optional)<br />
Abbildung 7: 6: Beispiel Beispiel eines eines kompletten kompletten Datenstrings Daten-<br />
mit strings den Datenelementen mit den Datenelementen <strong>PPN</strong>, Chargenbezeichnung,<br />
<strong>PPN</strong>, Chargenbe-<br />
Verfalldatum zeichnung, Verfallsdatum und Seriennummer und Seriennummer<br />
Die<br />
Die<br />
Reihenfolge<br />
Reihenfolge<br />
der<br />
der<br />
Datenfelder<br />
Datenfelder<br />
ist<br />
ist<br />
beliebig.<br />
beliebig.<br />
Es<br />
Es<br />
können<br />
können<br />
außer außer den den obligatorischen obligatorischen Datenelementen Datenelementen auch auch ggf. ggf.<br />
weitere verwendet werden. Details sind sind in in den den folgen-<br />
den Kapiteln beschrieben.<br />
4.1.1 Message Header<br />
4.3 Fieldseparator<br />
Jedes Datenfeld wird mit dem Field Separator G S ab-<br />
geschlossen. Am Ende des letzen Datenfeldes kann<br />
Message Trailer den Datenstring definiert abschließen.<br />
der Field-Separator entfallen, da der Format- und Mes-<br />
sagetrailer den Datenstring definiert abschließen.<br />
4.4 Trailer<br />
EOT<br />
abgeschlossen. Dieser Trailer ist gemäß ISO/IEC<br />
16022 Der Datenstring über das Macro wird mit 06 dem impliziert. Formattrailer RS und EOT<br />
abgeschlossen. Dieser Trailer ist gemäß ISO/IEC 16022<br />
über das Macro 06 impliziert.<br />
4.2.1 4.5 Zeichensätze<br />
Allgemeines<br />
Zulässige Datentypen, Zeichensätze sowie Datenlänge<br />
Die notwendigen Datenidentifikatoren sind in der<br />
etc. der zu codierenden Daten sind in einem separaten<br />
internationalen Datenstrukturnorm ISO/IEC 15418<br />
Anhang dargestellt (siehe Anhang A).<br />
(verweist auf ANSI MH10.8.2: Data Identifier and Application<br />
Identifier) definiert. In dieser Anwendung werden<br />
ausschließlich 4.6 Produktnummer<br />
die ASC Data Identifier (DI) nach dieser<br />
Norm verwendet, deren Ausprägung in den folgenden<br />
Kapiteln Datenbezeichner: definiert wird. „9N“ Zur besseren Übersicht sind die<br />
Data Identifier in Anhang A tabellarisch dargestellt.<br />
Zur Produktidentifikation wird die Pharmacy-Product-<br />
Number herangezogen. Alle weiteren, im Datenstring<br />
Die Normen lassen die Ausprägung der Datenelemente<br />
enthaltenen Datenelemente beziehen sich auf die <strong>PPN</strong>.<br />
in der Regel offen. Deshalb sind in dieser <strong>Spezifikation</strong>,<br />
In der <strong>PPN</strong> ist die PZN enthalten und kann daraus extra-<br />
für alle Markteilnehmer verbindlich, der jeweilige Dahiert<br />
werden (siehe Kapitel 3.2)<br />
tentyp, die Datenlänge und der Zeichenvorrat definiert<br />
(siehe Es muss Anhang die auf A). 8 Stellen erweiterte PZN verwendet<br />
werden. Daraus ergibt sich eine 12-stellige numerische<br />
Sollen weitere Data Identifier spezifiziert werden, so ist<br />
<strong>PPN</strong>.<br />
ein entsprechender Antrag bei der <strong>IFA</strong> zu stellen.<br />
Die Produktnummer steht auch anderen nationalen<br />
Nicht Nummernkreisen in dieser <strong>Spezifikation</strong> offen und verwendete ist deshalb Data in der Identifier, Norm<br />
die jedoch der Syntax der MH10.8.2. folgen, sollen in<br />
Zur All contents komprimierten copyright Darstellung © <strong>IFA</strong> GmbH im | Data Informationsstelle Matrix <strong>Code</strong> für Arzneispezialitäten | Deutsch V 1.03 Seite 9<br />
nach ISO/IEC 16022 „ASCII encodation“ werden über<br />
das Macro-<strong>Code</strong>wort „237“ der Header „[)> R<br />
S<br />
06 G<br />
S<br />
“<br />
und der Trailer interpretiert (siehe Abbildung 7<br />
und folgende Tabelle):<br />
Macro-<br />
<strong>Code</strong>wort Name<br />
den Applikationen korrekt ausgegeben werden und zu<br />
definierten Zuständen führen. Der Datenerfassungsvorgang<br />
und der Verifizierungsprozess dürfen dadurch<br />
nicht gefährdet werden. Die normierten Datenstrukturen<br />
dürfen durch solche Erweiterungen nicht verletzt<br />
werden. Grundsätzlich ist das Format der Data Iden-<br />
Interpretation<br />
Header<br />
Interpretation<br />
Trailer<br />
tifier nach ANSI MH10.8.2 alphanumerisch. Der Data<br />
237 06 Macro [)>R<br />
S<br />
06G<br />
S<br />
R<br />
S<br />
EOT<br />
Identifier schließt immer mit einem Alphazeichen ab,<br />
dem kann eine Zahl vorangestellt sein.<br />
4.1.2 Field Separator<br />
Jedes Datenfeld wird mit dem Field Separator G<br />
S<br />
abgeschlossen. Am Ende des letzten Datenfeldes kann<br />
der Field Separator entfallen, da der Format Trailer und<br />
4.1.3 Message Trailer<br />
Der Datenstring wird mit dem Format Trailer R S und<br />
4.2 Datenidentifikatoren und Daten<br />
Zulässige Datentypen, Zeichensätze sowie Datenlänge<br />
etc. der zu codierenden Daten sind in Anhang A dargestellt.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 8
4.2.2 Produktnummer<br />
Data Identifier: „9N“<br />
Zur Produktidentifikation wird die Pharmacy Product<br />
Number (<strong>PPN</strong>) herangezogen. Alle weiteren, im Datenstring<br />
enthaltenen Datenelemente beziehen sich auf die<br />
<strong>PPN</strong>. In der <strong>PPN</strong> ist die PZN enthalten und kann daraus<br />
extrahiert werden (siehe Kapitel 3.2)<br />
Es muss die auf 8 Stellen erweiterte PZN (PZN8) verwendet<br />
werden. Daraus ergibt sich eine 12-stellige numerische<br />
<strong>PPN</strong>.<br />
Die Produktnummer steht auch anderen nationalen<br />
Nummernkreisen offen und ist deshalb in der Norm<br />
ANSI MH10.8.2 als alphanumerisches Feld mit 22<br />
Zeichen definiert.<br />
Beispiel:<br />
DI Daten<br />
9N 110375286414<br />
4.2.3 Chargenbezeichnung<br />
Data Identifier: „1T“<br />
Die Chargenbezeichnung wird vom Pharmazeutischen<br />
Unternehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />
Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />
Zur Abgrenzung von Teil-/Unterchargen können definierte<br />
Sonderzeichen verwendet werden (siehe Anhang A).<br />
Beispiel:<br />
DI Daten<br />
1T 12345ABCD<br />
4.2.4 Verfalldatum<br />
Data Identifier: „D“<br />
Das Verfalldatum wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />
nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />
Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />
Das Verfalldatum hat das Format „YYMMDD“<br />
YY = zweistellige Jahreszahl<br />
Da das Verfalldatum ausschließlich in<br />
der Zukunft liegt, handelt es sich um<br />
Datumsangaben für das 21. Jahrhundert<br />
(2000-2099).<br />
MM = Numerische Monatsangabe (01-12)<br />
DD = Tag<br />
a) Verfalldatum mit Tages-/ Monats- und Jahresangabe<br />
(DD = 01-31)<br />
b) Verfalldatum mit Monats- und Jahresangabe<br />
(DD = 00)<br />
Beispiel: Verfalldatum Juni 2016<br />
DI Daten<br />
D 160600<br />
Dieses Beispiel stellt die vom AMG vorgegebene<br />
Datumsangabe dar.<br />
Beispiel: Verfalldatum 17. Juni 2016<br />
DI Daten<br />
D 160617<br />
Dieses Beispiel stellt die Möglichkeit einer tagesgenauen<br />
Datumsangabe dar.<br />
Anmerkung: In der ANSI MH10.8.2 ist „D“ als Datum<br />
allgemein definiert. Im Kontext der <strong>PPN</strong> ist das Datum<br />
zwangsweise das Verfalldatum. Bei anderen Datumsangaben,<br />
wie z.B. dem Produktionsdatum, sind andere<br />
Datenidentifikatoren zu verwenden. Beim Produktionsdatum<br />
wäre dies der DI „16“ (siehe Kapitel 4.2.6).<br />
4.2.5 Seriennummer<br />
Data Identifier: „S“<br />
Die Seriennummer wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />
nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />
Datenelement für den <strong>Code</strong>. Sie ist für den Verifizierungsprozess<br />
zur Arzneimittelsicherheit obligatorisch.<br />
Für Produkte, die nicht darunterfallen, kann diese<br />
optional aufgebracht werden. Bezüglich Generierung<br />
der Seriennummern siehe „Codierregeln securPharm“.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 9
Beispiel:<br />
DI Daten<br />
S 12345ABCDEF98765<br />
Die verwendbaren Zeichen sind im Anhang A be-<br />
schrieben.<br />
4.2.6 Herstelldatum<br />
Data Identifier: „16D“<br />
Das Herstelldatum wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />
nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />
Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />
Es kann für interne Zwecke oder dann ausgegeben<br />
werden, wenn zwischen Marktpartnern dedizierte<br />
Vereinbarungen bestehen.<br />
Das Herstelldatum hat das Format „YYYYMMDD“<br />
YYYY = vierstellige Jahreszahl<br />
MM = Numerische Monatsangabe (01-12)<br />
DD = Tag<br />
a) Herstelldatum mit Tages-/ Monats- und<br />
Jahresangabe<br />
(DD = 01-31)<br />
b) Herstelldatum mit Monats- und Jahresangabe<br />
(DD = 00)<br />
Beispiel: Herstelldatum März 2012<br />
DI Daten<br />
16D 20120300<br />
Beispiel: Herstelldatum 15. März 2012<br />
DI Daten<br />
16D 20120315<br />
4.2.7 GTIN<br />
Data Identifier: „8P“<br />
Die GTIN generiert der Hersteller nach den Regeln<br />
der GS1 für sein Produkt. Sie kann dann ausgegeben<br />
werden, wenn für Produkte neben der PZN (<strong>PPN</strong>) auch<br />
eine GTIN vergeben ist, zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel.<br />
Beispiel: GTIN mit der Nummer 01234567891234<br />
DI Daten<br />
8P 01234567891234<br />
4.2.8 Produktnummer bei<br />
Multi Country Packs<br />
Die Besonderheit bei Multi Country Packs sind mehrfach<br />
enthaltene, länderspezifische Produktnummern. Die für<br />
das jeweilige Land relevante Produktnummer muss<br />
durch die <strong>System</strong>e im Handel und bei den Abgabestellen<br />
erkannt werden. Je nachdem, ob es sich bei den<br />
Produktnummern um eine <strong>PPN</strong> oder um eine GTIN/<br />
NTIN handelt, wird der Data Identifier „9N“ oder „8P“<br />
verwendet, gegebenenfalls auch mehrfach.<br />
Beispiel:<br />
<strong>PPN</strong> mit der Nummer 110375286414 und<br />
GTIN mit der Nummer 01234567891231 und<br />
NTIN mit der Nummer 03400123456789<br />
DI Daten<br />
9N 110375286414<br />
8P 01234567891234<br />
8P 03400123456789<br />
Alle weiteren Datenelemente können ohne Einschränkung<br />
entsprechend hinzugefügt werden.<br />
5 Beschriftung mit <strong>Code</strong> und<br />
Klartext<br />
5.1 Symbologie<br />
Dieses Kapitel beschreibt die Codierung mit den Vorgaben<br />
für den Klartext und Elementen wie z.B. das Emblem<br />
zum <strong>Code</strong>.<br />
Der verwendete Datenträger bzw. die Symbologie<br />
ist der Data Matrix gemäß ISO/IEC 16022. Die Fehlerkorrektur<br />
erfolgt nach ECC200. Die anderen Fehlerkorrekturmethoden<br />
(ECC000 bis ECC140) dürfen<br />
nicht eingesetzt werden. Eigenschaften des Data<br />
Matrix <strong>Code</strong>s sind separat beschrieben (siehe Anhang I).<br />
Sofern immer eine gleichbleibende Matrixgröße<br />
gedruckt werden soll, sind ggf. Füllzeichen einzufügen<br />
(siehe Anhang I.5).<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 10
5.2 Matrixgröße<br />
Typischerweise soll die Matrixgröße von 26x26 bzw. 16x48 Modulen nicht überschritten werden. Klei-<br />
nere Matrixgrößen sind erlaubt, sofern die Kapazität für die zu kodierenden Daten ausreicht.<br />
Vorzugsweise sind die quadratischen <strong>Code</strong>s zu verwenden. Sofern das Packmitteldesign oder die Drucktechnolo-<br />
gie es erfordern, sind auch die rechteckigen Varianten verwendbar.<br />
Quadratische Symbole<br />
Matrixgröße Dimension (mm) Datenkapazität<br />
Zeilen Spalten Typisch<br />
Min<br />
X = 0,35 X = 0,25 X = 0,615<br />
numerisch<br />
22 22 7,7 5,5 13,5 60 43<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 11<br />
Max<br />
Numerisch Alpha-<br />
24 24 8,4 6,0 14,8 72 52<br />
26 26 9,1 6,5 16,0 88 64<br />
32 32 11,2 8,0 19,7 124 91<br />
Rechteckige Symbole<br />
Matrixgröße Dimension (mm) Datenkapazität<br />
Zeilen Spalten Typisch<br />
X = 0,35<br />
Min<br />
X = 0,25<br />
Max<br />
X = 0,615<br />
Numerisch Alphanumerisch<br />
16 36 5,6x12,6 4x9,0 9,8x22,1 64 46<br />
16 48 5,6x16,8 4x12,0 9,8x29,5 98 72<br />
X = Modulgröße in mm<br />
Details zur Symbologie siehe Anhang I<br />
5.3 <strong>Code</strong>größe und Ruhezone<br />
Die Modulgröße des <strong>Code</strong>s darf zwischen 0,25 und<br />
0,615 mm variieren. Innerhalb dieses Bereiches dürfen<br />
die Modulgrößen unter Beachtung der Druckqualität<br />
(siehe Kapitel 5.8) sowie der einzusetzenden Drucksysteme<br />
(siehe Kapitel 6) beliebig skaliert werden.<br />
Mit der Modulgröße ist die Größe einer Matrixzelle<br />
gemeint (siehe Kapitel 5.2 und Anhang I.1). Typische<br />
Modulgrößen liegen zwischen 0,33 und 0,45 mm.<br />
Die an den <strong>Code</strong> angrenzenden Flächen sind von<br />
weiterer Bedruckung freizuhalten. Dieser Abstand, die<br />
so genannte Ruhezone, soll mindestens drei Module<br />
betragen.<br />
5.4 Positionierung des<br />
Data Matrix <strong>Code</strong>s<br />
Für die Positionierung werden keine besonderen Festlegungen<br />
getroffen. Die Position bestimmt der Hersteller<br />
aufgrund des Packungslayouts und der Gegebenheiten<br />
des Bedruckens (siehe Anhang G).<br />
Bei Zulassungen durch die EMA wird der <strong>Code</strong> außerhalb<br />
der „Blue Box“ aufgebracht.
5.5 Emblem zum Data Matrix <strong>Code</strong><br />
Das Emblem „<strong>PPN</strong>“ am Data Matrix <strong>Code</strong>, weist den<br />
Handel auf den <strong>Code</strong> hin, der zum maschinellen<br />
Erfassen der Produktnummer und den weiteren Daten<br />
herangezogen wird. Bei verifizierungspflichtigen Produkten<br />
ist dies gleichzeitig der Hinweis zur Identifikation<br />
und Verifizierung der Handelspackung.<br />
Abbildung 8: Emblem zum <strong>Code</strong><br />
Es sind verschiedene Varianten und Details zur<br />
graphischen Gestaltung des Emblems möglich (siehe<br />
Anhang C).<br />
Die minimalen Abstände zum <strong>Code</strong> (Ruhezonen) sind<br />
zu beachten.<br />
Das Emblem kann in einer Übergangsphase entfallen.<br />
Somit hat der pharmazeutische Hersteller mehr Freiheiten<br />
bei den Umstellungsprozessen.<br />
5.6 Klartextinformation<br />
<strong>PPN</strong>: Die <strong>PPN</strong> respektive die PZN sind das Schlüsselelement<br />
der Verkaufspackung. Nach den aktuellen<br />
gesetzlich geltenden Regeln muss die PZN in Klarschrift<br />
mit dem <strong>Code</strong> 39 aufgebracht werden (siehe<br />
<strong>Spezifikation</strong> zur PZN (http://www.pzn8.de/downloads/<br />
de/<strong>IFA</strong>_Spec_PZN_Codierung_DE.pdf). Die <strong>PPN</strong> wird<br />
daher im Klartext nicht mitgedruckt.<br />
Chargenbezeichnung und Verfalldatum: Für die<br />
Klartextinformation bzgl. der Chargenbezeichnung<br />
und des Verfalldatums gelten die arzneimittelrechtlich<br />
vorgegebenen Anforderungen zur Kennzeichnung.<br />
Seriennummer: Die Seriennummer ist nicht im<br />
Klartext auszugeben, da der Verifizierungsprozess des<br />
Arzneimittels ausschließlich automatisch erfolgen soll<br />
und nach dem Stand der Technik die maschinenlesbare<br />
Information verfügbarer und fehlerfreier als eine<br />
manuelle Eingabe ist.<br />
Klartextinformationen bei Multi Country Packs:<br />
Unverändert sind in der „Blue Box“ neben den länderspezifischen<br />
Produktinformationen die Produktcodes<br />
abzubilden. Weitere textliche Kennzeichnungen am<br />
Data Matrix <strong>Code</strong> sind nicht vorgesehen.<br />
Weitere optionale Datenelemente: Die ggf. notwen-<br />
dige Klartextinformation unterliegt individuellen Regeln,<br />
die nicht Bestandteil dieser <strong>Spezifikation</strong> sind.<br />
5.7 <strong>Code</strong>beispiele<br />
Die folgenden Beispiele verwenden als Startsequenz<br />
immer das Macro 06 (<strong>Code</strong>wort 237). Die Datenfelder<br />
sind immer mit dem Zeichen G<br />
S<br />
(ASCII 29) abgeschlossen.<br />
Hinter dem letzten Datenfeld ist kein G<br />
S<br />
Zeichen kodiert, da das Lesegerät aufgrund des Macro<br />
06 die Zeichen R<br />
S<br />
und EOT<br />
automatisch generiert.<br />
Folgende Beispiele zeigen, welche Größen der <strong>Code</strong> je<br />
nach Länge der Datenfelder annehmen kann. Die Länge<br />
der Datenfelder bestimmt der Hersteller, unter Beachtung<br />
der in Anhang A aufgeführten <strong>Spezifikation</strong>en.<br />
Beispiel 1<br />
Ein typische Größe ist ein <strong>Code</strong> mit einer Matrix von<br />
26x26 Modulen. Die Datenfelder weisen hierbei eine<br />
häufig verwendete Länge auf:<br />
Beispiel 2<br />
<strong>Code</strong>inhalt:<br />
DI Datenfeld<br />
9N 110375286414<br />
1T 12345ABCD<br />
D 150600<br />
S 12345ABCDEF98765<br />
Die minimale Größe wäre eine Matrix von 22x22<br />
Modulen. Die Datenfelder weisen hierbei eine sehr<br />
kurze Datenlänge auf:<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 12
<strong>Code</strong>inhalt:<br />
DI Datenfeld<br />
9N 110375286414<br />
1T 1ABCDE<br />
D 150600<br />
S 1ABCDEF<br />
In der Variante mit einer Matrixgröße von 22x22 Modu-<br />
len kann die Chargenbezeichnung und die Seriennum-<br />
mer jeweils maximal 7 Zeichen umfassen.<br />
Beispiel 3<br />
Wird die Datenfeldkapazität für die vier Standard-<br />
elemente bis zum Limit genutzt, muss mit einer Matrix<br />
von 32x32 Modulen gerechnet werden:<br />
<strong>Code</strong>inhalt:<br />
Beispiel 4<br />
DI Datenfeld<br />
9N 110375286414<br />
1T 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J<br />
D 150600<br />
S A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0<br />
Dieser <strong>Code</strong> zeigt ein rechteckiges Format mit einer<br />
Matrix von 16x48 Modulen. Die Datenfelder sind identisch<br />
mit denen im Beispiel 1.<br />
<strong>Code</strong>inhalt:<br />
DI Datenfeld<br />
9N 110375286414<br />
1T 12345ABCD<br />
D 150600<br />
S 12345ABCDEF98765<br />
5.8 Druckqualität<br />
Die Prüfung des <strong>Code</strong>inhalts (Lesekontrolle) ist<br />
grundsätzlich von der Prüfung der Druckqualität<br />
(Druckqualitätskontrolle) zu unterscheiden.<br />
Grundvoraussetzung für einen nutzbaren <strong>Code</strong> ist,<br />
dass dieser gelesen werden kann und der Inhalt<br />
den festgelegten Regeln entspricht. Die praktische<br />
Lesbarkeit hängt vom jeweils verwendeten Lesegerät<br />
und den Rand- bzw. Umgebungsbedingungen ab. Zur<br />
Sicherstellung der allgemeinen Lesbarkeit eines <strong>Code</strong>s<br />
wird eine Mindestdruckqualität, entsprechend einer<br />
Konventionsmethode definiert.<br />
Bei Digitaldruck ist jeder Druck als individuell zu<br />
betrachten. Daher muss der <strong>Code</strong>inhalt jeweils mittels<br />
Lesekontrolle überprüft werden (siehe Anhang E.3).<br />
Der aktuelle technische Standard für die Bestimmung<br />
der Druckqualität ist in der ISO/IEC 15415 beschrieben.<br />
Die Lichtart, mit der geprüft wird, ist Rotlicht mit einer<br />
Wellenlänge von 660 nm (+/- 10 nm). Die synthetische<br />
Apertur ist 80% der jeweiligen <strong>Code</strong>größe<br />
gemäß dem oben genannten ISO-Standard. Alternativ<br />
gibt es die Möglichkeit, eingebaute Analysefähigkeiten<br />
der verwendeten Erfassungssysteme zu<br />
nutzen, die angelehnt an ISO/IEC 15415 die Druckqualität<br />
bestimmen.<br />
Die Druckqualität wird mit Ziffern von 4 bzw. Buchstaben<br />
von A (beste Qualität) bis 0 bzw. F (schlechteste Qualität)<br />
ausgedrückt (siehe nachfolgende Tabelle).<br />
Qualitätsstufen nach ISO/IEC 15415<br />
ISO/IEC-<br />
Klasse<br />
ANSI-<br />
Grad<br />
Bei Mehrfachmessung<br />
Bedeutung<br />
4 A 3,5 - 4,0 Sehr Gut<br />
3 B 2,5 - 3,49 Gut<br />
2 C 1,5 - 2,49 Befriedigend<br />
1 D 0,5 - 1,49 Ausreichend<br />
0 F Unter 0,5 Durchgefallen<br />
Die Druckqualität darf den Grad 0,5 (ausreichend)<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 13
gemäß ISO/IEC 15415 nicht unterschreiten. Um<br />
die Lesbarkeit am Ende (und ggf. während) der<br />
Lieferkette sicher zu gewährleisten, muss eine<br />
Druckqualität von Grad 1,5 (befriedigend) angestrebt<br />
werden.<br />
Die Mindestqualitätsanforderung an die Druckqualität<br />
gilt grundsätzlich nur im Zusammenhang mit allgemein<br />
anerkannten Methoden der Statistik in der Qualitätskontrolle<br />
(siehe Anhang E.5).<br />
Weitere Details zur Druckqualität und den Prüfgeräten<br />
sind in Anhang E beschrieben.<br />
6 Drucksysteme<br />
Die Drucksysteme müssen in der Lage sein, die <strong>Code</strong>s<br />
in der definierten Mindestdruckqualität (siehe Kapitel<br />
5.8) Drucksysteme können gemäß der internationalen<br />
Norm ISO/IEC 15419 geprüft werden.<br />
Typische Fehler im Druck sind neben denen der Daten-<br />
struktur und des Dateninhaltes in Anhang F beschrieben.<br />
7 Lesetechnik<br />
Gelesen wird der Data Matrix <strong>Code</strong> durch handelsübli-<br />
che Scanner für 2D Matrixcodes. Die optischen Eigen-<br />
schaften bezüglich Mindestleseabstand, Tiefenschärfe<br />
und Auflösung müssen so gewählt sein, dass eine hohe<br />
Erstleserate erzielt wird.<br />
Die in dieser <strong>Spezifikation</strong> beschriebenen <strong>Code</strong>eigen-<br />
schaften bezüglich Modulgrößenvariation und Matrix-<br />
größenvariation sind die Vorgabe für die Scannereigen-<br />
schaften. Darüber hinaus bestimmt die Applikation die<br />
notwendige Lesegeschwindigkeit und Schärfentiefe.<br />
Scanner können gemäß der internationalen Norm ISO/<br />
IEC 15423 getestet werden.<br />
Die Anforderungen an die <strong>Code</strong>qualität steigen mit dem<br />
Automatisierungsgrad. Manuell bediente Scanner sind<br />
am tolerantesten gegen schlechte <strong>Code</strong>druckqualitäten.<br />
Vollautomatische Leseeinrichtungen reagieren am<br />
empfindlichsten auf schlechte <strong>Code</strong>druckqualitäten.<br />
Die Anzahl der Leseausfälle steigt mit abnehmender<br />
Druckqualität und mit zunehmender Prozessgeschwin-<br />
digkeit (siehe auch Kapitel 5.8 und Anhang E).<br />
Die Wahrscheinlichkeit, dass <strong>Code</strong>s mit falschem<br />
Dateninhalt gelesen werden, ist gering, aber nicht<br />
unmöglich. Aus diesem Grund stößt eine Verbesserung<br />
der Scanner ab einem bestimmten Punkt an Grenzen.<br />
Ein optimales <strong>System</strong> verwendet fehlertolerante Scanner<br />
und <strong>Code</strong>s mit einer guten Druckqualität, um die Wahr-<br />
scheinlichkeit von erfolgreichen Falschlesungen zu mi-<br />
nimieren.<br />
8 Interoperabilität bei unterschiedlichen<br />
Datenstrukturen<br />
und Datenidentifikatoren<br />
8.1 Interoperabilität auf Basis<br />
bestehender Auto-ID<br />
Für die Hersteller, den Großhandel, die Apotheken, die<br />
Kliniken, aber auch die Praxen ist die Interoperabilität<br />
der Codierungen eine Voraussetzung für das Lesen<br />
und der eindeutigen Identifikation der Datenelemente.<br />
Bei einer durchgängigen Interoperabilität ist es den<br />
Beteiligten möglich, ihre Prozesse kostengünstig zu<br />
betreiben.<br />
Die gemeinsame Basis dafür sind die Norm ISO/IEC<br />
15459 Unique Identification, die <strong>System</strong>- und Datenidentifikatoren<br />
Norm ISO/IEC 15418 (ANSI MH10.8.2)<br />
und die Syntaxnorm ISO/IEC 15434.<br />
Unter Beachtung der Normen können Daten aus<br />
verschiedenen Datenträgern, unterschiedlichen Sym-<br />
bologien und Kennzeichnungssystemen konfliktfrei<br />
übertragen werden, wie in Abbildung 5 gezeigt.<br />
Im Folgenden sind die im Gesundheitsbereich gängigen<br />
<strong>System</strong>e aufgeführt, die konfliktfrei neben der in dieser<br />
<strong>Spezifikation</strong> beschriebenen Kennzeichnung von Daten<br />
eingesetzt werden können.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 14
GS1<br />
Das <strong>System</strong> der GS1 basiert auf der Artikelkennzeich-<br />
nung mittels GTIN. Für spezielle Lösungen hat die GS1<br />
auch einen Präfix für eine so genannte NTIN, die datentechnisch<br />
als Artikelnummer einer GTIN gleichzusetzen<br />
ist, vergeben. Wesentliche Merkmale sind der nach DIN<br />
66403 als <strong>System</strong>identifikator verwendete Steuercode<br />
„FNC1“ und die Verwendung von Application Identifier<br />
(AI) als Datenindentifikatoren. Die Interoperabilität<br />
zwischen den AI und den Data Identifier (DI) ist über<br />
die Referenztabellen der ANSI MH10.8.2 sichergestellt.<br />
Das Envelope Format der Norm ISO/IEC 15434 wird<br />
vom GS1 <strong>System</strong> nicht benutzt.<br />
HIBC<br />
Der Healthcare Industry Bar <strong>Code</strong> – HIBC wird von der<br />
EHIBCC-Organisation verwaltet. EHIBCC ist eine Issuing<br />
Agency nach ISO/IEC 15459. Der klassische HIBC wird<br />
von dem registriertem <strong>System</strong>identifikator „+“ (Plus)<br />
angeführt und ist damit von allen anderen <strong>System</strong>en<br />
verwechslungsfrei identifizierbar. Das entscheidende<br />
Merkmal des HIBC ist der kompakte Aufbau und die<br />
Kapazität für alphanumerische Produktcodes von<br />
2 bis 18 Stellen. Der HIBC-Standard ist auf die alternative<br />
Verwendung von Datenidentifikatoren für alle<br />
logistischen Ebenen erweitert worden (DI 25P); (siehe<br />
www.HIBC.de).<br />
8.2 Interoperabilität auf Basis von<br />
XML-Standards<br />
Im Anhang D ist ein vorzugsweise anzuwendender<br />
Standard beschrieben, der auf allgemeinen XML-<br />
Standards beruht und die Datenidentifikatoren neutral<br />
beschreibt. Dies ermöglicht den offenen Datenaustausch<br />
wie z.B in Abbildung 9 beschrieben, unabhängig<br />
von Symbolik und Datenstrukturen.<br />
11012…<br />
012345..<br />
12334….<br />
12ABC..<br />
151231<br />
01234567<br />
Abbildung 9: Datenaustausch zwischen Lesegerät<br />
und <strong>System</strong> auf XML-Basis<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 15<br />
….<br />
….<br />
….
Anhang A<br />
Übersicht Datenelemente und Data Identifier<br />
Die folgende Tabelle spezifiziert die Ausprägung der einzelnen Datenelemente und der zugehörigen Data Identifier:<br />
Datenelemente XML-<br />
Knoten<br />
Pharmacy<br />
Product Number<br />
Chargenbezeichnung<br />
DI Datentyp Datenformat<br />
Zeichenlänge<br />
Zeichenvorrat<br />
9N AN --- 4-22 0-9; A-Z<br />
Keine Sonderzeichen<br />
keine Kleinschreibung<br />
keine Umlaute<br />
1T AN --- 1-20 0-9; A-Z<br />
Erlaubte Sonderzeichen „-“<br />
und „_“<br />
keine Kleinschreibung<br />
keine Umlaute<br />
Verfalldatum D Datum YYMMDD 6 0-9<br />
Seriennummer S AN --- 1-20 0-9; A-Z<br />
Keine Sonderzeichen<br />
keine Kleinschreibung<br />
keine Umlaute<br />
Herstelldatum 16D Datum YYYYMMDD 8 0-9<br />
GTIN oder NTIN 8P N --- 14 0-9<br />
Anmerkung zum Datenformat:<br />
Lediglich bei den Datumsangaben ist ein festes Datenformat vorgegeben<br />
Anmerkung zum Zeichenvorrat bezüglich Chargenbezeichnung:<br />
Erlaubte Sonderzeichen bei der Chargenbezeichnung sind der Unterstrich „_“ und der Bindestrich „-“. Alle<br />
anderen Sonderzeichen werden in verschiedenen Anwendungen unterschiedlich verwendet. Die Anwendung solcher<br />
Zeichen birgt ein hohes Risiko der Fehlinterpretation und wird daher hier ausgeschlossen.<br />
Kleinbuchstaben sind nicht erlaubt, weil einige <strong>System</strong>e zwischen Kleinbuchstaben und Großbuchstaben unter-<br />
scheiden und andere nicht. Auch wegen der Verwechslungsgefahr von Kleinbuchstaben und Großbuchstaben<br />
sind Kleinbuchstaben ausgeschlossen Zur Aufnahme weiterer Data Identifier in diese <strong>Spezifikation</strong> wenden Sie sich<br />
bitte an die <strong>IFA</strong>.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 16
Anhang B<br />
Algorithmus zur Prüfzifferberechnung der <strong>PPN</strong><br />
Die Prüfziffer der <strong>PPN</strong> (Beschreibung der <strong>PPN</strong> siehe Kapitel 3.2 wird nach dem Modulo 97 berechnet.<br />
Dabei werden den Zeichen der <strong>PPN</strong> die Dezimalwerte der ASCII-Tabelle von 00 bis 127 zugeordnet. Jede Stelle<br />
der <strong>PPN</strong> wird mit einem Faktor gewichtet. Das Produkt der ASCII-Dezimalwerte wird addiert und durch 97 geteilt.<br />
Der verbleibende Rest bildet als Zahlenwert die zweistellige Prüfziffer von 00 bis 99. Ein einstelliger Restwert wird<br />
mit führender Null aufgefüllt. Die Gewichtung der Stellen beginnt links mit „2“ und erhöht sich für die jeweils<br />
folgende Stelle um „1“.<br />
Dieser Algorithmus liefert die Prüfziffer sowohl für rein numerische, als auch für alphanumerische <strong>PPN</strong>.<br />
Beispiel zur <strong>PPN</strong> und Bildung der Prüfziffer:<br />
Für den deutschen Markt enthält die <strong>PPN</strong> die Pharmazentralnummer (PZN) mit dem vorangestellten<br />
„Product-Registration Agency <strong>Code</strong>“ „11“. Die <strong>PPN</strong> enthält ausschließlich die 8-stellige PZN (PZN8).<br />
Die PZN7 (siebenstellige PZN) wird durch eine führende Null in eine PZN8 überführt.<br />
Details zur PZN8 siehe: http://www.pzn8.de/downloads/de/<strong>IFA</strong>_Spec_PZN_Codierung_DE.pdf<br />
Für die PZN mit dem Präfix 11 „1103752864“ berechnet sich die <strong>PPN</strong> Prüfziffer wie folgt:<br />
PRA-<strong>Code</strong> PZN PZN<br />
Prüfziffer<br />
<strong>PPN</strong><br />
Prüfziffer<br />
<strong>PPN</strong> 1 1 0 3 7 5 2 8 6 4 1 4<br />
ASCII<br />
Dez-Wert<br />
49 49 48 51 55 53 50 56 54 52<br />
Gewichtung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Produkt<br />
aus ASCII<br />
Wert und<br />
Gewichtung<br />
98 147 192 255 330 371 400 504 540 572<br />
Summe 3409 / 97 = 35 Rest 14<br />
Die Prüfziffer ist der numerische Rest 14 und bildet die letzten beiden Stellen der <strong>PPN</strong>. Die vollständige<br />
<strong>PPN</strong> lautet damit: 110375286414.<br />
Der Rest wird als numerischer Wert übernommen und nicht durch das entsprechende ASCII-Zeichnen<br />
dargestellt. Somit ist sichergestellt, dass die Prüfziffer nur aus den Ziffern von 0 bis 9 besteht.<br />
Numerische Folgen bleiben damit auch numerisch.<br />
Hinweis:<br />
Nach der Überprüfung der <strong>PPN</strong>-Prüfziffer kann bei korrektem Ergebnis noch zusätzlich die in der PZN enthaltene<br />
Prüfziffer verifiziert werden. Ist auch diese korrekt, so können übliche Eingabefehler ausgeschlossen werden.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 17
Anhang C<br />
Emblem zum <strong>Code</strong><br />
Als Emblem zum <strong>Code</strong> ist die Zeichenfolge „<strong>PPN</strong>“ in der Schriftart „OCR-B“ festgelegt.<br />
Die graphische Ausprägung ist nachstehender Skizze zu entnehmen:<br />
f<br />
e<br />
a<br />
b<br />
c<br />
d<br />
Nominale Maße:<br />
a: ergibt sich aus gewählter Modul- und Matrixgröße<br />
b: ist bei quadratischen <strong>Code</strong>s gleich a, bei rechteckigen<br />
<strong>Code</strong>s entsprechend der Modul- und<br />
Matrixgröße<br />
c: 0,4 * a<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 18<br />
d: *)<br />
e: ergibt sich aus der geforderten Ruhezone*)<br />
(Ruhezone siehe Kapitel 5.3)<br />
f: ergibt sich aus der Schrifttype und Maß c<br />
*) Die Maße d und e sind so zu wählen, dass das<br />
Emblem dem <strong>Code</strong> zugeordnet ist.<br />
Toleranzen:<br />
Die Toleranzen können entsprechend dem gewählten Druckverfahren frei festgelegt werden.<br />
Folgende Ausrichtungen sind prinzipiell möglich:<br />
Folgende Ausrichtungen sind prinzipiell möglich:<br />
In Ausnahmefällen kann das Emblem auch auf einer anderen, angrenzenden Fläche aufgebracht werden.
Anhang D<br />
Interoperabilität auf der Basis von<br />
XMLBeschreibungen (informativ)<br />
D.1 Allgemeines<br />
Für die Hersteller, den Großhandel, die Apotheken und<br />
die Kliniken ist die Interoperabilität der Codierungen eine<br />
Voraussetzung für das Lesen und die eindeutige Identifikation<br />
der Datenelemente. Bei einer durchgängigen<br />
Interoperabilität ist es den Beteiligten möglich, ihre<br />
Prozesse kostengünstig zu betreiben. Die gemeinsame<br />
Basis dafür sind die Standards IEC 15434 Syntax<br />
for High Capacity Media, ISO/IEC 15459 Unique<br />
Identification sowie die <strong>System</strong>- und Datenidentifikatoren<br />
nach ISO/IEC 15418.<br />
Um Herstellern und Nutzern im pharmazeutischen<br />
Bereich eine noch höhere Interoperabilität zu<br />
bieten, wird in diesem Anhang ein Standard zur<br />
Interpretation der Daten, basierend auf XML<br />
beschrieben. Dies gilt sowohl für die Datenübertragung<br />
zum Drucker als auch für die<br />
Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser an die angeschlossenen<br />
<strong>System</strong>e.<br />
Der in diesem Anhang beschriebene XML-Standard<br />
bezieht sich ausschließlich auf die Dateninhalte und<br />
damit nicht auf die Layouteigenschaften des <strong>Code</strong>s, zu<br />
denen die Festlegungen der Klarschriftbedruckung und<br />
die der Symbologie (z.B. Data Matrix <strong>Code</strong>) gehören.<br />
Bei der Datenübertragung werden nach dem hier<br />
beschriebenen Standard die Daten unabhängig von<br />
den im <strong>Code</strong> verwendeten Datenbezeichnern einheitlich<br />
mit neutralen XML-Knoten bezeichnet. Es bilden<br />
sich folgende Ebenen in der Darstellung der Daten<br />
aus:<br />
Applikation: XML-Knoten<br />
Datenhülle: nach ISO/IEC 15434<br />
z.B. Format 06 oder<br />
<strong>System</strong>identifikator nach<br />
DIN 66403 z.B. „FNC1“<br />
Datenstruktur Data Identifier (DI) oder<br />
Application Identifier (AI)<br />
Symbologie z. B. Data Matrix <strong>Code</strong><br />
D.2 Data Format Identifier (DFI)<br />
Bei der Übertragung der Datenelemente im XML-<br />
Standard werden die Eigenschaften zur Darstellung<br />
der Daten im <strong>Code</strong> dem Data Format Identifier (DFI)<br />
zugeordnet und lediglich dieser übertragen.<br />
Der DFI sagt aus, welche Datenhülle nach ISO/IEC<br />
15434, welche Datenbezeichner (AI oder DI) und ob<br />
ein Makro nach ISO/IEC 16022 zu verwenden ist. Die<br />
Zuweisungen des DFI können aus Tabelle 1 entnommen<br />
werden.<br />
XML-<br />
Data<br />
Format<br />
Identifier<br />
(DFI)<br />
Format-ID<br />
nach ISO/IEC<br />
15434<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />
Data-Typ-<br />
Identifier<br />
nach ISO/ IEC<br />
16022<br />
Data<br />
Identifier/<br />
Application<br />
Identifier<br />
nach ISO/IEC<br />
15418<br />
<strong>IFA</strong> 06 Macro 06 DI-ASC<br />
GS1 ------ FNC1 AI-GS1<br />
Tabelle 1: Data Format Identifier (DFI)<br />
Der DFI kann die Werte „<strong>IFA</strong>“ oder „GS1“ annehmen<br />
und wird im dem gleichlautenden Attribut des übergeordneten<br />
XML-Knoten übertragen.<br />
D.3 XML-Knoten für Daten<br />
In unten stehender Tabelle sind die XML-Knoten für die<br />
Daten und deren Zuordnung zu den Data Identifier (DI)<br />
und Application Identifier (AI) aufgeführt:<br />
XML-<br />
Knoten DI<br />
(dfi=„<strong>IFA</strong>“)<br />
AI<br />
(dfi=„GS1“)<br />
Beschreibung<br />
9N ---- Produktnummer<br />
---- 01 Produktnummer<br />
1T 10<br />
Chargenbezeichnung<br />
D 17 Verfalldatum<br />
S 21 Seriennummer<br />
Tabelle 2: XML-Knoten für Daten<br />
Seite 19
Die vollständige Auflistung der derzeit definierten Knoten<br />
ist im Anhang A aufgeführt. Auf dieser technischen<br />
Ebene der Beschreibung gibt es zwischen NTIN<br />
und GTIN keine Unterscheidung. Deshalb wird der<br />
umfassende Begriff GTIN verwendet.<br />
Der XML-Knoten umhüllt die „Datenknoten“<br />
(siehe Anhang D.4 und Anhang D.5).<br />
Aus den XML-Daten und dem darin enthaltenen Wert<br />
des „DFI“ leiten die Drucker alle notwendigen Informationen<br />
zur Erzeugung des Data Matrix <strong>Code</strong>s ab.<br />
Das beinhaltet die Datenelemente, die Data Identifier<br />
respektive die Application Identifier, die Trennzeichen<br />
und den Header.<br />
D.4 Anwendung<br />
Sowohl bei der Datenübergabe an die Druckertreiber,<br />
als auch bei der Datenausgabe von den <strong>Code</strong>lesern<br />
kann die XML-Beschreibung angewendet werden<br />
(siehe schematische Darstellung):<br />
XML-Tag<br />
MH10.8.2-<br />
Daten-<br />
bezeichner<br />
<strong>Code</strong><br />
MES-<br />
<strong>System</strong><br />
Terminal<br />
Printer<br />
Driver<br />
MES-<br />
<strong>System</strong>Anwender- Terminal<br />
Reader<br />
Printer Reader<br />
Abbildung 7: Datenaustausch auf XML-Basis<br />
Die Treiber zur Interpretation der XML-Beschreibung<br />
können Bestandteil der übergeordneten <strong>System</strong>e (MES)<br />
oder der Drucker (Printer) und <strong>Code</strong>leser (Reader) sein.<br />
Die Verwendung der einheitlichen Beschreibung steigert<br />
die Interoperabilität und hilft Fehler zu vermeiden.<br />
Auch die Unsicherheit hinsichtlich nichtdruckbarer<br />
<strong>System</strong>ebene<br />
Applikationsebene<br />
Steuerzeichen in Übertragung und Interpretation ist<br />
bei der XML- Beschreibung eliminiert. Beim Lesen der<br />
<strong>Code</strong>s setzen die <strong>Code</strong>leser den Dateninhalt in die<br />
XML-Struktur und die entsprechenden Knoten um.<br />
Bei der Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser an die über-<br />
geordneten <strong>System</strong>e werden standardmäßig lediglich<br />
die Daten ohne den „DFI“ übertragen. Optional kann<br />
dieser zusätzlich mit ausgegeben werden und ist<br />
dann von Interesse, wenn im <strong>Code</strong> z.B. die korrekte<br />
Verwendung der Strukturen zu verifizieren ist.<br />
Allgemeine XML-Beschreibung bei der Datenübertragung<br />
zum Drucker und vom <strong>Code</strong>leser:<br />
<br />
value _ Daten _ 1<br />
value _ Daten _ 2.<br />
value _ Daten _ n<br />
<br />
Bei der Übertragung vom <strong>Code</strong>leser ist der Wert „dfi“<br />
optional.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 20
D.5 Beispiele<br />
An folgenden Beispielen soll unter Verwendung der vier Datenelemente Produktnummer, Chargenbezeichnung,<br />
Verfalldatum und Seriennummer die Anwendung gezeigt werden:<br />
Beispiel 1: Datenübertragung an Drucker – <strong>IFA</strong>-Format<br />
Produktnummer: <strong>PPN</strong> Datenbezeichner: DI Data Format Identifier: <strong>IFA</strong><br />
<strong>System</strong><br />
<strong>PPN</strong>: 111234567842<br />
Batch: 1A234B5<br />
Verfalldatum: 31.12.2015<br />
Serien-Nr.: 1234567890123456<br />
Codierung: „<strong>IFA</strong>“<br />
<br />
111234567842<br />
1A234B5<br />
151231<br />
1234567890123456<br />
<br />
Beispiel 2: Datenübertragung an Drucker – GS1-Format<br />
Drucker<br />
Produktnummer: GTIN Datenbezeichner: AI Data Format Identifier: GS1<br />
<strong>System</strong><br />
GTIN: 04150123456782<br />
Batch: 1A234B5<br />
Verfalldatum: 31.12.2015<br />
Serien-Nr.: 1234567890123456<br />
Codierung: „GS1“<br />
<br />
04150123456782<br />
1A234B5<br />
151231<br />
1234567890123456<br />
<br />
Drucker<br />
Beispiel 3: Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser – <strong>IFA</strong>-Format<br />
Produktnummer: <strong>PPN</strong> Datenbezeichner: DI Data Format Identifier: <strong>IFA</strong><br />
Data Carrier<br />
Mac069N111234567842Gs<br />
1T1A234B5Gs<br />
D151231Gs<br />
S1234567890123456<br />
<strong>Code</strong>leser<br />
<br />
111234567842<br />
1A234B5<br />
151231<br />
1234567890123456<br />
<br />
Beispiel 4: Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser – GS1-Format<br />
Produktnummer: GTIN Datenbezeichner: AI Data Format Identifier: GS1<br />
Data Carrier<br />
FNC104150123456782<br />
101A234B5FNC1<br />
1717231<br />
211234567890123456<br />
<strong>Code</strong>leser<br />
<br />
04150123456782<br />
1A234B5<br />
151231<br />
1234567890123456<br />
<br />
Data Carrier<br />
Mac069N111234567842Gs<br />
1T1A234B5Gs<br />
D151231Gs<br />
S1234567890123456<br />
Data Carrier<br />
FNC104150123456782<br />
101A234B5FNC1<br />
17151231<br />
211234567890123456<br />
<strong>System</strong><br />
<strong>PPN</strong>: 1101234567842<br />
Batch: 1A234B5<br />
Verfalldatum: 31.12.2015<br />
Serien-Nr.: 1234567890123456<br />
<strong>System</strong><br />
GTIN: 04150123456782<br />
Batch: 1A234B5<br />
Verfalldatum: 31.12.2015<br />
Serien-Nr.: 1234567890123456<br />
Rückfragen und Anregungen zu den in diesem Anhang beschriebenen Festlegungen sind willkommen und an die<br />
<strong>IFA</strong> GmbH zu richten.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 21
Anhang E<br />
Qualität und Kontrolle des<br />
<strong>Code</strong>inhalts (informativ)<br />
E.1 Data Matrix <strong>Code</strong> als Punktcodes<br />
In Zusammenhang mit der Mindestqualitätsanforderung<br />
an die Druckqualität ist festzuhalten, dass <strong>Code</strong>s<br />
wie bspw. Punktcodes, deren Druckqualität nach der<br />
Prüfmethodik gemäß ISO/IEC TR 29158 (Direct Part<br />
Marking – Direkte Teilekennzeichnung) gemessen<br />
werden muss, für diese Anwendung nicht zum Einsatz<br />
kommen sollen. Punktcodes sind in der Data Matrix<br />
Norm ISO/IEC 16022 nicht spezifiziert. Standardlesegeräte<br />
können Punktcodes daher oft nicht lesen<br />
bzw. die Leseraten sind inakzeptabel niedrig. Davon<br />
ausgenommen sind lediglich Punktcodes, deren<br />
einzelne Punkte (Datenzellen) so breit und einander<br />
berührend ausgeführt sind, dass diese gemäß ISO/IEC<br />
15415 prüfbar und damit allgemein lesbar sind.<br />
E.2 Qualifizierungs- und<br />
Validierungsmaßnahmen<br />
Die Ausrüstung zum Aufbringen und Kontrollieren von<br />
<strong>Code</strong>s unterliegt den allgemeinen Vorgaben zur Qualifizierung.<br />
Ebenso gelten für die damit in Zusammenhang<br />
stehenden Prozesse die allgemeinen Anforderungen<br />
bzgl. einer Validierung.<br />
Definition und Umfang der Qualifizierungsmaßnahmen<br />
und der Prozessvalidierungen sind nicht Bestandteil<br />
dieser <strong>Spezifikation</strong>.<br />
E.3 Kontrolle der <strong>Code</strong>s auf<br />
Dateninhalt und Druckqualität<br />
E.3.1 Allgemeine Festlegungen<br />
Ort und ggf. Umfang der Prüfungen zur Lesekontrolle<br />
und der Druckqualität unterscheiden sich, je nachdem,<br />
ob die Packmittel vorbedruckt eingesetzt oder inline<br />
bedruckt werden.<br />
Die Eingangskontrolle für Packmittel muss vorgedruckte<br />
<strong>Code</strong>s oder Platzhalter für die Anbringung von <strong>Code</strong>s<br />
bei Umfang und Art der Prüfungen in angemessener<br />
Weise berücksichtigen.<br />
Die erreichbare Druckqualität der <strong>Code</strong>s hängt vom<br />
verwendeten Substrat, dem Material und Druckverfahren<br />
ab und kann daher deutlich besser als die Mindestanforderung<br />
sein.<br />
E.3.2 Lesekontrolle<br />
Im Rahmen der Lesekontrolle wird mittels eingebauter<br />
Erfassungssysteme geprüft, ob<br />
• der <strong>Code</strong> vorhanden ist,<br />
• die korrekte Symbologie verwendet wurde und<br />
• der Inhalt mit den Vorgaben übereinstimmt.<br />
Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass nicht<br />
vorhandene oder nicht lesbare oder von den Vorgaben<br />
abweichende <strong>Code</strong>s ausgeschleust werden.<br />
E.3.3 Druckqualitätskontrolle<br />
Die Druckqualität kann grundsätzlich mit zwei unterschiedlichen<br />
Verfahren geprüft werden:<br />
1. Mittels Messungen gemäß ISO/IEC 15415 (Näheres<br />
siehe Anhang E.6.1)<br />
2. Mittels eingebauter Erfassungssysteme (Näheres<br />
siehe Anhang E.6.2) mit der Fähigkeit zur Analyse<br />
und Bestimmung der Druckqualität in Anlehnung an<br />
ISO/IEC 15415<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 22
E.4 Varianten der Bedruckung<br />
E.4.1 Packmittel mit<br />
vorgedruckten <strong>Code</strong>s<br />
E.4.1.1 Prüfung der Lesbarkeit durch den<br />
Verpacker – Sicherstellung der Druckqualität<br />
durch den Lieferanten<br />
Die <strong>Code</strong>s werden durch den Packmittellieferanten<br />
aufgebracht. Er hat sicherzustellen, dass die <strong>Code</strong>s<br />
grundsätzlich vorhanden und lesbar sind, die festgelegte<br />
Symbologie aufweisen, den definierten Inhalt haben<br />
und die Seriennummern erfasst sind. Weiterhin stellt er<br />
durch geeignete Maßnahmen sicher, dass der <strong>Code</strong>inhalt<br />
und die Druckqualität der aufgebrachten <strong>Code</strong>s<br />
den definierten (Mindest)anforderungen genügen.<br />
Das wird vom Arzneimittel-Hersteller im Rahmen der<br />
Lieferantenqualifizierung geprüft.<br />
Die aufgebrachten <strong>Code</strong>s werden im Rahmen des<br />
Verpackungsprozesses des Arzneimittels ggf. erneut<br />
eingelesen. In diesen Fällen wird am Ort der Nutzung<br />
eine vollständige Überprüfung des Vorhandenseins<br />
und der Lesbarkeit aller <strong>Code</strong>s, der Verwendung der<br />
korrekten Symbologie und deren korrekte Inhalte<br />
sichergestellt. Zusätzlich werden die tatsächlich<br />
genutzten Seriennummern erfasst.<br />
E.4.2 Inline Bedruckung von Pack-<br />
mitteln ohne vorgedruckte <strong>Code</strong>s<br />
E.4.2.1 Kontinuierliche Lesekontrolle und<br />
Stichprobenkontrolle der Druckqualität<br />
Die <strong>Code</strong>s werden inline während des Verpackungsprozesses<br />
des Arzneimittels auf die Packmittel<br />
aufgebracht. Wie im Anhang E.3.2 beschrieben, wird<br />
durch die Erfassungssysteme jeder <strong>Code</strong> einer Lesekontrolle<br />
unterzogen. Auch die Seriennummer jedes<br />
<strong>Code</strong>s wird erfasst. Bei Bedarf wird gemäß ISO/IEC<br />
15415 zusätzlich die Qualität der aufgebrachten <strong>Code</strong>s<br />
offline mit einem entsprechendem Prüfgerät kontrolliert<br />
(Näheres siehe Anhang E.6.1).<br />
E.4.2.2 Kontinuierliche Lese- und Stichprobenkontrolle<br />
der Druckqualität<br />
Die <strong>Code</strong>s werden inline während des Verpackungsprozesses<br />
des Arzneimittels auf die Packmittel aufgebracht.<br />
Wie im Anhang E.3.2 beschrieben, wird durch<br />
die Erfassungssysteme jeder einzelne <strong>Code</strong> einer<br />
Lesekontrolle unterzogen. Auch die Seriennummer<br />
jedes <strong>Code</strong>s wird erfasst. Abweichend von Anhang<br />
E.4.2.1 wird mittels der Erfassungssysteme inline die<br />
Druckqualität in Anlehnung an ISO/IEC 15415 (Näheres<br />
siehe Anhang E.6.2) jedes <strong>Code</strong>s kontrolliert.<br />
E.5 Statistik in der Qualitätskontrolle<br />
Die Prüfung der Druckqualität nach ISO/IEC 15415<br />
muss immer im Kontext einer normierten Stichprobenprozedur<br />
nach allgemein anerkannten Regeln der<br />
Statistik durchgeführt werden. Kurz zusammengefasst<br />
bedeutet das: Wenn eine Unterschreitung der Mindestdruckqualität<br />
festgestellt wird, dann sind innerhalb der<br />
Fertigungscharge weitere Produkte zu prüfen. Wenn die<br />
Fehler, bei Anwendung der normierten Stichprobenprozedur<br />
das akzeptable Maß überschreiten, sind<br />
geeignete Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten.<br />
Es sind die Stichprobenprozeduren gemäß ISO 2859<br />
und ISO 3951 anzuwenden. In diesen Normen wird eine<br />
definierte statistische Methode beschrieben, die zu der<br />
Beurteilung führt, ob ein Fertigungslos akzeptabel ist<br />
oder nicht. Die Stichprobenmethodik soll den Aufwand<br />
für die Qualitätskontrolle intelligent steuern.<br />
Grundlegend ist dabei, dass im Rahmen dieser statistischen<br />
Methode immer eine bestimmte Fehlerquote<br />
zulässig ist.<br />
Die inline Kontrollen der Druckqualität in Anlehnung an<br />
ISO/IEC 15415 (siehe Anhang E.3.3) werden im Kontext<br />
der Stichprobenprozedur als sehr häufige Stichprobennahmen<br />
betrachtet. Die statistische Methode zur<br />
intelligenten Steuerung der Qualitätskontrolle kann<br />
damit auch für die inline Kontrolle eingesetzt werden.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 23
E.6 Prüfgeräte<br />
E.6.1 Prüfung gemäß ISO/IEC 15415<br />
Die Druckqualität gemäß ISO/IEC 15415 wird mit<br />
entsprechend geeigneten Prüfgeräten (sog. Verifier)<br />
kontrolliert. Die Prüfgeräte müssen die Anforderungen<br />
der internationalen Norm ISO/IEC 15426-2 erfüllen. Die<br />
wichtigsten Anforderungen an ein Messgerät sind:<br />
• Die Kalibrierung muss auf Messstandards rückführbar<br />
sein (PTB, N.I.S.T).<br />
• Die Messung muss unter definierten Bedingungen<br />
bezüglich Beleuchtung, Abstand und Kamerawinkel<br />
erfolgen (Vorlage : ISO/IEC 15415 Referenzaufbau).<br />
• Umgebungslicht darf die Messung nur innerhalb<br />
der erlaubten Toleranzen gemäß ISO/IEC 15426-2<br />
verändern.<br />
• Es muss eine regelmäßige Kalibrierung der Geräte<br />
beim Anwender erfolgen.<br />
• Es muss eine regelmäßige Kontrolle der Messgenauigkeit<br />
beim Anwender erfolgen.<br />
• Die Vorgaben der Symbologienorm bezüglich der<br />
Referenzdekodierung muss eingehalten werden,<br />
damit unterschiedliche Dekodieralgorithmen nicht<br />
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.<br />
Die Messung erfolgt offline. Aufgrund des Messaufwandes<br />
sind stichprobenhafte Prüfungen üblich.<br />
Eine vollständige, 100%ige Kontrolle ist mit dieser<br />
Messmethodik nicht realistisch darstellbar.<br />
Lesegeräte wie bspw. handelsübliche Barcodescan-<br />
ner dürfen den für Prüfgeräte geltenden Restriktionen<br />
nicht unterworfen werden, weil Lesegeräte unter möglichst<br />
beliebigen Bedingungen bezüglich Leseabstand,<br />
Lesewinkel, Beleuchtungswinkel und Umgebungslichteinflüssen<br />
die <strong>Code</strong>s erfassen müssen. Die definierte<br />
Mindestdruckqualität unterstützt dies.<br />
Es verbleibt ein geringes Restrisiko, dass - bedingt durch<br />
die Messung der Druckqualität als Konventionsmethode -<br />
wiederholte Messungen des gleichen <strong>Code</strong>s zu geringfügig<br />
abweichenden Messergebnissen führen. Dies gilt<br />
auch, wenn dieselben <strong>Code</strong>s mit unterschiedlichen<br />
Verifiern geprüft werden. Wenn auch nach der aktuell<br />
gültigen technischen Norm gemessen wird, ist, bedingt<br />
durch den Messaufwand und den Einsatz offline, nur eine<br />
stichprobenhafte Prüfung der Druckqualität möglich.<br />
E.6.2 Prüfung angelehnt an<br />
ISO/IEC 15415<br />
Viele Erfassungssysteme für die Lesekontrolle (siehe<br />
Anhang E.3.2) haben die Fähigkeit, die Druckqualität<br />
kontinuierlich inline zu analysieren und zu prüfen. Es<br />
handelt sich um eine Prüfung, die sich an die ISO/<br />
IEC 15415 Methode anlehnt und die häufig, alternativ<br />
zur offline Prüfung gemäß ISO/IEC 15415 (siehe<br />
Anhang E.3.3) eingesetzt wird. Diese <strong>System</strong>e nutzen die<br />
gleichen für die Prüfung der Druckqualität in der ISO/IEC<br />
15415 definierten Kriterien. Allerdings sind die dort festgelegten<br />
Randbedingungen wie bspw. die Wellenlänge<br />
und Einstrahlwinkel der verwendeten Lichtquelle oder<br />
Mehrfachprüfung des <strong>Code</strong>s aus unterschiedlichen<br />
Winkeln bauartbedingt, u. a. durch die Integration in die<br />
Verpackungslinie, nicht zu gewährleisten.<br />
Die, in Anlehnung an die ISO/IEC 15415, erhaltenen<br />
Ergebnisse sind im Rahmen der Qualifizierung der Druckund<br />
Erfassungssysteme mit den Messergebnissen<br />
eines sog. Verifiers (siehe Anhang E.6.1) zu korrelieren.<br />
Erfassungssysteme mit einer Prüfung, in Anlehnung an<br />
die ISO/IEC 15415 Methode, stellen eine vollständige,<br />
100%ige inline Kontrolle (Lesekontrolle und Druckqualitätskontrolle)<br />
jedes einzelnen <strong>Code</strong>s sicher.<br />
Es verbleibt ein geringes Restrisiko, dass das Erfassungs-<br />
system primär als Lesegerät konstruiert ist, das auf best-<br />
mögliche Leseergebnisse optimiert ist z.B. adaptive<br />
Beleuchtungen, Autofocus- und Autozoom-Objektive<br />
oder für die Lesung optimierte Dekodieralgorithmen. In<br />
diesem Fall kann das Erfassungssystem, trotz Abgleich<br />
mit dem Messergebnissen nach ISO/IEC 15415, fallweise<br />
abweichende Qualitätsergebnisse liefern.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 24
E.7 Farben und Materialien<br />
Erlaubte Farben und Trägermaterialien:<br />
• Das Trägermaterial muss eine gleichmäßig diffus<br />
reflektierende Oberfläche haben. Oberflächen, die<br />
stark spiegelnd sind (metallisch, Metalliceffekte),<br />
sind ungeeignet. Raue oder geprägte Oberflächen<br />
sind ebenfalls schlecht geeignet. Die folgenden<br />
farblichen Vorgaben ergeben sich aus der Annahme,<br />
dass handelsübliche Lesegeräte mit Rotlicht<br />
beleuchten.<br />
• Trägermaterialfarbe: Weiß, rot, gelb oder orange<br />
(hell unter Rotlicht).<br />
• Modul- bzw. <strong>Code</strong>farbe: Schwarz, blau oder grün<br />
(dunkel unter Rotlicht).<br />
• Negative Data Matrix Symbole, bei denen die<br />
Trägermaterialfarbe und die Modul bzw. <strong>Code</strong>farbe<br />
vertauscht werden, sind erlaubt.<br />
• Bei den Beschriftungsverfahren im Tintenstrahldruck<br />
ist ggf. auf Faltschachteln eine entsprechende<br />
Aussparung der Oberflächenbeschichtung erforderlich,<br />
damit die Beschriftung haftet und trocknet.<br />
Die Mindestqualitätsanforderung (siehe Kapitel 5.8) legt<br />
u.a. den Mindestkontrast fest und damit auch die Spielräume<br />
für farbige <strong>Code</strong>s.<br />
E.8 Qualitätskriterien nach<br />
ISO/IEC 15415 mit Bezug auf<br />
ISO/IEC 16022<br />
Nachfolgend sind die wichtigsten in der Norm<br />
enthaltenen Prüfparameter aufgelistet und kurz<br />
beschrieben:<br />
Dekodierung – Referenzdekodierung und <strong>Code</strong>-<br />
aufbau (Fehler siehe Anhang F.1 und Anhang F.1.9 und<br />
Anhang F.2).<br />
Symbolkontrast – Kontrast zwischen der hellsten und<br />
dunkelsten Reflexion im gesamten Symbol (Fehler siehe<br />
Anhang F.1.1).<br />
Modulation – Gleichmäßigkeit der Reflexionen der<br />
hellen Module jeweils zueinander sowie die Gleichmäßigkeit<br />
der Reflexionen der dunklen Module jeweils<br />
zueinander.<br />
Reflexionsbereich – wie Modulation, nur die durch die<br />
Fehlerkorrektur zu korrigierenden <strong>Code</strong>worte werden<br />
hier als Grad 0 (= durchgefallen) in die Entscheidungsmatrix<br />
einbezogen.<br />
Kontrastgleichmäßigkeit – Es werden MOD Werte für<br />
alle <strong>Code</strong>wörter bestimmt. Die MOD Werte werden für<br />
die Bestimmung der Modulation und des Reflexionsbereiches<br />
verwendet. Die Kontrastgleichmäßigkeit ist<br />
der schlechteste MOD Wert (informativ).<br />
Fehler zu Modulation, Reflexionsbereich und Kontrast-<br />
gleichmäßigkeit siehe unter:<br />
Anhang F.3.2.3 und<br />
Anhang F.3.2.4 und<br />
Anhang F.3.2.9 und<br />
Anhang F.3.3.2 und<br />
Anhang F.4.1 und<br />
Anhang F.4.5.<br />
Unused Error Correction (UEC) – Nicht benutzte<br />
Fehlerkorrektur d.h. je größer der Wert ist umso weniger<br />
müssen Fehler korrigiert werden (Fehler siehe Anhang<br />
F.3.1.2).<br />
Axial Non-Uniformity (AN) – wie stark ist das Symbol<br />
in x oder y Achse gestreckt oder gestaucht (Fehler siehe<br />
Anhang F.3.1.3).<br />
Grid Non-Uniformity (GN) – wie stark ist das idealer<br />
weise gleichmäßige, schachbrettartige Modulgitter in<br />
sich verzerrt ohne nach außen als AN in Erscheinung<br />
zu treten (Fehler siehe Anhang F.3.1.4).<br />
Fixed Pattern Damage (FPD) – Alle Teile des <strong>Code</strong>s,<br />
die keine Daten und keine Fehlerkorrekturwerte<br />
enthalten, werden auf Beschädigung überprüft. Dies ist<br />
das L Muster zur <strong>Code</strong>orientierungsbestimmung, das<br />
Taktmuster zur Gitterrekonstruktion und die Ruhezone.<br />
Kontrastungleichmäßigkeiten, die im Datenbereich als<br />
Modulation bewertet werden, werden hier für die festen<br />
Muster mit einbezogen (Fehler siehe Anhang F.3.2.1).<br />
Druckzuwachs – informativer Parameter der angibt,<br />
ob ein Symbol überdruckt oder unterdruckt ist (Fehler<br />
siehe Anhang F.3.2.2 und Anhang F.3.2.3).<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 25
Modulgröße – Die Größe einer Matrixzelle des<br />
Gesamtcodes wird als Modulgröße bezeichnet. Von<br />
der Modulgröße hängen die Lesegeräteeigenschaften,<br />
bezüglich der Scannertiefenschärfe, der Scannerauflösung<br />
und des Mindestleseabstandes ab (siehe Anhang<br />
I.1).<br />
Matrixgröße – Der gesamte <strong>Code</strong> baut sich aus<br />
einzelne Matrixzellen (= Module) einer bestimmten,<br />
identischen Modulgröße auf. Die Norm ISO/IEC 16022<br />
definiert als kleinste Matrixgröße 10x10 Module und als<br />
maximale Matrixgröße 144x144. In praktischen Anwendungen<br />
wird der Bereich der erlaubten Matrixgrößen<br />
eingeschränkt, um das Verhältnis der Kameraauflösung<br />
zur Größe der Matrix zu begrenzen und um eine<br />
ausreichend große Anzahl von Kamerapixeln pro Modul<br />
zur Verfügung zu haben. Dies ist für die Lesesicherheit<br />
erforderlich (siehe Anhang I.2).<br />
Anhang F<br />
Typische Fehler (informativ)<br />
In diesem Anhang werden typische Fehler, unterteilt<br />
nach Fehlern in der Datenstruktur, dem Dateninhalt und<br />
in dem Druck beschrieben.<br />
Diese Auflistung soll helfen, die Fehler bei der Generie-<br />
rung des <strong>Code</strong>s zu vermeiden und den Programmierern<br />
von Verarbeitungssoftware Anhaltspunkte geben, mit<br />
welchen Fehlern zu rechnen ist, um daraus entsprechende<br />
Fehlerreaktionen zu implementieren.<br />
F.1 Fehler in den Datenstrukturen<br />
F.1.1 FNC1 als Startsequenz<br />
anstelle von Macro 06<br />
Erklärung: Die bei der <strong>PPN</strong> verwendete Datenstruktur<br />
verwendet als Datenidentifikator keine GS1 „Application<br />
Identifier“ (AI), sondern „Data Identifier“ (DI). In diesem<br />
Fall darf das FNC1 Zeichen nicht verwendet werden,<br />
weil es kennzeichnet, dass eine GS1 Struktur folgt.<br />
Stattdessen ist das Macro 06 <strong>Code</strong>wort die korrekte<br />
Wahl anstelle von dem FNC1 zur Kennzeichnung, dass<br />
die DI Datenstruktur verwendet wird.<br />
F.1.2 Macro 05 anstelle von<br />
Macro06 verwendet<br />
Erklärung: Das Macro 05 ist ebenfalls eine Kennzeichnung<br />
der GS1 AI Struktur und darf nicht anstelle von<br />
Macro 06 eingesetzt werden.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 26
F.1.3 FNC1 als Feldtrenner anstelle<br />
von G S (ASCII 29)<br />
Erklärung : In der <strong>PPN</strong> werden mehrere Datenfelder<br />
nacheinander verwendet. Um zu erkennen, wann ein<br />
Datenfeld endet und das nächste Element beginnt ist<br />
ein Feldtrennzeichen erforderlich. Im Falle von GS1<br />
Datenstrukturen wird immer ein FNC1 Zeichen kodiert,<br />
das der Lesegerätedecoder durch ein G<br />
S<br />
Zeichen<br />
ersetzen muss. Im Falle der <strong>PPN</strong> muss das G<br />
S<br />
Zeichen<br />
immer direkt kodiert werden, und eine Übersetzung ist<br />
damit nicht mehr erforderlich. Die Übersetzung der<br />
FNC1 Zeichen als Feldtrenner darf nur vorgenommen<br />
werden, wenn der <strong>Code</strong> mit dem FNC1 Zeichen an der<br />
ersten Position als <strong>Code</strong> mit GS1 Datenstruktur identifiziert<br />
wurde.<br />
F.1.4 Macro 06 fehlt<br />
Erklärung: Die <strong>PPN</strong> verwendet das „Message envelope“<br />
gemäß ISO/IEC 15434. Das Macro 06 muss<br />
verpflichtend als erstes Zeichen kodiert werden, um die<br />
Bildungsvorschrift der <strong>PPN</strong> korrekt einzuhalten und um<br />
den nachgeschalteten Programmen eine zusätzliche<br />
Plausibilitätskontrolle und eindeutige Unterscheidungsmöglichkeit<br />
zu anderen ISO konformen Datenstrukturen<br />
zu ermöglichen.<br />
F.1.5 Data Identifier (DI) und<br />
Application Identifier (AI)<br />
gemischt verwendet<br />
Falscher Datenidentifikator für Charge AI „10“<br />
anstelle von DI „1T“<br />
Datum mit AI „17“ anstelle von DI „D“ kodiert<br />
Die Seriennummer ist mit AI „21“ anstelle von DI<br />
„S“ kodiert<br />
Es wird die AI „01“ (für GS1 GTIN) anstelle von DI<br />
„9N“ für die <strong>PPN</strong> verwendet<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 27
F.1.6 Falsche Data Identifier (DI)<br />
verwendet<br />
Es wird für das Verfalldatum DI „14D“ verwendet. Im<br />
Kontext der <strong>PPN</strong> soll immer DI „D“ für das Verfalldatum<br />
verwendet wird. Es handelt sich hier um keinen harten<br />
Fehler, sondern um einen Fall, der in dieser <strong>Spezifikation</strong><br />
ausgeschlossen wird, um die Variantenvielfalt zu<br />
begrenzen und um bei parallelen Einsatz der französischen<br />
C.I.P. Kodierung und der <strong>PPN</strong> Kodierung das<br />
gleiche Datumsformat YYMMDD einsetzten zu können<br />
(14D hat YYYYMMDD).<br />
Es wird für die <strong>PPN</strong> der DI „25P“ verwendet zusammen<br />
mit dem IAC <strong>Code</strong> PP, der der <strong>IFA</strong> zugeordnet ist. Diese<br />
Variante ist im allgemeinen ISO Kontext nicht erlaubt. Im<br />
Rahmen der <strong>PPN</strong> Anwendung soll diese Variante nicht<br />
verwendet werden weil „25P“ nach dem IAC <strong>Code</strong> PP<br />
eine <strong>Code</strong> für die Firmenidentifizierung (Company Identification<br />
<strong>Code</strong> - CIN) verlangt und danach eine<br />
Artikelnummer.<br />
F.1.7 Feldtrenner G S bei Datenfeldern<br />
mit fixer Länge fehlt<br />
Die der <strong>PPN</strong> zugrundeliegende DI Definition gemäß<br />
ISO/IEC 15418 verlangt nach jedem Datenfeld einen<br />
Feldtrenner (G<br />
S<br />
). Die GS1 Struktur verwendet eine<br />
Ausnahmebehandlung bei einigen Datenfeldern mit<br />
fester Länge. Diese Ausnahme erlaubt es keinen Feldtrenner<br />
bei bestimmten Datenfeldern zu benutzen.<br />
Diese Variante ist hier mit der <strong>PPN</strong> umgesetzt.<br />
Die Felder mit fester Länge sind nicht mit dem<br />
Feldtrenner G S abgeschlossen.<br />
F.1.8 Falsche Fehlerkorrektur<br />
In diesem Beispiel ist die <strong>PPN</strong> Struktur korrekt. Die<br />
<strong>Code</strong>variante ist falsch. Es muss der Data Matrix <strong>Code</strong><br />
mit der Reed Solomon Fehlerkorrektur, die als ECC200<br />
bezeichnet wird, benutzt werden. Hier kommt der Data<br />
Matrix <strong>Code</strong> mit der Fehlerkorrektur ECC040 zum<br />
Einsatz (CRC Fehlerkorrektur). Die Data Matrix Norm<br />
ISO/IEC 16022 rät vom Einsatz dieser Variante ab<br />
(Grund veraltet und Fehlerkorrektur weniger Leistungsfähig).<br />
Diese <strong>PPN</strong> <strong>Spezifikation</strong> erlaubt nur die ECC200<br />
Version.<br />
F.1.9 <strong>Code</strong> mit falschen Füllzeichen<br />
(pad character)<br />
Die Änderung der Matrixgröße geht immer mit einem<br />
Sprung in der Datenkapazität von z.B. 52 auf 64 alphanumerische<br />
Zeichen einher. Wenn z.B. 56 Zeichen<br />
benötigt werden, dann muss die Matrixgröße mit der<br />
Kapazität von 64 Zeichen benutzt werden. Die freie<br />
Kapazität des <strong>Code</strong>s wird mit den Füllzeichen aufgefüllt.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 28
F.2 Fehler in den Dateninhalten<br />
F.2.1 Prüfziffer <strong>PPN</strong> falsch<br />
Die <strong>PPN</strong> Bildungsvorschrift verlangt eine Prüfziffer nach<br />
Modulo 97 in dem Datenfeld „9N“ als Abschluss (siehe<br />
Anhang B). In diesem Beispiel ist eine falsche Prüfziffer<br />
kodiert worden.<br />
F.2.2 Prüfziffer <strong>PPN</strong> fehlt<br />
Erklärung: Die Prüfziffer, die über den PRA-<strong>Code</strong> (11<br />
bei der <strong>PPN</strong>) und der folgenden PZN-8 gebildet wird<br />
fehlt. Da das Datenfeld durch den Trenner G<br />
S<br />
abgeschlossen<br />
ist und die Prüfziffer der PZN-8 korrekt ist, ist<br />
dieser Fehler leicht zu erkennen.<br />
F.2.3 PZN Prüfziffer falsch<br />
Die <strong>PPN</strong> bettet eine PZN-8 Nummer mit dem Identifier<br />
„9N“ in eine international eindeutige Datenstruktur ein.<br />
In diesem Fall wurde eine PZN mit einer falsch berechneten<br />
Prüfziffer eingesetzt und dann eine <strong>PPN</strong> Prüfziffer<br />
berechnet, die den Fehler mit einbezieht und damit<br />
richtig erscheint.<br />
F.2.4 PZN Prüfziffer fehlt<br />
Die Prüfziffer des PZN <strong>Code</strong>s fehlt und die darauf<br />
folgende <strong>PPN</strong> Prüfziffer wurde über eine Stelle zu wenig<br />
berechnet.<br />
F.2.5 PRA-<strong>Code</strong> falsch /<br />
nicht plausibel<br />
Das <strong>System</strong> der <strong>PPN</strong> erlaubt es, dieses <strong>System</strong> mit<br />
einer Vielzahl von Anwendungen zu benutzen. Die <strong>PPN</strong>,<br />
die die PZN-8 Nummer einbettet wird immer mit dem<br />
PRA-<strong>Code</strong> 11 nach dem DI „9N“ gekennzeichnet.<br />
Andere PRA-<strong>Code</strong>s sind möglich dürfen aber nie eine<br />
PZN-8 Nummer kodieren.<br />
F.2.6 PRA-<strong>Code</strong> fehlt<br />
In diesem Beispiel ist der PRA-<strong>Code</strong> 11 nicht vorhanden.<br />
Nach „9N“ kommt direkt die PZN-8 Codierung.<br />
Da davon ausgegangen wird, dass der Fehler unbeabsichtigt<br />
gemacht wurde, stimmt die <strong>PPN</strong> Prüfziffer<br />
bezogen auf den vorhandenen Dateninhalt.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 29
F.2.7 Datum falsch<br />
In diesem Beispiel liegt beim Datum der Wert für den<br />
Monat nicht im Bereich von 1 bis 12.<br />
F.2.8 PZN 7 verwendet<br />
In der <strong>PPN</strong> muss immer eine PZN 8 verwendet werden.<br />
Dieses Beispiel benutzt eine alte PZN 7 Nummer. Um<br />
aus einer PZN-7 eine PZN-8 zu machen, wird dem<br />
<strong>Code</strong> eine 0 (Null) vorangestellt.<br />
F.2.9 PZN-8 aus PZN-7 falsch erzeugt<br />
In diesem Beispiel wurde die 0, die die PZN-7 auf eine<br />
PZN-8 auffüllt, hinten angehängt und nicht als erste<br />
Ziffer vorangestellt.<br />
F.3 Fehler im Druck<br />
Die in diesem Kapitel gezeigten <strong>Code</strong>s dienen zur<br />
Illustration der Fehler, die bei der Bedruckung entstehen<br />
können. Die <strong>Code</strong>inhalte sind willkürlich gewählt.<br />
F.3.1 Allgemeine Druckfehler<br />
F.3.1.1 Unzureichender Symbolkontrast<br />
a) Symbolkontrast gut<br />
b) Symbolkontrast schlecht weil der Hintergrund<br />
nicht weiß ist<br />
c) Symbolkontrast schlecht weil die Beschriftung<br />
grau anstelle von schwarz ist<br />
F.3.1.2 Zu hell gedruckte Module – Niedrige<br />
UEC<br />
Die roten Punkte erscheinen unter Rotlicht weiß. Es sind<br />
aber Teile der Matrix die schwarz sein sollten. Die Fehler<br />
werden durch die Unbenutzte Fehlerkorrektur bewertet,<br />
da die Fehlerkorrektur die korrekte Dekodierung trotz<br />
der Fehler erlaubt.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 30
F.3.1.3 Axial Nonuniformity (AN)<br />
a) Symbol in Y-Richtung Axial verzerrt<br />
b) Symbol in X-Richtung Axial verzerrt<br />
F.3.1.4 Grid Nonuniformity (GN)<br />
Zwei Beispiele mit einem verzerrten Gitter ohne die<br />
äußere quadratische Form des Symbols zu ändern<br />
F.3.2 Druckverfahren Bubble-Jet<br />
Ein Heizelement in der Düse erzeugt eine Dampfblase,<br />
die den Tintentropfen herausschießt<br />
F.3.2.1 Düsenausfälle im Inkjetdruck<br />
Einzelne Düsen des Druckers sind verstopft und führen<br />
zu Linien im <strong>Code</strong>. Der Druckkopf muss ersetzt oder<br />
gereinigt werden. Die Reinigung sollte nach den Herstellervorgaben<br />
vorgenommen werden.<br />
F.3.2.2 <strong>Code</strong> zu fett gedruckt<br />
Durch zu viel Tinte, zu starkes Saugverhalten des Materials<br />
oder durch eine falsche Druckeinstellung können<br />
die <strong>Code</strong>s zu fett gedruckt werden. Abhilfe schafft z.B.<br />
eine Pixelreduktion.<br />
F.3.2.3 <strong>Code</strong> zu dünn gedruckt<br />
Die Druckereinstellung ist falsch.<br />
F.3.2.4 Unregelmäßiges Druckbild<br />
Das unregelmäßige Druckbild kann mehrere Ursachen<br />
haben. Die Düsenplatte kann verschmutzt sein. Der<br />
Abstand des Druckkopfes vom zu beschriftenden<br />
Material kann zu groß sein. Der Druckkopf kann eine<br />
statische Aufladung haben, die einen Teil der Tintentropfen<br />
wieder zum Kopf zurückzieht.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 31
F.3.2.5 Schatten im Druckbild<br />
Die Schattenbilddung im Druckbild wird durch eine<br />
falsche Geschwindigkeitseinstellung hervorgerufen. Der<br />
Druckkopf hat mehrere Düsenreihen die mit dem rich-<br />
tigen Zeitverhalten die Tintentropfen abgeben müssen.<br />
Wenn die Tintentropfen zum falschen Zeitpunkt kommen,<br />
führt dies zu den Schattenbildungen die hier links<br />
neben den Matrixelementen zu sehen sind.<br />
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass der Druckkopf<br />
verschmutzt ist, statisch aufgeladen ist und dass der<br />
Abstand zu groß ist.<br />
Das folgende Beispiel zeigt als ausgeprägtes Merkmal<br />
die Schattenbildung durch die falsche Geschwindigkeitseinstellung.<br />
F.3.2.6 Falsche Tinte<br />
Durch eine falsche Tintenauswahl wird ein schlechtes<br />
Anschreibverhalten verursacht. Dies ist daran zu erkennen,<br />
dass bei jedem Druckstart die vertikalen Linien auf<br />
der linken Seite unregelmäßig und ausgefranst<br />
erscheinen.<br />
F.3.2.7 Druck ohne Weggeber (Produktgeschwindigkeit<br />
beim Druck unbekannt<br />
und variabel)<br />
Der <strong>Code</strong> ist verzerrt. Es können Axiale Verzerrungen<br />
auftreten (Symbol erscheint nicht mehr quadratisch).<br />
Bei Schlupf oder Betrieb ohne Drehgeber können die<br />
einzelnen Matrixspalten bzw. Zeilen (je nach Druckrichtung)<br />
unterschiedlich breit erscheinen. Dies hat eine<br />
Gitterverzerrung zur Folge.<br />
F.3.2.8 Druck mit Tinte für saugfähige Materialien<br />
auf lackierter Faltschachteloberfläche<br />
(oder Metall oder Kunststoff)<br />
In diesem Fall kann die Tinte nicht schnell genug trocknen<br />
und verwischt. Erschwerend kommt in diesem Fall<br />
dazu dass das Teil zum Bedrucken gewölbt ist.<br />
F.3.2.9 Druck auf einer sehr stark saugenden<br />
Oberfläche<br />
Die Tinte verläuft sehr stark im Material (Löschpapiereffekt),<br />
Dadurch So werden die Druckelemente viel<br />
dicker als das normalerweise zu erwarten wäre. Abhilfe<br />
kann man durch eine Pixelreduktion und ggf. durch eine<br />
schneller trocknende Tinte schaffen.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 32
F.3.3 Druckverfahren<br />
Continuous Ink-Jet (CIJ)<br />
(ein kontinuierlicher Strom aus Tintentropfen wird elektrostatisch<br />
abgelenkt)<br />
F.3.3.1 Druck als Dot <strong>Code</strong><br />
In diesem Fall sind die einzelnen Punkte zusammengeschoben.<br />
Damit wird ein Druckbild erreicht, dass<br />
auch als normaler gedruckter <strong>Code</strong> und nicht als DPM<br />
<strong>Code</strong> benutzt werden kann.<br />
F.3.3.2 <strong>Code</strong> verzerrt<br />
Bei diesem <strong>Code</strong> sind die Punkte der Matrix nicht korrekt<br />
positioniert. Die Druckkopf hat einen zu großen<br />
Abstand zum Druckmuster und / oder die elektrostatische<br />
Ablenkung der Tintentropfen in die richtige Position<br />
ist unzureichend.<br />
Wenn diese Fehler korrigiert werden und der <strong>Code</strong> nicht<br />
mehr verzerrt ist, dann bleibt der <strong>Code</strong> ein DPM <strong>Code</strong>,<br />
weil die Punkte in der Matrix einzeln stehen. Wenn solche<br />
Drucker eingesetzt werden, sollte er so eingestellt<br />
werden, dass das Druckbild aus dem vorhergehenden<br />
Anhang F.3.3.1 entsteht.<br />
F.3.3.3 Druckverfahren<br />
Laserdirektbeschriftung<br />
Mit Hilfe eines starken Lasers wird das Beschriftungsmaterial<br />
in der Farbe verändert (Farbumschlag) oder es<br />
wird aufgedruckte Farbe entfernt.<br />
Mögliche Fehlerquellen:<br />
• Farbe mit Laser nicht vollständig entfernt<br />
• Laser zu stark eingestellt<br />
• Druck als Dotcode<br />
• Falsche Farbkombination (für Rotlichtscanner)<br />
F.3.4 Druckverfahren Thermotransfer<br />
Es wird Farbe von einem Farbband mit Hilfe von Hitze<br />
auf das Produkt direkt gedruckt oder es wird indirekt<br />
mit einem Etikett gearbeitet.<br />
Mögliche Fehlerquellen:<br />
• Nicht wischfestes Thermotransferband<br />
• Temperatureinstellung zu hoch<br />
• Temperatureinstellung zu niedrig<br />
• Geschwindigkeit zu hoch<br />
• Andruck des Druckkopfes (Kopfleiste) zu niedrig<br />
• Ausfall von Heizelementen<br />
• Falten im Farbband<br />
• Farbband pendelt<br />
• Etikettenposition pendelt<br />
• Zu dicht am Rand gedruckt<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 33
F.4 Materialbedingte Fehler<br />
F.4.1 Druck auf durchscheinenden<br />
Kunststoff<br />
In diesem Fall wurde ein <strong>Code</strong> auf einem Kunststoffmaterial<br />
gedruckt. Der Kunststoff ist durchscheinend. Damit<br />
kann relativ viel Licht tief in das Material eindringen<br />
und von dort wieder partiell zurück reflektiert werden.<br />
Der daraus entstehende Effekt ist die scheinbare Schattenbildung<br />
an den Rändern der Beschriftung. Das liegt<br />
darin begründet, dass in den großen unbedruckten<br />
Flächen mehr Licht aus dem Material reflektiert wird als<br />
in den kleinen unbedruckten Strukturen.<br />
F.4.2 Deckweiß auf transparenter<br />
Kunststofffolie zu dünn<br />
Wenn ein <strong>Code</strong> auf eine dünne Folie gedruckt wird, die<br />
vorher weiß bedruckt wurde, entstehen zwei Effekte.<br />
Wenn sich unter der Folie ein Hohlraum befindet bzw.<br />
die Folie auf schwarzem Untergrund liegt, wird alles<br />
Licht, dass die dünnen weiße Schicht passiert, absorbiert.<br />
Der <strong>Code</strong> verliert an Kontrast.<br />
Wenn sich die Folie auf hellem Untergrund befindet,<br />
wird das durchgedrungene Licht von der hellen Fläche<br />
reflektiert. Die Reflexion wird ungleichmäßig und zeigt<br />
das gleiche Bild wie im Anhang F.4.1.<br />
F.4.3 Druck auf spiegelndem Metall<br />
Die spiegelnde Metalloberfläche verursacht unregelmäßige<br />
Ausleuchtungen, die vom Winkel der<br />
Beleuchtungsquelle (Scanner) zum <strong>Code</strong> abhängen. Es<br />
erscheinen partielle Spiegelungen, die selbst dunkle<br />
<strong>Code</strong>teile weiß erscheinen lassen.<br />
Dieser Fall ist ein typischer DPM <strong>Code</strong>. Für die<br />
Anwendung als <strong>IFA</strong> Produkt <strong>Code</strong> ist das nicht zuge-<br />
lassen, weil zum Lesen spezielle DOME Beleuchtungen<br />
erforderlich sind (sehr diffuse, ungerichtete Beleuchtung,<br />
die alle Spiegelungen und Winkelabhängigkeiten<br />
vermeidet).<br />
F.4.4 <strong>Code</strong> auf Rasterdruck<br />
Wenn ein <strong>Code</strong> auf einer Rasterfläche gedruckt wird<br />
(hier schwarze, gelbe und blaue Punkte, wobei die Rasterfläche<br />
für das menschliche Auge in der Summe grün<br />
erscheint) stören diese Punkte die <strong>Code</strong>s. Je größer die<br />
Modulgröße des <strong>Code</strong>s in Relation zur Rastergröße ist,<br />
umso besser lässt sich das Raster durch Filtern entfernen<br />
(Aufnahme stark vergrößert).<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 34
F.4.5 <strong>Code</strong> unter einer<br />
transparenten Folie<br />
Wenn über den <strong>Code</strong>druck eine Folie liegt, muss diese<br />
Folie eng anliegen. Es dürfen keine Luftblasen zwischen<br />
<strong>Code</strong> und Folie sein. Schweißnähte, Falten und<br />
Beschriftungen auf der Folie sind an der Position des<br />
<strong>Code</strong>s verboten.<br />
Anhang G<br />
Layout – Best Practice<br />
(informativ)<br />
Diese Beispiele zeigen, wie auch bei kleiner zur<br />
Verfügung stehender Fläche der <strong>Code</strong> und der Klartext<br />
dargestellt werden können:<br />
Anhang H<br />
Bubble-Jet – Best Practice<br />
(informativ)<br />
Diese Drucksysteme basieren typischerweise auf<br />
einem Kartuschensystem mit integriertem Druckkopf.<br />
Andere, ähnliche Drucksysteme benutzen Druckköpfe,<br />
die vom Tintenvorrat getrennt sind. Diese Drucksysteme<br />
weisen alle eine bestimmte Auflösung auf (z.B. 300,<br />
600, 720 dpi). Des Weiteren werden die Druckpunkte<br />
überlappend gedruckt, um eine Kantenglättung zu<br />
erzeugen. Teilweise kann durch die Tintenmenge und/<br />
oder Tintenart die Schwärzung des Druckes beeinflusst<br />
werden.<br />
Diese Variablen müssen in der Druckereinstellung<br />
berücksichtigt werden. Es ist von Vorteil, wenn das<br />
Drucksystem nur solche <strong>Code</strong>größeneinstellungen<br />
zulässt, die verzerrungsfrei gedruckt werden können.<br />
Wenn die Abstufung der <strong>Code</strong>größe, die durch die<br />
Druckerauflösung erzwungen wird, nicht beachtet wird,<br />
werden die Druckfehler mit sinkender Auflösung (notwendig<br />
bei höherer Geschwindigkeit) immer gravierender.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 35
Anhang I<br />
Data Matrix <strong>Code</strong> –<br />
Symbologiebeschreibung<br />
(informativ)<br />
Den Data Matrix <strong>Code</strong> in der modernen Variante<br />
ECC200 gibt es in einer quadratischen und in einer<br />
rechteckigen Version.<br />
I.1 Modulgrößen<br />
Mit Modulgröße ist die Dimension einer Matrixzelle des<br />
Gesamtcodes bezeichnet. Diese ist im Rahmen der in<br />
Kapitel 5.2 genannten Dimensionen frei skalierbar und<br />
wird von der in der Applikation verwendeten Druck- und<br />
Lesetechnik bestimmt.<br />
Beispiele identischer <strong>Code</strong>s in verschiedenen<br />
Modulgrößen:<br />
I.2 Matrixgröße<br />
Die Matrixgröße ist bestimmt durch die Anzahl der<br />
Module. Nach ISO/IEC 16022 ist die minimale Größe<br />
der quadratischen Version ist eine Matrix von 10x10<br />
Modulen und die maximale Größe ist 144x144 Module.<br />
Die rechteckige Version beginnt mit der Matrixgröße<br />
8x16 und geht bis maximal 16x48 Module. Im Kapitel<br />
5.2 sind die für die <strong>PPN</strong> vorgesehenen Matrixgrößen<br />
beschrieben.<br />
Beispiel Matrixgröße 32x32 Module:<br />
Beispiel Matrixgröße 16x16 Module:<br />
Beispiel Matrixgröße 16x48 Module:<br />
Beispiel Matrixgröße 104x104 Module:<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 36
I.3 Feste Muster<br />
Der Data Matrix <strong>Code</strong> besteht aus festen Mustern (Fixed<br />
Pattern) und aus dem Bereich für die kodierten Daten.<br />
Der rot markierte Teil des festen Musters wird auch als<br />
„L“ bezeichnet. Anhand des Musters wird die Orientierung<br />
des <strong>Code</strong>s im Bild bestimmt.<br />
Der rot markierte Teil des festen Musters wird als Taktmuster<br />
bzw. als Clock Track bezeichnet. Das Taktmuster<br />
zeigt die Matrix des <strong>Code</strong>s an.<br />
Die rot markierten Bereiche des festen Musters treten<br />
nur bei <strong>Code</strong>s ab einer Matrixgröße von 32x32 Modulen<br />
auf. Die oben gezeigten L- und Taktmuster werden im<br />
<strong>Code</strong> wiederholt.<br />
Die rot markierte Umrandung des <strong>Code</strong>s ist die kleinste<br />
erlaubte Ruhezonenbreite. Die Breite ist eine Matrixzeile<br />
bzw. Spalte. Es wird empfohlen, die 3-fache Breite in<br />
der Praxis zu verwenden.<br />
I.4 Datenbereich<br />
Die rot markierten Bereiche zeigen den Datenbereich<br />
des Data Matrix <strong>Code</strong>s an. In diesem Bereich befinden<br />
sich die <strong>Code</strong>wörter für die Daten und für die Fehlerkorrektur.<br />
Symbole bis zu einer Matrixgröße von 26x26<br />
Modulen weisen nur ein rotes Datensegment auf.<br />
I.5 Füllzeichen<br />
Die im Kapitel 5.2 gezeigte Tabelle mit den beiden<br />
quadratischen <strong>Code</strong>versionen 26x26 und 32x32<br />
Modulen beinhalten 44 bzw. 62 <strong>Code</strong>wörter für die<br />
Daten. Wenn z.B. die kodierten Daten 48 <strong>Code</strong>wörter<br />
benötigen, reicht die Kapazität der 26x26 Matrix dafür<br />
nicht mehr aus. Es muss die 32x32 Matrix mit 62 <strong>Code</strong>wörtern<br />
eingesetzt werden. Die Differenz zwischen der<br />
Kapazität von 62 <strong>Code</strong>wörtern und den benötigten<br />
48 <strong>Code</strong>wörtern wird mit Füllzeichen aufgefüllt (Pad<br />
Character). Das Auffüllen muss in einem festgelegten<br />
Schema vorgenommen werden, das in der Data Matrix<br />
Norm ISO/IEC 16022 definiert ist.<br />
Wenn in der Anwendung immer eine feste Matrixgröße<br />
von z.B. 26x26 Modulen verwendet werden soll, obwohl<br />
manchmal auch 22x22 Module oder 24x24 Module<br />
ausreichend wäre, muss die überschüssige Kodierkapazität<br />
mit den Füllzeichen aufgefüllt werden.<br />
Wenn mit (Scanner)lesbaren Daten aufgefüllt<br />
wird, ist die Datenstruktur zerstört und der <strong>Code</strong><br />
unbrauchbar.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 37
I.6 Fehlerkorrektur<br />
Die Fehlerkorrektur des Data Matrix <strong>Code</strong>s ist in der<br />
Data Matrix Norm ISO/IEC 16022 definiert . Es wird das<br />
Reed Solomon Verfahren dafür eingesetzt.<br />
Zu beachten ist, dass das Verfahren der Fehler-<br />
korrektur auf den <strong>Code</strong>wörtern und nicht auf den<br />
Einzelzellen der Matrix beruht.<br />
Im Bild ist ein <strong>Code</strong>wort, bestehend aus 8 Matrixzellen,<br />
dargestellt. Jede Matrixzelle ist in dem Bild durch das<br />
rote Schachbrettmuster hervorgehoben. Wenn eine<br />
Matrixzelle hell statt dunkel ist, dann ist das <strong>Code</strong>wort<br />
zerstört. Wenn alle Matrixzellen die falsche Farbe haben,<br />
bleibt es bei einem zerstörten <strong>Code</strong>wort. Wenn<br />
eine Teilfläche des <strong>Code</strong>s zerstört ist, sind damit die<br />
<strong>Code</strong>wörter betroffen, die in diesem Bereich liegen.<br />
Aber selbst die Daten aus relativ groß erscheinenden<br />
defekten Bereichen (zusammenhängend) können<br />
durch die Fehlerkorrektur rekonstruiert werden. Handelt<br />
es sich aber zwar um kleine zerstörte Matrixstellen, die<br />
jedoch über das gesamte Symbol zufällig verteilt sind,<br />
sind sehr viele <strong>Code</strong>wörter betroffen und die Fehlerkorrekturfähigkeit<br />
stößt viel eher an die Grenzen.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 38
Anhang J<br />
Glossar<br />
Grundsätzlich gelten die Begriffe und Definitionen der<br />
ISO/IEC 19762 Teil 1 und Teil 2. Im folgenden aufgeführt<br />
sind die in diesem Dokument verwendeten Begriffe und<br />
Abkürzungen<br />
• AMG: Zweck des Arzneimittelgesetzes (AMG) ist es,<br />
im Interesse einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung<br />
von Mensch und Tier für die Sicherheit<br />
im Verkehr mit Arzneimitteln, insbesondere für die<br />
Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der<br />
Arzneimittel nach Maßgabe der im AMG enthaltenen<br />
Vorschriften zu sorgen (s. § 1 AMG).<br />
• Application Identifier (AI): Durch die Anwender<br />
von GS1 entwickelte numerische Datenbezeichner,<br />
die in dem Standard ANSI MH10.8.2 (normative<br />
Referenz: ISO/IEC 15418) gelistet sind.<br />
• BARCODE: Optischer Datenträger aus Strichen<br />
bestehend (auch Strichcode genannt). Umgangssprachlich<br />
werden 2-dimensionale Matrixcodes u.a.<br />
als 2D Barcodes bezeichnet. Dazu zählt auch der<br />
Data Matrix <strong>Code</strong>.<br />
• <strong>Code</strong> 39: Ein Barcode bzw. Strichcodetyp der in<br />
der ISO/IEC 16388 spezifiziert ist. Der Platzbedarf<br />
dieses <strong>Code</strong>s ist, bei vergleichsweise geringen<br />
Datenmengen, groß.<br />
• Codierregeln securPharm: Steht als Kurzform<br />
für das Dokument „Regeln zur Codierung verifizierungspflichtiger<br />
Arzneimittel im deutschen Markt“.<br />
Siehe http://www.securpharm.de/fileadmin/pdf/<br />
Pharmahersteller/2013-01-11_securPharm_Regeln_<br />
Codierung_DE_V1_02%5B1%5D.pdf<br />
• Continous Ink-Jet (CIJ): Damit wird ein Tintenstrahldruckverfahren<br />
bezeichnet. Typischerweise<br />
erzeugt dieses Druckverfahren Dotcodes, die hier<br />
im Glossar erwähnt werden. Das Druckverfahren<br />
erzeugt einen ständig laufenden Strahl aus Tintentropfen,<br />
der elektrostatisch abgelenkt wird. Dabei<br />
verdunstet Lösemittel. Aufgrund des hohen Lösemittelanteiles<br />
trocknet und haftet die Tinte sehr gut<br />
auf allen nicht saugenden Oberflächen. Die Auflösung<br />
ist niedrig.<br />
• Data Matrix <strong>Code</strong>: Zweidimensionaler Matrixcode<br />
der aus quadratischen Elementen besteht. In der<br />
Ausführung ECC 200 nach ISO/IEC 16022 beinhaltet<br />
der <strong>Code</strong> eine Fehlerkorrektur für fehlende Punkte<br />
oder beschädigte Stellen. Die gleichfarbigen,<br />
benachbarten Elemente des <strong>Code</strong>s sollen ohne<br />
Unterbrechung direkt ineinander übergehen.<br />
• Datenidentifikator: Der Begriff wird in diesem<br />
Dokument übergeordnet für Data Identifier (DI) und<br />
Application Identifier (AI) verwendet. Datenidentifikatoren<br />
sind eindeutige Bezeichner für Datenelemente<br />
in Datencontainern (Datenträger) wie<br />
z.B. Barcode, 2-D-<strong>Code</strong>, oder RFID und in offenen<br />
<strong>System</strong>en zur sicheren Interpretation der Datenelemente<br />
unerlässlich.<br />
• Data Identifier (DI): Von dem „ASC MH 10<br />
Data Identifier Maintenance Committee“ vergebene<br />
Datenidentifikatoren, die in dem Standard ANSI<br />
MH10.8.2 (normative Referenz: ISO/IEC 15418)<br />
gelistet sind. Der Datenidentifikator schließt immer<br />
mit einem Alphazeichen ab. Diesem kann, zur<br />
Unterscheidung von Varianten, eine ein-, zwei- oder<br />
dreistellige Zahl vorangestellt sein.<br />
• Datenträger: Der Begriff Datenträger ist eine<br />
allgemeine Beschreibung für ein beliebiges Medium,<br />
das Daten aufnehmen bzw. speichern kann. Im<br />
Idealfall ist es für den Datenträger völlig gleichgültig,<br />
welche Art von Daten auf ihm gespeichert werden.<br />
Zu den Datenträgern gehören zum einen Festplatten,<br />
CD-ROM, DVD und USB-Sticks. Zum anderen<br />
werden im Bereich der automatischen Identifikation<br />
als Datenträger RFID Transponder, OCR Schriftarten,<br />
Strichcodes und Matrixcodes eingesetzt.<br />
• DFI – Data Format Identifier: Definiert welche<br />
Ausprägungen der <strong>Code</strong> nach den ISO-Standard<br />
enthält. Darüber ist festgelegt, welche Datenhülle<br />
nach ISO/ IEC 15434, welche Datenidentifikatoren<br />
(AI oder DI), ob ein Makro nach ISO/IEC 16022 und<br />
welche Syntax zu verwenden ist. Derzeit sind als<br />
Wert für den DFI „<strong>IFA</strong>“ oder „GS1“ definiert.<br />
• Dotcode: Es handelt sich dabei um zweidimensionale<br />
<strong>Code</strong>s, die typischerweise aus runden und<br />
einzeln stehenden Punkten aufgebaut sind. Die<br />
Data Matrix Norm spezifiziert keine Dotcode Variante.<br />
In der Praxis gibt es aber viele Dotcode Data Matrix<br />
Anwendungen. Es werden dafür Scanner benötigt,<br />
die solche Anwendungen lesen können. In der <strong>PPN</strong><br />
Anwendung, als offenes <strong>System</strong>, können die Scannertypen<br />
nicht vorgeschrieben werden. Auf die Data<br />
Matrix Dotcode Variante wird daher verzichtet.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 39
• European Medicines Agency (EMA): Europäische<br />
Zulassungsbehörde für bestimmte Arzneimittel.<br />
• Global Trade Item Number (GTIN): Eine Artikelnummer<br />
im Einzelhandel. Typischerweise findet<br />
sich diese Artikelnummer in einem Strichcode vom<br />
Typ EAN-13 kodiert wieder. Andere Kodierungen<br />
der GTIN im <strong>Code</strong> 128, Data Matrix <strong>Code</strong> und GS1-<br />
DataBar sind möglich. Die zuständige IA ist GS1.<br />
• GS1 – eingetragenes Warenzeichen: GS1 ist die<br />
Abkürzung von Global Standards One, die als IA<br />
registriert ist und weltweit die GS1-Nummernsysteme<br />
verwaltet.<br />
• HIBC – Health Industry Bar <strong>Code</strong>: Der HIBC ist eine<br />
komprimierte Struktur und wird vornehmlich für die<br />
Kennzeichnung von Medizinprodukten verwendet.<br />
Der HIBC wird von dem <strong>System</strong>identifikator „+“<br />
angeführt, die Kapazität für Produktcodes ist 2 bis<br />
18-stellig und alphanumerisch, gefolgt von den<br />
variablen Produktdaten (siehe www.hibc.de).<br />
• <strong>IFA</strong>: Informationsstelle für Arzneispezialitäten <strong>IFA</strong><br />
GmbH (www.ifaffm.de). Zuständige Vergabestelle<br />
für die PZN und den PRA-<strong>Code</strong>.<br />
• <strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong>: Von der <strong>IFA</strong> publizierte <strong>Spezifikation</strong>en,<br />
die die Regeln der deutschen Stakeholder<br />
im Arzneimittelmarkt umsetzen, erweitert auf<br />
alle apothekenüblichen Waren (z.B. auf Nahrungsergänzungsmittel).<br />
Es deckt die Kennzeichnung<br />
von Handelspackungen und Transporteinheiten ab.<br />
• Issuing Agency <strong>Code</strong> (IAC): Der von der<br />
„Registration Authority for ISO/IEC 15459“ zugeteilte<br />
Registration-<strong>Code</strong> einer Issuing Agency (IA).<br />
Eine Issuing Agency ist in der Lage, seinen <strong>System</strong>teilnehmern<br />
ein <strong>System</strong> zur weltweit eindeutigen<br />
Identifikation von Objekten zur Verfügung zu stellen.<br />
Die ISO hat die NEN (NEderlandse Norm) beauftragt,<br />
als Registration Authority zu fungieren.<br />
• Modulgröße: Bezeichnet die Größe einer Matrixzelle<br />
im Data Matrix<strong>Code</strong><br />
• National Trade Item Number (NTIN): Eine weltweit<br />
eindeutige Artikelnummer, in der nationale<br />
Artikelnummern unter Verwendung eines GS1-<br />
Präfix’ eingebettet sind. Für die PZN ist der Präfix<br />
4150 vergeben. Als Datenidentifikator ist wie für die<br />
GTIN der Application Identifier (AI) „01“ zu verwenden.<br />
• Optical readable media (ORM): Oberbegriff für<br />
Codierungen, die mit optischen Geräten erfasst<br />
•<br />
werden. Dazu gehören OCR-Schriften, Barcodes<br />
und 2D-<strong>Code</strong>s etc.<br />
OTC-Arzneimittel: OTC (engl. over the counter) ist<br />
die Bezeichnung für nicht verschreibungspflichtige<br />
Arzneimittel. Gemäß § 48 AMG werden Arzneimittel<br />
dann als nicht verschreibungspflichtig eingeordnet,<br />
wenn sie bei bestimmungsgemäßen Gebrauch die<br />
Gesundheit des Anwenders nicht gefährden, auch<br />
wenn sie ohne ärztliche Überwachung angewendet<br />
werden. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel<br />
werden noch unterteilt in apothekenpflichtige und<br />
nicht apothekenpflichtige (freiverkäufliche) Arzneimittel.<br />
• Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>): Eine weltweit<br />
eindeutige Artikelnummer für Produkte im Gesundheitswesen,<br />
in der die nationalen Artikelnummern<br />
eingebettet sind. Sie besteht aus einem zweistelligen<br />
Präfix (Product Registration Agency <strong>Code</strong>)<br />
gefolgt von der nationalen Produktnummer (in<br />
Deutschland PZN) und einer zweistelligen Prüfziffer.<br />
Die nationale Produktnummer wird so in eine weltweit<br />
eindeutige Produktnummer überführt, um im<br />
internationalen Geschäftsverkehr eindeutig zu sein.<br />
Die zuständige IA ist die <strong>IFA</strong>.<br />
• Pharmazeutischer Unternehmer (PU): Ist bei<br />
zulassungs- oder registrierungspflichtigen<br />
•<br />
Arzneimitteln der Inhaber der Zulassung oder<br />
Registrierung. PU ist auch, wer Arzneimittel unter<br />
seinem Namen in den Verkehr bringt (§ 4 Abs. 18<br />
AMG). Das bedeutet: Bringt ein anderer als der<br />
Zulassungsinhaber das Arzneimittel in den Verkehr,<br />
müssen beide Firmen in der Kennzeichnung<br />
angegeben werden, z.B. beide als PU oder als<br />
„Zulassungsinhaber“ und „Vertreiber“. Das gilt auch,<br />
wenn neben dem Zulassungs-/Registrierungsinhaber<br />
ein oder mehrere Mitvertreiber das Arzneimittel<br />
in den Verkehr bringen. Letztere werden dann als<br />
„(weitere) PU“ oder als „Mitvertreiber“ angegeben.<br />
Sowohl aus rechtlicher Sicht als auch im Rahmen des<br />
securPharm Projekts sind alle vorher genannten<br />
Parteien PU und für die ordnungsgemäße Erfüllung<br />
der entsprechenden Aufgaben verantwortlich,<br />
soweit auf sie zutreffend.<br />
<strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong>: Beschreibt einen Data Matrix <strong>Code</strong><br />
ECC 200 nach ISO/IEC 16022 und der Datenstruktur<br />
und Syntax gemäß ISO/IEC 15418/ANSI MH10.8.2<br />
sowie ISO/IEC 15434. Als führendes Datenelement<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 40
enthält der <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> die „Pharmcy-Product-Num-<br />
ber“ (<strong>PPN</strong>) und je nach Applikation noch weitere<br />
Datenelemente. Bei verifizierungspflichtigen Arzneimitteln<br />
sind dies grundsätzlich „Seriennummer“,<br />
„Chargenbezeichnung“ und „Verfalldatum“.<br />
• Product Registration Agency-<strong>Code</strong> (PRA-<br />
•<br />
<strong>Code</strong>): Zweistelliger Präfix zur eindeutigen Kennung<br />
einer <strong>PPN</strong>. Vergeben und verwaltet von der <strong>IFA</strong><br />
Pharmazentralnummer (PZN): Nationale Produktnummer<br />
der deutschen, pharmazeutischen Produkte<br />
bzw. apothekenüblichen Waren. Die Vergabe der<br />
PZN Nummer ist gesetzlich geregelt und obliegt der<br />
<strong>IFA</strong>. Siehe www.ifaffm.de/service/_index.html<br />
• Product Registration Agency (PRA): Vergabestelle<br />
der (nationalen) Produktnummern, die in Verbindung<br />
mit dem PRA-<strong>Code</strong> in die <strong>PPN</strong> überführt<br />
werden.<br />
• Randomisierte Serienummer: Nicht deterministisch<br />
generierte Seriennummer<br />
• RX-Arzneimittel: Verschreibungspflichtige Arzneimittel<br />
werden im Sprachgebrauch auch als RX-Arzneimittel<br />
bezeichnet.<br />
• SecurPharm: Projektbezeichnung der Initiative der<br />
Stakeholder im deutschen Pharmamarkt<br />
• SI – <strong>System</strong>identifikator: Ein <strong>System</strong>identifikator<br />
besteht aus einem Charakter oder aus einer<br />
Kombination und verweist am <strong>Code</strong>anfang auf die<br />
verwendete Datenstruktur, bzw. Syntax. <strong>System</strong>identifikatoren<br />
sind nach DIN 66403 genormt.<br />
• Symbologie: Der Begriff Symbologie wird als<br />
Überbegriff für eine allgemeine Benennung aller<br />
optischen <strong>Code</strong>s verwendet. Optische <strong>Code</strong>s sind<br />
z. B. lineare Strichcodes (Barcodes), Matrixcodes,<br />
Composite <strong>Code</strong>s oder gestapelte <strong>Code</strong>s. Unterschiedliche<br />
Symbologien bei linearen Strichcodes<br />
sind z.B. der EAN <strong>Code</strong>, <strong>Code</strong> 128 und <strong>Code</strong> 39,<br />
bei Matrixcodes z.B. der Data Matrix <strong>Code</strong> und der<br />
QR-<strong>Code</strong>.<br />
• Verifizierung: Unter der Verifizierung wird hier<br />
der Prozess der Erkennung von Fälschungen oder<br />
Duplikaten mit Hilfe einer Seriennummer auf<br />
Arzneimittelpackungen verstanden. Im Bereich der<br />
optischen Kodierungen wird der Begriff Verifizierung<br />
auch für die Druckqualitätskontrolle der <strong>Code</strong>s<br />
verwendet. Um eine Eindeutigkeit der Begriffe zu<br />
erreichen, wird in der vorliegenden <strong>Spezifikation</strong><br />
Verifizierung nur in dem Kontext der Fälschungs-<br />
erkennung verwendet. Die Druckqualitätskontrolle<br />
wird immer als Strichcode- oder Matrixcodeprüfung<br />
bezeichnet (vgl. englisch „Barcode verification“ im<br />
Sinne der Druckqualitätskontrolle).<br />
• XML: Der Begriff ist aus der englischen Bezeichnung<br />
„Extensible Markup Language“ abgeleitet.<br />
XML ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung<br />
hierarchisch strukturierter Daten in Form von<br />
Textdaten.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 41
Anhang K<br />
Bibliography<br />
K.1 Normen:<br />
ISO 22742: Packaging - Linear bar code and twodimensional<br />
symbols for product packaging<br />
ANSI MH10.8.2: Data Identifier and Application<br />
Identifier Standard<br />
ISO/IEC 15418: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture techniques -- GS1<br />
Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers<br />
and maintenance<br />
(Referenziert auf ANSI MH10.8.2)<br />
ISO/IEC 15415: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture techniques -- Bar code<br />
print quality test specification -- Two-dimensional<br />
symbols<br />
ISO/IEC 15434: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture techniques -- Syntax for<br />
high-capacity ADC media<br />
ISO/IEC 15459-2: Information technology -- Unique<br />
identifiers -- Part 2: Registration procedures<br />
ISO/IEC 15459-3: Information technology -- Unique<br />
identifiers -- Part 3: Common rules for unique identifiers<br />
ISO/IEC 16022: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture techniques -- Data Matrix<br />
bar code symbology specification<br />
ISO/IEC 19762-1: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture (AIDC) techniques<br />
-- Harmonized vocabulary -- Part 1: General terms<br />
relating to AIDC<br />
ISO/IEC 19762-2: Information technology -- Automatic<br />
identification and data capture (AIDC) techniques --<br />
Harmonized vocabulary -- Part 2: Optically readable<br />
media (ORM)<br />
ISO 2859-1: Sampling procedures for inspection by<br />
attributes Part 1: Sampling plans indexed by acceptable<br />
quality level (AQL) for lot-by-lot inspection<br />
ISO 3951: Sampling procedures and charts for inspec-<br />
tion by variables for per cent nonconforming<br />
ISO/IEC 10646: Information technology -- Universal<br />
<strong>Code</strong>d Character Set (UCS)<br />
K.2 Weiterführende Literatur<br />
Handbuch der automatischen Identifikation, Band<br />
2, ISBN 3-935551-00-2 , Autor Bernhard Lenk<br />
Barcode - Das Profibuch der Lesetechnik, ISBN<br />
3-935551-04-5<br />
Einführung in die Identifikation - Opt. ID / RFID,<br />
ISBN 3-935551-03-7<br />
K.3 Links<br />
AutoID: http://www.autoid.org<br />
Eurodata Council: http://www.eurodatacouncil.org<br />
GS1: http://www.gs1.org<br />
HIBC: http://www.hibc.de<br />
<strong>IFA</strong> Frankfurt: http://www.ifaffm.de<br />
SecurPharm: http://www.securpharm.de<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 42
Anhang L<br />
Dokumenthistorie<br />
Version Datum Kategorie der<br />
Änderung<br />
1.0 18.11.11 Erstausgabe<br />
Änderung<br />
1.01 18.11.11 Layout-/Textkorrektur Kap. F. 1; (Textkorrektur); Anhang D<br />
(Layoutkorrektur)<br />
1.02 23.01.12 Layout-/Textkorrektur Gesamtes Dokument (Layout); Kap. 1,<br />
Anhang F.1.6, F.2 (Text); Anhang F.1.6 (Inhalt<br />
ergänzt); Kap. 3.3 (Link); Anhang L (neu)<br />
1.03 24.04.12 Layout-/Textkorrektur Anhang B (Zahl)<br />
2.00 01.11.12 Inhalte, Layout-/<br />
Textkorrektur<br />
2.01 26.06.13 Layout-/Textkorrektur Links nachgeführt<br />
Gesamtes Dokument:<br />
Ergänzungen und Textkorrekturen unter Berücksichtigung<br />
der inzwischen veröffentlichten „Codierregeln<br />
securPharm“, insbesondere im Kapitel 1 und 2.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 43
Anhang M<br />
Impressum<br />
<strong>IFA</strong> GmbH<br />
Informationsstelle für Arzneispezialitäten<br />
Hamburger Allee 26 - 28<br />
60486 Frankfurt am Main<br />
Postfach 15 02 61<br />
60062 Frankfurt am Main<br />
Telefon: +49 69 / 97 99 19-0<br />
Telefax: +49 69 / 97 99 19-39<br />
E-Mail: ifa@ifaffm.de<br />
Internet: http://www.ifaffm.de<br />
Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie Fehler entdecken oder Inhalte vermissen, so<br />
bitten wir um Ihre Nachricht.<br />
Anmerkung zur Erstellung dieser <strong>Spezifikation</strong>:<br />
Die Arbeitsgruppe (AG) „Codierung“ innerhalb des securPharm-Projekts hat diese <strong>Spezifikation</strong> bis zur Version<br />
1.02 erarbeitet. Neben den Mitgliedern der AG Codierung haben zeitweise weitere Fachleute an der<br />
Erstellung der o.g. Dokumentation mitgewirkt. Insgesamt waren dies (in alphabetischer Reihenfolge der<br />
Familiennamen):<br />
• Klaus Appel, Informationsstelle für Arzneispezialitäten (<strong>IFA</strong>), Frankfurt/Main *<br />
• Dr. Ehrhard Anhalt, Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH), Bonn *<br />
• Thomas Brückner, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin<br />
• Dr. Stefan Gimmel, Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel<br />
• Dr. Clemens Haas, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Oberursel<br />
• Gerhard Haas, ABDATA Pharma-Daten-Service, Eschborn<br />
• Stefan Lustig, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim<br />
• Heinrich Oehlmann, Eurodata Council, Naumburg/The Hague *<br />
• Helmut Reichert, ABDATA Pharma-Daten-Service, Eschborn<br />
• Dr. Joachim Reineck, Merz Group Services GmbH, Reinheim<br />
• Kay Reinhardt, Salutas Pharma GmbH, Barleben<br />
• Christian Riediger, Bayer Health Care, Berlin<br />
• Paul Rupp, (Leiter der AG) Sanofi-Aventis, Schwalbach *<br />
• Dr. Stephan Schwarze, Bayer Health Care, Berlin<br />
• Wilfried Weigelt, Mitglied im Normenausschuss NIA-01-31 *<br />
Die mit * gekennzeichneten Personen haben maßgeblich an Version 2.00 mitgewirkt.<br />
All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 44