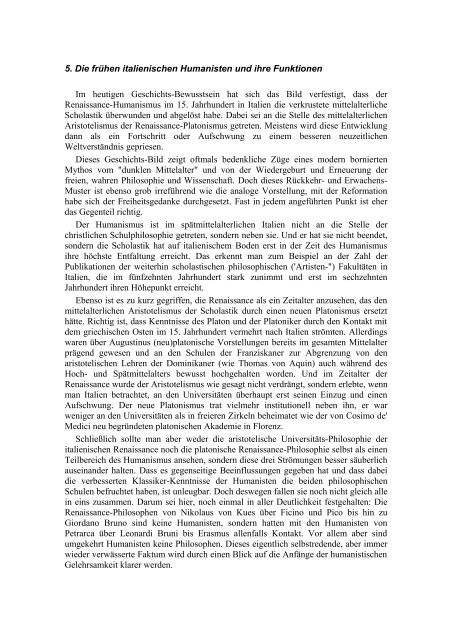5. Die frühen italienischen Humanisten und ihre ... - andopage
5. Die frühen italienischen Humanisten und ihre ... - andopage
5. Die frühen italienischen Humanisten und ihre ... - andopage
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>5.</strong> <strong>Die</strong> <strong>frühen</strong> <strong>italienischen</strong> <strong>Humanisten</strong> <strong>und</strong> <strong>ihre</strong> Funktionen<br />
Im heutigen Geschichts-Bewusstsein hat sich das Bild verfestigt, dass der<br />
Renaissance-Humanismus im 1<strong>5.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert in Italien die verkrustete mittelalterliche<br />
Scholastik überw<strong>und</strong>en <strong>und</strong> abgelöst habe. Dabei sei an die Stelle des mittelalterlichen<br />
Aristotelismus der Renaissance-Platonismus getreten. Meistens wird diese Entwicklung<br />
dann als ein Fortschritt oder Aufschwung zu einem besseren neuzeitlichen<br />
Weltverständnis gepriesen.<br />
<strong>Die</strong>ses Geschichts-Bild zeigt oftmals bedenkliche Züge eines modern bornierten<br />
Mythos vom "dunklen Mittelalter" <strong>und</strong> von der Wiedergeburt <strong>und</strong> Erneuerung der<br />
freien, wahren Philosophie <strong>und</strong> Wissenschaft. Doch dieses Rückkehr- <strong>und</strong> Erwachens-<br />
Muster ist ebenso grob irreführend wie die analoge Vorstellung, mit der Reformation<br />
habe sich der Freiheitsgedanke durchgesetzt. Fast in jedem angeführten Punkt ist eher<br />
das Gegenteil richtig.<br />
Der Humanismus ist im spätmittelalterlichen Italien nicht an die Stelle der<br />
christlichen Schulphilosophie getreten, sondern neben sie. Und er hat sie nicht beendet,<br />
sondern die Scholastik hat auf italienischem Boden erst in der Zeit des Humanismus<br />
<strong>ihre</strong> höchste Entfaltung erreicht. Das erkennt man zum Beispiel an der Zahl der<br />
Publikationen der weiterhin scholastischen philosophischen ('Artisten-") Fakultäten in<br />
Italien, die im fünfzehnten Jahrh<strong>und</strong>ert stark zunimmt <strong>und</strong> erst im sechzehnten<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>ihre</strong>n Höhepunkt erreicht.<br />
Ebenso ist es zu kurz gegriffen, die Renaissance als ein Zeitalter anzusehen, das den<br />
mittelalterlichen Aristotelismus der Scholastik durch einen neuen Platonismus ersetzt<br />
hätte. Richtig ist, dass Kenntnisse des Platon <strong>und</strong> der Platoniker durch den Kontakt mit<br />
dem griechischen Osten im 1<strong>5.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert vermehrt nach Italien strömten. Allerdings<br />
waren über Augustinus (neu)platonische Vorstellungen bereits im gesamten Mittelalter<br />
prägend gewesen <strong>und</strong> an den Schulen der Franziskaner zur Abgrenzung von den<br />
aristotelischen Lehren der Dominikaner (wie Thomas von Aquin) auch während des<br />
Hoch- <strong>und</strong> Spätmittelalters bewusst hochgehalten worden. Und im Zeitalter der<br />
Renaissance wurde der Aristotelismus wie gesagt nicht verdrängt, sondern erlebte, wenn<br />
man Italien betrachtet, an den Universitäten überhaupt erst seinen Einzug <strong>und</strong> einen<br />
Aufschwung. Der neue Platonismus trat vielmehr institutionell neben ihn, er war<br />
weniger an den Universitäten als in freieren Zirkeln beheimatet wie der von Cosimo de'<br />
Medici neu begründeten platonischen Akademie in Florenz.<br />
Schließlich sollte man aber weder die aristotelische Universitäts-Philosophie der<br />
<strong>italienischen</strong> Renaissance noch die platonische Renaissance-Philosophie selbst als einen<br />
Teilbereich des Humanismus ansehen, sondern diese drei Strömungen besser säuberlich<br />
auseinander halten. Dass es gegenseitige Beeinflussungen gegeben hat <strong>und</strong> dass dabei<br />
die verbesserten Klassiker-Kenntnisse der <strong>Humanisten</strong> die beiden philosophischen<br />
Schulen befruchtet haben, ist unleugbar. Doch deswegen fallen sie noch nicht gleich alle<br />
in eins zusammen. Darum sei hier, noch einmal in aller Deutlichkeit festgehalten: <strong>Die</strong><br />
Renaissance-Philosophen von Nikolaus von Kues über Ficino <strong>und</strong> Pico bis hin zu<br />
Giordano Bruno sind keine <strong>Humanisten</strong>, sondern hatten mit den <strong>Humanisten</strong> von<br />
Petrarca über Leonardi Bruni bis Erasmus allenfalls Kontakt. Vor allem aber sind<br />
umgekehrt <strong>Humanisten</strong> keine Philosophen. <strong>Die</strong>ses eigentlich selbstredende, aber immer<br />
wieder verwässerte Faktum wird durch einen Blick auf die Anfänge der humanistischen<br />
Gelehrsamkeit klarer werden.
Angesichts gerade des wandernden Schriftstellers Petrarca ist der ebenfalls falsche<br />
Eindruck entstanden, die <strong>Humanisten</strong> seien frei von institutionellen Bindungen<br />
gewesen. In Wahrheit waren nicht nur viele <strong>Humanisten</strong> genau so wie die Gelehrten des<br />
Mittelalters Geistliche (so auch Petrarca), sondern besaßen die meisten <strong>Humanisten</strong> eins<br />
(oder oft beide) von zwei charakteristischen Ämter, erstens das eines städtischen<br />
Kanzleisekretärs oder zweitens das eines Universitätsdozenten der Grammatik <strong>und</strong><br />
Rhetorik.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der wachsenden Unabhängigkeit <strong>und</strong> des zunehmenden wirtschaftlichen<br />
Aufschwungs der <strong>italienischen</strong> Stadtstaaten seit dem 11. Jahrh<strong>und</strong>ert erhielt die<br />
Anfertigung von Urk<strong>und</strong>en, Verträgen <strong>und</strong> Korrespondenzen im innerstädtischen wie<br />
im zwischenstaatlichen Verkehr eine erhöhte Bedeutung. Mit diesen wichtigen<br />
Aufgaben wurden in den städtischen Kanzleien eigens dazu ausgebildete Schriftk<strong>und</strong>ige<br />
betraut. die sogenannten "Dictatores". Sie gelten als die Träger der praktisch<br />
angewandten Rhetorik des Mittelalters, deren Kunst "ars dictaminis" hieß im<br />
Unterschied zur "ars praedicandi", die für die geistlichen Predigten gepflegt wurde.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Humanisten</strong> haben zum Großteil in der Renaissancezeit genau die selben<br />
Funktionen <strong>und</strong> Ämter eingenommen wie <strong>ihre</strong> mittelalterlichen Vorgänger, jene<br />
Dictatores. Allerdings unterschieden sie sich von denen in einem entscheidenden Punkt.<br />
<strong>Die</strong> mittelalterlichen Schreiber verfassten die offiziellen Texte zwar in Latein statt in<br />
der Volkssprache, aber sie entwickelten <strong>ihre</strong> zweckorientierten eigenen Lehrbücher <strong>und</strong><br />
Mustersammlungen. Dass man dagegen die Antike als die maßgebliche Schule für den<br />
eigenen Stil auffassen müsse, um gute Texte zu verfassen, diesen Gedanken<br />
propagierten <strong>und</strong> befolgten erst die <strong>Humanisten</strong>.<br />
Frühestes namhaftes Beispiel für diese Haltung ist Coluccio Salutati (1330-1406), ein<br />
Bew<strong>und</strong>erer Petrarcas. Seit 1375 Kanzler der Florentiner Regierung, spielte er eine<br />
bedeutende Rolle in der Politik Italiens. Als ausgebildeter Grammatiker (Lateinlehrer)<br />
<strong>und</strong> Jurist bildete er nach der Vorgabe Petrarcas seinen Stil an den Lateinern des<br />
klassischen Altertums aus <strong>und</strong> machte damit solchen Eindruck, dass seine Schriftstücke<br />
bald an anderen Herrscherhöfen Italiens nachgeahmt wurden. Insbesondere begründete<br />
Salutati den Anspruch seiner Heimatstadt auf' die alte "Romana libertas", nun als<br />
"Florentina libertas".<br />
Giangalleazo Visconti, die machtvollste Herrschergestalt Mailands, hat darob den<br />
berühmten Ausspruch über seinen Gegenspieler getan, Salutati sei ihm durch die<br />
Vortrefflichkeit seines Stils gefährlicher geworden als jedes Söldnerheer.<br />
Wie Petrarca gelang Salutati die Wiederentdeckung einiger vergessener Briefe des<br />
Vorbilds Cicero ("ad familiares" in Vercelli 1389). Und wie Petrarca polemisierte er<br />
gegen die aristotelische Schoaastik, <strong>und</strong> gleichfalls wie Petrarca betonte er die Würde<br />
des politisch-aktiven gegenüber dem asketisch-zurückgezogenen Leben.<br />
Dagegen erhob der Mönch Dominici, mit dem sich darüber ein langer Streit<br />
entspann, den Einspruch, dass die Kenntnisse des Gottesworts das höchste Gut <strong>und</strong> die<br />
kirchlichen Autoritäten die Bürgen für den Vorrang der Vernunft gegenüber dem Willen<br />
seien (was, wie schon ein Blick auf den Kirchenlehrer Augustinus zeigt, unzutreffend<br />
ist; <strong>und</strong> im Mittelalter hatten sich bekanntlich längst Duns Scotus <strong>und</strong> Wilhelm von<br />
Occam gegen den Vorrang des Intellekts bei Thomas von Aquin ausgesprochen. Aber<br />
Dominici war Thomist). Der Humanist Salutati entgegnete darauf, dass die Kenntnisse<br />
des Gotteswortes auf Kenntnissen der Sprache beruhten <strong>und</strong> somit der Sprachlehre eine<br />
gr<strong>und</strong>legendere Bedeutung zukomme.
Der Politiker Salutati verfasste eine Schrift "De nobilitate legum et medicinae", in<br />
der er den Vorrang der Jurisprudenz gegenüber der Wissenschaft der Medizin damit<br />
begründete, dass eine wohlgeordnete Gesetzgebung allen zugute komme, die Kunst des<br />
Heilens aber nur einzelnen Kranken. Damit ging also der schon von Petrarca entfachte<br />
Streit zwischen dem neuen politischen Gelehrtentyp des <strong>Humanisten</strong> <strong>und</strong> dem<br />
traditionellen des mönchischen Geistlichen weiter, der sich nun seit Salutati<br />
bezeichnenderweise immer wieder in die Form eines gelehrten Disputs um den Vorrang<br />
der sozialwissenschaftlichen Jurisprunz oder der naturwissenschaftlichen Medizin<br />
kleidete. <strong>Die</strong> Plattheit von Salutatis Argument ist ebenso kennzeichnend, ein<br />
eindrucksvolles Beispiel dafür, dass das Niveau der philosophischen Diskussion<br />
gegenüber den Scholatikern bei den <strong>Humanisten</strong> ganz <strong>und</strong> gar nicht so immens<br />
angehoben wurde wie es der Geschichts-Mythos von der Renaissance aber gerne<br />
erzählt. Für die Philosophie ist das genaue Gegenteil der Fall.<br />
Ein Schüler Salutatis war Leonardo Bruni (1369-1444). Auch er bekleidete zeitweise<br />
das Amt des Kanzlers in Florenz. Auch er pries <strong>und</strong> betrieb die Erforschung der antiken<br />
Schriften, er verfasste lateinische Briefe <strong>und</strong> übersetzte griechische Werke ins<br />
Lateinische. Und Leonardo Bruni ist für den Renaissance-Zeit das Musterbeispiel eines<br />
<strong>Humanisten</strong>, der ein solches Klassikerstudium ausdrücklich zu einem pädagogischen<br />
Konzept erhob, an den alten Griechen <strong>und</strong> Römern die vortrefflichsten Geistes-Anlagen<br />
des Menschen zu bilden. Bruni schreibt über dieses Studium der "litterae": "Und sie<br />
nennen sie studia humanitatis, weil sie den vollendeten Menschen bilden." - Hier ist also<br />
endlich wieder Ciceros Schlagwort gefallen, dass dieser ganzen Geistesströmung im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert den Namen geben sollte.<br />
Brunis Argument für diese zentrale These jedes Humanismus, dass die klassischen<br />
Autoren Persönlichkeits-bildend wirkten, kommt nun gerade in dem für die <strong>frühen</strong><br />
(nicht die späteren) Renaissance-<strong>Humanisten</strong> typischen Antiklerikalismus zum<br />
Ausdruck, der den Wert des Ehe- lind Staatsbürger-Lebens für den neuen "wahren"<br />
Gelehrten betont. Denn für die Unterweisung in der "via activa" bieten sich die Lehren<br />
der Klassiker <strong>und</strong> insbesondere Ciceros an.<br />
An Papst Eugen IV. schreibt Bruni: "<strong>Die</strong>ser Teil der Philosophie. der von den Sitten,<br />
den Regierungen, der besten Lebensweise handelt, ist fast gleich bei den heidnischen<br />
<strong>und</strong> christlichen Denkern." (<strong>Die</strong> christlichen Denker sind freilich als "Staats"-Denker<br />
eher vorgeschoben. <strong>Die</strong>s zeigt übrigens indirekt, dass der junge Humanismus zwar<br />
scharf antiklerikal polemisierte, aber fast nie gegen das Christentum gerichtet war).<br />
<strong>Die</strong> Autoritäten, auf die sich Bruni da berufen möchte, heißen in Wahrheit Sokrates,<br />
Platon, Aristoteles usw. In seiner Dante-Biographie schreibt Bruni: "Nach dieser<br />
Schlacht kehrte Dante nach Hause zurück; den Studien widmete er sich mehr als zuvor,<br />
doch unterließ er deswegen keineswegs die feinen geselligen Unterhaltungen... Bei<br />
dieser Gelegenheit scheint es mir angebracht, den Irrtum vieler Unwissender<br />
richtigzustellen, die da meinen, dass niemand zu den Studiosi gezählt werden könne,<br />
außer denjenigen, die sich in Einsamkeit <strong>und</strong> der Muße verstecken, während ich nie<br />
einen dieser Vermummten, die jeder geselligen Unterhaltung abhold sind, gekannt habe,<br />
der auch nur drei Buchstaben zu lesen imstande gewesen wäre ... Dante pflegte nicht<br />
nur die gesellige Unterhaltung mit Menschen, sondern nahm auch eine Frau ..., von der<br />
er mehrere Kinder bekam ... Das kann Boccaccio nicht dulden <strong>und</strong> sagt, dass das<br />
Heiraten den Studien abträblich sei, <strong>und</strong> vergisst dabei, dass Sokrates, der größte<br />
Philosoph, der je war, Frau <strong>und</strong> Kinder hatte <strong>und</strong> Ämter in der Regierum seiner Stadt,
<strong>und</strong> Aristoteles, den niemand an Weisheit <strong>und</strong> Wissen übertroffen hat, hatte zwei<br />
Frauen nacheinander <strong>und</strong> Kinder <strong>und</strong> bedeutende Reichtümer. Und Marcus Tullius,<br />
Cato, Seneca, Varro, große römische Philosophen, waren alle verheiratet, hatten Kinder<br />
<strong>und</strong> Ämter in der Republik... Der Mensch ist ein politisches Wesen nach der Meinung<br />
aller Philosophen."<br />
Bruni verfasste auch Biographien über Petrarca <strong>und</strong> Boccaccio. Aber das Lebens-<br />
Ideal für italienische <strong>Humanisten</strong> verkörperte der volkssprachige Dichter Dante, der<br />
sich in seinen Schriften als Agitator zur Rechtfertigung des deutschen Kaisertums über<br />
Italien betätigt hatte. Dante in der jüngeren Vergangenheit sowie Sokrates im Altertum<br />
waren die beliebtesten Instanzen für die antiklerikale humanistische Propaganda.<br />
Der Ausdruck "Propaganda" ist in diesem Fall kein zu starker Tobak, denn Sokrates<br />
taugt in Wirklichkeit ganz <strong>und</strong> gar nicht als Autorität für das neue Gelehrten-Ideal.<br />
Weder war Sokrates ein Schriftk<strong>und</strong>iger noch ein politischer Aktivist noch ein<br />
Musterbild von Ehemann <strong>und</strong> Familienvater; zu dem wenigen, was man über ihn weiß,<br />
gehört vielmehr, dass er Ämter bewusst gemieden hat <strong>und</strong> dass er für seine<br />
philosophische Tätigkeit seine Familie vernachlässigte.<br />
Festzuhalten bleibt, dass die <strong>Humanisten</strong> der Renaissancezeit erstens an<br />
herausragenden Stellen in der öffentlichen Verwaltung tätig waren wie <strong>ihre</strong><br />
mittelalterlichen Vorgänger, die Dictatores, <strong>und</strong> dass sie zweitens, anders als die<br />
Dictatores, das Klassiker-Studium forcierten <strong>und</strong> mit den neu propagierten antiken<br />
Autoritäten gleichzeitig <strong>ihre</strong> Verbindung von Gelehrsamkeit mit politischem Posten <strong>und</strong><br />
bürgerlichem Leben rechtfertigten.<br />
Doch bezeichnenderweise änderten sich mit den Studien der Antike zwar nicht die<br />
öffentlichen Ämter, die die Rhetoren in den <strong>italienischen</strong> Stadtstaaten innehatten, aber<br />
durchaus die Art <strong>ihre</strong>r öffentlichen Wirkung. Denn während die mittelalterlichen<br />
Dictatores maßgeblichen Einfluss in der Politik selbst ausgeübt hatten, verloren die<br />
<strong>Humanisten</strong> den in der Renaissancezeit <strong>und</strong> erwarben stattdessen ein den Dictatores<br />
fremdes soziales <strong>und</strong> kulturelles Prestige durch <strong>ihre</strong> Gelehrsamkeit. Salutati <strong>und</strong> Bruni,<br />
die noch Macht <strong>und</strong> Bildung vereinen konnten, bilden da eher die Ausnahmen, die am<br />
Anfang des humanistischen Zeitalters den Übergang markieren. Schon Lorenzo Valla<br />
war dagegen nicht mehr selbst ein politisch Handelnder, sondern stellte seine<br />
schriftstellerisch Tätigkeit ganz in den <strong>Die</strong>nst der Politik eines anderen, des<br />
neapolitanischen Königs Alfons voll Aragon.<br />
Florenz übrigens war aber nicht nur der Geburtsort der neuen Schriftgelehrsamkeit,<br />
es blieb auch im ganzen Quattrocento ihr Mittelpunkt. Berühmte <strong>Humanisten</strong> wie<br />
Lorenzo Valla wirkten zwar später an anderen <strong>italienischen</strong> Fürstenhöfen, aber <strong>ihre</strong><br />
Ausbildung <strong>und</strong> <strong>ihre</strong>n Aufstieg hatten sie stets in Florenz erfahren. Erst als der<br />
Florentiner Humanist Giovanni de’ Medici ab 1513 als Leo X. das Papstamt innehatte,<br />
wurde in der Hochrenaissance Rom der neue Vorort des Humanismus. Noch unter dem<br />
Vorgänger Julius II. waren zwar bereits die Florentiner Künstler wie Michelangelo nach<br />
Rom berufen worden, nicht aber die <strong>Humanisten</strong>.<br />
Außer in den städtischen Kanzleien waren die <strong>Humanisten</strong> auch an den Universitäten<br />
beschäftigt. Allerdings besaßen sie nicht einen der traditionellen Lehrstühle für<br />
Theologie, Jurisprudenz oder Medizin, auch nicht für Philosophie, sondern für Rhetorik.
<strong>Die</strong> Philosophie wurde im Mittelalter an der sogenannten "Artisten-Fakultät" gelehrt.<br />
<strong>Die</strong>ser Name leitet sich von den "artes liberales" ab. Ihren Namen tragen sie, weil sie im<br />
alten Römischen Reich von den "freien" Bürgern betrieben wurden. <strong>Die</strong> sieben freien<br />
Künste, die sich erst in der Spätantike herauskristallisierten, stellten dann den<br />
Bildungskanon dar, der das gesamte weltliche wissenschaftliche Wissen umfassen<br />
sollte.<br />
An den mittelalterlichen Universitäten diente die "Artisten"-Fakultät anfänglich<br />
meist der Propädeutik für einen der drei höheren Studiengänge, in West- <strong>und</strong><br />
Mitteleuropa vor allem als Vorstufe zur Theologie, in Italien dagegen hauptsächlich als<br />
naturwissenschaftliche Vorbereitung auf die Medizin. Erst im späteren Mittelalter <strong>und</strong><br />
in der Renaissancezeit, erhielt die philosophische Artisten-Fakultät den gleichen Rang<br />
wie die anderen Fakultäten.<br />
Doch in Italien bot die Artisten-Fakultät neben den Philosophen bald auch den<br />
Rhetorikern einen Lehrstuhl. Und das lief so ab: <strong>Die</strong> sieben freien Künste unterteilte<br />
man nämlich in zwei Teilbereiche, das Quadrivium (Vierweg) mit Astronomie,<br />
Geometrie, Arithmetik <strong>und</strong> Musik sowie das Trivium mit Grammatik (Latein), Rhetorik<br />
<strong>und</strong> Dialektik (Logik). In Italien diente nun das Quadrivium, weiterhin in enger<br />
Verbindung mit der Medizin, den aristotelischen Naturphilosophen als organisatorische<br />
Gr<strong>und</strong>lage all den Universitäten.<br />
Dagegen verselbständigte sich das Trivium zunehmend zu einer eigeilen rhetorischen<br />
Fakultät. An der beschäftigten sich die <strong>Humanisten</strong> außer mit Grammatik <strong>und</strong> Rhetorik,<br />
den eigentlichen Fächern des Triviums, vor allem mit der Dichtkunst, aber außerdem<br />
mit Geschichtsschreibung <strong>und</strong> sogar mit Moralphilosophie. Hierunter ist aber bis zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht unsere neuzeitliche Art der Lehre vom richtigen Handeln<br />
gegenüber anderen zu verstehen, sondern das Räsonnieren über die angemessene eigene<br />
Lebensweise, wie es oben in der Debatte um "via activa" gegen via contamplativa" zum<br />
Ausdruck gekommen ist. Andererseits zählten zum humanistisch-rhetorischen Fächer-<br />
Kanon ausdrücklich nicht Logik (obwohl sie unter dem Namen "Dialektik" ja eigentlich<br />
zum Trivium zu zählen wäre), nicht Naturphilosophie, Metaphysik <strong>und</strong> Theologie <strong>und</strong><br />
nicht Astronomie, Medizin <strong>und</strong> Rechtswissensbhaft, weil alle diese Bereiche bereits in<br />
den anderen Fakultäten <strong>ihre</strong>n traditionellen Platz eingenommen hatten.<br />
<strong>Die</strong>se neuen, aus dem "Trivium" hervorgegangenen rhetorischen Fakultäten waren<br />
nun also neben den städtischen Kanzleien die zweite wichtige institutionelle Basis für<br />
die <strong>Humanisten</strong>. Und aufgr<strong>und</strong> dieser Stellung an den Universtäten haben sie überhaupt<br />
erst <strong>ihre</strong>n Namen erhalten. Denn der Terminus "Humanista" scheint sich im<br />
Studentenjargon jener Zeit gebildet zu haben, um die Dozenten <strong>und</strong> Studenten der<br />
rhetorischen Fakultät zu benennen. Für die Juristen war damals bereits die Bezeichnung<br />
"Jurista" oder "Legista" üblich, für die Theologen "Canonista" (nach dem Kanonischen<br />
Recht der Kirche), für die Philosophen das besagte "Artista". Für die Angehörigen der<br />
rhetorischen Fakultäten bürgerte sich nun Ciceros Ausdruck "Humanista" ein, um<br />
damit. auch den umfassenden Bildungsanspruch der Rhetoren zum Ausdruck zu<br />
bringen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Humanisten</strong> an den Universitäten sahen sich damit als Rhetoren stets in<br />
Konkurrenz zu den scholastischen "Artisten", die ja einen ähnlichen Anspruch auf<br />
vollständiges <strong>und</strong> wertvolles Wissen erhoben. <strong>Die</strong> häufigen Polemiken von <strong>Humanisten</strong><br />
gegen die aristotelische Schul-Philosophie stehen darum nicht für eine Ablösung einer<br />
alten Lehre durch eine neue, sondern sind Ausdruck des alten <strong>und</strong> ewigen Kampfes um<br />
einen Prioritätsanspruch zwischen Rhetorik <strong>und</strong> Philosophie.
<strong>Die</strong>se sozusagen zeitlose Auseinandersetzung begann nämlich bereits im klassischen<br />
Griechenland mit der Polemik Platons gegen die Sophisten, die die Kunst des<br />
öffentlichen Redens lehrten. Der Vorwurf, den Platon <strong>und</strong> in seinem Gefolge die<br />
Philosophen immer gegen die Rhetorik erhoben, ist, dass diese zu jedem beliebigen<br />
Zwecke eingesetzt werden könne, während die Ziele vorher erst rein philosophisch<br />
geprüft werden müßten. Der Einwand der Rhetoriker - wenn sie nicht den Anspruch der<br />
Philosophie anerkannten wie Cicero - dagegen war stets, dass die Prüfung solcher Ziele<br />
doch selbst immer nur im Medium der rhetorischen Auseinandersetzung erfolgen<br />
könne. <strong>Die</strong>s - die alleinige Gültigkeit des rhetorischen Diskurses bei der Durchsetzung<br />
von Ideen - war in der Renaissancezeit auch schon fast die ganze "neue Philosophie" der<br />
<strong>frühen</strong> <strong>Humanisten</strong>.<br />
Einschub: <strong>Die</strong>ser alte Vorranganspruch der rhetorischen Wissenschaft gegenüber der<br />
Moral-Philosophie, den die <strong>Humanisten</strong> für sich reklamierten, ist übrigens heute im<br />
Gewande des Vorrangs der Untersuchung der Eigengesetzlichkeiten statt vernünftiger<br />
Normen für Diskurse, die verbreitete These von Psychologen, Soziologen, Politologen<br />
- nur mit der Neuerung, dass der rhetorische Diskurs auch über unbewusste Wege wirkt<br />
- <strong>und</strong> innerhalb der Philosophie auch der Ansatz der hermeneutischen Richtung. Auch<br />
die entsprechende praktische Tätigkeit der öffentlichen Überredung <strong>und</strong> <strong>ihre</strong><br />
systematische, wissenschaftlich betriebene Untersuchung führt heute nur andere<br />
Namen: "public relations" zum Beispiel - was gleichsam selbst eine rhetorische<br />
Maßnahme darstellt, denn der klassische Begriff dafür, eben "Rhetorik", scheint wohl<br />
zu antiquiert <strong>und</strong> negativ besetzt zu sein, denn er ist seit Platons (auch rhetorischem)<br />
Obsiegen über die Sophisten etwas in Misskredit geraten. Bezeichnenderweise gibt es in<br />
der hermeneutischen Philosophie (d.h. aus der Heidegger-Tradition) immer wieder<br />
Versuche, in den <strong>Humanisten</strong>, die Rhetoren <strong>und</strong> keine Philosophen waren <strong>und</strong> sein<br />
wollten, frühe Vorläufer der eigenen Philosophie zu sehen. Beispiele dafür bieten die<br />
Werke von Grassi <strong>und</strong> Garin. Dürftige Apologien der <strong>frühen</strong> humanistischen Rhetoren<br />
gegen die aristotelischen Logiker werden dabei nach meinem Eindruck gerne zu (nur<br />
scheinbar) tiefschürfenden hermeneutischen Aussagen verunklart. Immerhin war die<br />
Polemik der <strong>Humanisten</strong> gegen die Scholastiker so erfolgreich, dass sich heute in vielen<br />
Köpfen der besagte Mythos vom Untergang der Scholastik durch den geistigen<br />
Aufschwung des Humanismus festgesetzt hat.<br />
Also noch einmal: <strong>Die</strong> <strong>Humanisten</strong> sind keine (neuen) Philosophen gewesen, <strong>und</strong><br />
philosophisch hatten sie gegenüber der mittelalterlichen Scholastik nicht im<br />
Entferntesten etwas Gleichwertiges zu bieten. Paul Oskar Kristeller schreibt:<br />
<strong>Die</strong> (richtige) "Interpretation sieht in der humanistischen Bewegung lediglich den<br />
Aufschwung der klassischen Gelehrsamkeit, der in der Renaissance stattfand. <strong>Die</strong>se von<br />
den meisten Historikern der klassischen Philologie vertretene Auffassung ist heute nur<br />
nicht sehr beliebt." Und: "Ich glaube, man ist im Licht der späteren Entwicklungen <strong>und</strong><br />
unter dem Einfluss einer modernen Aversion gegenüber der Scholastik geneigt<br />
gewesen, die Opposition der <strong>Humanisten</strong> gegen die Scholastik zu übertreiben <strong>und</strong> ihnen<br />
im Rahmen der Geschichte des wissenschaftlichen <strong>und</strong> philosophischen Denkens eine<br />
Bedeutung zuzuweisen, die sie weder erlangen konnten noch auch tatsächlich erlangten.<br />
<strong>Die</strong> Reaktion auf diese Tendenz war unvermeidlich, aber sie ist ebenso falsch. Jene<br />
Gelehrten, die die Abhandlungen der <strong>Humanisten</strong> lasen <strong>und</strong> feststellten, dass sie einen<br />
verhältnismäßig geringen Gehalt an wissenschaftlichem <strong>und</strong> philosophischem<br />
Gedankengut aufweisen, kamen zu dem Schluss, dass die <strong>Humanisten</strong> schlechte
Wissenschaftler <strong>und</strong> Philosophen waren, die <strong>ihre</strong>n Ansprüchen oder denen <strong>ihre</strong>r<br />
modernen Anhänger nicht gerecht wurden. Ich möchte dagegen behaupten, dass die<br />
<strong>italienischen</strong> <strong>Humanisten</strong> im großen <strong>und</strong> ganzen weder gute noch schlechte Philosophen<br />
waren, sondern überhaupt keine." Und: "<strong>Die</strong> Kritik der <strong>Humanisten</strong> an der<br />
mittelalterlichen Wissenschaft ist oft sehr heftig, aber sie berührt nicht <strong>ihre</strong> spezifischen<br />
Probleme <strong>und</strong> <strong>ihre</strong>n Stoff. Ihre Vorwürfe richten sich in der Hauptsache gegen den<br />
schlechten lateinischen Stil der mittelalterlichen Autoren, gegen <strong>ihre</strong> Unkenntnis der<br />
antiken Geschichte <strong>und</strong> Literatur, <strong>und</strong> gegen <strong>ihre</strong> Beschäftigung mit angeblich nutzlosen<br />
Fragen."<br />
Doch auf seinem eigenen Terrain, den Textstudien, bewirkte der Humanismus<br />
tatsächlich einen ungeheuren Aufschwung der Gelehrsamkeit, von dem durch die<br />
verbesserten Klassiker-Kenntnisse nicht zuletzt auch die eigentlichen Philosophen<br />
Nutzen zogen. Denn unter anderem (aber keineswegs vorrangig) waren die Schriften der<br />
antiken Philosophen ein Forschungsgegenstand der <strong>Humanisten</strong>, so dass sie durch <strong>ihre</strong><br />
rhetorische Arbeit die Kenntnisse auch der alten klassischen philosophischen Texte sehr<br />
vorantrieben.