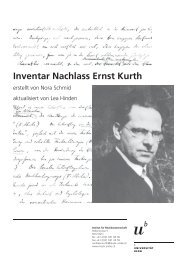Online Ausstellungskatalog (PDF) - Universität Bern
Online Ausstellungskatalog (PDF) - Universität Bern
Online Ausstellungskatalog (PDF) - Universität Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ausstellungskatalog</strong><br />
«Musik in <strong>Bern</strong><br />
zwischen Spätmittelalter<br />
und Reformation»<br />
29. Juni bis 13. Oktober 2007<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek <strong>Bern</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
Zum Geleit<br />
(Prof. Dr. Klaus Pietschmann) .........................................................................2<br />
1. Bedeutung und Funktion von Dufays isorhythmischer Motette<br />
«Magnanime Gentis»<br />
(Valentin Bachmann) .......................................................................................4<br />
2. Kirchengesang am St. Vinzenzstift<br />
(Marko Dermelj) ............................................................................................10<br />
3. Rückkehr des Gemeindegesangs in die Kirche und Entstehung /<br />
Entwicklung des <strong>Bern</strong>er Kirchengesangbuchs<br />
(Hans Ermel) ...................................................................................................15<br />
4. Die <strong>Bern</strong>er Stadtpfeifer<br />
(Anna Katharina Jampen) .............................................................................20<br />
5. Der Hymnenzyklus von Cosmas Alder<br />
(Renata Jeker) ................................................................................................25<br />
6. Die <strong>Bern</strong>er Musikdrucke von Mathias Apiarius<br />
(Irene Salgado) ..............................................................................................30<br />
7. Instrumentendarstellungen im <strong>Bern</strong>er Totentanz<br />
(Katrin Schneeberger) ...................................................................................37<br />
8. Die Bedeutung der Hausmusik in Patrizierfamilien und deren<br />
reiche Musiksammlung<br />
(Viktoria Supersaxo) ......................................................................................44<br />
-1-
Zum Geleit<br />
von Prof. Dr. Klaus Pietschmann<br />
Ob mit Dudelsack, Glocken oder Pfeifen – der <strong>Bern</strong>er Bär der Renaissance war ausgesprochen<br />
musikalisch. In dem Musiktraktat «Ein tütsche Musica» von 1491 begegnet er uns gleich in der<br />
ersten Initiale, und auch in den vorreformatorischen Chorbüchern oder im Chorgestühl des<br />
Münsters tummeln sich die musizierenden <strong>Bern</strong>er Wappentiere. So drollig diese Kameraden auf<br />
den heutigen Betrachter aber auch wirken mögen, die Kontexte, in denen sie begegnen,<br />
schliessen einen humorig augenzwinkernden Hintergrund weitgehend aus. Die Botschaft, die<br />
vermittelt werden soll, ist ausgesprochen seriös: Hier wird ein hohes Mass an Musikalität für die<br />
Stadt <strong>Bern</strong> insgesamt reklamiert. Heute würde man sagen: <strong>Bern</strong> definierte sich als Musikstadt.<br />
Tatsächlich gingen diese Darstellungen mit einem bemerkenswerten Engagement der<br />
Stadtherren einher, das auf den Ausbau einer der wichtigsten Institutionen im Musikleben der<br />
Stadt, des Chorherrenstifts am Münster, zielte. Im Jahre 1485 wurde das Chorherrenstift am<br />
Münster gegründet, dem von Anfang an auch eine Sängerschule angegliedert war. Den dafür<br />
zuständigen Stiftskantor hatte der <strong>Bern</strong>er Rat kurz zuvor eingestellt. Rasch wurde ein<br />
beachtliches Niveau erreicht, wovon nicht zuletzt die Tätigkeit von Komponisten wie<br />
Bartholomäus Frank, Johannes Wannenmacher und Cosmas Alder zeugt, die nach Ludwig Senfl<br />
zu den renommiertesten eidgenössischen Komponisten dieser Zeit gehören. Alder hatte zudem<br />
ebenso wie der bedeutende Humanist und Musiktheoretiker Heinrich Glarean einen Teil seiner<br />
Ausbildung in <strong>Bern</strong> genossen. Bedauerlicherweise nicht erhalten hat sich der Text zu einer<br />
Lobmotette mit der Überschrift «Musicorum <strong>Bern</strong>ensium Catalogus et eorumdem encomium»,<br />
jedoch zeigt allein ihre Existenz, dass sich ein solcher «Katalog» von <strong>Bern</strong>er Musikern überhaupt<br />
aufstellen liess – die Investitionen in die Kantorei des Vinzenzstifts hatten sich also ausgezahlt.<br />
Zwar bedeutete die Reformation auch für <strong>Bern</strong> Bildersturm und Zerstörung vieler kirchlicher<br />
Schätze, jedoch haben sich durch ungewöhnliche Umstände vergleichsweise viele Quellen<br />
erhalten, die über musikalische Standards und Usancen am Vinzenzstift informieren. So etwa die<br />
wertvollen Choralhandschriften des Stifts, die 1528 in das katholisch gebliebene Estavayer-le-Lac<br />
verkauft wurden und sich dort noch heute befinden. Noch erstaunlicher ist die Überlieferung des<br />
mehrstimmigen Hymnenzyklus von Cosmas Alder, der für die feierlichen Vespern im Münster<br />
entstanden sein muss. Solches Repertoire hatte besonders schlechte Chancen, die<br />
Reformationswirren zu überdauern, da es von einem Tag auf den nächsten seine Funktion verlor<br />
und zumeist nicht in so wertvollen Handschriften notiert war wie der Gregorianische Choral.<br />
Alders Kompositionen jedoch erschienen im Jahre 1553 bei dem <strong>Bern</strong>er Drucker Mathias Apiarius<br />
in vier Stimmbüchern, offensichtlich als Hommage an den kurz zuvor verstorbenen Komponisten.<br />
Damit ist <strong>Bern</strong> diejenige reformierte Schweizer Stadt, deren Kirchenmusik am Vorabend der<br />
Reformation am besten dokumentiert ist.<br />
Nachfolgend kam es zu ähnlich weitreichenden Einschnitten wie andernorts. Aufwendige<br />
Kirchenmusik wurde nicht mehr als frömmigkeitsfördernde Einrichtung im Gottesdienst<br />
begriffen, sondern galt als Ablenkung von Gottes Wort und blieb über einige Jahrzehnte hinweg<br />
ausschliesslich der privaten Praxis vorbehalten. Zu einer zögernden Rückkehr kam es erst ab<br />
1558. Neben den Eleven der Münsterschule waren es insbesondere die Stadtpfeifer, die die nach<br />
1528 abgebrochene Orgel ersetzten und dem Gottesdienst von Neuem musikalischen Glanz<br />
verliehen. Eine von Gabriel Hermann prächtig ausgestattete Handschrift mit Psalmvertonungen<br />
aus dem Jahre 1603 zeugt schliesslich von dem wiedererlangten Stellenwert des Gesangs im<br />
reformierten Gottesdienst.<br />
-2-
Die Stadtpfeifer blickten zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine lange Tradition zurück. Für<br />
städtische Repräsentationsanlässe kam ihnen eine zentrale Rolle zu, die durch die Reformation<br />
nicht tangiert wurde. Die aussergewöhnliche öffentliche Anerkennung, die darüber hinaus das<br />
Spielmannswesen insgesamt in <strong>Bern</strong> genoss, lässt sich noch heute an dem um 1545 entstandenen<br />
Dudelsackpfeiferbrunnen in der Spitalgasse ablesen. Das Repertoire solcher Ensembles ist für<br />
diese frühe Zeit in der Regel nicht überliefert, jedoch sind wiederum dank des Druckers Apiarius<br />
einige Kompositionen bekannt, die in <strong>Bern</strong> erklangen: Im selben Jahr wie Alders Hymnen<br />
veröffentlichte er eine Reihe von Bicinien von Johannes Wannenmacher und widmete sie den<br />
<strong>Bern</strong>er Stadtpfeifern.<br />
So erweisen sich die musizierenden Bären als die Zeugen einer reichen Musikkultur, die in<br />
hohem Masse auf das Engagement der öffentlichen Hand zurückging. Die Motive der<br />
Verantwortlichen waren vielfältig und dürften sich von heutigen Zielsetzungen der Kulturpolitik<br />
in mancher Hinsicht nicht so stark unterschieden haben: Neben dem Gemeinwohl spielte die<br />
Konkurrenz zu den anderen Zentren der Eidgenossenschaft sicherlich eine große Rolle –<br />
insbesondere Fribourg trat ausdrücklich in den Wettbewerb ein und gründete an der St.<br />
Nikolauskirche nur zehn Jahre nach der Einrichtung des <strong>Bern</strong>er St. Vinzenzstifts eine in jeder<br />
Hinsicht vergleichbare Institution mit angegliederter Sängerschule. Darüber hinaus dürfte jedoch<br />
ein weiterer Gedanke wesentlich gewesen sein: die weit verbreitete Vorstellung nämlich, dass<br />
eine hochstehende Musikkultur ein intaktes, harmonisches Staatswesen versinnbildlicht und es<br />
ebenso abbildet wie auch bedingt. So fern uns ein solches Denken heute liegen mag – eine umso<br />
grössere Aktualität würde es verdienen.<br />
-3-
1. Bedeutung und Funktion von Dufays isorhythmischer<br />
Motette «Magnanime gentis»<br />
von Valentin Bachmann<br />
Guillaume Dufay und sein Bezug zu <strong>Bern</strong><br />
Guillaume Dufay wurde zwischen 1397 und 1400 als Sohn von Marie Dufay geboren, sein<br />
genaues Geburtsdatum wie auch der Vater sind unbekannt. Den ersten verbürgten Nachweis<br />
finden wir in seinem Eintritt 1409 als puer altaris in die Kathedrale von Cambrai. 1414 bis 1418<br />
war er im Gefolge des Kardinals Pierre d’Ailly am Konzil von Konstanz, wo er in Kontakt mit<br />
Musik aus ganz Europa kam. Besonders die englische Musik hatte grossen Einfluss auf sein<br />
späteres Schaffen. Nach Reisen durch Mitteleuropa wirkte er von 1428 bis 1437 an der<br />
päpstlichen Hofkapelle unter Eugen IV. Danach erhielt er eine Einladung an den Hof von<br />
Savoyen, wo er die Leitung der Hofkapelle übernahm. Dort entstand 1438 die isorhythmische<br />
Motette «Magnanime gentis laudes» als Festmotette zum Friedensschluss zwischen <strong>Bern</strong> und<br />
Fribourg vom 3. Mai 1438. Später kehrte Guillaume Dufay nach Cambrai zurück, wo er 1474<br />
verstarb.<br />
Bereits 1403 schlossen <strong>Bern</strong> und Fribourg einen Vertrag, in dem sie sich gegenseitige Hilfe und<br />
militärische Unterstützung zusagten. 1438 erneuerten sie diesen Vertrag auf Initiative der<br />
Herzöge von Savoyen. Die beiden militärisch vereinten Städte bildeten nämlich ein gutes<br />
Bollwerk gegen Frankreich und die sog. Armagnaken, die gefürchteten Söldner der Grafen von<br />
Armagnac. Darum waren Graf Philipp von Genf und Ludwig von Savoyen persönlich mit ihrem<br />
Gefolge anwesend, finanzierten die Festlichkeiten im Rahmen der Vertragsunterzeichnung und<br />
sorgten für die Aufführung der Motette «Magnanime gentis».<br />
Im Folgenden werden wir einige Aspekte dieser Motette genauer betrachten und gewisse<br />
Begriffe klären.<br />
Isorhythmie<br />
Die Isorhythmie ist eine Kompositionstechnik, die sich um 1300 entwickelt hat. Typische<br />
Merkmale sind ein speziell gebauter Tenor sowie zwei oder mehr Oberstimmen, die voneinander<br />
verschiedene Texte verwenden. Im Tenor wird ein ausgewählter Choralabschnitt paraphrasiert;<br />
er wird wegen seiner spezifischen Bauweise in der heutigen Musikforschung als isorhythmisch<br />
(iso = gleich) bezeichnet. Zeitgenössische Musiktheoretiker beschrieben das Phänomen anders:<br />
ein Color – ein melodisches Schema – wird über eine Talea – ein rhythmisches Schema – gelegt,<br />
wobei die beiden Schemata nicht von gleicher Länge sein müssen. Sie werden mehrfach<br />
wiederholt und bilden so den spezifischen Charakter des Tenors. Nach 1400 waren Color und<br />
Talea oft von identischer Länge, jedoch konnten auch mehrere Taleae in einem Color enthalten<br />
sein.<br />
Anfangs wurden zu hohen Feiertagen geistliche Werke isorhythmisch komponiert, solche Werke<br />
galten als besonders feierlich und kunstvoll. Um 1400 trat eine Verweltlichung der Gattung ein,<br />
jedoch blieb sie kunstvoll und wurde nur für Musik zu speziellen Anlässen gebraucht.<br />
-4-
Choralvorlage «Hec est vera fraternitas», die Dufay in seiner Motette verwendete. 1<br />
Der Tenor «hec est vera<br />
fraternitas» der Motette<br />
«magnanime gentis» von<br />
Guillaume Dufay. Die<br />
verschiedenen Mensurzeichen (rot<br />
markiert) geben dem Sänger an, in<br />
welcher Taktart er die<br />
Wiederholungen zu singen hat. Im<br />
Melodieverlauf ist die<br />
Choralvorlage gut erkennbar. 2<br />
In «Magnanime gentis laudes» von Guillaume Dufay liegt dem Tenor ein Ausschnitt aus dem<br />
gregorianischen Choral «haec est vera fraternitas» zugrunde. Dufay hat die Choralvorlagen zu<br />
seinen Lobmotetten so ausgewählt, dass der Text des Chorals unmittelbar Bezug auf das<br />
besungene Ereignis nimmt, in unserem Falle auf den Friedensschluss zwischen <strong>Bern</strong> und Fribourg<br />
von 1438. Die Talea und der Color dieses Tenors sind völlig identisch; hingegen ist eine andere<br />
Erscheinung zu beobachten, die ebenfalls typisch für die Isorhythmie ist: Der Tenor ist einmal<br />
notiert, wird aber viermal wiederholt, jedoch immer in einer anderen Mensur (‚Taktangabe’), so<br />
dass die Notenwerte gegen Schluss immer kürzer werden (sog. Diminution). Diese<br />
Mensurvorzeichnung gab dem Sänger an, in welchem Verhältnis die Noten (longa zur brevis und<br />
maxima zur longa) geteilt werden, ob zwei oder drei der kürzeren die längere Note ausmachen.<br />
Auffallend ist, dass nach 1450 praktisch keine isorhythmischen Kompositionen mehr zu finden<br />
sind. Zur selben Zeit wird auch die Mehrtextigkeit immer seltener. Im Laufe der nachfolgenden<br />
Jahrzehnte rückt der Tenor von der tiefsten Stimme immer mehr in die Mittelstimmen und wird<br />
auch kompositorisch ausgestaltet. Choralvorlagen werden nicht mehr verwendet, manchmal<br />
wird eine Stimme aus einer früheren Komposition übernommen, aber Neukompositionen<br />
werden zur Regel. Diese Gründe haben wohl dazu geführt, dass die Isorhythmie zugunsten<br />
anderer Entwicklungen, insbesondere dem Tenorlied, verschwand. Warum dies 1450 aber so<br />
abrupt geschah, darüber können wir nur spekulieren. Natürlich gab es auch einige Nachläufer,<br />
welche diese Kompositionstechnik bewusst aufgegriffen haben, so weisen die Motetten des<br />
<strong>Bern</strong>er Komponisten Bartholomäus Frank (wie etwa die in der Ausstellung thematisierte<br />
Komposition «Celsa cumque») Überreste isorhythmischer Strukturen auf.<br />
1 Abschrift nach Lütteken 1993, V. Bachmann.<br />
2 Modena, Bibliotheche estense ed universitaria, Ms .X.1.11<br />
-5-
Quellenlage zu «Magnanime gentis»<br />
Die Motette «Magnanime gentis» von Dufay wurde zum Friedenschluss zwischen <strong>Bern</strong> und<br />
Fribourg 1438 komponiert und auch unter Mitwirkung der savoyischen Hofkapelle in den beiden<br />
Städten aufgeführt. Ein dadurch zu vermutender Besuch Guillaume Dufays in <strong>Bern</strong> findet in<br />
zeitgenössischen Quellen wie etwa der Spiezer Chronik von Diebold Schilling keine Erwähnung,<br />
da der Chronist das kulturelle Geschehen in keiner Weise dokumentiert, es finden nur politisch<br />
relevante Ereignisse Eingang. 3 Darum können wir nicht sagen, ob Dufay persönlich bei der<br />
Aufführung seiner Komposition in <strong>Bern</strong> anwesend war. 4 Da aber nur einige Musiker mitzogen,<br />
ist es nicht zwingend, und aufgrund der Umstände eher unwahrscheinlich, dass Dufay tatsächlich<br />
zu diesem Zeitpunkt mit nach <strong>Bern</strong> zog.<br />
Die Motette selbst ist in der Handschrift Modena B 5 überliefert, die sehr sorgfältig und reich<br />
ausgestattet ist. Entstanden ist die Handschrift in den 1430er Jahren in Ferrara, wobei bis 1448<br />
an ihr gearbeitet wurde. Einige Ergänzungen wurden sogar erst viel später vorgenommen. Die<br />
Handschrift enthält Hymnen, Magnificat-Vertonungen, Motetten, isorhythmische Motetten und<br />
einen grossen Abschnitt mit englischen Kompositionen. Schwerpunkte bilden die Werke von<br />
Dufay mit vierzehn seiner isorhythmischen Motetten und die Kompositionen von John Dunstable<br />
im englischen Teil. Die Handschrift hat stark repräsentativen Charakter und ist nicht für die<br />
Aufführungspraxis bestimmt gewesen, beim Verfassen stand also klar ein dokumentarisches<br />
Interesse im Vordergrund.<br />
Man nimmt an, dass ein grosser Teil der Handschrift mit geistlichen Werken schon früh<br />
abgetrennt wurde und verloren gegangen ist. Eventuell geschah dies, da diese liturgischen<br />
Kompositionen im Gottesdienst verwendet werden konnten, wohingegen die isorhythmischen<br />
Motetten Dufays auf einen Anlass oder ein grosses Ereignis bezogen und nur dann aufführbar<br />
waren. Obwohl die Isorhythmie zur Zeit der Entstehung dieses Codex schon im Niedergang<br />
begriffen war, wurden die isorhythmischen Motetten wohl der Vollständigkeit halber ebenfalls<br />
mit aufgenommen.<br />
Obschon die Handschrift sehr sorgfältig angefertigt wurde, scheint der Kopist nicht über allzu<br />
gute Lateinkenntnisse verfügt zu haben, denn aus den wahrscheinlich ursprünglichen Worten<br />
«magnanime gentis» wurde «magnam me gentes», was aber im Textzusammenhang keinen Sinn<br />
ergibt. So tendiert die heutige Forschung zu «magnanime gentis». 6<br />
Überlegungen zum Text<br />
Zum grossen Fest des Vertragsschlusses am 3. Mai 1438 wurde die Motette «Magnanime gentis»<br />
wahrscheinlich im Moment der Vertragsunterzeichnung in <strong>Bern</strong> und eine Woche später in<br />
Fribourg aufgeführt. Die beiden Oberstimmen haben zwei verschiedene Texte, die gleichzeitig<br />
erklingen. Daraus ist zu schliessen, dass bei solchen Kompositionen nicht die<br />
Textverständlichkeit, sondern die Kunstfertigkeit der Musik im Zentrum stand. Der Text ist – im<br />
Gegensatz zur Musik – denn auch kein ausgefeiltes literarisches Meisterwerk. Aus diesen<br />
Gründen wurde wohl damals der Komponist genannt, der Verfasser des Textes hingegen blieb<br />
anonym.<br />
In der obersten Stimme, dem Triplum, wird <strong>Bern</strong> als eine grosse Stadt gepriesen, die<br />
ausgezeichnete Geister und gute Soldaten hervorbringe. Ihr Ruhm dringe durch die ganze Welt,<br />
von den Spaniern (den Arabern) bis hin zu den Türken. In der zweiten Stimme, dem Motetus,<br />
wird erwähnt, dass <strong>Bern</strong> mit Fribourg ein Bündnis eingehe, und Savoyen das Bündnis der beiden<br />
Städte billige. Auffallend ist, dass Fribourg im Text gerade einmal erwähnt wird, Savoyen<br />
3 Siehe dazu: Schilling, Diebold: Amtliche Spiezer Chronik von 1474 bis 1483.<br />
4 Dazu: Besseler (1952): Neue Dokumente zum Leben und Schaffen Dufays .<br />
5 Modena, Bibliotheche estense ed universitaria, Ms .X.1.11<br />
6 Siehe dazu Holford-Strevens (1997).<br />
-6-
hingegen ist äusserst präsent und wird als «praeclara Sabaudia pacis autrix, servatrix», das<br />
«berühmte Savoyen, des Friedens Begründerin und Bewahrerin», gepriesen.<br />
Die Motette ist nur dreistimmig überliefert, obwohl Dufay seine isorhythmischen Motetten meist<br />
vier- oder fünfstimmig geschrieben hat. Je mehr Stimmen sie aufwies, als desto kunstfertiger und<br />
feierlicher galt eine solche Motette, deshalb stellt sich die Frage, ob möglicherweise Stimmen<br />
beim Kopieren verloren gegangen sind, oder - falls die dreistimmige Anlage ein bewusster<br />
Entscheid des Komponisten war - welche Überlegungen hierzu geführt haben mögen. Von der<br />
Satztechnik und dem Satzbau her ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten, darum können<br />
wir hier nur mutmassen.<br />
Wir stellen also fest: Während der Dichter eher unspektakulär schreibt, ist die Komposition<br />
bemerkenswert. Die Überlieferung der Motette «Magnanime gentis» ist nicht zuletzt auch<br />
deshalb ein Glücksfall, da uns aus dieser Zeit keine anderen bernspezifischen Kompositionen<br />
vorliegen – und umso mehr, als sie von dem wohl bedeutendsten Komponisten des<br />
15. Jahrhunderts stammt.<br />
Text<br />
Triplum<br />
Magnanime gentis laudes paciare, Minerva. 7<br />
Augeat usque suum nunctia fama decus<br />
Vox pegasea locum mundi percurrat ad omnem<br />
Cognoscant Dachus, Teucria, Parthus, Arabs<br />
Quam fortes animos, quam ferrea pectora quamque<br />
Egregios sensus, optima <strong>Bern</strong>a, paris.<br />
Viribus armorum cuius res publica florens<br />
Consilio veterum multiplicata manet.<br />
Que tua gloria sit, maxima gesta docent.<br />
Alleluya, alleluya<br />
Motetus<br />
Nexus amicicie Musa modulante Camenam<br />
Magnificetur, enim nil sine pace valet.<br />
O quando iungi potuisti, <strong>Bern</strong>a, Friburgo,<br />
quanta mali rabies impetuosa ruit!<br />
Optima cum vobis communia vota fuere,<br />
o quibus, o quantis utraque functa fuit!<br />
Vivite felices! Preclara Sabaudia pacis<br />
Autrix, sevatrix federa vestra probat.<br />
Pregentium Ludovicum comitemque Philippum<br />
Cernitis: en magnum pondus amicicie!<br />
Alleluya, alleluya<br />
Tenor<br />
Haec est vera fraternitas<br />
Triplum<br />
Lass, Minerva, die Loblieder eines hochgemuten Volkes zu<br />
Es vergrössere sich die Kunde bis zu seinem Ruhm.<br />
Die Stimme von Pegasus durcheile die Welt bis an jeden Ort<br />
7 Mögliche andere Lesart: mi <strong>Bern</strong>a<br />
-7-
Erkennen möge der Dacier 8 , die Türkei 9 , der Parther 10 , der Araber<br />
Welch tapfere Gemüter, wie eiserne Leiber und wie<br />
Ausgezeichnete Gesinnungen 11 du, ausgezeichnetes <strong>Bern</strong>, hervorbringst.<br />
Durch die Kraft der Waffen bleibt dein Staat blühend<br />
Gekräftigt durch den Rat der Alten.<br />
Die Achtung der Gerechtigkeit, die Hochhaltung des allgemeinen Friedens<br />
- was dich ruhmvoll auszeichnet – lehren grossartige Taten.<br />
Alleluya, alleluya<br />
Motetus<br />
Die freundschaftliche Bindung, während die Muse ein Lied singt,<br />
Möge sich verstärken, weil nichts ohne Friede taugt.<br />
Oh, wann konntest du, <strong>Bern</strong>, dich mit Fribourg verbinden,<br />
wieviel heftige Wildheit des Schlechten überstürzte sich.<br />
Da ihr höchstes Allgemeinwohl gelobtet,<br />
o wem, o wie vielem hatten beide Seiten gedient.<br />
Lebt glücklich! Das herrliche Savoyen, des Friedens<br />
Begründerin und Bewahrerin, billigt euer Bündnis<br />
Den erstgeborenen Ludwig und den Begleiter Philipp<br />
Seht ihr: wohlan ein grosses Freundschaftsgewicht!<br />
Alleluya, alleluya<br />
Tenor<br />
Dies ist wahre Brüderlichkeit<br />
8 Gemeint: Siebenbürge<br />
9 Für teucris(?)<br />
10 Skyther<br />
11 Verstand(?)<br />
-8-
Literatur<br />
Besseler, Heinrich: «Neue Dokumente zum Leben und Schaffen Dufays», in: Archiv für<br />
Musikwissenschaft, Hrsg. Wilibald Gurlitt, Neunter Jahrgang, Troningen, 1952.<br />
Holford-Strevens, Leofranc: «Du Fay the poet? Problems in the texts of his motets», in: Early<br />
music history: studies in medieval and early modern music. London, 1997.<br />
Lütteken, Laurenz: «Guillaume Dufay und die isohythmische Motette», Schriften zur<br />
Musikwissenschaft Band 4., Hamburg – Eisenbach, 1993.<br />
Lütteken, Laurenz: «Dufay, Guillaume», in: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Hrsg.<br />
Ludwig Finscher, Bd. 5 Personenteil, Sp. 1510–1550, Basel, London, New York et al., 1994.<br />
Kügler, Karl: «Isorhythmie», in: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Hrsg. Ludwig<br />
Finscher, Bd. 4 Sachteil, Sp. 1219–1229, Basel, London, New York et al., 1994.<br />
Handschriften<br />
Modena, Bibliothecke estense ed universitaria Ms .X.1.11<br />
Schilling, Diebold: Amtliche Spiezer Chronik von 1474 bis 1483, Burgerbibliothek <strong>Bern</strong>,<br />
Mss.h.h.l.2<br />
-9-
2. Kirchengesang am St. Vinzenzstift<br />
von Marko Dermelj<br />
Spätestens seit den Burgunderkriegen war das bürgerliche Selbstbewusstsein der <strong>Bern</strong>er durch<br />
den Reichtum, die gewonnene Macht und die Vergrösserung des Territoriums erstarkt. Der<br />
Einblick in die Lebensgewohnheiten unterworfener Feinde wie der Burgunder forderte zur<br />
Nachahmung heraus. Im Bereich der Gottesdienstpflege schnitt <strong>Bern</strong> zudem im Vergleich mit<br />
anderen - weit kleineren - Städten wie Solothurn, Luzern und Zürich schlecht ab. Um der<br />
Gottesdienstpflege einen würdigeren und ausstrahlenderen Rahmen zu verleihen, begann man<br />
mit dem Bau einer prachtvollen Kirche, dem Münster (ab 1420), die man mit einer Orgel<br />
ausstattete (1450), und strebte nach Unabhängigkeit in der Gestaltung des religiösen Lebens.<br />
Das Chorherrenstift St. Vinzenz<br />
Eine Verfügung von Papst Innozenz VIII (1484–1492) ermöglichte die Gründung des<br />
Chorherrenstifts St. Vinzenz im Jahre 1484. <strong>Bern</strong> erlangte das Recht, Priester einzusetzen und<br />
Kandidaten für die höheren Stiftsämter vorzuschlagen. Die Ernennung erfolgte jeweils durch<br />
den Bischof von Lausanne, dessen Diözese das Stift zugeordnet war.<br />
Die Stadt hatte sich mit diesem Schritt vom «Deutschen Orden» gelöst, dem seit Jahrhunderten<br />
das <strong>Bern</strong>er Kirchenwesen unterstellt gewesen war, der aber wegen Nachlässigkeiten in Pastoral<br />
und Liturgie zunehmend zu Unzufriedenheit und gar zu Spott Anlass gegeben hatte.<br />
Beanstandet wurden insbesondere die schlechten Latein- und Gesangskenntnisse. Der <strong>Bern</strong>er<br />
Chronist Valerius Anshelm (1475–1546/47) berichtet, dass die Priester den kor so tütsch regierten,<br />
dass schon keiner so vil Latin kund, dass die siben zit- und selgebet, gsang und ampt, item zuo<br />
not der sakramenten handlungen on ärgernuss und on spot vollbracht wurdid.<br />
Die Übernahme des Kirchenregimentes und das Bestreben, die Gottesdienstpflege aufzuwerten,<br />
führten unmittelbar vor der Reformation zu einer kurzen, über die Grenzen <strong>Bern</strong>s hinaus<br />
reichenden Blüte der Kirchenmusik.<br />
Die <strong>Bern</strong>er Sängerschule<br />
Ein grosser Teil der Gebete während der Gottesdienste wurde gesungen. Um den beklagten<br />
Missständen abzuhelfen, wurde eine Sänger- und Stiftsschule gegründet, in der Knaben in<br />
Gesang sowie vor allem im Lesen und Schreiben ausgebildet wurden. Sie wohnten im<br />
stiftseigenen Internat und hatten die Pflicht, täglich - meist einstimmig - in den Gottesdiensten<br />
zu singen. An Feiertagen und bei besonderen Gelegenheiten hatten sie bei der Aufführung<br />
mehrstimmiger Messgesänge in einem erweiterten Chor mitzuwirken, der vor allem aus anderen<br />
Stiftsangehörigen rekrutiert wurde.<br />
Die Oberaufsicht über die Sängerschule, alle Angelegenheiten des Gottesdienstes und die Musik<br />
in der Kirche hatte der Stiftskantor, der nicht unbedingt musikalische Kenntnisse zu haben<br />
brauchte; er konnte sich in gesanglichen Bereichen vom Succentor oder vom Kantoren vertreten<br />
lassen. Mit Probst, Dekan und Kustos teilte er sich die Leitung und Verwaltung des<br />
Chorherrenstiftes. Einige seiner Aufgaben waren, die Gottesdienste zu organisieren, die Stelle<br />
des Kantors mit einer geeigneten Person zu besetzen und das geregelte Funktionieren des<br />
Chores der Sänger- und der Stiftschule zu gewährleisten. Im Zeitraum des Bestehens des<br />
Vinzenzstifts (1485–1528) gab es vier Stiftskantoren:<br />
-10-
Thomas vom Stein (von 1485 bis zu seinem Tode 1519), Martin Lederach (von 1519 bis zu seinem<br />
Tode 1523), Heinrich Wölflin (von 1523 bis 1524) und Konrad Willimann (von 1524 bis zur<br />
Aufhebung des Stifts im Januar 1528).<br />
Nur zwei dieser vier Stiftskantoren hatten sich musikalisch betätigt: Heinrich Wölflin war 1504<br />
bis 1505 Leiter der Sängerei (Kantor) gewesen und Martin Lederach hatte kurz vor seiner<br />
Ernennung zum Stiftskantoren während dreier Monate als Succentor geamtet.<br />
Die Aufgabe des Succentors (Stellvertreter des Stiftskantors) war es, im Gottesdienst die<br />
Intonationen zu singen und im Chor für Disziplin und Ruhe zu sorgen. Der Succentor brauchte<br />
nicht Chorherr zu sein. Im Stiftsmanual (Protokollbuch der Stiftsaktivitäten) werden sechs<br />
Succentoren genannt:<br />
«Herr Steffan» (bis Ende Januar 1513)<br />
Johannes Wannenmacher (vom 27. Jan. bis Sept. 1513, vorher Kantor der Sängerei)<br />
Wernher Fries (vom 9. November 1513 an, vorher Chorleiter)<br />
Bartholomäus Frank (bis 23. August 1519, vorher Chorleiter)<br />
Meister Martin Lederach (vom 7. September 1519 an)<br />
Pankraz Schwäbli (von 1522 bis November 1523)<br />
Meinrad Steinbach (vom 28. November 1523 an).<br />
Den Chorgesang in Kirche und Schule leitete einer der erwachsenen Sänger. Er war als<br />
künstlerischer Leiter verantwortlich für die Ausbildung der Knaben und die praktische Leitung<br />
des Gesanges. In seinen Aufgabenbereich fiel auch die Komposition von Musik für den<br />
Gottesdienst sowie die Anfertigung und Verwahrung der Musikhandschriften.<br />
Im Manual werden mehr als zwanzig Namen von Personen genannt, die in der Sängerei eine<br />
leitende Funktion innehatten. Es kann angenommen werden, dass zwölf davon das Kantorenamt<br />
bekleideten. Sie werden mit den Anreden «Herr» oder «Meister» aufgeführt, wobei «Herr» für<br />
eine geistliche, «Meister» für eine weltliche Person steht:<br />
Meister Hans Schatt (5. Dezember 1486)<br />
Herr Bartholomäus Frank (von November 1488 bis vermutlich 1502)<br />
Meister Franz Kolb (von vermutlich 1502 bis 25. Juni 1504)<br />
Meister Heinrich Wölflin (von 25. Juni 1504 bis 29. September 1505)<br />
Jakob von Zürich (bis 6. Mai 1506)<br />
Herr Wernher Fries von Biel ? (von 6. Mai 1506 bis 10. Februar 1510)<br />
Herr Johannes Wannenmacher (von 13. Februar 1510 bis 15. Februar 1513)<br />
Herr Johann Jardon von Exter (von 15. Februar 1513 bis 29. November 1516)<br />
Herr Jakob Huber von Zürich (3. Dezember 1516 bis März 1518)<br />
Melchior Volmar Rot (Juni 1519)<br />
Herr Peter Hänni von Konstanz (von 2. September 1521 bis 10. Juni 1523)<br />
Cosmas Alder (6. April 1524), Künzi (bis 1528)<br />
Persönlichkeiten, die sich in der Zeit des Bestehens des Stifts besonders hervortaten, waren:<br />
als Stiftskantoren: Martin Lederach (1519–23) und Heinrich Wölflin (1523–24),<br />
als Kantoren: Bartholomäus Frank (1488–1502), Franz Kolb (1502–04), Johannes Wannenmacher<br />
(1512–13), Cosmas Alder (1523–24).<br />
Glarean, der spätere Humanist, hat höchstwahrscheinlich 1499 bis 1500 als Chorknabe die<br />
Stiftsschule besucht.<br />
-11-
Die Gottesdienstgesänge<br />
Das Kernstück des gottesdienstlichen Gesangs war der gregorianische Choral, der einstimmige,<br />
unbegleitete Gesang der römischen Liturgie mit lateinischem Text. Er ist integraler Bestandteil<br />
der Liturgie und hat auch heute noch «die Ehre Gottes und die Heiligung der Gläubigen»<br />
(II. Vatikanisches Konzil) zum Ziel. Der Choraltext gilt normalerweise als «Heilige Schrift», er<br />
vermittelt also Inhalte, die nicht von Menschen, sondern von Gott stammen. Als gesungenes<br />
Gebet ist der Choral beispielhaft für das Beten überhaupt; äusserer Ausdruck und innere<br />
Bewegtheit werden verbunden.<br />
Anders als heute gelegentlich praktiziert, war der spätmittelalterliche Choralgesang der<br />
Geistlichkeit bzw. angestellten Sängern und Chorknaben vorbehalten, insbesondere in grossen<br />
Stiftskirchen wie dem <strong>Bern</strong>er Vinzenzstift. Gemeindegesang wurde lediglich in den Pfarrkirchen<br />
praktiziert.<br />
Man unterscheidet zwei Arten des einstimmigen Choralgesanges, die Gesänge des<br />
Stundengebets und die Gesänge der Messe. Das Stundengebet gliederte den Tagesablauf mittels<br />
der sog. Horen (Matutin, Terz, Sext, Non, Vesper, Nocturn). Die Melodien sind einfach und<br />
wurden von allen Beteiligten gesungen. Der Text ist hier syllabisch vertont (eine Silbe pro Ton,<br />
resp. auf höchstens drei Tönen). Die Gesänge der Messe dagegen sind kunstvoller und häufig<br />
durch lange Tonketten charakterisiert (melismatisch). Gleichbleibenden Messteilen (Ordinarium)<br />
standen wechselnde Teile gegenüber (Proprium), die sich nach Festen oder Tagesheiligen<br />
richteten.<br />
Die Choralhandschriften des Vinzenzstifts<br />
Mit der Gründung des Stifts im Jahre 1484 übernahm die <strong>Bern</strong>er Kollegiatskirche die Liturgie der<br />
Diözese Lausanne. Die bereits vorhandenen Handschriften der alten Leutkirche <strong>Bern</strong>s enthielten<br />
zwar durchaus alle für die Gottesdienste benötigten Gesänge; weil jedoch der Choralgesang in<br />
der Lausanner Gottesdienstpflege eine weit höhere und feierlichere Bedeutung hatte, wurde<br />
zum Anlass der Stiftsgründung die Herstellung neuer Gesangsbücher in Auftrag gegeben. Diese<br />
enthielten alle einstimmigen Gesänge für den liturgischen Tages- und Jahresablauf der<br />
Stundengebete entsprechend der überlieferten römischen Choraltradition.<br />
Drei Antiphonare, den Winter- und den Sommerteil (pars hiemalis, pars aestivalis) der Gesänge<br />
enthaltend, wurden im Doppel, je eine Ausgabe für den linken und eine für den rechten Teil des<br />
Chores, hergestellt. Obwohl die Handschriften nach der Reformation funktionslos geworden<br />
waren, sind alle sechs Exemplare bis heute erhalten geblieben, da sie nach Estavayer-le-Lac und<br />
Vevey verkauft wurden. Heute werden die Codices in einem Gebäude der Kirchgemeinde<br />
Estavayer (Bände I, II und III sowie das Doppel von Band III) bzw. im historischen Museum von<br />
Vevey verwahrt.<br />
Die Bücher bestehen aus ca. 60 x 40 cm messenden Pergamentseiten (Band I aus 771, Band II aus<br />
632 und Band III / IV aus 232). Jede Seite enthält acht Systeme mit vier Notenlinien, auf denen die<br />
Melodien der Gesänge in Quadratnotation und darunter der lateinische Text handschriftlich<br />
festgehalten werden. Die Seiten sind mit bildlichen und ornamentartigen Darstellungen reich<br />
verziert und kräftig, strahlend, sehr oft unter Verwendung von Goldfarbe illuminiert.<br />
Anfangsbuchstaben (Initialen) und Miniaturen enthalten Darstellungen biblischer Inhalte, die<br />
auch Gegenstand der jeweiligen Gesänge sind. Die Kunsthistoriker Joseph Leisibach (Freiburg)<br />
und Albert Jörger (Horgen) schreiben die Erstellung des grösseren Teils der Miniaturen einem<br />
anonymen Künstler zu, der wegen seiner Arbeit an zwei Gesangsbüchern für den Bischof von<br />
-12-
Sitten, Josse de Silenen, nachträglich der «Meister von Silenen» genannt wird. Die Verzierungen<br />
und Bilder der Initialen werden dem Walliser Kalligraphen Conrad Blochinger zugeschrieben.<br />
Im Verlaufe der Reformation wurden viele Kunstwerke mit religiösem Inhalt zerstört.<br />
Die meisten Musikhandschriften des Vinzenzstifts gingen verloren. Bücher, die mehrstimmige<br />
Gesänge von kurzer Aktualitätsdauer enthielten und für deren Erstellung vergleichsweise wenig<br />
Aufwand und Sorgfalt aufgebracht worden war, stellten einen zu kleinen Wert dar, als dass man<br />
sich um ihre Rettung bemühen wollte.<br />
Die sechs <strong>Bern</strong>er Antiphonare aber wurden vom Savoyischen Händler Jean de Crée am 22.<br />
November 1530 gekauft und dadurch gerettet. Dieser war sich wohl bewusst, dass sich die<br />
prächtigen Bücher mit Choralgesängen zur Liturgie der Diözese Lausanne in einer nicht<br />
reformierten Stadt innerhalb der Diözese bestens verkaufen lassen würden.<br />
Den Kauf belegt eine Notiz, die von Lupulus (Heinrich Wölflin benutzte hier seinen Namen in<br />
lateinischer Übersetzung), Chorherr und Notar von St. Vinzenz, unterzeichnet ist. Vier dieser<br />
Bücher wurden drei Tage später von der Kirche Estavayer-le-Lac gekauft und fortan während ca.<br />
140 Jahren (bis zur Neuanpassung an die Römische Liturgie um 1686) in den Gottesdiensten<br />
verwendet.<br />
Seit ihrer Restauration durch den Tessiner Restauratoren Andrea Giovannini (1996 bis 2006)<br />
werden die Bücher in ihrer wiedergewonnenen Pracht unter grossen Vorsichtsmassnahmen<br />
gelagert. Der gute Zustand der beiden Bücher von Vevey - die Miniaturen und Illuminationen<br />
haben ihre volle Farbenpracht und Leuchtkraft bewahrt - lässt vermuten, dass diese nach dem<br />
Verkauf im Gottesdienst nicht mehr verwendet wurden.<br />
Um 1488 muss in <strong>Bern</strong> ein neues Graduale (Kirchengesangbuch mit den Gesängen der Messe)<br />
vorhanden gewesen sein, da sechs Zierbuchstaben für ein solches Buch in Auftrag gegeben<br />
worden waren. Es ist nicht klar, ob Teile dieser Handschrift möglicherweise erhalten geblieben<br />
sind. Auch die sechs <strong>Bern</strong>er Antiphonare entstanden zwischen 1485 und 1490.<br />
Der Inhalt der vier Exemplare von Estavayer wurde von Jürg Stenzl beschrieben:<br />
Band I:<br />
- Temporale pars hiemalis,<br />
- Sanctorale pars hiemalis,<br />
- Commune Sanctorum und<br />
- Sabbatis diebus Officium Beate Marie ab oct. Epiphanie usque ad Purificationem.<br />
Band II:<br />
- Sanctorale pars aestivalis,<br />
- Commune Sanctorum,<br />
- In festo beatorum decem milium mr.: Offizium Laudate omnes gentes dominum und<br />
- Sequitur Officium beate Marie virginis ab octavis Eucaristie usque ad Adventum dni. diebus<br />
Sabbatis.<br />
Band III und IV:<br />
- Temporale pars aestivalis : Vig . Resurrectionis - Dom. XXV post oct. Pent . und<br />
- Sequntur Invitatoria dicenda per ordinem dominicis diebus.<br />
<strong>Bern</strong>ische Urheberschaft in den Gesängen der Antiphonarien suchte Stenzl vor allem in neueren,<br />
oft durch lokale Feste bedingten Choraltypen wie Reimoffizien, Tropen oder Messprosen<br />
(Sequenzen), jedoch blieb diese Untersuchung ergebnislos: Das Repertoire der Antiphonarien<br />
besteht ausnahmslos aus Gesängen, die damals in Westeuropa oder zumindest in der<br />
Westschweiz weit verbreitet waren.<br />
-13-
Literatur<br />
De Capitani, François: «Musik in <strong>Bern</strong>», <strong>Bern</strong>, 1993.<br />
Geering, Arnold: «Geschichte der Musik in der Schweiz, von der Reformation bis zur Romantik»,<br />
Zürich, 1939.<br />
Joppich, Godehard: «Der Gregorianische Choral», Engelberger Musikhefte, Engelberg, 1998.<br />
Jörger, Albert: «Der Miniaturist des Breviers des Jost von Silenen», Sitten, 2001.<br />
Stenzl, Jürg: «Zur Kirchenmusik im <strong>Bern</strong>er Münster vor der Reformation», in: Festschrift Arnold<br />
Geering zum 70. Geburtstag, <strong>Bern</strong>, 1972.<br />
Tremp-Utz, Kathrin: «Das Kollegiatsstift St. Vinzenz in <strong>Bern</strong>, von der Gründung 1484/85 bis zur<br />
Aufhebung 1528», <strong>Bern</strong>, 1985.<br />
-14-
3. Rückkehr des Gemeindegesangs in die Kirche und Entstehung /<br />
Entwicklung des <strong>Bern</strong>er Kirchengesangbuchs<br />
von Hans Ermel<br />
Auswirkungen der Reformation auf die Kirchenmusik<br />
Im Zusammenhang mit den Zürcher Disputationen (1523 und 1524) äusserte sich Ulrich Zwingli<br />
(1484–1531) neben religiösen Fragen auch zur Musik und zum Kirchengesang und verlangte<br />
deren vollständige Verabschiedung aus dem Gottesdienst und der Kirche. Zwingli war aber nicht<br />
der Gesang an sich ein Dorn im Auge, es war vielmehr die alte Ordnung des Gottesdienstes, die<br />
er überwinden wollte. Er befürchtete, dass ein Festhalten an der traditionellen Liturgie die<br />
Reformation behindern könnte. Weiter kritisierte er am Kirchengesang, dass dieser sich mehr<br />
und mehr verselbständigt habe, zu kunstvoll geworden sei und nicht mehr der Sache diene,<br />
daher auch vom Wesentlichen, nämlich der Andacht ablenke. Schliesslich missfiel ihm, dass die<br />
Texte lateinisch waren und vom Volk (und oft auch von den Priestern!) nicht verstanden wurden.<br />
Der Haus- und Schulmusik hingegen war Zwingli sehr wohl gesinnt und förderte diese sogar. Er<br />
selbst war musikalisch sehr begabt, spielte mehrere Instrumente und komponierte auch einige<br />
(z. T. mehrstimmige) Psalmen und Lieder, hatte aber nie vorgesehen, diese im Gottesdienst zu<br />
verwenden.<br />
An der entscheidenden Disputation in <strong>Bern</strong> vom 6. bis zum 26. Januar 1528, an der Zwingli und<br />
die gesamte theologische Prominenz aus den evangelischen Städten der Schweiz und<br />
Süddeutschlands teilnahmen, war abzusehen, dass sich die reformatorischen Kräfte durchsetzen<br />
würden. Am Vorabend des 22. Januars 1528, dem Fest des Heiligen Vinzenz, wurde im <strong>Bern</strong>er<br />
Münster die letzte Messe gelesen. Am Tag darauf blieb die Orgel verschlossen, die liturgischen<br />
Gesänge verstummten. Wenige Tage später wurden die Orgeln in den Stadt-<strong>Bern</strong>er Kirchen<br />
abgebaut und verkauft. Die Münsterorgel beispielsweise gelangte nach Sitten, der letzte<br />
Organist, Moritz Kröul, erhielt eine Stelle als Sigrist. Ebenso wurde das Glockengeläut den neuen<br />
Umständen angepasst. So erklang es beispielsweise bei Beerdigungen und bei drohenden<br />
Gewittern nicht mehr, was jedoch zu einiger Irritation führte, da das Geläut doch sehr im Alltag<br />
der <strong>Bern</strong>er Bevölkerung verankert war (De Capitani 1993).<br />
<strong>Bern</strong> setzte die neuen Bestimmungen in seinem ganzen Territorium um, zum Teil aber gegen<br />
heftige Widerstände. 1536 wurde die Waadt erobert, wo sich die Umsetzung einfacher<br />
gestaltete, weil Johannes Calvin (1509–1564) bereits Vorarbeit geleistet hatte. Calvin weilte ab<br />
1536 in Genf und stand dort zusammen mit dem Prediger Guillaume Farel (1489–1565) an der<br />
Spitze der reformatorischen Bewegung.<br />
Somit waren Musik und Gesang auf lange Zeit aus den <strong>Bern</strong>er Kirchen verbannt: Die Ereignisse<br />
der Reformation stoppten eine verheissungsvolle Entwicklung und veränderten das musikalische<br />
Leben nachhaltig (nähere Angaben zum musikalischen Leben in <strong>Bern</strong> vor der Reformation finden<br />
sich in den Beiträgen von Marko Dermelj und Anna-Katharina Jampen).<br />
Rückkehr des Gemeindegesangs<br />
Der Gesang fand den Weg zurück in die Kirche über die Schule. Im Zuge einer verstärkten<br />
Förderung des Psalmengesangs in der Lateinschule beschloss die <strong>Bern</strong>er Obrigkeit im Jahre 1538,<br />
alle drei Wochen Schüler vor dem Gottesdienst einen Psalm singen zu lassen und bereitete damit<br />
den Boden für die Rückkehr des Gesangs in den Gottesdienst. Ab 1558 sangen die Schüler dann<br />
vor jedem Gottesdienst einen Psalm.<br />
-15-
Johannes Haller (1523–1575, führender Geistlicher in <strong>Bern</strong>):<br />
Als man bishar allein zu dryen wuchen im kinder bericht einest psalmen gsungen, ward<br />
geordnet, das man fürthin all sontag vor der predig ein psalmen singen solt. (Fluri 1902)<br />
Dieser Vorstoss geht auf den Theologieprofessor Wolfgang Musculus (1497–1563) und den<br />
Geistlichen Johannes Haller zurück. Musculus kam nach Stationen in Strassburg und Augsburg<br />
1549 nach <strong>Bern</strong> und war wahrscheinlich erstaunt, dass hier der Gottesdienst ohne jegliche Musik<br />
von statten ging. Im Vorwort zur Hymnenausgabe von Cosmas Alder (um 1497–1550) im Jahre<br />
1553 schreibt er sogar:<br />
«Es ist nämlich nicht so, wie irgend ein Griesgram sagen möchte, dass dies (der<br />
Gottesdienst) ohne Hymnen und Lieder allein durch die Übung Gottes Wort geschehen<br />
könne.»<br />
Es gilt zu beachten, dass mit dem Griesgram Ulrich Zwingli gemeint war!<br />
1574 wurde mit Hans Kiener der erste Kantor nach der Reformation gewählt, und er war<br />
angehalten, dass man alle Sonntage vor und nach der Predigt Psalmen singen sollte. Bereits 1573<br />
ist in einem Ratserlass vom «nüw gesang» die Rede, was darauf schliessen lässt, dass ab diesem<br />
Zeitpunkt wieder von Gemeindegesang gesprochen werden kann (Aeschbacher 1981). Hierbei<br />
handelt es sich aber immer um einstimmigen Gesang. Aus praktischen Gründen sollte aber dieses<br />
Psalmensingen nur im Sommer stattfinden: «den winter sol mans umb der kelti willen<br />
underlassen!» (Fluri 1902). Das Gesangsrepertoire basierte im wesentlichen auf demjenigen von<br />
Konstanz und Strassburg, das wohl massgeblich durch Musculus in <strong>Bern</strong> bekannt gemacht wurde.<br />
Ab 1581 unterstützten die vier <strong>Bern</strong>er Stadtpfeifer (ein Zinkenist und drei Posaunisten) den<br />
Gemeindegesang (Geering 1933).<br />
Genfer Psalter (Hugenottenpsalter)<br />
Die Psalmen sind Gebetstexte des alten Testaments, die der Tradition zufolge von König David<br />
verfasst wurden, und die wahrscheinlich zum Teil tatsächlich aus dieser Zeit stammen, zum Teil<br />
aber erst später entstanden sind. In ihnen kommen alle Gefühle zum Ausdruck, die der Gläubige<br />
Gott gegenüber haben kann: Lob, Dank, Jubel, aber auch Trauer, Klage, Verzweiflung. Wegen<br />
ihrer großen Bedeutung im Gottesdienst gibt es Psalmenvertonungen aus allen Epochen und in<br />
allen musikalischen Stilrichtungen.<br />
Für das Repertoire des Kirchengesangs wurde im späten 16. Jahrhundert der Genfer Psalter 12<br />
zentral: Auch in Genf war der Gottesdienst nach der Reformation 1536 zunächst ohne Gesang<br />
vorgesehen gewesen, bevor Calvin bei seinem Aufenthalt in Strassburg 1538 mit dem dortigen<br />
deutschen Psalmengesang in Kontakt kam. Hierauf initiierte er eine erste französische<br />
Psalmensammlung: «Auculns Pseaumes et cantiques mys en chant» (Strassburg 1539). Der Gesang<br />
sollte dazu dienen, die Herzen zu entflammen und dadurch näher zu Gott zu kommen.<br />
Parallel dazu nahm auch der Dichter Clément Marot versifizierte Übersetzungen von zunächst 30<br />
Psalmen vor. 1542 erweiterte Calvin sein Psalmenbuch um einige dieser Psalmübersetzungen<br />
Marots, die Melodien dazu stammten wahrscheinlich vom Genfer Vorsänger und Singlehrer<br />
Guillaume Franc. 1543 kam es zu einer erweiterten Auflage mit 50 Psalmen. Die Texte stammten<br />
nun sämtlich von Marot, die Melodien wahrscheinlich von Franc. 1551 kam es wiederum zu einer<br />
erweiterten Auflage mit nun 83 Psalmen, die neuen Melodien stammten nun von Francs<br />
Nachfolger Loys Bourgeois, die Verse von Théodore de Bèze. Dieser führte seine<br />
Übersetzungsarbeit nachfolgend fort, so dass 1562 dann der gesamte Psalter mit allen 150<br />
Psalmen erscheinen konnte, die Melodien stammten von einem nicht mit Sicherheit<br />
bestimmbaren Maitre Pierre (wahrscheinlich Pierre Davantès).<br />
12 Psalter = Psalmenbuch<br />
-16-
Claude Goudimel komponierte 1564 über sämtliche Psalmen vierstimmige Sätze. Dabei<br />
entstanden drei verschiedene Sammlungen mit je unterschiedlichen Satztechniken:<br />
• Grossangelegte polyphone Motetten, die aus der Psalmmelodie Motive für den<br />
imitatorischen Satz gewinnen.<br />
• Cantus-Firmus-Motetten, welche die Psalmmelodie in einer Stimme unverändert<br />
durchführen (Tenor oder Diskant) und von den anderen Stimmen mehr oder weniger<br />
dicht imitieren lassen, wobei auch homophone Partien vorkommen.<br />
• Homophoner Satz Note gegen Note, Melodie meist im Tenor.<br />
Es sei betont, dass die Sätze Goudimels in erster Linie für den häuslichen Gebrauch vorgesehen<br />
waren, aber dann rasch Eingang in die Kirchenmusik fanden (De Capitani 1993).<br />
Lobwasser-Psalter<br />
Der aus Königsberg stammende Jurist Ambrosius Lobwasser (1515–1572) studierte unter<br />
anderem an der <strong>Universität</strong> Bourges in Frankreich, wo er die französischen Psalmen<br />
kennenlernte. Die Kraft und Schönheit der Melodien prägten ihn nachhaltig. Die Motivation zur<br />
Übersetzung war für ihn sprachlicher, nicht religiöser Natur.<br />
Lobwasser hielt sich in seiner Übersetzung genau an das Versmass des französischen Originals.<br />
Die Übersetzung fiel sprachlich zwar eher holprig aus, jedoch liess sie sich den Genfer Melodien<br />
von 1562 unverändert unterlegen, so dass der gesamte Psalter mit den vierstimmigen,<br />
homophonen Sätzen Goudimels gesungen werden konnte. Die Sätze Goudimels erfuhren<br />
dadurch eine grosse Verbreitung im deutschsprachigen Raum, denn nach seinem Erscheinen im<br />
Jahre 1573 trat der Psalter im deutschen Sprachraum einen wahren Siegeszug an und fand zu<br />
Beginn des 17. Jahrhunderts auch Eingang ins <strong>Bern</strong>er Gesangbuch.<br />
Trotz der sprachlichen Mängel hielten sich die Lobwasser-Psalmen bis ins 18. Jahrhundert im<br />
<strong>Bern</strong>er Kirchengesangbuch!<br />
Das <strong>Bern</strong>er Kirchengesangbuch im 17. Jahrhundert<br />
Für den Schweizer Kirchengesang war das Konstanzer Gesangbuch, zusammen mit dem<br />
Strassburger Psalter, im 16. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung. Seit der Wende vom 16.<br />
zum 17. Jahrhundert wurde dann, wie bereits erwähnt, der Lobwasser-Psalter zentral. Das erste<br />
Zürcher Gesangbuch von 1598 beruhte zum grössten Teil auf dem Repertoire von Konstanz und<br />
dem Strassburger Psalter, daneben enthielt es aber auch Lobwasser-Psalmen (Marti 2004).<br />
In <strong>Bern</strong> tauchten um 1603 die ersten 24 Psalmen Lobwassers in einer prächtigen, auf Pergament<br />
geschriebenen Handschrift auf, ein kalligraphisches Meisterwerk des deutschen Schulmeisters<br />
Gabriel Hermann (1556–1631). Die Handschrift, die für den Kantor bestimmt war, trägt<br />
folgenden Titel: Christenliche Kirchengesang, das ist: Die ußerläßnesten und brüchlichesten<br />
Psalmenn Dauids, uß dem alten Psalmenbuch, und D. Ambrosii Lobwassers Composition<br />
gezogen. Sampt den Fästgesangenn unnd geistlichen Liederen, für die Kilchen <strong>Bern</strong> zusamenn<br />
gesetzt 1603 (<strong>Bern</strong>, Burgerbibliothek, Codex A 33).<br />
Der Kantor war angehalten, die Handschrift mit äusserster Sorgfalt zu behandeln.<br />
Im Jahre 1606 erschien das erste <strong>Bern</strong>ische Kirchengesangbuch, neben den Lobwasserpsalmen<br />
enthielt es weiterhin Psalmen aus Strassburg (sog. «Alte Psalmen») und geistliche Lieder aus<br />
Konstanz und Zürich. Diese Ausgabe ist bloss einstimmig erschienen.<br />
Die Ausgabe von 1620 (in der Kantonsbibliothek Aarau vorhanden) enthielt bereits 35, der Druck<br />
von 1655 dann alle 150 Lobwasserpsalmen. Dadurch geriet das deutsche Liedgut (beispielsweise<br />
der Strassburger Psalter oder Psalmvertonungen von Luther) deutlich in den Hintergrund. Auch<br />
diese Ausgaben sind lediglich einstimmig erschienen. Die genauen Kriterien für die Auswahl von<br />
-17-
Psalmen aus dem Strassburger Psalter oder dem Genfer Psalter sind bis anhin nicht hinreichend<br />
bekannt.<br />
Ab 1675 erschien das vom Stadtzinkenisten Johann Ulrich Sultzberger (1638–1701) bearbeitete<br />
Transponierte Psalmenbuch. Er passte die vierstimmigen Psalmen von Goudimel den örtlichen<br />
Verhältnissen an, indem er die Schlüsselzahl verringerte (von vier auf zwei), Transpositionen für<br />
tiefere Stimmen vornahm und alle Choralmelodien in den Tenor versetzte. Ab 1677 enthielten<br />
die <strong>Bern</strong>er Gesangbücher eine eigentliche Singschule, die den Gemeindemitgliedern das<br />
Notenlesen und das sichere Treffen der Intervalle beibringen wollte. Diese Singschule hielt sich<br />
bis 1853 im <strong>Bern</strong>er Gesangbuch (Marti 2004)!<br />
Aus den Jahren 1675 bis 1680 sind acht Ausgaben bekannt, gedruckt wurden sie von Samuel<br />
Kneubühler, auf Kosten Sultzbergers (Fluri 1920). Der Zürcher Künstler Conrad Meyer zeichnete<br />
zu drei der Ausgaben je ein doppelseitiges Titelblatt (Fluri 1920, Roder 2003). Die Ausgaben mit<br />
Titelkupfer waren entsprechend teuer, was zeigt, dass ein Kirchengesangbuch etwas Kostbares<br />
darstellte.<br />
Die acht Ausgaben des <strong>Bern</strong>er Gesangbuchs (1675–1680) im Überblick:<br />
• 1675: vierstimmige Ausgabe, Stimmen nebeneinander, kleiner Druck.<br />
• 1676: zweistimmige Ausgabe, Stimmen in Partitur (Tenor und Bass), grosser Druck.<br />
• 1676: zweistimmige Ausgabe, Stimmen nebeneinander (Tenor linke Seite, Bass rechte<br />
Seite), grosser Druck.<br />
• 1676: zweistimmige Ausgabe, Stimmen in Partitur (Tenor und Bass), grosser Druck.<br />
• 1676: zweistimmige Prachtausgabe mit doppeltem Titelkupferblatt, Stimmen in Partitur<br />
(Tenor und Bass), grosser Druck.<br />
• 1677: einstimmige Ausgabe, Noten zu jeder Strophe, Einleitung: «An den Musicbegierigen<br />
Leser», eine ausführliche Gesangslehre (vgl. weiter oben), kleiner Druck.<br />
• 1678: Kein vollständiges Exemplar gefunden, Prachtausgabe mit doppeltem<br />
Titelkupferblatt.<br />
• 1680: vierstimmige Prachtausgabe mit doppeltem Titelkupferblatt, Stimmen<br />
nebeneinander, kleiner Druck.<br />
Sultzberger hatte schon zu Beginn seiner Arbeit versprochen, sein Psalmbuch sowohl in grossem<br />
als auch in kleinem Format herauszugeben. Ferner hatte er auch von Anfang an ein- und<br />
mehrstimmige Ausgaben geplant (Brönnimann 1919). Die zweistimmigen Ausgaben von 1676<br />
waren vorwiegend dazu gedacht, die Tenorstimme durch eine Instrumentalstimme (Bass oder<br />
Clavier) begleiten zu lassen. Sie waren auch ausdrücklich für das private Musizieren und die<br />
Hausmusik bestimmt (Roder 2003). Die Ausgaben in grossem Druck sollten denjenigen behilflich<br />
sein, welche wegen blöde (hier: Schwäche) des gesichts, einen kleinen Truck und Noten nicht wol<br />
begreiffen können (Sultzberger 1676; in Brönnimann 1919, S. 69).<br />
Die Verdienste von Sultzberger um das Musikleben in <strong>Bern</strong> sind gross. Während seines Wirkens<br />
als Musikdirektor in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erlebte <strong>Bern</strong> eine musikalische<br />
Blütezeit.<br />
-18-
Literatur<br />
Aeschbacher, Gerhard: «Die Reformation und das kirchenmusikalische Leben im alten <strong>Bern</strong>»,<br />
<strong>Bern</strong>, Verlag des Historischen Vereins des Kantons <strong>Bern</strong>, 1981.<br />
<strong>Bern</strong>oulli, Peter Ernst und Frieder Furler: «Der Genfer Psalter - eine Entdeckungsreise»,<br />
Zürich, TVZ, 2001.<br />
Brönnimann, Fritz: «Der Zinkenist und Musikdirektor Johann Ulrich Sultzberger und die Pflege<br />
der Musik in <strong>Bern</strong> in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts», Diss phil, <strong>Bern</strong>, 1919.<br />
De Capitani, François: «Musik in <strong>Bern</strong>: Musik, Musiker, Musikerinnen und Publikum in der Stadt<br />
<strong>Bern</strong> vom Mittelalter bis heute», <strong>Bern</strong>, Historischer Verein des Kantons <strong>Bern</strong>, 1993.<br />
Fluri, Adolf (Hrsg): «Beschreibung der deutschen Schule zu <strong>Bern</strong>. Aufzeichnungen der deutschen<br />
Lehrmeister Gabriel Hermann (1556–1632) und Wilhelm Lutz (1625–1708)», <strong>Bern</strong>, Stämpfli, 1902.<br />
Fluri, Adolf: «Versuch einer Bibliographie der bernischen Kirchengesangbücher», in: Gutenberg-<br />
Museum, 6. Jg. <strong>Bern</strong> 1920, S. 35-47 und 117-120; 7. Jg. 1921, S.22-24 und 85-88; 8. Jg. 1922, S. 20-<br />
22 und 94-97; 10. Jg. 1924, S. 88-96, <strong>Bern</strong>, Gutenbergmuseum (Zeitschrift!), 1920–1924.<br />
Geering, Arnold: «Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation: Leben und Werke<br />
von Bartholomäus Frank, Johannes Wannenmacher, Cosmas Alder», Aarau, Sauerländer, 1933.<br />
Marti, Andreas: «Die Rezeption des Genfer Psalters in der deutschsprachigen Schweiz und im<br />
rätoromanischen Gebiet», in: Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der<br />
Schweiz und den Niederlanden: 16.–18. Jahrhundert, hrsg. von Eckhard Grunewald ... [et al.],<br />
Tübingen, Niemeyer, 2004.<br />
Roder, Martin: «Eine bisher nicht bekannte Ausgabe eines <strong>Bern</strong>er Psalmenbuches aus dem Jahr<br />
1676», Evilard, 2003.<br />
-19-
4. Die <strong>Bern</strong>er Stadtpfeifer<br />
Einleitung<br />
von Anna Katharina Jampen<br />
Die Stadtpfeifer galten als illustre, hoch geachtete Vereinigung 13 : Bei offiziellen Anlässen<br />
übernahmen sie die Funktion von klingenden Repräsentanten der Stadt, und bei Festen der<br />
Bürger wurde ihr Spiel geschätzt 14 . Die Stadtpfeifer bildeten nicht - wie etwa die Handwerker -<br />
eine eigene Gesellschaft; es ist aber denkbar, dass sie einer Art Pfeifer-Bruderschaft angehörten.<br />
Deren Vorsteher, der Pfeiferkönig, wachte über Recht und Ordnung und trug eine von den<br />
<strong>Bern</strong>er Stadtbehörden gestiftete Krone. Die Ernennung eines Pfeiferkönigs geht auf die<br />
Tradition der Spielleute zurück und ist Ausdruck des Bedürfnisses der Obrigkeit, die fahrenden<br />
Musiker zu kontrollieren. Der Pfeiferbrunnen - der Gruppe der <strong>Bern</strong>er Figurenbrunnen, die<br />
zwischen 1539 und 1544 erschaffen wurden, zugehörig - steht wohl im Zusammenhang mit den<br />
Musikerorganisationen der Stadt <strong>Bern</strong>. Da jedoch die Brunnenfigur, ein zerlumpter<br />
Dudelsackspieler, eher einem fahrenden Spielmann gleicht, ist ein direkter Bezug zu den<br />
Stadtpfeifern nicht wahrscheinlich.<br />
Die Geschichte der Stadtmusiker lässt sich in <strong>Bern</strong> bis ins Jahr 1375 zurückverfolgen. Bereits<br />
damals bestanden in Untergruppen verzweigte Verbände: unter ihnen die Feldpfeifer oder<br />
Pfeifer der «Venneren» 15 und die Hornbläser auf dem «Wendelstein», dem heutigen<br />
Zeitglockenturm. Aus der Zeit der eigentlichen Stadtpfeiferei wissen wir, dass hauptsächlich die<br />
Pfeife, bzw. Schalmei, und die Querpfeife, auch Schwegel oder Schweizerpfeife genannt, in<br />
Gebrauch waren. Ab 1430 sollten sich auch ein Trompeter, im 16. Jahrhundert dann Posaunen<br />
und Zinken dazugesellen 16 . Gemäss einer Ordonanz aus dem Jahre 1572 war die<br />
Quartettbesetzung Usus. Da das mehrstimmige Spiel - vor allem dasjenige mit lauten<br />
Instrumenten, insbesondere der Trompete - sich als besonders repräsentativ erwies, wuchs die<br />
Anzahl der von der Stadt beschäftigten Musiker. Ein wichtiges Zeugnis für das mehrstimmige<br />
Spiel der Stadtpfeifer ist die Vorrede zu den 1553 erschienenen Bicinien von Johannes<br />
Wannenmacher. Hier lobt der Drucker Mathias Apiarius die Stadtpfeifer und deren Fähigkeit,<br />
mehrstimmig zu musizieren.<br />
13 Geering, Arnold: die Stadtpfeifer, S. 106.<br />
14 Ernst, Fritz: «Die Spielleute im Dienste der Stadt Basel im ausgehenden Mittelalter», Basel, 1845, S. 91.<br />
15 Ein Venner war ursprünglich ein Quartierbeamter, der von seinem Quartier gewählt wurde und auch für<br />
dieses zuständig war. Sein Vorrecht war die Wahl der Wahlbehörde, später wurde ihm auch die Verwaltung<br />
der vier Landgerichte übertragen. Siehe De Capitani, François: «Adel, Bürger und Zünfte im <strong>Bern</strong> des<br />
15. Jahrhunderts», <strong>Bern</strong>, 1982, S. 72ff.<br />
16 Die Instrumente werden im Anhang erklärt.<br />
-20-
Die «Tütsche Musica»<br />
Es wird vermutet, dass die Stadtpfeifer im ausgehenden 15. Jahrhundert der Notenschrift kundig<br />
waren und ihr eigenes Lehrwerk besassen. 17 Dies liegt allein deshalb nahe, weil das<br />
Zusammenspiel von mehrstimmiger Musik ohne Kenntnisse notierter Musik kaum denkbar ist. Im<br />
Besitz der Burgerbibliothek <strong>Bern</strong> befindet sich die theoretische Lehrschrift mit dem Titel «Ein<br />
Tütsche Musica» 18 . Die Annahme, dass es sich um eine aus <strong>Bern</strong> stammende Handschrift handelt,<br />
wird durch die Bärendarstellung auf der ersten Seite erhärtet.<br />
Die erste Seite der «Tütschen Musica» mit Bärendarstellung<br />
(Burgerbibliothek <strong>Bern</strong>).<br />
Die Initialen auf Seite 1 (C.H.) und Seite 65 (C.H.S.) sowie der humoristische Spruch «Ach Du min<br />
karli du klempst mich» könnten Geering zufolge auf den Dominikaner Conrad Hebenhauser 19<br />
(Initialen) bzw. auf die drei Brüder des Chronisten und Lieddichters Ludwig Sterner hinweisen.<br />
Die oben genannten Initialen beziehen sich auf gängige Namen und können daher keineswegs<br />
eindeutig zugeordnet werden. Dieses Lehrwerk zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es<br />
sich um die deutsche Übersetzung einer unbekannten lateinischen Vorlage handelt, obwohl der<br />
Musikunterricht auch im 16. Jahrhundert vielfach noch in Latein abgehalten wurde. 20 Als<br />
Verfasser des Traktats nennt Geering Bartholomäus Götfried Frank, den damaligen Kantor des<br />
St. Vinzenzstifts. 21 Stilistische Vergleiche der Traktatschrift mit dem Begleittext zu der von Frank<br />
verfassten Motette für den Bischof Jost von Silenen «Celsa cumque» sind laut Geering klare<br />
Indizien für Francks Autorschaft der «Tütschen Musica». Dennoch kann ein definitiver Nachweis<br />
nicht geführt werden.<br />
17 Geering, Arnold, «ein Tütsche Musica 1491», Vorwort V, <strong>Bern</strong> 1964 107, bzw. Mitteilungsblatt der<br />
Schweiz. Musikforschenden Gesellschaft, Nr. 9, 1945, S. 3.<br />
18 Erworben wurde «Ein tütsche Musica» von der Familie Diesbach (Freiburger Linie) (siehe Geering: «Ein<br />
tütsche Musica des figurirten Gsangs 1491», S. 178.<br />
7 Siehe Fussnote 2, Geering: Ein tütsche Musica des figurirten Gsangs 1491, S. 181.<br />
8 1494 erhielt Bartholomäus Götfried Franck die Chorherrenwürde und war bis 1502 im Amt. (Siehe<br />
Geering: «Ein tütsche Musica des figurirten Gsangs 1491», S. 179).<br />
9 Das erste in Deutsch abgefasste Musiktraktat stammt von Notker Labeo (950 –1022).<br />
-21-
«Bestallung und ordinanz» der <strong>Bern</strong>er Stadtpfeifer<br />
Die <strong>Bern</strong>ische Ordonanz, ein Dokument aus dem Jahre 1572, richtet sich an die «vier nüwen<br />
Stetfpyfer(n) Pousuner und Zinkenbleser», jedoch ist auch der Gebrauch von anderen gängigen<br />
Instrumenten zu vermuten. Ob die verpflichteten Musiker jeweils in der Lage waren, alle<br />
Instrumente zu spielen und ob es möglich war, die Besetzung zu wechseln, kann zwar nicht mit<br />
Sicherheit beantwortet werden, ist aber, gemäss der Ordonanz, wahrscheinlich:<br />
Die Musiker im Dienste der Stadt schuldeten den gnädigen Herren, H. Bat Ludwigen von<br />
Mülinen, alt Schultheiss, und Niklausen von Grafenried, Seckelmeister der Stadt <strong>Bern</strong>, Gehorsam<br />
und Untertänigkeit; auch verpflichteten sie sich, Religion und Gesetz einzuhalten und zu<br />
verteidigen. Es war ihre Aufgabe, allezeit, nach Wunsch der Obrigkeit auf Flöten, Querpfeifen,<br />
Krummhörnern, Posaunen, Feldtrumpeten und Zinken zu deren Vergnügen zu musizieren, aber<br />
auch bei allgemeinen Versammlungen des Regiments, zu besonderen Festtagen wie Ostern, auf<br />
Geheiss des Senates und insbesondere der Burgergemeinde oder bei der Ankunft fremder<br />
Botschafter und Herren hatten die Stadtpfeifer aufzuspielen. In der Sommerzeit, wenn die<br />
gnädigen Herren abends nach dem Nachtmahl spazierten, galt es ihnen zur «recreation und<br />
luste» vom Kirchturm aus aufzuspielen.<br />
Besonders nach der Reformation wurde das Mitwirken der Stadtmusiker bei kirchlichen<br />
Veranstaltungen bedeutend und fand so auch Eingang in die Ordonanz:<br />
Im Dienste der Kirche sollten sie vor und nach der Predigt psalmodieren und den Schülern beim<br />
Singen helfen. Jeden Sonntag waren sie angehalten, nach der Mittagspredigt vom Kirchturm<br />
hinab je nach Ermessen ein bis zwei Stücke zu spielen.<br />
Nach der Reformation 1528 wurde zunächst keine Musik im Gottesdienst geduldet. Ab 1538<br />
sollten die Stadtpfeifer zunächst nur mit «lebender stimm» den Schülerchor unterstützen. Bereits<br />
zehn Jahre später war jedoch auch die Begleitung durch Zinken und Posaunen vorgesehen. Erst<br />
Niklaus Zeerleder, der ab 1652 das Kantorenamt innehatte, bemühte sich wieder ernsthaft um<br />
die protestantische Musikpflege (zur <strong>Bern</strong>er Kirchenmusik während der Reformation vgl. den<br />
Beitrag von Hans Ermel).<br />
Auch Musikunterricht für die Kinder, insbesondere mit Hinblick auf den Kirchengesang, fiel in<br />
den Aufgabenbereich der Stadtpfeifer: In der Schule wurden sie zu der musikalischen<br />
Unterweisung herangezogen, und wenn sich jemand interessiert zeigte, eines ihrer Instrumente<br />
zu erlernen, mussten sie ihm gegen einen bescheidenen Lohn Unterricht erteilen.<br />
Die dienstjüngeren Stadtpfeifer hatten dem dienstältesten zu gehorchen und sich zu bemühen,<br />
damit «es kein confus gebe». Auch mussten die festgelegten Übezeiten eingehalten und der<br />
«varietas» Rechnung getragen werden. Im Streitfall schritt die Obrigkeit ein und erliess Strafen.<br />
Geahndet wurden auch Gotteslästerung sowie übermässiger Alkoholkonsum. 22<br />
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Obrigkeit an die Stadtpfeifer lautete: «Die anderen lüten<br />
hofieren, sy frölich und gueter dingen machen» und «dass sy der lieben music ir kraft und<br />
dignitet» nicht durch unflätiges Verhalten schmälerten.<br />
22 Als wie unfähig sich ein «voller man» erweist, wird hervorgehoben. Die Musiker, wie auch früher die<br />
Spielleute, galten als sehr trinklustig.<br />
-22-
Anhang<br />
Die Schalmei gehört zu den Oboeninstrumenten; das heisst, die<br />
Tonerzeugung erfolgt mittels eines Doppelrohrblatts, dessen Grösse<br />
und Breite entsprechend der jeweiligen Masse des Instrumentes<br />
wechseln. Die konisch gebohrte Röhre verfügt meist über sieben<br />
vorderständige Grifflöcher, ein Daumenloch für den linken Daumen<br />
kann ebenfalls vorhanden sein. Der Klang ist sehr laut, scharf und vor<br />
allem in der tiefen Lage nasal. Der Tonumfang beträgt 1½-2<br />
Oktaven, wobei einmal in die Oktave überblasen wird.<br />
Der Zink ist ein leicht gebogenes Holzinstrument mit jeweils<br />
unterschiedlicher Anzahl an Grifflöchern. Er wird den<br />
Blechblasinstrumenten zugeordnet, da er im Prinzip wie<br />
eine Trompete geblasen wird. Das Kesselmundstück ist in<br />
der Regel aus Holz, Horn oder Elfenbein. Obwohl der Zink<br />
als schwer spielbares Instrument galt, erfreute er sich im 15.<br />
Jahrhundert und bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts einer<br />
grossen Beliebtheit, da sein weicher Klang als der<br />
menschlichen Stimme ähnlich empfunden wurde. Der<br />
Tonumfang liegt theoretisch bei nahezu drei Oktaven. In<br />
der Praxis reicht die gängige Literatur jedoch lediglich von a<br />
bis d’’’.<br />
Das Krummhorn ist ein Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt,<br />
zylindrisch gebohrter Röhre und Windkapsel. Es besitzt sieben<br />
vorderständige Grifflöcher und ein Daumenloch für den linken Daumen.<br />
Der Tonumfang beträgt eine große None. Beim modernen Krummhorn ist<br />
der Tonumfang durch zwei Klappen nach oben erweitert und beträgt eine<br />
Undezime. Das Krummhorn klingt sehr nasal und scharf.<br />
Die Querpfeife (Schwegel, Schweizerpfeife, Schweizerflöte, Trommelflöte, Turnerflöte,<br />
Militärflöte) gehört zu den Flöteninstrumenten und entspricht im Bau einer Piccoloflöte. Sie<br />
klingt daher eine Oktave höher als die gewöhnliche Querflöte, besitzt aber keine oder höchstens<br />
eine Klappe. Sie wurde oft zusammen mit Trommel zu militärischen Anlässen gespielt.<br />
-23-
Literatur<br />
De Capitani François: «Musik in <strong>Bern</strong>», <strong>Bern</strong>, 1896.<br />
Geering, Arnold: «Ein Tütsche Musica» 1491, <strong>Bern</strong>, 1964.<br />
De Capitani, François: «Adel, Bürger und Zünfte im <strong>Bern</strong> des 15. Jahrhunderts», <strong>Bern</strong>, 1982.<br />
Hofer, Paul: «Die Kunstdenkmäler des Kantons <strong>Bern</strong>», Bd. 1, Basel, 1952.<br />
Stauder, Wilhelm: «Alte Musikinstrumente», Braunschweig, 1973.<br />
-24-
5. Der Hymnenzyklus von Cosmas Alder<br />
von Renata Jeker<br />
Zur Geschichte des Hymnus<br />
Titelblatt des Stimmbuches<br />
(Facsimile des Druckes von<br />
Matthias Apiarius)<br />
Das Wort «Hymnus» ist wohl abgeleitet von dem griechischen humnos, das in der Antike<br />
Dichtungen zu Ehren einer Gottheit, aber auch andere Vorträge von Sängern oder Chorlieder<br />
bezeichnete. Im frühen Christentum wurde «Hymnus» oft, jedoch nicht ausschliesslich<br />
verwendet, um Loblieder auf Gott in Abgrenzung zu den Psalmen zu bezeichnen.<br />
In den Psalmenkommentaren des Augustinus heisst es dazu:<br />
Hymni laudes sunt dei cum cantico: hymni cantus<br />
sunt continentes laudem Dei. Si sit laus, et non sit<br />
Dei, non est hymnus; si sit laus, et Dei laus, et non<br />
cantetur, non est hymnus. Oportet ergo ut, si sit<br />
hymnus, habeat haec tria: et laudem, et Dei, et<br />
canticum23 .<br />
Hymnen sind Lob Gottes mit Gesang: Hymnen sind<br />
Gesänge, die Gottes Lob enthalten.Wird nicht Gott<br />
gelobt, so ist es kein Hymnus; ist es ein Gotteslob,<br />
doch nicht gesungen, so ist es ebenfalls kein<br />
Hymnus. Ein Hymnus beinhaltet also Dreierlei: Lob,<br />
Gotteslob und Gesang [Übers. d. V.]<br />
Hymnen im engeren Sinn sind jene strophischen Gedichte mit metrischen oder rhythmischen<br />
Versen, die zu den Gebetszeiten des Offiziums im gemeinsamen Chorgebet als Strophenlieder<br />
gesungen und vereinzelt auch bei Prozessionen oder in der Messe eingesetzt werden. Die<br />
Hymnen sind geistliche Poesie nichtbiblischen Ursprungs in der lateinischen Liturgie und<br />
erweitern somit das Choralrepertoire 24 .<br />
Um 540 verfasste Benedikt von Nursia seine Ordensregeln und weist den Hymnen dabei ihren<br />
Ort im (zeitlichen) Ablauf der Gebetszeiten zu. Dabei erhalten sie je nach Tageszeit eine andere<br />
Stellung: in den kleinen Horen des Tages eher zu Beginn, in Laudes und Vesper eher gegen Ende.<br />
Der Hymnenbestand des 5. und 6. Jahrhunderts umfasst 20 Hymnen, deren Zahl in den<br />
folgenden Jahrhunderten drastisch zunahm.<br />
Neben anonymen Dichtungen sind viele Hymnen enthalten, die mit ziemlicher Sicherheit<br />
bekannten Autoren zugeschrieben werden können. So werden beispielsweise dem Mailänder<br />
Bischof Ambrosius 14 Hymnen zugeschrieben. Gemeinsam ist diesen ambrosianischen Hymnen<br />
die Anzahl der Strophen (jeweils acht) und deren Bau aus vier Zeilen in jambischen Dimetern.<br />
Diese Form wird zum Muster und Vorbild für viele spätere Dichtungen.<br />
23 Karlheinz Schlager: Art. «Hymnus, Mittelalter – Begriff und Bedeutung», in: Musik in Geschichte und<br />
Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Band 4, Kassel u.a. 1998,<br />
Sp. 479.<br />
24 vgl. ebd. Sp. 480.<br />
-25-
Mehrstimmige Hymnenkompositionen seit dem 15 Jahrhundert<br />
Aus den einstimmigen Offiziumshymnen entstanden im 15. Jahrhundert mehrstimmige<br />
Kompositionen, die die Melodien übernahmen und diese in einer oder mehreren Stimmen in<br />
verzierter oder unverzierter Form aufnahmen. Die mehrstimmigen Sätze wurde dabei<br />
alternierend mit choraliter gesungenen Strophen vorgetragen. Die meisten bekannten Hymnen<br />
sind für den Gebrauch in der Vesper gedacht.<br />
Bei den frühesten mehrstimmigen Hymnen handelt es sich meist um Einzelsätze, die nicht<br />
zwingend für das Stundengebet bestimmt waren. Seit dem Ende der 1420er oder Anfang der<br />
1430er Jahre scheinen mehrstimmige Hymnensätze in grösserem Umfang in das Stundengebet<br />
eingebettet worden zu sein. Darauf lassen die seit jener Zeit überlieferten Sammlungen<br />
schliessen, die für die Vesper jedes höheren Festtages einen Tonsatz vorsehen. Vorbild ist hier<br />
der Hymnenzyklus von Guillaume Dufay, der um 1430 entstand. Das Charakteristikum dieser<br />
Kompositionen ist die Gestalt der Hymnenmelodie und deren Behandlung, ebenso wie die<br />
Verwendung des Fauxbourdons 25 .<br />
Zur Entstehung von Hymnenzyklen<br />
Von den unzähligen Offiziumshymnen des Mittelalters sind nur einige im 15. Jahrhundert<br />
Grundlage mehrstimmiger Kompositionen geworden. Es sind immer wieder dieselben Texte, die<br />
in den unterschiedlichen Quellen auftauchen. Zur selben Zeit setzt auch die Überlieferung von<br />
Zyklen ein. Die verschiedenen bekannten Zyklen haben eine Anzahl an Hymnen gemeinsam, zu<br />
denen jeweils Hymnen zu lokalen Festen treten können, was Rückschlüsse auf die regionalen<br />
Ursprünge erlaubt. Oft wurden auch Kompositionen verschiedener Autoren zusammengestellt<br />
und bei Bedarf mit Werken lokaler Komponisten ergänzt. Ein vollständiger Hymnenzyklus wie<br />
derjenige Guillaume Dufays mit seiner Ausstrahlung nach ganz Europa bildet um die Mitte des<br />
15. Jahrhunderts die Ausnahme.<br />
Im 16. Jahrhundert erscheinen dann verstärkt Hymnenzyklen von Einzelautoren. Der erste<br />
gedruckte Hymnenzyklus ist Johannes Martinis Hymnorum liber primus aus dem Jahre 1507.<br />
Nach einem Unterbruch von knapp drei Jahrzehnten erscheinen in kurzer Folge wiederum<br />
Hymnenzyklen von Einzelautoren. Elzéar Genet alias Carpentras und Adrian Willaert waren<br />
Verfasser von gedruckten Hymnenzyklen, die, zumindest im Falle von Willaert, nicht primär für<br />
den liturgischen Gebrauch vorgesehen waren, sondern vielmehr eine repräsentative<br />
Zusammenstellung für ein grösseres Publikum darstellten. Der Stil der Kompositionen ist in allen<br />
Zyklen ähnlich: gesetzt wurden nur die geraden oder ungeraden Strophen (da noch immer<br />
alternierend gedacht), mit cantus firmus in einer Stimme, von der Motive als Imitationen in die<br />
weiteren Stimmen übernommen wurden. Bisweilen wurde der cantus firmus kanonisch<br />
verdoppelt. Die Sätze umfassten zwei bis sechs Stimmen, wobei die grössere Besetzung für die<br />
letzte Strophe vorgesehen war.<br />
Im späteren 16. Jahrhundert erschienen insbesondere in Italien zahlreiche Hymnenzyklen, so<br />
unter anderem jene von Jacobus de Kerle (1558), Diego Ortiz (1565), Orlando di Lasso (um 1580),<br />
Tomas Luis da Victoria (1581), Francisco Guerrero (1584) und Pierluigi da Palestrina (1589). Jeder<br />
Zyklus umfasst mindestens 30 Hymnen, von denen eine bis drei Strophen mehrstimmig gesetzt<br />
wurden 26 . In diesem Zusammenhang steht auch die posthume Drucklegung der Hymni sacri von<br />
Cosmas Alder durch Mathias Apiarius im Jahre 1553.<br />
25 vgl. Tom R. Ward: Art. «Hymnus, Mehrstimmige Hymnen – 15. Jahrhundert», Übs. Thomas M. Höpfner, in:<br />
Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil,<br />
Band 4, Kassel u.a., 1998, Sp. 490-493.<br />
26 vgl. ders.: Art. «Hymn – Polyphonic Latin Hymn» , in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,<br />
hrsg. von Stanley Sadie, Bd. 12, London, 1980, S. 24-27.<br />
-26-
Der Hymnenzyklus von Cosmas Alder – Auswahl der Texte und Bearbeitung durch<br />
Wolfgang Musculus<br />
Der 1553 erschienene Duck der Hymni sacri von Cosmas Alder umfasst 58 mehrstimmige<br />
Hymnensätze. Die Drucklegung erfolgte posthum durch Alders Bekannten und Freund, Matthias<br />
Biener (genannt Apiarius). Im Vorwort verweist der Humanist und Theologe Wolfgang Musculus<br />
auf das Talent des Komponisten. Musculus nahm zudem eine Überarbeitung der Texte im Geiste<br />
des Humanismus und der Reformation vor 27 .<br />
Die Hymnensätze selbst stammen mit Sicherheit aus der Zeit vor der Reformation und waren<br />
wohl ursprünglich für den liturgischen Gebrauch am St.Vinzenz-Stift gedacht. Dass die nun nicht<br />
mehr zur Verwendung im kirchlichen Rahmen benötigten Hymnen im reformierten <strong>Bern</strong><br />
dennoch gedruckt wurden, lässt sich einerseits als Anknüpfung an die Vielzahl gedruckter<br />
Hymnenzyklen erklären, andererseits bildete sicherlich auch das Bestreben, dem kürzlich<br />
verstorbenen Alder ein Denkmal zu setzen, ein wichtiges Motiv für den Druck.<br />
Erste Seite des<br />
Tenor-<br />
Stimmbuches<br />
(Ausschnitt –<br />
Facsimile des<br />
Druckes von<br />
Apiarius)<br />
Der Titel des Hymnarius (Hymni sacri numero LVII) spricht von 57 Hymnen, wobei Apiarius und<br />
Musculus in Wahrheit die vertonten Hymnenstrophen gezählt haben. Andreas Traub zählt 46<br />
verschiedene Hymnenmelodien und Hymnentexte 28 .<br />
Werden nun zu den 46 Hymnen die gesondert vertonten Strophen hinzugezählt, ergibt sich<br />
daraus die im Titel genannte Zahl der 57 Hymnenstrophen. Da die beiden Fassungen von Hostis<br />
Herodes impie zusätzlich als Nr. 6a und b gezählt werden, umfasst das Werk tatsächlich 58<br />
Hymnensätze. Von diesen hat Wolfgang Musculus 12 textlich überarbeitet, namentlich die Sätze<br />
Nr. 10, 11, 12, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51 und 55. Die somit inhaltlich veränderten Texte sind<br />
jene der Fasten-, Marien- und Heiligenhymnen.<br />
Beispiel eines überarbeiteten Textes:<br />
Originaltext Überarbeitung von Musculus<br />
Ave, maris stella,<br />
Ave, maris stella,<br />
Dei mater alma<br />
Dei patris nate<br />
Atque semper virgo,<br />
Atque semper deus,<br />
Felix caeli porta.<br />
Felix coeli porta.<br />
Dass diese Arbeit des Theologen Musculus nicht unbedingt eine Verbesserung darstellt,<br />
bemerkte auch Andreas Traub:<br />
Die dichterische Kraft der Bearbeitungen hält sich in Grenzen; die Neufassung von<br />
Ave maris stella wirkt geradezu kurios. Es war wohl nicht die dankbarste Aufgabe,<br />
die der immer wieder lateinische Verse verfassende Musculus übernommen hatte 29 .<br />
27 vgl. Andreas Traub, Die «Hymni sacri» von Cosmas Alder, in: Die Musikforschung Jg. 58 (2005), Heft 3, S.<br />
274.<br />
28 vgl. ebd., S. 277-281.<br />
29 ders., Vorwort zu: Cosmas Alder, Hymnarius 1553 - Hymni sacri numero LVII, spartiert und mit einem<br />
Vorwort versehen von Andreas Traub, 1983, revidiert 1988 - Textteile 1989, revidiert 1991, Das Erbe<br />
deutscher Musik (noch nicht veröffentlicht), S. 7.<br />
-27-
Aufbau des Hymnenzyklus<br />
Die vertonten Hymnen lassen sich nicht auf eine bestimmte Hore, beispielsweise die Vesper,<br />
eingrenzen. Im Gegenteil vertont Alder auch Hymnen zu Complet, Prim und Terz. Der<br />
Complethymnus Te lucis ante terminum erscheint gar fünfstimmig, jede der drei Strophen mit<br />
eigenem Tonsatz und mit kanonischem Cantus firmus gesetzt. Möglicherweise ist die<br />
Sonderstellung dieses Hymnus und der damit verbundene besondere Aufwand in der Liturgie des<br />
Vinzenzstifts begründet 30 .<br />
Der Druck von Apiarius unterscheidet zwei Gruppen von Hymnen, die ersten 40 (respektive 41)<br />
Sätze schliessen mit dem Hinweis «Hymnorum de Tempore Finis». Die folgende Gruppe von 17<br />
Sätzen trägt den Titel «Hymnorum De Sanctis», ist also eine Sammlung von Heiligenhymnen. Es<br />
finden sich unter den ersten fünf Sätzen auch die Hymnen zu den Marienfesten.<br />
Es zeigt sich zudem, dass die Auswahl der Hymnentexte keinen kompletten Zyklus für das<br />
(römisch-katholische) Kirchenjahr ergibt. Der Druck von Alders Hymnenzyklus ist deshalb sicherlich<br />
nicht für den liturgischen Gebrauch vorgesehen gewesen. Dass Apiarius und Musculus eine<br />
Auswahl aus den vorliegenden Kompositionen Alders getroffen haben, ist anzunehmen, jedoch<br />
nicht mit Gewissheit zu sagen. Immerhin hat Musculus die Texte für den Gebrauch im reformierten<br />
<strong>Bern</strong> überarbeitet und empfiehlt die Kompositionen Alders jedem Bürger zur Erbauung 31 .<br />
Alder hat bei einigen Hymnen mehrere Strophen komponiert:Auf Qui Christe, lux es et dies folgt<br />
die zweite Strophe Te deprecamur singuli in einem neuen Satz mit Doppelkanon. Ebenso erscheint<br />
die zweite Strophe des Kreuzhymnus Pange lingua gloriosi als neuer Satz, der Hymnus Salve festa<br />
dies hat gar drei auskomponierte Strophen, der Palmsonntagshymnus Gloria laus et honor deren<br />
sechs. Cosmas Alder beweist in diesen durchkomponierten Hymnen einiges Geschick in der jeweils<br />
unterschiedlichen Behandlung desselben Themas. Wie bei seinem Zeitgenossen Johannes<br />
Wannenmacher deutet sich hier bei Alder der Hang zur Schaffung grösserer musikalischer<br />
Zusammenhänge an 32 . Vergleichbar mit Wannenmacher ist auch Alders Verwendung des Chorals<br />
im Cantus firmus, der selten in gleichen Notenwerten erscheint, sondern meist ausdrucksvoll<br />
rhythmisiert ist und sich gegen das Zeilenende in figurale Klauseln auflöst. Der Anfang der<br />
Melodiezeile im Cantus firmus ist oft sehr schlicht gehalten, die Schlusszeile im Gegensatz dazu<br />
mehrmals wiederholt und reich an melismatischen Verzierungen. Alle 58 Hymnensätze sind<br />
zweiteilig aufgebaut, wobei einem thematisch strengen Beginn eine figurale Schlusspartie folgt.<br />
Entsprechend heben sich zu Beginn der Hymnen die Haupt- und Nebenstimmen deutlich<br />
voneinander ab, um am Zeilenende und in den Schlusspartien oft zu verschmelzen. Der<br />
asymmetrische Bau wird oft noch unterstrichen durch die Betonung der Zeilenübergänge im<br />
ersten Teil, wo der Fluss des Satzes nur in einer Stimme weitergeführt wird, wohingegen im<br />
zweiten Teil fühlbare Einschnitte vermieden werden. Hauptstimme, d.h. Trägerin des cantus<br />
firmus, kann jede Stimme sein. Weitaus am häufigsten, in 34 der 58 Hymnensätze, erklingt die<br />
Choralvorlage im Diskant. Der Tenor erhält die Hauptstimme in sechs, der Bass in vier der<br />
Tonsätze, viermal teilen sich Tenor und Diskant die Führung 33 .<br />
Die Hymnen sind im Allgemeinen vierstimmig und umfassen zwischen 30 und 70 Mensuren.<br />
Ausnahmen bilden der Hymnus Crux fidelis mit 99 Mensuren, Urbs beata Jerusalem mit 93<br />
Mensuren und Sacris solemniis mit 111 Mensuren 34 . Es ist bei einigen Hymnen auch denkbar, dass<br />
eine oder mehrere Stimmen instrumental konzipiert waren. Beachtet man die unbefriedigende<br />
Textunterlegung und den recht grossen Umfang beim Altus sowie den bisweilen sehr<br />
instrumentalen Charakter des Bassus, drängt sich diese Lesart geradezu auf 35 .<br />
30 vgl. Traub 2005, S. 274.<br />
31 vgl. Traub 1991, S. 5.<br />
32 vgl. Arnold Geering, «Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation», Aarau, 1933, S. 166.<br />
33 vgl. ebd., S. 167-168.<br />
34 vgl. Traub 1991, S. 9.<br />
35 vgl. Traub 2005, S. 275.<br />
-28-
Literatur<br />
Geering, Arnold: «Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation», Aarau, 1933.<br />
Schlager, Karlheinz: Art. «Hymnus, Mittelalter», in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Zweite,<br />
neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Band 4, Kassel u.a., 1998, Sp. 479-<br />
490.<br />
Traub, Andreas: «Die `Hymni sacri` von Cosmas Alder», in: Die Musikforschung, Jg. 58 (2005),<br />
Heft 3, S. 274-281.<br />
Traub, Andreas: Vorwort zu: Cosmas Alder, Hymnarius 1553 - Hymni sacri numero LVII, spartiert<br />
und mit einem Vorwort versehen von Andreas Traub, 1983, revidiert 1988 - Textteile 1989,<br />
revidiert 1991, Das Erbe deutscher Musik (noch nicht veröffentlicht).<br />
Ward, Tom R.: Art. «Hymnus, Mehrstimmige Hymnen», Übs. Thomas M. Höpfner, in: Musik in<br />
Geschichte und Gegenwart, Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher,<br />
Sachteil, Band 4, Kassel u.a. 1998, Sp. 490-500.<br />
Ward, Tom R.: Art. «Hymn – Polyphonic Latin Hymn», in: The New Grove Dictionary of Music and<br />
Musicians, hrsg. von Stanley Sadie, Bd. 12, London, 1980, S. 23-28.<br />
Quellen<br />
Abb. 1 Cosmas Alder, Hymni sacri numero LVII,<br />
Einband des Diskant-Stimmbuches, Facsimile des Druckes von Apiarius<br />
Abb. 2 Cosmas Alder, Hymni sacri numero LVII,<br />
erste Seite des Tenor-Stimmbuches (Ausschnitt), Facsimile des Druckes von<br />
Apiarius<br />
-29-
6. Die <strong>Bern</strong>er Musikdrucke von Mathias Apiarius<br />
von Irene Salgado<br />
Buchdruck in der Schweiz<br />
Mathias Apiarius’ Druckermarke<br />
(Staatsarchiv des Kantons <strong>Bern</strong>)<br />
Der Buchdrucker Mathias Apiarius eröffnete 1537 die erste Druckerwerkstatt in <strong>Bern</strong>. Zu dieser<br />
Zeit gab es bereits in elf anderen Orten der Schweiz Buchdruckereien; <strong>Bern</strong> war in Sachen<br />
Buchdruck also gewissermassen ein Nachzügler.<br />
Den meisten der elf genannten Betriebe war aufgrund von Absatzproblemen nur eine kurze<br />
Lebensdauer beschieden gewesen, denn eine Werkstatt konnte nur bestehen, wenn die<br />
gedruckte Ware verkauft werden konnte. Es benötigte also einen Buchhandel, der einen guten<br />
Absatz sicherte. Buchmessen waren in dieser Hinsicht sehr wichtig: Dort konnten die Drucker ihre<br />
Ware verkaufen, sich gegenseitig austauschen, und Neues über Angebot und Nachfrage von<br />
Druckerzeugnissen erfahren, um dann ihre Produktion darauf auszurichten. Eine der grössten<br />
und wichtigsten Buchmessen fand mehrmals im Jahr in Frankfurt am Main statt. Damit ein<br />
Drucker seinen Absatz sichern konnte, war es von Vorteil, wenn seine Werkstatt in der Nähe<br />
einer solchen Messe lag. Die ungünstige Lage <strong>Bern</strong>s könnte demnach ein Grund sein, weshalb<br />
kein Buchdrucker vor Mathias Apiarius in <strong>Bern</strong> eine Werkstatt eröffnet hat. Nur wenige Betriebe<br />
konnten längerfristig bestehen, vor allem jedoch diejenigen in den Städten Basel, Zürich und<br />
Genf. Der in Basel seit 1491 tätige Johannes Froben etwa führte auch ein erfolgreiches<br />
Buchdruckergeschäft.<br />
Mathias Apiarius<br />
Mathias Apiarius wurde um 1500 in Berchingen, einem kleinen Städtchen in Mittelfranken,<br />
geboren. Über seine Herkunft und Bildung ist sehr wenig bekannt. Sicher ist, dass er in Nürnberg<br />
als Buchbinder tätig war und diesen Beruf wahrscheinlich auch dort erlernt hatte. Ab 1525<br />
arbeitete Apiarius in Basel, ebenfalls als Buchbinder, um dann nach Strassburg zu ziehen. Hier<br />
wechselte Apiarius den Beruf und versuchte sein Glück fortan als Buchdrucker. Ab wann genau<br />
er sich in der Stadt aufhielt, ist nicht nachzuweisen; im Strassburger Staatsarchiv ist die<br />
Anwesenheit Apiarius’ nicht dokumentiert. Die einzigen Nachweise für seine Anwesenheit in<br />
Strassburg bieten seine Drucke. Daneben gibt es zwei Anhaltspunkte, die ermöglichen, seine<br />
Abreise von Basel zwischen den Jahren 1531 und 1533 anzusiedeln: Der letzte Eintrag, der die<br />
Anwesenheit Apiarius’ in Basel bestätigt, stammt von 1531. Es ist eine Taufurkunde, die besagt,<br />
dass Madlen, seine Tochter, am 23. August 1531 in der Kirche St. Martin getauft wurde. In<br />
Strassburg tritt sein Name 1533 zum ersten Mal auf, nämlich in seinem ersten Strassburger Druck<br />
«Die Handlung in dem Gesprech jüngst im Synodo gehalten gegen Melchior Hoffman».<br />
-30-
Die Zusammenarbeit mit Peter Schöffer<br />
1534 wurde Apiarius zum Geschäftspartner von Peter Schöffer dem Jüngeren. Peter Schöffer,<br />
Sohn des gleichnamigen Mitarbeiters von Gutenberg, war wie sein Vater ein erfolgreicher<br />
Buchdrucker. Besonders seine wunderschönen, präzisen Musikdrucke, die er im Doppeldruckverfahren<br />
herstellte, wurden sehr geschätzt.<br />
Die Musikdrucke von Peter Schöffer: 36<br />
Tabulaturen etlicher Lobgesang und Liedlein uff die Orgel und Lauten, A. Schlick, Mainz 1512<br />
Quinquagena Carminum, Mainz, 1513<br />
Liederbuch (62 Lieder), Mainz, 1513<br />
Responsoria Mogutina, Mainz, um 1515<br />
36 Lieder, Mainz, 1515<br />
De dulcissimo nomine Jesu. Officium, Mainz, 1518 (nicht erhalten)<br />
Geystliche Gsanbüchlin, Johannes Walter, Worms 1525<br />
O Herre Gott, dein göttlich wort, A. von Wildenfels, Worms 1526<br />
Viginti cantiunculae Gallicae, Strassburg, um 1530<br />
Cantiones 5v. Mutetarum liber I, Strassburg, 1539<br />
Es stellt sich die Frage, weshalb Schöffer, der als Buchdrucker bereits erfolgreich war, mit dem<br />
noch unerfahrenen Drucker Apiarius zusammenarbeiten wollte. Eine Teilhaberschaft kann nicht<br />
der Grund gewesen sein: Apiarius wäre kaum in der Lage gewesen, Schöffer finanziell zu<br />
unterstützen, musste er doch oft selbst um Vorschüsse bitten. Hingegen stellten Apiarius’<br />
hervorragende Musikkentnisse und seine Kontakte zu zahlreichen Komponisten eine<br />
Bereicherung für das Geschäft von Schöffer dar. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb Schöffer<br />
und Apiarius nur musikalische Werke gemeinsam herausbringen sollten. Apiarius oblag es dabei<br />
offenbar, musikalische Handschriften zu sammeln und Werke für den Druck auszuwählen.<br />
«Fünff und sechzig teütsche Lieder»<br />
Das wohl wichtigste Werk, das die beiden Drucker herausgegeben haben, ist die<br />
Liedersammlung «Fünff und sechzig teütsche Lieder» von 1536. Der Grossteil der achtzehn in<br />
besagter Sammlung vertretenen Komponisten sind Deutsche, unter ihnen Sixt Dietrich und<br />
Thomas Sporer. Vier Komponisten waren in der Schweiz tätig: Arnold von Bruck, Ludwig Senfl,<br />
Cosmas Alder und Johannes Wannenmacher. Die Liedersammlung belegt damit<br />
Apiarius’ vielfältige musikalische Kontakte. Die Lieder sind vier- bis fünfstimmig, so dass gemäss<br />
dem Usus, jede Stimme in einem separaten Stimmbüchlein abzudrucken, fünf verschiedene<br />
Stimmhefte herausgegeben wurden. Die vollständigen Texte sind nur im Tenorheft abgedruckt,<br />
welches auch die Angabe enthält, 1536 von Apiarius und Schöffer in Strassburg gedruckt worden<br />
zu sein.<br />
Die geschäftliche Verbindung zwischen Schöffer und Apiarius dauerte von 1534 bis 1537.<br />
Nachdem Apiarius die Verbindung aufgelöst hatte, ging Schöffer 1539 nach Basel. 1541 bis 1542<br />
war er als Buchdrucker in Venedig tätig, bevor er wiederum nach Basel zurückkehrte, um dort als<br />
Schriftgiesser zu arbeiten. Der Weggang Apiarius’ erwies sich – jedenfalls in finanzieller Hinsicht<br />
– als Verlust, war es doch die besondere Verbindung gewesen, die Schöffers Buchdruckerei so<br />
36 RISM, Récueils imprimés XVIe-XVIIe siècle, ouvrage publié sous la direction de François Lesure, München,<br />
Duisburg; Henle, 1960.<br />
RISM, Einzeldrucke vor 1800, Red.: Karlheinz Schleger, München, Duisburg; Henle, Kassel, Basel [etc.]:<br />
Bärenreiter, 1971.<br />
Musik in Geschichte und Gegenwart, Artikel zu Peter Schöffer, Bd.15, Kassel; Basel [etc.]: Bärenreiter;<br />
Stuttgart [etc.]: Metzler, 1994–2007.<br />
-31-
erfolgreich gemacht hatte: Apiarius, der mit Kennerblick erfolgversprechende Musikwerke<br />
auswählte und Schöffer, dessen Druckkunst mit beweglichen Metalltypen zu einem überaus<br />
ansprechenden Druckbild und zu grosser Anerkennung unter Musikliebhabern geführt hatte.<br />
Gemeinsame Musikdrucke von Schöffer und Apiarius: 37<br />
Epicedion Thomae Sporeri musicorum principis,von Sixt Dietrich, Strassburg, 1534<br />
Wittenbergische Gsangbüchli, Strassburg,1534,1537<br />
Magnificat octo tenorum […] liber primus, von Sixt Dietrich, Strassburg, 1535, 1537<br />
Rerum musicarum opusculum, Joh. Frosch, Strassburg, 1535<br />
Fünff und sechzig teütsche Lieder, Strassburg, 1536<br />
Es könnte sein, dass Apiarius von offizieller Seite nach <strong>Bern</strong> berufen worden war, denn die<br />
beiden Reformatoren Butzer und Capito sollen ihn dem <strong>Bern</strong>er Rat empfohlen haben 38 . Sie<br />
kannten Apiarius schon seit dessen Strassburger Zeit, wo sie bei ihm drucken liessen.<br />
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Apiarius von seinen <strong>Bern</strong>er Freunden eingeladen wurde. Zu<br />
seinem engen Bekanntenkreis gehörten Cosmas Alder, Hans Hippocras, Johann Endsberg<br />
(Telorus), Wolfgang Musculus und Eberhard von Rümlang. Alder und Apiarius hatten sich schon<br />
1528 in <strong>Bern</strong> kennen gelernt, wo beide an der Disputation teilnahmen und die zehn Schlussthesen<br />
unterschrieben. Beide hatten sich also schon früh der Reformation zugewandt. Alder und<br />
Apiarius werden danach wohl miteinander in Kontakt geblieben sein, jedenfalls nahm der<br />
Drucker 1536 ein Lied von Alder in die Sammlung der «Fünff und sechzig teütsche Lieder» auf.<br />
Schmählieder<br />
Apiarius scheute sich nicht, auch politisch brisantere Werke zu veröffentlichen. Einige seiner<br />
Bücher standen auf dem Index, spiegelten sie doch deutlich seine reformatorische Gesinnung.<br />
Während seiner Strassburger Zeit druckte Apiarius ein Werk von Alder, das in der<br />
Eidgenossenschaft im Jahre 1539 einen Skandal auslösen sollte. Dabei handelt es sich um das<br />
«Interlaknerlied», das die Bauernaufstände in Interlaken unterstützte und den katholischen<br />
Glauben verunglimpfte. Wie bei vielen solcher Schmählieder wurde ein neuer Text über eine<br />
bereits bekannte Melodie gesungen; Alder hat also nur den Text, nicht aber die Musik des<br />
«Interlaknerliedes» verfasst. Als der Buchhändler Hans Hippocras dieses «new Lied von der uffrur<br />
der Landlüten zu Interlappen» an der Martinimesse 1538 anbot, waren die anwesenden<br />
Unterwaldner entsetzt. Als Folge schlossen sich die fünf katholischen Orte Uri, Luzern, Schwyz,<br />
Unterwalden und Zug zusammen, um gemeinsam gegen <strong>Bern</strong> vorzugehen. In einem Brief an<br />
den <strong>Bern</strong>er Rat forderten sie die Bestrafung des Verfassers, des Druckers und des Vertreibers<br />
dieses Schmähliedes. <strong>Bern</strong> kam dieser Aufforderung nach und bestrafte Cosmas Alder; Apiarius<br />
hingegen wurde von einer Strafe verschont, da er das Lied schon in Strassburg gedruckt hatte.<br />
Wie sich herausstellte, hatte sein Freund Hippocras das Lied bei ihm erworben und mit nach <strong>Bern</strong><br />
gebracht, weshalb er für schuldig befunden und mit einer Geldbusse bestraft wurde. Den<br />
Klägern jedoch genügten diese Massnahmen nicht; sie übten weiter Druck auf die Stadtväter<br />
aus, was 1539 zum Erlass der ersten <strong>Bern</strong>er Zensurordnung führte, die solche Schmählieder<br />
künftig verbieten sollte.<br />
37 RISM, Récueils imprimés XVIe-XVIIe siècles, ouvrage publié sous la direction de François Lesure, München,<br />
Duisburg: Henle, 1960.<br />
RISM, Einzeldrucke vor 1800, Red.: Karlheinz Schleger, München, Duisburg; Henle, Kassel, Basel, [etc.]:<br />
Bärenreiter, 1971.<br />
Musik in Geschichte und Gegenwart, Artikel zu Mathias Apiarius, Bd.1 und Peter Schöffer, Bd.15, Kassel;<br />
Basel [etc.]: Bärenreiter; Stuttgart [etc.]: Metzler, 1994–2007.<br />
38 Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s (1537–1554), S. 202, von Adolf Fluri, im<br />
<strong>Bern</strong>er Taschenbuch auf das Jahr 1897, hrsg. Von Heinrich Türler.<br />
-32-
Apiarius tritt im Zusammenhang mit politisch brisanten Liedern neben dem «Interlaknerlied»<br />
noch ein zweites Mal auf. 1552 kursierten in <strong>Bern</strong> drei Interimslieder, die sich gegen das<br />
Augsburger Interim wandten. Auf keinem der Drucke wurde der Urheber genannt; unter einem<br />
stand jedoch «getruckt zu <strong>Bern</strong>», ein anderes Mal weist der Druck ein <strong>Bern</strong>er Wasserzeichen auf<br />
und ein dritter war mit exakt den gleichen Typen gedruckt worden, die Apiarius in seiner<br />
Werkstatt verwendete. Als beim <strong>Bern</strong>er Rat Beschwerden über diese Schmählieder eingingen,<br />
wurde Apiarius verhört, bestritt aber, die Lieder gedruckt zu haben.<br />
Es könnte sein, dass ein Basler Buchdrucker die Drucke von Apiarius gezielt nachahmte, um die<br />
strenge Zensurordnung seiner Stadt zu umgehen. Das dritte Lied könnte auch von Apiarius’ Sohn<br />
Samuel ohne sein Wissen gedruckt worden sein. Jedenfalls bleibt offen, ob Apiarius etwas mit<br />
diesen drei Drucken zu tun hatte 39 .<br />
Apiarius und Hippocras<br />
Apiarius und Hans Hippocras verband eine enge Freundschaft. Im «Rollwagen büchlin» von Jörg<br />
Wickram, aus dem Jahre 1555, findet sich eine kleine Geschichte, die das Verhältnis der beiden<br />
beschreibt:<br />
«Von bruderlicher treüw.»<br />
Zu <strong>Bern</strong> haben gewont zwen gut freünd mit namen Mathias Apiarius der ein und Hans Hypocras<br />
der ander. Der Hypocras was dem Apiario schuldig etwas gelt. Nun auff ein zeit schickt der<br />
Apiarius sein fraw zum Hypocras, von im gelt zeforderen. Der Hypocras gibt ir die antwort:<br />
«Euwer mann ist mir auch schuldig.» Sy spricht : «Was ist er dir schuldig?»...Antwortet der<br />
schuldner: «Er weissts wol!» Also schied das weib zornigklich von im und klagets irem mann,<br />
welcher, sobald er das hort, ging in einem zorn eylentz selbs zu im und spricht: «Wie darfft dus<br />
reden, dass ich dir schuldig sye?» Dener herwider: «Du sparst die warheit; ich bin dir nichts<br />
schuldig.» Und triben solche zanckwort so lang, biss dass der Apiarius gar in zorn bewegt ward,<br />
dass der schuldner besorgt, es möchte zu streichen geraten; spricht mit lachendem mund: „Du<br />
bist mir brüderliche leb undtreüw schuldig. «Von dess wegen Apiarius, wiewohl er seer erzürnt<br />
war, ward lachend, und vertrugen sich zeletst gütiglich.» Ad. Fluri. 40<br />
Diese kleine Anekdote lässt ahnen, wie gut Apiarius und Hippocras befreundet waren und dass<br />
beide sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden haben.<br />
Apiarius in <strong>Bern</strong><br />
Wie bereits erwähnt, war Apiarius der erste Buchdrucker, der versuchte, sich in <strong>Bern</strong> zu<br />
etablieren. Er eröffnete seine Werkstatt 1537 in der Brunngasse Nr. 70. Sein erster <strong>Bern</strong>er Druck<br />
war das «Compendium musices», welches 1537 veröffentlicht wurde. Das Büchlein vom<br />
Lüneburger Kantor Auctor Lampadius ist ein musiktheoretisches Werk, das in Form eines Lehrer-<br />
Schüler-Dialogs aufgebaut ist. Zu diesem Druck verfassten Johannes Telorus und Eberhard von<br />
Rümlang Empfehlungen, die einleitend abgedruckt wurden. Apiarius wusste sehr genau, was er<br />
tat, als er dieses Kompendium zum Druck auswählte: Es sollte so erfolgreich sein, dass es<br />
insgesamt fünf Auflagen in den Jahren 1537, 1539, 1541, 1546 und 1554 erlebte. Die letzte<br />
Auflage von 1554 wurde von Apiarius’ Sohn Samuel gedruckt, da Apiarius kurz zuvor verstorben<br />
war. Diese Ausgabe enthält einen Brief von Lampadius an Apiarius, in dem er erklärt, warum er<br />
diesen als Drucker seines Werkes ausgewählt habe: «Uebrigens, dass mein Büchlein, sei es nun,<br />
39 Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s (1537–1554), von Adolf Fluri, im <strong>Bern</strong>er Taschenbuch auf<br />
das Jahr 1897. hrsg. von Heinrich Thürler.<br />
40 Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s (1537–1554), S. 253, von Adolf Fluri, im <strong>Bern</strong>er<br />
Taschenbuch auf das Jahr 1897, hrsg. von Heinrich Türler.<br />
-33-
wie es wolle, dir, mein herr Apiarius, zum Druck übersandt wurde, dass machte dein christliches<br />
Gemüth und deine ganz besondere Liebe zur Musik (…)». 41<br />
Die Notenbeispiele im «Compendium musices» wurden mittels Holzschnitten hergestellt, was<br />
nahelegt, dass Apiarius zu dieser Zeit noch keine beweglichen Metalltypen für den Druck von<br />
Noten besass. Er scheint demnach keine Typen von Schöffer mitgenommen zu haben und konnte<br />
sich wohl zu Beginn auch noch keine eigenen leisten. Der Beschluss des <strong>Bern</strong>er Rates, ihm Zoll-<br />
und Geleitsfreiheit für seinen Hausrat und seine Druckereinrichtungen zu erlassen, zeigt jedoch,<br />
dass Apiarius solches drucktechnisches Zubehör von Strassburg mit nach <strong>Bern</strong> nahm.<br />
Im gleichen Jahr, 1537, erschien ein zweites musiktheoretisches Werk aus seiner Werkstatt, die<br />
«Musica» von Nicola Listenius. Dass im selben Jahr zwei musiktheoretische Schriften<br />
erschienen, lässt auf die Bedeutung, aber auch die Absatzchancen schliessen, die Apiarius diesen<br />
Texten beimass.<br />
Zwei Musikdrucke in <strong>Bern</strong><br />
In seinen nachfolgenden <strong>Bern</strong>er Jahren druckte Apiarius nur zwei musikalische Werke, die<br />
Bicinien von Johannes Wannenmacher und die Hymnen von Cosmas Alder. Beide Drucke<br />
erschienen im Jahre 1553, nachdem beide Komponisten gestorben waren (Wannenmacher um<br />
1550, Alder 1551). In der Vorrede zu den Bicinien erläutert Apiarius, weshalb er diese beiden<br />
Musikwerke zum Druck ausgewählt hat: «[…] Es ist nit ein kleiner Schatz der edlen Musika durch<br />
gedachten Johannem vannium, Cosman Alderinum und Sixtum Theodericum, alle seliger<br />
gedechtnuss, verlassen, aber noch hinder mir und anderen mynen guten gönnern vorhanden;<br />
solichs (wils Gott) sol alles mit der zyt an tag geben werden.[…]» 42 Apiarius hoffte also, durch<br />
seine Drucke die als meisterlich empfundenen Werke von Wannenmacher, Alder und Dietrich<br />
der Nachwelt zu erhalten. Er widmete die Bicinien dem Feldtrompeter Meister Michel Kopp, dem<br />
Feldpfeifer Wendel Schärer sowie Siegfried, seinem Sohn, der bei den Stadtpfeifern angestellt<br />
war, und empfahl sie den Stadtpfeifern als Übungsstücke mit der Begründung, es sei viel<br />
schwieriger, zweistimmige Stücke zu spielen, als die üblichen vier- oder fünfstimmigen. Damit<br />
die Bicinien auch gesungen werden konnten, unterlegte er ihnen jeweils den vollständigen Text.<br />
Auch zwei seiner eigenen Kompositionen veröffentlichte er in dieser Sammlung, nämlich die<br />
Liedsätze «Ach hulff mich leid, und selig clag» und «Es taget vor dem Walde, stand uff<br />
Rötterlier». Der Autorangabe in den Drucken ist zu entnehmen, dass die Komposition schon<br />
länger zurücklag: «Math: Apiar: Olim facibat» («Matthias Apiarius hat dies einst gemacht»).<br />
Die Hymnen Alders wiederum waren kurz vor der Reformation vermutlich für die Liturgie des<br />
Vinzenzstifts entstanden. Für den Druck nahm der Reformator Wolfgang Musculus eine textliche<br />
Überarbeitung der Hymnen vor (zu Alders Hymnenzyklus vgl. den Beitrag von Renata Jeker).<br />
<strong>Bern</strong>er Musikdrucke von Apiarius:<br />
Hymni sacri numero LVII, quorum usus in Ecclesia esse consueuit, iam recens castigati: et eleganti<br />
plane modulatione concinnati Authore Casma Alderino Heöuetico. Cum epistola nuncupatoria D.<br />
Wolffgangi Musculi ac privilegio caesareo ad septenninum, <strong>Bern</strong>, 1553.<br />
Bicinia sive duo, germanica ad aequales. Tütsche Psalmen unnd andre Lieder durch Johannem<br />
Vannium mit zweyen Stimmen zusammen gsetzt. Mit R.K. Maiestat Fryheit Jnn siben Jaren nit<br />
nachzutrucken, <strong>Bern</strong>, 1553.<br />
41 Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s (1537-1554), S. 208, von Adolf Fluri, im <strong>Bern</strong>er Taschenbuch<br />
auf das Jahr 1897, hrsg. von Heinrich Türler.<br />
42 Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s (1537-1554), von Adolf Fluri, im <strong>Bern</strong>er Taschenbuch auf<br />
das Jahr 1897, hrsg. von Heinrich Türler<br />
-34-
Apiarius als Buchbinder in <strong>Bern</strong><br />
Apiarius druckte Werke aus verschiedensten thematischen Bereichen; so einige Schauspiele von<br />
Schweizer Verfassern und mehrere Katechismen, darunter auch einen in französischer<br />
Übersetzung, der für das 1536 eroberte Waadtland bestimmt war. Jedes Jahr gab Apiarius einen<br />
Kalender heraus, von welchen jedoch nur derjenige des Jahres 1539 vollständig erhalten<br />
geblieben ist.<br />
Zwischen 1539 und 1540 verliessen mehrere grössere Drucke seine Werkstatt, darunter die<br />
«Chronika» von Sebastian Frank, ein Buch über die «Geschichte des Mailänder Krieges», ein<br />
Werk über berühmte Frauen und zuletzt das «Kompendium der Weltgeschichte» des <strong>Bern</strong>ers<br />
Valerius Anselm. Manche der gedruckten Werke enthielten Illustrationen, die mittels der<br />
aufwändigen, teuren Holzschnitt-Technik hergestellt worden waren. Mit diesen grossen und<br />
teuren Drucken waren keine guten Geschäfte zu machen und Apiarius geriet in immer grössere<br />
finanzielle Schwierigkeiten. Dazu kam die starke Konkurrenz durch die Buchdruckereien in Basel,<br />
Genf und Zürich sowie die vielen umherreisenden Buchhändler, die in <strong>Bern</strong> ihre Ware anboten.<br />
Apiarius hatte in der Folge immer grössere Probleme, sich gegen die starke Konkurrenz<br />
durchzusetzen. Um seine Werkstatt aufrecht zu erhalten, musste er sich schliesslich<br />
notgedrungen wieder seinem alten Beruf, der Buchbinderei, zuwenden, um sich vor dem<br />
finanziellen Ruin zu retten. Bald bekam er immer häufiger Buchbinder-Aufträge vom Rat, für<br />
den er ab 1543 dann sämtliche städtischen Buchinder-Aufträge übernahm. Damit löste er die<br />
beiden Buchbinder Hans Chym und Hans Lehman ab, die wahrscheinlich vom <strong>Bern</strong>er Rat zu einer<br />
Kündigung zugunsten von Apiarius gezwungen worden waren.<br />
Als Apiarius wieder als Buchbinder arbeitete, verwendete er eigene makulierte Drucke für die<br />
Buchdeckel. Auf diese Weise sind einige seiner Werke wieder zum Vorschein gekommen, so zum<br />
Beispiel zahlreiche Fragmente der Hymnen von Alder, die im <strong>Bern</strong>er Staatsarchiv verwahrt<br />
werden und vor Bekanntwerden des einzigen vollständigen Stimmbuchsatzes in Wien<br />
(Österreichische Nationalbibliothek) die einzigen Zeugnisse für die Existenz dieses wichtigsten<br />
<strong>Bern</strong>er Musikdruckes des 16. Jahrhunderts darstellten.<br />
Apiarius verstarb im Laufe des Jahres 1554. Sein Todesjahr ist mittels zweier lateinischer Bücher<br />
eruierbar, die sich 1554 im Druck befanden: eines trägt noch Apiarius’ Kolophon, das andere<br />
wurde bereits von seinem Sohn Samuel signiert.<br />
Nach dem Tod des Druckers teilten seine zwei Söhne das Geschäft unter sich auf: Samuel<br />
übernahm die Druckerei und zog nach Basel, Siegfried blieb im Buchbinderbetrieb in <strong>Bern</strong> tätig.<br />
Bedauerlicherweise sind viele von Apiarius’ Drucken nicht erhalten geblieben. Mit seinem Tod<br />
kam die Buchdruckerkunst in <strong>Bern</strong> auf lange Zeit zum Erliegen.<br />
-35-
Literatur<br />
Apiarius, Matthias: «Vorrede in Bicinien von Johannes Wannenmacher, Mathias Apiarius», <strong>Bern</strong>,<br />
1553.<br />
Geering, Arnold: «Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation. Leben und Werk von<br />
Bartholomäus Frank, Johannes Wannenmacher, Cosmas Alder», in: Schweizerisches Jahrbuch für<br />
Musikwissenschaft, Bd. VI, Aarau, 1993.<br />
Fluri, Adolf: «Mathias Apiarius der erste Buchdrucker <strong>Bern</strong>s, 1537-1554, in: Neues <strong>Bern</strong>er<br />
Taschenbuch auf das Jahr 1897, hrsg. von Heinrich Türler, 1897.<br />
Lendenmann, Fritz: «Deckersche kleine Verlagsgeschichte», R. v Decker’s Verlag, G.Schenk,<br />
Heidelberg, 1988.<br />
Lindt, Johann: «<strong>Bern</strong>er Einbände, Buchbinder und Buchdrucker. Beiträge zur Buchkunde 15. bis<br />
16. Jahrhundert», Verlag des Schweizerischen Gutenbergmuseums <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong>, 1969.<br />
Thürlings, Adolf: «Der Musikdruck mit beweglichen Metalltypen im 16. Jahrhundert und die<br />
Musikdrucke des Mathias Apiarius in Strassburg und <strong>Bern</strong>», in: Vierteljahrsschrift für Musik-<br />
Wissenschaft, Jg. 1892, H. 3.<br />
-36-
7. Instrumentendarstellungen im <strong>Bern</strong>er Totentanz<br />
von Katrin Schneeberger<br />
Niklaus Manuel Deutsch und sein <strong>Bern</strong>er Totentanz<br />
Wer zwischen 1520 und 1660 den Laienfriedhof des <strong>Bern</strong>er Dominikanerklosters besuchte,<br />
konnte dort ein gut achtzig Meter langes Fresko an einer der Friedhofsmauern bestaunen: Auf<br />
dem Gemälde sah man Angehörige verschiedener Stände abgebildet, welche zusammen mit<br />
Skeletten gegen die linke Seite des Freskos tanzten oder gingen. Die Verse, die unter den<br />
Bildnissen geschrieben standen, gaben Dialoge zwischen den Skeletten und den Menschen<br />
wieder. Die einzelnen Bilder wurden von <strong>Bern</strong>er Patriziern gestiftet, deren Wappen jeweils am<br />
oberen Rand der Darstellung abgebildet sind. Geschaffen wurden Bilder und Texte zwischen<br />
1516 und 1519 von Niklaus Manuel Deutsch, einer der herausragenden Künstlerpersönlichkeiten<br />
im <strong>Bern</strong> des frühen 16. Jahrhunderts.<br />
Der um 1484 in <strong>Bern</strong> geborene Niklaus Manuel Alleman (Deutsch) wurde durch seine Heirat mit<br />
der Tochter des Ratsherren Hans Frischling in den Grossen Rat aufgenommen. Ab 1513 war er als<br />
Maler tätig und erhielt Aufträge in der Barfüsserkirche, der Dominikanerkirche und dem <strong>Bern</strong>er<br />
Münster. In Letzterem sollte er 1517 das Chorgewölbe künstlerisch ausgestalten, was er auch tat,<br />
obwohl er zur selben Zeit bereits am Totentanz-Zyklus arbeitete. Kurz davor, um 1516, hatte<br />
Niklaus Manuel sich als Söldner unter Albrecht von Stein verdingt und war als dessen Sekretär in<br />
die Lombardei gezogen. Die bei dieser Gelegenheit gesammelten Eindrücke vom italienischen<br />
Kunstschaffen sollten seine künftige Arbeit nachhaltig prägen.<br />
Ab 1520 widmete Niklaus Manuel sich vermehrt der Dichtkunst. Die Gedichte, welche während<br />
seiner Zeit als Landvogt zu Erlach (1523–528) entstanden sind, enthalten scharfe Kritik an der<br />
Amtskirche. Ein Beispiel dafür ist das <strong>Bern</strong>er Fastnachtsspiel «Von Papsts und Christi Gegensatz»<br />
(1523), in dem der Dichter die Kirchenstände kritisiert und verspottet. Es sollte sich als ein nicht<br />
unwesentlicher Vorbote für die fünf Jahre später eingeführte Reformation erweisen, von der<br />
Niklaus Manuel überzeugt war. Am Ende nämlich steht der Papst, der aus Ablässen und Kriegen<br />
Geld gewinnt und die eigentliche Botschaft des Evangeliums vergessen hat, als Antichrist da,<br />
während ein Reformator die Grundsätze des Evangeliums verkündet. Dieses Motiv durchzieht<br />
auch andere Texte des Autors, so etwa lässt er den Papst in den «Totenfressern» (1523) sagen:<br />
«Ich ryt mit drü-, viertusent pferden, Ein cardinal mit zwei-, drühundert: Wiewol die leyen übel<br />
wundert, Ich zwing sy alle durch den ban. Sy wondit der tüffel fiel sy an, Wo sy ein wort<br />
darwider redtend. Darumm, wenn wir nun selber wedtend, So sind wir her der ganzen welt,<br />
[...]». 43<br />
Am 28. April 1530, zwei Jahre nach der Einführung der Reformation, starb Niklaus Manuel. Der<br />
von der italienischen Renaissance und Albrecht Dürer geprägte <strong>Bern</strong>er Künstler hinterliess einige<br />
bedeutende Werke, unter denen der <strong>Bern</strong>er Totentanz herausragt. Dank Albrecht Kauw (um<br />
1612–1681) kann eine Reproduktion des <strong>Bern</strong>er Totentanzes heute im Historischen Museum von<br />
<strong>Bern</strong> betrachtet werden. Er war es, der 1649 das Fresko kopiert hat, ehe die Mauer 1660<br />
niedergerissen wurde.<br />
43 Totenfresser, Verse 72-79. Zitiert aus: Peter Pfrunder: Pfaffen, Ketzer, Totenfresser. Fasnachtskultur der<br />
Reformationszeit – Die <strong>Bern</strong>er Spiele von Niklaus Manuel, Zürich, 1989, S. 235.<br />
-37-
Der Totentanz: Darstellung und Symbolik<br />
Mit der Vertreibung aus dem Paradies wird der <strong>Bern</strong>er Totentanz eröffnet. Darauf folgen eine<br />
Abbildung von Moses, der die Gesetzestafeln erhält, und ein Bild der Kreuzigung Christi. Mit der<br />
nächsten Darstellung, dem «Konzert im Beinhaus», beginnt der eigentliche Totentanz. Ab hier<br />
werden, wie bereits erwähnt, Menschen aller Stände in Begleitung eines den Tod<br />
symbolisierenden Gerippes abgebildet. Auch alle klerikalen Stände, mit dem Papst an der Spitze,<br />
werden in dem Zug gezeigt. Dieser bewegt sich auf das «Konzert im Beinhaus» zu, geht also in<br />
die aus der Sicht des Betrachters linke Richtung. Das letzte Bild auf der rechten Seite stellt das<br />
Jüngste Gericht dar, wo über die Verstorbenen geurteilt wird. Schreitet man das Fresko also von<br />
rechts nach links ab, wird offenbar, dass ausnahmslos allen Menschen, vom Papst und allen<br />
klerikalen Ständen über den Kaiser als höchste weltliche Instanz bis hin zu den Heiden dasselbe<br />
Schicksal blüht: der Gang zum Beinhaus, also in den Tod.<br />
Dem Betrachter hielt dieses gewaltige Fresko zwei wesentliche Punkte vor Augen: Zum Einen<br />
propagierte es eine Gleichstellung aller Menschen. Dies wiederum veranlasste den Betrachter,<br />
ein möglichst gutes und sündenfreies Leben zu führen, damit er nach seinem Tod nicht<br />
verdammt würde. Der zweite Punkt, auf den das Fresko anspielte, war der Tod an sich sowie<br />
seine Allgegenwärtigkeit in Kriegen und Pestepidemien. Es galt, immer auf den Tod vorbereitet<br />
zu sein, denn nach mittelalterlicher Überzeugung strafte Gott den Sünder mit Vorliebe mit<br />
einem unvorbereiteten Tod, d.h. ohne das Busssakrament erhalten zu haben. Dieser zweite<br />
Punkt war vor allem für das Spätmittelalter prägend.<br />
Das Tanzmotiv spielt im Totentanz eine wichtige Rolle, obgleich es zunächst, vor allem auf<br />
Darstellungen von «Verdammtenzügen» aus dem Mittelalter 44 , eher noch ein «mit dem Tod<br />
Gehen» – also nicht ein Tanzen - war. Dass der Zug der Menschen, die mit dem Tod gehen, bald<br />
zur tanzenden Gesellschaft wurde, hat wahrscheinlich auch die Kirche zu verantworten. Von der<br />
Kirche her gesehen war der Tanz etwas Schlechtes, er erinnerte an heidnische Bräuche, war<br />
exzessiv und konnte ausarten, und so war das Tanzmotiv in den Totentänzen durchaus zur<br />
Abschreckung gedacht. Von der Kirche und der <strong>Bern</strong>er Obrigkeit wurden, gerade in der ersten<br />
Hälfte des 16. Jahrhunderts, auch verschiedene Verbote erlassen, um das Tanzen, Singen und<br />
Festen zu unterbinden. Man wollte damit verhindern, dass das Volk ausser Kontrolle geriete und<br />
sich Schmählieder gegen Kirche und Politik oder reformatorisches Gedankengut verbreiteten.<br />
Bereits im ersten Vers des <strong>Bern</strong>er Totentanzes heisst es: «Von des Tüffels vergifften Zung/ hatt<br />
der Tod seinen Ersten Ursprung/ Herrschet veber die Menschen ganntz/ Wir muessent all in<br />
sinenn Tanntz» 45 . Tod und Teufel, die über die Menschen herrschen, werden hier in engen Bezug<br />
zum Tanz gebracht: Jeder, der sich nicht an die Gebote hielte, würde mit dem Tod tanzen<br />
müssen – hier also die Anspielung auf den Tod als Strafe für die Sünde. Bereits in früheren<br />
Totentänzen erscheint das Tanzmotiv in diesem Sinne. Die Opfer, die der Tod zum Tanzen<br />
verführen will, versuchen sich zu wehren, erliegen aber schliesslich dem Drang und tun es doch.<br />
Wichtig ist, dass in den Totentänzen die Menschen und der Tod zur linken Seite hin tanzen. Die<br />
linke Seite symbolisierte die Verdammnis, womit der Tanz als Weg zur Hölle erschien. Der<br />
Verzicht auf eine Höllendarstellung, die im <strong>Bern</strong>er Totentanz durch das Beinhaus ersetzt ist,<br />
deutet darauf hin, dass man unter dem Tanzmotiv nicht mehr explizit den Weg zur Hölle<br />
verstand, sondern vielmehr das Sterben selbst. Somit blieb das Ende offen und bedeutete nicht<br />
mehr unausweichlich die Verdammnis. Doch blieb die zur linken Seite orientierte Darstellung des<br />
Totentanzes das groteske Gegenstück vieler religiöser Darstellungen, auf denen Engel ihre<br />
Reigen tanzen, meist in einem Kreis und zur rechten Seite hin, begleitet von himmlischer Musik.<br />
44 Reinhold Hammerstein sieht in den Darstellungen der sog. Verdammtenzüge aus dem Mittelalter<br />
Vorläufer des Totentanzes. In diesen Zügen werden die Verdammten aneinander gebunden in die Hölle<br />
gezogen. In: Reinhold Hammerstein: «Tanz und Musik des Todes. Die Mittelalterlichen Totentänze und ihr<br />
Nachleben», <strong>Bern</strong>, 1980, S. 59.<br />
45 Johannes Tripps: «Den Würmern wirst Du Wildbret sein». Der <strong>Bern</strong>er Totentanz des Niklaus Manuel<br />
Deutsch in den Aquarellkopien von Albrecht Kauw (1649), <strong>Bern</strong>, 2005, S. 25.<br />
-38-
Instrumentendarstellungen<br />
Im Totentanz sind verschiedene Musikinstrumente abgebildet, mit denen der Tod zum Tanz<br />
aufspielt. Bereits auf Darstellungen des 13. Jahrhunderts werden die Menschen nach dem<br />
Weltgericht von Musikinstrumenten auf ihrem Weg in den Himmel oder in die Hölle begleitet.<br />
Diejenigen, die verdammt worden sind, werden mit Ketten vom Teufel oder von einem Dämon<br />
in die Hölle gezerrt, während sie musikalisch begleitet werden. Die Instrumente sind<br />
gelegentlich absichtlich bizarr dargestellt worden, um ihren teuflischen Charakter zu<br />
unterstreichen. Zunächst wurden oft verschiedene Blasinstrumente wie etwa Schalmei, Flöte,<br />
Zink, Plater oder Dudelsack dargestellt, die unter den Begriff «fistula tartarea» (höllische Pfeife)<br />
gefasst wurden. Diese Instrumentendarstellung und -bedeutung wurde in den Totentänzen<br />
übernommen. Auch hier wurden die Instrumente verformt dargestellt, um einen Missklang zu<br />
verdeutlichen, oder es wurde im Text erwähnt, wie falsch die Musik des Todes im Gegensatz zu<br />
der harmonischen Musik der Engel im Himmel klinge.<br />
Doch durchlief diese Ansicht einen Wandel: Weitere Instrumente wie Laute, Drehleier, Fidel und<br />
andere wurden in den Totentänzen abgebildet. Die generalisierte Verteufelung der Instrumente<br />
wich einer neuen Interpretation. Neu wurden die Instrumente danach bewertet, von wem und<br />
zu welchen Gelegenheiten sie gespielt wurden. Nach wie vor in schlechtem Ruf standen<br />
Instrumente wie der Dudelsack, auch Sackpfeife genannt, Schalmei, Trommel und Schwegel, die<br />
bei Volksbelustigungen häufig zur Anwendung kamen, doch konnten sie auch anders konnotiert<br />
sein. Der Schwegel etwa war eine Einhand-Flöte, die mit der Trommel zusammen gespielt wurde<br />
und im Militär zum Einsatz kam. Trompete, Zink und Busine wurden oft als Signalinstrumente<br />
bzw. herrschaftliche Fanfaren genutzt.<br />
Eine bemerkenswerte Entwicklung machte die Drehleier durch: Als eines der ersten<br />
mehrstimmigen Instrumente wurde sie anfangs sogar in Klöstern und Kirchen gespielt. Aufgrund<br />
der Einfachheit in der Handhabung verbreitete sich die Leier schnell über die verschiedenen<br />
Schichten, zuletzt bis hin zum Blinden und Bettler. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass die<br />
Drehleier ihre Beliebtheit in der sozial höheren Gesellschaft verlor und schliesslich als Instrument<br />
für arme Leute verpönt war. Eine relativ breite soziale Streuung wies dagegen die Laute auf.<br />
Die Darstellung der Musikinstrumente in den Totentänzen macht sich diese Konnotationen<br />
häufig zunutze, indem sie den abgebildeten Standescharakter bezeichnet oder parodiert. Im<br />
<strong>Bern</strong>er Totentanz werden 41 Menschen aus verschiedenen Ständen vom Leben zum Tod geleitet.<br />
Davon werden dreizehn Musikinstrumente an die Seite gestellt, unter denen die Blasinstrumente<br />
mit acht Vertretern die Mehrzahl ausmachen.<br />
Die folgende Auflistung zeigt, wer mit welchem Instrument begleitet wird:<br />
Kardinal Zink<br />
Bischof Laute<br />
Chorherr verunstaltete Plater<br />
Astrologe Drehleier<br />
Kaiser verformte Trompete<br />
König Schalmei<br />
Königin Fidel<br />
Witwe Trommel und Schwegel<br />
armer Mann Querpfeife<br />
Dirne Dudelsack<br />
Kind kleine Pfeife<br />
Koch und Bauer Löffel, Krug, Milchgefäss und Deckel (zu Schlaginstrumenten<br />
umfunktioniert)<br />
-39-
Wie erwähnt ging Niklaus Manuel ziemlich kritisch mit den verschiedenen Ständen um, vor allem<br />
mit den klerikalen. Im Bild «Tod und Bischof» ist diese Kritik gut erkennbar: Der Tod spielt hier<br />
auf einer Laute, einem zwar beliebten, aber weltlich konnotierten Instrument, welches gerne zur<br />
Begleitung von Liebesliedern benutzt wurde. Wenn Niklaus Manuel im Zusammenhang mit dem<br />
Bischof eine Laute wählt, darf das durchaus als Kritik an dessen Sittenlosigkeit verstanden<br />
werden.<br />
Der Kardinal hingegen wird dadurch, dass der Tod ihm mit einem Zink aufspielt, des weltlichen<br />
Hochmutes bezichtigt, handelte es sich doch um ein v.a. im weltlichen Bereich verbreitetes<br />
Fanfaren- oder Signalinstrument. Was den Kaiser angeht, so handelte es sich bei der Trompete<br />
an sich um ein eindeutiges Standesattribut, wäre sie nicht dermassen verbogen. Durch die<br />
Verunstaltung erhält diese den Charakter eines misstönenden Hölleninstrumentes und soll wohl<br />
das Ende der irdischen Macht des Kaisers signalisieren.<br />
Tod und Bischof (Historisches Museum <strong>Bern</strong>).<br />
Der Tod fordert den Bischof auf der Laute<br />
spielend zum Tanzen auf.<br />
Tod und Kaiser (Historisches Museum <strong>Bern</strong>).<br />
Der Kaiser wird vom Tod mitgezogen, der auf<br />
einer völlig verbogenen Trompete spielend das<br />
Ende ankündigt.<br />
Die Querpfeife, mit der der Tod den armen Mann zum Tanzen auffordert, gehört zu den<br />
niedrigsten und elenden Instrumenten, charakterisiert also die Lage des armen Mannes<br />
unmittelbar. Ebenfalls zu den niederen Instrumenten gehören Trommel und Schwegel, die von<br />
Gauklern und fahrendem Volk an Festen, bei der Errichtung eines Galgens, aber auch im Krieg<br />
gespielt wurden. Auf ihnen spielt der Tod im Bild «Tod und Witwe» zum Geleit. Dies könnte eine<br />
Anspielung darauf sein, dass eine Witwe manchmal militärischen Verpflichtungen nachkommen<br />
musste: In <strong>Bern</strong> hatte eine Witwe die Möglichkeit, den Betrieb ihres Mannes weiterzuführen und<br />
gehörte auch weiterhin der Zunft an, in der der Verstorbene Mitglied gewesen war. Dadurch<br />
war sie aber auch verpflichtet, im Kriegsfall einen Knecht und Waffen zu stellen. 46 Trommel und<br />
Schwegel waren, wie bereits erwähnt, auch Instrumente der niederen und einfachen Leute, zu<br />
denen eine Witwe gehörte, wenn sie nicht das Glück hatte, einen Betrieb weiterführen zu<br />
können.<br />
46 Johannes Tripps: «Den Würmern wirst Du Wildbret sein». Der <strong>Bern</strong>er Totentanz des Niklaus Manuel<br />
Deutsch in den Aquarellkopien von Albrecht Kauw (1649), <strong>Bern</strong>, 2005, S. 78.<br />
-40-
Tod und Witwe (Historisches Museum <strong>Bern</strong>).<br />
Trommel und Schwegel spielend begleitet<br />
der Tod die Witwe auf ihrem letzten Weg.<br />
Ein bekanntes Bild aus dem <strong>Bern</strong>er Totentanz ist «Tod und Dirne». Der Dudelsack ist ein<br />
typisches<br />
Instrument, mit dem zum Tanz aufgespielt wurde. Symbolisch steht der Dudelsack für<br />
die Wollust und bezichtigt die Dirne eben dieses Lasters und der Sittenlosigkeit. Der Dudelsack,<br />
kombiniert mit Trompete, Busine und Zink, wird auch auf dem ersten Bild des Totentanzes<br />
dargestellt. Im «Konzert im Beinhaus» werden diese Instrumente von vier Gerippen<br />
gleichermassen im Ensemble gespielt. Diese Kombination von Instrumenten gab es in<br />
Wirklichkeit nicht: Dudelsack und Zink sind durchaus für Tanzmusik geeignete Instrumente,<br />
wurden aber nie zusammen, und schon gar nicht gemeinsam mit Trompete und Busine gespielt.<br />
Hier werden also Instrumente gemischt, die auf verschiedenen Ebenen gedeutet werden müssen.<br />
Trompete und Busine sind traditionsgemäss oft auf Darstellungen des Jüngsten Gerichts<br />
abgebildet und kündigen dieses durch Fanfarenstösse an. Ebenfalls traditionell ist der Dudelsack<br />
unter die Instrumente einzuordnen, die früher unter dem Sammelbegriff der «fistula tartarea»<br />
gefasst wurden und damit zu den stigmatisierten Instrumenten gehörten. Insgesamt ergibt das<br />
Ensemble im Beinhaus eine äusserst misstönende Kombination, der Hölle würdig, die die<br />
Menschen einerseits zum Tanzen auffordert und ihnen andererseits das Jüngste Gericht<br />
ankündigen soll.<br />
Niklaus Manuel hat einen Totentanz geschaffen, der einerseits an die Tradition der früheren<br />
Totentänze anknüpft,<br />
andererseits aber auch einige Neuerungen birgt, wie beispielsweise die<br />
schärfere Kritik an den Mitmenschen. Ebenfalls neu für einen Totentanz war der Umstand, dass<br />
es sich bei einigen Standesvertretern im <strong>Bern</strong>er Totentanz möglicherweise um Portraits von<br />
<strong>Bern</strong>er Bürgern handelt. So im Fall des Bildes «Tod und Herzog», bei dem vermutet wird, dass<br />
Niklaus Manuel den Stifter des Bildes, Kaspar von Mülinen, porträtiert haben könnte. Ebenfalls<br />
völlig neu am <strong>Bern</strong>er Totentanz ist, dass sich der Maler selber im Totentanz darstellte. Dass<br />
Niklaus Manuel andere Totentänze zum Vorbild genommen hat, ist nicht ausgeschlossen.<br />
Wahrscheinlich ist, dass er sich am Basler Totentanz, der um 1440 an eine Kirchhofmauer des<br />
Dominikanerklosters in Basel gemalt worden war, orientiert hat, denn einige Darstellungen, wie<br />
z.B. Tod und Kardinal, aber auch einzelne Verse der beiden Totentänze sind sich sehr ähnlich. Es<br />
könnte daher sein, dass es einige der abgebildeten Instrumente in dieser Form in <strong>Bern</strong> nicht<br />
gegeben hat und Niklaus Manuel sich bei ihrer Darstellung auf andere Bilder stützte: Wie<br />
erwähnt wurde er möglicherweise durch die Eindrücke seiner Italienreise, aber auch von den<br />
Bildern von Albrecht Dürer beeinflusst.<br />
-41-
Mit seinem Totentanz wollte er den Menschen nicht nur die Allgegenwärtigkeit des Todes,<br />
sondern auch die Gleichheit aller im Angesicht des Jüngsten Gerichts vor Augen halten.<br />
Gleichzeitig<br />
tat er als Anhänger des neuen Glaubens seine Meinung über die politischen und vor<br />
allem religiösen Missstände offen kund, indem er die Leute durch verschiedene Attribute wie die<br />
Musikinstrumente zusätzlich charakterisierte, sowohl positiv wie negativ.<br />
Mit den Jahren verlor der Totentanz allmählich seine Aktualität. Die Reformation zog<br />
weitreichende gesellschaftliche Veränderungen nach sich und die Gesellschaftskritik, welche<br />
Manuel in seinem Fresko geäussert hatte, war nur noch eine Zeitzeugin<br />
der vergangenen<br />
Unzufriedenheit. Als man die Friedhofsmauer, an die der Totentanz gemalt war, aufgrund einer<br />
Strassenerweiterung abriss, dachte man nicht daran, das gewaltige Kunstwerk zu bewahren, und<br />
so bleiben für die Nachwelt einzig die Kopien von Kauw erhalten.<br />
-42-
Literatur<br />
Hammerstein, Reinhold: «Tanz und Musik des Todes. Die mittelalterlichen Totentänze und ihr<br />
Nachleben», <strong>Bern</strong>, 1980.<br />
Kaiser, Gert (Hrsg.): «Der tanzende Tod. Mittelalterliche Totentänze», hrsg., eingeleitet und<br />
übersetzt von Gert Kaiser, Frankfurt am Main, 1982.<br />
Pfaff: «Die Welt der Schweizer Bilderchronik», Schwyz, 1991.<br />
Pfrunder, Peter: «Pfaffen, Ketzer, Totenfresser. Fasnachtskultur der Reformationszeit – Die<br />
<strong>Bern</strong>er Spiele von Niklaus Manuel», Zürich, 1989.<br />
Tripps, Johannes: «Den Würmern wirst Du Wildbret sein». Der <strong>Bern</strong>er Totentanz des Niklaus<br />
Manuel Deutsch in den Aquarellkopien von Albrecht Kauw (1649), <strong>Bern</strong>, 2005.<br />
-43-
8. Die Bedeutung der Hausmusik in Patrizierfamilien<br />
und deren reiche Musiksammlungen<br />
von Viktoria Supersaxo<br />
In gebildeten Kreisen des 16. Jahrhunderts wurde eine hochwertige musikalische Ausbildung der<br />
Söhne und Töchter bürgerlicher Familien gefördert und gesellige Zusammenkünfte zum<br />
gemeinsamen Musizieren mit befreundeten Gelehrten genutzt. Diese hohe Wertschätzung der<br />
Musik erstaunt zunächst, befanden sich doch unter den Musikfreunden auch Reformatoren wie<br />
Ulrich Zwingli (1484–1531). Warum sollten dieselben Personen, welche die Musik aus der Kirche<br />
und dem öffentlichen Leben verbannt hatten, nun im Privaten das Musizieren erlauben und<br />
sogar fördern? Die Antwort liegt im einenden Band des Humanismus.<br />
Grundsätzlich widmeten sich die Gelehrten der humanistischen Zirkel den studia humanitatis<br />
(Grammatik, Rhetorik, Poetik, Geschichte und Moralphilosophie), welche sich aus dem Trivium<br />
(Grammatik, Rhetorik und Dialektik) des mittelalterlichen <strong>Universität</strong>sunterrichts herausgebildet<br />
hatte. Die Musik als Teil des Quadriviums (Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie), dem<br />
anderen Schwerpunkt der mittelalterlichen Ausbildung, scheint also zunächst für den<br />
Humanismus irrelevant gewesen zu sein. Tatsächlich aber war der Humanismus für die<br />
Entwicklung der Kompositionstechnik, Aufführungspraxis, Musiktheorie und Ästhetik der<br />
Renaissance von grosser Bedeutung, stand doch das Studium antiker Quellen im Zentrum der<br />
Beschäftigung, das zu Neuansätzen auch in der Musikanschauung führte. Ausgehend von der<br />
platonischen Ethoslehre etwa wurde die Musik nicht mehr nur in mathematischen<br />
Zusammenhängen gesehen, sondern um rhetorische und poetische Aspekte bereichert.<br />
Altgriechische Musiktraktate wurden zunächst in lateinischer Übersetzung, später dann in<br />
Volkssprachen tradiert und erreichten damit ein grösseres Publikum. Die humanistisch gesinnten<br />
Musiktheoretiker der Renaissance griffen somit auf antike Theorien zurück, um sie dann auf die<br />
zeitgenössische Musikkultur anzuwenden.<br />
Als Musterbeispiel gilt der Schweizer Heinrich Glarean (1488–1563). Er verfasste die wichtige<br />
musiktheoretische Schrift Dodekachordon (Basel, 1547). Durch das Aufkommen des Drucks<br />
fanden diese Bücher eine weite Verbreitung. Anhand von 120 Werken internationaler<br />
Komponisten wie Josquin Desprez (1440–1521) und eidgenössischer Freunde wie etwa Johannes<br />
Wannenmacher (1485–1551) demonstriert Glarean die zwölf Modi (Tonarten). Dabei erweiterte<br />
er die bis anhin bekannten acht Modi (dorisch, hypodorisch, phrygisch, hypophrygisch, lydisch,<br />
hypolydisch, mixolydisch, hypomixolydisch) um weitere vier Kirchentonarten: äolisch (Moll),<br />
hypoäolisch, ionisch (Dur) und hypoionisch. Er lobt die polyphone Musik als eine ars perfecta, für<br />
die kein klassisches Vorbild existiere. Diese Äusserung erstaunt zunächst – ja mutet sogar<br />
antihumanistisch an -, galt doch die Antike für den Humanismus als Vorbild. Da jedoch keine<br />
Kompositionen der Antike überliefert sind, wandten Humanisten wie Glarean das antike<br />
Gedankengut auf die Kompositionen ihrer Zeit an. Die Musik vermochte demzufolge als<br />
klingende Kunstform menschliche Gefühle auszudrücken und sollte auf das Empfinden der<br />
Menschen einwirken. Somit wurde sie im humanistischen Sinne zu einer expressiven Sprache.<br />
Folglich war die Musik für Glarean nicht nur ein den Text transportierender Gesang, sondern<br />
konnte durch die Polyphonie auch den Affektgehalt steigern.<br />
Zugleich blühte der Gesang zur Laute als Versinnbildlichung antiker musikalischer<br />
Aufführungspraxis auf. Dieser monodische, d.h. einstimmige Gesang mit Instrumentalbegleitung<br />
wurde zudem als ideale Umsetzung sprachbezogener Einfachheit verstanden. Damit wurde die<br />
Laute zum damals am weitesten verbreiteten Instrument überhaupt und kann als typisches<br />
-44-
Hausinstrument mit dem heutigen Klavier verglichen werden. Bürgerliche Familien besassen<br />
nicht nur ein Instrument, sondern sammelten mehrere Lauten in den unterschiedlichsten<br />
Varianten. Dies führte zu einem geradezu explosionsartigen Boom des gewerblichen<br />
Lautenbaus. Neben der Verwendung der Laute zur Begleitung des Gesangs etablierte sie sich<br />
auch als Soloinstrument, gewann doch die Instrumentalmusik in der Renaissance allgemein<br />
zunehmend an Bedeutung.<br />
Das immens anwachsende Repertoire für die Laute und dessen wachsender Schwierigkeitsgrad<br />
setzte schliesslich eine spezifische Instrumentalnotenschrift, die Tabulatur, voraus. Im Nachlass<br />
des Basler Theologen Leonhard Hospinian (um 1500–1564), der in der Zentralbibliothek der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> verwahrt wird, findet sich einer der frühesten erhaltenen<br />
Lautentabulaturdrucke. Dieses Lehrbuch von Hans Neusiedler (1508–1563) zeigt in einem ersten<br />
Teil den Umgang mit der Tabulatur (Griffschrift). Anhand von «punctlein» soll selbst ein Schüler<br />
geringen Verstands ohne einen Lehrer das Lautenspiel erlernen können. In einem zweiten Teil<br />
erhält der Autodidakt «vil auserlesener kunstreicher stuck» zum Üben. Die Fantasien, Präambeln,<br />
Psalmen und Motetten von berühmten Komponisten dieser Zeit sind – wie Neusidler betont – nie<br />
zuvor im Druck erschienen. Im Hospinian-Nachlass der Zentralbibliothek der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
befindet sich nicht nur dieses praxisorientierte Lautentabulaturbuch, sondern auch die bereits<br />
erwähnte musiktheoretische Schrift Dodekachordon von Glarean. Jener ist eine weitere Schrift<br />
angebunden, Rerum musicarum opusculum (1535), verfasst vom Musiktheoretiker und<br />
Komponisten Johann Frosch (um 1490–1535?).<br />
Die Bibliothek des Basler Theologieprofessors Leonhard Hospinian ist die bedeutendste<br />
zusammenhängende Sammlung alter Drucke, die die Zentralbibliothek der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
besitzt. Insgesamt umfasst sie 435 Titel, wobei die meisten in lateinischer Sprache verfasst sind.<br />
Weiter befinden sich griechische, italienische, deutsche und sogar ein hebräisches Werk in der<br />
Sammlung. Im Hospinian-Nachlass stösst man sowohl auf zeitgenössische theologische Literatur<br />
und biblische Schriften, als auch auf bemerkenswert zahlreiche naturwissenschaftliche und<br />
medizinische Literatur. Vorwiegend finden sich in der Bibliothek jedoch römische und<br />
griechische Klassiker der Philosophie, Philologie, Rhetorik und Geschichte. Leonhard Hospinian<br />
ist damit ein Exempel des umfassend gebildeten Menschen der Renaissance, der seine Bibliothek<br />
ebenso als Hort theoretischen und praktischen Wissens wie auch als Ausweis seines über Bildung<br />
definierten Standes begriff.<br />
Alle jungen Leute gesellschaftlich gut gestellter Familien wurden in dem humanistisch geprägten<br />
Streben nach vielseitiger Bildung im Gesang unterrichtet und spielten mindestens ein<br />
Musikinstrument. Als das am besten dokumentierte und damit bekannteste Schweizer Beispiel<br />
einer solchen Patrizierfamilie gelten Bonifacius Amerbach (1495–1562) mit seinem Sohn Basilius<br />
(1533–1591) aus Basel. Basel war zur Zeit von Bonifacius’ Kindheit eine kulturelle Metropole, die<br />
durch die erste <strong>Universität</strong> der Schweiz (1514) und die 70 Drucker der Stadt zu einem Zentrum<br />
des Humanismus aufsteigen sollte. Bereits Bonifacius hat eine breite Allgemeinbildung erhalten,<br />
denn sein Vater Johannes Amerbach (1444–1513) war nicht nur der Gründer des bekanntesten<br />
Druckhauses der Stadt und Vorbereiter der Baseler <strong>Universität</strong>sgründung, sondern kannte den<br />
«Vater» des Humanismus, Erasmus von Rotterdam (1466–1536), persönlich.<br />
Der jüngste Sohn Bonifacius erreichte wie sein Vater grosses Ansehen. Als Jurist erhielt er die<br />
Doktorwürde und pflegte seinerseits eine enge Freundschaft zu Erasmus von Rotterdam. Anders<br />
als sein Vater und seine Brüder entwickelte Bonifacius bereits als fünfzehnjähriger Schüler eine<br />
ausgeprägte Liebe zur Musik. 1510 soll Bonifacius fünf in Basel gebundene Stimmhefte<br />
erworben haben, die sich heute im sogenannten Amerbach-Kabinett der<br />
Handschriftensammlung der <strong>Universität</strong>sbibliothek Basel befinden (FX 5–9). Das Amerbach-<br />
Kabinett beinhaltet nicht nur eine immense Sammlung von Gemälden, sondern auch die grösste<br />
private Bibliothek der damaligen Zeit in der Schweiz. Bereits Johannes Amerbach hatte damit<br />
begonnen, die Sammlung zusammen zu tragen, wobei sein Sohn Bonifacius und sein Enkel<br />
-45-
Basilius sie unter anderem um Musikalien erweiterten. Die bereits erwähnte Liedersammlung FX<br />
5–9 ist eines der wichtigsten Zeugnisse der polyphonen Vokal- und Instrumentalmusik des 16.<br />
Jahrhunderts. Sie enthält 43 Kompositionen, vorwiegend deutsche und lateinische Lieder sowie<br />
Motetten, jedoch sind auch französische Stücke und Tänze enthalten. Ein besonderer<br />
Schwerpunkt gilt <strong>Bern</strong>er Komponisten. Johannes Wannenmacher ist mit vier Werken vertreten:<br />
Grates domino iugiter referamus, Salve magnificum genu ac veneranda, Qua te mente feram / Tu<br />
bonitate deos und Invidie telum. Cosmas Alder werden sogar sechs Lieder zugeschrieben: Veni<br />
electa mea, Inssbruck muss ich dich lossen, Da Jacob nun das kleid ansach, Wie Joseph in Egipten<br />
landt, Floreat Ursine gentis und Ich weiss ein stotze müllerin.<br />
Eine andere Besonderheit der Stimmbücher FX 5-9 aus Basel stellen die mit Wasserfarben<br />
kolorierten Federzeichnungen dar. Das Stimmbuch FX 7 zeigt den personifizierten Tod, der mit<br />
Pfeilen auf Menschen jeden Alters und jeden Standes schiesst. Dieses Motiv findet sich im <strong>Bern</strong>er<br />
Totentanz des Niklaus Manuel (etwa 1484 bis 1530) wieder. Begleitet wird die Zeichnung von<br />
einem Vers aus den Oden des Horaz: Omnes una manet nox / Et caleanda semel via lethi (Eine<br />
Nacht wartet auf jeden, und manchmal muss der Weg des Todes beschritten werden).<br />
Bonifacius Amerbach erwarb für die Erziehung seines Sohnes und das Musizieren der Humanisten in<br />
«Privatensembles» Liederbücher. Sie sind die frühesten erhaltenen Zeugnisse privaten Musikunterrichts. Die<br />
Zeichnung mit Versen des Horaz zeigt den auf die verschiedenen Lebensalter schiessenden Tod, ein Motiv<br />
des «Totentanzes».<br />
Amerbach-Kabinett, Handschriftensammlung <strong>Universität</strong>sbibliothek Basel.<br />
Die Lektüre der Oden des Horaz gehörte zur Standardausbildung, wobei Bonifacius eine<br />
besondere Vorliebe dafür entwickelt zu haben scheint. In der Tat zählt die Liedersammlung zu<br />
den frühesten erhaltenen Zeugnissen privaten Musikunterrichts und verweist damit auf die weit<br />
verbreitete Praxis einer breit angelegten Ausbildung in den bürgerlichen Familien.<br />
Bonifacius Amerbach beauftragte für die musikalische Ausbildung seines Sohnes Basilius den<br />
Lehrer Christoph Piperinus (?–1565) aus <strong>Bern</strong>. Belegt ist das Schüler-Lehrerverhältnis einerseits<br />
durch einen Brief Piperinus’ an Basilius’ Vater Bonifacius Amerbach, andererseits taucht Piperinus<br />
auch als Schreiber in einigen der Amerbach-Liederbücher auf. Die enthaltenen Lieder, Chansons,<br />
Motetten, Tänze und Hymnen waren demnach Bestanteil des Unterrichts. Piperinus wird sich bei<br />
der Auswahl von Vokal- und Instrumentalstücken am Geschmack von Bonifacius Amerbach<br />
orientiert haben, prägte diesen jedoch zugleich. Bonifacius selbst spielte Laute und sehr<br />
wahrscheinlich gab es auch in seinem Haus Zusammenkünfte der Humanisten zwecks<br />
-46-
gemeinsamen Musizierens. Bei diesen Treffen konnten die Gelehrten sich einerseits von ihrem<br />
Alltag erholen, gemeinsam vergnügt sein und ihrem Wunsch nach kreativem Ausdruck<br />
nachkommen, andererseits boten die Zusammenkünfte Raum für den humanistischen<br />
Gedankenaustausch.<br />
Etliche andere Liederbücher, die sich in Schweizer Archiven und Bibliotheken wie etwa der<br />
Stiftsbibliothek St. Gallen, der Zentralbibliothek Zürich oder selbst im Walliser Archive du<br />
Chapitre Sion erhalten haben, lassen auf die weite Verbreitung einer derartigen bürgerlichen<br />
Musikkultur schliessen. Sie alle belegen, dass die private Musikpflege in der Schweiz zu einem<br />
zentralen Moment bürgerlichen Selbstverständnisses geworden war.<br />
Liederbücher in Schweizer Bibliotheken<br />
Archives du Chapitre Sion Tir. 87-4 Simon Zmutt<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.IX. 32-5 Bonifacius Amerbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.IX. 59-62 Jakob Hagenbach (1532–1565)<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.IX. 63 Jakob Hagenbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 1-4 Bonifacius Amerbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 5-9 Bonifacius Amerbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 10 Bonifacius Amerbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 17-20 Jakob Hagenbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 21 Ludwig Iselin (1559–1612)<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 22-4 Bonifacius Amerbach<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel F.X. 25-6 Ludwig Iselin<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel kk.IV. 19-22 Jakob Hagenbach?<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Basel FX 59-62 Jakob Hagenbach<br />
Stiftsbibliothek St. Gallen Codex 461 Fridolin Sicher (–1490)<br />
Stiftsbibliothek St. Gallen Codex 462 Johannes Heer (1489–1553)<br />
Stiftsbibliothek St. Gallen Codex 463 Aegidius Tschudy (1505–1572)<br />
Stiftsbibliothek St. Gallen Codex 464 Aegidius Tschudy<br />
Zentralbibliothek Zürich T 410-413 Johannis von Schännis (–1586)<br />
Zentralbibliothek Zürich Car.V.169 a-d Clemens Hör (um 1535–1572)<br />
-47-
Literatur<br />
Bowles, Edmund Addison: «Musikleben im 15. Jahrhundert», Leipzig, 1977.<br />
Capitani, François de: «Musik», in: <strong>Bern</strong>s mächtige Zeit, hrsg. von André Holenstein, <strong>Bern</strong>, 2006.<br />
«Die Fugger und die Musik. `lautenschlagen lernen und ieben`. Anton Fugger zum 500.<br />
Geburtstag», hrsg. von Renate Eikelmann, Augsburg, 1993 (Städtische Kunstsammlung.<br />
Ausstellung in den historischen `Badstuben` im Fuggerhaus, Augsburg. Vom 10. Juni bis 8.<br />
August 1993).<br />
«Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts» (Teil 1), hrsg. von Ludwig Finscher, Laaber, 1980.<br />
Geering, Arnold: «Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation. Leben und Werk von<br />
Bartholomäus Frank, Johannes Wannenmacher, Cosmas Alder», Aarau, 1933 (Schweizerisches<br />
Jahrbuch für Musikwissenschaft, Bd. VI).<br />
Gülke, Peter: «Mönch, Bürger, Minnesänger», Laaber 1998.<br />
Haar, James (übs. von Thomas Christian Schmidt): «Humanismus», in: MGG, hrsg. von Ludwig<br />
Finscher, Sachteil, Bd.4, Basel u.a., 1998 2 .<br />
Kmetz, John: «The sixteenth-century Basel songboogs». <strong>Bern</strong>, 1995.<br />
Kmetz, John: «Da Jacob nun das Kleid ansah and Zurich Zentralbibliothek T 410-413: A wellknown<br />
motet in a little-known 16th-centur manuscript», in: Schweizer Jahrbuch für<br />
Musikwissenschaft [Annales Suisse de Musicologie], Vol. 4-5, hrsg. von der Schweizerischen<br />
Musikforschenden Gesellschaft, <strong>Bern</strong>, 1984–1985.<br />
Knaus, Gabriella Hanke: «Musikgeschichte. Musik in <strong>Bern</strong> im 15. Jahrhundert», in: <strong>Bern</strong>s grosse<br />
Zeit. Das 15. Jahrhundert neu entdeckt, hrsg. von Ellen J. Beer u. a. <strong>Bern</strong>, 1999.<br />
Marx, Joachim Hans: «Unbekannte Basler Tabulatur-Fragmente aus dem frühen 16.<br />
Jahrhundert», in: Musikalische Quellen – Quellen zur Musikgeschichte: Festschrift für Martin<br />
Staehelin zum 65. Geburtstag, hrsg. von Ulrich Konrad, Göttingen, 2002.<br />
Schwindt, Nicole: «Musikalische Lyrik in der Renaissance», in: Handbuch der musikalischen<br />
Gattungen, hrsg. von Siegfried Mauser, Bd. 8.1, Laaber, 2004.<br />
Strohm, Reinhard: «The rise of European music. 1380-1500», Cambridge, 1993.<br />
-48-