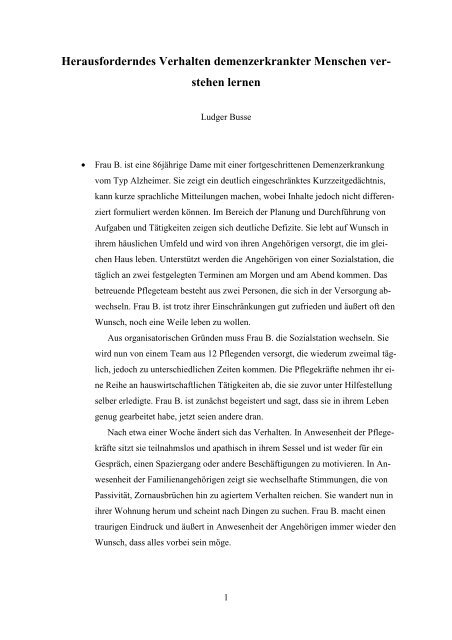Vortragstext Herausforderndes Verhalten - Let´s Care
Vortragstext Herausforderndes Verhalten - Let´s Care
Vortragstext Herausforderndes Verhalten - Let´s Care
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Herausforderndes</strong> <strong>Verhalten</strong> demenzerkrankter Menschen ver-<br />
stehen lernen<br />
Ludger Busse<br />
• Frau B. ist eine 86jährige Dame mit einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung<br />
vom Typ Alzheimer. Sie zeigt ein deutlich eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis,<br />
kann kurze sprachliche Mitteilungen machen, wobei Inhalte jedoch nicht differen-<br />
ziert formuliert werden können. Im Bereich der Planung und Durchführung von<br />
Aufgaben und Tätigkeiten zeigen sich deutliche Defizite. Sie lebt auf Wunsch in<br />
ihrem häuslichen Umfeld und wird von ihren Angehörigen versorgt, die im glei-<br />
chen Haus leben. Unterstützt werden die Angehörigen von einer Sozialstation, die<br />
täglich an zwei festgelegten Terminen am Morgen und am Abend kommen. Das<br />
betreuende Pflegeteam besteht aus zwei Personen, die sich in der Versorgung ab-<br />
wechseln. Frau B. ist trotz ihrer Einschränkungen gut zufrieden und äußert oft den<br />
Wunsch, noch eine Weile leben zu wollen.<br />
Aus organisatorischen Gründen muss Frau B. die Sozialstation wechseln. Sie<br />
wird nun von einem Team aus 12 Pflegenden versorgt, die wiederum zweimal täg-<br />
lich, jedoch zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Die Pflegekräfte nehmen ihr ei-<br />
ne Reihe an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ab, die sie zuvor unter Hilfestellung<br />
selber erledigte. Frau B. ist zunächst begeistert und sagt, dass sie in ihrem Leben<br />
genug gearbeitet habe, jetzt seien andere dran.<br />
Nach etwa einer Woche ändert sich das <strong>Verhalten</strong>. In Anwesenheit der Pflege-<br />
kräfte sitzt sie teilnahmslos und apathisch in ihrem Sessel und ist weder für ein<br />
Gespräch, einen Spaziergang oder andere Beschäftigungen zu motivieren. In An-<br />
wesenheit der Familienangehörigen zeigt sie wechselhafte Stimmungen, die von<br />
Passivität, Zornausbrüchen hin zu agiertem <strong>Verhalten</strong> reichen. Sie wandert nun in<br />
ihrer Wohnung herum und scheint nach Dingen zu suchen. Frau B. macht einen<br />
traurigen Eindruck und äußert in Anwesenheit der Angehörigen immer wieder den<br />
Wunsch, dass alles vorbei sein möge.<br />
1
• An diesem Beispiel können wir sehen, worum es im Folgenden geht, nämlich um Ver-<br />
haltensänderungen demenzerkrankter Menschen, die sich scheinbar aus heiterem<br />
Himmel und in ihrer Art willkürlich im Verlauf der Erkrankung entwickeln. Jeder, der<br />
mit demenzerkrankten Personen zu tun hat, kennt derartige <strong>Verhalten</strong>sänderungen und<br />
weiß, dass sie sich in vielfältiger Form zeigen können, nämlich in körperlich oder ver-<br />
bal aggressivem <strong>Verhalten</strong>, in agitiertem <strong>Verhalten</strong> mit Unruhezuständen und schein-<br />
bar ziellosem Wandern, in lautem Rufen ohne aggressive Tendenz aber auch in Passi-<br />
vität, Apathie und sozialem Rückzug.<br />
• (Folie 2) Für diese <strong>Verhalten</strong>sänderungen finden sich unterschiedliche Bezeichnun-<br />
gen, die sich in zwei große Gruppen unterteilen lassen:<br />
- zum einen wird von störendem, unangepasstem, auffälligem <strong>Verhalten</strong> ge-<br />
sprochen. Diese Bezeichnungen sind deutlich negativ besetzt, führen zu ei-<br />
ner defizitorientierten Sichtweise und einer Distanzierung zur erkrankten<br />
Person.<br />
- im modernen Pflegeverständnis sprechen wir von herausforderndem Ver-<br />
halten. Dieser Begriff bezieht das soziale Umfeld mit ein, da es herausge-<br />
fordert wird, sich mit der Person und deren <strong>Verhalten</strong> zu beschäftigen. Der<br />
Begriff zeigt eine ressourcenorientierte Sichtweise und Hinwendung zur<br />
erkrankten Person.<br />
• (Folie 3) Mit genau diesem Aspekt, nämlich mit der Sichtweise auf die Demenzer-<br />
krankung und den Auswirkungen, die eine Sichtweise auf den Umgang mit demenzer-<br />
krankten Personen hat, hat sich 1995 der Demenzforscher Tom Kitwood beschäftigt.<br />
Er formuliert zwei Pflegekulturen, die er als die alte und eine, noch zu etablierende,<br />
neue Pflegekultur bezeichnet. Am Beispiel der Sichtweise auf das Krankheitsbildes<br />
Demenz stellt Kitwood fest, dass in der alten Pflegekultur die Demenz als eine verhee-<br />
rende Erkrankung des Zentralnervensystems aufgefasst wird, „in deren Verlauf Per-<br />
sönlichkeit und Identität nach und nach zerstört werden“. In der neuen Pflegekultur<br />
wird Demenz als eine Form der Behinderung gesehen. „Wie ein Mensch dadurch be-<br />
einträchtigt wird, hängt ganz entscheidend von der Qualität der Pflege ab“ (Kitwood<br />
2008, S. 194).<br />
Tom Kitwood formuliert damit zwei Sichtweisen: die defizitorientierte Sicht der<br />
alten Pflegekultur und eine ressourcenorientierte Sicht in der neuen Pflegekultur.<br />
2
• (Folie 4) Am Beispiel herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s stellt Kitwood ebenfalls die alte<br />
und neue Pflegekultur gegenüber. In der alten Pflegekultur wird herausforderndes<br />
<strong>Verhalten</strong> als ein Problemverhalten verstanden, mit dem technisch gut und effizient<br />
umgegangen werden muss (Kitwood 2008, S. 195).<br />
Beispiele für einen technischen Umgang mit herausforderndem <strong>Verhalten</strong> finden<br />
sich in vielen Einrichtungen, beispielsweise in Form von Endloswanderwegen, fikti-<br />
ven Bushaltestellen, fiktiven Zugabteilen in denen sich anstelle der Fenster Bildschir-<br />
me befinden, auf denen eine vorbeiziehende Landschaft gezeigt wird, sog. Nestelde-<br />
cken oder durch Verabreichung von Psychopharmaka. Mit diesen Maßnahmen wird<br />
also technisch gut und effizient mit dem <strong>Verhalten</strong> umgegangen, ohne sich mit der<br />
Person zu beschäftigen. Symptome werden behandelt, nach Ursachen wird nicht ge-<br />
forscht.<br />
Im Gegensatz hierzu wird in der neuen Pflegekultur jedes sog. Problemverhalten<br />
„als Versuch der Kommunikation im Zusammenhang mit einem Bedürfnis gesehen“.<br />
Es sollte der Versuch unternommen werden, „die Botschaft zu verstehen und so auf<br />
das unbefriedigte Bedürfnis einzugehen“ (Ebd.).<br />
Mit dieser Aussage werden Pflegende aufgefordert, durch eine Beschäftigung mit<br />
der erkrankten Person, deren <strong>Verhalten</strong> zu verstehen, um dann Einfluss nehmen zu<br />
können.<br />
• (Folie 5) Ein Jahr nach der Veröffentlichung Tom Kitwoods präsentierte eine Gruppe<br />
US-amerikanischer Pflegewissenschaftler um Donna Algase (1996) das sog. Need-<br />
Driven Dementia-Compromised Behaviour Model. Dieser Begriff stellt ein Wortunge-<br />
tüm dar, das nur schwierig zu übersetzen ist, ein Versuch könnte lauten: „Bedürfnis-<br />
bedingtes <strong>Verhalten</strong>smodell bei Demenz“ (Halek u. Bartholomeyczik 2006, S. 49).<br />
Gemeint ist damit ein Modell, mit dessen Hilfe herausforderndes <strong>Verhalten</strong> erklärt<br />
werden kann. Bei uns in Deutschland hat es unter dem Kürzel NDB-Modell Eingang in<br />
die Diskussion gefunden.<br />
Das NDB-Modell betrachtet herausfordernde <strong>Verhalten</strong>sweisen als sinnvolle Äu-<br />
ßerungen, mit denen demenzerkrankte Menschen im Rahmen ihrer Fähigkeiten und<br />
Möglichkeiten auf Bedürfnisse aufmerksam machen. Im Sinne Kitwoods wird heraus-<br />
forderndes <strong>Verhalten</strong> also als ein Kommunikationsversuch gewertet, mit dem auf Be-<br />
dürfnisse aufmerksam gemacht wird.<br />
3
• (Folie 6) Das NDB-Modell versucht die Entstehung und das Wesen herausfordernden<br />
<strong>Verhalten</strong>s anhand zweier Komponenten zu erklären, die als „Hintergrundfaktoren“<br />
bzw. „Proximale/Nahe Faktoren“ bezeichnet werden.<br />
• (Folie 7) Unter Hintergrundfaktoren werden Merkmale verstanden, die eine Person<br />
beschreiben. Für die Pflegenden ergibt sich aus diesen Informationen Hintergrundwis-<br />
sen über die Person. Hintergrundfaktoren sind:<br />
- der neurologische Status im Rahmen der Grunderkrankung. Dieser macht<br />
Aussagen über Defizite im Bereich der Gedächtnisleistung, Sprache,<br />
Wahrnehmung und Planungsfähigkeit<br />
- der aktuelle Gesundheitszustand beschreibt die motorischen Fähigkeiten,<br />
die Fähigkeiten im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens oder des<br />
Seh- und Hörvermögen<br />
- demographische Faktoren geben Informationen zur Religionsangehörig-<br />
keit, Schulbildung und Beruf<br />
- psychosoziale Faktoren umfassen Charaktereigenschaften oder das Verhal-<br />
ten auf Stress.<br />
• Einige der genannten Hintergrundfaktoren möchte ich etwas genauer beschreiben,<br />
weil sich die Frage stellt, warum es wichtig ist, Informationen darüber zu sammeln.<br />
Ein eingeschränkter neurologischer Status, wie er sich aus Defiziten im Bereich der<br />
Gedächtnisleistung, Sprache, Wahrnehmung und Planungsfähigkeit ergibt, stellt eine<br />
grundlegende Voraussetzung für die Entstehung herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s dar. Je<br />
eingeschränkter sich der neurologische Status dabei darstellt, desto höher wird die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass derartiges <strong>Verhalten</strong> auftritt. Dieses Merkmal liefert also In-<br />
formationen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Ausbildung herausfordern-<br />
der <strong>Verhalten</strong>sweisen zu erwarten sind, so dass Risikopersonen identifiziert werden<br />
können.<br />
Neben der Möglichkeit, Risikopersonen zu ermitteln, können Persönlichkeits-<br />
merkmale Informationen liefern, mit denen das zu beobachtende <strong>Verhalten</strong> erklärt<br />
werden kann. Wenn eine Person vor ihrer Erkrankung einen introvertierten, in sich zu-<br />
rückgezogenen Persönlichkeitstyp zeigte, so wird sich dieser auch im Verlauf der Er-<br />
krankung in ihrem <strong>Verhalten</strong> zeigen, so dass eher passive <strong>Verhalten</strong>sweisen zu erwar-<br />
4
ten sind. Konnte eine Person Probleme besser lösen, indem sie Spaziergänge machte,<br />
um so intensiver nachdenken zu können, dann wäre in der Erkrankungsphase immer<br />
dann mit motorischer Unruhe zu rechnen, wenn die betroffene Person an einem Prob-<br />
lem arbeitet. Hat eine Person in ihrem Leben viele Dinge ertragen und sich nicht zur<br />
wehr gesetzt, so kann dieser Persönlichkeitszug in der Erkrankung durch Passivität<br />
und Rückzug in Erscheinung treten.<br />
Eine Analyse von Hintergrundfaktoren kann also dazu beitragen, sowohl Risi-<br />
kopersonen zu ermitteln, bei denen die Entwicklung herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s zu<br />
erwarten ist, als auch Erklärungen zu liefern, die die Art der beobachtbaren Verhal-<br />
tensänderungen verständlich macht.<br />
• (Folie8) Die zweite Komponente des NDB-Modells stellen die proximalen/nahen Fak-<br />
toren dar. Diese können als Umweltfaktoren bezeichnet werden, aus denen sich Be-<br />
dürfnisse ergeben können.<br />
- physiologische Faktoren wie Durst-, Hunger- oder Schmerzzustände sind<br />
mit den Bedürfnissen Trinken, Essen und Schmerzfreiheit verbunden<br />
- unter psychosozialen Faktoren werden beispielsweise Langeweile auf-<br />
grund einer Unterforderung, Anspannung infolge einer Überforderung<br />
oder aber Angst verstanden. Die Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, sind<br />
die nach Beschäftigung im Falle der Unterforderung, Ruhe bei Überforde-<br />
rung und einer sicheren Umgebung, in der die betroffene Person keine Un-<br />
sicherheit und Angst empfindet<br />
- unter Umgebungsfaktoren wird all das verstanden, was sich im Umfeld der<br />
Personen befindet, also beispielsweise die Umgebungslautstärke, die Um-<br />
gebungstemperatur oder Lichtverhältnisse. Bedürfnisse ergeben sich dabei<br />
aus den individuellen Vorlieben der jeweiligen Person.<br />
- der Faktor „soziale Umgebung“ umfasst z.B. die Anwesenheit von Perso-<br />
nen oder die Personalausstattung in der Betreuung. Bedürfnisse könnten<br />
sein: der Wunsch nach einer kleineren Gruppe, nach Alleinsein oder nach<br />
einer angemessenen Personalsituation, die den Versorgungsansprüchen ge-<br />
recht werden kann.<br />
Eine Analyse proximaler/naher Faktoren ist in der Lage unbefriedigte Bedürfnisse zu<br />
identifizieren, die das zu beobachtende herausfordernde <strong>Verhalten</strong> auslösen.<br />
5
• (Folie 9) Hintergrundfaktoren stellen damit Merkmale dar, die eine Person beschrei-<br />
ben. Als solche sind sie nur geringfügig von außen beeinflussbar und müssen als ge-<br />
geben akzeptiert werden.<br />
Unter proximalen/nahen Faktoren werden Bedürfnisse verstanden, die sich aus der<br />
Umwelt ergeben. Durch eine Anpassung der Umgebung an die Bedürfnisse der Betrof-<br />
fenen können diese gut beeinflusst werden.<br />
• (Folie 10) Der Theorie des NDB-Modells zufolge lässt sich die Entstehung herausfor-<br />
dernden <strong>Verhalten</strong>s aus dem Zusammenspiel der beiden Modellkomponenten erklären.<br />
Finden sich also Hintergrundfaktoren, die die Ausbildung herausfordernden Verhal-<br />
tens wahrscheinlich machen, und ergibt sich zudem ein Bedürfnis, das nicht befriedigt<br />
wird, so kann eine derartige Konstellation zu herausforderndem <strong>Verhalten</strong> führen.<br />
• (Folie 11) Im Umkehrschluss ergibt sich aus dieser Aussage die Handlungsnotwen-<br />
digkeit, dass beim Auftreten herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s nach möglichen Ursachen<br />
in Form unbefriedigter Bedürfnisse zu suchen ist und diese zu befriedigen sind. In die-<br />
sem Fall ist mit einer Verringerung oder einem Verschwinden der <strong>Verhalten</strong>sweisen<br />
zu rechen.<br />
• Für die praktische Arbeit stellt sich nun natürlich die Frage, auf welche Weise Bedürf-<br />
nisse im Alltag erkannt werden können. Das NDB-Modell kann diese Frage nicht<br />
schlüssig beantworten. Eine mögliche Antwort findet sich in den Empfehlungen einer<br />
Expertengruppe um Sabine Bartholomeyczik (2006), die im Auftrag des Bundesminis-<br />
teriums für Gesundheit die sog. Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausfor-<br />
derndem <strong>Verhalten</strong> bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe erarbeitete.<br />
• (Folie 12) In ihrer ersten Empfehlung spricht sich die Expertengruppe für eine verste-<br />
hende Diagnostik als Zugang zu Pflegesituationen aus, die durch herausfordernde<br />
<strong>Verhalten</strong>sweisen geprägt sind. Analog zum NDB-Modell wird herausforderndes Ver-<br />
halten dabei als ein Mitteilungsversuch verstanden, der für Demenzerkrankte „mögli-<br />
cherweise die letzte und einzige Form der Kommunikation“ darstellt (Halek 2008, S.<br />
20).<br />
6
Im Zentrum der verstehenden Diagnostik steht dabei ein Perspektivwechsel, der<br />
das <strong>Verhalten</strong> der demenzerkrankten Person aus dessen Position heraus zu beurteilen<br />
versucht.<br />
• (Folie 13) Der Prozess der verstehenden Diagnostik lässt sich in drei aufeinanderfol-<br />
gende Phasen unterteilen. Am Anfang steht eine detaillierte Beschreibung der Verhal-<br />
tensänderung durch den betreuenden Personenkreis. Diese erfolgt möglichst objektiv,<br />
also unabhängig von negativen Gefühlen und Interpretationen. Im zweiten Schritt wird<br />
auf der Grundlage des NDB-Modells systematisch nach Gründen gesucht, die als Aus-<br />
löser für <strong>Verhalten</strong>sänderungen in Frage kommen. Darauf aufbauend folgt in einem<br />
dritten Schritt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die zur Formulierung von Pfle-<br />
gezielen und Pflegemaßnahmen führt.<br />
• Um den Prozess der verstehenden Diagnostik zu verdeutlichen, möchte ich noch ein-<br />
mal auf das eingangs dargestellte Fallbeispiel zurückkommen. Wir erinnern uns: Frau<br />
B. zeigte nach einem Wechsel der Sozialstation und einer damit verbundenen Verän-<br />
derung in der Betreuungsstruktur herausforderndes <strong>Verhalten</strong>. Versuchen wir, diesen<br />
Fall auf der Grundlage der verstehenden Diagnostik zu analysieren, so beginnen wir<br />
mit der Beschreibung des <strong>Verhalten</strong>s: Frau B. zeigt im Kontakt mit den Pflegekräften<br />
Passivität und Rückzug. Diese <strong>Verhalten</strong>sweisen sind durch Interventionen nicht zu<br />
durchbrechen. Im Kontakt mit Angehörigen zeigt sie wechselhaftes <strong>Verhalten</strong> in Form<br />
von Passivität und Zornausbrüchen. Frau B. schimpft dann mit einer hohen emotiona-<br />
len Beteiligung über Personen oder Ereignisse aus früherer Zeit. Zudem findet sich<br />
agitiertes <strong>Verhalten</strong> mit Wandern in der Wohnung. Frau B. äußert eine negative Le-<br />
benseinstellung: „Hoffentlich ist bald alles vorbei“.<br />
Der zweite Prozessschritt sucht nach Faktoren, die das <strong>Verhalten</strong> erklären und<br />
auslösen. Das NDB-Modell dient dabei als Strukturierungshilfe. Hintergrundfaktoren<br />
beschreiben dabei die Person, und proximale/nahe Faktoren dienen der Überprüfung<br />
unbefriedigter Bedürfnisse.<br />
- Ein Hintergrundfaktor ergibt sich aus der fortgeschrittenen Demenzerkran-<br />
kung. Der neurologische Status ist in Hinblick auf Gedächtnisleistung,<br />
Sprache, Wahrnehmung und Planungsfähigkeit deutlich eingeschränkt. Er-<br />
höhte Gefahr der Ausbildung herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s. Frau B. zählt<br />
damit zur Risikogruppe.<br />
7
- Weitere Hintergrundfaktoren ergeben sich aus folgenden Persönlichkeits-<br />
merkmalen: Frau B hat als Hausfrau viel gearbeitet, und Arbeit stellt für sie<br />
einen zentralen Lebenssinn und eine Daseinsberechtigung dar.<br />
- Autoritäten gegenüber war Frau B. zurückhaltend und konnte vieles klaglos<br />
ertragen. Diese Information kann die <strong>Verhalten</strong>sweisen Passivität und<br />
Rückzug erklären, die Frau B. bei den Besuchen der Sozialstation zeigt, da<br />
die Pflegekräfte als Autoritäten betrachtet werden. Im Innern der Familie<br />
war Frau B. bestimmend, streng und durchsetzungsfähig. In diesem Zu-<br />
sammenhang können <strong>Verhalten</strong>sweisen wie Schimpfen und Zornausbrüche<br />
im Umgang mit nahen Angehörigen nicht überraschen.<br />
- Um über Probleme nachzudenken und Stress abzubauen, hat sich Frau B.<br />
vor ihrer Erkrankung immer viel im Garten und Haushalt bewegt. Es ist<br />
deshalb nicht verwunderlich, dass Frau B., die einer hohen Stressbelastung<br />
ausgesetzt ist, in der Wohnung umherwandert, und damit eine gewohnte<br />
Bewältigungsstrategie nutzt.<br />
- Über proximale/nahe Faktoren lassen sich folgende Aussagen machen: Im<br />
sozialen Umfeld finden sich viele Betreuungspersonen. Variable Besuchs-<br />
zeiten führen zu mangelnder zeitlicher Orientierung. Dies führt zu Unsi-<br />
cherheit und Angst und zu dem Bedürfnis, in einem vertrauten und sicheren<br />
Umfeld zu leben, in dem sie sich zurechtfinden kann.<br />
- Die neue Situation ist durch Langeweile und Unterforderung gekennzeich-<br />
net. Für Frau B. ergibt sich daraus das Bedürfnis nach Beschäftigung, ver-<br />
bunden mit dem Wunsch nach einer Daseinsberechtigung.<br />
Im letzten Schritt folgt die Formulierung von Pflegezielen und Pflegemaßnahmen.<br />
Diese sind: Reduzierung und Kontinuität des betreuenden Personenkreises und festge-<br />
legte Besuchszeiten. Ressourcen werden erkannt und gefördert. Aktivitäten, die Frau<br />
B. zuvor mit Unterstützung ausführte, werden erneut angeboten.<br />
Die herausfordernden <strong>Verhalten</strong>sweisen konnten durch diese Maßnahmen er-<br />
heblich gemindert werden.<br />
• Diese Analyse zeigt, dass herausforderndes <strong>Verhalten</strong> nicht ohne Grund auftritt. Frau<br />
B. hat sogar sehr gute Gründe, sich über herausforderndes <strong>Verhalten</strong> mitzuteilen, um<br />
damit auf unbefriedigte Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Die <strong>Verhalten</strong>sweisen,<br />
die sie dabei zeigt, können bei genauerer Betrachtung nicht als willkürlich bezeichnet<br />
8
werden, sondern entsprechen in groben Zügen denen, die auch vor ihrer Erkrankung<br />
für sie typisch waren.<br />
• (Folie 14) Die Sicht auf die Demenzerkrankung und deren Symptome führt zu Einstel-<br />
lungen, die Auswirkungen auf die Versorgung der betroffenen Personen haben.<br />
Das NDB-Modell und die verstehende Diagnostik favorisieren eine ganzheitliche,<br />
ressourcenorientierte Sicht auf Menschen mit Demenz. <strong>Herausforderndes</strong> <strong>Verhalten</strong><br />
wird dabei als Kommunikationsversuch gewertet, mit dem die Betroffenen auf unbe-<br />
friedigte Bedürfnisse aufmerksam machen.<br />
• (Folie 15) Die Entstehung herausfordernden <strong>Verhalten</strong>s erklärt das NDB-Modell aus<br />
dem Zusammenspiel von Hintergrundfaktoren und proximalen/nahen Faktoren. Hin-<br />
tergrundfaktoren beschreiben die Person. Sie geben Hinweise auf Risikopersonen und<br />
sind in der Lage, die Art der <strong>Verhalten</strong>sweise zu erklären.<br />
Proximale/nahe Faktoren stellen Umweltfaktoren dar, aus denen sich Bedürf-<br />
nisse ergeben können. Eine Analyse dieser Faktoren ist in der Lage, unbefriedigte Be-<br />
dürfnisse als Auslöser für herausforderndes <strong>Verhalten</strong> zu ermitteln.<br />
Bei der Suche nach möglichen unbefriedigten Bedürfnissen kann die Methode<br />
der verstehenden Diagnostik hilfreich sein. In drei Schritten findet eine Analyse des<br />
<strong>Verhalten</strong>s statt, die in der Lage ist, die zu beobachtende <strong>Verhalten</strong>sänderung zu erklä-<br />
ren und unbefriedigte Bedürfnisse zu ermitteln, die das <strong>Verhalten</strong> ausgelöst haben.<br />
• (Folie 16) Die Demenzerkrankung ist in ihrer Ausprägung sehr vielschichtig und lässt<br />
sich nur schwer in ein Modell pressen. Dennoch bietet das NDB-Modell, in Kombina-<br />
tion mit der verstehenden Diagnostik, einen vielversprechenden Erklärungs- und<br />
Handlungsansatz, um herausforderndes <strong>Verhalten</strong> als eine krankheitsspezifische<br />
„Form der Kommunikation“ zu verstehen und adäquat auf diese antworten zu können.<br />
Diese Sichtweise erlaubt es, herausforderndem <strong>Verhalten</strong> nicht defizitorientiert<br />
mit Ohnmacht, Frustration und Ärger zu begegnen, sondern ressourcenorientiert zu<br />
handeln, indem nach unbefriedigten Bedürfnissen gesucht wird, die das <strong>Verhalten</strong><br />
ausgelöst haben. Eine daran anschließende Bedürfnisbefriedigung steigert in erhebli-<br />
chem Maße die Lebensqualität der Betroffenen.<br />
9
Literatur<br />
Algase, D. u.a.: Need-driven dementia-compromised behavior: An alternative view of disruptive<br />
behavior. In: American Journal of Alzheimer’s Disease 11, 1996, H. 6, S. 10-19.<br />
Bartholomeyczik, Sabine u.a.: Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem<br />
<strong>Verhalten</strong> bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe. Hrsg: Bundesministerium<br />
für Gesundheit. Witten 2006. In:<br />
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/fa_redaktion_bak/pdf_publik<br />
ationen/Forschungsbericht_Rahmenempfehlungen_Umgang_Demenz.pdf<br />
Halek, M.; Bartholomeyczik, S.: Verstehen und Handeln. Hannover 2006.<br />
Halek, M.: Verstehende Diagnostik: das Verstehen kommt vor dem Handeln. In: Österreichische<br />
Pflegezeitschrift 61, 2008, H. 3, S. 19-23.<br />
Kitwood, Tom: Demenz. Bern 2008.<br />
Hamburg, 18. Januar 2013<br />
Ludger Busse<br />
Hansestraße 21<br />
49685 Schneiderkrug<br />
E-Mail: ludger.busse@gmx.de<br />
10