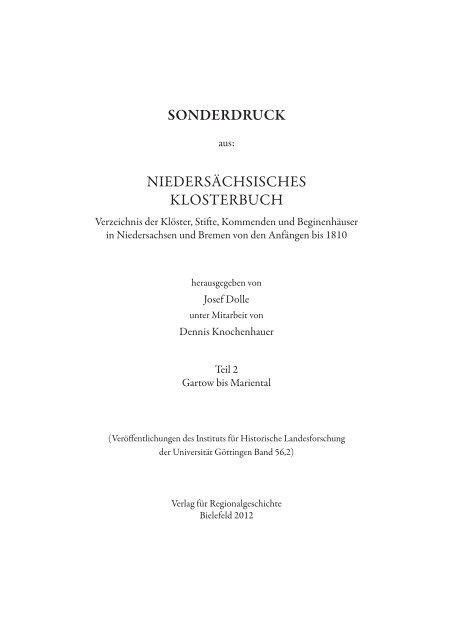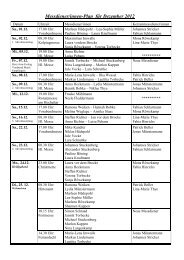Download - Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer Lage ...
Download - Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer Lage ...
Download - Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer Lage ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Son<strong>der</strong>druck<br />
aus:<br />
Nie<strong>der</strong>sächsisches<br />
Klosterbuch<br />
Verzeichnis <strong>der</strong> Klöster, stifte, Kommenden und beginenhäuser<br />
in Nie<strong>der</strong>sachsen und bremen von den Anfängen bis 1810<br />
herausgegeben von<br />
Josef dolle<br />
unter Mitarbeit von<br />
dennis Knochenhauer<br />
teil 2<br />
Gartow bis Mariental<br />
(Veröffentlichungen des instituts für historische landesforschung<br />
<strong>der</strong> universität Göttingen band 56,2)<br />
Verlag für regionalgeschichte<br />
bielefeld 2012
Glie<strong>der</strong>ungsschema<br />
1 KurZiNforMatioNeN<br />
1.1 die administrative Zugehörigkeit <strong>der</strong> institution (stand 2007)<br />
1.1.1 diözese bzw. kirchliche Zugehörigkeit<br />
1.1.2 staatliche Zugehörigkeit 1789, 1810 und bei <strong>der</strong> aufhebung; datum <strong>der</strong> aufhebung<br />
1.2 benennungen <strong>der</strong> institution in den Quellen<br />
1.2.1 rechtsform, lebensform, ordenszugehörigkeit und ordensprovinz<br />
1.2.2 hauptpatrozinien und ihr eventueller Wechsel<br />
1.2.3 bekenntnis bzw. Konfessionswechsel<br />
1.2.4 siegel und gegebenenfalls Wappen<br />
2 geschichte uNd bedeutuNg <strong>der</strong> iNstitutioN<br />
2.1 allgemeine geschichte und Verfassung<br />
2.1.1 stifter, dotation<br />
2.1.2 Mutterkloster<br />
2.1.3 reliquienausstattung<br />
2.1.4 Verlegungen<br />
2.1.5 än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ordenszugehörigkeit<br />
2.1.6 anschluss an reformen<br />
2.2 Verfassung sowie innere und äußere organisation<br />
2.2.1 dignitäten und geistliche und weltliche ämter<br />
2.2.2 immunität und Vogteirechte<br />
2.3 einfluss auf an<strong>der</strong>e institutionen<br />
2.3.1 tochtergründungen, termineien und einsiedeleien in den Pfarreien<br />
2.3.2 Pfarrkirchliche funktionen, stellung im Pfarrverband, inkorporierte Pfarreien, Patronats<br />
rechte<br />
2.3.3 hilfen in <strong>der</strong> Katechese und seelsorge o<strong>der</strong> als beichtväter in frauenkonventen<br />
2.3.4 archidiakone, ständige Visitatoren und leiter gleichzeitig an<strong>der</strong>er Kommunitäten<br />
2.3.5 Konventsmitglie<strong>der</strong> an fürstlichen höfen (z.b. als rat, Kaplan)<br />
2.4 Kulturelle und spirituelle leistungen<br />
2.4.1 schule<br />
2.4.2 hospitäler<br />
2.4.3 Wallfahrten<br />
2.5 Wirtschaftsgeschichte sowie Münz- und Marktrechte<br />
2.5.1 Wirtschaftshöfe, grangien<br />
2.5.2 Mühlen, fabriken, brauereien o<strong>der</strong> fischrechte<br />
2.5.3 stadthäuser bzw. -höfe<br />
2.6 darstellung bestimmter beson<strong>der</strong>heiten wie ordensverleihungen, wissenschaftliche<br />
und künstlerische leistungen, beson<strong>der</strong>e Wirtschaftssysteme etc.
XXVi glie<strong>der</strong>ungsschema<br />
3 gedrucKte uNd uNgedrucKte QuelleN<br />
3.1 Kurzer überblick zur geschichte des archivs und <strong>der</strong> bibliothek<br />
3.2 gedruckte Quellen, archiv- und handschriftenverzeichnisse<br />
3.3 die heutige aufbewahrung des archivs und sonstiger das institut betreffen-<br />
<strong>der</strong> archivalischer Nachrichten<br />
3.4 Zu den überkommenen archivalien in folgen<strong>der</strong> auflistung:<br />
3.4.1 Nicht gedruckte archivverzeichnisse, repertorien, urkundenregesten und<br />
bibliothekskataloge, bes. die heutigen findbücher<br />
3.4.2 liturgische handschriften<br />
3.4.3 reliquienverzeichnisse<br />
3.4.4 urkundenabschriften, statutenbücher, akten zur Verfassung<br />
3.4.5 Nekrologe, Memorienbücher<br />
3.4.6 annalen, chroniken, diarien, literarische und wissenschaftliche handschriften<br />
3.4.7 rechnungs- und lagerbücher, einkünfte- und inventarverzeichnisse, Protokollbücher<br />
3.4.8 Visitationsakten<br />
3.4.9 Weihematrikel, Profess- und aufschwörungsbücher, abtslisten<br />
3.4.10 akten zur säkularisation bzw. <strong>der</strong> Nachfolgeinstitute<br />
3.5 Zu den gemälden, ansichten, grundrissen und Karten<br />
3.5.1 alte gemälde und ansichten <strong>der</strong> Kirchen- und Klosteranlage<br />
3.5.2 alte Karten, lagepläne und grundrisse<br />
3.5.3 alte fotos, beson<strong>der</strong>s wenn die gebäude zerstört sind<br />
3.5.4 Porträts<br />
4 bau- uNd KuNstdeNKMäler<br />
4.1 geschichte <strong>der</strong> gebäude und gebäudeausstattung<br />
4.2 ausstattung <strong>der</strong> gebäude<br />
4.2.1 altäre (bei Verlegung Verweis auf heutige institutionen)<br />
4.2.2 orgeln<br />
4.2.3 glocken<br />
4.2.4 Kelche, Monstranzen, Kreuze, reliquienschreine, Kanzel, taufsteine, chorgestühl und<br />
Kommunionbänke, fenster, textilien und sonstige wichtige gegenstände<br />
4.2.5 statuen<br />
4.2.6 grabstätten bzw. grabdenkmäler<br />
4.2.7 Kunstgeschichtlich bedeutende gegenstände<br />
4.2.8 alte inschriften<br />
5 listeN <strong>der</strong> iNstitutsVorstäNde<br />
5.1 dignitäten<br />
6 literaturVerZeichNis
Abkürzungsverzeichnis<br />
* geboren<br />
† gestorben, wüst<br />
a archiv<br />
aa adelsarchiv<br />
abb. abbildung<br />
abschr. abschrift<br />
abt. abteilung<br />
adW göttingen akademie <strong>der</strong> Wissenschaften zu göttingen<br />
af alte folge<br />
anh. anhang<br />
art. artikel<br />
aufl. auflage<br />
b. bei<br />
bd. band<br />
bde. bände<br />
bearb. bearbeiter<br />
bibl. bibliothek<br />
bistumsa bistumsarchiv<br />
cod. codex<br />
<strong>der</strong>s. <strong>der</strong>selbe<br />
dep. depositum<br />
doma domarchiv, domstiftsarchiv<br />
dombibl. dombibliothek<br />
doZa deutschordenszentralarchiv<br />
ev. evangelisch(es)<br />
fl. gulden<br />
gb great britain<br />
gsta PK berlin geheimes staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz berlin<br />
hab Wolfenbüttel herzog august bibliothek Wolfenbüttel<br />
hast Köln historisches archiv <strong>der</strong> stadt Köln<br />
hauM herzog anton ulrich-Museum<br />
hg. herausgegeben<br />
hl., hll., hl. heilig, heiliger<br />
hs., hs. handschrift, handschriftlich<br />
hsta hauptstaatsarchiv<br />
hsta düsseldorf landesarchiv Nordrhein-Westfalen, abteilung rheinland
XXViii abkürzungsverzeichnis<br />
Jg. Jahrgang<br />
kath. katholisch<br />
Kla Klosterarchiv<br />
Klbibl Klosterbibliothek<br />
Krs. Kreis<br />
lb dresden landesbibliothek dresden<br />
lha landeshauptarchiv<br />
lK landkreis<br />
lKa landeskirchliches archiv<br />
m Meter(n)<br />
masch. maschinenschriftlich<br />
Mgh Monumenta germania historica<br />
Ms. Manuskript, Manuscripta<br />
NdK Nie<strong>der</strong>sächsische denkmalkartei<br />
Nf Neue folge<br />
Nlb hannover gottfried Wilhelm leibniz bibliothek – Nie<strong>der</strong>sächsische<br />
landesbibliothek<br />
Nld Nie<strong>der</strong>sächsisches landesamt für denkmalpflege<br />
N.N. Nomen nescio<br />
Nr Neue reihe<br />
o.J. ohne Jahr<br />
o.o. ohne ort<br />
Pfarra Pfarrarchiv<br />
phil. philosophisch<br />
rhc groninger arven regionaal historisch centrum groninger archieven<br />
sbPK berlin staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz berlin<br />
sJ societas Jesu (Jesuitenorden)<br />
slg. sammlung<br />
sta staatsarchiv<br />
sta Münster landesarchiv Nordrhein-Westfalen, abteilung Westfalen<br />
stadta stadtarchiv<br />
stadtbibl stadtbibliothek<br />
st. sankt<br />
stbibl staatsbibliothek<br />
sub staats- und universitätsbibliothek<br />
suppl. supplement<br />
t. teil<br />
ub urkundenbuch<br />
übers. übersetzt<br />
ulb halle universität- und landesbibliothek halle<br />
univa universitätsarchiv<br />
univbibl universitätsbibliothek
L<br />
LaGe – Johanniter<br />
(1245 bis 1810)<br />
1 Kurzinformationen<br />
1.1 gemeinde rieste, samtgemeinde bersenbrück, lK osnabrück.<br />
1.1.1 diözese osnabrück; heute evangelisch-lutherische landeskirche hannovers, bistum osnabrück.<br />
1.1.2 1789: fürstbistum osnabrück; 1810 bei <strong>der</strong> aufhebung: Königreich Westphalen.<br />
1.2 domum in <strong>Lage</strong> (1245); domui sancte Marie in <strong>Lage</strong> et hospitali sancti Johannis Iherosolimitani<br />
(1253); commendatori et fratribus domus hospitalis sancti Johannis in Laga (1262); commenduyr<br />
und brue<strong>der</strong>e des huses zu <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>n (1385); Laech preceptoria (1495); <strong>Lage</strong> preceptoria in Westfalia<br />
(1540); Commendator S. Ioannis Baptistae in <strong>Lage</strong> ordinis Hierosolymitani seu Melitensis (1656);<br />
Commende <strong>Lage</strong> (1810).<br />
1.2.1 ordenskommende; Johanniter; ballei Westfalen; großpriorat deutschland.<br />
1.2.2 Maria (1253), dann nur noch <strong>Johannes</strong> <strong>der</strong> täufer.<br />
1.2.3 <strong>Kath</strong>olisch.<br />
1.2.4 bei <strong>der</strong> 1478 verfassten urkunde sta osnabrück, rep. 18, 41 ist das siegel des Komturs<br />
Johann von Warendorp erhalten, bei den übrigen urkunden im sta osnabrück sind die siegel sämtlich<br />
abgeschnitten o<strong>der</strong> mitsamt den Presseln aus dem Pergament gerissen.<br />
um 1600 verwenden die Komture Papiersiegel.<br />
2 Geschichte und Bedeutung <strong>der</strong> Institution<br />
2.1 1245 stiftete graf otto von tecklenburg seinen hof zu lage in <strong>der</strong> gemarkung<br />
rieste „dem heiligen <strong>Johannes</strong> und dem hospital in Jerusalem“. er bestätigte 1258<br />
seine stiftung „zwecks unterstützung <strong>der</strong> armen christi in den län<strong>der</strong>n jenseits des<br />
Meeres“ zugunsten <strong>der</strong> beabsichtigten ansiedlung <strong>der</strong> Johanniter. 1260 wird erstmals<br />
die Präsenz <strong>der</strong> Johanniter erwähnt. die im weitläufigen Kirchspiel bramsche gelegene<br />
Kommende entwickelte sich neben burgsteinfurt zu einer <strong>der</strong> wichtigsten Nie<strong>der</strong>lassungen<br />
des Johanniterordens in Nordwestdeutschland. 1262 zählte sie zwölf confratres<br />
und wuchs bis 1341 auf 45 brü<strong>der</strong> an. im 14. Jh. begann die bis heute bestehende Wallfahrt<br />
zum „heiligen Kreuz von lage“, das gemäß <strong>der</strong> legende nach einer himmlischen<br />
Vision von den Johannitern <strong>Johannes</strong> und rudolf geschnitzt worden war.<br />
<strong>der</strong> osnabrücker bischof dietrich von horne (1376-1402) for<strong>der</strong>te trotz päpstlicher<br />
exemtion steuerzahlungen von den Johannitern. als sie diese verweigerten, überfiel<br />
<strong>der</strong> bischof am 18.2.1384 von seiner benachbarten burg in Vörden aus das ritterhaus<br />
von lage, nahm die bewohner gefangen, plün<strong>der</strong>te die Kommende aus und machte sie<br />
unbewohnbar. trotz <strong>der</strong> über ihn verhängten exkommunikation bequemte er sich erst<br />
1395 zur Wie<strong>der</strong>gutmachung des schadens. Nur langsam erholte sich die Kommende<br />
von diesem schlag, 1426 wurde die lager Kirche vom osnabrücker Weihbischof neu
896 lage<br />
konsekriert. 1495 bestand <strong>der</strong> Konvent aus dem Komtur und fünf brü<strong>der</strong>n. im dreißigjährigen<br />
Krieg wurde lage von den schweden besetzt, so dass <strong>der</strong> neue Komtur<br />
Johann Jakob von Pallandt (1650-1693) nach dem Westfälischen frieden die gebäude<br />
<strong>der</strong> Kommende gänzlich neu errichten ließ. Nach dem tod des letzten Johanniter-<br />
Priesters 1647 residierte nur noch <strong>der</strong> Komtur im ordenshaus, wenn er nicht in einer<br />
seiner an<strong>der</strong>en Kommenden weilte o<strong>der</strong> in ordensgeschäften von <strong>der</strong> residenz dispensiert<br />
war. die Komture des 16. bis 19. Jh. gehörten zum hessischen, rheinischen<br />
und südwestdeutschen adel. in ihrem auftrag übten von 1652-1811 dominikaner<br />
aus osnabrück und zusätzlich seit 1659 Weltpriester an <strong>der</strong> lager Kirche katholische<br />
seelsorge aus. die Kommende lage und das benediktinerinnen-Kloster Malgarten<br />
blieben katholische institutionen inmitten des lutherischen Kirchspiels bramsche.<br />
1810 wurde die Kommende zugunsten des von Jerôme bonaparte gestifteten „ordens<br />
<strong>der</strong> Westphälischen Krone“ aufgehoben, doch kam <strong>der</strong> geplante Verkauf <strong>der</strong> güter<br />
nicht zustande. die län<strong>der</strong>eien unterstehen heute <strong>der</strong> Klosterkammer in hannover,<br />
während die gebäude nach 1964 zum hotel und restaurant umgebaut wurden. 1999<br />
erwarb sie das bistum osnabrück und errichtete darin am 8. dezember 2000 das dominikanerinnenkloster<br />
„Zum gekreuzigten erlöser“.<br />
2.1.1 graf otto von tecklenburg übertrug die ihm resignierten lehen des ritters hugo von horne,<br />
darunter eine domus in lage, dem Johanniterorden. die seit dem 15. Jh. übliche Zuschreibung<br />
<strong>der</strong> stiftung an den ritter hermann von hake beruht auf einem Missverständnis: er musste den<br />
Johannitern 1260 umfangreiche Wie<strong>der</strong>gutmachung zahlen.<br />
2.1.3 Nach den iburger annalen weihte bischof engelbert von osnabrück (1305-1320) das lager<br />
Kreuz und überließ ihm viele kostbare reliquien. die reliquienverzeichnisse wurden durch die<br />
öffnung des lager Kreuzes (zuletzt 1956 und 1987) bestätigt: 25 reliquien vom Kreuz christi,<br />
vom Kalvarienberg, vom berge sinai, vom grabe christi, vom weißen gewand des herrn, von <strong>der</strong><br />
Krippe des herrn. apostel andreas und bartholomäus, Märtyrer georg, Petronilla, regina, barbara,<br />
sebastian, Margaretha, erzbischof Thomas becket von canterbury, cordula. reliquien des<br />
hochaltars und von zwei seitenaltären bei <strong>der</strong> altarweihe 1676: crispin und crispinian. secundus,<br />
Vitalis, Margaretha.<br />
2.2.1 genannt werden <strong>der</strong> Komtur (1260), <strong>der</strong> rittmeister (miles magister) (1262), Prior und senior<br />
(1491).<br />
2.3.2 die Kirche <strong>der</strong> Kommende nahm nach dem Westfälischen frieden de facto die funktion<br />
einer Pfarrkirche für die <strong>Kath</strong>oliken von rieste wahr. deshalb kam es zu beschwerden des zuständigen<br />
lutherischen Pfarrers von bramsche. erst 1815 wurde die Pfarrei st. <strong>Johannes</strong> <strong>der</strong> täufer zu lage<br />
staatlicherseits offiziell anerkannt.<br />
2.3.4 <strong>der</strong> Komtur von lage war oft gleichzeitig Komtur in an<strong>der</strong>en häusern o<strong>der</strong> nahm innerhalb<br />
des ordens weitere funktionen wahr: albert von ulenbroke, Komtur von burgsteinfurt; lubbert<br />
von dehem, Komtur von burgsteinfurt, bailli von Westfalen; ludolph von langhen, Komtur von<br />
burgsteinfurt, bailli von Westfalen; Johann Kruse, Komtur von burgsteinfurt, bailli von Westfalen;<br />
herbord von snetlage Komtur von burgsteinfurt, bailli von Westfalen; otto graf von Waldeck,<br />
Komtur von herford und burgsteinfurt, bailli von Westfalen; Johann von altenbockum, Komtur<br />
von herford, bailli von Westfalen; heinrich Johann von ledebur, Prior von dacien, zugleich Komtur<br />
von herford, rezeptor in Nie<strong>der</strong>deutschland; Moritz lesch von Mühlheim, Prior von dacien,<br />
Komtur von herford und süpplingenburg; heinrich von bernsau, Komtur von herford; Jakob<br />
christoph von andelau, Komtur von herford, burgsteinfurt, Wietersheim, großbailli von Malta,<br />
Prokurator <strong>der</strong> deutschen län<strong>der</strong>; friedrich ludwig landgraf von hessen-darmstadt, Komtur von
lage<br />
897<br />
herford, großprior von deutschland in heitersheim; Johann Jakob freiherr von Pallandt zu eyll<br />
und hamern, Prior von dacien, Komtur von borken, herford und Wesel, Komtur von herrenstrunden,<br />
bailli von Westfalen; otto Theodor heinrich freiherr von Pallandt zu borschemich, großprior<br />
von dacien, Komtur von herford; Johann sigismund graf von schaesberg, Komtur von herford,<br />
Münster, hasselt und burgsteinfurt; Johann friedrich freiherr schenk von stauffenberg zu Wilflingen,<br />
Komtur von herford; Philipp Wilhelm graf von Nesselrode und reichenstein, admiral <strong>der</strong><br />
ordensflotte in Malta, Komtur von frankfurt, herford, schleusingen und Weißensee, großbailli in<br />
Malta, großprior von deutschland in heitersheim; hermann adolf graf von Nesselrode und reichenstein,<br />
Komtur von borken, herford und Wesel, Prokurator <strong>der</strong> finanzen des ordens; bernhard<br />
Moritz dietrich freiherr von cappel zur horst, Komtur von herford, herrenstrunden, schleusingen<br />
und Weißensee, bailli von brandenburg, großprior von dacien; caspar fidelis freiherr von schönau<br />
zu Wehr, Komtur von bassel (lothringen), dorlisheim (elsaß) und herford, Prior von dacien;<br />
fidelis Joseph felix ignatius freiherr von schönau zu Wehr, Komtur von hasselt und herford,<br />
generalreceptor in ober- und Nie<strong>der</strong>deutschland, administrator des fürstpriorats in heitersheim;<br />
ferdinand Joseph hermann anton freiherr von hompesch zu bolheim, Komtur von bassel (lothringen),<br />
colmar, dorlisheim (elsaß), herford, reichardsroth, rothenburg, Mühlhausen und sulz,<br />
bailli von brandenburg, dann großbailli, später großmeister des Malteserordens; <strong>Johannes</strong> baptista<br />
<strong>Johannes</strong> Nepomuk Joseph ferdinand christoph reinhard freiherr von Pfürdt zu carspach, Komtur<br />
von herford, großbailli, großmeisterlicher Minister beim Kaiserlich-französischen hof in Paris.<br />
2.3.5 Komtur Johann Jakob von Pallandt war als gesandter des Malteserordens beim frieden von<br />
Nijmegen 1678/79 (sta osnabrück rep. 18, 129).<br />
2.4.1 1688 erfolgte die stiftung einer katholischen Volksschule in rieste. 1781 för<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Komtur<br />
auch die errichtung einer evangelischen Volksschule in rieste.<br />
2.4.2 1495 wird eine Magd genannt, die in <strong>der</strong> infirmeria tätig war, 1591 wird das inventar <strong>der</strong><br />
infirmerie aufgezählt. offenbar gab es ein Krankenzimmer für ordensangehörige und dienerschaft.<br />
2.4.3 seit anfang des 14. Jh. ist die bis heute bestehende Wallfahrt zum heiligen Kreuz von lage<br />
nachweisbar, die auf eine Kreuzvision zweier Johanniter zurückgeht. hauptwallfahrtstage und<br />
Markttage waren bis ins 20. Jh. das Patronatsfest <strong>der</strong> geburt <strong>Johannes</strong> des täufers (24. Juni) und das<br />
fest Kreuzerhöhung (14. september), mit dem auch das Kirchweihfest verbunden wurde.<br />
2.5 durch schenkungen und Käufe, aber auch durch geschickte tauschgeschäfte gelang<br />
es den Johannitern, ihre besitzungen in den umliegenden Kirchspielen bramsche,<br />
Neuenkirchen i.o., damme und ankum zu arrondieren. 1495 zählte man 79 Vasallen,<br />
die getreide und bargeld lieferten. die vergleichsweise hohe responsionszahlung an<br />
den Johanniterorden in höhe von mehr als 50 gulden im Jahre 1501 lässt auf eine<br />
gute wirtschaftliche situation schließen. 1801 gab es 154 eigenbehörige. das Klostergut<br />
umfasste bei <strong>der</strong> säkularisation 270 hektar.<br />
da die Konventskirche keine Pfarrkirche war, entwickelte sich seit dem 15. Jh. für den<br />
unterhalt <strong>der</strong> Priester das „beneficium lagense“ mit län<strong>der</strong>eien in den umliegenden<br />
Kirchspielen und dem holdorfer Zehnten im Kirchspiel damme. die aufgaben des<br />
Verwalters nahmen im 18. Jh. oft die ortsansässigen Weltpriester wahr.<br />
2.5.1 ein Wirtschaftshof mit großem Viehhaus befand sich am sitz <strong>der</strong> Kommende in lage, dazu<br />
heuerhäuser wie das sun<strong>der</strong>haus für forstarbeiten und Jagdaufgaben im Waldgebiet sun<strong>der</strong>n.<br />
2.5.2 eine Mühle in rieste wird schon in <strong>der</strong> dotation 1245 genannt: cum molendino in Rist.<br />
die künstlich angelegte hohe hase, ein seitenarm <strong>der</strong> hase, umflutet das Kloster von Malgarten<br />
und die Kommende lage, bevor sie wie<strong>der</strong> in die tiefe hase mündet. <strong>der</strong> Komtur hermann adolf<br />
von Nesselrode erbaute 1733/1743 die heute noch bestehenden gebäude für die lager Wassermühle<br />
an <strong>der</strong> hohen hase.
898 lage<br />
2.5.3 <strong>der</strong> lager hof in osnabrück (heute hasestr. 35) geht auf das 14. Jh. zurück und erhielt seine<br />
heutige form im 17. Jh., wie bis heute <strong>der</strong> Wappenstein des Komturs Johann Jakob von Pallandt im<br />
giebel bezeugt. <strong>der</strong> repräsentative hof in <strong>der</strong> Nähe des osnabrücker doms war meist vermietet,<br />
einige räume dienten den Maltesern als unterkunft, zumal mehrere Komture Mitglie<strong>der</strong> und Vorsitzende<br />
<strong>der</strong> osnabrücker ritterschaft waren.<br />
3 Gedruckte und ungedruckte Quellen<br />
3.1 <strong>der</strong> urkundenbestand ist insgesamt eher schlecht erhalten. er wurde zwar in einem<br />
beson<strong>der</strong>s gesicherten raum <strong>der</strong> Kommende aufbewahrt, doch schon 1491 klagte<br />
man, dass urkunden verloren seien. um 1820 kam das archiv ins sta osnabrück.<br />
Weitere urkunden liegen im Pfarrarchiv lage.<br />
1591 werden liturgische handschriften erwähnt (antiphonale, Psalterium, Missale)<br />
sowie bücher des Komturs lesch von Mühlheim: <strong>der</strong> sachsenspiegel des eike von<br />
repgow, bücher von sleidanus und Melanchthon. Visitationsakten des 18. und frühen<br />
19. Jh. berichten detailliert von einer dienstbibliothek des Pastors: 60 teils mehrbändige<br />
titel mit Predigt-, erbauungs- und Kontroversliteratur. davon ist nichts vor<br />
ort erhalten.<br />
3.2 osnabrücker ub i-iV. – osnabrücker ub V (Kloster iburg) s. 70-71 Nr. 70. – Westfälisches<br />
ub iii (bistum Münster) s. 760 Nr. 1460, s. 869 Nr. 1665; X s. 100 Nr. 275. – sudendorf, beiträge.<br />
3.3 das archiv befindet sich im sta osnabrück; einige urkunden sind im Pfarra lage. Visitationsakten<br />
liegen auch im sta Münster (herford – Johanniter).<br />
3.4.1 die urkunden werden im sta osnabrück durch das findbuch zu rep. 18, die akten durch<br />
das findbuch zu rep. 556 (Klosteramt) erschlossen; hinzu kommen das findbuch im Pfarra lage<br />
sowie im sta Münster, findbuch a 236 (herford – Johanniter).<br />
3.4.2 offiziums-antiphonar (15. Jh.): erzbischöfliche dom- und diözesanbibliothek Köln, handschrift<br />
259, http://www.ceec.uni-koeln.de/.<br />
3.4.3 urkunde <strong>der</strong> altarweihe am 19. Januar 1676 (Pfarra lage a.-1676.01.19); reliquien des<br />
lager Kreuzes (Pfarra lage, lagerbuch b.-02 fol. 10).<br />
3.4.4 abschriften verschiedener urkunden: Pfarra lage, lagerbuch b.-02; mehrere abschriften<br />
des berichts des Priors heinrich Wormsberch 1490 über die entstehung des lager Kreuzes („ratione<br />
s. crucis“): Pfarra lage, c.-314-0 und b.-02 fol. 3-8.<br />
3.4.5 dombibl. Köln, Ms 259 fol. 1-2 (15. Jh.): offiziums-antiphonar, eintragungen; vgl. berlage<br />
s. 288-292. – Pfarra lage, d.-001 p. 178-183: ordo missarum et memoriarum (um 1650); desgleichen<br />
b.-03 (1717) p. 1-190 und b.-04 fol. 43-51.<br />
3.4.7 sta osnabrück, rep. 2 Nr. 176: Zinsregister (um 1400); rep. 100, abschnitt 338 b, Nr. 5<br />
(1627), Nr. 32-33, Nr. 35, Nr. 36 (2. ausfertigung: rep. 2 Nr. 218), Nr. 37-40; rep. 556 Nr. 1914-<br />
1919: lagerbücher (cabrea) von 1661, 1700, 1727, 1751, 1776, 1801; rep. 556 Nr. 2001: Verpachtungen,<br />
Nr. 2034: heberegister. – sta oldenburg, best. 285-1 Nr. 95: cabreum 1776. – Pfarra<br />
lage, b.-01: lagerbuch über das „beneficium lagense“ (einkünfte <strong>der</strong> seelsorgspriester) (1708);<br />
b.-02: lagerbuch (1870) mit abschriften von urkunden und einkunftsregistern; b.-06: almosenregister<br />
(1696).<br />
3.4.8 archiv des Malteser-ritter-ordens in <strong>der</strong> National library of Malta in Valetta (aoM), 45<br />
fol. 231r-233r ; 6340 fol. 144v-145v (1495 und 1540; vgl. rödel, großpriorat s. 371-374). – sta<br />
osnabrück, rep. 556 Nr. 1914-1919: cabrea von 1661, 1700, 1727, 1751, 1776, 1801. – Pfarra<br />
lage, e.02/03 (1735, 1777). – sta Münster, Johanniter-Kommende herford Nr. 247 (1803).<br />
3.4.9 generallandesa Karlsruhe, aufschwörungstafeln 46 (von cappel zu horst), 176 (Philipp<br />
Wilhelm von Nesselrode), 179 (hermann adolf von Nesselrode), 183 (Johann Jacob von Pallandt),<br />
184 (otto dietrich von Pallandt, abbildung bei dethlefs, Porträtgalerie s. 58), 185 und 243
lage<br />
(von schaesberg), 255 (Kaspar fidelis von schönau zu Wehr), 256 (fidelis Joseph von schönau zu<br />
Wehr). – sta osnabrück, slg. 32 (aufschwörungstafeln) Nr. 3 /23 und 5/31 (hermann adolf von<br />
Nesselrode), Nr. 3/73 (fidelis Joseph von schönau zu Wehr), Nr. 5 / 9 (von schaesberg).<br />
3.4.10 sta osnabrück, rep. 230, 211-215. (Westphälisches Weserdepartement): besitznahme<br />
und inventarisierung <strong>der</strong> Kommende und Kirche; rep. 556 Nr. 87. 1996: Verkauf des Mobiliars <strong>der</strong><br />
Kommende lage (1828).<br />
3.5.1 ansicht auf dem epitaph des Komturs Johann Jakob von Pallandt in <strong>der</strong> Kirche (1693). –<br />
ansicht 1830 bei holtmann, Malteserorden s. 61.<br />
3.5.2 Kunstdenkmäler <strong>der</strong> Provinz hannover iV, 3 s. 136 u. 137. – sta osnabrück, K 100 Nr. 1<br />
h iii fol. 6 (Johann Wilhelm du Plat, landesaufnahme des fürstbistums osnabrück, 1783, vgl.<br />
Kramer, Kommende s. 15); K 100 Nr. 2 h fol. 43 (1805); K 104 Nr. 26 h (1825); K 22 lage Nr. 2<br />
h und Nr. 3 h (1829). – rieste s. 55 (lageplan um 1840). – Kramer, Kommende s. 17 (grundriss<br />
<strong>der</strong> Kommende 1817).<br />
3.5.3 fotos beim landesamt für denkmalpflege in hannover, z.t. im internet einsehbar unter<br />
www.fotomarburg.de (suchwort: rieste lage).<br />
3.5.4 galerie von 30 Portraits von großmeistern, Komturen und rittern des Malteserordens im<br />
Kreismuseum bersenbrück (1670-1780), vgl. dethlefs, Porträtgalerie.<br />
4 Bau- und Kunstdenkmäler<br />
4.1 die ursprünglichen gebäude <strong>der</strong> Kommende wurden beim überfall des osnabrücker<br />
bischofs dietrich von horne 1384 unbewohnbar und mussten neu aufgebaut<br />
werden. anlässlich <strong>der</strong> einführung eines neuen Komturs wurde 1591 eine detaillierte<br />
bestandsaufnahme von Kirche und Kommende erstellt. Nach den Zerstörungen des<br />
dreißigjährigen Krieges entstand um 1660 eine vierflügelige eingeschossige anlage<br />
über hohem Kellergeschoss, die von <strong>der</strong> hohen hase umflossen wird. <strong>der</strong> Nordflügel<br />
wurde im 19. Jh. abgebrochen, die gräben an <strong>der</strong> Nord- und ostseite zugeschüttet.<br />
erhalten blieben <strong>der</strong> westliche torhausflügel mit einer brücke über die hase, <strong>der</strong> östliche<br />
Wirtschaftsflügel und <strong>der</strong> südflügel mit den festsälen. die Kommende präsentierte<br />
sich seit 1660 mehr als rittergut denn als ordensnie<strong>der</strong>lassung. für die großen<br />
Wallfahrtstage wurde jedoch ein großer raum als „beicht- und Kommunionssaal“ genutzt.<br />
1964 wurde die Kommende von <strong>der</strong> hannoverschen Klosterkammer verkauft<br />
und ein gastronomie- und hotelbetrieb eingerichtet. 1999 erwarb <strong>der</strong> bischof von<br />
osnabrück die Kommende und gründet 2000 das dominikanerinnen-Kloster „Zum<br />
gekreuzigten erlöser“. die schwestern kamen aus dem Kloster „Mater dolorosa“ in<br />
Klausen bei Wittlich (Mosel) im bistum trier.<br />
1260 wird in <strong>der</strong> Kommende eine hauskapelle in superiori domo erwähnt. im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> entstehung des lager Kreuzes kam es nach 1300 zum bau einer eigenen<br />
Kirche neben <strong>der</strong> Kommende, für die eine altarweihe 1313 bezeugt ist. Nach<br />
dem überfall des bischofs dietrich von horne 1384 wurde anfang des 15. Jh. ein<br />
Neubau errichtet und 1426 konsekriert. <strong>der</strong> einschiffige gotische bruchsteinbau mit<br />
spitzbogigen dreiteiligen Maßwerkfenstern wurde ab 1659 renoviert und mit einem<br />
Portalanbau und einem barocken dachreiter ausgestattet. die gewölbe erhielten ab<br />
1733 eine stuckdecke von Joseph geitner. 1904 erweiterung durch Westquerhaus<br />
und turm, 1960-1962 neues chorjoch im osten.<br />
899
900 lage<br />
4.2.1 1313 Weihe des altars mit dem Patrozinium hl. Kreuz, Maria und <strong>Johannes</strong> <strong>der</strong> täufer.<br />
1426 Weihe des südlichen seitenaltars: <strong>Johannes</strong> evangelista, Matthias, stephanus und drei Könige<br />
(Weihefest am ostermontag), weiterer seitenaltar: hl. Kreuz (Weihefest am Pfingstmontag). –<br />
1495 gab es in <strong>der</strong> den heiligen <strong>Johannes</strong> und <strong>Kath</strong>arina geweihten Kirche vier altäre: 1. st. <strong>Johannes</strong><br />
baptista, 2. drei Könige, 3. antonius abbas, 4. andreas. – 1676 erfolgte die altarweihe durch<br />
Valerio Maccioni, titularbischof von Marokko: hochaltar st. <strong>Johannes</strong> baptista, nördlicher seitenaltar<br />
st. <strong>Johannes</strong> evangelista (mit eingebauter Kanzel, 1906 abgebrochen, 1995 rekonstruiert) und<br />
südlicher seitenaltar st. <strong>Kath</strong>arina von alexandrien. – ein unbenannter altar in <strong>der</strong> sakristei wurde<br />
1904 nach einem brand entfernt.<br />
4.2.2 ein organist wird 1495 erwähnt. 1661 wird von einer „neuen orgel“ berichtet, die um 1720<br />
erweitert wurde. sie bildet den grundbestand <strong>der</strong> heutigen orgel von 1880.<br />
4.2.3 bei <strong>der</strong> Visitation 1803 werden zwei heute nicht mehr vorhandene glocken erwähnt.<br />
4.2.4 lager Kreuz (eiche, anfang 14. Jh.). – taufbecken und Weihwassserbecken, Nussbaum, bemalt<br />
(17. Jh.). – Zwei gotische fenster: Karl <strong>der</strong> große und ein Johanniter (um 1426) im diözesanmuseum<br />
osnabrück. – Kelch und ciborium <strong>der</strong> gebrü<strong>der</strong> von Pallandt. – drei barockaltäre<br />
(1676). – ewig-licht-ampel (1684). – chormantel (dunkelblauer samt) im Kestner-Museum<br />
hannover (15. Jh.). – chormantelschließe im diözesanuseum osnabrück (um 1450). – Zwei altarantependien:<br />
ein weißes mit chinoiserien (holz, um 1720) und ein schwarzes mit totengebein<br />
(leinwand, 18. Jh.).<br />
Komturstuhl: loge für den Komtur und weitere Personen an <strong>der</strong> südwand des chores (1860 abgebaut).<br />
4.2.5 sandsteinmadonna 1440. – Pietà 1520. – christus in <strong>der</strong> rast (um 1670). – Kruzifixus in <strong>der</strong><br />
sakristei (17. Jh.). – st. <strong>Johannes</strong> baptist mit lamm (17. Jh.). – st. <strong>Kath</strong>arina (17. Jh.) im Kreismuseum<br />
bersenbrück. – Krippenfiguren (Wachs, 18. Jh., im diözesanmuseum osnabrück).<br />
4.2.6 an <strong>der</strong> ostwand <strong>der</strong> Kirche sind die epitaphe <strong>der</strong> Komture heinrich von ledebur († 1577)<br />
und Johann Jakob von Pallandt († 1693). das stark beschädigte epitaph des Komturs otto von Pallandt<br />
(† 1702) hängt im rathaus von bersenbrück. <strong>der</strong> Wappenschild des Komturs felix ignatius<br />
von schönau zu Wehr († 1783) befindet sich in Privatbesitz in freiburg im breisgau.<br />
4.2.7 secco-Malerei „<strong>der</strong> kreuztragende christus“ an <strong>der</strong> Nordwand des chorraums (um 1450). –<br />
im Kulturgeschichtlichen Museum osnabrück sind unter <strong>der</strong> signatur 3745, e 2100-2106 folgende<br />
gemälde aus dem 17. Jh.: allegorie auf den sieg bei lepanto, öl/lw.; ansicht des hafens von la<br />
Valetta auf Malta, öl/lw., 1674; staatskogge des Johanniterordens, öl/lw.; effectus Vini (allegorie<br />
auf die Mäßigkeit), öl/holz; hochmeisterpalast auf Malta, Vor<strong>der</strong>ansicht, öl/lw., holz, kaschiert;<br />
hochmeisterpalast auf Malta, seitenansicht, öl/lw.; Mittelmeergaleere des Johanniterordens, öl/<br />
lw. holz, kaschiert. – die galerie <strong>der</strong> lager Komture befindet sich im Kreismuseum bersenbrück.<br />
4.2.8 inschriften an <strong>der</strong> Kommende, am torbogen des ehemaligen torhauses und zwei chronogramme<br />
<strong>der</strong> Mühlengebäude (Mithof, Kunstdenkmale Vi s. 75-76).<br />
5 Listen <strong>der</strong> Institutsvorstände<br />
5.1 Komture: albero (1260); rudolfus (1262); hermannus unccus [hake] (1264); arnold<br />
(1293); Johann dusenfoet (1300); hermann (1300); gottfried von seynen (1316); Johann hun<strong>der</strong>tosse<br />
(1332, 1337); albert von ulenbroke (1341); bernhard von Kerkering (1351); lubbert von<br />
dehem (1361, 1372, 1384); hermann von hamelen (1376); ludolph von langhen (1400, 1401);<br />
hermann von brandlecht (1401); Johann Kruse (Kruzen) (1413, 1427); hermann von brockhusen<br />
(1426, 1431, 1448); Johann von Warendorp (1467, 1482); herbord von snetlage (1488,<br />
1530); otto graf von Waldeck (1535, † 1541); Johann von altenbockum (1549, 1556); heinrich<br />
Johann von ledebur (1560, † 1577); Moritz lesch von Mühlheim (1581, † 1591); heinrich von<br />
bernsau (1593, † 1625); Jakob christoph von andelau (1627, 1637); friedrich ludwig landgraf<br />
von hessen-darmstadt, (1638-1649), später Kardinal († 1682); Johann Jakob freiherr von Pallandt<br />
zu eyll und hamern (1650-1693); otto Theodor (dietrich) heinrich freiherr von Pallandt zu
lamspringe<br />
901<br />
borschemich (1693-1702); Johann sigismund graf von und zu schaesberg (1703-1718); Johann<br />
friedrich freiherr schenk von stauffenberg zu Wilflingen (1718-1720); Philipp Wilhelm graf<br />
von Nesselrode und reichenstein (1720-1727, † 1754); hermann adolf graf von Nesselrode und<br />
reichenstein (1727-1748); bernhard Moritz dietrich freiherr von cappel zur horst (1748-1758);<br />
caspar fidelis freiherr von schönau zu Wehr (1759-1772); fidelis Joseph felix ignatius freiherr<br />
von schönau zu Wehr (1772-1783); ferdinand Joseph hermann anton freiherr von hompesch zu<br />
bolheim (1785-1797, † 1805); <strong>Johannes</strong> baptista <strong>Johannes</strong> Nepomuk Joseph ferdinand christoph<br />
reinhard freiherr von Pfürdt zu carspach (1797-1810, † 1819).<br />
6 Literaturverzeichnis<br />
dehio, handbuch s. 1128-1130. – hoogeweg, Verzeichnis s. 76. – Krumwiede, Kirchen- und altarpatrozinien<br />
i s. 225. – streich, Klöster s. 87-88.<br />
berentzen, Kreuz zu lage. – berlage, historische Notizen. – bruch, rittersitze des emslandes,<br />
s. 292-301. – dethlefs, Porträtgalerie. – goV osnabrück s. 5-6. – hoene, Johanniter-Malteser-<br />
Kommende lage. – hoffmann, gabelkreuz. – holtmann, Malteserorden s. 56-111. – Jankrift, Johanniter-Kommende<br />
lage. – Jankrift, Zwischen Kreuzzügen und regionaler Machtpolitik. – Jaszai,<br />
Monastisches Westfalen s. 95-96. – Karrenbrock, Johanniskirche. – Kraienhorst, beispiel lage. –<br />
Kramer, Kommende. – Kunstdenkmäler <strong>der</strong> Provinz hannover iV, 3, s. 134-140. – rieste. – riester<br />
bildchronik iii. – rödel, großpriorat. – rothert, heimatbuch s. 286-296. – schnackenburg,<br />
Kunstwerke. – schönau-Wehr/frings, freiherren von schönau.<br />
heinrich bernhard Kraienhorst<br />
LaMsPrInGe – Kanonissen, später Benediktinerinnen, dann Benediktiner<br />
(872/73 bis 1803)<br />
1 Kurzinformationen<br />
1.1 lK hildesheim.<br />
1.1.1 diözese hildesheim; heute evangelisch-lutherische landeskirche hannovers, bistum hildesheim.<br />
1.1.2 1789: hochstift hildesheim; 1810: Königreich Westphalen; 1803 bei <strong>der</strong> aufhebung: Königreich<br />
Preußen.<br />
1.2 Lammespringensis ecclesia (872); sancti Adriani monasterium (873); ecclesia sancti Adriani<br />
Lame sprinche (1149); ecclesia beati Adriani in Lamespringe (1238); monasterium de Lamespringe<br />
(1240); monasterium beatorum Adriani et Dionysii martirum in Lammespringhe (1338); monasterium<br />
sanctorum Mariae, Dionysii et Adriani in Lamspringe (1405); sticht sanctorum Adriani et Dionisii<br />
thom Lambspring (1487); Lambspring (1573).<br />
1.2.1 abtei; Kanonissen, dann benediktinerinnen, später benediktiner (englische benediktinerkongregation).<br />
1.2.2 Maria (872, 1138, 1335); hadrian (872, durchgängig hauptpatron); dionysios (erwähnt<br />
1178, durchgängig Zweitpatron).<br />
1.2.3 <strong>Kath</strong>olisch; 1568-1643 evangelisch; seit 1643 wie<strong>der</strong> katholisch.<br />
1.2.4 siegel: römer, art. lamspringe s. 376; abb.: guerreau, Klerikersiegel l 073-085. – Wappen:<br />
rees, art. lamspringe s. 320.<br />
2 Geschichte und Bedeutung <strong>der</strong> Institution<br />
2.1 die gründung von lamspringe als Kanonissenstift geht auf die sächsische sippe<br />
<strong>der</strong> immedinger zurück. <strong>der</strong> gründungslegende nach waren graf ricdag und dessen<br />
gemahlin emhild kin<strong>der</strong>los geblieben und unternahmen eine Wallfahrt nach rom,