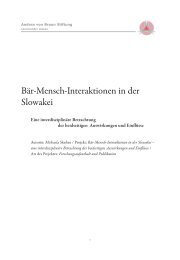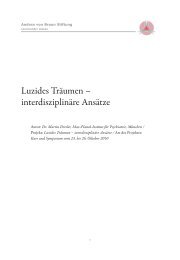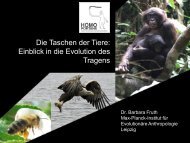LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Parallaktisches Hin und Her<br />
Meridian-Lektüren mit dem Heliometer<br />
Autorin: <strong>Nele</strong> <strong>Tincheva</strong> / Projekt: Parallaktisches Hin und Her –<br />
Meridian-Lektüren mit dem Heliometer / Art des Projektes: Essay<br />
1
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Jeder Bericht ist ein Reisebericht. […] Aber dennoch, die Geschichte der Reisen des<br />
Menschen durch seine eigenen Texte bleibt zum größten Teil unbekannt.<br />
Michel de Certeau<br />
Die Zahlen, im Bund mit der Bilder Verhängnis und Gegen-Verhängnis.<br />
Paul Celan<br />
2
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Einblick<br />
I. „Kritische Selbstreflexion der eigenen Wahrnehmung der Wirklichkeit“, konstatiert<br />
Gottfried Boehm im Ausklang eines Aufsatzes, „ist immer noch eine unverächtliche Basis: der<br />
Kunst und der Argumentation.“ Und zur Frühromantik um Friedrich <strong>von</strong> Hardenberg merkt<br />
Ulrich Stadler an: „Novalis zielt […] mit seinen Überlegungen auf Erkenntnis im<br />
Allgemeinen, und zwar auf eine solche, die geisteswissenschaftliche Hervorbringungen (z.B.<br />
Kunstwerke) wie auch naturwissenschaftliche Gegenstände (z.B. Fixsterne) gleichermaßen<br />
umfaßt.“<br />
Die Titel der beiden Aufsätze lauten: „Eine kopernikanische Wende des Blicks“ (Boehm,<br />
1995) 1 sowie „Hardenbergs ‚poetische Theorie der Fernröhre‘“ (Stadler, 1987) 2 . Zwischen<br />
den beiden zitierten Bemerkungen spannt sich eine Thematik auf, die derzeit im Rahmen<br />
mehrerer turns (spatial, cultural, ethical) als Desiderat wieder einmal ausgerufen wird: der<br />
Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst sowie zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. 3<br />
Unsere Eingangszitate legen eine Basis nahe, auf der ein solcher Dialog zu Stande kommen<br />
könnte: den menschlichen Blick auf die Wirklichkeit. Und zugleich problematisieren sie beide<br />
Komponenten dieser Basis:<br />
Was den Blick betrifft, so tritt mit besagter kopernikanischer Wende zwischen ihn und das<br />
Wahrgenommene der Wahrnehmungsprozess selbst. In der Philosophie ist es Kant, der diese<br />
Wende explizit vollzieht: Fluchtpunkt der Wahrnehmung ist nun nicht mehr die wahrzunehmende<br />
Welt, sondern die wahrnehmende Vernunft. In diesem Zuge fordert Kant, cartesia-<br />
1 In: Brandes, Uta (Hrsg.), Sehsucht. Über die Veränderung der visuellen Wahrnehmung.<br />
Göttingen 1995 [= Schriftenreihe Forum, 4], S. 25–34; hier: S. 34.<br />
2 In: Behler, Ernst/Hörisch, Jochen (Hgg.): Die Aktualität der Frühromantik. Paderborn 1987,<br />
S. 51–62; hier: S. 60. Stadlers Überlegungen beziehen sich auf das Fragment Nr. 737 aus<br />
Hardenbergs Enzyklopädie-Projekt, dem „Allgemeinen Brouillon“.<br />
3 – so etwa bei Vittoria Borsò: Die Aufgabe der Kulturgeschichte bestehe „in der Beschreibung der<br />
diskontinuierlichen Entwicklung jener Konstellationen und Handlungen, durch die das Wissen<br />
– auch der Naturwissenschaften – geregelt und sozial organisiert wird. Darin gründet sich auch<br />
die Vorstellung einer engen Kooperation <strong>von</strong> Natur- und Kulturwissenschaft.“ Als zentrale<br />
Gemeinsamkeit sieht Borsò mit Foucault die „Technik der topografischen Organisation des<br />
Denkens“. Dieser voraus und zu Grunde liegt allerdings der organisierende Blick. – Borsò,<br />
Vittoria: Grenzen, Schwellen und andere Orte. In: dies./Görling, Rainer (Hrsg.): Kulturelle<br />
Topografien. Stuttgart/Weimar 2004, S. 13–41; hier: S. 20.<br />
3
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
nisch, eine rigide Trennung <strong>von</strong> Kunst und Wissenschaft. 4 Hiergegen macht Novalis nun die<br />
Produktivität des Blicks geltend und damit den Erzeugnischarakter auch des wissenschaftlichen<br />
Gegenstandes, so dass Kunst und Wissenschaft einander in der poiesis, der Dimension<br />
des Erzeugens, wieder nahe kommen: Galileis Fernrohr, Instrument und Sinnbild der naturwissenschaftlichen<br />
Blick-Wende, wird bei Novalis zum Bindeglied. 5<br />
Was die Wirklichkeit angeht, so treten verschiedene Bedeutungsschichten dieses Begriffs aufeinander:<br />
„Authentizität“, „Echtheit“, „Wahrheit“; Wissen über und Erfahrung <strong>von</strong> Wirklichkeit<br />
werden unterschiedlich gewichtet. Stets aber wird die Arbeit an Wirklichkeit über den<br />
Sehsinn artikuliert: über Sichtbarkeit, sei es vom „äußeren“ Auge her (Naturwissenschaften),<br />
sei es vom „inneren“ (Philosophie). 6 Das innere Auge ist immer ein höchst diskussionswürdiges<br />
Organ gewesen, wie die Philosophiegeschichte zeigt – doch Galileis Fernrohr hat auch die<br />
Beweiskraft des äußeren Auges in räumliche Schranken verwiesen. Naturwissenschaftliche<br />
Diskurse erfahren sehr viel stärkere Prägung durch kulturgeschichtliche Metaphern, als man<br />
lange Zeit sehen wollte 7 – und im Gegenzug besinnen sich die „weltfremden“ Geisteswissenschaften<br />
auf ihren Bezug zur „faktischen“ (sozialen, materiellen, …) Um-Welt.<br />
Gegenwärtig ist auf beiden Seiten die Bereitschaft erkennbar, Vorurteile abzubauen. Hier<br />
wollen wir weiter arbeiten – unter der Prämisse, dass, was jeden Wissenschaftszweig seit jeher<br />
motiviert und in Konkurrenzkämpfe verwickelt hat, als gemeinsame Tradition gewertet werden<br />
kann, über die gut reden ist: die Fragwürdigkeit der Wirklichkeit.<br />
II. Gemeinsamer Nenner all der turns, die immer rascher aufeinander folgen, ist ein drängendes<br />
Bedürfnis nach Orientierung in einer räumlich enger werdenden und medial „übererschlossenen“<br />
Welt, das beide Wissenschaftszweige betrifft. Dieses Orientierungsbedürfnis<br />
4 „Kritik der reinen Vernunft“, §47.<br />
5 „Die <strong>von</strong> Hardenberg auch ausdrücklich einbekannte Intention, Wissenschaft als Poesie zu verwirklichen,<br />
kommt in der Rede vom Fernrohr zum Ausdruck, die metaphorisch und gleichzeitig<br />
nicht-metaphorisch ist.“ Stadler, a.a.O., S. 61.<br />
6 Für eine knappe, aber höchst informative Zusammenfassung der Geschichte des Sehens sei verwiesen<br />
auf Ralf Konersmanns Einleitung des <strong>von</strong> ihm herausgegebenen Bandes „Kritik des<br />
Sehens“, Leipzig 1997: „Die Augen des Philosophen. Zur historischen Semantik und Kritik des<br />
Sehens“, S. 9–47.<br />
7 Vgl. hierzu den jüngst erschienen Band „Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften – Zur historischen<br />
und kulturellen Dimension naturwissenschaftlicher Konzepte“, hrsg. v. Ernst Müller und<br />
Falko Schmieder, Berlin/New York 2008.<br />
4
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
soll uns zugleich thematischer und methodischer Index sein, wenn wir nun versuchen, zwei<br />
Verortungsversuche einander entgegenzulesen: Friedrich Wilhelm Bessels Messung der<br />
Fixsternparallaxe in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts und Paul Celans Meridian-Rede<br />
<strong>von</strong> 1960, die eine Poetik der Begegnung entwirft.<br />
Die Ausgangspositionen könnten extremer nicht sein: Bessel arbeitet auf einer triumphalen<br />
Höhe der modernen Physik – er überschreitet die Schwelle zur Vermessung des Weltraums<br />
– Celan steht auf dem verlorenen Posten des deutschsprachig-jüdischen Dichters nach dem<br />
Holocaust. Und doch lassen sich gemeinsame Zielsetzungen, ja Hoffnungen nachweisen: eine<br />
verlässliche Wirklichkeit allererst zu finden. Es ist hier nicht der Ort, die Komplexität <strong>von</strong><br />
Bessels Messung und Celans Text in allen Facetten darzustellen; uns geht es darum zu prüfen,<br />
inwieweit Bessels heliometergestützter, „doppelter“ Blick in den Weltraum und Celans<br />
Konzept der Begegnung mit dem Anderen Wege eröffnen für die wechselseitige In-Blick-<br />
Nahme, das Gespräch zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.<br />
In-Blick-Nahme geschieht im Rahmen einer Szenerie: Wir schauen <strong>von</strong> einem Standpunkt<br />
aus auf etwas; dazwischen erstreckt sich eine räumliche Distanz. Unser Blick steht dabei nicht<br />
still: Seine Perspektive ändert sich, er „wandert“ durch das Blickfeld, er liest. Um darüber präziser<br />
sprechen zu können, skizziert nun ein erster Abschnitt, was nach Michel de Certeau<br />
unter Räumen und Orten zu verstehen ist – und wie sie gehend und sehend erfahren werden.<br />
1. Gehen und Sehen – im Raum, am Ort<br />
Für Michel de Certeau 8 bezeichnen Gehen und Sehen zwei Erfahrungspole im Umgang des<br />
Menschen mit/im Raum, die sich zu zwei Beschreibungsmodi des Raumes in Beziehung setzen<br />
lassen: der Karte (carte), die dem „Blick <strong>von</strong> oben“ zweidimensional fixierte Orte darbietet,<br />
und der Wegbeschreibung (parcours), die den Akzent auf das Wie des Gehens setzt. Auch<br />
Karte und Wegbeschreibung sind als Pole einer verbindenden Linie, nicht als distinkte<br />
Gegensätze zu verstehen: „Es hat den Anschein, daß man sich beim Übergang <strong>von</strong> der ‚alltäglichen‘<br />
Kultur zum wissenschaftlichen Diskurs vom einen [Wegbeschreibung, Gehen] zum<br />
anderen [Sehen, Karte] bewegt.“ (222) Damit birgt der Weg ein zweifaches Potential:<br />
„Route“– eine festgelegte, wiederholt begehbare Wegstrecke zwischen zwei Orten – und<br />
„parcours“, die einzigartige Erfahrung eines Weges.<br />
8 Die folgenden Ausführungen basieren auf Michel de Certeau, Kunst des Handelns. Berlin<br />
1988. Vgl. insbesondere Kap. IX: Berichte <strong>von</strong> Räumen, S. 215–238, sowie Kap. XII: Lesen<br />
heißt wildern, S. 293–311. Nachfolgend die Seitenzahl eingeklammert im Fließtext.<br />
5
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Gehen und Sehen erhalten eine zusätzliche Verbindungslinie durch die Analogie zwischen<br />
Gehen und Lesen. „Nun bedeutet Lesen aber tatsächlich, in einem vorgegebenen System<br />
umherzuwandern (im System des Textes, analog zur gebauten Ordnung einer Stadt oder eines<br />
Supermarktes).“ (300) Unsere Gehbewegung, Schritt für Schritt, verläuft nicht kontinuierlich,<br />
sondern zäsuriert, in einem Wechsel aus Verdichtung und Unterbrechung. Gerade so<br />
bewegen sich unsere Augen beim Lesen durch den Text, was die Leseforschung inzwischen<br />
erwiesen hat: in einer unregelmäßigen Abfolge aus sog. Sakkaden und Fixationen, Auslassungen<br />
und Verdichtungen. Dem lesenden Blick muss damit dieselbe Beweglichkeit eingeräumt<br />
werden wie dem Körper als Ganzem, nicht vollkommen abhängig <strong>von</strong> dessen Position; wenn<br />
„lesen bedeutet, woanders zu sein, dort wo wir nicht sind, in einer anderen Welt“ (306), dann<br />
erhält der lesende Blick eine halb physische, halb virtuelle Existenzform: Der Blick wandert<br />
mit dem Körper, verändert also seine leibliche Position, und wandert zugleich eigenständig<br />
durch den Text. Relativ zum Text tut er das in aller Regel <strong>von</strong> derselben leiblichen Position<br />
aus: wir halten das Buch vor unsere Augen, ob wir nun im Zug sitzen oder auf einem Stuhl.<br />
Das Durch-den-Text-Wandern kann jedoch – besonders auffällig beim Lesen eines packenden<br />
Romans, wobei wir die Perspektive einer oder mehrerer Figuren einnehmen – dazu führen,<br />
dass wir unsere materielle Leiblichkeit ausblenden zu Gunsten einer oder mehrerer „virtueller<br />
Existenzen“ im Text. 9<br />
De Certeau bezieht sich auf das Lesen einer Erzählung. Wir wollen diesen Bezug erweitern:<br />
Auch beim Lesen eines wissenschaftlichen Textes nehmen wir verschiedene Perspektiven ein,<br />
wenn wir einer Argumentation aufmerksam folgen. Auf einer virtuellen Ebene – „im Kopf “<br />
gleichsam – betrachten wir dann den behandelten Gegenstand aus unterschiedlichen Richtungen,<br />
wobei wir als kritische Leser gerade nicht in einer Perspektive aufgehen. Und: Auch<br />
dem naturwissenschaftlich beobachtenden Blick ist eine solche Dynamik zuzuschreiben. Der<br />
Blick des Astronomen etwa beschreitet den Weltraum, „so weit das Auge reicht“ – auch er<br />
geht dorthin, wo wir (noch?) nicht sind. In diesem Sinne sind Naturwissenschaftler ebenso<br />
wie Leser „Reisende; sie bewegen sich auf dem Gelände des Anderen, wildern wie Nomanden<br />
[sic!] in Gebieten, die sie nicht beschrieben haben“ (307).<br />
9 Dies mag an „Avatare“ in Computerspielen erinnern. Allerdings ist es bei typischen Rollenspielen<br />
wie World of Warcraft in aller Regel so, dass man eine und nur eine virtuelle Existenz besitzt;<br />
innerhalb des Spiels kann die Perspektive nicht gewechselt werden. Dieser „Blickrahmen“ gibt eine<br />
stabile Identität vor, was zu der Sogwirkung dieser Spiele gerade auf Heranwachsende beiträgt.<br />
Beim Lesen wird uns mehr abgefordert, denn es bleibt ein Abstand zwischen dem Text und unseren<br />
Perspektiven, die durchaus auch auf virtueller Ebene wechseln können: Lesen kann destabilisieren,<br />
verunsichern. Wenn wir es zulassen.<br />
6
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Diese Analogie zwischen lesendem und naturwissenschaftlich beobachtendem Blick liegt in<br />
einer organischen Eigenschaft des menschlichen Sehens begründet, die unsere Orientierungsschwierigkeiten<br />
entscheidend prägt: dass es nämlich nur auf ein Detail zugleich fokussieren<br />
kann und alles andere dabei zu den Rändern des Gesichtsfelds hin immer unschärfer<br />
wird. Biologisch zeichnet hierfür die Anordnung der Rezeptoren auf der Netzhaut verantwortlich:<br />
sehr dicht gesät im Zentrum, immer verstreuter gegen die Ränder hin. Das fördert<br />
die enorme Konzentrationsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Es hindert uns jedoch daran,<br />
panoramatisch zu sehen, wie es z.B. die Kaleidoskopaugen mancher Insekten erlauben. Die<br />
Erfassung eines Panoramas, etwa der klassische Rundblick <strong>von</strong> einem „view point“ aus, gestaltet<br />
sich bei uns als zeitliche Folge <strong>von</strong> Einzelbildern: technisch gesehen, filmen wir die<br />
Umgebung ab. Blicken wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Wahrnehmungsstrecke, kann<br />
sich dort inzwischen bereits etwas verändert haben. Und unser Kurzzeitgedächtnis ist<br />
beschränkt. Wir vergessen Details rasch über der Wahrnehmung neuer Einzelheiten.<br />
Für die räumliche Orientierung des Menschen bedeutet das: Lange Wege, Routen durchs<br />
Gelände werden bildlich/schriftlich fixiert, um Zeit für die Wahrnehmung ihrer komplexen<br />
Gestalt zu gewinnen, Details immer wieder abzurufen, kurz: Wege wieder finden zu können.<br />
Menschen zeichnen Karten: mit allen verfügbaren technischen Hilfsmitteln. Eine Karte bewahrt<br />
dauerhafte materielle Identität, so dass der Blick sie bewandern kann, ohne Veränderungen<br />
fürchten zu müssen. 10<br />
Mit de Certeau müssen wir nun Ort und Raum unterscheiden, und diese Differenz besitzt<br />
eine andere Struktur als die zwischen Gehen und Sehen. Raum und Ort werden nicht als Pole,<br />
sondern als Umgangsformen mit derselben Umgebung – unserer Umgebung – aufgefasst.<br />
Ein Ort ist die Ordnung (egal, welcher Art), nach der Elemente in Koexistenzbeziehungen aufgeteilt<br />
werden. Damit wird also die Möglichkeit ausgeschlossen, dass sich zwei Dinge an derselben<br />
Stelle befinden. […] Ein Ort ist also eine momentane Konstellation <strong>von</strong> festen Punkten. […] Ein<br />
Raum entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität der<br />
Zeit in Verbindung bringt. Der Raum ist ein Geflecht <strong>von</strong> beweglichen Elementen. […]<br />
Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht. (217f.)<br />
Wir können de Certeaus Unterscheidung <strong>von</strong> Raum und Ort als parallaktische Differenz 11<br />
beschreiben: sie ist nicht in der Materie begründet, sondern einem Wechsel der Beobachter-<br />
10 Karten müssen daher laufend an Veränderungen angepasst werden. Sie dokumentieren<br />
Zustände.<br />
11 Was unter einer Parallaxe zu verstehen ist, wird in Abschnitt 3 erläutert. Hier genügt es, sich<br />
den Perspektivwechsel vorzustellen.<br />
7
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
perspektive geschuldet. Von Raum zu Ort und vice versa führt keine Passage, sondern ein<br />
Blickwechsel: Man kann nicht <strong>von</strong> einem zeitlosen Ort in einen bewegten Raum „hinübergehen“;<br />
es ist aber möglich, den Ort als Raum zu sehen, indem man etwas mit ihm macht, sich<br />
in ihm bewegt – oder auch, einen Raum in einen Ort zu übersetzen, indem man ihn festschreibt,<br />
fixiert (z.B. eine Karte zeichnet). Dieser Blickwechsel kennzeichnet auch das Hin<br />
und Her zwischen verschiedenen Lesepraktiken: dazu mehr in Abschnitt 2. Auf Orientierungsprozesse<br />
bezogen heißt das: Im Raum befinden wir uns in einer Situation. Wir blicken<br />
nicht aus der Vogelperspektive auf den Raum und erfassen ihn als Ort, sondern erfahren ihn<br />
in unserem Umgang. Orientierung versucht nun stets – im Sinne des Sich-Zurechtfindens –<br />
den Raum in einen Ort zu übersetzen, d.h. ihn mit Koordinaten zu versehen: an einem Ort<br />
befinden wir uns an einer Position. Wir stellen ihn still, entziehen ihm Zeit: Nun wissen wir,<br />
wo wir – eben nicht gehen, sondern stehen. Zweck des Ganzen ist freilich das Weitergehen:<br />
Orientierung meint einen progressiven Wechsel zwischen beiden Perspektiven.<br />
Ein parallaktischer Blickwechsel ist also – das wollen wir festhalten – gekennzeichnet durch<br />
eine Veränderung der Blickrichtung in dem Sinne, dass sich die Ausgangsposition des Blicks<br />
verändert, wandert: Man schaut „<strong>von</strong> anderswo her“, aus einer anderen Richtung auf denselben<br />
Gegenstand. Dieser Wechsel-Struktur – einem 1-in-2-Sehen quasi – tritt eine zweite gegenüber.<br />
Bei de Certeau findet sie im Zusammenhang der Grenze Erwähnung: Es kann scheinen,<br />
bemerkt de Certeau, „als ob die Grenzziehung selber die Brücke wäre, die das Innere für sein<br />
Anderes öffnet.“ (236) Das klingt zunächst nach einer Binsenweisheit: Verbinden kann man<br />
nur zuvor Getrenntes. Dieser Satz beschreibt jedoch auch – <strong>von</strong> de Certeau offenbar unbemerkt,<br />
jedenfalls nicht thematisiert 12 – die Dynamik der Metapher als in sich geteilter Figur,<br />
die zwei <strong>von</strong>einander getrennte Bedeutungen zusammenbringt, indem sie sie nebeneinander<br />
stellt: Die Bedeutungen verfließen nicht in eine. Sie sind aber im metaphorischen Ausdruck<br />
direkt, „strichförmig“ wie durch eine Grenzlinie, benachbart: getrennt und verbunden<br />
zugleich. Ein solches Nebeneinander nimmt der Blick durch ein 2-in-1-Sehen wahr, indem er<br />
<strong>von</strong> derselben Position aus abwechselnd auf beide Bedeutungen fokussiert. Er wandert nicht, sondern<br />
oszilliert. Diese beiden Formen des Blickwechsels – die parallaktische und die „metaphorische“<br />
13 – gilt es im (lesenden) Blick zu behalten, der nun <strong>von</strong> de Certeau zu Celan wechselt.<br />
12 Was um so erstaunlicher ist angesichts seiner Ausführungen auf S. 192ff., die die „Rhetorik des<br />
Gehens“ beschreiben, also Analogien zwischen Stilfiguren und Arten des Herumgehens bilden.<br />
Möglicherweise ist de Certeau der o.g. Bezug dadurch entgangen, dass er die Metapher bereits mit<br />
der Analogie zur Geschichte besetzt hat (S. 215).<br />
13 Wir können und wollen uns hier nicht in die unübersehbare Diskussion der Metapher als Figur<br />
verstricken. Uns geht es um die perspektivische Struktur, die einen Gegenstand „als zwei“ wahrnehmbar<br />
macht; die Metapher ist hierfür ein thematisch naheliegendes Beispiel.<br />
8
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
2. Meridian: Orientierungsprobleme<br />
Das Schreiben <strong>von</strong> Gedichten, erläutert Celan in seiner Ansprache zur Verleihung des Bremer<br />
Literaturpreises, betreibe er vor allem, „um zu erkunden, wo ich mich befand […], um mir<br />
Wirklichkeit zu entwerfen.“ 14 Celans Rede anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises am<br />
22.10.1960 15 , <strong>von</strong> ihm selbst als sein wichtigster Beitrag zur zeitgenössischen Poetik eingeschätzt,<br />
nimmt diese Thematik wieder auf. Dem Anlass gemäß <strong>von</strong> Büchner ausgehend, versucht<br />
Celan das Gedicht und zugleich das dichtende Ich zwischen Polen zu verorten: Sprache<br />
und Verstummen, Kunst und Natur, Historie und Schicksal, Selbst und Fremde. Dabei<br />
kommt die Bewegung des Textes zu keinem Ende. „Quer“ hindurch, seinen Fluss durchkreuzend<br />
und rhythmisierend, verläuft eine Schreib-Bewegung, die wir mitlesen wie an- und<br />
ablaufende Wellen: ein Wechsel aus immer-wieder-neu-Ansetzen und Rückzug, deutlich<br />
sichtbar an unzähligen Leerzeilen und Fragezeichen, an dem stockenden, sich selbst unterbrechenden<br />
Satzbau. Celans Text, konsequent durchzogen vom Vokabular des Weges, der Richtung,<br />
der Orientierung in Raum und Zeit, macht es unserem lesenden Blick sehr schwer, sich<br />
in ihm zu orientieren: Er lässt uns einen Weg (parcours) mitgehen, vorwärts, seitwärts, in<br />
Sprüngen, ohne dass wir eine Richtung oder Struktur ausmachen könnten. Wir sind mittendrin<br />
im Text-Raum und bekommen das unruhige, unregelmäßige Hin und Her des Weges<br />
nicht in eine still stellende „Draufsicht“: Das Ich des Textes spricht selbst aus der Perspektive<br />
eines unterwegs Seienden, der keinen Überblick hat über das Terrain, das er erkundet. 16<br />
14 Celan, Paul, Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt<br />
Bremen, in ders., Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hrsg. v. Beda Allemann u.a.<br />
Frankfurt/Main 2000. Bd. 3, S. 185f., hier: S. 186<br />
15 Celan, Paul, Der Meridian. Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Darmstadt,<br />
am 22. Oktober 1960. In ders., Werke. Tübinger Ausgabe. Bd. 3: Der Meridian. Endfassung<br />
– Entwürfe – Materialien. Hrsg. v. Bernhard Böschenstein u. Heino Schmull. Frankfurt/<br />
Main 1999. Hieraus zitierte Stellen werden nachfolgend im Fließtext mit eingeklammerter<br />
Seitenzahl versehen; Passagen aus der Endfassung erhalten den zusätzlichen Hinweis „EF“.<br />
16 Celan als Schreibender hat natürlich den Überblick über die Endfassung seines Textes „diese ist<br />
Ergebnis eines langwierigen Schreibprozesses“ worüber die textgenetische Tübinger Celan-<br />
Ausgabe Aufschluss gibt. Da der Text jedoch nicht fiktional ist, sind das Gedicht-Ich, über das<br />
geschrieben wird, das redende Ich und Celans Person kaum zu unterscheiden. Unterschieden<br />
werden können und müssen die Blickwinkel, in denen diese drei Ich-Instanzen zum Text stehen.<br />
Dieser Komplexität können wir hier nicht gerecht werden. Auch die intertextuellen<br />
Bezugnahmen der Rede (auf Adorno, Benn, Heidegger, Schmitt) müssen wir beiseite lassen.<br />
9
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Wir müssen <strong>von</strong> der Möglichkeit des Blickwechsels Gebrauch machen, indem wir den Text<br />
nicht nur räumlich, sondern auch örtlich wahrnehmen: als zweidimensional fixierte, begrenzte<br />
Buchstabenfolge, die uns wiederholte, punktuelle Stellenlektüre gestattet. Wir können entscheiden,<br />
an welchen Stellen wir den Text-Ort wieder zum Lese-Raum machen, wo wir „wieder<br />
einsteigen“ wollen. So gelingt es uns, zwei Bewegungsmuster im Text zu konturieren, die<br />
beide auf das Zentrum der Rede abzielen, auf das, was Wirklichkeit für Celan heißt:<br />
„Begegnung! Begegnung!“ (139)<br />
1.) Hin zum Anderen: Schritt hinaus. Das Gedicht ist, erstens, auf der Suche nach einem<br />
Anderen, seinem Gesprächspartner, „es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es<br />
sucht es auf, es spricht sich ihm zu.“ (EF 9) Dieser Partner ist ubiquitär: er kann überall sein.<br />
„Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses<br />
Anderen.“ Das Gedicht versucht, „auf jenes Ferne und Besetzbare zuzuhalten“ (EF 11); das<br />
Gelingen dieses Versuchs allerdings ist höchst ungewiss: Der Zielpunkt ist ja ubiquitär zu<br />
denken. Bei dem Versuch, eine Karte des Weges zu ihm zu zeichnen, stoßen wir auf eine parallaktische<br />
Differenz: Ubiquität schlägt um in Utopie, in Ortlosigkeit – ein ubiquitärer Ort ist<br />
eben kein Ort, er ist ein Ort ohne Örtlichkeit, eine wandernde Stelle ohne feste Koordinaten.<br />
Wie wäre eine solche Stelle zu erreichen? Sie kann ja höchstens angetroffen, aber nicht angesteuert<br />
werden. In der „Bremer Rede“ heißt es denn auch:<br />
Das Gedicht kann […] eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer hoffnungsstarken<br />
– Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an<br />
Herzland vielleicht. (Bremer Rede, a.a.O., 186)<br />
Voraussetzung für das Erreichen des ubiquitär-utopischen „Herzlandes“ ist allemal der<br />
Schritt hinaus: eine „ins Offene und Leere und Freie weisende[n] Frage“ (EF 10),<br />
ein Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben in einen dem Menschlichen<br />
zugewandten und unheimlichen Bereich – denselben, in dem die Affengestalt, die Automaten<br />
und damit… ach, auch die Kunst zuhause zu sein scheinen. (EF 5)<br />
Dort erst kann das Gedicht seinen Ort finden: wiederholt und dauerhaft sichtbar (lesbar) in<br />
seiner örtlichen Gestalt, der zweidimensionalen Textfläche voller unveränderlicher Buchstaben,<br />
die, analog Orten auf einer Karte, durch rekurrierende Lese-Linien verbunden werden<br />
können. Zugleich wird es Begegnungsraum, in dem das Gespräch mit dem Anderen statt finden<br />
kann – als „eine, einmalige, punktuelle Gegenwart“ (EF 10). Hier ist seine Wahrnehmung<br />
an ein vergängliches Hier-und-Jetzt gebunden, in dem es als „Gegenwart und Präsenz“ zu<br />
einem Anderen spricht. Wir müssen das Gedicht also als Raum und Ort zugleich betrachten.<br />
Nach de Certeau wäre das nicht möglich: wir hatten gesehen, dass zwar Raum und Ort materiell<br />
dasselbe sind – wie das Gedicht als Text es selbst ist –, dass sie aber durch einen Wechsel<br />
10
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
der Perspektive unterschieden werden und eben nicht als „beides zugleich“ sichtbar sein können.<br />
Nun haben wir ja bereits damit begonnen, den Meridian-Text räumlich und örtlich im<br />
Wechsel zu lesen. Nehmen wir ihn also als Metapher wahr, indem unser lesender Blick zwischen<br />
Räumlichkeit und Örtlichkeit oszilliert? Nicht nur, sondern auch: Der Leseprozess ist<br />
komplexer, als es zunächst scheinen mag. Denn tatsächlich haben wir zugelassen, dass sich<br />
unser lesender Blick zum Teil <strong>von</strong> uns abspaltet: unsere leibliche Position beim Lesen bleibt,<br />
relativ zum Text, vermutlich dieselbe; <strong>von</strong> dort aus lesen wir metaphorisch, aus derselben<br />
Richtung. Unser lesender Blick aber nimmt den Text wechselweise als Raum (<strong>von</strong> „innen“)<br />
und als Ort (<strong>von</strong> „oben“/außen) wahr: parallaktisch.<br />
Diese Spaltung lässt uns auf einen zweiten Aspekt der Bewegung zum Anderen hin aufmerksam<br />
werden: „Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, der ist […] selbstvergessen. Kunst schafft<br />
Ich-Ferne. Kunst fordert hier in einer bestimmten Richtung eine bestimmte Distanz, einen<br />
bestimmten Weg.“ (EF 6) Auch die Kunst besitzt die „Gabe der Ubiquität“ (EF 4) und damit<br />
etwas „Unheimliches“ (EF 5). 17 Die Bewegung hin zum Anderen meint also zweierlei: für das<br />
Gedicht das Auffinden seiner „fehlenden Hälfte“, für das Gedicht-Ich die Trennung <strong>von</strong> sich<br />
selbst‚ indem es mit dem Gedicht in seine Fremde geht. Das Gedicht wird voraus geworfen,<br />
auf einen Weg geschickt – und nimmt etwas vom Ich mit sich, das „mit seinem Dasein zur<br />
Sprache geht, wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend.“ 18 So eilt uns auch unser lesender<br />
Blick voraus.<br />
Vielleicht – ich frage nur –, vielleicht geht die Dichtung, wie die Kunst, mit einem selbstvergessenen<br />
Ich zu jenem Unheimlichen und Fremden, und setzt sich – doch wo? doch an welchem Ort?<br />
doch womit? doch als was? – wieder frei? (EF 6)<br />
17 Das Potential des Ubiquitären – und zugleich sein un-heimliches Grauen – wird in einer Szene<br />
aus David Lynchs Film „Lost Highway“ (1997) deutlich. Auf einer Party bei Bekannten wird der<br />
Protagonist <strong>von</strong> einem kleinen Mann mit geschminktem Gesicht beobachtet und schließlich angesprochen:<br />
„We’ve met before, haven’t we?“ Der Protagonist fragt nach, wo das gewesen sein solle.<br />
Antwort: „At your house. Don’t you remember? As a matter of fact, I am there right now.“ Er holt<br />
ein Telefon hervor: „Call me.“ Chance: Immer und überall ist eine Begegnung möglich. Gefahr:<br />
Man ist vor dieser Begegnung nirgendwo mehr sicher. Einmal dem Anderen begegnet, wird man<br />
ihn/es nie mehr los. Denn, wie es im Meridian heißt: „Ich bin… mir selbst begegnet.“ (EF 11) –<br />
Mit dem Mann in seinem Haus telefonierend, der zugleich vor ihm steht, fragt der Protagonist,<br />
wie er herein gekommen sei. Antwort: „You invited me. It is not my custom to go where I am not<br />
wanted.“ Hier ist etwas angesprochen, worauf wir am Schluss des Aufsatzes zurück kommen werden:<br />
die persönliche Bereitschaft zur Begegnung.<br />
18 Celan, Bremer Rede, a.a.O., S.186.<br />
11
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
2.) Kreis. Wie findet das Gedicht-Ich aus dieser seiner Fremde wieder zu sich selbst zurück?<br />
Denn dies ist die zweite Komponente der Begegnung, auf die der Text abzielt: Sein Titel „Der<br />
Meridian“ weist hin auf die am Ende offen gelegte Intention, den Ausgangspunkt der Reise<br />
wieder zu finden. Das ideale Abbild dieser Bewegung ist der Kreis (EF 11). Und hier taucht<br />
auch die Karte auf, folgerichtig „im Lichte der Utopie“ (EF 12): eine erinnerte „Kinder-<br />
Landkarte“ (ebd.), auf der der Ort der eigenen Herkunft, der Anfangs- und Zielpunkt, nicht<br />
auffindbar ist. Statt dessen wird etwas Anderes gefunden: ein Meridian, das Abbild der intendierten<br />
Kreisbewegung, „etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches,<br />
etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes“ (ebd).<br />
Nun müssen wir bedenken, dass ein irdischer Meridian, streng genommen, <strong>von</strong> seiner „eigentlichen“,<br />
geographischen Bedeutung her kein Voll-, sondern ein Halbkreis ist, <strong>von</strong> Pol zu Pol:<br />
als Route verspricht er also gerade keine Rückkehr zum, sondern extreme Entfernung vom<br />
Ausgangspunkt. Celans Text lässt beide Versionen zugleich zu, lässt den Meridian damit als<br />
Metapher – mit beiden Bedeutungen – zum Zuge kommen: Der Halbkreis beschreibt den<br />
Schritt hinaus in die Fremde, den Weg des Gedichts zum Anderen hin; der volle Kreis bildet<br />
den Weg des Gedicht-Ichs ab: hinaus in die Fremde und zu sich zurück. Den postulierten Weg:<br />
denn der Kreis wird zwar explizit als erwünschte Bewegung genannt und seine Durchführung<br />
unterstellt – „Es war ein Kreis.“ (EF 11) „Ich bin… mir selbst begegnet.“ (ebd.) „Eine Art<br />
Heimkehr.“ (ebd.) –, im Vollzug aber unterstreicht der Text auch für das Gedicht-Ich die<br />
Halbkreis-Variante. Lesen wir:<br />
Welche Fragen! Welche Forderungen! Es ist Zeit, umzukehren.<br />
[Leerzeile]<br />
Meine Damen und Herren, ich bin am Ende – ich bin wieder am Anfang.<br />
[…]<br />
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, da ich ja wieder am Anfang bin, noch einmal, in<br />
aller Kürze und aus einer anderen Richtung, nach dem Selben zu fragen. (EF 10f.)<br />
Der parcours des Textes wird hier zusammengefasst, als wäre ein Kreis beschrieben worden:<br />
obwohl ja gerade eben <strong>von</strong> einer Umkehr die Rede war. Wir sollten dem Motiv der Umkehr<br />
genauer nachfragen. „Umkehr“ steht bei Celan in engem Zusammenhang mit der Bewegung<br />
des Atems. „Atem, das heißt Richtung und Schicksal.“ (EF 3) „Dichtung: das kann eine<br />
Atemwende bedeuten.“ (EF 7) Die Atemwende - ein Richtungswechsel – ereignet sich an den<br />
Punkten, da Ein- in Ausatmen ineinander umschlagen. Dabei steht der Atem kurz still, „für<br />
diesen einmaligen, kurzen Augenblick.“ (EF 7) Celan nennt ihn auch „Atempause“ (EF 8); in<br />
12
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
den Notizen taucht die Bezeichnung „Kammzeiten“ 19 auf. Wir müssen an den Wellenkamm<br />
denken: die Atembewegung ließe sich als Sinuskurve (Welle) darstellen, auf deren höchsten/<br />
tiefsten Punkten das Gedicht „verweilt und verhofft“ (EF 8) bei dem Gedanken an mögliche<br />
Begegnung. Atem ist Ruhe, Rhythmus und Bewegung in Einem. Er vollzieht eine Bewegung<br />
der Wiederholung – Atemwege werden „wieder und wieder“ begangen: Route – und der Einzigartigkeit<br />
zugleich; kein Atemzug gleicht dem anderen, jeder besitzt „eine, einmalige, punktuelle<br />
Gegenwart“ (EF 9): parcours. Zudem vollzieht der Atem einen Wechsel zwischen Ausweitung<br />
und Verengung/Verdichtung; gegen Merciers „Elargissez l’art!“ wendet Celan ein:<br />
„Nein. Sondern geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei.“ (EF 11)<br />
Atemwege sind Engpässe; sie verbinden ein enges, zutiefst individuelles Innen mit dem<br />
unendlich weiten Draußen: als stimmhafte Sprache verlässt der Atem die Enge und macht<br />
sich auf die Suche nach seinem Gegenüber. Atem gibt der Sprache Richtung, macht sie zur<br />
Stimme, strukturiert sie durch Rhythmus und Timbre: das Gedicht kommt „auf Atemwegen“<br />
(51). Es bleibt „ … unter dem einmaligen Neigungswinkel eines Daseins sich vergegenwärtigende,<br />
sich erfüllende Sprache“ (119) dessen, „der nicht vergißt, daß er unter dem<br />
Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht.“ (EF 9)<br />
Sprache eines Einzelnen also: leibliche, konkrete, erfahrene Sprache. Damit verlässt Celans<br />
Meridian den Status einer „bloß rhetorischen Metapher“ 20 : Er wird Wirklichkeit – wenn wir<br />
Leser ihn erreichen, indem wir den Ansprüchen des Textes nachzukommen versuchen. Dies<br />
war ja Celans Ausgangspunkt: Wirklichkeit kann sich nur als persönliche Begegnung ereignen.<br />
Die einfache Beziehung Ich-Gegenstand reicht hierfür nicht hin.<br />
Bevor wir darauf näher eingehen, wollen wir uns dem zweiten, astrophysikalischen<br />
Verortungsversuch zuwenden; in seinen Bereich verweist uns zweierlei: der naturwissenschaftliche<br />
Begriff des Neigungswinkels, der im Meridian eine tragende Rolle spielt, und das<br />
zweite, räumliche Bild für Umkehr in Celans Rede: das „auf-dem-Kopf-Gehen“ aus Büchners<br />
Lenz-Erzählung. „Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, – wer auf dem Kopf<br />
geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich.“ (EF 7) „Mit ihm/Wandern die<br />
Meridiane“ 21 : Hier ist die Rede nicht <strong>von</strong> irdischen, sondern <strong>von</strong> Himmelsmeridianen, imagi-<br />
19 „An den Atemhöfen, in denen es steht, erkennst du’s [das Gedicht, NT]; an den Kammzeiten.“<br />
(107) „Auf der Kammzeit der erinnerten Pause findet dich dein Wort.“ (127)<br />
20 Gegen die Metapher als bloße „Wortkunst“ hat sich Celan übrigens stets vehement ausgesprochen.<br />
„Das Gedicht […] hat nur seine Sprach- und damit Bedeutungsebene.“ (104) „gegen das<br />
mittelbare – vorwegnehmende - Assoziieren!! Für die unmittelbare Wahrnehmung!!“ (137)<br />
21 Celan, Und mit dem Buch aus Tarussa, in Ges. Werke…, Bd. 1, S. 290. Das Gedicht entstammt<br />
dem 1963 erschienenen, dem russischen Dichter Ossip Mandelstam gewidmeten Gedichtband<br />
„Die Niemandsrose“.<br />
13
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
nären Großkreisen am Himmel, deren Situierung <strong>von</strong> der irdischen Position des Beobachters<br />
abhängt.<br />
3. Fixsternparallaxe: Wahrnehmungsprobleme<br />
Im Jahre 1543 erscheint Kopernikus’ „De Revolutionibus“. Sein Postulat des heliozentrischen<br />
Weltbildes gründet auf der Erkenntnis, „dass die sichtbare Bewegung eines Punktes, ebenso<br />
wohl durch die Ortsveränderung des Gesichtspunktes, als durch seine eigene, erzeugt werden<br />
kann.“ 22 Dies führt zur Hypothese der Fixsternparallaxe: Durch die Eigenbewegung der Erde<br />
hat der Blickpunkt des irdischen Beobachters keine fixe Position mehr, sondern durchläuft<br />
eine Bahn. Ein Fixstern muss also, <strong>von</strong> der Erde aus beobachtet, im Laufe eines Jahres eine<br />
kleine Ellipse am Himmel beschreiben – scheinbar, denn „in Wirklichkeit“ bewegt sich der<br />
Beobachter.<br />
„Unter Parallaxe eines Fixsterns wird die Entfernung seines, <strong>von</strong> der Erde gesehenen (scheinbaren)<br />
Ortes an der Himmelskugel, <strong>von</strong> dem <strong>von</strong> der Sonne gesehenen (wahren oder mittleren)<br />
Orte verstanden;“ 23 gemessen wird sie in Grad bzw. Bogensekunden durch einfache<br />
Trigonometrie: man bildet ein Dreieck zwischen Stern, Erd- und Sonnenmittelpunkt und<br />
ermittelt den Winkel beim Stern. Eine gelungene Parallaxenmessung hätte das neue Weltbild<br />
bewiesen.<br />
Unglücklicherweise gelingt sie lange Zeit nicht, zahllosen Versuchen zum Trotz. Kopernikus<br />
selbst scheitert mit einem Triquetrum 24 – und schließt <strong>von</strong> seinem Misserfolg nicht etwa auf<br />
die Falschheit seiner Überzeugung, sondern darauf, dass die Messgenauigkeit seines<br />
Instruments offenkundig nicht ausreicht: Die Sterne müssen sehr viel weiter <strong>von</strong> der Erde entfernt<br />
sein als die Sonne – wodurch der parallaktische Winkel zu klein wird, als dass man ihn<br />
messen könnte. 25 Zu bedenken ist hierbei, dass auch Kopernikus noch <strong>von</strong> der Existenz einer<br />
Fixsternsphäre ausgeht und infolgedessen annimmt, alle Fixsterne seien gleich weit <strong>von</strong> der<br />
22 Bessel, Friedrich Wilhelm, Messung der Entfernung des 61. Sterns im Sternbilde des Schwans.<br />
In: Jahrbuch für 1839, hrsg. v. H.C.Schumacher, S. 1–56, hier: S. 2<br />
23 ebd., S. 8<br />
24 Ein dem Astrolab verwandtes parallaktisches Messinstrument, erstmals beschrieben <strong>von</strong> Ptole-<br />
mäus im Almagest.<br />
25 Der dänische Astronom Tycho Brahe wertete die Nichtbeobachtbarkeit der Parallaxe als Beweis<br />
gegen das heliozentrische System und kam so zu seiner kreativen Verknüpfung beider Versionen,<br />
wonach sich alle Planeten außer der Erde um die Sonne drehten (Kopernikus) und dieses<br />
Gesamtsystem wiederum um die Erde kreiste (Ptolemäus).<br />
14
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Erde entfernt – fest („fix“) angeordnet auf der Innenseite einer Kugel, die das Universum<br />
umschließt und ihm damit, mit de Certeau gesprochen, eine Ortsstruktur gibt. Erst Giordano<br />
Bruno vertritt die Ansicht, dass das Weltall unendlich sei und die Sterne frei darin verstreut:<br />
ein Weltraum.<br />
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erfindet Galileo Galilei das Fernrohr nach, richtet es auf den<br />
Himmel – und sieht das Universum nicht „örtlich“ als geschlossene Kugelsphäre, sondern als<br />
unermesslichen Raum, der durch den fernrohrgestützten Blick ein Stück weit beschritten,<br />
erfahren werden kann. Das Medium Fernrohr sorgt dafür, dass sich der erkenntnisorientierte<br />
Blick des Menschen endgültig vom reinen Sehen abkoppelt. „Sehen“ hatte bis dato gemeint:<br />
die Welt erfassen, ordnen und benennen können; im Christentum kennzeichnet das Sehvermögen<br />
den Menschen als Gott darin ähnliches Geschöpf, dass es das Universum mit bloßem<br />
Auge zu erfassen vermag, bis in den hintersten Winkel gleichsam. 26 Nun kommt etwas hinzu:<br />
das Wissen um Unermessliches, das hinter dem letzten sichtbaren Winkel liegt, in das man<br />
mit Hilfe optischer Instrumente zwar vordringen kann, dessen Grenze sich jedoch als beweglicher<br />
Horizont immer weiter und weiter entzieht; man erkennt, dass „das sinnlich Erfahrbare<br />
die bloße phänomenale Oberfläche der Wirklichkeit“ darbietet. 27 Der Zuwachs an Sichtbarem<br />
im Rahmen des Objektivs wird erkauft durch eine immense Potenzierung dessen, was<br />
man eben nicht sieht. 28 Damit wird der wissenschaftliche Blick „Begehren, unstillbares<br />
Begehren […]; ein Blick, der nicht im Gesehenen aufgeht.“ 29 Kulturelle Kehrseite dieses<br />
26 „Der Naturbegriff der Tradition war mit einer Art <strong>von</strong> Sichtbarkeitspostulat verbunden, das<br />
sowohl der Endlichkeit des Universums als auch der Vorstellung seiner auf den Menschen bezogenen<br />
Zweckmäßigkeit und Zentrierung entsprach. Daß es in der Welt für den Menschen nicht nur<br />
zeitweise und vorläufig, sondern seiner natürlichen Ausstattung definitiv Entzogenes und<br />
Unsichtbares geben könnte, war eine der Antike wie dem Mittelalter unbekannte, unter bestimmten<br />
metaphysischen Voraussetzungen auch unvollziehbare Unterstellung.“ Blumenberg, Hans,<br />
Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit. In Galilei, Galileo, Sidereus Nuncius. Hrsg. u.<br />
eingeleitet v. Hans Blumenberg. Frankfurt/Main 1965, S. 5–73, hier: S. 13.<br />
27 ebd.<br />
28 Bemerkbar macht sich dies jedoch erst später – und mündet ein in die „kopernikanische Wende“<br />
des menschlichen Blicks, die wir in der Einleitung angesprochen hatten: Der zunächst als entwurzelnd<br />
empfundene, uneinholbare Einfluss des Wie der Wahrnehmung auf ihr Was, paradigmatisch<br />
erfahrbar am medialen Ereignis des Fernrohrs, wird umgewertet zu einem Primat der<br />
Wahrnehmung, die im Zentrum der menschlichen Vernunft neue Wurzeln schlägt.<br />
29 Borsò, a.a.O., S. 36, spricht hier vom Antlitz bei Levinas. Im Rahmen der christlich geprägten<br />
europäischen Kulturgeschichte beginnt die Geschichte dieses Blicks meines Erachtens jedoch bereits<br />
bei Galilei.<br />
15
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Blicks: der horror vacui, die maßlose Verlorenheit des Menschen im Leeren, Grenzenlosen.<br />
Dies sind Galileis Sorgen noch nicht. Bezüglich der Parallaxenmessung schlägt er eine höhere<br />
Abstraktionsebene vor, indem er Folgendes zu bedenken gibt: Wenn zwei Sterne, <strong>von</strong> der<br />
Erde aus beobachtet, nah beieinander stehen, jedoch unterschiedlich weit <strong>von</strong> der Erde entfernt<br />
sind, müsste ja der nähere Stern eine größere Parallaxe zeigen als der weiter entfernte,<br />
dessen Parallaxe gegen Null ginge. Man könne daher den entfernten Stern als Bezugspunkt<br />
wählen, um die Parallaxe des näheren gegen ihn zu messen („Differenzmethode“).<br />
Wie Galilei geht man bis ins 19. Jahrhundert hinein da<strong>von</strong> aus, dass ein Stern der Erde umso<br />
näher steht, je heller er strahlt. Andere Möglichkeiten der Entfernungsbestimmung gibt es<br />
noch nicht: hierfür müsste man ja die Parallaxe messen können. Und bis ins 19. Jahrhundert<br />
hinein bleiben alle Versuche erfolglos. Längst hat sich das neue Weltbild über Kepler und<br />
Newton durchgesetzt, doch bleibt das Parallaxenproblem virulent bezüglich der Vermessung<br />
des Weltraums: der „Schritt hinaus“ aus dem Sonnensystem wird angestrebt, und hierzu muss<br />
die Astrophysik in der Lage sein, Entfernungen zwischen Erde und Fixsternen zu bestimmen.<br />
Diese Tendenz zur „visuellen Landnahme“ bildet ein logisches Gegengewicht zum entgrenzenden<br />
Blick ins Unermessliche.<br />
Ein wichtiger Zwischenschritt glückt im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts dem englischen<br />
Astronomen James Bradley: Über Jahre hinweg beobachtet er Sternpositionen, katalogisiert<br />
seine Messreihen und entdeckt tatsächlich Schwankungen, die jedoch nicht Parallaxenphasen<br />
entsprechen. So entdeckt Bradley die Aberration des Lichts. 30 Tatsächlich sind Aberrationsund<br />
Nutationsverschiebungen um ein Vielfaches größer als die aufgrund der Entfernungen<br />
vergleichsweise winzigen parallaktischen Positionsveränderungen. Solange keine entsprechend<br />
präzisen optischen Instrumente zur Verfügung stehen, muss die Fixsternparallaxe also<br />
unmessbar bleiben.<br />
Bradleys Messreihen werden, gemeinsam mit der Entdeckung der Doppelsterne durch<br />
William Herschel, zur Grundlage für den Wissenschaftler, dem die erste hinreichend genaue<br />
30 Da die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, benötigt das Licht Zeit, um durch das Teleskop zum<br />
Betrachter zu laufen. Unterdessen bewegt sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn mit etwa 30<br />
km/sec weiter, so dass die Sternpositionen verschoben wahrgenommen werden. Auch die<br />
Nutationseffekte der Erdachse entdeckt Bradley, kann sie zunächst jedoch nicht erklären: kleinere,<br />
periodische Schwankungen der Rotationsachse der Erde, die sich ihrem „regulären“ Kreistaumeln<br />
überlagern – verursacht dadurch, dass die Erde nicht exakt kugelförmig, sondern an den<br />
Polen leicht abgeplattet ist und <strong>von</strong> den Bahnbewegungen des Mondes und der Sonne unterschiedliche<br />
Drehmomente erfährt.<br />
16
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Parallaxenmessung schließlich gelingt: Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846). Auf Umwegen<br />
zur Astronomie gelang 31 und hierfür ungewöhnlich begabt – „entdeckt“ wird er durch<br />
den Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers, der ihn mit Carl Friedrich Gauß bekannt macht<br />
–, wird Bessel 1810 nach Königsberg berufen, um dort eine neue Sternwarte zu erbauen und<br />
zu leiten und außerdem als Universitätsprofessor Astronomie zu lehren. 32<br />
Schon vor seinem Umzug nach Königsberg hatte sich Bessel mit Bradleys Messreihen beschäftigt.<br />
Auch ihm war es nicht gelungen, daraus eine Parallaxe abzuleiten – dafür allerdings<br />
Konstanten für die Aberrations- und Nutationsverschiebungen, die er richtig zu deuten wusste.<br />
Erst 1815 findet Bessel erneut Zeit, sich mit dem Parallaxenproblem zu befassen; nach<br />
mehreren Anläufen mit seinem Passageninstrument 33 gelangt er zu der Überzeugung, dass die<br />
Parallaxe durch Meridianbeobachtungen nicht festzustellen ist. Zwanzig Jahre später nimmt<br />
er das Parallaxenprojekt wieder auf – inzwischen ausgerüstet mit der nahezu perfekten Version<br />
eines Instrumententyps, der erst durch die Photographie abgelöst werden sollte: dem<br />
Heliometer.<br />
Die hervorstechendste Eigenschaft eines Heliometers besteht in der Möglichkeit des doppelten<br />
Blicks: Es ist in der Lage, mit zwei quasi <strong>von</strong> einander entkoppelten „Augen“ zu sehen.<br />
Bessels Exemplar, ein in jahrelanger Arbeit <strong>von</strong> Joseph <strong>von</strong> Fraunhofer hergestelltes<br />
Refraktorteleskop, besitzt ein in Längsrichtung entzwei geschnittenes 6-Zoll-Objektiv mit<br />
einer Brennweite <strong>von</strong> 2,60 m, dessen halbzylindrische Hälften mittels einer Schraube gegen-<br />
31 – er hatte die Schule abgebrochen und eine kaufmännische Lehrstelle angenommen und plante,<br />
als Frachtaufseher an einer Expedition nach Südamerika teilzunehmen, wofür er sich Astronavigation<br />
beibrachte; die hierfür notwendigen Instrumente baute er aus Geldmangel selbst<br />
nach.<br />
32 Zusätzlich wird Bessel, wie sein Göttinger Kollege Gauß, mit geodätischen Aufgaben betraut.<br />
Seine auf zehn Gradmessungsbögen basierende Berechnung der abgeplatteten Figur der Erde –<br />
der „Bessel-Ellipsoid“ – ist noch immer rechnerische Grundlage der Landesvermessung in zahlreichen<br />
Staaten. Auch in der Mathematik hat sich Bessel durch seine Differentialgleichungen<br />
(„Bessel-Funktionen“) „verewigt“.<br />
33 Passageninstrumente sind auf einer Horizontalachse montierte, in der Meridianebene<br />
schwenkbare Fernrohre, die den Durchgang (Passage) des Sterns durch den Meridian erfassen.<br />
Sie bilden eine Kompaktversion der Meridiankreise, die seit ca. 1800 der Ortsbestimmung <strong>von</strong><br />
Sternen dienen. Mit einem Fadennetz im Objektiv und dem Ticken einer Pendeluhr ermittelte<br />
man Zeit und Höhenwinkel des Sterns im Kulminationspunkt. Noch heute sind Meridiankreise<br />
für die Erstellung <strong>von</strong> Sternkatalogen in Gebrauch; ab ca. 1920 wurden sie auf fotografische,<br />
fünfzig Jahre später auf elektro-optische, jüngst auf CCD-Messmethoden umgerüstet.<br />
17
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
einander verschoben werden können. Direkt am Schraubenkopf sind die Umdrehungen in<br />
Tausendstel abzulesen, entsprechend 0,05 Bogensekunden des zu messenden Winkelabstands.<br />
Eine zweite Schraubvorrichtung dient der Positionseinstellung des gesamten Rohres;<br />
in Rektaszension wird es durch ein Chronometer mit Gewichtsantrieb geführt, was die zeitlichen<br />
Messungenauigkeiten der Meridiankreise stark verringert. Das Heliometer besitzt fünf<br />
Okulare mit 45 bis 290facher Vergrößerung, ein 65fach vergrößerndes Kreismikrometer<br />
sowie ein Ring- und ein Netzmikrometer.<br />
Will man nun den Winkelabstand zweier Sterne im Gesichtsfeld messen, so bringt man das<br />
Objektiv so in Stellung, dass die Schnittlinie der Objektivhälften auf der kürzesten Strecke<br />
zwischen den beiden Sternen liegt; anschließend zieht man die Hälften so auseinander, dass<br />
in der Brennebene beide Stern-Bilder zu einem werden 34 : Das Heliometer macht zwei Bilder<br />
34 Entsprechend ermittelte man den Durchmesser der Sonne – daher die Bezeichnung<br />
„Heliometer“.<br />
18<br />
Dieses renovierte Heliometer<br />
steht heute in der<br />
Eingangshalle des<br />
Argelander-Instituts für<br />
Astronomie in Bonn.<br />
Foto: Dr. Michael Geffert
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
deckungsgleich, indem es sie auf einer parallel zum Objektiv verlaufenden Linie anordnet, die<br />
ins Auge des Beobachters mündet. Dieser schaut nun „<strong>von</strong> oben“ auf die zwei Bilder und sieht<br />
sie daher als eines 35 . Die Schraubenskalierung ermöglicht die Abstandsberechnung.<br />
Verpackt in 27 Kisten wird das Instrument im März 1829<br />
nach Königsberg geliefert; die Arbeiten an dem eigens<br />
hierfür zu errichtenden Turm über einem Seitenflügel der<br />
Sternwarte ziehen sich jedoch noch bis in den Oktober<br />
hin. 36 In den folgenden Jahren setzt Bessel das Heliometer<br />
für diverse Vorhaben ein; 1837 endlich, immer wieder<br />
gedrängt durch seinen Freund und Mentor Olbers,<br />
beginnt er fortlaufende Parallaxenmessungen vorzunehmen.<br />
Er hält sich an den Doppelstern 61 Cygni (Sternbild<br />
Schwan): dessen starke Eigenbewegungen waren ihm<br />
durch Bradleys Beobachtungen aufgefallen, derentwegen<br />
er ihn für einen erdnahen Stern hält – entgegen der<br />
Auffassung zahlreicher Kollegen, die seine Lichtschwäche als Indikator für große Entfernung<br />
sehen. Sicherheitshalber wählt er zwei Anschlusssterne in 61 Cygnis Umgebung für die<br />
Differenzmessung aus.<br />
35 So etwas ereignet sich übrigens auch in der „materiellen“ Wirklichkeit, etwa bei einer Sonnenoder<br />
Mondfinsternis. Nur dass ein Effekt wie die Corona beim Heliometer unerwünscht wäre: es<br />
funktioniert genau dann, wenn seine künstlich-produktive Leistung gerade keine Effekte zeitigt,<br />
die das Bild als gemachtes entlarven. – Im Falle des Doppelsterns 61 Cygni erhält man eine<br />
optisch noch komplexere Anordnung dadurch, dass Bessel, um der größeren Genauigkeit willen,<br />
das Bild des jeweiligen Anschlusssterns mitten in den Zwischenraum 61 Cygnis rückt. Wir bleiben<br />
bei der einfacheren Variante der Deckungsgleichheit.<br />
36 Für genauere Informationen zu Bau, Aufstellung und Einsatz des Heliometers vgl. Bessel:<br />
Vorläufige Nachricht <strong>von</strong> einem auf der Königsberger Sternwarte befindlichen grossen Heliometer.<br />
In ders., Abhandlungen, hrsg. v. Rudolf Engelmann, Bd.II, Leipzig 1876, S. 95–106. Vgl.<br />
außerdem Bessels Briefe an den Hamburger Instrumentenhersteller J.G. Repsold. Letzterer kehrt<br />
im September 1826, kurz nach Fraunhofers Tod, <strong>von</strong> einer München-Reise nach Hamburg<br />
zurück und wird sofort <strong>von</strong> dem besorgten Bessel angeschrieben, der ihn bezüglich seines im Bau<br />
befindlichen Heliometers ausfragt. Koch, Jürgen W., Der Briefwechsel zwischen Friedrich<br />
Wilhelm Bessel und Johann Georg Repsold. Kommentierte Übertragung der Brieftexte.<br />
Hamburg 2000, v.a. S. 61–64. – Im Jahre 1834 hat auch Alexander <strong>von</strong> Humboldt, angeleitet<br />
<strong>von</strong> Bessel, mit diesem Königsberger Heliometer Doppelsterne beobachtet. Im zweiten Weltkrieg<br />
wurde die Sternwarte mitsamt ihren Instrumenten zerstört.<br />
19
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Damit hat Bessel die Voraussetzungen geschaffen für eine naturwissenschaftliche Untersuchung<br />
mit Netz und doppeltem Boden: 14 Monate lang führt er in 99 Beobachtungsnächten<br />
knapp 3000 Einzelmessungen durch; er stellt 183 Bedingungsgleichungen für die<br />
Anschlusssterne auf und löst sie für jeden Stern einzeln. Im Mittel ergibt sich für die Parallaxe<br />
ein Wert <strong>von</strong> 0,3136 Bogensekunden bei einem anzunehmenden Fehler <strong>von</strong> bis zu 0,<strong>02</strong><strong>02</strong><br />
Bogensekunden. Als Entfernung zwischen Erde und 61 Cygni ergeben sich somit etwa 10,3<br />
Lichtjahre. Unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Ergebnisses unterzieht Bessel sein<br />
Instrument einer Generalüberholung und setzt seine Beobachtungen bis in den Frühling<br />
1840 hinein fort. 37 „Ich habe jetzt das Vergnügen, die Parallaxe <strong>von</strong> 61 Cygni in einer zweiten<br />
Beobachtungsreihe sich wiederum entwickeln zu sehen“, teilt er Gauß Ende Juni 1839 mit,<br />
„wahrscheinlich wird das neue Resultat dem alten ziemlich nahe kommen.“ 38 Bessels<br />
Optimismus ist berechtigt: Es ergibt sich eine Parallaxe <strong>von</strong> 0,3483’’, möglicher Fehler bis zu<br />
0,0095’’. 39 „Es ist also nicht mehr zu bezweifeln, dass die Beobachtungen endlich über die<br />
Grenze hinausgeführt haben, welche sie überschreiten mussten, damit die Entfernung eines<br />
Fixsterns <strong>von</strong> dem Unermesslichen in das Messbare übergehen konnte.“ 40<br />
Damit finden Bessels Messungen offizielle Anerkennung – auch in Form einer Goldmedaille<br />
der Londoner Royal Astronomical Society. Deren Präsident John Herschel in der Laudatio:<br />
I congratulate you and myself that we have lived to see the great and hitherto impassable barrier<br />
to our excursions into the sidereal universe; that barrier (aestuantes angusto limite mundi) –<br />
almost simultaneously overleaped at three different points[ 41 ]. It is the greatest and most glorious<br />
triumph which practical astronomy has ever witnessed. 42<br />
37 Bessels Berichte sind ebenfalls im Bd. II seiner Abhandlungen abgedruckt: S. 217–236. Höchst<br />
anschaulich und informativ auch sein allgemein verständlicher Artikel „Messung der Entfernung<br />
des 61. Sterns im Sternbilde des Schwans“, a.a.O. Der Briefwechsel zwischen W. Olbers und F.W.<br />
Bessel, hrsg. v. Adolph Erman, Leipzig 1852, Bd.II, gibt Aufschluss darüber, dass Bessel seine<br />
geglückte Parallaxenmessung dem Freund zu dessen 80. Geburtstag zueignet (v.a. S. 429–433).<br />
38 Bessel an Gauß, 28.06.1839; zit. nach, Gauss, Carl Friedrich, Werke. Ergänzungsreihe, Bd. I:<br />
Briefwechsel C.F. Gauss – F.W. Bessel. Hildesheim/New York 1975 [Nachdruck d. Ausg. Leipzig<br />
1880], S. 529.<br />
39 Tatsächlich weichen Bessels Ergebnisse nur sechs Prozent vom derzeit gültigen Wert ab.<br />
40 Bessel, Messung…, a.a.O., S. 49.<br />
41 Hiermit sind außer Bessel die Astronomen Friedrich G.W. Struve und Thomas Henderson<br />
gemeint, deren Parallaxenmessungen etwa zeitgleich veröffentlicht wurden. Bessel wurde wegen<br />
der Gründlichkeit herausgehoben, mit denen er seine Ergebnisse nach allen Seiten abgesichert und<br />
überprüft hatte. Die Ehrung gebührte ihm übrigens nach Ansicht aller Kollegen zu Recht.<br />
42 Zit. nach: Lawrynowicz, Kasimir „Friedrich Wilhelm Bessel“ 1784–1846. Basel 1995, S. 211.<br />
20
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Der „Schritt hinaus“ in einen messbaren Weltraum ist getan – im Rahmen der Messgenauigkeit:<br />
indem die Natur aller Beobachtungen mit sich bringt, dass sie nur Näherungen an die Wahrheit<br />
sind, ist auch ihr Resultat nur eine Näherung an die Wahrheit, und das Urtheil über seinen<br />
Werth kann nur durch eine Untersuchung der Grenzen erlangt werden, über welche hinaus es<br />
sich wahrscheinlich nicht <strong>von</strong> der Wahrheit entfernt. Je genauer und zahlreicher die Beobachtungen,<br />
durch welche das Resultat gegeben wird, sind, desto weniger entfernen sich die Grenzen<br />
seiner wahrscheinlichen Unrichtigkeit <strong>von</strong> der Wahrheit. 43<br />
Die empirisch gestützten Naturwissenschaften lassen die „unscharfen Ränder“ eines solchen<br />
Ergebnisses durchaus zu – und tragen damit einem Unsichtbaren hinter dem Sichtbaren<br />
Rechnung: Auch für einen Wissenschaftler wie Bessel wäre wünschenswerte Wirklichkeit ein<br />
Zusammentreffen – des eigenen Blicks mit der Wahrheit nämlich, die bis auf weiteres Grenzwert<br />
jenseits des Beobachtbaren und Messbaren bleibt. 44 Dies ist die Utopie der Naturwissenschaften:<br />
kein Nirgend-, sondern ein Irgendwo, das noch unsichtbar und damit ortlos ist, aber<br />
nicht bleiben muss. Denn: „Indessen ist der Verstand nicht an die Grenzen des Anschaulichen<br />
gebunden“ 45 .<br />
4. Das Licht der Utopie – Der Schatten der Parallaxe<br />
Mit diesem Befund ergibt sich eine überraschende Verschränkung der Natur- mit den<br />
Geisteswissenschaften. Aus einer vermeintlichen Tradition heraus würden wir die Priorisierung<br />
des Gegebenen, Sichtbaren den „harten“ Naturwissenschaften zuordnen; den ‚weichen’<br />
Geisteswissenschaften hingegen unterstellen wir den Blick der Interpretation, der sich hinter<br />
dem Sichtbaren in einem vagen, virtuellen, imaginären Raum ergeht (und oftmals verliert). In<br />
den <strong>von</strong> uns soeben untersuchten Fällen liegen die Dinge umgekehrt: Es ist Bessel, der der<br />
Beobachtung Näherungscharakter bescheinigt; es ist der naturwissenschaftliche Blick durch<br />
das Fernrohr, den „unstillbares Begehren“ nach einer Wirklichkeit „dahinter“ treibt. Für den<br />
Dichter Celan hingegen ist ein solches Dahinter keine Option mehr 46 . Er pocht auf das<br />
Primat des sichtbaren Phänomens – und vollzieht damit eine Umkehr: zurück zum „Sichtbar-<br />
43 Bessel, Messung…, a.a.O., S. 47.<br />
44 Zwei weitere Einsichten stellen sich Bessels Erfolg an die Seite; deren erste hat er selbst mit hervorgebracht.<br />
Erstens ist der Blick hinaus ins All aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit ein<br />
Blick in die Vergangenheit. Zweitens stellt sich im 20. Jahrhundert heraus, dass das Universum<br />
gegenwärtig expandiert; dies geht einher mit der Anerkennung des Raum-Zeit-Kontinuums.<br />
45 Bessel, Messung…, a.a.O., S. 50.<br />
46 – kann es, historisch gesehen, auch kaum mehr sein.<br />
21
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
keitspostulat“. „Gegenständlichkeit, Gegenständigkeit der Gedichte: Anschauung kein<br />
Durchschauen –: das Gedicht ist schon das Dahinter“ (Meridian, 97). „Wer schon durchschaut<br />
hat, ehe er wahrnimmt und anschaut, dem steht das Gedicht mit seiner ganzen – im<br />
geologischen Sinne zu verstehenden – Mächtigkeit entgegen.“ (96)<br />
Das Einende beider Perspektiven ist ihr Gerichtetsein auf Wirklichkeit als Begegnung.<br />
„Wirklichkeit – Gegenüberstehen“ (101): seien es Wissenschaftler und Wahrheit, seien es<br />
Dichter und Leser. In beiden Fällen droht die Begegnung im Utopischen zu verbleiben: sei es<br />
als unerreichbarer Grenzwert, sei es als wandernde Stelle. Wie ist Begegnung dennoch denkund<br />
erreichbar?<br />
Bessel plädiert für größtmögliche Annäherung an den Grenzwert via Sorgfalt und Präzisierung:<br />
für wissenschaftlichen Fortschritt. Er nimmt in Kauf, dass sich beim Erreichen eines<br />
„Etappenziels“ sofort ein neuer Horizont auftut, hinter den es zu sehen gilt. 47 Auch Celans<br />
Poetik der Begegnung impliziert, dass auf sie hingearbeitet werden muss: „Wirklichkeit ist<br />
nicht, Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein.“ 48 Die „Stelle“ der Begegnung ist räumlich<br />
und örtlich zugleich; zu ihr hin führt eine Bewegung, die zwischen Navigation und parcours<br />
oszilliert: „zwischen Vorgefundenem und Aufgefundenem, Auffindbarem steht das<br />
Gedicht.“ (97). Wirklichkeit ist zu suchen und zu gewinnen nur dann, wenn ein „doppelter<br />
Blick“ beide Dimensionen – Örtliches und Räumliches – erfasst und „in eins sieht“. Das<br />
Moment der Begegnung beschreibt Celan denn auch so:<br />
Es geht um die Aufhebung einer Dualität; mit dem Ich des Gedichts ist auch das Du gesetzt; es<br />
geht um ein solches In-eins-Sehen; es geht um Kongruenz; der Begriff des Künstlerischen reicht<br />
hier nicht mehr aus, auch der des Artistischen nicht. (152)<br />
Statt „In-eins-Sehen“ hatte Celan zuerst „Einssein“ geschrieben, dies jedoch gestrichen: Kongruenz<br />
heißt nicht Identität, sondern Deckungsgleichheit. Diese Art des „In-eins-Sehens“ hat<br />
uns das Heliometer vorgeführt. Es ist ein Instrument zur Bestimmung <strong>von</strong> Sternorten – und<br />
doch unterläuft es de Certeaus Bedingung des Ortes: Es macht den Ort der Sterne zum<br />
Raum, indem es das Koexistenzgesetz aushebelt und zwei Objekte für den Blick an einer<br />
Stelle zusammenfallen lässt, deckungsgleich macht. Verortung wird also möglich durch den<br />
Um-Weg (parcours) der Verräumlichung, die hier eben nicht als Ausdehnung, sondern als<br />
47 Beispielsweise sind wir heute in der Lage, Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und Gravitationswellen<br />
zu registrieren, doch das Ereignis des „Urknalls“ haben wir noch immer nicht „auf dem<br />
Schirm“.<br />
48 Celan, Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker, Paris (1958), in ders., Ges. Werke, Bd.<br />
3, S. 167f., hier: S. 167.<br />
22
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Komprimierung, als Zusammenziehung auftritt: als Konzentration. Die enge Passage des<br />
Fernrohrs macht den Blick in die Weite möglich: denken wir an die Bewegung des Atmens.<br />
Deckungsgleichheit meint noch immer: Zweiheit. In die Gegenwart des Gedichts „bringt das<br />
Angesprochene und durch Nennung gleichsam zum Du Gewordene auch sein Anderssein<br />
mit.“ (EF 9) Hier vollzieht Celans Poetik ihren „ethical turn“, ganz im Sinne Emmanuel<br />
Levinas’: „Der Angerufene ist nicht Gegenstand meines Verstehens: Er steht unter keiner<br />
Kategorie. Er ist der, mit dem ich spreche – er hat Bezug nur auf sich selbst, er hat keine<br />
Washeit.“ Sein Anderssein wird nicht aufgelöst, es kommt zu keiner Verschmelzung. Dies ist<br />
Bedingung eines wirklichen Gesprächs. Wahrlich poetisch mutet in diesem Zusammenhang<br />
der Umstand an, dass Heliometer zuweilen Oszillationsphänomene zeigen, die die Zweiheit<br />
ihrer Bilder kenntlich machen: sie „benehmen sich metaphorisch“. 49 Im Januar 1830 berät sich<br />
Bessel hierüber brieflich mit Gauß:<br />
[…] benutze ich zugleich diese Gelegenheit Sie zu bitten, mir über einiges was mir bei meinem<br />
grossen Heliometer aufgestossen ist gefällige Auskunft zu ertheilen. […] Die Hauptsache <strong>von</strong> meinen<br />
Zweifeln wird durch eine Eigenthümlichkeit des Objectivs erzeugt. Wenn ich nämlich das<br />
Ocular auf das deutlichste Sehen stelle und die beiden Objectivhälften so berichtige, dass die beiden<br />
Bilder eines Sterns sich genau decken, so verschwindet diese Berichtigung sogleich wieder,<br />
wenn ich das Ocular ein wenig hinein oder heraus schiebe; d.i. es entstehen zwei Bilder, in einer<br />
auf den Durchschnitt senkrechten Ebene. Ich weiss den eigentlichen Grund hierfür nicht; sollte es<br />
wohl <strong>von</strong> der Diffraction an den Rändern des Schnitts herrühren? doch auch dieses ist mir nicht<br />
völlig klar. Hat Ihr Instrument eine ähnliche Erscheinung gezeigt? – Auf jeden Fall ist dieses ein<br />
übeler Umstand, wenn er sich nicht abändern lässt […] 50<br />
Bessel muss solche Erscheinungen – aus der Perspektive des Naturwissenschaftlers – als Störung<br />
sehen. 51 Wir können darin auch eine Begegnung lesen: es berühren sich Technik und „…<br />
ach, die Kunst!“ Das Bild des Heliometers zeigt nicht „die eine Wahrheit dahinter“, sondern<br />
gemachte Wirklichkeit. Und die ist nicht homogen. Was sich in ihr nur angleichen kann, ist<br />
49 Levinas, Emmanuel, Totalität und Unendlichkeit – Versuch über die Exteriorität. München<br />
1987, S. 93.<br />
50 Bessel an Gauß, 24.01.1830; in Gauss: Werke, Erg.bd. I, a.a.O., S. 494.<br />
51 Zu dieser und anderen Störungen Bessel, Vorläufige Nachricht…, a.a.O., S. 101f., S. 105. Vgl.<br />
auch Seeliger, Hugo,Theorie des Heliometers. Leipzig 1877, S. 67: „Durch die Wärme verändern<br />
sich sowohl die Krümmungen der Linsen, als auch die Brechungsexponenten der brechenden<br />
Medien.“ S. 71: „Namentlich hat die Tatsache seinerzeit einiges Befremden hervorgerufen, dass<br />
Wallungen in der Atmosphäre, welche unruhige und bewegte Sternbilder bewirken, momentane<br />
Trennungen der vereinigt gewesenen Bilder hervorrufen.“<br />
23
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
der Neigungswinkel <strong>von</strong> Beobachter und Beobachtetem bzw. <strong>von</strong> Gesprächspartnern.<br />
Hierüber ergibt sich die Kongruenz: „es geht um den Neigungswinkel, unter dem man zueinanderkam;<br />
es geht, wie bei jeder wirklichen Begegnung, um Ort und Stunde.“ (Meridian, 132)<br />
Naturwissenschaftlicher Fortschritt in Bessels Sinne hat uns inzwischen gezeigt, dass „Ort<br />
und Stunde“ nicht distinkten Dimensionen angehören: Raum und Zeit bilden vielmehr ein<br />
Kontinuum. 52 Vor diesem Hintergrund scheint unsere Bezeichnung „Stelle der Begegnung“<br />
gerechtfertigt: Ort und Stunde fallen zusammen – nicht als Schnittpunkt zweier Linien eines<br />
Koordinatenkreuzes, sondern in einer Dimension. Auch hier kommt es auf die Perspektive an.<br />
Zweierlei braucht es, um solche Stellen anzutreffen. Erstens die „Aufmerksamkeit des Lesers:<br />
eine Zuwendung zum Gedicht“ (Meridian, 132). Diese Disposition der Aufmerksamkeit<br />
haben wir bei Bessel im Vollzug kennen gelernt: sie hat mit Konzentration (s.o.), akribischer<br />
Beobachtung und Geduld zu tun und ist auf Begegnung ausgerichtet, gibt mithin Richtung.<br />
Zweitens bedarf es der Bereitschaft zum Sprung: auf beiden Seiten. „schöpf. Sprung des<br />
Dichters, schöpf. Sprung des Lesers (Du) – Voraussetzung (nicht Gewähr!) ist das Einanderzugewendetsein“<br />
(133). Wenn wir ein Gespräch zwischen verschiedenen Disziplinen (Perspektiven)<br />
verwirklichen wollen, müssen wir den Mut haben, aus der Sicherheit des eigenen<br />
Denkens ein Stück weit hinauszuspringen: Wir müssen dazu bereit sein, uns neuen Erfahrungen<br />
zu öffnen – an Stellen, da der sichere Hintergrund des Wissens uns (noch) fehlt. In<br />
den parallaktischen Blick genommen, muss dieser Sprung vielleicht so groß gar nicht sein.<br />
Denn das hängt vom Maß ab: Wenn der Abstand oder Sprung in horizontaler Richtung gleich<br />
Null ist, kann er in vertikaler Richtung dennoch gewaltig sein. Und wenn er in der Horizontalen<br />
riesig ist, kann er dennoch in der Vertikalen gleich Null sein. 53<br />
Über der Begegnung „lagert, lagert und umreißt sie – und das ist seit Hegel oft wiederholt<br />
worden, ein Schatten:“ (132) es ist der Schatten der Parallaxe, unseres wandernden Blicks<br />
selbst. Er blendet das gleißende Licht der Utopie an einer Stelle ab und umreißt diese ubiquitäre<br />
Stelle für ein Zusammentreffen. Immer wieder – einmal.<br />
52 Dieses Wissen übersteigt unsere physikalische Alltagserfahrung. Dass unser „inneres“ Auge mit<br />
der Invarianz einer Raum-Zeit möglicherweise besser zurechtkommt als mit der Galilei-Invarianz<br />
<strong>von</strong> Raum und Zeit, können wir hier nicht weiter ausführen.<br />
53 Serres, Michel, Hermes V., Die Nordwest-Passage. Berlin 1994, S. 181.<br />
24
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Ausblick<br />
Natürlich muss die Möglichkeit solcherart wirklicher Begegnungen bezweifelt werden. Eben<br />
dieser Zweifel an Wirklichkeit ist – das hoffen wir gezeigt zu haben – Grundlage beider<br />
Wissenschaftszweige und damit ihr gemeinsamer Neigungswinkel. „Denn dubitare ist lediglich<br />
ein Frequentativum <strong>von</strong> duo-habere, etwas für zweierlei halten, und dann auch: zwischen<br />
zwei Positionen schwanken oder oszillieren.“ 54 Und:<br />
Bessel (in seinem Aufsatz zur Messung der Parallaxe <strong>von</strong> 61 Cygni):<br />
denn die Ueberzeugung des sicheren Vorhandenseins des Gesuchten nährte die Hoffnung, und<br />
erst dann würde sie verschwunden seyn, wenn hätte nachgewiesen werden können, dass der<br />
zuletzt gethanene fruchtlose Schritt, der äusserste für die menschliche Kunstfertigkeit und die<br />
menschlichen Sinne wäre. Dieser Beweis ist aber weder geführt worden, noch kann er geführt<br />
werden. 55<br />
Celan (einzelne, handschriftliche Aufzeichnung zum Meridian):<br />
1606 Kepler: v. einem neuen Stern geträumt (53).<br />
Danksagung<br />
Für hilfreiche Auskünfte und für Bildmaterial danke ich herzlich: Frau Prof. Dr. Gudrun<br />
Wolfschmidt, Hamburg; Herrn Prof. Dr. Edward H. Geyer, Bonn; Herrn Dr. Michael<br />
Geffert, Bonn.<br />
54 Serres, Michel, Hermes V., Die Nordwest-Passage. Berlin 1994, S. 51.<br />
55 Bessel, Messung…, a.a.O., S. 32.<br />
25
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Curriculum Vitae<br />
1977 Geboren in Hamburg<br />
1987–1996 Gymnasium Meiendorf, Hamburg<br />
1996 Abitur – Leistungskurse: Deutsch/Englisch<br />
1996–20<strong>02</strong> Universitätsstudium an der Universität Hamburg<br />
Fächer: Deutsche Sprache und Literatur (Hauptfach),<br />
Italienische Literatur (1. Nebenfach),<br />
Chinesische Literatur und Kultur (2. Nebenfach)<br />
13.11.20<strong>02</strong> Abschluss: Magistra Artium<br />
2003 Promotion: begonnen an der Universität Hamburg,<br />
Fachbereich Sprachwissenschaften, bei Prof. Dr. Ulrich<br />
Wergin, Weiterbildung: zur Office-Managerin und<br />
Management-Assistentin (Fernstudium), 2004/2005,<br />
am Institut für Lernsysteme Hamburg, außerdem<br />
diverse bibliothekarische Fortbildungen (PICA, OUS)<br />
WS 2003/04 unbesoldeter Lehrauftrag am IfGII für ein Ib-Seminar<br />
zum Thema „Literaturwissenschaft heute – ein<br />
verlorener Posten?“<br />
- wissenschaftliches Tutorium am Asien-Afrika-Institut<br />
der Universität Hamburg: „Einführung in die<br />
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ (2 Semester)<br />
01.12.2007<br />
–28.<strong>02</strong>.2009 Mentorin für Bachelor-Studierende am Department<br />
SLM I<br />
ab Oktober<br />
2008 Vorbereitung eines Kurses für Masterstudierende:<br />
„Wissenschaftliches Arbeiten“ mit Prof. Dr.<br />
Anthimos Georgiadis, Fak. III der Universität<br />
Lüneburg: Umwelt und Technik<br />
ab 11.2009 Hamburger Zentrum für Theaterforschung<br />
26<br />
<strong>Nele</strong> <strong>Tincheva</strong>, M.A.