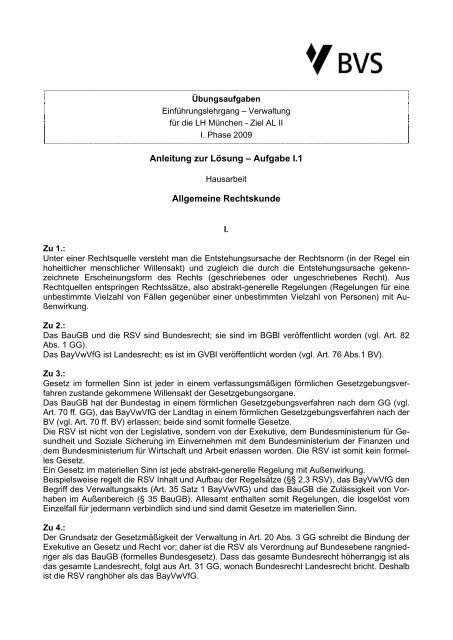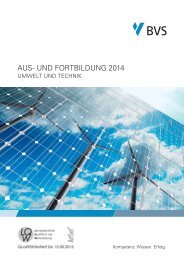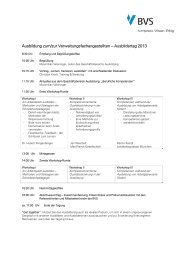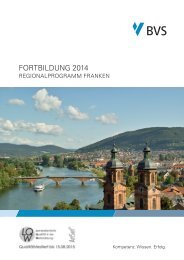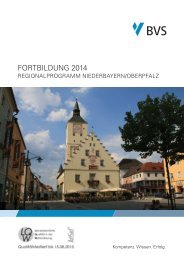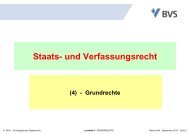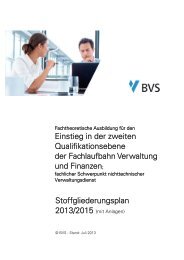1. Lösung_LH München_Phase I_Ziel AL II
1. Lösung_LH München_Phase I_Ziel AL II
1. Lösung_LH München_Phase I_Ziel AL II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Übungsaufgaben<br />
Einführungslehrgang – Verwaltung<br />
für die <strong>LH</strong> <strong>München</strong> - <strong>Ziel</strong> <strong>AL</strong> <strong>II</strong><br />
I. <strong>Phase</strong> 2009<br />
Anleitung zur <strong>Lösung</strong> – Aufgabe I.1<br />
Hausarbeit<br />
Allgemeine Rechtskunde<br />
I.<br />
Zu <strong>1.</strong>:<br />
Unter einer Rechtsquelle versteht man die Entstehungsursache der Rechtsnorm (in der Regel ein<br />
hoheitlicher menschlicher Willensakt) und zugleich die durch die Entstehungsursache gekennzeichnete<br />
Erscheinungsform des Rechts (geschriebenes oder ungeschriebenes Recht). Aus<br />
Rechtquellen entspringen Rechtssätze, also abstrakt-generelle Regelungen (Regelungen für eine<br />
unbestimmte Vielzahl von Fällen gegenüber einer unbestimmten Vielzahl von Personen) mit Außenwirkung.<br />
Zu 2.:<br />
Das BauGB und die RSV sind Bundesrecht; sie sind im BGBl veröffentlicht worden (vgl. Art. 82<br />
Abs. 1 GG).<br />
Das BayVwVfG ist Landesrecht; es ist im GVBl veröffentlicht worden (vgl. Art. 76 Abs.1 BV).<br />
Zu 3.:<br />
Gesetz im formellen Sinn ist jeder in einem verfassungsmäßigen förmlichen Gesetzgebungsverfahren<br />
zustande gekommene Willensakt der Gesetzgebungsorgane.<br />
Das BauGB hat der Bundestag in einem förmlichen Gesetzgebungsverfahren nach dem GG (vgl.<br />
Art. 70 ff. GG), das BayVwVfG der Landtag in einem förmlichen Gesetzgebungsverfahren nach der<br />
BV (vgl. Art. 70 ff. BV) erlassen; beide sind somit formelle Gesetze.<br />
Die RSV ist nicht von der Legislative, sondern von der Exekutive, dem Bundesministerium für Gesundheit<br />
und Soziale Sicherung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und<br />
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erlassen worden. Die RSV ist somit kein formelles<br />
Gesetz.<br />
Ein Gesetz im materiellen Sinn ist jede abstrakt-generelle Regelung mit Außenwirkung.<br />
Beispielsweise regelt die RSV Inhalt und Aufbau der Regelsätze (§§ 2,3 RSV), das BayVwVfG den<br />
Begriff des Verwaltungsakts (Art. 35 Satz 1 BayVwVfG) und das BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben<br />
im Außenbereich (§ 35 BauGB). Allesamt enthalten somit Regelungen, die losgelöst vom<br />
Einzelfall für jedermann verbindlich sind und sind damit Gesetze im materiellen Sinn.<br />
Zu 4.:<br />
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in Art. 20 Abs. 3 GG schreibt die Bindung der<br />
Exekutive an Gesetz und Recht vor; daher ist die RSV als Verordnung auf Bundesebene rangniedriger<br />
als das BauGB (formelles Bundesgesetz). Dass das gesamte Bundesrecht höherrangig ist als<br />
das gesamte Landesrecht, folgt aus Art. 31 GG, wonach Bundesrecht Landesrecht bricht. Deshalb<br />
ist die RSV ranghöher als das BayVwVfG.
Zu 5.:<br />
Im Privatrecht, das jedermann berechtigt bzw. verpflichtet, werden die Rechtsbeziehungen der<br />
einzelnen Rechtssubjekte zueinander und zu ihrer Umwelt geregelt; Kennzeichen ist die Gleichordnung<br />
der einzelnen Rechtssubjekte.<br />
Das öffentliche Recht ist der Teil der Rechtsordnung, der die Rechtsverhältnisse regelt, die durch<br />
das Wirken der staatlichen Hoheitsgewalt bestimmt sind. Öffentliches Recht – das grundsätzlich<br />
durch ein Über- und Unterordnungsverhältnis gekennzeichnet ist – liegt immer dann vor, wenn<br />
notwendig mindestens ein Hoheitsträger gerade in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger beteiligt<br />
ist.<br />
Beispielsweise regelt § 24 BauGB das allg. Vorkaufsrecht der Gemeinden. Darin zeigt sich die<br />
Unterordnung des Einzelnen unter das Gemeinwesen. Das BauGB gehört damit zum öffentlichen<br />
Recht.<br />
Die RSV unterwirft in § 3 Abs. 3 Ehegatten und Lebenspartner, die zusammen leben, der Regelung,<br />
dass sie nicht 100 % des Eckregelsatzes erhalten, sondern nur 90 %. Die RSV gehört daher<br />
ebenfalls zum öffentlichen Recht.<br />
Das BayVwVfG regelt in Art 80 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, dass der Widerspruchsführer die Kosten<br />
des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat, wenn sein Widerspruch erfolglos geblieben ist; ihm<br />
wird somit die Kostenlast einseitig auferlegt. Ferner enthält das BayVwVfG z.B. Regelungen über<br />
die Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher Verträge (vgl. Art. 54 ff. BayVwVfG). Da in diesen Verträgen<br />
öffentliche Aufgaben geregelt werden, handelt es sich trotz Gleichordnung um öffentliches Recht.<br />
Das BayVwVfG gehört damit ebenfalls zum öffentlichen Recht.<br />
Keine der genannten Rechtsquellen gehört somit zum Privatrecht; alle gehören zum öffentlichen<br />
Recht.<br />
Zu 6.:<br />
Durch Gerichtsurteil werden nur konkrete Einzelfälle geregelt. Sie wenden sich nur an die vor dem<br />
Gericht wegen einer bestimmten Streitigkeit stehenden Parteien. Die Judikative erlässt daher<br />
grundsätzlich keine Rechtsquellen. Es gibt jedoch Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,<br />
der Landesverfassungsgerichte und der Oberverwaltungsgerichte (in Bayern: Bay.<br />
Verwaltungsgerichtshof), sog. Normenkontrollentscheidungen, die Rechtsquellen darstellen. Es<br />
handelt sich hierbei um Entscheidungen, durch welche die Rechtmäßigkeit einer Rechtsvorschrift<br />
bejaht oder verneint wird. Wird die Rechtmäßigkeit einer Rechtsvorschrift verneint, so ist sie ungültig.<br />
Logischerweise muss diese Entscheidung ebenso abstrakt-generell sein, wie die Rechtsvorschrift<br />
selbst.<br />
Zu 7.:<br />
Satzungen sind abgeleitete Rechtsquellen, wenn sie von juristischen Personen des öffentlichen<br />
Rechts auf Grund einer ihnen vom Staat verliehenen eigenen Rechtsetzungsgewalt (Satzungsbefugnis,<br />
Autonomie) zur Regelung ihrer eigenen (also nicht unmittelbar staatlicher) Angelegenheiten<br />
erlassen werden. Die Satzung des Vereins „Westheimer Kicker e.V.“ ist keine Rechtsquelle, weil<br />
der Verein als juristische Person des Privatrechts kein Hoheitsträger ist.<br />
<strong>II</strong>.<br />
Die Gemeinsamkeiten von Satzungen und Verordnungen bestehen darin, dass es sich jeweils um<br />
sog. abgeleitete Rechtssätze handelt, die von Organen der Exekutive erlassen werden.<br />
Satzungen und Verordnungen unterscheiden sich wie folgt voneinander:<br />
Satzungen werden aufgrund einer allgemeinen eigenen Rechtssetzungsgewalt (Satzungsautonomie)<br />
von nichtstaatlichen Stellen erlassen. Durch Satzungen regeln juristische Personen, denen<br />
ein Selbstverwaltungsrecht zusteht, ihre eigenen Angelegenheiten.<br />
Verordnungen werden demgegenüber aufgrund einer speziellen gesetzlichen Ermächtigung (Delegation)<br />
erlassen. Durch Verordnungen werden nicht eigene, sondern staatliche Angelegenheiten<br />
geregelt.<br />
Seite 2 von 5
<strong>II</strong>I.<br />
Zu <strong>1.</strong>:<br />
Ein Rechtssatz liegt vor, wenn eine Regelung allgemeinverbindlich ist und abstrakt-generell, also<br />
für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen und Personen gilt. So verhält es sich bei § 823 Abs. 1<br />
BGB. Vollständig ist eine Norm, wenn sie eingeteilt ist in Tatbestand und Rechtsfolge. Der Tatbestand<br />
ist die (abstrakte) Beschreibung der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die<br />
Rechtsfolge eintritt. Die Rechtsfolge ist die (abstrakte) Beschreibung dessen, was eintreten muss<br />
oder eintreten kann, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind. § 823 Abs. 1 BGB ist<br />
eine vollständige Rechtsvorschrift, denn wer widerrechtlich eines der in § 823 Abs. 1 BGB genannten<br />
Rechtsgüter eines anderen vorsätzlich oder fahrlässig verletzt (Tatbestand), ist dem anderen<br />
zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet (Rechtsfolge).<br />
Zu 2.:<br />
Manche Rechtssätze sind unabdingbar (zwingend), andere Rechtssätze lassen sich durch eine<br />
abweichende vertragliche Vereinbarung der Beteiligten „beiseite schieben“ (nachgiebiges Recht).<br />
Zwingendes Recht gilt stets dann, wenn der Schutz des Einzelnen oder wenn Gründe des öffentlichen<br />
Interesses die Beachtung bestimmter Rechtsvorschriften fordern.<br />
§ 823 Abs. 1 BGB ist dem nachgiebigen Recht (und nicht dem zwingenden Recht) zuzuordnen.<br />
Eine Abänderung durch die Beteiligten ist zulässig. Der Schutz des Einzelnen sowie Gründe des<br />
öffentlichen Interesses erfordern die Beachtung dieser Rechtsvorschrift entgegen dem Parteiwillen<br />
nicht.<br />
Zu 3.:<br />
Der Bearbeiter hat den Sachverhalt nicht unter die anzuwendende Rechtsvorschrift subsumiert.<br />
Unter Subsumtion versteht man die Unterordnung eines Sachverhalts unter den gesetzlichen Tatbestand<br />
einer Rechtsnorm mit dem <strong>Ziel</strong>, die Rechtsfolge festzustellen. Dazu ist der Tatbestand in<br />
seine einzelnen Merkmale (Tatbestandsmerkmale) zu zerlegen und dann festzustellen, ob sie für<br />
den Sachverhalt zutreffen. Der Bearbeiter der Klausur hat die einschlägige Norm lediglich (unvollständig)<br />
erwähnt und die Rechtsfolge angegeben. Es wäre aber seine Aufgabe gewesen, den<br />
Sachverhalt unter die einschlägige Norm unterzuordnen mit dem <strong>Ziel</strong>, die Rechtsfolge festzustellen.<br />
Zu 4.:<br />
Die Gemeinde Schlump könnte einen gesetzlichen Schadensersatzanspruch gegen Koller i.H.v.<br />
350 € wegen der beschädigten Türe nach § 823 Abs. 1 BGB haben.<br />
Dadurch dass Koller die Bürotüre zuschlug (haftungsbegründende Kausalität), ist eine Rechtsgutverletzung<br />
eingetreten, weil das Eigentum der Gemeinde, nämlich deren Bürotüre, beschädigt<br />
worden ist; der gläserne Türeinsatz ist in tausend Scherben zerbrochen. Dies geschah widerrechtlich,<br />
weil die (rechtmäßige) Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens natürlich keinen<br />
Rechtfertigungsgrund darstellt. Koller handelte auch fahrlässig, weil er die im Verkehr erforderliche<br />
Sorgfalt nicht beachtete (§ 276 Abs. 2 BGB), indem er die Türe mit zu großer Wucht zuschlug.<br />
Somit muss Koller der Gemeinde den daraus entstandenen Schaden, die Reparaturkosten i.H.v.<br />
350 € ersetzen (§§ 249 ff. BGB).<br />
Zu 5.:<br />
Die Streitigkeit über den Schadensersatzanspruch ist eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit die nach<br />
§ 13 GVG vor die ordentlichen Gerichte gehört. Bei einer Streitsumme von unter 350,- € ist nach<br />
§ 23 Nr. 1 GVG das Amtsgericht sachlich zuständig.<br />
Seite 3 von 5
IV.<br />
Recht im objektiven Sinn sind nicht nur ganze Gesetze, sondern auch dessen einzelne Vorschriften.<br />
Das subjektive Recht „entspringt“ dem objektiven Recht.<br />
Die Rechtsklarheit verlangt, dass Rechtsvorschriften möglichst klar und verständlich gefasst werden.<br />
Das Rückwirkungsverbot sichert, dass belastende Gesetze grundsätzlich nicht rückwirkend erlassen<br />
werden dürfen.<br />
Die ZPO ist Teil des öffentlichen Rechts.<br />
Das Strafrecht ist Teil des öffentlichen Rechts.<br />
Das BGB enthält weitgehend nachgiebiges Recht.<br />
§§ 104, 105 BGB sind zwingendes Recht.<br />
Kennzeichen des billigen Rechts sind unbestimmte Rechtsbegriffe.<br />
18. Lebensjahr“ ist ein bestimmter Rechtsbegriff.<br />
Vorrang des Gesetzes bedeutet „ kein Handeln gegen das Gesetz“.<br />
V.<br />
Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO vor dem Oberverwaltungsgericht<br />
(das nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 AGVwGO in Bayern die Bezeichnung „Bayerischer Verwaltungsgerichtshof“<br />
führt) können Satzungen, die nach den Vorschriften des BauGB erlassen worden sind,<br />
sowie Rechtsverordnungen auf Grund von § 246 Abs. 2 BauGB und andere im Range unter dem<br />
Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt, sein (vgl. § 47<br />
Abs. 1 VwGO, Art. 5 Satz 1 AGVwGO), bei deren Anwendung Streitigkeiten entstehen können, für<br />
die der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist (vgl. § 40 VwGO und den Passus „im Rahmen seiner<br />
Gerichtsbarkeit“ in § 47 Abs. 1 VwGO).<br />
Der Bebauungsplan der Gemeinde Schlump ist eine „Satzung, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches<br />
erlassen worden ist“ (vgl. § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO und § 10 BauGB); er kann folglich<br />
Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens sein.<br />
Bei dem von der Gemeinde Schlump erlassenen Verbot ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten<br />
handelt es sich um eine gemeindliche Verordnung im Sinne von Art. 14 BayImSchG. Solche Verordnungen<br />
sind Rechtsvorschriften im Range unter dem Landesgesetz (vgl. § 47 Abs. 1 Nr. 2<br />
VwGO), bei deren Anwendung Streitigkeiten entstehen können, für die der Verwaltungsrechtsweg<br />
gegeben ist. Da das Landesrecht dies nach Art. 5 Satz 1 AGVwGO auch so bestimmt, kann auch<br />
die Verordnung Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO sein.<br />
VI.<br />
Oft erweist sich die Subsumtion eines Sachverhaltes unter die einzelnen Tatbestandsmerkmale<br />
einer Rechtsnorm als schwierig. Dann muss das betreffende Tatbestandsmerkmal bzw. die Norm<br />
ausgelegt werden. <strong>Ziel</strong> der Auslegung ist, den Regelungsinhalt einer Norm, ihre Bedeutung und<br />
Reichweite zu ermitteln. Die teleologische Auslegung ermittelt den Inhalt einer Norm aus ihrem<br />
Sinn und Zweck.<br />
Eine Differenzierung zwischen Verordnungen und Satzungen macht hier keinen Sinn. Eine extensive<br />
Auslegung nach teleologischer Interpretation ergibt somit, dass Art. 98 Satz 4 BV - abweichend<br />
von seinem Wortlaut - nach seinem Sinn und Zweck auch Satzungen erfasst.<br />
Nach anderer Ansicht ist Art. 98 Satz 4 BV nach seinem eindeutigen Wortlaut nicht auslegungsfähig.<br />
Somit liegt eine Gesetzeslücke vor. Gesetzeslücken können u.a. durch Analogie ausgefüllt<br />
werden. Bei der Gesetzesanalogie wird eine Rechtsnorm auf einen ähnlichen, von der Rechtsnorm<br />
nicht erfassten Sachverhalt angewendet. Dabei wird die Rechtsfolge von einem im Gesetz geregelten<br />
Tatbestand auf einen im Gesetz nicht geregelten Tatbestand, der dem geregelten ähnlich<br />
ist, übertragen.<br />
Da die in Art. 98 Satz 4 BV nicht geregelte Satzung der Verordnung ähnlich ist, gilt Art. 98 Satz 4<br />
BV nach a.A. analog auch für Satzungen.<br />
Seite 4 von 5
V<strong>II</strong>.<br />
Bei der Frage der Rückwirkung ist zunächst zwischen begünstigenden und belastenden Rechtssätzen<br />
zu unterscheiden. Begünstigende Rechtssätze können grundsätzlich rückwirkend erlassen<br />
werden. Bei unechter Rückwirkung bzw. tatbestandlicher Anknüpfung (Einwirkung auf Tatbestände,<br />
die zwar aus der Vergangenheit kommen, aber noch nicht abgeschlossen sind) ist die Waagschale<br />
zugunsten des Gesetzgebers vorbelastet; sie ist somit grundsätzlich zulässig. Belastende<br />
Rechtssätze mit echter Rückwirkung (nachträgliches Einwirken auf Tatbestände, die bereits in der<br />
Vergangenheit abgeschlossen wurden) sind hingegen wegen Verstoßes gegen das aus dem<br />
Rechtsstaatsprinzip herzuleitende Gebot der Rechtssicherheit unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes<br />
grundsätzlich nichtig. Dieser Grundsatz gilt ausnahmslos im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2<br />
GG) und im Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 3 OWiG). Bei sonstigen belastenden Rechtssätzen ist<br />
eine echte Rückwirkung ausnahmsweise dann zulässig, wenn die Belastung für den Bürger voraussehbar<br />
war, die geltende Rechtslage unklar und verworren war, der Bürger sich nicht auf den<br />
von einer ungültigen Norm erzeugten Rechtsschein verlassen durfte, zwingende Gründe des Allgemeinwohls<br />
die Rückwirkung rechtfertigen oder die Belastung im Einzelnen unbedeutend ist.<br />
Die Gebührenbescheide für das abgenommene Wasser aus der gemeindlichen Versorgungsanlage<br />
enthalten eine sog. „echte“ Rückwirkung für die Zeit vom <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2009 bis 13.7.2009, weil für diese<br />
Zeit die Abgabensatzung nur die niedrigere Gebühr von <strong>1.</strong>40 € pro Kubikmeter verbrauchten Wassers<br />
vorsah. Die Rückwirkung ist hier jedoch zulässig, denn die nichtige Rechtsnorm (Abgabensatzung)<br />
wird durch eine gültige ersetzt. Das Vertrauen der Bürger ist in diesem Falle nicht geschützt,<br />
weil bereits 2008 eine – wenn auch nichtige – Satzung mit den erhöhten Gebühren vorhanden war,<br />
die Wasserabnehmer also mit der Erhöhung rechnen mussten.<br />
Seite 5 von 5