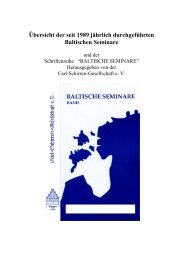Kathrin Laine Lehtma - Carl-Schirren-Gesellschaft
Kathrin Laine Lehtma - Carl-Schirren-Gesellschaft
Kathrin Laine Lehtma - Carl-Schirren-Gesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kathrin</strong> <strong>Laine</strong> <strong>Lehtma</strong><br />
Außenpolitische Handlungsoptionen<br />
der baltischen Staaten 1918-1940 1<br />
Geographisch zwischen dem Kriegsverlierer Deutschland und der<br />
revolutionären Sowjetunion gelegen, befanden sich die baltischen Staaten<br />
Estland, Lettland und Litauen nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund<br />
potentieller revisionistischer Zielsetzungen ihrer beiden großen Nachbarn,<br />
in einer sehr beunruhigenden sicherheitspolitischen Lage. Weil das primäre<br />
Ziel ihrer außenpolitischen Bemühungen in der Zwischenkriegszeit die<br />
Sicherung ihrer jungen nationalen Unabhängigkeit war, bedeutete<br />
Außenpolitik für sie größtenteils auch Sicherheitspolitik. Im Zentrum dieser<br />
Politik standen vor allem Bemühungen um eine völlige Integration in das<br />
internationale System und um den Erhalt von Sicherheitsgarantien 2 .<br />
Theoretisch besaßen sie vier sicherheitspolitische Möglichkeiten, ihren<br />
Handlungsspielraum zu vergrößern und damit ihre Souveränität zu sichern:<br />
erstens eine bilaterale Allianz mit einer Großmacht, zweitens eine Allianz<br />
untereinander und/oder mit ihren Nachbarn, drittens eine multilaterale<br />
Allianz mit einer bzw. mit mehreren Großmächten oder viertens eine Politik<br />
der neutralen Pufferstaaten unter dem Schutz des Völkerbundes 3 . Es gilt zu<br />
beachten, daß die drei Staaten bei der Entscheidung für eine der Optionen<br />
nicht auf geschichtliche Erfahrungen zurückgreifen konnten.<br />
In meiner Magisterarbeit habe ich den Zeitraum von 1920 bis 1940 in<br />
vier Phasen gegliedert: 1920 bis 1925, 1925 bis 1933, 1933 bis 1938 sowie<br />
1938 bis 1940. Die Zeit von 1918 bis 1920 wird als Umbruchphase<br />
betrachtet. Diese Einteilung erfolgte nicht willkürlich, sondern orientiert<br />
sich an den einschneidenden Veränderungen in der Weltpolitik, die an den<br />
Schnittstellen der einzelnen Phasen stattfanden und die immer auch<br />
Auswirkungen auf die baltischen Staaten hatten. Der chronologische<br />
Verlauf der Phasen läßt zudem die großen Zusammenhänge in der Europa-<br />
und Baltikumpolitik erkennen und ermöglicht eine bessere<br />
Vergleichsmöglichkeit mit den politischen Entwicklungen in anderen<br />
europäischen Staaten.<br />
1 Dieser Beitrag beruht auf der gleichnamigen Magisterarbeit (Münster 2006) sowie<br />
auf dem leicht überarbeiteten Vortrag auf der 7. Konferenz für Baltische Studien in<br />
Europa (CBSE) 2007 am 10. Juni 2007 in Lüneburg.<br />
2 THOMAS SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten. Im Spannungsfeld<br />
zwischen Ost und West. Wiesbaden 2003, S. 39.<br />
3 Ebenda, S. 20.
Für die einzelnen Phasen sollen folgende Fragen beantwortet werden:<br />
Welche Option wurde aus welchem Grund gewählt und mit welchem Erfolg<br />
schließlich angewendet? Es soll festgestellt werden, ob und wodurch sich<br />
die einzelnen Phasen charakterisieren lassen.<br />
I. In der „windstillen Bucht“ 1920 bis 1925<br />
Für die Stabilisierung der außenpolitischen Situation der baltischen Staaten<br />
war einerseits das zeitweilige wirtschaftliche und politische Interesse der<br />
Westmächte Großbritannien und Frankreich am Erhalt der baltischen<br />
Eigenstaatlichkeit und andererseits die anfängliche Zurückhaltung sowohl<br />
der deutschen als auch der sowjetischen Politik von entscheidender<br />
Bedeutung 4 . Beides führte dazu, daß sich die baltischen Staaten anfangs<br />
noch in der so genannten „windstillen Bucht der großen Politik“ befanden 5 .<br />
Abhängig war diese Stabilisierung vom relativen Gleichgewicht zwischen<br />
den regionalen Mächten Polen, Deutschland und der Sowjetunion 6 . Esten,<br />
Letten und Litauer nutzten diese „Windstille“, um sich dem Schutz ihrer<br />
Selbständigkeit zu widmen.<br />
Die Westmächte und der Völkerbund<br />
Die Westmächte unterstützten die Eigenstaatlichkeit der baltischen sowie<br />
weiterer zentral- und osteuropäischer Staaten entlang der sowjetischen<br />
Grenze als Elemente der hauptsächlich nach französischen Vorstellungen<br />
gebildeten „barrière de l´est“ oder auch dem „cordon sanitaire“ – einem<br />
Gürtel von Pufferstaaten und zugleich ein klassisches Instrument des<br />
Staatensystems zur Stabilisierung von Konfliktzonen seit dem 17.<br />
Jahrhundert 7 , der die Sowjetunion vom übrigen Europa trennen und als<br />
4 MICHAEL GARLEFF: Die baltischen Länder. Estland, Lettland, Litauen vom Mittelalter<br />
bis zur Gegenwart. Regensburg 2001, S. 146.<br />
5 Georg von Rauch bezeichnet die gesamte Zeit von 1920 bis 1936 als „windstille<br />
Bucht“; GEORG VON RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten. 3. Aufl. München<br />
1990, S. 184.<br />
6 GERT VON PISTOHLKORS: Der Hitler-Stalin-Pakt und die Baltischen Staaten. In:<br />
ERWIN OBERLÄNDER (Hrsg.): Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas?<br />
Frankfurt am Main 1989, S. 75-97, hier S. 82.<br />
7 PETER KRÜGER: Locarno und die Frage eines europäischen Sicherheitssystems<br />
unter besonderer Berücksichtigung Ostmitteleuropas. In: RALPH SCHATTKOWSKY<br />
(Hrsg.): Locarno und Osteuropa. Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in<br />
den 20er Jahren. Marburg 1994 (Marburger Studien zur neueren Geschichte, Bd. 5),<br />
S. 9-27, hier S. 15 f.
Barriere zwischen Deutschland und der Sowjetunion dienen sollte 8 .<br />
Großbritannien hatte zudem, mehr noch als Frankreich, großes Gewicht als<br />
Handelspartner – seine Rolle als „Schutzmacht“ nahm jedoch rasch ab 9 .<br />
Britische Politiker zweifelten immer wieder an der Lebensfähigkeit der<br />
baltischen Staaten und rechneten fest damit, daß sie früher oder später<br />
wieder dem Herrschaftsbereich einer Großmacht angehören würden 10 .<br />
London war nicht wie erwartet ein uneigennütziger Anwalt der<br />
europäischen Kleinstaaten, sondern von seiner günstigen geographischen<br />
Lage her nicht geneigt, sich in internationale Streitigkeiten verwickeln zu<br />
lassen. Während sich die baltischen Staaten bei Frankreich, das nicht nur<br />
traditionell ein enger Bundesgenosse des Zarenreiches gewesen war,<br />
sondern sich auch relativ schnell mit Polen verbündete, das den einstigen<br />
Bündnispartner im Osten ersetzen sollte, von Anfang an weniger Illusionen<br />
machten, ist die außenpolitische Orientierung auf Großbritannien als grobe<br />
Fehleinschätzung zu werten 11 .<br />
Deutschland und die Sowjetunion<br />
Da die baltischen Staaten eine Anlehnung an Deutschland oder die Sowjetunion<br />
als mit zu großen Gefahren für ihre Eigenstaatlichkeit verbunden<br />
sahen, stand diese Option im Grunde von vornherein nicht zur Diskussion.<br />
Zwischen 1920 und 1925 achteten die beiden Großmächte aber alles in<br />
allem die Eigenstaatlichkeit der Ostseerepubliken – zudem war die<br />
Weimarer Republik für den gesamten Außenhandel der baltischen Staaten<br />
von noch größerer Bedeutung als die Westmächte. Bereits 1923 hatte sie<br />
mit Estland und Lettland provisorische Handelsverträge geschlossen und<br />
1929 dann auch mit Litauen 12 .<br />
Kooperationsbemühungen im baltischen Raum<br />
Der Zeitraum von 1920 bis 1925 ist aber vor allem durch die<br />
Kooperationsbemühungen der drei baltischen Staaten mit ihren Nachbarn<br />
Polen und Finnland charakterisiert. Die Konferenzen jener Jahre kreisten<br />
8 ANDREAS LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten in der<br />
Zwischenkriegsphase und seit der Unabhängigkeit von 1991. Ein Vergleich. Berlin<br />
1997 (BIAB-Berichte 13), S. 15.<br />
9 GARLEFF: Die baltischen Länder (wie Anm. 4), S. 146.<br />
10 SUSANNE NIES: Lettland in der internationalen Politik. Aspekte seiner<br />
Außenpolitik 1918-95. Münster 1995 (Bonner Beiträge zur Politikwissenschaft, Bd.<br />
6), S. 159.<br />
11 SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 41 sowie<br />
LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 8), S. 23.<br />
12 Ebenda, S. 42.
hauptsächlich um die Bildung entweder einer großen regionalen Allianz aus<br />
den eben genannten fünf Staaten oder einer kleinen regionalen Allianz<br />
bestehend aus Estland, Lettland und Litauen.<br />
Kurz gefaßt scheiterte die Bildung einer großen regionalen Allianz<br />
allerdings durch den litauisch-polnischen Territorialkonflikt um die seit<br />
1920 von Polen okkupierte litauische Hauptstadt Vilnius, der ein Bündnis<br />
unter Einschluß Litauens und Polens undenkbar machte 13 , und der ab 1922<br />
intensivierten skandinavischen Orientierung Finnlands, das sich nicht mehr<br />
enger mit den als schwächer angesehen und mit eigenen Problemen<br />
belasteten anderen Randstaaten verbinden wollte und das ein Bündnis mit<br />
den baltischen Staaten sowie mit einer möglichen polnischen Führung –<br />
Polen bemühte sich als dominante Groß- und Hegemonialmacht in<br />
Osteuropa aufzutreten – zunehmend als Unruheherd für das<br />
Gleichgewichtssystem betrachtete 14 .<br />
Aber auch die Bildung einer kleinen regionalen Allianz konnte nicht<br />
umgesetzt werden, da Estland und Lettland nicht in die Probleme Litauens<br />
mit Polen und Deutschland – 1923 annektierte Litauen das sowohl von<br />
Deutschen als auch von Litauern beanspruchte Memelgebiet – verwickelt<br />
werden wollten 15 . Nur Estland und Lettland schlossen am 1. November<br />
1923 ein Bündnis 16 . Es ist von da an zum festen Kern aller<br />
Randstaatenkombinationen geworden 17 – auch wenn die historische<br />
Forschung ihm lediglich eine geringe Bedeutung beimißt.<br />
II. Stabilisierung der politischen Verhältnisse 1925 bis 1933<br />
Nachdem Deutschland 1925 durch die Locarno-Gespräche seine Isolation<br />
durchbrochen hatte, 1926 in den Völkerbund eingetreten war und sich 1928<br />
am Briand-Kellogg-Pakt beteiligt hatte, verbesserten sich die deutsch-<br />
13 RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 108.<br />
14 GARLEFF: Die baltischen Länder (wie Anm. 4), S. 152.<br />
15 PEETER VARES: The Baltic security failed. In: DERS. (Hrsg.): Estonia and the<br />
European Union. In Search of Security. Tallinn 1999, S. 7-13, hier S. 7.<br />
16 Die sechs Verträge des Bündnisses bestanden aus folgenden Abkommen: 1.<br />
Vertrag über die Beilegung der Grenzstreitigkeiten (diese Grenzstreitigkeiten<br />
betrafen einerseits die Grenzstadt Walk, andererseits aber auch die Insel Runö. Sie<br />
konnten erst von einer Kommission unter britischem Vorsitz beigelegt werden), 2.<br />
Regelungen der finanziellen Verpflichtungen der Kriegszeit, 3. provisorischer<br />
Handelsvertrag mit Zollunion, 4. Verteidigungsbündnis, 5. Konvention über die<br />
Hafensteuer, 6. Abkommen über die Vereinheitlichung des Rechtswesens; vgl. NIES:<br />
Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 132.<br />
17 RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 111.
altischen Beziehungen. Zudem schien es für die baltischen Staaten<br />
kurzfristig sogar möglich zu sein, auch mit der Sowjetunion friedliche<br />
Beziehungen zu entwickeln, da mit der „Erklärung des Sozialismus in<br />
einem Land“ 1925 eine Wende in der sowjetischen Politik erfolgte. Sie<br />
verabschiedete sich dadurch offiziell von ihren weltrevolutionären Plänen<br />
und betrieb danach eine aktivere Politik gegenüber den Randstaaten 18 .<br />
Durch die deutsche und sowjetische außenpolitische Kursänderung<br />
verlor die Bildung einer kleinen oder großen regionalen Allianz gegen die<br />
beiden Staaten allerdings die Basis und stattdessen traten zwischen 1925<br />
und 1933 Garantien dieser Großmächte in den Vordergrund – in diesem<br />
Kontext muß das Augenmerk auf Moskau gerichtet werden, da Berlin<br />
entsprechende Angebote ablehnte und auch keine eigenen Entwürfe<br />
entwickelte.<br />
Eine sowjetische Initiative: das „Litvinov-Protokoll“<br />
In die Jahre 1925 bis 1933 fallen daher vornehmlich verschiedene<br />
sowjetische diplomatische Offensiven und Angebote an die baltischen<br />
Staaten – vor allem Nichtangriffspakte, die zweifelsohne die Friedensliebe<br />
des Kreml unterstreichen sollten 19 , wurden das zentrale Mittel sowjetischer<br />
Sicherheitspolitik in Ostmitteleuropa 20 . In dieser Zeit schloß die<br />
Sowjetunion mit den meisten ihrer westlichen Nachbarn bilaterale<br />
Wirtschaftsverträge und Nichtangriffspakte ab – so schon 1926 mit Litauen<br />
und 1932 dann auch mit Lettland und Estland, die aber bereits 1927 und<br />
1929 Handelsabkommen mit der Sowjetunion geschlossen hatten 21 .<br />
Erst viel später, am 7. Juni 1939, schlossen Estland und Lettland Nichtangriffspakte<br />
auch mit Deutschland ab – allerdings konnten die zweiseitigen<br />
Abkommen keine reale Unterstützung ihrer Selbständigkeit leisten. Eher<br />
waren die nur wenige Woche vor der Auslieferung der beiden Staaten an die<br />
Sowjetunion getätigten Abschlüsse nichts anderes als ein<br />
Täuschungsmanöver über die wahren Absichten Hitlers 22 .<br />
Eines der Hauptziele der Sowjetunion in der Zwischenkriegszeit war die<br />
Verhinderung eines Zusammenschlusses der Randstaaten an ihrer<br />
18 SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 43.<br />
19 RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 167.<br />
20 ROLF AHMANN: Sicherheitsprobleme Ostmitteleuropas nach Locarno 1926 bis<br />
1936. In: RALPH SCHATTKOWSKY (Hrsg.): Locarno und Osteuropa. Fragen eines<br />
europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren. Marburg 1994 (Marburger<br />
Studien zur neueren Geschichte, Bd. 5), S. 183-200, hier S. 192.<br />
21 KEVIN O´ CONNOR: The History of the Baltic States. London 2003, S. 107.<br />
22 GARLEFF: Die baltischen Länder (wie Anm. 4), S. 158.
westlichen Grenze 23 . Zwischen 1925 und 1933 bemühte sich Moskau, die<br />
osteuropäischen Staaten in ein Vertragssystem einzubinden, um einer<br />
einheitlichen antisowjetischen Blockbildung entgegenzuwirken 24 und um<br />
eine internationale Isolierung zu umgehen 25 .<br />
Zu diesem Zweck konnte sie am 9. Februar 1929 das so genannte<br />
„Litvinov-Protokoll“, die osteuropäische Version des Briand-Kellogg-<br />
Paktes, unter den baltischen Staaten, Polen und Rumänien durchsetzen 26 .<br />
Die baltischen Staaten gaben ihre bisherige Zurückhaltung gegenüber<br />
vertraglichen Angeboten aus Moskau 1929 auf, weil ihnen die Weltlage nun<br />
sicherer als zuvor erschien und ihre Befürchtungen, durch Vereinbarungen<br />
mit ihrem größeren östlichen Nachbarn auch gleichzeitig in seinen Sog zu<br />
geraten, zunächst in den Hintergrund getreten waren 27 . Für die baltischen<br />
Staaten war das Protokoll neben den Garantien des Völkerbundes die zweite<br />
internationale Sicherheitsgarantie 28 .<br />
Allerdings muß hier im Auge behalten werden, daß die Sowjetunion<br />
bereits in den Jahren von 1929 bis 1932, also in der Zeit, in der sie die<br />
Nichtangriffspakte und das Litvinov-Protokoll abschloß, angefangen hatte,<br />
ihre taktische Position an der estnischen und lettischen Grenze durch den<br />
Ausbau von Stich- und Grenzbahnen und die Anlage von Stützpunkten,<br />
Flugplätzen und Artilleriestellungen zu sichern 29 .<br />
Aktivitäten im Völkerbund<br />
Schon während der Jahre 1920 bis 1925 nahm der Völkerbund eine zentrale<br />
Rolle für die drei Ostseerepubliken ein. Hauptsächlich aber stützten sich die<br />
baltischen Staaten in der Zeit von 1925 bis 1933 auf den Völkerbund. Von<br />
einer baltischen Gemeinschaftsarbeit im Völkerbund kann in diesem<br />
Zeitraum aber keineswegs gesprochen werden: Im Jahr 1925 begann<br />
23<br />
MAGNUS ILMJÄRV: Silent Submission. Formation of foreign policy of Estonia,<br />
Latvia and Lithuania. Period from mid- 1920 -s to annexation in 1940. Stockholm<br />
2004 (Studia Baltica Stockholmiensia 24), S. 38.<br />
24<br />
RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 116.<br />
25<br />
LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 8), S. 29.<br />
26<br />
BOHDAN BASIL BUDUROWYCZ: Polish-Soviet Relations 1932-1939. New York<br />
u. a. 1963, S. 7.<br />
27<br />
RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 165.<br />
28<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 43. Hinter<br />
dem Litvinov-Protokoll stand die Initiative des stellvertretenden Außenkommissars<br />
Litvinov, der seit einiger Zeit für den erkrankten Volkskommissar Georgij<br />
Vasilievič Čičerin die Geschäfte führte; vgl. RAUCH: Geschichte der baltischen<br />
Staaten (wie Anm. 5), S. 164.<br />
29<br />
RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 185.
zwischen dem lettischen und dem estnischen Außenminister ein Wettstreit<br />
um die Zuteilung eines nichtständigen Sitzes im Völkerbundrat mit dem<br />
Resultat, daß keiner der beiden Staaten einen Sitz bekam. Damit war das<br />
Ziel, die baltischen Staaten international zu einem bedeutenden Faktor zu<br />
machen, an der Konkurrenz und Selbstgefälligkeit der Politiker<br />
gescheitert 30 .<br />
Die japanische Besetzung des Völkerbundmitgliedes Mandschurei am<br />
18. September 1931 kündigte allerdings bereits die zweite Wende in der<br />
Einstellung der baltischen Staaten zum Völkerbund an – sie offenbarte, daß<br />
der Völkerbund nicht in der Lage war, militärische Sicherheitsgarantien für<br />
die Eigenstaatlichkeit seiner Mitglieder zu geben 31 .<br />
III. Wachsende Spannungen in den Jahren 1933 bis 1938<br />
Eines der einschneidendsten Ereignisse im Zeitraum zwischen 1933 und<br />
1938 hinsichtlich der zukünftigen internationalen Entwicklung war der<br />
überraschende Abschluß des deutsch-polnischen Nichtangriffsvertrages<br />
oder auch Hitler-Piłsudski-Paktes am 26. Januar 1934, dem am 15.<br />
November 1933 ein deutsch-polnisches Gewaltverzichtkommuniqué<br />
vorausgegangen war 32 . Er beendete nicht nur die bekannte Konstellation der<br />
deutsch-sowjetischen Kooperation, sondern auch die traditionelle deutschpolnische<br />
Feindschaft 33 . Zudem wurde noch ein deutsch-polnischer<br />
Wirtschaftsvertrag mit Meistbegünstigungsklausel für Polen unterzeichnet,<br />
den die baltischen Staaten, die Tschechoslowakei, Frankreich, aber auch die<br />
Sowjetunion als neue Bedrohung empfanden 34 .<br />
Das sowjetisch-französische „Ostpakt-Projekt“<br />
Für den Zeitraum von 1933 bis 1938 sind hauptsächlich die<br />
unterschiedlichen sowjetischen Initiativen charakteristisch, um die baltische<br />
Eigenstaatlichkeit vor potentiellen, gegen die Sowjetunion gerichteten,<br />
30 NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 237.<br />
31 VAHUR MADE: Estonia and Security Matters in the League of Nations. In: PEETER<br />
VARES (Hrsg.): Estonia and the European Union. In Search of Security. Tallinn<br />
1999, S. 14-25, hier S. 14.<br />
32 ROLF AHMANN: Die baltischen Staaten zwischen Deutschland und der<br />
Sowjetunion 1933-39. Neutralität oder Allianz – zwei Wege zu ihrem Untergang?<br />
In: JOHN HIDEN / ALEKSANDER LOIT (Hrsg.): Contact or Isolation? Soviet-Western<br />
Relations in the Interwar Period. Stockholm 1991 (Studia Baltica Stockholmiensia,<br />
Bd. 8), S. 381-403, hier S. 383.<br />
33 NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 66.<br />
34 AHMANN: Sicherheitsprobleme (wie Anm. 20), hier S. 198.
deutschen Ambitionen zu bewahren 35 : Um eine deutsch-polnische<br />
Annäherung zu unterbinden, schlug die Sowjetunion der polnischen<br />
Regierung 1933 einen gemeinsamen Pakt vor – mußte allerdings feststellen,<br />
daß Polen für ein anti-deutsches Programm nicht zu gewinnen war. Nach<br />
der Devise „wenn Warschau nicht von Berlin abgewendet werden kann,<br />
kann Berlin vielleicht von Warschau abgewendet werden“ 36 schlug sie 1934<br />
der deutschen Regierung ein gemeinsames Protokoll vor – das ebenfalls<br />
abgelehnt wurde 37 .<br />
Nach Abschluß des deutsch-polnischen Nichtangriffsvertrages trat die<br />
Sowjetunion dann zusammen mit Frankreich, dessen Ostmitteleuropapolitik<br />
auf dem deutsch-polnischen Gegensatz basiert hatte 38 und der mit dem<br />
Hitler-Piłsudski-Pakt, welcher zugleich den polnischen<br />
Bündnisverpflichtungen mit Frankreich entgegen stand, der Boden entzogen<br />
worden war 39 , mit dem so genannten „Ostpakt“ hervor, um den deutschpolnischen<br />
Pakt in einem ganz Osteuropa umfassenden Paktsystem<br />
gewissermaßen untergehen zu lassen 40 . Es sollte ein kollektiver<br />
Nichtangriffs- und Beistandspakt zwischen der Sowjetunion, Polen, der<br />
Tschechoslowakei, den baltischen Staaten und Deutschland sein – ergänzt<br />
durch einen sowjetisch-französischen Vertrag. Das gesamte Vertragspaket<br />
war am Völkerbund orientiert, in den die Sowjetunion am 18. September<br />
1934 eintrat 41 . Allerdings stimmte allein die Tschechoslowakei dem Ostpakt<br />
eindeutig zu. Ein „Ost-Locarno“ war damit gescheitert 42 .<br />
Baltische Kooperationsbemühungen<br />
Zwischen 1933 und 1938 gab es außerdem viele verschiedene Ideen und<br />
Konzepte für eine Kooperation im Ostseeraum – der einzig verwirklichte<br />
Bündnisentwurf aber präsentierte sich in der so genannten „Baltischen<br />
Entente“. Am 17. Februar 1934 reagierten zunächst Estland und Lettland<br />
mit der Erneuerung und Erweiterung ihres Bündnisses von 1923 auf die<br />
35 SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 44 sowie<br />
NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 67.<br />
36 AIVARS STRANGA: Russian and Polish Policies in the Baltic States from 1933 to<br />
1935. In: TĀLAVS JUNDZIS: The Baltic States at Historical Crossroads. 2. Aufl. Riga<br />
2001, S. 381-404, hier S. 385.<br />
37 SEPPO MYLLYNIEMI: Die baltische Krise 1938-1941. Stuttgart 1979 (Schriftenreihe<br />
der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Nr. 38), S. 16 f.<br />
38 NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 117.<br />
39 LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 8), S. 23.<br />
40 RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 169.<br />
41 AHMANN: Sicherheitsprobleme (wie Anm. 20), hier S. 198.<br />
42 LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 8), S. 23.
deutsch-polnische Partnerschaft, doch schon am 12. September 1934<br />
schlossen die drei baltischen Staaten einen Konsultativpakt, der den<br />
litauisch-polnischen und litauisch-deutschen Territorialkonflikt<br />
ausklammerte 43 . Mit der Zeit zeigte sich allerdings, daß die „Baltische<br />
Entente“ die an sie gerichteten Erwartungen nicht erfüllen konnte – ihre<br />
Bedeutung wurde immer geringer 44 . Sie erzielte in den insgesamt elf<br />
gemeinsamen Konferenzen zwischen 1934 und 1939 wenig konkrete<br />
Ergebnisse und erwies sich vielmehr als ein unverbindliches<br />
Konsultationsforum 45 . In der gesamten Zeit des Bestehens der Baltischen<br />
Entente stattete kein baltischer Präsident einem anderen baltischen Staat<br />
einen Besuch ab – ein deutliches Zeichen dafür, wie wenig Bedeutung man<br />
einer Zusammenarbeit der baltischen Staaten im Grunde beimaß 46 . Letztlich<br />
litten sämtliche Kooperationsbemühungen der Balten darunter, daß die<br />
junge nationale Unabhängigkeit erheblich mehr geachtet wurde als die<br />
nachbarschaftliche Zusammenarbeit 47 . So reagierten auch Deutschland und<br />
die Sowjetunion sehr gelassen auf die Baltische Entente und maßen dem<br />
Zusammenschluß der drei Kleinstaaten keine größere Bedeutung bei 48 .<br />
Zudem schlugen auch Estland und Lettland 1934 den Weg ein, den<br />
Litauen bereits 1926 gegangen war. Doch durch die Errichtung der<br />
autoritären Regime verloren die baltischen Staaten nach und nach ihr<br />
Prestige in der internationalen Arena 49 und die Sympathien seitens der<br />
demokratischen Staaten: In Großbritannien wurde der Orientierungswechsel<br />
43<br />
ROLF AHMANN: Die baltischen Staaten zwischen Deutschland und der<br />
Sowjetunion (wie Anm. 32), S. 383. Im Februar vereinbarten die drei Staaten: 1. auf<br />
internationalen Konferenzen geschlossen zu agieren, 2. zu diesem Zweck<br />
gemeinsame Vertreter zu entsenden, 3. regelmäßige Außenministerkonferenzen<br />
abzuhalten, 4. zur Koordinierung der gesetzgeberischen, politischen und<br />
wirtschaftlichen Aktivitäten eine gemischte Kommission einzusetzen sowie 5. die<br />
gegenseitige Unterstützung in allen internationalen Fragen. Im September fand dann<br />
die erste gesamtbaltische Außenministerkonferenz statt. Ein 1935 errichtetes<br />
gemeinsames Büro sollte die Annäherung der baltischen Staaten intensivieren – es<br />
befaßte sich mit der Ausarbeitung von gemeinsamen Plänen für kulturelle und<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Veranstaltung von Kongressen und<br />
Konferenzen; vgl. RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 173 f.<br />
44<br />
GARLEFF: Die baltischen Länder (wie Anm. 4), S. 155.<br />
45<br />
Zum Verlauf der Konferenzen siehe: NIES: Lettland in der internationalen Politik<br />
(wie Anm. 10), S. 149-156.<br />
46<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 45.<br />
47<br />
GARLEFF: Die baltischen Länder (wie Anm. 4), S. 156.<br />
48<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 45 f.<br />
49<br />
VARES: The Baltic security failed (wie Anm. 15), S. 12.
z. B. mit Unmut registriert 50 , und auch das Interesse der nordischen Länder<br />
am Baltikum wurde durch die Errichtung der Präsidialdiktaturen weiter<br />
vermindert 51 . Eine positive defensive Anpassung an den als Verbündeten<br />
angesehenen Westen durch eine Demokratisierung der Regime erfolgte<br />
nicht. Wohl gab es Versuche aktiver Diplomatie, wie z. B. Lettlands starkes<br />
Engagement im Völkerbund, die aber als Ausnahmen anzusehen sind. Dies<br />
zeigte sich beispielsweise daran, daß Ulmanis, der diktatorisch regierende<br />
Präsident Lettlands, es ablehnte, Staatsbesuche im Ausland zu machen 52 .<br />
Zum Völkerbund<br />
Am Beispiel der italienischen Besetzung des Völkerbundmitgliedes<br />
Abessinien am 3. Oktober 1935 zeigte sich außerdem erneut die<br />
Unfähigkeit des Völkerbundes, für die Eigenstaatlichkeit seiner Mitglieder<br />
einzutreten – die Westmächte ließen die Annexion untätig zu. Letztlich<br />
blieb der Völkerbund als Akteur in der baltischen Region<br />
sicherheitspolitisch bedeutungslos 53 .<br />
Dennoch verpflichteten sich die baltischen Staaten bis 1938 einer<br />
Politik, in deren Zentrum der Völkerbund stand 54 . Die lettische Regierung<br />
war im Völkerbund z. B. besonders aktiv und wurde nach jahrelangen<br />
vergeblichen Anstrengungen am 8. Oktober 1936 schließlich als Vertreter<br />
für das gesamte Baltikum in den Völkerbundrat gewählt. Dieser Erfolg<br />
bedeutete für die baltischen Staaten wieder einen Zugewinn an Prestige und<br />
die internationale Anerkennung der neuen Gruppierung 55 .<br />
IV. Die Krisenjahre 1938 bis 1940<br />
„You must take a good look at reality and understand that in the future<br />
small nations will have to disappear […].“ 56<br />
50<br />
SERAINA GILLY: Der Nationalstaat im Wandel. Estland im 20. Jahrhundert. Bern<br />
u. a. 2002, S. 156.<br />
51<br />
KARLIS KANGERIS: Das Baltikum im Rahmen der schwedisch-sowjetischen<br />
Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. In: JOHN HIDEN / ALEKSANDER LOIT<br />
(Hrsg.): Contact or Isolation? Soviet-Western Relations in the Interwar Period.<br />
Stockholm 1991 (Studia Baltica Stockholmiensia, Bd. 8), S. 351-371, hier S. 359 f.,<br />
366.<br />
52<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 54.<br />
53<br />
LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 8), S. 25.<br />
54<br />
NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 10), S. 67.<br />
55<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 1), S. 40.<br />
56<br />
So der sowjetische Außenminister Molotov 1940 im Zusammentreffen mit dem<br />
litauischen Schriftsteller Vincas Krėvė-Mickevičius, der nach der Zukunft des
Dieses Zitat verdeutlicht die ausweglose Situation, in der sich Estland,<br />
Lettland und Litauen 1940 befanden.<br />
War der Zeitraum von 1933 bis 1938 bereits durch wachsende<br />
Spannungen gekennzeichnet, so wird spätestens in den Jahren 1938 bis<br />
1940 deutlich, daß sich die baltischen Staaten den internationalen<br />
Spannungen insgesamt und besonders den regionalen Spannungen nicht<br />
entziehen konnten 57 . Mehr und mehr waren sie den Ambitionen ihrer beiden<br />
großen Nachbarn ausgeliefert 58 . In der Erwartung, ihre Eigenstaatlichkeit<br />
im deutsch-sowjetischen Spannungsfeld erhalten zu können, bemühten sich<br />
die baltischen Staaten im Zeitraum von 1938 bis 1940 vornehmlich um eine<br />
Politik der strikten Neutralität und der gutnachbarlichen Beziehungen zu<br />
den beiden Großmächten 59 .<br />
Baltische Neutralitätserklärungen<br />
1938/39 erklärten die baltischen Staaten die Neutralität offiziell zum<br />
sicherheitspolitischen Konzept, das in allen drei Staaten gesetzlich<br />
festgeschrieben wurde: Am 3. Dezember 1938 wurden in Estland, am 21.<br />
Dezember 1938 in Lettland und am 25. Januar 1939 in Litauen<br />
Neutralitätsgesetze mit gleichem Wortlaut erlassen 60 . Allerdings sprach die<br />
strategische Bedeutung des Baltikums für die benachbarten Großmächte<br />
und die große militärische Schwäche der baltischen Staaten gegen eine<br />
aussichtsreiche Neutralität. Den Großmächten erschien das Baltikum<br />
vielmehr als ein militärisches Vakuum, das allzeit von einem rivalisierenden<br />
Staat besetzt werden konnte 61 . Mittlerweile hält die Mehrheit der heutigen<br />
baltischen Politiker und Historiker die Wahl der strikten Neutralität für eine<br />
Fehlentscheidung 62 .<br />
Auf einer Völkerbundsitzung im Spätsommer 1938 verkündeten die drei<br />
baltischen Außenminister zudem ihre Übereinkunft, daß der Truppentransit<br />
auf der Basis des Artikel 16 des Völkerbundstatuts, d. h. das Durchmarschrecht<br />
für fremde Truppen, keineswegs zu gestatten sei, da sie<br />
befürchteten, daß sowjetische Truppen in einem derartigen Fall das<br />
Baltikum nicht mehr verlassen würden. Sie beraubten sich jedoch damit der<br />
unabhängigen Litauens fragte. Zitiert nach ROMUALD MISIUNAS / REIN TAAGEPERA:<br />
The Baltic States. Years of Dependence 1940-1990. Berkeley u. a. 1993, S. 25.<br />
57<br />
PISTOHLKORS: Der Hitler-Stalin-Pakt und die Baltischen Staaten (wie Anm. 6),<br />
hier S. 85.<br />
58<br />
GILLY: Der Nationalstaat im Wandel (wie Anm. 51), S. 155.<br />
59<br />
NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 9), S. 67.<br />
60<br />
LINDE: Die Außenpolitik der Baltischen Staaten (wie Anm. 7), S. 16.<br />
61<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 1), S. 53.<br />
62<br />
VARES: The Baltic security failed (wie Anm. 15), hier S. 13.
einzigen internationalen Garantie für die eigene Sicherheit und<br />
Souveränität. 63<br />
Zusammenarbeit in der Baltischen Entente<br />
Zwar gab es die Außenministertreffen der Baltischen Entente noch, aber<br />
ihre Ergebnisse beschränkten sich bis Anfang 1940 vornehmlich auf den<br />
Austausch von Informationen über die sowjetischen Truppenstützpunkte<br />
sowie auf eine Neutralitätserklärung zum sowjetisch-finnischen Winterkrieg<br />
1939/40 64 . Doch bereits ab Februar 1940 begann die im Rahmen der<br />
Bildung der Baltischen Entente entstandene „<strong>Gesellschaft</strong> zur<br />
Zusammenarbeit der baltischen Staaten“ in Anlehnung an ein 1918/19<br />
kurzfristig erschienenes Organ eine dreisprachige periodische Zeitschrift zu<br />
publizieren – die „Revue Baltique“ –, um baltische Themen und<br />
Angelegenheiten im Ausland bekannt zu machen 65 . Nach dem Abschluß des<br />
finnisch-sowjetischen Friedensvertrages am 12. März 1940, der den<br />
Winterkrieg beendete und in den baltischen Staaten mit großer Genugtuung<br />
und Erleichterung aufgenommen wurde, beschlossen die baltischen<br />
Außenminister die Fortsetzung der Neutralitätspolitik und betonten<br />
schließlich auch den Wunsch nach einer engeren wirtschaftlichen und<br />
kulturellen Kooperation untereinander. Nach Georg von Rauch ist es eine<br />
der tragischen Ironien in der Geschichte des Baltikums, daß die 1923<br />
gegründete und 1934 erweiterte Baltische Entente erst im Winter 1939/40<br />
mit einer gezielten und intensiven Zusammenarbeit begann, weil die<br />
internationale Mächtekonstellation der Zwischenkriegszeit nie<br />
unvorteilhafter gewesen sei als zu jenem Zeitpunkt. Für eine baltische<br />
Kooperation, welche die baltischen Staaten vielleicht vor ihrem tragischen<br />
Schicksal bewahrt hätte, war es nun viel zu spät 66 .<br />
Die Situation 1939/40 bot den baltischen Staaten keine realistische<br />
außenpolitische Alternative mehr, die eine Okkupation und Annexion hätte<br />
verhindern können. Der Hitler-Stalin-Pakt verhinderte jegliche Chance,<br />
noch eine andere außenpolitische Option zu wählen 67 . Zusammen mit dem<br />
geheimen Zusatzprotokoll bildete er den negativen Höhepunkt der<br />
63<br />
NIES: Lettland in der internationalen Politik (wie Anm. 9), S. 80, 233.<br />
64<br />
Ebenda, S. 155.<br />
65<br />
RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 174 sowie GILLY: Der<br />
Nationalstaat im Wandel (wie Anm. 50), S. 159.<br />
66<br />
RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten (wie Anm. 5), S. 205.<br />
67<br />
TOIVO U. RAUN: Estonia and the Estonians. 2. Aufl. Stanford 2001, S. 125.
altischen Regionalgeschichte im gesamten Zeitraum von 1918 bis 1940 68 .<br />
Die Möglichkeit einer deutsch-sowjetischen Einigung auf ihre Kosten<br />
hatten die baltischen Entscheidungsträger nicht in die Überlegungen<br />
miteinbezogen 69 . Offiziell wurden Litauen am 3. August, Lettland am 5.<br />
August und Estland am 6. August 1940 als sozialistische Sowjetrepubliken<br />
in die Sowjetunion aufgenommen. Damit hatten Estland, Lettland und<br />
Litauen als unabhängige Staaten zu bestehen aufgehört. Die Sowjetunion<br />
hatte sich ihren Teil aus dem Hitler-Stalin-Pakt genommen 70 .<br />
Fazit<br />
Bis heute bestehen unter Historikern zwei unterschiedliche Auffassungen<br />
über die möglichen Überlebenschancen souveräner baltischer Staaten<br />
während der Zwischenkriegszeit. Während die einen vermuten, daß die<br />
baltischen Staaten durch die äußere Entwicklung irgendwann unweigerlich<br />
in die Einflußzone eines ihrer beiden großen Nachbarn geraten wären,<br />
vertreten andere die Ansicht, die baltischen Staaten hätten vereint eine<br />
wichtige Rolle bei der Bestimmung ihrer eigenen Zukunft spielen können<br />
und es sei überwiegend ihre eigene Unfähigkeit und der Mangel an<br />
Kooperation gewesen, die ihr Schicksal bestimmten 71 . Es fällt nicht leicht,<br />
in diesem recht spekulativen Diskurs einen eindeutigen Standpunkt zu<br />
beziehen. Sicherlich hatte die äußere internationale Entwicklung einen<br />
starken Einfluß auf die außenpolitische Situation der baltischen Staaten,<br />
doch meine Magisterarbeit zeigt auch, daß der Zeitraum von 1920 bis 1940<br />
neben außenpolitischen Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen vor<br />
allem durch mangelnde regionale Kooperation charakterisiert ist.<br />
Ausblick<br />
Nachdem sich die baltischen Staaten 1991 ihre Selbständigkeit erneut<br />
erkämpft hatten und Mitglieder der UNO geworden waren, strebten sie<br />
68<br />
PISTOHLKORS: Der Hitler-Stalin-Pakt und die Baltischen Staaten (wie Anm. 6),<br />
hier S. 75.<br />
69<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 54.<br />
70<br />
Ebenda, S. 53<br />
71<br />
RAUN: Estonia and the Estonians (wie Anm. 67), S. 123 f. Für ein Statement der<br />
„pessimistischen“ Schule siehe: ALEXANDER DALLIN: The Baltic States Between<br />
Nazi Germany and Soviet Russia. In: VYTAS STANLEY VARDYS / ROMUALD<br />
MISIUNAS (Hrsg.): The Baltic States in Peace and War 1917-1945. London u. a.<br />
1978, S. 97-109 und für eine „optimistische“ Sichtweise siehe: EDGAR ANDERSON:<br />
The Baltic Entente: Phantom or Reality? In: VYTAS STANLEY VARDYS / ROMUALD<br />
MISIUNAS (Hrsg.): The Baltic States in Peace and War 1917-1945. London u. a.<br />
1978,<br />
S. 126-135.
sofort die volle politische, wirtschaftliche und militärische Integration in<br />
westliche Strukturen an. Sie erreichten ihr Ziel „Westintegration“<br />
schließlich im Jahr 2004 mit der Aufnahme in NATO und EU – den<br />
wichtigsten internationalen Organisationen des Westens 72 .<br />
Bereits während des Kampfes um die Unabhängigkeit zwischen 1989 und<br />
1991 begann auch die innerbaltische und regionale Zusammenarbeit, von<br />
der heute viele Institutionen zeugen – so wurde als Institution für die Kooperation<br />
in der gesamten Ostseeregion z. B. 1992 der „Rat der<br />
Ostseestaaten“ (CBSS), auch Ostseerat genannt, gegründet 73 .<br />
Er hat eine Reihe von Instrumenten zur Verstärkung der<br />
Zusammenarbeit geschaffen, wie z.B. schon 1991, also noch vor der<br />
formellen Gründung des CBSS, die „Union der baltischen Städte“ (UBC).<br />
Der Sitz des Sekretariats ist in Danzig. Heute gehören dem<br />
Zusammenschluß von Städten rund um die Ostsee 107 Mitgliedsstädte aus<br />
zehn Nationen an 74 .<br />
So werden durch vielfältige persönliche Kontakte Brücken zwischen den<br />
Völkern entlang der Ostsee gebaut. Wie Wolfgang Froese in seiner<br />
„Geschichte der Ostsee“ schreibt, stehen die Chancen gut, daß sie dauerhaft<br />
friedlich miteinander auskommen werden, und die Hoffnung ist groß, daß<br />
die Ostsee auch zukünftig ein „Meer des Friedens bleibt“ 75 .<br />
72<br />
SCHMIDT: Die Außenpolitik der baltischen Staaten (wie Anm. 2), S. 130, 189.<br />
73<br />
Ebenda, S. 280.<br />
74<br />
Zu den Mitgliedsstaaten siehe: http://www.ubc.net/members/members.html<br />
(28.07.08)<br />
75<br />
WOLFGANG FROESE: Geschichte der Ostsee. Völker und Staaten am Baltischen<br />
Meer. Gernsbach 2002, S. 480.