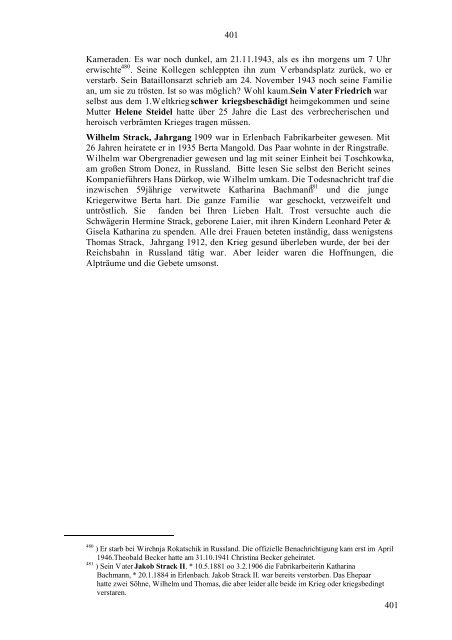1944 - 850 Jahre Erlenbach
1944 - 850 Jahre Erlenbach
1944 - 850 Jahre Erlenbach
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
401<br />
Kameraden. Es war noch dunkel, am 21.11.1943, als es ihn morgens um 7 Uhr<br />
erwischte 480 . Seine Kollegen schleppten ihn zum Verbandsplatz zurück, wo er<br />
verstarb. Sein Bataillonsarzt schrieb am 24. November 1943 noch seine Familie<br />
an, um sie zu trösten. Ist so was möglich? Wohl kaum. Sein Vater Friedrich war<br />
selbst aus dem 1.Weltkrieg schwer kriegsbeschädigt heimgekommen und seine<br />
Mutter Helene Steidel hatte über 25 <strong>Jahre</strong> die Last des verbrecherischen und<br />
heroisch verbrämten Krieges tragen müssen.<br />
Wilhelm Strack, Jahrgang 1909 war in <strong>Erlenbach</strong> Fabrikarbeiter gewesen. Mit<br />
26 <strong>Jahre</strong>n heiratete er in 1935 Berta Mangold. Das Paar wohnte in der Ringstraße.<br />
Wilhelm war Obergrenadier gewesen und lag mit seiner Einheit bei Toschkowka,<br />
am großen Strom Donez, in Russland. Bitte lesen Sie selbst den Bericht seines<br />
Kompanieführers Hans Dürkop, wie Wilhelm umkam. Die Todesnachricht traf die<br />
inzwischen 59jährige verwitwete Katharina Bachmann 481 und die junge<br />
Kriegerwitwe Berta hart. Die ganze Familie war geschockt, verzweifelt und<br />
untröstlich. Sie fanden bei Ihren Lieben Halt. Trost versuchte auch die<br />
Schwägerin Hermine Strack, geborene Laier, mit ihren Kindern Leonhard Peter &<br />
Gisela Katharina zu spenden. Alle drei Frauen beteten inständig, dass wenigstens<br />
Thomas Strack, Jahrgang 1912, den Krieg gesund überleben wurde, der bei der<br />
Reichsbahn in Russland tätig war. Aber leider waren die Hoffnungen, die<br />
Alpträume und die Gebete umsonst.<br />
480 ) Er starb bei Wirchnja Rokatschik in Russland. Die offizielle Benachrichtigung kam erst im April<br />
1946.Theobald Becker hatte am 31.10.1941 Christina Becker geheiratet.<br />
481 ) Sein Vater Jakob Strack II. * 10.5.1881 oo 3.2.1906 die Fabrikarbeiterin Katharina<br />
Bachmann, * 20.1.1884 in <strong>Erlenbach</strong>. Jakob Strack II. war bereits verstorben. Das Ehepaar<br />
hatte zwei Söhne, Wilhelm und Thomas, die aber leider alle beide im Krieg oder kriegsbedingt<br />
verstaren.<br />
401
402<br />
402<br />
<strong>1944</strong><br />
Stellvertretend für diese traurigen Benachrichtigungen drucken wir das Schreiben<br />
des Oberstabsarztes Dr. Sauer ab, das am 19.4.<strong>1944</strong> im Lazarett Lemberg<br />
verfasst wurde. Mit wenigen, aber klaren Worten beschreibt der Arzt die<br />
Verwundung, die Behandlung und den Tod des Theobald Reisel. So kann sich<br />
jeder ein gutes Bild machen. Doch lesen Sie selbst und lassen Sie die Worte auf<br />
sich wirken.<br />
Emil Heinrich war 1917 in <strong>Erlenbach</strong> auf die Welt gekommen. Seine Eltern<br />
waren Eugen Heinrich und Katharina Carra vom Münschschwanderhof. Emil<br />
erlernte das Schreinerhandwerk. Als Arbeitsloser kam er zum Arbeitsdienst und<br />
1938 ging er zur Wehrmacht. Von Anfang an war er im Kriegseinsatz. Zuerst in<br />
Polen und ab Juni 1941 in Russland. Seine letzte Nachricht war auf den 20.6.<strong>1944</strong><br />
datiert, wo er bei Rschew im Kampfeinsatz war.
403<br />
Otto Reich: Jahrgang 1913. Seine Eltern waren Otto Reich und Katharina<br />
Weißmann. Er heiratete Weihnachten 1943 in <strong>Erlenbach</strong> seine süße Elisabetha<br />
Barth. Das Familienglück war jedoch nur sehr kurz. Nach dem kurzen und<br />
glücklichen Hochzeitsurlaub ging es gleich wieder in das noch ruhige Frankreich,<br />
wo er glaubte, eine ruhige Kugel schieben zu dürfen. Nach der Landung in der<br />
Normandie ging es auch für ihn rund. Stress, Todesangst und Hoffnungslosigkeit<br />
begleiteten ihn. Nachts war er von schrecklichen Visionen verfolgt. Am 24.8.<strong>1944</strong><br />
erlöste ihn bei Montklimar eine Kugel vom Elend. Seine Frau und seine Eltern<br />
lebten 2 <strong>Jahre</strong> in Ungewissheit. Das Rote Kreuz überbrachte im März 1946 die<br />
niederschmetternde Todesnachricht.<br />
Walter Reisel, * 9.9.1914 war der Sohn des Heinrich Reisel und der Anna Maria<br />
Bachmann. Er war mit Charlotte Hermine Welker aus Otterberg verheiratet.<br />
Walter war bei Boulogne im Einsatz. Seit dem 16.8.<strong>1944</strong> wurde er vermisst. Das<br />
Photo ist eine schöne Erinnerung an einen ehrlichen und aufrechten Kerl.<br />
Arnold Mangold war 1919 in der Bergstraße auf die Welt gekommen. Die Eltern<br />
waren Johann * 28.8.1886 und Elisabetha Wilhelm * 6.5.1890 aus Dansenberg,<br />
die am 18.5.1912 in <strong>Erlenbach</strong> geheiratet hatten. Arnold hatte 10 Geschwister.<br />
Arnold war ein ausgezeichneter Sportler, der am 25.8.1937 in den<br />
Männersportverein Kaiserslautern eintrat. Arnold war Soldat und kämpfte in<br />
403
404<br />
404<br />
Russland. Die Eltern hörten seit <strong>1944</strong> nichts mehr von ihrem Sohn. Er ist<br />
vermisst. Leider waren die Eltern doppelt gestraft, denn ihr erster Sohn war 1942<br />
bereits in Russland gefallen. Ein hartes Schicksal traf auch diese Famile.<br />
Das Foto zeigt den gefallenen Fähnrich Ruprecht Schneider, der in Ingoldstadt<br />
feierlich begraben wurde. Die von den Nazis organisierte Beerdigung fiel pompös<br />
aus, konnte aber auch nicht die Tränen trocknen.<br />
1945
405<br />
Die Familie Strack traf das Unglück doppelt. Die Mutter Katharina Bachmann<br />
hatte nach der Todesnachricht ihres Sohnes Wilhelm Alpträume. Ständige Angst<br />
und Alpträume verfolgten sie. In Sorge um ihren zweiten Sohn Thomas, der<br />
1911/1912 auf die Welt gekommen war, vermochte sie kaum noch zu schlafen.<br />
Eigentlich hatte Thomas Glück im Unglück. Kurz nach Kriegsbeginn leistete er<br />
seinen Kriegsdienst bei der Deutschen Reichsbahn ab. So sah er als Eisenbahner<br />
viele Fratzen des schrecklichen und des teuflischen Krieges. Nach der<br />
Kapitulation schlug er sich in Zivil nach Westen durch. In Leverkusen bekam er<br />
von einem Verwandten ein Fahrrad. Er radelte die fast ebene Strecke den Rhein<br />
und daraufhin die Nahe entlang. Anstatt die hügelige Stecke durch den Hunsrück<br />
zu nehmen. Bei Kreuznach nahmen ihn die Amerikaner gefangen und sperrten ihn<br />
ihr gefürchtetes Open Air Camp Bretzenheim 482 ein. Dass er dies ohne<br />
Lungenentzündung überlebte, war schon ein kleines Wunder. Aber er holte sich<br />
dort das tödliche Fleckfieber. Zwar wurde er am 2. Juni 1945 aus der<br />
Gefangenschaft entlassen, aber er starb am 3.7.1945 an Typhus in Kaiserslautern.<br />
Herbert Thines †<br />
482 ) Im Hungerlager Bretzenheim war auch der <strong>Erlenbach</strong>er Franz Steidel, * 14.4.1902<br />
405
406<br />
406<br />
Herbert, * Ende 1927 wurde mit 17 <strong>Jahre</strong>n eingezogen. Er fiel am 3. Jan. 1945,<br />
noch keine 18 <strong>Jahre</strong> alt, bei Beffe-Laroche im Belgisch/ Luxemburgischen<br />
Grenzgebiet. Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner erhielten die Eltern, der<br />
Maurer Heinrich Thines und seine Ehefrau, die Katharina Guckenbiehl, die<br />
traurige Todesnachricht.<br />
Gefallene FCE - Mitglieder<br />
waren:<br />
Ernst Barth, Theobald Barth, Willi Haffner, Heinrich Herzhauser, Willi Korn,<br />
Arnold Korn, Arthur Martin, Ludwig Rössner, Heinrich Schmidt, Leonhard<br />
Schmitt, Paul Schneider, Karl Trautwein jun. und Alfred Wissmann. Der FCE<br />
gedachte ihnen anlässlich seines 20jährigen Jubiläums im Jahr 1951.
407<br />
11.11. 19. März 1945 war Kriegsende in <strong>Erlenbach</strong><br />
<strong>1944</strong>: Die alliierte Luftflotte bombardierte Kaiserslautern und Morlautern. Etliche<br />
Maschinen kamen vom Hagelgrund und flogen in Richtung Gersweilerkopf.<br />
Hatten sie den Gersweilerhof im Visier? Wir wissen es nicht! Etliche Bomben<br />
fielen in die Brunnenwiese (unterhalb der Pumpstation) und sechs in die<br />
Lochwiesen. Die Grundstücksbesitzer mussten jahrelang noch die kreisrunden<br />
Bombenlöcher füllen. Fielen in die Lochwiesen Brandbomben? Dies könnte wohl<br />
sein, denn an vielen Stellen wuchert noch heute Unkraut, das sich durch gar nichts<br />
vertreiben lässt.<br />
Die schnellen Jagdbomber flogen im Tiefflug über das Land und schossen auf<br />
alles, was sich im Tageslicht bewegte. Weder Vieh, noch Menschen waren vor<br />
ihnen sicher. Beerdigungen mussten im Dämmerlicht früh morgens vollzogen<br />
werden. Aber dieser Terror schweißte die Bevölkerung zusammen. Dies<br />
demonstrierte aber eindrucksvoll, sogar dem Dümmsten, dass die Wehrmacht<br />
diesen Krieg verloren hatte.<br />
Der Volkssturm <strong>Erlenbach</strong> unter Julius Speier hatte <strong>Erlenbach</strong> durch<br />
wochenlange Schufterei in einen seiner Meinung nach exzellenten<br />
Verteidigungszustand gebracht. Schützenlöcher waren ausgehoben, Unterstände<br />
gebaut und MG Nester vorbereitet worden. Dies war gut für die NS Seele,<br />
militärisch war es aber vollkommen sinnlos.<br />
1945, 19. März Zur Vorbereitung des alliierten Einmarsches waren Tiefflieger<br />
unterwegs gewesen. Sie hatten auf alles geschossen, was sich bewegt hatte. Der<br />
Widerstand der Wehrmacht war nur noch gering. Einige Wehrmachtsangehörige<br />
hatten sich da und dort in den sicheren Hinterhalt gelegt, um auf vorrückende<br />
amerikanische Soldaten zu schießen. Dies machte die alliierten Soldaten sehr<br />
misstrauisch. Vorsichtig und bei Gefahr gingen sie logischerweise jedem eigenen<br />
Risiko aus dem Weg. Gnadenlos erschossen sie jeden, der sich in den Weg stellte.<br />
Sechzehn deutsche Soldaten sollten die Festung <strong>Erlenbach</strong> verteidigen. Die<br />
Soldatengruppe hatte die Ortseingänge mit Panzersperren verriegelt, wie wenn sie<br />
damit die schweren Panzer hätten aufhalten können. Die alten Wehrwölfe hatten<br />
bereits um <strong>Erlenbach</strong> herum Schützenlöcher gegraben, in die sich die deutschen<br />
Soldaten hätten kurzfristig rein ducken können. Die meisten hatten sich jedoch im<br />
Buchwald in Erdlöchern versteckt. Jeder von ihnen hatte noch gerade fünf Schuss<br />
Munition bei sich. Auf sinnlosen Befehl hin harrten vier Mann nervös und unruhig<br />
am Ortseingang in Richtung Turnerheim auf den Feind. Was konnten sie schon<br />
ausrichten? Der Obergefreite Franz Lang war nervös und er steckte sich an seinem<br />
LKW eine selbst gedrehte Zigarette an. Er ging unruhig auf und ab. Der<br />
Transporter war wegen Benzinmangels dort stehen geblieben. Plötzlich war ein<br />
Motorengeräusch zu vernehmen und über den Osterberg raste ein US Tiefflieger<br />
auf ihn zu. Starr vor Schreck, war er unfähig zu handeln. Der Pilot zersägte ihn mit<br />
seinem MG. Der LKW ging in Flammen auf und brannte vollkommen aus. Seine<br />
Kameraden sahen die Sinnlosigkeit einer Verteidigung ein und suchten ihr Heil in<br />
der Flucht. Sie warfen alles weg, was sie nicht gebrauchen konnten. Irgendeiner<br />
warf selbst im Buchwald die Wehrpässe der im Kampf um Köln gefallenen Freunde<br />
weg, die er eigentlich persönlich den Witwen aushändigen wollte.<br />
407
408<br />
408<br />
Überall, so auch in <strong>Erlenbach</strong>, hatte sich die Bevölkerung in ihren sicheren Keller<br />
versteckt. Die Nazigrößen waren verschwunden und die NS-Lokalgrößen hatten<br />
ihre Macht eingebüßt. Die Bürger hatten ihre Angst vor ihnen verloren. Vom<br />
Kirchturm hing von weitem sichtbar eine weiße Fahne heraus. Für die Alliierten<br />
war dies ein sicheres Zeichen, dass sie in diesen Ort nun ungefährdet<br />
einmarschieren konnten. Aus den winzigen Fenstern beobachteten die Leute das<br />
Geschehen. Der <strong>Erlenbach</strong>er Bürgermeister Holstein wartete am Ortsrand mit einer<br />
weißen Fahne. Gespannt und erwartungsvoll verharrten die Menschen in<br />
gespenstiger Ruhe. Gegen 17 Uhr rollten sie nun an. Bürgermeister Hollstein wird<br />
wohl Angst gehabt haben. Nichts desto trotz siegte sein Pflichtgefühl. Mutig ging<br />
er auf die amerikanischen Truppen zu, um zu zeigen, dass sie nichts zu befürchten<br />
hätten. Das Eis war gebrochen und Hollstein ging den Truppen ungeschützt voraus.<br />
Aus Skepsis entwickelte sich bald eine solide Vertrauensbasis.<br />
Die Leiche des gefallenen Soldaten Franz Langs lag zwei Tage lang bis zum<br />
21ten im Dreck, bis sie geborgen werden konnte. Endlich fasste man sich am<br />
Mittwoch ein Herz und lud die sterblichen Überreste auf einen Karren und brachte<br />
sie zur Kirche. Unter Zeugen leerte man die Innen- und Außentaschen des Toten.<br />
Daraufhin erstellte der Bürgermeister über alle gefundenen Wertsachen und<br />
Habseligkeiten ein Protokoll, das die Anwesenden unterschrieben. Am Freitag, den<br />
23. März, wurde Franz Lang dann endlich auf dem Gemeindefriedhof beerdigt.<br />
Ganz <strong>Erlenbach</strong> war auf den Beinen, um dem Gefallenem die letzte Ehre zu<br />
erweisen. Die <strong>Erlenbach</strong>er betteten Franz Lang tränenreich zur letzten Ruhe. Dabei<br />
gedachten sie ihrer eigenen 97 Toten, die irgendwo vergraben waren. Wehrpass und<br />
alle Sachen Langs hob man an einem sicheren Ort auf, um sie so bald wie möglich<br />
der Witwe zuzustellen. Endlich funktionierte im November die Post wieder und<br />
unter dem Datum vom 13. November 1945 schrieb Hollstein den Bürgermeister<br />
Langs Heimatgemeinde Retzbach an der Niederdonau (Österreich) an.<br />
Das Kriegsende zeigte in <strong>Erlenbach</strong> ein bizarres Bild der Wehrmacht. Zerschossene<br />
Fahrzeuge standen herum. Der Hagelgrund sei voller Pferdewagen gewesen und<br />
überall hätten friedlich herrenlose Wehrmachts-Pferde gegrast.. Zum Teil wären sie<br />
noch vor dem Proviantwagen eingespannt gewesen. Es war eigentlich<br />
selbstverständlich gewesen, diese Pferde auszuspannen und sie mit nach Hause zu<br />
nehmen. Außerdem war es Frühjahr und die Felder mussten bestellt werden. Da<br />
konnten die kräftigen Pferde gut mithelfen.<br />
Was geschah mit den „herrenlosen“ Proviantwagen? Die Zeiten waren j sehr<br />
schlecht und warum sollte der Proviant auf den Wehrmachtswagen verrotten? Die<br />
Wagen kamen ins Dorf und die Einwohner entleerten und verteilten die Konserven<br />
unter den Glücklichen auf. In diesen miserablen Zeiten war dies ein unerwarteter<br />
Reichtum, der ihnen in die Hände gefallen war. Allerdings mussten die<br />
Wehrmachtspferde im September 1945 an die Französische Armee abgegeben<br />
werden.
409<br />
409
410<br />
410<br />
Franz Steidel war am 14.4.1902 auf die Welt gekommen. Vorm Krieg war er<br />
Arbeiter gewesen. Nach dem Tod seiner ersten Frau Erna Korn war er in zweiter<br />
Ehe mit Elise Herbrand aus Otterberg verheiratet. Er hatte vier Kinder. Im<br />
November 1941 berief ihn dann die Wehrmacht ein. Da er schon vorher als Rot<br />
Kreuz Helfer gearbeitet hatte, wurde er zum Sanitäter ausgebildet. Die meiste Zeit<br />
war er dann in den Verwundetenzügen als Reisebegleiter eingesetzt gewesen. Dies<br />
war kein Job für schwache Nerven. Aber er hielt durch. Gegen Kriegsende kam er<br />
in russische Gefangenschaft. Ein glücklicher Zufall bescherte ihm bereits am 10.<br />
Juni 1945 seine Entlassung. Glücklich machte er sich auf den Heimweg. Er suchte<br />
den kurzen und leichten Weg durch die Täler und nicht durch die Berge. So kam<br />
er nach Kreuznach, wo ihn die Amerikaner aufgriffen und ihn in das Hungerlager<br />
Bretzenheim in offener Gefangenen-Haltung einpferchten. Wie lange er dort war,<br />
konnten wir nicht mehr erfahren. Der Krieg und die Gefangenschaft hatten ihn<br />
stark geschwächt. So dass er bereits am 1.1.1947 in Otterberg starb.
411<br />
11.12. Willi Lenz erzählte 2005 von seiner Gefangenschaft<br />
Ich wurde Ende 1926 in <strong>Erlenbach</strong> geboren. 1940 schloss ich die Schule ab und<br />
begann bei der Firma Pfaff eine Lehre als Mechaniker. Im Oktober 1943 bestand<br />
ich die Gesellenprüfung. Ich war gerademal 17 geworden und ich musste wie die<br />
anderen meines Jahrgangs zur Wehrmacht. Meine dreimonatige militärische<br />
Ausbildung war in Landau bei dem 14. Grenadier Regiment 951. Sie begann am<br />
29. Oktober 1943.<br />
Nach der Grundausbildung wurde meine Einheit mit lauter Gleichaltrigen nach<br />
Dänemark versetzt. Auch doch dort blieben wir nur kurze Zeit. Dann ging es mit<br />
dem Zug an die Ostfront. Unsere Einheit verstärkte die deutschen Truppen bei<br />
ihrem Verteidigungskampf um Lemberg. Es war der 23.3.<strong>1944</strong>: Mein<br />
Unteroffizier gab mir den Auftrag, einen Durchhaltebefehl mündlich an eine<br />
Soldatengruppe weiterzugeben. Der Weg führte über offenes Gelände an einem<br />
Bauernhof vorbei. Obwohl kein bedrohlicher Beschuss zu hören war, lief ich<br />
vorsichtig, hastig und gebückt auf die angegebene Stellung zu. In der Nähe des<br />
Bauernhofes fielen dann plötzlich und unerwartet drei Schüsse, die mich auch<br />
trafen. Ein Gewehrschuss prallte am Munitionsgürtel ab und richtete kein Unheil<br />
an. Der Zweite war ein Lungendurchschuss, wie sich später herausstellte und der<br />
Dritte durchschlug die Schulter und den Oberarm. Ich fiel um und war einige<br />
Minuten bewusstlos. Wie durch ein Wunder öffnete sich der Misthaufen und eine<br />
Frau kam schreiend heraus. Ich rappelte mich wieder auf und rannte zurück. Dass<br />
ich mit der Verwundung noch springen konnte, ist für mich heute noch sehr<br />
verwunderlich. Diesmal schoss keiner auf mich.<br />
In der Nähe deutscher Soldaten brach ich zusammen und wurde wieder<br />
bewusstlos. Ich kam erst wieder zu mir, als ich auf einem deutschen Panzer lag,<br />
der Verwundete zum Hauptverbandsplatz nach Lemberg brachte. Nachdem die<br />
Ärzte mich transportfähig gemacht hatten, kam ich mit anderen Verwundeten im<br />
Lazarettzug nach Marienbad. Dort päppelte man mich und meine Kameraden<br />
wieder hoch. Als Anerkennung für meinen (ungewollten) Opfermut stellte mir der<br />
Chefarzt am 24.4.<strong>1944</strong> das Verwundetenabzeichen in Schwarz aus. Ein<br />
wertloses Papier. Danach kam ich mit anderen Kameraden vier Wochen lang zur<br />
Reha in die Genesungskompanie nach Karlsbad. Sie sehen, die Wehrmacht ließ<br />
nichts unversucht, uns wieder feuertauglich zu machen.<br />
Die nächste Etappe war das Ersatz-Auffangregiment in Osnabrück, wo ich bis<br />
zum November <strong>1944</strong> verblieb. Dann kam der Einsatzbefehl nach Thorn/Polen. An<br />
meinem 18. Geburtstag (30.11.) kamen wir dort an. Ich hatte Glück, das wir noch<br />
nicht mal 14 Tag dort bleiben mussten. Denn wir wurden an die Westfront verlegt.<br />
Wir bezogen unsere Ausgangsstellung am 12. Dezember. Und schon am 17.<br />
Dezember <strong>1944</strong> ging die Offensive in Luxemburg los. Aber nach täuschenden<br />
Anfangserfolgen scheiterte sie kläglich. Auf dem Rückzug hatten wir uns für<br />
unsere 10 Männer einen sichernden Unterstand gebaut. Am 18. Januar 1945<br />
morgens rückten langsam 4 Panzer an. Als unsere Flak einen in Brand geschossen<br />
hatte, drehten die anderen ab. Wir nahmen die amerikanischen Soldaten gefangen,<br />
die sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Gefährt hatten retten können.<br />
Nachmittags rollte die amerikanische Panzerwelle auf breiter Front an. Der hatten<br />
wir nichts entgegen zu setzten. Der bei uns weilende Sanitäter hisste aus der Luke<br />
heraus sein weißes Rotkreuz Shirt als Zeichen für unsere Aufgabe. Nachdem wir<br />
411
412<br />
412<br />
durchsucht waren, ging es zu Fuß in den nächsten Ort, Dielkirchen. In der<br />
dortigen Kirche hatten die Amerikaner ein provisorisches Gefangenenlager<br />
eingerichtet. Nach wenigen Stunden ging es durch Luxemburg in das große<br />
Durchgangslager Steney. Bereits am 20. Januar kam ich als Helfer zur US<br />
Transportkompanie 643. Ich hatte das große Los gezogen. Meine anfängliche<br />
Aufgabe war, die Fahrzeuge aufzutanken, zu pflegen und kleinere Reparaturen<br />
durchzuführen. Wir P.O.W. (Prisoner of War) bekamen das gleiche Essen wie<br />
die GI´s. Das Kriegsende erlebten wir bei Fort Devau in der Nähe von Verdun.<br />
Unsere Stimmung war gedrückt. Was sollte denn schon aus uns werden?<br />
Gegen Ende 1945 schickte die US Army bereits einen Großteil ihrer Soldaten in<br />
die Heimat zurück. Das war für mich und meine Kameraden wiederum von<br />
Vorteil. Jetzt durften, bzw. mussten wir zwangsläufig die Aufgaben der US<br />
Soldaten übernehmen. Dies war am 12.12.1945. Wir fuhren allein, unbewacht mit<br />
unseren LKWs zu den Gefangenenlagern und belieferten sie mit Lebensmittel. Bei<br />
einer dieser Fahrten traf ich den <strong>Erlenbach</strong>er Erwin Sokoly, der mit anderen im<br />
Lager die Verpflegung seiner Mitgefangenen organisierte. Da ich mich geschickt<br />
anstellte, erteilte mir der leitende Offizier der >Truck Cargo< meinen ersten<br />
Führerschein. Das Ausstellungsdatum war der 26.12.1945. Ein verspätetes<br />
Geburtstags- & Weihnachtsgeschenk zu meinem 19. Geburtstag. Auf dem<br />
Formular steht:<br />
„I certify that Lenz Willi, Gefreiter, has demonstrated<br />
proficiency in driving the types of vehicles listed below as<br />
per signal authentication . Trucks von 1 ½ - 2 ½ tons”:<br />
Wir wurden bei der US-Transporteinheit sehr gut behandelt und bekamen das<br />
gleiche Essen wie die Amerikaner. Der einzige Nachteil war, dass wir das Lager<br />
nicht allein verlassen durften. Da ich mich gut und geschickt anstellte, erhielt ich<br />
eine Auszeichnung und ein Empfehlungsschreiben des Kommandanten des<br />
1134th Labour Supervision Company. Es lautet:<br />
Recommendation: Willi Lenz, Gefr, 31 G 971233 has been<br />
until in the 2025 GM TRK Co he has performed his duties<br />
in an excellent manner. William M Dagg.<br />
Kurz vor meinem 20ten Geburtstag, am 29.10.1946, stellte der Kommandant mir<br />
auch den Führerschein für Sattelschlepper aus. Danach versetzte man uns Ende<br />
Oktober 1946 mit den LKWs von Lothringen nach München. Wir waren wie die<br />
Amerikaner in der gleichen Münchener Kaserne untergebracht. Wir erhielten auch<br />
das gleiche Essen und standen in nichts den US Soldaten nach. Wir erhielten<br />
unbeschränkt die sehr begehrten Rauchwaren, die ich hamsterte. Der einzige<br />
Unterschied, dass die GI´s Ausgang hatten und wir nicht. Die Aufgabe unserer<br />
Kolonne war es, die beschlagnahmten Lebensmittel bei den Bauern abzuholen und<br />
zur zentralen Sammelstelle zu bringen. Der Winter war noch nicht vorbei und<br />
dann nahte die Entlassung. Es war Ende Februar und ich packte meinen Seesack<br />
und den schweren Holzkoffer, der voll mit Schätzen war. Das Entlassungslager<br />
war das ehemalige KZ Dachau. Am 27. Februar 1947 bestieg ich den Zug in<br />
Richtung Heimat. In Mannheim Hbf angekommen, verließen wir mit unserem<br />
schweren Gepäck den Hauptbahnhof und schleppten alles über die provisorische
413<br />
Fußgängerbrücke 483 über den Rhein in Richtung Ludwigshafen. Vor mir ging ein<br />
großer und kräftiger Kamerad, der aus dem Saarland stammte. Der franz. Soldat<br />
wollte in dessen Gepäck schauen. Da schrie ihn der Saarländer an, wenn Du den<br />
Koffer aufmachst, fliegst Du in den Rhein. Der franz. Soldat, war so geschockt,<br />
dass er uns alle ungeprüft passieren ließ.<br />
Der Zug Ludwigshafen nach Saarbrücken war proppevoll. Mein Gegenüber hatte<br />
6 Eier, die er mir gegen etwas Tabak tauschen wollte. Ich hatte ja genug davon.<br />
Gesagt getan, ich steckte die Eier vorsichtig in meine Manteltasche. Wir näherten<br />
uns Kaiserslautern und meine Freude wurde immer größer. Bei jeder Station<br />
zwängten sich immer noch Menschen in die Menschenmasse. Sie standen so<br />
dicht, dass ich in Kaiserslautern nicht durch die Zugtür herauskam. Ich musste<br />
durch das Fenster klettern. Da passierte das kleine Malheure, alle meine Eier<br />
zerbrachen und das Flüssigei drückte sich durch den Stoff.<br />
Dies drückte jedoch nicht meine Stimmung. Obwohl ich 6 km, mit zwei steilen<br />
Anstiegen, heim zu laufen hatte, war ich beseelt. Es war so schön als ich<br />
heimkam. Mit Tränen in den Augen lagen wir uns alle in den Armen.<br />
Ich hatte dann zwei Wochen Erholungsurlaub. Am 15. März fing ich bei der<br />
Firma Pfeiffer AG zu arbeiten an.<br />
DIE ENTBEHRUNGSREICHE<br />
NACHKRIEGSZEIT<br />
Am 28.3.1945 hatten amerikanische Truppen die Pfalz vollkommen besetzt.<br />
General Hugh. J. Gaffey bekam mit seinem XXIII Corps 484 die Aufgabe, die<br />
Zivil-Verwaltung aufzubauen. Am 30. April standen ihm bereits 36.000 eigene<br />
Soldaten zur Seite und als sie das Gebiet an die Franzosen übergaben, waren es<br />
bereits 56.000 gewesen. Gaffey hatte sein Hauptquartier in Idar-Oberstein<br />
aufgeschlagen. Die für die Verwaltung vorgesehenen Soldaten und Offiziere des<br />
XXIII. Korps waren schon im Herbst <strong>1944</strong> gut auf ihre Aufgaben vorbereitet und<br />
483 ) Die Rheinbrücke war gegen Kriegsende von den zurückflutenden deutschen Truppen gesprengt<br />
worden, um den amerikanischen Vormarsch zu stoppen.<br />
484 ) Schaupp, Stefan, Eine Reform der Gesinnung. Der Wiederaufbau der pfälzischen<br />
Verwaltung, in > Die Pfalz in der Nachkriegszeit
414<br />
414<br />
zu funktionierenden Gruppen zusammengefasst worden. Bereits wenige Tage<br />
nach dem Einmarsch bestimmten die Soldaten den Ortsbürgermeister, wobei auch<br />
NSDAP Mitglieder vorübergehend ernannt wurden.<br />
Aber wie sah es in <strong>Erlenbach</strong> aus? Die optischen Kriegsnarben waren gering. Es<br />
waren zwar ein paar Bomben in den Reichswald am Hagelgrund und in die<br />
Wiesen des Gersweilerhofes gefallen. Das waren unerhebliche Nadelstiche. Aber<br />
die menschlichen Verluste waren schmerzlich. Bei Kriegsende wussten nur<br />
wenige Familien, wo ihre Söhne und Männer waren. Bis dahin hatte die<br />
Wehrmacht und die Zentralstelle der Waffen SS in Berlin nur wenigen Eltern, das<br />
traurige Ende ihrer Söhne mitteilen können. Mit Sicherheit waren Ende März 45<br />
oder gar am 9.Mai 45 noch 300 Familien in skeptischer Hoffnung, ihren Sohn und<br />
Ehemann doch noch in die Arme schließen zu können.<br />
Neben dieser nagenden Ungewissheit, fehlten sie auch im wirtschaftlichen Sinne.<br />
Wer sollte die Arbeiten in Garten und Feld erledigen? Die meisten Fremd- und<br />
Zwangsarbeiter waren verschwunden. Die Frauen und Alten schufteten ihren<br />
Buckel krumm. Aber hinten und vorn fehlten die helfenden Hände. Selbst die<br />
durch Bombardements zerstörten Fabriken lagen brach. Nicht nur die Arbeitskraft<br />
fehlte den Familien durch den Verlust der Angehörigen, sondern auch deren<br />
Einkommen. Aber was sollte man auch kaufen, es gab ja nichts?<br />
Die <strong>Jahre</strong> 1945 – 1948 hatten mehrere Aspekte, die in den folgenden Artikeln<br />
kurz dargestellt werden:<br />
12.1. Hunger & Entbehrung<br />
Hunger schmerzt. Langfristig führten die Mangelerscheinungen zu<br />
Wachstumshemmnissen bei Kindern und Jugendlichen, die nicht wieder gut zu<br />
machen sind. Unterernährung ist der Nährboden für schwerwiegende<br />
Erkrankungen. Hungern ist schlimmer als Heimweh. Das Kriegsende läutete eine<br />
heimische Hungersnot ein, die vor allem die Lautrer heftig traf. Die <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Selbstversorger hätten eigentlich gut zu lachen gehabt. Wenn da nicht andere<br />
gewesen wären, die nachts auf Raubzüge gingen, um den Hunger ihrer Familie zu<br />
stillen. Außerdem verpflichtete die französische Besatzung die <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Bevölkerung zur Ablieferung von Lebensmitteln, Hühnern, Eier und Schlachtvieh.<br />
Ein <strong>Erlenbach</strong>er berichtete:<br />
Wir bewohnten ein kleines Haus mit Stall und einer Scheune am Südhang des<br />
Buchenwaldes. Die Straße hieß früher Obere Straße oder das Rutsloch. Unser<br />
steiles Grundstück war terrassiert. Direkt am Haus hatten unsere 15 Hühner, vier<br />
Gänse und die vier Truthähne ihren Auslauf. Die 50 Stallhasen saßen in Boxen.<br />
Die beiden Schweine und die vier Ziegen lebten in einem kleinen Stall. Weiter<br />
unten hatten wir den Hausgarten und ganz unten pflanzten die Eltern Kartoffeln.<br />
Nachdem die Franzosen bei uns das Sagen hatten, mussten wir alle Naturalien<br />
abgeben. Die Erfassung und Kontrolle darüber übernahmen <strong>Erlenbach</strong>er, die nicht<br />
in der NSDAP gewesen waren. Sie gingen von Haus zu Haus und erfassten die<br />
Viehbestände. Die Gemeindeverwaltung unter dem Bürgermeister Hollstein und<br />
dem Gemeindesekretär Braunbach erstellten dann für <strong>Erlenbach</strong> Requirierungslisten.<br />
Da jeder Haushalt unentgeltlich ungefähr ein Viertel abgeben musste,
415<br />
versteckte eigentlich jeder vor der offiziellen Viehzählung einen Teil seiner Tiere.<br />
Die Hühner kamen in einen Sack und verschwanden in einer dunklen Ecke. Die<br />
dann beschlagnahmten Hühner und Hasen mussten geschlachtet und<br />
ausgenommen abgeliefert werden. Anders war es bei den Schweinen. Nach der<br />
Schlachterlaubnis ließ die Familie das Schwein auf der Gemeindewaage offiziell<br />
wiegen. Auch jetzt war die Besatzungsmacht am Schlachtgewicht beteiligt. Um<br />
den abzugebenden Anteil zu reduzieren, dachten sich die <strong>Erlenbach</strong>er so manchen<br />
Trick aus, um das Schlachtgewicht nach unten zu manipulieren. Dies alles<br />
geschah unter den gestrengen Augen des Polizeidieners Emil Kühner, der<br />
regelmäßig mit der Dorfschelle durch <strong>Erlenbach</strong> lief, um die Bekanntmachungen<br />
lautstark zu verkünden.<br />
Zwei meiner Tanten, Emma und Mathilde Heinrich hatten noch vor dem Krieg<br />
nach Wiesloch in größere Bauernhöfe hineingeheiratet. Bereits im Krieg hatte ich<br />
dort meine Sommer- und Herbstferien verbracht. Auch nach dem Krieg ließen die<br />
beiden Tanten ihre Sippschaft Heinrich & Becker nicht hängen. Dies war ein<br />
großes Glück für uns alle. Denn besonders 1946 und 1947 hatten wir eine extrem<br />
niedere Kartoffelernte, während in Nordbaden die Kartoffelernte fast normale<br />
Ernteergebnisse brachte. Kurz nach der Kartoffelernte erhielten wir aus Wiesloch<br />
eine verklausulierte Nachricht. Sonntags fuhren wir mit dem Personenzug nach<br />
Ludwigshafen. Natürlich auf Holzbänken in der 4. Klasse. Die Erwachsenen<br />
zogen den Leiterwagen. An der provisorischen Rheinbrücke angekommen, ging<br />
ich allein in Richtung Mannheim. Denn Kinder brauchten auf ihrem Weg zurück<br />
in die französische Besatzungszone keine Papiere zu zeigen und unterlagen keiner<br />
Kontrolle. In Mannheim wartete bereits Onkel und Tante, die mit ihrem<br />
Pferdewagen und einem Doppelzentner Kartoffeln zur Brücke gefahren waren.<br />
Meine Freude war groß und die Herzlichkeit meiner Tante war grenzenlos. Nach<br />
herzlichen Umarmungen stärkten sie mich mit üppig belegten Wurstbroten Ich<br />
musste mich viermal schwer beladen auf den langen Weg machen, bis ich die 100<br />
kg in jeweils zwei Taschen über den Rhein geschleppt hatte. Jedes Mal hatten sie<br />
mir für die Verwandtschaft außerdem links und rechts eine Wurstdose in meine<br />
Jackentasche gesteckt. Die Aktionen hatten über 3 Stunden gedauert und ich<br />
verabschiedete mich mit dem Versprechen, in den Weihnachtsferien wieder nach<br />
Wiesloch zu kommen.<br />
Auf dem Weg zum Bahnhof passierte etwas Kurioses. Ein US LKW fuhr etwas zu<br />
schnell um die Kurve und von der Ladepritsche fielen etliche Kasten mit Orangen<br />
auf die Straße herunter. Hunderte Früchte kullerten da herum. Jeder steckte ein,<br />
was er kriegen konnte. Im Bahnhof angekommen, protestierten etliche Reisende,<br />
dass wir unseren Bollerwagen mit in den Wagon nehmen wollten. Meinem Vater<br />
blieb nichts anderes übrig, als ihn auf dem Wagendach zu befestigen. Wir waren<br />
alle skeptisch, ob dies bei den niedrigen Tunnelhöhen gut ginge. Auf dem Weg<br />
nach KL wurde der Zug derart voll, dass wir kaum noch Luft bekamen.<br />
Volkswirtschaftlich<br />
Nüchtern betrachtet waren die <strong>Jahre</strong> 1945 – 1948 eine Versorgungskrise, die<br />
sich allerdings nicht auf die deutschen Besatzungszonen beschränkte. Aus der<br />
Sicht der hungernden Menschen war dies eine elendige Notzeit. Die Körper<br />
stellten sich gezwungener weise auf die wenigen Kalorien ein, die irgendwie<br />
zusammen gehamstert und gefuggert wurden. Die Versorgungslage unserer<br />
415
416<br />
416<br />
<strong>Erlenbach</strong>er war genauso miserabel, wie anderen Orts. Allerdings hatten die einen<br />
mehr zu sich zu nehmen als die anderen. Adolf Beckers Familie gehörte zu den<br />
Ärmeren. Nach der Ernte stoppelten alle zuerst die Getreidefelder, um verlorene<br />
Ähren aufzusammeln. Adolf erzählte, seine Mutter habe dann die Getreidekörner<br />
in der früheren Kaffeemühle zu Mehl vermahlen. Daraus seien dann fettarme<br />
Pfannkuchen entstanden. Im Herbst hätten die Kinder mit dem Kehrblech den<br />
Buchenwald gekehrt, um an die fetthaltigen Bucheckern zu kommen. Der Carra<br />
habe dann daraus Öl gepresst. Dann gab es doch öfters mal fetttriefende<br />
Grumbeer-Pannekuche.<br />
Selbst Frankreich war von der misslichen Lage betroffen. Trotzalledem vermochte<br />
sie sich als Siegermacht besser und rücksichtsloser zu helfen, während die<br />
deutsche Bevölkerung die Mängel still und mit knurrendem Magen durchleiden<br />
musste. Die BASF war nur noch ein Trümmerhaufen und konnte weder Dünger<br />
noch Pflanzenschutzmittel liefern. Teilweise hatten unsere Kleinbauern ihr<br />
Saatgut aufgegessen, um sich einige Tage zu sättigen. Schon von daher konnten<br />
unsere <strong>Erlenbach</strong>er Kleinbauern nur wenig pflanzen und aussäen. Dazu kamen<br />
die äußerst trockenen Sommer 1945 und 1946. Der Sommer 1947 schlug alle<br />
Temperatur- und Trockenperioden der letzten Jahrzehnte. Die Kartoffelpflanzen<br />
verdursteten und selbst das Gras vertrocknete. Selbst in unseren günstiger<br />
gelegenen Gärten in den Tallagen des Krehbachs und des <strong>Erlenbach</strong>s war keine<br />
ausreichende Kartoffel- und Gemüseernte möglich. Das gleiche galt für die<br />
schmalen Terrassen unterhalb der Bergstraße, die Eimerweise gewässert werden<br />
konnten. Irene Hottenbach erzählte, dass ihre Mutter aus dem Garten untere<br />
Bergstraße lediglich 2 Körbe kleine Kartoffeln geerntet hatte. Das erfolgte auf<br />
einer Fläche, wo sonst mehr als 12 Zentner heranwuchsen. Und dies, obwohl sie<br />
die Kartoffelpflanzen fleißig gewässert 485 und fortwährend Kartoffelkäfer<br />
abgelesen hatte. Das Wasser entsprang aus zwei kleinen Quellen, die bergseits<br />
gegenüber dem Haus Nr . 2 gelegen waren.<br />
Da Frankreich ebenfalls durch die extrem heißen Sommer 45 – 47 starke<br />
Ernteausfälle zu verbüßen hatte, griff es auf seine Besatzungszonen zurück und<br />
plünderte sie aus. Um die innerfranzösische Versorgungslage zu entspannen,<br />
drückte die Militärverwaltung bis zu 400.000 Menschen in die Besatzungszonen,<br />
die auf unsere Kosten wie der liebe Gott in Frankreich lebten. Mit den hier rigoros<br />
beschlagnahmten Lebensmitteln versorgte die Besatzungsmacht ihre Truppen und<br />
die voluminöse und wasserkopflastige Verwaltung. Der Rest ging nach<br />
Frankreich.<br />
Andererseits unternahm die Militärregierung große Anstrengungen, um die<br />
Infrastruktur wieder herzurichten. Sie erinnern sich, dass die Wehrmacht auf<br />
ihrem fluchtartigen Rückzug rücksichtslos alle Brücken über den Rhein, Mosel,<br />
Lahn und Nahe gesprengt hatte, um etwas Luft für neue Heldentaten zu<br />
bekommen. Nichts funktionierte mehr. Post und Telefon lagen still und erst ab<br />
dem Spätsommer 1945 gab es für wenige Stunden Strom.<br />
Die franz. Militärregierung führte die von den Nazis bei Kriegsbeginn 1939<br />
eingeführte Rationierung aller Wirtschaftsgüter zwangsläufig weiter. Was hätte<br />
sie auch sonst machen sollen? Es gab zwei Gruppen. Zum einen die<br />
485 ) Das Wasser der zwei Quellen lief in Bottiche (Brenken), aus denen die Bewohner der<br />
unteren Bergstraße ihr Wasser holten. Als die Häuser unterhalb des Kindergartens gebaut<br />
wurden, schütteten die Bagger die Quellen zu.
417<br />
Selbstversorger, die in der Pfalz durchschnittlich 30 % der Bevölkerung<br />
ausmachte. Aber in <strong>Erlenbach</strong> waren es 70 % aller Haushalte, die aus ihren<br />
kleinen Gärten und Äckern das Notwendigste herausholten. Ein gut bewachter<br />
Garten von 100 qm erbrachte gut 300 kg Kartoffeln 486 . Wenn es möglich war,<br />
pflanzte die Familie mehr. Die meisten hielten im Keller ein Schwein, lakonisch<br />
als Kellersau benannt, das die Essensreste bekam. Stallhasen, 10 Hühner und eine<br />
Geiß rundeten den Existenz sichernden Besitz ab. In diesen Notzeiten erinnerten<br />
sich die Städter ihrer armen <strong>Erlenbach</strong>er Verwandtschaft und erbettelten sich<br />
wichtige Kalorien. Wer konnte da schon hartherzig nein sagen?<br />
Denen standen die hungernden „Normalverbraucher“ gegenüber, die außer ihrer<br />
Arbeitskraft nichts vorzuweisen hatten. Dies waren in der Regel die früheren<br />
Beamten und Angestellten, die in guten Zeiten hochnäsig ihre Kontakte zu „de<br />
Bauere“ abgebrochen hatten. Sie bekamen zwar wie alle anderen am<br />
Monatsanfang je Person eine Lebensmittelkarte. Das Existenzminimum wurde<br />
nach Gramm berechnet. Erwachsene bekamen monatlich 25 x 50 g Brot und 40<br />
mal 5 g Fett. Haben Sie mal mitgerechnet wie wenig jedem Erwachsenem<br />
zustand? Dies war 2,5 kg Brot und 200 Gramm Fett. Auf der rechten Kartenseite<br />
waren 60 Abschnitte, mit denen wahlweise mal ein Pfund Kartoffeln, Marmelade<br />
oder sonstiges genommen werden konnte. Das hing davon ab, was gerade dem<br />
Laden zugeteilt worden war. Die Hausfrauen oder Kinder standen meist<br />
stundenlang in langen Warteschlangen vor dem Lebensmittelladen an, bis sie<br />
endlich bedient wurden. Auch damals galt bereits, wer zu spät kommt, den<br />
bestraft der Mangel. Glücklich war, wer großzügige Verwandtschaft aus<br />
<strong>Erlenbach</strong> und Morlautern hatte.<br />
Unsere <strong>Erlenbach</strong>er Selbstversorger gaben offiziell das ab, was sie abgeben<br />
mussten. Aber natürlich hatten sie für Fremde nicht einsehbar, noch Hühner oder<br />
ein Schwein versteckt. Oder vor der Schlachtung wurde die öffentliche Waage<br />
geschickt manipuliert, so dass aus einem fetten drei Zentner Schwein nur noch ein<br />
mageres 100 kg Tier wurde.<br />
Dass es in der Pfalz nicht zur Katastrophe kam, hing mit der amerikanischen Hilfe<br />
zusammen. Die USA hatten keine Missernten wie hier zu Ort, sondern sie<br />
verbuchten eine Weizen- und Maisrekordernte. Die Überschüsse kamen zu uns<br />
und linderten ab dem Oktober 1947 die Versorgungskrise ab. Allmählich ging es<br />
bergauf. Wendepunkt war die Währungsreform. Entsprechend dem ERP-Plan 487<br />
(Marshallplan) stellten die USA riesige Mengen an Grundnahrungsmittel zur<br />
Verfügung. Der Aufwind wurde durch die sehr ertragreiche Ernte des <strong>Jahre</strong>s 1948<br />
unterstützt. Fleisch und Zucker waren noch 1949 knapp. Aber im März 1950<br />
schlossen bereits die Ernährungsämter ihre Pforten und die Angestellten<br />
übernahmen andere Aufgaben.<br />
12.2. Wehrmachts- und Beutegut in <strong>Erlenbach</strong> 1945 – 1947<br />
Nach dem Einmarsch machten die Alliierten etwas sehr Vernünftiges. Die<br />
bisherigen Gemeindeverwaltungen und ihre Bediensteten wurden unverzüglich<br />
wieder mit der Verwaltung beauftragt, natürlich unter anderen Vorzeichen. Denn<br />
486<br />
) Die extrem trockenen Sommer der <strong>Jahre</strong> 1946 und 1947 reduzierten die Ernte auf weniger als ein<br />
Drittel<br />
487<br />
European Recovery Program (ERP)<br />
417
418<br />
418<br />
schließlich musste das Leben ja weitergehen. Der alte Gemeindesekretär Heinrich<br />
Braunbach und Bürgermeister Hollstein kamen abermals in Amt & Würden.<br />
Das hatte er wohl verdient, denn schließlich lief er, mit einer weißen Fahne<br />
bewaffnet, mutig den Amerikanern entgegen. Die Gemeindeverwaltungen<br />
erfassten das Militärgut, dass die Wehrmacht in <strong>Erlenbach</strong> hinterlassen hatte.<br />
Manche Erfassungen listeten zum Teil sehr kleinlich und Familien weise alte<br />
Bekleidungsgegenstände, wie Hose, Jacke, Strümpfe etc. auf. Die Meldungen<br />
erhielt das Landratsamt, die die Statistik an die Militärregierung weitergab.<br />
Standortkommandant <strong>Erlenbach</strong>s war ein US Amerikaner in Uniform, der für die<br />
meisten sehr verwunderlich perfekt Deutsch sprach. Es handelte sich um einen<br />
ausgewanderten Deutschen.<br />
Für mich sehr überraschend war, dass die Wehrmacht außer 34 Eisenbettgesellen,<br />
98 Drahtmatratzen und 19 Schultische und 34 Schultische in <strong>Erlenbach</strong><br />
hinterlassen hatte. Wertvoller waren<br />
Gegenstände „aufbewahrt bei“<br />
1 Pferdewagen,<br />
1 Proviantwagen,<br />
1Pferdebrustgeschirr<br />
Philipp Jacob Barth<br />
1 Proviantwagen Jacob Mangold<br />
1 Proviantwagen Karl Schneider<br />
1 Proviantwagen Rudolf Hollstein<br />
2 Pferdewagen Emma Korn, Witwe<br />
4 qm Sohlenleder und<br />
1 Elektromotor<br />
August Scheubeck, aus<br />
Kaiserslautern<br />
Die obigen sieben Proviant- und Pferdewagen waren von 14 Wehrmachts-Pferden<br />
gezogen worden. Wo waren die denn geblieben?<br />
Sie erinnern sich, Franz Lang wurde am 19. März von einem Tiefflieger<br />
erschossen, als er rauchend an seinem LKW stand. Der Soldat wurde vier Tage<br />
später unter zahlreicher Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt. Der ausgebrannte<br />
LKW stand am 9. März 1946 immer noch neben der Straße, denn die <strong>Erlenbach</strong>er<br />
hatten nicht das schwere Bergegerät, um ihn zum Bahnhof zu bringen.<br />
Die anderen Auto-Wracks hatte die Gemeinde entweder an den <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Bahnhof oder im Steinbruch in der Steinbruchstraße deponiert. Den <strong>Erlenbach</strong>er<br />
stank es aber zum Himmel, dass die früheren Nazis auch im<br />
Nachkriegsdeutschland noch abkassierten. Sie informierten die Militärregierung,<br />
die im Herbst 1946 daraufhin aktiv wurde. Sie schrieb den Bürgermeister<br />
Hollstein an und bat um Auskunft.<br />
Wie verhielt es sich mit dem „wertlosen“, aber fahrbereiten PKW der Marke<br />
DKW der Wehrmacht? Nun lesen Sie, wer den bekam und wie das gedeichselt<br />
wurde:
419<br />
1946, 4. Oktober: Unter gleichem Datum schrieb Bürgermeister Hollstein<br />
nochmals an den Landrat des Kreises Kaiserslautern. Es ist genauso zu beurteilen,<br />
wie obiges Schreiben. Ohne Gemütsregung und vollkommen sachlich informierte<br />
Hollstein den Landrat, dass da ein vollständig demolierter, aber fahrbereiter LKW<br />
419
420<br />
420<br />
aus Wehrmachtsbeständen sei. Der Transportunternehmer Heinrich Hoffmann sei<br />
der derzeitige Besitzer. Der veraltete Antrieb sei Holzgas. Heinrich Hoffman habe<br />
im Juni 1945 den LKW käuflich erworben und der Kaufpreis von 1.800<br />
Reichsmark sei zu Gunsten der Militärregierung einbezahlt worden.<br />
Liebe Leser, Sie haben sich wohl Ihre eigenen Gedanken über diese<br />
Merkwürdigkeiten gemacht?<br />
Für diese oben genannten Gegenstände gab es keine Interessenten. Das Kettenkrad<br />
könnte ein kettengetriebener PKW gewesen sein.<br />
12.3. Die Feuerwehr nach Kriegsende<br />
1945: Aufgrund der Anweisung der franz. Besatzungsmacht machte<br />
Bürgermeister Hollstein am 15.5.1945 Inventur im Feuerwehrschuppen. Er<br />
notierte 2 Leiterwagen, 2 Hydrantenwagen, 2 Ausstellleitern mit Stützen,<br />
2 Dachleitern, circa 12 Uniformröcke und 12 Stahlhelme.<br />
1946: Die im Krieg gedient hatten, hatten die Schnauze voll von dem<br />
militärischen Drill. Aber der kommissarisch eingesetzte Feuerwehrhauptmann<br />
Eugen Herbrand aus Mehlingen bestand darauf, dass seine Leute auf<br />
Kommandos antraten und auch sonst sich zackig verhielten. Aber seine Leute<br />
weigerten sich, dies zu tun. Über das Bürgermeisteramt <strong>Erlenbach</strong> holte sich der<br />
Wehrführer bei der franz. Kommandantur Rat ein, wie er sich zu verhalten hätte.
421<br />
Sie antwortete, „sie dürfen ihre Mannschaften mit entsprechenden Kommandos<br />
antreten, wegtreten und in die Geräte einmarschieren lassen. Denn ohne Ordnung<br />
und Disziplin kann keine Schlagfertigkeit erreicht werden“. (Schreiben vom<br />
12.4.1946)<br />
1947, 4 Februar schrieb Bürgermeister Hollstein an den Landrat. In Punkt 8 teilt<br />
er ihm mit, dass die Feuerwehr <strong>Erlenbach</strong>s eine Handdruckspritze mit dem<br />
erforderlichen Schlauchmaterial hätte. Außerdem sei in der <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Wasserleitung ausreichender Druck vorhanden, was aber nicht stimmte..<br />
Feuerwehrmannschaft vom 24.2.1947 und in 1948<br />
Name Vorname Geboren* gelöscht<br />
aus<br />
Datenschutzgründen<br />
Herbrand Eugen ----<br />
Merk Willi,<br />
Gruppenführer<br />
Truppe, Straße<br />
Fallschirm, Brunnenstr<br />
Bachmann Herbert Marine, Bergstraße<br />
Barth Werner Gersweilerhof<br />
Becker Richard Infanterie, Hauptstraße<br />
Dendl Herbert Gersweilerhof, ab 1948<br />
Eimer Hermann K´lauterer Straße<br />
Engel Hardi Infanterie, Obere Str.<br />
Fischer Theobald Gersweilerhof, ab 1949<br />
Hager Werner Artillerie, Friedhofstraße<br />
Heinrich Eugen Artillerie, Hauptstraße<br />
Henn Hermann Pionier, Hauptstraße<br />
Hoffmann Kuno Hauptstraße<br />
De Hooge Alfons Friedhofstraße<br />
Klein II Herbert Infanterie, nur bis 1947<br />
Knieriemen Hermann Marine Ogfr, Hauptstr.<br />
Korn Armin Infanterie, Obere Str.<br />
Korn Bruno Weiherstraße, ab 1949<br />
Korn Theobald Infanterie , Hauptstr.<br />
421
422<br />
422<br />
Lenz Willi Kirchgasse, ab 1949<br />
Mangold Werner Bergstraße, ab 1949<br />
Noll Herbert,<br />
Gruppenführer<br />
Luftwaffe, Gersweilerhof<br />
Reich Edmund Infanterie Flurstraße<br />
Reisel Albert Friedhofstraße, ab 48<br />
Schneider Hugo Luftwaffe, Bergstraße<br />
Wenz Heinrich Infanterie, Kirchstraße<br />
Wenz Willi Ab 1948, Kirchstraße<br />
Winter Walter Infanterie, Gersweilerhof.<br />
Woll Walter Marine Ogfr, Hauptstr.<br />
Woll Werner Gersweilerhof<br />
Zimmer Heinz Fallschirmj, Friedhofstr.<br />
Schindler Bernhard Marine Obermaat, nur<br />
1947<br />
Der Bürgermeister Hollstein hob hervor, dass keiner der oben genannten Personen<br />
Mitglied in der NSDAP gewesen wäre. Die Feuerwehrliste für 1949 umfasst 27<br />
ehrenamtliche Helfer<br />
1947: Aber bereits am 19. August. loderten die Flammen aus dem Anwesen der<br />
Witwe Emma Heinrich in der Bahnhofstraße 6 Scheuer, Stall und Schuppen<br />
brannten bis auf die Grundmauern total ab. Da hatte auch die Handdruckspritze<br />
mit dem .erforderlichen Schlauchmaterial nicht geholfen.<br />
1949: 2. April: Oberregierungsrat Schellhaaas des Landratsamtes schrieb den<br />
Bürgermeister <strong>Erlenbach</strong>s an. Er fragte an, warum sich bisher keine <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Feuerwehrmänner hätten entnazifizieren lassen Die Antwort war ganz einfach und<br />
einleuchtend. Hollstein schrieb „wir haben keine Nazis in unseren Reihen“ denn<br />
die Feuerwehrmänner waren ja alles junge Leute, die zwar in der Hitlerjugend<br />
gewesen waren, aber Nazis, nein danke!<br />
12.3. Das Entnazifizierungsverfahren<br />
Der Charakter und Verlauf der Entnazifizierung im deutschen Südwesten waren<br />
durch die Vorgaben der französischen Sicherheits- Demokratisierungs- und<br />
Dezentralisierungspolitik bestimmt. Der Leiter der franz. Besatzungsverwaltung<br />
in Baden-Baden Emile Laffon, maß der Entnazifizierung eine hohe Bedeutung<br />
für das Gelingen der französischen Demokratisierungspolitik bei. Er entwickelte<br />
im Spätsommer 1945 mit seinem Beratungsstab ein entsprechendes Konzept, dass<br />
mit den Rahmenrichtlinien in allen westlichen Zonen identisch war.
423<br />
Es ging um die Feststellung einer bedeutenden politischen Schuld. Ziel war es<br />
nicht, die Millionen kleiner PGs 488 zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen,<br />
sondern lediglich die großen Fische sollten zur Rechenschaft gezogen werden. So<br />
kamen viele in die Gruppe III der Minderbelasteten, aber die Mehrzahl wurde in<br />
die Gruppe IV der Mitläufer eingeordnet. Nachteil dieser Entnazifizierung<br />
waren die hohen Gerichtsgebühren, die die Beglückten bezahlen sollten. Deshalb<br />
verzichteten fast alle betroffenen <strong>Erlenbach</strong>er darauf, sich von dem braunen<br />
Geruch weiß waschen zu lassen. Nur die Beamten und die Lehrer benötigten den<br />
Persilschein, um wieder in Amt und Würden zu kommen. Zum Leidwesen der<br />
Militärverwaltung in Kaiserslautern verweigerten die <strong>Erlenbach</strong>er Feuerwehrleute<br />
(aus Kostengründen) die Entnazifizierung, obwohl der Feuerwehrhauptmann<br />
Eugen Herbrand sie eindringlich im Namen der Bezirksverwaltung dazu<br />
aufgefordert hatte. Dabei waren die Militärgerichte und später die neu<br />
konstituierten deutsche Gerichte für die Verfolgung politisch motivierter<br />
Verbrechen zuständig.<br />
12.4. Eröffnung der <strong>Erlenbach</strong>er Schule als<br />
Bekenntnisschule 1.10.1945<br />
Der Unterricht begann wieder am 1. Oktober. Die Besatzungsmacht hatte den<br />
beiden Lehrern Karl Gugel und Frau Wirth die Unterrichtserlaubnis erteilt. Die<br />
beiden Lehrer lehrten im Schichtbetrieb. Die beiden großen Klassen hatten von<br />
7.00 bis 10 Uhr und die zweite Gruppe von 10 bis 13 Uhr Unterricht.<br />
Nach dem Krieg befand sich das Schulhaus in einem mitleidenswertem Zustand.<br />
Während des Krieges konnten keine Renovierungen durchgeführt werden und<br />
nach dem Krieg waren öfters Besatzungstruppen wochenweise untergebracht<br />
worden. Am 26.7.1947 schrieb der alte und neue Bürgermeister Hollstein das<br />
„Staatliche Hochbauamt“ in KL an und bat gleichzeitig das Gesundheitsamt Kl<br />
um Unterstützung. Denn nach Ansicht des Bürgermeisters konnten<br />
Gesundheitsschädigungen der Schüler nicht ausgeschlossen werden. Einige der<br />
Schüler hatten Läuse und Krätze. Andere wiesen auf dem Rücken und der<br />
Schulter eitrige Geschwüre auf. Er war sich gewiss, dass ein Sack Gips und als<br />
Anstrichmittel würde ein Sack Schlemmkreide vorläufig ausreichen. Deshalb bat<br />
er in Anbetracht der Dringlichkeit um einen Freigabeschein für diese Materialien.<br />
Wie einfach und billig es heututage ist? Wir fahren zum Baumarkt und holen die<br />
Dinge, die massenweise und unbeschränkt lieferbar sind. (Akt 205). 1946 – 47:<br />
Der extreme Lehrermangel zwang die franz. Besatzungsmacht nach politisch<br />
unbelasteten Lehrern Ausschau zu halten. Da kamen auf den ersten Blick nur die<br />
alten Pensionäre in Frage. So wurde der pensionierte Morlauterer Lehrer<br />
Hermann Becker 489 reaktiviert, der aus <strong>Erlenbach</strong> stammte und da und dort Land<br />
besaß. Er hielt noch drei <strong>Jahre</strong> lang Unterricht. In seinem allgemeinen Unterricht<br />
488 ) In <strong>Erlenbach</strong> waren 130 Bürger Mitglieder der NSDAP<br />
489 ) Hermann Becker kam zum ersten Mal als Hilfslehrer an die Volksschule in <strong>Erlenbach</strong>. Folgende<br />
Geschichte wird erzählt. Ende <strong>1944</strong> stürzte in der Nähe des heutigen Autohauses Liegert ein<br />
englisches Kampfflugzeug ab. Der Pilot rettete sich durch einen Fallschirmabsprung. Etliche<br />
Dorfbewohner rannten zu ihm hin und nahmen ihn gefangen. Als der Engländer gesagt hatte:<br />
>Deutschland kaputt
424<br />
424<br />
berichtete er gerne von Würzburg und Helgoland, wo er im Ersten Weltkrieg<br />
gedient hatte und naturgemäß verschwieg er auch nicht seine Leidenschaft als<br />
Jäger. Viele <strong>Jahre</strong> später gehörte noch seine mangelhafte Treffsicherheit zum<br />
lustigen Jägerlatein an den Stammtischen. Seine Jagdgenossen, wie Rainer<br />
Heckmann, berichteten wilde Episoden. So schoss er von seinem Hochsitz immer<br />
wieder auf einen Rehbock, den er aber niemals traf. Stattdessen musste ein alter<br />
Grenzstein zwischen der <strong>Erlenbach</strong>er und Otterbacher Gemarkung dran glauben,<br />
den er mit seinen Fehlschüssen langsam halbierte.<br />
1949: Zum 1. September besetzte die Schulverwaltung wieder die vierte<br />
Lehrerstelle. Aus diesem Grunde kündigte die Ortsverwaltung dem<br />
Schneidermeister Ehrenfried Wolf das Pachtverhältnis für den benötigten<br />
Schulsaal. In dem bitterbösen Schreiben vom 28.8.1948 reklamierte der<br />
Bürgermeister Hollstein, dass der Schneidermeister eigenmächtig die Schultafel<br />
abgebaut hatte und auch sonst den Raum ohne zu fragen, umgestaltet hatte.<br />
Hollstein: „Ich mache hiermit den Schadenersatzanspruch der Gemeinde geltend<br />
und werde Ihnen die Kosten für die Wiederinstandsetzung in Rechnung stellen“<br />
12.5. Lehrer in <strong>Erlenbach</strong> nach 1950<br />
1950 Frau Hertha Wirth, geb. Steidel * 1915, unterrichtete die 1. und 2. Klasse.<br />
1950 wurden 26 Kinder eingeschult. Darunter waren allein 23 Mädchen.<br />
• 1950 Herr Otto Gebhardt kam nach <strong>Erlenbach</strong>. Er hatte einen anderen<br />
Beruf erlernt. Nahm aber die Chance wahr, als Seiteneinsteiger ohne<br />
Abitur in den Schuldienst zu kommen. Seine ehemaligen Schüler sprechen<br />
ehrfurchtsvoll vom Eisernen Otto. Er lebte später in Höringen,<br />
• 1950 – 1951 Herr Schick aus Untersulzbach<br />
• 1952 – 1953, Lehrer Simbgen aus Baalborn * um 1930, starb 1961, war<br />
bereits einige Zeit vorher öfters krank gewesen. Vertretung durch:<br />
• Fräulein Münch, wohnt jetzt in Mehlingen<br />
• 1954, Jacob Schmidt wurde mit 65 <strong>Jahre</strong>n pensioniert<br />
• 1954 Herr Georg Meng kam in Vertretung von Jacob Schmidt als<br />
Schulleiter nach <strong>Erlenbach</strong>. Meng war sehr musikalisch. Unter ihm erlebte<br />
das Musikleben einen erheblichen Aufschwung.<br />
12.6. Alles war in den <strong>Jahre</strong>n 1945 – Juni 1948 rationiert<br />
Die Armut und das Elend waren greifbar. Alle Familien schlugen sich irgendwie<br />
durch. Legal oder illegal, Hauptsache man sättigte seine Lieben ein wenig. Die<br />
älteren <strong>Erlenbach</strong>er erzählen noch heute mit Stolz von ihren Strategien, wie sie die<br />
Feldhüter mit Fehlinformationen ins Raupenthal schickten, während sie in der<br />
Geißendell zuschlugen und dort Grumbeeren ausbuddelten.<br />
Selbst der Buchwald und die anderen Gemeindewälder teilten seit Jahrzehnten das<br />
Schicksal der am Hungertuch nagenden Bewohner. Jedermann ging mit Rechen
425<br />
und Blechen hinein und holte das letzte trockene Blatt als Spreu für seine Ziege<br />
oder das im Keller stehende Hausschwein heraus. Nichts blieb liegen. Sämtliche<br />
Hutzeln, Ästchen, einfach alles verschwand letzten Endes im Küchenherd. Der<br />
Wald war gekehrt und wirkte wie geleckt. Der Wald hatte keine Chance sich zu<br />
regenerieren, geschweige denn Humus zu bilden. 1932 verbot die zuständige<br />
Otterberger Forstverwaltung die weitere Entleerung, wie sie unten abgedruckt ist.<br />
Die Nazis hatten ihre Lehren aus den Ernährungskrisen des Ersten Weltkrieges<br />
gezogen und alles Notwendige vorbereitet. Zudem waren sie vom Wettergott<br />
gnädig unterstützt worden. Das Frühjahr und der Sommer 1943 bescherte die bis<br />
dahin zweitbeste Ernte des 20. Jahrhunderts. Die allgemeine Hungersnot setzte<br />
erst nach dem Krieg ein. Denn es fehlte an Saatgut und Dünger. Dazu kamen die<br />
extrem trockenen Sommer von 1945 und 1946.<br />
12.7. Die Rückkehr der Kriegsgefangenen<br />
Im September und Oktober 1945 kamen 25 ehemalige <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Kriegsgefangene zurück. Allerdings trugen sie Zivilkleidung. Sie mussten an<br />
Eides statt erklären, dass sie ohne Uniform entlassen worden wären. Sie werden<br />
wohl froh gewesen sein, als sie in Zivilkleidern die Heimreise antreten durften.<br />
Die Reaktion des Bürgermeisteramtes ist aus heutiger Sicht unverständlich. Die<br />
Liste enthält auch drei <strong>Erlenbach</strong>er Mädchen, die als Wehrmachtshelferinnen in<br />
Gefangenschaft kamen. Darunter ist Helene Marky, die später als > s Milch<br />
Helen< lange Zeit in <strong>Erlenbach</strong> Dienst tat.<br />
425
426<br />
426<br />
Ende 1947, Im Krieg und danach war das Schicksal noch vieler unserer Soldaten<br />
vollkommen ungewiss. Selbst wenn die Angehörigen monatelang nichts hörten,<br />
erhofften sie eine Rückkehr. Das Rote Kreuz griff unter die Arme, wo sie es<br />
vermochte. Anfang 1947 bekam die Familie Willi Korn die erlösende Nachricht<br />
von ihrem Sohn in Russland. Unverzüglich schrieben die Eltern ihrem Sohn<br />
aufmunternde Worte. Der Jubelschrei Willis wird groß gewesen sein, als er die<br />
Grüße aus seiner Heimat erhielt und fortwährend las. Es war nicht viel, was Willi<br />
aus russischer Kriegsgefangenschaft schreiben durfte. Die Zensur ließ nichts<br />
Anderes zu. So war die unten abgedruckte Karte aus dem Lager 7271, irgendwo in<br />
Sibirien, dennoch für die Eltern eine Hoffnungsgarantie.<br />
Die <strong>Erlenbach</strong>er
Kriegsgefangenen<br />
427<br />
wohnten Ankunft<br />
in<br />
<strong>Erlenbach</strong><br />
Abraham Karl Hauptstr. 36 30.03.1948<br />
Bang Karl Hauptstr. 7 03.04.1949<br />
Barth Emil Hauptstr. 61 03.10.1947<br />
Barth Heinrich Lautrer Str. 10.02.1948<br />
Bandel Kurt Hauptstr. 42 08.09.1949<br />
Bender Harry Brunnenstr. 15 08.01.1950<br />
Benkel Heinrich Gersweilerhof 16.07.1947<br />
Benra Hermann Bahnhofstr. 5 24.11.1949<br />
Bogusch, Hans Brunnenstr. 5 08.10.1947<br />
Braun Karl Hauptstr. 33 05.08.1948<br />
Buley Ernst Kirchstr. 2 20.05.1948<br />
Carra Leonhard Hauptstr. 8<br />
Gersweilerhof<br />
23.11.1947<br />
Carra Louis<br />
15 28.11.1947<br />
Closset Alois Kirchstr. 9 18.03.1948<br />
Deubel Jacob Bergstr. 5 16.12.1947<br />
Eigenfeld Paul Flurstr. 4 05.03.1948<br />
Freiermuth Alfons Ringstr. 4a 04.07.1949<br />
Groth Walter Bergstr. 22 06.09.1948<br />
Haffner Wilfried Heinz Hauptstr. 52 25.10.1948<br />
Hager Heinrich Friedhofstr. 4 30.01.1948<br />
Halfmann Oskar Flurstr. 5 06.08.1948<br />
Haustein Werner Bergstr. 26 28.02.1948<br />
Henrich Heinrich Obere Str. 3 28.04.1948<br />
Herbach Armin I. Hauptstr. 24 23.12.1949<br />
Herbach Otto<br />
Hix Karl, * 19.8.1913 in<br />
Hauptstr. 67 26.04.1948<br />
Rheingönnheim Hauptstr. 23 22.11.1948<br />
Jungmann Heinrich Obere Str. 1 17.03.1947<br />
Kallmeyer Werner HauptStr. 31 16.12.1948<br />
Korn Karl Hauptstr. 64 03.05.1949<br />
Korn Wilhelm Hauptstr. 51 22.04.1948<br />
Kühner Franz Hauptstr. 39 01.02.1947<br />
Lang Hermann Gersweilerhof 22.11.1948<br />
Lenz Willi<br />
Lesoine Richard<br />
Kirchstr. 03.03.1947<br />
Leudolph, Heinz Friedhofstr. 6 29.07.1947<br />
Mangold Werner Ringstr. 5 29.04.1947<br />
Marky Otto Flurstr. 8 01.02.1948<br />
Menge Fritz Berstr. 30 15.01.1948<br />
Merk Alfred Gersweilerhof 25.09.1947<br />
427
428<br />
428<br />
Meuler Alfred Hauptstr. 12 26.06.1948<br />
Miskinis Edith<br />
Müller Kurt Klauter Str. 16 13.03.1947<br />
Rahm Herbert Ringstr. 2 01.07.1948<br />
Rahm Karl Bergstr. 14 09.09.1948<br />
Reidenbach, Karl<br />
Reisel Otto Lautrer Str. 19 20.09.1948<br />
Schlosser Hans Bahnhofstr.11 15.04.1947<br />
Schmitt Erwin Hauptstr. 29, 5 21.09.1948<br />
Schmitt, Ludwig Brunnenstr. 7a 09.07.1949<br />
Schwaderer Friedrich Gersweilerhof 4 08.08.1947<br />
Seel, Heinrich Höllenstr. 4 08.09.1948<br />
Spang Eleonore,<br />
Tonnius Lautrer Str. 6 02.07.1951<br />
Speier Julius<br />
Stuzenberger Paul K´lauter 8 24.03.1947<br />
Theis, Helmut Hauptstr. 12 13.02.1948<br />
Tonnius Dieter Lautrer Str. 6 02.07.1951<br />
Tonnius Edith Lautrer Str. 6 02.07.1951<br />
Ultes Alfred Raupenthal 1 06.03.1948<br />
Ultes Baltasar Bergstr. 17 14.05.1947<br />
Weber Werner Weiherstr. 5 14.04.1948<br />
Werle Fritz Kirchstr. 4 07.04.1948<br />
Werner Klaus Kanalstr. 2 04.08.1949<br />
Williard Franz Hauptstr. 10 31.10.1947<br />
Winter, Erwin Bahnhoftr. 10 21.01.1947<br />
Diese Liste wurde am 31. Januar 1955<br />
vom Bürgermeisteramt <strong>Erlenbach</strong> erstellt<br />
12.8. Alliierte Manöver in 1946<br />
1946: <strong>Erlenbach</strong> und die anderen Orte der Umgebung unterstanden der Militär-<br />
Kommandantur in Otterbach. Im Januar 1946 forderte die Militärverwaltung das<br />
Bürgermeisteramt <strong>Erlenbach</strong> auf, eine Aufstellung aller Unterbringungsmöglichkeiten<br />
für das Militärpersonal und das vorhandene Material anzufertigen.<br />
Die Antwort des <strong>Erlenbach</strong>er Bürgermeister Hollsteins vom 21.1.1946 gibt uns<br />
eine gute Übersicht über die damalige Raumsituation. Es gab:<br />
• 40 kleinere Scheunen und Ställe,<br />
• 6 größere Wohnungen für Offiziere und 11 kleinere für Unteroffiziere<br />
• 1 Blechgarage<br />
• 4 Schulsäle von jeweils 55 qm. Nur in zwei von ihnen wurde Unterricht<br />
gehalten, denn zwei Lehrer waren suspendiert, wegen zu großen<br />
Engagements in der NSDAP. Insgesamt hätten im Schul- und<br />
Gemeindehaus 220 qm freigemacht werden können.
429<br />
• ein größeres Wohnungsproblem. Denn 40 Lautrer Familien hatten in<br />
<strong>Erlenbach</strong> Unterschlupf gefunden, da ihre Wohnungen im Bombenhagel<br />
<strong>1944</strong> zerfielen. Dazu kamen einige Evakuierte aus Ludwigshafen.<br />
• Den Kindergarten, der sich als Leit- und Geschäftsstelle eignete. Davon<br />
waren 70 qm frei.<br />
• 40 Einzelzimmer, die den Soldaten als Schlafzimmer zur Verfügung<br />
gestellt werden konnten. Diese Information stammt aus einer anderen<br />
Aufstellung.<br />
1947: Am 2. Februar konkretisierte Bürgermeister Hollstein die<br />
Wohnraumsituation in <strong>Erlenbach</strong>. Es gab damals 396 voll belegte Wohnungen mit<br />
1.309 Zimmern für genau 1.274 Menschen. (Dabei waren aber mindestens 200<br />
<strong>Erlenbach</strong>er Kriegsgefangene noch nicht zurück)<br />
429
430<br />
430<br />
12.9. Die Bebauung im Jahr 1947<br />
DER WEG IN DIE GEGENWART<br />
13.1. Die Ausgangslage ab 1949<br />
Geschrieben vom damaligen Gemeindesekretär Braunbach<br />
Stromversorgung<br />
Die Zeiten waren schwierig, das Geld war nichts mehr wert und hohe<br />
Arbeitslosigkeit bedrückte damals wie heute die Menschen. Der Gemeinderat war<br />
aber vorausschauend. Er erkannte die Zeichen der Zeit und dass es dringend war<br />
anderen Gemeinden nachzuziehen. Der elektrische Strom musste her und ein<br />
ausbaufähiges Stromnetz entstand in eigener Regie. Baubeginn war in 1923. Zur<br />
Finanzierung erfolgte auf dem Rotenberg ein teilweiser Kahlhieb und aus den<br />
Verkaufserlösen konnten die Rechnungen bezahlt oder Leistungen eingetauscht<br />
werden. Dies erfolgte im Gleichschritt zu den Morlauterern. In 1924 ging den<br />
<strong>Erlenbach</strong>ern das Licht auf. <strong>Erlenbach</strong> bezog den Strom von Otterbach. Die<br />
Straßenbeleuchtung hing an einer langen Kupferleitung, die im Zweiten Weltkrieg
431<br />
zu Kriegszwecken geraubt wurde. Erst 1950 konnte sie wieder ersetzt und die<br />
Straßenbeleuchtung abermals in Gang gesetzt werden.<br />
Gasversorgung<br />
Um eine weitere Einnahmequelle zu schaffen trug sich die Gemeinde mit der<br />
Absicht in <strong>Erlenbach</strong> ein eigenes Gasleitungsnetz aufzubauen und das Gas über<br />
die Gasfernleitung von Saarbrücken her zu beziehen. Es gab heiße Diskussionen<br />
und Rücktritte, Neuwahlen und Geschichten, die unter der Bezeichnung Gaskrieg<br />
Eingang in die <strong>Erlenbach</strong>er Geschichte fand. Trotz aller Widerstände entstand die<br />
Gasleitung. Zur Finanzierung erfolgte ein größerer Holzhieb im Gemeindewald.<br />
Die neue Energie fand in der Bevölkerung eine breite Zustimmung. 98 % aller<br />
Haushalte waren leicht zu überzeugen und schlossen ihr Haus an. Welche Zeit und<br />
Arbeitsvorteile gewannen unsere Bürger? Sie brauchten die Öfen nicht mehr jeden<br />
Morgen von Asche zu befreien, kein Feuermachen und das schweißtreibende<br />
Schleppen der Kohle und des Holzes entfiel.<br />
Die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung bestand aus Arbeitern. Allein in<br />
Kaiserslautern und der näheren Umgebung waren über 500 <strong>Erlenbach</strong>er<br />
beschäftigt. 1951 arbeiten noch etwa 8 % (= 104 Personen) in der Landwirtschaft.<br />
Unsere Landwirte waren in der Milchlieferungsgenossenschaft organisiert. Jeden<br />
Morgen erfolgte am Milchhäuschen die Sammlung der Frischmilch. Etliche<br />
Haushalte versorgten sich auch dort mit dem Milchkännchen. Jahrzehntelang<br />
verkaufte „s Milch Helen“ (Helene Marky, die Mutter des Klaus Marky) dort<br />
frische Molkereiartikeln.<br />
Die drei Transportunternehmen, wie Sokoly, entstanden aus landwirtschaftlichen<br />
Betrieben, die in einnahmeschwachen Zeiten mit ihren Fuhrwerken für Lohn<br />
fuhren.<br />
Wir hatten damals auch 22 Handwerksbetriebe und drei Verkaufsgeschäfte wie<br />
Erich Jescheck und die Hellis gegenüber der Kirche. Für das leibliche Wohl<br />
sorgten vier Lebensmittelgeschäfte, drei Bäckereien. 490 und die beiden<br />
Metzgereien Villiard und Hepp in der Hauptstraße. Selbst für den Durst und die<br />
Geselligkeit war gesorgt. Vor fast 60 <strong>Jahre</strong>n gab es vier Gaststätten 491 : Helmut<br />
Kläs, Fritz Hermann in der Höllenstraße, Emma Korn (Witwe) in der<br />
Hauptstraße und das Gartenlokal Ludwig Carra auf dem Gersweilerhof. 492 Am<br />
2.12.1952 hielten die Alliierten in <strong>Erlenbach</strong> ein Manöver ab und dazu brauchten<br />
sie für die Soldaten Schlafgelegenheiten. Sie wurden in den Tanzsälen der<br />
Gaststätten untergebracht<br />
• Fritz Hermann, Höllenstraße 100 Soldaten<br />
• Frau Emma Korn, Hauptstr. 35 60 Soldaten<br />
• Helmut Kläs, Hauptstraße 40 60 Soldaten<br />
490 ) Die Bäckerei-Inhaber waren Eugen Woll in der Ringstraße, Franz Kühner und Helmut<br />
Woll. Später verkauften sie auch Lebensmittel. Eugen Woll ist der Sohn des Bäckermeisters<br />
Otto Woll, * 7.11.1875 in Untersulzbach, der am 10.3.1942 an Magen- und Darmkrebs starb.<br />
Otto W war seit 27.7.1911 mit Maria Linz verheiratet.<br />
491 ) Später eröffneten Schwehm, das Café Rinck, das Turnerheim und das Sportheim ihre<br />
Gaststättenbetriebe.<br />
492 )<br />
431
432<br />
432<br />
• Ludwig Carra, Gersweilerhof 60 Mann<br />
Die Offiziere schliefen bei Privatleuten in bequemen Betten<br />
1951, Im Oktober ließ sich die Matratzenfabrik Conrad & Co aus Morlautern<br />
in <strong>Erlenbach</strong> nieder. Weitere Bemühungen der Gemeindeverwaltung <strong>Erlenbach</strong><br />
waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt, obwohl der Gemeinderat zu weit<br />
reichenden Konzessionen bereit war. Gewerbesteuerbefreiung für 10 <strong>Jahre</strong> und<br />
kostenlose Grundstücke lockten, aber womöglich waren die Flächen zu klein.<br />
Eigene Flüchtlinge & deren Integration<br />
Nach dem Krieg blieben 95 Flüchtlinge in <strong>Erlenbach</strong> ansässig. Der vom<br />
Bürgermeister diktierte Bericht verweist darauf, dass sie sich gut mit den Sitten &<br />
Gebräuchen vertraut gemacht hätten. Sogar vier Familien hatten 1951 bereits mit<br />
dem Bau ihres Eigenheims begonnen, wovon eines bereits Ende des <strong>Jahre</strong>s von<br />
den Bauherren bezogen worden war.<br />
Auch die am 2. Juli 1951 als Verschleppte zu ihrer Tante nach <strong>Erlenbach</strong><br />
zurückgekehrten Geschwister Dieter und Edith Tonnius hatten sich eingewöhnt<br />
und in den Arbeitsprozess eingeschaltet. Der bei ihrer Heimkehr von der >Die<br />
Rheinpfalz< veröffentlichte Schicksalsbericht dieser Geschwister war nicht<br />
ungehört geblieben. Für sie gingen danach zahlreiche Liebesgaben und Geschenke<br />
direkt oder über das Bürgermeisteramt ein. Darunter waren konkrete<br />
Hilfsangebote und unzählige Teilnahme-Bezeugungen.<br />
Im Großen und Ganzen waren die Flüchtlinge 1951 einigermaßen wohnlich<br />
untergebracht. Teilweise konnte ihnen auch schon größere und bessere<br />
Wohnungen zugewiesen werden. Aber nach wie vor war die Wohnraumfrage<br />
noch das Sorgenkind der Gemeindeverwaltung. Der Bürgermeister war 1951<br />
schon ausgesprochen zuversichtlich, dass sich die Situation bald entspannen<br />
würde.<br />
Baugelände<br />
Das Bürgermeisteramt verwaltete nicht nur den Mangel. Im Gegenteil. Sie<br />
beauftragte die Heimstätten GmbH (aus Neustadt) in der Weiherstraße ein<br />
Doppelhaus mit vier schönen Dreizimmer-Wohnungen zu erstellen. Es kostete je<br />
16.000 DM. (Für 8.000 Mark konnte also damals eine Wohnung gebaut werden.<br />
Der Stundenlohn betrug aber auch nur eine Mark. ) Die Gemeinde finanzierte den<br />
Bau mit zwei Darlehen von je 16.000 DM.<br />
Aber auch die Einheimischen benötigten Wohnungen. Die Gemeinde erschloss<br />
rasch Baugelände >im Flürchen< und in der unteren >Bergstraße
433<br />
Protestantischer Kindergarten<br />
1935 war in der Bergstraße das Kindergarten-Gebäude errichtet worden, das<br />
damals allen hygienischen Vorschriften entsprach. Kurz nach dem Krieg kam<br />
alles erst sehr langsam wieder in Gang. 1945 und 1946 diente das Haus als<br />
Wohnraum. Davon waren 70 qm frei. Diesen Teil bot die Gemeinde den Alliierten<br />
als Leit- und Geschäftsstelle für ihre Manöver an.<br />
Nach 1949 bemühte sich die Gemeinde um eine baldige Wiedereröffnung als<br />
Kindergarten. Zu diesem Zweck hatte sie mit dem Diakonissen-Mutterhaus in<br />
Marburg einen Vertrag zur Gestellung einer Kindergärtnerin geschlossen. Aber<br />
sehr schnell kam die Gemeinde an ihre finanziellen Grenzen. Deshalb<br />
beabsichtigte der Gemeinderat, das Gebäude an die Evangelische Kirche der Pfalz<br />
zu verkaufen und den Betrieb der protestantischen Kirchengemeinde zu<br />
übertragen. Natürlich wollte sich die Gemeinde nicht ganz aus ihrer<br />
Verantwortung stehlen und sie sicherte dem kirchlichen Träger einen jährlichen<br />
Betriebszuschuss zu.<br />
Verkehrsanbindung<br />
1951/52: Der Bürgermeister beurteilte in seiner Aktennotiz die verkehrsmäßige<br />
Anbindung als zufriedend stellend. Einerseits konnten die Bürger mit der<br />
Bundesbahn fahren, andererseits hatten die Verkehrsbetriebe 493 nach <strong>Erlenbach</strong><br />
eine stark frequentierte Buslinie aufgebaut, mit der man besser, schneller und<br />
billiger nach KL kam. Im Sommer 1951 waren die Busse bereits voll besetzt.<br />
Aber im Winter, als die Rad- und Motorradfahrer wegen des Schnees nicht mehr<br />
selbst fahren konnten, herrschte in den Bussen ein beängstigendes Gedränge und<br />
mancher Morlauterer kam erst gar nicht mehr in den Bus hinein.<br />
Vereine<br />
Bürgermeister Braunbach zählte in seiner Aktennotiz 11 Vereine auf. Der<br />
Gesang- und Musikverein betätigten sich kulturell und der Fußball- und<br />
Turnverein warteten mit besonderen sportlichen Leistungen auf. Für die Jungen<br />
war es eine Ehre für den FCE zu spielen und sonntags pilgerten Hunderte von<br />
<strong>Erlenbach</strong>er Fans auf den Sportplatz, um ihre Mannschaft anzufeuern. Das<br />
mütterliche Engagement war gelegentlich so groß, dass sie mit dem Regenschirm<br />
hinter dem gegnerischen Spieler her war, wenn der geliebte Sohn gefault oder gar<br />
umgesäbelt wurde. Da wurden ein paar Pfennige Eintritt kassiert und die beiden<br />
Rot Kreuz Helfer waren immer zur Stelle.<br />
Der Pfälzerwaldverein bot den Wanderern monatlich schöne Wanderungen und<br />
Ausflüge in die nähere und fernere Umgebung an. Der VdK und das DRK hatten<br />
recht aktive Ortsgruppen und der Krankenpflegeverein unterhielt eine<br />
Schwesternstation. Auch der Obst- und Gartenbauverein konnte in vielen<br />
Versammlungen und in Beratungen vor Ort sachkundige Hilfe anbieten. In<br />
sozialer Hinsicht war der Bürgersterbeverein besonders rührig. Dieser Verein<br />
auf Gegenseitigkeit hatte viele Mitglieder geworben und konnte deshalb durch<br />
sein Umlageverfahren in den letzten <strong>Jahre</strong>n 1948 – 51 die Sterbegelder bedeutend<br />
erhöhen. Gerade in den dunklen Wintermonaten boten die Vereine etliche<br />
Veranstaltungen an, so dass das damalige Leben sehr kurzweilig war.<br />
493 ) Sie hießen damals Städtische Omnibusbetriebe Kaiserslautern<br />
433
434<br />
434<br />
Landwirtschaft<br />
So ging man 1950 noch aufs Feld, um Futter zu machen. Frau Mangold trägt<br />
einen Rechen und die Sense. Durch ihre Arbeit war zwar kein großer Reichtum<br />
möglich, aber es reichte zum Überleben! Das war die Familie Mangold, die<br />
Großeltern der Liselotte Reidenbach, geb. Benkel<br />
1960 gab es 43 landwirtschaftliche Betriebe, von denen nur 17 mehr als 2 Hektar<br />
bewirtschafteten. Also gab es 26 Nebenerwerbslandwirte. 1963 quälten sich noch<br />
9 Familien hauptberuflich, um existieren zu können. Man stelle sich vor, nur 7<br />
erreichten damals die Richtgröße von 14 Hektar 494 . Heute ist die Untergrenze für<br />
eine sinnvolle Grünlandbewirtschaftung 100 Hektar und die wird in 2030 mit<br />
Sicherheit 200 Hektar betragen. Im Jahr 2005 hatten wir noch einen Landwirt, der<br />
wird aber über kurz oder lang auch aufgeben müssen.<br />
Gemeindehaushalt<br />
1951: Die oben dargestellten Maßnahmen kosteten alle Geld. Da nicht alles auf<br />
einmal gemacht werden konnte, packte der Bürgermeister immer nur das<br />
Dringendste an. Allerdings reichten in 1951 die Mittel nicht ganz aus. Der<br />
Nachtragshaushalt hatte ein Volumen von 5.285 DM und erhöhte den Gesamtetat<br />
auf 77.911,-- DM<br />
494 ) Quelle der Daten: Landkreis Kaiserslautern, Stollfuß- Verlag, Bonn 1968, Seite 282
435<br />
13.2. Die Wohnungszwangswirtschaft<br />
Schon während des Krieges herrschte ein eklatanter Wohnungsmangel in und um<br />
Kaiserslautern herum. Zwei Drittel der Stadt Kaiserslautern war durch den<br />
furchtbaren Bombenkrieg zerstört worden und hinzu kamen die Evakuierten aus<br />
Ludwigshafen. Die Menschen mussten zusammenrücken. Wer ein leeres Zimmer<br />
hatte, stellte es Freunden und Verwandten zur Verfügung. Bei der Stadt- und<br />
Kreisverwaltung richteten die Behörden Wohnungsämter ein, die als erstes den<br />
Wohnraum quantitativ und qualitativ erfassten, aber dann auch verwalteten. Da<br />
hatten die Hausbesitzer keine Möglichkeiten mehr, sich die Leute auszusuchen<br />
oder über die Miete zu diskutieren.<br />
1947 am 2. Februar gab es in <strong>Erlenbach</strong> 396 Wohnungen mit 1.309 Zimmern.<br />
Außer den 1274 Einwohnern lebten noch 40 Familien aus Kaiserslautern und<br />
Ludwigshafen in <strong>Erlenbach</strong>, die untergebracht werden mussten. Für kurzfristig<br />
anberaumte Manöver räumten die <strong>Erlenbach</strong>er 18 Wohnungen und etliche Einzel-<br />
Zimmer für die Manöver-Soldaten. Außerdem kehrten 200 Kriegsgefangene<br />
zurück, die kräftig zupacken konnten und dem Aufschwung die notwendige<br />
Antriebskraft verliehen. Diese Wohnungen boten Schutz vor Wind und Wetter<br />
und entsprachen natürlich nicht unseren heutigen hygienischen Standards und<br />
Ansprüchen. Die meisten Häuser hatten bis Anfang der 60iger <strong>Jahre</strong> Außen-<br />
Toiletten mit entsprechenden Geruchsbelästigungen. Nachts ging man wohl aufs<br />
Töpfchen.<br />
1950 setzte die erste rege Bautätigkeit ein. Die neuen und stolzen Hausbesitzer<br />
räumten ihre Wohnungen, so dass nach und nach sich die Wohnungssituation<br />
entspannte. Die Bevölkerung wuchs stetig und übersprang Ende 1954 die<br />
magische Marke von 1.500 Einwohnern. Ab jetzt durfte <strong>Erlenbach</strong> auch dieses<br />
Wohnungsproblem in eigener Regie anpacken bzw. selbst verwalten. Wir<br />
vermuten, dass diese Neubauten jetzt Innentoiletten erhielten, wahrscheinlich in<br />
Verbindung mit einem Bad.<br />
435
436<br />
436<br />
13.3. Die Feuerwehrmänner von 1950<br />
Aufstellung vom 3.3.1950 durch den Bürgermeister Herbach
437<br />
1950: am 31.7.1949 hatten die „Alten“, die Kampferprobten, die<br />
Weltkriegsveteranen bis auf Willi Merk die Feuerwehr verlassen und den ganz<br />
Jungen den Brandschutz überlassen. Am 1.8.1950 verpflichtete dann der<br />
Wehrführer Eugen Herbrand insgesamt 20 junge Feuerwehrmänner des Jahrgangs<br />
1930 und 1931. Es waren 19 bzw. 20 jährige, kräftige Männer, die von nun an<br />
einen Großteil ihrer Freizeit der allgemeinen Sicherheit opferten. Ihnen gebührt<br />
noch heute ein großes Lob für ihren Einsatz.<br />
Name Vorname *, gelöscht aus<br />
Datenschutzgründen<br />
Herbrand Eugen,<br />
Brandmeister<br />
Merk Willi,<br />
Gruppenführer<br />
Barth Eckhard<br />
Bohlander Karl<br />
Decker Werner<br />
Dendl Herbert<br />
Denzer Hans<br />
Eimer Hermann<br />
Fischer Theobald<br />
Halfmann Kurt<br />
Heinrich Erwin<br />
Heinrich Günther<br />
Heinrich Heinz<br />
Heinrich Günther<br />
Hermann Guido<br />
Hermann Karl-Heinz<br />
Knieriemen Alfred<br />
Korn Oskar<br />
Lesoine Kurt<br />
Lesoine Willi<br />
Marburger Werner<br />
Marky Bruno<br />
Wohnort: gelösscht<br />
437
438<br />
Sittel Werner<br />
Schmidt Heinrich<br />
Weber Karl<br />
Woll Oswald<br />
438<br />
13.4. Anschaffung der Motorspritze<br />
Inzwischen war <strong>Erlenbach</strong> auf 1.300 Einwohner gewachsen, die in 250<br />
Wohnungen lebten. Die Feuerwehr war mit einer vollkommen veralteten<br />
Handdruckspritze ausgerüstet, welche schon seit langem nicht mehr für eine<br />
wirksame Brandbekämpfung ausgereicht hatte, wie sich bei dem großen<br />
Brandschaden der Witwe Emma Heinrich ja gezeigt hatte. Ein direkter Anschluss<br />
an die Wasserleitung war auch zwecklos, da der Wasserdruck viel zu gering<br />
ausfiel. Aus diesem Grund fasste 1949 der Gemeinderat den einstimmigen<br />
Beschluss eine Motorpumpe, nebst wichtigem Zubehör, anzuschaffen.<br />
Bürgermeister Herbach hatte bereits ein Angebot der Schlauch- und<br />
Feuergerätefabrik Albert Ziegler eingeholt. Das Gerät sollte mit 4<br />
Saugschläuchen und einem ballonbereiften Transportwagen 2.203,60 DM kosten,<br />
Ein weiteres Zuwarten löste nicht die Finanzprobleme. Die Sicherheit ging vor.<br />
Darum schloss die Gemeinde am 5.2.1950 mit dem Generalvertreter Otto Dörr aus<br />
Ludwigshafen einen entsprechenden Kaufvertrag ab.<br />
Aber das Geld fehlte in der leeren Gemeindekasse. Ideenreich schrieb<br />
Bürgermeister Herbach deshalb die zwei großen Feuerversicherungen an, bei<br />
denen 1950 die meisten Haushalte versichert waren. Die Briefe gingen gleichzeitig<br />
am 7.2.1950 an die Frankfurter Allianz und an die Bayerische<br />
Versicherungskammer in München raus. Die höflichen Bettelbriefe verfehlten<br />
nicht ihren Zweck und die beiden Versicherungen überwiesen jeweils 250 DM.<br />
Der Hersteller Ziegler lieferte das Gerät Ende Februar. Laut der getroffenen<br />
Vereinbarung zahlte <strong>Erlenbach</strong> 1.500 DM sofort und den Rest am 1. Juni 1950.<br />
Die Einführung am Gerät erfolgte durch Fachleute am Samstag, den 18. März<br />
1950 direkt vor Ort in <strong>Erlenbach</strong>.<br />
1960 schaffte <strong>Erlenbach</strong> einen 34 PS starken VW Bus an. Der Motor war viel zu<br />
schwach, um mit der Löschmannschaft die <strong>Erlenbach</strong>er Straße hinaufzufahren.<br />
Die Helfer mussten aussteigen und zum Teil das Fahrzeug den Berg<br />
hinaufschieben. Es war bis 1980 in Gebrauch.<br />
Zugführer Horst Müller<br />
Horst Müller trat am 1.3.1960 in die Pflicht-Feuerwehr <strong>Erlenbach</strong> ein. Er fühlte<br />
sich unverzüglich zuhause. Engagiert absolvierte er einige wichtige Lehrgänge<br />
und erarbeitete sich ziemlich schnell eine Führungsposition. 1968 avancierte er<br />
zum Kommandanten. Seine erste Amtshandlung war die Umwandlung in eine<br />
Freiwillige Feuerwehr mit einer Mannschaftsstärke von 20 Mann.
439<br />
Inzwischen erweiterte sich das Aufgabengebiet beachtlich. Früher stand der Haus-<br />
und Waldbrand im Vordergrund. Wer heute Hilfe benötigt, ruft die Feuerwehr. Ihr<br />
Motto ist retten, bergen und löschen.<br />
1973 <strong>Erlenbach</strong> war inzwischen eingemeindet und die Freiwillige Feuerwehr ist<br />
seitdem Bestandteil der Lautrer Wehr. 1973 kam dieser 82 PS starke Daimler<br />
Unimog nach <strong>Erlenbach</strong>. Er tat bis 1986 seinen Dienst.<br />
Sie kommt bei den individuellsten Notlagen, wenn z. B. die Katze nicht mehr<br />
vom Baum kommt, sie sichert und rettet Personen aus Zwangslagen, schneidet<br />
Verletzte und Tote aus verunglückten Autos und ist bei Eis und Schnee zur Stelle.<br />
Ihre Hilfe war bei den Hurrikans Wiebke und Vievien gefragt, als Bäume<br />
umstürzten und die Straßen und Wege rundum <strong>Erlenbach</strong> blockiert waren. Fast 20<br />
Stunden waren wir ohne Strom und die Feuerwehrleute mussten einen Tag ohne<br />
Schlaf im Einsatz auskommen. Der letzte große Einsatz war am 11. Mai 2001 als<br />
ein plötzliches Gewitter Schnee und Hagel wie aus Kübeln über die Weiherstraße<br />
und den Ochsenberg ausleerten. Da griffen natürlich auch sämtliche Bewohner zu<br />
den Schaufeln, um sich und anderen unter die Arme zu greifen. Allen Beteiligten<br />
sagen wir herzlichen Dank.<br />
12.6. Kirche & Konfirmationen<br />
Eine stolze Dorfgemeinschaft holte die neuen Glocken am 27. August 1950 am<br />
<strong>Erlenbach</strong>er Bahnhof ab und brachte sie zur Kirche. Wegen des Ereignisses fuhr<br />
man vierspännig. Wenige Tage danach setzte ein Fachmann die Turmuhr wieder<br />
in Betrieb.<br />
439
440<br />
440<br />
Die linke Gruppe führte die Schneiderin, Frau Becker an, an der Spitze der rechten<br />
Kolonne ging Frau Winter †, deren Sohn in Frankfurt Rechtsanwalt ist.<br />
Die Mädchen waren bildhübsch gewandet und genossen die wärmenden<br />
Sonnenstrahlen. Die Buben trugen Glocken in Blumenform. Der 3. v.l. ist ein<br />
Knieriemen und der 5. heißt Oss Woll.
441<br />
Die Glocke war herrlich geschmückt und sie war der Star des Tages.<br />
Die Konfirmanden des <strong>Jahre</strong>s 1955<br />
441
442<br />
442
443<br />
Im Hintergrund sehen wir das Haus der Lina Heinrich, links davon war die Bäckerei<br />
Schwaderer. Die Musiker sind die Herren Kurz und Hein. Der Herr Pfarrer Bopp<br />
ging voraus und ihm folgten in der rechten Reihe Frl Hager 3. und hinter ihr war<br />
Manfred B.. In der rechten Reihe war an 4. Stelle Herr STB Porr.<br />
443
444<br />
444<br />
13.7. Der Turnverein<br />
1947: Nach dem 2. Weltkrieg dauerte es doch fast 2 <strong>Jahre</strong>, bis der Sportbetrieb<br />
abermals anlief. Zuerst waren die Turner eine Unterabteilung des Sportvereins.<br />
Daraufhin erfolgte die Neugründung in 1949 unter dem alten Namen.<br />
Vorsitzender war jetzt Albert Tharun (1949 – 1954). Die Übungsstunden waren<br />
im Saal der Gaststätte Hermann, da die Gemeinde <strong>Erlenbach</strong> sich die kleine<br />
Turnhalle als Folge der <strong>Erlenbach</strong>er Nazis sich unter den Nagel gerissen hatte. Sie<br />
hatte außerdem die Halle verpachtet.<br />
Die 1950iger<br />
Auch sportlich ging es aufwärts. Unsere Turner lagen bei den zahlreichen<br />
Wettkämpfen fortwährend vorne. So war es auch kein Wunder, dass der<br />
Pfalzmeister und spätere deutsche Meister Philipp Fürst immer wieder gerne<br />
nach <strong>Erlenbach</strong> kam. Aber es blieb nicht allein beim Turnen. Das Interesse war<br />
groß, deshalb gründeten etliche Sportler die Tischtennis-Abteilung. Der TV 04<br />
erhielt auch das prominente Mitglied Walter Heckmann, der zusammen mit dem<br />
Raketenbauer Werner von Braun zusammen die Schulbank gedrückt hatte. 1963<br />
konnte der Verein noch drei Mannschaften stellen. Aber wegen wiederholten<br />
Spielerwechsels musste die 1. Mannschaft in die C-Klasse absteigen.<br />
1955: am Vormittag den 21.3.1955 veranstaltete der Turnverein seine Bundes-<br />
Winterspiele. Als Ehrengäste begrüßte der Vorsitzende Ernst Korn den<br />
stellvertretenden Bürgermeister Winter und die Lehrer Meng und Gebhard. In<br />
abwechslungsreicher Folge am Barren, Reck, Pferd und auf dem Boden konnten<br />
sich die Gäste vor der turnerischen Klasse der Turner überzeugen. Kampfrichter<br />
für die optischen Leckerbissen waren die Herren Schneider, Dendl, Herbach und<br />
Steller. Da die Turner die Messlatte sehr hoch gelegt hatten, erreichte nur Erwin<br />
Barth 72 Punkte. Bei den Mädchen waren Kunigunde Benkel * 4.11.1945,<br />
Gisela Lanzer * 22.4.1946, Eleonore Kleber * 22.10.1946, Else Jungmann *<br />
9.4.1948 und Ellen Christmann * 4.10.1949 sehr erfolgreich. Hauptlehrer Meng<br />
dankte dem Jugendtrainer Heiner Eimer für die vorbildlich geleistete Arbeit.<br />
13.8. Der Turnhallenkrieg<br />
1954: schlugen die Emotionen hoch. Der Turnhallenkrieg war ausgebrochen. Die<br />
geladene Stimmung entlud sich in der Generalversammlung, in der der von allen<br />
geschätzte Korn Ernst zum Vorsitzenden gewählt wurden. Die Turner feierten,<br />
wie es damals üblich war, im großen Rahmen ihr 50jähriges Jubiläum. Dazu<br />
gehörte der Festgottesdienst und ein prächtiger Umzug durch das geschmückte<br />
Dorf. Naturgemäß herrschte eine Atmosphäre mit Sang und Klang. Gekommen<br />
war u.a. der Präsident des Sportbundes Pfalz. In seiner feurigen Rede gab Ernst<br />
Korn das Versprechen ab, nicht eher zu ruhen, bis dem Verein sein Eigentum<br />
zurückerstattet würde. Da vermochte der Chef des Sportbundes nicht ruhig sitzen<br />
zu bleiben. Ohne sich mit seinen Vorstandskollegen abzusprechen, gab er die<br />
mündliche Zusage, dass der Sportbund die Prozesskosten tragen würde.<br />
Ernst Korn versuchte mit dem Bürgermeister diesbezüglich ins Gespräch zu<br />
kommen. Nichtsdestotrotz blockte die damalige Gemeindeführung ab und war<br />
nicht kooperativ. Da die Gemeindeverwaltung unter dem Bürgermeister Merk sich
445<br />
absolut stur stellte, musste der Turnverein beim Landgericht auf Herausgabe<br />
klagen. Die Prozesskosten bis zu 7.000 DM wollte der Sportbund bezahlen. Am<br />
14.10.1955 war die Verhandlung. Der Vorsitzende Richter schlug folgenden<br />
weisen Vergleich vor: Die Gemeinde rückt die Turnhalle wieder heraus und<br />
1. der Turnverein zahlt an die Gemeinde den geschuldeten Betrag von 3.785<br />
allerdings in DM, der seit 1933 offenstand.<br />
Am nächsten Tag versammelte sich der Gemeinderat unter dem Vorsitz des<br />
Bürgermeister Merks. Da ging es hoch her, wie wir aus dem Gesprächsprotokoll<br />
des Walter Klein 495 entnehmen können. 90 Minuten waren aggressiv<br />
vorgetragene Wortmeldungen vorherrschend. Da flogen die Fetzen. Mit 13: 2<br />
Stimmen wurde der Antrag verschmäht. Die Mehrheit war der Meinung, dass der<br />
Verein sich eine neue Turnhalle bauen sollte.<br />
Aber das Landgericht ließ nicht locker. Langsam kehrte Ruhe und Vernunft ein.<br />
Im April 1957 gelang endlich der Durchbruch, nachdem Neuwahlen dem<br />
Gemeinderat eine andere Zusammensetzung gegeben hatte. Es war ein<br />
Kompromiss und so konnte jeder sein Gesicht wahren und jede Partei hatte<br />
irgendwie Recht bekommen.<br />
Aber die Turner waren noch lange nicht am Ziel. Denn der Pächter hatte 1947 mit<br />
der Gemeinde einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 25 <strong>Jahre</strong>n abgeschlossen<br />
und der wollte nicht heraus, denn so billig kam er anderswo nicht unter. 1959<br />
entschied das Amtsgericht Kaiserslautern die Räumung. Das Engagement Ernst<br />
Korns hatte sich ausgezahlt. Aber es wäre auch schlimm gewesen, wenn es anders<br />
gekommen wäre.<br />
13.9. Bau des Handballplatzes<br />
1957: Im März veranstalteten die umliegenden Turnvereine im Gasthaus Kraus<br />
Otterberg eine Werbeveranstaltung, um dem Turnverein Otterberg wieder auf die<br />
Beine zu helfen. Eine besondere Attraktion waren die fünf <strong>Erlenbach</strong>er<br />
Akrobaten. Die durften bei keiner Schauvorstellung fehlen. Heiner Eimer,<br />
Friedel Schwaderer, Hugo Steller, Horst Steinberg und Heinz Heinrich<br />
zeigten erstaunliche Figuren. Die uns vorliegenden Bilder entstanden beim großen<br />
Werbeabend in Otterberg im März 1957 496 .<br />
1957: Es war Juni und der Turnverein beging seine 50jährige Fahnenweihe. Da<br />
die Halle noch nicht zur Verfügung stand, feierte man draußen, aber das Wetter<br />
war nasskalt. Die meisten Besucher waren deshalb mit Hüten und langen Mänteln<br />
gekommen. Zwischen zwei heftigen Regenschauern ehrte der Verein die<br />
Mitglieder, die bereits 50 <strong>Jahre</strong> lang dem Turnen treu verbunden waren: Die<br />
waren Michael Bandel (* 25.12.1881) und Adam Heinrich (* 18.3.1894). Die<br />
alte Fahne bekam eine neue Schleife. Und dann ging es schnell in das<br />
Vereinslokal Oskar Korn.<br />
1959 21. Juni, gab es wieder ein ausgelassenes Fest. Der Rahmen war ein<br />
Schauturnen, als Korn Ernst seinen Sportlern den Turnplatz und die renovierte<br />
Turnhalle offiziell wieder überreichte. Der Turnverein war sportlich und<br />
495 ) Klein, Walter, * 26.10.1925 in <strong>Erlenbach</strong>, turnte seit dem 21.7.1955 für den TV 04<br />
496 ) Bericht der „die Rheinpfalz“ vom 20.3.1957,<br />
445
446<br />
446<br />
wirtschaftlich im Aufwind. Nach umfangreichen An- und Umbauten eröffnete der<br />
Turnverein am 18. August 1959 (18.8.1959) seine neue Gaststätte „Zum<br />
Turnerheim“. Dies ist auch heute noch ein Ort, wo man sich wohl fühlen kann.<br />
Herrlich sind die Linden, unter denen man im Sommer in geselliger Runde sich<br />
der Nacht entgegentrinken könnte, wenn da nicht der schaukelnde Heimweg oder<br />
das wachsame Auge des Gesetzes wäre.<br />
13.10. Die 60iger & 70iger <strong>Jahre</strong><br />
1963 hatte die alte Turnhalle noch eine neue Ölzentralheizung erhalten. Dadurch<br />
konnten auch in den bitterkalten Wintermonaten die Turnstunden des Vereins und<br />
der Schule problemlos durchgeführt werden. Erwin Barth (Jugendwart) betreute<br />
damals 50 Jugendliche, deren Leistungen >Die Rheinpfalz< vom 17.1.1964 als<br />
sehr ansprechend bezeichnete. Die Leistungen des Turnvereins honorierten die<br />
Einwohner durch aktive Mitgliedschaft. Jeder 10. <strong>Erlenbach</strong>er war deshalb<br />
Mitglied des TV 04.<br />
1964: Der Verein veranstaltete am 1. Februar seinen jährlichen Faschingsball.<br />
Veranstaltungsort war die Gaststätte Kläs in der heutigen <strong>Erlenbach</strong>er Straße.<br />
Eine junge 5-Mann-Band spielte und heizte den Besuchern kräftig ein. Die<br />
Stimmung war riesig. Die erhaltenen Fotos dokumentieren die Lebensfreude des<br />
Abends.<br />
1964: Die Gemeindeverwaltung und der damalige Gemeindeanzeiger gratulierte<br />
den älteren Mitbürgern zum Geburtstag. Sie waren:<br />
• Katharina Strack, geborene Bachmann, * 20.1.1884,<br />
• Michael Fleischer, * 21.1.1887, Sonnenstraße 3<br />
• Eva Hoffmann, geb. Merk, * 21.1.1889, wohnhaft in der Hauptstr. 13<br />
• Therese Schröttinger (ledig), * 22.1.1892, Friedhofstraße 8,<br />
• Heinrich Thines, * 23.1.1888, Hauptstraße 8<br />
• Maria Wesner, geb. Hollstein, * 24.1.1894, Flurstraße 6<br />
1964: 3. August 164: Der Turnverein nahm sein 60jähriges Jubiläum zum Anlass,<br />
zwei Tage lang mal groß zu feiern und Rückschau zu halten. „Mit<br />
Fanfarenklängen eröffnete der Spielmannzug Morlautern unter Wilhelm Lenz den<br />
Festabend. Der Gesangverein <strong>Erlenbach</strong> sang unter der Leitung des Lehrers<br />
Georg Meng. Danach war die Mitgliederehrung, der ältesten, noch lebenden<br />
Mitglieder von 1904. Dies waren Heinrich Thines, Karl Woll und Michael<br />
Bandel. (siehe oben Näheres unter Punkt 7.6.)<br />
Pfarrer Edgar Popp aus Otterberg hielt am Sonntagmorgen unter Gottes freiem<br />
Himmel seine Predigt. Die Leitworte der Turner, Frisch, Fromm, fröhlich, Frei<br />
nahm er als Aufhänger, den Zusammenhang zwischen ausgewogener Ernährung,<br />
viel Bewegung als Voraussetzung für unsere Gesundheit und Gemütslage<br />
darzustellen. Seine Meinung über den damaligen Tanz wird wohl heute keiner<br />
mehr teilen: Er malte das Bild der gliederverzerrenden Urwaldtänze, die selbst<br />
dem Affengeschlecht unbekannt seien. Pfarrer Popp machte auch abfällige
447<br />
Bemerkungen über die schwächlichen und verweichlichten Jugendlichen, die sich<br />
nicht engagieren und nur das Saufen kennen würden 497 .<br />
Nachmittags bewegte sich ein bemerkenswerter Festzug durch die Ortsstraßen<br />
zum Festplatz am Turnerheim. Das Nachmittagsprogramm war vielfältig und<br />
wurde durch unterschiedliche Turnvorführungen spannend gestaltet.<br />
1965: Die <strong>Jahre</strong>shauptversammlung beschloss den Bau der heutigen Turnhalle.<br />
Der Baubeginn zögerte sich leider bis 1970 hinaus. 1972 konnte sie mit einem<br />
großen Sport- und Familienfest eingeweiht werden. Der Geräteraum kam in den<br />
80ern und das Sitzungszimmer entstand in den 90er <strong>Jahre</strong>n.<br />
1971: Ende der 60iger rollte eine neue Fitness-Welle von Amerika aus über ganz<br />
Westeuropa hinweg. Selbst die <strong>Erlenbach</strong>er wollten sich diesem Trend nicht<br />
entziehen. So organisierten die Turner für den 15. August 1971 den ersten<br />
internationalen Volkslauf. Mehr als 900 Läufer, Geher und Wanderer nahmen die<br />
Einladung an. Mit einem so großen Andrang hatte der Vorsitzende Heinz Weber<br />
nicht gerechnet. Start und Ziel war das Turnerheim und dann ging es bergauf und<br />
bergab zum Weinbrunnerhof. Die Teilnehmer waren von der idyllischen<br />
Streckenführung durch unsere schönen Wälder und entlang blühender Wiesen<br />
wahrhaftig begeistert. Vielen gefiel jedoch nicht die Unsportlichkeit einiger<br />
Teilnehmer, die sich durch Rempeleien und Wegstoßens freien Raum für<br />
schnelleres Laufen geschafft hatten.<br />
1972: am 13.8.1971 war der 2. Volkslauf. Dieses Mal war die Teilnehmerzahl<br />
noch größer als im Vorjahr. Der Verein hatte sich gerüstet und so konnten alle<br />
Teilnehmer am Start und Ziel und unterwegs gut mit Speis und Trank versorgt<br />
werden.<br />
1973: 13.8.. Der Volkslauf stand unter dem Motto bleib fit, mach mit. Der<br />
finanzielle Erfolg weckte Neid. Und so schwammen immer mehr Vereine auf der<br />
Laufwelle und machten sich gegenseitig Konkurrenz. 1975 war die Beteiligung so<br />
schwach, dass der Verein keinen weiteren Volkslauf mehr veranstaltete.<br />
13.11. Kerstin Barth, das Aushängeschild 498<br />
1988: Im Rahmen des Schauturnens am Samstag den 12. November ehrte der<br />
Verein seine beste Turnerin. Kerstin Barth. Dazu hatte der Vorsitzende Dietmar<br />
Zund etliche Gäste eingeladen. Der Vorsitzende des Turngaus Sickingen Heinz<br />
Christmann, Klaus Hach, der Chef des Sport- und Bäderamtes und natürlich der<br />
<strong>Erlenbach</strong>er Ortsvorsteher Oswald Henrich waren gekommen. Warum stand<br />
Kerstin Barth im Mittelpunkt der Ehrungen?<br />
Unmittelbarer Anlass war ihr bombastischer Erfolg bei dem Deutschen Turnfest<br />
in Dortmund und Bochum gewesen. An dem Wettbewerb hatten 53 Turner aus<br />
ganz Deutschland teilgenommen und unsere Kerstin hatte triumphiert. Sie hatte<br />
den Siegerpokal im Kür-4 –Kampf gewonnen. Der damalige Jugendwart Arno<br />
497 ) Aus „Die Rheinpfalz“, 5.8.1964, Heute, über 40 <strong>Jahre</strong> danach, sind wir, die damaligen<br />
Saufbolde schon Großeltern und haben im Leben pflichtgemäß unseren Mann gestanden .<br />
498 ) Quelle: „Die Rheinpfalz“<br />
447
448<br />
448<br />
Barth hob in seiner Rede hervor, dass Kerstin damit ihre langjährige und<br />
außerordentlich erfolgreiche Karriere im Kür-Vierkampf gekrönt hatte. Wie hatte<br />
alles begonnen?<br />
Bereits im Alter von zwei <strong>Jahre</strong>n begann Kerstin mit dem Turnen. Ihre Trainer<br />
waren die selbst erfolgreichen Turner-Eltern Christa und Erwin. Bereits mit fünf<br />
<strong>Jahre</strong>n beherrschte sie fast alle schweren Übungen des Bodenturnens. Mit acht<br />
<strong>Jahre</strong>n verschrieb sich Kerstin dem Kunstturn Leistungssport. Mit elf <strong>Jahre</strong>n<br />
wurde sie das erste Mal Pfalzmeisterin. Jährlich nahm sie an den Deutschen<br />
Meisterschaften teil und glänzte jedes Mal mit vorderen Platzierungen. 1988<br />
gelang ihr mit dem Sieg dann der größte Coup.<br />
Kerstin legte 1989 am Heinrich Heine Sportgymnasium das Abitur ab. Sie hatte es<br />
verstanden, in vorzüglicher Art und Weise ihre akademischen und sportlichen<br />
Ambitionen miteinander zu verbinden. Bereits als Jugendliche hatte sie sich als<br />
Gaukunst-Turnwartin betätigt. Im Rahmen ihrer Ausbildung im Bundes-<br />
Leistungs-Zentrum hatte sie als einzige Frau die Lizenz als Bundes-<br />
Kampfrichterin erworben.<br />
Kerstin hat nun selbst zwei Kinder. Neben ihrem Beruf und ihren Belastungen als<br />
Hausfrau und Mutter opfert sie wöchentlich drei Nachmittage, um ihr Können und<br />
ihr Wissen an unsere jungen Sportlerinnen weiterzugeben. Man sieht, die<br />
Mädchen sind mit großer Begeisterung beim Training und absolvieren<br />
konzentriert und engagiert jede Turnübung. Für mich als Sportler und früherer<br />
Turner ist es sehr erstaunlich, welche Spitzenleistungen da mit Feuereifer gezeigt<br />
werden. Die 11jährige Johanna ist eine Prinzessin des Hochrecks. Ihre gestreckten<br />
Riesenfelgen im Sekundentakt, umgreifen, Handstand und dann ihr geschraubter<br />
Flugabgang sieht der objektive Beobachter mit großen Augen. Der Trainerin<br />
Kerstin gebührt permanent ein Riesenbukett von dankenden und ehrenden<br />
Worten.<br />
Das Jahr 2005<br />
Unsere akrobatische Mädchengruppe (1.6.2005)<br />
Leitung Kerstin Brand, geborene Barth
449<br />
beim Dehnen und Strecken<br />
449
450<br />
450<br />
Handstand auf dem Reck, eine starke Leistung!
451<br />
Aber der Turnverein 04 <strong>Erlenbach</strong> ist auch ein anerkanntes Leistungszentrum. Viele<br />
amerikanische Familien wissen von dem guten Ruf und schicken ihre Kinder zur<br />
Ausbildung nach <strong>Erlenbach</strong>. Von der großen Mädchengruppe kommen nur noch vier<br />
aus <strong>Erlenbach</strong>.<br />
451
452<br />
452<br />
13.12. Der prot. Kindergarten<br />
1935 war in der Bergstraße das alte Kindergarten-Gebäude errichtet worden, das<br />
allen damaligen Hygiene - Vorschriften entsprach. Nach dem Kriegsende war der<br />
Kindergarten wegen des Wohnungsmangels erst einmal privat bewohnt. Als die<br />
französischen Manövertruppen Platz für ihre Soldaten benötigten, bot die<br />
Gemeinde das Gebäude als Kommando- und Leitstelle an. Ab 1949 bemühte sich<br />
die Gemeinde um eine baldige Wiedereröffnung. Zu diesem Zweck schloss sie<br />
mit dem Diakonissen-Mutterhaus in Marburg einen Vertrag zur Gestellung<br />
einer Kindergärtnerin. Aber sehr schnell kam die Gemeinde an ihre finanziellen<br />
Grenzen. Deshalb beabsichtigte der Gemeinderat, das Gebäude an die<br />
Evangelische Kirche der Pfalz zu verkaufen und den Betrieb der protestantischen<br />
Kirchengemeinde zu übertragen. Natürlich wollte sich die Gemeinde nicht ganz<br />
aus ihrer Verantwortung stehlen und sie sicherte dem kirchlichen Träger einen<br />
jährlichen Betriebszuschuss zu.
453<br />
13.13. Der FCE<br />
Der Krieg war schlimm gewesen, aber dennoch ging das Leben weiter. Man<br />
benötigte Ablenkung und Sport ist und war hierfür die beste Möglichkeit. Die<br />
Militärverwaltung in Otterbach genehmigte im Dezember 1945 499 wieder den<br />
Amateur-Fußball. Selbst die Turner fanden sich wieder ein, zuerst als eine Abteilung,<br />
aber schon 1949 gründete sich der Turnverein 1904 wieder neu.<br />
1950 Die <strong>Erlenbach</strong>er Fußballer waren schon vor dem Krieg spitze, auch jetzt hatten<br />
sie in ihrer Liga keinen adäquaten Gegner. 1950 stiegen sie auf. In der<br />
Meistermannschaft spielten erstklassige Leute, deren Namen noch heute einen guten<br />
Klang haben. Karl Weber, Walter Hager, Willi Merk, Karl Thines, Hugo<br />
Schneider, Fritz Sokoly, Eugen Merk, Erwin Schmidt, Herbert Martin (*<br />
21.10.1918). August Schneider und Fritz Heinrich.<br />
Das Photo zeigt die Herren Sportfunktionäre noch ganz in der alten Tradition, ohne<br />
Hut galt man nicht als angezogen.<br />
499 ) 1946: neue Mitglieder waren Walter Hager, Lesoine Kurt, Hans Reisel, Fritz Sokoly und Karl<br />
Weber<br />
453
454<br />
454<br />
Diese Mannschaft gewann die Meisterschaft der Bezirksklasse und stieg damit in die<br />
II. Amateurliga auf. Die fünf Betreuer waren von links Hans Blauth, Artur Strack<br />
dann die siegreiche Elf: bestand aus Karl Weber, Heiner Katzenbach, Daniel<br />
Stanger, Werner Marburger, Klaus Illig, Fritz Sokoly, Hugo Schneider, Eugen Merk,<br />
knieend Karl Christmann, August Schneider und Fritz Heinrich. Neben dem<br />
Schiedsrichter stehen Albert Winter (die Schwalb) Karl Hix und Kurt Bandel
455<br />
13.14. Die Sportler von 1955<br />
Am 27. Dezember teilten die beiden Sportvereine ihre Mitgliederzahlen dem<br />
Bürgermeisteramt <strong>Erlenbach</strong> mit. Bürgermeister war damals Herr Merk.<br />
455
456<br />
aktive Mitglieder<br />
456<br />
FCE Turnverein<br />
bis 13 <strong>Jahre</strong> 11 35 (19 weibl<br />
14 bis 18 <strong>Jahre</strong> 13 24 (8 weibl<br />
über 18 <strong>Jahre</strong> 32 12<br />
passive Mitglieder 149 (2 weibl 42<br />
insgesamt 207 (2 weibl 113 (2 weibl<br />
Liebe Leser, Sie sehen der Turnverein hat und hatte zwei Vorteile. Erstens mehr<br />
als die Hälfte sind aktive Sportler und zweitens überrascht der hohe Anteil an<br />
Mädchen und Frauen, die Sport treiben.<br />
Freunde kicken
457<br />
13.14. Bau der Sportanlagen<br />
1950: Die FCE- Generalversammlung unter der Leitung ihres Vorsitzenden<br />
Richard Groß 500 vom 16.1.1950 war richtungweisend. Sie beschloss den heutigen<br />
Sportplatz zu bauen. Der Vorstand nahm mit der Gemeinde <strong>Erlenbach</strong><br />
dementsprechende Kontakte auf und fand offene Ohren und Türen. Bereits am<br />
15.6.1950 schloss der Vorstand mit der Gemeinde einen Pachtvertrag.<br />
Richard Groß, Vorstand von 1949 bis 1952, er war Schreinermeister und half<br />
nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft, die Firma Pfaff wieder aufzubauen.<br />
Jetzt konnte der Verein an die Realisierung gehen. Durch die Vereinsaktivitäten<br />
gewann der Verein viel Sympathie. 14 neue Mitglieder traten 1950/51 ein, die bis<br />
zu ihrem Tod dem Verein die Treue hielten 501 . Zahlreiche größere und kleinere<br />
Spenden häuften sich zu einer erstaunlichen Summe. Bei der Weihnachtsfeier kam<br />
nochmals viel Geld zusammen. Dann war erstmals Schluss, denn es war Winter<br />
und es lag Schnee. Der Boden war zudem gefroren. Als das Wetter sich besserte,<br />
versammelten sich zahlreiche Helfer, um das Waldstück zu roden und für den<br />
Platzbau aufzubereiten. Das war ein hartes Stück Arbeit, das sich bis in das Jahr<br />
1956 502 hinzog. Denn schwere Maschinen standen nicht zur Verfügung. So<br />
dauerte es mehr als fünf <strong>Jahre</strong>, bis endlich am Wochenende des 28. und 29. Juli<br />
1956 die Einweihungsfeier den offiziellen Spielbetrieb auf dem Buchberg<br />
eröffnete. Es war ein großes Fest und ein hervorragender Rahmen, um Danke zu<br />
sagen. Ein Beisitzer hatte die geleisteten Stunden aus den Helferlisten aufaddiert<br />
und war zu einem erstaunlichen Ergebniss gekommen. Mehr als 20 Mitglieder<br />
hatten jeweils mehr als 500 Stunden beim Stadionausbau erbracht 503 .<br />
Morgens war der Festgottesdienst und nachmittags, nach dem Eröffnungsspiel,<br />
spielte die Kapelle des Musikvereins. Zur Erinnerung und als Dankeschön an die<br />
Zehntausend Helferstunden errichtete die Vereinsleitung unter der Leitung von<br />
Kurt Bandel einen heute wenig beachteten Gedenkstein, der in der Rundung zur<br />
Mehrzweckhalle steht. Der Sportplatzbau war ein anerkennenswerter Höhepunkt<br />
für die Vereinsarbeit Kurt Bandels, um die Verantwortung in die Hände Kurt de<br />
Schryvers zu legen. Denn Kurt betrieb in KL im alten Pfalztheater-Gebäude<br />
einen gut gehenden Photoladen, der seine ganze Arbeit nun erforderte.<br />
1957: Kaum war diese Last geschultert, nahm der Verein das nächste große<br />
Projekt ins Visier: das Vereinsheim. Fachleute schätzten den Bau auf 70.000 DM.<br />
Bereits ab dem Frühjahr 1958 standen samstags die Helfer wieder unentgeltlich<br />
bereit. Wer mauern konnte, mauerte. Auch genug Laien leisteten wertvolle<br />
Handreichungen wie: Mörtel anrühren & tragen, Steine holen und bereitstellen.<br />
Mittags Schlag 12 Uhr kamen die Hausfrauen oder die Kinder mit den<br />
Essenskännchen und versorgten die verschwitzten Arbeiter. Insgesamt benötigten<br />
die fleißigen Heinzelmännchen drei <strong>Jahre</strong>, um den ersten Bauabschnitt fertig<br />
500 ) Richard Groß war von 1949 bis 1952 FCE Vorsitzender. Ihm folgte für 6 <strong>Jahre</strong> Kurt Bandel.<br />
501 ) Barth Erwin, Bang Karl †, Becker, Adolf, Hager Werner, Herbach Gerhard, Herbach Hardi,<br />
Herbach Philipp, Korn Heiner, Erhard Marky, Hugo Merk, Wilfried Müller †, Eugen Reisel †,<br />
Otto Wenzel und Hermann Wenzel.<br />
502 ) 1956 traten Peter Knieriemen und Horst Ruelius ein!<br />
503 ) Besonderes Engagement hatten gezeigt: Karl Trautwein, Richard, Groß, de Schryver Kurt,<br />
Albert Winter, Karl Hix, Otto Herbach, Fritz Knieriemen, Artur Strack, Schneider Hugo, Lesoine<br />
Kurt, Hartwig Speier, Heinz Zimmer, Bandel Kurt, Fritz Heinrich und Kurt Wilhelm, Weber Karl,<br />
Willi Lenz, Eugen Engel, Kurt Wilhelm, Jacob Herbach, Barth Emil<br />
457
458<br />
458<br />
zustellen. Sie konnten stolz sein und erhielten deshalb von allen Anerkennung.<br />
Was hatten sie nicht alles geleistet? Gezimmert, das Dach gedeckt, die Elektro-<br />
und Sanitär-Installationen erledigt, verputzt, gefliest, gestrichen und Estrich<br />
gelegt. So entstanden die Duschräume & Umkleidekabinen für die Spieler, ein<br />
Sitzungsraum und eine Gaststätte mit einer kleinen Wohnung.<br />
Doch alles war etwas zu klein und zu beengt geraten. So war die Erweiterung<br />
zwangsläufig. Die finanziellen Mittel errang der FCE 1964 durch den Verkauf<br />
seines alten Geländes, auf dem acht Wohnhäuser entstanden. Damals nahm das<br />
Sportheim die Gestalt und den Schnitt an, den es heute noch prägt. Längst sind<br />
wieder Renovierungen und Verbesserungen fällig, um einen zeitgemäßen<br />
Standard halten zu können.
459<br />
13.15. Der Gesangsverein<br />
459
460<br />
460
461<br />
13.15. Das Unwetter am 11.5.2000<br />
Im 18. Jahrhundert war man felsenfest davon überzeugt, dass der liebe Gott die<br />
bösen Sünder bestrafte. Hierfür nahm unser himmlischer Vater Blitz, Donner,<br />
Regen- und Hagelstürme zur Hand. Wenn dies auch heutzutage zu treffen würde,<br />
dann sind auf dem Ochsenberg und in der Weiherstraße <strong>Erlenbach</strong>er Sünder<br />
ansässig. Aus diesem Grund sandte er am späten Samstagnachmittag mal ein paar<br />
eindrucksvolle Abmahnungen. Gegen 18 Uhr ging es los. Es krachte und blitzte<br />
direkt über unseren Köpfen und es war das schwerste Unwetter seit Jahrzehnten.<br />
Walnussgroße Eisbrocken krachten auf die Haus- und Autodächer, die nach<br />
kurzem wie Streuselkuchen aussahen. Das Wasser stieg und stieg und bald danach<br />
war aus der Weiherstraße ein rasant fließender Bach geworden. Die Kinder hatten<br />
Spaß an dem, was sie sahen. Die Hausbesitzer schauten erst erstaunt, dann doch<br />
entsetzt, was sich innerhalb weniger Minuten entwickelte. Das Wasser reichte bis<br />
an die Radnaben der Autos. Wer Pech hatte, dem lief blitzartig der Keller voll.<br />
Die Feuerwehren aus KL, Morlautern und Siegelbach waren prompt zur Stelle.<br />
Dem Wehrführer Hans-Otto Kraus genügte ein geübter Blick und dann kamen<br />
seine Kommandos. Unsere Helfer öffneten die schweren Gullys, damit das<br />
Wasser ablaufen konnte. Daraufhin begannen die Wasserwehrleute koordiniert<br />
und rasant ihren Kampf gegen das nasse Element. Als die dicken C- Rohre<br />
lagen, pumpten die starken Lautrer Motoren mit voller Kraft und die Nachbarn<br />
halfen sich gegenseitig bei der Schadensbegrenzung bzw. deren Beseitigung.<br />
Das <strong>Erlenbach</strong>er Feuerwehr-Auto ist auf dem Chassis eines 7,49 Tonnen Daimler<br />
LKW aufgebaut. Die berühmte Fachfirma Ziegler fertigte darauf eine rund um<br />
perfekte Feuerbekämpfungs-Einheit. Das Fahrzeug hat die Typenbezeichnung LF<br />
8/8 und bringt 9,2 Tonnen Gesamtgewicht auf die Achsen. Der permanente<br />
Tankinhalt beträgt 800 Liter. Die Pumpenleistung von 800 Liter je Minute ist<br />
beachtlich. Der Wasserdruck von 8 bar löscht unverzüglich kleinere Brandherde.<br />
An den Einsatzort können neben dem Wehrführer noch 8 Feuerwehrleute<br />
mitfahren.<br />
Regelmäßige Wartung und Pfleg tut not. Diesmal erledigt von Michael und<br />
Martin Bürthel und Thomas Heinrich.<br />
13.15. Gefesselt in einer blauen Plastikhülle<br />
eine Männerleiche im Hagelgrund<br />
2005, 25. März: Am Karfreitag war wunderschönes Wetter. Die Sonne schien und<br />
angenehmes Frühlingswetter lockte zum Spaziergang. Die 51jährige Carla Eberle<br />
packte ihren Hund „Bino“ in den Kofferraum und fuhr in den Hagelgrund. Zuerst<br />
führte sie ihn an der Leine und dann durfte er frei herumlaufen. Die beiden liefen bis<br />
zur Waschmühle und dann kehrten sie um. Der Weg bereitete den beiden einen<br />
vergnüglichen Tag und öffnete ihr Herzen. Dass ihr viele Menschen begegneten,<br />
störte sie nicht. Bino war in seinem Element. Stöckchenwerfen und dann ab und zu<br />
sprang er in den Eselsbach. So ging es langsam wieder zum Auto zurück.<br />
Kurz vor 18 Uhr: Doch kurz vor der K 9 schlug Bino an. Carla Eberle rief den<br />
Hund, aber der kam nicht. Bino bellte und bellte und rührte sich nicht vom Platz.<br />
Also ging Frau Eberle die 30 Meter durch die Wiese. Was sie sah, ließ ihr Herz vor<br />
Schreck fast stehen. Ein Totenschädel grinste sie an. Sie packte ihren Hund am<br />
461
462<br />
462<br />
Halsband und rief mit dem Handy die Polizei an. Was dann kam, war Routine. Die<br />
Leitstelle alarmierte Kriminalpolizei und Feuerwehr. Doch was war wirklich<br />
passiert? Wir zitieren aus der Rheinpfalz Nr. 72 vom 29. März.<br />
„Es war am säten Abend des Karfreitags, eine Szene wie aus einem Krimi-Reißer.<br />
Die Stille des Eselsbachtals an der kleinen Brücke über die Kreisstraße 9 in der<br />
Gemarkung <strong>Erlenbach</strong> wurde durch das laute Motorgeknatter zweier Stromaggregate<br />
der Feuerwehr zerrissen. Scheinwerfer erhellten mehr als 500 Quadratmeter des<br />
Wiesentals in ein gespenstiges Kunstlicht. Nebelschwaden zogen durch das Tal,<br />
legten sich wie Schleier um die Flutlichtstrahler. Polizisten hatten ein weißrotes<br />
Absperrband großzügig um die Fundstelle gespannt.<br />
In der Wiese in Richtung Waschmühle waren im kargen Licht vier Menschen<br />
auszumachen, die sich über etwas am Boden beugten: Beamte der Kriminalpolizei,<br />
die sich um den makabren Fund kümmerten, den der Hund der Spaziergängerin<br />
Stunden vorher aufgestöbert hatte. Es handelte sich um die flüchtig mit Erdreich<br />
bedeckte und wenige Zentimeter tief, offensichtlich in aller Eile eingebuddelte<br />
Leiche eines Mannes. Gefesselt mit einem Computerkabel war der Tote eingehüllt in<br />
eine blaue Plastikhülle.<br />
Der Körper des Unbekannten war teilweise bereits mumifiziert. Was daraus<br />
schließen lässt, dass er bereits geraume Zeit in der Erde lag. Teile der Hände und<br />
Füße fehlten, sie waren vermutlich von Wild frei gescharrt und gefressen worden.<br />
Ein Gerichtsmediziner aus Mainz kam noch am Abend zur Fundstelle und nahm<br />
nähere Untersuchungen vor.<br />
War die Fundstelle auch der Ort an dem der Mord geschah? Nachdem die Spuren<br />
gesichert waren, brachte ein Beerdigungsunternehmen die Leiche zur<br />
gerichtsmedizinischen Untersuchung. Die Polizei erklärte, die Leiche sei inzwischen<br />
obduziert worden. Es handelte sich um einen 1,83 m großen Mann, der etwa 40 – 50<br />
<strong>Jahre</strong> alten Mitteleuropäer. Aber weder die Identität, noch die genaue Todesursache<br />
konnten festgestellt werden. Weitere Untersuchungen, auch toxilogischer Art werden<br />
folgen.<br />
30. März Am Dienstag gelang die Identifizierung. Ein Mitarbeiter der<br />
Stadtverwaltung brachte die Polizei auf die Spur. Der hatte sich durch die<br />
Presseveröffentlichung an gefundene Ausweispapiere erinnert. Er rief an und<br />
Polizisten holten die Dokumente am Dienstag ab. Daraufhin ermittelte die Kripo den<br />
Zahnarzt des Toten. Jetzt steht fest, es handelt sich um einen 48 jährigen<br />
Russlanddeutschen, der allein in einem Einzimmer- Appartement wohnte. Vor etwa<br />
4 Monaten sei er verschwunden und der Vermieter renovierte die Wohnung und<br />
vermietete sie weiter.
[AKTEN]<br />
Ober Appelations Gericht 311<br />
[BERUFE - POLIZEIDIENER]<br />
Knieriemen, Jacob III. 367, 389<br />
[BERUFE)<br />
Feuerwehrhauptmann 461, 492, 494<br />
[BERUFE]<br />
Metzger 352, 419<br />
463<br />
INDEX<br />
[BERUFE] 220, 227, 238, 243<br />
Adjunkt 374, 375<br />
Bauschaffner 374<br />
Bauunternehmer 374, 375<br />
Bezirksbauschaffner 374, 376<br />
Bürgermeister 373, 374, 375, 376<br />
Chirurg 219<br />
Dragoner 169, 231, 290, 305<br />
Fußsoldaten 72, 74, 87<br />
Geometer 340<br />
Hebamme 204, 307, 358, 380<br />
Hirte 187, 231, 234, 260, 272, 341<br />
Hutmacher 119, 239<br />
Landrat 204, 205, 328, 459, 494<br />
Landwirte 373<br />
Polizei 174, 175, 261, 347, 493, 522, 523<br />
Polizeidiener 374<br />
Schäfer 230, 231, 260, 273, 341, 351, 352, 407, 419, 526<br />
Schreiner 183, 205, 365, 402, 432<br />
Schultheiß 15, 20, 23, 31, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 115, 166, 174, 221, 225, 260, 261, 263,<br />
269, 271, 273, 278, 353<br />
Steinmetzmeister 23, 36<br />
Strumpfstricker 248<br />
Tuchmacher 230<br />
Unternehmer 374, 376<br />
Zimmerleute 201, 202, 365<br />
[KAISER, KÖNIGE, POLITIKER]<br />
Richelieu, Kanzler Frankreichs 132, 146<br />
[LEHRER]<br />
Karl Gugel 401, 418, 428, 429<br />
[LEHRER]<br />
1717 - 1726 Bourgeois David 189, 197, 198, 201, 203, 206, 207, 209, 211, 215, 216, 222<br />
Anthone Migeot (bis 1714) 190, 197, 216, 220, 333<br />
Antoine Migeot (bis 1714) 189, 192, 202, 204<br />
August Schneider, 1913 387, 388, 390<br />
Ernst Stamm (1824 - 1844) 361<br />
463
464<br />
464<br />
Ernst Stamm (1824 - 1<strong>850</strong>) 361<br />
Hedwig Weber 428<br />
Heinrich Hofstadt, Morlautern 387<br />
Heinrich Jeblick 387, 390, 427<br />
Jacob Schmidt 418, 427, 429<br />
Johann Jacob Rheinheimer 361<br />
Johann Peter Gutenberg († 1781) 265, 273<br />
Johann Peter Gutenberg (oo 1781) 265, 274, 361<br />
Johanna Steiner 400<br />
Jost Riemenschneider († 1740) 232<br />
Jost Riemenschneider, († 1740) 263<br />
Julius Schmidt (1900 - 1916) 386, 387, 388<br />
Julius Schmidt (1900 – 1916) 390<br />
Julius Schmidt (1900 – 1916) 390<br />
Julius Schmidt (1900 – 1916) 390<br />
Paula Guth 401<br />
Riemenschneider, Jost 231, 232, 233, 263, 361<br />
Thekla Weynantz (1916) 387, 390<br />
Valentin Caub † 1728, 230, 263<br />
Wilhelm Cherdron (1906) 371, 387<br />
Wilhelm Ludt 387, 390, 427<br />
[ORTE<br />
Obermoschel 158<br />
[ORTE)<br />
Pfeddersheim, Bauernkrieg<br />
[ORTE]<br />
Alsenborn 26, 304<br />
Sedan 160, 168, 389<br />
[ORTE]<br />
Albisheim 50, 52<br />
Albisheim a.d. Pfrimm 39, 125, 182, 322<br />
Albisheim a.d.. Pfrimm 173<br />
Alsenborn 75<br />
Alsenbrück 22, 35<br />
Altleiningen 84, 85, 279<br />
Alzey 253, 327, 351<br />
Aschaffenburg 84<br />
Avignon, Papstsitz 23<br />
Baalborn 19, 185, 246, 296, 311, 341, 344, 488, 494<br />
Bacherach 287<br />
Bamberg 28<br />
Bayersfeld 374<br />
Bergstraße 13, 170, 198, 438, 443, 456, 470, 471, 495, 499, 521<br />
Bisterschied 375<br />
Bitsch 48, 142, 289<br />
Bockenheim 23, 33<br />
Bornberg, 1793 Schlacht 294<br />
Boulay, Lothringen 146<br />
Brunnenwiesen 17<br />
Buchberg in <strong>Erlenbach</strong> 12, 294, 295, 303, 380, 513<br />
Burg Vohburg, Bayern 35<br />
Burg Wolfstein bei Landshut 36
465<br />
Cambrai 173<br />
Colmar 48<br />
Den Haag 300<br />
Dielkirchen 80<br />
Disibodenberg 79<br />
Disibodenberg, Kloster 24<br />
Donauwörth 66<br />
Drehenthaler Glashütte 197, 203, 207, 229, 231, 274, 344<br />
Dreisen, früher Münsterdreisen 50, 51, 53<br />
Duchroth 278<br />
Dürkheim 33, 309, 328<br />
Enkenbach 12, 21, 26, 36, 304, 375<br />
Erfenbach 116, 231, 271, 301<br />
<strong>Erlenbach</strong> 71, 115, 153, 159, 188, 200, 209, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 269,<br />
316, 317, 340, 341, 356, 366, 373, 374, 375, 376, 399, 400, 406, 409, 430, 431, 444, 457,<br />
474, 509, 518, 519, 530<br />
Eselsmühle 201<br />
Florenz 63<br />
Frankenthal 107, 140, 159, 160, 286<br />
Frankfurt 22, 29, 35, 60, 62, 68, 74, 93, 121, 144, 170, 200, 201, 203, 210, 215, 219, 286, 482<br />
Fröhnerhof 304<br />
Galgenschanze in KL 290, 303<br />
Gaststätte 380, 420, 432, 433, 514<br />
Geinsheim 262<br />
Gembloux, Schlacht 1576 106<br />
Gersweilerhof 373, 376, 405<br />
Gersweilerkopf 17, 304, 312, 444<br />
Glantal 291<br />
Göllheim 51, 301, 304<br />
Hagelgrund = Eselsbachtal 17, 71, 75, 275, 277, 303, 312, 444, 446, 453, 522<br />
Hanau 140, 200, 201, 219, 222<br />
Heiligenmoschel 72, 280, 283, 303, 305, 329, 553<br />
Heiligenmoschel (1632) 129<br />
Hockenheim 169<br />
Holzappel 175, 182, 188, 189, 193, 213, 219, 220, 248<br />
Höningen 85<br />
Höningen, Kloster 85<br />
Hornbach 79<br />
Husarenäcker 265, 267, 268, 269, 303, 351, 521<br />
im Welchental 298, 383<br />
Kaiserslautern 317, 336, 373, 374, 375, 400, 406, 530<br />
Kaiserstraße 69, 329<br />
Kaiserstraßen 309, 327, 328<br />
Katzweiler 39, 185, 218, 219, 260, 289, 291, 303, 312, 333, 489<br />
Ketzenwoog 71<br />
Kloster Rosenthal 63<br />
Kohlplatte 17, 312<br />
La Chapelle 166<br />
La Chapelle, Picardie, einige Bürger kamen nach Otterberg 160, 164<br />
Lachen 72, 169, 172<br />
Ladenburg 170, 172, 312<br />
Lambrecht 15, 19, 69, 183<br />
Landau 100, 262, 286, 287, 298, 299, 303<br />
Lanzenbrunner Weiher 259<br />
Lauerhof 294, 295, 296<br />
Lauterecken 290, 293, 308, 309, 336<br />
465
466<br />
466<br />
Limoges 103, 105, 266<br />
Lochwiesen 17, 19, 444<br />
Longwy 285<br />
Mainz 12, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 71, 72, 90, 121, 128, 139, 144, 183, 267, 285,<br />
286, 289, 300, 305, 310, 322, 323, 326, 327, 328, 369, 523, 551<br />
Mainz, Mayence 300, 309, 325<br />
Mannheim 70, 107, 170, 174, 214, 218, 219, 280, 309, 452, 455<br />
Marienthal 15, 183, 306<br />
Marphée, 1641 Schlacht bei Sedan 139, 151, 152<br />
Messersbach 30, 230, 255<br />
Metz 33, 104, 143, 160, 161, 174, 175, 181, 222, 232, 233, 263, 266, 270, 325, 326, 327, 328,<br />
393, 395, 551<br />
Mölschbach 313, 316, 317, 530<br />
Monts en Honau, 1685 Einwanderung 175, 176<br />
Morlautern 375<br />
Münchschwanderhof 89, 234<br />
Münsterdreisen, heute Dreisen bei Kibo 36<br />
Namur 104<br />
Neuhemsbach 255<br />
Neukirchen 19, 233, 276<br />
Neustadt 12, 84, 88, 107, 140, 169, 172, 327, 470<br />
Niederkirchen 72, 99, 173, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 278, 308, 341<br />
Nîmes 187<br />
Nîmes, Geburtsort Fauchers 187<br />
Nördlingen, 1634 Schlacht 132, 139<br />
Oberndorf 29, 47, 52, 57<br />
Odenbach 71, 72, 83, 251, 252, 254, 255, 257, 309, 311<br />
Odernheim 79, 145<br />
Offenbach am Glan 79<br />
Oggersheim 309<br />
Oppenheim 12, 84, 85, 185, 188, 231, 286, 300<br />
Oppenheim, wichtige Festung und Rheinübergang 121, 122, 123, 124, 127, 155, 158, 173, 181<br />
Otterberg 340, 373, 374, 375, 400<br />
Paris 22, 68, 101, 107, 116, 146, 285, 300, 309, 325, 326, 327, 328, 388, 396, 551<br />
Pavia, 1329 Vertrag 67, 90<br />
Petite-Roselle 404<br />
Pfeddersheim 84, 85, 86, 87, 88<br />
Philippsburg 169, 172<br />
Picardie, Provinz im Nordosten Frankreichs 105, 160, 164, 169, 174, 186, 393, 438<br />
Pisa 63<br />
Provinz Nordosten Frankrachs 101, 160, 164<br />
Ramstein 20, 73, 83, 301, 302, 305, 352<br />
Rehborn 145, 254<br />
Reichenbach 33, 75, 145<br />
Reichenbacher Hof 293<br />
Reipoltskirchen 81, 254, 305, 308, 309<br />
Remigiusberg, Kloster 79<br />
Retzbach, Niederdonau 446<br />
Rijswijk, 1697 Friedensvertrag 183<br />
Rockenhausen 129, 217, 218, 219, 234, 248, 274, 305, 306, 336, 350<br />
Rohrbach 19, 26, 232, 276<br />
Rosenthal, Kloster bei Eisenberg 51<br />
Rottweil, 1643 Schlacht 149<br />
Saarbrücken 103, 133, 139, 143, 177, 266, 309, 328, 410, 452, 469<br />
Sambach 23, 31, 32, 68, 69, 89, 115, 116, 165, 186, 260, 294, 295, 313, 314, 333<br />
Sandwallweiher 71
467<br />
Sankt Alban 33<br />
Saulheim 15, 19, 29<br />
Schallbrunnen im Hagelgrund 296, 311<br />
Schallbrunnertal 16, 60<br />
Schallodenbach 291, 303, 308<br />
Schlangen-Woog 16<br />
Schlangenwoog im Hagelgrund 71<br />
Schmitterhof 438<br />
Schneckenhausen 291, 293, 295<br />
Schorleberg bei Alsenborn 304<br />
Sedan, seit 1641 Asylort 142, 160, 164, 166, 167, 186<br />
Sedan, Zufluchtsort 161, 165, 278<br />
Sembach 256, 296, 304<br />
Sinsheim, 1674 Schlacht 169, 170, 172<br />
Sivac 278<br />
Speyer 19, 29, 33, 34, 38, 39, 41, 70, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 119, 171, 182, 251, 286, 287,<br />
309, 311, 314, 331, 335, 337, 339, 340, 360, 387, 388, 391, 392<br />
Sponheim 20, 66, 67, 72, 352<br />
St. Germain en Laye 132, 163<br />
Standenbühl 351<br />
Staudernheim 145<br />
Steinwenden 20, 73, 83, 218, 352<br />
Straßburg 46, 47, 50, 57, 65, 84, 99, 104, 142, 154, 157, 171, 177, 183, 185, 226, 261, 262, 266,<br />
310, 325<br />
Stüterhof 88<br />
Turnerheim 22, 61, 95, 118, 257, 305, 313, 351, 420, 424, 426, 437, 476, 493, 503<br />
Valenciennes 173<br />
Valmy 285<br />
Versailles 285, 290, 400<br />
Vogelweh 290, 303<br />
Vogelweh, Vogel Weeh 301<br />
Waldböckelheim, Plünderung 1635, 144<br />
Waldgrehweiler 375<br />
Waldmohr 291<br />
Weihenstephan 46<br />
Weilerbach 12, 20, 73, 83, 352, 488<br />
Weinbrunner Hof 206, 233, 234<br />
Welchental 73<br />
Weselberg 230<br />
Wetzlar 299<br />
Weyler, Nähe vom Reifen-Broschart 108, 182, 194, 212, 213, 214, 215, 216<br />
Winnweiler 129, 200, 277, 301, 303, 305, 310, 328, 336, 350<br />
Wittenberg, Schloßkirche 76<br />
Wolfstein 252, 258, 306, 551<br />
Worms 33, 39, 40, 89, 93, 139, 144, 286<br />
Worms, Reichstag 12, 76, 77, 79, 253<br />
Wörsbach 120, 161, 252, 260<br />
Würzburg 84, 121, 387, 462<br />
Zweibrücken 76, 77, 79, 80, 336<br />
[ORTE]]<br />
Albisheim 227, 321<br />
[ORTE}<br />
Lämmchesberg 301, 303<br />
467
468<br />
468<br />
[REICHSWALD]<br />
Gersweilerhof im Reichswald 17, 20, 21, 25, 69, 73, 111, 181, 201, 280, 281, 311, 351, 352,<br />
353, 362, 382, 453, 490, 521<br />
{ORTE]<br />
Otterbach 69, 89, 107, 230, 260, 271, 283, 295, 301, 303, 313, 330, 332, 333, 334, 352, 361,<br />
377, 522<br />
ABT ADAM<br />
Abt von Disibodenberg 79<br />
ABT ANTON RATZ<br />
von Disibodenberg 79<br />
ABT CONRAD<br />
1209, bestätigt die Waldrechte 19, 73<br />
ABT FOLKARD<br />
1241, Bau der Steinrose 22<br />
ABT JOHANN VON KINDHAUSEN<br />
von Hornbach 79<br />
ABT OTTO VON ENKENBACH<br />
1253 Probst 36<br />
ABT STEPHAN<br />
1195- 1225 Abt 19, 26<br />
ABT STEPHAN VON OTTERBERG 26<br />
ABT ULRICH<br />
1241 - 48, kauft Wald bis Alsenbrück 22, 35<br />
ABT WALTHELM<br />
1247 - 1259 in Otterberg 23<br />
1247 -59, kaufte Höferer Land 23, 25, 36<br />
kaufte 1253 Höferer Land 36<br />
ABT WILHELM VON ST. GALLEN<br />
1298 Kämpfer bei Göllheim 52, 55<br />
ACHENBACH, JOH. HEINRICH<br />
1650<br />
reform. Pfarrer in Otterberg 165<br />
AMBERT<br />
franz. General 291, 292, 300, 301, 302, 303<br />
BALDUIN<br />
Erzbischof von Trier, Bruder König Heinrichs VII. 62<br />
BAMBERG<br />
1644, Kommandeur von Philippsburg 154<br />
BARTH
469<br />
Anna Catharina (1775) 317, 530<br />
Carolina (±1818) 317, 530<br />
Catharina (±1814) 317, 530<br />
Charlotta (1826) 317, 530<br />
Charlotta Elisabetha (1781) 317, 530<br />
Jacob (1821) 317, 530<br />
Jacobina Elisabetha (1783) 317, 530<br />
Johann Heinrich III. (±1812) 317, 530<br />
Johann Heinrich, genannt der Große (1773) 317, 530<br />
Johann Michel (1748) 316, 530<br />
Leonhard (±1795) 317, 530<br />
Leonhard (1810) 317, 530<br />
Maria Catharina (1789) 317, 530<br />
Maria Elisabetha (1771) 317, 530<br />
Martha Catharina (1778) 317, 530<br />
Martha Katharina 317, 530<br />
BARTH, DANIEL<br />
verkauft an FCE Wiese 419<br />
BARTH, JOHANN HEINRICH<br />
Eheschließung 1809 313<br />
BLÜCHER<br />
Gerhard Leberecht von, Feldmarschall 291<br />
preuß Feldmarschall 291, 293, 295, 296, 299, 304, 305, 327<br />
BOLANDEN<br />
berühmtes Grafengeschlecht 23, 33, 222<br />
BOUILLON<br />
vgl. Duc de Bouillon & Wilhelm v Oranien 81, 139, 150, 151, 152, 160, 161, 168<br />
BOURGEOIS, DAVID<br />
1717 - 1729 Spendensammlung und Lehrer 211<br />
BRAUNSCHWEIG<br />
Herzog Wilhelm Ferdinand, Heerführer 290, 293, 294, 298, 300<br />
BROSCHART<br />
Reifenhändler in Otterberg 32<br />
BÜRGERMEISTERS HOFFMANN<br />
1724 in Otterberg 214<br />
CARL THEODOR, KURFÜRST<br />
regierte 1743 - 16.2.1799 287<br />
CARL THEODOR, KURFÜRST<br />
regierte 1743 - 16.2.1799 281<br />
CARNOT<br />
Kriegsminister 298<br />
CASPAR BECKER<br />
Schultheiß in <strong>Erlenbach</strong> 166, 228, 260<br />
469
CERELOTT, ANTOINE<br />
1668 - 1678, Pfarrer in Otterberg 187<br />
470<br />
470<br />
CHÂTILLON<br />
1641, franz. General, verlor die Schlacht bei Sedan 151, 152<br />
CLARA EUGENIA ISABELLA<br />
Infantin, Tochter des span Königs 125<br />
CLIGNET<br />
Dr. war 1579 wallonischer Pfarrer Otterbergs 105, 107, 194, 212<br />
CLIGNET, DR.<br />
1. wallonischer Pfarrer seit 1579 107, 108, 182<br />
CLOSETT, FRANZ<br />
1818, Schäfer des Gersweilerhofes 352<br />
CONDÉ<br />
Hugenottenführer 101<br />
CRUCIGER<br />
Crusiger, Johann Caspar, um 1720 Dekan 195, 200, 206, 218, 222, 223<br />
CUSTINE<br />
Adam Philippe, General, eroberte 1792 Mainz 289<br />
CUSTINE, ADAM PHILIPP<br />
franz General, † 1793 286<br />
DER STAMMLER<br />
Pfalzgraf Rudolf I. Stammvater der Kurpfalz 67, 68<br />
DIPPOLD, KARL HEINZ<br />
Ortsvorsteher 518, 519<br />
DOLL<br />
Joh. 375<br />
DÖRHAGEN, CONRAD<br />
1684 Pfarrer in Heimkirchen 178<br />
DU CLOUX, BARTHÉLEMY<br />
1633 - 38, wallon Pfarrer Otterbergs 187<br />
DUC D´ENGUIEN<br />
1644, 46, franz. Oberbefehlshaber eroberte mit Turenne die Pfalz 158<br />
General, Bruder des franz. Königs 153, 155, 156<br />
DUC DE BOUILLON<br />
Fréderic Maurice, Calvinist, Bruder Turennes, genannt Prinz des Friedens, machte Sedan zum<br />
Asyl 149, 150, 151, 152<br />
DUC DE GUISE<br />
2. Sohn des Herzog Karl von Lothringen, Erzbischof von Reims, Gegner Richelieus 150, 151
471<br />
ENGELMANN<br />
Jean Pierre, Pfarrer, 1715 - 1751 108, 119, 179, 180, 182, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195,<br />
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,<br />
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 235, 240<br />
ERZBISCHOF CONRAD VON SALZBURG<br />
1291, 1298, Feind König Albrechts 42<br />
ERZBISCHOF VON TRIER<br />
einer der Kurfürsten 62<br />
Kurfürst 43, 52, 58, 84, 132<br />
FABERT<br />
ab 1642 Gouverneur Sedans 152, 162, 163<br />
FLECK<br />
Maria Eva (1749) 316, 530<br />
FLECK, MARIA EVA<br />
Frau des Heinrich Barth 313<br />
FOLKNAND<br />
um 1200 Pfarrer Sambachs & <strong>Erlenbach</strong>s 15, 31, 32<br />
FONTAINEBLEAU<br />
1685, Aufhebung der Religionsfreiheit 174<br />
FORTINEUX<br />
Joh. Jacob, * 1690 in Holzappel 160, 193, 201, 202, 238, 242, 246, 247, 248<br />
FRANKFURT<br />
ab 1152 Wahlort der Deutschen Könige, ab 1562 auch Krönungsort. In allen Jahrhunderten<br />
bedeutender Messeplatz 41, 43, 44, 47, 58, 64, 81, 107, 122, 127, 142, 187<br />
FRANZ VON SICKINGEN<br />
Querkopf, Heerführer, 1523 gestorben 79, 81, 82, 85<br />
FREI, HANS, STADTSCHLOSSER<br />
betreute 1568 das Uhrwerk 103, 266<br />
FRIEDEN VON BADEN<br />
vom 7.9.1714, beendet den Span. Erbfolgekrieg 78, 189, 204<br />
GALLAS, MATHIAS<br />
1634, kaiserl. Feldmarschall 134, 139, 140, 143, 144, 145, 146<br />
GALLÉ, PETER<br />
Müller in Otterberg 338<br />
GEIß<br />
Jacob 373<br />
GEISSEL<br />
Johann, Bischof von Speyer, Erzbischof von Köln, recherchierte Schlacht von Göllheim 41<br />
GEISSEL,<br />
471
472<br />
472<br />
Johannes, Bischof von Speyer, Erzbischof von Köln 43, 48, 51, 55, 57<br />
GENERAL AMBROSIUS SPINOLA<br />
beherrschte ab Sept. 1620 bis 1631 die Pfalz 122<br />
GENERAL MÖLLENDORF<br />
1794, preuß. Kommandant 301<br />
GLASER, RÜDIGER<br />
Klimageschichte 251, 254, 258, 259<br />
GOUPILLIÈRE<br />
de la, 1684 Gouverneur der Pfalz 178<br />
GRAF HAIGERLOCH<br />
Onkel Albrechts, † 1298 47<br />
GRAF JOHANN LUDWIG VON NASSAU<br />
erwarb 1613 zwei Drittel von Albisheim 56<br />
GRAF OTTO VON OCHSENSTEIN<br />
gefallen 1298 bei Göllheim 55<br />
GUTTENBERG, GUTENBERG, JOH. WILHELM<br />
ref. Schulmeister in <strong>Erlenbach</strong> 274, 315, 361<br />
HACH<br />
Daniel, Bürgermeister 333<br />
Daniel, Bürgermeister 332, 333<br />
HAFFNER<br />
Elisabetha (1785) 317, 530<br />
HAIGERLOCH<br />
Otto, Graf, Onkel König Albrechts 42, 45, 47, 57, 58<br />
HATZFELD<br />
Graf Melchior, 1635 zerstörte K`lautern 139, 140, 141, 145, 146<br />
HEINRICH VON KALDEN<br />
1209 rächte den Königsmord und unterschrieb <strong>Erlenbach</strong>er Urkunden 27<br />
1209, rächte den Königsmord und unterschieb die <strong>Erlenbach</strong>er Urkunde 29<br />
So rächte er den Königsmord und unterschrieb <strong>Erlenbach</strong>er Urkunden 29<br />
HEINRICH, JACOB<br />
1913 Scheunenbrand 490<br />
HERBRAND, EUGEN<br />
Feuerwehrhauptmann 461, 494, 495, 496<br />
HERZOG HEINRICH<br />
arbeitsamer Ahnenforscher, bearbeitete die KB Alsenz, Wolfstein, Otterberg, KL, Hanau,<br />
Heimkirchen, Ransweiler 142<br />
HERZOG VON KÄRNTEN<br />
Schwager Albrechts, kämpfte in Göllheim 55
473<br />
HERZOG VON LONGUEVILLE<br />
1644 - 48 franz Verhandlungsführer in Münster 158<br />
HERZOG WOLFGANG<br />
von ZW, reformierte Staat & Gesellschaft, starb 1569 bei Limoges 81, 91, 94, 95, 99, 102, 103,<br />
104, 105, 114, 266<br />
HERZOG WOLFGANGS<br />
von Zweibrücken 80<br />
HERZOG WOLFGANGS VON ZWEIBRÜCKEN 80<br />
HOCHE<br />
Lazare, franz. General 290, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300<br />
Lazare, General 290<br />
HOF<br />
Johannes 340<br />
HOLLSTEIN<br />
Johannes 374, 375<br />
HOLLSTEIN, JACOB<br />
1900 Feuerwehrkommandant 490<br />
HOLLSTEIN, KARL<br />
1933 Bürgermeister 424<br />
HOUZEAU, LOUIS<br />
Gerichtsvollzieher in KL 312<br />
HUET<br />
franz. General 1793 292<br />
IMAGINA<br />
Frau, Wwe König Adolfs 56<br />
Gattin, König Adolfs 58, 59<br />
Witwe König Adolfs 63<br />
INNOZENZ IV.<br />
1243 - 1254 Papst 23, 36, 37<br />
JACOBI<br />
Christian Julius 340<br />
JACOBI, CHRISTIAN JULIUS<br />
kaiserslicher & königlicher Notar in Otterberg 312<br />
JEAN RAQUET<br />
floh 1635 nach Metz 142<br />
JENNER<br />
Edward, der Erfinder der Pockenimpfung 120<br />
Edward, Erfinder der Pockenimpfung 180<br />
JENNER, EDWARD, ENGL ARZT<br />
473
474<br />
Erfinder der Pockenimpfung 120<br />
474<br />
JENNER, EDWARD, ENGLUDWIG ARZT<br />
Erfinder der Pockenimpfung 306<br />
JOHANN KEIPER<br />
Forstdirektor und wichtiger Autor 20, 21, 66, 67, 69, 73, 109, 110, 277, 281, 283, 351, 352, 353<br />
JOHANN PARRICIDA<br />
1.5.1308, bringt seinen Onkel König Albrecht um 41, 61<br />
JUNG, FRIEDENSRICHTER<br />
Carl 336, 340<br />
KAISER HEINRICH<br />
staufischer Kaiser 27<br />
KAISER HEINRICH IV<br />
war 1195 drei Monate in KL 27, 28<br />
KAISER RUDOLF<br />
1276 Stadtrechte KL 16, 114<br />
KALKREUTH<br />
Reitergeneral 293, 294, 295, 302<br />
KALLER, GERHARD, HISTORIKER<br />
schrieb die 2bändige Chronik Otterbergs 20<br />
schrieb die 2bändige Chronik Otterbergs 32<br />
schrieb die 2bändige Chronik Otterbergs 75<br />
schrieb die 2bändige Chronik Otterbergs 106<br />
schrieb die 2bändige Chronik Otterbergs 340<br />
schrieb die zweibändige Chronik Otterbergs 353<br />
KARL V.<br />
Deutscher Kaiser 77<br />
Deutscher Kaiser 76, 77<br />
KLEEMANN<br />
Christian 374<br />
Gerald 374<br />
KNIERIEMEN JACOB III.<br />
1900 Polizeidiener 367<br />
KNOBELSDORFF<br />
Reitergeneral 293, 303<br />
KOLB<br />
Werner von Wartenberg 19, 33, 35<br />
KÖNIG HEINRICH VII<br />
1211 -1242 dt. König 20, 22, 32<br />
Friedrich II. . Sohn, von ihm 1235 abgesetzt, verübte 1542 <strong>Jahre</strong> später im sizilianischen Kerker<br />
Selbstmord 34
475<br />
KÖNIG LUDWIG<br />
genannt der Bayer, 1323 verpfändet den Reichswald und das Königsland 66<br />
KÖNIG LUDWIG XIII.<br />
franz. König, griff in den 30jährigen Krieg ein 132, 150<br />
KÖNIG OTTO IV<br />
deutscher König 19, 20, 29, 32, 33<br />
KÖNIG PHILIPP<br />
1208 in Bamberg ermordet 28<br />
KÖNIG PHILIPP IV<br />
franz König um 1300 59<br />
KÖNIG PHILIPP IV.<br />
franz. König, schloss 1299 Bündnis mit Albrecht 59<br />
KÖNIG RUDOLF<br />
† 1291 gestorben 40, 41<br />
1276 Stadtrechte KL 39, 40<br />
KONRADIN<br />
letzter Staufer 36, 37<br />
KORN ERNST<br />
langjähriger TV Vorsitzender 503<br />
KORN ERNST,<br />
langjähriger TV Vorsitzender 502<br />
KRIEGSMINISTER LOUVOIS<br />
Minister unter Louis XIV. 174<br />
KURFÜRST FRIEDRICH III.<br />
1559 - 1576, Nachfolger Ottheinrichs 94, 107<br />
KURFÜRST FRIEDRICH V.<br />
Sohn von Friedrich IV, wurde 1618 böhmischer König, verlor die Schlacht am Weißen Berg, †<br />
29.11.1632 in Mainz, 1635 beerdigt in Sedan 122<br />
KURFÜRST LUDWIG<br />
schlug die Revolten des Franz von Sickingen & der Bauern nieder 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90,<br />
111, 352<br />
KURFÜRST LUDWIG III<br />
1417 erlaubt die Waldweide für Schweine 73<br />
KURFÜRST RUPRECHT II<br />
genannt der Harte, bestätigte 1391 den Vergleich über die Waldnutzung 70<br />
KURFÜRSTEN FRIEDRICH I<br />
genannt der Siegreiche, schlägt 1455 Ludwig den Schwarzen 74<br />
KURFÜRSTEN RUPRECHT I<br />
1356 - 1390, Vertrag über Waldnutzung 70, 90<br />
475
476<br />
476<br />
LAMBOY<br />
1635 bei der Erstürmung KL dabei, befehligte 1641 als General kaiserliche Truppen im Kampf<br />
um Sedan 139, 140, 151, 152<br />
LANDOLF VON WILENSTEIN<br />
1159, besitzt Gutshof in <strong>Erlenbach</strong> 13, 26<br />
LANG<br />
Franz, Obergefreiter 445<br />
LEHRER<br />
Becker, Hermann, 1912, 1946 - 1949, 1. FCE Vorsitzender 387, 419, 461<br />
LENCKE<br />
Philipp August, Geometer 338, 339<br />
LENCKÉ<br />
Philipp August Allbrecht 340<br />
LICHTENBERG<br />
Graf, kämpfte 1298 mit Albrecht 46, 141, 173, 234<br />
LUDWIG II<br />
Herzog von Zweibrücken 77, 79<br />
Herzog von Zweibrücken 79<br />
Herzog von Zweibrücken 79<br />
Herzog von Zweibrücken 336<br />
Herzog von Zweibrücken 466<br />
LUDWIG XIV<br />
* 5.9.1639 St. Germain en Laye 163, 167, 168, 171, 173, 174, 177, 178, 181, 183, 186, 188,<br />
193, 204, 219, 233, 263<br />
LUTHER<br />
Martin, Reformator 75<br />
MAJOR SALOMON KELLER<br />
Juni 1635, in Frankenthal 137<br />
MANGOLD<br />
alte <strong>Erlenbach</strong>er Familie 220, 221, 230, 233, 234, 260, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 313, 318,<br />
322, 323, 341, 367, 392, 398, 418, 431, 440, 441, 443, 458, 466, 480, 495, 525<br />
MANNWEILER<br />
Christian 375<br />
MANSFELD<br />
Graf, kämpfte 1621 für die Kurpfalz, 1635 war er auf Seiten Generals Gallas 139<br />
MARGGRAF, DR.<br />
Carl, Arzt 340<br />
MARKY<br />
Johannes 373, 374<br />
MARTIN LUTHER
Reformator 75, 77, 89<br />
477<br />
MEISTERLIN<br />
Dr. Jonas, Kanzler der Kurpfalz, war 1648 in Münster aktiv 158<br />
MERK<br />
Hermann, Wehrsportführer 425<br />
MERK, HERMANN<br />
1935, FCE Vereinsdiener 426<br />
MITTLER<br />
Ernst Siegfried, Autor 296<br />
MÖLLENDORF<br />
Feldmarschall 300<br />
MONTMOREMY<br />
Standortkommandant 1733, 1734 119<br />
MÜLLER<br />
1415 Schultheiß in <strong>Erlenbach</strong> 73<br />
MÜNSTER<br />
1641 - 1648 Verhandlungsstadt 101, 132, 157, 158, 161<br />
NEUENBURG<br />
Heimat Ottheinrichs, Sterbeort Herzog Bernhards von Weimar 131<br />
NICOLAUS VON KINDENHEIM<br />
1324, Schultheiß von KL 20, 66, 67, 352<br />
OBERTRAUT<br />
Michael, Reiteroberst 123, 124<br />
OBRISTEN STALHANDSKE<br />
führte 1632 die Schweden in die Schlacht bei Standenbühl129<br />
OTTHEINRICH<br />
Pfalzgraf und später Kurfürst 65, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99<br />
PAPST<br />
Innozenz III. 30<br />
PAPST ALEXANDER<br />
1254 - 1261, Papst 37<br />
PAPST BONIFAZ VIII<br />
1298, geißelte die Tötung Albrechts von Nassau 60<br />
PAPST GREGOR IX<br />
1241 schützt Kloster Otterberg 22, 38<br />
PAPST INNOZENZ III.<br />
Vormund Friedrich II. ., 30<br />
Vormund Friedrich II.. 28<br />
477
PAPST INNOZENZ IV.<br />
Gegner Kaiser Friedrich II. 37<br />
Gegner Kaiser Friedrich II. . 24, 37<br />
PAPST URBAN VIII.<br />
1641, initiierte Friedensverhandlungen 157<br />
PFAFF, FRIEDRICH<br />
1. FCE Vorsitzender 419, 420, 424<br />
478<br />
478<br />
PFALZGRAF LUDWIG PHILIPP<br />
ab 1632 Vormund des spätern Kurfürsten Carl Ludwig 159<br />
PFALZGRAF OTTO VON WITTELSBACH<br />
ermordet 1208 König Philipp 28<br />
PFALZGRAFEN LUDWIG PHILIPP<br />
Bruder des Winterkönigs 161<br />
PFALZGRÄFIN MARIA ELEONORA<br />
Tochter des Kurfürsten von Brandenburg 161<br />
PHILIPP CASPAR STURM<br />
Sekretär und Unterherold † 1525 vor Pfeddersheim 86<br />
PHILIPP CORDIER<br />
1652 - 1682 Lehrer in Otterberg 187<br />
PHILIPPSBURG<br />
wichtige Festung und Rheinübergang 153, 154, 155, 156, 158<br />
PISTORIUS<br />
Stadtschreiber in 1719 198<br />
RAQUET<br />
Catharina Margretha 334, 339<br />
RAQUET JACOB<br />
Bürgermeister Otterbergs 314<br />
RAUHGRAF GOTTFRIED RAUB<br />
tötete 1298 König Adolf 54<br />
REINHEIMER<br />
Barbara 316, 530<br />
REISEL,<br />
Johann Jacob, * 30.7.1820 341<br />
RETTIG<br />
Forstmeister Dynastie 201, 281, 311, 312, 329, 351, 476<br />
Forstmeister-Dynastie 200<br />
RETTIG, JOH. DANIEL<br />
Forstmeisterdynastie 281
RHEINHEIMER, JOH. JACOB<br />
1818, Lehrer in <strong>Erlenbach</strong> 361<br />
RICHARD LÖWENHERZ<br />
mischt 1198 in dt Innenpolitik mit 27, 28<br />
479<br />
RICHELIEU<br />
Kardinal, Regierungschef, der absolut regierte. während seiner Amtszeit gewann<br />
Frankreich internationale Anerkennung und Kolonien126,<br />
132, 133, 142, 147, 148,<br />
149, 150, 151, 157, 160, 161<br />
ROSENTHAL<br />
1298, Grablegung König Adolfs 50, 51, 56<br />
RUDLER<br />
bis 1813 Präfekt 20, 67, 70, 281, 352<br />
RUDLER, FRANZ JOSEF<br />
Präfekt des Donnersbergkreises 310, 336<br />
RUDOLF VON HABSBURG<br />
1273 - 1291, deutscher König 38, 39, 41<br />
SAUERWEIN<br />
luth Pfarrer Otterbergs 179, 180, 184, 222<br />
SCHELLHAAß LUDWIG<br />
Sekretär im Rathaus 312<br />
SCHERMER<br />
Bauer in Relsberg 252<br />
Theobald 375<br />
SCHMITT<br />
Johann Nicolaus (1823) 317, 530<br />
SCHNEIDER, PETER FRANZ<br />
1904 - 1918, Vorstand des TUS 382<br />
SCHWEBEL<br />
Johann, 1. Reformator in ZW 79<br />
SEDAN<br />
Zufluchtsort 160<br />
SIEGFRIED VON MORBACH<br />
schenkt am 14.4.1360 sein Gutshof in <strong>Erlenbach</strong> dem Kloster Otterberg 68<br />
SIMBGEN<br />
Simchen, Morlauterer Familie 119, 270, 271, 272, 273, 488<br />
SÖDER, JOH. CONRAD<br />
1749 - 1756 luth Pfarrer 185<br />
SOKOLI, PHILIPP<br />
2. FCE Vorsitzender 424<br />
479
480<br />
480<br />
SOLDAT 205, 223, 234, 270, 271, 272, 275, 289, 306, 307, 326, 393, 394, 397, 427, 429,<br />
430, 432, 433, 437, 443, 444, 452, 458<br />
STREUBER<br />
Pfarrer zu Rathskirchen 252<br />
THARUN, ALBERT<br />
1949 -1954, TV Vorsitzender 501<br />
TRAPONNIER<br />
franz. General 1793 290<br />
TURENNE<br />
franz Feldmarschall 121, 130, 134, 139, 143, 144, 145, 148, 168, 169, 170, 171, 172, 251<br />
ULTES<br />
August, 1917 Polizeidiener 396<br />
VALETTE<br />
de la, Kardinal & General 134, 144, 146<br />
VIETTINGHOFF<br />
preuß. General 296<br />
WACHMANN<br />
Joseph, 1796 Staatsanwalt in KL 311<br />
Joseph, 1808 Staatsanwalt in KL 311<br />
WALLONEN 1579, EINWANDERER 105<br />
WALLONEN,<br />
1579, Einwanderer 106<br />
WECKMANN<br />
Samuel von der Eselsmühle 201, 238<br />
WELDENER<br />
Johannes, 1689 - 1712, ref. Pfarrer 188, 189, 194, 204, 213<br />
WELDNER, JOHANNES<br />
1680 - 1712 Otterberger Pfarrer 188, 194, 213<br />
WIEGAND<br />
Peter, Bigamist aus Baalborn 311<br />
WILHELM VON HABERN<br />
General, besiegte Franz v. Sickingen und die Bauern bei Pfeddersheim 82, 85, 87<br />
WILHELM VON ORANIEN<br />
dominierende Persönlichkeit, Feldherr, Staatsgründer, Beschützer der Reformation, Stammvater<br />
von Königshäusern 104, 105, 107, 159, 160<br />
WILLIARD, VILLIARD<br />
Metzger, verkauft dem FCE eine Wiese 419<br />
WINTER,
481<br />
Jacob, Sohn Cath. Raquet 185, 198, 230, 237, 341, 382, 407, 432, 466, 471, 513, 527<br />
WINTER, JOSEF<br />
Steinbruchbesitzer, † 1.2.1912 378<br />
WITT<br />
Joh. Daniel, Standesbeamter 195, 198, 201, 206, 214, 215, 312, 313, 315, 318<br />
WITT, JOHANN DANIEL<br />
2. Bürgermeister in KL 312<br />
WOLPERT<br />
Peter, Gerichtsschreiber 336, 340<br />
WURMSER<br />
österreichischer General 299, 300<br />
WURSTER<br />
aus Albisheim 321, 322<br />
ZEUSIG<br />
Christoph von Winnweiler, Zimmermann 200, 202<br />
481