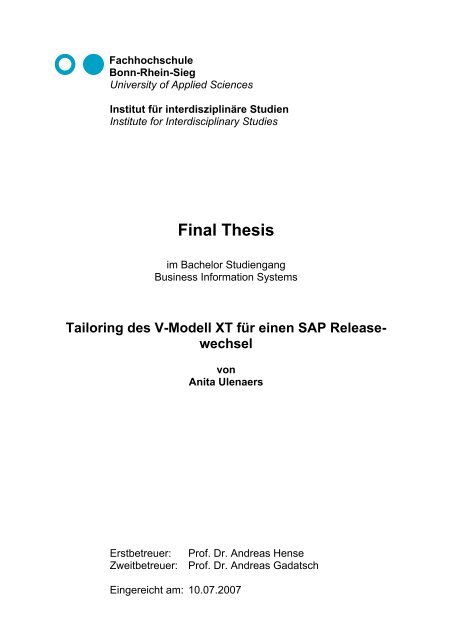Final Thesis - Bis.inf.fh-brs.de
Final Thesis - Bis.inf.fh-brs.de
Final Thesis - Bis.inf.fh-brs.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fachhochschule<br />
Bonn-Rhein-Sieg<br />
University of Applied Sciences<br />
Institut für interdisziplinäre Studien<br />
Institute for Interdisciplinary Studies<br />
<strong>Final</strong> <strong>Thesis</strong><br />
im Bachelor Studiengang<br />
Business Information Systems<br />
Tailoring <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
von<br />
Anita Ulenaers<br />
Erstbetreuer: Prof. Dr. Andreas Hense<br />
Zweitbetreuer: Prof. Dr. Andreas Gadatsch<br />
Eingereicht am: 10.07.2007
Inhaltsverzeichnis<br />
II<br />
Seite<br />
Abbildungsverzeichnis................................................................................... IV<br />
Abkürzungsverzeichnis.................................................................................. VI<br />
1 Einleitung ...................................................................................................1<br />
1.1 Problemstellung <strong>de</strong>r Bachelor <strong>Thesis</strong> ...................................................1<br />
1.2 Zielsetzung <strong>de</strong>r Bachelor <strong>Thesis</strong> ..........................................................3<br />
1.3 Vorgehensweise ...................................................................................4<br />
2 ERP Systeme..............................................................................................5<br />
2.1 Einordnung ...........................................................................................5<br />
2.2 Merkmale von ERP Systemen..............................................................6<br />
2.3 SAP ERP Systeme ...............................................................................8<br />
3 Vorgehensmo<strong>de</strong>lle für einen Releasewechsel von SAP.......................11<br />
3.1 Implementation Roadmap...................................................................11<br />
3.2 Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout..............................................16<br />
4 V-Mo<strong>de</strong>ll XT ..............................................................................................19<br />
4.1 Ziele <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT ........................................................................20<br />
4.2 Grundkonzept <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT..........................................................21<br />
4.3 Tailoring..............................................................................................27<br />
5 Konzeptbildung........................................................................................31<br />
5.1 Konzept für das Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftraggebers.........................................31<br />
5.2 Konzept für das Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftragnehmers......................................36<br />
5.3 Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für eine SAP Releasewechsel..............40<br />
6 Vorstellung <strong>de</strong>r Ergebnisse ....................................................................42<br />
6.1 SAP Releasewechsel (AG).................................................................43<br />
6.2 SAP Releasewechsel (AN) .................................................................48<br />
6.3 Bekannter Fehler ................................................................................52
III<br />
7 Das Projekt „SAP Releasewechsel“ einer oberen Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong> ....53<br />
7.1 Vorgehensweise im Projekt „SAP Releasewechsel“...........................54<br />
7.2 Mögliche Risiken dieses Vorgehens...................................................56<br />
8 Schlussbetrachtung ................................................................................57<br />
8.1 Zusammenfassung <strong>de</strong>r Ergebnisse ....................................................57<br />
8.2 Weitere Einsatzmöglichkeiten.............................................................58<br />
8.3 Kritische Würdigung............................................................................59<br />
Literaturverzeichnis........................................................................................60<br />
Glossar ............................................................................................................62<br />
Ei<strong>de</strong>sstattliche Erklärung...............................................................................64
Abbildungsverzeichnis<br />
IV<br />
Seite<br />
Abbildung 1: Softwarekategorien ........................................................................6<br />
Abbildung 2: Implemenation Roadmap <strong>de</strong>r SAP AG.........................................12<br />
Abbildung 3: Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout <strong>de</strong>r IDS Scheer AG........16<br />
Abbildung 4: Logo V-Mo<strong>de</strong>ll XT ........................................................................19<br />
Abbildung 5: Grundstruktur <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT....................................................23<br />
Abbildung 6: Klassifizierung von Projekten in Projekttypen ..............................24<br />
Abbildung 7: Zuordnung <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie.............................25<br />
Abbildung 8: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT........................26<br />
Abbildung 9: Auswahl <strong>de</strong>s Projekttyps ..............................................................28<br />
Abbildung 10: Auswahl <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie und <strong>de</strong>r<br />
Vorgehensbausteine .........................................................................................28<br />
Abbildung 11: V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor.....................................................................29<br />
Abbildung 12: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Systementwicklungsprojekt (AG) .....33<br />
Abbildung 13: Konzept Vorgehensmo<strong>de</strong>ll AG...................................................34<br />
Abbildung 14: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel AG .......................35<br />
Abbildung 15: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Systementwicklungsprojekt (AN)......37<br />
Abbildung 16: Konzept Vorgehensmo<strong>de</strong>ll AN ...................................................38<br />
Abbildung 17: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel AN .......................39<br />
Abbildung 18: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel .............................41<br />
Abbildung 19: Auswahl <strong>de</strong>r Projekttypen im getailorten Projektassistenten......42<br />
Abbildung 20: Register Anwendungsprofil ........................................................43<br />
Abbildung 21: Vorgehensbausteine und Projektdurchführungsstrategie für <strong>de</strong>n<br />
Projekttyp "SAP Releasewechsel (AG)"............................................................44<br />
Abbildung 22: Planung <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP<br />
Releasewechsel (AG)"......................................................................................45<br />
Abbildung 23: Projektplan zu <strong>de</strong>m Projekt "SAP Releasewechsel AG" ............46<br />
Abbildung 24: Dokumentation <strong>de</strong>s Projektes "SAP Releasewechsel (AG)" ......47<br />
Abbildung 25: Vorgehensbausteine und Projektdurchführungsstrategie für <strong>de</strong>n<br />
Projekttyp "SAP Releasewechsel (AN)"............................................................49
V<br />
Abbildung 26: Planung <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP<br />
Releasewechsel (AN)" ......................................................................................49<br />
Abbildung 27: Projektplan zu <strong>de</strong>m Projekt "SAP Releasewechsel AN".............50<br />
Abbildung 28: Dokumentation <strong>de</strong>s Projektes "SAP Releasewechsel (AN)" ......51
Abkürzungsverzeichnis<br />
ABAP/4 Advanced Business Application Programming/4<br />
Programmiersprache <strong>de</strong>r SAP AG<br />
AG Auftraggeber<br />
AN Auftragnehmer<br />
ARIS Architektur integrierter Informationssysteme<br />
VI<br />
ERP Enterprise Resource Planning<br />
HTML Hypertext Markup Language<br />
IDS Gesellschaft für integrierte Datenverarbeitungssysteme<br />
IMKA Interministerielle Koordinierungssausschuss<br />
IT Informationstechnologie<br />
KBSt Koordinierungs- und Beratungsstelle <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sregierung<br />
für Informationstechnik in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sverwaltung<br />
PC Personal Computer<br />
PDF Portable Document Format<br />
R/3 Realtime/3<br />
ERP System <strong>de</strong>r SAP AG<br />
RBE Reverse Business Engineer<br />
ROI Return On Investment<br />
SAP früher für: Systeme, Anwendungen und Produkte in <strong>de</strong>r Datenverarbeitung<br />
heute: Offizieller Name <strong>de</strong>s Herstellers von betrieblicher Anwendungssoftware,<br />
sowie <strong>de</strong>ssen Produkte
VII<br />
SOA Service-orientierten-Architektur<br />
XML Extensible Markup Language<br />
XT extreme Tailoring
1 Einleitung<br />
1.1 Problemstellung <strong>de</strong>r Bachelor <strong>Thesis</strong><br />
1<br />
In über 120 Län<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong> ca. 91.500-mal SAP in Unternehmen installiert. 1 Bei<br />
<strong>de</strong>r E<strong>inf</strong>ührung dieser Systeme wer<strong>de</strong>n Anpassungen gemacht, um die zuvor<br />
mo<strong>de</strong>llierten Soll-Geschäftsprozesse besser abzubil<strong>de</strong>n. Diese Anpassungen<br />
können zum einen aus einer Parametrisierung <strong>de</strong>r Software, <strong>de</strong>m so genannten<br />
„Customizing“, aber auch aus selbst entwickelten Add-Ons bestehen. 2<br />
Nach einiger Zeit <strong>de</strong>r Nutzung <strong>de</strong>s SAP-Systems wird es erfor<strong>de</strong>rlich, auf ein<br />
neues Release umzusteigen. Die Grün<strong>de</strong> dafür können verschie<strong>de</strong>n sein: Es<br />
wer<strong>de</strong>n neue Funktionalitäten angeboten, Prozesse <strong>de</strong>s Systems wur<strong>de</strong>n optimiert<br />
und bieten Einsparpotenzial o<strong>de</strong>r Fehler im vorherigen Release wur<strong>de</strong>n<br />
verbessert.<br />
Doch spätestens in <strong>de</strong>m Moment, wenn <strong>de</strong>r Wartungsvertrag für das aktuelle<br />
Release endgültig ausläuft, gerät das Unternehmen in Zugzwang. Und genau<br />
hier bereiten diese Anpassungen Probleme. 3<br />
Bei einer Migration <strong>de</strong>r Systeme können diese Anpassungen unter Umstän<strong>de</strong>n<br />
nicht automatisch übernommen wer<strong>de</strong>n. Es kann auch passieren, dass sie<br />
durch die Standardprogramme überschrieben wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r es zu an<strong>de</strong>ren<br />
Wechselwirkungen kommen kann. 4 Somit entsteht ein erhöhter Aufwand, da<br />
das neue System wie<strong>de</strong>r manuell angepasst wer<strong>de</strong>n muss.<br />
Aus diesem Grund müssen folgen<strong>de</strong> Fragestellungen genau geprüft wer<strong>de</strong>n:<br />
• Wie genau lassen sich die Anpassungen in das neue System integrieren?<br />
• Sind die Anpassungen aus heutiger Sicht immer noch von Nöten?<br />
1 Vgl. SAP (2005), www.sap.com/germany/media/mc_673/Emp-Rep_2005_D.pdf S.5.<br />
2 Vgl. Gadatsch (2002b), S. 25.<br />
3 Vgl. Rau (2006), S. 31-33.<br />
4 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 67.
2<br />
• Bietet das neue SAP Release sogar neue Funktionalitäten, die alte Individualanpassungen<br />
unnötig machen?<br />
• In wie weit ist es möglich in <strong>de</strong>n SAP Standard zurückzukehren?<br />
Für die Umsetzung <strong>de</strong>s Releasewechsels benötigt das Projektteam genaue Informationen<br />
über diese Anpassungen. Doch stellt sich die Informationsgewinnung<br />
problematisch dar, wenn die Dokumentationen <strong>de</strong>r System-E<strong>inf</strong>ührung<br />
unzulänglich sind.<br />
Damit keine wichtigen Aspekte bei <strong>de</strong>r Vorbereitung vergessen wer<strong>de</strong>n, wird ein<br />
Vorgehensmo<strong>de</strong>ll erfor<strong>de</strong>rlich, das die Beson<strong>de</strong>rheiten eines SAP Releasewechsels<br />
unterstützt.<br />
Durch die Empfehlung vom 04.11.2004 <strong>de</strong>s Interministeriellen Koordinierungssausschuss<br />
(IMKA) ist das V-Mo<strong>de</strong>ll XT verbindlich für IT-Projekte in Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n<br />
einzusetzen. 5<br />
Über 50% <strong>de</strong>r Mitarbeiter in Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n arbeiten mit SAP. 6 Diesen Mitarbeitern<br />
steht in <strong>de</strong>r Zukunft ein Releasewechsel bevor. Für die Umsetzung dieser<br />
Releasewechsel können sie nicht auf vorhan<strong>de</strong>ne Vorgehensmo<strong>de</strong>lle, wie<br />
bspw. <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r SAP AG zurückgreifen, son<strong>de</strong>rn sind verpflichtet das V-Mo<strong>de</strong>ll<br />
XT zu nutzen.<br />
Damit diesen Projektteams <strong>de</strong>nnoch eine geeignete Unterstützung durch das V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT erhalten, ist es erfor<strong>de</strong>rlich das V-Mo<strong>de</strong>ll XT an die Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
eines SAP Releasewechsels anzupassen.<br />
5 Vgl. KBSt (2006).<br />
6 Mündliche Aussage <strong>de</strong>s Herrn Dr. Schuster (Mitarbeiter <strong>de</strong>r SAP AG und zuständig für Kun<strong>de</strong>n<br />
in Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n) am 22.06.2007 in Bonn.
1.2 Zielsetzung <strong>de</strong>r Bachelor <strong>Thesis</strong><br />
In dieser Bachelor <strong>Thesis</strong> soll das V-Mo<strong>de</strong>ll XT auf die Beson<strong>de</strong>rheiten eines<br />
Releasewechsels von SAP angepasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Dafür soll eine lauffähige Version <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten erstellt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Aus <strong>de</strong>m erstellten Projektassistenten sollen ein Vorgehensmo<strong>de</strong>ll, eine Dokumentation<br />
und Dokument-Vorlagen exportiert wer<strong>de</strong>n können, die die Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
eines SAP Releasewechsel enthalten.<br />
3
1.3 Vorgehensweise<br />
Diese Arbeit wur<strong>de</strong> wie folgt geglie<strong>de</strong>rt:<br />
In Kapitel 2 wer<strong>de</strong>n ERP (Enterprise Resource Planning) Systeme vorgestellt<br />
und in die verschie<strong>de</strong>nen Softwarekategorien eingeordnet. Weiterhin wer<strong>de</strong>n<br />
ERP-Systeme <strong>de</strong>r SAP AG kurz vorgestellt.<br />
4<br />
In Kapitel 3 wer<strong>de</strong>n die Vorgehensmo<strong>de</strong>lle „Implementation Roadmap“ <strong>de</strong>r SAP<br />
AG und das „Phasemo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout“ <strong>de</strong>r IDS Scheer AG vorgestellt.<br />
Diese Vorgehensmo<strong>de</strong>lle wur<strong>de</strong>n bereits entwickelt, um einen Releasewechsel<br />
einer SAP Software durchzuführen.<br />
Eine Vorstellung <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT, <strong>de</strong>ssen Ziele, das Grundkonzept und das<br />
Tailoring wird in Kapitel 4 gegeben.<br />
Im fünften Kapitel wird das Konzept <strong>de</strong>s neuen V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
erklärt. Dabei wird ver<strong>de</strong>utlicht, welche I<strong>de</strong>en von <strong>de</strong>n in Kapitel 3<br />
vorgestellten Vorgehensmo<strong>de</strong>llen in das neue V-Mo<strong>de</strong>ll XT e<strong>inf</strong>ließen.<br />
In Kapitel 6 wer<strong>de</strong>n die Ergebnisse vorgestellt. Dabei wer<strong>de</strong>n die Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel <strong>de</strong>s Auftraggebers separat von<br />
<strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel <strong>de</strong>s Auftragnehmers erläutert.<br />
Im siebten Kapitel wird das Projekt „SAP Releasewechsel“ einer oberen Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong><br />
vorgestellt. Dabei wird <strong>de</strong>ren Vorgehensweise dargestellt und mögliche<br />
Risiken diesen Vorgehens angemerkt.<br />
In <strong>de</strong>r Schlussbetrachtung in Kapitel 8 wer<strong>de</strong>n die Ergebnisse dieser Arbeit<br />
noch einmal kurz zusammengefasst. Auch mögliche weitere Einsatzmöglichkeiten<br />
wer<strong>de</strong>n in diesem Kapitel in Form von offenen Fragen diskutiert. Zum Abschluss<br />
gibt es eine kritische Würdigung <strong>de</strong>s neuen Vorgehensmo<strong>de</strong>lls.
2 ERP Systeme<br />
5<br />
In diesem Kapitel wird eine E<strong>inf</strong>ührung in ERP Systeme bzw. ERP Software<br />
gegeben. Dafür wird <strong>de</strong>r Begriff erklärt, eine Abgrenzung zu an<strong>de</strong>ren Softwarearten<br />
dargelegt und die Merkmale vorgestellt.<br />
Zum Schluss wird auf die ERP Systeme <strong>de</strong>r SAP AG eingegangen. Dabei wer<strong>de</strong>n<br />
die Problematiken bei einem Releasewechsels dieses Systems ver<strong>de</strong>utlicht.<br />
2.1 Einordnung<br />
Software lässt sich zum einen in Systemsoftware, wie z.B. Betriebssysteme<br />
o<strong>de</strong>r Datenbanksysteme und zum an<strong>de</strong>ren in Anwendungssysteme unterteilen.<br />
Unter einem Anwendungssystem wird ein System verstan<strong>de</strong>n, das fachliche<br />
Aufgaben unterstützt. Da es verschie<strong>de</strong>ne fachliche Aufgaben gibt, wer<strong>de</strong>n die<br />
Anwendungssysteme noch einmal in Betriebliche-, Technische-, 7 Büro- und<br />
Kommunikationssoftware unterteilt. Betriebliche Software wur<strong>de</strong> für die Unterstützung<br />
verschie<strong>de</strong>ner Arbeitsplatz-Tätigkeiten in einem Unternehmen wie z.B.<br />
„Vertriebsabwicklung“ entwickelt. 8<br />
Da die an<strong>de</strong>ren Softwaretypen im weiteren Verlauf <strong>de</strong>r Arbeit nicht von Be<strong>de</strong>utung<br />
sind, wird an dieser Stelle auf eine nähere Erklärung verzichtet.<br />
Ein ERP System unterstützt Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Diese<br />
Geschäftsprozesse können z.B. Finanzwesen, Controlling, Vertrieb etc. sein. 9<br />
Somit gehört eine ERP Software in die Kategorie <strong>de</strong>r betrieblichen Anwendungssoftware.<br />
Alle erwähnten Softwaresysteme können sowohl Individualentwicklungen, als<br />
auch Standardsoftware sein. Da in dieser Arbeit, die Standardsoftware SAP <strong>de</strong>r<br />
SAP AG näher betrachtet wird, wird auf Individualentwicklungen nicht näher<br />
eingegangen.<br />
7 Vgl. Gadatsch (2002a), S. 3.<br />
8 Vgl. Gadatsch (2003), S. 248-249.<br />
9 Vgl. Gadatsch (2001), S. 71-72.
Abbildung 1: Softwarekategorien<br />
Quelle: In Anlehnung an Gadatsch (2002a), S. 3.<br />
2.2 Merkmale von ERP Systemen<br />
6<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n die Merkmale eines ERP Systems näher erläutert. Mit<br />
Hilfe dieser Merkmale wird eine klare Abgrenzung zu an<strong>de</strong>ren Software Systemen<br />
<strong>de</strong>utlich.<br />
Standardisierung<br />
ERP Software wird für <strong>de</strong>n „anonymen Markt“ 10 entwickelt. Aus diesem Grund<br />
muss sie so entwickelt wer<strong>de</strong>n, dass sie die Anfor<strong>de</strong>rungen vieler Unternehmen<br />
ab<strong>de</strong>ckt.<br />
Die Grundlagen <strong>de</strong>r Standardisierung können verschie<strong>de</strong>n sein. Beispielsweise<br />
haben Gesetze <strong>de</strong>s Steuer- und Han<strong>de</strong>lsrechts zu einer Standardisierung im<br />
externen Rechnungswesen geführt. Für das interne Rechnungswesen hingegen<br />
führten wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer Vereinheitlichung. 11<br />
10 Gadatsch (2002a), S. 3.<br />
11 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 4.
7<br />
Dadurch, dass viele Unternehmen die Software nutzen können, verteilen sich<br />
die Entwicklungskosten auf mehrere Anwen<strong>de</strong>r. Der Software-Anbieter kann<br />
bereits nach einer geringen Anzahl an Installationen die Software günstiger anbieten,<br />
wovon auch die nachfragen<strong>de</strong>n Unternehmen profitieren. 12<br />
Customizing<br />
Durch das Customizing wird <strong>de</strong>n nachfragen<strong>de</strong>n Unternehmen die Möglichkeit<br />
geboten, die Standardsoftware auf ihre Anfor<strong>de</strong>rungen anzupassen.<br />
Die von <strong>de</strong>m Unternehmen benötigten Software-Bausteine wer<strong>de</strong>n dabei durch<br />
das Setzen von Parametern ausgewählt. 13 Somit ist diese Art <strong>de</strong>r Anpassungen<br />
nur im Rahmen <strong>de</strong>r vom Hersteller vorgegebenen Parametertabellen möglich. 14<br />
Anpassungen, die darüber hinaus erwünscht sind, können mit dieser Metho<strong>de</strong><br />
nicht realisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Modularisierung<br />
Durch die Modularisierung von ERP Software ist das nachfragen<strong>de</strong> Unternehmen<br />
in <strong>de</strong>r Lage nur die Komponenten zu einzusetzen, die es benötigt. Somit<br />
bleibt <strong>de</strong>r Kauf eines Komplettsystems, von <strong>de</strong>m nur wenige Funktionalitäten<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n, erspart. 15<br />
Auch für <strong>de</strong>n Hersteller ist Modularisierung von Vorteil. Module sind in sich geschlossene<br />
Software Pakete, die Schnittstellen zu an<strong>de</strong>ren Modulen besitzen.<br />
Die Komplexität bei <strong>de</strong>r Entwicklung mehrerer kleinerer Module ist geringer, als<br />
bei <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Gesamtsystems. Außer<strong>de</strong>m wird die Arbeitsorganisation<br />
in <strong>de</strong>r Entwicklung erleichtert, da bspw. die Module parallel programmiert<br />
wer<strong>de</strong>n können. 16<br />
Dadurch, dass die Module in sich geschlossen sind, können sie auch einzeln<br />
vermarktet wer<strong>de</strong>n.<br />
12 Vgl. Gronau (1999), S. 15.<br />
13 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 4.<br />
14 Vgl. Rau (2006), S. 7.<br />
15 Vgl. Rau (2006), S. 9.<br />
16 Vgl. Balzert (1998), S. 572-574.
8<br />
Die unten aufgeführte Liste dient <strong>de</strong>r Vervollständigung <strong>de</strong>r ERP-Merkmale.<br />
Diese sind für <strong>de</strong>n weiteren Verlauf <strong>de</strong>r Arbeit nicht relevant und darum wird auf<br />
eine nähere Erklärung verzichtet.<br />
• Operative Funktionalität<br />
• Datenintegration<br />
• Prozessintegration<br />
• Schichtenarchitektur<br />
• Transaktionsorientierung 17<br />
2.3 SAP ERP Systeme<br />
Die Unternehmen, die aktuell vor einem Releasewechsel stehen, wechseln von<br />
<strong>de</strong>m System SAP R/3 zu SAP ERP 6.0. Aus diesem Grund wird das SAP R/3<br />
System hier als Beispiel aufgeführt und weiter betrachtet.<br />
SAP R/3 wur<strong>de</strong> 1992 von <strong>de</strong>r SAP AG eingeführt. Als ERP System besitzt SAP<br />
R/3 die oben genannten Merkmale.<br />
Individualentwicklungen in R/3<br />
Als Standardsoftware versucht auch R/3 so viele Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r nachfragen<strong>de</strong>n<br />
Unternehmen wie möglich zu unterstützen. Doch ist das bei <strong>de</strong>r Vielzahl<br />
an Unternehmen nicht komplett möglich. Auch durch das Customizing<br />
können nicht alle Anfor<strong>de</strong>rungen realisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
So wer<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>n Stellen Erweiterungen notwendig, an <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Geschäftsprozess<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens nicht mehr mit <strong>de</strong>r Standardsoftware abgebil<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n kann. 18<br />
17 Vgl. Gadatsch (2003), S. 254-257.<br />
18 Vgl. Rau (2006), S. 24.
9<br />
Erweiterungen wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r SAP eigener Programmiersprache ABAP/4 entwickelt.<br />
Grün<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n Wechsel eines SAP Releases<br />
Angesichts <strong>de</strong>s Konkurrenzdrucks ist ein Software-Hersteller in <strong>de</strong>r Pflicht sein<br />
Produkt stetig weiterzuentwickeln.<br />
Auch SAP entwickelt seine Produkte weiter. Dabei wird die Software nicht nur<br />
stetig verbessert, son<strong>de</strong>rn es wer<strong>de</strong>n auch neue Funktionalitäten in die vorhan<strong>de</strong>ne<br />
Software implementiert.<br />
Die weiterentwickelte Software wird dann in einem neuen Release vermarktet.<br />
Unter einem Release ist somit eine neue Version <strong>de</strong>r Software zu verstehen.<br />
Bei <strong>de</strong>m Kauf einer Software bzw. eines Releases schließt das Unternehmen<br />
mit SAP einen Wartungsvertrag ab. In diesem Wartungsvertrag wird genau <strong>de</strong>finiert,<br />
welchen Support SAP gegenüber <strong>de</strong>m Unternehmen zu erbringen hat.<br />
Dabei bezieht sich <strong>de</strong>r Support nur auf das gekaufte Release und en<strong>de</strong>t zu einem<br />
vorgegebenen Datum.<br />
Möchte das Unternehmen einen störungsfreien Betrieb ihres SAP Systems gewährleisten,<br />
so muss es spätestens zu <strong>de</strong>m Auslaufdatum <strong>de</strong>s Wartungsvertrags<br />
auf ein neues Release wechseln.<br />
Dieser künstlich verkürzte Systemlebenszyklus sorgt für eine regelmäßige Aktualisierung<br />
<strong>de</strong>r Software Releases im Unternehmen und zu einer Umsatzgenerierung<br />
bei SAP. 19<br />
Problematik Individualentwicklung bei einem Releasewechsel<br />
Bei <strong>de</strong>r Durchführung eines Releasewechsels stellen die Individualentwicklungen<br />
das größte Hemmnis dar. Unter Umstän<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n die Individualentwick-<br />
19 Vgl. Rau (2006), S. 31-33.
10<br />
lungen nicht automatisch in das neuen Release übernommen und es kommt zu<br />
Anpassungsschwierigkeiten. 20<br />
Es muss auch darauf geachtet wer<strong>de</strong>n, dass die Individualentwicklungen von<br />
<strong>de</strong>m neuen Release nicht gelöscht o<strong>de</strong>r überschrieben wer<strong>de</strong>n. Dabei kann es<br />
auch zu Wechselwirkungen mit an<strong>de</strong>ren Programmen kommen. 21<br />
Die Individualentwicklungen können auch dazu führen, dass die Gewährleistungsansprüche<br />
gegenüber SAP vermin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
Diese Grün<strong>de</strong> zeigen, dass Individualentwicklungen schnell zu ungeplanten<br />
Zusatzaufwendungen führen können. 22<br />
Daher liegt es nahe <strong>de</strong>n Releasewechsel zu nutzen, um so weit wie möglich in<br />
<strong>de</strong>n SAP Standard zurückzukehren und somit diese Zusatzaufwen<strong>de</strong> zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
20 Vgl. Rau (2006), S. 34.<br />
21 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 67.<br />
22 Vgl. Arb, von (1997), S. 187.
3 Vorgehensmo<strong>de</strong>lle für einen Releasewechsel von SAP<br />
3.1 Implementation Roadmap<br />
11<br />
Die Implementation Roadmap ist die aktuelle standardisierte Vorgehensweise<br />
für die E<strong>inf</strong>ührung und <strong>de</strong>n Wechsel von SAP R/3 und wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r SAP AG<br />
selbst entwickelt.<br />
Dabei besteht die Implementation Roadmap aus fünf nach einan<strong>de</strong>r auszuführen<strong>de</strong>n<br />
Phasen:<br />
• Projektvorbereitung<br />
• Business Blueprint<br />
• Realisierung<br />
• Produktvorbereitung und<br />
• Go Live und Support. 23<br />
23 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 77.
12<br />
Abbildung 2: Implemenation Roadmap <strong>de</strong>r SAP AG<br />
© SAP AG<br />
Projektvorbereitung<br />
Die erste Phase dient <strong>de</strong>r Planung und Vorbereitung <strong>de</strong>s Projektes. Hierbei<br />
wer<strong>de</strong>n allgemeine Grundsätze <strong>de</strong>s Projektmanagements befolgt, die in allen<br />
Projekten erfolgen sollten, unabhängig von einer E<strong>inf</strong>ührung von SAP.<br />
In dieser Phase<br />
• wer<strong>de</strong>n die Ziele <strong>de</strong>finiert,<br />
• eine E<strong>inf</strong>ührungsstrategie festgelegt,<br />
• <strong>de</strong>r Projektplan mit <strong>de</strong>n Arbeitspakten, Aktivitäten und Aufgaben <strong>de</strong>finiert,<br />
• die Projektorganisation aufgestellt und <strong>de</strong>r Entscheidungsweg festgelegt,<br />
• Standards für das Verfahren und die Dokumentation bestimmt,<br />
• das Projektbudget festgelegt,
13<br />
• die Anfor<strong>de</strong>rungen und die Zuteilung <strong>de</strong>r benötigten Ressourcen <strong>de</strong>finiert. 24<br />
Business Blueprint<br />
Ziel dieser Phase ist die Erstellung <strong>de</strong>r Business Blueprints. Unter Business<br />
Blueprints wer<strong>de</strong>n Entwurfsdokumente für das einzuführen<strong>de</strong> System verstan<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>n Business Blueprints wer<strong>de</strong>n<br />
• die Geschäftsprozesse und Unternehmensbereiche <strong>de</strong>finiert,<br />
• eine Zuordnung <strong>de</strong>r Organisationsstruktur zu <strong>de</strong>n R/3-<br />
Organisationseinheiten erstellt,<br />
• Anfor<strong>de</strong>rungen an die Geschäftsprozesse festgelegt,<br />
• Anfor<strong>de</strong>rungen für die Datenübernahme festgelegt und erfor<strong>de</strong>rliche Schnittstellen<br />
aufgelistet.<br />
Zusätzlich zu <strong>de</strong>n Business Blueprints gibt es noch an<strong>de</strong>re Arbeitspakete, die in<br />
dieser Phase erledigt wer<strong>de</strong>n.<br />
So muss bspw. eine Strategie zum Change Management erarbeitet wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Change Management ist für die Än<strong>de</strong>rungen im Rahmen <strong>de</strong>s Projektes<br />
verantwortlich.<br />
Neben <strong>de</strong>n fachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen an das neue System, müssen auch technische<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n. Aus diesen Anfor<strong>de</strong>rungen wird dann<br />
eine erste Test-Umgebung aufgebaut, und die Entwicklungsumgebung vorbereitet.<br />
Ein letztes Arbeitspaket dieser Phase ist das Erstellen eines Schulungsplans für<br />
die Endbenutzer. Damit wird sichergestellt, dass die Endbenutzer rechtzeitig auf<br />
ihre neuen Aufgaben vorbereitet sind. 25<br />
24 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 78.<br />
25 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 92-105.
14<br />
Realisierung<br />
In <strong>de</strong>r Realisierungsphase wer<strong>de</strong>n die Anfor<strong>de</strong>rungen aus <strong>de</strong>r vorherigen Phase<br />
umgesetzt. Diese Umsetzung geschieht in zwei Schritten:<br />
1. Baseline- und Detail-Konfiguration<br />
2. individuelle Funktionen<br />
Unter einer Baseline-Konfiguration wird das Einrichten <strong>de</strong>r Grun<strong>de</strong>instellungen,<br />
wie z.B. Län<strong>de</strong>rspezifikationen, Währungen, etc. verstan<strong>de</strong>n. Aber auch Unternehmensspezifische<br />
Einstellungen wie Buchungskreis und Werke wer<strong>de</strong>n eingestellt.<br />
In <strong>de</strong>r Detail-Konfiguration wer<strong>de</strong>n die Geschäftsprozesse in das System integriert.<br />
Bei <strong>de</strong>r Umsetzung <strong>de</strong>r individuellen Funktionen wer<strong>de</strong>n Systemerweiterungen,<br />
Berichte und Formulare entwickelt, die nicht standardmäßig im SAP System<br />
vorgesehen sind.<br />
Zu <strong>de</strong>n zwei Schritten, in <strong>de</strong>nen das SAP System konfiguriert wird, müssen<br />
noch an<strong>de</strong>re Programme entwickelt wer<strong>de</strong>n. So wer<strong>de</strong>n bspw. Programme benötigt,<br />
die die Datenübernahme automatisieren und Schnittstellen zu an<strong>de</strong>ren<br />
Systemen bzw. <strong>de</strong>m Alt-System liefern.<br />
Vor <strong>de</strong>m abschließen<strong>de</strong>n Integrationstest, muss das Berechtigungskonzept in<br />
das SAP System implementiert wer<strong>de</strong>n und Schulungsdokumentationen und -<br />
unterlagen erstellt wer<strong>de</strong>n. 26<br />
Produktionsvorbereitung<br />
Das Ziel dieser Phase ist es, das Unternehmen, wie auch das SAP System für<br />
<strong>de</strong>n produktiven Betrieb vorzubereiten.<br />
26 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 105-120.
15<br />
Dafür wer<strong>de</strong>n die zuvor geplanten Anwen<strong>de</strong>rschulungen durchgeführt. Auch<br />
wer<strong>de</strong>n Einstellungen, wie die Verarbeitung <strong>de</strong>r Hintergrundprozesse und die<br />
Infrastruktur für das Drucken in das System eingepflegt.<br />
Anschließend wer<strong>de</strong>n diverse Tests durchgeführt, wie z.B. Disaster Recovery<br />
Tests, Backup-Tests, Druck- und Faxtests, aber auch Tests zum Prüfen wichtiger<br />
Transaktionen.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Phase wird <strong>de</strong>r Wechsel von <strong>de</strong>m Alt-System zu <strong>de</strong>m neuen SAP<br />
System vollzogen. Dieser Wechsel wird auch Cut Over genannt. 27<br />
Go Live und Support<br />
In <strong>de</strong>r letzten Phase wird das SAP System noch so lange vom Projektteam begleitet,<br />
bis eine ausreichen<strong>de</strong> Stabilität <strong>de</strong>s Systems erreicht wird.<br />
In <strong>de</strong>r ersten Woche nach <strong>de</strong>m Produktivsetzen <strong>de</strong>s Systems wer<strong>de</strong>n vor allem<br />
die Benutzer bei <strong>de</strong>r Arbeit mit <strong>de</strong>m System unterstützt. Sollten dabei noch<br />
Probleme auftauchen, die eine Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Systems erfor<strong>de</strong>rn, sollten diese<br />
zuerst im Entwicklungssystem durchgeführt und im Qualitätssystem getestet<br />
wer<strong>de</strong>n, bevor sie in das Produktivsystem eingespielt wer<strong>de</strong>n.<br />
Zum Abschluss <strong>de</strong>s Projektes wird in einem Lenkungsausschuss das System<br />
übergeben und abgenommen. Damit ist das Projekt offiziell been<strong>de</strong>t und die<br />
Projektmitarbeiter wer<strong>de</strong>n aus ihren Projektaufgaben entlassen. 28<br />
27 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 120-123.<br />
28 Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 124-125.
16<br />
3.2 Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout<br />
Die IDS Scheer AG bietet ein Tool namens „Redocumentation Scout“ an. Mit<br />
diesem Tool ist es möglich „vorhan<strong>de</strong>ne R/3-System auf einer prozessorientierter<br />
Basis zu redokumentieren“ 29 . Neben <strong>de</strong>m eigentlich Tool, wird auch ein<br />
Phasenmo<strong>de</strong>ll angeboten, das Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout. Dieses<br />
Phasenmo<strong>de</strong>ll wird im Folgen<strong>de</strong>n vorgestellt.<br />
Abbildung 3: Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout <strong>de</strong>r IDS Scheer AG<br />
Quelle: Rau (2006), S. 41.<br />
Projektvorbereitung<br />
Auch in diesem Phasenmo<strong>de</strong>ll dient die erste Phase zur Projektvorbereitung.<br />
Es müssen die Ziele <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n, es muss ein Projektplan erstellt wer<strong>de</strong>n<br />
und die beteiligten Personen müssen über das Projektvorgehen <strong>inf</strong>ormiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Auch das erste vertraut Machen mit <strong>de</strong>r notwendigen Software, muss in<br />
dieser Phase vollzogen wer<strong>de</strong>n. 30<br />
Datenextrakt<br />
Über einen speziellen ABAP/4-Report wer<strong>de</strong>n die Daten aus <strong>de</strong>m produktiven<br />
R/3 System in eine Datei geschrieben. Dieser Report liefert Daten über Trans-<br />
29 Rau (2006), S. 39.<br />
30 Vgl. Rau (2006), S. 41-42.
aktionen, Reports, Entwicklungen und Tabellen, die angepasst wur<strong>de</strong>n, wie<br />
auch Informationen über <strong>de</strong>n Releasestand, Benutzer und organisatorische<br />
Funktionen.<br />
Durch <strong>de</strong>n Transaktionsmonitor <strong>de</strong>s R/3 Systems sollen folgen<strong>de</strong> Fragen beantwortet<br />
wer<strong>de</strong>n: 31<br />
• „Welche Funktionen und Transaktionen wer<strong>de</strong>n im R/3-System genutzt?“<br />
17<br />
• „Welche Organisationseinheiten und Nutzer wer<strong>de</strong>n im R/3-System repräsentiert?“<br />
• „Welche Geschäftsprozesse und Geschäftsabläufe wer<strong>de</strong>n durch das R/3-<br />
System unterstützt?“ 32<br />
Datenanalyse<br />
Die vorher extrahierte Datei wird in dieser Phase in <strong>de</strong>n Reverse Business Engineer<br />
(RBE) von SAP importiert. Dieser analysiert die Datei und gibt Informationen<br />
über<br />
• welche organisatorische Einheit, welche Art von Transaktionen nutzt,<br />
• welche Funktionen überhaupt genutzt wer<strong>de</strong>n,<br />
• wie die Nutzung <strong>de</strong>r Individualentwicklungen ist,<br />
• welche Customizingeinstellungen gemacht wur<strong>de</strong>n,<br />
• welche Stammdaten genutzt wer<strong>de</strong>n<br />
• und ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Mandaten 33 , falls mehrere<br />
vorhan<strong>de</strong>n sind. 34<br />
31 Vgl. Rau (2006), S. 42.<br />
32 Rau (2006), S. 42.<br />
33 Ein Mandant ist die oberste Organisationseinheit in R/3. Vgl. Appelrath / Ritter (2000), S. 48.<br />
34 Vgl. Rau (2006), S. 43-44.
18<br />
Direkte Überführung in Prozessmo<strong>de</strong>lle<br />
In dieser Phase wer<strong>de</strong>n die Analyseergebnisse <strong>de</strong>s RBE in Prozessmo<strong>de</strong>lle<br />
übertragen. Dabei wer<strong>de</strong>n nicht nur die R/3 Standardprozesse, son<strong>de</strong>rn auch<br />
die individuellen Prozesse abgebil<strong>de</strong>t. Diese Prozessmo<strong>de</strong>lle dienen dann als<br />
Basis zur Geschäftsprozessoptimierung. 35<br />
Y-Match<br />
Nun wird ein High Level Prozessmo<strong>de</strong>ll für die Geschäftsprozesse <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
erstellt. Dabei wer<strong>de</strong>n das SAP Referenzmo<strong>de</strong>ll und die Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>r vorherigen Phase betrachtet. Es muss geprüft wer<strong>de</strong>n, an welchen Stellen<br />
das SAP System die internen Prozesse unterstützt und an welchen Stellen Anpassungen<br />
erfor<strong>de</strong>rlich sind. 36<br />
Kontinuierliche Optimierung<br />
Die Ergebnisse <strong>de</strong>r Redokumentation können auch für weitere Optimierung genutzt<br />
wer<strong>de</strong>n. Dieses wird in dieser abschließen<strong>de</strong>n Phase durchgeführt. 37<br />
35 Vgl. Rau (2006), S. 44-45.<br />
36 Vgl. Rau (2006), S. 45.<br />
37 Vgl. Rau (2006), S. 46.
4 V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
19<br />
Das V-Mo<strong>de</strong>ll XT wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Koordinierungs- und Beratungsstelle <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sregierung<br />
für Informationstechnik in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sverwaltung (KBSt) entwickelt.<br />
Es ist ein Vorgehensmo<strong>de</strong>ll zum Planen und Durchführen von IT-<br />
Projekten. 2004 löst es das zuvor entwickelte V-Mo<strong>de</strong>ll ’97 ab, da dieses nicht<br />
mehr <strong>de</strong>n aktuellen Stand <strong>de</strong>r Informationstechnologie wi<strong>de</strong>rspiegelte. 38<br />
Das V-Mo<strong>de</strong>ll® XT ist eine durch die Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland geschützte<br />
Marke.<br />
Abbildung 4: Logo V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
38 Vgl. KBSt (2004), Teil 1 S. 3.
4.1 Ziele <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
20<br />
Minimierung <strong>de</strong>r Projektrisiken<br />
Durch eine standardisierte Vorgehensweise, die zu erledigen<strong>de</strong>n Ergebnisse<br />
mit <strong>de</strong>n verantwortlichen Rollen <strong>de</strong>finiert, wird die Projekttransparenz und Planbarkeit<br />
verbessert. Somit wer<strong>de</strong>n Planungsabweichungen frühzeitig erkannt und<br />
das Eintreten von Risiken kann verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n<br />
Verbesserung und Gewährleistung <strong>de</strong>r Qualität<br />
Die Standarisierung <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT stellt sicher, dass die Ergebnisse von gewünschter<br />
Qualität sind. Die Vereinheitlichung <strong>de</strong>r Produktinhalte verbessert die<br />
Lesbarkeit und erhöht die Verständlichkeit. Daher können die Zwischenergebnisse<br />
frühzeitig und leichter überprüft wer<strong>de</strong>n.<br />
Eindämmung <strong>de</strong>r Gesamtkosten<br />
Die Kosten für die Entwicklung, Herstellung und Pflege eines Systems lassen<br />
sich besser kalkulieren, abschätzen und steuern.<br />
Verbesserung <strong>de</strong>r Kommunikation<br />
Reibungsverluste zwischen Nutzern, Auftraggeber (AG), Auftragnehmer (AN)<br />
und Entwickler wer<strong>de</strong>n durch eine einheitliche Beschreibung <strong>de</strong>r relevanten Bestandteile<br />
und Begrifflichkeiten reduziert. 39<br />
39 Vgl. KBSt (2004), Teil 1 S. 4.
4.2 Grundkonzept <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
Das V-Mo<strong>de</strong>ll XT legt fest „Wer“ „Wann“ „Was“ in einem Projekt zu erledigen<br />
hat.<br />
21<br />
Das V-Mo<strong>de</strong>ll XT ist für verschie<strong>de</strong>ne Projektkonstellationen geeignet. Doch ist<br />
ein Ablaufschema nicht auf je<strong>de</strong> Projektkonstellation anwendbar. Daher bietet<br />
das V-Mo<strong>de</strong>ll XT verschie<strong>de</strong>ne Projekttypen an, die die charakteristischen Eigenschaften<br />
von Softwareprojekten klassifizieren.<br />
Die Projekttypen, die das V-Mo<strong>de</strong>ll XT anbietet sind:<br />
• Systementwicklungsprojekt (AG)<br />
• Systementwicklungsprojekt (AN)<br />
• Systementwicklungsprojekt (AG/AN)<br />
• E<strong>inf</strong>ührung und Pflege eines organisationsspezifischen Vorgehensmo<strong>de</strong>lls.<br />
Bei <strong>de</strong>m zu entwickeln<strong>de</strong>n System gibt es wie<strong>de</strong>rum eine Einteilung in:<br />
• Hardware-System<br />
• Software-System<br />
• Komplexes System<br />
• Eingebettetes System<br />
• Systemintegration<br />
Abbildung 6 veranschaulicht die Beziehungen <strong>de</strong>r Projektmerkmale, Projektrollen<br />
und Projekttypen.
22<br />
Der ausgewählte Projekttyp <strong>de</strong>finiert min<strong>de</strong>stens eine Projektdurchführungsstrategie.<br />
Eine Projektdurchführungsstrategie ist eine Folge von Entscheidungspunkten<br />
und somit <strong>de</strong>r Ablaufrahmen für das Projekt.<br />
Ein Entscheidungspunkt ist ein Meilenstein im Projektablauf, zu ihm wird <strong>de</strong>r<br />
aktuelle Stand <strong>de</strong>s Projektes evaluiert.<br />
Eine Zuordnung <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategien zu <strong>de</strong>n Projekttypen ist in<br />
Abbildung 7 dargestellt und eine Übersicht aller Entscheidungspunkte ist<br />
Abbildung 8 zu entnehmen.<br />
Zusätzlich zu <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie <strong>de</strong>finiert <strong>de</strong>r Projekttyp auch<br />
die Vorgehensbausteine, die während <strong>de</strong>s Projektes bearbeitet wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
Zu <strong>de</strong>n vorgegebenen Vorgehensbausteinen, können außer<strong>de</strong>m auch weitere<br />
ausgewählt wer<strong>de</strong>n.<br />
Um einen Min<strong>de</strong>stmaß an Projektdurchführungsqualität zu gewährleisten, gibt<br />
es Vorgehensbaustein, die in je<strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT konformen Projekt angewen<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n müssen. Diese Vorgehensbausteine wer<strong>de</strong>n V-Mo<strong>de</strong>ll-Kern genannt.<br />
Diese sind:<br />
• Projektmanagement<br />
• Qualitätssicherung<br />
• Konfigurationsmanagement<br />
• Problem- und Än<strong>de</strong>rungsmanagement.<br />
Ein Vorgehensbaustein ist eine konkrete Aufgabenstellung im Projekt. Zu <strong>de</strong>r<br />
Aufgabenstellung wer<strong>de</strong>n die zu erarbeiten<strong>de</strong>n Produkte, die Aktivitäten und die<br />
ausführen<strong>de</strong>n Rollen festgelegt. Dabei ist je<strong>de</strong>r Vorgehensbaustein in sich abgeschlossen.
23<br />
Ein Vorgehensbaustein <strong>de</strong>finiert somit das „Was“ - die zu erstellen<strong>de</strong>n Produkte<br />
- und das „Wer“ - die verantwortliche Rolle. Da zu je<strong>de</strong>m Entscheidungspunkt<br />
eine Menge zu erledigen<strong>de</strong>n Produkten <strong>de</strong>finiert ist, legt die Projektdurchführungsstrategie<br />
somit das „Wann“ fest.<br />
Eine Übersicht über die Gesamtstruktur <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT bietet Abbildung 5. 40<br />
Abbildung 5: Grundstruktur <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
40 Vgl. KBSt (2004), Teil 1 S. 8-16.
24<br />
Abbildung 6: Klassifizierung von Projekten in Projekttypen<br />
Quelle: KBSt (2004), Teil 1 S. 10.
25<br />
Abbildung 7: Zuordnung <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie<br />
Quelle: KBSt (2004), Teil 1 S. 14.
Abbildung 8: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
Quelle: KBSt (2004), Teil 1 S. 16.<br />
26
4.3 Tailoring<br />
27<br />
Unter Tailoring wird das Anpassen <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT verstan<strong>de</strong>n.<br />
Wie im Kapitel 4.2 „Grundkonzept <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT“ beschrieben, bietet das V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT mehrere Auswahlmöglichkeiten, die die Projektdurchführung bee<strong>inf</strong>lussen.<br />
Um diese Auswahl zu erleichtern wird <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistent<br />
angeboten. Der V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistent ist ein Softwaretool mit <strong>de</strong>ssen<br />
Hilfe das Tailoring durchgeführt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Durch die Auswahl <strong>de</strong>s Projekttyps in <strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten,<br />
wer<strong>de</strong>n die nicht relevanten Teile <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT ausgeblen<strong>de</strong>t. Somit braucht<br />
sich <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r nur noch mit <strong>de</strong>n projektrelevanten Vorgehensbausteinen<br />
und Projektdurchführungsstrategien auseinan<strong>de</strong>r setzen. 41<br />
Abbildung 9 zeigt die Auswahl <strong>de</strong>s Projekttyps mit Hilfe <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten.<br />
In Abbildung 10 ist zu sehen, wie <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistent<br />
die projektunrelevanten Merkmale ausblen<strong>de</strong>t. Der Anwen<strong>de</strong>r kann sich<br />
nun durch Anklicken für eine Projektdurchführungsstrategie und für zusätzliche<br />
Vorgehensbausteine entschei<strong>de</strong>n.<br />
Der V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistent bietet weiterhin an, getailorte Dokumentvorlagen,<br />
Dokumentationen und einen Projektplan zu exportieren. Durch diese vorgefertigten<br />
Dokumente wird <strong>de</strong>r Einstieg in das Projekt erleichtert.<br />
Bei <strong>de</strong>m Export <strong>de</strong>r Dokumentation wer<strong>de</strong>n nur die Beschreibungen exportiert,<br />
die für das aktuelle Projekt notwendig sind. Somit muss sich <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r<br />
nicht durch Beschreibungen durcharbeiten, die nicht für sein Projekt relevant<br />
sind.<br />
41 Vgl. KBSt (2004), Teil 1 S. 18-19.
28<br />
Abbildung 9: Auswahl <strong>de</strong>s Projekttyps<br />
Abbildung 10: Auswahl <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie<br />
und <strong>de</strong>r Vorgehensbausteine
Im V-Mo<strong>de</strong>ll XT wird unter <strong>de</strong>r Auswahl <strong>de</strong>s Projekttyps, <strong>de</strong>n Vorgehensbausteinen<br />
und <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie <strong>de</strong>r Begriff Tailoring verstan<strong>de</strong>n.<br />
42 Dieses Tailoring unterstützt <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistent.<br />
29<br />
Wer<strong>de</strong>n allerdings Anpassungen benötigt, die nicht im V-Mo<strong>de</strong>ll XT Standard<br />
enthalten sind, ist es möglich sie über <strong>de</strong>n V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor hineinzutailorn.<br />
Der V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor ermöglicht das V-Mo<strong>de</strong>ll XT über <strong>de</strong>n Standard hinweg<br />
für die spezifischen Anfor<strong>de</strong>rungen anzupassen. Mit diesem Editor wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT Standard auch selbst entwickelt.<br />
Der V-Mo<strong>de</strong>ll XT Standard bietet mit <strong>de</strong>m Projekttyp „E<strong>inf</strong>ührung und Pflege<br />
eines organisationsspezifischen Vorgehensmo<strong>de</strong>lls“ eine Vorgehensweise, um<br />
das V-Mo<strong>de</strong>ll XT an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.<br />
Abbildung 11: V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor<br />
42 Vgl. KBSt (2004), Teil 1 S. 18.
30<br />
Abbildung 11 zeigt <strong>de</strong>n V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor. Über <strong>de</strong>m Dateibaum auf <strong>de</strong>r linken<br />
Seite wird ausgewählt was geän<strong>de</strong>rt bzw. hinzufügen wer<strong>de</strong>n soll. Über die<br />
rechte Seite wird das ausgewählte Element mit Werten gefüllt.
5 Konzeptbildung<br />
31<br />
Aus <strong>de</strong>n Vorgehensmo<strong>de</strong>llen aus Kapitel 3 und <strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT soll nun ein<br />
Konzept für ein V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel entwickelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>m neuen V-Mo<strong>de</strong>ll XT wird berücksichtigt, dass <strong>de</strong>r Auftragnehmer an<strong>de</strong>re<br />
Aktivitäten zu erledigen hat, als <strong>de</strong>r Auftraggeber. Aus diesem Grund wer<strong>de</strong>n<br />
zwei Vorgehensmo<strong>de</strong>lle, spezielle für die jeweiligen Bedürfnisse, entwickelt.<br />
Diese zwei Vorgehensmo<strong>de</strong>lle lassen sich durch gleiche Schnittstellen zu einem<br />
Vorgehensmo<strong>de</strong>ll zusammenfassen.<br />
5.1 Konzept für das Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftraggebers<br />
Zuerst wird das Konzept für das Vorgehensmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftraggebers vorgestellt.<br />
Ausgangspunkt für die Konzeptbildung ist <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projekttyp „Systementwicklungsprojekt<br />
(AG)“ mit <strong>de</strong>n Projektmerkmalen „Systemintegration“ und<br />
„AG mit einem AN“.<br />
Abbildung 12 zeigt die Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s oben genannten Projekttyps.<br />
Doch wie zu sehen ist, fehlt bei diesem Vorgehen eine genaue Analyse <strong>de</strong>s<br />
SAP Systems, wie sie im Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout vorgestellt<br />
wur<strong>de</strong>n. Aus diesem Grund wer<strong>de</strong>n zwischen <strong>de</strong>n Entscheidungspunkten „Projekt<br />
<strong>de</strong>finiert“ und „Anfor<strong>de</strong>rung festgelegt“ drei weitere Entscheidungspunkte<br />
eingeführt, nämlich „Datenextrakt“, „Datenanalyse“ und „Direkte Überführung in<br />
Prozessmo<strong>de</strong>lle“ aus <strong>de</strong>m Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout.<br />
Abbildung 13 zeigt welche Entscheidungspunkte aus <strong>de</strong>m Vorgehensmo<strong>de</strong>ll<br />
und welche aus <strong>de</strong>m Phasenmo<strong>de</strong>ll Redocumentation Scout stammen.<br />
Im letzten Schritt wer<strong>de</strong>n die neuen Entscheidungspunkte noch an die Form<br />
<strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT angepasst. Aus „Datenextrakt“ wird „Daten extrahiert“, aus<br />
„Datenanalyse“ wird „Daten analysiert“ und zuletzt wird „Direkte Überführung in<br />
Prozessmo<strong>de</strong>lle“ zu „in Prozessmo<strong>de</strong>ll überführt“.
32<br />
Abbildung 14 zeigt das fertige Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
AG mit beson<strong>de</strong>rer Kennzeichnung, was speziell für <strong>de</strong>n Auftraggeber<br />
und was von Auftraggeber und Auftragnehmer erledigt wer<strong>de</strong>n muss.
33<br />
Abbildung 12: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Systementwicklungsprojekt (AG)<br />
Quelle: in Anlehnung an KBSt (2004), Teil 3 S. 16.
34<br />
Abbildung 13: Konzept Vorgehensmo<strong>de</strong>ll AG<br />
Quelle: Eigene Darstellung.
Abbildung 14: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel AG<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
35
36<br />
5.2 Konzept für das Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftragnehmers<br />
Ausgangspunkt für das Konzept <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>lls für <strong>de</strong>n Auftragnehmer ist <strong>de</strong>r V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT Projekttyp „Systementwicklungsprojekt (AN)“ mit <strong>de</strong>n Projektmerkmalen<br />
„Systemintegration“ und „AN ohne Unterauftragnehmer“ und <strong>de</strong>r Projektdurchführungsstrategie<br />
„Inkrementelle Systementwicklung (AN)“.<br />
Abbildung 15 zeigt die Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s oben genannten Projekttyps.<br />
Hier fällt allerdings auf, dass es zu <strong>de</strong>r Implementation Roadmap keine gravieren<strong>de</strong>n<br />
Unterschie<strong>de</strong> gibt. Zwar hat die Implementation Roadmap nur eine Phase<br />
um die „Business Blueprints“ zu entwickeln und im V-Mo<strong>de</strong>ll XT gibt es drei<br />
Phasen um letztendlich zu <strong>de</strong>m „Feinkonzept“ zu gelangen. Auch die Phase<br />
„Realisierung“ <strong>de</strong>r Implementation Roadmap wird im V-Mo<strong>de</strong>ll XT in <strong>de</strong>n Phasen<br />
„Systemelemente realisiert“ und „System integriert“ aufgeteilt. Aber die eigentliche<br />
Vorgehensweise unterschei<strong>de</strong>t sich kaum.<br />
Es gibt allerdings eine Phase innerhalb <strong>de</strong>r Implementation Roadmap, die im V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT in dieser Form nicht vorgesehen ist. Und diese ist die Phase „Go Live<br />
& Support“. Diese Phase muss somit in das neue V-Mo<strong>de</strong>ll XT hineingetailort<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Abbildung 16 zeigt die Überführung <strong>de</strong>r Implementation Roadmap in das V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT.<br />
Auch hier wird <strong>de</strong>r Entscheidungspunkt „Go Live & Support“ <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
Form angepasst und in „Go Live & Support abgeschlossen“ umbenannt.<br />
Abbildung 17 zeigt das fertige Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
(AN) mit beson<strong>de</strong>rer Kennzeichnung, was speziell für <strong>de</strong>n Auftragnehmer<br />
und was von Auftraggeber und Auftragnehmer erledigt wer<strong>de</strong>n<br />
muss.
37<br />
Abbildung 15: Entscheidungspunkte <strong>de</strong>s Systementwicklungsprojekt (AN)<br />
Quelle: in Anlehnung an KBSt (2004), Teil 3 S. 19.
38<br />
Abbildung 16: Konzept Vorgehensmo<strong>de</strong>ll AN<br />
Quelle: Eigene Darstellung.
Abbildung 17: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel AN<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
39
5.3 Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für eine SAP Releasewechsel<br />
40<br />
Mit <strong>de</strong>r Zusammenführung <strong>de</strong>r Konzepte für <strong>de</strong>n Auftraggeber und <strong>de</strong>n Auftragnehmer<br />
zu einem einzigen Konzept, entsteht das Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
für einen SAP Releasewechsel.<br />
Abbildung 18 zeigt das gesamt Konzept für das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
mit spezieller Kennzeichnung <strong>de</strong>r Aufgaben <strong>de</strong>s Auftraggebers<br />
und <strong>de</strong>r Auftragnehmers.
41<br />
Abbildung 18: V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel<br />
Quelle: Eigene Darstellung.
42<br />
6 Vorstellung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Die technische Umsetzung <strong>de</strong>s Konzepts geschieht mit <strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor.<br />
Mit <strong>de</strong>ssen Hilfe wird die V-Mo<strong>de</strong>ll XT.xml 43 verän<strong>de</strong>rt. Wird anschließend<br />
<strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten gestartet, erkennt er diese Än<strong>de</strong>rungen und<br />
zeigt diese an.<br />
Da Auftraggeber und Auftragnehmer getrennt betrachtet wer<strong>de</strong>n, ist es auch<br />
notwendig für je<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bei<strong>de</strong>n einen Projekttyp zur Verfügung zu stellen.<br />
Die neuen Projekttypen sind „SAP Releasewechsel (AG)“ und „SAP Releasewechsel<br />
(AN)“.<br />
Abbildung 19: Auswahl <strong>de</strong>r Projekttypen im getailorten Projektassistenten<br />
43 XML = Extensible Markup Language
6.1 SAP Releasewechsel (AG)<br />
43<br />
Wird <strong>de</strong>r Projekttyp „SAP Releasewechsel (AG)“ ausgewählt, wird sofort angezeigt,<br />
dass das Projekt exportiert wer<strong>de</strong>n kann. Dies be<strong>de</strong>utet, dass alle verpflichten<strong>de</strong>n<br />
Einstellungen bereits gesetzt sind.<br />
Auch die bestimmen<strong>de</strong>n Projektmerkmale „Systemintegration“ und „AG mit einem<br />
AN“ wur<strong>de</strong>n bereits gesetzt. Wer<strong>de</strong>n diese Projektmerkmale nachträglich<br />
verän<strong>de</strong>rt, wird die Auswahl <strong>de</strong>s Projekttypen automatisch gelöscht. Dies be<strong>de</strong>utet,<br />
dass für <strong>de</strong>n Projekttyp „SAP Releasewechsel (AG)“ diese Projektmerkmale<br />
verpflichtend sind.<br />
Im Register „Anwendungsprofil“ gibt es keine Än<strong>de</strong>rungen zum Standard V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT. Hier kann <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r weitere Projektmerkmale <strong>de</strong>finieren.<br />
Abbildung 20: Register Anwendungsprofil<br />
Im nächsten Register „Vorgehensbausteine und Projektdurchführungsstrategien“<br />
ist bereits die hineingetailorte Projektdurchführungsstrategie „Vergabe und
44<br />
Durchführung eines Systementwicklungsprojektes für einen SAP Releasewechsel“<br />
ausgewählt wor<strong>de</strong>n. Diese Projektdurchführungsstrategie ist die einzige,<br />
die für diesen Projekttypen zur Verfügung gestellt wird. Über diese Projektdurchführungsstrategie<br />
wird die Abfolge <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte bestimmt, die<br />
in Abbildung 14 bereits gezeigt wur<strong>de</strong>.<br />
Auch auf <strong>de</strong>r linken Seite bei <strong>de</strong>n Vorgehensbausteinen sind bereits einige<br />
ausgewählt wor<strong>de</strong>n. Unter <strong>de</strong>n ausgewählten Vorgehensbausteinen sind die<br />
verpflichten<strong>de</strong>n Vorgehensbausteine <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Kerns, Vorgehensbausteine<br />
für die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, wie<br />
bspw. „Vertragsschluss (AG)“ o<strong>de</strong>r „Lieferung und Abnahme (AG)“, aber auch<br />
ein neuer Vorgehensbaustein „Analyse und Bewertung <strong>de</strong>s SAP Systems“. Dieser<br />
Vorgehensbaustein <strong>de</strong>finiert die Aktivitäten für die Entscheidungspunkte<br />
„Daten extrahiert“, „Daten analysiert“ und „in Prozessmo<strong>de</strong>lle überführt“.<br />
Abbildung 21: Vorgehensbausteine und Projektdurchführungsstrategie<br />
für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP Releasewechsel (AG)"
45<br />
Abbildung 22: Planung <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP<br />
Releasewechsel (AG)"<br />
Die Vorgehensbausteine, die nicht ausgewählt wur<strong>de</strong>n und inaktiv sind, sind für<br />
diesen Projekttyp nicht relevant.<br />
Der Anwen<strong>de</strong>r hat zusätzlich die Möglichkeit die optionalen Vorgehensbausteine<br />
„Evaluierung von Fertigprodukten“, „Systemsicherheit“, „Kaufmännisches<br />
Projektmanagement“, „Messung und Analyse“ auszuwählen.<br />
Über <strong>de</strong>n Button „Planung“ kann <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r die Entscheidungspunkte mit<br />
geplanten Fertigstellungsterminen versehen. Abbildung 22 zeigt alle Entscheidungspunkte,<br />
die für diesen Projekttyp relevant sind.<br />
Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, können Dokumentvorlagen exportiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Zusätzlich zu <strong>de</strong>n Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT Produktvorlagen, gibt es nun<br />
eine weitere Produktgruppe: „Analyse und Bewertung <strong>de</strong>s SAP-Systems“. Diese<br />
Produktgruppe ist durch <strong>de</strong>n verpflichten<strong>de</strong>n Vorgehensbaustein „Analyse<br />
und Bewertung <strong>de</strong>s SAP-Systems“ hinzugekommen. Zu dieser Produktgruppe<br />
gehören die Produkte „Datenanalyse“, „Datenextrakt“ und „Soll-Prozessmo<strong>de</strong>ll“.
47<br />
Abbildung 24: Dokumentation <strong>de</strong>s Projektes "SAP Releasewechsel (AG)"<br />
Teil 1 und 2 <strong>de</strong>r Dokumentation wur<strong>de</strong> nicht angepasst. In Teil 1 sind die<br />
Grundlagen <strong>de</strong>s Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT beschrieben und in Teil 2 wird anhand<br />
eines Beispiels <strong>de</strong>r Ablauf im Projekt dargestellt. Diese zwei Teile dienen dazu,<br />
dass <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r ein Grundverständnis über das V-Mo<strong>de</strong>ll XT erlangt. Aus<br />
diesem Grund ist es nicht sinnvoll diese zwei Teile zu än<strong>de</strong>rn.
6.2 SAP Releasewechsel (AN)<br />
48<br />
Wird <strong>de</strong>r Projekttyp „SAP Releasewechsel (AN)“ ausgewählt, wird sofort angezeigt,<br />
dass das Projekt exportiert wer<strong>de</strong>n kann. Somit sind auch hier alle verpflichten<strong>de</strong>n<br />
Einstellungen bereits gesetzt.<br />
Anlog zu <strong>de</strong>m Projekttyp „SAP Releasewechsel (AG)“ sind auch hier die gesetzten<br />
Projektmerkmale „Systemintegration“ und „AN ohne Unterauftragnehmer“<br />
verpflichtet.<br />
Auch bei diesem Projekttyp wur<strong>de</strong>n keine Än<strong>de</strong>rungen im Register „Anwendungsprofil“<br />
vorgenommen.<br />
Allerdings gibt es wie<strong>de</strong>r einen neuen Vorgehensbaustein und eine weitere Projektdurchführungsstrategie.<br />
Die neue Projektdurchführungsstrategie heißt „SAP<br />
Releasewechsel (AN)“ und ist die einzig mögliche Projektdurchführungsstrategie<br />
für diesen Projekttyp. Die Abfolge <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte, die diese Projektdurchführungsstrategie<br />
festlegt, wur<strong>de</strong> bereits in Abbildung 17 gezeigt.<br />
Der neue Vorgehensbaustein heißt „Go Live & Support“. Dieser Vorgehensbaustein<br />
<strong>de</strong>finiert die Aktivitäten, die für <strong>de</strong>n neuen Entscheidungspunkt „Go Live &<br />
Support abgeschlossen“, zu erledigen sind. Das Projektteam, unter <strong>de</strong>r Verantwortlichkeit<br />
<strong>de</strong>s Projektleiters <strong>de</strong>s Auftragnehmers, bleiben noch so lange bei<br />
<strong>de</strong>m Auftraggeber, bis das neue SAP System eine ausreichen<strong>de</strong> Stabilität erreicht<br />
hat. Dabei unterstützen sie auch die Anwen<strong>de</strong>r, so dass diese sich<br />
schnell im neuen System zurechtfin<strong>de</strong>n.
Abbildung 25: Vorgehensbausteine und Projektdurchführungsstrategie<br />
für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP Releasewechsel (AN)"<br />
49<br />
Abbildung 26: Planung <strong>de</strong>r Entscheidungspunkte für <strong>de</strong>n Projekttyp "SAP<br />
Releasewechsel (AN)"
50<br />
Auch hier kann <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>r über <strong>de</strong>n Button „Planung“ die Entscheidungspunkte<br />
mit geplanten Fertigstellungsterminen versehen. Abbildung 26 zeigt alle<br />
Entscheidungspunkte, die für diesen Projekttyp relevant sind.<br />
Bei diesem Projekttyp ist zusätzlich zu <strong>de</strong>n Standard-Produkten, nur das Produkt<br />
„Support“ hinzugekommen. Da bei diesem Produkt kein formales Dokument<br />
erstellt wer<strong>de</strong>n muss, gibt es bei diesem Projekttyp auch keine zusätzliche<br />
Dokumentvorlage. Durch die Exportfunktion <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten<br />
wer<strong>de</strong>n somit nur die Standard-Dokumentvorlagen exportiert.<br />
Dennoch muss dieses Produkt bearbeitet wer<strong>de</strong>n. Über die Projektplan-Export-<br />
Funktion, wird <strong>de</strong>m Anwen<strong>de</strong>r angezeigt, wann es bearbeitet wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Abbildung 27: Projektplan zu <strong>de</strong>m Projekt "SAP Releasewechsel AN"
51<br />
Ebenfalls bei diesem Export <strong>de</strong>r Dokumentation, wer<strong>de</strong>n nur die Beschreibungen<br />
exportiert, die für dieses Projekt relevant sind. Und auch dieses Mal wur<strong>de</strong>n<br />
die Teile 1 und 2 <strong>de</strong>r Dokumentation aus <strong>de</strong>n vorher genannten Grün<strong>de</strong>n nicht<br />
verän<strong>de</strong>rt.<br />
Abbildung 28: Dokumentation <strong>de</strong>s Projektes "SAP Releasewechsel (AN)"
6.3 Bekannter Fehler<br />
52<br />
Die Dokumentation für die getailorten Projekte kann sowohl per HTML (Hypertext<br />
Markup Language), als auch per PDF (Portable Document Format) exportiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Export-Funktion via HTML funktioniert ohne Probleme. Allerdings<br />
funktioniert die Export-Funktion via PDF im Teil 3 nicht. Und somit auch<br />
nicht beim Komplett-Export.<br />
Dieses kann durch kleine Inkonsistenzen bei <strong>de</strong>r Anpassung <strong>de</strong>r V-Mo<strong>de</strong>ll-<br />
XT.xml herführen. Die aktuelle V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor Version 3.2 unterstützt bis<br />
her noch nicht das Auffin<strong>de</strong>n dieser Inkonsistenzen. Diese Funktion soll in <strong>de</strong>r<br />
nächsten Version implementiert wer<strong>de</strong>n. 44<br />
44 Vgl. Sihling (2007).
53<br />
7 Das Projekt „SAP Releasewechsel“ einer oberen Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong><br />
Im Folgen<strong>de</strong>n wird das Projekt „SAP Releasewechsel“ einer oberen Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong><br />
vorgestellt.<br />
Diese Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong> besitzt neben einer Zentrale mehrere Außenstellen, die<br />
sich in ganz Deutschland verteilen.<br />
Das Projekt „SAP Releasewechsel“ wird in <strong>de</strong>r Zentrale <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong><br />
durchgeführt.<br />
Auf Grund <strong>de</strong>r Kündigung <strong>de</strong>s Wartungsvertrages <strong>de</strong>r aktuellen Version R/3<br />
4.6c seitens <strong>de</strong>r SAP AG, ist diese Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong> auf einen Releasewechsel<br />
auf die Version SAP ERP 6.0 angewiesen.<br />
Der Releasewechsel auf die neue Software soll zusätzlich die erhöhten organisatorischen<br />
und technischen Ansprüche an die IT-Landschaft <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong><br />
gerecht wer<strong>de</strong>n. Daher ist <strong>de</strong>r Aufbau einer einheitlichen Serviceorientierten-Architektur<br />
(SOA), die das SAP System mit <strong>de</strong>r übrigen IT-<br />
Landschaft verbin<strong>de</strong>t, geplant.<br />
Weiterhin soll bei diesem Releasewechsel eine Rückführung in <strong>de</strong>n SAP Standard<br />
erfolgen. Nur die Softwareanpassungen, die nicht durch SAP ERP 6.0 unterstützt<br />
wer<strong>de</strong>n, sollen in das neue System migriert wer<strong>de</strong>n.
54<br />
7.1 Vorgehensweise im Projekt „SAP Releasewechsel“<br />
Da das Projekt „SAP Releasewechsel“ bereits begonnen hatte, bevor das neue<br />
V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel entwickelt wur<strong>de</strong>, gibt es dort ein<br />
an<strong>de</strong>res Vorgehen.<br />
Die Basis dieses Vorgehens ist das Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT. Das Standard V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT sieht das erste klein V (Daten extrahiert, Daten analysiert, ins Prozessmo<strong>de</strong>ll<br />
überführt) nicht vor. Somit wird vor <strong>de</strong>m Entscheidungspunkt „Anfor<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>finiert“ keine Ist-SAP-System-Analyse durchgeführt.<br />
Diese Ist-Analyse wird in diesem Projekt Teil <strong>de</strong>r Ausschreibung sein, und ist<br />
somit vom Auftragnehmer zu erstellen.<br />
Zusätzlich gibt es noch weitere Grün<strong>de</strong>, weshalb die Ist-Analyse nicht vom Auftraggeber<br />
selbst erledigt wird.<br />
Zum einen kann es passieren, dass die Dokumentation <strong>de</strong>r SAP-E<strong>inf</strong>ührung,<br />
bzw. <strong>de</strong>s letzten Releasewechsels nicht aussagekräftig genug ist. Und kann<br />
somit nicht als Grundlage für eine Ist-Analyse dienen. Weiterhin ist es möglich,<br />
dass das benötigte Know-how fehlt, um ein Reverse Engineering 45 durchzuführen.<br />
Auch <strong>de</strong>r zeitliche Ablauf kann ein Grund sein, dass auf eine Ist-Analyse verzichtet<br />
wird. So kann es bspw. passieren, dass das im Haushalt zugesicherte<br />
Budget gestrichen wird, sollte das Projekt nicht innerhalb <strong>de</strong>s laufen<strong>de</strong>n Jahres<br />
zu einer Ausschreibung kommen. Dieser Grund führt somit zu einem Komplett-<br />
Abbruch <strong>de</strong>s Projektes.<br />
Es besteht in <strong>de</strong>r Praxis auch die Möglichkeit diese Ist-Analyse in einer separaten<br />
Ausschreibung durch einen Auftragnehmer durchführen zu lassen. Der<br />
Nachteil an dieser Variante ist <strong>de</strong>r, dass sich dieser Auftragnehmer an <strong>de</strong>r eigentlichen<br />
Ausschreibung für die Umsetzung nicht mehr beteiligen darf. Dadurch<br />
wird bereits im Vorfeld ein möglicher kompetenter Auftraggeber ausge-<br />
45<br />
„Beim Reverse Engineering“ ist das vorhan<strong>de</strong>ne Software-System <strong>de</strong>r Ausgangspunkt <strong>de</strong>r<br />
Analyse. Balzert (1998), S. 595.
55<br />
schlossen. Des Weiteren kann es bei dieser Variante zu unerwünscht langen<br />
Projektlaufzeiten kommen, da zwei Ausschreibungen vorbereitet und ausgewertet<br />
wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
Da in diesem Projekt somit nicht vorher bekannt ist, welche Anpassungen gemacht<br />
wur<strong>de</strong>n, muss eine an<strong>de</strong>re Vorgehensweise gewählt wer<strong>de</strong>n, um <strong>de</strong>nnoch<br />
<strong>de</strong>n Releasewechsel durchzuführen.<br />
Diese Vorgehensweise ist in diesem Projekt wie folgt geplant:<br />
In einem Testsystem wird über die alte SAP-Version die neue Version drüberinstalliert.<br />
Stoppt die Installation aufgrund einer nicht kompatiblen Anpassung,<br />
wird sich diese Anpassung notiert und die Installation weiter geführt.<br />
Am En<strong>de</strong> existiert eine Liste <strong>de</strong>r Anpassungen <strong>de</strong>s alten SAP-Systems, die<br />
nicht von <strong>de</strong>m neuen SAP-System übernommen wer<strong>de</strong>n konnten. Anschließend<br />
müssen die Anpassungen so verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, dass das neue SAP-System<br />
die Anpassungen akzeptiert. Dieser Vorgang wird so oft wie<strong>de</strong>rholt, bis <strong>de</strong>r Installationsvorgang<br />
ohne Fehlermeldungen durchläuft.<br />
Diese Installation geht dann nach einer Test-Phase in <strong>de</strong>n produktiven Einsatz.<br />
Erst im zweiten Schritt wird geprüft, welche Anpassung <strong>de</strong>s alten SAP-Systems<br />
nicht mehr benötigt wer<strong>de</strong>n und somit durch Standard-Funktionen ersetzt wer<strong>de</strong>n<br />
können. Auch fachliche Neu-Anfor<strong>de</strong>rungen wer<strong>de</strong>n erst in diesem zweiten<br />
Schritt implementiert.
56<br />
7.2 Mögliche Risiken dieses Vorgehens<br />
Durch dieses Vorgehen entstehen weitere Risiken, die zu beachten sind.<br />
Da im Vorfeld nicht beschrieben wer<strong>de</strong>n kann, wie viele Anpassungen in <strong>de</strong>m<br />
alten SAP Release vorhan<strong>de</strong>n sind, ist <strong>de</strong>r Auftragnehmer nicht in <strong>de</strong>r Lage eine<br />
vollständige Kalkulation <strong>de</strong>r Aufwen<strong>de</strong> durchzuführen. Dem entsprechend<br />
muss er sein Angebot aus Erfahrungswerten mitteln. Doch es bekommt <strong>de</strong>r jenige<br />
<strong>de</strong>n Zuschlag für die Ausschreibung, <strong>de</strong>r das wirtschaftlichste Angebot bietet,<br />
auch wenn dieser Preis nicht mit <strong>de</strong>n Aufwen<strong>de</strong>n übereinstimmt.<br />
Übersteigen die Kosten <strong>de</strong>s Auftragnehmers <strong>de</strong>r Angebotssumme, wird er versuchen<br />
über <strong>de</strong>n Angebotspreis hinaus Geld zu bekommen. Somit kann nicht<br />
genau gesagt wer<strong>de</strong>n, dass das günstigste Angebot ausgewählt wur<strong>de</strong>.<br />
Durch diese unkalkulierbaren Aufwendungen übersteigen die Kosten schnell<br />
das eingeplante Budget. So ist es möglich, dass das Budget, das für <strong>de</strong>n zweiten<br />
Schritt geplant war, schon für <strong>de</strong>n ersten Schritt ausgegeben wer<strong>de</strong>n muss.<br />
Und die fachlich benötigten Än<strong>de</strong>rungen können nicht durchgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
Er schlimmerer Fall ist es, wenn weitere Aufwendungen erfor<strong>de</strong>rlich sind, aber<br />
das vom Auftraggeber eingeplante und genehmigte Budget ist verbraucht.<br />
Bleibt das neue System dann in <strong>de</strong>r unfertigen Fassung? In diesem Fall wur<strong>de</strong><br />
Geld ausgegeben, ohne ein neues System zu bekommen.<br />
Durch das Vorgehen in <strong>de</strong>n oben genannten zwei Schritten, kann es passieren,<br />
dass im ersten Schritt Geld für Anpassungen ausgegeben wird. Im zweiten<br />
Schritt wird dann festgestellt, dass diese Anpassungen nicht mehr benötigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Dadurch sind unnötige Kosten entstan<strong>de</strong>n.<br />
Ein Ziel <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT ist es Kosten zu minimieren und die Kosten transparent<br />
zu halten. Dieses Ziel kann bei einer <strong>de</strong>rartigen Vorgehensweise nicht gewährleistet<br />
wer<strong>de</strong>n.
8 Schlussbetrachtung<br />
57<br />
8.1 Zusammenfassung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wur<strong>de</strong> das V-Mo<strong>de</strong>ll XT an die Beson<strong>de</strong>rheiten eines<br />
SAP Releasewechsels angepasst.<br />
Dabei wur<strong>de</strong> die V-Mo<strong>de</strong>ll-XT.xml mit <strong>de</strong>m V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor getailor’, so dass<br />
eine lauffähige Version <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten entstand, die die<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten eines SAP Releasewechsels unterstützt.<br />
Aus dieser Version <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten lassen sich zwei Vorgehensmo<strong>de</strong>lle<br />
für einen SAP Releasewechsel, Dokumentvorlagen und eine<br />
Dokumentation exportieren.<br />
Das neue V-Mo<strong>de</strong>ll XT enthält nun zwei neue Projekttypen. Der eine Projekttyp<br />
unterstützt die Arbeiten <strong>de</strong>s Auftraggebers bei einem SAP Releasewechsel, <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re Projekttyp die <strong>de</strong>s Auftragnehmers. Durch diese Trennung sind nur die<br />
Arbeiten zu erledigen, die für ihre Rolle relevant sind.<br />
Auf <strong>de</strong>r Auftraggeberseite sind mehr Anpassungen erfor<strong>de</strong>rlich gewesen, als<br />
auf <strong>de</strong>r Auftragnehmerseite. Das Vorgehensmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftragnehmers wur<strong>de</strong><br />
nur um eine Phase erweitert, hingegen das Vorgehensmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Auftraggebers<br />
eine Erweiterung von drei weiteren Phasen mit drei weiteren Produkten<br />
benötigte.
8.2 Weitere Einsatzmöglichkeiten<br />
58<br />
Das angepasste Vorgehensmo<strong>de</strong>ll wur<strong>de</strong> speziell für einen Releasewechsel<br />
eines SAP-Systems entwickelt. Doch in wie weit ist es für einen Releasewechsel<br />
an<strong>de</strong>rer Software nutzbar? Beziehungsweise welche Än<strong>de</strong>rungen sind erfor<strong>de</strong>rlich<br />
um es allgemein für Releasewechsel von Software einzusetzen?<br />
Welche Anpassungen sind erfor<strong>de</strong>rlich, dass dieses Mo<strong>de</strong>ll selbst für die E<strong>inf</strong>ührung<br />
einer Software nutzbar ist?<br />
Das Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT sieht einen Projekttyp „E<strong>inf</strong>ührung und Pflege eines<br />
organisationsspezifischen Vorgehensmo<strong>de</strong>lls“ vor. Mit diesem Projekttyp kann<br />
das V-Mo<strong>de</strong>ll XT an Beson<strong>de</strong>rheiten einer Organisation angepasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Macht es dann auch Sinn, dass V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel an<br />
eine Organisation anzupassen?<br />
Seitens <strong>de</strong>r KBSt wird das Standard V-Mo<strong>de</strong>ll XT stetig weiterentwickelt. In wie<br />
weit ist das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel mit einer neuen V-<br />
Mo<strong>de</strong>ll XT Version nutzbar? Ist eine e<strong>inf</strong>ache Migration möglich, o<strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rt<br />
es erheblichen Aufwand das V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel mit<br />
dieser neuen Standard Version zu vereinen?
8.3 Kritische Würdigung<br />
59<br />
Dieses Vorgehensmo<strong>de</strong>ll dient <strong>de</strong>m Projektteam und <strong>de</strong>m Projektleiter als Leitfa<strong>de</strong>n<br />
das Projekt eines SAP Releasewechsels durchzuführen. Es liefert allerdings<br />
keine fertigten Produkte. Diese Aktivitäten müssen immer noch von <strong>de</strong>m<br />
Projektteam bearbeitet wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Vorgehensmo<strong>de</strong>ll soll die Vorgehensweise eine SAP Releasewechsels<br />
transparent machen und damit Komplexität reduzieren, doch es verhin<strong>de</strong>rt<br />
nicht, dass ein solcher Releasewechsel sehr zeit- und kostenintensiv ist. Durch<br />
seine strukturierte Vorgehensweise kann aber <strong>de</strong>nnoch das Auftreten unkalkulierbarer<br />
Kosten verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die in <strong>de</strong>r Literatur empfohlen Vorgehensweisen und damit auch das daraus<br />
entwickelte V-Mo<strong>de</strong>ll XT für einen SAP Releasewechsel, lassen sich unter bestimmten<br />
Voraussetzungen nur schwer in <strong>de</strong>r Praxis anwen<strong>de</strong>n. Entschließt<br />
sich aber <strong>de</strong>r Projektleiter gegen einer solchen Vorgehensweise, muss er mit<br />
erheblichen zeitlichen und finanziellen Risiken rechnen. Und es stellt sich die<br />
Frage, ob es nicht <strong>de</strong>nnoch sinnvoller wäre nach <strong>de</strong>n Vorgaben <strong>de</strong>r Vorgehensmo<strong>de</strong>lle<br />
vorzugehen.
Literaturverzeichnis<br />
60<br />
Appelrath, Hans-Jürgen / Ritter, Jörg (2000),<br />
R/3-E<strong>inf</strong>ührung, Metho<strong>de</strong>n und Werkzeuge,<br />
Berlin et al., 2000.<br />
Arb, Reto C., von (1997),<br />
Vorgehensweisen und Erfahrungen bei <strong>de</strong>r E<strong>inf</strong>ührung von Enterprise-<br />
Management-Systemen dargestellt am Beispiel von SAP R/3,<br />
Bern, 1997,<br />
http://www.digital-publications.ch/vonarb/vonarb.zip,<br />
Stand 06.07.2007.<br />
Balzert, Helmut (1998),<br />
Lehrbuch <strong>de</strong>r Software-Technik,<br />
Hei<strong>de</strong>lberg, Berlin, 1998.<br />
Gadatsch, Andreas (2001),<br />
Management von Geschäftsprozessen,<br />
Braunschweig, Wiesba<strong>de</strong>n, 2001.<br />
Gadatsch, Andreas (2002a),<br />
Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware,<br />
in: Andreas Gadatsch / Reinhard Mayr (Hrsg.): Best-Practice mit SAP®,<br />
Braunschweig, Wiesba<strong>de</strong>n, 2002, S. 3-14.<br />
Gadatsch, Andreas (2002b),<br />
Strategien zur E<strong>inf</strong>ührung und Implementierung betriebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware,<br />
in: Andreas Gadatsch / Reinhard Mayr (Hrsg.): Best-Practice mit SAP®,<br />
Braunschweig, Wiesba<strong>de</strong>n, 2002, S. 15-30.<br />
Gadatsch, Andreas (2003),<br />
Grundkurs Geschäftsprozess-Management,<br />
3. Auflage, Wiesba<strong>de</strong>n, 2003.<br />
Gronau, Norbert (1999),<br />
Management von Produktion und Logistik mit SAP® R/3®,<br />
3. Auflage, München, Wien, 1999.<br />
KBSt (2004),<br />
V-Mo<strong>de</strong>ll® XT,<br />
http://ftp.uni-kl.<strong>de</strong>/pub/v-mo<strong>de</strong>ll-xt/Release-1.2/Dokumentation/pdf/V-Mo<strong>de</strong>ll-<br />
XT-Komplett.pdf,<br />
2004, Stand 06.07.2007.
KBSt (2006),<br />
Empfehlung <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT durch die KBSt,<br />
http://www.kbst.bund.<strong>de</strong>/cln_047/nn_837404/SharedDocs/Hintergrund<strong>inf</strong>oskbst/2005/empfehlung-<strong>de</strong>s-v-mo<strong>de</strong>ll-xt-durch-die-kbst.html,<br />
2006, Stand 06.07.2007.<br />
61<br />
Rau, Hans-Joachim (2006),<br />
Restandardisierung von SAP R/3-Systemen,<br />
Saarbrücken, 2006.<br />
SAP (2005),<br />
Gemeinsam die Zukunft gestalten,<br />
http://www.sap.com/germany/company/press/pdf/Emp_Rep_2005_D.pdf,<br />
2005, Stand 06.07.2007.<br />
Sihling, Marc (2007),<br />
PDF Export nach XML-Verän<strong>de</strong>rung mit <strong>de</strong>m Editor,<br />
http://www.kbst.bund.<strong>de</strong>/kbst_forum/showthread.php?t=924,<br />
2007, Stand 06.07.2007.
Glossar<br />
Add-On Programmierte Softwarekomponente, die nicht zum<br />
Standardprodukt gehört<br />
Baseline-<br />
Konfiguration<br />
62<br />
Einrichten von Grun<strong>de</strong>instellungen im SAP<br />
Business Blueprint Entwurfsdokument für ein einzuführen<strong>de</strong>s SAP System<br />
Change Management Projektteam, dass für Än<strong>de</strong>rungen im Projekt verantwortlich<br />
ist<br />
Customizing Anpassen einer Software mittels Setzen von Parametern<br />
ohne Programmierung<br />
Cut Over Wechsel von <strong>de</strong>m Alt-System zum neuen SAP System<br />
Entscheidungspunkt Evaluationspunkt <strong>de</strong>s Projektes<br />
Migration Wechsel von Software<br />
Projektdurchführungsstrategie<br />
Abfolge von Entscheidungspunkten<br />
Release Version einer Software<br />
SAP Hersteller von betrieblicher Anwendungssoftware, sowie<br />
<strong>de</strong>ssen Produkte<br />
Support Problemorientierte Beratungsdienstleistung<br />
Tailoring Anpassung <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT<br />
V-Mo<strong>de</strong>ll XT Vorgehensmo<strong>de</strong>ll für IT-Projekte<br />
V-Mo<strong>de</strong>ll XT Editor Software-Tool, das Anpassungen über <strong>de</strong>n V-Mo<strong>de</strong>ll<br />
XT Standard hinaus erlaubt
V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projektassistenten<br />
63<br />
Software-Tool, das die Nutzung <strong>de</strong>s V-Mo<strong>de</strong>ll XT unterstützt<br />
Vorgehensbaustein Definiert die Aufgabenstellung im V-Mo<strong>de</strong>ll XT Projekt
Ei<strong>de</strong>sstattliche Erklärung<br />
Name: Anita Ulenaers<br />
64<br />
Adresse: Breslauer Str. 41, 53840 Troisdorf<br />
Erklärung<br />
Hiermit erkläre ich an Ei<strong>de</strong>s Statt, dass ich die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit selbst angefertigt<br />
habe; die aus frem<strong>de</strong>n Quellen direkt o<strong>de</strong>r indirekt übernommenen Gedanken<br />
sind als solche kenntlich gemacht.<br />
Die Arbeit wur<strong>de</strong> bisher keiner Prüfungsbehör<strong>de</strong> vorgelegt und auch noch nicht<br />
veröffentlicht.<br />
Unterschrift Sankt Augustin, <strong>de</strong>n 10.07.2007